Archivrecht
Wieso nicht?
Gemäß § 58 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (PDF)gilt:
"Werbung muss als solche klar erkennbar und vom übrigen Inhalt der Angebote eindeutig getrennt sein."
Allerdings ist ein Verstoß gegen diese Vorschrift leider nicht bußgeldbewehrt.
Das Wiki zur Endinger Geschichte ist offenbar seit 2008/09 vom Endinger Geschichtsverein (ein nach dem Rundfunkstaatsvertrag erforderliches Impressum existiert nicht) aufgegeben worden, während die "letzten Änderungen" zeigen, dass es aktuell ganz in den Händen englischsprachiger Spamverbreiter ist:
http://www.endinger-geschichte.de/wiki/index.php/Spezial:Letzte_%C3%84nderungen
Wer in einem Wiki (einem Telemedium nach Rundfunkstaatsvertrag) Spammer Seiten erstellen lässt, verstößt gegen den Rundfunkstaatsvertrag, da für den Besucher nicht ersichtlich ist, welche Inhalte "redaktionell" und welche von Forennutzern eingebrachte Werbung sind.
Wer auch nur eine Seite Werbung (Spam) in seinem Wiki - jedenfallls dauerhaft - zulässt, unterstellt sich damit dem geschäftlichen Verkehr. Alle Privilegien einer nichtkommerziellen Nutzung entfallen, das UWG kommt zur Anwendung, dessen Anhang zu § 3 Ab. 3 Nr. 11 als Information getarnte Werbung verbietet. Wer ein solches Wiki nicht mehr kontrolliert, sondern Spammern überlässt, kann daher von Mitbewerbern oder Verbrauerschützern kostenpflichtig abgemahnt werden.
Ein vergleichsweise junges Urteil des BGH zu einem gänzlich anders gelagerten Fall:
http://www.damm-legal.de/bgh-zur-trennung-von-werbung-und-redaktionellen-inhalten-in-zeitschriften-keine-irrefuehrung-wenn-der-werbecharakter-deutlich-erkennbar-ist-berichtet-von-dr-damm-und-partner
Die Grundsätze der Forenhaftung (Beseitigungspflicht erst nach Kenntnis) können auf ein nicht mehr gepflegtes Wiki nicht angewandt werden.
Es erscheint nicht sachgerecht, Blogger und Wikibetreiber Abmahnungen bezahlen zu lassen, wenn ihnen im Blog ein Spamkommentar entgeht oder in einem Wiki eine übersehene Spamseite. Ich selbst habe für Archivalia nur die Mailbenachrichtigung von Twoday bei neuen Kommentaren zur Verfügung, die nicht ganz zuverlässig ist. Bei über 22.000 Beiträgen ist es natürlich ganz und gar unmöglich, zu kontrollieren, ob irgendwo ein Spamkommentar übersehen wurde, da auf der rechten Seite jeweils nur 5 Kommentare angezeigt werden.
Viagra-Spam, bei dem Viagra unverschlüsselt als Zeichenfolge erscheint, gibt es anscheinend in Archivalia jedenfalls nicht:
http://archiv.twoday.net/search?q=viagra
Wer aber ein Wiki "herrenlos" werden lässt, auf dass die Spammer sich seiner annehmen, oder konsequent Spamkommentare in seinem Weblog nicht löscht, könnte meines Erachtens nach geltender Rechtslage durchaus Ärger bekommen.
Gemäß § 58 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (PDF)gilt:
"Werbung muss als solche klar erkennbar und vom übrigen Inhalt der Angebote eindeutig getrennt sein."
Allerdings ist ein Verstoß gegen diese Vorschrift leider nicht bußgeldbewehrt.
Das Wiki zur Endinger Geschichte ist offenbar seit 2008/09 vom Endinger Geschichtsverein (ein nach dem Rundfunkstaatsvertrag erforderliches Impressum existiert nicht) aufgegeben worden, während die "letzten Änderungen" zeigen, dass es aktuell ganz in den Händen englischsprachiger Spamverbreiter ist:
http://www.endinger-geschichte.de/wiki/index.php/Spezial:Letzte_%C3%84nderungen
Wer in einem Wiki (einem Telemedium nach Rundfunkstaatsvertrag) Spammer Seiten erstellen lässt, verstößt gegen den Rundfunkstaatsvertrag, da für den Besucher nicht ersichtlich ist, welche Inhalte "redaktionell" und welche von Forennutzern eingebrachte Werbung sind.
Wer auch nur eine Seite Werbung (Spam) in seinem Wiki - jedenfallls dauerhaft - zulässt, unterstellt sich damit dem geschäftlichen Verkehr. Alle Privilegien einer nichtkommerziellen Nutzung entfallen, das UWG kommt zur Anwendung, dessen Anhang zu § 3 Ab. 3 Nr. 11 als Information getarnte Werbung verbietet. Wer ein solches Wiki nicht mehr kontrolliert, sondern Spammern überlässt, kann daher von Mitbewerbern oder Verbrauerschützern kostenpflichtig abgemahnt werden.
Ein vergleichsweise junges Urteil des BGH zu einem gänzlich anders gelagerten Fall:
http://www.damm-legal.de/bgh-zur-trennung-von-werbung-und-redaktionellen-inhalten-in-zeitschriften-keine-irrefuehrung-wenn-der-werbecharakter-deutlich-erkennbar-ist-berichtet-von-dr-damm-und-partner
Die Grundsätze der Forenhaftung (Beseitigungspflicht erst nach Kenntnis) können auf ein nicht mehr gepflegtes Wiki nicht angewandt werden.
Es erscheint nicht sachgerecht, Blogger und Wikibetreiber Abmahnungen bezahlen zu lassen, wenn ihnen im Blog ein Spamkommentar entgeht oder in einem Wiki eine übersehene Spamseite. Ich selbst habe für Archivalia nur die Mailbenachrichtigung von Twoday bei neuen Kommentaren zur Verfügung, die nicht ganz zuverlässig ist. Bei über 22.000 Beiträgen ist es natürlich ganz und gar unmöglich, zu kontrollieren, ob irgendwo ein Spamkommentar übersehen wurde, da auf der rechten Seite jeweils nur 5 Kommentare angezeigt werden.
Viagra-Spam, bei dem Viagra unverschlüsselt als Zeichenfolge erscheint, gibt es anscheinend in Archivalia jedenfalls nicht:
http://archiv.twoday.net/search?q=viagra
Wer aber ein Wiki "herrenlos" werden lässt, auf dass die Spammer sich seiner annehmen, oder konsequent Spamkommentare in seinem Weblog nicht löscht, könnte meines Erachtens nach geltender Rechtslage durchaus Ärger bekommen.
KlausGraf - am Sonntag, 21. Oktober 2012, 19:25 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nachdem ich in bibliothekarisch.de digiwis (nicht freigeschaltet) etwas voreilig kommentiert hatte, hab ich in Google+ etwas besser recherchiert.
https://plus.google.com/u/0/104781858495372716844/posts/gkiDau2Uko9
http://digiwis.de/blog/2012/10/16/roulettespiel-bei-coverabbildungen-in-bloggerrezensionen/
Ich lasse mich von der unverantwortlichen Panikmache ("Roulettespiel" ist wirklich völlig daneben, ein Restrisko ist IMMER da und wenns noch so gering ist) dort nicht beirren und werde auch weiterhin kleine Coverabbildungen in Rezensionen nutzen.
 Nicht geschütztes Buchcover, die Abbildung ist gemeinfrei, die weitere Gestaltung erreicht keine Schöpfungshöhe.
Nicht geschütztes Buchcover, die Abbildung ist gemeinfrei, die weitere Gestaltung erreicht keine Schöpfungshöhe.
https://plus.google.com/u/0/104781858495372716844/posts/gkiDau2Uko9
http://digiwis.de/blog/2012/10/16/roulettespiel-bei-coverabbildungen-in-bloggerrezensionen/
Ich lasse mich von der unverantwortlichen Panikmache ("Roulettespiel" ist wirklich völlig daneben, ein Restrisko ist IMMER da und wenns noch so gering ist) dort nicht beirren und werde auch weiterhin kleine Coverabbildungen in Rezensionen nutzen.
 Nicht geschütztes Buchcover, die Abbildung ist gemeinfrei, die weitere Gestaltung erreicht keine Schöpfungshöhe.
Nicht geschütztes Buchcover, die Abbildung ist gemeinfrei, die weitere Gestaltung erreicht keine Schöpfungshöhe.KlausGraf - am Dienstag, 16. Oktober 2012, 21:43 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die AutoComplete-Funktion von Google ist nicht rechtswidrig, so das OLG Köln in einer aktuellen Entscheidung (Urt. v. 10.05.2012 - Az.: 15 U 199/11).
Die Auto-Vervollständigungs-Funktion bei Suchmaschinenbetreibern sei keine eigene inhaltliche Äußerung des jeweiligen Anbieters. Daher treffe eine Suchmaschine für mögliche eherverletzende angezeigte Begriffe grundsätzlich keine Haftung. "
http://www.dr-bahr.com/news/autocomplete-funktion-von-google-nicht-rechtswidrig.html
Volltext:
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2012/15_U_199_11_Urteil_20120510.html
Siehe schon
http://archiv.twoday.net/stories/142782528/
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/410258916/
 Foto Franz Richter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Foto Franz Richter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Die Auto-Vervollständigungs-Funktion bei Suchmaschinenbetreibern sei keine eigene inhaltliche Äußerung des jeweiligen Anbieters. Daher treffe eine Suchmaschine für mögliche eherverletzende angezeigte Begriffe grundsätzlich keine Haftung. "
http://www.dr-bahr.com/news/autocomplete-funktion-von-google-nicht-rechtswidrig.html
Volltext:
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2012/15_U_199_11_Urteil_20120510.html
Siehe schon
http://archiv.twoday.net/stories/142782528/
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/410258916/
 Foto Franz Richter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Foto Franz Richter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.deKlausGraf - am Dienstag, 16. Oktober 2012, 20:20 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die unzulässige Veröffentlichung von 278 Wörtern aus einem 1974 erschienenen Lehrbuch durch einen Lehrer hat beim Webhoster ServerBeach gereicht, um fast eineinhalb Millionen Weblogs zu schließen. Der Lehrer hatte vor fünf Jahren unzulässigerweise aus dem heute noch 120 US-Dollar teuren Werk zitiert. Der Webhoster schaltete daraufhin letzte Woche die Server der gesamten Blogplattform ab, auf der die Veröffentlichung stattfand: Der australische Anbieter Edublogs.com betreibt eine gemeinsame Wordpress-Multiuser-Installation für alle seine Kunden, die auch der Lehrer nutzte.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Einzelner-Copyright-Verstoss-1-45-Millionen-Blogs-voruebergehend-geschlossen-1730043.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Einzelner-Copyright-Verstoss-1-45-Millionen-Blogs-voruebergehend-geschlossen-1730043.html
KlausGraf - am Dienstag, 16. Oktober 2012, 20:13 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
RA Ferner betätigt sich als Abmahnanwalt in Sachen Rechtsdienstleistungsgesetz:
http://www.ferner-alsdorf.de/2012/10/unerlaubte-rechtsberatung-rechtsdienstleistungsgesetz-was-ist-erlaubt-rechtsanwalt/
Das Gesetz
http://dejure.org/gesetze/RDG
trat 2007 an die Stelle des Rechtsberatungsgesetzes, dessen Opfer ich aufgrund eines Beitrags in der Mailingliste URECHT geworden bin. Ein Rechtsanwalt hatte mich 2003 bei der Staatsanwaltschaft Freiburg angezeigt (ohne dass dies Folgen hatte):
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg14831.html
http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2000/0085.html
In JurPC erörterte Wolfgang Michel den Fall:
http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2000/0085.html
Inzwischen stellt das Rechtsdienstleistungsgesetz klar (§ 2 Abs. 3):
"Rechtsdienstleistung ist nicht:
1. die Erstattung wissenschaftlicher Gutachten,
2. die Tätigkeit von Einigungs- und Schlichtungsstellen, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern,
3. die Erörterung der die Beschäftigten berührenden Rechtsfragen mit ihren gewählten Interessenvertretungen, soweit ein Zusammenhang zu den Aufgaben dieser Vertretungen besteht,
4. die Mediation und jede vergleichbare Form der alternativen Streitbeilegung, sofern die Tätigkeit nicht durch rechtliche Regelungsvorschläge in die Gespräche der Beteiligten eingreift,
5. die an die Allgemeinheit gerichtete Darstellung und Erörterung von Rechtsfragen und Rechtsfällen in den Medien,
6. die Erledigung von Rechtsangelegenheiten innerhalb verbundener Unternehmen (§ 15 des Aktiengesetzes)."
Unentgeltlich darf man innerhalb "familiärer, nachbarschaftlicher oder ähnlich enger persönlicher Beziehungen" rechtlich beraten, auch ohne dafür eine Erlaubnis zu haben.
Selbst RA Ferner konzediert: "Auch darf man sich in der Öffentlichkeit rechtliche Gedanken machen. Die ständige Panikmache in Webforen bzw. Diskussionsgruppen, dass rechtliche Äußerungen gleich ein Verstoß gegen das RDG wären, ist vollkommen überzogen – jedenfalls solange man nicht am Einzelfall hantiert und einer Einzelperson konkrete Ratschläge gibt."

http://www.ferner-alsdorf.de/2012/10/unerlaubte-rechtsberatung-rechtsdienstleistungsgesetz-was-ist-erlaubt-rechtsanwalt/
Das Gesetz
http://dejure.org/gesetze/RDG
trat 2007 an die Stelle des Rechtsberatungsgesetzes, dessen Opfer ich aufgrund eines Beitrags in der Mailingliste URECHT geworden bin. Ein Rechtsanwalt hatte mich 2003 bei der Staatsanwaltschaft Freiburg angezeigt (ohne dass dies Folgen hatte):
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg14831.html
http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2000/0085.html
In JurPC erörterte Wolfgang Michel den Fall:
http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2000/0085.html
Inzwischen stellt das Rechtsdienstleistungsgesetz klar (§ 2 Abs. 3):
"Rechtsdienstleistung ist nicht:
1. die Erstattung wissenschaftlicher Gutachten,
2. die Tätigkeit von Einigungs- und Schlichtungsstellen, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern,
3. die Erörterung der die Beschäftigten berührenden Rechtsfragen mit ihren gewählten Interessenvertretungen, soweit ein Zusammenhang zu den Aufgaben dieser Vertretungen besteht,
4. die Mediation und jede vergleichbare Form der alternativen Streitbeilegung, sofern die Tätigkeit nicht durch rechtliche Regelungsvorschläge in die Gespräche der Beteiligten eingreift,
5. die an die Allgemeinheit gerichtete Darstellung und Erörterung von Rechtsfragen und Rechtsfällen in den Medien,
6. die Erledigung von Rechtsangelegenheiten innerhalb verbundener Unternehmen (§ 15 des Aktiengesetzes)."
Unentgeltlich darf man innerhalb "familiärer, nachbarschaftlicher oder ähnlich enger persönlicher Beziehungen" rechtlich beraten, auch ohne dafür eine Erlaubnis zu haben.
Selbst RA Ferner konzediert: "Auch darf man sich in der Öffentlichkeit rechtliche Gedanken machen. Die ständige Panikmache in Webforen bzw. Diskussionsgruppen, dass rechtliche Äußerungen gleich ein Verstoß gegen das RDG wären, ist vollkommen überzogen – jedenfalls solange man nicht am Einzelfall hantiert und einer Einzelperson konkrete Ratschläge gibt."

KlausGraf - am Montag, 15. Oktober 2012, 17:51 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Frage, ob Websites und insbesondere Blogs, ein Impressum benötigen, ist durchaus umstritten. Ratgeber und Informationsseiten tendieren dazu, für die meisten Internetangebote eine Impressumspflicht zu bejahen. Exemplarisch aus der jüngsten Zeit:
http://buch-blogger-recht.blogspot.de/2012/08/impressum-ja-oder-nein.html
http://www.connektar.de/blog/impressumspflicht-fuer-websites-wer-ist-betroffen/
http://dominikruisinger.wordpress.com/2012/08/22/impressumspflicht-im-internet-tipps-und-tools-im-uberblick/
http://linksandlaw.info/Impressumspflicht-Notwendige-Angaben.html (juristische Darstellung von einem Spezialisten, sehr restriktiv)
http://de.wikipedia.org/wiki/Impressumspflicht
Weniger restriktiv hat sich Ende 2010 das Landgericht Köln geäußert. Ein privates Blog brauche kein Impressum:
Gemäß § 55 Abs. 1 RStV haben Anbieter von Telemedien, die nicht ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dienen, Namen und Anschrift leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten.
Nach der Begründung zu § 55 im 9. RÄStV (abgedruckt bei Held in Beck`scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 2. Auflage 2008, § 55 Rz. 6), in dem die Informationspflichten neu geregelt wurden, soll mit der Ausnahme von der Informationspflicht sicher gestellt werden, dass Kommunikation im privaten (persönlichen oder familiären) Bereich ohne Nennung des Namens und der Anschrift erfolgen kann. Damit werde dem Schutz der Privatsphäre Rechnung getragen. Nicht kennzeichnungspflichtig sei demnach private Kommunikation, auch wenn sie über die reine Telekommunikation hinausgehe. Dies betreffe etwa die Einstellung von Meinungsäußerungen in Foren. In diesen Fällen sei über den Plattformanbieter sichergestellt, dass die schutzwürdigen Belange der Beteiligten gewahrt werden können. Eine Kennzeichnungspflicht würde ansonsten dazu führen, dass die Kommunikation unterbliebe.
Danach fallen unter die Ausnahme von der Informationspflicht jedenfalls Einstellungen von Meinungsäußerungen in Foren. Das gilt auch, wenn das Thema der Meinungsäußerung weder persönlich noch familiär ist. "Persönlich" bezieht sich nach dem Wortlaut auf die Zwecke der Kommunikation, nicht etwa auf das behandelte Thema. Persönlich ist der Zweck der Kommunikation aber auch dann, wenn der sich Äußernde dem persönlichen Bedürfnis nach Kommunikation politischer Meinungen, persönlichen Ärgers oder Enttäuschung nachkommt. Nach der Gesetzesbegründung bezieht sich persönlich auf die Kommunikation, auch wenn sie über die reine Telekommunikation hinaus geht. Insofern kann sich diese Kommunikation eben – typisch für das Internet – an die gesamte Internetgemeinschaft wenden. Die Ausnahme erfährt auch keine weitere Einschränkung dadurch, dass durch die Inhalte der Meinungsäußerung ein Bedürfnis entsteht, zu erfahren, wer hinter diesen Aussagen steht. Dies ist bei der Abfassung des Gesetzes vielmehr bereits bedacht worden, da keine Informationspflicht für notwendig erachtet wird, wo durch einen Plattformanbieter sichergestellt ist, dass die schutzwürdigen Belange der Beteiligten gewahrt sind. Daher geht die Auffassung zu weit, nach der die Ausnahme nur in Betracht kommt, wenn die Inhalte passwortgeschützt sind oder nur Inhalte aus dem engsten persönlichen Lebensbereich betroffen sind (so aber Ott, MMR 2007, 354, 356; für die Notwendigkeit einer weiten Fassung hingegen Kitz, ZUM 2007, 368, 372).
Unaufgeregt sieht die Sachlage auch der Lawblogger Udo Vetter (Video 2012, Zitat daraus). In einem Interview [depubliziert] sagte er 2012:
Grundsätzlich unterliegen Blogger in Deutschland der Impressumspflicht, aber die wird hier nur sehr lasch verfolgt. Es handelt sich um eine mögliche Ordnungswidrigkeit. Aber mir ist bisher kein Fall bekannt, bei dem ein Blogger ein Bußgeld bezahlen musste, weil er kein Impressum hatte. Das einzige, was die Behörden mitunter verschicken, sind höfliche Schreiben, in denen sie darum bitten, innerhalb von vier Wochen ein Impressum einzusetzen. Wenn man das dann nicht macht, kann es problematisch werden. Aber an sich kann man erst einmal beruhigt abwarten. Ich halte das auch für eine vernünftige Praxis der Behörden. Es gibt genug andere Missstände, beispielsweise bloggende Frauen, die zu Opfern von sexuellen Nachstellungen werden. Es ist vernünftig, da mit Augenmaß dran zu gehen.
Wer "geschäftlich" agiert, ist bereits bei Einsatz von "Google-Ads" gut beraten, ein korrektes Impressum (wie das auszusehen hat, sagen die oben verlinkten Seiten) anzubieten. Das gilt auch für soziale Netzwerke wie Facebook und sogar für Twitter. Er kann sich sonst leicht eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung einfangen.
Bei reinen Wissenschaftsblogs schätze ich das Risiko, ein Bußgeld zu erhalten, als sehr gering ein. Die Aufsichtsbehörden haben, das sieht Vetter richtig, Wichtigeres zu tun.
Wo der Anbieter der Blogmöglichkeit (Bloghoster z.B. blogger.com) sitzt, spielt keine Rolle. Richten sich z.B. Blogs von de.hypotheses.org an ein Publikum in Deutschland, so unterliegen sie der deutschen Impressumspflicht.
Bei institutionellen Blogs sollte ein Impressum kein Problem sein. Bei Gemeinschaftsblogs sollte eine Person als verantwortlich angegeben werden, an die man sich bei Rechtsverletzungen wenden kann. Möchte eine bloggende Wissenschaftlerin ihre Identität nicht preisgeben, ist die Nennung eines Strohmanns (oder einer Strohfrau?) eine empfehlenswerte Option.
Wer seriös wissenschaftlich bloggt, wird in der Regel mit offenem Visier agieren und seinen Namen nennen, zumal damit zu rechnen ist, dass dereinst auch Blogbeiträge als wissenschaftliche Leistungen anerkannt werden. In Ausnahmefällen, wenn es etwa um rechtmäßige, aber brisante Meinungsäußerungen geht oder wenn der Blogger "undercover" ermittelt, muss man es aber auch als legitim ansehen, wenn er anonym bleiben möchte.
Mein Impressum:
http://archiv.twoday.net/stories/134812/
***
Nachtrag:
Es wurde beanstandet, dass ich nicht gesagt habe, was denn nun zwingend in ein Impressum gehört. Je nach Rechtsgrundlage leider Unterschiedliches. Wer ein strikt-nichtgewerbliches Wissenschaftsblog unterhält und nicht ganz auf ein Impressum verzichten möchte, kann sich auf die Vorgabe des Rundfunkstaatsvertrags (§ 55, PDF) stützen und nur Name (voller Vorname!) und Anschrift angeben. Bei dem Telemediengesetz (§ 5) sind unverzichtbar zusätzlich die Emailadresse und mindestens ein zweiter effizienter Kommunikationsweg, um den Anbieter zu erreichen (vor allem kommen in Betracht: Telefonnummer oder Faxnummer oder Anfragemaske). Es existiert aber auch die Ansicht, die Telefonnummer sei auf jeden Fall zu nennen.
Das Impressum muss von jeder Seite aus erreichbar sein. Wenn man es Impressum nennt, macht man am wenigsten falsch, da die Bezeichnung "Kontakt" von einem Teil der Experten als nicht ausreichend angesehen wird.
Siehe auch das Hoeren-Skript S. 255ff. (PDF).
Es gibt Impressum-Generatoren, die die entsprechenden Angaben abfragen und dann ein hoffentlich korrektes Impressum erzeugen. Hier ein Musterimpressum, erstellt mit einem dieser Angebote.
***
Blog & Recht 1: Darf ich Bilder lebender Personen veröffentlichen?
http://archiv.twoday.net/stories/156271221/
Blog&Recht 2: Darf ich mein Blog mit einem Porträtfoto von mir schmücken?
http://archiv.twoday.net/stories/156272358/
http://buch-blogger-recht.blogspot.de/2012/08/impressum-ja-oder-nein.html
http://www.connektar.de/blog/impressumspflicht-fuer-websites-wer-ist-betroffen/
http://dominikruisinger.wordpress.com/2012/08/22/impressumspflicht-im-internet-tipps-und-tools-im-uberblick/
http://linksandlaw.info/Impressumspflicht-Notwendige-Angaben.html (juristische Darstellung von einem Spezialisten, sehr restriktiv)
http://de.wikipedia.org/wiki/Impressumspflicht
Weniger restriktiv hat sich Ende 2010 das Landgericht Köln geäußert. Ein privates Blog brauche kein Impressum:
Gemäß § 55 Abs. 1 RStV haben Anbieter von Telemedien, die nicht ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dienen, Namen und Anschrift leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten.
Nach der Begründung zu § 55 im 9. RÄStV (abgedruckt bei Held in Beck`scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 2. Auflage 2008, § 55 Rz. 6), in dem die Informationspflichten neu geregelt wurden, soll mit der Ausnahme von der Informationspflicht sicher gestellt werden, dass Kommunikation im privaten (persönlichen oder familiären) Bereich ohne Nennung des Namens und der Anschrift erfolgen kann. Damit werde dem Schutz der Privatsphäre Rechnung getragen. Nicht kennzeichnungspflichtig sei demnach private Kommunikation, auch wenn sie über die reine Telekommunikation hinausgehe. Dies betreffe etwa die Einstellung von Meinungsäußerungen in Foren. In diesen Fällen sei über den Plattformanbieter sichergestellt, dass die schutzwürdigen Belange der Beteiligten gewahrt werden können. Eine Kennzeichnungspflicht würde ansonsten dazu führen, dass die Kommunikation unterbliebe.
Danach fallen unter die Ausnahme von der Informationspflicht jedenfalls Einstellungen von Meinungsäußerungen in Foren. Das gilt auch, wenn das Thema der Meinungsäußerung weder persönlich noch familiär ist. "Persönlich" bezieht sich nach dem Wortlaut auf die Zwecke der Kommunikation, nicht etwa auf das behandelte Thema. Persönlich ist der Zweck der Kommunikation aber auch dann, wenn der sich Äußernde dem persönlichen Bedürfnis nach Kommunikation politischer Meinungen, persönlichen Ärgers oder Enttäuschung nachkommt. Nach der Gesetzesbegründung bezieht sich persönlich auf die Kommunikation, auch wenn sie über die reine Telekommunikation hinaus geht. Insofern kann sich diese Kommunikation eben – typisch für das Internet – an die gesamte Internetgemeinschaft wenden. Die Ausnahme erfährt auch keine weitere Einschränkung dadurch, dass durch die Inhalte der Meinungsäußerung ein Bedürfnis entsteht, zu erfahren, wer hinter diesen Aussagen steht. Dies ist bei der Abfassung des Gesetzes vielmehr bereits bedacht worden, da keine Informationspflicht für notwendig erachtet wird, wo durch einen Plattformanbieter sichergestellt ist, dass die schutzwürdigen Belange der Beteiligten gewahrt sind. Daher geht die Auffassung zu weit, nach der die Ausnahme nur in Betracht kommt, wenn die Inhalte passwortgeschützt sind oder nur Inhalte aus dem engsten persönlichen Lebensbereich betroffen sind (so aber Ott, MMR 2007, 354, 356; für die Notwendigkeit einer weiten Fassung hingegen Kitz, ZUM 2007, 368, 372).
Unaufgeregt sieht die Sachlage auch der Lawblogger Udo Vetter (Video 2012, Zitat daraus). In einem Interview [depubliziert] sagte er 2012:
Grundsätzlich unterliegen Blogger in Deutschland der Impressumspflicht, aber die wird hier nur sehr lasch verfolgt. Es handelt sich um eine mögliche Ordnungswidrigkeit. Aber mir ist bisher kein Fall bekannt, bei dem ein Blogger ein Bußgeld bezahlen musste, weil er kein Impressum hatte. Das einzige, was die Behörden mitunter verschicken, sind höfliche Schreiben, in denen sie darum bitten, innerhalb von vier Wochen ein Impressum einzusetzen. Wenn man das dann nicht macht, kann es problematisch werden. Aber an sich kann man erst einmal beruhigt abwarten. Ich halte das auch für eine vernünftige Praxis der Behörden. Es gibt genug andere Missstände, beispielsweise bloggende Frauen, die zu Opfern von sexuellen Nachstellungen werden. Es ist vernünftig, da mit Augenmaß dran zu gehen.
Wer "geschäftlich" agiert, ist bereits bei Einsatz von "Google-Ads" gut beraten, ein korrektes Impressum (wie das auszusehen hat, sagen die oben verlinkten Seiten) anzubieten. Das gilt auch für soziale Netzwerke wie Facebook und sogar für Twitter. Er kann sich sonst leicht eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung einfangen.
Bei reinen Wissenschaftsblogs schätze ich das Risiko, ein Bußgeld zu erhalten, als sehr gering ein. Die Aufsichtsbehörden haben, das sieht Vetter richtig, Wichtigeres zu tun.
Wo der Anbieter der Blogmöglichkeit (Bloghoster z.B. blogger.com) sitzt, spielt keine Rolle. Richten sich z.B. Blogs von de.hypotheses.org an ein Publikum in Deutschland, so unterliegen sie der deutschen Impressumspflicht.
Bei institutionellen Blogs sollte ein Impressum kein Problem sein. Bei Gemeinschaftsblogs sollte eine Person als verantwortlich angegeben werden, an die man sich bei Rechtsverletzungen wenden kann. Möchte eine bloggende Wissenschaftlerin ihre Identität nicht preisgeben, ist die Nennung eines Strohmanns (oder einer Strohfrau?) eine empfehlenswerte Option.
Wer seriös wissenschaftlich bloggt, wird in der Regel mit offenem Visier agieren und seinen Namen nennen, zumal damit zu rechnen ist, dass dereinst auch Blogbeiträge als wissenschaftliche Leistungen anerkannt werden. In Ausnahmefällen, wenn es etwa um rechtmäßige, aber brisante Meinungsäußerungen geht oder wenn der Blogger "undercover" ermittelt, muss man es aber auch als legitim ansehen, wenn er anonym bleiben möchte.
Mein Impressum:
http://archiv.twoday.net/stories/134812/
***
Nachtrag:
Es wurde beanstandet, dass ich nicht gesagt habe, was denn nun zwingend in ein Impressum gehört. Je nach Rechtsgrundlage leider Unterschiedliches. Wer ein strikt-nichtgewerbliches Wissenschaftsblog unterhält und nicht ganz auf ein Impressum verzichten möchte, kann sich auf die Vorgabe des Rundfunkstaatsvertrags (§ 55, PDF) stützen und nur Name (voller Vorname!) und Anschrift angeben. Bei dem Telemediengesetz (§ 5) sind unverzichtbar zusätzlich die Emailadresse und mindestens ein zweiter effizienter Kommunikationsweg, um den Anbieter zu erreichen (vor allem kommen in Betracht: Telefonnummer oder Faxnummer oder Anfragemaske). Es existiert aber auch die Ansicht, die Telefonnummer sei auf jeden Fall zu nennen.
Das Impressum muss von jeder Seite aus erreichbar sein. Wenn man es Impressum nennt, macht man am wenigsten falsch, da die Bezeichnung "Kontakt" von einem Teil der Experten als nicht ausreichend angesehen wird.
Siehe auch das Hoeren-Skript S. 255ff. (PDF).
Es gibt Impressum-Generatoren, die die entsprechenden Angaben abfragen und dann ein hoffentlich korrektes Impressum erzeugen. Hier ein Musterimpressum, erstellt mit einem dieser Angebote.
Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG:
Klaus Graf
Deutsche Straße 8
41464 Neuss
Kontakt:
Telefon: |
491774880893 |
Telefax: |
|
E-Mail: |
klausgraf@googlemail.com |
Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:
Dr. Klaus Graf
Deutsche Str. 8
41464 Neuss
Quelle: Impressumgenerator des Anwaltes Sören Siebert
Ich rate dringend davon ab, die Entscheidung für oder gegen ein Impressum und über seinen Inhalt allein auf diesen Beitrag zu stützen. Es sollten in jedem Fall noch weitere (z.B. die angegebenen) Internetquellen konsultiert werden!***
Blog & Recht 1: Darf ich Bilder lebender Personen veröffentlichen?
http://archiv.twoday.net/stories/156271221/
Blog&Recht 2: Darf ich mein Blog mit einem Porträtfoto von mir schmücken?
http://archiv.twoday.net/stories/156272358/
KlausGraf - am Samstag, 13. Oktober 2012, 23:08 - Rubrik: Archivrecht
Das Buch 2011 "Knowledge Policy for the 21st Century: A Legal Perspective", das auf eine Tagung 2007 zurückgeht, ist auch online Open Access verfügbar und enthält auch einen Aufsatz von Damien O'Brien "Blogs and the Law: Key Legal Issues for the Blogosphere"
http://www.irwinlaw.com/pages/knowledge-policy-for-the-21st-century--a-legal-perspective
Zitat:
In particular,
copyright law, defamation law, Internet jurisdiction, employment law, and
the law of authorization for intermediaries will all prove to be a significant impediment to the functioning of the blogosphere. The many challenges that these areas of the law will have on the blogosphere have, to a
small degree, already been experienced, with an increase in actions filed
against bloggers, specifically for defamation. It is expected that the amount
of litigation in the courts involving blogs will increase dramatically, as blogs
become a mainstream form of online communication.
http://www.irwinlaw.com/pages/knowledge-policy-for-the-21st-century--a-legal-perspective
Zitat:
In particular,
copyright law, defamation law, Internet jurisdiction, employment law, and
the law of authorization for intermediaries will all prove to be a significant impediment to the functioning of the blogosphere. The many challenges that these areas of the law will have on the blogosphere have, to a
small degree, already been experienced, with an increase in actions filed
against bloggers, specifically for defamation. It is expected that the amount
of litigation in the courts involving blogs will increase dramatically, as blogs
become a mainstream form of online communication.
KlausGraf - am Samstag, 13. Oktober 2012, 21:18 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bei einem Teil der auf Wikimedia Commons zugänglichen Bilder wird unter dem Reiter "Einbinden" ein Einbettungscode angeboten, der zunächst eine Textzeile "Nennung der Urheberschaft" und danach einen HTML-Einbettungscode vorgibt. Unzweckmäßig, aber rechtmäßig ist, dass die Lizenz darin nicht anklickbar ist. Aber meine Bedenken
http://archiv.twoday.net/stories/156272262/
haben sich inzwischen zu der Einschätzung verdichtet, dass ich diesen Code für nicht lizenzkonform und daher illegal ansehe.
Wie eine Anfrage in der Wikipedia-Auskunft ergab, unterstützen sowohl alte Browser als auch weit verbreitete mobile Geräte (iPad und andere mit Betriebssystem iOS das title-Attribut von HTML 4 nicht, was bedeutet, dass auf diesen Geräten eine korrekte Attribuierung (Namens- und Lizenznennung) nur über den Quelltext möglich ist.
Wenn auf WP:UF bestritten wird, dass kein Rechtsbruch vorliege, wenn " iOS html-4.0 nicht richtig rendert", so trifft das angesichts der Verbreitung mobiler Geräte mit iOS nicht den Punkt. Eine korrekte Attribuierung muss plattformunabhängig gültig sein. Es sollte nicht darauf ankommen, ob sich das eigene Gerät an einen akzeptierten Standard hält und auch nicht darauf, ob der Nutzer auf die Idee kommt, mit der Maus über das Bild zu fahren. Mit gleichem Recht könnte man auch einen Bilddateinamen, in dem der Name des Autors und die Lizenz-URL versteckt ist, als gültig ansehen, da man mit einem Mouseover auch ihn in vielen Browsern sehen kann.
Túrelio schrieb in der WP-UF-Diksussion:
[...] dass die CC-BY-xy-Vorlagen die Nachnutzer zwar über die Namensnennungspflicht, NICHT aber über die (für die meisten Nutzungsformen) ebenso bestehende Pflicht zur Mitteilung der anwendbaren Lizenzbedingungen (üblicherweise zu erzielen durch Link auf legal-code oder notfalls auf den sog. deed) informieren. Dieser Mangel ist seit langem bekannt, aber bis heute nicht behoben. CC ist daran allerdings nicht ganz unschuldig, weil sie in den meist ausschließlich gelesenen Lizenz-deeds (Zusammenfassung) diese 2. Nutzungsbedingung nicht gleichrangig neben die Namensnennung, sondern unten auf der Seite (so quasi in Kleingedruckte) plaziert haben. Solange das auf Commons nicht korrigiert ist, darf man sich nicht wundern, wenn Nachnutzer diese Bedingung nicht einhalten, sofern nicht beim betroffenen Bild auf Commons ein individueller Hinweis (z.B. in der Creditline; Beispiel) vorhanden war.
Maßgeblich ist der Lizenzcode von CC, ich zitiere CC 3.0 unported:
"You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. "
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
Punkt 4c lautet: "f You Distribute, or Publicly Perform the Work or any Adaptations or Collections, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and (iv) , consistent with Ssection 3(b), in the case of an Adaptation, a credit identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g., "French translation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). The credit required by this Section 4(c) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Adaptation or Collection, at a minimum such credit will appear, if a credit for all contributing authors of the Adaptation or Collection appears, then as part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing authors."
Bei Commons-Bildern existiert in der Regel kein beizubehaltender Titel. Weder der Dateiname noch die Beschreibung, die ja beliebig von anderen änderbar ist, muss bei der Nutzung angegeben werden - es sei denn, ein Titel wird ausdrücklich angegeben. maßgeblich ist auf Commons die sogenannte Credit Line:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Credit_line
Im Quellcode des von Túrelio angegebenen Bilds sieht man, dass ein Standardfeld für die Credit Line nicht existiert, man muss diese bei "Sonstiges" mittels Vorlage einbinden, und der HTML-Einbettungscode ignoriert die Vorlage Credit-Line, was ganz und gar nicht lizenzkonform ist.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DurchgebrannteG4HalogenBirne_5632.JPG
Es muss grundsätzlich klar und eindeutig erkennbar sein, was der Urheber im Rahmen der von CC vorgegebenen Befugnis, fordert.
Wo und wie diese Angaben angebracht werden, kann der Urheber nicht vorgeben, da es auf die Auslegung von "reasonable to the medium or means" der Lizenz ankommt. Ich bezweifle, dass deutsche Gerichte Nutzern da sehr viel durchgehen lassen werden.
Wenn es für eine der norwegische Wikipedien möglich ist, den Namen des Urhebers direkt beim Bild zu nennen, siehe etwa den Artikel Oslo
http://no.wikipedia.org/wiki/Oslo
sollte es generell bei Online-Veröffentlichungen möglich zu sein, Urhebername und Lizenz direkt am Foto zu nennen. Bei gedruckten Büchern kann der Bildnachweis in einem eigenen Anhang nach wie vor als branchenüblich gelten.
Eine Nennung nur im Quelltext oder nur im Dateinamen sehe ich nicht als lizenzkonform an. Auch das name-Attribut von img in HTML ist ungeeignet, da es in der Regel nur dann angezeigt wird, wenn das Bild nicht zu sehen ist.
Für den Fotografen ist es am günstigsten, wenn die Nennung direkt am Bild steht. Bei Online-Nutzungen sehe ich es aber als rechtmäßig an, wenn der Bildnachweis auf der gleichen HTML-Seite (auch als Fußtext) erfolgt, wenn er ohne weiteres sichtbar ist. Das ist beim title-Attribut nicht der Fall, da es ein Mouseover voraussetzt und weit verbreitete mobile Geräte das Attribut nicht unterstützen.

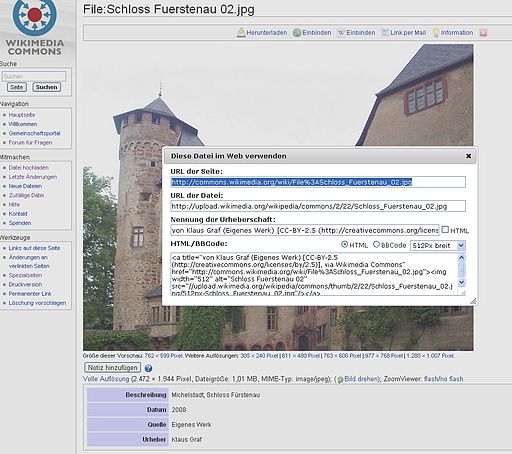
http://archiv.twoday.net/stories/156272262/
haben sich inzwischen zu der Einschätzung verdichtet, dass ich diesen Code für nicht lizenzkonform und daher illegal ansehe.
Wie eine Anfrage in der Wikipedia-Auskunft ergab, unterstützen sowohl alte Browser als auch weit verbreitete mobile Geräte (iPad und andere mit Betriebssystem iOS das title-Attribut von HTML 4 nicht, was bedeutet, dass auf diesen Geräten eine korrekte Attribuierung (Namens- und Lizenznennung) nur über den Quelltext möglich ist.
Wenn auf WP:UF bestritten wird, dass kein Rechtsbruch vorliege, wenn " iOS html-4.0 nicht richtig rendert", so trifft das angesichts der Verbreitung mobiler Geräte mit iOS nicht den Punkt. Eine korrekte Attribuierung muss plattformunabhängig gültig sein. Es sollte nicht darauf ankommen, ob sich das eigene Gerät an einen akzeptierten Standard hält und auch nicht darauf, ob der Nutzer auf die Idee kommt, mit der Maus über das Bild zu fahren. Mit gleichem Recht könnte man auch einen Bilddateinamen, in dem der Name des Autors und die Lizenz-URL versteckt ist, als gültig ansehen, da man mit einem Mouseover auch ihn in vielen Browsern sehen kann.
Túrelio schrieb in der WP-UF-Diksussion:
[...] dass die CC-BY-xy-Vorlagen die Nachnutzer zwar über die Namensnennungspflicht, NICHT aber über die (für die meisten Nutzungsformen) ebenso bestehende Pflicht zur Mitteilung der anwendbaren Lizenzbedingungen (üblicherweise zu erzielen durch Link auf legal-code oder notfalls auf den sog. deed) informieren. Dieser Mangel ist seit langem bekannt, aber bis heute nicht behoben. CC ist daran allerdings nicht ganz unschuldig, weil sie in den meist ausschließlich gelesenen Lizenz-deeds (Zusammenfassung) diese 2. Nutzungsbedingung nicht gleichrangig neben die Namensnennung, sondern unten auf der Seite (so quasi in Kleingedruckte) plaziert haben. Solange das auf Commons nicht korrigiert ist, darf man sich nicht wundern, wenn Nachnutzer diese Bedingung nicht einhalten, sofern nicht beim betroffenen Bild auf Commons ein individueller Hinweis (z.B. in der Creditline; Beispiel) vorhanden war.
Maßgeblich ist der Lizenzcode von CC, ich zitiere CC 3.0 unported:
"You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. "
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
Punkt 4c lautet: "f You Distribute, or Publicly Perform the Work or any Adaptations or Collections, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and (iv) , consistent with Ssection 3(b), in the case of an Adaptation, a credit identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g., "French translation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). The credit required by this Section 4(c) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Adaptation or Collection, at a minimum such credit will appear, if a credit for all contributing authors of the Adaptation or Collection appears, then as part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing authors."
Bei Commons-Bildern existiert in der Regel kein beizubehaltender Titel. Weder der Dateiname noch die Beschreibung, die ja beliebig von anderen änderbar ist, muss bei der Nutzung angegeben werden - es sei denn, ein Titel wird ausdrücklich angegeben. maßgeblich ist auf Commons die sogenannte Credit Line:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Credit_line
Im Quellcode des von Túrelio angegebenen Bilds sieht man, dass ein Standardfeld für die Credit Line nicht existiert, man muss diese bei "Sonstiges" mittels Vorlage einbinden, und der HTML-Einbettungscode ignoriert die Vorlage Credit-Line, was ganz und gar nicht lizenzkonform ist.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DurchgebrannteG4HalogenBirne_5632.JPG
Es muss grundsätzlich klar und eindeutig erkennbar sein, was der Urheber im Rahmen der von CC vorgegebenen Befugnis, fordert.
Wo und wie diese Angaben angebracht werden, kann der Urheber nicht vorgeben, da es auf die Auslegung von "reasonable to the medium or means" der Lizenz ankommt. Ich bezweifle, dass deutsche Gerichte Nutzern da sehr viel durchgehen lassen werden.
Wenn es für eine der norwegische Wikipedien möglich ist, den Namen des Urhebers direkt beim Bild zu nennen, siehe etwa den Artikel Oslo
http://no.wikipedia.org/wiki/Oslo
sollte es generell bei Online-Veröffentlichungen möglich zu sein, Urhebername und Lizenz direkt am Foto zu nennen. Bei gedruckten Büchern kann der Bildnachweis in einem eigenen Anhang nach wie vor als branchenüblich gelten.
Eine Nennung nur im Quelltext oder nur im Dateinamen sehe ich nicht als lizenzkonform an. Auch das name-Attribut von img in HTML ist ungeeignet, da es in der Regel nur dann angezeigt wird, wenn das Bild nicht zu sehen ist.
Für den Fotografen ist es am günstigsten, wenn die Nennung direkt am Bild steht. Bei Online-Nutzungen sehe ich es aber als rechtmäßig an, wenn der Bildnachweis auf der gleichen HTML-Seite (auch als Fußtext) erfolgt, wenn er ohne weiteres sichtbar ist. Das ist beim title-Attribut nicht der Fall, da es ein Mouseover voraussetzt und weit verbreitete mobile Geräte das Attribut nicht unterstützen.

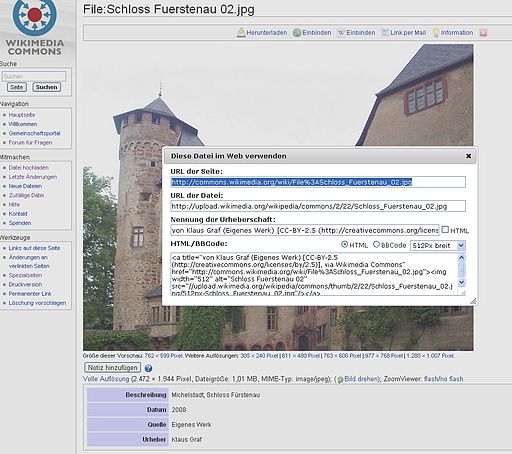
KlausGraf - am Samstag, 13. Oktober 2012, 19:21 - Rubrik: Archivrecht
"OLG Hamburg, Beschluss vom 26.04.2010, Az. 5 U 160/08
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG, § 2 Abs. 2 UrhG
Das OLG Hamburg hat in diesem Hinweisbeschluss darauf hingewiesen, dass der Refrain eines Liedes, der aus wenigen Worten oder einem Satz besteht, nicht isoliert als Sprachwerk dem Urheberrechtsschutz unterfällt, auch wenn er über einen gewissen Grad an Originalität verfügt. Der vom Kläger erdachten Textzeile „alles ist gut so lange du wild bist” fehle es an der erforderlichen Schöpfungshöhe."
http://www.damm-legal.de/olg-hamburg-zum-urheberrechtlichen-schutz-einer-einzigen-zeile-eines-liedes
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG, § 2 Abs. 2 UrhG
Das OLG Hamburg hat in diesem Hinweisbeschluss darauf hingewiesen, dass der Refrain eines Liedes, der aus wenigen Worten oder einem Satz besteht, nicht isoliert als Sprachwerk dem Urheberrechtsschutz unterfällt, auch wenn er über einen gewissen Grad an Originalität verfügt. Der vom Kläger erdachten Textzeile „alles ist gut so lange du wild bist” fehle es an der erforderlichen Schöpfungshöhe."
http://www.damm-legal.de/olg-hamburg-zum-urheberrechtlichen-schutz-einer-einzigen-zeile-eines-liedes
KlausGraf - am Samstag, 13. Oktober 2012, 17:51 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In meiner Urheberrechtsfibel (PDF) behandelte ich 2009 folgenden fiktiven Fall zu § 17 UrhG, der das Verbreitungsrecht und den sogenannten Erschöpfungsgrundsatz regelt:
"Wer aus dem Thailand-Urlaub eine dort legal vertriebene Musik-DVD mitbringt und bei eBay anbietet, kann wegen Urheberrechtsverletzung abgemahnt werden. Angebot und Inverkehrbringen des Werks (Original oder Kopie)
müssen sich in der Öffentlichkeit abspielen. Wenn der Thailandurlauber die DVD im Freundeskreis verschenkt oder verkauft, handelt er legal. Mit der Einstellung der Auktion bei dem Online-Auktionshaus erfolgt aber ein öffentliches Anbieten.
Durch das Inverkehrbringen wird das Werk aus der internen Betriebssphäre des Urhebers, Herstellers oder Verwerters entlassen. Eine konzerninterne Weitergabe ist kein Inverkehrbringen. [...]
Absatz 2 ist der sogenannte Erschöpfungsgrundsatz. Dem Urheber
steht nur das Recht der Erstverbreitung zu. Verschenkt, verkauft oder tauscht er das Werk, soll er weitere Veräußerungen nicht mehr kontrollieren dürfen. Einzig und allein die Vermietung unterliegt seinem Verbotsrecht. Wer einen urheberrechtlich geschützten Gartenzwerg kauft, darf diesen sowohl weiterverkaufen als auch in seinen Vorgarten stellen, wo er
dann – gemäß der Panoramafreiheit des § 59 – vom Gartenzaun aus
vergütungsfrei fotografiert werden darf (auch zu gewerblichen Zwecken).
Die Erschöpfung gilt nur für die EU/EWR (der Europäische Wirtschaftsraum erweitert die EU um Liechtenstein, Norwegen und Island), nicht aber z. B. für Thailand in meinem Beispiel. Hier lauert eine üble Abmahnfalle, denn der normale Bürger wird selbstverständlich davon ausgehen, dass er legal erworbene Waren – schließlich handelt es sich ja nicht etwa um Raubkopien – ohne weiteres weiterverkaufen kann. Dass die Erschöpfung nur europaweit gilt, ist schlicht und einfach nicht fair und verstößt auch gegen das Eigentumsgrundrecht des nichtsahnenden
Verbrauchers. Ist eine Weitergabe nur im Bekannten- oder Freundeskreis möglich, so wird die Verkehrsfähigkeit der Ware unzumutbar beeinträchtigt. Die Erschöpfung muss weltweit gelten!"
Zu ergänzen ist, dass der Europäische Gerichtshof 2006 im Laserdisken-Fall verboten hat, dass der nationale Gesetzgeber die Erschöpfung über den EU-Wirtschaftsraum hinaus erstreckt.
Die Erwähnung Thailands war insofern von mir prophetisch, als 2012 ein solcher Import aus Thailand die US-Rechtsszene beschäftigt.
"Durch den Verkauf gebrauchter und neuer Bücher wollte sich der thailändische Student Supap Kirtsaeng sein Studium in den USA finanzieren. Dazu gehörten auch acht echte und legal gekaufte Lehrbücher des Wiley Verlags, die ihm Verwandte aus Thailand geschickt hatten. Eine Jury verurteilte ihn dafür wegen willentlicher Urheberrechtsverletzung zu 600.000 Dollar Strafschadenersatz.
Das Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung mit 2:1 Stimmen der Richter. Nun hat der Oberste Gerichtshof der USA (Supreme Court) eingewilligt, diesen und einen sehr ähnlichen Fall zu behandeln. Die zentrale Rechtsfrage ist, ob die sogenannte "First Sale Doctrine" (Erschöpfungsgrundsatz) auch für Werkstücke gilt, die legal im Ausland angefertigt und dann in den USA verkauft werden. "
http://derstandard.at/1341526759646/US-Gericht-erwaegt-ewiges-Urheberrecht
Schon die unsinnige Überschrift des Standard-Artikels lässt den Verdacht aufkommen, dass da nicht alles korrekt verstanden wurde.
Was prima facie als Rechtsfrage erscheint, die uns nicht zu kümmern braucht, kann sehr wohl - und das nicht nur in den USA - Auswirkungen auf die Kulturinstitutionen haben.
In einer Eingabe an den Supreme Court (Amicus-Brief) haben Museums-Institutionen davor gewarnt, dass eine Beschränkung der First-sale-Doktrin (die dem Erschöpfungsgrundsatz des EU-Rechts entspricht) auf die USA dazu führen könnte, dass Museen ausländische Werke weder zeigen noch ankaufen können.
http://clancco.com/wp/2012/10/first-sale-doctrine-copyright-art/
Aus dem Schriftsatz:
To avoid the risk of liability, museums could be forced to seek licenses from copyright owners. But clearing rights will be expensive and in many cases impossible. The cost of having to find copyright owners and negotiate individual licenses will be high, and museums likely will be unable to locate the copyright owner in every instance even after a diligent search. Copyright owners, who have no obligation to grant licenses, could demand sizeable royalty payments and non-monetary concessions like control over curatorial decisions. Where museums are unable to secure permissions, they would face an untenable choice: running the risk of copyright infringement liability or not making art available to the public or even acquiring art, whether by gift, bequest, or purchase.
Auch die US-Bibliotheken sind alarmiert:
http://newsandinsight.thomsonreuters.com/New_York/News/2012/07_-_July/A_Supreme_Court_copyright_case_has_libraries_fighting_for_the_right_to_lend/
[I]f the Supreme Court agrees with the 2nd Circuit's Kirtsaeng reasoning, according to the libraries' brief, libraries may no longer be legally permitted to lend books that were manufactured outside the United States, whether they be foreign-language books or books from U.S. publishers that are printed overseas.
Ich hatte schon 2010 auf einen Beitrag von Peter Hirtle aufmerksam gemacht, der auch Implikationen für Archive bzw. Manuskriptsammlungen erwägt:
http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2010/07/costco-v-omega.html
In der EU gilt der Erschöpfungsgrundsatz wie gesagt nur EU-weit. Konstruiertes Beispiel: Der berühmte englische Künstler Damien H. malt in Moskau für Oligarch A ein Bild, das dieser an Oligarch Б verkauft, der das Bild in Köln versteigern lassen will. Damien kann die Versteigerung unterbinden, da sein Verbreitungsrecht nicht erschöpft ist. Jeder Verkauf in der EU kann nur mit seiner Zustimmung erfolgen.
Erwirbt eine deutsche Bibliothek ein vom Ulmer Verlag in der Türkei in den Handel gebrachtes Lehrbuch gebraucht von einem türkischstämmigen Studenten, so darf sie es nicht verleihen, da das Verleihrecht als ausschließliches Recht in der EU nach wie vor besteht. Folgt man der abzulehnenden Auffassung von Schulze in Dreier/Schulze, UrhG 3. Aufl. 2008 § 27 Rz. 17 (siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/5837518/ ), wonach auch die Präsenznutzung ein Verleihen sei, so darf die Bibliothek mit ihrem Eigentum gar nichts machen als es bis zum Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers aufzubewahren - oder sie erhält die Zustimmung von Ulmer, der freilich an seinen Maserati denken muss.
Ein Museum dürfte ein Kunstwerk, dessen Verbreitungsrecht nicht erschöpft ist, allerdings zeigen, wenn das auf die Erstveröffentlichung bezogene Ausstellungsrecht verbraucht ist (§ 18 UrhG).
Eine oberflächliche Recherche in Beck-Online erbrachte keine Stellungnahmen von deutschen Juristen zu den Implikationen der Nichterschöpfung des Verbreitungsrechts auf Kunsthandel und Kulturinstitutionen. Das Problem hat glücklicherweise wohl hierzulande nur theoretischen Charakter, aber auch hier gilt "Grafs Law": Alles was abgemahnt werden kann, wird einmal abgemahnt werden ...
 Bilderverkauf in Bangkok, Foto: leekiza CC-BY-SA
Bilderverkauf in Bangkok, Foto: leekiza CC-BY-SA
"Wer aus dem Thailand-Urlaub eine dort legal vertriebene Musik-DVD mitbringt und bei eBay anbietet, kann wegen Urheberrechtsverletzung abgemahnt werden. Angebot und Inverkehrbringen des Werks (Original oder Kopie)
müssen sich in der Öffentlichkeit abspielen. Wenn der Thailandurlauber die DVD im Freundeskreis verschenkt oder verkauft, handelt er legal. Mit der Einstellung der Auktion bei dem Online-Auktionshaus erfolgt aber ein öffentliches Anbieten.
Durch das Inverkehrbringen wird das Werk aus der internen Betriebssphäre des Urhebers, Herstellers oder Verwerters entlassen. Eine konzerninterne Weitergabe ist kein Inverkehrbringen. [...]
Absatz 2 ist der sogenannte Erschöpfungsgrundsatz. Dem Urheber
steht nur das Recht der Erstverbreitung zu. Verschenkt, verkauft oder tauscht er das Werk, soll er weitere Veräußerungen nicht mehr kontrollieren dürfen. Einzig und allein die Vermietung unterliegt seinem Verbotsrecht. Wer einen urheberrechtlich geschützten Gartenzwerg kauft, darf diesen sowohl weiterverkaufen als auch in seinen Vorgarten stellen, wo er
dann – gemäß der Panoramafreiheit des § 59 – vom Gartenzaun aus
vergütungsfrei fotografiert werden darf (auch zu gewerblichen Zwecken).
Die Erschöpfung gilt nur für die EU/EWR (der Europäische Wirtschaftsraum erweitert die EU um Liechtenstein, Norwegen und Island), nicht aber z. B. für Thailand in meinem Beispiel. Hier lauert eine üble Abmahnfalle, denn der normale Bürger wird selbstverständlich davon ausgehen, dass er legal erworbene Waren – schließlich handelt es sich ja nicht etwa um Raubkopien – ohne weiteres weiterverkaufen kann. Dass die Erschöpfung nur europaweit gilt, ist schlicht und einfach nicht fair und verstößt auch gegen das Eigentumsgrundrecht des nichtsahnenden
Verbrauchers. Ist eine Weitergabe nur im Bekannten- oder Freundeskreis möglich, so wird die Verkehrsfähigkeit der Ware unzumutbar beeinträchtigt. Die Erschöpfung muss weltweit gelten!"
Zu ergänzen ist, dass der Europäische Gerichtshof 2006 im Laserdisken-Fall verboten hat, dass der nationale Gesetzgeber die Erschöpfung über den EU-Wirtschaftsraum hinaus erstreckt.
Die Erwähnung Thailands war insofern von mir prophetisch, als 2012 ein solcher Import aus Thailand die US-Rechtsszene beschäftigt.
"Durch den Verkauf gebrauchter und neuer Bücher wollte sich der thailändische Student Supap Kirtsaeng sein Studium in den USA finanzieren. Dazu gehörten auch acht echte und legal gekaufte Lehrbücher des Wiley Verlags, die ihm Verwandte aus Thailand geschickt hatten. Eine Jury verurteilte ihn dafür wegen willentlicher Urheberrechtsverletzung zu 600.000 Dollar Strafschadenersatz.
Das Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung mit 2:1 Stimmen der Richter. Nun hat der Oberste Gerichtshof der USA (Supreme Court) eingewilligt, diesen und einen sehr ähnlichen Fall zu behandeln. Die zentrale Rechtsfrage ist, ob die sogenannte "First Sale Doctrine" (Erschöpfungsgrundsatz) auch für Werkstücke gilt, die legal im Ausland angefertigt und dann in den USA verkauft werden. "
http://derstandard.at/1341526759646/US-Gericht-erwaegt-ewiges-Urheberrecht
Schon die unsinnige Überschrift des Standard-Artikels lässt den Verdacht aufkommen, dass da nicht alles korrekt verstanden wurde.
Was prima facie als Rechtsfrage erscheint, die uns nicht zu kümmern braucht, kann sehr wohl - und das nicht nur in den USA - Auswirkungen auf die Kulturinstitutionen haben.
In einer Eingabe an den Supreme Court (Amicus-Brief) haben Museums-Institutionen davor gewarnt, dass eine Beschränkung der First-sale-Doktrin (die dem Erschöpfungsgrundsatz des EU-Rechts entspricht) auf die USA dazu führen könnte, dass Museen ausländische Werke weder zeigen noch ankaufen können.
http://clancco.com/wp/2012/10/first-sale-doctrine-copyright-art/
Aus dem Schriftsatz:
To avoid the risk of liability, museums could be forced to seek licenses from copyright owners. But clearing rights will be expensive and in many cases impossible. The cost of having to find copyright owners and negotiate individual licenses will be high, and museums likely will be unable to locate the copyright owner in every instance even after a diligent search. Copyright owners, who have no obligation to grant licenses, could demand sizeable royalty payments and non-monetary concessions like control over curatorial decisions. Where museums are unable to secure permissions, they would face an untenable choice: running the risk of copyright infringement liability or not making art available to the public or even acquiring art, whether by gift, bequest, or purchase.
Auch die US-Bibliotheken sind alarmiert:
http://newsandinsight.thomsonreuters.com/New_York/News/2012/07_-_July/A_Supreme_Court_copyright_case_has_libraries_fighting_for_the_right_to_lend/
[I]f the Supreme Court agrees with the 2nd Circuit's Kirtsaeng reasoning, according to the libraries' brief, libraries may no longer be legally permitted to lend books that were manufactured outside the United States, whether they be foreign-language books or books from U.S. publishers that are printed overseas.
Ich hatte schon 2010 auf einen Beitrag von Peter Hirtle aufmerksam gemacht, der auch Implikationen für Archive bzw. Manuskriptsammlungen erwägt:
http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2010/07/costco-v-omega.html
In der EU gilt der Erschöpfungsgrundsatz wie gesagt nur EU-weit. Konstruiertes Beispiel: Der berühmte englische Künstler Damien H. malt in Moskau für Oligarch A ein Bild, das dieser an Oligarch Б verkauft, der das Bild in Köln versteigern lassen will. Damien kann die Versteigerung unterbinden, da sein Verbreitungsrecht nicht erschöpft ist. Jeder Verkauf in der EU kann nur mit seiner Zustimmung erfolgen.
Erwirbt eine deutsche Bibliothek ein vom Ulmer Verlag in der Türkei in den Handel gebrachtes Lehrbuch gebraucht von einem türkischstämmigen Studenten, so darf sie es nicht verleihen, da das Verleihrecht als ausschließliches Recht in der EU nach wie vor besteht. Folgt man der abzulehnenden Auffassung von Schulze in Dreier/Schulze, UrhG 3. Aufl. 2008 § 27 Rz. 17 (siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/5837518/ ), wonach auch die Präsenznutzung ein Verleihen sei, so darf die Bibliothek mit ihrem Eigentum gar nichts machen als es bis zum Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers aufzubewahren - oder sie erhält die Zustimmung von Ulmer, der freilich an seinen Maserati denken muss.
Ein Museum dürfte ein Kunstwerk, dessen Verbreitungsrecht nicht erschöpft ist, allerdings zeigen, wenn das auf die Erstveröffentlichung bezogene Ausstellungsrecht verbraucht ist (§ 18 UrhG).
Eine oberflächliche Recherche in Beck-Online erbrachte keine Stellungnahmen von deutschen Juristen zu den Implikationen der Nichterschöpfung des Verbreitungsrechts auf Kunsthandel und Kulturinstitutionen. Das Problem hat glücklicherweise wohl hierzulande nur theoretischen Charakter, aber auch hier gilt "Grafs Law": Alles was abgemahnt werden kann, wird einmal abgemahnt werden ...
 Bilderverkauf in Bangkok, Foto: leekiza CC-BY-SA
Bilderverkauf in Bangkok, Foto: leekiza CC-BY-SAKlausGraf - am Freitag, 12. Oktober 2012, 21:03 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen