Archivrecht
KlausGraf - am Sonntag, 27. April 2014, 16:51 - Rubrik: Archivrecht
KlausGraf - am Sonntag, 27. April 2014, 16:24 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Urteil des LG Tübingen von 2012 ist mir bisher entgangen:
http://openjur.de/u/582363.html
Auszug:
"Aufseiten der Beklagten ist ferner zu berücksichtigen, dass es sich bei Wikipedia um eine weltweite freie Online-Enzyklopädie handelt, welche allein in der deutschsprachigen Version über 300000 Beiträge bereithält. Insofern besteht ein erhebliches öffentliches Interesse nach Art. 5 I 1 2. Alt. GG, 10 I 1 EMRK an den von der Beklagten bereitgehaltenen Einträgen, um sich umfassend informieren zu können. Vor allem auch die Personen, welche über keine geschriebene Enzyklopädie verfügen, haben ein beachtliches Interesse sich über die Internetseite der Beklagten Informationen zu verschaffen.
Weiterhin kann die Beklagte die Pressefreiheit aus Art. 5 I 2 1. Alt. GG für sich in Anspruch nehmen. Diese schützt grundsätzlich die Verbreitung von Informationen, wobei unter anderem auch das Recht eingeräumt wird, wahre Tatsachen zu publizieren. Mit dieser Gewährleistung korrespondiert insbesondere das Interesse der Öffentlichkeit an einer ausreichenden Versorgung mit Informationen. Zudem kommt diesen beiden Rechten schon aufgrund ihres Charakters als demokratische Grundrechte ein hoher Stellenwert zu, sodass gewichtige Gründe erforderlich sind, welche ein Überwiegen eines kollidierenden Rechtsgutes rechtfertigen."
Ob das LG Tübingen über eine "geschriebene Enzyklopädie" verfügt?
http://openjur.de/u/582363.html
Auszug:
"Aufseiten der Beklagten ist ferner zu berücksichtigen, dass es sich bei Wikipedia um eine weltweite freie Online-Enzyklopädie handelt, welche allein in der deutschsprachigen Version über 300000 Beiträge bereithält. Insofern besteht ein erhebliches öffentliches Interesse nach Art. 5 I 1 2. Alt. GG, 10 I 1 EMRK an den von der Beklagten bereitgehaltenen Einträgen, um sich umfassend informieren zu können. Vor allem auch die Personen, welche über keine geschriebene Enzyklopädie verfügen, haben ein beachtliches Interesse sich über die Internetseite der Beklagten Informationen zu verschaffen.
Weiterhin kann die Beklagte die Pressefreiheit aus Art. 5 I 2 1. Alt. GG für sich in Anspruch nehmen. Diese schützt grundsätzlich die Verbreitung von Informationen, wobei unter anderem auch das Recht eingeräumt wird, wahre Tatsachen zu publizieren. Mit dieser Gewährleistung korrespondiert insbesondere das Interesse der Öffentlichkeit an einer ausreichenden Versorgung mit Informationen. Zudem kommt diesen beiden Rechten schon aufgrund ihres Charakters als demokratische Grundrechte ein hoher Stellenwert zu, sodass gewichtige Gründe erforderlich sind, welche ein Überwiegen eines kollidierenden Rechtsgutes rechtfertigen."
Ob das LG Tübingen über eine "geschriebene Enzyklopädie" verfügt?
KlausGraf - am Sonntag, 27. April 2014, 01:09 - Rubrik: Archivrecht
Sagt RA Schwenke
http://allfacebook.de/policy/sharing-leistungsschutzrecht-nutzerbeitraege
Und das gilt nicht nur für Facebook. Als Ausnahmen erkennt er an:
- rechtswidrige Aussagen
- die Seite wird praktisch lahmgelegt.
Siehe auch seinen Beitrag von 2012 zu den Grenzen des "virtuellen Hausrechts":
http://rechtsanwalt-schwenke.de/ing-diba-veganer-und-die-grenzen-des-hausrechts-auf-facebook-fanseiten/
http://allfacebook.de/policy/sharing-leistungsschutzrecht-nutzerbeitraege
Und das gilt nicht nur für Facebook. Als Ausnahmen erkennt er an:
- rechtswidrige Aussagen
- die Seite wird praktisch lahmgelegt.
Siehe auch seinen Beitrag von 2012 zu den Grenzen des "virtuellen Hausrechts":
http://rechtsanwalt-schwenke.de/ing-diba-veganer-und-die-grenzen-des-hausrechts-auf-facebook-fanseiten/
KlausGraf - am Sonntag, 27. April 2014, 00:44 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://kritischegeschichte.wordpress.com/2014/04/26/radergate-was-die-debatte-um-plagiate-aus-der-wikipedia-ubersieht/#comment-583
Wir "brauchen ein Umfeld, das gelernt hat, mit freiem Wissen und freien Lizenzen offen und ehrlich umzugehen". Das ist absolut richtig!
Für einen Verlag wie Beck ist die Nachnutzung von Wikipedia-Auszügen keine Option, da aufgrund der CC-BY-SA-Lizenz günstigstenfalls das ganze Kapitel unter die gleiche Lizenz gestellt werden muss, was nach (falscher) Ansicht der ewiggestrigen Verlagslobby die Vermarktungsmöglichkeiten einschränkt. Ich lasse mal das Problem beiseite, dass nach meiner Rechtsauffassung bei der Lizenzumstellung die GNU-FDL-Forderung nach Wiedergabe der Versionsgeschichte illegalerweise unter den Tisch fiel, was für ältere Artikel Bedeutung hat.
Anders als bei Bildern erfolgt die Attribution bei Texten durch einen Link zur Wikipedia. Außerdem muss auch die Lizenz verlinkt werden und die Tatsache der Bearbeitung signalisiert werden.
Das von Schmalenstroer ins Spiel gebrachte Zitatrecht hat hier keine Relevanz, da Zitate nach § 51 UrhG einem ÄNDERUNGSVERBOT unterliegen und b) eine QUELLENANGABE erfordern. Wie üblich reagiert Schmalenstroer auf Kommentare in seinem Blog nicht:
http://schmalenstroer.net/blog/2014/04/seeschlachtplagiatsdebatte/
Ob die Verteidigungslinie der Beck-Anwälte, dass alle Übernahmen keine Schöpfungshöhe besitzen, also kein Plagiat nach dem UrhG vorliegt (was aus akademischer Sicht nichts an der UNREDLICHKEIT ändert), wirklich gerichtsfest ist?
Wir haben einerseits die Position, die durch BGH Staatsexamensarbeit beschrieben wird (wenig Schutz für wissenschaftliche Formulierungen)
http://archiv.twoday.net/search?q=bgh+staatsexamensarbeit
Andererseits sind nach Ansicht des EuGH auch vergleichsweise kleine Schnipsel (11 Worte - der Rumpfgeschwindigkeitssatz hat gut 30) von Texten urheberrechtlich geschützt, ohne dass von einem Wissenschaftsvorbehalt etwas bekannt wurde:
http://archiv.twoday.net/stories/5855439/
Ums klar zu sagen. Die Rechtsprechung des EugH finde ich genauso behämmert wie Ladislaus. Aber es gibt eine menge Rechtsprechung, die in fahrlässiger Weise kleinste Münze durchgehen lässt und einen Urheberrechtsschutz behauptet. Im umgekehrten Fall - jemand hätte aus einem Beck-Buch plagiiert - hätte der Beck-Verlag sich mit Sicherheit auf diese Position gestützt.
Frühere Meldungen:
http://archiv.twoday.net/search?q=seeschlachten

Wir "brauchen ein Umfeld, das gelernt hat, mit freiem Wissen und freien Lizenzen offen und ehrlich umzugehen". Das ist absolut richtig!
Für einen Verlag wie Beck ist die Nachnutzung von Wikipedia-Auszügen keine Option, da aufgrund der CC-BY-SA-Lizenz günstigstenfalls das ganze Kapitel unter die gleiche Lizenz gestellt werden muss, was nach (falscher) Ansicht der ewiggestrigen Verlagslobby die Vermarktungsmöglichkeiten einschränkt. Ich lasse mal das Problem beiseite, dass nach meiner Rechtsauffassung bei der Lizenzumstellung die GNU-FDL-Forderung nach Wiedergabe der Versionsgeschichte illegalerweise unter den Tisch fiel, was für ältere Artikel Bedeutung hat.
Anders als bei Bildern erfolgt die Attribution bei Texten durch einen Link zur Wikipedia. Außerdem muss auch die Lizenz verlinkt werden und die Tatsache der Bearbeitung signalisiert werden.
Das von Schmalenstroer ins Spiel gebrachte Zitatrecht hat hier keine Relevanz, da Zitate nach § 51 UrhG einem ÄNDERUNGSVERBOT unterliegen und b) eine QUELLENANGABE erfordern. Wie üblich reagiert Schmalenstroer auf Kommentare in seinem Blog nicht:
http://schmalenstroer.net/blog/2014/04/seeschlachtplagiatsdebatte/
Ob die Verteidigungslinie der Beck-Anwälte, dass alle Übernahmen keine Schöpfungshöhe besitzen, also kein Plagiat nach dem UrhG vorliegt (was aus akademischer Sicht nichts an der UNREDLICHKEIT ändert), wirklich gerichtsfest ist?
Wir haben einerseits die Position, die durch BGH Staatsexamensarbeit beschrieben wird (wenig Schutz für wissenschaftliche Formulierungen)
http://archiv.twoday.net/search?q=bgh+staatsexamensarbeit
Andererseits sind nach Ansicht des EuGH auch vergleichsweise kleine Schnipsel (11 Worte - der Rumpfgeschwindigkeitssatz hat gut 30) von Texten urheberrechtlich geschützt, ohne dass von einem Wissenschaftsvorbehalt etwas bekannt wurde:
http://archiv.twoday.net/stories/5855439/
Ums klar zu sagen. Die Rechtsprechung des EugH finde ich genauso behämmert wie Ladislaus. Aber es gibt eine menge Rechtsprechung, die in fahrlässiger Weise kleinste Münze durchgehen lässt und einen Urheberrechtsschutz behauptet. Im umgekehrten Fall - jemand hätte aus einem Beck-Buch plagiiert - hätte der Beck-Verlag sich mit Sicherheit auf diese Position gestützt.
Frühere Meldungen:
http://archiv.twoday.net/search?q=seeschlachten

KlausGraf - am Samstag, 26. April 2014, 22:31 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Überschrift ist natürlich keine Anspielung auf die oft unfähigen alten Männer, sondern bezieht sich ausschließlich auf den Gegenstand ("Tarzan of the Apes") einer erfreulichen Entscheidung, die die Public Domain eine Spur stärkt.
Wir hatten den Casus vor kurzem schon:
http://archiv.twoday.net/stories/714912405/
Der BGH entschied, "dass der Roman nach dem Inhalt der in Betracht zu ziehenden Staatsverträge in Deutschland nur bis zum 31. Dezember 2000 urheberrechtlich geschützt war. Das Welturheberrechtsabkommen von 1952 überlagere das Übereinkommen zwischen dem Deutschen Reich und den Vereinigten Staaten von Amerika über den gegenseitigen Schutz der Urheberrechte von 1892 und führe dazu, dass dem Werk die seit Inkraftreten des Urheberrechtsgesetz am 9. September 1965 geltende Verlängerung der Schutzfrist auf 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers bis zum 31. Dezember 2020 nicht zugutekomme. Gemäß dem Schutzfristenvergleich nach Art. IV Abs. 4 bis 6 WUA wirke sich die Verlängerung der Schutzdauer nur insoweit aus, wie die Schutzfrist im Ursprungsland länger währt als die vor der Verlängerung geltende Schutzfrist im Inland."
http://www.urheberrecht.org/news/5194/
Volltext des Urteils:
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=67537&pos=4&anz=595&Blank=1.pdf
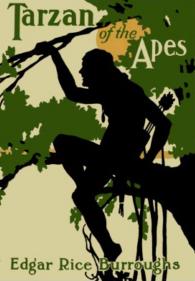
Wir hatten den Casus vor kurzem schon:
http://archiv.twoday.net/stories/714912405/
Der BGH entschied, "dass der Roman nach dem Inhalt der in Betracht zu ziehenden Staatsverträge in Deutschland nur bis zum 31. Dezember 2000 urheberrechtlich geschützt war. Das Welturheberrechtsabkommen von 1952 überlagere das Übereinkommen zwischen dem Deutschen Reich und den Vereinigten Staaten von Amerika über den gegenseitigen Schutz der Urheberrechte von 1892 und führe dazu, dass dem Werk die seit Inkraftreten des Urheberrechtsgesetz am 9. September 1965 geltende Verlängerung der Schutzfrist auf 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers bis zum 31. Dezember 2020 nicht zugutekomme. Gemäß dem Schutzfristenvergleich nach Art. IV Abs. 4 bis 6 WUA wirke sich die Verlängerung der Schutzdauer nur insoweit aus, wie die Schutzfrist im Ursprungsland länger währt als die vor der Verlängerung geltende Schutzfrist im Inland."
http://www.urheberrecht.org/news/5194/
Volltext des Urteils:
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=67537&pos=4&anz=595&Blank=1.pdf
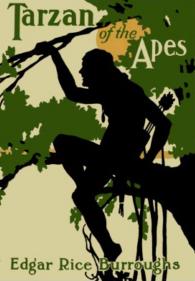
KlausGraf - am Freitag, 25. April 2014, 19:14 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://netzpolitik.org/2014/raus-aus-dem-gruselkabinett-vorschlag-fuer-neue-wissenschaftsschranke-im-urheberrecht/
"Ein gutes Jahre lang hat sich Katharina de la Durantaye, Juniorprofessorin für Bürgerliches Recht und Rechtsvergleichung an der Humboldt-Universität zu Berlin, mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) eingehend mit der Bildungs- und Wissenschaftsschranke im Urheberrecht beschäftigt. Das 340 Seiten starke Ergebnis liegt nun vor und ist erfreulicherweise auch im Volltext zugänglich (PDF)."
http://durantaye.rewi.hu/doc/Wissenschaftsschranke.pdf
"Ein gutes Jahre lang hat sich Katharina de la Durantaye, Juniorprofessorin für Bürgerliches Recht und Rechtsvergleichung an der Humboldt-Universität zu Berlin, mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) eingehend mit der Bildungs- und Wissenschaftsschranke im Urheberrecht beschäftigt. Das 340 Seiten starke Ergebnis liegt nun vor und ist erfreulicherweise auch im Volltext zugänglich (PDF)."
http://durantaye.rewi.hu/doc/Wissenschaftsschranke.pdf
KlausGraf - am Donnerstag, 24. April 2014, 21:12 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://app-in-die-geschichte.de/document/79243
Ein Download des Bilds aus dem Landeshauptarchiv Koblenz ist nicht möglich.
Ein Teilen dieses Bilds ist mit den Buttons unten nicht möglich.
Eine gemeinfreie 2-D-Reproduktion unter CC-BY-NC-SA zu stellen ist eindeutig COPYFRAUD.
http://archiv.twoday.net/search?q=copyfraud (322 Treffer)
Was soll der Schrott?
Es geht schlicht und einfach nicht an, Archiven die Wahl der CC-Lizenz für Inhalte freizustellen, die gemeinfrei sind oder an denen das Archiv die Rechte nicht besitzt. Besitzt das Archiv entsprechende Rechte ist dies aus Transparenzgründen zwingend mit Nachweis bei jedem einzelnen CC-Bild zu dokumentieren.
NC ist übrigens für die Wikipedia untauglich.
CC-BY-SA bieten die Stadtarchive Koblenz und Linz am Rhein an.
Update: http://app-in-die-geschichte.de/document/79641 ist ein Bild von Wikimedia Commons, dort richtig unter Public Domain, in der App unter CC-BY-SA.
Auch das Stadtarchiv Koblenz hat übrigens NC-Bilder, wenn diese nicht auf Commons verfügbar sind:
http://app-in-die-geschichte.de/document/79662
oder aus dem Quelltext:
http://app-in-die-geschichte.de/uploads/documents/9a4148168890ba99d4707b685d598dc8526294f1.jpeg

Ein Download des Bilds aus dem Landeshauptarchiv Koblenz ist nicht möglich.
Ein Teilen dieses Bilds ist mit den Buttons unten nicht möglich.
Eine gemeinfreie 2-D-Reproduktion unter CC-BY-NC-SA zu stellen ist eindeutig COPYFRAUD.
http://archiv.twoday.net/search?q=copyfraud (322 Treffer)
Was soll der Schrott?
Es geht schlicht und einfach nicht an, Archiven die Wahl der CC-Lizenz für Inhalte freizustellen, die gemeinfrei sind oder an denen das Archiv die Rechte nicht besitzt. Besitzt das Archiv entsprechende Rechte ist dies aus Transparenzgründen zwingend mit Nachweis bei jedem einzelnen CC-Bild zu dokumentieren.
NC ist übrigens für die Wikipedia untauglich.
CC-BY-SA bieten die Stadtarchive Koblenz und Linz am Rhein an.
Update: http://app-in-die-geschichte.de/document/79641 ist ein Bild von Wikimedia Commons, dort richtig unter Public Domain, in der App unter CC-BY-SA.
Auch das Stadtarchiv Koblenz hat übrigens NC-Bilder, wenn diese nicht auf Commons verfügbar sind:
http://app-in-die-geschichte.de/document/79662
oder aus dem Quelltext:
http://app-in-die-geschichte.de/uploads/documents/9a4148168890ba99d4707b685d598dc8526294f1.jpeg

KlausGraf - am Donnerstag, 24. April 2014, 20:41 - Rubrik: Archivrecht
http://www.cmshs-bloggt.de/gewerblicher-rechtsschutz/einfacher-und-moderner-das-neue-designgesetz/
Das ehemalige Geschmacksmustergesetz heißt jetzt Designschutzgesetz:
http://www.gesetze-im-internet.de/geschmmg_2004/BJNR039010004.html
Geschützt (da auch in Archivalia serifenlos):
NOR
DER
NEY
http://www.cmshs-bloggt.de/gewerblicher-rechtsschutz/designschutz-fuer-die-gestaltung-von-schriftzuegen/
BUNDESP
ATENTG
ERICHT
SPINNT
Das ehemalige Geschmacksmustergesetz heißt jetzt Designschutzgesetz:
http://www.gesetze-im-internet.de/geschmmg_2004/BJNR039010004.html
Geschützt (da auch in Archivalia serifenlos):
NOR
DER
NEY
http://www.cmshs-bloggt.de/gewerblicher-rechtsschutz/designschutz-fuer-die-gestaltung-von-schriftzuegen/
BUNDESP
ATENTG
ERICHT
SPINNT
KlausGraf - am Mittwoch, 23. April 2014, 22:05 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Heute, am 23. April, ist der Welttag des Buches und des Urheberrechts, 1995 eingerichtet von der UNESCO. Der niederländische Politikwissenschaftler und Autor Joost Smiers nimmt den Tag zum Anlass, über die Marktverhältnisse der Inhaltewirtschaft und Gründe für eine Abschaffung des Urheberrechts nachzudenken."
http://irights.info/nur-keine-angst-unsere-kultur-braucht-kein-urheberrecht
http://irights.info/nur-keine-angst-unsere-kultur-braucht-kein-urheberrecht
KlausGraf - am Mittwoch, 23. April 2014, 21:25 - Rubrik: Archivrecht