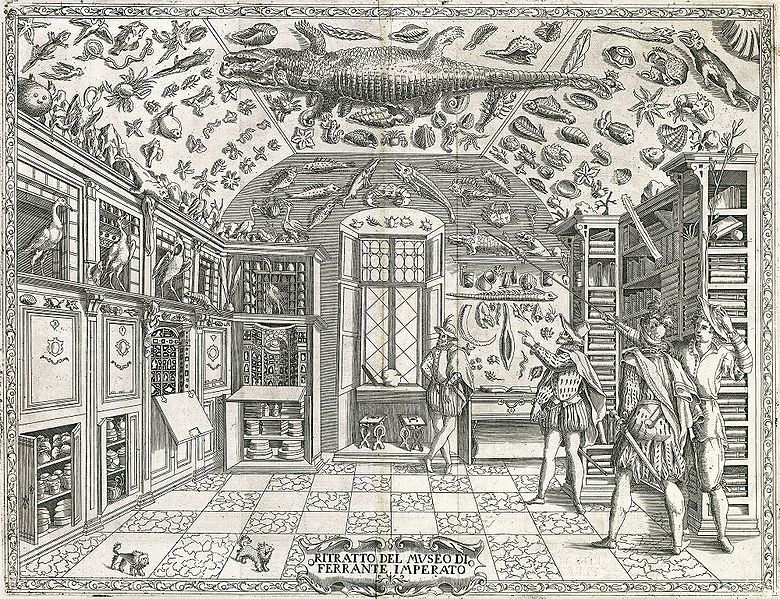Museumswesen
KlausGraf - am Samstag, 28. August 2010, 16:14 - Rubrik: Museumswesen
Das Stiftmuseum Xanten (siehe http://archiv.twoday.net/stories/6336833/ ), dieses Jahr eröffnet, ist eine überaus sehenswerte Schatzkammer sakraler Kunst. Vor allem Freunde von Paramenten kommen auf ihre Kosten.
So schön und kostbar die Stücke auch sind und die Aufmachung des Museums ansprechend, so wenig befriedigt das museumsdidaktische Konzept im Detail.
Die Texte sind vergleichsweise lang und in zu kleiner Schrift gehalten. Eine seltene Ausnahme ist die Tafel zur Viktorstracht, auf der ein sehr langes Zitat nicht besonders optisch hervorgehoben wird. Sonst fehlen aber Übersichtsinformationen, etwa zur Stiftsbibliothek, von der man im letzten Raum diverse Cimelien bewundern darf. Außerdem hat man einen Blick auf die eindrucksvollen Bücherwände. Ein Unding ist es, dass man die jeweilige Datierung nur in winziger Schrift bei den Objekten vermerkt hat - sie ist für die historische Einordnung zentral und darf unter keinen Umständen optisch so an den Rand gedrängt werden!
Eine Archivalien-Collage bleibt ganz ohne Erläuterungen, man steht davor und bestaunt allerlei Schriftgut. Dieser Raum ist abgedunkelt, während andere Archivalien in einem Raum präsentiert werden, der teilweise von Tageslicht beleuchtet wird. Keine Archivalien in eine Dauerausstellung, lautete früher die Devise. Ich möchte daher nicht ausschließen, dass die Präsentation der Archivalien in Raum IV aus Gründen der Bestandserhaltung bedenklich ist.
Ein Reinfall ist die Website des Museums: http://www.stiftsmuseum-xanten.de/index.php Sie befindet sich seit Mai "im Aufbau" und zeigt nicht das mindeste, was einen nach Xanten locken könnte. Der Katalog ist gut und mit 20 Euro nicht zu teuer, aber das ist im digitalen Zeitalter nicht mehr das Non-Plus-Ultra. Wer es als Museumsmensch nicht kapiert hat, dass man auf seiner Internetseite (mindestens) durch einige ausgewählte Bilder in guter Qualität Lust machen sollte, den Musentempel aufzusuchen, hat nichts verstanden.
***
Aus archivischer Sicht besonders spannend sind - in der Ausstellung auf zwei Räume verteilte - bemalte Urkundenladen, die Urkunden über Gebetsverbrüderungen enthielten. Unverständlich ist, wieso nicht einmal im Katalog ein Querverweis erfolgt.
Die ältere zeigt die Madonna und barg die Verbrüderungen mit den Weseler Kartäusern (1441). Die jüngere Urkundenlade von 1460 enthielt die Verbrüderung mit den Kamper Zisterziensern. Hier steht der hl. Bernhard von Clairvaux im Mittelpunkt. Die besondere Eigenart dieser raren Stücke wird vom Katalog (S. 84f., 149) übergangen, der bei diesen Stücken patzt (weil er das Stück mit kunsthistorischen Scheuklappen betrachtet). Dass es noch eine weitere (nicht ausgestellte) Lade von 1535 (Verbrüderung mit den Kreuzherren von Marienfrede) gibt und dass es sich um die "bisher einzig bekannten Gebetwsverbrüderungsladen" überhaupt handelt, erfährt man nicht aus dem Katalog, sondern aus dem (in einer örtlichen Buchhandlung im modernen Antiquariat für 9,95 Euro erhältlichen) Buch von Udo Grote, Der Schatz von St. Viktor, 1998, S. 161.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xanten_verbruederung_kamp.jpg
So schön und kostbar die Stücke auch sind und die Aufmachung des Museums ansprechend, so wenig befriedigt das museumsdidaktische Konzept im Detail.
Die Texte sind vergleichsweise lang und in zu kleiner Schrift gehalten. Eine seltene Ausnahme ist die Tafel zur Viktorstracht, auf der ein sehr langes Zitat nicht besonders optisch hervorgehoben wird. Sonst fehlen aber Übersichtsinformationen, etwa zur Stiftsbibliothek, von der man im letzten Raum diverse Cimelien bewundern darf. Außerdem hat man einen Blick auf die eindrucksvollen Bücherwände. Ein Unding ist es, dass man die jeweilige Datierung nur in winziger Schrift bei den Objekten vermerkt hat - sie ist für die historische Einordnung zentral und darf unter keinen Umständen optisch so an den Rand gedrängt werden!
Eine Archivalien-Collage bleibt ganz ohne Erläuterungen, man steht davor und bestaunt allerlei Schriftgut. Dieser Raum ist abgedunkelt, während andere Archivalien in einem Raum präsentiert werden, der teilweise von Tageslicht beleuchtet wird. Keine Archivalien in eine Dauerausstellung, lautete früher die Devise. Ich möchte daher nicht ausschließen, dass die Präsentation der Archivalien in Raum IV aus Gründen der Bestandserhaltung bedenklich ist.
Ein Reinfall ist die Website des Museums: http://www.stiftsmuseum-xanten.de/index.php Sie befindet sich seit Mai "im Aufbau" und zeigt nicht das mindeste, was einen nach Xanten locken könnte. Der Katalog ist gut und mit 20 Euro nicht zu teuer, aber das ist im digitalen Zeitalter nicht mehr das Non-Plus-Ultra. Wer es als Museumsmensch nicht kapiert hat, dass man auf seiner Internetseite (mindestens) durch einige ausgewählte Bilder in guter Qualität Lust machen sollte, den Musentempel aufzusuchen, hat nichts verstanden.
***
Aus archivischer Sicht besonders spannend sind - in der Ausstellung auf zwei Räume verteilte - bemalte Urkundenladen, die Urkunden über Gebetsverbrüderungen enthielten. Unverständlich ist, wieso nicht einmal im Katalog ein Querverweis erfolgt.
Die ältere zeigt die Madonna und barg die Verbrüderungen mit den Weseler Kartäusern (1441). Die jüngere Urkundenlade von 1460 enthielt die Verbrüderung mit den Kamper Zisterziensern. Hier steht der hl. Bernhard von Clairvaux im Mittelpunkt. Die besondere Eigenart dieser raren Stücke wird vom Katalog (S. 84f., 149) übergangen, der bei diesen Stücken patzt (weil er das Stück mit kunsthistorischen Scheuklappen betrachtet). Dass es noch eine weitere (nicht ausgestellte) Lade von 1535 (Verbrüderung mit den Kreuzherren von Marienfrede) gibt und dass es sich um die "bisher einzig bekannten Gebetwsverbrüderungsladen" überhaupt handelt, erfährt man nicht aus dem Katalog, sondern aus dem (in einer örtlichen Buchhandlung im modernen Antiquariat für 9,95 Euro erhältlichen) Buch von Udo Grote, Der Schatz von St. Viktor, 1998, S. 161.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xanten_verbruederung_kamp.jpg
KlausGraf - am Freitag, 27. August 2010, 00:41 - Rubrik: Museumswesen
" .... Der Barkenhoff, einst Wohnsitz und Arbeitsplatz des Jugendstilkünstlers Heinrich Vogeler, soll ein Archiv, eine Bibliothek sowie Räume für Sonderausstellungen bekommen.
Auch die "Große Kunstschau" wird modernisiert. Der von Bernhard Hoetger im Jahr 1927 erbaute Teil wurde bereits vor drei Jahren in originalen Farben restauriert. Hier hängen Meisterwerke der Gründer der Künstlerkolonie. Jetzt soll ein großzügiges Museum daraus werden, das die heute gültigen Standards erfüllt.
Außerdem soll ein Leitsystem mit Informationszentrum die Besucher zu den wichtigsten Museen führen: Angefangen bei der Großen Kunstschau, von dort weiter zum Barkenhoff, dann zum Haus im Schluh und zum Schluss zur Worpsweder Kunsthalle. Das Gesamtbild des Ortes soll stärker hervorgehoben werden, sagt Matthias Jäger vom Museumsverbund. ....."
Quelle: Deutschlandradio, Fazit v. 5.8.2010
Auch die "Große Kunstschau" wird modernisiert. Der von Bernhard Hoetger im Jahr 1927 erbaute Teil wurde bereits vor drei Jahren in originalen Farben restauriert. Hier hängen Meisterwerke der Gründer der Künstlerkolonie. Jetzt soll ein großzügiges Museum daraus werden, das die heute gültigen Standards erfüllt.
Außerdem soll ein Leitsystem mit Informationszentrum die Besucher zu den wichtigsten Museen führen: Angefangen bei der Großen Kunstschau, von dort weiter zum Barkenhoff, dann zum Haus im Schluh und zum Schluss zur Worpsweder Kunsthalle. Das Gesamtbild des Ortes soll stärker hervorgehoben werden, sagt Matthias Jäger vom Museumsverbund. ....."
Quelle: Deutschlandradio, Fazit v. 5.8.2010
Wolf Thomas - am Donnerstag, 12. August 2010, 18:37 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Briefe Max Liebermanns sind wichtige Dokumente für die Kunstgeschichts- und Geschichtsforschung, die bedeutende Äußerungen über seine Kunst, über die Berliner Secession, die Akademie der Künste, die zeitgenössische Kunstdiskussion und die Berliner Gesellschaft der Zeit zwischen 1890 und 1935 enthalten.
Anlässlich des 100jährigen Jubiläums der Liebermann-Villa im Jahr 2010 hat sich die Max-Liebermann-Gesellschaft Berlin das Ziel gesetzt, die Briefe des Künstlers wissenschaftlich zu erforschen und als historisch-kritische Gesamtedition herauszugeben.
In Kooperation mit dem Verfasser des Liebermann-Werksverzeichnisses, Prof. Dr. Matthias Eberle (Kunsthochschule Berlin-Weißensee) und Dr. Martin Faass (Liebermann-Villa am Wannsee) wird der Dresdener Liebermann-Spezialist Ernst Volker Braun die Künstlerbriefe bearbeiten. Dabei wird er vom wissenschaftlichen Beirat der Liebermann-Villa am Wannsee unterstützt.
Ab Mai 2011 soll jährlich ein Band der auf insgesamt acht Bände ausgelegten Briefedition im Deutschen Wissenschaftsverlag (DWV) erscheinen und auch im Buchhandel erhältlich sein.Das Projekt durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Hermann Reemtsma Stiftung ermöglicht.
Bitte treten Sie mit uns in Kontakt, wenn Sie durch Liebermann-Autographen oder anderes Quellenmaterial die Briefedition unterstützen können.
Projektstelle Liebermann-Briefedition
Simone Schweers
Tel.: 030-805 85 90 12
Email briefedition@liebermann-villa.de
Quelle: Homepage der Liebermann Villa
Anlässlich des 100jährigen Jubiläums der Liebermann-Villa im Jahr 2010 hat sich die Max-Liebermann-Gesellschaft Berlin das Ziel gesetzt, die Briefe des Künstlers wissenschaftlich zu erforschen und als historisch-kritische Gesamtedition herauszugeben.
In Kooperation mit dem Verfasser des Liebermann-Werksverzeichnisses, Prof. Dr. Matthias Eberle (Kunsthochschule Berlin-Weißensee) und Dr. Martin Faass (Liebermann-Villa am Wannsee) wird der Dresdener Liebermann-Spezialist Ernst Volker Braun die Künstlerbriefe bearbeiten. Dabei wird er vom wissenschaftlichen Beirat der Liebermann-Villa am Wannsee unterstützt.
Ab Mai 2011 soll jährlich ein Band der auf insgesamt acht Bände ausgelegten Briefedition im Deutschen Wissenschaftsverlag (DWV) erscheinen und auch im Buchhandel erhältlich sein.Das Projekt durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Hermann Reemtsma Stiftung ermöglicht.
Bitte treten Sie mit uns in Kontakt, wenn Sie durch Liebermann-Autographen oder anderes Quellenmaterial die Briefedition unterstützen können.
Projektstelle Liebermann-Briefedition
Simone Schweers
Tel.: 030-805 85 90 12
Email briefedition@liebermann-villa.de
Quelle: Homepage der Liebermann Villa
Wolf Thomas - am Sonntag, 1. August 2010, 18:31 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://heinemann.gnm.de
Die Datenbank Galerie Heinemann online ermöglicht Recherchen zum Kunsthandel der Münchner Galerie Heinemann (1872-1939), schwerpunktmäßig für den Zeitraum von 1890 bis 1939. Sie erschließt Informationen zu rund 43.500 bedeutenden Gemälden aller Epochen sowie zu etwa 13.000 mit ihrem Erwerb beziehungsweise Verkauf verbundenen Personen und Institutionen.
Grundlage der Datenbank sind die Geschäftsbücher und die Karteien der Galerie, die sich im Deutschen Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg, befinden, sowie die Kataloge und Fotografien, die im Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München, aufbewahrt werden.
In der Datenbank bildet das einzelne Kunstwerk die oberste Hierarchieebene. Mit den Informationen zum Kunstwerk sind weitere Angaben zu Künstlern, Kunden sowie An- und Verkäufen verknüpft. Neben den transkribierten wichtigsten Inhalten werden zusätzlich alle Scans der zugrunde liegenden Dokumente angeboten.
Teilweise mit Abbildungen.
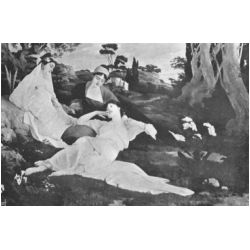 Lebiedzki, Eduard (1862-1915)
Lebiedzki, Eduard (1862-1915)
Sakuntala - Die drei Grazien
Die Datenbank Galerie Heinemann online ermöglicht Recherchen zum Kunsthandel der Münchner Galerie Heinemann (1872-1939), schwerpunktmäßig für den Zeitraum von 1890 bis 1939. Sie erschließt Informationen zu rund 43.500 bedeutenden Gemälden aller Epochen sowie zu etwa 13.000 mit ihrem Erwerb beziehungsweise Verkauf verbundenen Personen und Institutionen.
Grundlage der Datenbank sind die Geschäftsbücher und die Karteien der Galerie, die sich im Deutschen Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg, befinden, sowie die Kataloge und Fotografien, die im Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München, aufbewahrt werden.
In der Datenbank bildet das einzelne Kunstwerk die oberste Hierarchieebene. Mit den Informationen zum Kunstwerk sind weitere Angaben zu Künstlern, Kunden sowie An- und Verkäufen verknüpft. Neben den transkribierten wichtigsten Inhalten werden zusätzlich alle Scans der zugrunde liegenden Dokumente angeboten.
Teilweise mit Abbildungen.
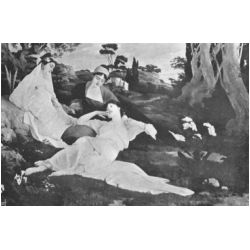 Lebiedzki, Eduard (1862-1915)
Lebiedzki, Eduard (1862-1915)Sakuntala - Die drei Grazien
KlausGraf - am Freitag, 30. Juli 2010, 03:22 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 22. Juli 2010, 22:24 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 15. Juli 2010, 16:08 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.damals.de/de/4/news.html?aid=189859&action=showDetails
http://www.gnm.de/mythos-burg/
http://www.damals.de/de/13/Titelthema.html
http://www.gnm.de/mythos-burg/
http://www.damals.de/de/13/Titelthema.html
KlausGraf - am Freitag, 9. Juli 2010, 01:37 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 7. Juli 2010, 21:56 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Raumentwurf Schiel Projektgesellschaft
"Auf einem Baustellenevent präsentierte das Computerspiele Museum am 2.7.2010 den Standort und das Konzept seiner künftigen Dauerausstellung.
Ende des Jahres 2010 lädt das Museum im Berliner Szenebezirk Friedrichshain zu einer faszinierenden Zeitreise zum spielenden Menschen des 21. Jahrhunderts ein. In einer Spiel- und Experimentierlandschaft wird dann die Technik- und Kulturgeschichte des Computerspiels erlebbar. Auf 13 erfolgreiche Museumsjahre verwies Dr. Klaus Spieler, Geschäftsführer der gameshouse gGmbH, Betreibergesellschaft der künftigen Ausstellung in seiner Begrüßung am neuen Standort: „Wir freuen uns sehr, dass wir dank der Unterstützung Berlins in der Lage sind, mit einer neuen ständigen Ausstellung das Medium Computerspiel einem großen Publikum in all seiner Vielfalt näher bringen zu können.“ Das Medium ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem der interessantesten Kultur- und Wirtschaftsgüter unserer Zeit entwickelt. In diesem Sinne würdigte Staatssekretärin Barbara Kisseler, Chefin der Berliner Senatskanzlei, die kommende Ausstellung am Medienstandort Berlin-Brandenburg in ihrem Grußwort auf der Baustelle.
„Durch vielfältige Formen der Interaktion wird für den Besucher in der Ausstellung ein grundlegender Wandel unserer Kommunikation erlebbar, der ja im Grunde den historischen Umbrüchen nach der Erfindung des Buchdrucks oder der Nutzung von Technologien zur Produktion des bewegten Bildes gleicht“, so Andreas Lange, Direktor des Museums und Kurator der Ausstellung.
Schirmherr der Ausstellung ist der Vater der Heimvideospiele, Ralph H. Baer. Auch der Atari-Gründer Nolan Bushnell sicherte bereits seine Unterstützung bei einem Treffen mit Andreas Lange nur zwei Tage vor dem Kick-off Event am Rande der Lara Award Verleihung in Köln zu. Dabei wünschte er dem Museum in Form einer signierten Atari Konsole "Good luck on your new opening!".
Standort der Ausstellung wird das ehemalige „Café Warschau“, Karl-Marx-Allee 93a, gut erreichbar für Berliner und Touristen. Unmittelbar am Eingang der künftigen Ausstellung befindet sich die U-Bahn Station Weberwiese (U 5, drei Stationen von Alexanderplatz), auch vom Ostbahnhof wird die Ausstellung gut zu erreichen sein (Fußweg ca. 10 Minuten). Im Kreuzpunkt der Bezirke Mitte, Friedrichshain/Kreuzberg, Prenzlauer Berg bietet sich hier auf rund 500 m2 Ausstellungsfläche die Möglichkeit, die Kulturgeschichte des Mediums Computerspiel zu schreiben. Teile der Innenräume, wie ein Glasmosaik im Eingangsbereich, und das gesamte 1999 sanierte Gebäude stehen unter Denkmalschutz.
Für Berlin und den Bezirk entsteht in der Karl-Marx-Allee ein touristisches Highlight mit hoher Alleinstellung in der Stadt, das vor allem junges Publikum, Familien und Touristen aus aller Welt in die Allee führen wird. Neben Galerien und Theatern finden sich in der Allee zahlreiche gastronomische Einrichtungen, die im Zusammenspiel mit der Dauerausstellung viele Synergien erwarten lassen. Das attraktive Konzept der Ausstellung und diese touristischen Effekte überzeugten, so Lutz Dessau, der für den Vermieter, die Predac Immobilien Fonds GmbH, auf dem Kick-Off die Geschichte des neuen Museumsstandortes skizzierte.
Schiel Projektgesellschaft übernimmt Gestaltung und Umsetzung der Dauerausstellung
Die Schiel Projektgesellschaft ist als Sieger aus einem Bewerbungsverfahren hervorgegangen und übernimmt die Gestaltung und Umsetzung der neuen Dauerausstellung des Computerspiele Museums. Die Schiel Projektgesellschaft mbH ist ein seit 2004 bestehendes, interdisziplinär arbeitendes Planungsbüro für Ausstellungen und temporäre Architektur. Das Büro übernahm bislang Konzeption, Planung und Realisation zahlreicher temporärer Schauen und Dauerausstellungen für namhafte Museen in ganz Deutschland. Dazu zählen u.a. das Neue Museum auf der Berliner Museumsinsel, das Museum für Naturkunde Berlin, das Deutsche Technikmuseum Berlin, das LVR Landesmuseum Bonn oder das Hessische Landesmuseum Darmstadt.
„Mit der Generalplanung des Computerspiele Museums übernimmt die Schiel Projektgesellschaft mbH ein weiteres spannendes Ausstellungsprojekt in Berlin und freut sich sehr, gemeinsam mit Museum und Partnern die Kulturgeschichte des Computerspiels zu pixeln“, so Daniel Schiel, Geschäftsführer der Projektgesellschaft.
Das Projektmanagement und die Vorbereitung des Ausstellungsbetriebs wird von der x:hibit GmbH übernommen. Dieses Dienstleistungsunternehmen entwickelt und realisiert seit 1999 Ausstellungen, Besucherdienste und Merchandising für museale Institutionen und private Auftraggeber. Zu den Auftraggebern von x:hibit zählten u.a. die documenta, die Staatlichen Museen zu Berlin, die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, die Stiftung Bauhaus Dessau und das Museum Folkwang in Essen. Seit 2008 betreibt x:hibit das Museumportal, den ersten gemeinsamen Webauftritt der Berliner Museen.
Die Konzeptentwicklung zur Ausstellung wurde vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert. Die Einrichtung der Ausstellung wird gefördert von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie und EFRE. Betreibergesellschaft der Ausstellung ist die gameshouse gGmbH."
Quelle: Computerspielemuseum Berlin, Pressemitteilung 5.7.2010
Wolf Thomas - am Dienstag, 6. Juli 2010, 21:00 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen