Veranstaltungen
"Die UN-Vollversammlung hat den 20. Juni eines jeden Jahres zum zentralen Gedenktag für Flüchtlinge ausgerufen. Einen Tag später wird an der Hochschule Fulda das Archiv der Forschungsgesellschaft für Flucht und Migration (FFM) eröffnet.
Bei den Dokumenten im FFM-Archiv handelt es sich überwiegend um “graue” Literatur, die in den etablierten Bibliotheken und Instituten nicht zu finden ist, und um Schlüssel- und Hintergrundtexte zur internationalen Migrations- und Flüchtlingspolitik. Der Bestand umfasst den Zeitraum von den 1980er Jahren bis 2004. Der Schwerpunkt liegt auf den Jahren 1996 bis 2001.
Die Forschungsgesellschaft Flucht und Migration (FFM) gründete sich 1994. Sie recherchierte und veröffentlichte zur Situation von Flüchtlingen und MigrantInnen sowie zur Abschottungs- und Lagerpolitik an den EU-Außengrenzen. Bezugspunkt für das Archiv der FFM sind die Interessen und Rechte von Flüchtlingen und MigrantInnen und damit einhergehend die kritische Auseinandersetzung mit staatlicher Migrations- und Flüchtlingspolitik. Dabei werden Gründe für Flucht und Migration grundsätzlich respektiert.
Veranstalter:
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften
Veranstaltungsort:
Hochschule Fulda, Geb. P, Raum 022
Anfang:
Di, Jun 21, 2011 um 18:00 Uhr
Programm
Eröffnung durch Prof. Dr. Gudrun Hentges,
Prodekanin des Fachbereichs Sozial- und Kulturwissenschaften der Hochschule Fulda
Grußworte Berthold Weiß, Stellvertretender Leiter der Hochschul- und Landesbibliothek Hochschule Fulda
Helmut Dietrich, Mitbegründer und Mitarbeiter der Forschungsgesellschaft Flucht und Migration (FFM)
Lesung Sabrina Freyer, Eine kleine Lesung von Texten aus dem Archiv zur „Kostprobe“
Besichtigung der Räumlichkeiten des Archivs, Gebäude P, Raum -113
...."
Quelle: Hochschule Fulda, Termine
Bei den Dokumenten im FFM-Archiv handelt es sich überwiegend um “graue” Literatur, die in den etablierten Bibliotheken und Instituten nicht zu finden ist, und um Schlüssel- und Hintergrundtexte zur internationalen Migrations- und Flüchtlingspolitik. Der Bestand umfasst den Zeitraum von den 1980er Jahren bis 2004. Der Schwerpunkt liegt auf den Jahren 1996 bis 2001.
Die Forschungsgesellschaft Flucht und Migration (FFM) gründete sich 1994. Sie recherchierte und veröffentlichte zur Situation von Flüchtlingen und MigrantInnen sowie zur Abschottungs- und Lagerpolitik an den EU-Außengrenzen. Bezugspunkt für das Archiv der FFM sind die Interessen und Rechte von Flüchtlingen und MigrantInnen und damit einhergehend die kritische Auseinandersetzung mit staatlicher Migrations- und Flüchtlingspolitik. Dabei werden Gründe für Flucht und Migration grundsätzlich respektiert.
Veranstalter:
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften
Veranstaltungsort:
Hochschule Fulda, Geb. P, Raum 022
Anfang:
Di, Jun 21, 2011 um 18:00 Uhr
Programm
Eröffnung durch Prof. Dr. Gudrun Hentges,
Prodekanin des Fachbereichs Sozial- und Kulturwissenschaften der Hochschule Fulda
Grußworte Berthold Weiß, Stellvertretender Leiter der Hochschul- und Landesbibliothek Hochschule Fulda
Helmut Dietrich, Mitbegründer und Mitarbeiter der Forschungsgesellschaft Flucht und Migration (FFM)
Lesung Sabrina Freyer, Eine kleine Lesung von Texten aus dem Archiv zur „Kostprobe“
Besichtigung der Räumlichkeiten des Archivs, Gebäude P, Raum -113
...."
Quelle: Hochschule Fulda, Termine
Wolf Thomas - am Dienstag, 14. Juni 2011, 22:01 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Von 1949 bis 1961 wurden in Göttingen Spielfime produziert. Mit einer Ausstellung von 63 Original-Filmplakaten erinnert das Stadtarchiv demnächst an die Jahre, als Göttingen eine Filmstadt war. Die Ausstellung, in der auch Exponate des Kulturarchivs Hannover gezeigt werden, ist ab dem 10. Juni 2011 bis zum Jahresende zu sehen. Der Eintritt ist frei! " 1)
"An die aufregende Zeit der „Filmaufbau GmbH Göttingen“ soll mit der Ausstellung „Traumfabrik an der Leine: Göttinger Filmplakate“ erinnert werden. Die Präsentation wird am Donnerstag, 9. Juni 2011, um 16.30 Uhr im Stadtarchiv eröffnet .....
Im Jahr 1945 gründeten Rolf Thiele und Hans Abich die Filmaufbau GmbH Göttingen und machten die Stadt in den 50er Jahren zur „Traumfabrik an der Leine“. Im Studio der Filmaufbau auf dem Gelände des ehemaligen Wehrmachtsflugplatzes zwischen Grone und Holtensen wurden in den Jahren von 1949 bis 1961 über einhundert Spielfilme gedreht, darunter so bekannte Streifen wie „Liebe 47“, „Das Haus in Montevideo“, „Königliche Hoheit“ und „Rosen für den Staatsanwalt“." 2)
1) Stadtarchiv Göttingen, Homepage
2) Stadt Göttingen, Homepage
(T)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 2. Juni 2011, 18:03 - Rubrik: Veranstaltungen
Dazu ein Gespräch mit Dr. Jens Riederer, dem Vorsitzenden des VdA-Landesverbands Thüringen, in der Online-Ausgabe der Mitteldeutschen Zeitung vom 01.06.2011:
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1306905184541
Den erstmals vergebenen Thüringer Archivpreis erhielt das Thüringer Archiv für Zeitgeschichte «Matthias Domaschk» Jena:
http://www.dnews.de/nachrichten/thuringen/525730/preis-jenaer-archiv-ddr-widerstand.html
(ML)
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1306905184541
Den erstmals vergebenen Thüringer Archivpreis erhielt das Thüringer Archiv für Zeitgeschichte «Matthias Domaschk» Jena:
http://www.dnews.de/nachrichten/thuringen/525730/preis-jenaer-archiv-ddr-widerstand.html
(ML)
ingobobingo - am Mittwoch, 1. Juni 2011, 16:26 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das documenta Archiv feiert am 28. Mai sein 50-jähriges Bestehen.
Für die Festveranstaltung im Schauspielhaus konnten wir die international renommierte documenta-Künstlerin Laurie Anderson (documenta 6 und 8, 1977 und 1987) gewinnen, sie wird ihre neueste Produktion "DELUSION" präsentieren. Laurie Anderson war wegweisend für den Musikbereich, aber auch für die gängigen Grenzen sprengende "Video-Performance-Kunst" der 70-er und 80-er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Spätestens 1981 ist Laurie Anderson durch "O Superman" für ihren innovativen Einsatz von Computertechnik und neuen Medien, besonders aber für ihre "elektronische Violine" bekannt geworden.
Die Performance "DELUSION" wird von ihr als eine Meditation über Leben und Sprache angekündigt und entwickelt sich aus unterschiedlichen Welten und Ebenen: Technik, Wissenschaft, Traum und verschiedenen Bewusstseinszuständen. Die darin erzählten Geschichten bewegen sich zwischen mystischen Anfängen und russischem Weltraumprogramm und erzählen von Zeit, Geschwindigkeit, Ahnen, Kontrolle, Stille und Tieren.
Neben diesen zwei Veranstaltungen - am 28. und 29. Mai im Schauspielhaus des Staatstheaters Kassel - wird die Künstlerin auch an der Tagung "Video- und Performancekunst, Laurie Anderson eine Pionierin" in der nahegelegenen Ev. Akademie Hofgeismar beteiligt sein (27.-29.05.2011). Im Vorfeld dazu werden am 26.05.2011 frühe Videos von ihr in den BALi Kinos, Kassel gezeigt.
Hintergrund für diese Form des Jubiläumsprogramms ist auch der Abschluss des Digitalisierungsprojektes "mediaartbase.de", das von den Kulturstiftungen des Bundes und der Länder initiiert wurde. Im Rahmen dieses 3-jährigen, gemeinsam mit dem Kasseler DOKFEST, dem ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe und dem European Media Art Festival (EMAF), Osnabrück durchgeführten Pilotprojekts sind jetzt die seltenen, sehr gefährdeten Bestände dieser Institutionen digitalisiert worden.
Dazu gehören aus Kassel insbesondere documenta-Beiträge, die die Video- und Performancekunst der 70-er und 80-er Jahre zeigen sowie die zahlreichen Fernsehmitschnitte des Hessischen Rundfunks. Das Kasseler Dokfest hat in diesem Rahmen die Beiträge des Kasseler Dokumentarfilm- und Videofestes erfasst.
26.05.2011: Filmreihe zu Laurie Anderson
BALiKino, Eintrittspreis: 6 Euro, ermäßigt 5,50 Euro.
Spielzeiten werden noch bekanntgegeben
27. - 29.05.2011: Tagung "Video- und PerformanceKunst Laurie Anderson eine Pionierin"
Evangelische Akademie Hofgeismar
Leitung: Karin Stengel, Kassel und Dr. Heike Radeck, Hofgeismar
Tagungsbeitrag: 80 € (zuzüglich Eintrittskarte für 20 €)
28.05.2011:
18:00 Uhr Jubiläumsfeier Staatstheater (Schauspielhaus)
19.00 Uhr Empfang
20:00 Uhr Performance von Laurie Anderson "DELUSION"
29.05.2011:
20:00 Uhr Performance von Laurie Anderson "DELUSION"
Kartenvorverkauf im Staatstheater Kassel: 0561/1094-333
Preisstaffelung: 16 €, 28 €, 35 € und 45 € "
documenta Archiv, Aktuelles
(T)
Für die Festveranstaltung im Schauspielhaus konnten wir die international renommierte documenta-Künstlerin Laurie Anderson (documenta 6 und 8, 1977 und 1987) gewinnen, sie wird ihre neueste Produktion "DELUSION" präsentieren. Laurie Anderson war wegweisend für den Musikbereich, aber auch für die gängigen Grenzen sprengende "Video-Performance-Kunst" der 70-er und 80-er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Spätestens 1981 ist Laurie Anderson durch "O Superman" für ihren innovativen Einsatz von Computertechnik und neuen Medien, besonders aber für ihre "elektronische Violine" bekannt geworden.
Die Performance "DELUSION" wird von ihr als eine Meditation über Leben und Sprache angekündigt und entwickelt sich aus unterschiedlichen Welten und Ebenen: Technik, Wissenschaft, Traum und verschiedenen Bewusstseinszuständen. Die darin erzählten Geschichten bewegen sich zwischen mystischen Anfängen und russischem Weltraumprogramm und erzählen von Zeit, Geschwindigkeit, Ahnen, Kontrolle, Stille und Tieren.
Neben diesen zwei Veranstaltungen - am 28. und 29. Mai im Schauspielhaus des Staatstheaters Kassel - wird die Künstlerin auch an der Tagung "Video- und Performancekunst, Laurie Anderson eine Pionierin" in der nahegelegenen Ev. Akademie Hofgeismar beteiligt sein (27.-29.05.2011). Im Vorfeld dazu werden am 26.05.2011 frühe Videos von ihr in den BALi Kinos, Kassel gezeigt.
Hintergrund für diese Form des Jubiläumsprogramms ist auch der Abschluss des Digitalisierungsprojektes "mediaartbase.de", das von den Kulturstiftungen des Bundes und der Länder initiiert wurde. Im Rahmen dieses 3-jährigen, gemeinsam mit dem Kasseler DOKFEST, dem ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe und dem European Media Art Festival (EMAF), Osnabrück durchgeführten Pilotprojekts sind jetzt die seltenen, sehr gefährdeten Bestände dieser Institutionen digitalisiert worden.
Dazu gehören aus Kassel insbesondere documenta-Beiträge, die die Video- und Performancekunst der 70-er und 80-er Jahre zeigen sowie die zahlreichen Fernsehmitschnitte des Hessischen Rundfunks. Das Kasseler Dokfest hat in diesem Rahmen die Beiträge des Kasseler Dokumentarfilm- und Videofestes erfasst.
26.05.2011: Filmreihe zu Laurie Anderson
BALiKino, Eintrittspreis: 6 Euro, ermäßigt 5,50 Euro.
Spielzeiten werden noch bekanntgegeben
27. - 29.05.2011: Tagung "Video- und PerformanceKunst Laurie Anderson eine Pionierin"
Evangelische Akademie Hofgeismar
Leitung: Karin Stengel, Kassel und Dr. Heike Radeck, Hofgeismar
Tagungsbeitrag: 80 € (zuzüglich Eintrittskarte für 20 €)
28.05.2011:
18:00 Uhr Jubiläumsfeier Staatstheater (Schauspielhaus)
19.00 Uhr Empfang
20:00 Uhr Performance von Laurie Anderson "DELUSION"
29.05.2011:
20:00 Uhr Performance von Laurie Anderson "DELUSION"
Kartenvorverkauf im Staatstheater Kassel: 0561/1094-333
Preisstaffelung: 16 €, 28 €, 35 € und 45 € "
documenta Archiv, Aktuelles
(T)
Wolf Thomas - am Sonntag, 29. Mai 2011, 17:01 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ausstellung in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch
von 14. Mai bis 10. Juli 2011
Gefundenes, Geborgenes, Gesammeltes ...
all das findet man in Ernst Lorchs Laboratorium zur Sicherung von Lebensspuren, und all das zieht sich wie ein roter Faden durch sein künstlerisches Schaffen.
Zeichnungen, Gemälde, Skulpturen und Installationen aus fünf Jahrzehnten geben einen Überblick über das ausgedehnte Werk.
Kontakt:
Landratsamt Sigmaringen
Stabsbereich Kultur und Archiv
Leopoldstraße 4, 72488 Sigmaringen
www.landkreis-sigmaringen.de/kreisgalerie
Film erstellt und veröffentlicht im Auftrag des Landratsamt Sigmaringen von Michael Setz
© 2011 by michaelsetz.com
(W)
Wolf Thomas - am Samstag, 28. Mai 2011, 17:45 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Tagung
des LWL-Institus für westfälische Regionalgeschichte
der LWL-Literaturkommission für Westfalen
des Westfälischen Heimatbundes
Straßennamen dienen Bewohnerinnen und Bewohnern, Besucherinnen und Besuchern eines Ortes vorrangig zur räumlichen Orientierung. Darüber hinaus sollen sie die Erinnerung wach halten, das Gedenken fördern sowie der Ehrenbezeugung dienen. Straßennamen verweisen auf die Zeit ihrer Verleihung: auf die jeweiligen Herrschaftsverhältnisse, die Kultur und den Raum. Sie sind damit sichtbarer Teil der Vergangenheitspolitik einer Stadt und ihrer Repräsentanten.
Straßenumbenennungen hingegen greifen in die Erinnerungskultur ein, indem sie einzelne Personen, Ereignisse oder Orte aus dem offiziellen Gedächtnis einer Stadt streichen. Zumeist sind solche Umbenennungen in Deutschland Folgen und Zeichen politischer Zäsuren gewesen, so während der Umbrüche 1918/19, 1933, 1945 und 1989/90. In jüngerer Zeit sind sie vor allem Ausdruck eines sich wandelnden Verständnisses und gesellschaftspolitischen Umgangs mit der NS-Diktatur, insbesondere mit Tätern und Opfern.
Die Tagung behandelt im ersten Teil die Benennungspraxis von Straßen in Westfalen und Lippe seit dem 19. Jh. und beleuchtet, ausgehend von einzelnen Personennamen, vorwiegend die Umbenennungen während der NS-Zeit und nach 1945.
Im zweiten Teil werden ausgewählte "Grenzfälle" thematisiert, deren Leben und Wirken heute kontrovers beurteilt wird und folglich Straßenumbenennungen bereits erfolgt sind oder weiterhin diskutiert werden. Die Tagung greift diese tagespolitischen Debatten auf und bietet damit ein Forum, um die lokalen Argumentations- und Umgangsweisen im Hinblick auf Straßenumbenennungen transparent zu machen.
Programm
ab 9.00 Uhr
Anmeldung im Tagungsbüro
(LWL-Landeshaus)
9.30 Uhr
Moderation der Tagung
Anke Bruns
Begrüßung und Eröffnung
Dr. Wolfgang Kirsch
Prof. Dr. Bernd Walter
10.00 Uhr
PD Dr. Rainer Pöppinghege
Politik per Stadtplan. Zur Erinnerungsfunktion von Straßennamen
10.45 - 11.15 Uhr
Kaffeepause
11.15 Uhr
Dr. Marcus Weidner
"Wir beantragen?unverzüglich umzubenennen."
Straßenumbenennungen in Westfalen und Lippe im
Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit
12.00 Uhr
Prof. Dr. Walter Gödden
Belastete westfälische Autorinnen und Autoren auf
Straßenschildern. Eine quantifizierende Analyse
13.00 - 14.00 Uhr
Mittagspause
14.00 Uhr
PD Dr. Karl Ditt
Karl Wagenfeld - Heimatdichter, Heimatfunktionär,
Nationalsozialist?
14.45 Uhr
Dr. Steffen Stadthaus
Agnes Miegel und Friedrich Castelle.
Schriftsteller als Beispiel regionaler Vergangenheitspolitik
15.30 - 15.45 Uhr
Kaffeepause
15.45 Uhr
Prof. Dr. Hans-Ulrich Thamer
Hindenburg und die Stadt Münster
16.30 Uhr
Abschlussdiskussion
gegen 17.00 Uhr
Ende der Tagung
INFO
Kontakt/Anmeldung bis zum 30.06.2011
Dr. Matthias Frese
Katharina Stütz
LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte
Karlstr. 33, 48147 Münster
Tel.: (0251) 591-5706
E-Mail: katharina.stuetz@lwl.org
Veranstaltungsdaten:
Tagung "Fragwürdige Ehrungen !? Straßennamen als Instrument von
Geschichtspolitik und Erinnerungskultur"
Datum: 12.07.2011
Plenarsaal im LWL-Landeshaus
Freiherr-vom-Stein-Platz 1
48147 Münster"
Quelle: Mailingliste "Westfälische Geschichte"
(ML)
des LWL-Institus für westfälische Regionalgeschichte
der LWL-Literaturkommission für Westfalen
des Westfälischen Heimatbundes
Straßennamen dienen Bewohnerinnen und Bewohnern, Besucherinnen und Besuchern eines Ortes vorrangig zur räumlichen Orientierung. Darüber hinaus sollen sie die Erinnerung wach halten, das Gedenken fördern sowie der Ehrenbezeugung dienen. Straßennamen verweisen auf die Zeit ihrer Verleihung: auf die jeweiligen Herrschaftsverhältnisse, die Kultur und den Raum. Sie sind damit sichtbarer Teil der Vergangenheitspolitik einer Stadt und ihrer Repräsentanten.
Straßenumbenennungen hingegen greifen in die Erinnerungskultur ein, indem sie einzelne Personen, Ereignisse oder Orte aus dem offiziellen Gedächtnis einer Stadt streichen. Zumeist sind solche Umbenennungen in Deutschland Folgen und Zeichen politischer Zäsuren gewesen, so während der Umbrüche 1918/19, 1933, 1945 und 1989/90. In jüngerer Zeit sind sie vor allem Ausdruck eines sich wandelnden Verständnisses und gesellschaftspolitischen Umgangs mit der NS-Diktatur, insbesondere mit Tätern und Opfern.
Die Tagung behandelt im ersten Teil die Benennungspraxis von Straßen in Westfalen und Lippe seit dem 19. Jh. und beleuchtet, ausgehend von einzelnen Personennamen, vorwiegend die Umbenennungen während der NS-Zeit und nach 1945.
Im zweiten Teil werden ausgewählte "Grenzfälle" thematisiert, deren Leben und Wirken heute kontrovers beurteilt wird und folglich Straßenumbenennungen bereits erfolgt sind oder weiterhin diskutiert werden. Die Tagung greift diese tagespolitischen Debatten auf und bietet damit ein Forum, um die lokalen Argumentations- und Umgangsweisen im Hinblick auf Straßenumbenennungen transparent zu machen.
Programm
ab 9.00 Uhr
Anmeldung im Tagungsbüro
(LWL-Landeshaus)
9.30 Uhr
Moderation der Tagung
Anke Bruns
Begrüßung und Eröffnung
Dr. Wolfgang Kirsch
Prof. Dr. Bernd Walter
10.00 Uhr
PD Dr. Rainer Pöppinghege
Politik per Stadtplan. Zur Erinnerungsfunktion von Straßennamen
10.45 - 11.15 Uhr
Kaffeepause
11.15 Uhr
Dr. Marcus Weidner
"Wir beantragen?unverzüglich umzubenennen."
Straßenumbenennungen in Westfalen und Lippe im
Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit
12.00 Uhr
Prof. Dr. Walter Gödden
Belastete westfälische Autorinnen und Autoren auf
Straßenschildern. Eine quantifizierende Analyse
13.00 - 14.00 Uhr
Mittagspause
14.00 Uhr
PD Dr. Karl Ditt
Karl Wagenfeld - Heimatdichter, Heimatfunktionär,
Nationalsozialist?
14.45 Uhr
Dr. Steffen Stadthaus
Agnes Miegel und Friedrich Castelle.
Schriftsteller als Beispiel regionaler Vergangenheitspolitik
15.30 - 15.45 Uhr
Kaffeepause
15.45 Uhr
Prof. Dr. Hans-Ulrich Thamer
Hindenburg und die Stadt Münster
16.30 Uhr
Abschlussdiskussion
gegen 17.00 Uhr
Ende der Tagung
INFO
Kontakt/Anmeldung bis zum 30.06.2011
Dr. Matthias Frese
Katharina Stütz
LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte
Karlstr. 33, 48147 Münster
Tel.: (0251) 591-5706
E-Mail: katharina.stuetz@lwl.org
Veranstaltungsdaten:
Tagung "Fragwürdige Ehrungen !? Straßennamen als Instrument von
Geschichtspolitik und Erinnerungskultur"
Datum: 12.07.2011
Plenarsaal im LWL-Landeshaus
Freiherr-vom-Stein-Platz 1
48147 Münster"
Quelle: Mailingliste "Westfälische Geschichte"
(ML)
Wolf Thomas - am Freitag, 27. Mai 2011, 12:03 - Rubrik: Veranstaltungen
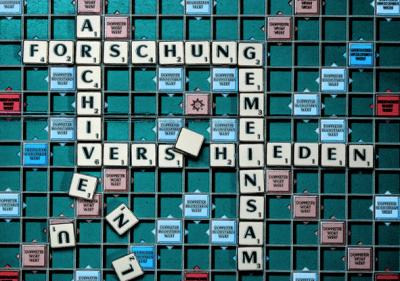
Im 19. Jahrhundert lagen die Berufsbilder des Historikers und des Archivars eng beieinander. Historiker und Archivare verstanden sich als gleichgesinnte und gleichberechtigte Partner auf der Suche nach der historischen Wahrheit. Beginnend mit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert änderte sich diese Situation. Mittlerweile ist eine Kluft zwischen Archiven und geschichtswissenschaftlicher Forschung entstanden, die bereits mehrfach konstatiert und beklagt worden ist. Geändert hat sich indes bislang wenig. Im Gegenteil: Die fachlich-professionelle Eigendynamik und knappe Ressourcen auf beiden Seiten führen eher zu einer weiteren Entfremdung als zu einer Wiederannäherung von Archiven und historischer Forschung. Infolge der Ausweitung kulturgeschichtlicher Ansätze greift die Geschichtswissenschaft heute zunehmend auf nicht-archivische Quellen zurück. Diese Quellen besitzen zudem den Vorteil, dass sie meist leichter zugänglich sind als die archivische Überlieferung. Natürlich versuchen die Archive, durch den Aufbau digitaler Infrastrukturen den Zugang zu Archivgut zu verbessern. Die damit verbundenen Aufgaben bedeuten aber eine Herausforderung, die in den Archiven kurz- bzw. mittelfristig durchaus zu Lasten des historisch-wissenschaftlichen Auswertungs- und Bildungsauftrags (und damit auch zu Lasten der archivisch-historischen Netzwerke) gehen können; die dringend gebotene Sicherung elektronischer Unterlagen verlagert darüber hinaus den Schwerpunkt der aktuellen archivischen Aufgaben auf Bestände, die erst kommenden Historiker/innen-Generationen zur Verfügung stehen.
Die Podiumsdiskussion will das Gespräch zwischen Historikern und Archivaren neu aufnehmen. Führende Vertreter des deutschen Archivwesens einerseits und des Historikerverbandes andererseits wollen die Entwicklungen der vergangenen Jahre mit Blick auf die fachlichen Methoden sowie die institutionellen Rahmenbedingungen in beiden Aufgabenbereichen analysieren und aufzeigen, welche Gefahren bestehen, wenn die Kluft weiterbesteht oder sich noch vergrößert. Für die Zukunft sollen die gegenseitigen Erwartungen der Archive und der Forschung neu abgesteckt und auf dieser Grundlage Perspektiven einer verbesserten Kooperation entwickelt werden. Das Plenum hat Gelegenheit, sich mit Fragen und eigenen Statements in die Diskussion mit einzubringen.
Die Ergebnisse der Podiumsdiskussion sollen im Spätherbst des Jahres in Heft 4/2011 der Zeitschrift ARCHIVAR veröffentlicht werden.
Programm
Beginn: 10:30 Uhr
Dr. Evelyn Brockhoff
Leitende Direktorin des Instituts für Stadtgeschichte
Frankfurt am Main
Begrüßung
Podiumsdiskussion
Die Archive und die historische Forschung
Es diskutieren:
Prof. Dr. Christoph Cornelißen, Historisches Seminar Universität Kiel, Mitglied des Ausschusses des Historikerverbandes
Prof. Dr. Dirk van Laak, Historisches Institut Universität Gießen, Mitglied des Ausschusses des Historikerverbandes
Dr. Clemens Rehm, Landesarchiv Baden-Württemberg, Erster stellvertretender Vorsitzender des VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare
Prof. Dr. Wilfried Reininghaus, Präsident des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen
Moderation
Dr. Andreas Pilger, Landesarchiv Nordrhein-Westfalen/Redaktion ARCHIVAR
Veranstaltungsort
Institut für Stadtgeschichte
Münzgasse 9
60311 Frankfurt am Main
Sie erreichen das Institut mit der U-Bahn (Linien U1 bis U5 und U8, Haltestelle „Willy-Brandt-Platz“) oder fußläufig vom Hauptbahnhof in ca. 15 min.
Die Podiumsdiskussion wird veranstaltet vom Landesarchiv Nordrhein-Westfalen und vom VdA - Verband deutscher Archivarinnen und Archivare.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Bitte melden Sie sich vorher an unter archivar@lav.nrw.de.
Kontakt
Dr. Andreas Pilger
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
Graf-Adolf-Str. 67
40210 Düsseldorf
E-Mail: archivar@lav.nrw.de
Tel. +49 211 159238-201
Andreas Pilger - am Freitag, 27. Mai 2011, 09:08 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Ob beschlagnahmte Plakate, Zensur oder abgesetzte Programme - das deutsche Kabarett hatte es in den vergangenen 110 Jahren so manches Mal mit der Justiz zu tun bekommen. Nun dokumentiert eine Ausstellung diese oft nicht so heiteren Berührungspunkte. Am 13. Mai wird die Schau "Satire und Justiz" des Deutschen Kabarettarchivs in Mainz eröffnet. Vom 16. Mai an ist sie dann für Besucher in den Räumen der Mainzer Staatsanwaltschaft zu sehen. Kabarettarchiv und Staatsanwaltschaft kündigten die Ausstellung am Donnerstag als eine "exemplarische Bildergeschichte von der Kaiserzeit bis ins 21. Jahrhundert" an. Es gehe dabei um die schwierige Beziehung zwischen der auf Eindeutigkeit und Einhaltung klarer Regeln bedachten Göttin Justitia und der auf Kunst- und Meinungsfreiheit bestehenden, ihre subjektive Weltsicht verteidigenden Satire.
Die Sonderschau aus Anlass des 50-jährigen Bestehens des Kabarettarchivs läuft bis zum 9. September 2011. "
Pressemitteilung der Landesregierung Rheinland-Pfalz, 28.4.11
Ankündigung des Kabarettarchivs
(S)
Wolf Thomas - am Samstag, 14. Mai 2011, 20:23 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Ausstellung zeigt in einem breit angelegten Spektrum die Geschichte des Waldes in Bayern vom 9. Jahrhundert bis heute. Ein weiter Bogen wird gespannt von der Rodungstätigkeit im Mittelalter bis zur Entwicklung des Ökosystems Wald unter den Rahmenbedingungen des Klimawandels. In der Ausstellung wird deutlich, dass der viel genutzte Begriff Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft stammt und bereits seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts zunehmend an Bedeutung gewann.
Holz ist ein vom Menschen seit Jahrtausenden genutzter Rohstoff. Über viele Jahrhunderte war er allgegenwärtig im täglichen Leben und Wirtschaften. Er diente als Energielieferant und wurde vielfältig verwendet, als Feuerholz, Bauholz oder als Zierobjekt. Möbel, Arbeitsgeräte, Geschirr, Besteck, Spielzeug – alltägliche Gegenstände waren oft aus Holz. Das älteste Gebäude aus Holz im Freilichtmuseum Glentleiten stammt aus dem Jahr 1507.
In zehn Kapiteln greift die Ausstellung zahlreiche Aspekte aus der Geschichte von Wald und Jagd auf: Der Wald war Lebensraum der Wildtiere und Ort des Jagdgeschehens – die adelige Jagd des Barock wird ebenso thematisiert wie die moderne Jagd und die Hege des Wildes. Gleichzeitig war der Wald die Basis für das ländliche Leben der vorindustriellen Zeit. Aus dem Wald holte die Landbevölkerung Laub und Streu, dort weideten Schweine und Rinder.
Der Wald lieferte neben Bau- und Werkholz zahlreiche Produkte des täglichen Bedarfs: Harz zum Pichen von Bierfässern oder Pottasche zur Glasherstellung.
Mit der Romantik veränderte sich der Blick auf den Wald grundlegend: Der Wald war nicht mehr ausschließlich Wildnis, Jagdrevier oder Holzlieferant, sondern wurde zum Sehnsuchtsort, zum Thema von Märchen und Mythen, zum Gegenstand von Literatur und Musik.

Ebenfalls an der Wende zum 19. Jahrhundert änderten sich in Bayern in Folge der Säkularisation die Besitzverhältnisse. Als Reaktion darauf entstanden neue Verwaltungsstrukturen und Bewirtschaftungsformen, die unser Bild von Wald, Förster und Jäger bis heute beeinflussen.
Entstehung und Entwicklung des Nationalparks Bayerischer Wald veranschaulichen die in den 1970er Jahren neu entdeckte Verantwortung für die Natur und den erwachenden Naturschutzgedanken..
Mit audiovisuellen Medien und mit ungewöhnlichen Exponaten werden die Hintergründe des Mythos Wilderei dargestellt.
Unter dem Motto »(M)ein Tag im Wald« haben sich Schüler des Gymnasiums Ottobrunn in einem P-Seminar mit ihren Vorstellungen zum Thema Wald auseinandergesetzt und einen Ausstellungsraum gestaltet. Ein Hochsitz lädt den Besucher ein, die Ausstellung von oben zu betrachten. Darum herum gruppieren sich Versuche und Mitmachstationen, die die biologischen Prozesse in einem Wald veranschaulichen."
Ausstellungsort: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Ludwigstraße 14, München
Zur Ausstellung "WaldGeschichten" erscheint ein Katalog (ISBN 978-3-938831-25-0; 20,00 Euro), der viele Exponate in Farbe wiedergibt; zur gleichzeitig zu sehenden Ausstellung "(M)ein Tag im Wald" des P-Seminars des Gymnasiums Ottobrunn erscheint eine Broschüre (ISBN 978-3-938831-26-7; 2,00 Euro).
Quelle: Homepage der Ausstellung im bayr. Archivportal
(W)
Wolf Thomas - am Montag, 9. Mai 2011, 19:10 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Westfälische Städteatlas ist Teil eines gesamteuropäischen Vorhabens der Internationalen Kommission für Städtegeschichte. Veröffentlicht wird er durch die Historische Kommission für Westfalen im Landschaftsverband Westfalen-Lippe und das Institut für vergleichende Städtegeschichte in Münster. Auf der Grundlage gemeinsamer Kriterien ist es das Ziel dieses Atlaswerkes, sämtliche Städte des heutigen Westfalen (Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold, Münster), die um 1828 den Rechtscharakter einer Stadt, eines Marktes, einer Freiheit etc. hatten, vollständig zu erfassen. Dies geschieht durch eine Kombination von bislang unveröffentlichten Quellen, historischen, aktuellen und thematischen Karten und einer wissenschaftlichen Aufarbeitung der Stadtgeschichte auf der Grundlage des neuesten Forschungsstandes.
Bisher sind 80 Städte erschienen. Die vorliegende 11. Lieferung beinhaltet die Städte Freudenberg, Horneburg (Datteln), Preußisch Oldendorf, Sundern mit Allendorf, Endorf, Hachen, Hagen und Langscheid und Wattenscheid (Bochum). Jede Stadtmappe enthält eine Reihe neu gezeichneter Karten: In erster Linie handelt sich dabei um die Urkatasterkarte der Stadt aus dem 1. Drittel des 19. Jahrhunderts (1:2500), eine zeitgleiche historische Karte ihres Umlands (1:25000) und eine moderne Stadtkarte (1:5000). Um ein dreidimensionales Bild der Stadt zu vermitteln, wird das Kartenmaterial durch alte Stadtansichten, Pläne und Luftbilder ergänzt. Zu diesem Materialkanon gehört eine zusammenfassende Darstellung der Stadtgeschichte. Neben der verfassungs-, sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Entwicklung der Stadt z. T. bis in die jüngste Vergangenheit wird darin vor allem das räumliche Wachstum der Stadt rekonstruiert, dessen Phasen auch in einer besonderen Karte farbig dargestellt werden. Der Textteil wird durch Kartenausschnitte, Zeichnungen und Fotos illustriert.
Mit Freudenberg wurde jetzt eine Atlasmappe vorgelegt, die das Thema Protoindustrialisierung aufgreift und kartographisch umsetzt. Vor 1806 gehörte die Stadt zur Grafschaft Nassau-Siegen und sicherte die Straße von Köln nach Siegen. Andreas Bingener, der bereits die Stadtmappe Siegen bearbeitet hat, hat als ausgewiesener Experte seine vielseitigen Ergebnisse zur Freudenberger Stadtgeschichte ebenso wie seine Kenntnisse zur vorindustriellen Entwicklung des Bergbaus und des Gewerbes in diesem Raum eingebracht. Die Mitherausgeberin Cornelia Kneppe übernahm die Erstellung der Wachstumsphasenkarte, die neue, wissenschaftlich fundierte Vorschläge zur Stadtentwicklung macht. Denn die Entwicklung der nassauischen Burgstadt war bisher bedingt durch verschiedene Brandkatastrophen und Ortsverlagerung weitgehend ungeklärt. Von großer Bedeutung für die Geschichte der Stadt und deshalb auf einer besonderen Tafel thematisiert ist die Entwicklung des vorindustriellen, auf dem Wasser- und Holzreichtum des Freudenberger Raumes basierenden Eisen gewinnenden und verarbeitenden Gewerbes, das Mitte des 19. Jahrhunderts von der Gerberei abgelöst wurde. Dabei wurde zum ersten Mal die Ausdehnung der nur für das Siegerland überlieferten einzigartigen Hauberge kartiert – einer seit dem 15. Jahrhundert bis heute genossenschaftlich ausgeübten Form einer multifunktionalen Waldbewirtschaftung.
Info:
Westfälischer Städteatlas, XI. Lieferung, herausgegeben von der Historischen Kommission für Westfalen und dem Institut für vergleichende Städtegeschichte durch Cornelia Kneppe und Mechthild Siekmann, Altenbeken: GSV Städteatlas Verlag 2010.
Termin:
XI. Lieferung Westfälischer Städteatlas – Stadtmappe Freudenberg wird vorgestellt
Die Stadt Freudenberg lädt zur Präsentation der Stadtmappe Freudenberg im Westfälischen Städteatlas am 14. Mai 2011, um 11 Uhr, in das Rathaus Freudenberg, Mórer Platz 1, Ratssaal, ein.
Programm:
Begrüßung durch den Bürgermeister Eckhard Günther
Westfälischer Städteatlas – Aufgaben, Ziele, Perspektiven
Prof. Dr. Werner Freitag, Institut für vergleichende Städtegeschichte
Freudenberg – ein geschichtlicher Abriss auf Grundlage der Karten des Westfälischen Städteatlas
Dr. Andreas Bingener, Autor der Stadtmappe
Kontakt:
Historische Kommission für Westfalen
Geschäftsstelle: Salzstr. 38 / Erbdrostenhof
48143 Münster
Tel.: 0251/ 591-4720
Fax : 0251/ 591-5871
eMail: hiko@lwl.org
http://www.historische-kommission.lwl.org
Institut für vergleichende Städtegeschichte
Königsstr. 46
48143 Münster
Tel.: 0251/ 83-27512
Fax : 0251/ 83-27535
eMail: istg@uni-muenster.de
http://www.uni-muenster.de/staedtegeschichte
GSV Städteatlas Verlag
Driburger Straße 45
33184 Altenbeken
Tel.: 05255/ 7373
Fax: 05255/ 7375
eMail: atlas@stadtgeschichte.de
http://www.stadtgeschichte.de
Quelle: AUGIAS.net
P.S.: Gerne bin ich der Bitte des Freudenberger Kollegen nachgekommen, auf diese Veranstaltungen hinzuweisen.
(W)
Wolf Thomas - am Montag, 9. Mai 2011, 10:55 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen