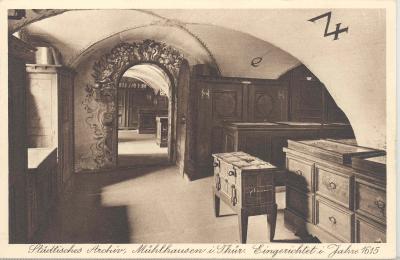Archivgeschichte
" .... Max Planck, der in Berlin ausgebombt worden war, wobei auch sein wissenschaftliches Archiv verbrannte, kam als alter Mann 1945 bei Verwandten in Göttingen unter, musste dort in bescheidenen Verhältnissen leben. ....."
Quelle:
http://www.all-in.de/nachrichten/deutschlandundwelt/reportagen/art6290,329323
" .....sein Haus im Grunewald mit seinem persönlichen Archiv wurde Anfang 1944 bei einem Bombenangriff zerstört ....."
Quelle:
http://www.heise.de/newsticker/Der-Humanist-der-Physik-zum-150-Geburtstag-von-Max-Planck--/meldung/106776
Quelle:
http://www.all-in.de/nachrichten/deutschlandundwelt/reportagen/art6290,329323
" .....sein Haus im Grunewald mit seinem persönlichen Archiv wurde Anfang 1944 bei einem Bombenangriff zerstört ....."
Quelle:
http://www.heise.de/newsticker/Der-Humanist-der-Physik-zum-150-Geburtstag-von-Max-Planck--/meldung/106776
Wolf Thomas - am Mittwoch, 23. April 2008, 18:05 - Rubrik: Archivgeschichte
http://www.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00002880/images/index.html?id=00002880&no=5&seite=5
Zum Digitalisat siehe:
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/BEITRAG/essays/grkl0500.htm#a32
Vor 10 Jahren habe ich den Vortrag gehalten, gedruckt ist er bis heute nicht, aber vergleichsweise oft als Internetpublikation zitiert!
Zum Digitalisat siehe:
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/BEITRAG/essays/grkl0500.htm#a32
Vor 10 Jahren habe ich den Vortrag gehalten, gedruckt ist er bis heute nicht, aber vergleichsweise oft als Internetpublikation zitiert!
KlausGraf - am Donnerstag, 17. April 2008, 03:22 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nach den Meldungen
http://archiv.twoday.net/stories/4380259/
http://archiv.twoday.net/stories/4677510/
http://archiv.twoday.net/stories/4811555/
ist nunmehr auch eine Rezension in H-SOZ-U-KULT anzuzeigen:
Matthias Manke: Rezension zu: Lehr, Stefan: Ein fast vergessener "Osteinsatz". Deutsche Archivare im Generalgouvernement und im Reichskommissariat Ukraine. Düsseldorf 2007. In: H-Soz-u-Kult, 02.04.2008, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2008-2-006 .
Zitat:
Stefan Lehrs Studie ist eine äußerst solide Fleißarbeit mit Pioniercharakter, deren Verdienste nach Ansicht des Rezensenten vor allem im Folgenden bestehen: Erstens unterlag der „Osteinsatz“ keiner ideologiefreien und unmanipulierten Fachmethodik, wie – im Übrigen bei fachlich begründetem Widerspruch – noch auf dem 75. Deutschen Archivtag von nichtarchivischer Seite glauben gemacht werden sollte. In diesem Kontext sei zudem darauf hingewiesen, dass sich der sogenannte Archivschutz nicht auf den Osteinsatz und dieser wiederum nicht auf das GG und das RKU beschränkte, aber hier möglicherweise unproblematischer als in weiter nördlich gelegenen Gebieten oder als die Tätigkeit des Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg verlief. Zweitens kann das in Ansätzen erkennbare und durchaus zu honorierende Bemühen um Nationalitäten-Grenzen überwindende berufsständische Kollegialität nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Osteinsatz ein Verhältnis von Siegern und Besiegten, von Besatzern und Besetzten darstellte. In anderen Arbeiten bisweilen suggerierte, sich wesentlich unterscheidende Vorzeichen bei den archivarischen (Nord-)Westeinsätzen erscheinen daher wenig plausibel und harren insofern weiterhin einer objektiven Analyse. Drittens verdeutlicht der gesamte Band, dass nicht allein radikale Gesinnungsäußerungen oder Parteimitgliedschaften das nationalsozialistische Regime trugen und sein Funktionieren gewährleisteten. Es waren auch die alltäglichen anonymen Mitgestaltungsprozesse, in denen sogar eine zahlenmäßig kleine Gruppe wie die Archivare ihre Funktion und ihren Platz hatte, wahrnahm und ausfüllte.

http://archiv.twoday.net/stories/4380259/
http://archiv.twoday.net/stories/4677510/
http://archiv.twoday.net/stories/4811555/
ist nunmehr auch eine Rezension in H-SOZ-U-KULT anzuzeigen:
Matthias Manke: Rezension zu: Lehr, Stefan: Ein fast vergessener "Osteinsatz". Deutsche Archivare im Generalgouvernement und im Reichskommissariat Ukraine. Düsseldorf 2007. In: H-Soz-u-Kult, 02.04.2008, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2008-2-006 .
Zitat:
Stefan Lehrs Studie ist eine äußerst solide Fleißarbeit mit Pioniercharakter, deren Verdienste nach Ansicht des Rezensenten vor allem im Folgenden bestehen: Erstens unterlag der „Osteinsatz“ keiner ideologiefreien und unmanipulierten Fachmethodik, wie – im Übrigen bei fachlich begründetem Widerspruch – noch auf dem 75. Deutschen Archivtag von nichtarchivischer Seite glauben gemacht werden sollte. In diesem Kontext sei zudem darauf hingewiesen, dass sich der sogenannte Archivschutz nicht auf den Osteinsatz und dieser wiederum nicht auf das GG und das RKU beschränkte, aber hier möglicherweise unproblematischer als in weiter nördlich gelegenen Gebieten oder als die Tätigkeit des Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg verlief. Zweitens kann das in Ansätzen erkennbare und durchaus zu honorierende Bemühen um Nationalitäten-Grenzen überwindende berufsständische Kollegialität nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Osteinsatz ein Verhältnis von Siegern und Besiegten, von Besatzern und Besetzten darstellte. In anderen Arbeiten bisweilen suggerierte, sich wesentlich unterscheidende Vorzeichen bei den archivarischen (Nord-)Westeinsätzen erscheinen daher wenig plausibel und harren insofern weiterhin einer objektiven Analyse. Drittens verdeutlicht der gesamte Band, dass nicht allein radikale Gesinnungsäußerungen oder Parteimitgliedschaften das nationalsozialistische Regime trugen und sein Funktionieren gewährleisteten. Es waren auch die alltäglichen anonymen Mitgestaltungsprozesse, in denen sogar eine zahlenmäßig kleine Gruppe wie die Archivare ihre Funktion und ihren Platz hatte, wahrnahm und ausfüllte.

KlausGraf - am Dienstag, 1. April 2008, 20:02 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 30. März 2008, 22:50 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Rainer Hering hat in der Abteilung Online-Rezensionen des Archiv fuer Sozialgeschichte das Buch: Ein fast vergessener "Osteinsatz" : deutsche Archivare im Generalgouvernement und im Reichskommissariat Ukraine von Stefan Lehr besprochen. Siehe http://library.fes.de/fulltext/afs/htmrez/80909.htm.
Siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/4677510/
Siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/4677510/
Bernd Hüttner - am Dienstag, 25. März 2008, 11:14 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Schrotts Homer musste mehrere Sprachen gekonnt und Zugang zu einem Archiv gehabt haben. Denn nur das könne erklären, warum sich in der Ilias so große Parallelen zum Gilgamesch, zugleich aber auch zum Alten Testament finden ließen und genaue Kenntnis der damals rezenten Aufstände ....."
Quelle:
http://derstandard.at/?url=/?id=3255545
".....Unzweifelhaft ist aber auch, dass Homer dort ein Archiv fand, wo die ganzen Siegesberichte vorlagen, die die assyrischen Könige, die jedes Jahr einen Feldzug starteten, losschickten in ihre Provinzen, um zu dokumentieren, welche Regionen sie wieder erobert, wie viel Beute sie gemacht haben. ...."
Quelle:
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/750351/
Quelle:
http://derstandard.at/?url=/?id=3255545
".....Unzweifelhaft ist aber auch, dass Homer dort ein Archiv fand, wo die ganzen Siegesberichte vorlagen, die die assyrischen Könige, die jedes Jahr einen Feldzug starteten, losschickten in ihre Provinzen, um zu dokumentieren, welche Regionen sie wieder erobert, wie viel Beute sie gemacht haben. ...."
Quelle:
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/750351/
Wolf Thomas - am Freitag, 7. März 2008, 18:54 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
für eine Transferarbeit der archivischen Ausbildungsstellen. So jedenfalls formuliert Christiane Heinemann in ihrer Rezension in den hessischen Archivnachrichten 7/2 (20007), S. 62, über meinen Vortrag auf dem 75. Deutschen Archivtag, publiziert im Tagungsband. Ihre Zweifel dürften durchaus berechtigt sein, was die dort angeregte Arbeit über den geplanten Reichsarchivneubau anbelangt.
Michael Früchtels in diesem Jahr erschienene, architekturhistorische Dissertation über den Architekten Hermann Giesler bietet jedoch einen interessanten Fund (S. 291 f) - Hitler geplantes Privatarchiv in Linz. Im "Wohn- bzw. Führerkastell", dem Alterssitz Hitlers, sollte im ersten Obergeschoss ein Archiv errichtet werden. Giesler vermerkt am 12.11.1942: ".... Der Führer betont, dass er ausserordentlich viel wichtige Dinge, die für das Reich von grösster Bedeutung sind, angesammelt hat, die er dort unterbringen möchte .... Der Sockel, auf dem das Wohnkastell ruht, wird als Luftschutzraum ausgebaut, mit absolut bomensicheren Decken. Beste Verbindung des Hauses mit dem Luftschutzraum muss hergestellt werden (Sicherstellung des Archivs in Zeiten der Gefahr). ....." Lediglich zwei Skizzen Hitlers sowie das Linzer Stadtmodell von 1945 zeigen den geplanten Bau. Diese (Wieder-)Entdeckung nährt die Hoffnung, dass auch im Zuge anderer städtebaulicher Planungen Archivbauten realisiert werden sollten. M. W. ist auch die Frage nach Archiveinrichtungen der nationalsozialistischen Organisationen noch nicht untersucht worden. Vielleicht böte dies ja "genügend Stoff" für eine Transferarbeit.
Nach meinem Vortrag hatte Wolf Buchmann eine vergleichende Untersuchung von Archivbauten dieser Epoche bezogen auf das amerikanische Nationalarchiv angeregt. In Blick in die 2007 von Anton Gössi herausgegebene Schrift über Archivbauten in der Schweiz und Lichtenstein weist mit Berner Staatsarchiv einen europäischen Vergleichsbau, der als "Architekturmanifest der Neuen Sachlichkeit" bezeichnet wird, aus. Es ist zu hoffen, dass dieser Anregung ebenfalls nachgegangen wird.
Michael Früchtels in diesem Jahr erschienene, architekturhistorische Dissertation über den Architekten Hermann Giesler bietet jedoch einen interessanten Fund (S. 291 f) - Hitler geplantes Privatarchiv in Linz. Im "Wohn- bzw. Führerkastell", dem Alterssitz Hitlers, sollte im ersten Obergeschoss ein Archiv errichtet werden. Giesler vermerkt am 12.11.1942: ".... Der Führer betont, dass er ausserordentlich viel wichtige Dinge, die für das Reich von grösster Bedeutung sind, angesammelt hat, die er dort unterbringen möchte .... Der Sockel, auf dem das Wohnkastell ruht, wird als Luftschutzraum ausgebaut, mit absolut bomensicheren Decken. Beste Verbindung des Hauses mit dem Luftschutzraum muss hergestellt werden (Sicherstellung des Archivs in Zeiten der Gefahr). ....." Lediglich zwei Skizzen Hitlers sowie das Linzer Stadtmodell von 1945 zeigen den geplanten Bau. Diese (Wieder-)Entdeckung nährt die Hoffnung, dass auch im Zuge anderer städtebaulicher Planungen Archivbauten realisiert werden sollten. M. W. ist auch die Frage nach Archiveinrichtungen der nationalsozialistischen Organisationen noch nicht untersucht worden. Vielleicht böte dies ja "genügend Stoff" für eine Transferarbeit.
Nach meinem Vortrag hatte Wolf Buchmann eine vergleichende Untersuchung von Archivbauten dieser Epoche bezogen auf das amerikanische Nationalarchiv angeregt. In Blick in die 2007 von Anton Gössi herausgegebene Schrift über Archivbauten in der Schweiz und Lichtenstein weist mit Berner Staatsarchiv einen europäischen Vergleichsbau, der als "Architekturmanifest der Neuen Sachlichkeit" bezeichnet wird, aus. Es ist zu hoffen, dass dieser Anregung ebenfalls nachgegangen wird.
Wolf Thomas - am Mittwoch, 6. Februar 2008, 20:51 - Rubrik: Archivgeschichte
Ein fast vergessener "Osteinsatz"
Deutsche Archivare im Generalgouvernement und im Reichskommissariat Ukraine
Produktinformation
* Verlag: Droste
* 2007
* Ausstattung/Bilder: 2007. 448 S.
* Schriften des Bundesarchivs Bd.68
Beschreibung
Im zweiten Weltkrieg leiteten deutsche Statsarchivare die polnischen und ukrainischen Archive. Zu welchen Zwecken nutzten sie die Kontrolle über das fremde Archivgut? Vollzogen sie einen selbstlosen Schutzder fremden Archivalien, wie sie es selbst nach dem Krieg glaubhaft machen wollten, oder verfolgten sie vornehmlich "deutsche" Interessen? Die Studie fragt nach dem Verhalten der Archivare, ihrem Verhältnis zur NSDAP und ihren Verstrickungen in die NS-Politik sowie der Politisierung der Archivarbeit. Speziell untersucht sie die Verlagerung von Archivbeständen in das Deutsche Reich und das Schicksal von "Deutschtums-" und "Judenarchivalien". Betrachtet werden nicht nur die grundlegenden Entwicklungen im preußischen, sondern auch im polnischen und ukrainischen Archivwesen. Anhand der persönlichen Korrespondenzen und der Entnazifizierungsverfahren werden schließlich Bedeutung und Selbstwahrnehmung des "Osteinsatzes" in der Nachkriegszeit analysiert.
F.A.Z.-Besprechung, zur Verfügung gestellt von der F.A.Z.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.01.2008
Operation Aktenklau - Auch deutsche Archivare waren im "Osteinsatz"
Die Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus fällt deutschen Behörden schwer. Dies gilt sogar für die Archive. Sie hüten zwar, wie Novalis meinte, "das Gedächtnis der Nation". Doch auch bei diesem der Geschichte und der Erinnerung besonders verbundenen Berufsstand muss die Bewältigung der Vergangenheit mitunter von außen angestoßen werden. Die deutsche Archivverwaltung des Generalgouvernements und des Reichskommissariats Ukraine ist Gegenstand einer quellenmäßig breit angelegten, materialgesättigten Studie, mit der Stefan Lehr primär die Geschichte des "Osteinsatzes" von Reichsarchiv und Generaldirektion der preußischen Staatsarchive im Zweiten Weltkrieg nachzeichnet. Darüber hinaus schildert er die preußische Archivverwaltung in Polen im Ersten Weltkrieg, vergleicht für die Zwischenkriegszeit das Archivwesen in Preußen, Polen und der Ukraine und gibt für die Zeit nach 1945 ein umfassendes Bild des Schicksals der deutschen, polnischen und ukrainischen Archivalien und Archivare.
Besonderen Reiz gewinnt die Arbeit durch die privaten Aufzeichnungen deutscher und polnischer Archivare, die Lehr neben den Behördenakten heranzieht. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten die preußischen Staatsarchive intensive Forschungen zu den an Polen verlorenen deutschen Ostgebieten begonnen, deren Ergebnisse von der Publikationsstelle des Geheimen Staatsarchivs veröffentlicht wurden. Die preußischen Archivare waren somit gut vorbereitet auf die neuen Aufgaben beim Einsatzstab des "Reichsministers für die besetzten Ostgebiete", Alfred Rosenberg, im Generalgouvernement und im Reichskommissariat Ukraine.
Die Auslagerungen von Archivalien und ihre Transporte innerhalb der Ukraine und des Generalgouvernements und auf reichsdeutsches Gebiet weist Lehr akribisch nach. Nicht nur polnische Archivare sahen die Verlagerung von Teilen ihrer Bestände mit Skepsis. Auch Hans Frank, Generalgouverneur und 1946 in Polen als Kriegsverbrecher hingerichtet, achtete darauf, dass die Akten seines Herrschaftsbereichs dort verblieben und nicht ausgelagert wurden.
Die Beziehungen der deutschen Besatzungsarchivare zu den ihnen unterstellten polnischen Kollegen waren in der Regel von korrekter Höflichkeit; die deutschen Vorgesetzten halfen bei der Wohnraumbeschaffung, beim Zugang zum Kantinenessen und veranlassten die Zahlung von Sonderprämien. 1946 und 1947 gewährte Polen dem ehemaligen Direktor der Archive im Generalgouvernement Erich Randt in Berlin monatliche Geldzahlungen und gelegentlich auch Speckseiten. Im Gegenzug musste Randt sich verpflichten, die Auslagerungen von Akten aus polnischen Archiven aufzuzeichnen. Der Osteinsatz war für die deutschen Archivare lukrativ; es lockten eine schnellere Karriere und ein deutlich höheres Gehalt als im Reichsgebiet. Die Verbrechen an der einheimischen Bevölkerung mussten sie zur Kenntnis nehmen. Die Ermordung der Juden hielt Wolfgang Mommsen, Archivar beim Reichskommissariat Ostland in Riga, in seinem Tagebuch am 29. März 1942 fest. Die Mitgliedschaft der Archivare in der NSDAP und ihren Gliederungen und die "Entnazifizierung" weist der Autor detailliert nach.
In der Bundesrepublik begann für die meisten Archivare eine neue Karriere - als Leiter des Archivs im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in Bonn oder als Dozent in Marburg bei der Ausbildung der westdeutschen Archivare oder als Direktor beziehungsweise Präsident des Bundesarchivs in Koblenz, das auch weitere Archivare des Osteinsatzes als Referenten aufnahm. Gelegentliche Wiederholungen mindern nicht das Verdienst dieser nicht immer leicht lesbaren Studie.
HANS JOCHEN PRETSCH
Stefan Lehr: Ein fast vergessener "Osteinsatz". Deutsche Archivare im Generalgouvernement und im Reichskommissariat Ukraine. Droste Verlag, Düsseldorf 2007. 412 S., 38,- [Euro].
Deutsche Archivare im Generalgouvernement und im Reichskommissariat Ukraine
Produktinformation
* Verlag: Droste
* 2007
* Ausstattung/Bilder: 2007. 448 S.
* Schriften des Bundesarchivs Bd.68
Beschreibung
Im zweiten Weltkrieg leiteten deutsche Statsarchivare die polnischen und ukrainischen Archive. Zu welchen Zwecken nutzten sie die Kontrolle über das fremde Archivgut? Vollzogen sie einen selbstlosen Schutzder fremden Archivalien, wie sie es selbst nach dem Krieg glaubhaft machen wollten, oder verfolgten sie vornehmlich "deutsche" Interessen? Die Studie fragt nach dem Verhalten der Archivare, ihrem Verhältnis zur NSDAP und ihren Verstrickungen in die NS-Politik sowie der Politisierung der Archivarbeit. Speziell untersucht sie die Verlagerung von Archivbeständen in das Deutsche Reich und das Schicksal von "Deutschtums-" und "Judenarchivalien". Betrachtet werden nicht nur die grundlegenden Entwicklungen im preußischen, sondern auch im polnischen und ukrainischen Archivwesen. Anhand der persönlichen Korrespondenzen und der Entnazifizierungsverfahren werden schließlich Bedeutung und Selbstwahrnehmung des "Osteinsatzes" in der Nachkriegszeit analysiert.
F.A.Z.-Besprechung, zur Verfügung gestellt von der F.A.Z.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.01.2008
Operation Aktenklau - Auch deutsche Archivare waren im "Osteinsatz"
Die Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus fällt deutschen Behörden schwer. Dies gilt sogar für die Archive. Sie hüten zwar, wie Novalis meinte, "das Gedächtnis der Nation". Doch auch bei diesem der Geschichte und der Erinnerung besonders verbundenen Berufsstand muss die Bewältigung der Vergangenheit mitunter von außen angestoßen werden. Die deutsche Archivverwaltung des Generalgouvernements und des Reichskommissariats Ukraine ist Gegenstand einer quellenmäßig breit angelegten, materialgesättigten Studie, mit der Stefan Lehr primär die Geschichte des "Osteinsatzes" von Reichsarchiv und Generaldirektion der preußischen Staatsarchive im Zweiten Weltkrieg nachzeichnet. Darüber hinaus schildert er die preußische Archivverwaltung in Polen im Ersten Weltkrieg, vergleicht für die Zwischenkriegszeit das Archivwesen in Preußen, Polen und der Ukraine und gibt für die Zeit nach 1945 ein umfassendes Bild des Schicksals der deutschen, polnischen und ukrainischen Archivalien und Archivare.
Besonderen Reiz gewinnt die Arbeit durch die privaten Aufzeichnungen deutscher und polnischer Archivare, die Lehr neben den Behördenakten heranzieht. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten die preußischen Staatsarchive intensive Forschungen zu den an Polen verlorenen deutschen Ostgebieten begonnen, deren Ergebnisse von der Publikationsstelle des Geheimen Staatsarchivs veröffentlicht wurden. Die preußischen Archivare waren somit gut vorbereitet auf die neuen Aufgaben beim Einsatzstab des "Reichsministers für die besetzten Ostgebiete", Alfred Rosenberg, im Generalgouvernement und im Reichskommissariat Ukraine.
Die Auslagerungen von Archivalien und ihre Transporte innerhalb der Ukraine und des Generalgouvernements und auf reichsdeutsches Gebiet weist Lehr akribisch nach. Nicht nur polnische Archivare sahen die Verlagerung von Teilen ihrer Bestände mit Skepsis. Auch Hans Frank, Generalgouverneur und 1946 in Polen als Kriegsverbrecher hingerichtet, achtete darauf, dass die Akten seines Herrschaftsbereichs dort verblieben und nicht ausgelagert wurden.
Die Beziehungen der deutschen Besatzungsarchivare zu den ihnen unterstellten polnischen Kollegen waren in der Regel von korrekter Höflichkeit; die deutschen Vorgesetzten halfen bei der Wohnraumbeschaffung, beim Zugang zum Kantinenessen und veranlassten die Zahlung von Sonderprämien. 1946 und 1947 gewährte Polen dem ehemaligen Direktor der Archive im Generalgouvernement Erich Randt in Berlin monatliche Geldzahlungen und gelegentlich auch Speckseiten. Im Gegenzug musste Randt sich verpflichten, die Auslagerungen von Akten aus polnischen Archiven aufzuzeichnen. Der Osteinsatz war für die deutschen Archivare lukrativ; es lockten eine schnellere Karriere und ein deutlich höheres Gehalt als im Reichsgebiet. Die Verbrechen an der einheimischen Bevölkerung mussten sie zur Kenntnis nehmen. Die Ermordung der Juden hielt Wolfgang Mommsen, Archivar beim Reichskommissariat Ostland in Riga, in seinem Tagebuch am 29. März 1942 fest. Die Mitgliedschaft der Archivare in der NSDAP und ihren Gliederungen und die "Entnazifizierung" weist der Autor detailliert nach.
In der Bundesrepublik begann für die meisten Archivare eine neue Karriere - als Leiter des Archivs im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in Bonn oder als Dozent in Marburg bei der Ausbildung der westdeutschen Archivare oder als Direktor beziehungsweise Präsident des Bundesarchivs in Koblenz, das auch weitere Archivare des Osteinsatzes als Referenten aufnahm. Gelegentliche Wiederholungen mindern nicht das Verdienst dieser nicht immer leicht lesbaren Studie.
HANS JOCHEN PRETSCH
Stefan Lehr: Ein fast vergessener "Osteinsatz". Deutsche Archivare im Generalgouvernement und im Reichskommissariat Ukraine. Droste Verlag, Düsseldorf 2007. 412 S., 38,- [Euro].
Bernd Hüttner - am Montag, 4. Februar 2008, 20:26 - Rubrik: Archivgeschichte
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gedichte_%28Drollinger_1745%29
Der baden-durlachische Archivar war ein nicht unbedeutender Lyriker im 18. Jahrhundert. Zu weiteren Archivaren als Autoren:
http://de.wikisource.org/wiki/Archivwesen

Der baden-durlachische Archivar war ein nicht unbedeutender Lyriker im 18. Jahrhundert. Zu weiteren Archivaren als Autoren:
http://de.wikisource.org/wiki/Archivwesen

KlausGraf - am Sonntag, 3. Februar 2008, 02:32 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Vatikan öffnet sein bis dahin kaum zugängliches Inquisitions-Archiv für Historiker.
Nachtrag 22.02.2008:
http://www.oecumene.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=188404
Nachtrag 22.02.2008:
http://www.oecumene.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=188404
Wolf Thomas - am Dienstag, 22. Januar 2008, 09:26 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen