Landesgeschichte
Er ist den Bibliographen als Autor eines zuerst 1497 in Memmingen gedruckten Kräuterbüchleins (fußend weitgehend auf dem "Gart der Gesundheit") bekannt (GND 104176970):
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/JOHATOL.htm
Autorennennung:
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00034816/image_84
Sudhoff dachte an eine apokryphe Zuschreibung, da er keine Lebenszeugnisse fand. Walther brachte dann in Sudhoffs Archiv 1970 (unfrei bei JSTOR) den Hinweis auf den Stuttgarter Cod. HB XII 5 bei, der Tallat als Lehrer dem Umkreis des Kemptener Stiftsschulmeisters Johannes Birk zuweist.
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0072_b060_JPG.htm
Walther fand einen Marsilius Dalat aus Kempten zum Jahr 1501 in der Heidelberger Matrikel und identifizierte Vochenberg mit einem Lehengut bei Kempten. Saam (Bibliothek und Wissenschaft 1991, S. 93; von Keil im ²VL 9, Sp. 595f. nicht berücksichtigt, hier referiert nach Duntze http://books.google.de/books?id=iochsYU1g9UC&pg=PA114 ) sah in Tallat ein Pseudonym Birks.
Erkundigungen Walthers bei bayerischen Archiven nach Tallat blieben erfolglos. Im badischen Bodenseeraum wären er und Sudhoff dagegen fündig geworden. Sie hätten nur einen Blick in Kindlers Geschlechterbuch s.v. Talat werfen müssen.
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kindlervonknobloch1898bd1/0195/
Johannes Talat, Meister der freien Künste und Schulmeister des Stifts Kempten, war der Sohn des Wirts Konrad Talat aus Denkingen (1500).
Google Book Search bietet weitere Belege:
FDA 1893, S. 296 zu 1500
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6381/
Vgl.
http://books.google.de/books?id=a_c8AQAAIAAJ&q=talat+denkingen
1483 war er schon Schulmeister in Kempten (SpitalA Biberach)
http://books.google.de/books?id=XTZmAAAAMAAJ&q=talat+denkingen
Saams Vermutung ist damit widerlegt. Birk und Talat waren zwei Personen.
Nachtrag: Ein Blick in Saam selbst ergibt keine andere Beurteilung, wenngleich angemerkt sei, dass die biographischen Mitteilungen zu Birck S. 93f. schätzenswert sind als Nachtrag zum ²VL-Artikel von Johanek. Zu beachten ist der Hinweis auf eine Abschrift der Imitatio Christi des Thomas von Kempen 1475 unter dem Rektor Johannes Birk Clm 26775
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008255/image_217 (Handschriftenkatalog München)
[ https://archive.org/stream/descriptionsbib00puyogoog#page/n333/mode/2up wohl nach dem Katalog]
Nachtrag: http://archiv.twoday.net/stories/233330746/
Gundolf Keil behandelte Tallat in der NDB 25 (2013), S. 771f. und spricht von einem wahrscheinlichen Studium in Erfurt, sonst nichts Neues zu den Biographica. Saam hat er immer noch nicht.
Nachtrag August 2014 zur Kemptener Stiftsschule in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts:
Daisenberger
http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015031667978?urlappend=%3Bseq=31
Konrad Resch, Lehrer an der Klosterschule Kempten 1464
1498 Birk noch "rector scolarium"
"Im Jahre 1464 war Othmar Binder, der zu Studien in Kempten weilte, der geringen Zahl der Brüder wegen nach Irsee zurückgerufen worden"
https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22othmar+binder%22++studien+kempten
Augsburg, Universitätsbibl., Cod. II.1.4° 32, Bl. 497r: "per me Petrum Fend tunc temporis scolaris in Kampidona" 1466 - seit wann bedeutet scolaris Lehrer (so apodiktisch Hilg, während noch mit Fragezeichen Roth ZfdA 1992, S. 440: Schüler oder Student oder bereits akademisch gebildeter Lehrer?)?
http://www.handschriftencensus.de/4327
http://books.google.de/books?id=4_12pRKL5t0C&pg=PA966 (Baldzuhn)
http://books.google.de/books?id=kf3lBydaynMC&pg=PA291 (Handschriftenkatalog von Hilg)
Könnte natürlich auch die Stadtschule sein.
Augsburg, 8° Cod. 144
"Die Hs entstand laut Schreibervermerk (189v) 1490 sub magistro Johanne Birck, zu identifizieren als Schulmeister der Stiftsschule Kempten u. Verfasser der Kemptener Klosterchronik (zu ihm 2VL 1, Sp. 870-875, P. JOHANEK). Die Bezugnahme im Text (68v, 157v) auf Augusta und Campidonia deutet ebenfalls auf Kempten (Bistum Augsburg); Sequenz und Hymnus (72v, 141r) weisen auf die Klosterpatrone Gordianus und Epimachus. ― Die ersten beiden Texte lassen sich aufgrund Inhalt, Form sowie zahlreicher Fehler als Mitschriften aus dem Unterricht einstufen. Schreiber war (laut Vermerk 84r) Jo Kurtz. Bei ihm handelt es sich wahrscheinlich um Johannes Kurtz aus Ebersbach (gelegen zwischen Irsee und Kempten), der sich zwei Jahre später an der Universität Freiburg immatrikulierte und als Pfarrer in Ebersbach die Irseer Reimchronik verfaßte (zu ihm 2VL 5, Sp. 463-468, F. SCHANZE; PÖTZL, Irsee S. 16-18). ― Die Zugehörigkeit der Hs zur Irseer Bibliothek (Besitzvermerk Iv) ist durch die Verbindung von Johannes Kurtz zum Kloster Irsee zu erklären."
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31760842
Druck: Die Handschriften der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg 8°Cod 1-232 / beschrieben von Juliane Trede und Wolf Gehrt. - 2011
Nachtrag September 2014: 1544 ließ der Hofmeister des Stifts Kempten Georg Fläschutz die ältere Chronik von Meister Hans Dallat von Denkingen fortsetzen. Der Dallat'sche Teil folgt offenbar den Fiktionen Birks.
https://archive.org/stream/quellenzurgesch00baumgoog#page/n403/mode/2up (Baumann, Quellen)
Nachtrag Dezember 2014: Marsilius Tallat erscheint als Marsilius Terat aus Kempten 1502 auch in der Wiener Matrikel.
http://books.google.de/books?id=WKrlAAAAMAAJ&q=kempten+marsilius+wien
Nachtrag 21.1.2015:
Das Bayerische Hauptstaatsarchiv teilt heute mit:
"Kemptener Chronik von Fleschutz-Dallat
Sehr geehrter Herr Dr. Graf,
die stift-kemptischen Bestände des Bayerischen Hauptstaatsarchivs sind in den Jahre 1990 bis 1992
an das Staatsarchiv Augsburg abgegeben worden und wurden dort bis 1998 vom Unterzeichneten in
Anlehnung an die Repertorien des Stiftsarchivars Feigele aus den späten 1760er und 1770er Jahren
völlig neu aufgebaut. Für den Hauptbestand FÜRSTSTIFT KEMPTEN ARCHIV ist dies durch das im Jahr
2002 als Band 51 der Bayerischen Archivinventare gedruckte Inventar dokumentiert. Die im Auftrag
des auch in diesem Inventar mehrfach genannten stiftischen Hofmeisters Georg Fleschutz von Dallat
verfasste Chronik befand sich nicht unter den abgegebenen Archivalien.
Wie Sie dem Inventar (S. 18) entnehmen können, fehlen aus der Gruppe II Lit. A des Stiftsarchivs,
die die Chroniken enthielt, heute die Nummern 1-11. Im Bayerischen Hauptstaatsarchiv zurückgeblieben
sind sie nicht. Es bleibt damit nur zu vermuten, dass sie zu einem unbekannten Zeitpunkt
vor dem 2. Weltkrieg vom Allgemeinen Reichsarchiv bzw. Bayerischen Hauptstaatsarchiv an die
Bayerische Staatsbibliothek abgegeben worden sind. Beide Institutionen waren damals im jetzt der
Staatsbibliothek allein vorbehaltenen Gebäude Ludwigstraße 16 untergebracht. Dass aus säkularisierten
Klosterarchiven stammende Chroniken, Annalen und ähnliches literarisches Schriftgut "von
kurzer Hand" der benachbarten Bibliothek überwiesen wurde, war nicht ungewöhnlich. Ich kann
Ihnen daher nur empfehlen, sich an die Handschriftenabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek zu
wenden.
Mit freundlichen Grüßen
i.A.
gez.
Dr. Gerhard Immler
Ltd. Archivdirektor"
Es handelt sich um Cgm 5821:
http://archiv.twoday.net/stories/1022391026/
#forschung
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/JOHATOL.htm
Autorennennung:
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00034816/image_84
Sudhoff dachte an eine apokryphe Zuschreibung, da er keine Lebenszeugnisse fand. Walther brachte dann in Sudhoffs Archiv 1970 (unfrei bei JSTOR) den Hinweis auf den Stuttgarter Cod. HB XII 5 bei, der Tallat als Lehrer dem Umkreis des Kemptener Stiftsschulmeisters Johannes Birk zuweist.
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0072_b060_JPG.htm
Walther fand einen Marsilius Dalat aus Kempten zum Jahr 1501 in der Heidelberger Matrikel und identifizierte Vochenberg mit einem Lehengut bei Kempten. Saam (Bibliothek und Wissenschaft 1991, S. 93; von Keil im ²VL 9, Sp. 595f. nicht berücksichtigt, hier referiert nach Duntze http://books.google.de/books?id=iochsYU1g9UC&pg=PA114 ) sah in Tallat ein Pseudonym Birks.
Erkundigungen Walthers bei bayerischen Archiven nach Tallat blieben erfolglos. Im badischen Bodenseeraum wären er und Sudhoff dagegen fündig geworden. Sie hätten nur einen Blick in Kindlers Geschlechterbuch s.v. Talat werfen müssen.
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kindlervonknobloch1898bd1/0195/
Johannes Talat, Meister der freien Künste und Schulmeister des Stifts Kempten, war der Sohn des Wirts Konrad Talat aus Denkingen (1500).
Google Book Search bietet weitere Belege:
FDA 1893, S. 296 zu 1500
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6381/
Vgl.
http://books.google.de/books?id=a_c8AQAAIAAJ&q=talat+denkingen
1483 war er schon Schulmeister in Kempten (SpitalA Biberach)
http://books.google.de/books?id=XTZmAAAAMAAJ&q=talat+denkingen
Saams Vermutung ist damit widerlegt. Birk und Talat waren zwei Personen.
Nachtrag: Ein Blick in Saam selbst ergibt keine andere Beurteilung, wenngleich angemerkt sei, dass die biographischen Mitteilungen zu Birck S. 93f. schätzenswert sind als Nachtrag zum ²VL-Artikel von Johanek. Zu beachten ist der Hinweis auf eine Abschrift der Imitatio Christi des Thomas von Kempen 1475 unter dem Rektor Johannes Birk Clm 26775
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008255/image_217 (Handschriftenkatalog München)
[ https://archive.org/stream/descriptionsbib00puyogoog#page/n333/mode/2up wohl nach dem Katalog]
Nachtrag: http://archiv.twoday.net/stories/233330746/
Gundolf Keil behandelte Tallat in der NDB 25 (2013), S. 771f. und spricht von einem wahrscheinlichen Studium in Erfurt, sonst nichts Neues zu den Biographica. Saam hat er immer noch nicht.
Nachtrag August 2014 zur Kemptener Stiftsschule in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts:
Daisenberger
http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015031667978?urlappend=%3Bseq=31
Konrad Resch, Lehrer an der Klosterschule Kempten 1464
1498 Birk noch "rector scolarium"
"Im Jahre 1464 war Othmar Binder, der zu Studien in Kempten weilte, der geringen Zahl der Brüder wegen nach Irsee zurückgerufen worden"
https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22othmar+binder%22++studien+kempten
Augsburg, Universitätsbibl., Cod. II.1.4° 32, Bl. 497r: "per me Petrum Fend tunc temporis scolaris in Kampidona" 1466 - seit wann bedeutet scolaris Lehrer (so apodiktisch Hilg, während noch mit Fragezeichen Roth ZfdA 1992, S. 440: Schüler oder Student oder bereits akademisch gebildeter Lehrer?)?
http://www.handschriftencensus.de/4327
http://books.google.de/books?id=4_12pRKL5t0C&pg=PA966 (Baldzuhn)
http://books.google.de/books?id=kf3lBydaynMC&pg=PA291 (Handschriftenkatalog von Hilg)
Könnte natürlich auch die Stadtschule sein.
Augsburg, 8° Cod. 144
"Die Hs entstand laut Schreibervermerk (189v) 1490 sub magistro Johanne Birck, zu identifizieren als Schulmeister der Stiftsschule Kempten u. Verfasser der Kemptener Klosterchronik (zu ihm 2VL 1, Sp. 870-875, P. JOHANEK). Die Bezugnahme im Text (68v, 157v) auf Augusta und Campidonia deutet ebenfalls auf Kempten (Bistum Augsburg); Sequenz und Hymnus (72v, 141r) weisen auf die Klosterpatrone Gordianus und Epimachus. ― Die ersten beiden Texte lassen sich aufgrund Inhalt, Form sowie zahlreicher Fehler als Mitschriften aus dem Unterricht einstufen. Schreiber war (laut Vermerk 84r) Jo Kurtz. Bei ihm handelt es sich wahrscheinlich um Johannes Kurtz aus Ebersbach (gelegen zwischen Irsee und Kempten), der sich zwei Jahre später an der Universität Freiburg immatrikulierte und als Pfarrer in Ebersbach die Irseer Reimchronik verfaßte (zu ihm 2VL 5, Sp. 463-468, F. SCHANZE; PÖTZL, Irsee S. 16-18). ― Die Zugehörigkeit der Hs zur Irseer Bibliothek (Besitzvermerk Iv) ist durch die Verbindung von Johannes Kurtz zum Kloster Irsee zu erklären."
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31760842
Druck: Die Handschriften der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg 8°Cod 1-232 / beschrieben von Juliane Trede und Wolf Gehrt. - 2011
Nachtrag September 2014: 1544 ließ der Hofmeister des Stifts Kempten Georg Fläschutz die ältere Chronik von Meister Hans Dallat von Denkingen fortsetzen. Der Dallat'sche Teil folgt offenbar den Fiktionen Birks.
https://archive.org/stream/quellenzurgesch00baumgoog#page/n403/mode/2up (Baumann, Quellen)
Nachtrag Dezember 2014: Marsilius Tallat erscheint als Marsilius Terat aus Kempten 1502 auch in der Wiener Matrikel.
http://books.google.de/books?id=WKrlAAAAMAAJ&q=kempten+marsilius+wien
Nachtrag 21.1.2015:
Das Bayerische Hauptstaatsarchiv teilt heute mit:
"Kemptener Chronik von Fleschutz-Dallat
Sehr geehrter Herr Dr. Graf,
die stift-kemptischen Bestände des Bayerischen Hauptstaatsarchivs sind in den Jahre 1990 bis 1992
an das Staatsarchiv Augsburg abgegeben worden und wurden dort bis 1998 vom Unterzeichneten in
Anlehnung an die Repertorien des Stiftsarchivars Feigele aus den späten 1760er und 1770er Jahren
völlig neu aufgebaut. Für den Hauptbestand FÜRSTSTIFT KEMPTEN ARCHIV ist dies durch das im Jahr
2002 als Band 51 der Bayerischen Archivinventare gedruckte Inventar dokumentiert. Die im Auftrag
des auch in diesem Inventar mehrfach genannten stiftischen Hofmeisters Georg Fleschutz von Dallat
verfasste Chronik befand sich nicht unter den abgegebenen Archivalien.
Wie Sie dem Inventar (S. 18) entnehmen können, fehlen aus der Gruppe II Lit. A des Stiftsarchivs,
die die Chroniken enthielt, heute die Nummern 1-11. Im Bayerischen Hauptstaatsarchiv zurückgeblieben
sind sie nicht. Es bleibt damit nur zu vermuten, dass sie zu einem unbekannten Zeitpunkt
vor dem 2. Weltkrieg vom Allgemeinen Reichsarchiv bzw. Bayerischen Hauptstaatsarchiv an die
Bayerische Staatsbibliothek abgegeben worden sind. Beide Institutionen waren damals im jetzt der
Staatsbibliothek allein vorbehaltenen Gebäude Ludwigstraße 16 untergebracht. Dass aus säkularisierten
Klosterarchiven stammende Chroniken, Annalen und ähnliches literarisches Schriftgut "von
kurzer Hand" der benachbarten Bibliothek überwiesen wurde, war nicht ungewöhnlich. Ich kann
Ihnen daher nur empfehlen, sich an die Handschriftenabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek zu
wenden.
Mit freundlichen Grüßen
i.A.
gez.
Dr. Gerhard Immler
Ltd. Archivdirektor"
Es handelt sich um Cgm 5821:
http://archiv.twoday.net/stories/1022391026/
#forschung
KlausGraf - am Donnerstag, 10. Januar 2013, 23:52 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wenig erhellend ein Video aus dem Jahr 2008:
http://www.goodnews4.de/preview_interviewtv.php?iid=493
Sehr viel Unwichtigeres wurde von der BLB bereits digitalisiert. Irgendwann soll auch dieses Turnierbuch an die Reihe kommen, wurde mir versichert.
http://www.goodnews4.de/preview_interviewtv.php?iid=493
Sehr viel Unwichtigeres wurde von der BLB bereits digitalisiert. Irgendwann soll auch dieses Turnierbuch an die Reihe kommen, wurde mir versichert.
KlausGraf - am Donnerstag, 10. Januar 2013, 20:40 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
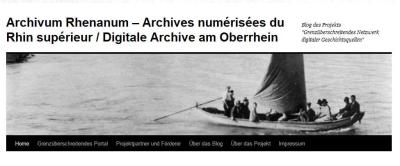 Internetpräsenzen (Blogs) des deutsch-französischen Projekts (2013-2015):
Internetpräsenzen (Blogs) des deutsch-französischen Projekts (2013-2015):http://archives.hypotheses.org/
http://archives-fr.hypotheses.org/
J. Kemper - am Mittwoch, 9. Januar 2013, 17:39 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Stammbuch des Stephanus Lansius in Tübingen, deutsch u. lat. – 46 Eintragungen mit 25 Porträts, einem Widmungsblatt, einer Ansicht von Tübingen (1620) u. einem Exlibris. Unter den Eintragungen eine von Johannes Kepler mit Porträt aus seiner Linzer Zeit. [s. dazu: Frank, Karl Friedrich von: Das Stammbuch des Stephanus Lansius. In: Senftenegger Monatsblatt f. Genealogie u. Heraldik, 1955, H. 5/6)"
Die Linzer Hs. 74 ist jetzt online:
http://digi.landesbibliothek.at/viewer/resolver?urn=urn%3Anbn%3Aat%3AAT-OOeLB-1348087
Mir war neu, dass es einen frühneuzeitlichen Kupferstich von den Wiblinger Mönchen des 15. Jahrhunderts Jodocus Winkelhofer und Georg Schwarz gibt. Aber nach Heuchlingers Templum honoris 1702 ist die gleiche Abbildung wie in der Linzer Handschrift reproduziert
http://www.kloster-wiblingen.de/de/371288.html?image=371285
Der 1480 gestorbene Winkelhofer war ab 1477 Abt in Kloster Lorch, siehe
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lorch1990bd1/0062
Abbildung und Wappen in einem Lorcher Chorbuch (sw):
http://www.bildindex.de/obj00043095.html
Unscharfe Farbabbildung:
http://www.schwaben-kultur.de/pdfs/2012-03.pdf
Epitaph (4 lateinische Verse) auf die beiden Mönche aus Heuchlinger in der Geschichte Alpirsbachs
http://books.google.de/books?id=flRIAAAAYAAJ&pg=PA101 (US)
Im Digitalisat Heuchlingers:
http://books.google.de/books?id=7CNqJPoRgTUC&pg=PA50
Zur Familie: Schulers Notare (1987), S. 518 mit falschem Todesdatum des Lorcher Abts.

Die Linzer Hs. 74 ist jetzt online:
http://digi.landesbibliothek.at/viewer/resolver?urn=urn%3Anbn%3Aat%3AAT-OOeLB-1348087
Mir war neu, dass es einen frühneuzeitlichen Kupferstich von den Wiblinger Mönchen des 15. Jahrhunderts Jodocus Winkelhofer und Georg Schwarz gibt. Aber nach Heuchlingers Templum honoris 1702 ist die gleiche Abbildung wie in der Linzer Handschrift reproduziert
Der 1480 gestorbene Winkelhofer war ab 1477 Abt in Kloster Lorch, siehe
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lorch1990bd1/0062
Abbildung und Wappen in einem Lorcher Chorbuch (sw):
http://www.bildindex.de/obj00043095.html
Unscharfe Farbabbildung:
http://www.schwaben-kultur.de/pdfs/2012-03.pdf
Epitaph (4 lateinische Verse) auf die beiden Mönche aus Heuchlinger in der Geschichte Alpirsbachs
http://books.google.de/books?id=flRIAAAAYAAJ&pg=PA101 (US)
Im Digitalisat Heuchlingers:
http://books.google.de/books?id=7CNqJPoRgTUC&pg=PA50
Zur Familie: Schulers Notare (1987), S. 518 mit falschem Todesdatum des Lorcher Abts.
KlausGraf - am Dienstag, 8. Januar 2013, 19:12 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Böhmers Aufsatz von 1849 ist online:
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11040856_00018.html
Desgleichen die Kompilation von FWE Roth 1908:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roth_deutsche_geschichtsblaetter.pdf
Aus der modernen Forschung hebe ich Müllers Bistumsgeschichtsscheibung (1998) und die Studien von Uta Goerlitz hervor. Trotz vieler Mängel unverzichtbar die GESCHICHTSQUELLEN, siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/232606290/
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11040856_00018.html
Desgleichen die Kompilation von FWE Roth 1908:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roth_deutsche_geschichtsblaetter.pdf
Aus der modernen Forschung hebe ich Müllers Bistumsgeschichtsscheibung (1998) und die Studien von Uta Goerlitz hervor. Trotz vieler Mängel unverzichtbar die GESCHICHTSQUELLEN, siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/232606290/
KlausGraf - am Samstag, 5. Januar 2013, 04:06 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 3. Januar 2013, 18:55 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ich werde nie wieder die Aufforderung zur Durchsicht der Korrekturfahne ignorieren, sollte ich nochmals etwas für literaturkritik.de rezensieren. Mea culpa! Zur Faksimileedition von Petermann Efferling „Kronica von der loblichen Eydtgnoschaft“ als Untertitel ist denn doch zu peinlich.
Die Rezension gilt:
Petermann Etterlin: Kronica von der loblichen Eydtgnoschaft Jr harkomen und sust seltzam strittenn und geschichten.
Herausgegegeben und mit einem Nachwort von Guy P. Marchal.
Georg Olms Verlag, Hildesheim 2011.
272 Seiten, 58,00 EUR.
ISBN-13: 9783487146652
http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=17315&ausgabe=201212
Zitat: Wer in dem Band blättert, kommt nicht umhin, sich die Frage zu stellen: Cui bono? Für die Wissenschaft ist er wertlos, da Eugen Grubers wissenschaftliche Edition des Werks (erschienen 1965) nach wie vor verbindlich ist und seit Jahren Digitalisate der in zwei Varianten vorliegenden Originalausgabe beim Münchner Digitalisierungszentrum im World Wide Web verfügbar sind. Laien werden in der Regel Probleme haben, die Frakturschrift zu lesen und Etterlins Deutsch zu verstehen. Ihnen wäre mit einer kommentierten Ausgabe in modernisierter Sprache eher geholfen gewesen. So drängt sich der Eindruck auf, dass der traditionsreiche Faksimileverlag hier ein reichlich überflüssiges „Coffee Table Book“ auf den Markt geworfen hat.
Zu Etterlins Chronik:
http://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege#Petermann_Etterlin

Die Rezension gilt:
Petermann Etterlin: Kronica von der loblichen Eydtgnoschaft Jr harkomen und sust seltzam strittenn und geschichten.
Herausgegegeben und mit einem Nachwort von Guy P. Marchal.
Georg Olms Verlag, Hildesheim 2011.
272 Seiten, 58,00 EUR.
ISBN-13: 9783487146652
http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=17315&ausgabe=201212
Zitat: Wer in dem Band blättert, kommt nicht umhin, sich die Frage zu stellen: Cui bono? Für die Wissenschaft ist er wertlos, da Eugen Grubers wissenschaftliche Edition des Werks (erschienen 1965) nach wie vor verbindlich ist und seit Jahren Digitalisate der in zwei Varianten vorliegenden Originalausgabe beim Münchner Digitalisierungszentrum im World Wide Web verfügbar sind. Laien werden in der Regel Probleme haben, die Frakturschrift zu lesen und Etterlins Deutsch zu verstehen. Ihnen wäre mit einer kommentierten Ausgabe in modernisierter Sprache eher geholfen gewesen. So drängt sich der Eindruck auf, dass der traditionsreiche Faksimileverlag hier ein reichlich überflüssiges „Coffee Table Book“ auf den Markt geworfen hat.
Zu Etterlins Chronik:
http://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege#Petermann_Etterlin

KlausGraf - am Montag, 24. Dezember 2012, 01:56 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Lehmann durfte sich im Jahrgang 2012 der ZGO ausbreiten, wobei unter Schwarzmaier dergleichen wohl nicht möglich gewesen wäre.
Ebenso wie Hans Bayer - siehe http://archiv.twoday.net/stories/38768067/ - darf Lehmann seine unsäglichen Aufsätze in seriösen landesgeschichtlichen Organen unterbringen, obwohl man ihm längst das Handwerk hätte legen sollen.
Welchen unglaublichen Stuss die früher angesehenen "Blätter für deutsche Landesgeschichte" von ihm 1994 zum Turnierwesen im 11. Jahrhundert (und Rüxner) abdruckten, kann man auch online nachlesen:
http://periodika.digitale-sammlungen.de/bdlg/Blatt_bsb00000334,00071.html
Zu weiteren Machwerken Lehmanns siehe den OPAC der Regesta Imperii (wenn nicht gerade offline, wie jetzt).
Einige Aufsätze in der Hohenzollerischen Heimat sind online:
http://www.hohenzollerischer-geschichtsverein.de/hohenz._heimat,107,107.html
Ebenso wie Hans Bayer - siehe http://archiv.twoday.net/stories/38768067/ - darf Lehmann seine unsäglichen Aufsätze in seriösen landesgeschichtlichen Organen unterbringen, obwohl man ihm längst das Handwerk hätte legen sollen.
Welchen unglaublichen Stuss die früher angesehenen "Blätter für deutsche Landesgeschichte" von ihm 1994 zum Turnierwesen im 11. Jahrhundert (und Rüxner) abdruckten, kann man auch online nachlesen:
http://periodika.digitale-sammlungen.de/bdlg/Blatt_bsb00000334,00071.html
Zu weiteren Machwerken Lehmanns siehe den OPAC der Regesta Imperii (wenn nicht gerade offline, wie jetzt).
Einige Aufsätze in der Hohenzollerischen Heimat sind online:
http://www.hohenzollerischer-geschichtsverein.de/hohenz._heimat,107,107.html
KlausGraf - am Mittwoch, 19. Dezember 2012, 03:44 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Pfeiffer S. 13 (ebenso Studt ZGO 1995, S. 163 Anm. 60) hat in seiner Stadtschreiberliste (ohne Belege)
Rabanus Blicker genannt Schmalkalder 1450-1496
http://de.slideshare.net/StadtASpeyer/albert-pfeiffer-das-archiv-der-stadt-speier-1912-10088242
In den Regesta Imperii (Heft Friedrich III. zu Speyer, bearbeitet von Joachim Kemper) kann ich ihn 1471/4 und 1490 belegen, siehe das Register
Schmalkalden, Raban (von ~ ), gen. Blicker, Stadtschreiber und Notar zu Speyer 17-248, 17-257, 17-258, 17-269, 17-270, 17-271, 17-272, 17-281, 17-346, 17-351
1471 August 28
"Rafan Smalkalden", Stadtschreiber, Zeuge in einem von dem öffentlichen Notar Eberhard Selbach, Kleriker der Diözese Speyer, ausgestellten Notariatsinstrument
http://www.regesta-imperii.de/id/1471-01-21_1_0_13_17_0_250_248
http://www.regesta-imperii.de/id/1471-08-08_2_0_13_17_0_259_257
http://www.regesta-imperii.de/id/1471-08-12_1_0_13_17_0_260_258
Digitalisat (mit Notariatszeichen von Eberhard Selbach) von Stadtarchiv Speyer, Hospitalurkunden Nr. 81
http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/DE-StaASpeyer/121U/171/charter
Zwei Dokumente (sicher Kriegsverlust) einst im Heilbronner Stadtarchiv vom gleichen Tag mit Nennung des Stadtschreibers als Zeuge im Heilbronner UB Bd. 1, S. 431
http://archive.org/stream/UrkundenbuchDerStadtHeilbronn1#page/n449/mode/2up
Durch Raban Blicker (1472) Dezember 5 in der Speyerer "scribaria" beglaubigte Abschrift im StadtA Speyer (Sign. 1A Nr. 840/I fol. 33r-v u. 35r)
http://www.regesta-imperii.de/id/1472-11-05_1_0_13_17_0_271_269
weitere Beglaubigungen am gleichen Tag:
http://www.regesta-imperii.de/id/1472-11-05_2_0_13_17_0_272_270
desgleichen
http://www.regesta-imperii.de/id/1472-11-09_1_0_13_17_0_274_272
1474 August 8 Notariatsinstrument des Unterschreibers und Notars zu Speyer Raban Schmalkalden gen. Blicker ("Rafann Smalkalden genant Blicker")
http://www.regesta-imperii.de/id/1474-06-16_1_0_13_17_0_283_281
Digitalisat von Stadtarchiv Speyer 1 U Nr. 223
http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/DE-StaASpeyer/1Uchron/181/charter
Siehe Abbildung unten.
“Ladung der Speyerer Ratsherren und Ratsfreunde Dr. decr. Thomas Dornberg, Dr. Friedrich Fritz d.Ä., Debolt Borlin, Jakob Burckhart, Niclas zum Hag, Daniel von (Kaisers-)Lautern, Jost Diel, Peter Drach, Adam Zan und des Stadtschreibers Raban von Schmalkalden durch Jakob von Gochsheim von 1490 Juni 3”
http://www.regesta-imperii.de/id/1489-08-06_1_0_13_17_0_348_346
Bl. 33r entspricht Bild 34 im Digitalisat von Stadtarchiv Speyer 1 U Nr. 294
http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/DE-StaASpeyer/1Uchron/245/charter
(bei mir nur im Flash-Viewer sichtbar)
(Ob Dorniberg tatsächlich Ratsherr heißt, habe ich in der Quelle nicht überprüft.)
Notariatsinstrument von dem öffentlichen Notar und Stadtschreiber zu Speyer Raban Schmalkalden von 1490 Dezember 21
http://www.regesta-imperii.de/id/1490-11-22_1_0_13_17_0_353_351
Digitalisat mit Notariatszeichen (Stadtarchiv Speyer 1 U Nr. 292)
http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/DE-StaASpeyer/1Uchron/243/charter
Familie
Zur Familie des Stadtschreibers rechne ich den 1522 verstorbenen Kleriker Dietrich Schmalkalden (Busch/Glasschröder, Chorregel Bd. 1, 1923, S. 453f.; Bd. 2, 1926, S. 94), der 1483 in Heidelberg immatrikuliert wurde (mit Herkunft Speyer), siehe Toepke I, S. 373
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/matrikel1386/0451
Er war ab 1488 Domvikar in Speyer und wird mehrfach in der Edition der Domkapitelsprotokolle erwähnt:
http://books.google.de/books?id=170rAQAAIAAJ&q=schmalkal
Es dürfte sich um den Sohn des Stadtschreibers handeln.
Da Raban 1474 ausdrücklich Unterschreiber heißt, wird er wohl nie Leiter der städtischen Kanzlei, also "eigentlicher" Stadtschreiber, gewesen sein. Dass es mehrere gleichzeitig tätige Stadtschreiber gab, erklärt auch die Überschneidung der Belegzeiträume in der oben zitierten Liste Pfeiffers. Zur Hierarchie der Speyerer Stadtschreiber siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/49587546/
Frühere Beiträge zu Speyerer Stadtschreibern:
http://archiv.twoday.net/stories/49586414/ (Joh. Selbach)
http://archiv.twoday.net/stories/49587546/ (Michel Geilfus)
http://archiv.twoday.net/stories/75239842/ (Paul Melser)
#forschung

Rabanus Blicker genannt Schmalkalder 1450-1496
http://de.slideshare.net/StadtASpeyer/albert-pfeiffer-das-archiv-der-stadt-speier-1912-10088242
In den Regesta Imperii (Heft Friedrich III. zu Speyer, bearbeitet von Joachim Kemper) kann ich ihn 1471/4 und 1490 belegen, siehe das Register
Schmalkalden, Raban (von ~ ), gen. Blicker, Stadtschreiber und Notar zu Speyer 17-248, 17-257, 17-258, 17-269, 17-270, 17-271, 17-272, 17-281, 17-346, 17-351
1471 August 28
"Rafan Smalkalden", Stadtschreiber, Zeuge in einem von dem öffentlichen Notar Eberhard Selbach, Kleriker der Diözese Speyer, ausgestellten Notariatsinstrument
http://www.regesta-imperii.de/id/1471-01-21_1_0_13_17_0_250_248
http://www.regesta-imperii.de/id/1471-08-08_2_0_13_17_0_259_257
http://www.regesta-imperii.de/id/1471-08-12_1_0_13_17_0_260_258
Digitalisat (mit Notariatszeichen von Eberhard Selbach) von Stadtarchiv Speyer, Hospitalurkunden Nr. 81
http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/DE-StaASpeyer/121U/171/charter
Zwei Dokumente (sicher Kriegsverlust) einst im Heilbronner Stadtarchiv vom gleichen Tag mit Nennung des Stadtschreibers als Zeuge im Heilbronner UB Bd. 1, S. 431
http://archive.org/stream/UrkundenbuchDerStadtHeilbronn1#page/n449/mode/2up
Durch Raban Blicker (1472) Dezember 5 in der Speyerer "scribaria" beglaubigte Abschrift im StadtA Speyer (Sign. 1A Nr. 840/I fol. 33r-v u. 35r)
http://www.regesta-imperii.de/id/1472-11-05_1_0_13_17_0_271_269
weitere Beglaubigungen am gleichen Tag:
http://www.regesta-imperii.de/id/1472-11-05_2_0_13_17_0_272_270
desgleichen
http://www.regesta-imperii.de/id/1472-11-09_1_0_13_17_0_274_272
1474 August 8 Notariatsinstrument des Unterschreibers und Notars zu Speyer Raban Schmalkalden gen. Blicker ("Rafann Smalkalden genant Blicker")
http://www.regesta-imperii.de/id/1474-06-16_1_0_13_17_0_283_281
Digitalisat von Stadtarchiv Speyer 1 U Nr. 223
http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/DE-StaASpeyer/1Uchron/181/charter
Siehe Abbildung unten.
“Ladung der Speyerer Ratsherren und Ratsfreunde Dr. decr. Thomas Dornberg, Dr. Friedrich Fritz d.Ä., Debolt Borlin, Jakob Burckhart, Niclas zum Hag, Daniel von (Kaisers-)Lautern, Jost Diel, Peter Drach, Adam Zan und des Stadtschreibers Raban von Schmalkalden durch Jakob von Gochsheim von 1490 Juni 3”
http://www.regesta-imperii.de/id/1489-08-06_1_0_13_17_0_348_346
Bl. 33r entspricht Bild 34 im Digitalisat von Stadtarchiv Speyer 1 U Nr. 294
http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/DE-StaASpeyer/1Uchron/245/charter
(bei mir nur im Flash-Viewer sichtbar)
(Ob Dorniberg tatsächlich Ratsherr heißt, habe ich in der Quelle nicht überprüft.)
Notariatsinstrument von dem öffentlichen Notar und Stadtschreiber zu Speyer Raban Schmalkalden von 1490 Dezember 21
http://www.regesta-imperii.de/id/1490-11-22_1_0_13_17_0_353_351
Digitalisat mit Notariatszeichen (Stadtarchiv Speyer 1 U Nr. 292)
http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/DE-StaASpeyer/1Uchron/243/charter
Familie
Zur Familie des Stadtschreibers rechne ich den 1522 verstorbenen Kleriker Dietrich Schmalkalden (Busch/Glasschröder, Chorregel Bd. 1, 1923, S. 453f.; Bd. 2, 1926, S. 94), der 1483 in Heidelberg immatrikuliert wurde (mit Herkunft Speyer), siehe Toepke I, S. 373
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/matrikel1386/0451
Er war ab 1488 Domvikar in Speyer und wird mehrfach in der Edition der Domkapitelsprotokolle erwähnt:
http://books.google.de/books?id=170rAQAAIAAJ&q=schmalkal
Es dürfte sich um den Sohn des Stadtschreibers handeln.
Da Raban 1474 ausdrücklich Unterschreiber heißt, wird er wohl nie Leiter der städtischen Kanzlei, also "eigentlicher" Stadtschreiber, gewesen sein. Dass es mehrere gleichzeitig tätige Stadtschreiber gab, erklärt auch die Überschneidung der Belegzeiträume in der oben zitierten Liste Pfeiffers. Zur Hierarchie der Speyerer Stadtschreiber siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/49587546/
Frühere Beiträge zu Speyerer Stadtschreibern:
http://archiv.twoday.net/stories/49586414/ (Joh. Selbach)
http://archiv.twoday.net/stories/49587546/ (Michel Geilfus)
http://archiv.twoday.net/stories/75239842/ (Paul Melser)
#forschung

KlausGraf - am Samstag, 15. Dezember 2012, 23:48 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Drei Kasseler Handschriften (16./17. Jahrhundert) sind jetzt online:
http://www.handschriftencensus.de/werke/5255
Zu Nuhn
http://www.libreka.de/9783110107548/644 (Peter Johanek, ²VL)
http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_03716.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Nuhn (etwas laienhaft)
Von dem Werk liegt nur ein unvollständiger alter Druck (durch Senckenberg, Selecta iuris III, 1735, S. 45-49, 301-514) vor:
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10561348_00049.html

http://www.handschriftencensus.de/werke/5255
Zu Nuhn
http://www.libreka.de/9783110107548/644 (Peter Johanek, ²VL)
http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_03716.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Nuhn (etwas laienhaft)
Von dem Werk liegt nur ein unvollständiger alter Druck (durch Senckenberg, Selecta iuris III, 1735, S. 45-49, 301-514) vor:
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10561348_00049.html
KlausGraf - am Donnerstag, 13. Dezember 2012, 14:29 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen