Landesgeschichte
http://www.hr-lavater.ch/2014/07/05/register-zofinger-neujahrsblatt/
Zofingen ist eine winzige Stadt zwischen Deutschland und Italien.
Zofingen ist eine winzige Stadt zwischen Deutschland und Italien.
KlausGraf - am Samstag, 5. Juli 2014, 22:44 - Rubrik: Landesgeschichte
http://www.watson.ch/Front/articles/699182286-100%27000-feierten-am-Winterthurer-Albanifest
Es gilt als das größte Altstadtfest Europas.
Auf http://www.albanifest.ch/albanifest/index.php steht zu lesen:
"Im Jahre 286 wurde der heilige Albanus während der Christenverfolgung hingerichtet. Albanus gehörte zu den 3 Heiligen, denen unsere Stadtkirche geweiht ist. Später wurde er zum Schutzpatron der Stadt Winterthur erkoren. Am Gedenktag des Albanus (22.6.1264) verlieh Rudolf von Habsburg der Stadt einen Freiheitsbrief. Von da an wurde dieses Ereignis jeweils am Albanustag gefeiert. Das Albanifest wie wir es heute kennen wurde 1971 lanciert und gilt als Europas grösstes, alljährlich wiederkehrendes Stadtfest."
"St. Alban, St. Pankratius und St. Laurentius sind die drei Schutzheiligen der Stadt Winterthur. St. Pankratius ist auch Patron der Winterthurer Stadtkirche. Die drei sind auf einem Gemälde aus dem Jahre 1490 an der Decke der Sakristei im Brustbild dargestellt."
http://www.winterthur-glossar.ch/app/default/pub/fw.action/wine.article?ce_id=119&ce_name=Person
Mehr zur Albanus-Verehrung in Winterthur:
http://www.winterthur-glossar.ch/app/default/pub/fw.action/wine.article?ce_id=117&ce_name=Building
Hauptpatron der Stadtkirche ist Laurentius, Nebenpatrone sind Pankratius und Albanus.
Schon Waser 1779 sagt ausdrücklich, Albanus sei der "Schutz-Patron" Winterthurs.
http://books.google.de/books?id=BYNEAAAAcAAJ&pg=PA179
Um 1700 zählte Albani zu den "solennen" Ratstagen:
http://books.google.de/books?id=buxYAAAAcAAJ&pg=PA153
Damals wurden die Verordnungen auf Albani der Bürgerschaft in der Kirche vorgelesen:
http://books.google.de/books?id=vetYAAAAcAAJ&pg=PA88
http://books.google.de/books?id=Vt1YAAAAcAAJ&pg=PA55
Albanus erscheint auch als Vorname von Winterthurer Bürgern im 15./16. Jahrhundert (teste Google).
Zu anderen Stadtpatronen im deutschsprachigen Raum:
http://archiv.twoday.net/search?q=stadtpatron

Es gilt als das größte Altstadtfest Europas.
Auf http://www.albanifest.ch/albanifest/index.php steht zu lesen:
"Im Jahre 286 wurde der heilige Albanus während der Christenverfolgung hingerichtet. Albanus gehörte zu den 3 Heiligen, denen unsere Stadtkirche geweiht ist. Später wurde er zum Schutzpatron der Stadt Winterthur erkoren. Am Gedenktag des Albanus (22.6.1264) verlieh Rudolf von Habsburg der Stadt einen Freiheitsbrief. Von da an wurde dieses Ereignis jeweils am Albanustag gefeiert. Das Albanifest wie wir es heute kennen wurde 1971 lanciert und gilt als Europas grösstes, alljährlich wiederkehrendes Stadtfest."
"St. Alban, St. Pankratius und St. Laurentius sind die drei Schutzheiligen der Stadt Winterthur. St. Pankratius ist auch Patron der Winterthurer Stadtkirche. Die drei sind auf einem Gemälde aus dem Jahre 1490 an der Decke der Sakristei im Brustbild dargestellt."
http://www.winterthur-glossar.ch/app/default/pub/fw.action/wine.article?ce_id=119&ce_name=Person
Mehr zur Albanus-Verehrung in Winterthur:
http://www.winterthur-glossar.ch/app/default/pub/fw.action/wine.article?ce_id=117&ce_name=Building
Hauptpatron der Stadtkirche ist Laurentius, Nebenpatrone sind Pankratius und Albanus.
Schon Waser 1779 sagt ausdrücklich, Albanus sei der "Schutz-Patron" Winterthurs.
http://books.google.de/books?id=BYNEAAAAcAAJ&pg=PA179
Um 1700 zählte Albani zu den "solennen" Ratstagen:
http://books.google.de/books?id=buxYAAAAcAAJ&pg=PA153
Damals wurden die Verordnungen auf Albani der Bürgerschaft in der Kirche vorgelesen:
http://books.google.de/books?id=vetYAAAAcAAJ&pg=PA88
http://books.google.de/books?id=Vt1YAAAAcAAJ&pg=PA55
Albanus erscheint auch als Vorname von Winterthurer Bürgern im 15./16. Jahrhundert (teste Google).
Zu anderen Stadtpatronen im deutschsprachigen Raum:
http://archiv.twoday.net/search?q=stadtpatron

KlausGraf - am Sonntag, 29. Juni 2014, 17:41 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Familie Leiprecht hat die kompletten Ausgaben der Allgäuer Kriegschronik von1914 - 1918 digitalisiert und als PDF auf Ihrer Homepage eingestellt.
Dies ist im Rahmen der Geschichte des 1. Weltkriegs ein sehr löbliches Projekt.
Dies ist im Rahmen der Geschichte des 1. Weltkriegs ein sehr löbliches Projekt.
FredLo - am Freitag, 20. Juni 2014, 16:55 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Auf den ersten Blick ist der von Felix Josef Lipowsky (1764-1842) - GND - 1818 in seinem Buch über Herzog Christoph von Bayern abgedruckte Text "Auszüge aus einer Chronik vom Lande Baiern was zu meiner Zeit sich anbegeben" (S. 159-167) unverdächtig.
http://bavarica.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10483962_00171.html
Lipowsky will die Handschrift von dem Ingolstädter Stadtsyndikus Ignaz Hübner erhalten haben, der sie drucken wollte, was aber durch seinen Tod 1815 vereitelt worden sei. Die ihm mitgeteilte stamme aus dem Anfang oder der Mitte des 17. Jahrhunderts und trage den Schreibervermerk J. M. S. J. (Kopist war also ein Jesuit J. M.). Hübner habe den Chronisten des Landshuter Erbfolgekriegs, Andreas Zayner, Stadtschreiber zu Ingolstadt, als Verfasser vermutet (S. 159f.).
Die Handschrift ist seither nicht wieder aufgetaucht; da Hübner verstorben war, waren Nachfragen bei Hübner nach dem Stück zwecklos.
Lipowsky war ein seriöser Autor und Archivar (er betreute das landständische Archiv).
Die Chronik ist kaum benutzt worden. In einer Rezension 1819 wurde eine bemerkenswerte Stelle zur Idee des Vaterlands hervorgehoben:
http://books.google.de/books?id=l7ZFAAAAcAAJ&pg=PA143#v=onepage&q&f=false
Roth von Schreckenstein zitierte sie zum Löwlerbund:
http://books.google.de/books?id=LngAAAAAcAAJ&pg=PA136
In der Ausgabe der Nürnberger Deichsler-Chronik (S. 571) wurde sie ebenfalls herangezogen:
https://archive.org/stream/diechronikender09kommgoog#page/n141/mode/2up
Riezler, ein ausgezeichneter Kenner der bayerischen Historiographie, würdigte den Text, indem er ihm eine Fußnote in seiner Geschichte Baierns (III, S. 912) widmete. Er fand die Charaktere der vier Münchner Herzöge "nicht übel gezeichnet".
https://archive.org/stream/RiezlerGeschichteBaiernsBd3/Riezler%20Geschichte_Baierns_Bd_3#page/n927/mode/2up
Im 20. Jahrhundert war der Text so gut wie vergessen. Helga Czerny erwähnte ihn 2005 (Der Tod ... S. 211).
Eine quellenkundliche Analyse liegt nicht vor. Ich werde diese Lücke nicht füllen können, sondern mich auf einige Beobachtungen beschränken, die einen Fälschungsverdacht begründen könnten.
Der Text bietet viel zu interessante Details. Ein ganz schwaches Argument! Ich bin bei Fälschungen vorsichtiger geworden, seit ich eine ziemlich echte, wenngleich höchst ungewöhnliche Urkunde zum Heroldswesen als Fälschung erklärte (unveröffentlicht).
Erheblich bedenklicher stimmt der Umstand, dass S. 165 ohne nähere Kennzeichnung zwei lateinische Verse des dänischen Dichters Ludvig Holberg in den Text eingestreut werden:
https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22spartae+quod+gravitas%22
Man kann natürlich argumentieren, dass es sich dabei um einen nicht gekennzeichneten Kommentar des Herausgebers (Hübner oder Lipowsky) handelt.
Zu 1492 wird als Jurist der Löwenritter Dr. Georg Lamparter erwähnt, der als Bayer und früherer Kanzler des Herzogs von Württemberg vorgestellt wird. Vor 1495 gab es noch keinen Herzog von Württemberg, und Lamparter wurde erst nach dem Tod Eberhards im Bart 1496 württembergischer Kanzler. Er war auch kein Bayer, sondern stammte aus Biberach (war also ein Oberschwabe) während Lipowsky ihn in der Fußnote hypothetisch den Sohn des Münchner Arztes Peter Lamparter nennt. Um diese Vermutung abzusichern, wäre es schlüssig, ihn als Bayer zu bezeichnen.
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=136241948 (insbesondere Wikipedia)
[ http://archiv.twoday.net/stories/1022374158/ ]
Bei Krenner heißt er nur Dr. Lamparter:
http://geschichte.digitale-sammlungen.de/landtag1429/seite/bsb00008572_00067
Nach Dollinger/Stark starb Martha von Werdenberg wohl vor ihrem Gemahl, dem letzten Abensberger Grafen Nikolaus
http://books.google.de/books?id=TJhCAAAAcAAJ&pg=PA209
während unsere Quelle S. 161 angibt, sie sei "vor enntsetzn und Leydt" über den Tod ihres Manns gestorben. Was über ihre Stiftungen gesagt klingt wie eine Lesefrucht aus dem bei Krenner veröffentlichten Testament, das Lipowsky in der Note nachweist. Gleiches gilt für den Tadel des Christoph von Degenberg (nicht "Degenfelt", so die Quelle S. 160), zu dem Lipowsky Sunthaim aus Oefele zitiert:
http://www.literature.at/viewer.alo?objid=14325&viewmode=fullscreen&scale=3.33&rotate=&page=583
Besonders schwierig ist die sprachliche Gestalt zu beurteilen, da eine spätmittelalterliche Vorlage durch den Abschreiber im 17. Jahrhundert geglättet worden sein kann. Siehe dazu auch meine Ausführungen zu dem von Trautmann gefälschten Pilgramsbuch Herzog Christophs:
http://archiv.twoday.net/stories/790549607/
Ein "Bauchgefühl" lässt mich dazu tendieren, dass die Sprache und die resümierende Darstellungstechnik eher unmittelalterlich ist. Die üblichen Verständigungshürden fehlen.
Reichen diese Indizien, um die Beweislast umzukehren? Dann müsste derjenige, der den Text als authentische Quelle nützen wollte, seine Echtheit zeigen.
Ich bin mir nicht sicher, verdächtig erscheint mir der Text aber schon. Und auf jeden Fall kann - wie die Lamparter-Stelle gezeigt hat - keine unbearbeitete zeitgleiche Niederschrift vorliegen.
Meinungen?
#forschung
Fälschungen in Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/96987511/

http://bavarica.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10483962_00171.html
Lipowsky will die Handschrift von dem Ingolstädter Stadtsyndikus Ignaz Hübner erhalten haben, der sie drucken wollte, was aber durch seinen Tod 1815 vereitelt worden sei. Die ihm mitgeteilte stamme aus dem Anfang oder der Mitte des 17. Jahrhunderts und trage den Schreibervermerk J. M. S. J. (Kopist war also ein Jesuit J. M.). Hübner habe den Chronisten des Landshuter Erbfolgekriegs, Andreas Zayner, Stadtschreiber zu Ingolstadt, als Verfasser vermutet (S. 159f.).
Die Handschrift ist seither nicht wieder aufgetaucht; da Hübner verstorben war, waren Nachfragen bei Hübner nach dem Stück zwecklos.
Lipowsky war ein seriöser Autor und Archivar (er betreute das landständische Archiv).
Die Chronik ist kaum benutzt worden. In einer Rezension 1819 wurde eine bemerkenswerte Stelle zur Idee des Vaterlands hervorgehoben:
http://books.google.de/books?id=l7ZFAAAAcAAJ&pg=PA143#v=onepage&q&f=false
Roth von Schreckenstein zitierte sie zum Löwlerbund:
http://books.google.de/books?id=LngAAAAAcAAJ&pg=PA136
In der Ausgabe der Nürnberger Deichsler-Chronik (S. 571) wurde sie ebenfalls herangezogen:
https://archive.org/stream/diechronikender09kommgoog#page/n141/mode/2up
Riezler, ein ausgezeichneter Kenner der bayerischen Historiographie, würdigte den Text, indem er ihm eine Fußnote in seiner Geschichte Baierns (III, S. 912) widmete. Er fand die Charaktere der vier Münchner Herzöge "nicht übel gezeichnet".
https://archive.org/stream/RiezlerGeschichteBaiernsBd3/Riezler%20Geschichte_Baierns_Bd_3#page/n927/mode/2up
Im 20. Jahrhundert war der Text so gut wie vergessen. Helga Czerny erwähnte ihn 2005 (Der Tod ... S. 211).
Eine quellenkundliche Analyse liegt nicht vor. Ich werde diese Lücke nicht füllen können, sondern mich auf einige Beobachtungen beschränken, die einen Fälschungsverdacht begründen könnten.
Der Text bietet viel zu interessante Details. Ein ganz schwaches Argument! Ich bin bei Fälschungen vorsichtiger geworden, seit ich eine ziemlich echte, wenngleich höchst ungewöhnliche Urkunde zum Heroldswesen als Fälschung erklärte (unveröffentlicht).
Erheblich bedenklicher stimmt der Umstand, dass S. 165 ohne nähere Kennzeichnung zwei lateinische Verse des dänischen Dichters Ludvig Holberg in den Text eingestreut werden:
https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22spartae+quod+gravitas%22
Man kann natürlich argumentieren, dass es sich dabei um einen nicht gekennzeichneten Kommentar des Herausgebers (Hübner oder Lipowsky) handelt.
Zu 1492 wird als Jurist der Löwenritter Dr. Georg Lamparter erwähnt, der als Bayer und früherer Kanzler des Herzogs von Württemberg vorgestellt wird. Vor 1495 gab es noch keinen Herzog von Württemberg, und Lamparter wurde erst nach dem Tod Eberhards im Bart 1496 württembergischer Kanzler. Er war auch kein Bayer, sondern stammte aus Biberach (war also ein Oberschwabe) während Lipowsky ihn in der Fußnote hypothetisch den Sohn des Münchner Arztes Peter Lamparter nennt. Um diese Vermutung abzusichern, wäre es schlüssig, ihn als Bayer zu bezeichnen.
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=136241948 (insbesondere Wikipedia)
[ http://archiv.twoday.net/stories/1022374158/ ]
Bei Krenner heißt er nur Dr. Lamparter:
http://geschichte.digitale-sammlungen.de/landtag1429/seite/bsb00008572_00067
Nach Dollinger/Stark starb Martha von Werdenberg wohl vor ihrem Gemahl, dem letzten Abensberger Grafen Nikolaus
http://books.google.de/books?id=TJhCAAAAcAAJ&pg=PA209
während unsere Quelle S. 161 angibt, sie sei "vor enntsetzn und Leydt" über den Tod ihres Manns gestorben. Was über ihre Stiftungen gesagt klingt wie eine Lesefrucht aus dem bei Krenner veröffentlichten Testament, das Lipowsky in der Note nachweist. Gleiches gilt für den Tadel des Christoph von Degenberg (nicht "Degenfelt", so die Quelle S. 160), zu dem Lipowsky Sunthaim aus Oefele zitiert:
http://www.literature.at/viewer.alo?objid=14325&viewmode=fullscreen&scale=3.33&rotate=&page=583
Besonders schwierig ist die sprachliche Gestalt zu beurteilen, da eine spätmittelalterliche Vorlage durch den Abschreiber im 17. Jahrhundert geglättet worden sein kann. Siehe dazu auch meine Ausführungen zu dem von Trautmann gefälschten Pilgramsbuch Herzog Christophs:
http://archiv.twoday.net/stories/790549607/
Ein "Bauchgefühl" lässt mich dazu tendieren, dass die Sprache und die resümierende Darstellungstechnik eher unmittelalterlich ist. Die üblichen Verständigungshürden fehlen.
Reichen diese Indizien, um die Beweislast umzukehren? Dann müsste derjenige, der den Text als authentische Quelle nützen wollte, seine Echtheit zeigen.
Ich bin mir nicht sicher, verdächtig erscheint mir der Text aber schon. Und auf jeden Fall kann - wie die Lamparter-Stelle gezeigt hat - keine unbearbeitete zeitgleiche Niederschrift vorliegen.
Meinungen?
#forschung
Fälschungen in Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/96987511/

KlausGraf - am Donnerstag, 12. Juni 2014, 21:59 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Jiri Hönes: "Tief unten zieht die grüne Nagoldwelle..." Karl Doll. Leben und Werk, Sagen und Sonette. Calw: Kreisarchiv 2014. 168 S. mit zahlreichen SW-Abbildungen. ISBN 978-3-00-045852-1. 10 Euro.
Kaum einmal legte ich bei einer lokalgeschichtlichen Publikation diese mit so viel Zustimmung aus der Hand. Hönes, dessen Webpublikationen ( http://www.sagenballaden.de, http://schlehen.hypotheses.org/) schon häufiger zu rühmen waren, hat eine sehr gründlich recherchierte Biographie des Calwer Oberamtmanns Karl Doll (1834-1910) vorgelegt. Bevor er eine Stelle am Stuttgarter Innenministerium antrat, wirkte der in Ulm geborene Verwaltungsbeamte 1872 bis 1879 in Calw.
Zahlreiche gedruckte und handschriftliche Materialien (vor allem aus dem Landesarchiv Baden-Württemberg und dem DLA Marbach) wurden umsichtig ausgewertet, alle Erkenntnisse sind in 363 Anmerkungen mustergültig belegt. Da Doll Sagenballaden dichtete und Prosasagen in Birlingers Alemannia publizierte, ist der Band auch eine wichtige Bereicherung für die wissenschaftliche Sagenforschung.
Hönes ediert (und kommentiert kundig) die nur in je einem Exemplar überlieferten Sonette-Drucke aus den 1870er Jahren sowie alle von Doll veröffentlichten Sagen.
Dem Buch ist weite Verbreitung und möglichst rasch eine Open-Access-Version zu wünschen.
Bereits jetzt bietet die neue Website http://karldoll.de/ höchst reichhaltige Inhalte. Zur Verfügung stehen die Publikationen Dolls, teils als Faksimile, teils als E-Texte, wobei es wünschenswert wäre, Digitalisate der seltenen Sonette-Drucke online zu haben (z.B. für Wikisource´, wo es leider noch keinen Artikel über Doll gibt). Etwas mehr als die Biographie auf doll.de bietet der Beitrag
http://sagenballaden.de/karl-doll-glockenheimweh
Dort ist auch die maßgebliche Version meiner "Schwabensagen" (2007) zitiert, während im Buch (Anm. 161) die gedruckte Erstfassung angeführt wird. Man sollte aber auch in gedruckten Publikationen die neueste und beste Version berücksichtigen.
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3459/

Aus den "Sonetten vom Schwarzwald":
Hirsau.
Es glänzt das Thal, umkränzt von waldʼgen Hügeln,
Der Fluß, die Luft − nur lichte Wölkchen schweben:
Die klugen Mönchlein wußten, gottergeben,
Der Erde schönste Fleckchen auszuklügeln.
Hell stund mit Kreuzgang, Thürmen, Höfen, Flügeln,
Das Kloster da. War das ein frommes Leben!
Hei, Geistesarbeit bei Brevie[r] und Reben!
Gern stiegen Fürsten selbst hier aus den Bügeln.
Der Greiner auch: ob mehr ihn Orgelschallen,
Ihn Klosterwein ergetzt, man weiß es nimmer;
Denn längst in Schutt ist all die Pracht zerfallen.
Ein Sänger sang davon − er schläft für immer.
Grün steigt die Ulme noch aus Trümmerhallen,
Und breitet schweigsam ihren Blätterschimmer.
***
Über Hirsau in Archivalia:
http://archiv.twoday.net/search?q=hirsau
Kaum einmal legte ich bei einer lokalgeschichtlichen Publikation diese mit so viel Zustimmung aus der Hand. Hönes, dessen Webpublikationen ( http://www.sagenballaden.de, http://schlehen.hypotheses.org/) schon häufiger zu rühmen waren, hat eine sehr gründlich recherchierte Biographie des Calwer Oberamtmanns Karl Doll (1834-1910) vorgelegt. Bevor er eine Stelle am Stuttgarter Innenministerium antrat, wirkte der in Ulm geborene Verwaltungsbeamte 1872 bis 1879 in Calw.
Zahlreiche gedruckte und handschriftliche Materialien (vor allem aus dem Landesarchiv Baden-Württemberg und dem DLA Marbach) wurden umsichtig ausgewertet, alle Erkenntnisse sind in 363 Anmerkungen mustergültig belegt. Da Doll Sagenballaden dichtete und Prosasagen in Birlingers Alemannia publizierte, ist der Band auch eine wichtige Bereicherung für die wissenschaftliche Sagenforschung.
Hönes ediert (und kommentiert kundig) die nur in je einem Exemplar überlieferten Sonette-Drucke aus den 1870er Jahren sowie alle von Doll veröffentlichten Sagen.
Dem Buch ist weite Verbreitung und möglichst rasch eine Open-Access-Version zu wünschen.
Bereits jetzt bietet die neue Website http://karldoll.de/ höchst reichhaltige Inhalte. Zur Verfügung stehen die Publikationen Dolls, teils als Faksimile, teils als E-Texte, wobei es wünschenswert wäre, Digitalisate der seltenen Sonette-Drucke online zu haben (z.B. für Wikisource´, wo es leider noch keinen Artikel über Doll gibt). Etwas mehr als die Biographie auf doll.de bietet der Beitrag
http://sagenballaden.de/karl-doll-glockenheimweh
Dort ist auch die maßgebliche Version meiner "Schwabensagen" (2007) zitiert, während im Buch (Anm. 161) die gedruckte Erstfassung angeführt wird. Man sollte aber auch in gedruckten Publikationen die neueste und beste Version berücksichtigen.
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3459/

Aus den "Sonetten vom Schwarzwald":
Hirsau.
Es glänzt das Thal, umkränzt von waldʼgen Hügeln,
Der Fluß, die Luft − nur lichte Wölkchen schweben:
Die klugen Mönchlein wußten, gottergeben,
Der Erde schönste Fleckchen auszuklügeln.
Hell stund mit Kreuzgang, Thürmen, Höfen, Flügeln,
Das Kloster da. War das ein frommes Leben!
Hei, Geistesarbeit bei Brevie[r] und Reben!
Gern stiegen Fürsten selbst hier aus den Bügeln.
Der Greiner auch: ob mehr ihn Orgelschallen,
Ihn Klosterwein ergetzt, man weiß es nimmer;
Denn längst in Schutt ist all die Pracht zerfallen.
Ein Sänger sang davon − er schläft für immer.
Grün steigt die Ulme noch aus Trümmerhallen,
Und breitet schweigsam ihren Blätterschimmer.
***
Über Hirsau in Archivalia:
http://archiv.twoday.net/search?q=hirsau
KlausGraf - am Donnerstag, 12. Juni 2014, 18:56 - Rubrik: Landesgeschichte
Dieses bequeme Prinzip der überregionalen Forschung, Ergebnisse der Regional- und Lokalliteratur zu ignorieren, sprach der zu früh verewigte Franz Staab in einem Aufsatz über angebliche Juden in der Pfalz (2002) in den Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz an (S. 80):
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a144712.pdf
Für meinen Nawer-Aufsatz 2010
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8068/
hatte ich noch vergeblich nach der Fundstelle der treffenden Wendung "Regionalia non leguntur" (ich erinnerte mich nur, sie einmal bei Staab gelesen zu haben) gefahndet. Nun wirft sie eine Google-Suche aus.
Vorbild war die lateinische Sentenz Graeca (sunt) non leguntur:
http://de.wikipedia.org/?title=Liste_lateinischer_Phrasen/G#Graeca
Es gibt dazu teste Google weitere Abwandlungen (Polonica, Slavica, Physica, Catholica usw.).
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a144712.pdf
Für meinen Nawer-Aufsatz 2010
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8068/
hatte ich noch vergeblich nach der Fundstelle der treffenden Wendung "Regionalia non leguntur" (ich erinnerte mich nur, sie einmal bei Staab gelesen zu haben) gefahndet. Nun wirft sie eine Google-Suche aus.
Vorbild war die lateinische Sentenz Graeca (sunt) non leguntur:
http://de.wikipedia.org/?title=Liste_lateinischer_Phrasen/G#Graeca
Es gibt dazu teste Google weitere Abwandlungen (Polonica, Slavica, Physica, Catholica usw.).
KlausGraf - am Mittwoch, 4. Juni 2014, 12:01 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://ordensgeschichte.hypotheses.org/7271
Erwähnte ich schon, dass ich am Mittwoch im Hirsauer Klostermuseum um 20 Uhr über Trithemius referiere?

Erwähnte ich schon, dass ich am Mittwoch im Hirsauer Klostermuseum um 20 Uhr über Trithemius referiere?

KlausGraf - am Dienstag, 3. Juni 2014, 17:29 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Der Seelsorger forderte dazu auf, die Stadtkirche und ihre Einmaligkeit zu entdecken. Verschiedene Wege möchte der Pfarrer im Sponsorenbereich gehen. So könne er sich Patenschaften für die historisch wertvollen und zahlreichen Figuren in der Kirche vorstellen. Als Beispiel sei der heilige Donatus genannt, der Stadtpatron von Bräunlingen, gestiftet im Jahre 1684 vom Bräunlinger Oberschultheissen Johann Konrad Gumpp aus Innsbruck."
http://www.suedkurier.de/region/schwarzwald-baar-heuberg/braeunlingen/Foerderverein-tagt-zu-Sanierung;art372509,6961676
Über Donatus als Stadtpatron von Bräunlingen auf der Baar nahe bei Donaueschingen habe ich in meinen Aufzeichnungen zu den Ortspatronen der Diözese Freiburg nichts gefunden. Er wird auch im Realschematismus von 1939 nicht als solcher erwähnt.
Ob es sich um einen Bräunlinger Katakombenheiligen oder um den bekannten Donatus von Münstereifel handelt?
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=stadtpatron
http://www.suedkurier.de/region/schwarzwald-baar-heuberg/braeunlingen/Foerderverein-tagt-zu-Sanierung;art372509,6961676
Über Donatus als Stadtpatron von Bräunlingen auf der Baar nahe bei Donaueschingen habe ich in meinen Aufzeichnungen zu den Ortspatronen der Diözese Freiburg nichts gefunden. Er wird auch im Realschematismus von 1939 nicht als solcher erwähnt.
Ob es sich um einen Bräunlinger Katakombenheiligen oder um den bekannten Donatus von Münstereifel handelt?
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=stadtpatron
KlausGraf - am Freitag, 23. Mai 2014, 02:16 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ortenburg Reichsgrafschaft und 450 Jahre Reformation 1563-2013. Ortenburg: Förderkreis Bereich Schloss Ortenburg 2013. 495 S. mit über 620 Abbildungen. Keine ISBN.
Zur Rezension lag die 1. Auflage vor, die 2. Auflage mit kleineren Korrekturen erschien ebenfalls 2013, scheint aber nicht den Weg in eine der im KVK vertretenen wissenschaftlichen Bibliotheken gefunden zu haben. Auch die erste Auflage ist in der Deutschen Nationalbibliothek nicht vorhanden.
Über das Zustandekommen des Buchs unterrichtet ausführlich das Regiowiki. Ein Inhaltsverzeichnis ist abrufbar im BVB als PDF.
Es handelt sich um eine heimatkundliche Aufsatzsammlung, in deren Focus mehrere Themen stehen: die Geschichte der Grafen von Ortenburg, die Ortsgeschichte von Ortenburg und die Territorialgeschichte der Reichsgrafschaft Ortenburg, die durch Graf Joachim von Ortenburg 1563 reformiert wurde, die Reformationsgeschichte und die Geschichte der evangelischen Gemeinde. Die Qualität der einzelnen Beiträge ist sehr unterschiedlich - sie reicht von wissenschaftlichen Aufsätzen bis zu laienhaften Darstellungen ohne Belege. Leider vermisst man weitgehend Nachweise bei den vielen Artikeln des Heimatforschers Walter Fuchs, obgleich sie teilweise zentralen Themen wie der Biographie Graf Joachims gelten. Hervorzuheben ist die opulente Ausstattung mit Farbbildern, auch wenn man sich manches Bild größer reproduziert gewünscht hätte.
Deutlich wird die enge Verbundenheit der Gemeinde Ortenburg mit dem ehemals regierenden Haus, den inzwischen im oberfränkischen Tambach residierenden Grafen von Ortenburg. Diese gehen auf einen im 11. Jahrhundert lebenden Graf Siegfried aus der rheinfränkischen Familie der Sponheimer zurück, die man als Kärntner Herzöge Spanheimer nennt. Das enge Verhältnis zu den Grafen zeigt sich insbesondere am Grußwort Heinrichs Graf von Ortenburg und der "Übersicht über die regierenden Grafen von Ortenburg", die bis zur Gegenwart reicht.
Erfreulicherweise werden in dem Band viele Stücke abgebildet, die sich im Privatbesitz der Grafen von Ortenburg befinden, darunter auch etliche Werke des "Malergrafen" Friedrich Casimir (1591-1658).
Die abscheuliche Zerstückelung der Ortenburger Adelsbibliothek wird in dem Interview mit Heinrich Graf von Ortenburg nicht angesprochen, kommt jedoch in dem Beitrag des Hamburger Altphilologen Walther Ludwig zur Sprache: Die humanistische Bildung der Grafen Joachim und Anton zu Ortenburg (S. 76-80), die Kurzfassung eines ausführlichen Aufsatzes, den Ludwig 2002 und dann wieder 2005 (in seiner Aufsatzsammlung Miscella Neolatina Bd. 3) publiziert hatte. 1999 wurden 130 Nummern aus der Tambacher Bibliothek bei Venator & Hanstein in Köln versteigert, was mich damals sehr erboste:
http://archiv.twoday.net/stories/3560241/
In den 1980er Jahren war die bemerkenswerte Handschriftensammlung der Ortenburger ohne Aufsehen in den Antiquariatshandel gelangt:
http://web.archive.org/web/20131228002040/http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/privbib.htm
Ludwig ist zuzustimmen, wenn er in der ausführlichen Fassung schreibt, dass durch Auswertung von Lesespuren "rezeptions- und mentalitätsgeschichtliche Einsichten zu erreichen sind, die sonst verschlossen blieben". Zu unterstreichen ist auch der nächste, der Schlusssatz seiner Abhandlung: "Sie machen auch bewußt, wie wichtig es ist, erhaltene Bibliotheken historischer Personen im ganzen auszuwerten und daß durch die Zerstreuung historischer Bibliotheksbestände manche Erkenntnismöglichkeiten unwiederbringlich verloren gehen können" (Miscella III, S. 259). Das ist noch recht zurückhaltend formuliert. Zum Quellenwert von Adelsbibliotheken darf ich auch auf meinen Aufsatz zu oberschwäbischen Adelsbibliotheken hinweisen. Nicht-zensierte Fassung unter
http://hdl.handle.net/10760/7542
Über den Verkauf der Bibeln des Grafen Joachim, die für 5 Mio. DM für das Deutsche Historische Museum erworben wurden, berichtet Walter Fuchs (S. 357-360).
Leider ist dem reichhaltigen Sammelband, einem landesgeschichtliches Standardwerk für die Reichsgrafschaft Ortenburg, kein Register beigegeben.
Update:
http://histbav.hypotheses.org/2373
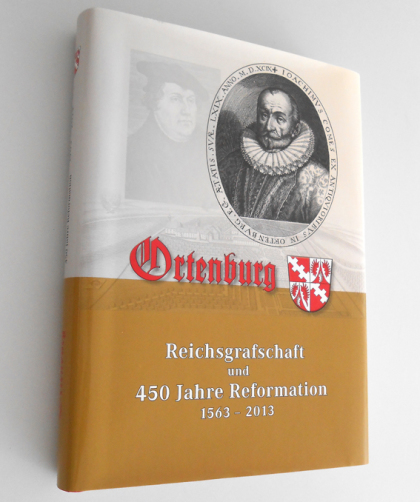
Zur Rezension lag die 1. Auflage vor, die 2. Auflage mit kleineren Korrekturen erschien ebenfalls 2013, scheint aber nicht den Weg in eine der im KVK vertretenen wissenschaftlichen Bibliotheken gefunden zu haben. Auch die erste Auflage ist in der Deutschen Nationalbibliothek nicht vorhanden.
Über das Zustandekommen des Buchs unterrichtet ausführlich das Regiowiki. Ein Inhaltsverzeichnis ist abrufbar im BVB als PDF.
Es handelt sich um eine heimatkundliche Aufsatzsammlung, in deren Focus mehrere Themen stehen: die Geschichte der Grafen von Ortenburg, die Ortsgeschichte von Ortenburg und die Territorialgeschichte der Reichsgrafschaft Ortenburg, die durch Graf Joachim von Ortenburg 1563 reformiert wurde, die Reformationsgeschichte und die Geschichte der evangelischen Gemeinde. Die Qualität der einzelnen Beiträge ist sehr unterschiedlich - sie reicht von wissenschaftlichen Aufsätzen bis zu laienhaften Darstellungen ohne Belege. Leider vermisst man weitgehend Nachweise bei den vielen Artikeln des Heimatforschers Walter Fuchs, obgleich sie teilweise zentralen Themen wie der Biographie Graf Joachims gelten. Hervorzuheben ist die opulente Ausstattung mit Farbbildern, auch wenn man sich manches Bild größer reproduziert gewünscht hätte.
Deutlich wird die enge Verbundenheit der Gemeinde Ortenburg mit dem ehemals regierenden Haus, den inzwischen im oberfränkischen Tambach residierenden Grafen von Ortenburg. Diese gehen auf einen im 11. Jahrhundert lebenden Graf Siegfried aus der rheinfränkischen Familie der Sponheimer zurück, die man als Kärntner Herzöge Spanheimer nennt. Das enge Verhältnis zu den Grafen zeigt sich insbesondere am Grußwort Heinrichs Graf von Ortenburg und der "Übersicht über die regierenden Grafen von Ortenburg", die bis zur Gegenwart reicht.
Erfreulicherweise werden in dem Band viele Stücke abgebildet, die sich im Privatbesitz der Grafen von Ortenburg befinden, darunter auch etliche Werke des "Malergrafen" Friedrich Casimir (1591-1658).
Die abscheuliche Zerstückelung der Ortenburger Adelsbibliothek wird in dem Interview mit Heinrich Graf von Ortenburg nicht angesprochen, kommt jedoch in dem Beitrag des Hamburger Altphilologen Walther Ludwig zur Sprache: Die humanistische Bildung der Grafen Joachim und Anton zu Ortenburg (S. 76-80), die Kurzfassung eines ausführlichen Aufsatzes, den Ludwig 2002 und dann wieder 2005 (in seiner Aufsatzsammlung Miscella Neolatina Bd. 3) publiziert hatte. 1999 wurden 130 Nummern aus der Tambacher Bibliothek bei Venator & Hanstein in Köln versteigert, was mich damals sehr erboste:
http://archiv.twoday.net/stories/3560241/
In den 1980er Jahren war die bemerkenswerte Handschriftensammlung der Ortenburger ohne Aufsehen in den Antiquariatshandel gelangt:
http://web.archive.org/web/20131228002040/http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/privbib.htm
Ludwig ist zuzustimmen, wenn er in der ausführlichen Fassung schreibt, dass durch Auswertung von Lesespuren "rezeptions- und mentalitätsgeschichtliche Einsichten zu erreichen sind, die sonst verschlossen blieben". Zu unterstreichen ist auch der nächste, der Schlusssatz seiner Abhandlung: "Sie machen auch bewußt, wie wichtig es ist, erhaltene Bibliotheken historischer Personen im ganzen auszuwerten und daß durch die Zerstreuung historischer Bibliotheksbestände manche Erkenntnismöglichkeiten unwiederbringlich verloren gehen können" (Miscella III, S. 259). Das ist noch recht zurückhaltend formuliert. Zum Quellenwert von Adelsbibliotheken darf ich auch auf meinen Aufsatz zu oberschwäbischen Adelsbibliotheken hinweisen. Nicht-zensierte Fassung unter
http://hdl.handle.net/10760/7542
Über den Verkauf der Bibeln des Grafen Joachim, die für 5 Mio. DM für das Deutsche Historische Museum erworben wurden, berichtet Walter Fuchs (S. 357-360).
Leider ist dem reichhaltigen Sammelband, einem landesgeschichtliches Standardwerk für die Reichsgrafschaft Ortenburg, kein Register beigegeben.
Update:
http://histbav.hypotheses.org/2373
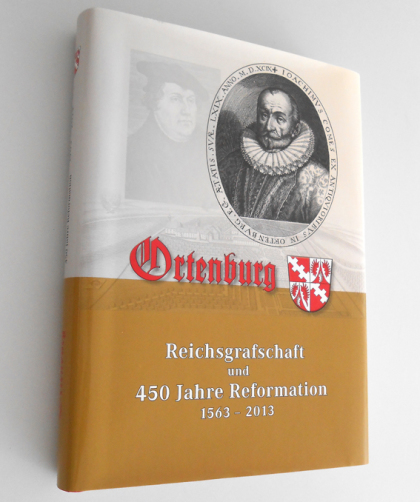
KlausGraf - am Dienstag, 20. Mai 2014, 04:28 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
HathiTrust hat sich überzeugen lassen, den Band weltweit freizugeben:
http://hdl.handle.net/2027/wu.89069098788
Ebenfalls frei sein illustrierter Führer:
http://hdl.handle.net/2027/njp.32101078300702
http://archiv.twoday.net/search?q=riga
http://hdl.handle.net/2027/wu.89069098788
Ebenfalls frei sein illustrierter Führer:
http://hdl.handle.net/2027/njp.32101078300702
http://archiv.twoday.net/search?q=riga
KlausGraf - am Mittwoch, 7. Mai 2014, 19:47 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen