KlausGraf - am Mittwoch, 20. Februar 2008, 22:44 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nur das Inhaltsverzeichnis ist online:
http://www.ulb.tu-darmstadt.de/tocs/189546654.pdf
Nachtrag: Besprochen unter
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/type=rezbuecher&id=10767
#sphragistik
http://www.ulb.tu-darmstadt.de/tocs/189546654.pdf
Nachtrag: Besprochen unter
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/type=rezbuecher&id=10767
#sphragistik
KlausGraf - am Mittwoch, 20. Februar 2008, 22:43 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.exulanten.geschichte.uni-muenchen.de
Die Böhmischen Exulanten – zu einem großen Teil lutherische Konfessionsflüchtlinge, die seit dem Dreißigjährigen Krieg Böhmen, Mähren, die Slowakei oder Schlesien verließen und sich in großer Zahl in Sachsen ansiedelten – gehörten lange Zeit zu den in der Forschung wenig behandelten Migrantengruppen des 17. Jahrhunderts, vergleicht man ihren Bekanntheitsgrad mit dem der Hugenotten oder der Salzburger Protestanten. Nichts desto weniger wurde vor allem in Sachsen die Erinnerung an die vielen tausend Einwanderer aufrechterhalten, die sich im 17. und 18. Jahrhundert dort niederließen. Aufgrund des jüngst neu belebten Interesses an Migrationsgeschichte schien es geboten, hier der Forschung neue Grundlagen zu liefern.
Das Sächsische Hauptstaatsarchiv Dresden verwahrt zahlreiche Archivalia und Hilfsmittel zur Geschichte der Böhmischen Exulanten, darunter die sogenannte »Bergmann'sche Exulantensammlung«. In einer Kooperation zwischen dem Hauptstaatsarchiv und einem von der DFG geförderten Forschungsprojekt am Historischen Seminar der Universität München (SFB 573 »Pluralisierung und Autorität«, Teilprojekt C9) wurde im Jahre 2001 damit begonnen, die Informationen der »Bergmann'schen Exulantensammlung« in eine Datenbank aufzunehmen. Auf diese Weise ergeben sich ganz neue Recherche- und Zugriffsmöglichkeiten auf individuelle Schicksale und soziale Strukturen dieser Personen und Familien. Die Datenbank stellt so eine neue Grundlage für jedwede prosopographische Studie zu den Exulanten dar.
Die Böhmischen Exulanten – zu einem großen Teil lutherische Konfessionsflüchtlinge, die seit dem Dreißigjährigen Krieg Böhmen, Mähren, die Slowakei oder Schlesien verließen und sich in großer Zahl in Sachsen ansiedelten – gehörten lange Zeit zu den in der Forschung wenig behandelten Migrantengruppen des 17. Jahrhunderts, vergleicht man ihren Bekanntheitsgrad mit dem der Hugenotten oder der Salzburger Protestanten. Nichts desto weniger wurde vor allem in Sachsen die Erinnerung an die vielen tausend Einwanderer aufrechterhalten, die sich im 17. und 18. Jahrhundert dort niederließen. Aufgrund des jüngst neu belebten Interesses an Migrationsgeschichte schien es geboten, hier der Forschung neue Grundlagen zu liefern.
Das Sächsische Hauptstaatsarchiv Dresden verwahrt zahlreiche Archivalia und Hilfsmittel zur Geschichte der Böhmischen Exulanten, darunter die sogenannte »Bergmann'sche Exulantensammlung«. In einer Kooperation zwischen dem Hauptstaatsarchiv und einem von der DFG geförderten Forschungsprojekt am Historischen Seminar der Universität München (SFB 573 »Pluralisierung und Autorität«, Teilprojekt C9) wurde im Jahre 2001 damit begonnen, die Informationen der »Bergmann'schen Exulantensammlung« in eine Datenbank aufzunehmen. Auf diese Weise ergeben sich ganz neue Recherche- und Zugriffsmöglichkeiten auf individuelle Schicksale und soziale Strukturen dieser Personen und Familien. Die Datenbank stellt so eine neue Grundlage für jedwede prosopographische Studie zu den Exulanten dar.
KlausGraf - am Mittwoch, 20. Februar 2008, 22:41 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Das freie Kölner Theaterensemble Futur3 führt die Besucher am TAG DER ARCHIVE in das Innenleben eines Archivs und füllt einen Magazinraum mit einer Performance aus Klang, Schauspiel und Musik. Literarische Texte über das Erinnern werden neben wissenschaftliche Texte über die Arbeit des Archivars gestellt. Mit Musik von vorgestern und übermorgen, dem Rapper MC Sensitive, sowie einer subtilen Lichtinstallation umkreist Futur3 das Thema des gemeinsamen Tages: den Bauch des Archivars.
Archivarinnen und Archivare aus 14 Kölner Archiven - darunter auch die Mitarbeiter des RWWA - präsentieren dazu eine Ausstellung persönlicher Lieblingsstücke, in der bedeutende, überraschende, merkwürdige und amüsante Schätze der Kölner Stadtgeschichte zu sehen sein werden, die nebenbei sicherlich einiges über die Aussteller verraten und Anknüpfungspunkte für Gespräche mit den Besuchern bieten......"
Ich glaube kulturpolitisch korrekt beschreibt man dieses Projekt als spannend, charmant und womöglich sogar sexy.
Quelle:
Link
Nachtrag 27.02.2008:
http://www.futur-drei.de/
Archivarinnen und Archivare aus 14 Kölner Archiven - darunter auch die Mitarbeiter des RWWA - präsentieren dazu eine Ausstellung persönlicher Lieblingsstücke, in der bedeutende, überraschende, merkwürdige und amüsante Schätze der Kölner Stadtgeschichte zu sehen sein werden, die nebenbei sicherlich einiges über die Aussteller verraten und Anknüpfungspunkte für Gespräche mit den Besuchern bieten......"
Ich glaube kulturpolitisch korrekt beschreibt man dieses Projekt als spannend, charmant und womöglich sogar sexy.
Quelle:
Link
Nachtrag 27.02.2008:
http://www.futur-drei.de/
Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Februar 2008, 21:15 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus einer Buchbesprechung (Dirik von Oettingen: Verhüllt um zu verführen. Die Welt auf der Orange. vacat Verlag, Potsdam 2007)
des Deutschlandradios:
" ..... Da lässt sich sogar eine Merkwürdigkeit übersehen, die darauf hindeutet, dass Orangenpapiersammler älteren Jahrgangs und noch aus einer Zeit sind, in der es wenig berufstätige Frauen gegeben hat: Als typische Berufe von Sammlern zählt Oettingen Bäcker, Fotografen, Übersetzer, Designer oder Ingenieure auf, alle in der männlichen Form. Das wäre kaum der Rede wert, fände sich dazwischen nicht doch eine feminine Endung; dass ausgerechnet die Archivarin für den Autor der offenbar einzig vorstellbare weibliche Beruf ist, lässt auf einen ähnlich vagen Zusammenhang zwischen dem "Bewahren von Dingen" und "Frau" schließen, wie er sich für die Orangenpapiergestalter zwischen der Blutorange und einem Mohren hergestellt haben mag ..."
Quelle:
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/buechermarkt/741587/
des Deutschlandradios:
" ..... Da lässt sich sogar eine Merkwürdigkeit übersehen, die darauf hindeutet, dass Orangenpapiersammler älteren Jahrgangs und noch aus einer Zeit sind, in der es wenig berufstätige Frauen gegeben hat: Als typische Berufe von Sammlern zählt Oettingen Bäcker, Fotografen, Übersetzer, Designer oder Ingenieure auf, alle in der männlichen Form. Das wäre kaum der Rede wert, fände sich dazwischen nicht doch eine feminine Endung; dass ausgerechnet die Archivarin für den Autor der offenbar einzig vorstellbare weibliche Beruf ist, lässt auf einen ähnlich vagen Zusammenhang zwischen dem "Bewahren von Dingen" und "Frau" schließen, wie er sich für die Orangenpapiergestalter zwischen der Blutorange und einem Mohren hergestellt haben mag ..."
Quelle:
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/buechermarkt/741587/
Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Februar 2008, 21:11 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Früh pensioniert und auf Diät gesetzt, ist dem mausgrauen Archivar Ákos nur die Leidenschaft für Namens-, Wappen- und Siegelkunde geblieben. Vor sich sieht er nur Tod, doch Herkunft ist ihm alles. ....."
Besprechung in der NZZ:
http://www.nzz.ch/nachrichten/medien/der_menschliche_makel_1.674478.html
Besprechung in der NZZ:
http://www.nzz.ch/nachrichten/medien/der_menschliche_makel_1.674478.html
Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Februar 2008, 21:09 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Inhalt: http://www.mdr.de/tv/programm/prog_detail+43207000244429.html
weitere Informationen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Archiv_des_Todes
weitere Informationen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Archiv_des_Todes
Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Februar 2008, 21:08 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Mittwoch, 20. Februar 2008, 21:03 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/ag/mitglieder.html
Siehe dazu auch:
http://titan.bsz-bw.de/cms/recherche/links/infedo/infedo13.html
Siehe dazu auch:
http://titan.bsz-bw.de/cms/recherche/links/infedo/infedo13.html
KlausGraf - am Dienstag, 19. Februar 2008, 18:48 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Briefsteller_%28Ruckert%29
Alois Josef Ruckert: Briefsteller für Volks- & Fortbildungs-Schulen, Würzburg 1875
Auswahl:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/brief.htm
Vorwort:
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/19Jh/Briefsteller/bri_vorw.html
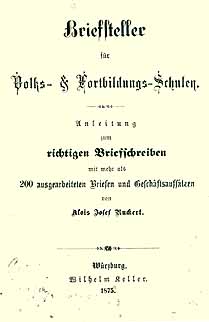
Alois Josef Ruckert: Briefsteller für Volks- & Fortbildungs-Schulen, Würzburg 1875
Auswahl:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/brief.htm
Vorwort:
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/19Jh/Briefsteller/bri_vorw.html
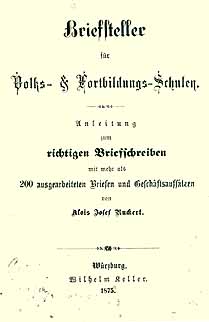
KlausGraf - am Dienstag, 19. Februar 2008, 18:34 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.opus-bayern.de/uni-augsburg/volltexte/2008/731/
Rupp, Paul Berthold: Die Totenroteln der Universitätsbibliothek Augsburg gesammelt in den Benediktinerklöstern Heilig Kreuz, Donauwörth und St. Martin, Mönchsdeggingen, 02/IV.28.2.243-1 ff.
pdf-Format:
Dokument 1.pdf (1,392 KB)
Kurzfassung in deutsch
Das Dokument verzeichnet in alphabetischer Reihenfolge die Personen, derer in den Totenroteln gedacht wird, die in den Benediktinerklöstern Hl. Kreuz / Donauwörth und Mönchsdeggingen gesammelt wurden und die heute zur Oettingen-Wallersteinschen Bibliothek an der Universitätsbibliothek Augsburg gehören. Es handelt sich um insgesamt ca. 650 Personen, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und im 18. Jahrhundert lebten bzw. tätig waren (meist Angehörige des Benediktinerordens im süddeutschen Raum). Jeder Eintrag ist mit biographischen und bibliographischen Daten versehen.
Rupp, Paul Berthold: Die Totenroteln der Universitätsbibliothek Augsburg gesammelt in den Benediktinerklöstern Heilig Kreuz, Donauwörth und St. Martin, Mönchsdeggingen, 02/IV.28.2.243-1 ff.
pdf-Format:
Dokument 1.pdf (1,392 KB)
Kurzfassung in deutsch
Das Dokument verzeichnet in alphabetischer Reihenfolge die Personen, derer in den Totenroteln gedacht wird, die in den Benediktinerklöstern Hl. Kreuz / Donauwörth und Mönchsdeggingen gesammelt wurden und die heute zur Oettingen-Wallersteinschen Bibliothek an der Universitätsbibliothek Augsburg gehören. Es handelt sich um insgesamt ca. 650 Personen, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und im 18. Jahrhundert lebten bzw. tätig waren (meist Angehörige des Benediktinerordens im süddeutschen Raum). Jeder Eintrag ist mit biographischen und bibliographischen Daten versehen.
KlausGraf - am Dienstag, 19. Februar 2008, 18:14 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Jenny-Aloni-Archiv sammelt und archiviert den literarischen Nachlaß der deutschsprachigen Schriftstellerin Jenny Aloni, die 1917 als Jenny Rosenbaum in Paderborn/Westfalen geboren wurde, Ende 1939 nach Palästina/Israel emigrierte und dort 1993 starb. Jenny Aloni gilt als die bedeutendste deutschsprachige Schriftstellerpersönlichkeit Israels ihrer Generation und als eine der herausragenden Schriftstellerinnen Westfalens und der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. 1990 bis 1997 erschienen in zehn Bänden die "Gesammelten Werke in Einzelausgaben", die inzwischen auch als preiswerte Taschenbuchausgabe vorliegen. Das 1992 am Fachbereich 3 "Sprach- und Literaturwissenschaft" der Universität Paderborn gegründete Archiv wird von Prof. Dr. Hartmut Steinecke geleitet und umfaßt inzwischen mehr als 1200 Nummern literarische Texte, 550 Briefe von und an Jenny Aloni, sowie zahlreiche Lebensdokumente: Zeugnisse, Ausweise, Auswanderungspapiere...sowie über 200 Fotos. Viele Texte sind bisher unveröffentlicht. Die Bestände des Archivs können nach Rücksprache eingesehen werden, als Hilfsmittel steht eine Datenbank zur Verfügung, die den Gesamtbestand erfaßt. Ein wichtiger Bestandteil des Archivs ist das von Jenny Aloni von 1935 bis zu ihrem Tod 1993 geführte Tagebuch, das in 12 Heften insgesamt mehr als 1900 Seiten umfaßt. ...."
Quelle:
http://kw.upb.de/~aloni/
Informationen zu Jenny Aloni:
http://de.wikipedia.org/wiki/Jenny_Aloni
Quelle:
http://kw.upb.de/~aloni/
Informationen zu Jenny Aloni:
http://de.wikipedia.org/wiki/Jenny_Aloni
Wolf Thomas - am Dienstag, 19. Februar 2008, 16:25 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Mond ist "Archiv von Vorgängen, die seit viereinhalb Milliarden Jahren im Sonnensystem ablaufen".
Quelle:
Link
s.a.
http://archiv.twoday.net/stories/4249200/
Quelle:
Link
s.a.
http://archiv.twoday.net/stories/4249200/
Wolf Thomas - am Dienstag, 19. Februar 2008, 16:20 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
s. http://www.ksta.de/html/artikel/1202761031067.shtml
s.a.
http://archiv.twoday.net/stories/4681303/
s.a.
http://archiv.twoday.net/stories/4681303/
Wolf Thomas - am Dienstag, 19. Februar 2008, 16:17 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.iwk-online.de/2006-2-3_editorial.html
http://www.jungewelt.de/2008/02-19/026.php
Via http://adresscomptoir.twoday.net/stories/4718066/
http://www.jungewelt.de/2008/02-19/026.php
Via http://adresscomptoir.twoday.net/stories/4718066/
KlausGraf - am Dienstag, 19. Februar 2008, 12:04 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 19. Februar 2008, 03:06 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine Beschwerde 1966:
http://www.mgh-bibliothek.de/da/da221/da221.pl?seite=308.gif&start=308
http://www.mgh-bibliothek.de/da/da221/da221.pl?seite=308.gif&start=308
KlausGraf - am Dienstag, 19. Februar 2008, 00:57 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wann wird es wohl Standard werden, dass bei großen Ausstellungen Ausstellungstexte und Publikationen "Open Access" zur verfügung stehen?
Bei der Niedersächsischen Landesausstellung über Friedrich II. gibt es nur die üblichen Appetithäppchen. Immerhin gibt es einen Podcast (bislang 1 Folge, zu Friedrich als Herrscher) und Ausstellungs-"Zeitungen":
http://friedrich-ii.naturundmensch.de/
Zum Presse-Echo
http://news.google.de/news?num=100&hl=de&q=%22friedrich+ii%22&as_qdr=w&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wn

In Wikisource gibt es das gemeinfreie Buch von Franz Kampers als E-Text (unvollständig, die Scans auf Commons sind aber komplett):
http://de.wikisource.org/wiki/Kaiser_Friedrich_II._Der_Wegbereiter_der_Renaissance
Quellen und Sekundärliteratur beginnt aufzulisten:
http://de.wikisource.org/wiki/Friedrich_II._%28HRR%29
Der Wikipedia-Artikel hat von der Community das Prädikat Lesenswert erhalten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_II._%28HRR%29
Bei der Niedersächsischen Landesausstellung über Friedrich II. gibt es nur die üblichen Appetithäppchen. Immerhin gibt es einen Podcast (bislang 1 Folge, zu Friedrich als Herrscher) und Ausstellungs-"Zeitungen":
http://friedrich-ii.naturundmensch.de/
Zum Presse-Echo
http://news.google.de/news?num=100&hl=de&q=%22friedrich+ii%22&as_qdr=w&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wn

In Wikisource gibt es das gemeinfreie Buch von Franz Kampers als E-Text (unvollständig, die Scans auf Commons sind aber komplett):
http://de.wikisource.org/wiki/Kaiser_Friedrich_II._Der_Wegbereiter_der_Renaissance
Quellen und Sekundärliteratur beginnt aufzulisten:
http://de.wikisource.org/wiki/Friedrich_II._%28HRR%29
Der Wikipedia-Artikel hat von der Community das Prädikat Lesenswert erhalten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_II._%28HRR%29
KlausGraf - am Montag, 18. Februar 2008, 22:55 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://tepin.aiki.de/blog/archives/264-Erfahrungen-mit-Open-Access-Publikationen.html
Obwohl die GI eine OA-Erklärung unterschrieben hat, werden Autoren mit einer "Copyrightvereinbarung" geknebelt, die es ausschließt, einen Beitrag unter CC zu veröffentlichen.
Zur OA-Heuchelei der Bibliotheken siehe
http://archiv.twoday.net/stories/2518568/
Zur inkonsequenten Durchsetzung bei der Leibniz-Gemeinschaft:
http://archiv.twoday.net/stories/4113065/
Obwohl die GI eine OA-Erklärung unterschrieben hat, werden Autoren mit einer "Copyrightvereinbarung" geknebelt, die es ausschließt, einen Beitrag unter CC zu veröffentlichen.
Zur OA-Heuchelei der Bibliotheken siehe
http://archiv.twoday.net/stories/2518568/
Zur inkonsequenten Durchsetzung bei der Leibniz-Gemeinschaft:
http://archiv.twoday.net/stories/4113065/
KlausGraf - am Montag, 18. Februar 2008, 22:29 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Viele Korallen wachsen ähnlich wie Bäume und bilden Wachstumsringe - ein historisches Archiv, das Rückschlüsse auf die Wasserbedingungen über Jahrtausende erlaubt. ...."
Quelle:
http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/wissen/umwelt/842322.html
Nachtrag 24.02.2008:
http://www.pressetext.de/pte.mc?pte=080223007
Quelle:
http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/wissen/umwelt/842322.html
Nachtrag 24.02.2008:
http://www.pressetext.de/pte.mc?pte=080223007
Wolf Thomas - am Montag, 18. Februar 2008, 18:59 - Rubrik: Miscellanea
" ... Es gibt zu 1968, das - Segen und Fluch - als deutsches Durchbruchsjahr in die Moderne gilt, die unterschiedlichsten Stimmen und Verarbeitungsstrategien: den leidenschaftlichen Revisionismus von Gerd Koenen ("Das rote Jahrzehnt"), den ideologiefreien Recherche-und-Scoop-Journalismus von Stefan Aust ("Der Baader-Meinhof-Komplex") oder die hartnäckige Archiv-Krabbelei von Wolfgang Kraushaar ("Die Bombe im Jüdischen Gemeindehaus"). ...."
Quelle:
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,535950,00.html
Quelle:
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,535950,00.html
Wolf Thomas - am Montag, 18. Februar 2008, 18:57 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Archiv: lange Regalfluchten in dunklen Kellern, hohe Papierstapel mit verstaubten Akten, tonnenweise Dinge, nach denen nie wieder gefragt wird. Der Archivar: graues Gesicht, gebeugter Rücken, unauffällige Kleider. Im schummrigen Licht flackernder Deckenleuchten beschriftet er Karteikarten, schleppt Akten, sortiert Papier. Eine Sisyphos-Arbeit.
Wenn Angela Ullmann mit solchen Klischees konfrontiert wird, muss sie schmunzeln. ..."
Quelle:
http://www.bundestag.de/dasparlament/2008/08/KulturMedien/19609564.html
Wenn Angela Ullmann mit solchen Klischees konfrontiert wird, muss sie schmunzeln. ..."
Quelle:
http://www.bundestag.de/dasparlament/2008/08/KulturMedien/19609564.html
Wolf Thomas - am Montag, 18. Februar 2008, 18:56 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
1997 wurde der Nachlass von den Erben Schönbergs nach Wien, in die Geburtsstadt des Komponisten, gebracht. Im März 1998 wurde das Arnold Schönberg Center am Schwarzenbergplatz 6 eröffnet. Auf einer Fläche von 1300 Quadratmetern finden ein Archiv, eine Bibliothek, eine Mediathek und Ausstellungsräume Platz. Seither kamen 120.000 BesucherInnen zu 510 Veranstaltungen, 19 Symposien und 14 Ausstellungen.
Quellen:
http://www.magwien.gv.at/vtx/vtx-rk-xlink?SEITE=020080218011
http://diepresse.com/home/kultur/news/363557/index.do?_vl_backlink=/home/index.do
s.a.:
http://www.schoenberg.at/
Quellen:
http://www.magwien.gv.at/vtx/vtx-rk-xlink?SEITE=020080218011
http://diepresse.com/home/kultur/news/363557/index.do?_vl_backlink=/home/index.do
s.a.:
http://www.schoenberg.at/
Wolf Thomas - am Montag, 18. Februar 2008, 18:52 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
meint die Welt.
Wolf Thomas - am Montag, 18. Februar 2008, 18:49 - Rubrik: Kulturgut
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), Dr.
Wolfgang Kirsch, hat am Freitag (15.2.) den scheidenden Leiter
des LWL-Archivamtes, Prof. Dr. Norbert Reimann, verabschiedet
und seinen Nachfolger Dr. Marcus Stumpf begrüßt.
Der LWL-Direktor würdigte Reimanns Verdienste in den 21 Jahren
an der Spitze des Amtes. Er habe sich zum Beispiel in der Aus-
und Fortbildung verdient gemacht, aber auch die elektronische
Datenverarbeitung und neue Methoden zum Erhalt von Archivalien
vorangetrieben.
Reimanns Nachfolger Dr. Marcus Stumpf war bisher
stellvertretender Leiter des Technischen Zentrums im
Landesarchiv Nordhein-Westfalen in Münster. Nach Studium in
Mainz, Aachen und Bonn promovierte Stumpf 1998 in München mit
einer kritischen Edition der Bamberger Heiligenvita Kaiser
Heinrichs II.
Das LWL-Archivamt für Westfalen, 1927 gegründet als
Archivberatungsstelle der Provinz Westfalen, hat als Einrichtung
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) mit 30
Beschäftigten zur Aufgabe, die Archive nichtstaatlicher Träger,
also die kommunalen, kirchlichen und privaten Archive in
Westfalen-Lippe, fachlich und technisch zu beraten und zu
unterstützen. Darüber hinaus beherbergt das LWL-Archivamt das
eigene Archiv des Landschaftsverbandes und das Archivdepot der
Vereinigten Westfälischen Adelsarchive.
via Mailing-Liste "Westfälische Geschichte"
Wolfgang Kirsch, hat am Freitag (15.2.) den scheidenden Leiter
des LWL-Archivamtes, Prof. Dr. Norbert Reimann, verabschiedet
und seinen Nachfolger Dr. Marcus Stumpf begrüßt.
Der LWL-Direktor würdigte Reimanns Verdienste in den 21 Jahren
an der Spitze des Amtes. Er habe sich zum Beispiel in der Aus-
und Fortbildung verdient gemacht, aber auch die elektronische
Datenverarbeitung und neue Methoden zum Erhalt von Archivalien
vorangetrieben.
Reimanns Nachfolger Dr. Marcus Stumpf war bisher
stellvertretender Leiter des Technischen Zentrums im
Landesarchiv Nordhein-Westfalen in Münster. Nach Studium in
Mainz, Aachen und Bonn promovierte Stumpf 1998 in München mit
einer kritischen Edition der Bamberger Heiligenvita Kaiser
Heinrichs II.
Das LWL-Archivamt für Westfalen, 1927 gegründet als
Archivberatungsstelle der Provinz Westfalen, hat als Einrichtung
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) mit 30
Beschäftigten zur Aufgabe, die Archive nichtstaatlicher Träger,
also die kommunalen, kirchlichen und privaten Archive in
Westfalen-Lippe, fachlich und technisch zu beraten und zu
unterstützen. Darüber hinaus beherbergt das LWL-Archivamt das
eigene Archiv des Landschaftsverbandes und das Archivdepot der
Vereinigten Westfälischen Adelsarchive.
via Mailing-Liste "Westfälische Geschichte"
Wolf Thomas - am Montag, 18. Februar 2008, 12:25 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://pages.prodigy.net/ptheroff/gotha/waldburg.html
Der Chef des Hauses und Hausbuchverkäufer heisst:
JOHANNES Franz Xaver Willibald Maria Josef Philipp Jeningen Leonhard [Reichserbtruchseß] Fürst von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee

Der Chef des Hauses und Hausbuchverkäufer heisst:
JOHANNES Franz Xaver Willibald Maria Josef Philipp Jeningen Leonhard [Reichserbtruchseß] Fürst von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Es gibt jetzt im Netz ein größeres Bild einer Seite, siehe
http://archiv.twoday.net/stories/4387974/

http://archiv.twoday.net/stories/4387974/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:VG_Berlin_VG_5_A_280_06
http://de.wikisource.org/wiki/Verwaltungsgericht_Berlin_-_Dienstliche_Beurteilung_eines_Archivinspektors
Das VG Berlin stellte mit Urteil vom 20. November 2007 fest, dass der Widerspruchsbescheid des Bundesarchivs über eine Regelbeurteilung rechtswidrig war. Das Bundesarchiv hatte gegen die eigenen Beurteilungsrichtlinien verstoßen, da die vorgeschriebene Abstimmung zwischen Erst- und Zweitbeurteiler nicht beachtet wurde.
Möglicherweise sind somit die meisten im Bundesarchiv durchgeführten Beurteilungen fehlerhaft.
http://de.wikisource.org/wiki/Verwaltungsgericht_Berlin_-_Dienstliche_Beurteilung_eines_Archivinspektors
Das VG Berlin stellte mit Urteil vom 20. November 2007 fest, dass der Widerspruchsbescheid des Bundesarchivs über eine Regelbeurteilung rechtswidrig war. Das Bundesarchiv hatte gegen die eigenen Beurteilungsrichtlinien verstoßen, da die vorgeschriebene Abstimmung zwischen Erst- und Zweitbeurteiler nicht beachtet wurde.
Möglicherweise sind somit die meisten im Bundesarchiv durchgeführten Beurteilungen fehlerhaft.
KlausGraf - am Sonntag, 17. Februar 2008, 20:53 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Dr. Daniel Hess (GNM Nürnberg) war freundlicherweise bereit, mit mir ein Mailinterview zum "Mittelalterlichen Hausbuch" zu führen.
* Sie haben 1994 die maßgebliche deutschsprachige Monographie zum Hausbuchmeister vorgelegt (Meister um das „mittelalterliche
Hausbuch"). Was bedeutet die Handschrift für Sie persönlich?
Für mich ist die Handschrift, mit der ich mich damals insbesondere in formaler und stilistischer Hinsicht beschäftigt habe, eines der faszinierendsten Werke des Spätmittelalters, auf die ich in der Beschäftigung mit den unterschiedlichsten Fragestellungen seit zwanzig Jahren mit immer neuer Begeisterung zurückkomme. Für mich ist das Hausbuch eines des großartigsten Werke!
* Wie würden Sie den Rang des "Mittelalterlichen Hausbuchs" aus
kultur- und kunstgeschichtlicher Sicht einschätzen?
Die Texte und Illustrationen sind kunst- und kulturgeschichtlich von einzigartiger Bedeutung und gelten in der Lebendigkeit und Frische der Alltagsbeobachtung als unübertroffen. Sie geben in Einblick in die unterschiedlichsten Kultur- und Wissensbereiche wie Technikgeschichte, Montanwesen, Alchemie, Medizin- und Handwerksgeschichte, Kriegsgeschichte und Rüstungswesen, höfische und städtische Kultur, Rhetorik und Gedächtniskunst. Die Texte und Illustrationen vermitteln einen authentischen Einblick in die Lebenswelt und Vorstellungen sowie das Wissensspektrum zur Zeit des Umbruchs vom späten Mittelalter zur frühen Neuzeit. Die künstlerisch herausragenden Illustrationen, die in nahezu jedem historischen Werk zum Spätmittelalter abgebildet sind, zählen zu den Spitzenleistungen spätmittelalterlicher Kunst im deutschen Sprachraum. Im Lauf der 150 jährigen Forschungsgeschichte ist das Hausbuch darüber hinaus immer wieder zum Prüfstein neuer kunsthistorischer Methoden und kulturgeschichtlicher Deutungsmuster geworden und nimmt daher auch wissenschaftsgeschichtlich einen zentralen Rang ein.
* Es wurde ja in der kunsthistorischen Literatur Klage darüber
geführt, dass der Zugang zum Hausbuch schwierig oder unmöglich war. Sie hatten Gelegenheit, einen Tag lang diese einzigartige Handschrift einzusehen. Erinnern Sie sich an Ihre damaligen Gefühle?
Für mich ist dieser Tag unvergesslich: Ich hatte mich zuvor schon lange und intensiv mit den älteren Faksimile-Ausgaben beschäftigt und hatte nun einen ganzen Tag Zeit, die Darstellungen unter die Lupe zu nehmen und meine Thesen und Überlegungen am Original zu überprüfen. Es waren sehr bewegende und faszinierende Stunden!
* Seit der Erstellung des qualitativ hochwertigen Faksimiles 1997
(Prestel-Verlag) gab es so gut wie keine nennenswerten
Forschungsbeiträge zum Hausbuch. Eigentlich hätte man ja erwarten können, dass durch die Veränderung der Grundlage für die Forschung diese gleichsam aufgeblüht wäre. Haben Sie für diesen paradoxen Befund eine Erklärung?
Die Erfahrung zeigt, dass eine plötzliche Bereicherung der Forschung nicht zu einer breiten Diskussion führt, sondern dass die Ergebnisse zunächst nur punktuell wahrgenommen werden. Es dauert in der Regel rund eine halbe Generation, bis man sich aus kritischer Distanz grundlegender mit den neuen Erkenntnissen auseinandersetzt. Offenbar fehlt davor die Kraft für einen erneuten Spannungsaufbau; außerdem sorgt die Relativierung oder Zerstörung einer eben etablierten Ordnung nicht selten für Irritationen und Verunsicherungen.
* Der Kommentarband zum Faksimile hat ja eine sehr konservative Sicht der Forschung geboten. Ihr Ansatz, verschiedene Hände zu scheiden, ist damals nicht aufgenommen worden. Können Sie vielleicht in wenigen Sätzen umreißen, welche Hauptfragen zum Hausbuch offen geblieben sind trotz einer riesigen Sekundärliteratur seit 1855?
Mit meinem Ansatz konnte ich mich auf viele hervorragende Forscher stützen, die sich in den letzten 150 Jahren intensiv mit dem Hausbuch auseinandergesetzt hatten. Viele kamen bereits früher zu ähnlichen Ergebnissen, die dann durch nachfolgende Generationen wieder in Frage gestellt wurden. Neben vielen inhaltlichen Fragen, die zum Teil erst ansatzweise geklärt sind, dreht sich die Diskussion nicht nur um die Anzahl der beteiligten Künstler, sondern auch um die Frage der Konzeption der Handschrift und ihrer verwirrenden Entstehungs- und Besitzergeschichte. Angesichts der zeitlichen Zäsuren und konzeptionellen Änderungen zwischen den einzelnen Bestandteilen, angesichts der stilistischen Brüche, den wechselnden inhaltlichen Ausrichtungen und Gestaltungsprinzipien sowie den wechselnden Schreibern und Illustratoren stellt sich die Frage, ob das Buch tatsächlich aus einem Guss entstanden ist und ob das Postulat eines Meisters bzw. einer Werkstatt einer kritischen Prüfung standhalten kann. Nach meiner Überzeugung ist das Hausbuch weder nach einem einheitlichen Konzept entstanden, noch können seine heterogenen Illustrationen einem einzigen Künstler zugeschrieben werden. Neben stilistischen Unterschieden sprechen auch inhaltliche, buchtechnische und historische Argumente für eine Entstehung über einen Zeitraum von 1470 bis gegen 1500 unter mindestens zwei verschiedenen, bis heute noch immer nicht identifizierten Besitzern. Nach meiner Einschätzung lassen sich inklusive der beiden Nachtragsillustrationen des Liebesgartens und Bergwerks insgesamt sechs verschiedene Illustratoren unterscheiden. Wichtiger als die Frage der Händescheidung, die angesichts der aktuellen Ausrichtung der Kunstgeschichte wie ein kennerschaftliches Glasperlenspiel anmuten mag, erscheint mir jedoch der Umstand, dass das Manuskript organisch aus verschiedenen Bestandteilen zusammengewachsen ist. Gerade hierin liegt eine besondere Faszination des „Hausbuchs“.
* Die Sammelhandschrift hat im 19. Jahrhundert das Etikett "Hausbuch" verpasst bekommen. Sind Sie damit glücklich?
Die Bezeichnung „Hausbuch“ ist irreführend und wird der thematischen Breite der Handschrift und ihrer herausragenden künstlerischen Qualität nicht gerecht. Auch frühere Forscher haben sich deshalb an dieser Benennung gestoßen. Hat gar das unspektakuläre Etikett „Hausbuch“ dazu beigetragen, dass man sich in den Ministerien Baden-Württembergs der einzigartigen Bedeutung dieser Handschrift nicht rechtzeitig bewusst geworden ist?
* Es scheint ja inzwischen Konsens zu sein, dass der Hausbuchmeister in den Jahren um 1480 im Mittelrheingebiet im Dreieck zwischen Mainz, Frankfurt und Heidelberg tätig war. Wie erklären Sie sich, dass man das stolz zweimal im Hausbuch präsentierte Ast-Wappen in dieser Region bislang nicht aufspüren konnte?
Die durch unzählige Kriege seit dem frühen 16. Jh. verursachten Verluste an historischen Kulturgütern sind gerade in diesem Gebiet sehr groß. Das im Hausbuch auftretende Wappen lässt sich wohl deshalb an anderer Stelle bislang nicht dokumentieren. Da das erste Wappen von einem Stechhelm, das zweite von einer in der Heraldik ungebräuchlichen Schallern [*] bekrönt ist, dürfte die Auftraggeberfamilie aus dem Bereich der am spätmittelalterlichen Hof an Einfluss gewinnenden Schicht nicht-adliger Spezialisten (Büchsenmeister o.ä.) stammen. Die Möglichkeit weiterer historischer Nachweise und der namentlichen Bestimmung wird dadurch noch geringer.
* Nun ist ja vor wenigen Tagen bekannt geworden, dass der bisherige Eigentümer das Hausbuch verkauft hat (wobei die Frage der Rechtsgültigkeit des Verkaufs dahingestellt bleiben kann). Sie sind Leiter der Sammlungen Malerei bis 1800 und Glasmalerei am Germanischen Generalmuseum in Nürnberg und einer von zwei Stellvertretern des Generaldirektors. Wie sehen Sie diesen Verkauf?
Als ich aus der Presse vom Verkauf des Hausbuchs erfuhr, war ich völlig überrascht. Die Umstände, die dazu geführt haben, haben mich erschüttert. Angesichts der Bedeutung der Handschrift muss meines Erachtens alles dafür getan werden, dass das Hausbuch dauerhaft in eine öffentliche Sammlung überführt werden kann, in der eine fachgerechte Verwahrung und Pflege sowie der Zugang für weitere Forschungen gesichert ist.
* Hielten Sie es, gemessen am Rang des Hausbuchs, für angebracht, eine ähnliche "Staatsaktion" wie seinerzeit beim "Evangeliar Heinrichs des Löwens", das ja 1983 für 32,5 Millionen DM für Deutschland ersteigert wurde, unter Beteiligung der Kulturstiftung der Länder in die Wege zu leiten?
Ich hoffe, dass es auf Grund der singulären kulturgeschichtlichen Bedeutung des Hausbuchs gelingt, die erforderlichen Mittel aufzubringen, um einen Ankauf für eine öffentliche Sammlung in die Wege zu leiten. Ich kann nicht verstehen, dass man diesen sicherlich schwierigeren und langwierigeren Weg nicht von vornherein verfolgt hat. Ich hoffe sehr, dass es für eine „Rettungsaktion“ noch nicht zu spät ist.
* In welches Museum würde das Hausbuch am besten passen?
In Deutschland gibt es eine Reihe großer Museen und Bibliotheken, in denen das Hausbuch vom Sammlungsprofil her gut untergebracht wäre und fachgerecht betreut werden könnte. Sollte sich in Baden-Württemberg keine Lösung finden, sei mir als Mitarbeiter des Germanischen Nationalmuseums der Hinweis erlaubt, dass die Handschrift im größten kunst- und kulturgeschichtlichen Museen im deutschen Sprachraum einen ihrer Bedeutung und breiten inhaltlichen Ausrichtung angemessenen Platz finden würde. Ich darf daran erinnern, dass das Germanische Nationalmuseum 1866 die erste vollständige Veröffentlichung des Hausbuch mit faksimilierten Abbildungen sowie 1957 eine populäre Zusammenfassung herausgegeben hat. Da ich doppelt befangen bin, sollten diese Überlegungen jedoch nicht im Vordergrund stehen.
* Sie stammen aus der Schweiz. Kennen Sie den als Verkäufer
gerüchtweise verdächtigten Sammler, den im Thurgau lebenden Baron August von Finck?
Ich kenne diesen Sammler nicht und werde mich im Internet kundig machen.
* Halten Sie im Zeichen der Globalisierung eine Liste national
wertvollen Kulturguts, auf der das Hausbuch ja steht, noch für
zeitgemäß? Wieso sollte so ein Stück, das man ja auch als
Weltkulturerbe ansprechen könnte, nicht auch in Basel oder Malibu
(Getty-Museum) dauerhaft lagern?
Grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden, doch halte ich die Bewahrung eines Artefakts möglichst in seinem Entstehungs- und Wirkungszusammenhang für die in jedem Fall beste Lösung. Je weiter ein Objekt seinem ursprünglichen Kontext entfremdet wird, desto größer ist die Gefahr eines Verlusts wichtiger historischer Zusammenhänge und Umstände.
* Angenommen, ein Museum würde das Hausbuch erwerben können? Könnte es überhaupt ständig ausgestellt werden? Die "Library of Congress" hat ja für die Waldseemüllerkarte, die ebenfalls aus Wolfegg stammt, eine eigene Vitrine gebaut.
Die konservatorischen Anforderungen haben auf Grund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Im Kontext eines zusehends auf Events abzielenden Leih- und Ausstellungsbetriebs droht die Bewahrung des uns anvertrauten, für die nachfolgenden Generationen möglichst unbeschadet zu überliefernden Kulturguts jedoch ins Hintertreffen zu geraten. Deshalb gilt es unter Ausschöpfung neuer Konservierungsmethoden und Präsentationsmittel sorgsam abzuwägen, in welcher Form wir besonders empfindliche Objekte wie Bücher, Papierarbeiten oder Textilien der Öffentlichkeit präsentieren können, ohne diesen Werken zuviel zuzumuten oder ihnen nachhaltig Schaden zuzufügen.
* Um nachzuhaken: Wäre eine - womöglich als "Event" inszenierte, auf wenige "Hausbuch-Tage" im Jahr beschränkte - museale Präsentation der fragilen Handschrift aus konservatorischer Sicht möglich? Eine meiner eindruckvollsten Begegnungen mit Kulturgut war ein Besuch im Heidekloster Wienhausen vor vielen Jahren, das nur in einer einzigen Woche nach Pfingsten jährlich einmal seine großartigen mittelalterlichen Bildteppiche zeigte.
Grundsätzlich scheint mir eine solche Präsentationsform möglich. Ob die Erwartungen der Besucher im Rahmen eines solchen „Events“ ohne visuelle Zusatzangebote wie Faksimile und Reproduktion befriedigt werden könnten, ist jedoch angesichts der Größe der sich nur in Nahsicht erschließenden Darstellungen und des Umstands, dass immer nur eine aufgeschlagene Doppelseite zu sehen ist, fraglich. Die Themenbreite des Hausbuchs ist andererseits so breit und spannend, dass man mit etwas Phantasie und Kreativität zündende Präsentationen entwickeln könnte, die auf einzigartige Weise in die Lebenswelt des Spätmittelalters einführen.
* Nun gibt es ja, wie erwähnt, seit 1997 ein sehr gutes Faksimile.
Brauchen wir da überhaupt das Original in öffentlichem Eigentum?
Für viele Fragestellungen, die sich vor allem inhaltlich und motivisch mit der Handschrift auseinandersetzen, bietet das Faksimile eine gute Arbeitsgrundlage. Für formale, stilistische, maltechnische und kunsttechnologische Fragestellungen und Untersuchungen ist die Auseinandersetzung mit dem Original jedoch unverzichtbar. Kein noch so gutes Faksimile kann das Original ersetzen.
* Vielen Dank für das Interview!
Helmform, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Schaller

* Sie haben 1994 die maßgebliche deutschsprachige Monographie zum Hausbuchmeister vorgelegt (Meister um das „mittelalterliche
Hausbuch"). Was bedeutet die Handschrift für Sie persönlich?
Für mich ist die Handschrift, mit der ich mich damals insbesondere in formaler und stilistischer Hinsicht beschäftigt habe, eines der faszinierendsten Werke des Spätmittelalters, auf die ich in der Beschäftigung mit den unterschiedlichsten Fragestellungen seit zwanzig Jahren mit immer neuer Begeisterung zurückkomme. Für mich ist das Hausbuch eines des großartigsten Werke!
* Wie würden Sie den Rang des "Mittelalterlichen Hausbuchs" aus
kultur- und kunstgeschichtlicher Sicht einschätzen?
Die Texte und Illustrationen sind kunst- und kulturgeschichtlich von einzigartiger Bedeutung und gelten in der Lebendigkeit und Frische der Alltagsbeobachtung als unübertroffen. Sie geben in Einblick in die unterschiedlichsten Kultur- und Wissensbereiche wie Technikgeschichte, Montanwesen, Alchemie, Medizin- und Handwerksgeschichte, Kriegsgeschichte und Rüstungswesen, höfische und städtische Kultur, Rhetorik und Gedächtniskunst. Die Texte und Illustrationen vermitteln einen authentischen Einblick in die Lebenswelt und Vorstellungen sowie das Wissensspektrum zur Zeit des Umbruchs vom späten Mittelalter zur frühen Neuzeit. Die künstlerisch herausragenden Illustrationen, die in nahezu jedem historischen Werk zum Spätmittelalter abgebildet sind, zählen zu den Spitzenleistungen spätmittelalterlicher Kunst im deutschen Sprachraum. Im Lauf der 150 jährigen Forschungsgeschichte ist das Hausbuch darüber hinaus immer wieder zum Prüfstein neuer kunsthistorischer Methoden und kulturgeschichtlicher Deutungsmuster geworden und nimmt daher auch wissenschaftsgeschichtlich einen zentralen Rang ein.
* Es wurde ja in der kunsthistorischen Literatur Klage darüber
geführt, dass der Zugang zum Hausbuch schwierig oder unmöglich war. Sie hatten Gelegenheit, einen Tag lang diese einzigartige Handschrift einzusehen. Erinnern Sie sich an Ihre damaligen Gefühle?
Für mich ist dieser Tag unvergesslich: Ich hatte mich zuvor schon lange und intensiv mit den älteren Faksimile-Ausgaben beschäftigt und hatte nun einen ganzen Tag Zeit, die Darstellungen unter die Lupe zu nehmen und meine Thesen und Überlegungen am Original zu überprüfen. Es waren sehr bewegende und faszinierende Stunden!
* Seit der Erstellung des qualitativ hochwertigen Faksimiles 1997
(Prestel-Verlag) gab es so gut wie keine nennenswerten
Forschungsbeiträge zum Hausbuch. Eigentlich hätte man ja erwarten können, dass durch die Veränderung der Grundlage für die Forschung diese gleichsam aufgeblüht wäre. Haben Sie für diesen paradoxen Befund eine Erklärung?
Die Erfahrung zeigt, dass eine plötzliche Bereicherung der Forschung nicht zu einer breiten Diskussion führt, sondern dass die Ergebnisse zunächst nur punktuell wahrgenommen werden. Es dauert in der Regel rund eine halbe Generation, bis man sich aus kritischer Distanz grundlegender mit den neuen Erkenntnissen auseinandersetzt. Offenbar fehlt davor die Kraft für einen erneuten Spannungsaufbau; außerdem sorgt die Relativierung oder Zerstörung einer eben etablierten Ordnung nicht selten für Irritationen und Verunsicherungen.
* Der Kommentarband zum Faksimile hat ja eine sehr konservative Sicht der Forschung geboten. Ihr Ansatz, verschiedene Hände zu scheiden, ist damals nicht aufgenommen worden. Können Sie vielleicht in wenigen Sätzen umreißen, welche Hauptfragen zum Hausbuch offen geblieben sind trotz einer riesigen Sekundärliteratur seit 1855?
Mit meinem Ansatz konnte ich mich auf viele hervorragende Forscher stützen, die sich in den letzten 150 Jahren intensiv mit dem Hausbuch auseinandergesetzt hatten. Viele kamen bereits früher zu ähnlichen Ergebnissen, die dann durch nachfolgende Generationen wieder in Frage gestellt wurden. Neben vielen inhaltlichen Fragen, die zum Teil erst ansatzweise geklärt sind, dreht sich die Diskussion nicht nur um die Anzahl der beteiligten Künstler, sondern auch um die Frage der Konzeption der Handschrift und ihrer verwirrenden Entstehungs- und Besitzergeschichte. Angesichts der zeitlichen Zäsuren und konzeptionellen Änderungen zwischen den einzelnen Bestandteilen, angesichts der stilistischen Brüche, den wechselnden inhaltlichen Ausrichtungen und Gestaltungsprinzipien sowie den wechselnden Schreibern und Illustratoren stellt sich die Frage, ob das Buch tatsächlich aus einem Guss entstanden ist und ob das Postulat eines Meisters bzw. einer Werkstatt einer kritischen Prüfung standhalten kann. Nach meiner Überzeugung ist das Hausbuch weder nach einem einheitlichen Konzept entstanden, noch können seine heterogenen Illustrationen einem einzigen Künstler zugeschrieben werden. Neben stilistischen Unterschieden sprechen auch inhaltliche, buchtechnische und historische Argumente für eine Entstehung über einen Zeitraum von 1470 bis gegen 1500 unter mindestens zwei verschiedenen, bis heute noch immer nicht identifizierten Besitzern. Nach meiner Einschätzung lassen sich inklusive der beiden Nachtragsillustrationen des Liebesgartens und Bergwerks insgesamt sechs verschiedene Illustratoren unterscheiden. Wichtiger als die Frage der Händescheidung, die angesichts der aktuellen Ausrichtung der Kunstgeschichte wie ein kennerschaftliches Glasperlenspiel anmuten mag, erscheint mir jedoch der Umstand, dass das Manuskript organisch aus verschiedenen Bestandteilen zusammengewachsen ist. Gerade hierin liegt eine besondere Faszination des „Hausbuchs“.
* Die Sammelhandschrift hat im 19. Jahrhundert das Etikett "Hausbuch" verpasst bekommen. Sind Sie damit glücklich?
Die Bezeichnung „Hausbuch“ ist irreführend und wird der thematischen Breite der Handschrift und ihrer herausragenden künstlerischen Qualität nicht gerecht. Auch frühere Forscher haben sich deshalb an dieser Benennung gestoßen. Hat gar das unspektakuläre Etikett „Hausbuch“ dazu beigetragen, dass man sich in den Ministerien Baden-Württembergs der einzigartigen Bedeutung dieser Handschrift nicht rechtzeitig bewusst geworden ist?
* Es scheint ja inzwischen Konsens zu sein, dass der Hausbuchmeister in den Jahren um 1480 im Mittelrheingebiet im Dreieck zwischen Mainz, Frankfurt und Heidelberg tätig war. Wie erklären Sie sich, dass man das stolz zweimal im Hausbuch präsentierte Ast-Wappen in dieser Region bislang nicht aufspüren konnte?
Die durch unzählige Kriege seit dem frühen 16. Jh. verursachten Verluste an historischen Kulturgütern sind gerade in diesem Gebiet sehr groß. Das im Hausbuch auftretende Wappen lässt sich wohl deshalb an anderer Stelle bislang nicht dokumentieren. Da das erste Wappen von einem Stechhelm, das zweite von einer in der Heraldik ungebräuchlichen Schallern [*] bekrönt ist, dürfte die Auftraggeberfamilie aus dem Bereich der am spätmittelalterlichen Hof an Einfluss gewinnenden Schicht nicht-adliger Spezialisten (Büchsenmeister o.ä.) stammen. Die Möglichkeit weiterer historischer Nachweise und der namentlichen Bestimmung wird dadurch noch geringer.
* Nun ist ja vor wenigen Tagen bekannt geworden, dass der bisherige Eigentümer das Hausbuch verkauft hat (wobei die Frage der Rechtsgültigkeit des Verkaufs dahingestellt bleiben kann). Sie sind Leiter der Sammlungen Malerei bis 1800 und Glasmalerei am Germanischen Generalmuseum in Nürnberg und einer von zwei Stellvertretern des Generaldirektors. Wie sehen Sie diesen Verkauf?
Als ich aus der Presse vom Verkauf des Hausbuchs erfuhr, war ich völlig überrascht. Die Umstände, die dazu geführt haben, haben mich erschüttert. Angesichts der Bedeutung der Handschrift muss meines Erachtens alles dafür getan werden, dass das Hausbuch dauerhaft in eine öffentliche Sammlung überführt werden kann, in der eine fachgerechte Verwahrung und Pflege sowie der Zugang für weitere Forschungen gesichert ist.
* Hielten Sie es, gemessen am Rang des Hausbuchs, für angebracht, eine ähnliche "Staatsaktion" wie seinerzeit beim "Evangeliar Heinrichs des Löwens", das ja 1983 für 32,5 Millionen DM für Deutschland ersteigert wurde, unter Beteiligung der Kulturstiftung der Länder in die Wege zu leiten?
Ich hoffe, dass es auf Grund der singulären kulturgeschichtlichen Bedeutung des Hausbuchs gelingt, die erforderlichen Mittel aufzubringen, um einen Ankauf für eine öffentliche Sammlung in die Wege zu leiten. Ich kann nicht verstehen, dass man diesen sicherlich schwierigeren und langwierigeren Weg nicht von vornherein verfolgt hat. Ich hoffe sehr, dass es für eine „Rettungsaktion“ noch nicht zu spät ist.
* In welches Museum würde das Hausbuch am besten passen?
In Deutschland gibt es eine Reihe großer Museen und Bibliotheken, in denen das Hausbuch vom Sammlungsprofil her gut untergebracht wäre und fachgerecht betreut werden könnte. Sollte sich in Baden-Württemberg keine Lösung finden, sei mir als Mitarbeiter des Germanischen Nationalmuseums der Hinweis erlaubt, dass die Handschrift im größten kunst- und kulturgeschichtlichen Museen im deutschen Sprachraum einen ihrer Bedeutung und breiten inhaltlichen Ausrichtung angemessenen Platz finden würde. Ich darf daran erinnern, dass das Germanische Nationalmuseum 1866 die erste vollständige Veröffentlichung des Hausbuch mit faksimilierten Abbildungen sowie 1957 eine populäre Zusammenfassung herausgegeben hat. Da ich doppelt befangen bin, sollten diese Überlegungen jedoch nicht im Vordergrund stehen.
* Sie stammen aus der Schweiz. Kennen Sie den als Verkäufer
gerüchtweise verdächtigten Sammler, den im Thurgau lebenden Baron August von Finck?
Ich kenne diesen Sammler nicht und werde mich im Internet kundig machen.
* Halten Sie im Zeichen der Globalisierung eine Liste national
wertvollen Kulturguts, auf der das Hausbuch ja steht, noch für
zeitgemäß? Wieso sollte so ein Stück, das man ja auch als
Weltkulturerbe ansprechen könnte, nicht auch in Basel oder Malibu
(Getty-Museum) dauerhaft lagern?
Grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden, doch halte ich die Bewahrung eines Artefakts möglichst in seinem Entstehungs- und Wirkungszusammenhang für die in jedem Fall beste Lösung. Je weiter ein Objekt seinem ursprünglichen Kontext entfremdet wird, desto größer ist die Gefahr eines Verlusts wichtiger historischer Zusammenhänge und Umstände.
* Angenommen, ein Museum würde das Hausbuch erwerben können? Könnte es überhaupt ständig ausgestellt werden? Die "Library of Congress" hat ja für die Waldseemüllerkarte, die ebenfalls aus Wolfegg stammt, eine eigene Vitrine gebaut.
Die konservatorischen Anforderungen haben auf Grund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Im Kontext eines zusehends auf Events abzielenden Leih- und Ausstellungsbetriebs droht die Bewahrung des uns anvertrauten, für die nachfolgenden Generationen möglichst unbeschadet zu überliefernden Kulturguts jedoch ins Hintertreffen zu geraten. Deshalb gilt es unter Ausschöpfung neuer Konservierungsmethoden und Präsentationsmittel sorgsam abzuwägen, in welcher Form wir besonders empfindliche Objekte wie Bücher, Papierarbeiten oder Textilien der Öffentlichkeit präsentieren können, ohne diesen Werken zuviel zuzumuten oder ihnen nachhaltig Schaden zuzufügen.
* Um nachzuhaken: Wäre eine - womöglich als "Event" inszenierte, auf wenige "Hausbuch-Tage" im Jahr beschränkte - museale Präsentation der fragilen Handschrift aus konservatorischer Sicht möglich? Eine meiner eindruckvollsten Begegnungen mit Kulturgut war ein Besuch im Heidekloster Wienhausen vor vielen Jahren, das nur in einer einzigen Woche nach Pfingsten jährlich einmal seine großartigen mittelalterlichen Bildteppiche zeigte.
Grundsätzlich scheint mir eine solche Präsentationsform möglich. Ob die Erwartungen der Besucher im Rahmen eines solchen „Events“ ohne visuelle Zusatzangebote wie Faksimile und Reproduktion befriedigt werden könnten, ist jedoch angesichts der Größe der sich nur in Nahsicht erschließenden Darstellungen und des Umstands, dass immer nur eine aufgeschlagene Doppelseite zu sehen ist, fraglich. Die Themenbreite des Hausbuchs ist andererseits so breit und spannend, dass man mit etwas Phantasie und Kreativität zündende Präsentationen entwickeln könnte, die auf einzigartige Weise in die Lebenswelt des Spätmittelalters einführen.
* Nun gibt es ja, wie erwähnt, seit 1997 ein sehr gutes Faksimile.
Brauchen wir da überhaupt das Original in öffentlichem Eigentum?
Für viele Fragestellungen, die sich vor allem inhaltlich und motivisch mit der Handschrift auseinandersetzen, bietet das Faksimile eine gute Arbeitsgrundlage. Für formale, stilistische, maltechnische und kunsttechnologische Fragestellungen und Untersuchungen ist die Auseinandersetzung mit dem Original jedoch unverzichtbar. Kein noch so gutes Faksimile kann das Original ersetzen.
* Vielen Dank für das Interview!
Helmform, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Schaller

Die Archivarin der Zeitschrift "Volkswirt" stellt der Spiegel (Link) vor.
Wolf Thomas - am Sonntag, 17. Februar 2008, 16:43 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.cinder.hk/LatinEdit/Overview.html
There is no Windows version, thus I cannot say anything about it.
There is no Windows version, thus I cannot say anything about it.
KlausGraf - am Sonntag, 17. Februar 2008, 16:27 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 17. Februar 2008, 04:31 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 17. Februar 2008, 03:37 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
... Fußnote als Fußtritt:
1 Ich bitte die freundliche Kritikerin meines Buches im Arch. f. math. Wirtschafts- u. Sozialforsch. 3, 238, die meine zu zahlreichen Sperrungen beanstandet, um Vergebung für diese einzige, hoffentlich vertretbare.(Carl Brinkmann, S. 53, Fn. 1 aus: "Schmollers Gerechtigkeit", in: Arthur Spiethoff (Hg.), Gustav von Schmoller und die deutsche geschichtliche Volkswirtschaftslehre. Festgabe zur hundertsten Wiederkehr seines Geburtstages 24. Juni 1938, Berlin 1938, 53-63.) Gesperrt war: "W i r b l e i b e n i m m e r e i n T e i l d e s P r o b l e m s , w e l c h e s w i r u n t e r s u c h e n u n d e r k e n n e n w o l l e n ." (Schmoller)
BCK - am Sonntag, 17. Februar 2008, 00:31 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 16. Februar 2008, 23:15 - Rubrik: Medienarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://digitalearchivaris.blogspot.com/2008/02/een-tweede-leven-voor-een-oude.html
The article on displaying archival maps in virtual worlds can be downloaded at:
http://www.box.net/shared/qzrico3oks
Serious articles on archival topics should be deposited in repositories like E-LIS!
The article on displaying archival maps in virtual worlds can be downloaded at:
http://www.box.net/shared/qzrico3oks
Serious articles on archival topics should be deposited in repositories like E-LIS!
KlausGraf - am Samstag, 16. Februar 2008, 17:18 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Das Original des Dayton-Abkommens zur Beendigung des Krieges in Bosnien-Herzegowina ist aus dem bosnisches Staatsarchiv verschwunden. ....."
Quelle:
Link
Quelle:
Link
Wolf Thomas - am Samstag, 16. Februar 2008, 15:15 - Rubrik: Kulturgut
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Samstag, 16. Februar 2008, 15:14 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Dietmar Gottschall, 1938 in Berlin geboren, absolvierte er eine Ausbildung an der Hamburger Fachschule für Fotografie.Dann aber studierte er Psychologie. Gearbeitet hat er als Redakteur bei „Capital“ und „Manager Magazin“.
Quelle:
FAZ-Bericht
Quelle:
FAZ-Bericht
Wolf Thomas - am Samstag, 16. Februar 2008, 15:12 - Rubrik: Fotoueberlieferung
" .... Ich habe im Wiesbadener Hauptstaatsarchiv die Akten des Mordfalles "Helga Matura" von 1966 einsehen dürfen, für mich ein riesiger Schatz. Und außerdem ein hochinteressantes Stück Stadtgeschichte, das weitgehend vergessen ist ..."
Quelle:
FR-Artikel
Quelle:
FR-Artikel
Wolf Thomas - am Samstag, 16. Februar 2008, 15:10 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Folgende Ankündigung des DRW (vgl. Rezension von Gerhard Schmitz (MGH) in: H-Soz-u-Kult, 26.11.2005) geben wir gerne weiter:
Auch Archivare sind eingeladen zum interdisziplinären Kolloquium:
Das Deutsche Rechtswörterbuch als interdisziplinäres Medium: Seine praktische Anwendung in Geschichte, Kunstgeschichte, Theologie, Germanistik und Recht
am 7./8. November 2008 in Heidelberg
Das "Deutsche Rechtswörterbuch" (DRW) ist ein nützliches Instrument für (fast) jeden historisch arbeitenden Wissenschaftler. Erfasst es doch - weit über das enge Korsett seines Namens hinaus - die gesamte ältere deutsche Sprache, soweit sie in weiterem Sinne rechtliche Relevanz hat. Das DRW enthält somit neben juristischen Fachbegriffen alle Wörter der Alltagssprache, sofern sie in rechtlichen Kontexten auftreten. So wird beispielsweise das Adjektiv "nackt" behandelt - aufgrund seiner rechtsrelevanten Bedeutung als Indiz für einen Ehebruch. Die Wörter werden in ihren unterschiedlichsten Bedeutungen erklärt, Beispiele für ihre Verwendung unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten aufgelistet. Das bearbeitete Quellencorpus reicht hierbei vom Beginn der schriftlichen Überlieferung im 6. Jahrhundert bis etwa 1800. Der Begriff "Deutsch" wird zudem weit gefasst; nach der Theorie des 19. Jahrhunderts, in dem das DRW konzipiert wurde, diente er als Oberbegriff für die gesamte westgermanische Sprachfamilie, so dass selbst "die friesische, niederländische, altsächsische und angelsächsische noch der deutschen sprache in engerm sinn zufallen", wie Jacob Grimm 1854 definiert hat.
Längst haben daher neben den Rechtshistorikern auch andere Disziplinen das DRW als wichtige Informationsquelle für sich entdeckt: Sprachwissenschaftler, Historiker, Kunsthistoriker, Religionshistoriker und auch viele Archivare. Die (kostenlose) Online-Ausgabe macht das Werk weltweit zugänglich. Immer mehr Quellentexte aus dem Corpus des DRW werden auf der Homepage als elektronischer Volltext oder als Faksimile zur Verfügung gestellt und durch zahlreiche Verlinkungen und Zusatzrecherchemöglichkeiten ergänzt.
75 Jahre nach Fertigstellung des ersten Bandes, während gerade der 12. Band des Werkes begonnen ist und bald der 90.000. Wortartikel bearbeitet wird, soll nun erneut Gelegenheit geboten werden, die Eindrücke, Interessen und Erwartungen der DRW-Nutzer zu sammeln. Die Interessenschwerpunkte seit Beginn des Projekts haben sich verschoben, neue Nutzergruppen sind hinzugetreten. Was sind ihre Erfahrungen? Was ihre Wünsche? Was hat einen Gebrauch des Wörterbuchs bislang verhindert? Die Forschungsstelle "Deutsches Rechtswörterbuch" an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften plant hierzu ein Kolloquium für interessierte Wissenschaftler/innen aller Disziplinen.
Das Kolloquium soll nicht zuletzt Nachwuchswissenschaftler/innen ansprechen, wobei eine abgeschlossene Promotion oder hinreichende praktische Berufserfahrung z.B. in einem Archiv erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich ist. Auf zwei Tage verteilt sollen die Teilnehmer/innen in einem Kurzreferat über ihre spezifischen Erfahrungen mit dem DRW berichten, gegebenenfalls Bezüge zur eigenen Forschung herstellen, Kritikpunkte oder Ansätze für eine Angebotsoptimierung des DRW herausarbeiten.
Ziel ist es, Erfahrungsberichte im Umgang mit dem DRW aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen zu sammeln. Die Tagungsteilnehmer/innen werden Gelegenheit haben, die Redaktionsarbeit des Rechtswörterbuchs näher kennenzulernen. Gegenseitiger Erfahrungsaustausch und Kontaktpflege zu Forschenden aus unterschiedlichen Disziplinen sind erwünschter Nebeneffekt. Ein Tagungsband ist geplant.
Fahrtkosten und Übernachtung werden von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften übernommen.
Interessierte senden Ihre Bewerbungen mit kurzem Lebenslauf und Themenvorschlag bitte bis spätestens 29. Februar 2008 an:
Dr. Andreas Deutsch
Leiter der Forschungsstelle Deutsches Rechtswörterbuch
Heidelberger Akademie der Wissenschaften
Karlstraße 4
D-69117 Heidelberg
Bei Rückfragen: drw-tagung@adw.uni-heidelberg.de.
Weitere Info: www.deutsches-rechtswoerterbuch.de
Auch Archivare sind eingeladen zum interdisziplinären Kolloquium:
Das Deutsche Rechtswörterbuch als interdisziplinäres Medium: Seine praktische Anwendung in Geschichte, Kunstgeschichte, Theologie, Germanistik und Recht
am 7./8. November 2008 in Heidelberg
Das "Deutsche Rechtswörterbuch" (DRW) ist ein nützliches Instrument für (fast) jeden historisch arbeitenden Wissenschaftler. Erfasst es doch - weit über das enge Korsett seines Namens hinaus - die gesamte ältere deutsche Sprache, soweit sie in weiterem Sinne rechtliche Relevanz hat. Das DRW enthält somit neben juristischen Fachbegriffen alle Wörter der Alltagssprache, sofern sie in rechtlichen Kontexten auftreten. So wird beispielsweise das Adjektiv "nackt" behandelt - aufgrund seiner rechtsrelevanten Bedeutung als Indiz für einen Ehebruch. Die Wörter werden in ihren unterschiedlichsten Bedeutungen erklärt, Beispiele für ihre Verwendung unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten aufgelistet. Das bearbeitete Quellencorpus reicht hierbei vom Beginn der schriftlichen Überlieferung im 6. Jahrhundert bis etwa 1800. Der Begriff "Deutsch" wird zudem weit gefasst; nach der Theorie des 19. Jahrhunderts, in dem das DRW konzipiert wurde, diente er als Oberbegriff für die gesamte westgermanische Sprachfamilie, so dass selbst "die friesische, niederländische, altsächsische und angelsächsische noch der deutschen sprache in engerm sinn zufallen", wie Jacob Grimm 1854 definiert hat.
Längst haben daher neben den Rechtshistorikern auch andere Disziplinen das DRW als wichtige Informationsquelle für sich entdeckt: Sprachwissenschaftler, Historiker, Kunsthistoriker, Religionshistoriker und auch viele Archivare. Die (kostenlose) Online-Ausgabe macht das Werk weltweit zugänglich. Immer mehr Quellentexte aus dem Corpus des DRW werden auf der Homepage als elektronischer Volltext oder als Faksimile zur Verfügung gestellt und durch zahlreiche Verlinkungen und Zusatzrecherchemöglichkeiten ergänzt.
75 Jahre nach Fertigstellung des ersten Bandes, während gerade der 12. Band des Werkes begonnen ist und bald der 90.000. Wortartikel bearbeitet wird, soll nun erneut Gelegenheit geboten werden, die Eindrücke, Interessen und Erwartungen der DRW-Nutzer zu sammeln. Die Interessenschwerpunkte seit Beginn des Projekts haben sich verschoben, neue Nutzergruppen sind hinzugetreten. Was sind ihre Erfahrungen? Was ihre Wünsche? Was hat einen Gebrauch des Wörterbuchs bislang verhindert? Die Forschungsstelle "Deutsches Rechtswörterbuch" an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften plant hierzu ein Kolloquium für interessierte Wissenschaftler/innen aller Disziplinen.
Das Kolloquium soll nicht zuletzt Nachwuchswissenschaftler/innen ansprechen, wobei eine abgeschlossene Promotion oder hinreichende praktische Berufserfahrung z.B. in einem Archiv erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich ist. Auf zwei Tage verteilt sollen die Teilnehmer/innen in einem Kurzreferat über ihre spezifischen Erfahrungen mit dem DRW berichten, gegebenenfalls Bezüge zur eigenen Forschung herstellen, Kritikpunkte oder Ansätze für eine Angebotsoptimierung des DRW herausarbeiten.
Ziel ist es, Erfahrungsberichte im Umgang mit dem DRW aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen zu sammeln. Die Tagungsteilnehmer/innen werden Gelegenheit haben, die Redaktionsarbeit des Rechtswörterbuchs näher kennenzulernen. Gegenseitiger Erfahrungsaustausch und Kontaktpflege zu Forschenden aus unterschiedlichen Disziplinen sind erwünschter Nebeneffekt. Ein Tagungsband ist geplant.
Fahrtkosten und Übernachtung werden von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften übernommen.
Interessierte senden Ihre Bewerbungen mit kurzem Lebenslauf und Themenvorschlag bitte bis spätestens 29. Februar 2008 an:
Dr. Andreas Deutsch
Leiter der Forschungsstelle Deutsches Rechtswörterbuch
Heidelberger Akademie der Wissenschaften
Karlstraße 4
D-69117 Heidelberg
Bei Rückfragen: drw-tagung@adw.uni-heidelberg.de.
Weitere Info: www.deutsches-rechtswoerterbuch.de
BCK - am Samstag, 16. Februar 2008, 13:50 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 16. Februar 2008, 01:37 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
By Jack Kessler
It is a starting-place for research, only, like any
encyclopedia... And it can be incomplete and uneven and
at-times-eccentric to the point of being quirky, although again
like any encyclopedia... It offers great "pictures"...
More importantly, though, Wikipédia is becoming the premier
research "starting-point", the first resort, on French subjects:
for students and researchers of all types, on both sides of the
Manche, both sides of the Atlantique, elsewhere -- just ask
them... Why? Because it is right there on the laptop or even on
the handheld: _that_ is "access"!
But what is the "quality" to be obtained thereby: the breadth,
the depth, the accuracy? Well, that is changing: all reference
resources change over time, but unlike the others Wikipédia is
changing very rapidly, and it seems always to be getting better.
A few Wikipédia examples:
* Jean Bodin -- This Wikipédia article currently offers several
concise screens' worth of information, on the 16th c. savant.
One learns, instantly and easily, who Bodin was and where he
"fits" -- that he was a contemporary of Montaigne and Nostradamus
-- that his ideas had something to do with "sovereignty", also
with "sorcery"... Instant links are provided, to other Wikipédia
articles on these topics, and to other websites, and famous
quotes and bibliography are included. It's all in French, but
links to similar -- perhaps done worse, perhaps done better --
are provided too, to other Wikipedia "Bodin" articles in 18 other
languages!
That last is extraordinary, I think: it reminds me of the old
"polyglot" bibles, which squeezed only 4 languages in.
So, if the professor, of law or politics or international
relations -- anywhere, including in France -- teased the class
today by announcing that next week's lecture will be about "Jean
Bodin", and if you can't remember much, or really have no idea...
Well, it's easy: out comes the omnipresent wifi-enabled laptop,
and this excellent Wikipédia starting-point conveniently appears.
No, don't "cite" Wikipédia in your thèse d'état... But then you
wouldn't cite a printed encyclopedia, either -- one which you
laboriously have dug out of a far-off library reading-room. Both
simply are research starting-points: one just happens to be a lot
more convenient, nowadays, and with its links far more supple,
than the other.
A second example:
* Révolution française -- The Senior Partner's spouse is on his
way to a tony Paris "cocktail"... He has texted you desperately
from his limo that his French is OK but he can't remember how
"The Mountain" figured in their revolution, or exactly what its
adherents were called, "and someone is sure to ask!"... He is an
insecure and anxious type, and She is not along this time to
reassure him...
The Wikipédia article on his topic, which he can reach and read
easily en route, on his own handheld, can advise him: "Quand les
_Montagnards_ arrivent au pouvoir, la République connaît des
périls extrèmes..." etc. -- and as "Montagnards" is linked he not
only learns the exact French term he sought but also he can point
& click to an article providing great detail about the group...
this to a limo crawling through Paris traffic... via an
intermediary -- you -- who might be located currently on a bus in
San Francisco, or beneath a tree in Tasmania...
It is a Brave New Information World... but at least Wikipédia is
here, to help the francophone part of it, anyway...
A few more instances:
* glaucome -- Linked from the article in English... the French
Wikipédia article not only provides the subtly-different French
spelling of the principal term, it also offers reminders of
ancillary terminology and faux amis -- "humeur aqueuse", "la
pression intra-oculaire", "corps ciliare" -- useful review for
one's own limo-, or maybe taxi-, ride to that professional
conference out at La Défense.
* Lyon -- Suppose it's a student paper on Roman Gaul... The
Wikipédia article: ah, "Lugdunum" -- link to an enormous detailed
article on the old Roman capital, rigorously annotated and
copiously linked. Sheer magic, those Internet links...
Illustrated, with full bibliography: the inquisitive student's
research dream.
* and, finally here, chaologie -- oops no, faux ami alert,
Wikipédia says that should be "chaos quantique" -- let's see...
Again, the Wikipédia article appears to be very complete: an
introduction, starting-point only, but who among us honestly can
say we'd need no such overview / introduction to such a subject,
particularly to its French aspects and terminology, if we were
asked to "report on" or "attend a conference regarding" same?
All this is introduced by a well-designed and interesting
homepage --
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
-- which explains how the specifically-French Wikipedia site is
constructed, and offers characteristically-French resources for
plowing through it -- "portails thématiques", "image du jour", etc.
The general Wikipedia effort has developed into one of the
world's outstanding digital library resources. To date there are
over 2,218,000 articles in its version in English alone; plus
over 705,000 in German, 468,000 in Polish, 466,000 in Japanese,
410,000 in Italian -- and such Wikipedia versions are offered now
in over 250 languages.
The range of quality in the articles can be enormous: from very
bad to extremely good, again like other reference resources...
But in Wikipedia's case there is one outstanding difference: the
good articles can be really good, and the bad articles constantly
-- 24/7 in a continuous and truly-globalized effort -- are
getting better and better.
This last is a key to Wikipedia, as it is to so many online
digital library undertakings: change -- Wikipedia is dynamic,
constantly-changing -- this can be unsettling, to someone seeking
immutability, permanence, in their "authoritative" reference
resources -- but it is how Wikipedia grows, so rapidly and so
enormously, and it is how it gets better and better.
Other reference resources by comparison are immutable, literally:
they just stand there, still, until their next publication date,
which may be years away. That can be a good thing but also a bad
thing, just like Wikipedia's changeability...
To anyone interested in information science -- interested in
digital libraries -- perhaps the most fascinating aspect of the
Wikipedia effort is its tranparency: the minute history and
ongoing log of the design and development of each article may be
viewed by any registered member, on the article's "historique"
and "discussion" tab pages -- to register simply click the link
in the upper right corner of any page, "Créer un compte".
The Wikipedia in French -- "Wikipédia: l'encyclopédie libre" --
http://fr.wikipedia.org
-- currently offers over 621,459 articles, available from nearly
anywhere, 24/7, on your nearest laptop or iPhone, with nice
pictures and active links, plus links to same-topic articles in
nearly any language.
Jack Kessler, kessler@well.com
Sent from my iPhone -- The Future will be Handheld
--oOo--
FYI France (sm)(tm) e-journal ISSN 1071-5916
*
| FYI France (sm)(tm) is a monthly electronic
| journal published since 1992 as a small-scale,
| personal experiment, in the creation of large-
| scale "information overload", by Jack Kessler.
/ \ Any material written by me which appears in
----- FYI France may be copied and used by anyone for
// \\ any good purpose, so long as, a) they give me
--------- credit and show my email address, and, b) it
// \\ isn't going to make them money: if it is going
to make them money, they must get my permission
in advance, and share some of the money which they get with me.
Use of material written by others requires their permission. FYI
France archives may be found at http://www.cru.fr/listes/biblio-fr@cru.fr/
(BIBLIO-FR archive), or http://listserv.uh.edu/archives/pacs-l.html
(PACS-L archive), or http://www.lib.berkeley.edu/Collections/FYIFrance/
or http://www.fyifrance.com . Suggestions, reactions, criticisms,
praise, and poison-pen letters all gratefully received at kessler@well.sf.ca.us .
Copyright 1992- , by Jack Kessler,
all rights reserved except as indicated above.
It is a starting-place for research, only, like any
encyclopedia... And it can be incomplete and uneven and
at-times-eccentric to the point of being quirky, although again
like any encyclopedia... It offers great "pictures"...
More importantly, though, Wikipédia is becoming the premier
research "starting-point", the first resort, on French subjects:
for students and researchers of all types, on both sides of the
Manche, both sides of the Atlantique, elsewhere -- just ask
them... Why? Because it is right there on the laptop or even on
the handheld: _that_ is "access"!
But what is the "quality" to be obtained thereby: the breadth,
the depth, the accuracy? Well, that is changing: all reference
resources change over time, but unlike the others Wikipédia is
changing very rapidly, and it seems always to be getting better.
A few Wikipédia examples:
* Jean Bodin -- This Wikipédia article currently offers several
concise screens' worth of information, on the 16th c. savant.
One learns, instantly and easily, who Bodin was and where he
"fits" -- that he was a contemporary of Montaigne and Nostradamus
-- that his ideas had something to do with "sovereignty", also
with "sorcery"... Instant links are provided, to other Wikipédia
articles on these topics, and to other websites, and famous
quotes and bibliography are included. It's all in French, but
links to similar -- perhaps done worse, perhaps done better --
are provided too, to other Wikipedia "Bodin" articles in 18 other
languages!
That last is extraordinary, I think: it reminds me of the old
"polyglot" bibles, which squeezed only 4 languages in.
So, if the professor, of law or politics or international
relations -- anywhere, including in France -- teased the class
today by announcing that next week's lecture will be about "Jean
Bodin", and if you can't remember much, or really have no idea...
Well, it's easy: out comes the omnipresent wifi-enabled laptop,
and this excellent Wikipédia starting-point conveniently appears.
No, don't "cite" Wikipédia in your thèse d'état... But then you
wouldn't cite a printed encyclopedia, either -- one which you
laboriously have dug out of a far-off library reading-room. Both
simply are research starting-points: one just happens to be a lot
more convenient, nowadays, and with its links far more supple,
than the other.
A second example:
* Révolution française -- The Senior Partner's spouse is on his
way to a tony Paris "cocktail"... He has texted you desperately
from his limo that his French is OK but he can't remember how
"The Mountain" figured in their revolution, or exactly what its
adherents were called, "and someone is sure to ask!"... He is an
insecure and anxious type, and She is not along this time to
reassure him...
The Wikipédia article on his topic, which he can reach and read
easily en route, on his own handheld, can advise him: "Quand les
_Montagnards_ arrivent au pouvoir, la République connaît des
périls extrèmes..." etc. -- and as "Montagnards" is linked he not
only learns the exact French term he sought but also he can point
& click to an article providing great detail about the group...
this to a limo crawling through Paris traffic... via an
intermediary -- you -- who might be located currently on a bus in
San Francisco, or beneath a tree in Tasmania...
It is a Brave New Information World... but at least Wikipédia is
here, to help the francophone part of it, anyway...
A few more instances:
* glaucome -- Linked from the article in English... the French
Wikipédia article not only provides the subtly-different French
spelling of the principal term, it also offers reminders of
ancillary terminology and faux amis -- "humeur aqueuse", "la
pression intra-oculaire", "corps ciliare" -- useful review for
one's own limo-, or maybe taxi-, ride to that professional
conference out at La Défense.
* Lyon -- Suppose it's a student paper on Roman Gaul... The
Wikipédia article: ah, "Lugdunum" -- link to an enormous detailed
article on the old Roman capital, rigorously annotated and
copiously linked. Sheer magic, those Internet links...
Illustrated, with full bibliography: the inquisitive student's
research dream.
* and, finally here, chaologie -- oops no, faux ami alert,
Wikipédia says that should be "chaos quantique" -- let's see...
Again, the Wikipédia article appears to be very complete: an
introduction, starting-point only, but who among us honestly can
say we'd need no such overview / introduction to such a subject,
particularly to its French aspects and terminology, if we were
asked to "report on" or "attend a conference regarding" same?
All this is introduced by a well-designed and interesting
homepage --
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
-- which explains how the specifically-French Wikipedia site is
constructed, and offers characteristically-French resources for
plowing through it -- "portails thématiques", "image du jour", etc.
The general Wikipedia effort has developed into one of the
world's outstanding digital library resources. To date there are
over 2,218,000 articles in its version in English alone; plus
over 705,000 in German, 468,000 in Polish, 466,000 in Japanese,
410,000 in Italian -- and such Wikipedia versions are offered now
in over 250 languages.
The range of quality in the articles can be enormous: from very
bad to extremely good, again like other reference resources...
But in Wikipedia's case there is one outstanding difference: the
good articles can be really good, and the bad articles constantly
-- 24/7 in a continuous and truly-globalized effort -- are
getting better and better.
This last is a key to Wikipedia, as it is to so many online
digital library undertakings: change -- Wikipedia is dynamic,
constantly-changing -- this can be unsettling, to someone seeking
immutability, permanence, in their "authoritative" reference
resources -- but it is how Wikipedia grows, so rapidly and so
enormously, and it is how it gets better and better.
Other reference resources by comparison are immutable, literally:
they just stand there, still, until their next publication date,
which may be years away. That can be a good thing but also a bad
thing, just like Wikipedia's changeability...
To anyone interested in information science -- interested in
digital libraries -- perhaps the most fascinating aspect of the
Wikipedia effort is its tranparency: the minute history and
ongoing log of the design and development of each article may be
viewed by any registered member, on the article's "historique"
and "discussion" tab pages -- to register simply click the link
in the upper right corner of any page, "Créer un compte".
The Wikipedia in French -- "Wikipédia: l'encyclopédie libre" --
http://fr.wikipedia.org
-- currently offers over 621,459 articles, available from nearly
anywhere, 24/7, on your nearest laptop or iPhone, with nice
pictures and active links, plus links to same-topic articles in
nearly any language.
Jack Kessler, kessler@well.com
Sent from my iPhone -- The Future will be Handheld
--oOo--
FYI France (sm)(tm) e-journal ISSN 1071-5916
*
| FYI France (sm)(tm) is a monthly electronic
| journal published since 1992 as a small-scale,
| personal experiment, in the creation of large-
| scale "information overload", by Jack Kessler.
/ \ Any material written by me which appears in
----- FYI France may be copied and used by anyone for
// \\ any good purpose, so long as, a) they give me
--------- credit and show my email address, and, b) it
// \\ isn't going to make them money: if it is going
to make them money, they must get my permission
in advance, and share some of the money which they get with me.
Use of material written by others requires their permission. FYI
France archives may be found at http://www.cru.fr/listes/biblio-fr@cru.fr/
(BIBLIO-FR archive), or http://listserv.uh.edu/archives/pacs-l.html
(PACS-L archive), or http://www.lib.berkeley.edu/Collections/FYIFrance/
or http://www.fyifrance.com . Suggestions, reactions, criticisms,
praise, and poison-pen letters all gratefully received at kessler@well.sf.ca.us .
Copyright 1992- , by Jack Kessler,
all rights reserved except as indicated above.
KlausGraf - am Samstag, 16. Februar 2008, 01:24 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://en.wikinews.org/wiki/Historic_manuscript_%22The_Housebook%22_reported_sold_in_Germany
If anyone can add some details: it's a wiki.
In this weblog see
http://archiv.twoday.net/topics/Kulturgut/
passim (German news on the Housebook case).

If anyone can add some details: it's a wiki.
In this weblog see
http://archiv.twoday.net/topics/Kulturgut/
passim (German news on the Housebook case).

KlausGraf - am Samstag, 16. Februar 2008, 00:45 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Allein der jetzt regierende Fürst hat sich nicht entschließen können, den Codex noch einmal aus der Hand zu geben. Das Comité der soeben in Augsburg stattfindenden Ausstellung hatte sich zwar der Hoffnung hingegeben, denselben zur Ausstellung zu erhalten, und so wäre auch die Möglichkeit geboten gewesen, daß er für unsere Zwecke noch hätte verglichen werden können. Indessen ist das Buch doch nicht zur Ausstellung gekommen, weil, wie man uns versicherte, der Fürst an der Freiheit einiger Darstellungen Anstand nimmt. Essenwein 1887 nach
http://de.wikisource.org/wiki/Mittelalterliches_Hausbuch

http://de.wikisource.org/wiki/Mittelalterliches_Hausbuch

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In Finnland werden die im Rahmen einer Buchpatenschaft restaurierten Bände digitalisiert und öffentlich zugänglich gemacht - eine ausgezeichnete Idee!
http://www.rahasto.kansalliskirjasto.fi/raddaboken/digitaliseratobjekt.php?list=nimeke
Unter den Digitalisaten ist auch ein deutschsprachiger Titel von 1804.
http://www.rahasto.kansalliskirjasto.fi/raddaboken/digitaliseratobjekt.php?list=nimeke
Unter den Digitalisaten ist auch ein deutschsprachiger Titel von 1804.
KlausGraf - am Freitag, 15. Februar 2008, 22:56 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mittelalterliches_Hausbuch_%281887%29
Ohne die Abbildungen.

Der Text wird auch in Wikisource bereitstehen. Beispiel einer anderen Seite:
Luna der monat der letzst planet naß
Heiß ich vnd wurck dingk die sein laß
Kalt vnd feucht mein wurckung ist
Naturlich vnstet zu aller frist
http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Mittelalterliches_Hausbuch_1887_11.jpg
Ohne die Abbildungen.

Der Text wird auch in Wikisource bereitstehen. Beispiel einer anderen Seite:
Luna der monat der letzst planet naß
Heiß ich vnd wurck dingk die sein laß
Kalt vnd feucht mein wurckung ist
Naturlich vnstet zu aller frist
http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Mittelalterliches_Hausbuch_1887_11.jpg
http://tools.wikimedia.de/~apper/pd/
(Automatische Trunkierung hinten und vorne: phons findet auch Alphonse)
53 Personen stammen aus Aserbeidschan, z.B.
http://tools.wikimedia.de/~apper/pd/index.php?name=tur+rasi
Wussten Sie schon, dass heute vor 140 Jahren der Prämonstratenser-Historiker Alphons Žák geboren wurde?
In Kirchberg an der Wild wirkte er nicht nur als Seelsorger, sondern während des Ersten Weltkriegs auch als Verwalter für das Internierungslager Kirchberg an der Wild sowie für das ukrainisches Privatgymnasium und Waisenhaus. Seine Tätigkeit für das Internierungslager wertete er publizistisch aus, er sprach sich auch dafür aus, dass Unterlagen über das Lager in Archiven gesammelt wurden.
(Automatische Trunkierung hinten und vorne: phons findet auch Alphonse)
53 Personen stammen aus Aserbeidschan, z.B.
http://tools.wikimedia.de/~apper/pd/index.php?name=tur+rasi
Wussten Sie schon, dass heute vor 140 Jahren der Prämonstratenser-Historiker Alphons Žák geboren wurde?
In Kirchberg an der Wild wirkte er nicht nur als Seelsorger, sondern während des Ersten Weltkriegs auch als Verwalter für das Internierungslager Kirchberg an der Wild sowie für das ukrainisches Privatgymnasium und Waisenhaus. Seine Tätigkeit für das Internierungslager wertete er publizistisch aus, er sprach sich auch dafür aus, dass Unterlagen über das Lager in Archiven gesammelt wurden.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde [keine Homepage?] 107 (2007) hat das Schwerpunktthema Sportgeschichte. S. 103ff. "Sportfotografien im Staatsarchiv" ist eine reine Bildstrecke (die Bilder sind im digitalisierten Angebot des Staatsarchivs nicht enthalten!).
KlausGraf - am Freitag, 15. Februar 2008, 20:20 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zitat aus:
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=1886
Archivieren und Forschen
Bericht von:
Roger Sidler, Bern
E-Mail:
Das Archiv für Agrargeschichte (AfA) feierte am 23.11.2007 sein 5-jähriges Bestehen mit einer Tagung im Berner Käfigturm, auf der auch der Band 2 seiner Reihe Studien und Quellen zur Agrargeschichte/Etudes et sources de l’histoire rurale vorgestellt wurde.
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=1886
Archivieren und Forschen
Bericht von:
Roger Sidler, Bern
E-Mail:
Das Archiv für Agrargeschichte (AfA) feierte am 23.11.2007 sein 5-jähriges Bestehen mit einer Tagung im Berner Käfigturm, auf der auch der Band 2 seiner Reihe Studien und Quellen zur Agrargeschichte/Etudes et sources de l’histoire rurale vorgestellt wurde.
KlausGraf - am Freitag, 15. Februar 2008, 20:00 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Klaus Wrede schrieb einen lesenswerten Kommentar zu einem Beitrag über das Ende des gedruckten Brockhauses
http://www.boersenblatt.net/180923/
In der Wikipedia lässt sich jede Bearbeitungsstufe zeitlich unbegrenzt (?) nachvollziehen. Bei Tageszeitungen haben wir uns auch angewöhnt, einzelne Ausgaben zu zitieren, also ist das beliebte Argument mit der fehlenden Langzeitarchivierung nur sehr bedingt tauglich. Wichtige Fassungen eines elektronischen Nachschlagewerks könnten durch die Deutsche Bibliothek archiviert werden oder meinetwegen auch ausgedruckt.
http://www.boersenblatt.net/180923/
In der Wikipedia lässt sich jede Bearbeitungsstufe zeitlich unbegrenzt (?) nachvollziehen. Bei Tageszeitungen haben wir uns auch angewöhnt, einzelne Ausgaben zu zitieren, also ist das beliebte Argument mit der fehlenden Langzeitarchivierung nur sehr bedingt tauglich. Wichtige Fassungen eines elektronischen Nachschlagewerks könnten durch die Deutsche Bibliothek archiviert werden oder meinetwegen auch ausgedruckt.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Adelshaus Waldburg-Wolfegg kann sich nicht, wie offenbar versucht, damit herausreden, von Auflagen im Zusammenhang mit der Veräußerung seines Mittelalterlichen Hausbuchs im Juli 2007 keine Kenntnis gehabt zu haben. Dietrich Birk, Staatssekretär im zuständigen Wissenschaftsministerium, hatte Johannes Fürst zu Waldburg-Wolfegg schriftlich im August 2006 darauf hingewiesen, dass das Handbuch als Kulturgut geschützt sei und auch als Teil des Fideikommisses unter denkmalgeschützter Aufsicht stehe. Danach müssen Eigentümer- und Standortwechsel angezeigt und die Genehmigung zum Verkauf eingeholt werden. Entsprechende Auflagen hatte das Oberlandesgericht Stuttgart bereits 1956 in einem Beschluss festgeschrieben. Gleichzeitig wurde damals dem Land ein Vorkaufsrecht an dem Hausbuch eingeräumt.
Im Juni 2006 hatte das Adelshaus dem Land erstmals deutlich gemacht, dass es sich von dem Hausbuch trennen wolle. Seinem schriftlich geäußerten Vorschlag, das Hausbuch gegen frei veräußerbare Handschriften aus dem Bestand der Landesbibliothek einzutauschen, hatte Birk im erwähnten Schreiben eine Absage erteilt.
Fest steht, dass das Adelshaus bis gestern den Auflagen nicht nachgekommen ist. Vom Land wurde ihm diese Woche eine letzte Frist bis zum 22. Februar eingeräumt, ehe rechtliche Schritte eingeleitet werden. Zwar informierte Waldburg-Wolfegg im August 2007 das ebenfalls zuständige Wirtschaftsministerium vom Verkauf im Monat zuvor. Käufer und Standort wurden aber nicht benannt, auch kein Kaufvertrag vorgelegt. Mehrere behördliche Aufforderungen blieben dann seit Ende Oktober unbeantwortet. Den Namen des Käufers, August Baron von Finck, erfuhr Wirtschaftsminister Ernst Pfister am 15. Januar in einem Vier-Augen-Gespräch mit Hausbuch-Vermittler Graf Douglas.
Ergänzend dazu die Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.02.2008, Nr. 39, S. 35
Unverzügliche Bringschuld
Stuttgart fordert Auskunft über den Hausbuch-Verkauf
Jedenfalls hat der Streit über die badischen Kulturgüter die Beamten in den
Stuttgarter Ministerien auch nicht sensibler gemacht für die Belange des
Kulturgüterschutzes. Den Vorwurf des "Kulturbanausentums" haben viele Beamte wie
einen Wassertropfen an einer Gore-tex-Jacke an sich abperlen lassen. Das
Wirtschaftsministerium, das für den Denkmalschutz zuständig ist und in diesen
Fragen schlecht mit dem für den Kulturgüterschutz zuständigen
Wissenschaftsministerium zusammenarbeitete, war am 14. August 2007 von Fürst
Waldburg-Wolfegg informiert worden. Der zuständige Ministerialdirektor brauchte
sechs Tage zur Weiterleitung des Briefs an den für Denkmalschutz zuständigen
Referatsleiter. Weil dieser gerade gewechselt hatte, dauerte es drei Monate, bis
das Regierungspräsidium in Tübingen und das Wissenschaftsministerium über die
Verkaufsabsichten des Fürsten informiert wurden.
Bietigheimer Zeitung

Im Juni 2006 hatte das Adelshaus dem Land erstmals deutlich gemacht, dass es sich von dem Hausbuch trennen wolle. Seinem schriftlich geäußerten Vorschlag, das Hausbuch gegen frei veräußerbare Handschriften aus dem Bestand der Landesbibliothek einzutauschen, hatte Birk im erwähnten Schreiben eine Absage erteilt.
Fest steht, dass das Adelshaus bis gestern den Auflagen nicht nachgekommen ist. Vom Land wurde ihm diese Woche eine letzte Frist bis zum 22. Februar eingeräumt, ehe rechtliche Schritte eingeleitet werden. Zwar informierte Waldburg-Wolfegg im August 2007 das ebenfalls zuständige Wirtschaftsministerium vom Verkauf im Monat zuvor. Käufer und Standort wurden aber nicht benannt, auch kein Kaufvertrag vorgelegt. Mehrere behördliche Aufforderungen blieben dann seit Ende Oktober unbeantwortet. Den Namen des Käufers, August Baron von Finck, erfuhr Wirtschaftsminister Ernst Pfister am 15. Januar in einem Vier-Augen-Gespräch mit Hausbuch-Vermittler Graf Douglas.
Ergänzend dazu die Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.02.2008, Nr. 39, S. 35
Unverzügliche Bringschuld
Stuttgart fordert Auskunft über den Hausbuch-Verkauf
Jedenfalls hat der Streit über die badischen Kulturgüter die Beamten in den
Stuttgarter Ministerien auch nicht sensibler gemacht für die Belange des
Kulturgüterschutzes. Den Vorwurf des "Kulturbanausentums" haben viele Beamte wie
einen Wassertropfen an einer Gore-tex-Jacke an sich abperlen lassen. Das
Wirtschaftsministerium, das für den Denkmalschutz zuständig ist und in diesen
Fragen schlecht mit dem für den Kulturgüterschutz zuständigen
Wissenschaftsministerium zusammenarbeitete, war am 14. August 2007 von Fürst
Waldburg-Wolfegg informiert worden. Der zuständige Ministerialdirektor brauchte
sechs Tage zur Weiterleitung des Briefs an den für Denkmalschutz zuständigen
Referatsleiter. Weil dieser gerade gewechselt hatte, dauerte es drei Monate, bis
das Regierungspräsidium in Tübingen und das Wissenschaftsministerium über die
Verkaufsabsichten des Fürsten informiert wurden.
Bietigheimer Zeitung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.welt.de/welt_print/article1672074/Den_Fuersten_keinen_Pfennig.html
Wenn der deutsche Adel Kunstschätze verkauft, konkurrieren privates und öffentliches Interesse
"Dieser Fürst hat viele starke Seiten", lobte das ZDF Johannes Fürst zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee. Vielen sei er "als Hüter der Waldburg und Bewahrer des Wolfegger Kupferstichkabinetts ein Begriff", meinte das Haus der Geschichte Baden-Württemberg anlässlich eine Plauderstunde "Adel verpflichtet - wozu?". Die Frage ist aktuell. Denn gerade hat der Fürst das berühmte mittelalterliche "Hausbuch" verkauft. Und dabei, wie das Wissenschaftsministerium in Stuttgart wissen ließ, die Vorgaben des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung missachtet, auf dessen Liste die bedeutende Handschrift steht. Da der Verkauf ohne Genehmigung erfolgte, sei er unwirksam, heißt es in Stuttgart. Zugleich prüfe man rechtliche Schritte. Denn wer das Gesetz missachtet, "wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft". Bereits "der Versuch ist strafbar". Und zusätzlich kann das "Kulturgut oder Archivgut, auf das sich die Straftat bezieht, eingezogen werden". Zugunsten des Landes.
Im Extremfall könnte Baden-Württemberg also einen Schatz gewinnen, den es sich aufgrund seiner Finanzen nicht leisten kann. Von 20 Millionen Euro wird nämlich gemunkelt.
Der Artikel von Peter Dittmar wirft ohne Not Fideikommiss-Schutzrecht und Abwanderungs-Schutz durcheinander. Kann man sich, wenn man schon nicht hierherfindet, nicht wenigstens in der FAZ informieren, was Sache ist?
Mit dem Brief ans (unzuständige) Wirtschafsministerium im letzten Jahr mit der Verkaufsanzeige hat das Haus Waldburg-Wolfegg möglicherweise der Anzeigepflicht genügt.
§ 9 Abs. 1 KultgSchG:
"Wird ein eingetragenes Kulturgut im Inland an einen anderen Ort gebracht oder gerät es in Verlust oder ist es beschädigt worden, so hat der Besitzer unverzüglich der obersten Landesbehörde Mitteilung zu machen, die dem Beauftragten der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und der Medien davon Kenntnis gibt. Zur Mitteilung sind im Falle des Besitzwechsels der bisherige und der neue Besitzer verpflichtet."
Wenn das Wirtschaftsministerium die Mitteilung nicht weiterleitet, ist das nicht die Schuld der Wolfegger. Eine Ordnungswidrigkeit liegt sicher nicht vor.
Aber das ist nicht der Punkt: Der Verkauf ist rechtlich unwirksam, da die Genehmigung des Regierungspräsidiums aufgrund eines rechtsgültigen gerichtlichen Fideikommissauflösungsbeschlusses nicht eingeholt wurde.
Wieso gilt eigentlich die folgende Bestimmung (§ 14) nur für Archivgut?
"Wer Verhandlungen über die Ausfuhr von geschütztem Archivgut (§ 10) aus dem Geltungsbereich des Gesetzes führt oder vermittelt, hat dies dem Beauftragten der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und der Medien unverzüglich mitzuteilen."
Geldnot war nicht der Grund für den Hausbuch-Verkauf, ist Dittmar überzeugt:
Immerhin gehört zu diesem Familienbesitz noch ein veritables Schloss samt Golfplatz nebenan. Die Armut schaut also noch nicht um die Ecke wie scheinbar bei Prinz Rüdiger von Sachsen, dem Chef des Hauses Wettin. Er lebe mit seiner Frau ebenso wie seine beiden Schwestern zur Miete, verriet er der "Dresdner Morgenpost": "Die bedrückenden Verhältnisse, in denen unsere Familie leben muss, erzwingen, dass wir Einnahmen haben." Und diese Einnahmen erwachsen aus einem komplizierten Vergleich mit dem Freistaat. 1999 einigte man sich, dass von 18 000 Kunstwerken in sächsischen Museen 6000 an das Haus Wettin zurückgingen - und für die verbleibenden 23,6 Millionen Mark gezahlt würden. Allerdings enthält der Vertrag eine "Öffnungsklausel", die weitere Forderungen möglich macht. 2006 waren das sechs bedeutende Porzellane, von denen die Staatliche Porzellansammlung zwar eins als Geschenk erhielt, die anderen fünf jedoch bei Christie's Siebenstelliges eintrugen. Aber damit noch nicht genug. Weitere 1600 Porzellane sowie 139 Bilder stehen auf einer neuen Liste, obwohl der Prinz doch erklärt hatte: "Wir haben weder Platz noch Mittel für die Unterbringung und Pflege dieser Werke." Der Kunstmarkt wird es ihm danken.
Denn der Kunstmarkt liebt die hochadligen Häuser: die Fürsten zu Waldburg wie das Haus Wettin, die Markgrafen und Großherzöge von Baden wie die Thurn und Taxis, die Fürsten zu Fürstenberg und natürlich das Haus Hannover. Sie alle haben - auf einen Schlag oder sukzessive in mehreren Auktionen - unters Volk gebracht, was sich im Laufe der Jahrhunderte in ihren Schlössern angesammelt hat. Und das war nicht wenig. Denn das raue 20. Jahrhundert hat sie allen Kriegen, Revolutionen, Umbrüchen zum Trotz noch recht gut behandelt. Französische Verhältnisse wie nach 1789, als jeglicher Adelsbesitz von der Republik entschädigungslos kassiert wurde, hat es in deutschen Landen nicht gegeben.
Nach der Novemberrevolution anno 1918 wurde zwar der "Fürstenbesitz" beschlagnahmt, aber enteignet wurde er nicht. Als sich die deutsche Republik stabilisierte, zog der Adel vor die Gerichte. Und die haben generell den Anspruch auf das Privateigentum anerkannt. Probleme machte allerdings die Scheidung, was "privat" sei und was der herrscherlichen Funktion zugerechnet werden müsse, also dem nachfolgenden Staat gehöre. Das Ergebnis waren Kompromisse, mit denen die Fürstenhäuser zufrieden sein konnten.
Der Freistaat Bayern einigte sich 1923 mit den Wittelsbachern, deren Besitztümer in den Wittelsbacher Ausgleichsfonds zu übertragen, eine Stiftung, deren Erträge den Wittelsbachern zustehen, während die immaterielle, oft kostenträchtige Nutzung - z. B. der umfangreiche Kunstbesitz - dem Freistaat zusteht. Der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin hatte bereits Ende 1919 einen Abfindungsvertrag akzeptiert, der ihm Grundbesitz, Schlösser sowie sechs Millionen Mark und dazu eine jährliche Rente von 175 000 Mark und Jahresrenten für einige Familienmitglieder garantierte. Die Abfindung der Wettiner regelte 1924 ein Gesetz. Die Welfen ließen sich ein Jahr später auf den Vergleich ein, den das Oberlandesgericht Braunschweig erarbeitet hatte. Und in Preußen wurde 1926 ein Vertrag über den Vermögensausgleich mit den Hohenzollern geschlossen.
[...] weil es bei dem Adelsbesitz nicht nur um Schlösser, Wald- und Grundbesitz, sondern auch um bedeutende Kunstschätze geht, eröffnet sich damit ein weites Feld nicht nur für Juristen. Der "Fall Hausbuch" macht das ebenso deutlich wie der Streit mit den Wettinern um die Dresdner Kunstschätze und Stuttgarts Probleme mit Schloss Salem und dem Eigentum an Kunstwerken wie Archivbeständen aus badischem Besitz. Eine zentrale, gar eine "französische" Lösung kann es wegen der Kulturhoheit der Länder nicht geben. So herrscht auch hier nur zu oft "die Rücksicht, die elend lässt zu hohen Jahren kommen".
Zum Plan einer Fürstenteignung in der Weimarer Republik siehe
http://archiv.twoday.net/search?q=f%C3%BCrstenent
Dittmars Schlusszitat war mir nicht bekannt, es stammt aus Shakespeares "Hamlet".

Wenn der deutsche Adel Kunstschätze verkauft, konkurrieren privates und öffentliches Interesse
"Dieser Fürst hat viele starke Seiten", lobte das ZDF Johannes Fürst zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee. Vielen sei er "als Hüter der Waldburg und Bewahrer des Wolfegger Kupferstichkabinetts ein Begriff", meinte das Haus der Geschichte Baden-Württemberg anlässlich eine Plauderstunde "Adel verpflichtet - wozu?". Die Frage ist aktuell. Denn gerade hat der Fürst das berühmte mittelalterliche "Hausbuch" verkauft. Und dabei, wie das Wissenschaftsministerium in Stuttgart wissen ließ, die Vorgaben des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung missachtet, auf dessen Liste die bedeutende Handschrift steht. Da der Verkauf ohne Genehmigung erfolgte, sei er unwirksam, heißt es in Stuttgart. Zugleich prüfe man rechtliche Schritte. Denn wer das Gesetz missachtet, "wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft". Bereits "der Versuch ist strafbar". Und zusätzlich kann das "Kulturgut oder Archivgut, auf das sich die Straftat bezieht, eingezogen werden". Zugunsten des Landes.
Im Extremfall könnte Baden-Württemberg also einen Schatz gewinnen, den es sich aufgrund seiner Finanzen nicht leisten kann. Von 20 Millionen Euro wird nämlich gemunkelt.
Der Artikel von Peter Dittmar wirft ohne Not Fideikommiss-Schutzrecht und Abwanderungs-Schutz durcheinander. Kann man sich, wenn man schon nicht hierherfindet, nicht wenigstens in der FAZ informieren, was Sache ist?
Mit dem Brief ans (unzuständige) Wirtschafsministerium im letzten Jahr mit der Verkaufsanzeige hat das Haus Waldburg-Wolfegg möglicherweise der Anzeigepflicht genügt.
§ 9 Abs. 1 KultgSchG:
"Wird ein eingetragenes Kulturgut im Inland an einen anderen Ort gebracht oder gerät es in Verlust oder ist es beschädigt worden, so hat der Besitzer unverzüglich der obersten Landesbehörde Mitteilung zu machen, die dem Beauftragten der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und der Medien davon Kenntnis gibt. Zur Mitteilung sind im Falle des Besitzwechsels der bisherige und der neue Besitzer verpflichtet."
Wenn das Wirtschaftsministerium die Mitteilung nicht weiterleitet, ist das nicht die Schuld der Wolfegger. Eine Ordnungswidrigkeit liegt sicher nicht vor.
Aber das ist nicht der Punkt: Der Verkauf ist rechtlich unwirksam, da die Genehmigung des Regierungspräsidiums aufgrund eines rechtsgültigen gerichtlichen Fideikommissauflösungsbeschlusses nicht eingeholt wurde.
Wieso gilt eigentlich die folgende Bestimmung (§ 14) nur für Archivgut?
"Wer Verhandlungen über die Ausfuhr von geschütztem Archivgut (§ 10) aus dem Geltungsbereich des Gesetzes führt oder vermittelt, hat dies dem Beauftragten der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und der Medien unverzüglich mitzuteilen."
Geldnot war nicht der Grund für den Hausbuch-Verkauf, ist Dittmar überzeugt:
Immerhin gehört zu diesem Familienbesitz noch ein veritables Schloss samt Golfplatz nebenan. Die Armut schaut also noch nicht um die Ecke wie scheinbar bei Prinz Rüdiger von Sachsen, dem Chef des Hauses Wettin. Er lebe mit seiner Frau ebenso wie seine beiden Schwestern zur Miete, verriet er der "Dresdner Morgenpost": "Die bedrückenden Verhältnisse, in denen unsere Familie leben muss, erzwingen, dass wir Einnahmen haben." Und diese Einnahmen erwachsen aus einem komplizierten Vergleich mit dem Freistaat. 1999 einigte man sich, dass von 18 000 Kunstwerken in sächsischen Museen 6000 an das Haus Wettin zurückgingen - und für die verbleibenden 23,6 Millionen Mark gezahlt würden. Allerdings enthält der Vertrag eine "Öffnungsklausel", die weitere Forderungen möglich macht. 2006 waren das sechs bedeutende Porzellane, von denen die Staatliche Porzellansammlung zwar eins als Geschenk erhielt, die anderen fünf jedoch bei Christie's Siebenstelliges eintrugen. Aber damit noch nicht genug. Weitere 1600 Porzellane sowie 139 Bilder stehen auf einer neuen Liste, obwohl der Prinz doch erklärt hatte: "Wir haben weder Platz noch Mittel für die Unterbringung und Pflege dieser Werke." Der Kunstmarkt wird es ihm danken.
Denn der Kunstmarkt liebt die hochadligen Häuser: die Fürsten zu Waldburg wie das Haus Wettin, die Markgrafen und Großherzöge von Baden wie die Thurn und Taxis, die Fürsten zu Fürstenberg und natürlich das Haus Hannover. Sie alle haben - auf einen Schlag oder sukzessive in mehreren Auktionen - unters Volk gebracht, was sich im Laufe der Jahrhunderte in ihren Schlössern angesammelt hat. Und das war nicht wenig. Denn das raue 20. Jahrhundert hat sie allen Kriegen, Revolutionen, Umbrüchen zum Trotz noch recht gut behandelt. Französische Verhältnisse wie nach 1789, als jeglicher Adelsbesitz von der Republik entschädigungslos kassiert wurde, hat es in deutschen Landen nicht gegeben.
Nach der Novemberrevolution anno 1918 wurde zwar der "Fürstenbesitz" beschlagnahmt, aber enteignet wurde er nicht. Als sich die deutsche Republik stabilisierte, zog der Adel vor die Gerichte. Und die haben generell den Anspruch auf das Privateigentum anerkannt. Probleme machte allerdings die Scheidung, was "privat" sei und was der herrscherlichen Funktion zugerechnet werden müsse, also dem nachfolgenden Staat gehöre. Das Ergebnis waren Kompromisse, mit denen die Fürstenhäuser zufrieden sein konnten.
Der Freistaat Bayern einigte sich 1923 mit den Wittelsbachern, deren Besitztümer in den Wittelsbacher Ausgleichsfonds zu übertragen, eine Stiftung, deren Erträge den Wittelsbachern zustehen, während die immaterielle, oft kostenträchtige Nutzung - z. B. der umfangreiche Kunstbesitz - dem Freistaat zusteht. Der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin hatte bereits Ende 1919 einen Abfindungsvertrag akzeptiert, der ihm Grundbesitz, Schlösser sowie sechs Millionen Mark und dazu eine jährliche Rente von 175 000 Mark und Jahresrenten für einige Familienmitglieder garantierte. Die Abfindung der Wettiner regelte 1924 ein Gesetz. Die Welfen ließen sich ein Jahr später auf den Vergleich ein, den das Oberlandesgericht Braunschweig erarbeitet hatte. Und in Preußen wurde 1926 ein Vertrag über den Vermögensausgleich mit den Hohenzollern geschlossen.
[...] weil es bei dem Adelsbesitz nicht nur um Schlösser, Wald- und Grundbesitz, sondern auch um bedeutende Kunstschätze geht, eröffnet sich damit ein weites Feld nicht nur für Juristen. Der "Fall Hausbuch" macht das ebenso deutlich wie der Streit mit den Wettinern um die Dresdner Kunstschätze und Stuttgarts Probleme mit Schloss Salem und dem Eigentum an Kunstwerken wie Archivbeständen aus badischem Besitz. Eine zentrale, gar eine "französische" Lösung kann es wegen der Kulturhoheit der Länder nicht geben. So herrscht auch hier nur zu oft "die Rücksicht, die elend lässt zu hohen Jahren kommen".
Zum Plan einer Fürstenteignung in der Weimarer Republik siehe
http://archiv.twoday.net/search?q=f%C3%BCrstenent
Dittmars Schlusszitat war mir nicht bekannt, es stammt aus Shakespeares "Hamlet".

http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/laenderreport/735630/
Das Deutschlandradio lässt noch einmal die Karlsruher Kulturgutaffäre Revue passieren.

Das Deutschlandradio lässt noch einmal die Karlsruher Kulturgutaffäre Revue passieren.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Update zu: http://archiv.twoday.net/stories/4552355/
Der jüngst in K & R (Kommunikation und Recht) 1/2008, 7-11 erschienene Aufsatz von Christian Sprang und Astrid Ackermann, Der "Zweite Korb" aus Sicht der (Wissenschafts-)Verlage (von Steinhauer besprochen in Bibliotheksrecht.Blog.de vom 23.01.2008), geht auch auf den Fragenkreis der Übertragung unbekannter Nutzungsrechte in §§ 31a, 32c, 137l UrhG ein.
Sprang und Ackermann beklagen, dass im Zuge einer "Hinterzimmermauschelei" hinsichtlich der "Archivwerke", die Gegenstand von § 137l sind, der Anspruch des Urhebers auf eine angemessene Vergütung verwertungsgesellschaftspflichtig gemacht worden sei (§ 137l Abs. 5). Sie halten den Vergütungsanspruch für ungeeignet für kollektive Verwertung und den Regelungsvorschlag für Werknutzungen durch Dritte für vollkommen verfehlt, was viele Werknutzungen vereiteln werde (weil danach der Dritte letztlich doppelt zahlen müsse: eine Lizenz an den ursprünglichen Vertragspartner und eine Vergütung an die Verwertungsgesellschaft, während der Autor mit einer individuell auszuhandelnden Beteiligung an den Lizenzerlösen seines Vertragspartners besser bedient wäre). Schließlich schneide der Regelungsvorschlag Urhebern auch Sanktionsmöglichkeiten ab, wenn der Anspruch auf angemessene Vergütung nicht vom Autor selbst, sondern von Verwertungsgesellschaften wahrgenommen wird. Hinsichtlich der künftigen Doppelrolle der Verwertungsgesellschaften, die nun auch ihnen von den Autoren übertragenen Rechte gegen die Verleger wahrzunehmen haben, seien Interessenkonflikte vorprogrammiert.
Was Sprang und Ackermann hier ausblenden, ist allerdings die als Alternative ja unberührte Möglichkeit, an die Stelle der Verwertung von Altwerken unter der neuen gesetzlichen Regelung den Abschluss eines Ergänzungsvertrages zwischen Autor und Verlag zu setzen, wie es in der "Handreichung" empfohlen wird. Wie dort erwähnt, hält der Börsenverein für seine Mitgliedsverlage Musterschreiben bereit, mit denen Verlage Ergänzungsvereinbarungen "in schlanker, aber rechtswirksamer Form" abschließen können.
Sprang und Heckmann konzedieren, die hohe Komplexität der Neuregelung sei nur zum Teil dem Gesetzgeber anzulasten, im Übrigen sei es der Schwierigkeit des zu lösenden Problems geschuldet. Um so bedauerlicher sei es, "wenn auch in klar geregelten Bereichen Autoren in die Irre geführt werden, wie das in einigen von Forschungs- und Forschungsförderorganisationen empfohlenen Muster- Widerrufsschreiben zur Neuregelung des Rechts der unbekannten Nutzungsarten geschehen ist". Exemplarisch verweist Sprang hier ausgerechnet auf die differenzierte Stellungnahme von Steinhauer, § 137l und die Rolle der Bibliotheken (bibliotheksrecht.blog.de, 3.09.2007). Worin die Irreführung bestehen soll, darauf bleibt Sprang allerdings die Antwort schuldig.
Das Ziel der Hebung der "Archivschätze" wurde verfehlt, so die Autoren.
Anders als in der o.g. Handreichung (wo nur pauschal auf die Grundvoraussetzung verwiesen wird, dass "alle wesentlichen Nutzungsrechte" vertraglich ausschließlich sowie räumlich und zeitlich unbegrenzt eingeräumt worden seien) stellen Sprang und Ackermann hier explizit klar, dass § 137l hinsichtlich der großen Zahl zusammengesetzter Werke, an deren Bestandteilen die Verlage nur einfache Nutzungsrechte erworben haben, nicht greift.
Vgl. hierzu auch die "Stellungnahme zu dem Entwurf einer Formulierungshilfe zur Neuregelung des Rechts der Unbekannten Nutzungsarten (§§ 31a, 32c, 88, 89, 137l UrhG-E) des Börsenvereins vom 27. Mai 2007 (geringfügig überarbeitete Fassung Juni 2007). Dort heißt es:
Nicht erwähnt wird hier, dass die geschilderte Problematik auch und gerade das DFG-geförderte Projekt DigiZeitschriften betrifft, in dem ja bereits seit Jahren ohne eigentliche rechtliche Grundlage (lediglich mit Zustimmung der Verlage und einer zugesicherten Freistellung der Verlage gegenüber den Autoren durch die VG Wort) deutschsprachige wissenschaftliche Zeitschriften digitalisiert und im Rahmen eines überwiegend kostenpflichtigen Angebots online bereitgestellt werden. Weil das so ist, geht auch der jüngst in der FAZ vom 7.2.2007 erhobene Vorwurf von Verleger Vittorio Klostermann ins Leere, der den schwarzen Peter jetzt den Wissenschaftsorganisationen und Universitätsverwaltungen zuschieben möchte, die ihre Wissenschaftler auf Chancen und Risiken im Zusammenhang mit der Neuregelung der unbekannten Nutzungsarten hingewiesen haben. Die von diesen ausgesprochenen Empfehlungen waren aber nicht so einseitig, wie es Klostermann suggeriert; ihr Ziel war lediglich, eine Monopolisierung der zu hebenden "Archivschätze" durch die Verwerter zu verhindern.
Gegenseitige Schuldzuweisungen bringen uns nicht weiter. Börsenverein und Urheberrechtsbündnis, Bibliotheksverband und Wissenschaftsorganisationen sollten eine Verständigung über § 137l suchen ( vgl. auch die Vorschläge unter http://archiv.twoday.net/stories/4637947/ ) und den Gesetzgeber im Zusammenhang mit dem 3. Korb bitten, entsprechende Änderungen bzw. Klarstellungen vorzunehmen.
Wenn DigiZeitschriften, wie Klostermann behauptet, keine Lizenzgebühren an die Verleger zahlen muß, dann ist es überfällig, dass das Angebot in das Nationallizenzenprogramm einbezogen und dass bereits Gemeinfreies in jedem Fall open access zugänglich gemacht wird und dass auf Antrag auch jeder Autor seine eigenen Beiträge in DigiZeitschriften mit einem "open access"-Flag versehen lassen kann. Das würde auch den berechtigten Wünschen vieler Urheber nach einer breiten Verfügbarkeit ihrer Arbeiten entgegenkommen.
Der jüngst in K & R (Kommunikation und Recht) 1/2008, 7-11 erschienene Aufsatz von Christian Sprang und Astrid Ackermann, Der "Zweite Korb" aus Sicht der (Wissenschafts-)Verlage (von Steinhauer besprochen in Bibliotheksrecht.Blog.de vom 23.01.2008), geht auch auf den Fragenkreis der Übertragung unbekannter Nutzungsrechte in §§ 31a, 32c, 137l UrhG ein.
Sprang und Ackermann beklagen, dass im Zuge einer "Hinterzimmermauschelei" hinsichtlich der "Archivwerke", die Gegenstand von § 137l sind, der Anspruch des Urhebers auf eine angemessene Vergütung verwertungsgesellschaftspflichtig gemacht worden sei (§ 137l Abs. 5). Sie halten den Vergütungsanspruch für ungeeignet für kollektive Verwertung und den Regelungsvorschlag für Werknutzungen durch Dritte für vollkommen verfehlt, was viele Werknutzungen vereiteln werde (weil danach der Dritte letztlich doppelt zahlen müsse: eine Lizenz an den ursprünglichen Vertragspartner und eine Vergütung an die Verwertungsgesellschaft, während der Autor mit einer individuell auszuhandelnden Beteiligung an den Lizenzerlösen seines Vertragspartners besser bedient wäre). Schließlich schneide der Regelungsvorschlag Urhebern auch Sanktionsmöglichkeiten ab, wenn der Anspruch auf angemessene Vergütung nicht vom Autor selbst, sondern von Verwertungsgesellschaften wahrgenommen wird. Hinsichtlich der künftigen Doppelrolle der Verwertungsgesellschaften, die nun auch ihnen von den Autoren übertragenen Rechte gegen die Verleger wahrzunehmen haben, seien Interessenkonflikte vorprogrammiert.
Was Sprang und Ackermann hier ausblenden, ist allerdings die als Alternative ja unberührte Möglichkeit, an die Stelle der Verwertung von Altwerken unter der neuen gesetzlichen Regelung den Abschluss eines Ergänzungsvertrages zwischen Autor und Verlag zu setzen, wie es in der "Handreichung" empfohlen wird. Wie dort erwähnt, hält der Börsenverein für seine Mitgliedsverlage Musterschreiben bereit, mit denen Verlage Ergänzungsvereinbarungen "in schlanker, aber rechtswirksamer Form" abschließen können.
Sprang und Heckmann konzedieren, die hohe Komplexität der Neuregelung sei nur zum Teil dem Gesetzgeber anzulasten, im Übrigen sei es der Schwierigkeit des zu lösenden Problems geschuldet. Um so bedauerlicher sei es, "wenn auch in klar geregelten Bereichen Autoren in die Irre geführt werden, wie das in einigen von Forschungs- und Forschungsförderorganisationen empfohlenen Muster- Widerrufsschreiben zur Neuregelung des Rechts der unbekannten Nutzungsarten geschehen ist". Exemplarisch verweist Sprang hier ausgerechnet auf die differenzierte Stellungnahme von Steinhauer, § 137l und die Rolle der Bibliotheken (bibliotheksrecht.blog.de, 3.09.2007). Worin die Irreführung bestehen soll, darauf bleibt Sprang allerdings die Antwort schuldig.
Das Ziel der Hebung der "Archivschätze" wurde verfehlt, so die Autoren.
Anders als in der o.g. Handreichung (wo nur pauschal auf die Grundvoraussetzung verwiesen wird, dass "alle wesentlichen Nutzungsrechte" vertraglich ausschließlich sowie räumlich und zeitlich unbegrenzt eingeräumt worden seien) stellen Sprang und Ackermann hier explizit klar, dass § 137l hinsichtlich der großen Zahl zusammengesetzter Werke, an deren Bestandteilen die Verlage nur einfache Nutzungsrechte erworben haben, nicht greift.
Vgl. hierzu auch die "Stellungnahme zu dem Entwurf einer Formulierungshilfe zur Neuregelung des Rechts der Unbekannten Nutzungsarten (§§ 31a, 32c, 88, 89, 137l UrhG-E) des Börsenvereins vom 27. Mai 2007 (geringfügig überarbeitete Fassung Juni 2007). Dort heißt es:
(...) Dies gilt z.B. für (Sach-)Bücher, die mit Material von Fotoagenturen bebildert wurden, oder für wissenschaftliche Zeitschriften oder Festschriften, an deren Werkbeiträgen die Verlage aufgrund von § 38 UrhG nach zwölf Monaten nur noch einfache Nutzungsrechte innehaben und die deshalb von § 137l Abs. 1 UrhG-E nicht umfasst sind.Der Börsenverein schlug daher schon damals vor (und regt jetzt wieder an), § 137l Abs. 4 wie folgt zu fassen (Hinzufügung fett gedruckt):
Dieser Zustand erscheint unbefriedigend. Es kann nicht richtig sein, dass die DFG für ihr Projekt www.nationallizenzen.de online-Rechte nur für altere Jahrgänge von Zeitschriften erwerben kann, die im anglo-amerikanischen Rechtskreis verlegt wurden. Vielmehr besteht ein dringendes Bedürfnis, auch deutschsprachige Wissenschaftsliteratur nachträglich zu digitalisieren und online zu erschließen. (...)
"Sind mehrere Werke oder Werkbeiträge zu einer Gesamtheit zusammengefasst, die sich in der neuen Nutzungsart in angemessener Weise nur unter Verwendung sämtlicher Werke oder Werkbeiträge verwenden lässt, gilt Absatz 1 entsprechend. In diesem Fall kann der Urheber das Widerrufsrecht nicht wider Treu und Glauben ausüben.Die Anregung des Börsenvereins wurde im Gesetzgebungsverfahren nicht mehr aufgegriffen, der Vorschlag ist aber nicht abwegig. Für den Fall, dass eine solche Ergänzung gemacht wird, sollte aber klargestellt werden, dass in diesem Fall auch nur einfache, nicht ausschließliche Nutzungsrechte eingeräumt werden.
Nicht erwähnt wird hier, dass die geschilderte Problematik auch und gerade das DFG-geförderte Projekt DigiZeitschriften betrifft, in dem ja bereits seit Jahren ohne eigentliche rechtliche Grundlage (lediglich mit Zustimmung der Verlage und einer zugesicherten Freistellung der Verlage gegenüber den Autoren durch die VG Wort) deutschsprachige wissenschaftliche Zeitschriften digitalisiert und im Rahmen eines überwiegend kostenpflichtigen Angebots online bereitgestellt werden. Weil das so ist, geht auch der jüngst in der FAZ vom 7.2.2007 erhobene Vorwurf von Verleger Vittorio Klostermann ins Leere, der den schwarzen Peter jetzt den Wissenschaftsorganisationen und Universitätsverwaltungen zuschieben möchte, die ihre Wissenschaftler auf Chancen und Risiken im Zusammenhang mit der Neuregelung der unbekannten Nutzungsarten hingewiesen haben. Die von diesen ausgesprochenen Empfehlungen waren aber nicht so einseitig, wie es Klostermann suggeriert; ihr Ziel war lediglich, eine Monopolisierung der zu hebenden "Archivschätze" durch die Verwerter zu verhindern.
Gegenseitige Schuldzuweisungen bringen uns nicht weiter. Börsenverein und Urheberrechtsbündnis, Bibliotheksverband und Wissenschaftsorganisationen sollten eine Verständigung über § 137l suchen ( vgl. auch die Vorschläge unter http://archiv.twoday.net/stories/4637947/ ) und den Gesetzgeber im Zusammenhang mit dem 3. Korb bitten, entsprechende Änderungen bzw. Klarstellungen vorzunehmen.
Wenn DigiZeitschriften, wie Klostermann behauptet, keine Lizenzgebühren an die Verleger zahlen muß, dann ist es überfällig, dass das Angebot in das Nationallizenzenprogramm einbezogen und dass bereits Gemeinfreies in jedem Fall open access zugänglich gemacht wird und dass auf Antrag auch jeder Autor seine eigenen Beiträge in DigiZeitschriften mit einem "open access"-Flag versehen lassen kann. Das würde auch den berechtigten Wünschen vieler Urheber nach einer breiten Verfügbarkeit ihrer Arbeiten entgegenkommen.
BCK - am Freitag, 15. Februar 2008, 14:35 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Okwui Enwezor, Leiter der Documenta 11 spürt er in «Archive Fever. Uses of the Document in Contemporary Art»im International Center of Photography in New York der Idee des fotografischen Archivs nach.
Quelle:
http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/kunst/841881.html
Quelle:
http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/kunst/841881.html
Wolf Thomas - am Donnerstag, 14. Februar 2008, 20:43 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Brenn selber sieht darin nichts Besonderes. Das liebevolle Abzeichnen der hundertfachen Variationen drahtiger Formen gehört bei ihm zur alltäglichen Arbeit dazu. Und damit wird er für die Welt zu einem wichtigen Archivar: Nämlich in der Umsetzung seiner ganz eigenen Archäologie des Wissens im Umgang mit Kunst des Alltäglichen. ..."
Quelle
http://www.einseitig.info/html/content.php?txtid=644
s.a.
http://www.stephan-brenn.de
Quelle
http://www.einseitig.info/html/content.php?txtid=644
s.a.
http://www.stephan-brenn.de
Wolf Thomas - am Donnerstag, 14. Februar 2008, 20:41 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
".... Der Film .... zeigt dies am Beispiel der Produktionsfirma Afghan Film, deren Archiv von mutigen Filmemachern unter Einsatz ihres Lebens vor der Zerstörung durch die Taliban gerettet wird. ...."
Quelle:
Link
Quelle:
Link
Wolf Thomas - am Donnerstag, 14. Februar 2008, 20:38 - Rubrik: Kulturgut
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Aber als er eine mysteriöse Notiz aus dem Archiv bekommt, die eine Verbindung zur Vergangenheit offenlegt, schockiert ihn das. Es öffnet etwas in ihm, er entdeckt den Schmerz – und was es bedeutet, ein Mensch zu sein. ....." Ein Film über eine Firmenintrige, die in zeithistorische Abgründe führt.
Quelle: http://derstandard.at/?url=/?id=3225563
Quelle: http://derstandard.at/?url=/?id=3225563
Wolf Thomas - am Donnerstag, 14. Februar 2008, 20:37 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
s. http://wien.orf.at/stories/256839/
s. a.
http://archiv.twoday.net/stories/29348/
http://archiv.twoday.net/stories/667797/
s. a.
http://archiv.twoday.net/stories/29348/
http://archiv.twoday.net/stories/667797/
Wolf Thomas - am Donnerstag, 14. Februar 2008, 20:35 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

S.D. Johannes Fürst zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee: "Und dann hab ich soo einen großen Reibach beim Hausbuch-Verkauf gemacht!"
Quelle: http://www.hdgbw.de/hdg/besucher_galerie.shtml
Die bedeutende Harvard-Fakultät für Arts and Sciences hat einen Entschluss für ein Opt-out-Modell eines institutionellen mandats angenommen:
The Faculty of Arts and Sciences of Harvard University is committed to disseminating the fruits of its research and scholarship as widely as possible. In keeping with that commitment, the Faculty adopts the following policy: Each Faculty member grants to the President and Fellows of Harvard College permission to make available his or her scholarly articles and to exercise the copyright in those articles. In legal terms, the permission granted by each Faculty member is a nonexclusive, irrevocable, paid-up, worldwide license to exercise any and all rights under copyright relating to each of his or her scholarly articles, in any medium, and to authorize others to do the same, provided that the articles are not sold for a profit. The policy will apply to all scholarly articles written while the person is a member of the Faculty except for any articles completed before the adoption of this policy and any articles for which the Faculty member entered into an incompatible licensing or assignment agreement before the adoption of this policy. The Dean or the Dean’s designate will waive application of the policy for a particular article upon written request by a Faculty member explaining the need.
To assist the University in distributing the articles, each Faculty member will provide an electronic copy of the final version of the article at no charge to the appropriate representative of the Provost’s Office in an appropriate format (such as PDF) specified by the Provost’s Office. The Provost’s Office may make the article available to the public in an open-access repository.
The Office of the Dean will be responsible for interpreting this policy, resolving disputes concerning its interpretation and application, and recommending changes to the Faculty from time to time. The policy will be reviewed after three years and a report presented to the Faculty.
Nach:
http://www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html
Siehe auch
http://insidehighered.com/news/2008/02/13/openaccess
Das ist eine außerordentlich wichtige Entwicklung für Open Access.
Die Privatuni Harvard gilt als bedeutendste US-Universität, sie unterhält die größte Universitätsbibliothek der Welt.
Harvard erhält ein unwiderrufliches nicht-ausschließliches Nutzungsrecht mit dem Recht der Unterlizensierung für nicht-kommerzielle Zwecke an allen Publikationen von jetzt an bis zum jeweiligen Ausscheiden. Will ein Fakultätsmitglied einen der üblichen Exklusivverträge mit einem Verlag abschließen, muss er im Einzelfall begründet widersprechen oder auf die Publikation verzichten.
Dieses Modell soll das Repositorium besser füllen als bisherige Mandate bzw. Absichtserklärungen. Allerdings stellt sich die Frage, ob die Fakultätsmitglieder der Pflichtablieferung ihrer Aufsatzversion eifriger nachkommen als der Aufforderung, das Repositorium zu nutzen. Falls der Verleger die Nutzung des Verlags-PDFs erlaubt, hätte Harvard wohl auch die Möglichkeit, dieses von sich aus in den Schriftenserver einzubringen.
Siehe dazu auch meinen Vorschlag einer Hochschulsatzung unter
http://archiv.twoday.net/stories/4369539/
"(1) Hochschullehrer und Beschäftigte der Universität sind verpflichtet, alle Veröffentlichungen in Zeitschriften und Sammelbänden sowie Buchveröffentlichungen an den Hochschulschriftenserver in elektronischer Form abzuliefern.
(2) Abzuliefern ist die für den Druck akzeptierte Fassung oder die gedruckte Fassung.
(3) Solange den Hochschulschriftenserver keine Freigabe des Rechteinhabers bzw. Verlags erreicht hat, sind nur die Metadaten der jeweiligen Veröffentlichung für die Allgemeinheit zugänglich.
(4) Gibt der Rechteinhaber die für den Druck akzeptierte Fassung oder die gedruckte Fassung frei, wird der Zugriff durch die Allgemeinheit freigegeben.
(5) Auf Antrag des Hochschullehrers oder Beschäftigten kann der Zugriff für die Allgemeinheit auch bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 4 gesperrt bleiben oder werden, wenn die berechtigten Interessen des Hochschullehrers oder Beschäftigten an der Nicht-Veröffentlichung auf dem Hochschulschriftenserver überwiegen. Ein solcher Antrag ist alle fünf Jahre zu erneuern."

The Faculty of Arts and Sciences of Harvard University is committed to disseminating the fruits of its research and scholarship as widely as possible. In keeping with that commitment, the Faculty adopts the following policy: Each Faculty member grants to the President and Fellows of Harvard College permission to make available his or her scholarly articles and to exercise the copyright in those articles. In legal terms, the permission granted by each Faculty member is a nonexclusive, irrevocable, paid-up, worldwide license to exercise any and all rights under copyright relating to each of his or her scholarly articles, in any medium, and to authorize others to do the same, provided that the articles are not sold for a profit. The policy will apply to all scholarly articles written while the person is a member of the Faculty except for any articles completed before the adoption of this policy and any articles for which the Faculty member entered into an incompatible licensing or assignment agreement before the adoption of this policy. The Dean or the Dean’s designate will waive application of the policy for a particular article upon written request by a Faculty member explaining the need.
To assist the University in distributing the articles, each Faculty member will provide an electronic copy of the final version of the article at no charge to the appropriate representative of the Provost’s Office in an appropriate format (such as PDF) specified by the Provost’s Office. The Provost’s Office may make the article available to the public in an open-access repository.
The Office of the Dean will be responsible for interpreting this policy, resolving disputes concerning its interpretation and application, and recommending changes to the Faculty from time to time. The policy will be reviewed after three years and a report presented to the Faculty.
Nach:
http://www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html
Siehe auch
http://insidehighered.com/news/2008/02/13/openaccess
Das ist eine außerordentlich wichtige Entwicklung für Open Access.
Die Privatuni Harvard gilt als bedeutendste US-Universität, sie unterhält die größte Universitätsbibliothek der Welt.
Harvard erhält ein unwiderrufliches nicht-ausschließliches Nutzungsrecht mit dem Recht der Unterlizensierung für nicht-kommerzielle Zwecke an allen Publikationen von jetzt an bis zum jeweiligen Ausscheiden. Will ein Fakultätsmitglied einen der üblichen Exklusivverträge mit einem Verlag abschließen, muss er im Einzelfall begründet widersprechen oder auf die Publikation verzichten.
Dieses Modell soll das Repositorium besser füllen als bisherige Mandate bzw. Absichtserklärungen. Allerdings stellt sich die Frage, ob die Fakultätsmitglieder der Pflichtablieferung ihrer Aufsatzversion eifriger nachkommen als der Aufforderung, das Repositorium zu nutzen. Falls der Verleger die Nutzung des Verlags-PDFs erlaubt, hätte Harvard wohl auch die Möglichkeit, dieses von sich aus in den Schriftenserver einzubringen.
Siehe dazu auch meinen Vorschlag einer Hochschulsatzung unter
http://archiv.twoday.net/stories/4369539/
"(1) Hochschullehrer und Beschäftigte der Universität sind verpflichtet, alle Veröffentlichungen in Zeitschriften und Sammelbänden sowie Buchveröffentlichungen an den Hochschulschriftenserver in elektronischer Form abzuliefern.
(2) Abzuliefern ist die für den Druck akzeptierte Fassung oder die gedruckte Fassung.
(3) Solange den Hochschulschriftenserver keine Freigabe des Rechteinhabers bzw. Verlags erreicht hat, sind nur die Metadaten der jeweiligen Veröffentlichung für die Allgemeinheit zugänglich.
(4) Gibt der Rechteinhaber die für den Druck akzeptierte Fassung oder die gedruckte Fassung frei, wird der Zugriff durch die Allgemeinheit freigegeben.
(5) Auf Antrag des Hochschullehrers oder Beschäftigten kann der Zugriff für die Allgemeinheit auch bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 4 gesperrt bleiben oder werden, wenn die berechtigten Interessen des Hochschullehrers oder Beschäftigten an der Nicht-Veröffentlichung auf dem Hochschulschriftenserver überwiegen. Ein solcher Antrag ist alle fünf Jahre zu erneuern."

KlausGraf - am Donnerstag, 14. Februar 2008, 01:23 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der umstrittene Verkauf einer kostbaren mittelalterlichen Handschrift durch das Adelshaus Waldburg-Wolfegg erhitzt auch bundesweit die Gemüter. Der Deutsche Kulturrat in Berlin forderte Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) am Mittwoch auf, in dem Fall schnell für Klarheit zu sorgen. "Es ist sehr zu hoffen, dass nach der unglückseligen Handschriftenaffäre 2006 nun der Schutz von national bedeutsamem Kulturgut in Baden-Württemberg endlich ernster genommen wird", sagte Kulturrats- Geschäftsführer Olaf Zimmermann am Mittwoch in Berlin. Er hoffe, dass das Krisenmanagement in Stuttgart diesmal besser funktioniere.
Oettinger hatte am Dienstag betont, alle rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, um gegen den Verkauf vorzugehen. Das Adelshaus behauptet, alle notwendigen Schritte für den Verkauf eingehalten zu haben. Dagegen erklärte Oettinger, eine Genehmigung sei nie erteilt worden. Der Wert des sogenannten Hausbuchs aus dem 15. Jahrhundert wird auf 20 Millionen Euro geschätzt. In Fachkreisen gilt das Werk als einzigartig. Die Zeichnungen auf Pergament geben Einblicke in den Alltag der Menschen des Spätmittelalters.
Unteressen haben die Stuttgarter Ministerien für Wissenschaft und Wirtschaft dem Adelshaus eine Frist gesetzt: Bis zum 22. Februar müssten die bislang fehlenden Angaben zum Verkauf vorliegen, teilte ein Sprecher des Wissenschaftsministeriums mit. Dies sei mit dem Haus Waldburg-Wolfegg telefonisch vereinbart worden. Welche Konsequenzen angedroht wurden, ließ er offen.
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1635094
PM Deutscher Kulturrat
http://www.kulturrat.de/detail.php?detail=1253&rubrik=2

Oettinger hatte am Dienstag betont, alle rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, um gegen den Verkauf vorzugehen. Das Adelshaus behauptet, alle notwendigen Schritte für den Verkauf eingehalten zu haben. Dagegen erklärte Oettinger, eine Genehmigung sei nie erteilt worden. Der Wert des sogenannten Hausbuchs aus dem 15. Jahrhundert wird auf 20 Millionen Euro geschätzt. In Fachkreisen gilt das Werk als einzigartig. Die Zeichnungen auf Pergament geben Einblicke in den Alltag der Menschen des Spätmittelalters.
Unteressen haben die Stuttgarter Ministerien für Wissenschaft und Wirtschaft dem Adelshaus eine Frist gesetzt: Bis zum 22. Februar müssten die bislang fehlenden Angaben zum Verkauf vorliegen, teilte ein Sprecher des Wissenschaftsministeriums mit. Dies sei mit dem Haus Waldburg-Wolfegg telefonisch vereinbart worden. Welche Konsequenzen angedroht wurden, ließ er offen.
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1635094
PM Deutscher Kulturrat
http://www.kulturrat.de/detail.php?detail=1253&rubrik=2

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Straßenleben mittels Video einzufangen wird im allgemeinen nicht als Aufgabe eines öffentlichen Archivs gesehen (Antwort auf http://archiv.twoday.net/stories/4703758/ ). Angesprochen wurden aber auch "Musikdarbietungen in den städtischen Parks im Kultursommer".
Dazu gibt es eine unüberwindliche Huerde: § 53 Abs. 7 UrhG:
"Die Aufnahme öffentlicher Vorträge, Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes auf Bild- oder Tonträger, die Ausführung von Plänen und Entwürfen zu Werken der bildenden Künste und der Nachbau eines Werkes der Baukunst sind stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig."
Weder als Privatkopie noch zu wissenschaftlichen Zwecken dürfen öffentliche Vorführungen mitgeschnitten werden (wenn sie nicht per Funk übertragen werden), was das Archiv zwingt, in jedem Fall die Zustimmung des Berechtigten einzuholen, die dieser natürlich nach Belieben erteilen oder verweigern kann. Dies ist an sich unter dem Gesichtspunkt der Wissenschaftsfreiheit, zu der auch die Möglichkeit gehört, öffentliche Vorträge oder Aufführungen für die Forschung späterer Generationen zu sichern, nicht hinzunehmen. Eine entsprechende Schranke für Archive wäre daher de lege ferenda zu fordern.
Dazu gibt es eine unüberwindliche Huerde: § 53 Abs. 7 UrhG:
"Die Aufnahme öffentlicher Vorträge, Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes auf Bild- oder Tonträger, die Ausführung von Plänen und Entwürfen zu Werken der bildenden Künste und der Nachbau eines Werkes der Baukunst sind stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig."
Weder als Privatkopie noch zu wissenschaftlichen Zwecken dürfen öffentliche Vorführungen mitgeschnitten werden (wenn sie nicht per Funk übertragen werden), was das Archiv zwingt, in jedem Fall die Zustimmung des Berechtigten einzuholen, die dieser natürlich nach Belieben erteilen oder verweigern kann. Dies ist an sich unter dem Gesichtspunkt der Wissenschaftsfreiheit, zu der auch die Möglichkeit gehört, öffentliche Vorträge oder Aufführungen für die Forschung späterer Generationen zu sichern, nicht hinzunehmen. Eine entsprechende Schranke für Archive wäre daher de lege ferenda zu fordern.
KlausGraf - am Donnerstag, 14. Februar 2008, 00:24 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

