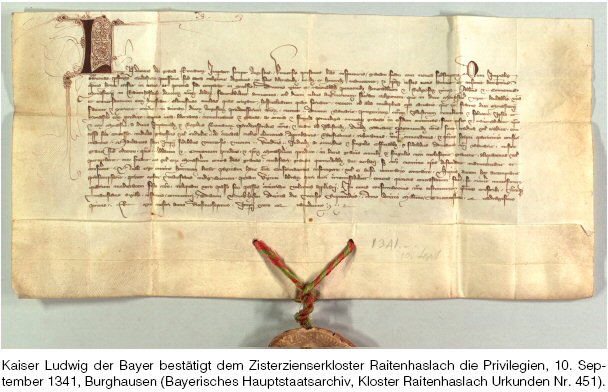"Geschichte einmal anders ist das Ziel des Digitalen Stadtgedächtnisses. In einer multimedialen Zeitreise wird die Coburger Geschichte greifbar. Ob berühmte Coburger Persönlichkeiten, bedeutende Epochen oder einfach nur Orte wie Gebäude, Brunnen oder Plätze - das Digitale Stadtgedächtnis liefert multimediale Inhalte.
Stellen Sie sich vor, Sie können Geschichte mitschreiben.
Geschichte umfasst mehr als nur Gebäude, Jahreszahlen oder Exponate. Sie entsteht auch durch Erinnerungen - die Erinnerungen der Coburger Bürger. Jeder Coburger Bürger kann über eine Eingabemaske Bildmaterial oder Briefe und Geschichten in die Plattform einpflegen oder seine eigenen Erlebnisse schildern. So entsteht ein lebendiges Bild des historischen und des gegenwärtigen Coburg.
Partner dieses Projekts sind aktuell die Stadtverwaltung, das Stadtarchiv, das Staatsarchiv Coburg, die Landesbibiliothek Coburg, die Kunstsammlungen der Veste Coburg, die Historische Gesellschaft Coburg e. V., das AWO-Mehrgenerationenhaus, die Initiative Stadtmuseum, der Tourismus Coburg, die Hochschule Coburg, Gymnasien, der Kultur- und Schulservice und die herzogliche Hauptverwaltung.
Prinz Andreas von Sachsen-Coburg und Gotha hat die Schirmherrschaft über das Projekt übernommen." (1)
Die Inhalte des örtlichen Stadtarchivs mitgestalten und die Geschichte der Stadt individuell vervollständigen und mit persönlichen Erinnerungen versehen? Für die Bürger der Stadt Coburg seit Kurzem kein Problem mehr. Mittels Web 2.0 -Technologien wird den Coburgern die direkte Mitgestaltung ihres neuen Stadtarchivs eröffnet.
Auf der eigens dafür vorgesehenen Internetplattform ist es möglich, die Inhalte des Stadtgedächtnisses aktiv mitzubestimmen sowie eigene kleine Bildarchive und individuelle Geschichten mit einzubringen.
Dieses deutschlandweit einmalige Projekt eines "Digitalen Stadtgedächtnisses" wurde in Berlin Anfang September 2009 als diesjähriger Sieger beim E-Government-Wettbewerb von BearingPoint und Cisco ausgezeichnet. In der Kategorie „Next Generation Service“ erreichten die Coburger mit ihrem innovativen Projekt den ersten Platz.
Mit dem Coburger Ansatz werde dank zeitgemäßer IuK-Technologien der generationsübergreifende Zusammenhalt der Coburger gestärkt, heißt es in der Würdigung des Preisgerichtes. Die Erinnerungen und Geschichten der Bürger gehen durch die Plattform nicht verloren. Im Gegenteil. Sie leben im digitalen Gedächtnis weiter und sind auch den nächsten Generationen zugänglich." (2)
Quellen:
(1) http://www.stadtgeschichte-coburg.de/
(2) http://maerkzettel.blogspot.com/2009/09/digitales-stadtgedachtnis-burger.html
Stellen Sie sich vor, Sie können Geschichte mitschreiben.
Geschichte umfasst mehr als nur Gebäude, Jahreszahlen oder Exponate. Sie entsteht auch durch Erinnerungen - die Erinnerungen der Coburger Bürger. Jeder Coburger Bürger kann über eine Eingabemaske Bildmaterial oder Briefe und Geschichten in die Plattform einpflegen oder seine eigenen Erlebnisse schildern. So entsteht ein lebendiges Bild des historischen und des gegenwärtigen Coburg.
Partner dieses Projekts sind aktuell die Stadtverwaltung, das Stadtarchiv, das Staatsarchiv Coburg, die Landesbibiliothek Coburg, die Kunstsammlungen der Veste Coburg, die Historische Gesellschaft Coburg e. V., das AWO-Mehrgenerationenhaus, die Initiative Stadtmuseum, der Tourismus Coburg, die Hochschule Coburg, Gymnasien, der Kultur- und Schulservice und die herzogliche Hauptverwaltung.
Prinz Andreas von Sachsen-Coburg und Gotha hat die Schirmherrschaft über das Projekt übernommen." (1)
Die Inhalte des örtlichen Stadtarchivs mitgestalten und die Geschichte der Stadt individuell vervollständigen und mit persönlichen Erinnerungen versehen? Für die Bürger der Stadt Coburg seit Kurzem kein Problem mehr. Mittels Web 2.0 -Technologien wird den Coburgern die direkte Mitgestaltung ihres neuen Stadtarchivs eröffnet.
Auf der eigens dafür vorgesehenen Internetplattform ist es möglich, die Inhalte des Stadtgedächtnisses aktiv mitzubestimmen sowie eigene kleine Bildarchive und individuelle Geschichten mit einzubringen.
Dieses deutschlandweit einmalige Projekt eines "Digitalen Stadtgedächtnisses" wurde in Berlin Anfang September 2009 als diesjähriger Sieger beim E-Government-Wettbewerb von BearingPoint und Cisco ausgezeichnet. In der Kategorie „Next Generation Service“ erreichten die Coburger mit ihrem innovativen Projekt den ersten Platz.
Mit dem Coburger Ansatz werde dank zeitgemäßer IuK-Technologien der generationsübergreifende Zusammenhalt der Coburger gestärkt, heißt es in der Würdigung des Preisgerichtes. Die Erinnerungen und Geschichten der Bürger gehen durch die Plattform nicht verloren. Im Gegenteil. Sie leben im digitalen Gedächtnis weiter und sind auch den nächsten Generationen zugänglich." (2)
Quellen:
(1) http://www.stadtgeschichte-coburg.de/
(2) http://maerkzettel.blogspot.com/2009/09/digitales-stadtgedachtnis-burger.html
Wolf Thomas - am Montag, 21. September 2009, 15:22 - Rubrik: Web 2.0
Eva-Maria Knab in der Augsburger Allgemeinen : "Das Augsburger Stadtarchiv gleicht einem großen Kühlhaus. Bei 17 Grad Celsius will man eine massive Schädlingsplage im Gebäude wenigstens vorübergehend durch Kälte eindämmen. Der Brotkäfer frisst sich durch die wertvollsten Bestände des Hauses. „Bei uns ist es eins nach zwölf“, sagt Archivleiter Michael Cramer-Fürtig. Der geplante Umzug des Archivs im Jahr 2013 dürfe nicht mehr länger aufgeschoben werden. Genau das könnte aber wegen der dramatischen Finanzlage der Stadt in Zeiten der Rezession passieren, befürchten die Grünen.
Bekanntlich kämpfen die Mitarbeiter des Stadtarchivs, unterstützt von Fachleuten, seit einigen Wochen gegen die schlimme Plage - wieder einmal. Denn die Schädlinge fallen regelmäßig vom Stadtmarkt nebenan ein, und vermehren sich etwa alle drei Jahre explosionsartig, so Cramer-Fürtig. „Pergament und Leim wirken regelrecht als Appetitanreger für die Käfer.“
Vor allem die Archivbestände aus den Zeiten der alten Reichsstadt, das wertvollste Gut des Archivs, sind durch die Brotkäfer enorm gefährdet. Die Schäden sind im Laufe der Jahre groß geworden. Manche Bücher sind schon so stark zerfressen, dass man die Schrift nicht mehr lesen kann. Eine Restaurierung des historischen Materials würde laut Cramer-Fürtig einen „hohen siebenstelligen Betrag“ kosten. Wohl ähnlich viel Geld, wie das neue Quartier fürs Stadtarchiv auf dem AKS-Gelände im Textilviertel kosten soll. Die Stadt hat dafür 7,2 Millionen Euro veranschlagt.
Sofortmaßnahmen gegen die Schädlinge sind eingeleitet. Der erste Stock ist hermetisch abgeriegelt. Durch die Kühlung werden die Käferlarven vorübergehend in Schlaf versetzt. Als erstes Archiv in Süddeutschland setzt man diesmal einen tierischen Nützling zur Bekämpfung ein. Rund 600 Lagererzwespen wurden ausgesetzt. Sie bohren die Käfer an, worauf diese absterben. Das Verfahren sei in Kirchen und Museen erprobt und für Dokumente ungefährlich, sagen Experten.
Doch das alles hilft nur vorübergehend. Das befallene Papier muss ausgelagert und speziell behandelt werden, damit die Käferlarven endgültig absterben. Laut Cramer-Fürtig wird unter Zelten Stickstoff zugeführt, um Sauerstoffmangel für die Schädlinge zu erzeugen. Voraussichtlich soll das ab dem kommenden Frühjahr in einer Messehalle als neuem Außenlager geschehen.
Die Mammutaktion ist teuer. Man rechnet mit 250 000 Euro für die Auslagerung. Einen Teil der Kosten muss das Archiv selbst erbringen. Möglicherweise müssen deshalb Planungsmittel für den Umzug des Hauses aufs AKS-Gelände angegriffen werden. Laut Cramer-Fürtig ist auch mit Blick auf die Forschung Eile geboten. Das Material soll aus rechtlichen Gründen möglichst schnell wieder zugänglich sein, weil sonst laufende Doktorarbeiten gefährdet wären.
Die Grünen nahmen die großen Probleme des Stadtarchivs gestern zum Anlass für einen Informationsbesuch. Stadträtin Verena von Mutius sieht mit Sorge den Beratungen des Stadtrats zum Haushalt 2010 im November entgegen. Wegen der desaströsen Finanzlage der Stadt befürchtet sie, dass Gelder für den Umzug gestrichen werden könnten.
„Am Umzug des Stadtarchivs führt kein Weg vorbei“, meint Landtagsabgeordnete Christine Kamm. In dem früheren Wohnhaus an der Fuggerstraße könnten die Bestände nicht sachgemäß gelagert werden. Zumal es dort noch viele weitere Probleme wie Schimmel, Säurebefall von Dokumenten und unzureichenden Brandschutz gibt. ...."
Dank an stilangel via Twitter!
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/5820528/
Bekanntlich kämpfen die Mitarbeiter des Stadtarchivs, unterstützt von Fachleuten, seit einigen Wochen gegen die schlimme Plage - wieder einmal. Denn die Schädlinge fallen regelmäßig vom Stadtmarkt nebenan ein, und vermehren sich etwa alle drei Jahre explosionsartig, so Cramer-Fürtig. „Pergament und Leim wirken regelrecht als Appetitanreger für die Käfer.“
Vor allem die Archivbestände aus den Zeiten der alten Reichsstadt, das wertvollste Gut des Archivs, sind durch die Brotkäfer enorm gefährdet. Die Schäden sind im Laufe der Jahre groß geworden. Manche Bücher sind schon so stark zerfressen, dass man die Schrift nicht mehr lesen kann. Eine Restaurierung des historischen Materials würde laut Cramer-Fürtig einen „hohen siebenstelligen Betrag“ kosten. Wohl ähnlich viel Geld, wie das neue Quartier fürs Stadtarchiv auf dem AKS-Gelände im Textilviertel kosten soll. Die Stadt hat dafür 7,2 Millionen Euro veranschlagt.
Sofortmaßnahmen gegen die Schädlinge sind eingeleitet. Der erste Stock ist hermetisch abgeriegelt. Durch die Kühlung werden die Käferlarven vorübergehend in Schlaf versetzt. Als erstes Archiv in Süddeutschland setzt man diesmal einen tierischen Nützling zur Bekämpfung ein. Rund 600 Lagererzwespen wurden ausgesetzt. Sie bohren die Käfer an, worauf diese absterben. Das Verfahren sei in Kirchen und Museen erprobt und für Dokumente ungefährlich, sagen Experten.
Doch das alles hilft nur vorübergehend. Das befallene Papier muss ausgelagert und speziell behandelt werden, damit die Käferlarven endgültig absterben. Laut Cramer-Fürtig wird unter Zelten Stickstoff zugeführt, um Sauerstoffmangel für die Schädlinge zu erzeugen. Voraussichtlich soll das ab dem kommenden Frühjahr in einer Messehalle als neuem Außenlager geschehen.
Die Mammutaktion ist teuer. Man rechnet mit 250 000 Euro für die Auslagerung. Einen Teil der Kosten muss das Archiv selbst erbringen. Möglicherweise müssen deshalb Planungsmittel für den Umzug des Hauses aufs AKS-Gelände angegriffen werden. Laut Cramer-Fürtig ist auch mit Blick auf die Forschung Eile geboten. Das Material soll aus rechtlichen Gründen möglichst schnell wieder zugänglich sein, weil sonst laufende Doktorarbeiten gefährdet wären.
Die Grünen nahmen die großen Probleme des Stadtarchivs gestern zum Anlass für einen Informationsbesuch. Stadträtin Verena von Mutius sieht mit Sorge den Beratungen des Stadtrats zum Haushalt 2010 im November entgegen. Wegen der desaströsen Finanzlage der Stadt befürchtet sie, dass Gelder für den Umzug gestrichen werden könnten.
„Am Umzug des Stadtarchivs führt kein Weg vorbei“, meint Landtagsabgeordnete Christine Kamm. In dem früheren Wohnhaus an der Fuggerstraße könnten die Bestände nicht sachgemäß gelagert werden. Zumal es dort noch viele weitere Probleme wie Schimmel, Säurebefall von Dokumenten und unzureichenden Brandschutz gibt. ...."
Dank an stilangel via Twitter!
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/5820528/
Wolf Thomas - am Montag, 21. September 2009, 15:02 - Rubrik: Kommunalarchive

(Quelle: Wikimedia Commons)
"Ein Teil des Nachlasses des deutschen Philosophen Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel (1772-1829) ist dem Historischen Archiv des Erzbistums Köln übergeben worden. Den besondern Wert des Teilnachlasses machen Manuskripte, Texte und Entwürfe aus, die mit handschriftlichen ergänzungen versehen sind ..... Darunter findet sich eine kritische Betrachtung Schlegels aus dem Jahr 1823 mit dem Titel "Zusatz vom ganzen Goethe in der jetzigen deutschen Literatur". Der vorliegende Teilnachlass ist Eigentum der 1876 gegründeten "Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft und umfasst 3321 Seiten."
Quelle: Rheinische Post, Print v. 19.09.2009
Wikipedia zu Friedrich Schlegel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schlegel
Wikipedia zur Görres-Gesellschaft:
http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6rres-Gesellschaft
Wolf Thomas - am Montag, 21. September 2009, 12:01 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Exposé
" ....Social Networking“ als Herausforderung und Paradigma
1) Web 2.0 und Geschichtswissenschaft – ein komplexer Zusammenhang
Die historische Fachinformatik hat sich in den letzten Jahren verstärkt mit dem Web 2.0 auseinandergesetzt. Die Sektion über „Kollaboratives Schreiben, Lehren und Lernen“ auf der .hist2006-Tagung in Berlin und das Projekt „Zeitgeschichte online – Docupedia“ belegen nachdrücklich, dass eine theoretische Auseinandersetzung und eine methodisch fundierte Erprobung von „kollaborativen Systemen“ Eingang in die Geschichtswissenschaft gefunden haben.
Die Charakteristika der mit dem Begriff Web 2.0 umrissenen Konzeptionen und Internetapplikationen sind nicht exakt festgelegt , jedoch gibt es eine Reihe an „Schlüsselprinzipien“, welche Web 2.0-Anwendungen und die mit ihnen verbundenen Arbeitsweisen beschreiben.
Das Web 2.0 steht „für eine Reihe interaktiver und kollaborativer Elemente des Internets“. Es bezieht sich weniger auf spezifische Technologien oder Innovationen, sondern primär auf eine veränderte Nutzung und Wahrnehmung des Internets. Ein zentraler Aspekt besteht dabei darin, dass die Benutzer Inhalte in quantitativ und qualitativ entscheidendem Maße selbst erstellen und bearbeiten. Individuen vernetzen sich in einer großen Anzahl mit Hilfe sozialer Software untereinander und kommunizieren und kollaborieren auf diese Weise. Web 2.0 bedeutet also, dass sich Individuen mit Hilfe von „kollaborativer Software“ Plattformen im Internet generieren, mit denen sie Inhalte gestalten und so mit anderen Individuen an „gemeinsamen Projekten“ arbeiten und insbesondere kommunikative Komponenten nutzen. Im Kern ist das Web 2.0 demnach ein „Mitmach-Web“.
Das „Mitmach-Web“ beinhaltet zwei Komponenten, welche die Geschichtswissenschaftlich zentral tangieren. Zum einen verortet sich in ihm die Philosophie des „Sharing knowledge“ , welche fundamental für (geschichts-)wissenschaftliche Diskurse ist. Zum anderen aber löst sich in ihm die vormals eindeutige Beziehung zwischen einem Text und seinem Autor auf, Texte erfahren eine stilistische und inhaltliche Dynamik, deren Substanz durch das Regelwerk bestimmt ist, das dem „social network“ gewissermaßen als dessen Verfassung zu Grunde liegt. Kurzum: Der (geschichts-) wissenschaftliche Autor hat in Web 2.0-Plattformen ein grundlegend neuartiges Verhältnis zu den von ihm verfassten wissenschaftlichen Texten einzunehmen.
Web 2.0:
2) Leitfragen der Tagung
Theoretische und methodologische Probleme von „social networks“ in der Geschichtswissenschaft – Vom Nutzen und Nachteil der „social networks“
Konzeption und Implementierung von „social-Software“ in der Geschichtswissenschaft – Erfahrungen und Beispielprojekte
„Knowledge Sharing Using Social Media” als neues Paradigma geschichtswissenschaftlichen Arbeitens?
„Social networks“ als neue Pfade historischen Lernens?"
Programm und Ablauf der Tagung
9. Oktober 2009
14:00 Uhr
Angela Schwarz:
Begrüßung und Eröffnung
14:15 Uhr
Rüdiger Hohls / Jürgen Danyel:
Docupedia-Zeitgeschichte: Werkstattbericht zu einem Web 2.0 Publikationsmodell
15.15 Uhr
Jürgen Beine:
Wikis als Herausforderung für die Geschichtswissenschaft
16.15 Uhr
Kaffeepause
16.45 Uhr
Patrick Sahle
Das Archiv als virtualisierte Forschungsumgebung?
17.45 Uhr
Gregor Horstkemper
Eine verzopfte Zunft auf dem Weg zur Bibliothek 2.0? Neue Rollenverteilungen zwischen Bibliotheken und "social communities" beim Aufbau geschichtswissenschaftlich relevanter Online-Angebote
19.00 Uhr
Abendessen
10. Oktober 2009
9.30 Uhr
Richard Heigl
Wikis und Blogs als neue wissenschaftliche Arbeitsinstrumente
10:30 Uhr
Peter Haber
Geschichte schreiben in digitalen Zeiten
11.30 Uhr
Kaffeepause
12.00 Uhr
Manfred Thaller
Das Ende des Kanons: Drohungen und Hoffnungen
13:00 Uhr
Abschlussdiskussion
Quelle:
http://www.fb1.uni-siegen.de/geschichte/web2null/index.html?lang=de
Wolf Thomas - am Montag, 21. September 2009, 10:23 - Rubrik: Web 2.0
Diese Tagung wendet sich an Lehrerinnen und Lehrer, Erwachsenenbildner, Archivare und Stadthistoriker, MitarbeiterInnen von Gedenkstätten, Geschichtswerkstätten und
Geschichtsvereinen, aber auch alle anderen historisch interessierten und engagierten Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen neue thematische Anregungen, methodenorientierte Workshops und fachlichen Austausch bieten und Mitarbeiter und
Nutzer aus unterschiedlichen Geschichts- und Bildungsinstitutionen zusammenführen.
In diesem Jahr lautet das Oberthema "Vermittlungsarbeit". In Gedenkstätten und Museen wird nicht nur ausgestellt und geforscht, das wichtigste Anliegen im Alltag stellt vielmehr das Vermitteln von Geschichte und konkreten Geschichten dar. In den Workshops wollen wir unter anderem uns praktisch mit dem Interpretieren von historischen Gegenständen und der Frage "Wie macht man einen gute Führung?" befassen. Wie Besucher eigentlich mit den Erkenntnissen, die sie in Gedenkstätten und
historischen Museen gewinnen, umgehen und wie sie diese weiter verarbeiten, ist ebenso Gegenstand eines Vortrages wie die Frage, welche Qualität die virtuellen Geschichtsangebote im Internet und in den Medien bieten.
Geplantes Programm
Donnerstag, 19. November 2009
Anreise bis ca. 17.00 Uhr: Einchecken im Hotel
18.00 Uhr: Begrüßung und Einführung durch Heide Koehler (Vorsitzende des Fördervereins Konsumgenossenschaftshaus "Vorwärts", Münzstraße e.V.) und N.N.
18.30 Uhr: Abendimbiss
19.30-21.00 Uhr: "Mit eigenen Augen sehen, wozu der Mensch fähig ist". Zur Wirkung von Gedenkstätten auf ihre Besucher/innen. Vortrag von Bert Pampel (Stiftung Sächsische Gedenkstätten) und Diskussion
Freitag, 20. November 2009
9.00-11.00 Uhr: Kurze Einführung in die Geschichte des Gebäudekomplexes Münzstraße (Heide Koehler), anschließend Führung durch die Gebäude (Reiner Rhefus/Förderverein Konsumgenossenschaft "Vorwärts")
11.00-12.30 Uhr: Workshops
>> Gruppen durch Ausstellungen, Museen und Gedenkstätten begleiten - mit Olesja Nein/Osnabrück und Dr. Benigna Schönhagen/Augsburg - Moderation: Dr. Ulrike Schrader
>> Spuren lesen. Zum Umgang und zur Interpretation von baulichen Relikten und Alltagsgegenständen - mit Clemens Heinrichs/Oberhausen - Moderation: Dr. Paul Ciupke
>> Kinder des Widerstands. Ein vergessenes Stück NS-Geschichte, ein Forschungsprojekt und eine Bildungsaufgabe - mit Dr. Dieter Nelles/Wuppertal - Moderation: Dr. Norbert Reichling
12.30 Uhr: Mittagspause und Imbiss
14.30-17.30 Uhr: Fortsetzung der Workshops
18.00 Uhr: Empfang durch Dr. Eberhard Illner, Leiter des Historischen Zentrums in Wuppertal im Museum für Frühindustrialisierung
19.30 Uhr: Abendessen im "Engelskeller"(Engels-Haus)
Samstag, 21. November 2009
9.00-10.30 Uhr:
Projektebörse - Pläne, Kurzberichte und Nachrichten aus Vereinen, Gedenkstätten, Museen, politischer Bildung, Initiativen und Geschichtswerkstätten
11.00-12.30 Uhr:
Visualisierung und Virtualisierung von Erinnerung. Geschichtspolitik in der medialen Erlebnisgesellschaft. Öffentlicher Vortrag von Dr. Erik Meyer/Justus-Liebig-Universität Gießen und Diskussion
Veranstalter:
Bildungswerk der Humanistischen Union
Arbeitskreis NS-Gedenkstätten NRW
Forum Geschichtskultur an Ruhr und Emscher in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Konsumgenossenschaftshaus "Vorwärts", Münzstraße e.V. und
der Begegnungsstätte Alte Synagoge Wuppertal und mit Unterstützung der Landeszentrale für politische Bildung NRW
INFO
Tagungsort:
ehemaliges Konsumgenossenschaftshaus "Vorwärts"
Münzstraße 47
Wuppertal-Barmen
Übernachtungsort:
Art Fabrik&Hotel
Teilnahmebeitrag: (einschließlich Übernachtung und Verpflegung)
Im Einzelzimmer 100 Euro - im Doppelzimmer 80 Euro -
für Arbeitslose und StudentInnen und bei Teilnahme
ohne Übernachtung 45 Euro
Rückfragen und schriftliche Anmeldungen bitte an:
Bildungswerk der Humanistischen Union
Kronprinzenstr.15
45128 Essen
Tel.: 0201 - 22 79 82
Fax 0201 - 23 55 05
E-Mail: buero@hu-bildungswerk.de
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Geschichtsvereinen, aber auch alle anderen historisch interessierten und engagierten Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen neue thematische Anregungen, methodenorientierte Workshops und fachlichen Austausch bieten und Mitarbeiter und
Nutzer aus unterschiedlichen Geschichts- und Bildungsinstitutionen zusammenführen.
In diesem Jahr lautet das Oberthema "Vermittlungsarbeit". In Gedenkstätten und Museen wird nicht nur ausgestellt und geforscht, das wichtigste Anliegen im Alltag stellt vielmehr das Vermitteln von Geschichte und konkreten Geschichten dar. In den Workshops wollen wir unter anderem uns praktisch mit dem Interpretieren von historischen Gegenständen und der Frage "Wie macht man einen gute Führung?" befassen. Wie Besucher eigentlich mit den Erkenntnissen, die sie in Gedenkstätten und
historischen Museen gewinnen, umgehen und wie sie diese weiter verarbeiten, ist ebenso Gegenstand eines Vortrages wie die Frage, welche Qualität die virtuellen Geschichtsangebote im Internet und in den Medien bieten.
Geplantes Programm
Donnerstag, 19. November 2009
Anreise bis ca. 17.00 Uhr: Einchecken im Hotel
18.00 Uhr: Begrüßung und Einführung durch Heide Koehler (Vorsitzende des Fördervereins Konsumgenossenschaftshaus "Vorwärts", Münzstraße e.V.) und N.N.
18.30 Uhr: Abendimbiss
19.30-21.00 Uhr: "Mit eigenen Augen sehen, wozu der Mensch fähig ist". Zur Wirkung von Gedenkstätten auf ihre Besucher/innen. Vortrag von Bert Pampel (Stiftung Sächsische Gedenkstätten) und Diskussion
Freitag, 20. November 2009
9.00-11.00 Uhr: Kurze Einführung in die Geschichte des Gebäudekomplexes Münzstraße (Heide Koehler), anschließend Führung durch die Gebäude (Reiner Rhefus/Förderverein Konsumgenossenschaft "Vorwärts")
11.00-12.30 Uhr: Workshops
>> Gruppen durch Ausstellungen, Museen und Gedenkstätten begleiten - mit Olesja Nein/Osnabrück und Dr. Benigna Schönhagen/Augsburg - Moderation: Dr. Ulrike Schrader
>> Spuren lesen. Zum Umgang und zur Interpretation von baulichen Relikten und Alltagsgegenständen - mit Clemens Heinrichs/Oberhausen - Moderation: Dr. Paul Ciupke
>> Kinder des Widerstands. Ein vergessenes Stück NS-Geschichte, ein Forschungsprojekt und eine Bildungsaufgabe - mit Dr. Dieter Nelles/Wuppertal - Moderation: Dr. Norbert Reichling
12.30 Uhr: Mittagspause und Imbiss
14.30-17.30 Uhr: Fortsetzung der Workshops
18.00 Uhr: Empfang durch Dr. Eberhard Illner, Leiter des Historischen Zentrums in Wuppertal im Museum für Frühindustrialisierung
19.30 Uhr: Abendessen im "Engelskeller"(Engels-Haus)
Samstag, 21. November 2009
9.00-10.30 Uhr:
Projektebörse - Pläne, Kurzberichte und Nachrichten aus Vereinen, Gedenkstätten, Museen, politischer Bildung, Initiativen und Geschichtswerkstätten
11.00-12.30 Uhr:
Visualisierung und Virtualisierung von Erinnerung. Geschichtspolitik in der medialen Erlebnisgesellschaft. Öffentlicher Vortrag von Dr. Erik Meyer/Justus-Liebig-Universität Gießen und Diskussion
Veranstalter:
Bildungswerk der Humanistischen Union
Arbeitskreis NS-Gedenkstätten NRW
Forum Geschichtskultur an Ruhr und Emscher in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Konsumgenossenschaftshaus "Vorwärts", Münzstraße e.V. und
der Begegnungsstätte Alte Synagoge Wuppertal und mit Unterstützung der Landeszentrale für politische Bildung NRW
INFO
Tagungsort:
ehemaliges Konsumgenossenschaftshaus "Vorwärts"
Münzstraße 47
Wuppertal-Barmen
Übernachtungsort:
Art Fabrik&Hotel
Teilnahmebeitrag: (einschließlich Übernachtung und Verpflegung)
Im Einzelzimmer 100 Euro - im Doppelzimmer 80 Euro -
für Arbeitslose und StudentInnen und bei Teilnahme
ohne Übernachtung 45 Euro
Rückfragen und schriftliche Anmeldungen bitte an:
Bildungswerk der Humanistischen Union
Kronprinzenstr.15
45128 Essen
Tel.: 0201 - 22 79 82
Fax 0201 - 23 55 05
E-Mail: buero@hu-bildungswerk.de
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Wolf Thomas - am Sonntag, 20. September 2009, 17:29 - Rubrik: Archivpaedagogik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://listserver.sigmaxi.org/sc/wa.exe?A2=ind09&L=american-scientist-open-access-forum&D=1&O=D&F=l&S=&P=83251
Ab Oktober wird eine kostenfreie separate Suche nach OAIster-Inhalten nach der Übernahme der besten OA-Suchmaschine
http://www.oaister.org
durch OCLC nicht mehr möglich sein. OAIster-Suchergebnisse werden in den oft unbrauchbaren Datenmüll des freien WorldCat reingemischt.
"find the pearls" kann man dann vergessen.
Es entfallen auch die Nachnutzungsmöglichkeiten von OAIster:
http://www.oaister.org/sru.html
Beispielsweise nutzt
http://sbdsproto.nla.gov.au/
die OAIster-Daten, bietet aber komfortablere Filtermöglichkeiten.
Die University of Michigan hat der OA-Community mit der Übergabe von OAIster an OCLC den denkbar schlechtesten Dienst erwiesen.
Der einzige adäquate Ersatz ist Bielefelds BASE:
http://www.base-search.net/
OAIster hätte einer Weiterentwicklung mit einer verfeinerten erweiterten Suche bedurft. Dass eine solche Suche womöglich nur für zahlende Kunden zugänglich sein wird, ist ein Schlag ins Gesicht der OA-Gemeinde. Es müssen dringend kostenfreie Alternativen aufgebaut werden.
Update:
http://infobib.de/blog/2009/09/22/oclc-stampft-oaister-ein-was-tun/
http://infobib.de/blog/2009/09/24/dezentrale-oaister-alternative-mit-yacy/
http://hangingtogether.org/?p=738
http://serials.infomotions.com/ngc4lib/archive/2009/200909/index.html
Ab Oktober wird eine kostenfreie separate Suche nach OAIster-Inhalten nach der Übernahme der besten OA-Suchmaschine
http://www.oaister.org
durch OCLC nicht mehr möglich sein. OAIster-Suchergebnisse werden in den oft unbrauchbaren Datenmüll des freien WorldCat reingemischt.
"find the pearls" kann man dann vergessen.
Es entfallen auch die Nachnutzungsmöglichkeiten von OAIster:
http://www.oaister.org/sru.html
Beispielsweise nutzt
http://sbdsproto.nla.gov.au/
die OAIster-Daten, bietet aber komfortablere Filtermöglichkeiten.
Die University of Michigan hat der OA-Community mit der Übergabe von OAIster an OCLC den denkbar schlechtesten Dienst erwiesen.
Der einzige adäquate Ersatz ist Bielefelds BASE:
http://www.base-search.net/
OAIster hätte einer Weiterentwicklung mit einer verfeinerten erweiterten Suche bedurft. Dass eine solche Suche womöglich nur für zahlende Kunden zugänglich sein wird, ist ein Schlag ins Gesicht der OA-Gemeinde. Es müssen dringend kostenfreie Alternativen aufgebaut werden.
Update:
http://infobib.de/blog/2009/09/22/oclc-stampft-oaister-ein-was-tun/
http://infobib.de/blog/2009/09/24/dezentrale-oaister-alternative-mit-yacy/
http://hangingtogether.org/?p=738
http://serials.infomotions.com/ngc4lib/archive/2009/200909/index.html
KlausGraf - am Samstag, 19. September 2009, 14:22 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Man verzeihe das unflätige Wortspiel für das Holinshed-Projekt, das eine Edition zweier wichtiger englischer Chroniken aus dem 16. Jahrhundert bietet.
http://www.english.ox.ac.uk/holinshed/
Es ist aber Ausdruck der ätzenden Bezahl-Kultur im UK, dass es nicht möglich war, den zwei (in Zahlen: 2) Büchern kostenlose Faksimiles aus EEBO beizugeben. Die entsprechenden Links gehen auf das (hierzulande als Nationallizenz zugängliche) Angebot EEBO.
http://www.english.ox.ac.uk/holinshed/
Es ist aber Ausdruck der ätzenden Bezahl-Kultur im UK, dass es nicht möglich war, den zwei (in Zahlen: 2) Büchern kostenlose Faksimiles aus EEBO beizugeben. Die entsprechenden Links gehen auf das (hierzulande als Nationallizenz zugängliche) Angebot EEBO.
KlausGraf - am Samstag, 19. September 2009, 13:11 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
„Archive im Digitalen Zeitalter“ lautet das Rahmenthema des 79. Deutschen Archivtags, der vom 22. bis 25. September 2009
in Regensburg stattfindet. Erwartet werden rund 850 Teilnehmer aus 14 Ländern.
„Wir richten einen umfassenden Blick auf die epochalen Veränderungen, die sich für die Archivarbeit in der digitalen Welt
ergeben“, sagte Robert Kretzschmar, der Vorsitzende des VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. „Alle
Arbeitsfelder in den Archiven – von der Sicherung der Überlieferung und Bereitstellung für die Nutzung bis zur politischhistorischen
Bildungsarbeit – sind heute unmittelbar von der Entwicklung betroffen.“ Ziel des Archivtags sei, die Rolle der
Archive im digitalen Zeitalter zu analysieren: Vollzieht sich derzeit geradezu ein Funktionswandel? Welche Strategien sind für
die Zukunft zu verfolgen? Diese Fragen stellen sich auch beim Wiederaufbau des Historischen Archivs der Stadt Köln.
Vieles, was für die Zukunft aufbewahrt werden soll, entsteht heute nur noch digital und ist damit flüchtig. Der dauerhafte
Erhalt digitaler Texte, Datensammlungen, aber auch audiovisueller Unterlagen für die Nachwelt wird auf dem Archivtag
diskutiert. Thematisiert werden auch neue Möglichkeiten der digitalen Präsentation von Archivgut im Netz und Perspektiven
für eine interaktive Kommunikation zwischen den Archiven und ihren Nutzern.
Von den Arbeitssitzungen und Diskussionsrunden verspricht sich der VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare
e.V. wichtige Impulse und Weichenstellungen für die Arbeit der nächsten Jahre.
Fachmesse ARCHIVISTICA
Über neueste Produkte und Dienstleistungen zum Archivwesen informieren die Aussteller auf der Fachmesse
ARCHIVISTICA und in speziellen „Ausstellerforen“. Mit 49 Anbietern ist die Messe wieder die größte ihrer Art in Europa
(www.archivistica.de).
Mitgliederversammlung des VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare
In der nicht-öffentlichen Mitgliederversammlung des VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. am 24.
September 2009 steht auch der Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln auf der Tagesordnung. Der Verband
bereitet vor diesem Hintergrund einen Appell an die Träger von Archiven vor, der nach dem Kongress unter
www.vda.archiv.net veröffentlicht wird."
Quelle (PDF):
http://www.vda.archiv.net/pdf/PM20090917.pdf
in Regensburg stattfindet. Erwartet werden rund 850 Teilnehmer aus 14 Ländern.
„Wir richten einen umfassenden Blick auf die epochalen Veränderungen, die sich für die Archivarbeit in der digitalen Welt
ergeben“, sagte Robert Kretzschmar, der Vorsitzende des VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. „Alle
Arbeitsfelder in den Archiven – von der Sicherung der Überlieferung und Bereitstellung für die Nutzung bis zur politischhistorischen
Bildungsarbeit – sind heute unmittelbar von der Entwicklung betroffen.“ Ziel des Archivtags sei, die Rolle der
Archive im digitalen Zeitalter zu analysieren: Vollzieht sich derzeit geradezu ein Funktionswandel? Welche Strategien sind für
die Zukunft zu verfolgen? Diese Fragen stellen sich auch beim Wiederaufbau des Historischen Archivs der Stadt Köln.
Vieles, was für die Zukunft aufbewahrt werden soll, entsteht heute nur noch digital und ist damit flüchtig. Der dauerhafte
Erhalt digitaler Texte, Datensammlungen, aber auch audiovisueller Unterlagen für die Nachwelt wird auf dem Archivtag
diskutiert. Thematisiert werden auch neue Möglichkeiten der digitalen Präsentation von Archivgut im Netz und Perspektiven
für eine interaktive Kommunikation zwischen den Archiven und ihren Nutzern.
Von den Arbeitssitzungen und Diskussionsrunden verspricht sich der VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare
e.V. wichtige Impulse und Weichenstellungen für die Arbeit der nächsten Jahre.
Fachmesse ARCHIVISTICA
Über neueste Produkte und Dienstleistungen zum Archivwesen informieren die Aussteller auf der Fachmesse
ARCHIVISTICA und in speziellen „Ausstellerforen“. Mit 49 Anbietern ist die Messe wieder die größte ihrer Art in Europa
(www.archivistica.de).
Mitgliederversammlung des VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare
In der nicht-öffentlichen Mitgliederversammlung des VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. am 24.
September 2009 steht auch der Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln auf der Tagesordnung. Der Verband
bereitet vor diesem Hintergrund einen Appell an die Träger von Archiven vor, der nach dem Kongress unter
www.vda.archiv.net veröffentlicht wird."
Quelle (PDF):
http://www.vda.archiv.net/pdf/PM20090917.pdf
Wolf Thomas - am Freitag, 18. September 2009, 09:21 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.wien.gv.at/kultur/archiv/geschichte/vermeer.html
Digitalisierte Akten im Wiener Stadt- und Landesarchiv.
Digitalisierte Akten im Wiener Stadt- und Landesarchiv.
KlausGraf - am Freitag, 18. September 2009, 02:41 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.geschichtskombinat.de/google-books-eine-zwiespaeltige-sache
http://geschichtspuls.de/art1359-google-books-eine-zwiespaeltige-sache
Man kann nur immer betonen: Wenn Google die Seiten mit Genehmigung anzeigt, dann hat es eine Genehmigung des Verlags. Und wer sich die Sichtbarkeit von Google Books entgehen lässt, ist mit dem Klammerbeutel gepudert. Mehr möchte ich jetzt zu diesen inkompetenten Ergüssen nicht schreiben.
http://geschichtspuls.de/art1359-google-books-eine-zwiespaeltige-sache
Man kann nur immer betonen: Wenn Google die Seiten mit Genehmigung anzeigt, dann hat es eine Genehmigung des Verlags. Und wer sich die Sichtbarkeit von Google Books entgehen lässt, ist mit dem Klammerbeutel gepudert. Mehr möchte ich jetzt zu diesen inkompetenten Ergüssen nicht schreiben.
KlausGraf - am Freitag, 18. September 2009, 02:21 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 18. September 2009, 02:01 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sehr interessante Fragen und Antworten (auch von der Piratenpartei)
http://wikimedia.de/index.php?id=119
http://wikimedia.de/index.php?id=119
KlausGraf - am Freitag, 18. September 2009, 01:58 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.kanzlei.biz/nc/urteile/07-05-2009-vg-frankfurt-main-7-l-676-09-f.html
Die Entscheidung ist mit Sinn und Zweck des IFG nicht zu vereinbaren. Systematisch werden dadurch sehr komplexe Themen im Bereich der Wirtschaftsaufsicht des Staates dem Transparenzgebot des IFG und der aktuellen journalistischen Berichterstattung entzogen.
Die Entscheidung ist mit Sinn und Zweck des IFG nicht zu vereinbaren. Systematisch werden dadurch sehr komplexe Themen im Bereich der Wirtschaftsaufsicht des Staates dem Transparenzgebot des IFG und der aktuellen journalistischen Berichterstattung entzogen.
KlausGraf - am Freitag, 18. September 2009, 01:50 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Über 2.000 Mal haben sich Anna und Willi Hausen während der Kriegsjahre geschrieben. Die kaum drei Jahre ihrer Ehe verbringen sie bis auf wenige Wochen getrennt. Den Briefwechsel hat die Tochter nun dem Erzbistumsarchiv übergeben."
Quelle: WDR-Mediathek
Quelle: WDR-Mediathek
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. September 2009, 20:05 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/newsticker/Wikipedia-korrekt-zitieren--/meldung/145444
Update: http://weblog.histnet.ch/archives/3075
Update: http://weblog.histnet.ch/archives/3075
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.kittredgecollection.org/
John Kittredge was well known as a generous and supportive member of the numismatic community, both in Worcester, Massachusetts and in New England. Much of his collection concentrates on Crowns and Talers from the 15th century onward. He also has a collection of U.S. coins, New England Numismatic Association (NENA) medals, tokens and other items. All told he had over 7,200 coins and other items that are now in the collection.
Upon his death, John’s collection went to the Kittredge Numismatic Foundation. The mission of the Foundation is to preserve John’s collection, to promote numismatics in the New England region, and to generally provide an educational and research source for the greatest community possible.
Because of the scope and nature of John’s collection, and the endowment of the Foundation, there is an exciting prospect to achieve John’s goals, although one that does not lend itself to the traditional museum setting. It was decided, therefore, to create a “virtual museum” for the coins and medals.
With the help of Ethan Gruber (whose expertise and assistance is gratefully acknowledged) this site has been created to be an ongoing resource for the professional researcher, the serious numismatist and the casual collector of coins and medals. We have used open source software in creating this site, so that others may freely use and modify this application for their own purposes, and also help us continually improve the ease of access and quality of the information.
Some of the database entries have images.
http://www.kittredgecollection.org/display/ead/d1e98386
#numismatik
John Kittredge was well known as a generous and supportive member of the numismatic community, both in Worcester, Massachusetts and in New England. Much of his collection concentrates on Crowns and Talers from the 15th century onward. He also has a collection of U.S. coins, New England Numismatic Association (NENA) medals, tokens and other items. All told he had over 7,200 coins and other items that are now in the collection.
Upon his death, John’s collection went to the Kittredge Numismatic Foundation. The mission of the Foundation is to preserve John’s collection, to promote numismatics in the New England region, and to generally provide an educational and research source for the greatest community possible.
Because of the scope and nature of John’s collection, and the endowment of the Foundation, there is an exciting prospect to achieve John’s goals, although one that does not lend itself to the traditional museum setting. It was decided, therefore, to create a “virtual museum” for the coins and medals.
With the help of Ethan Gruber (whose expertise and assistance is gratefully acknowledged) this site has been created to be an ongoing resource for the professional researcher, the serious numismatist and the casual collector of coins and medals. We have used open source software in creating this site, so that others may freely use and modify this application for their own purposes, and also help us continually improve the ease of access and quality of the information.
Some of the database entries have images.
http://www.kittredgecollection.org/display/ead/d1e98386
#numismatik
KlausGraf - am Donnerstag, 17. September 2009, 18:15 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.boersenblatt.net/339783/
Wenn man für 8 Dollar ein Buch mit unbrauchbarer OCR bekommt wie bei vielen der PD-Ebooks von Google, dann sind das 8 Dollar zuviel.
Wenn man für 8 Dollar ein Buch mit unbrauchbarer OCR bekommt wie bei vielen der PD-Ebooks von Google, dann sind das 8 Dollar zuviel.
KlausGraf - am Donnerstag, 17. September 2009, 17:52 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
http://geo.hlipp.de/
Nunmehr auch in Deutschland (zuvor im UK).
 Foto: Harald Kucharek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Foto: Harald Kucharek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Nunmehr auch in Deutschland (zuvor im UK).
 Foto: Harald Kucharek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Foto: Harald Kucharek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/KlausGraf - am Donnerstag, 17. September 2009, 17:24 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://beta.nachrichten.de
Burdas neuer Newsaggregator ist als Beta online, siehe auch
http://www.kress.de/cont/story.php?id=130326
Wird mich sicher nicht von Google News weglotsen.
Auf der Seite Amoklauf sehen wir rechts eine Definition der Wikipedia mit Quellenangabe Wikipedia und Link zum Artikel Amoklauf:
http://beta.nachrichten.de/thema/Amoklauf/
Die Definition könnte durchaus die nötige Schöpfungshöhe haben, um die Übernahme an die Lizenzbestimmungen zu binden. Das Zitatrecht dürfte nicht in Betracht kommen, wenn regelmäßig bei Themen die Wikipedia-Artikel anzitiert werden.
Die (von mir abgelehnten) Terms of use sehen bei der neuen Wikipedia-Lizenz CC-BY-SA die Urhebernennung mittels Link vor. Der Link ist vorhanden.
Da eine Kürzung vorliegt, ist auch das Share Alike (SA) relevant. Der neue Inhalt muss unter der gleichen Lizenz angeboten werden. Man wird angesichts der Art der Einbindung der Wikipedia nicht verlangen können, dass die gesamte Seite unter der Lizenz angeboten wird.
Nicht nur für CC-BY-SA, sondern für jede CC-Lizenz gilt:
"Sie dürfen den Schutzgegenstand ausschließlich unter den Bedingungen dieser Lizenz verbreiten oder öffentlich zeigen. Sie müssen dabei stets eine Kopie dieser Lizenz oder deren vollständige Internetadresse in Form des Uniform-Resource-Identifier (URI) beifügen."
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode
Ohne einen Link zur Lizenz liegt keine lizenzkonforme Nutzung vor. Die bloße Nennung der Lizenz ohne Link dürfte zwar so gut wie nie zu Problemen führen, ist aber nicht zu empfehlen.
Nachrichten.de nennt die Lizenz aber nicht, also liegt eine Urheberrechtsverletzung vor.
Zum Thema Burda als Heuchler:
http://archiv.twoday.net/search?q=burda
Burdas neuer Newsaggregator ist als Beta online, siehe auch
http://www.kress.de/cont/story.php?id=130326
Wird mich sicher nicht von Google News weglotsen.
Auf der Seite Amoklauf sehen wir rechts eine Definition der Wikipedia mit Quellenangabe Wikipedia und Link zum Artikel Amoklauf:
http://beta.nachrichten.de/thema/Amoklauf/
Die Definition könnte durchaus die nötige Schöpfungshöhe haben, um die Übernahme an die Lizenzbestimmungen zu binden. Das Zitatrecht dürfte nicht in Betracht kommen, wenn regelmäßig bei Themen die Wikipedia-Artikel anzitiert werden.
Die (von mir abgelehnten) Terms of use sehen bei der neuen Wikipedia-Lizenz CC-BY-SA die Urhebernennung mittels Link vor. Der Link ist vorhanden.
Da eine Kürzung vorliegt, ist auch das Share Alike (SA) relevant. Der neue Inhalt muss unter der gleichen Lizenz angeboten werden. Man wird angesichts der Art der Einbindung der Wikipedia nicht verlangen können, dass die gesamte Seite unter der Lizenz angeboten wird.
Nicht nur für CC-BY-SA, sondern für jede CC-Lizenz gilt:
"Sie dürfen den Schutzgegenstand ausschließlich unter den Bedingungen dieser Lizenz verbreiten oder öffentlich zeigen. Sie müssen dabei stets eine Kopie dieser Lizenz oder deren vollständige Internetadresse in Form des Uniform-Resource-Identifier (URI) beifügen."
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode
Ohne einen Link zur Lizenz liegt keine lizenzkonforme Nutzung vor. Die bloße Nennung der Lizenz ohne Link dürfte zwar so gut wie nie zu Problemen führen, ist aber nicht zu empfehlen.
Nachrichten.de nennt die Lizenz aber nicht, also liegt eine Urheberrechtsverletzung vor.
Zum Thema Burda als Heuchler:
http://archiv.twoday.net/search?q=burda
KlausGraf - am Donnerstag, 17. September 2009, 16:24 - Rubrik: Archivrecht
Im Rahmen des EU-Projekts ARROW will die Deutsche Nationalbibliothek die Schönsten Bücher digitalisieren. Die von der Stiftung Buchkunst prämierten Titel (rund 5000 Bände) dienen als Testballon für die Rechte-Klärung bei vergriffenen und verwaisten Werken. Ein Interview mit Ines Kolbe und Thomas Jaeger, die das Vorhaben bei der Deutschen Nationalbibliothek betreuen.
http://www.boersenblatt.net/339422/
http://www.boersenblatt.net/339422/
KlausGraf - am Donnerstag, 17. September 2009, 15:54 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 17. September 2009, 15:48 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://jpress.tau.ac.il/view-english.asp
Digitalisate von einer englischsprachigen (Palestine Post), fünf französischsprachigen und fünf hebräischen Zeitungen.
Digitalisate von einer englischsprachigen (Palestine Post), fünf französischsprachigen und fünf hebräischen Zeitungen.
KlausGraf - am Donnerstag, 17. September 2009, 15:43 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
http://www.buchreport.de/nachrichten/verlage/verlage_nachricht/datum/2009/09/16/im-boersenverein-fehlt-frischer-wind.htm
"Zugunsten der Nutzer und der Allgemeinheit gilt es, der ständigen Ausdehnung des Urheberrechts entgegenzuwirken und es wieder auf einen Kernbestand wirklich kreativer Inhalte zu beschränken."
"Zugunsten der Nutzer und der Allgemeinheit gilt es, der ständigen Ausdehnung des Urheberrechts entgegenzuwirken und es wieder auf einen Kernbestand wirklich kreativer Inhalte zu beschränken."
KlausGraf - am Mittwoch, 16. September 2009, 17:02 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Auch die kritische Diskussion ist jederzeit möglich, soweit sie nicht in den jeweiligen Räumlichkeiten der documenta erfolgt"
Ein ziemliches Skandalurteil, das in seinem urheberrechtlichen Teil abstrus anmutet:
http://www.kanzlei.biz/nc/urheberrecht/07-11-2008-lg-kassel-12-o-4157-07.html
Ein ziemliches Skandalurteil, das in seinem urheberrechtlichen Teil abstrus anmutet:
http://www.kanzlei.biz/nc/urheberrecht/07-11-2008-lg-kassel-12-o-4157-07.html
KlausGraf - am Mittwoch, 16. September 2009, 15:39 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Astrid Küntzel legt im Rahmen einer Transferarbeit 2009 Vorarbeiten für ein regionales Überlieferungsprofil vor:
http://www.archive.nrw.de/LandesarchivNRW/BilderKartenLogosDateien/K__ntzel___berlieferungspraxis.pdf
http://www.archive.nrw.de/LandesarchivNRW/BilderKartenLogosDateien/K__ntzel___berlieferungspraxis.pdf
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.kanzlei.biz/nc/news-urteile/01-09-2009-olg-frankfurt-11-u-51-08.html
In einem Urheberrechtsprozess wegen eines wissenschaftlichen Aufsatzes hat das OLG Frankfurt eine eher bedenkliche Ansicht geäußert:
Jedenfalls außerhalb des Hochschulbereichs können die Umstände des Einzelfalls auch bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen dazu führen, dass eine sogenannte "Ghostwriter-Vereinbarung", mit der sich der Urheber zum Verschweigen der eigenen Urheberschaft verpflichtet und dem Namensgeber gestattet, das Werk als eigenes zu veröffentlichen, nicht sittenwidrig ist.
Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Urteil vom 01.09.2009, Az.: 11 U 51/08
In einem Urheberrechtsprozess wegen eines wissenschaftlichen Aufsatzes hat das OLG Frankfurt eine eher bedenkliche Ansicht geäußert:
Jedenfalls außerhalb des Hochschulbereichs können die Umstände des Einzelfalls auch bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen dazu führen, dass eine sogenannte "Ghostwriter-Vereinbarung", mit der sich der Urheber zum Verschweigen der eigenen Urheberschaft verpflichtet und dem Namensgeber gestattet, das Werk als eigenes zu veröffentlichen, nicht sittenwidrig ist.
Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Urteil vom 01.09.2009, Az.: 11 U 51/08
KlausGraf - am Mittwoch, 16. September 2009, 14:58 - Rubrik: Archivrecht
PONS bewertet deutsche Blogs nach ihrem korrekten Deutsch und veröffentlicht dann eine Rangliste:
http://charts.pons.eu/
Glückwunsch an Netbib für Platz 4 (Vorwoche 3)
Ich habe uns auch mal angemeldet und würde mich freuen, wenn die werten Contributoren dies beachten würden.
http://charts.pons.eu/
Glückwunsch an Netbib für Platz 4 (Vorwoche 3)
Ich habe uns auch mal angemeldet und würde mich freuen, wenn die werten Contributoren dies beachten würden.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
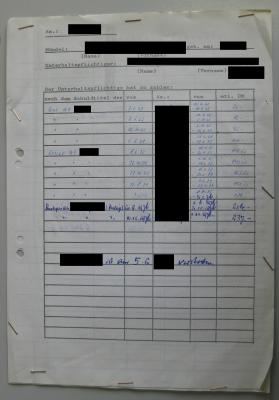
Wolf Thomas - am Mittwoch, 16. September 2009, 09:42 - Rubrik: Unterhaltung
KlausGraf - am Mittwoch, 16. September 2009, 02:28 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
ResearchGATE bringt Open Access entscheidend voran
Wissenschaftliches Online-Netzwerk startet Self-Archiving Repository
Berlin, 15. September 2009. Gerade erst hat ResearchGATE (www.researchgate.net) den Durchbruch als führendes wissenschaftliches Online-Netzwerk weltweit geschafft, da sorgt es schon wieder mit einem neuen Feature für Schlagzeilen: Künftig werden wissenschaftliche Artikel innerhalb der Plattform auch dann frei und vollständig zugänglich sein, wenn sie in kostenpflichtigen Publikationen erschienen sind. Wie das funktioniert? ResearchGATE hat das Konzept des Self-Archiving Repository, in dem Forscher ihre eigenen Veröffentlichungen trotz Copyright ablegen dürfen, weiterentwickelt. Da jedes ResearchGATE-Profil juristisch als persönliche Website gilt, dürfen die Mitglieder dort im Normalfall ihre Aufsätze hochladen, ohne das Urheberrecht zu verletzen. Das ist der einfache Weg zu Open Access, nach dem die wissenschaftliche Community so lange gesucht hat!
Dabei hat ResearchGATE darauf geachtet, dass rechtlich alles im grünen Bereich bleibt. Der Publikationsindex der Plattform, der Metadaten für 35 Millionen Veröffentlichungen enthält, wird automatisch mit den Angaben aus SHERPA RoMEO(http://www.sherpa.ac.uk/romeo) verbunden, der Datenbank, in der Verlage und Autoren ihre Vereinbarungen über Self Archiving ablegen. Als Ergebnis dieses Matching-Prozesses wissen die ResearchGATE-Mitglieder genau, welche Version ihres Artikels sie in ihr Profil hochladen dürfen, ohne Urheberrechte zu verletzen. Da neun von zehn wissenschaftlichen Zeitschriften eine Self Archiving-Vereinbarung mit ihren Autoren eingehen, könnte das ResearchGATE-Projekt in kürzester Zeit Hunderttausende von Artikeln zum ersten Mal kostenfrei in der Vollversion zugänglich machen.
Gerade erst hatte ResearchGATE die Schwelle von 140.000 Mitgliedern überschritten und ist dadurch mit deutlichem Abstand das größte Online-Netzwerk für Wissenschaftler -und das, obwohl es erst im Mai des vergangenen Jahres online gegangen ist. Ein weiteres neues Tool innerhalb der Plattform ist das Job Board, über das freie Stellen in Wissenschaft und Lehre vermittelt werden. Trotz dieser laufenden Weiterentwicklung bleibt ResearchGATE für seine Mitglieder kostenfrei.
Um mehr Informationen über ResearchGATE und seine vielen Features zu erhalten, besuchen Sie bitte die Website http://www.researchgate.net und legen ein kostenloses Profil an. Bei weiteren Fragen, wenden sie sich jederzeit an mich persönlich oder an unser Team unter press@researchgate.net.
Mehr Hintergrundinfos zu Self Archiving finden Sie auf der Website www.self-archiving.me (via Mail)
Wissenschaftliches Online-Netzwerk startet Self-Archiving Repository
Berlin, 15. September 2009. Gerade erst hat ResearchGATE (www.researchgate.net) den Durchbruch als führendes wissenschaftliches Online-Netzwerk weltweit geschafft, da sorgt es schon wieder mit einem neuen Feature für Schlagzeilen: Künftig werden wissenschaftliche Artikel innerhalb der Plattform auch dann frei und vollständig zugänglich sein, wenn sie in kostenpflichtigen Publikationen erschienen sind. Wie das funktioniert? ResearchGATE hat das Konzept des Self-Archiving Repository, in dem Forscher ihre eigenen Veröffentlichungen trotz Copyright ablegen dürfen, weiterentwickelt. Da jedes ResearchGATE-Profil juristisch als persönliche Website gilt, dürfen die Mitglieder dort im Normalfall ihre Aufsätze hochladen, ohne das Urheberrecht zu verletzen. Das ist der einfache Weg zu Open Access, nach dem die wissenschaftliche Community so lange gesucht hat!
Dabei hat ResearchGATE darauf geachtet, dass rechtlich alles im grünen Bereich bleibt. Der Publikationsindex der Plattform, der Metadaten für 35 Millionen Veröffentlichungen enthält, wird automatisch mit den Angaben aus SHERPA RoMEO(http://www.sherpa.ac.uk/romeo) verbunden, der Datenbank, in der Verlage und Autoren ihre Vereinbarungen über Self Archiving ablegen. Als Ergebnis dieses Matching-Prozesses wissen die ResearchGATE-Mitglieder genau, welche Version ihres Artikels sie in ihr Profil hochladen dürfen, ohne Urheberrechte zu verletzen. Da neun von zehn wissenschaftlichen Zeitschriften eine Self Archiving-Vereinbarung mit ihren Autoren eingehen, könnte das ResearchGATE-Projekt in kürzester Zeit Hunderttausende von Artikeln zum ersten Mal kostenfrei in der Vollversion zugänglich machen.
Gerade erst hatte ResearchGATE die Schwelle von 140.000 Mitgliedern überschritten und ist dadurch mit deutlichem Abstand das größte Online-Netzwerk für Wissenschaftler -und das, obwohl es erst im Mai des vergangenen Jahres online gegangen ist. Ein weiteres neues Tool innerhalb der Plattform ist das Job Board, über das freie Stellen in Wissenschaft und Lehre vermittelt werden. Trotz dieser laufenden Weiterentwicklung bleibt ResearchGATE für seine Mitglieder kostenfrei.
Um mehr Informationen über ResearchGATE und seine vielen Features zu erhalten, besuchen Sie bitte die Website http://www.researchgate.net und legen ein kostenloses Profil an. Bei weiteren Fragen, wenden sie sich jederzeit an mich persönlich oder an unser Team unter press@researchgate.net.
Mehr Hintergrundinfos zu Self Archiving finden Sie auf der Website www.self-archiving.me (via Mail)
KlausGraf - am Mittwoch, 16. September 2009, 02:23 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blog.beck.de/2009/09/15/infos-gute-blogs-zum-internetrecht
Manche Leser des Beck-Blogs wollen es wissen. Was sind eigentlich gute Informationsquellen im Internetrecht, Herr Hoeren? Also gut, hier einige meiner Favourites (ich weiss, ich habe viel vergessen; es ist nur eine spontane Liste)
Platz 1: RA Thomas Gramespacher und MIR
http://medien-internet-und-recht.de/
Platz 2: Ra Dr. Bahr & Co (allerdings ohne Volltexte)
http://www.dr-bahr.com/news.html
Platz 3: Das Institut für Urheber- und Medienrecht in München
http://www.urheberrecht.org/news/
Platz 4: Streitbar, up-to-date und innovativ
http://archiv.twoday.net/
Platz 5: Auch Österreich verdient ein Plus
http://www.internet4jurists.at/
Außer Konkurrenz und auch wenns Geld kostet:
http://www.weblaw.ch/de/
Viel Spass beim Surfen - und wer hat andere Highlights? Ihr Thomas Hoeren (Hervorhebung KG)
Aus den Kommentaren:
Archivalia ist prima, aber in der Auswahl sehr eingeschränkt (Urheberrecht halt).
Wir fühlen uns geehrt!
Manche Leser des Beck-Blogs wollen es wissen. Was sind eigentlich gute Informationsquellen im Internetrecht, Herr Hoeren? Also gut, hier einige meiner Favourites (ich weiss, ich habe viel vergessen; es ist nur eine spontane Liste)
Platz 1: RA Thomas Gramespacher und MIR
http://medien-internet-und-recht.de/
Platz 2: Ra Dr. Bahr & Co (allerdings ohne Volltexte)
http://www.dr-bahr.com/news.html
Platz 3: Das Institut für Urheber- und Medienrecht in München
http://www.urheberrecht.org/news/
Platz 4: Streitbar, up-to-date und innovativ
http://archiv.twoday.net/
Platz 5: Auch Österreich verdient ein Plus
http://www.internet4jurists.at/
Außer Konkurrenz und auch wenns Geld kostet:
http://www.weblaw.ch/de/
Viel Spass beim Surfen - und wer hat andere Highlights? Ihr Thomas Hoeren (Hervorhebung KG)
Aus den Kommentaren:
Archivalia ist prima, aber in der Auswahl sehr eingeschränkt (Urheberrecht halt).
Wir fühlen uns geehrt!
KlausGraf - am Dienstag, 15. September 2009, 22:02 - Rubrik: Archivrecht
http://e-library.ircica.org/index.php
Das Research Centre for Islamic History, Art and Culture in Istambul hat auch wenige englischsprachige Bücher digitalisiert. Netter Viewer!
Via
http://filosofiastoria.wordpress.com/2009/09/15/la-biblioteca-digitale-del-research-centre-for-islamic-history-art-and-culture-ircica/
Das Research Centre for Islamic History, Art and Culture in Istambul hat auch wenige englischsprachige Bücher digitalisiert. Netter Viewer!
Via
http://filosofiastoria.wordpress.com/2009/09/15/la-biblioteca-digitale-del-research-centre-for-islamic-history-art-and-culture-ircica/
KlausGraf - am Dienstag, 15. September 2009, 21:29 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Vor allem in den Kommentaren zu
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/31/31135/1.html
Aber auch der Artikel selbst gibt mir Rätsel auf:
"Google blockiert aufgrund der Vorwürfe nämlich große Teile der Buchanzeige für IP-Nummernblöcke aus der Bundesrepublik."
Wo bitteschön ist dafür irgendein Beleg?
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/31/31135/1.html
Aber auch der Artikel selbst gibt mir Rätsel auf:
"Google blockiert aufgrund der Vorwürfe nämlich große Teile der Buchanzeige für IP-Nummernblöcke aus der Bundesrepublik."
Wo bitteschön ist dafür irgendein Beleg?
KlausGraf - am Dienstag, 15. September 2009, 21:06 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/6142964/Fairy-tales-have-ancient-origin.html
Was soll daran neu sein? Solche Studien gibts doch schon zuhauf.
Was soll daran neu sein? Solche Studien gibts doch schon zuhauf.
KlausGraf - am Dienstag, 15. September 2009, 21:02 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das westfälische Archivamt in Münster kommt mit dem Trocknen der durchnässten Bücher, Schriftstücke und Urkunden aus dem zerstörten Kölner Stadtarchiv gut voran. Seit März sind etwa elf Tonnen Archivalien getrocknet worden. Bis Anfang nächsten Jahres will das Archivamt noch weitere 15 Tonnen behandeln. Dieses Material lagert zurzeit noch in Kühlhäusern "
Quelle: WDR-Lokalzeit-Nachrichten aus dem Münsterland vom 13.08.2009 11:34 Uhr via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Quelle: WDR-Lokalzeit-Nachrichten aus dem Münsterland vom 13.08.2009 11:34 Uhr via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Wolf Thomas - am Dienstag, 15. September 2009, 19:20 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Info-Box (Quelle: Bundesarchiv)
"An der Hauptpforte des Bundesarchivs in Berlin-Lichterfelde zieht seit kurzem eine Info-Box die Blicke der Passanten, Besucher und Mitarbeiter auf sich. Das ehemalige Pförtnerhäuschen der "Andrews Barracks" hat eine zünftige Bau-Verkleidung bekommen und beherbergt seit Juni 2008 eine kleine Ausstellung, die täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr geöffnet ist.
In der Info-Box vermitteln die ersten vier Schautafeln Wissenswertes zur Baugeschichte und zur früheren Nutzung der Liegenschaft: zur Errichtung der Hauptkadettenanstalt ab 1865, über die Ausbildung und das Leben der Kadetten (1878 - 1919), die anschließende zivile Nutzung des Geländes als Staatliche Bildungseinrichtung, bis die "Leibstandarte SS Adolf Hitler" 1933 von dem Gelände Besitz ergriff und es auch baulich veränderte, über den Umfang der Kriegsschäden sowie die Nutzung und Bebauung durch die amerikanischen Streitkräfte in den Jahren 1945 bis 1994.
Die nachfolgenden drei Ausstellungstafeln stellen das Bundesarchiv als heutigen zivilen Nutzer vor, seine Geschichte, seine Tätigkeit als Dienstleister für Forschung und Verwaltung, seine Dienststellen und Standorte. Anschließend werden die geplanten Neu- und Umbaumaßnahmen ausführlich an Hand von Plänen, Zeichnungen und Modellen erläutert und die Skizzen einer städtebaulichen Entwicklungsstudie für das Bundesarchiv präsentiert."
Quelle: Bundesarchiv
http://www.bundesarchiv.de/aktuelles/neubau/index.html
Wolf Thomas - am Dienstag, 15. September 2009, 19:15 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Generaldirektor Dr. Ulziibatar Demberel (r.) und Prof. Dr. Hartmut Weber am Grundstein des künftigen Nationalarchivs der Mongolei (Quelle: Bundesarchiv)
"Auf Einladung des Generaldirektors der Staatsarchive der Mongolei Dr. Ulziibaatar Demberel besuchte der Präsident des Bundesarchivs vom 8. bis zum 13. Juli 2009 Archiveinrichtungen in Ulaanbaatar und führte Fachgespräche.
Im Mittelpunkt der Gespräche standen Archivbau und Archiveinrichtung. Die Mongolei ist im Begriff, einen aufwändigen Neubau für das Nationalarchiv zu erstellen. Eingehend wurden mit den Architekten die Ausführungspläne erörtert. In diese sind viele Anregungen eingeflossen, die Generaldirektor Demberel bei Archivbesichtigungen in Koblenz, in Berlin und in Bayreuth aufgenommen hatte. So sollen in dem ansprechend gestalteten kompakten Baukörper der Öffentlichkeitsbereich und die Dienstzimmer durch ein Atrium nach Bayreuther Vorbild zusätzliches Tageslicht erhalten. Der Grundstein für den Neubau ist im Norden der Stadt schon gelegt, wovon sich Professor Weber überzeugen konnte.
Vor mehr als 70 Angehörigen des Nationalarchivs hielt der Präsident des Bundesarchivs zwei Vorträge: eine Präsentation über den Kölner Archiveinsturz, an dem das Nationalarchiv bereits im März große Anteilnahme hatte erkennen lassen, und eine Präsentation über die aktuelle Situation des Bundesarchivs und seine Herausforderungen wie die Erhaltung herkömmlichen und digitalen Archivguts und die Bereitstellung von Erschließungsinformationen im Internet. Auch dem Archiv des Außenministeriums galt ein Besuch. Dabei stand ein ehrgeiziges Digitalisierungsprojekt von Staatsverträgen im Mittelpunkt des Interesses und der fachlichen Erörterungen mit der Direktorin Baatarjamts Gantulga. Ein weiterer Höhepunkt war die Besichtigung der National-bibliothek mit ihren wertvollen Altbeständen und der Austausch von Erfahrungen zur Erhaltung von Kulturgut in einem repräsentativen Altbau mit dem Direktor Hatagin G. Akim.
Während des Besuch fand in Ulaanbaatar das eindrucksvolle Nadam-Fest mit seinen berühmten Wettkämpfen Ringen, Pferderennen und Bogenschießen statt. In entspannter Atmosphäre konnten dabei und bei einer Exkursion nach Tsonjin Boldog zur neu errichteten gewaltigen Reiterstatue Chingiss Khaans die fachlichen und menschlichen Beziehungen vertieft werden."
Quelle: Bundesarchiv
Wolf Thomas - am Dienstag, 15. September 2009, 19:04 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Sitzung des "Arbeitskreises der nordrhein-westfälischen Kreisarchive" in Paderborn mit Prof. Dr. Leo Peters (1. von rechts) und Kreisarchivar Wilhelm Grabe (5. von rechts)
"Vor fünfundzwanzig Jahren wurde die "Arbeitsgemeinschaft der nordrhein-estfälischen Kreisarchivare" formell aus der Taufe gehoben. Zwar organisierte das Westfälische Archivamt schon seit 1960 mehr oder weniger regelmäßige Arbeitsgespräche, auf Landesebene traf man sich aber erstmals im November 1983 in Altena. So kam es, dass sich am 29. März 1984 in Kempen im Kreis Viersen Kreisarchivare aus dem Rheinland und aus Westfalen zur Gründung einer Facharbeitsgemeinschaft zusammenfanden. Diese solle, so heißt es im Protokoll der Gründungssitzung, "zur Koordination der Interessen und zum Erfahrungsaustausch der Kreisarchivare insbesondere als Verbindungsorgan zu den anderen archivarischen Arbeitsgemeinschaften in Nordrhein-Westfalen sowie zum Kommunalen Spitzenverband, dem Landkreistag NW fungieren".
Mit der Zeit verfestigten sich die organisatorischen Strukturen. Wurde noch in der Gründungssitzung mit dem Viersener Kreisarchivar Paul-Günter Schulte ein aus dem Rheinland stammender Sprecher und einem aus Westfalen stammenden Stellvertreter quasi eine Doppelspitze installiert, so wechselt das Amt des Sprechers heute im Abstand von zwei Jahren zwischen einem Kreisarchivar aus dem Rheinland und einem aus Westfalen. Auf der Frühjahrssitzung 1986 wurde - nach dem Vorbild der übrigen beim LKT angesiedelten Arbeitskreise - das Amt eines Vorsitzenden eingeführt. Mit dem Soester Oberkreisdirektor Rudolf Harling konnte jemand gewonnen werden, der diese Funktion mit hohem Engagement bis Ende 1993 ausübte. Zu seinem Nachfolger avancierte der Kulturdezernent des Kreises Viersen, Prof. Dr. Leo Peters, der jetzt am 20. Mai 2009 auf der 49. Arbeitssitzung des AKKA in Paderborn verabschiedet wurde, da er mit Ablauf des Monats September in den Ruhestand tritt. Er hat insgesamt 15 Jahre lang - in Worten 29 Sitzungen - die Geschicke des AKKA geprägt. Seine Nachfolge wird im Herbst der Schul- und Kulturdezernent beim Rhein-Kreis Neuss, Tillmann Lonnes, antreten.
Der "Arbeitskreis der nordrhein-westfälischen Kreisarchive" hat sich inzwischen zu einer festen und anerkannten Größe entwickelt und steht heute gleichberechtigt neben den beiden anderen, beim Städtetag bzw. Städte- und Gemeindebund NRW angesiedelten Archivarbeitskreisen, der Arbeitsgemeinschaft der Stadtarchive des Städtetages NRW (ARGE) und der Arbeitsgemeinschaft der Stadt- und Gemeindearchive beim Städte- und Gemeindebund (ASGA). Dabei sind die Kreisarchive ja eine recht junge Archivgattung. Die meisten verdanken ihre Entstehung bekanntlich der kommunalen Neugliederung der 1970er Jahre. In den Sitzungsprotokollen spiegeln sich die intensiven fachlichen Diskussionen der vergangenen Jahre. Auf den zweimal jährlich abwechselnd in Westfalen und im Rheinland stattfindenden Arbeitstreffen wurden und werden Fragen der Bestandserhaltung, der Öffentlichkeitsarbeit oder der Historischen Bildungsarbeit ebenso behandelt wie die Einführung neuer kommunaler Finanz- und Steuerungssysteme. Das Themenspektrum reicht vom Einsatz der Elektronischen Datenverarbeitung im Archiv bis hin zur Langzeitarchivierung elektronischer Unterlagen. Auf der letzten Sitzung standen die Novellierung des nordrhein-westfälischen Archivgesetzes sowie die Probleme der Umsetzung des Personenstandsreformgesetzes im Mittelpunkt."
Autor: Wilhelm Grabe
Quelle:
http://www.lkt-nrw.de/Page/2009/05_09/28.html
Wolf Thomas - am Dienstag, 15. September 2009, 18:52 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Für Zadeks erste Theaterstücke in England hat mein Vater die Musik komponiert und gespielt. Mit seinem Tod ist nun ein weiteres Bindeglied zur Vergangenheit und zu meinem Vater (der schon 1976 verstarb) verschwunden – auch im wörtlichen Sinn, denn diese Kompositionen hatte ich dem Stadtarchiv in Köln geschenkt. Sie werden vielleicht nicht wieder auftauchen – zumindest hat sich fünf Monaten nach dem Einsturz bei mir als Nachlassgeberin, noch niemand vom Historischen Archiv gemeldet, um mitzuteilen ob etwas sichergestellt worden ist.
Zadek hatte seinen großen Erfolg nicht in England, sondern in Deutschland - die Kontakte hatten mein Großvater und mein Großonkel - Alfred und Wilhelm Unger - für ihn organisiert, deren Nachlässe ebenfalls im Stadtarchiv so zu sagen „sichergestellt“ worden waren. Die Ungers waren Theaterleute, die Zadek in seiner Autobiographie „My Way“ mehrmals erwähnt, ebenso wie auch meinen Vater: „Ich befreundete mich sehr mit ihm, und alles, was ich über Musik gelernt habe, habe ich von ihm gelernt. Einmal fuhren wir zusammen nach Cornwall, mieteten uns dort ein Haus mit Klavier und schrieben zusammen eine Oper. Sie heißt Hinzelmeier, nach dem Märchen von Theodor Storm. Peter Ury hat zu vielen Gedichten von Erich Fried die Musik geschrieben.“
Zur Kinderoper unters Klavier
Das war um 1956, und ich reiste als Kleinkind mit auf Urlaub nach Cornwall. Tagsüber gingen wir Kinder mit den Müttern am Strand spazieren und spielten, während die Väter zuhause an der Oper arbeiten haben. Später legte ich mich dann auf den Boden unter dem Klavier, während mein Vater spielte, um die Klänge beim Üben der neuen Musikstücke mit dem ganzen Körper zu genießen.
Es war die Geschichte von „Timothy“, der sich in ein Rosenmädchen verliebt, aber statt sich der Liebe hinzugeben, in die Welt auszieht, auf der Suche nach der Stein der Weisen, um erst als alte Mann zu erkennen, dass die Liebe die reinste Form von Weisheit sei. Als sie sich am Ende der Oper wieder treffen, sind Timothy und das Rosenmädchen schon zu alt geworden, um ein gemeinsames Leben in Liebe und Weisheit zu genießen.
Ich kann mich noch an viele Passagen dieser Oper erinnern, die zwar nie veröffentlicht wurde - einige Arien daraus wurden aber bereits damals aufgenommen (mit Pamela Bowden, Heather Harper und Wilfried Brown). Diese Aufzeichnungen habe ich ebenfalls dem Historischen Archiv geschenkt, auch sie sind wahrscheinlich vernichtet, und es existieren keine Kopien davon. Eine dieser Arien sang der Teufel, der die Welt mit einer Bombe in die Luft sprengen wollte, eine andere handelte von einer Frau, die den ganzen Tag backte – szenisch sollten Pfannkuchen durch einen Kamin auf die Bühne geschossen werden - und eine weitere ging über „Jasper“, den schwarzen Raaben, der Timothy als Freund durch die Welt begleitete, auf der Suche nach Weisheit – Außerdem gab es eine Musik für die Rosenmädchen. Der Musikstil meines Vaters war spätromantisch.
Verpasste Gelegenheit
Hinzelmeier wurde auf dem und für das Klavier komponiert - die Kompositionen waren noch nicht für Orchester bearbeitet. Einige Jahre nach dem Tod meines Vaters, hat Zadek meine Mutter in London besucht, um sie um Erlaubnis für die Aufführung zu bitten – er hatte die finanzielle Möglichkeiten, die Oper in Deutschland zu inszenieren, und wollte die Klavierstücke für Orchester bearbeiten lassen. Nur haben meine inzwischen verstorbene Mutter Sylvia Ury und Peter Zadek sich leider nicht einigen können – und so wurde diese Gelegenheit verpasst.
Etwa 15 Jahre später - im Jahr 2000 - habe ich mich dann mit Zadek in Stuttgart getroffen, anlässlich seines Theaterstücks „Hamlet“. Ich fragte ihn nach Möglichkeiten, die Kinderoper endlich einmal zu inszenieren, denn ich würde mich mit ihm sehr wohl einigen, und ihm die Original-Partitur, die zu diesem Zeitpunkt noch unversehrt im Stadtarchiv Köln lagerten, zur Bearbeitung zukommen lassen. Aber der richtige Zeitpunkt schien verpasst - die Sponsoren für dieses bestimmte Projekt hatten sich zurückgezogen, so meinte Zadek.
Am 29. Juli habe ich das Stück Land, mitten in Köln, das als „Loch“ bezeichnet wird gefilmt wo früher das Stadtarchiv stand. Zehn Prozent der dort eingelagerten Archivalien sind noch unter der Erde dort begraben – alle Such- und Rettungsaktionen sind fast zu Ende gebracht worden. Inzwischen ist man mit den aufwändigen Erfassungs- und Restaurierungsarbeiten der zerstörten Archivalien, fortschritten, die Jahrzehnte dauern wird.
Als ich über die Erdenhaufen ging, die Bagger in Teilen des „Lochs“ aufgeschüttet hatten, trat ich fasst auf eine Rolle schwarzes Videoband, das aus seiner Kassettenhülle entfernt worden war, und aus den oberen Erdschichten herausguckte. Dieses Band wurde dann von den Berufsfeuerwehrleuten, die mich und den Kameramann begleiteten, sichergestellt.
Verlust für immer?
Zufall war es, das dieses Videoband aufgefunden wurde, aber es war in keinem guten Zustand. Ich musste wieder an weitere Sachen denken, die mir teuer waren und die noch in der Erde liegen könnten, wie etwa die gelben Judensterne meiner Großeltern (die sie in Nazideutschland auf ihre Mäntel aufzunähen mussten), oder der Brief, den mein Vater Peter Ury 1944 als letztes Lebenszeichen von seiner Mutter, Fanny Hedwig Ury, aus Auschwitz erhalten hat – sie sagte, dass es ihr gut ging - und die Originalausgaben der Bücher meines Großvaters Alfred und seines Bruder Wilhelm Unger - Kopien davon wurden vor der Bücherverbrennung gerettet, um hier in diesem schwarzen Loch für immer zu verschwinden. "
Quelle: http://www.ksta.de/html/artikel/1248965025900.shtml
s. a.
http://archiv.twoday.net/stories/5827304/
http://archiv.twoday.net/stories/5669090/
Zadek hatte seinen großen Erfolg nicht in England, sondern in Deutschland - die Kontakte hatten mein Großvater und mein Großonkel - Alfred und Wilhelm Unger - für ihn organisiert, deren Nachlässe ebenfalls im Stadtarchiv so zu sagen „sichergestellt“ worden waren. Die Ungers waren Theaterleute, die Zadek in seiner Autobiographie „My Way“ mehrmals erwähnt, ebenso wie auch meinen Vater: „Ich befreundete mich sehr mit ihm, und alles, was ich über Musik gelernt habe, habe ich von ihm gelernt. Einmal fuhren wir zusammen nach Cornwall, mieteten uns dort ein Haus mit Klavier und schrieben zusammen eine Oper. Sie heißt Hinzelmeier, nach dem Märchen von Theodor Storm. Peter Ury hat zu vielen Gedichten von Erich Fried die Musik geschrieben.“
Zur Kinderoper unters Klavier
Das war um 1956, und ich reiste als Kleinkind mit auf Urlaub nach Cornwall. Tagsüber gingen wir Kinder mit den Müttern am Strand spazieren und spielten, während die Väter zuhause an der Oper arbeiten haben. Später legte ich mich dann auf den Boden unter dem Klavier, während mein Vater spielte, um die Klänge beim Üben der neuen Musikstücke mit dem ganzen Körper zu genießen.
Es war die Geschichte von „Timothy“, der sich in ein Rosenmädchen verliebt, aber statt sich der Liebe hinzugeben, in die Welt auszieht, auf der Suche nach der Stein der Weisen, um erst als alte Mann zu erkennen, dass die Liebe die reinste Form von Weisheit sei. Als sie sich am Ende der Oper wieder treffen, sind Timothy und das Rosenmädchen schon zu alt geworden, um ein gemeinsames Leben in Liebe und Weisheit zu genießen.
Ich kann mich noch an viele Passagen dieser Oper erinnern, die zwar nie veröffentlicht wurde - einige Arien daraus wurden aber bereits damals aufgenommen (mit Pamela Bowden, Heather Harper und Wilfried Brown). Diese Aufzeichnungen habe ich ebenfalls dem Historischen Archiv geschenkt, auch sie sind wahrscheinlich vernichtet, und es existieren keine Kopien davon. Eine dieser Arien sang der Teufel, der die Welt mit einer Bombe in die Luft sprengen wollte, eine andere handelte von einer Frau, die den ganzen Tag backte – szenisch sollten Pfannkuchen durch einen Kamin auf die Bühne geschossen werden - und eine weitere ging über „Jasper“, den schwarzen Raaben, der Timothy als Freund durch die Welt begleitete, auf der Suche nach Weisheit – Außerdem gab es eine Musik für die Rosenmädchen. Der Musikstil meines Vaters war spätromantisch.
Verpasste Gelegenheit
Hinzelmeier wurde auf dem und für das Klavier komponiert - die Kompositionen waren noch nicht für Orchester bearbeitet. Einige Jahre nach dem Tod meines Vaters, hat Zadek meine Mutter in London besucht, um sie um Erlaubnis für die Aufführung zu bitten – er hatte die finanzielle Möglichkeiten, die Oper in Deutschland zu inszenieren, und wollte die Klavierstücke für Orchester bearbeiten lassen. Nur haben meine inzwischen verstorbene Mutter Sylvia Ury und Peter Zadek sich leider nicht einigen können – und so wurde diese Gelegenheit verpasst.
Etwa 15 Jahre später - im Jahr 2000 - habe ich mich dann mit Zadek in Stuttgart getroffen, anlässlich seines Theaterstücks „Hamlet“. Ich fragte ihn nach Möglichkeiten, die Kinderoper endlich einmal zu inszenieren, denn ich würde mich mit ihm sehr wohl einigen, und ihm die Original-Partitur, die zu diesem Zeitpunkt noch unversehrt im Stadtarchiv Köln lagerten, zur Bearbeitung zukommen lassen. Aber der richtige Zeitpunkt schien verpasst - die Sponsoren für dieses bestimmte Projekt hatten sich zurückgezogen, so meinte Zadek.
Am 29. Juli habe ich das Stück Land, mitten in Köln, das als „Loch“ bezeichnet wird gefilmt wo früher das Stadtarchiv stand. Zehn Prozent der dort eingelagerten Archivalien sind noch unter der Erde dort begraben – alle Such- und Rettungsaktionen sind fast zu Ende gebracht worden. Inzwischen ist man mit den aufwändigen Erfassungs- und Restaurierungsarbeiten der zerstörten Archivalien, fortschritten, die Jahrzehnte dauern wird.
Als ich über die Erdenhaufen ging, die Bagger in Teilen des „Lochs“ aufgeschüttet hatten, trat ich fasst auf eine Rolle schwarzes Videoband, das aus seiner Kassettenhülle entfernt worden war, und aus den oberen Erdschichten herausguckte. Dieses Band wurde dann von den Berufsfeuerwehrleuten, die mich und den Kameramann begleiteten, sichergestellt.
Verlust für immer?
Zufall war es, das dieses Videoband aufgefunden wurde, aber es war in keinem guten Zustand. Ich musste wieder an weitere Sachen denken, die mir teuer waren und die noch in der Erde liegen könnten, wie etwa die gelben Judensterne meiner Großeltern (die sie in Nazideutschland auf ihre Mäntel aufzunähen mussten), oder der Brief, den mein Vater Peter Ury 1944 als letztes Lebenszeichen von seiner Mutter, Fanny Hedwig Ury, aus Auschwitz erhalten hat – sie sagte, dass es ihr gut ging - und die Originalausgaben der Bücher meines Großvaters Alfred und seines Bruder Wilhelm Unger - Kopien davon wurden vor der Bücherverbrennung gerettet, um hier in diesem schwarzen Loch für immer zu verschwinden. "
Quelle: http://www.ksta.de/html/artikel/1248965025900.shtml
s. a.
http://archiv.twoday.net/stories/5827304/
http://archiv.twoday.net/stories/5669090/
Wolf Thomas - am Dienstag, 15. September 2009, 18:43 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Einsturz des Kölner Stadtarchivs hat weit über Nordrhein-Westfalen hinaus die Frage nach der Sicherheit archivischer Überlieferung aufgeworfen. Reichen die baulichen Standards für Archive aus? Sind die Archive fachlich und logistisch ausreichend für Notfälle gerüstet? Wie müssen Strategien zur Sicherung und zum Schutz von Archivgut durch Verfilmung und Digitalisierung aussehen? In einer Expertenanhörung, die am 24. Juni in Köln stattfand, haben Archivarinnen und Archivare, Restauratorinnen und Restauratoren sowie Vertreter der Archivträger und der historischen Forschung versucht, Antworten auf diese Fragen zu formulieren. Sie haben damit in einer ersten Bestandsaufnahme nach dem Unglück die "Lehren aus Köln" gezogen.
Zum Deutschen Archivtag in Regensburg (22.-25. September 2009) erscheint jetzt die Dokumentation zur Expertenanhörung. Sie enthält einen ausführlichen Bericht über die Referate und die Diskussionen in den Arbeitsgruppen sowie ausgewählte Vorträge im Volltext.
Die Publikation kann über das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen (Graf-Adolf-Str. 67, 40210 Düsseldorf, Mail: poststelle@lav.nrw.de) und über den Buchhandel bezogen werden.
Auf dem Deutschen Archivtag in Regensburg besteht die Möglichkeit zum Kauf der Publikation am Stand des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen (ARCHIVISTICA 2009 Regensburg Stand 40).
Lehren aus Köln. Dokumentation zur Expertenanhörung "Der Kölner Archiveinsturz und die Konsequenzen". Für das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen hg. v. Wilfried Reininghaus und Andreas Pilger. Düsseldorf 2009 (= Veröffentlichungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen 25). 96 Seiten. ISBN 978-3-9804317-0-5. Klappbroschur fadengeheftet, Verkaufspreis: 10,00 Euro.
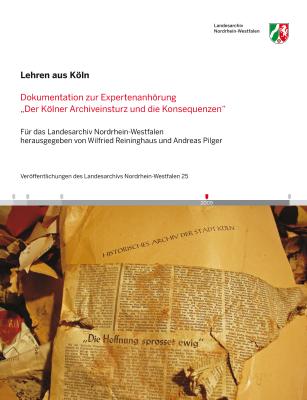
Zum Deutschen Archivtag in Regensburg (22.-25. September 2009) erscheint jetzt die Dokumentation zur Expertenanhörung. Sie enthält einen ausführlichen Bericht über die Referate und die Diskussionen in den Arbeitsgruppen sowie ausgewählte Vorträge im Volltext.
Die Publikation kann über das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen (Graf-Adolf-Str. 67, 40210 Düsseldorf, Mail: poststelle@lav.nrw.de) und über den Buchhandel bezogen werden.
Auf dem Deutschen Archivtag in Regensburg besteht die Möglichkeit zum Kauf der Publikation am Stand des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen (ARCHIVISTICA 2009 Regensburg Stand 40).
Lehren aus Köln. Dokumentation zur Expertenanhörung "Der Kölner Archiveinsturz und die Konsequenzen". Für das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen hg. v. Wilfried Reininghaus und Andreas Pilger. Düsseldorf 2009 (= Veröffentlichungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen 25). 96 Seiten. ISBN 978-3-9804317-0-5. Klappbroschur fadengeheftet, Verkaufspreis: 10,00 Euro.
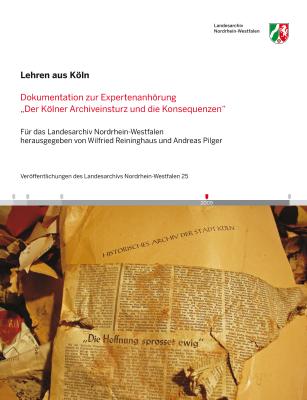
Andreas Pilger - am Dienstag, 15. September 2009, 13:46 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
RECHTLICHE ASPEKTE IM AUSSTELLUNGSBETRIEB - 3 1/2 tägiges Seminar vom 12.-15.12.2009
Das Ausstellen von Werken und Objekten kann die unterschiedlichsten rechtlichen Problemstellungen beinhalten. Durch die immer häufiger wechselnden Ausstellungen - auch auf internationaler Ebene - wird es notwendig sich rechtliche Kenntnisse anzueignen, um für alle Beteiligten zufrieden stellende Lösungen finden zu können. Das Seminar „Rechtliche Aspekte im Ausstellungsbetrieb geht auf aktuelle Rechtsprobleme im Ausstellungsbereich ein und vermittelt relevante Rechtsgrundkenntnisse. An drei Tagen geben national und international tätige JuristInnen Einblick ins Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, ins Recht der Verwertungsgesellschaften, ins Versicherungsrecht, in die Vertragsgestaltung unter anderem im Bereich des Leihverkehrs sowie der Projektfinanzierung
Ziele
Das Ziel dieses Seminars ist es, TeilnehmerInnen eine auf die juristischen Problemstellungen im Ausstellungsbetrieb bezogene Ausbildung anzubieten. Inhaltlich werden rechtswissenschaftliche Kenntnisse im Bereich des Ausstellungswesens vermittelt. Zu den Inhalten zählen die Projektfinanzierung, die Vertragsgestaltung, das Versicherungsrecht, sowie das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte, wobei auf letzteres aufgrund der hohen Relevanz ein besonderer Schwerpunkt gelegt wird.
Wir wenden uns an MitarbeiterInnen von Kulturbetrieben, die ihre Chancen im Wettbewerb vergrößern möchten und frei arbeitende Personengruppen im Bereich des Ausstellungswesens, die an einer Weiterbildung auf juristischer Ebene interessiert sind.
Eckdaten zum Seminar
Dauer: 3,5 Tage (24 Gesamtstunden)
Veranstaltungsort: Zentrum für Bildwissenschaften im Stift Göttweig (ca. 1 Fahrtstunde von Wien entfernt, gute Zuganbindungen)
Referenten
Die Referenten kommen aus der Praxis und sind international tätig. Unter anderem der bekannteste Experte des Copyrights Prof. Dr. Walter.
.....
Weitere Informationen:
www.donau-uni.ac.at/ausstellungsrecht
www.donau-uni.ac.at/dbw
www.donau-uni.ac.at/ausstellungsdesign
Leitung Seminar
Wendy Jo Coones, M.Ed.
Tel.: +43 (0)2732 893-2543
Fax: +43 (0)2732 893-4551
E-Mail: wendy.coones@donau-uni.ac.at
Information und Anmeldung
Andrea Haberson
Tel. +43 (0)2732 893-2569
Fax. +43 (0)2732 893-4551
E-Mail: andrea.haberson@donau-uni.ac.at
Das Ausstellen von Werken und Objekten kann die unterschiedlichsten rechtlichen Problemstellungen beinhalten. Durch die immer häufiger wechselnden Ausstellungen - auch auf internationaler Ebene - wird es notwendig sich rechtliche Kenntnisse anzueignen, um für alle Beteiligten zufrieden stellende Lösungen finden zu können. Das Seminar „Rechtliche Aspekte im Ausstellungsbetrieb geht auf aktuelle Rechtsprobleme im Ausstellungsbereich ein und vermittelt relevante Rechtsgrundkenntnisse. An drei Tagen geben national und international tätige JuristInnen Einblick ins Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, ins Recht der Verwertungsgesellschaften, ins Versicherungsrecht, in die Vertragsgestaltung unter anderem im Bereich des Leihverkehrs sowie der Projektfinanzierung
Ziele
Das Ziel dieses Seminars ist es, TeilnehmerInnen eine auf die juristischen Problemstellungen im Ausstellungsbetrieb bezogene Ausbildung anzubieten. Inhaltlich werden rechtswissenschaftliche Kenntnisse im Bereich des Ausstellungswesens vermittelt. Zu den Inhalten zählen die Projektfinanzierung, die Vertragsgestaltung, das Versicherungsrecht, sowie das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte, wobei auf letzteres aufgrund der hohen Relevanz ein besonderer Schwerpunkt gelegt wird.
Wir wenden uns an MitarbeiterInnen von Kulturbetrieben, die ihre Chancen im Wettbewerb vergrößern möchten und frei arbeitende Personengruppen im Bereich des Ausstellungswesens, die an einer Weiterbildung auf juristischer Ebene interessiert sind.
Eckdaten zum Seminar
Dauer: 3,5 Tage (24 Gesamtstunden)
Veranstaltungsort: Zentrum für Bildwissenschaften im Stift Göttweig (ca. 1 Fahrtstunde von Wien entfernt, gute Zuganbindungen)
Referenten
Die Referenten kommen aus der Praxis und sind international tätig. Unter anderem der bekannteste Experte des Copyrights Prof. Dr. Walter.
.....
Weitere Informationen:
www.donau-uni.ac.at/ausstellungsrecht
www.donau-uni.ac.at/dbw
www.donau-uni.ac.at/ausstellungsdesign
Leitung Seminar
Wendy Jo Coones, M.Ed.
Tel.: +43 (0)2732 893-2543
Fax: +43 (0)2732 893-4551
E-Mail: wendy.coones@donau-uni.ac.at
Information und Anmeldung
Andrea Haberson
Tel. +43 (0)2732 893-2569
Fax. +43 (0)2732 893-4551
E-Mail: andrea.haberson@donau-uni.ac.at
Wolf Thomas - am Dienstag, 15. September 2009, 08:51 - Rubrik: Archivrecht
http://www.boersenblatt.net/339077/
„Der Staat missbraucht diese Steuergelder, wenn er eine Monopolbildung unterstützt, indem er einer kommerziellen Suchmaschine das exklusive Recht gibt, gemeinfreie Bücher aus dem Bestand der Bibliotheken im Internet zugänglich zu machen“
Wo bitteschön wurde Google ein solches exklusives Recht übertragen? Oder wer hat derlei gefordert? Noch nicht einmal Google selbst, bin ich überzeugt. Der Vertrag mit der BSB ist zwar geheim, aber eine Exklusivvereinbarung wäre offenkundig rechtswidrig. In den USA sind einige Bibliotheken sowohl Google-Partner als auch Partner der "Open Content Alliance" - für beide Projekte wird also gescannt.
Wieder ein ausgezeichnetes Beispiel für die ideologische und jedes Niveau unterschreitende Argumentation des Börsenvereins!
„Der Staat missbraucht diese Steuergelder, wenn er eine Monopolbildung unterstützt, indem er einer kommerziellen Suchmaschine das exklusive Recht gibt, gemeinfreie Bücher aus dem Bestand der Bibliotheken im Internet zugänglich zu machen“
Wo bitteschön wurde Google ein solches exklusives Recht übertragen? Oder wer hat derlei gefordert? Noch nicht einmal Google selbst, bin ich überzeugt. Der Vertrag mit der BSB ist zwar geheim, aber eine Exklusivvereinbarung wäre offenkundig rechtswidrig. In den USA sind einige Bibliotheken sowohl Google-Partner als auch Partner der "Open Content Alliance" - für beide Projekte wird also gescannt.
Wieder ein ausgezeichnetes Beispiel für die ideologische und jedes Niveau unterschreitende Argumentation des Börsenvereins!
KlausGraf - am Montag, 14. September 2009, 23:55
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen