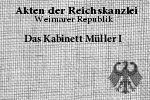Homepage: http://www.igm-bosch.de/f3.htm
Wolf Thomas - am Mittwoch, 12. Dezember 2007, 23:19 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
rint Collection of Göttweig Monastery Brought Online: http://www.gssg.at
The print collection of Göttweig Monastery is Austria’s largest
private collection of historical graphic art. The digitization of the
collection is a project developed by the Department of Image Science at
Danube University under the direction of Prof. Dr. Oliver Grau and
conducted in cooperation with the Göttweig Monastery. On November 7,
2008, the state-of-the-art, entirely web-based database was made
accessible to the public, and the first segment is now available at
www.gssg.at
The collection of prints at Göttweig Monastery, which itself was
founded in 1083, is based on acquisitions made by various monks since
the 15th century. The first report of graphic art kept in the monastery
dates back to 1621, with an archive record that mentions a number of
“tablets of copper engraving” (“Täfelein von Kupferstich”).
The actual act of founding the collection is attributed to Abbot
Gottfried Bessel whose systematic purchases in Austria and from abroad
added a total of 20,000 pieces to the collection. Reaching to the
present day, the print collection at Göttweig Monastery has grown to be
the largest private collection of historical graphic art in Austria with
more than 30,000 examples.
The curator and Benedictine monk, Prof. Dr. Martin Lechner continues to
expand the collection with additions of historical prints. In summer
2002, the collection was made available to the Department of Image
Science at Danube University for research and study purposes.
Simultaneously, the digitization project was launched which culminated
in the opening of the online database. This latest supplement to the
department’s online content and services offers a representative
selection of the collection’s examples, showcasing a variety of
craftsmen, genres and techniques and thus opening up new research
opportunities. For academic purposes, all of the database’s assets may
be used free of charge and are also employed in the department’s
teaching. A fee is requested only for commercial uses of high-resolution
images as well as for reproduction licenses.
The Department of Image Science’s digitization center at the Göttweig
Monastery uses the latest technology to scan paintings and prints from
the collection (up to 72 million pixels). Newly digitized material is
continually added to the database, which can be searched using an
innovative interface, and search results can be forwarded directly to
researchers via email. Past exhibitions of the Monastery’s print
collection are gradually integrated into the database and can be
accessed as a virtual exhibition online. The first exhibition “Under
Your Shelter” was dedicated to representations of the Virgin Mary from
the Monastery’s collection.
VIRTUAL EXHIBITION
“Under Your Shelter - The Image of Mary in Göttweig” was curated by
Prof. Dr. Martin Lechner and Mag. Michael Grünwald. It offers a
comprehensive view of the history and background of the worship and
adoration of the Virgin Mary. In four chapters, the exhibition
introduces the visitor to the tradition of images of Marian Grace and
its typology, drawing on numerous examples from Austria, Bavaria and
other countries formerly belonging to the Austrian empire. The genre
“Marian life” is explained and illustrated by both single prints
and print series. Finally, the close relationship between Mary and the
saints of various convents is elaborated and explored.
Further inquiries:
Univ.-Prof. Dr. Oliver Grau (project director)
Head of the Department for Image Science
Danube University
Dr.-Karl-Dorrek-Strasse 30
3500 Krems, AUSTRIA
oliver.grau@donau-uni.ac.at
www.donau-uni.ac.at/dbw
Mag. Christian Berndt (project coordinator)
Department for Image Science
Graphik.Online@donau-uni.ac.at
------------------------------------------------------------------------------
Graphische Sammlung von Stift Göttweig ist online : www.gssg.at
Die Graphische Sammlung im Stift Göttweig ist Österreichs größte
Privatsammlung historischer Graphiken. Die digitale Erschließung der
Graphischen Sammlung ist ein Projekt des Departments für
Bildwissenschaft der Donau-Universität in Kooperation mit dem
Benediktinerstift Göttweig unter der Leitung von Prof. Dr. Oliver Grau.
Seit dieser Woche ist ein erster Abschnitt über ein modernes,
vollstaendig webbasiertes Datenbanksystem der Öffentlichkeit frei
zugaenglich: www.gssg.at
Der Bestand der Graphischen Sammlung des 1083 gegründeten
Benediktinerstifts basiert auf Erwerbungen durch verschiedene
Konventsmitglieder seit dem 15. Jahrhundert. Erstmalige Nachricht von
Graphiken im Stift Göttweig gibt eine Archivaufzeichnung aus dem Jahr
1612, die von einigen „Täfelein von Kupferstich“ berichtet. Als
eigentlicher Gründer der Sammlung gilt Abt Gottfried Bessel, der durch
gezielte Ankäufe im In- und Ausland den damaligen Bestand um über 20.000
Blätter erweiterte. Mittlerweile ist die Graphische Sammlung Göttweig
mit über 30.000 Blättern zur größten Privatsammlung historischer
Druckgraphiken in Österreich angewachsen.
Durch den Kustos Prof. Dr. Martin Lechner wird die Sammlung nach wie
vor um historische Blätter und ausgewählte moderne Druckgraphik ergänzt.
Die Bestände wurden im Sommer 2002 dem Department für Bildwissenschaften
der Donau-Universität Krems zur Bearbeitung, Erschließung und für
Studienzwecke zur Verfügung gestellt.
Das neue Internetangebot des Departments für Bildwissenschaften macht
ausgewählte, repräsentative Blätter unterschiedlicher Stecher, Genres
und graphischer Techniken aus der Graphischen Sammlung verfügbar und
eröffnet damit auch neue Forschungsperspektiven. Der Gesamtbestand steht
für wissenschaftliche Zwecke unentgeltlich zur Verfügung und wird auch
im Studienbetrieb der Donau-Universität genutzt. Eine kommerzielle
Verwertung von hoch auflösendem Bildmaterial und Abdrucklizenzen ist
gebührenpflichtig.
Im DIGITALISIERUNGS-CENTER des Departments für Bildwissenschaften
wurden die Gemälde und Graphiken der Sammlung mit neuer Technik in sehr
hoch aufgelöster Form (bis zu 72 Millionen Pixel) eingescannt. Die
Bestände, die in regelmäßigen Intervallen um frisch erschlossenes
Material ergänzt werden, können über ein neu entwickeltes Suchinterface
recherchiert und per Mail in Forschergruppen kommuniziert werden.
Zusätzlich werden vergangene Ausstellungen der Graphischen Sammlung
als virtuelle Ausstellungen online zugänglich. Aktuell ist die
Ausstellung „Unter deinen Schutz - Das Marienbild in Göttweig“ online
zu besuchen.
VIRTUELLE AUSSTELLUNG
"Unter deinen Schutz - Das Marienbild in Göttweig", kuratiert von Prof.
Dr. Martin Lechner und Mag. Michael Grünwald präsentiert in umfassender
Weise die Geschichte und Hintergründe kirchlicher Marienverehrung. In 4
Kapiteln wird die Tradition marianischer Gnadenbilder anhand zahlreicher
Beispiele aus Österreich, Bayern und den ehemaligen Kronländern
geschildert, die vielfältige Welt der unterschiedlichen Marienbildtypen
vor Augen geführt, der Bildtypus "Marienleben" mit verschiedenen
Stichserien und in Einzelblättern vorgestellt und schließlich die enge
Beziehung zwischen Maria und den Ordensheiligen untersucht.
Rückfragen:
Univ.-Prof. Dr. Oliver Grau (Projektleitung)
Lehrstuhl für Bildwissenschaften
DONAU-UNIVERSITÄT
Dr.-Karl-Dorrek-Strasse 30
3500 Krems, AUSTRIA
oliver.grau@donau-uni.ac.at
www.donau-uni.ac.at/dbw
Mag. Christian Berndt
Projektkoordinator
Department für Bildwissenschaften
christian.berndt@donau-uni.ac.at
Aus der Archivliste

The print collection of Göttweig Monastery is Austria’s largest
private collection of historical graphic art. The digitization of the
collection is a project developed by the Department of Image Science at
Danube University under the direction of Prof. Dr. Oliver Grau and
conducted in cooperation with the Göttweig Monastery. On November 7,
2008, the state-of-the-art, entirely web-based database was made
accessible to the public, and the first segment is now available at
www.gssg.at
The collection of prints at Göttweig Monastery, which itself was
founded in 1083, is based on acquisitions made by various monks since
the 15th century. The first report of graphic art kept in the monastery
dates back to 1621, with an archive record that mentions a number of
“tablets of copper engraving” (“Täfelein von Kupferstich”).
The actual act of founding the collection is attributed to Abbot
Gottfried Bessel whose systematic purchases in Austria and from abroad
added a total of 20,000 pieces to the collection. Reaching to the
present day, the print collection at Göttweig Monastery has grown to be
the largest private collection of historical graphic art in Austria with
more than 30,000 examples.
The curator and Benedictine monk, Prof. Dr. Martin Lechner continues to
expand the collection with additions of historical prints. In summer
2002, the collection was made available to the Department of Image
Science at Danube University for research and study purposes.
Simultaneously, the digitization project was launched which culminated
in the opening of the online database. This latest supplement to the
department’s online content and services offers a representative
selection of the collection’s examples, showcasing a variety of
craftsmen, genres and techniques and thus opening up new research
opportunities. For academic purposes, all of the database’s assets may
be used free of charge and are also employed in the department’s
teaching. A fee is requested only for commercial uses of high-resolution
images as well as for reproduction licenses.
The Department of Image Science’s digitization center at the Göttweig
Monastery uses the latest technology to scan paintings and prints from
the collection (up to 72 million pixels). Newly digitized material is
continually added to the database, which can be searched using an
innovative interface, and search results can be forwarded directly to
researchers via email. Past exhibitions of the Monastery’s print
collection are gradually integrated into the database and can be
accessed as a virtual exhibition online. The first exhibition “Under
Your Shelter” was dedicated to representations of the Virgin Mary from
the Monastery’s collection.
VIRTUAL EXHIBITION
“Under Your Shelter - The Image of Mary in Göttweig” was curated by
Prof. Dr. Martin Lechner and Mag. Michael Grünwald. It offers a
comprehensive view of the history and background of the worship and
adoration of the Virgin Mary. In four chapters, the exhibition
introduces the visitor to the tradition of images of Marian Grace and
its typology, drawing on numerous examples from Austria, Bavaria and
other countries formerly belonging to the Austrian empire. The genre
“Marian life” is explained and illustrated by both single prints
and print series. Finally, the close relationship between Mary and the
saints of various convents is elaborated and explored.
Further inquiries:
Univ.-Prof. Dr. Oliver Grau (project director)
Head of the Department for Image Science
Danube University
Dr.-Karl-Dorrek-Strasse 30
3500 Krems, AUSTRIA
oliver.grau@donau-uni.ac.at
www.donau-uni.ac.at/dbw
Mag. Christian Berndt (project coordinator)
Department for Image Science
Graphik.Online@donau-uni.ac.at
------------------------------------------------------------------------------
Graphische Sammlung von Stift Göttweig ist online : www.gssg.at
Die Graphische Sammlung im Stift Göttweig ist Österreichs größte
Privatsammlung historischer Graphiken. Die digitale Erschließung der
Graphischen Sammlung ist ein Projekt des Departments für
Bildwissenschaft der Donau-Universität in Kooperation mit dem
Benediktinerstift Göttweig unter der Leitung von Prof. Dr. Oliver Grau.
Seit dieser Woche ist ein erster Abschnitt über ein modernes,
vollstaendig webbasiertes Datenbanksystem der Öffentlichkeit frei
zugaenglich: www.gssg.at
Der Bestand der Graphischen Sammlung des 1083 gegründeten
Benediktinerstifts basiert auf Erwerbungen durch verschiedene
Konventsmitglieder seit dem 15. Jahrhundert. Erstmalige Nachricht von
Graphiken im Stift Göttweig gibt eine Archivaufzeichnung aus dem Jahr
1612, die von einigen „Täfelein von Kupferstich“ berichtet. Als
eigentlicher Gründer der Sammlung gilt Abt Gottfried Bessel, der durch
gezielte Ankäufe im In- und Ausland den damaligen Bestand um über 20.000
Blätter erweiterte. Mittlerweile ist die Graphische Sammlung Göttweig
mit über 30.000 Blättern zur größten Privatsammlung historischer
Druckgraphiken in Österreich angewachsen.
Durch den Kustos Prof. Dr. Martin Lechner wird die Sammlung nach wie
vor um historische Blätter und ausgewählte moderne Druckgraphik ergänzt.
Die Bestände wurden im Sommer 2002 dem Department für Bildwissenschaften
der Donau-Universität Krems zur Bearbeitung, Erschließung und für
Studienzwecke zur Verfügung gestellt.
Das neue Internetangebot des Departments für Bildwissenschaften macht
ausgewählte, repräsentative Blätter unterschiedlicher Stecher, Genres
und graphischer Techniken aus der Graphischen Sammlung verfügbar und
eröffnet damit auch neue Forschungsperspektiven. Der Gesamtbestand steht
für wissenschaftliche Zwecke unentgeltlich zur Verfügung und wird auch
im Studienbetrieb der Donau-Universität genutzt. Eine kommerzielle
Verwertung von hoch auflösendem Bildmaterial und Abdrucklizenzen ist
gebührenpflichtig.
Im DIGITALISIERUNGS-CENTER des Departments für Bildwissenschaften
wurden die Gemälde und Graphiken der Sammlung mit neuer Technik in sehr
hoch aufgelöster Form (bis zu 72 Millionen Pixel) eingescannt. Die
Bestände, die in regelmäßigen Intervallen um frisch erschlossenes
Material ergänzt werden, können über ein neu entwickeltes Suchinterface
recherchiert und per Mail in Forschergruppen kommuniziert werden.
Zusätzlich werden vergangene Ausstellungen der Graphischen Sammlung
als virtuelle Ausstellungen online zugänglich. Aktuell ist die
Ausstellung „Unter deinen Schutz - Das Marienbild in Göttweig“ online
zu besuchen.
VIRTUELLE AUSSTELLUNG
"Unter deinen Schutz - Das Marienbild in Göttweig", kuratiert von Prof.
Dr. Martin Lechner und Mag. Michael Grünwald präsentiert in umfassender
Weise die Geschichte und Hintergründe kirchlicher Marienverehrung. In 4
Kapiteln wird die Tradition marianischer Gnadenbilder anhand zahlreicher
Beispiele aus Österreich, Bayern und den ehemaligen Kronländern
geschildert, die vielfältige Welt der unterschiedlichen Marienbildtypen
vor Augen geführt, der Bildtypus "Marienleben" mit verschiedenen
Stichserien und in Einzelblättern vorgestellt und schließlich die enge
Beziehung zwischen Maria und den Ordensheiligen untersucht.
Rückfragen:
Univ.-Prof. Dr. Oliver Grau (Projektleitung)
Lehrstuhl für Bildwissenschaften
DONAU-UNIVERSITÄT
Dr.-Karl-Dorrek-Strasse 30
3500 Krems, AUSTRIA
oliver.grau@donau-uni.ac.at
www.donau-uni.ac.at/dbw
Mag. Christian Berndt
Projektkoordinator
Department für Bildwissenschaften
christian.berndt@donau-uni.ac.at
Aus der Archivliste

KlausGraf - am Mittwoch, 12. Dezember 2007, 22:18 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Gerade mit dem Auftauchen der Aktionskunst in den 1950er Jahren wären zahlreiche Performances oder Veranstaltungen bildender Künstler heute völlig vergessen, hätten sie nicht Fotografen festgehalten. Daher wurde 2003 das „Archiv künstlerischer Fotografie der Rheinischen Kunstszene (AFORK) .....“
Quelle: http://www.kunstmarkt.com/pagesmag/kunst/_id139607-/news_detail.html
Siehe auch:
http://www.museum-kunst-palast.de/doc98A
Quelle: http://www.kunstmarkt.com/pagesmag/kunst/_id139607-/news_detail.html
Siehe auch:
http://www.museum-kunst-palast.de/doc98A
Wolf Thomas - am Mittwoch, 12. Dezember 2007, 12:09 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Für Oberbürgermeisterin der Stadt Halle/Saale, Dagmar Szabados, auf alle Fälle. "Weine sind doch flüssige Urkunden", so das Stadtoberhaupt zum Aufbau eines Weinarchivs. Prost an Kolleginnen und Kollegen !
Die ganze Geschichte unter:
http://halleforum.de/article.php?sid=11245
Die ganze Geschichte unter:
http://halleforum.de/article.php?sid=11245
Wolf Thomas - am Mittwoch, 12. Dezember 2007, 12:07 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Becks unrasierter Punk baut das Musik-Archiv des Frankfurter TV-Sender iMusicTV auf.
Quelle FR:
Link
Quelle FR:
Link
Wolf Thomas - am Mittwoch, 12. Dezember 2007, 12:05 - Rubrik: Personalia
KlausGraf - am Mittwoch, 12. Dezember 2007, 02:48 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 12. Dezember 2007, 02:46 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 12. Dezember 2007, 02:42 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Erfahrene Wikipedia-Autoren zeigten Schülern und Lehrern dieses Jahr an drei Gymnasien, wie ein Wikipedia-Artikel entsteht, was das Nachschlagewerk von klassischen Enzyklopädien unterscheidet und was allgemein bei der Recherche in Online-Medien zu beachten ist. “Unsere finanzielle Situation erlaubt eine Fortführung dieses wichtigen Projektes derzeit leider nicht”, stellt Frank Schulenburg fest und hofft auf potente Partner für dieses Vorhaben.
http://www.wikimedia.de/2007/12/gemischte-zwischenbilanz/
Hallo? Begreift das jemand? Dass man ein solches Projekt bei etwas gutem Willen auch ohne irgendwelche Gelder organisieren könnte, davon bin ich felsenfest überzeugt. Dass erfahrene Wikipedianer aus Garmisch nach Flensburg auf Kosten des Vereins gekarrt werden, ist ja wohl auch ökologisch nicht sinnvoll. Werden die erfahrenen Wikipedianer für die Selbstverständlichkeit üppig bezahlt oder muss Schmiergeld für den Hausmeister der Schule berappt werden?
Dutzende Archive unterhalten archivpädagogische Projekte, ohne dass dafür riesige Summen zur Verfügung stehen. Die Archivare bekommen für ihr Engagement keinen Cent.
http://www.wikimedia.de/2007/12/gemischte-zwischenbilanz/
Hallo? Begreift das jemand? Dass man ein solches Projekt bei etwas gutem Willen auch ohne irgendwelche Gelder organisieren könnte, davon bin ich felsenfest überzeugt. Dass erfahrene Wikipedianer aus Garmisch nach Flensburg auf Kosten des Vereins gekarrt werden, ist ja wohl auch ökologisch nicht sinnvoll. Werden die erfahrenen Wikipedianer für die Selbstverständlichkeit üppig bezahlt oder muss Schmiergeld für den Hausmeister der Schule berappt werden?
Dutzende Archive unterhalten archivpädagogische Projekte, ohne dass dafür riesige Summen zur Verfügung stehen. Die Archivare bekommen für ihr Engagement keinen Cent.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wir haben eine Schatzkammer – einen Schatz – an Literatur, der bis zu den Ägyptern, den Griechen, den Römern zurückreicht. Er steht zur Verfügung, dieser Reichtum der Literatur, und jeder, der das Glück hat, auf ihn zu stoßen, kann ihn immer wieder neu entdecken. Einen Schatz. Angenommen, es gäbe ihn nicht. Wie verarmt wir wären, wie leer.
Wir besitzen ein Erbe an Sprachen, Gedichten, Geschichtsschreibung, das unerschöpflich ist. Es ist da, immer.
Wir haben ein Vermächtnis an Geschichten, Erzählungen der alten Geschichtenerzähler, deren Namen wir manchmal kennen und manchmal nicht. Geschichtenerzähler hat es immer gegeben, das reicht zurück bis hin zu einer Lichtung im Wald, auf der ein großes Feuer brennt und die alten Schamanen tanzen und singen, denn was wir an Geschichten ererbt haben, begann mit Feuer, mit Zauber, der Geisterwelt. Und dort wird es noch heute bewahrt.
Wenn man einen modernen Geschichtenerzähler fragt, wird er sagen, dass es immer einen Moment gibt, in dem ihn das Feuer berührt, das, was wir gerne als Inspiration bezeichnen, und das reicht bis zu den Anfängen unserer Spezies zurück, Feuer, Eis und die großen Winde, die uns und unsere Welt geformt haben.
Der Geschichtenerzähler ist tief in uns allen. Der Geschichten-Macher ist immer da. Nehmen wir an, dass ein Krieg über unsere Welt hereinbricht, jene Schrecken, die wir uns alle ohne Weiteres vorstellen können. Nehmen wir an, dass Fluten unsere Städte überspülen, dass die Meere ansteigen … der Geschichtenerzähler wird da sein, denn es ist unsere Vorstellungskraft, die uns formt, erhält, erschafft – im Guten wie im Schlechten. Es sind unsere Geschichten, es ist der Geschichtenerzähler, der uns wiedererschafft, wenn wir zerrissen, verwundet, ja vernichtet sind. Es ist der Geschichtenerzähler, der Träume-Macher, der Mythen-Macher, der unser Phönix ist, das sind wir, wenn wir am besten, will heißen am schöpferischsten sind.
Der ganze Text lohnt sich:
http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2007/lessing-lecture_ty.html
Wir besitzen ein Erbe an Sprachen, Gedichten, Geschichtsschreibung, das unerschöpflich ist. Es ist da, immer.
Wir haben ein Vermächtnis an Geschichten, Erzählungen der alten Geschichtenerzähler, deren Namen wir manchmal kennen und manchmal nicht. Geschichtenerzähler hat es immer gegeben, das reicht zurück bis hin zu einer Lichtung im Wald, auf der ein großes Feuer brennt und die alten Schamanen tanzen und singen, denn was wir an Geschichten ererbt haben, begann mit Feuer, mit Zauber, der Geisterwelt. Und dort wird es noch heute bewahrt.
Wenn man einen modernen Geschichtenerzähler fragt, wird er sagen, dass es immer einen Moment gibt, in dem ihn das Feuer berührt, das, was wir gerne als Inspiration bezeichnen, und das reicht bis zu den Anfängen unserer Spezies zurück, Feuer, Eis und die großen Winde, die uns und unsere Welt geformt haben.
Der Geschichtenerzähler ist tief in uns allen. Der Geschichten-Macher ist immer da. Nehmen wir an, dass ein Krieg über unsere Welt hereinbricht, jene Schrecken, die wir uns alle ohne Weiteres vorstellen können. Nehmen wir an, dass Fluten unsere Städte überspülen, dass die Meere ansteigen … der Geschichtenerzähler wird da sein, denn es ist unsere Vorstellungskraft, die uns formt, erhält, erschafft – im Guten wie im Schlechten. Es sind unsere Geschichten, es ist der Geschichtenerzähler, der uns wiedererschafft, wenn wir zerrissen, verwundet, ja vernichtet sind. Es ist der Geschichtenerzähler, der Träume-Macher, der Mythen-Macher, der unser Phönix ist, das sind wir, wenn wir am besten, will heißen am schöpferischsten sind.
Der ganze Text lohnt sich:
http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2007/lessing-lecture_ty.html
KlausGraf - am Dienstag, 11. Dezember 2007, 16:49 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.ub.uni-bielefeld.de/aktuell/aktuell_main.htm#urheberrecht
Dirk Pieper schrieb mir freundlicherweise:
Auf Initiative der UB und unter Beteiligung der entsprechenden Uni-Gremien
hat unser Prorektor für Forschung und Lehre alle Professorinnen und
Professoren sowie wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am
15.11.2007 per Brief gebeten (der Text auf der UB-WWW-Seite ist eine
gekürzte Fassung), der UB das einfache oder ausschließliche Recht für die
elektronische Nutzung der vor 1995 erschienenen Publikationen zu
übertragen. Der Rücklauf ist inzwischen so gewaltig, dass wir für das
Beschaffen, Scannen und Einstellen der Dokumente im nächsten Jahr
wahrscheinlich zusätzliche Hilfskräfte einstellen müssen.
Dirk Pieper schrieb mir freundlicherweise:
Auf Initiative der UB und unter Beteiligung der entsprechenden Uni-Gremien
hat unser Prorektor für Forschung und Lehre alle Professorinnen und
Professoren sowie wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am
15.11.2007 per Brief gebeten (der Text auf der UB-WWW-Seite ist eine
gekürzte Fassung), der UB das einfache oder ausschließliche Recht für die
elektronische Nutzung der vor 1995 erschienenen Publikationen zu
übertragen. Der Rücklauf ist inzwischen so gewaltig, dass wir für das
Beschaffen, Scannen und Einstellen der Dokumente im nächsten Jahr
wahrscheinlich zusätzliche Hilfskräfte einstellen müssen.
KlausGraf - am Dienstag, 11. Dezember 2007, 16:27 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ausstellungsreihe „TransAktion“ zeigt im ersten Halbjahr 2008 in Chemnitz Installationen - eben auch das "wandernde Archiv".
Quelle:
http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/REGIONALES/CHEMNITZ/1139594.html
Quelle:
http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/REGIONALES/CHEMNITZ/1139594.html
Wolf Thomas - am Dienstag, 11. Dezember 2007, 15:32 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Über den Vorgang informiert das Liechtensteiner Volksblatt.
http://www.volksblatt.li/Default.aspx?newsid=10849&src=vb
s.a.:
http://www.suedostschweiz.ch/medien/sogr/index_detail.cfm?id=445263
Nachtrag 12.12.2007:
http://www.vaterland.li/page/lv/artikel_detail.cfm?id=27372
http://www.shn.ch/index.html?http://www.shn.ch/pages/artikel.cfm?id=202483
http://www.kreuz.net/article.6340.html
http://www.baz.ch/news/index.cfm?ObjectID=C9B99E60-1422-0CEF-70E018213841273F
Nachtrag 14.12.2007:
http://www.kath.net/detail.php?id=18483
Nachtrag 15.12.2007:
http://www.oecumene.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=174102
http://www.kreuz.net/article.6362.html
http://www.volksblatt.li/Default.aspx?newsid=10849&src=vb
s.a.:
http://www.suedostschweiz.ch/medien/sogr/index_detail.cfm?id=445263
Nachtrag 12.12.2007:
http://www.vaterland.li/page/lv/artikel_detail.cfm?id=27372
http://www.shn.ch/index.html?http://www.shn.ch/pages/artikel.cfm?id=202483
http://www.kreuz.net/article.6340.html
http://www.baz.ch/news/index.cfm?ObjectID=C9B99E60-1422-0CEF-70E018213841273F
Nachtrag 14.12.2007:
http://www.kath.net/detail.php?id=18483
Nachtrag 15.12.2007:
http://www.oecumene.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=174102
http://www.kreuz.net/article.6362.html
Wolf Thomas - am Dienstag, 11. Dezember 2007, 15:31 - Rubrik: Kirchenarchive
http://www.franconica-online.de/
Unter den neuen Projekten ist auch eine Präsentation von Papsturkunden von St. Stephan in Würzburg, die mit Edition und Abbildung präsentiert werden. Die Videoclips sind eine hübsche Zugabe, freilich hätte man sich gewünscht, dass die Ansicht der Originale benutzerfreundlich und in genügender Auflösung geboten würde. Es ist ohne weiteres möglich, auch ohne technischen Schnickschnack eine brauchbare Ansicht zu realisieren.
Beim "Rundbuch" hat soeben mit FF überhaupt nichts funktioniert, über die Startseite war nicht hinauszukommen!

Unter den neuen Projekten ist auch eine Präsentation von Papsturkunden von St. Stephan in Würzburg, die mit Edition und Abbildung präsentiert werden. Die Videoclips sind eine hübsche Zugabe, freilich hätte man sich gewünscht, dass die Ansicht der Originale benutzerfreundlich und in genügender Auflösung geboten würde. Es ist ohne weiteres möglich, auch ohne technischen Schnickschnack eine brauchbare Ansicht zu realisieren.
Beim "Rundbuch" hat soeben mit FF überhaupt nichts funktioniert, über die Startseite war nicht hinauszukommen!

KlausGraf - am Dienstag, 11. Dezember 2007, 13:57 - Rubrik: Hilfswissenschaften
Auf http://www.open-access.net gibt es dazu nun auch so etwas wie eine FAQ. Unsere Übersicht zu Aktivitäten einzelner Bibliotheken/Universitäten wurde aktualisiert (ist aber sicher nicht vollständig):
http://archiv.twoday.net/stories/4474892/
http://archiv.twoday.net/stories/4474892/
KlausGraf - am Dienstag, 11. Dezember 2007, 10:42 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/newsticker/meldung/100338
Ihre kompletten rechtsgültigen Bebauungspläne für das gesamte Stadtgebiet und alle Satzungen, die den Städtebau in der Main-Metropole betreffen, veröffentlicht die Stadt Frankfurt am Main seit dem heutigen Montag im Rahmen des Auskunftssystems "planAS" im Internet.
Ihre kompletten rechtsgültigen Bebauungspläne für das gesamte Stadtgebiet und alle Satzungen, die den Städtebau in der Main-Metropole betreffen, veröffentlicht die Stadt Frankfurt am Main seit dem heutigen Montag im Rahmen des Auskunftssystems "planAS" im Internet.
KlausGraf - am Dienstag, 11. Dezember 2007, 00:39 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Fast zu schön, um wahr zu sein, die "Toten Hosen", Düsseldorfer Punk-Band, gehen in ihr Archiv. Tote Hose zu Toter Hose.
Quellen:
http://www.spiegel.de/kultur/musik/0,1518,522268,00.html
express.de
Nachtrag 07.01.2008:
" .....Ist euer Archiv nun restlos geplündert?
Campino: Was nicht veröffentlicht wurde, lohnt sich auch nicht. ....."
Quelle: http://www.pz-news.de/kultur/sonstige/98688/
Quellen:
http://www.spiegel.de/kultur/musik/0,1518,522268,00.html
express.de
Nachtrag 07.01.2008:
" .....Ist euer Archiv nun restlos geplündert?
Campino: Was nicht veröffentlicht wurde, lohnt sich auch nicht. ....."
Quelle: http://www.pz-news.de/kultur/sonstige/98688/
Wolf Thomas - am Montag, 10. Dezember 2007, 19:44 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
s. http://www.merkur-online.de/politik/art8808,868056
s. dazu a.
http://archiv.twoday.net/stories/4313839/
http://archiv.twoday.net/stories/4313851/
http://archiv.twoday.net/stories/4230240/
http://archiv.twoday.net/stories/4269423/
http://archiv.twoday.net/stories/4187451/
http://archiv.twoday.net/stories/4159979/
http://archiv.twoday.net/stories/2968952/
http://archiv.twoday.net/stories/477280/
http://archiv.twoday.net/stories/436205/
http://archiv.twoday.net/stories/428630/
s. dazu a.
http://archiv.twoday.net/stories/4313839/
http://archiv.twoday.net/stories/4313851/
http://archiv.twoday.net/stories/4230240/
http://archiv.twoday.net/stories/4269423/
http://archiv.twoday.net/stories/4187451/
http://archiv.twoday.net/stories/4159979/
http://archiv.twoday.net/stories/2968952/
http://archiv.twoday.net/stories/477280/
http://archiv.twoday.net/stories/436205/
http://archiv.twoday.net/stories/428630/
Wolf Thomas - am Montag, 10. Dezember 2007, 19:16 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 10. Dezember 2007, 18:47 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 10. Dezember 2007, 17:23 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 10. Dezember 2007, 17:15 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.kanzlei-prof-schweizer.de/bibliothek/urteile/index.html?id=13807
OBERLANDESGERICHT MÜNCHEN Aktenzeichen: 29 W 2325/07
Auszug:
a) Das Schreiben vom 16. Juli 2007 genießt keinen urheberrechtlichen Schutz.
aa) Auch Anwaltsschriftsätze sind als Schriftwerke grundsätzlich nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG dem Urheberrechtsschutz zugänglich. Sie sind grundsätzlich dem (rechts-) wissenschaftlichen und nicht dem literarischen Bereich zuzuordnen. Bei wissenschaftlichen Werken findet der erforderliche geistig-schöpferische Gehalt seinen Niederschlag und Ausdruck in erster Linie in der Form und Art der Sammlung, Einteilung und Anordnung des dargebotenen Stoffes und nicht ohne weiteres auch - wie meist bei literarischen Werken - in der Gedankenformung und -führung des dargebotenen Inhalts. Die Frage, ob ein Schriftwerk einen hinreichenden schöpferischen Eigentümlichkeitsgrad besitzt, bemisst sich dabei nach dem geistig-schöpferischen Gesamteindruck der konkreten Gestaltung, und zwar im Gesamtvergleich gegenüber vorbestehenden Gestaltungen. Lassen sich nach Maßgabe des Gesamtvergleichs mit dem Vorbekannten schöpferische Eigenheiten feststellen, so sind diese der durchschnittlichen Gestaltertätigkeit gegenüberzustellen. Die Urheberrechtsschutzfähigkeit erfordert ein deutliches Überragen des
Alltäglichen, des Handwerksmäßigen, der mechanisch-technischen Aneinanderreihung des Materials (vgl. BGH GRUR 1986, 739 [740] - Anwaltsschriftsatz m. w. N .).
bb) Das Schreiben vom 16. Juli 2007 ist als anwaltliche Stellungnahme für einen Mandanten unabhängig davon als Anwaltsschriftsatz anzusehen, dass es nicht an ein Gericht oder eine Behörde gerichtet ist. Zu Recht ist das Landgericht allerdings im Ergebnis davon ausgegangen, dass diesem Schreiben die für die urheberrechtliche Schutzfähigkeit erforderlichen deutlich überragenden Elemente im Sinne der Rechtssprechung des Bundesgerichtshofs nicht zukommen.
Der Antragsteller trägt selbst vor, welche Anforderungen an ein Schreiben der streitgegenständlichen Art sich aus dessen Funktion zwangsläufig ergeben. Enthielte ein presserechtliches Warnschreiben nicht eine Herausarbeitung der wesentlichen Elemente des presserechtlich relevanten Sachverhalts, Hinweise auf Verstöße gegen publizistische Grundsätze oder sonstige Rechtsvorschriften und einen Hinweis auf die Folgen neuer Verstöße, so könnte es seine Funktion nicht - vollständig - erfüllen und wäre handwerklich misslungen. Die Einhaltung dieser Anforderungen stellt daher für sich genommen keinen Umstand dar, der ein deutliches Überragen des Handwerklichen begründen könnte. Keinesfalls kommt es darauf an, dass die Kategorie des presserechtlichen Warnschreibens nicht alltäglich sein mag. Dieser Umstand kann nicht die Annahme einer schöpferischen Leistung hinsichtlich jedes einzelnen in diese Kategorie fallenden Textes begründen; vielmehr müsste das streitgegenständliche Schreiben im Gesamtvergleich mit vorbestehenden Schreiben eben dieser Art gestalterisch deutlich überragend anzusehen sein. Derartige Eigenheiten des Schreibens, die eine schöpferische Leistung darstellen könnten (vgl. dazu OLG Düsseldorf NJW 1989, 1162 f.), sind weder vom Antragsteller vorgetragen noch sonst ersichtlich.
Anmerkung:
Im Ergebnis ist der Entscheidung zuzustimmen. Für die Schreiben von Anwälten gilt der Schutz der "kleinen Münze" nicht, da sie dem Bereich Wissenschaft zugeordnet werden. Für eine nicht-wissenschaftlichen Schriftwerke sind die Hürden niedriger, was fragwürdig erscheint.
Blicken wir kurz zurück in die Amtliche Begründung des UrhG:
Als "persönliche geistige Schöpfungen" sind Erzeugnisse anzusehen, die durch ihren Inhalt oder, durch ihre Form oder durch die Verbindung von Inhalt und Form etwas Neues und Eigentümliches darstellen. Dem Vorschlag, die geschützten Werke als "Schöpfungen eigentümlicher Prägung" zu definieren, folgt der Entwurf nicht. Eine solche Begriffsbestimmung erscheint bedenklich, weil sie das Erfordernis der individuellen Form zu sehr betont und zu dem Schluß verführen könnte, daß im Gegensatz zum geltenden Recht Werke von geringem schöpferischen Wert, die sog. "Kleine Münze", in Zukunft keinen Schutz mehr genießen sollen. Ein solche Änderung gegenüber dem geltenden Recht ist nicht beabsichtigt.
http://www.urheberrecht.org/law/normen/urhg/1965-09-09/materialien/ds_IV_270_B_01_02.php3
Hier ist der Grundwiderspruch bereits angelegt: Werke von geringem schöpferischem Wert müssen gleichwohl etwas "Neues und Eigentümliches" darstellen.
Bei den Anwaltsschriftsätzen wird den Anwälten (ausnahmsweise zu ihren Ungunsten) eine Extrawurst gebraten. Diese Texte suchen Erkenntnis, aber sind sie deshalb rechtswissenschaftliche Werke?
Kann nicht auch ein Verwaltungsschreiben als (verwaltungs-)wissenschaftlicher Text verstanden werden mit der Konsequenz, dass auch hier die höheren Maßstäbe für Wissenschaft gelten?
Eine weitere Ausnahme vom Grundsatz der "kleinen Münze" besteht im Bereich der Schriftwerke bei Briefen, worunter wohl nur Privatbriefe zu verstehen sind.
Das Landgericht Berlin führte aus:
"Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung setzt ein
urheberrechtlicher Werkschutz an Briefen voraus, daß sie entweder eine
originelle Art des gedanklichen Inhalts oder eine eigenständige
persönliche Formgebung als literarische Erzeugnisse aufweisen (vgl.
BGHZ 31, 308 (311) = NJW 1960, 476 - Alte Herren), sich mithin - auch
abgesehen von den bekundeten Tatsachen - als Ausfluß einer
individuellen geistigen Tätigkeit von literarischer Bedeutung
darstellen (vgl. RGZ69, 401 (404f.) - Nietzsche-Briefe). Diese - im
Gegensatz zu herkömmlichen Sprachwerken - gesteigerten Anforderungen
an die Werkqualität beruhen dabei auf dem Umstand, daß Briefen im
Sinne der schriftlichen Mitteilung vornehmlich eine besondere Art der
zwischenmenschlichen Kommunikation zum Gegenstand haben, mithin der
Unterrichtung von Dritten über bestimmte Begebenheiten dienen. Da
diese Begebenheiten - mögen sie seelischer, gedanklicher oder auch
tatsächlicher Natur sein - gleichwohl selbst im Wege der isolierten
Wiedergabe regelmäßig keine persönliche geistige Schöpfung aufweisen,
bedarf es für die Gewährung eines urheberrechtlichen Werkschutzes
einer literarischen Bedeutung bzw. Originalität, die ihren Ausdruck in
der den Briefen prägenden Textgestaltung finden kann (vgl. RGZ 69, 401 (405)). [...]
Da es sich bei Briefen jedoch ihrem Sinn und Zweck entsprechend in
erster Linie um eine allgemein verwendete Kommunikationsform handelt,
ist zudem darauf zu achten, daß die - einem Werkschutz vornehmlich
zugängliche - Formgebung eine Qualität aufweist, die sich von einem
vergleichbaren Bildungsniveau und den damit einhergehenden - ohnehin
vorhandenen - Fertigkeiten des Verfassers deutlich abhebt (vgl. BGHZ 31, 308 (311) = NJW 1960, 476)."
NJW 1995, 881
Das Kammergericht hat diese Bewertung übernommen und zugleich
festgestellt, dass Briefe "nur ausnahmsweise Urheberrechtsschutz
genießen" (NJW 1995, 3392).
Auf der Linie dieser Rechtsprechung liegt auch die Entscheidung des AG Charlottenburg zum Urheberrechtsschutz von E-Mails, die diesen verneinte:
PDF
OBERLANDESGERICHT MÜNCHEN Aktenzeichen: 29 W 2325/07
Auszug:
a) Das Schreiben vom 16. Juli 2007 genießt keinen urheberrechtlichen Schutz.
aa) Auch Anwaltsschriftsätze sind als Schriftwerke grundsätzlich nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG dem Urheberrechtsschutz zugänglich. Sie sind grundsätzlich dem (rechts-) wissenschaftlichen und nicht dem literarischen Bereich zuzuordnen. Bei wissenschaftlichen Werken findet der erforderliche geistig-schöpferische Gehalt seinen Niederschlag und Ausdruck in erster Linie in der Form und Art der Sammlung, Einteilung und Anordnung des dargebotenen Stoffes und nicht ohne weiteres auch - wie meist bei literarischen Werken - in der Gedankenformung und -führung des dargebotenen Inhalts. Die Frage, ob ein Schriftwerk einen hinreichenden schöpferischen Eigentümlichkeitsgrad besitzt, bemisst sich dabei nach dem geistig-schöpferischen Gesamteindruck der konkreten Gestaltung, und zwar im Gesamtvergleich gegenüber vorbestehenden Gestaltungen. Lassen sich nach Maßgabe des Gesamtvergleichs mit dem Vorbekannten schöpferische Eigenheiten feststellen, so sind diese der durchschnittlichen Gestaltertätigkeit gegenüberzustellen. Die Urheberrechtsschutzfähigkeit erfordert ein deutliches Überragen des
Alltäglichen, des Handwerksmäßigen, der mechanisch-technischen Aneinanderreihung des Materials (vgl. BGH GRUR 1986, 739 [740] - Anwaltsschriftsatz m. w. N .).
bb) Das Schreiben vom 16. Juli 2007 ist als anwaltliche Stellungnahme für einen Mandanten unabhängig davon als Anwaltsschriftsatz anzusehen, dass es nicht an ein Gericht oder eine Behörde gerichtet ist. Zu Recht ist das Landgericht allerdings im Ergebnis davon ausgegangen, dass diesem Schreiben die für die urheberrechtliche Schutzfähigkeit erforderlichen deutlich überragenden Elemente im Sinne der Rechtssprechung des Bundesgerichtshofs nicht zukommen.
Der Antragsteller trägt selbst vor, welche Anforderungen an ein Schreiben der streitgegenständlichen Art sich aus dessen Funktion zwangsläufig ergeben. Enthielte ein presserechtliches Warnschreiben nicht eine Herausarbeitung der wesentlichen Elemente des presserechtlich relevanten Sachverhalts, Hinweise auf Verstöße gegen publizistische Grundsätze oder sonstige Rechtsvorschriften und einen Hinweis auf die Folgen neuer Verstöße, so könnte es seine Funktion nicht - vollständig - erfüllen und wäre handwerklich misslungen. Die Einhaltung dieser Anforderungen stellt daher für sich genommen keinen Umstand dar, der ein deutliches Überragen des Handwerklichen begründen könnte. Keinesfalls kommt es darauf an, dass die Kategorie des presserechtlichen Warnschreibens nicht alltäglich sein mag. Dieser Umstand kann nicht die Annahme einer schöpferischen Leistung hinsichtlich jedes einzelnen in diese Kategorie fallenden Textes begründen; vielmehr müsste das streitgegenständliche Schreiben im Gesamtvergleich mit vorbestehenden Schreiben eben dieser Art gestalterisch deutlich überragend anzusehen sein. Derartige Eigenheiten des Schreibens, die eine schöpferische Leistung darstellen könnten (vgl. dazu OLG Düsseldorf NJW 1989, 1162 f.), sind weder vom Antragsteller vorgetragen noch sonst ersichtlich.
Anmerkung:
Im Ergebnis ist der Entscheidung zuzustimmen. Für die Schreiben von Anwälten gilt der Schutz der "kleinen Münze" nicht, da sie dem Bereich Wissenschaft zugeordnet werden. Für eine nicht-wissenschaftlichen Schriftwerke sind die Hürden niedriger, was fragwürdig erscheint.
Blicken wir kurz zurück in die Amtliche Begründung des UrhG:
Als "persönliche geistige Schöpfungen" sind Erzeugnisse anzusehen, die durch ihren Inhalt oder, durch ihre Form oder durch die Verbindung von Inhalt und Form etwas Neues und Eigentümliches darstellen. Dem Vorschlag, die geschützten Werke als "Schöpfungen eigentümlicher Prägung" zu definieren, folgt der Entwurf nicht. Eine solche Begriffsbestimmung erscheint bedenklich, weil sie das Erfordernis der individuellen Form zu sehr betont und zu dem Schluß verführen könnte, daß im Gegensatz zum geltenden Recht Werke von geringem schöpferischen Wert, die sog. "Kleine Münze", in Zukunft keinen Schutz mehr genießen sollen. Ein solche Änderung gegenüber dem geltenden Recht ist nicht beabsichtigt.
http://www.urheberrecht.org/law/normen/urhg/1965-09-09/materialien/ds_IV_270_B_01_02.php3
Hier ist der Grundwiderspruch bereits angelegt: Werke von geringem schöpferischem Wert müssen gleichwohl etwas "Neues und Eigentümliches" darstellen.
Bei den Anwaltsschriftsätzen wird den Anwälten (ausnahmsweise zu ihren Ungunsten) eine Extrawurst gebraten. Diese Texte suchen Erkenntnis, aber sind sie deshalb rechtswissenschaftliche Werke?
Kann nicht auch ein Verwaltungsschreiben als (verwaltungs-)wissenschaftlicher Text verstanden werden mit der Konsequenz, dass auch hier die höheren Maßstäbe für Wissenschaft gelten?
Eine weitere Ausnahme vom Grundsatz der "kleinen Münze" besteht im Bereich der Schriftwerke bei Briefen, worunter wohl nur Privatbriefe zu verstehen sind.
Das Landgericht Berlin führte aus:
"Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung setzt ein
urheberrechtlicher Werkschutz an Briefen voraus, daß sie entweder eine
originelle Art des gedanklichen Inhalts oder eine eigenständige
persönliche Formgebung als literarische Erzeugnisse aufweisen (vgl.
BGHZ 31, 308 (311) = NJW 1960, 476 - Alte Herren), sich mithin - auch
abgesehen von den bekundeten Tatsachen - als Ausfluß einer
individuellen geistigen Tätigkeit von literarischer Bedeutung
darstellen (vgl. RGZ69, 401 (404f.) - Nietzsche-Briefe). Diese - im
Gegensatz zu herkömmlichen Sprachwerken - gesteigerten Anforderungen
an die Werkqualität beruhen dabei auf dem Umstand, daß Briefen im
Sinne der schriftlichen Mitteilung vornehmlich eine besondere Art der
zwischenmenschlichen Kommunikation zum Gegenstand haben, mithin der
Unterrichtung von Dritten über bestimmte Begebenheiten dienen. Da
diese Begebenheiten - mögen sie seelischer, gedanklicher oder auch
tatsächlicher Natur sein - gleichwohl selbst im Wege der isolierten
Wiedergabe regelmäßig keine persönliche geistige Schöpfung aufweisen,
bedarf es für die Gewährung eines urheberrechtlichen Werkschutzes
einer literarischen Bedeutung bzw. Originalität, die ihren Ausdruck in
der den Briefen prägenden Textgestaltung finden kann (vgl. RGZ 69, 401 (405)). [...]
Da es sich bei Briefen jedoch ihrem Sinn und Zweck entsprechend in
erster Linie um eine allgemein verwendete Kommunikationsform handelt,
ist zudem darauf zu achten, daß die - einem Werkschutz vornehmlich
zugängliche - Formgebung eine Qualität aufweist, die sich von einem
vergleichbaren Bildungsniveau und den damit einhergehenden - ohnehin
vorhandenen - Fertigkeiten des Verfassers deutlich abhebt (vgl. BGHZ 31, 308 (311) = NJW 1960, 476)."
NJW 1995, 881
Das Kammergericht hat diese Bewertung übernommen und zugleich
festgestellt, dass Briefe "nur ausnahmsweise Urheberrechtsschutz
genießen" (NJW 1995, 3392).
Auf der Linie dieser Rechtsprechung liegt auch die Entscheidung des AG Charlottenburg zum Urheberrechtsschutz von E-Mails, die diesen verneinte:
KlausGraf - am Montag, 10. Dezember 2007, 16:17 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://timea.rice.edu/
All stuff I have seen in the presentation is PD in the US. Licensing unter CC-BY seems to be "Copyfraud Light". Nevertheless it's quite fair to give attribution to Rice U as source. It would be better to mark PD as PD but given the practice of almost all other US libraries which claim Copyrights on PD materials Rice decision to choose CC-BY and thos allowing commercial use is simply great.

All stuff I have seen in the presentation is PD in the US. Licensing unter CC-BY seems to be "Copyfraud Light". Nevertheless it's quite fair to give attribution to Rice U as source. It would be better to mark PD as PD but given the practice of almost all other US libraries which claim Copyrights on PD materials Rice decision to choose CC-BY and thos allowing commercial use is simply great.

KlausGraf - am Montag, 10. Dezember 2007, 16:06 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
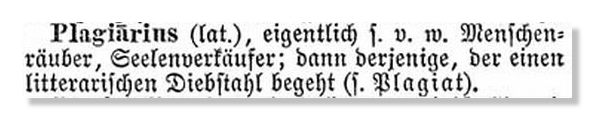
Das Bild habe ich von weblog.histnet.ch geklaut, wo es in einem Beitrag und seinen Kommentaren
http://weblog.histnet.ch/archives/750
um die Position von Plagiatsjäger Stefan Weber geht, der in INETBIB einen ebenso fulminanten wie eigenartigen Kurzauftritt hinlegte.
In der Sache bin ich hier mit dem Kollegen Haber ganz einig. Wir müssen nicht unsere Neue-Medienpraxis überdenken, sondern das Konzept der Autorschaft bzw. des Urheberrechts.
"Attribution" funktioniert schon im vor-digitalen Wissenschaftsbetrieb nicht so, wie man sich das more geometrico ausdenkt. Jemand (A) hat eine Idee oder führt einen Begriff ein, der korrekt von einem einflußreicheren Wissenschaftler (B) aufgegriffen wird (mit korrekter Zitation). Der nächste C zitiert aber nicht mehr A, sondern B, weil er keinen Anlass sieht, auf A zurückzugehen.
Am Beispiel eines handschriftlichen Rechenbuchs von 1599 führt der Kurs in das Lesen frühneuzeitlicher Texte ein.
http://de.wikiversity.org/wiki/Kurs:Pal%C3%A4ographie/%C3%9Cbung_3
Einsteigen kann man in der ersten Woche jederzeit. Der Unterricht findet täglich abends gegen 21 Uhr im Channel #paelo des Wikipedia-Chats statt (etwa eine Dreiviertelstunde). Bei dem Kurs vor einem Jahr hat sich gezeigt, dass der Unterricht im Chat effizienter als andere virtuellen Interaktionsformen (Wiki, Mail) ist.

http://de.wikiversity.org/wiki/Kurs:Pal%C3%A4ographie/%C3%9Cbung_3
Einsteigen kann man in der ersten Woche jederzeit. Der Unterricht findet täglich abends gegen 21 Uhr im Channel #paelo des Wikipedia-Chats statt (etwa eine Dreiviertelstunde). Bei dem Kurs vor einem Jahr hat sich gezeigt, dass der Unterricht im Chat effizienter als andere virtuellen Interaktionsformen (Wiki, Mail) ist.

KlausGraf - am Sonntag, 9. Dezember 2007, 00:27 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Ihr zu Ehren hat die Neu-Isenburger Franz-Völker-Anny-Schlemm-Gesellschaft ein Archiv eingerichtet. Ihre 60-jährige Karriere ist im Robert-Maier-Haus in der Wilhelm-Leuschner-Straße 28 fast lückenlos dokumentiert – in Wort und Bild. Vor Kurzem ließ die Stadt auch einen Film über Anny Schlemm drehen, wie der Vorsitzende Berthold Depper berichtete. Auch die drei Veranstaltungen in diesem Jahr anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Gesellschaft seien gefilmt und archiviert worden.
Die aufwendige Arbeit des Archivierens hatte Gerhard Kilian, ehemaliges Vorstandsmitglied des Franz-Völker-Kreises, die 2005 in Franz-Völker-Anny-Schlemm-Gesellschaft umbenannt wurde, übernommen. In liebevoller Kleinarbeit hat er Kritiken, Programme und Pressetexte zusammengetragen und dokumentiert. Insgesamt umfasst das Anny-Schlemm-Archiv 18 dicke Ordner und 8 Aktenständer. Kilian hat 4100 Printfotos zusammengetragen und nach Daten sortiert, hinzu kommen 300 Originalprogramme und Druckschriften. Zwei Jahre habe er für das jetzt „im Großen und Ganzen fertige Archiv“ gebraucht, erklärt Kilian, der sich „eine eingehende Weiterverarbeitung und Pflege des Archivs“ wünscht. Das Archiv, sagt Kilian, solle ein „Denkmal für Anny Schlemm sein“.
Quelle: http://www.rhein-main.net/sixcms/list.php?page=fnp2_news_article&id=4182666
Anny-Schlemm-Links:
http://de.wikipedia.org/wiki/Anny_Schlemm
http://annyschlemm.de/pages/home.php
Die aufwendige Arbeit des Archivierens hatte Gerhard Kilian, ehemaliges Vorstandsmitglied des Franz-Völker-Kreises, die 2005 in Franz-Völker-Anny-Schlemm-Gesellschaft umbenannt wurde, übernommen. In liebevoller Kleinarbeit hat er Kritiken, Programme und Pressetexte zusammengetragen und dokumentiert. Insgesamt umfasst das Anny-Schlemm-Archiv 18 dicke Ordner und 8 Aktenständer. Kilian hat 4100 Printfotos zusammengetragen und nach Daten sortiert, hinzu kommen 300 Originalprogramme und Druckschriften. Zwei Jahre habe er für das jetzt „im Großen und Ganzen fertige Archiv“ gebraucht, erklärt Kilian, der sich „eine eingehende Weiterverarbeitung und Pflege des Archivs“ wünscht. Das Archiv, sagt Kilian, solle ein „Denkmal für Anny Schlemm sein“.
Quelle: http://www.rhein-main.net/sixcms/list.php?page=fnp2_news_article&id=4182666
Anny-Schlemm-Links:
http://de.wikipedia.org/wiki/Anny_Schlemm
http://annyschlemm.de/pages/home.php
Wolf Thomas - am Samstag, 8. Dezember 2007, 18:50 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 8. Dezember 2007, 16:04 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 8. Dezember 2007, 03:36 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.telemedicus.info/article/557-Kommentar-Vorabkontrollpflicht-bei-Blogs-ist-verfassungswidrig.html
Dieser Ansicht aus Anlass einer skandalösen Hamburger Gerichtsentscheidung schließen wir uns an.
Dieser Ansicht aus Anlass einer skandalösen Hamburger Gerichtsentscheidung schließen wir uns an.
Zugang zum Wissen (E. Hilf)
Autoren können Ihre Rechte wahren, Ihre alten (1966-1994, in Papier-Zeitschriften gedruckten) Publikationen auch selbst online zu stellen oder durch z.B. ihre lokale Bibliothek professionell irgendwann online stellen zu lassen, wenn sie vor dem 31.12.2007 (also sehr bald) Ihrer Bibliothek das Recht einräumen, (z.B. nichteklusiv, d.h. ohne es anderen, etwa dem Verlag zu verbieten) dies zu tun, und dies dem Verlag mitteilen. Anderenfalls verfällt das Recht für immer an den Verlag.
Fertig vorformulierte Musterbriefe und Hilfestellungen haben nun herausgegeben:
das Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft sowie DINI Deutsche Initiative für NetzwerkInformation e.V.
Hier sind die links:
- Musterbrief zur Übertragung der einfachen Nutzungsrechte an eine Bibliothek
- Musterbrief zum Widerspruch an einen Verlag
- Ergänzende Informationen zum Rundbrief von Aktionsbündnis und DINI zu unbekannten Nutzungsarten
- Nähere Erläuterungen
- Rundbrief
Siehe hier:
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/
Autoren können Ihre Rechte wahren, Ihre alten (1966-1994, in Papier-Zeitschriften gedruckten) Publikationen auch selbst online zu stellen oder durch z.B. ihre lokale Bibliothek professionell irgendwann online stellen zu lassen, wenn sie vor dem 31.12.2007 (also sehr bald) Ihrer Bibliothek das Recht einräumen, (z.B. nichteklusiv, d.h. ohne es anderen, etwa dem Verlag zu verbieten) dies zu tun, und dies dem Verlag mitteilen. Anderenfalls verfällt das Recht für immer an den Verlag.
Fertig vorformulierte Musterbriefe und Hilfestellungen haben nun herausgegeben:
das Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft sowie DINI Deutsche Initiative für NetzwerkInformation e.V.
Hier sind die links:
- Musterbrief zur Übertragung der einfachen Nutzungsrechte an eine Bibliothek
- Musterbrief zum Widerspruch an einen Verlag
- Ergänzende Informationen zum Rundbrief von Aktionsbündnis und DINI zu unbekannten Nutzungsarten
- Nähere Erläuterungen
- Rundbrief
Siehe hier:
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/
KlausGraf - am Samstag, 8. Dezember 2007, 03:19 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bei den Württembergischen Vierteljahrsheften für Landesgeschichte liegt anscheinend der Fall vor, dass Bände bei der U of Michigan mit US-Proxy zugänglich sind, die bei Google nicht als Volltext vorliegen:
http://de.wikisource.org/wiki/Zeitschriften#W

http://de.wikisource.org/wiki/Zeitschriften#W

KlausGraf - am Samstag, 8. Dezember 2007, 03:12 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In Wikisource habe ich zusammengestellt, welche Bände bei Google Book Search digitalisiert vorliegen und dabei auch die Titel der enthaltenen Chroniken erfasst:
http://de.wikisource.org/wiki/Die_Chroniken_der_deutschen_St%C3%A4dte
Von den 29 vor 1910 erschienenen Bänden fehlen noch bei Google: Mainz 2, Augsburg 3 und 4.
Von der gesamten Reihe ist nur Bd. 1 ohne US-Proxy normal für deutsche Nutzer zugänglich!

http://de.wikisource.org/wiki/Die_Chroniken_der_deutschen_St%C3%A4dte
Von den 29 vor 1910 erschienenen Bänden fehlen noch bei Google: Mainz 2, Augsburg 3 und 4.
Von der gesamten Reihe ist nur Bd. 1 ohne US-Proxy normal für deutsche Nutzer zugänglich!

KlausGraf - am Samstag, 8. Dezember 2007, 00:58 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Am 5.12. hat endlich (!) auch www.open-access.net reagiert:
05.12.2007 11:52
Jetzt Nutzungsrechte sichern!
Am 1. Januar 2008 tritt eine Veränderung des Urheberrechtsgesetzes in Kraft. Durch die neuen Regelungen in § 31a und § 137 l UrhG erhalten Verlage automatisch die Rechte zur Online-Verwertung von Publikationen, die bisher bei den Autoren lagen, d.h. durch die neue Regelung verlieren Autoren die Möglichkeit, ihre vor 1995 erschienenen Publikationen in fachlichen oder institutionellen Servern, wie dem Institutional Repository ihrer Universität oder einem anderen Open Access Server publizieren zu dürfen. Noch bis Ende dieses Jahres haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Möglichkeit, Ihre Rechte zu wahren:
Übertragen Sie Ihrer Bibliothek oder einem fachlichen Repository ein einfaches Nutzungsrecht an Ihren Publikationen vor 1995, dies können Sie in Form einer vorformulierten Standard-E-Mail (siehe unten) tun. So erhält der Verlag nicht automatisch die Rechte an der Internet-Verwertung Ihrer Publikationen und ein separater Widerruf gegenüber den Verlagen ist dann nicht mehr nötig. Die Möglichkeit Ihre Publikationen in den Online-Angeboten der Verlage zu präsentieren haben Sie trotzdem. Verhindert wird mit Ihrer Rechteeinräumung jedoch, dass NUR der Verlag online publizieren darf (und der Online-Zugriff zukünftig höchstwahrscheinlich nur gegen Bezahlung möglich ist).
Schicken Sie noch in diesem Jahr eine E-Mail mit folgendem Inhalt an Ihre Bibliothek:
"Hiermit übertrage ich der Bibliothek der Universität ... ein einfaches Nutzungsrecht an meinen vor 1995 erschienenen Fachpublikationen zur Nutzung auf dem Institutional Repository der Universität .... Die Möglichkeit, nicht-ausschließliche Nutzungsrechte an diesen Publikationen selbst zu behalten oder an Dritte weiterzugeben, bleibt davon unberührt."
Fügen Sie (falls möglich) die Liste Ihrer Publikationen oder eine URL, die auf eine solche Liste verweist, an.
Siehe auch:
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/
05.12.2007 11:52
Jetzt Nutzungsrechte sichern!
Am 1. Januar 2008 tritt eine Veränderung des Urheberrechtsgesetzes in Kraft. Durch die neuen Regelungen in § 31a und § 137 l UrhG erhalten Verlage automatisch die Rechte zur Online-Verwertung von Publikationen, die bisher bei den Autoren lagen, d.h. durch die neue Regelung verlieren Autoren die Möglichkeit, ihre vor 1995 erschienenen Publikationen in fachlichen oder institutionellen Servern, wie dem Institutional Repository ihrer Universität oder einem anderen Open Access Server publizieren zu dürfen. Noch bis Ende dieses Jahres haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Möglichkeit, Ihre Rechte zu wahren:
Übertragen Sie Ihrer Bibliothek oder einem fachlichen Repository ein einfaches Nutzungsrecht an Ihren Publikationen vor 1995, dies können Sie in Form einer vorformulierten Standard-E-Mail (siehe unten) tun. So erhält der Verlag nicht automatisch die Rechte an der Internet-Verwertung Ihrer Publikationen und ein separater Widerruf gegenüber den Verlagen ist dann nicht mehr nötig. Die Möglichkeit Ihre Publikationen in den Online-Angeboten der Verlage zu präsentieren haben Sie trotzdem. Verhindert wird mit Ihrer Rechteeinräumung jedoch, dass NUR der Verlag online publizieren darf (und der Online-Zugriff zukünftig höchstwahrscheinlich nur gegen Bezahlung möglich ist).
Schicken Sie noch in diesem Jahr eine E-Mail mit folgendem Inhalt an Ihre Bibliothek:
"Hiermit übertrage ich der Bibliothek der Universität ... ein einfaches Nutzungsrecht an meinen vor 1995 erschienenen Fachpublikationen zur Nutzung auf dem Institutional Repository der Universität .... Die Möglichkeit, nicht-ausschließliche Nutzungsrechte an diesen Publikationen selbst zu behalten oder an Dritte weiterzugeben, bleibt davon unberührt."
Fügen Sie (falls möglich) die Liste Ihrer Publikationen oder eine URL, die auf eine solche Liste verweist, an.
Siehe auch:
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/
KlausGraf - am Freitag, 7. Dezember 2007, 20:01 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus dem Newsletter für Mitarbeiter der Uni Freiburg:
Ihre Rechte an Ihren (digitalen) Publikationen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Zum 1. Januar 2008 tritt eine Veränderung des Urheberrechtsgesetzes in Kraft. Sie enthält eine Regelung, mit der Verlagen automatisch (und damit rückwirkend) die Rechte zur Online-Verwertung von Publikationen zufallen, die bisher bei den Autoren lagen. Bislang galten Rechte bis zu einem Stichjahr (1995) als nicht abgegeben, da diese Nutzungsmöglichkeit damals noch nicht gegeben bzw. nicht üblich war. Noch bis Dezember haben Sie als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Möglichkeit, Ihre Rechte zu wahren und darüber zu verfügen. Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit – im Interesse der Wissenschaft.
——
Bevor die urheberrechtlichen Regelungen für den Verfasser ungünstiger werden, ist es sinnvoll, die digitalen Publikationsrechte möglichst umfassend, zumindest aber für Aufsatzpublikationen, der Universitätsbibliothek (und damit unserer Universität) zur Publikation auf dem Hochschulschriftenserver zu übertragen. Wissenschaftsorganisationen wie vor allem die Deutsche Forschungsgemeinschaft plädieren nachdrücklich für diese Rechteübertragung und auch andere Universitäten rufen ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu diesem Schritt auf. Zwei weiterführende Links sind:
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
http://edoc.hu-berlin.de/e_info/copyright.php
Neben der Sicherung Ihrer eigenen Rechte würde damit ermöglicht, eine breite Dokumentation der wissenschaftlichen Forschung an der Universität für diesen Zeitraum in leichter Zugänglichkeit aufzubauen. Viele von Ihnen kennen die Schwierigkeiten, die sich bei elektronischen Datensammlungen und Dokumentationen aus dem Urheberrecht ergeben. Helfen Sie daher mit, dass zumindest für ältere Publikationen diese Probleme in Zukunft vermieden werden können.
Bei neuen Publikationen sollten Sie unbedingt auf vertragliche Vereinbarungen achten. Bislang sind Aufsätze in Zeitschriften und Sammelwerken (Festschriften) nach einem Jahr für den Verfasser wieder verfügbar (UrhG § 38), somit auch digital publizierbar, sofern keine eigenen vertraglichen Regelungen entgegenstehen. Die Universitätsbibliothek ist natürlich gerade auch an diesen neuen Aufsätzen interessiert.
Das Zur-Verfügung-Stellen auf dem Hochschulschriftenserver erlaubt Ihnen zugleich den einfachen Ausdruck von Sonderdrucken oder eben den Verweis auf diese Möglichkeit, der das Verschicken u.U. erspart.
Über den Nutzen dieser Möglichkeit können Sie sich z.B. unter der Adresse (URL) des Hochschulschriftenservers http://www.freidok.uni-freiburg.de/ selbst anhand der Publikationen von Kollegen überzeugen, die diese Möglichkeit bereits genutzt haben. Die Aufsätze sind im Online-Katalog der Universitätsbibliothek nachgewiesen, werden von Suchmaschinen erfasst und sind ggf. leicht mit Ihrer Homepage oder auch der Freiburger Forschungsdatenbank zu verlinken.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die untenstehende Erklärung für die vor 1995 publizierten Aufsätze der Universitätsbibliothek – ggf. mit einer Liste der einschlägigen Publikationen oder mit reproduzierbaren Kopien oder Sonderdrucken – zurücksenden könnten.
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Schneider Prorektor für Wissenstransfer und Kommunikationstechnologien
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Universitätsbibliothek Freiburg
Sekretariat
Hauspost
Hiermit übertrage ich der Universitätsbibliothek Freiburg i.Br. ein einfaches Nutzungsrecht an meinen vor 1995 erschienenen wissenschaftlichen Aufsätzen zur Nutzung auf dem Hochschulschriftenserver (digitale Publikation).
Name / Adresse:
(Unterschrift)
***
Zum Thema siehe
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/ (fast alle neueren Beiträge)
Ihre Rechte an Ihren (digitalen) Publikationen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Zum 1. Januar 2008 tritt eine Veränderung des Urheberrechtsgesetzes in Kraft. Sie enthält eine Regelung, mit der Verlagen automatisch (und damit rückwirkend) die Rechte zur Online-Verwertung von Publikationen zufallen, die bisher bei den Autoren lagen. Bislang galten Rechte bis zu einem Stichjahr (1995) als nicht abgegeben, da diese Nutzungsmöglichkeit damals noch nicht gegeben bzw. nicht üblich war. Noch bis Dezember haben Sie als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Möglichkeit, Ihre Rechte zu wahren und darüber zu verfügen. Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit – im Interesse der Wissenschaft.
——
Bevor die urheberrechtlichen Regelungen für den Verfasser ungünstiger werden, ist es sinnvoll, die digitalen Publikationsrechte möglichst umfassend, zumindest aber für Aufsatzpublikationen, der Universitätsbibliothek (und damit unserer Universität) zur Publikation auf dem Hochschulschriftenserver zu übertragen. Wissenschaftsorganisationen wie vor allem die Deutsche Forschungsgemeinschaft plädieren nachdrücklich für diese Rechteübertragung und auch andere Universitäten rufen ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu diesem Schritt auf. Zwei weiterführende Links sind:
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
http://edoc.hu-berlin.de/e_info/copyright.php
Neben der Sicherung Ihrer eigenen Rechte würde damit ermöglicht, eine breite Dokumentation der wissenschaftlichen Forschung an der Universität für diesen Zeitraum in leichter Zugänglichkeit aufzubauen. Viele von Ihnen kennen die Schwierigkeiten, die sich bei elektronischen Datensammlungen und Dokumentationen aus dem Urheberrecht ergeben. Helfen Sie daher mit, dass zumindest für ältere Publikationen diese Probleme in Zukunft vermieden werden können.
Bei neuen Publikationen sollten Sie unbedingt auf vertragliche Vereinbarungen achten. Bislang sind Aufsätze in Zeitschriften und Sammelwerken (Festschriften) nach einem Jahr für den Verfasser wieder verfügbar (UrhG § 38), somit auch digital publizierbar, sofern keine eigenen vertraglichen Regelungen entgegenstehen. Die Universitätsbibliothek ist natürlich gerade auch an diesen neuen Aufsätzen interessiert.
Das Zur-Verfügung-Stellen auf dem Hochschulschriftenserver erlaubt Ihnen zugleich den einfachen Ausdruck von Sonderdrucken oder eben den Verweis auf diese Möglichkeit, der das Verschicken u.U. erspart.
Über den Nutzen dieser Möglichkeit können Sie sich z.B. unter der Adresse (URL) des Hochschulschriftenservers http://www.freidok.uni-freiburg.de/ selbst anhand der Publikationen von Kollegen überzeugen, die diese Möglichkeit bereits genutzt haben. Die Aufsätze sind im Online-Katalog der Universitätsbibliothek nachgewiesen, werden von Suchmaschinen erfasst und sind ggf. leicht mit Ihrer Homepage oder auch der Freiburger Forschungsdatenbank zu verlinken.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die untenstehende Erklärung für die vor 1995 publizierten Aufsätze der Universitätsbibliothek – ggf. mit einer Liste der einschlägigen Publikationen oder mit reproduzierbaren Kopien oder Sonderdrucken – zurücksenden könnten.
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Schneider Prorektor für Wissenstransfer und Kommunikationstechnologien
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Universitätsbibliothek Freiburg
Sekretariat
Hauspost
Hiermit übertrage ich der Universitätsbibliothek Freiburg i.Br. ein einfaches Nutzungsrecht an meinen vor 1995 erschienenen wissenschaftlichen Aufsätzen zur Nutzung auf dem Hochschulschriftenserver (digitale Publikation).
Name / Adresse:
(Unterschrift)
***
Zum Thema siehe
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/ (fast alle neueren Beiträge)
KlausGraf - am Freitag, 7. Dezember 2007, 19:34 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Handschriften des Mittelalters. Hrsg. vom Staatsanzeiger-Verlag / Badische Landesbibliothek Karlsruhe / Württembergische Landesbibliothek Stuttgart / Universitätsbibliothek Freiburg / Universitätsbibliothek Heidelberg / Universitätsbibliothek Tübingen / Leopold-Sophien-Bibliothek Überlingen. 2007, 120 S., reiche farbige Bebilderung, 21 x 28 cm, kartoniert, € 7,50, ISBN-10: 3-929981-69-6, ISBN-13: 978-3-929981-69-8
Inhaltsverzeichnis als PDF
Das von den großen öffentlichen Handschriftenbibliotheken Baden-Württembergs verantwortete Magazin im Zeitschriftenformat stellt sein Thema überaus ansprechend dar. Die mit vielen Farbabbildungen versehenen kurzen Beiträge (meist 2 Seiten) führen in verständlicher Form in die Welt der Handschriften ein. Man erfährt, wie eine Handschrift entsteht, exemplarische Stücke und ihre Bibliotheksheimat werden vorgestellt.
Dieses Magazin ist sicher auch eine Antwort auf die "Causa Karlsruhe". Magda Fischer schreibt in ihrem Beitrag über die Klosterbibliotheken und deren Schicksal nach der Säkularisation abschließend zu Recht: "Zeittpisch hingegen war ihr Unverständnis für den Wert einer Bibliothek als einem in Jahrhundert aus Handschriften und Drucken zusammengewachsenen Ganzen mit jeweils eigenem Profil, in dem sich die Geschichte eines Klosters und einer Region widerspiegelt. Wie Beispiele in jüngster Zeit zeigen, hat auch unsere Generation solches Denken offensichtlich nicht überwunden. Könnte man sonst überlegen, alte Büchern in Bibliotheken auszusondern, wenn sie über eine bestimmte Zeit nicht benutzt worden sind? Würde man gewachsene, großzügig durch Generationen geförderte und mit Sachkenntnis vermehrte Büchersammlungen in Einzelpakaten zum Kauf anbieten, bevor der Bestand überhaupt inventarisiert ist? Dürfte man bei finanziellen Engpässen Handschriften als Verfügungsmasse sehen und sie beliebig aus ihrem Bibliothekszusammenhang herausreißen und veräußern?" (S. 25)
Beachtung verdienen auch die beiden Seiten, auf denen Armin Schlechter handschriftliche Einträge in gedruckten Büchern würdigt (S. 20f.). Er präsentiert einen geradezu sensationellen Randvermerk aus dem Jahr 1503 in einer Heidelberger Inkunabel , der sich auf Leonardos Mona Lisa bezieht.
Das Heft dokumentiert, dass man in den Handschriftensammlungen begriffen hat, dass man mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben muss, um die eigenen Schätze vor politischen Begehrlichkeiten zu schützen.
Vielleicht hätte man die kleineren Sammlungen ausführlicher porträtieren können (S. 116-117). Die Prädikantenbibliothek in Isny besitzt 70 Handschriften, während die Überlinger Bibliothek nur 44 mittelalterliche Handschriften ihr eigen nennt. Dass "Buchhandschriften" auch in den Archiven des Landes zu finden sind, wird nicht erwähnt. Kostbare Stücke befinden sich immer noch in adeligem Privatbesitz (insbesondere in Wolfegg und Zeil).
Wer noch eine nette Kleinigkeit als Weihnachtsgeschenk für einen Kulturbeflissenen sucht, ist mit diesem Magazin gut bedient.

Inhaltsverzeichnis als PDF
Das von den großen öffentlichen Handschriftenbibliotheken Baden-Württembergs verantwortete Magazin im Zeitschriftenformat stellt sein Thema überaus ansprechend dar. Die mit vielen Farbabbildungen versehenen kurzen Beiträge (meist 2 Seiten) führen in verständlicher Form in die Welt der Handschriften ein. Man erfährt, wie eine Handschrift entsteht, exemplarische Stücke und ihre Bibliotheksheimat werden vorgestellt.
Dieses Magazin ist sicher auch eine Antwort auf die "Causa Karlsruhe". Magda Fischer schreibt in ihrem Beitrag über die Klosterbibliotheken und deren Schicksal nach der Säkularisation abschließend zu Recht: "Zeittpisch hingegen war ihr Unverständnis für den Wert einer Bibliothek als einem in Jahrhundert aus Handschriften und Drucken zusammengewachsenen Ganzen mit jeweils eigenem Profil, in dem sich die Geschichte eines Klosters und einer Region widerspiegelt. Wie Beispiele in jüngster Zeit zeigen, hat auch unsere Generation solches Denken offensichtlich nicht überwunden. Könnte man sonst überlegen, alte Büchern in Bibliotheken auszusondern, wenn sie über eine bestimmte Zeit nicht benutzt worden sind? Würde man gewachsene, großzügig durch Generationen geförderte und mit Sachkenntnis vermehrte Büchersammlungen in Einzelpakaten zum Kauf anbieten, bevor der Bestand überhaupt inventarisiert ist? Dürfte man bei finanziellen Engpässen Handschriften als Verfügungsmasse sehen und sie beliebig aus ihrem Bibliothekszusammenhang herausreißen und veräußern?" (S. 25)
Beachtung verdienen auch die beiden Seiten, auf denen Armin Schlechter handschriftliche Einträge in gedruckten Büchern würdigt (S. 20f.). Er präsentiert einen geradezu sensationellen Randvermerk aus dem Jahr 1503 in einer Heidelberger Inkunabel , der sich auf Leonardos Mona Lisa bezieht.
Das Heft dokumentiert, dass man in den Handschriftensammlungen begriffen hat, dass man mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben muss, um die eigenen Schätze vor politischen Begehrlichkeiten zu schützen.
Vielleicht hätte man die kleineren Sammlungen ausführlicher porträtieren können (S. 116-117). Die Prädikantenbibliothek in Isny besitzt 70 Handschriften, während die Überlinger Bibliothek nur 44 mittelalterliche Handschriften ihr eigen nennt. Dass "Buchhandschriften" auch in den Archiven des Landes zu finden sind, wird nicht erwähnt. Kostbare Stücke befinden sich immer noch in adeligem Privatbesitz (insbesondere in Wolfegg und Zeil).
Wer noch eine nette Kleinigkeit als Weihnachtsgeschenk für einen Kulturbeflissenen sucht, ist mit diesem Magazin gut bedient.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Hoffmann, Ronald: Die Domänenfrage in Thüringen
Über die vermögensrechtlichen Auseinandersetzungen mit den ehemaligen Landesherren in Thüringen nach dem Ersten Weltkrieg
http://www.buchhandel.de/detailansicht.aspx?isbn=978-3-631-55850-8
Verlag : Lang, Peter Frankfurt
ISBN : 978-3-631-55850-8
Einband : Paperback
Preisinfo : 68,50 Eur[D] / 68,50 Eur[A]
Seiten/Umfang : LXXII, 347 S., 6 schw.-w. u. 1 farb. Abb. - 21 x 14,8 cm
Erschienen : 1. Aufl. 09.2006
Aus der Reihe : Rechtshistorische Reihe
Rezension von Gerhard Köbler
Über die vermögensrechtlichen Auseinandersetzungen mit den ehemaligen Landesherren in Thüringen nach dem Ersten Weltkrieg
http://www.buchhandel.de/detailansicht.aspx?isbn=978-3-631-55850-8
Verlag : Lang, Peter Frankfurt
ISBN : 978-3-631-55850-8
Einband : Paperback
Preisinfo : 68,50 Eur[D] / 68,50 Eur[A]
Seiten/Umfang : LXXII, 347 S., 6 schw.-w. u. 1 farb. Abb. - 21 x 14,8 cm
Erschienen : 1. Aufl. 09.2006
Aus der Reihe : Rechtshistorische Reihe
Rezension von Gerhard Köbler
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Badische Zeitung vom Freitag, 7. Dezember 2007
TAGESSPIEGEL:
Klare Verhältnisse
Badische Kunstschätze
Auch wenn noch nicht die letzte Hand angelegt ist: Das Gutachten der
Experten zum Streit um die badischen Kunstschätze steht. Dessen
Aussage ist deutlich. Das Haus Baden erhebt zu Unrecht Besitzansprüche
auf den größten Teil der Kunstsammlungen. Das Gutachten hat dafür
durch intensive Archivarbeit eine einmalige Faktenbasis geschaffen.
Die Rechtslage ist demnach, anders als behauptet, juristisch gar nicht
schwammig, sondern erlaubt eine präzise Scheidung von Mein und Dein.
Den Nutzen hat das Land Baden-Württemberg. Es hat eine
millionenschwere Kunstsammlung gewonnen, die es bisher nur verwalten
durfte. Und es steht in den Verhandlungen um Schloss Salem nicht mehr
unter Druck. Gewiss, das Ergebnis des Gutachtens muss schlimmstenfalls
durch alle Gerichtsinstanzen verteidigt werden. Aber das zu erwartende
Ergebnis ist diese Mühe wert. Denn ohne Mühe verliert man Werte --- oder
bezahlt sie ein zweites Mal. Genau das drohte vor einem Jahr durch den
Deal zwischen Land und Haus Baden. Daher muss man dem Protest danken,
der sich damals gegen den geplanten Verkauf mittelalterlicher
Handschriften erhoben hat. Er hat das Verfahren aufgehalten und
letztlich die ernsthafte Prüfung der Besitzverhältnisse veranlasst.
Das von der Landesregierung in Auftrag gegebene Gutachten zeigt daher
zugleich, wie schlampig anfangs eben diese Landesregierung gearbeitet
hat. Das sollte sie verpflichten, ihre Besitzrechte umso
nachdrücklicher zu vertreten. Wulf Rüskamp
Diesem Kommentar ist voll und ganz zuzustimmen.
 War 2006 verkaufsgefährdet: Handschrift aus St. Peter perg 11a
War 2006 verkaufsgefährdet: Handschrift aus St. Peter perg 11a
TAGESSPIEGEL:
Klare Verhältnisse
Badische Kunstschätze
Auch wenn noch nicht die letzte Hand angelegt ist: Das Gutachten der
Experten zum Streit um die badischen Kunstschätze steht. Dessen
Aussage ist deutlich. Das Haus Baden erhebt zu Unrecht Besitzansprüche
auf den größten Teil der Kunstsammlungen. Das Gutachten hat dafür
durch intensive Archivarbeit eine einmalige Faktenbasis geschaffen.
Die Rechtslage ist demnach, anders als behauptet, juristisch gar nicht
schwammig, sondern erlaubt eine präzise Scheidung von Mein und Dein.
Den Nutzen hat das Land Baden-Württemberg. Es hat eine
millionenschwere Kunstsammlung gewonnen, die es bisher nur verwalten
durfte. Und es steht in den Verhandlungen um Schloss Salem nicht mehr
unter Druck. Gewiss, das Ergebnis des Gutachtens muss schlimmstenfalls
durch alle Gerichtsinstanzen verteidigt werden. Aber das zu erwartende
Ergebnis ist diese Mühe wert. Denn ohne Mühe verliert man Werte --- oder
bezahlt sie ein zweites Mal. Genau das drohte vor einem Jahr durch den
Deal zwischen Land und Haus Baden. Daher muss man dem Protest danken,
der sich damals gegen den geplanten Verkauf mittelalterlicher
Handschriften erhoben hat. Er hat das Verfahren aufgehalten und
letztlich die ernsthafte Prüfung der Besitzverhältnisse veranlasst.
Das von der Landesregierung in Auftrag gegebene Gutachten zeigt daher
zugleich, wie schlampig anfangs eben diese Landesregierung gearbeitet
hat. Das sollte sie verpflichten, ihre Besitzrechte umso
nachdrücklicher zu vertreten. Wulf Rüskamp
Diesem Kommentar ist voll und ganz zuzustimmen.
 War 2006 verkaufsgefährdet: Handschrift aus St. Peter perg 11a
War 2006 verkaufsgefährdet: Handschrift aus St. Peter perg 11anoch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eyn manung der cristenheit widder die durken, [Türkenkalender], [Mainz] [1454]
http://mdz10.bib-bvb.de/~db//0001/bsb00018195/images/
Wieso muss die BSB nach einem Schwarzweissmikrofilm dieses Highlight ihrer Sammlungen digitalisieren? Die meisten anderen Bibliotheken wären stolz darauf, das Original in guter Auflösung nach heutigen Standards zu präsentieren.
http://mdz10.bib-bvb.de/~db//0001/bsb00018195/images/
Wieso muss die BSB nach einem Schwarzweissmikrofilm dieses Highlight ihrer Sammlungen digitalisieren? Die meisten anderen Bibliotheken wären stolz darauf, das Original in guter Auflösung nach heutigen Standards zu präsentieren.
KlausGraf - am Freitag, 7. Dezember 2007, 15:50 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
http://www.buchmarkt-college.de/lexikon
Erscheint mir nach kurzer Stichproben-Durchsicht soweit aktuell und richtig, oft angenehm kurz und präzis (Beispiel "Lehrerfreistück"), andererseits oft zu kurz und damit verkürzend (Beispiel "Amtliches Werk").
Erscheint mir nach kurzer Stichproben-Durchsicht soweit aktuell und richtig, oft angenehm kurz und präzis (Beispiel "Lehrerfreistück"), andererseits oft zu kurz und damit verkürzend (Beispiel "Amtliches Werk").
Ladislaus - am Freitag, 7. Dezember 2007, 15:13 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die strittigen Kulturgüter gehören dem Land und nicht dem Haus Baden, sagt die umfangreiche Studie der vom Land Baden-Württemberg beauftragten Expertenkommission. Offenbar ist ein Exemplar an die BNN gelangt:
http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/verkauf.php
Nach Informationen von Archivalia könnte das Gutachten am 18. Dezember öffentlich vorgestellt werden. Diesen Termin nennt auch:
http://www.badische-zeitung.de/gutachten-kunstschaetze-gehoeren-dem-land.102301

 Collage: SWR
Collage: SWR
http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/verkauf.php
Nach Informationen von Archivalia könnte das Gutachten am 18. Dezember öffentlich vorgestellt werden. Diesen Termin nennt auch:
http://www.badische-zeitung.de/gutachten-kunstschaetze-gehoeren-dem-land.102301

 Collage: SWR
Collage: SWRnoch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In celebration of the Society for Medieval Archaeology's 50th anniversary the first fifty volumes of Medieval Archaeology have been made available in digital form.
http://ads.ahds.ac.uk/catalogue/library/med_arch/index.cfm
1 (1957)- 50 (2006)
It's free!

http://ads.ahds.ac.uk/catalogue/library/med_arch/index.cfm
1 (1957)- 50 (2006)
It's free!

KlausGraf - am Donnerstag, 6. Dezember 2007, 21:54 - Rubrik: English Corner
" ..... Allerdings lässt sich diese Argumentation nach Ansicht von Staatsrechtlern nicht eins zu eins auf alle anderen Beamtinnen übertragen. Lehrer und Schüler stehen in einem besonders engen Verhältnis: Der eine soll den anderen erziehen und ihm Werte vermitteln, was in vielen Fällen zu einer engen Beziehung führt. Das jedoch gilt nicht für eine verbeamtete Archivarin, die Bücher und Akten verwaltet und nie mit Publikum zu tun hat. „Wen stört es, wenn diese Frau ein Kopftuch trägt?“, fragt etwa der Berliner Staatsrechtler Ulrich Battis, der in der Anhörung des Wiesbadener Landtags starke Bedenken gegen das Gesetz vorbrachte. Er sieht einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Religionsfreiheit. Innenminister Bouffier hält dagegen: „Wir stellen keine Beamten für Hinterzimmer ein, die niemals mit Publikum in Berührung kommen“, sagt der CDU-Politiker. „Beamte müssen überall einsetzbar sein.“ ....."
Quelle: http://www.merkur.de/2007_49_Reisstest_fuers_K.25050.0.html?&no_cache=1
Quelle: http://www.merkur.de/2007_49_Reisstest_fuers_K.25050.0.html?&no_cache=1
Wolf Thomas - am Donnerstag, 6. Dezember 2007, 11:04 - Rubrik: Archivrecht
KlausGraf - am Donnerstag, 6. Dezember 2007, 10:48 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen