"..... Um nach 20 Monaten Umbau die Neueröffnung der renommierten Kunsthalle Henri Nannens [in Emden] zu würdigen, wird mit rund 200 Werken von mehr als 100 Künstlern der "Garten Eden" in einer Sonderausstellung zur Schau gestellt. In acht Kapiteln zu Themen wie »Archiv und Ordnung«, »Locus amoenus« oder »Der Garten als Labor« geben Gemälde und Fotos, Skulpturen und Installationen auf die unterschiedlichste Art Zeugnis vom Garten in der Kunst seit 1900 – ob nun als Hort der Utopien, heiliger Hain oder wilde Natur. Natürlich sind die modernen Klassiker vertreten wie Claude Monet und Emil Nolde, Paul Cézanne und Paul Klee, Lovis Corinth und Max Liebermann, aber auch Zeitgenossen von Cecily Brown über Izima Kaoru zu Peter Fischli & David Weiss tragen ihre Sichtweise bei. ......"
Quelle: http://www.zeit.de/2007/52/Magnet-gruen
Weitere Informationen: http://www.kunsthalle-emden.de
Quelle: http://www.zeit.de/2007/52/Magnet-gruen
Weitere Informationen: http://www.kunsthalle-emden.de
Wolf Thomas - am Mittwoch, 19. Dezember 2007, 19:09 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Gastrosoph Dr. Nikolai Wojtko schreibt über das Aussterben des Filterkaffees und den Nutzen des Archivs:
" .... Meistens bedauert man, wenn etwas ausstirbt. In diesem Fall ist es anders. Es ist wahrlich eine wunderbare Entwicklung, dass der Filterkaffee allmählich ausstirbt. Schön, dass dieses unnatürlich braune Kaffeepulver, durch die dunklere Brennung in vielen vorzüglichen Varianten ersetzt wird. Man muss dem Filterkaffee sicherlich keine Träne nachweinen. Vielleicht erinnern sie sich noch, wie er im Büro stundenlang auf extra für diesen Zweck konzipierten Warmhalteplatten seinen Aromatod entgegensimmerte, bis seine Reste sich endgültig in eine Konsistenz aus Plastik verwandelten. Diese Dinge sollte es nur noch in der Erinnerung geben. Vielleicht noch in einem Archiv, um zukünftige Generationen vor dieser schlimmen esskulturellen Entgleisung zu warnen...."
Quelle: http://www.mercurio-press.net/html/firma_full.php?id=4462&mod_id=5&owner_id=335&ar_year=2007
" .... Meistens bedauert man, wenn etwas ausstirbt. In diesem Fall ist es anders. Es ist wahrlich eine wunderbare Entwicklung, dass der Filterkaffee allmählich ausstirbt. Schön, dass dieses unnatürlich braune Kaffeepulver, durch die dunklere Brennung in vielen vorzüglichen Varianten ersetzt wird. Man muss dem Filterkaffee sicherlich keine Träne nachweinen. Vielleicht erinnern sie sich noch, wie er im Büro stundenlang auf extra für diesen Zweck konzipierten Warmhalteplatten seinen Aromatod entgegensimmerte, bis seine Reste sich endgültig in eine Konsistenz aus Plastik verwandelten. Diese Dinge sollte es nur noch in der Erinnerung geben. Vielleicht noch in einem Archiv, um zukünftige Generationen vor dieser schlimmen esskulturellen Entgleisung zu warnen...."
Quelle: http://www.mercurio-press.net/html/firma_full.php?id=4462&mod_id=5&owner_id=335&ar_year=2007
Wolf Thomas - am Mittwoch, 19. Dezember 2007, 19:07 - Rubrik: Miscellanea
KlausGraf - am Mittwoch, 19. Dezember 2007, 18:48 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.awm.gov.au/diaries/index.asp
Digitised images of selected original war diaries recording the daily activities of Australian Army units, are available for the following conflicts:
* First World War
* Second World War
* Korean War
* South East Asian conflicts
Digitised images of selected original war diaries recording the daily activities of Australian Army units, are available for the following conflicts:
* First World War
* Second World War
* Korean War
* South East Asian conflicts
KlausGraf - am Mittwoch, 19. Dezember 2007, 18:47 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 19. Dezember 2007, 01:18 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine Ausstellung des Landesarchivs Berlin, in Zusammenarbeit mit der Stiftung Stadtmuseum Berlin, noch bis 18. April 2008
http://www.landesarchiv-berlin.de/lab-neu/01_01c56.htm
http://www.landesarchiv-berlin.de/lab-neu/01_01c56.htm
Bernd Hüttner - am Dienstag, 18. Dezember 2007, 19:25 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/KULTUR/1149087.html
Stuttgart (ddp). Im Kulturgüterstreit in Baden-Württemberg stuft eine Expertenkommission den weitaus größten Teil der badischen Sammlungen als Staatseigentum ein. In dem am Dienstag in Stuttgart vorgelegten Gutachten kommen die von der Landesregierung beauftragten Wissenschaftler zu dem Schluss, dass die Kunstschätze der badischen Großherzöge nach dem Ende der Monarchie auf die Republik übergingen. Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) betonte, das Gutachten werde Grundlage für das weitere Handeln der Regierung sein.
Zu den beauftragten Experten gehörte unter anderen der Verfassungsrechtler Ernst Gottfried Mahrenholz. Das rund 380 Seiten starke Papier der Kommission, in dem die Ergebnisse von mehr als einem Jahr Forschungsarbeit stecken, widerspricht einer Expertise des Hauses Baden. Die Adelsfamilie hatte jüngst ein eigenes Gutachten vorgelegt, das die Schätze weitgehend als Familienbesitz einstuft. Beide Seiten schließen inzwischen einen Rechtsstreit vor Gericht nicht mehr aus.
Die Kulturgüter sollen einen Gesamtwert von rund 300 Millionen Euro haben. Dem Gutachten der Expertenkommission zufolge stehen dem Haus Baden davon nur vereinzelte Bestände zu, darunter einige kleinere Gemäldesammlungen. Der Wert dieser Güter wird auf fünf bis sechs Millionen Euro geschätzt. Das Land will sie dem Haus Baden abkaufen.
http://www.pr-inside.com/de/neues-gutachten-im-badischen-handschriften-streit-r353413.htm
Die Kommission argumentiert unter anderem damit, dass die sogenannte Hofausstattung direkt mit dem Amt des Regenten als Staatsperson verbunden gewesen und infolgedessen «unveräußerlich, unbelastbar und unteilbar» und mit dem Ende der Monarchie durch Revolution auf die Republik übergegangen sei. Unstrittig dem Haus Baden zugeordnet werden 36 sogenannte Hinterlegungen, 13 Signaturen und drei Gemäldesammlungen. Wissenschaftsminister Peter Frankenberg bewertet die der Adelsfamilie zugesprochenen Gegenstände mit fünf bis sechs Millionen Euro.
In der FAZ vom 19.12.2007 (morgen) heisst es ergänzend:
Dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter Ernst Gottfried Mahrenholz schien das einstimmig gefasste, zugunsten des Auftraggebers ausfallende Gutachten schon fast peinlich zu sein: "Mir wäre es lieber gewesen, wenn unser Ergebnis gewesen wäre, 50 Prozent gehören dem Haus Baden und 50 Prozent dem Land, dann wäre unsere Glaubwürdigkeit größer."
Die einzelnen eigentumsrechtlichen Bewertungen stützen sich auf eine rechtsgeschichtliche Argumentation, die jenseits der Einzelheiten früherer Rechtsstreitigkeiten in stringenter Weise die Konsequenzen der verfassungsgeschichtlichen Entwicklung vom Absolutismus über den Verfassungsstaat des neunzehnten Jahrhunderts zur Republik herausarbeitet. Entscheidend sind die Aussagen der Juristen und Historiker zum Verbleib derjenigen fürstlichen Besitztümer, die der Wahrnehmung der fürstlichen Pflichten dienten (Pertinenzlehre), und zum Säkularisationsgut. Die Kommission unterscheidet Staatseigentum, Hausfideikommisseigentum und Privateigentum und kommt zu dem Schluss, dass Staatseigentum und Hausfidekommisseigentum nach der Revolution 1918 Eigentum der neu gegründeten Republik Baden geworden sind. "Die Hofausstattung war öffentlich-rechtliche Amtsausstattung des Regenten als Staatsperson und somit Pertinenz, das heißt Zubehör der Krone. Daher wurden Staats- und Hausfideikommisseigentum vom jeweiligen Regierungsnachfolger des Regenten übernommen."
In einem "gutachterlichen Positionspapier" hatten vom Haus Baden beauftragte Wissenschaftler die Pertinenzlehre verworfen, weil es sich nur um eine "Pertinenztheorie" handle, die in der Rechtspraxis bedeutungslos sei. Dieser Aufsagung widersprach Dietmar Willoweit, emeritierter Rechtshistoriker der Universität Würzburg und Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften: "Die Pertinenztheorie ist nicht Theorie, sondern sie ist geltendes Recht." Die ehemalige großherzogliche Familie könnte theoretisch am Hausfideikommiss Anteile haben, das hätte aber auf die Eigentumsverhältnisse nur dann Einfluss, wenn es vertraglich festgelegt wäre. "Das Erbteil eines Herrschaftshauses durfte vermehrt, aber nicht vermindert werden. Es war das Hausvermögen des Splendors und diente dem Haus zur Repräsentation", sagte Mahrenholz. Deshalb müsse auch der Nachfolgestaat diese Güter zum Zweck der staatlichen Repräsentation nutzen. Persönliches Eigentum des Monarchen waren die Gegenstände, die er aus der "Privatschatulle" bezahlt oder als Geschenk bekommen habe.
Anders als die Gutachter des Hauses Baden zählen die Gutachter des Landes auch die Domänen zum Staatseigentum, sie seien schon im neunzehnten Jahrhundert Teil der Amtsausstattung des konstitutionellen Staates gewesen, unterlägen also ebenso dem Pertinenzprinzip. Die Liegenschaften und Mobilien der Klöster seien schon mit der Säkularisierung im Reichsdeputationshauptschluss 1803 Staatseigentum geworden. Die 1927 gegründete Zähringer-Stiftung habe nie rechtswirksam Eigentum übertragen bekommen.
Hier findet sich auch eine Dokumentation zu den Eigentumsverhältnissen:
Die eigentumsrechtliche Zuordnung der Kulturgüter
gemäß dem Gutachten der Expertenkommission des Landes
Dem Haus Baden gehören
drei auf private Zuwendungen zurückgehende Kunstsammlungen:
- das Kopf'sche Kunstmuseum aus Baden-Baden,
- die Louis Jüncke´sche Gemäldesammlung aus Baden-Baden,
- die ehemalige Wessenberg'sche Gemäldesammlung (Wessenberg-
Galerie Konstanz);
vier Werke der ehemaligen Gipsabgusssammlung der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe:
- Jungfrau Maria, Marmorbüste von
K. Steinhäuser (Kat. Nr. 815),
- neunzehn Künstlerstatuetten von
Schwanthaler, Gips (Kat. Nr. 847 - 866),
- Freiherr Emmerich Josef von
Dalberg, Badischer Staatsminister,
Marmorbüste von H. Mülhäuser
(Geschenk des Freiherrn Heyl zu
Herrnsheim, Kat. Nr. 885),
- Großherzog Friedrich I. und Groß-
herzogin Luise von Baden, Bronze-
plaketten (Geschenk von Rudolf
Mayer, Kat. Nr. 888);
von den Beständen im Generallandesarchiv:
- der Urkundenbestand sowie ein
Kopialbuch aus dem Klosterarchiv
Salem,
- zwei hinterlegte Bestände mit
Schriftgut fürstlicher Personen,
- ein hinterlegter Bestand mit
Verwaltungsschriftgut (teilweise),
- sechsunddreißig Hinterlegungen
in der Badischen Landesbibliothek
Karlsruhe, darunter das "Speculum
humanae salvationis".
Dem Haus Baden gehören ferner
- dreizehn Signaturen Hebel-Handschriften in der Badischen Landesbibliothek,
- vier Tulpenbücher (Badische
Landesbibliothek und
Generallandesarchiv),
- zwei Bestände des ehemaligen
Haus- und Staatsarchivs,
- zwei Bestände des ehemaligen
Hausfideikommisses,
- das Großherzogliche Familienarchiv, wobei das Land an diesen Gegenständen auf Grund des Beschlusses
der Volksregierung vom 20. Februar 1919 ein dauerndes Besitzrecht hat.
Ein Thronsessel befindet sich im Eigentum des Landes, aber im Besitz des Hauses Baden (Salem).
Dem Land Baden-Württemberg gehört der Rest.
KOMMENTAR:
Man wird unschwer feststellen, dass die hier vertretene Rechtsauffassung hinsichtlich der Zähringer Stiftung eine andere war. Ich bin von der Ausstattung der Zähringer-Stiftung insbesondere mit der Jüncke'schen Sammlung und der Kopf'schen Sammlung nach wie vor überzeugt. Sobald mir das umfangreiche Gutachten vorliegt, werde ich prüfen, ob die Argumente der Juristen mir stichhaltig erscheinen. Hinsichtlich der auch von Mußgnug (und seinem Schüler Klein) vertretenen Pertinenz-Theorie gibt es keinen Dissens.
Ein Nebenprodukt der 300 000 Euro teuren Recherchen der Kommission ist ein Zufallsfund: Das Land hat ein Vorkaufsrecht.
Man fragt sich, wofür die 300.000 Euro (eine höchst dubiose Summe) ausgegeben wurden. Für das wöchentliche Sichten von ARCHIVALIA? Denn von einem "Zufallsfund" kann ja nun wirklich nicht die Rede sein, wenn in ARCHIVALIA wiederholt auf das Vorkaufsrecht des Landes hinsichtlich der ehemaligen Fideikommiss-Kulturgüter hingewiesen wurde:
http://archiv.twoday.net/search?q=vorkaufsrecht
Zuerst am 21.10.2006:
http://archiv.twoday.net/stories/2834592/
Ausführlicher dann am 31. Oktober 2006 mit genauen Belegen:
http://archiv.twoday.net/stories/2876347/
In der Folgezeit wurde es dann immer wieder erwähnt.
 Tulpenbuch, BLB
Tulpenbuch, BLB
Stuttgart (ddp). Im Kulturgüterstreit in Baden-Württemberg stuft eine Expertenkommission den weitaus größten Teil der badischen Sammlungen als Staatseigentum ein. In dem am Dienstag in Stuttgart vorgelegten Gutachten kommen die von der Landesregierung beauftragten Wissenschaftler zu dem Schluss, dass die Kunstschätze der badischen Großherzöge nach dem Ende der Monarchie auf die Republik übergingen. Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) betonte, das Gutachten werde Grundlage für das weitere Handeln der Regierung sein.
Zu den beauftragten Experten gehörte unter anderen der Verfassungsrechtler Ernst Gottfried Mahrenholz. Das rund 380 Seiten starke Papier der Kommission, in dem die Ergebnisse von mehr als einem Jahr Forschungsarbeit stecken, widerspricht einer Expertise des Hauses Baden. Die Adelsfamilie hatte jüngst ein eigenes Gutachten vorgelegt, das die Schätze weitgehend als Familienbesitz einstuft. Beide Seiten schließen inzwischen einen Rechtsstreit vor Gericht nicht mehr aus.
Die Kulturgüter sollen einen Gesamtwert von rund 300 Millionen Euro haben. Dem Gutachten der Expertenkommission zufolge stehen dem Haus Baden davon nur vereinzelte Bestände zu, darunter einige kleinere Gemäldesammlungen. Der Wert dieser Güter wird auf fünf bis sechs Millionen Euro geschätzt. Das Land will sie dem Haus Baden abkaufen.
http://www.pr-inside.com/de/neues-gutachten-im-badischen-handschriften-streit-r353413.htm
Die Kommission argumentiert unter anderem damit, dass die sogenannte Hofausstattung direkt mit dem Amt des Regenten als Staatsperson verbunden gewesen und infolgedessen «unveräußerlich, unbelastbar und unteilbar» und mit dem Ende der Monarchie durch Revolution auf die Republik übergegangen sei. Unstrittig dem Haus Baden zugeordnet werden 36 sogenannte Hinterlegungen, 13 Signaturen und drei Gemäldesammlungen. Wissenschaftsminister Peter Frankenberg bewertet die der Adelsfamilie zugesprochenen Gegenstände mit fünf bis sechs Millionen Euro.
In der FAZ vom 19.12.2007 (morgen) heisst es ergänzend:
Dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter Ernst Gottfried Mahrenholz schien das einstimmig gefasste, zugunsten des Auftraggebers ausfallende Gutachten schon fast peinlich zu sein: "Mir wäre es lieber gewesen, wenn unser Ergebnis gewesen wäre, 50 Prozent gehören dem Haus Baden und 50 Prozent dem Land, dann wäre unsere Glaubwürdigkeit größer."
Die einzelnen eigentumsrechtlichen Bewertungen stützen sich auf eine rechtsgeschichtliche Argumentation, die jenseits der Einzelheiten früherer Rechtsstreitigkeiten in stringenter Weise die Konsequenzen der verfassungsgeschichtlichen Entwicklung vom Absolutismus über den Verfassungsstaat des neunzehnten Jahrhunderts zur Republik herausarbeitet. Entscheidend sind die Aussagen der Juristen und Historiker zum Verbleib derjenigen fürstlichen Besitztümer, die der Wahrnehmung der fürstlichen Pflichten dienten (Pertinenzlehre), und zum Säkularisationsgut. Die Kommission unterscheidet Staatseigentum, Hausfideikommisseigentum und Privateigentum und kommt zu dem Schluss, dass Staatseigentum und Hausfidekommisseigentum nach der Revolution 1918 Eigentum der neu gegründeten Republik Baden geworden sind. "Die Hofausstattung war öffentlich-rechtliche Amtsausstattung des Regenten als Staatsperson und somit Pertinenz, das heißt Zubehör der Krone. Daher wurden Staats- und Hausfideikommisseigentum vom jeweiligen Regierungsnachfolger des Regenten übernommen."
In einem "gutachterlichen Positionspapier" hatten vom Haus Baden beauftragte Wissenschaftler die Pertinenzlehre verworfen, weil es sich nur um eine "Pertinenztheorie" handle, die in der Rechtspraxis bedeutungslos sei. Dieser Aufsagung widersprach Dietmar Willoweit, emeritierter Rechtshistoriker der Universität Würzburg und Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften: "Die Pertinenztheorie ist nicht Theorie, sondern sie ist geltendes Recht." Die ehemalige großherzogliche Familie könnte theoretisch am Hausfideikommiss Anteile haben, das hätte aber auf die Eigentumsverhältnisse nur dann Einfluss, wenn es vertraglich festgelegt wäre. "Das Erbteil eines Herrschaftshauses durfte vermehrt, aber nicht vermindert werden. Es war das Hausvermögen des Splendors und diente dem Haus zur Repräsentation", sagte Mahrenholz. Deshalb müsse auch der Nachfolgestaat diese Güter zum Zweck der staatlichen Repräsentation nutzen. Persönliches Eigentum des Monarchen waren die Gegenstände, die er aus der "Privatschatulle" bezahlt oder als Geschenk bekommen habe.
Anders als die Gutachter des Hauses Baden zählen die Gutachter des Landes auch die Domänen zum Staatseigentum, sie seien schon im neunzehnten Jahrhundert Teil der Amtsausstattung des konstitutionellen Staates gewesen, unterlägen also ebenso dem Pertinenzprinzip. Die Liegenschaften und Mobilien der Klöster seien schon mit der Säkularisierung im Reichsdeputationshauptschluss 1803 Staatseigentum geworden. Die 1927 gegründete Zähringer-Stiftung habe nie rechtswirksam Eigentum übertragen bekommen.
Hier findet sich auch eine Dokumentation zu den Eigentumsverhältnissen:
Die eigentumsrechtliche Zuordnung der Kulturgüter
gemäß dem Gutachten der Expertenkommission des Landes
Dem Haus Baden gehören
drei auf private Zuwendungen zurückgehende Kunstsammlungen:
- das Kopf'sche Kunstmuseum aus Baden-Baden,
- die Louis Jüncke´sche Gemäldesammlung aus Baden-Baden,
- die ehemalige Wessenberg'sche Gemäldesammlung (Wessenberg-
Galerie Konstanz);
vier Werke der ehemaligen Gipsabgusssammlung der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe:
- Jungfrau Maria, Marmorbüste von
K. Steinhäuser (Kat. Nr. 815),
- neunzehn Künstlerstatuetten von
Schwanthaler, Gips (Kat. Nr. 847 - 866),
- Freiherr Emmerich Josef von
Dalberg, Badischer Staatsminister,
Marmorbüste von H. Mülhäuser
(Geschenk des Freiherrn Heyl zu
Herrnsheim, Kat. Nr. 885),
- Großherzog Friedrich I. und Groß-
herzogin Luise von Baden, Bronze-
plaketten (Geschenk von Rudolf
Mayer, Kat. Nr. 888);
von den Beständen im Generallandesarchiv:
- der Urkundenbestand sowie ein
Kopialbuch aus dem Klosterarchiv
Salem,
- zwei hinterlegte Bestände mit
Schriftgut fürstlicher Personen,
- ein hinterlegter Bestand mit
Verwaltungsschriftgut (teilweise),
- sechsunddreißig Hinterlegungen
in der Badischen Landesbibliothek
Karlsruhe, darunter das "Speculum
humanae salvationis".
Dem Haus Baden gehören ferner
- dreizehn Signaturen Hebel-Handschriften in der Badischen Landesbibliothek,
- vier Tulpenbücher (Badische
Landesbibliothek und
Generallandesarchiv),
- zwei Bestände des ehemaligen
Haus- und Staatsarchivs,
- zwei Bestände des ehemaligen
Hausfideikommisses,
- das Großherzogliche Familienarchiv, wobei das Land an diesen Gegenständen auf Grund des Beschlusses
der Volksregierung vom 20. Februar 1919 ein dauerndes Besitzrecht hat.
Ein Thronsessel befindet sich im Eigentum des Landes, aber im Besitz des Hauses Baden (Salem).
Dem Land Baden-Württemberg gehört der Rest.
KOMMENTAR:
Man wird unschwer feststellen, dass die hier vertretene Rechtsauffassung hinsichtlich der Zähringer Stiftung eine andere war. Ich bin von der Ausstattung der Zähringer-Stiftung insbesondere mit der Jüncke'schen Sammlung und der Kopf'schen Sammlung nach wie vor überzeugt. Sobald mir das umfangreiche Gutachten vorliegt, werde ich prüfen, ob die Argumente der Juristen mir stichhaltig erscheinen. Hinsichtlich der auch von Mußgnug (und seinem Schüler Klein) vertretenen Pertinenz-Theorie gibt es keinen Dissens.
Ein Nebenprodukt der 300 000 Euro teuren Recherchen der Kommission ist ein Zufallsfund: Das Land hat ein Vorkaufsrecht.
Man fragt sich, wofür die 300.000 Euro (eine höchst dubiose Summe) ausgegeben wurden. Für das wöchentliche Sichten von ARCHIVALIA? Denn von einem "Zufallsfund" kann ja nun wirklich nicht die Rede sein, wenn in ARCHIVALIA wiederholt auf das Vorkaufsrecht des Landes hinsichtlich der ehemaligen Fideikommiss-Kulturgüter hingewiesen wurde:
http://archiv.twoday.net/search?q=vorkaufsrecht
Zuerst am 21.10.2006:
http://archiv.twoday.net/stories/2834592/
Ausführlicher dann am 31. Oktober 2006 mit genauen Belegen:
http://archiv.twoday.net/stories/2876347/
In der Folgezeit wurde es dann immer wieder erwähnt.
 Tulpenbuch, BLB
Tulpenbuch, BLBDas Archiv der RWTH Aachen und das Archiv der Fachhochschule Aachen haben einen gemeinsamen Kalender für 2008 mit Bildern aus ihren Beständen vorgelegt.

Eine Auswahl der Kalenderblätter gibts als Download unter
http://www.archiv.rwth-aachen.de/Kalender_kurz.pdf
Der Kalender ist für einen Unkostenbeitrag von 10 Euro beim Hochschularchiv Aachen erhältlich.
http://www.hochschularchiv-aachen.de

Eine Auswahl der Kalenderblätter gibts als Download unter
http://www.archiv.rwth-aachen.de/Kalender_kurz.pdf
Der Kalender ist für einen Unkostenbeitrag von 10 Euro beim Hochschularchiv Aachen erhältlich.
http://www.hochschularchiv-aachen.de
KlausGraf - am Dienstag, 18. Dezember 2007, 14:01 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.fotostoria.de/?p=1049
Archivalia wird in der Liste des "Rundbrief Fotografie" ignoriert, obwohl wir alle paar Tage eine Meldung zur Rubrik Fotoueberlieferung haben.
Archivalia wird in der Liste des "Rundbrief Fotografie" ignoriert, obwohl wir alle paar Tage eine Meldung zur Rubrik Fotoueberlieferung haben.
KlausGraf - am Dienstag, 18. Dezember 2007, 02:10 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die 3sat-Kulturzeit berichtete heute in ihren Nachrichten folgendes:
"Die Österreichische Nationalbibliothek hat jetzt einen großen Teil von Handkes Vorlass - oder, wie Robert Musil es genannt hätte, Nachlasses zu Lebzeiten - erworben. Dazu zählen handschriftliche Werkmanuskripte, Notizen und Materialsammlungen. Die großen Romane "Mein Jahr in der Niemandsbucht" und "Der Bildverlust oder durch die Sierra de Gredos" sind in dem Bestand ebenso enthalten wie kürzere Prosaarbeiten. Auch die Theaterstücke "Die Fahrt im Einbaum", "Zurüstungen für die Unsterblichkeit", "Untertagblues" und "Spuren der Verirrten" finden sich neben Übersetzungen und essayistischen Arbeiten. ..... "
s.a.:
http://derstandard.at/?url=/?id=3154375
http://wien.orf.at/stories/243583/
http://diepresse.com/text/home/kultur/literatur/349523
So neu ist die Meldung nicht, denn bereits aus Anlass des 65. Geburtstages von Handke wurde über die Vorlass-Ankauf berichtet, s. dazu: http://oe1.orf.at/inforadio/84281.html?filter=5
zu Peter Handke:
http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Handke
Nachtrag 19.12.2007:
http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/jahreszeiten_des_schreibens_1.601022.html
"Die Österreichische Nationalbibliothek hat jetzt einen großen Teil von Handkes Vorlass - oder, wie Robert Musil es genannt hätte, Nachlasses zu Lebzeiten - erworben. Dazu zählen handschriftliche Werkmanuskripte, Notizen und Materialsammlungen. Die großen Romane "Mein Jahr in der Niemandsbucht" und "Der Bildverlust oder durch die Sierra de Gredos" sind in dem Bestand ebenso enthalten wie kürzere Prosaarbeiten. Auch die Theaterstücke "Die Fahrt im Einbaum", "Zurüstungen für die Unsterblichkeit", "Untertagblues" und "Spuren der Verirrten" finden sich neben Übersetzungen und essayistischen Arbeiten. ..... "
s.a.:
http://derstandard.at/?url=/?id=3154375
http://wien.orf.at/stories/243583/
http://diepresse.com/text/home/kultur/literatur/349523
So neu ist die Meldung nicht, denn bereits aus Anlass des 65. Geburtstages von Handke wurde über die Vorlass-Ankauf berichtet, s. dazu: http://oe1.orf.at/inforadio/84281.html?filter=5
zu Peter Handke:
http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Handke
Nachtrag 19.12.2007:
http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/jahreszeiten_des_schreibens_1.601022.html
Wolf Thomas - am Montag, 17. Dezember 2007, 21:51 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://sciencecommons.org/projects/publishing/open-access-data-protocol/
This memo provides information for the Internet community interested in distributing data or databases under an “open access” structure.
See also
http://www.earlham.edu/~peters/fos/2007/12/science-commons-protocol-for-open-data.html
Suber writes:
The protocol "is persuasive. For example, I've been thinking that any open data standard would probably have to require attribution, if only to recruit participating researchers. But the protocol cogently argues that such a requirement would result in "attribution stacking" (e.g. crediting "40,000 data depositors in the event of a query across 40,000 data sets") and violate the "principle of low transaction costs." It's equally cogent in arguing that open data should not limit re-use with "share-alike" and similar contractual restrictions."
This memo provides information for the Internet community interested in distributing data or databases under an “open access” structure.
See also
http://www.earlham.edu/~peters/fos/2007/12/science-commons-protocol-for-open-data.html
Suber writes:
The protocol "is persuasive. For example, I've been thinking that any open data standard would probably have to require attribution, if only to recruit participating researchers. But the protocol cogently argues that such a requirement would result in "attribution stacking" (e.g. crediting "40,000 data depositors in the event of a query across 40,000 data sets") and violate the "principle of low transaction costs." It's equally cogent in arguing that open data should not limit re-use with "share-alike" and similar contractual restrictions."
KlausGraf - am Montag, 17. Dezember 2007, 19:18 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Catalogers are wonderful people: we had 2 occasions to confirm this
great opinion.
About "Text block defect description" , we had 29 emails in 2 days,
about dog-ear, dog earings, dog-eared witness,
alszeugnisumschlagendenpapierblattgutgottbereits, temoin, binder's
hangover, binder's dog ear, binder's folded corner, etc...
And the 2 following days (including sunday) again 38 emails about the
correct way to list pages in bibliography and in the The Golden Ass of
Apuleius. Apuleius (and his Golden Ass) certainly would have like this
discussion , becaus he was a very famous and emeritus rhetor and much
more...
We are really delighted to read some magic formulas such:
v-xxxv-27-239
converted into [iv],v-xxxv, [1],
then into [i-iv]v-xxxv [xxxvi], 27-239 [240],
and [4], v-xxxv,[1],27-239
and so on...
Is [1-2] 3-16, [1-2] 3-16 better than [1-2] 3-16 [1-2] 3-16 ?
Are we reading magic formulas ? At least we need some Enigma machine to
decipher the code.
Or probably catalogers are members of an international and dangerous
sect, with some hidden God utturing some uncomprehensible rules and
laws, gurus to clarify the unclear, and practising and non practising
members
God save catalogers!
François Lapèlerie
Université de la Mediterranée
13009 Marseille -- France
Ex: EXLIBRIS list
great opinion.
About "Text block defect description" , we had 29 emails in 2 days,
about dog-ear, dog earings, dog-eared witness,
alszeugnisumschlagendenpapierblattgutgottbereits, temoin, binder's
hangover, binder's dog ear, binder's folded corner, etc...
And the 2 following days (including sunday) again 38 emails about the
correct way to list pages in bibliography and in the The Golden Ass of
Apuleius. Apuleius (and his Golden Ass) certainly would have like this
discussion , becaus he was a very famous and emeritus rhetor and much
more...
We are really delighted to read some magic formulas such:
v-xxxv-27-239
converted into [iv],v-xxxv, [1],
then into [i-iv]v-xxxv [xxxvi], 27-239 [240],
and [4], v-xxxv,[1],27-239
and so on...
Is [1-2] 3-16, [1-2] 3-16 better than [1-2] 3-16 [1-2] 3-16 ?
Are we reading magic formulas ? At least we need some Enigma machine to
decipher the code.
Or probably catalogers are members of an international and dangerous
sect, with some hidden God utturing some uncomprehensible rules and
laws, gurus to clarify the unclear, and practising and non practising
members
God save catalogers!
François Lapèlerie
Université de la Mediterranée
13009 Marseille -- France
Ex: EXLIBRIS list
KlausGraf - am Montag, 17. Dezember 2007, 19:13 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Auf http://www.historicum.net ist nun zu lesen:
Durch die am 1.1.2008 in Kraft tretende Urheberrechtsreform droht Autoren von Werken, die zwischen 1966 und 1995 veröffentlicht wurden, der Verlust ihrer Nutzungsrechte für eine Internetpublikation dieser Werke (§ 137l UrhG). Wer jedoch bis zum 31.12.2007 der Bayerischen Staatsbibliothek als Betreiberin des geschichtswissenschaftlichen Informationsportals historicum.net ein einfaches Nutzungsrecht einräumt, wahrt die Möglichkeit einer Open-Access-Publikation älterer Fachveröffentlichungen.
Wie überträgt man die Nutzungsrechte an historicum.net?
Richten Sie eine Mail (oder einen Brief an):
Redaktion historicum.net
Gregor Horstkemper
Bayerische Staatsbibliothek
Fachkoordination Geschichte
D-80328 München
Tel.: +49-(0)89-28638-2604
E-Mail: redaktion(at)historicum.net
Sehr geehrter Herr Horstkemper,
hiermit übertrage ich der Bayerischen Staatsbibliothek als Betreiberin des geschichtswissenschaftlichen Informationsportals historicum.net ein einfaches Nutzungsrecht zur Online-Publikation im Internet aller meiner in der Zeit vom 1.1.1966 bis 31.12.1994 erschienenen Publikationen.
Mit freundlichen Grüßen
Fügen Sie, wenn möglich, eine Liste der Publikationen bei.
Durch die am 1.1.2008 in Kraft tretende Urheberrechtsreform droht Autoren von Werken, die zwischen 1966 und 1995 veröffentlicht wurden, der Verlust ihrer Nutzungsrechte für eine Internetpublikation dieser Werke (§ 137l UrhG). Wer jedoch bis zum 31.12.2007 der Bayerischen Staatsbibliothek als Betreiberin des geschichtswissenschaftlichen Informationsportals historicum.net ein einfaches Nutzungsrecht einräumt, wahrt die Möglichkeit einer Open-Access-Publikation älterer Fachveröffentlichungen.
Wie überträgt man die Nutzungsrechte an historicum.net?
Richten Sie eine Mail (oder einen Brief an):
Redaktion historicum.net
Gregor Horstkemper
Bayerische Staatsbibliothek
Fachkoordination Geschichte
D-80328 München
Tel.: +49-(0)89-28638-2604
E-Mail: redaktion(at)historicum.net
Sehr geehrter Herr Horstkemper,
hiermit übertrage ich der Bayerischen Staatsbibliothek als Betreiberin des geschichtswissenschaftlichen Informationsportals historicum.net ein einfaches Nutzungsrecht zur Online-Publikation im Internet aller meiner in der Zeit vom 1.1.1966 bis 31.12.1994 erschienenen Publikationen.
Mit freundlichen Grüßen
Fügen Sie, wenn möglich, eine Liste der Publikationen bei.
KlausGraf - am Montag, 17. Dezember 2007, 18:47 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.inghist.nl/retro
Het ING digitaliseert deze serie (de RGP) en heeft een applicatie ontwikkeld om elektronisch door de boeken te bladeren. De electronische versie blijft zo dicht mogelijk bij de ontsluiting van de oorspronkelijke uitgave. Tegelijkertijd is er getracht van de nieuwe mogelijkheden van een digitale publicatie gebruik te maken door de tekst doorzoekbaar te maken, en, waar mogelijk, aanklikbare inhoudsopgaves en/of indexen toe te voegen. In de toelichting vindt u meer informatie over de gekozen aanpak.
De eerste vier publicaties (in totaal 33 delen) die met deze methode zijn gedigitaliseerd, zijn in december 2007 op het internet beschikbaar gesteld:
* De VOC. Beschrijving door Pieter van Dam 1693-1701, 7 delen.
* Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936, 3 delen.
* Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, 20 delen.
* Excerpta Romana, Bronnen der Romeinse Geschiedenis van Nederland, 3 delen.

Het ING digitaliseert deze serie (de RGP) en heeft een applicatie ontwikkeld om elektronisch door de boeken te bladeren. De electronische versie blijft zo dicht mogelijk bij de ontsluiting van de oorspronkelijke uitgave. Tegelijkertijd is er getracht van de nieuwe mogelijkheden van een digitale publicatie gebruik te maken door de tekst doorzoekbaar te maken, en, waar mogelijk, aanklikbare inhoudsopgaves en/of indexen toe te voegen. In de toelichting vindt u meer informatie over de gekozen aanpak.
De eerste vier publicaties (in totaal 33 delen) die met deze methode zijn gedigitaliseerd, zijn in december 2007 op het internet beschikbaar gesteld:
* De VOC. Beschrijving door Pieter van Dam 1693-1701, 7 delen.
* Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936, 3 delen.
* Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, 20 delen.
* Excerpta Romana, Bronnen der Romeinse Geschiedenis van Nederland, 3 delen.

KlausGraf - am Montag, 17. Dezember 2007, 18:27 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Viele Mitarbeiter unterstuetzen die Aktion und wie in Bielefeld und an anderen Bibliotheken ist die Resonanz sehr hoch", erfährt man in INETBIB von der UB Chemnitz.
Aus einer anderen Hochschule war allerdings zu erfahren, dass man dort nichts tut, da der Rektor gegen Open Access sei.
Nachtrag: Nach den bisherigen Erfolgsmeldungen giesst eine Zahl der TU Berlin Wasser in den Wein:
http://archiv.twoday.net/stories/4552735/
Aus einer anderen Hochschule war allerdings zu erfahren, dass man dort nichts tut, da der Rektor gegen Open Access sei.
Nachtrag: Nach den bisherigen Erfolgsmeldungen giesst eine Zahl der TU Berlin Wasser in den Wein:
http://archiv.twoday.net/stories/4552735/
KlausGraf - am Montag, 17. Dezember 2007, 14:46 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Freya Klier fordert in der Welt (Link) keine Verklärung des DDR-Unrechtsstaats und geht auf die Geschichte der jetzigen Birthler-Behörde ein:
" ..... Nachdem die Gauck-Behörde gerettet war, blieb doch ein anhaltendes Unbehagen. Einer hatte sich da hineingewagt, in außerordentlicher Tapferkeit: der Schriftsteller, Psychologe und DDR-Dissident Jürgen Fuchs. Er ließ sich eine Zeit lang als Mitarbeiter einstellen, um das Archiv von innen zu beurteilen. Im April 1992 war Dienstbeginn, ein Jahr wollte Jürgen Fuchs durchhalten. ... Jürgen Fuchs, Ende der 70er-Jahre selbst Häftling in Hohenschönhausen, beschreibt damit schon den ganzen Wende-Vorgang: „Erinnerung ist Krankheit, Empfindsamkeit, Pathologie. Wichtig sind jetzt Organisation, Ordnung, Effizienz, Abwicklung, Aufbau, Umbau, Aufarbeitung, Dienstführung, Auswertung... SIE haben schon alles aufgeschrieben, sieh nur ihre Archive, Fabrikhallen voller Vorgänge...“
...... Jürgen Fuchs war auch der Erste, der die in die Gauck-Behörde eingeschleusten Stasi-Mitarbeiter bemerkte: sogenanntes Wachpersonal, eine Militärhistorikerin aus der DDR, eine Dame aus der Kaderabteilung der Mitropa, eine Reihe merkwürdiger Gestalten in den Archiven. Er erkannte sie an ihrer Sprache... ihren misstrauischen Blicken – denn auch sie wussten, wer er ist. Ein Jahr lang reichte man einander Richtlinien und Merkblätter zu...."
" ..... Nachdem die Gauck-Behörde gerettet war, blieb doch ein anhaltendes Unbehagen. Einer hatte sich da hineingewagt, in außerordentlicher Tapferkeit: der Schriftsteller, Psychologe und DDR-Dissident Jürgen Fuchs. Er ließ sich eine Zeit lang als Mitarbeiter einstellen, um das Archiv von innen zu beurteilen. Im April 1992 war Dienstbeginn, ein Jahr wollte Jürgen Fuchs durchhalten. ... Jürgen Fuchs, Ende der 70er-Jahre selbst Häftling in Hohenschönhausen, beschreibt damit schon den ganzen Wende-Vorgang: „Erinnerung ist Krankheit, Empfindsamkeit, Pathologie. Wichtig sind jetzt Organisation, Ordnung, Effizienz, Abwicklung, Aufbau, Umbau, Aufarbeitung, Dienstführung, Auswertung... SIE haben schon alles aufgeschrieben, sieh nur ihre Archive, Fabrikhallen voller Vorgänge...“
...... Jürgen Fuchs war auch der Erste, der die in die Gauck-Behörde eingeschleusten Stasi-Mitarbeiter bemerkte: sogenanntes Wachpersonal, eine Militärhistorikerin aus der DDR, eine Dame aus der Kaderabteilung der Mitropa, eine Reihe merkwürdiger Gestalten in den Archiven. Er erkannte sie an ihrer Sprache... ihren misstrauischen Blicken – denn auch sie wussten, wer er ist. Ein Jahr lang reichte man einander Richtlinien und Merkblätter zu...."
Wolf Thomas - am Montag, 17. Dezember 2007, 14:45 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ....Die Linux-Entwicklung auch noch nach Jahren nachvollziehbar zu machen haben sich mehrere Entwickler zur Aufgabe gemacht. Sie arbeiten an einem Git-Archiv, das die Änderungen am Kernel von Version 0.0.1 bis heute dokumentiert. .....
Derzeit steht das Archiv mit den gesammelten Versionen, Patches und Changelogs bei einer Größe von gut 1,9 Gigabyte. Darin enhalten sind circa 1040 Commits, davon 420 mit ihren Changelogs. Sie sind in Anlehnung an die Kernel-Entwicklung strukturiert. ...."
Quelle: http://www.linux-magazin.de/meldung/18766
Derzeit steht das Archiv mit den gesammelten Versionen, Patches und Changelogs bei einer Größe von gut 1,9 Gigabyte. Darin enhalten sind circa 1040 Commits, davon 420 mit ihren Changelogs. Sie sind in Anlehnung an die Kernel-Entwicklung strukturiert. ...."
Quelle: http://www.linux-magazin.de/meldung/18766
Wolf Thomas - am Montag, 17. Dezember 2007, 14:42 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Dieser Frage geht der Tagesspiel nach und beschreibt die Problemlage wie folgt:
" ..... Tänzer wie auch Wissenschaftler sind mit einer doppelten Geschichtstradition konfrontiert: mit dem lückenhaften Archiv der Dokumente vergangener Tanzereignisse; und mit dem lebendigen Archiv zeitgenössischer Tanzformen, ihren Experimenten und Entwürfen. ...."Quelle: http://www.tagesspiegel.de/magazin/wissen/;art304,2440506
" ..... Tänzer wie auch Wissenschaftler sind mit einer doppelten Geschichtstradition konfrontiert: mit dem lückenhaften Archiv der Dokumente vergangener Tanzereignisse; und mit dem lebendigen Archiv zeitgenössischer Tanzformen, ihren Experimenten und Entwürfen. ...."Quelle: http://www.tagesspiegel.de/magazin/wissen/;art304,2440506
Wolf Thomas - am Montag, 17. Dezember 2007, 14:38 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Taz (Link)interviewt Sissel Tolaas vor:
" .... [Sie] kämpft für die Befreiung unserer Nasen. Die 46-Jährige ist als Duftforscherin, Künstlerin und Linguistin dem Zusammenhang von Geruch und Kommunikation auf der Spur. Dabei scheut die gebürtige Norwegerin, die in Schöneberg lebt, auch nicht vor drastischen Methoden zurück: Sie sprüht sich mit Angstschweiß ein, macht Ausstellungsbesucher mit dem konzentrierten Duft von Geld verrückt und stellt in ihrem hauseigenen Labor Hundekacke- und Schlachthausaromen her. Die in der Wohnung umherwabernden Gerüche stören weder sie noch ihre zehnjährige Tochter. Der hat Tolaas bereits eine feine, aber äußerst tolerante Nase anerzogen. ...
Wie haben Sie es geschafft, Ihre Nase zu neutralisieren?
Das war ein harter Kampf. Ich habe in meinem Archiv rund 7.000 Gerüche. Angenehme habe ich so lange mit unangenehmen gepaart, bis ich alle akzeptieren konnte. Sieben Jahre dauerte das. Jetzt kann ich Gerüche aushalten, die für andere komplett unerträglich sind. ...."
" .... [Sie] kämpft für die Befreiung unserer Nasen. Die 46-Jährige ist als Duftforscherin, Künstlerin und Linguistin dem Zusammenhang von Geruch und Kommunikation auf der Spur. Dabei scheut die gebürtige Norwegerin, die in Schöneberg lebt, auch nicht vor drastischen Methoden zurück: Sie sprüht sich mit Angstschweiß ein, macht Ausstellungsbesucher mit dem konzentrierten Duft von Geld verrückt und stellt in ihrem hauseigenen Labor Hundekacke- und Schlachthausaromen her. Die in der Wohnung umherwabernden Gerüche stören weder sie noch ihre zehnjährige Tochter. Der hat Tolaas bereits eine feine, aber äußerst tolerante Nase anerzogen. ...
Wie haben Sie es geschafft, Ihre Nase zu neutralisieren?
Das war ein harter Kampf. Ich habe in meinem Archiv rund 7.000 Gerüche. Angenehme habe ich so lange mit unangenehmen gepaart, bis ich alle akzeptieren konnte. Sieben Jahre dauerte das. Jetzt kann ich Gerüche aushalten, die für andere komplett unerträglich sind. ...."
Wolf Thomas - am Montag, 17. Dezember 2007, 14:27 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 17. Dezember 2007, 04:05 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das kommt davon, wenn man Fraktur nimmer lesen kann. In der Darlington Digital Library gibts auch deutschsprachige Bücher (2?).
http://digital.library.pitt.edu/d/darlington/books.html

http://digital.library.pitt.edu/d/darlington/books.html

KlausGraf - am Montag, 17. Dezember 2007, 03:42 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Meine eigenen Versuche sind immer noch nicht besonders toll, vor allem wegen des Beleuchtungsproblems (die meinem Repro-Stativ eigenen Lampen sind zu hell und leuchten vor allem die Fläche nicht gleichmäßig aus). Im Blog "Bibliophile Bullpen" habe ich nun einige Ideen gesehen, wie ich das Problem vielleicht bald mit wenig Aufwand vermindern kann:
http://bibliophilebullpen.blogspot.com/2007/12/light-on-subject.html
http://bibliophilebullpen.blogspot.com/2007/12/light-on-subject.html
Ladislaus - am Montag, 17. Dezember 2007, 00:28 - Rubrik: Technik
Ich glaube, dieses Blog hatten wir hier noch nicht. Es geht hauptsächlich um das Sammeln und Digitalisieren von Fotos.
The Practical Archivist
Archiving tips and geeky tidbits for genealogists, keepers of the family photo album, and anyone who loves a beautiful anachronism. Written by an archivist who never met an antique photograph (or a Czech beer) she didn't like.
http://practicalarchivist.blogspot.com/
The Practical Archivist
Archiving tips and geeky tidbits for genealogists, keepers of the family photo album, and anyone who loves a beautiful anachronism. Written by an archivist who never met an antique photograph (or a Czech beer) she didn't like.
http://practicalarchivist.blogspot.com/
Ladislaus - am Montag, 17. Dezember 2007, 00:25 - Rubrik: Weblogs
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2007/12/16/dlf_20071216_1752_f4457eb1.mp3 (Sendung Kultur heute vom 16.12.2007)
Klaus Ceynowa spricht vornehmlich über zweierlei Unternehmungen der Bayerischen Staatsbibliothek:
1. dem Digitalisierungsprojekt der Bücher aus dem 16. Jh. der BSB und
2. der Zusammenarbeit mit dem Projekt Google Books.
Danke an M. Anders für den Hinweis.
Kommentar: Man fühle sich der Philosophie des Open Access verpflichtet, sagt der Direktor am Schluss. Mit dem martialischen Copyfraud und dem Quasi-DRM des MDZ ist OA aber nicht vereinbar!
Klaus Ceynowa spricht vornehmlich über zweierlei Unternehmungen der Bayerischen Staatsbibliothek:
1. dem Digitalisierungsprojekt der Bücher aus dem 16. Jh. der BSB und
2. der Zusammenarbeit mit dem Projekt Google Books.
Danke an M. Anders für den Hinweis.
Kommentar: Man fühle sich der Philosophie des Open Access verpflichtet, sagt der Direktor am Schluss. Mit dem martialischen Copyfraud und dem Quasi-DRM des MDZ ist OA aber nicht vereinbar!
KlausGraf - am Sonntag, 16. Dezember 2007, 19:05 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://technikforschung.twoday.net/stories/4535923/
Für den Bereich Sozialwissenschaften können Forscher ohne Uni-Anbindung ihre Rechte bis zum 31.12.2007 an das "Social Science Open Access Repository" (SSOAR)
http://www.ssoar.info/
übertragen.
Für den Bereich Sozialwissenschaften können Forscher ohne Uni-Anbindung ihre Rechte bis zum 31.12.2007 an das "Social Science Open Access Repository" (SSOAR)
http://www.ssoar.info/
übertragen.
KlausGraf - am Sonntag, 16. Dezember 2007, 02:04 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Als ich vor rund 15 Jahren nach den frühesten Belegen des Worts Raubritter suchte, herrschte in der einschlägigen historischen Literatur zum spätmittelalterlichen Raubrittertum die irrige Ansicht vor, der im Grimmschen Wörterbuch gegebene Beleg aus Friedrich Chr. Schlossers Weltgeschichte 1847 sei der Erstbeleg. Ich konnte darauf hinweisen, dass bereits in den Deutschen Sagen der Brüder Grimm (1816/18) Raubritter vorkommen und fand noch einen etwas älteren Beleg in Gottschalcks Ritterburgen Bd. 1, 1810 (ZGO 141, 1993, S. 137f.). Wenig später entdeckte ich "Raubritter" im Titel eines 1799 erschienenen Ritterromans "Der Raubritter mit dem Stahlarme", der im Jahr 1800 in der "Neuen Allgemeinen Deutschen Bibliothek" verrissen wurde (ein Exemplar dieses Buchs ist anscheinend nicht erhalten). 1997 veröffentlichte ich diesen Fund in Kurt Andermanns Sammelband "Raubritter" oder "Rechtschaffene vom Adel", S. 179f. Die Rezension, die den Roman mit dem knappen Verdikt "scheint im Tollhause geschrieben" abtut, aus dem Jahr 1800 ist inzwischen online:
in Bielefeld und bei
Google Book Search.
In einem Internetforum 2004 wurde zu diesem Roman auf eine Wiener Diplomarbeit verwiesen, der zu entnehmen war, dass der Titel des Ritterromans bereits in der Wiener Zeitung vom 29. September 1798 angekündigt wurde. Ich nahm diese Information in meinen Aufsatz "... ein stattlicher schwäbischer Ritter, kühn und tapfer..." Johann Gottfried Pahls Ritterroman "Ulrich von Rosenstein" (Basel 1795) im Internet. In: einhorn-Jahrbuch Schwäbisch Gmünd 2005, S. 115-128 auf. Sie ist auch im (ansonsten schlechten) Raubritter-Artikel der Wikipedia nachlesbar.
Inzwischen bietet Google Book Search durch seine Volltexterschließung grandiose neue Suchmöglichkeiten für die begriffsgeschichtliche Forschung. Durch die Volltextsuche in Verbindung mit der Zeiteingrenzung kann man sich etwa darüber informieren, wo vor 1850 in den bei Google erfassten Büchern der Begriff Raubritter auftritt:
Suche
Es sind allerdings zwei Einschränkungen zu machen:
(1) Die von Google der Suche zugrundegelegte Datierung ist in jedem Fall zu überprüfen, da nicht selten eine fehlerhafte Einordnung vorliegt. Beispielsweise stammt ein für die "Frankfurter Dramaturgie" 1781 gefundener Beleg aus den Anmerkungen des Nachworts des (nicht gekennzeichneten) Nachdrucks.
(2) Bei Frakturschriften ist die Texterkennung durch Google so gut wie unbrauchbar. Bestimmte Worte, die in Frakturschrift wenig von Antiqua-Formen abweichen, können aber im Einzelfall trotzdem erkannt werden. Dazu gehört anscheinend Raubritter, denn Google weist mehrere Belege aus Frakturdrucken nach, obwohl der Rest der Seite inakzeptable OCR bietet.
So auch hier:
"fie geflanb 91е(ф ben eaitjfit
QSorfall, erjagte, roie n?ir ade lebten, unb bag »ir
Raubritter гоДгеп" (in dem Satz ist nur ein einziges Wort richtig gelesen, die korrekte Wiedergabe siehe unten).
Durch die Google-Book-Search-Suche konnte das Wort Raubritter nun knapp 20 früher als bislang bekannt in der deutschen Literatur nachgewiesen werden.
http://books.google.com/books?id=0SosAAAAMAAJ&pg=RA1-PA164
sie gestand gleich den ganzen Vorfall, erzählte, wie wir alle lebten, und daß wir Raub-Ritter wären heisst es in der Übersetzung des Schelmenromans
"Historia de la vida del Buscón" bzw. "Historia del gran Tacaño" (1626) von Francisco de Quevedo die in dem von Friedrich Justin Bertuch (dem Weimarer Verleger, damals noch im Staatsdienst) herausgegebenen Magazin der Spanischen und Portugiesischen Literatur Bd. 2, Dessau 1781 abgedruckt wurde (Seite 164). Im Internet wird als Übersetzer der Weimarer Romanist und Bibliothekssekretär Ernst August Schmid (1746-1809) genannt (was zu überprüfen wäre).

Die hübsche Pointe, dass der Erstbeleg für Raubritter sich im Titel eines trivialen Ritterromans findet, ist perdu (es sei denn, man differenziert zwischen Raub-Ritter und Raubritter). Niemand hätte durch systematische Suche in den unzähligen Büchern, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gedruckt wurden, die Verwendung bereits 1781 herausfinden können. Es steht zu erwarten, dass in den kommenden Jahren durch Google Book Search oder andere (freie oder lizenzpflichtige) Digitalisierungsprojekte mit Schrifterkennung weitere frühe Raubritter-Belege aufgefunden werden können.
Da der Pikaro-Roman ein Klassiker der spanischen Literatur ist, findet man die spanische Vorlage als freies E-Book im Netz (PDF). Die spanische Vorlage des zitierten Satzes lautet:
"Confesó luego todo el caso y dijo cómo
vivíamos todos y que éramos caballeros de rapiña." Raub-Ritter steht also für "caballeros de rapiña".
Cervantes Virtual hält ein (natürlich zitierfähiges) Faksimile der Erstausgabe Zaragoza 1626 bereit, in dem es auf fol. 56r "cavalleros de rapiña" heisst (Link)
Auch diese Verifizierung wäre ohne die E-Texte und Digitalisate des Internets nicht möglich gewesen. Es ließen sich am Bildschirm innerhalb weniger Stunden die wichtigsten Fakten zum Kontext des Belegs von 1781 recherchieren. Für die Frage der Verfasserschaft der Übersetzung muss allerdings eine gedruckte Quelle überprüft werden.
UPDATE 5.10.2008
Das Werk von 1781 ist nach wie vor online, der Raubritter-Beleg wird aber in Google Book Search nicht mehr gefunden. Offenbar hat man die OCR ausgetauscht - gegen eine ebenso schlechte, die aber Raubritter nicht mehr erkennt:
" raie wir alle lebten, Staub i «Ritter rearen"
UPDATE 4.5.2009
Der Beleg von 1781 wird wieder gefunden; außerdem zähle ich aus der Zeit vor 1800 sechs Belege, davon drei aus Ritterromanen.
http://tinyurl.com/dhlag2
UPDATE 3.3.2012
Kurt Andermann fand einen Beleg 1672
http://archiv.twoday.net/stories/18118553/ (2011)
#forschung
in Bielefeld und bei
Google Book Search.
In einem Internetforum 2004 wurde zu diesem Roman auf eine Wiener Diplomarbeit verwiesen, der zu entnehmen war, dass der Titel des Ritterromans bereits in der Wiener Zeitung vom 29. September 1798 angekündigt wurde. Ich nahm diese Information in meinen Aufsatz "... ein stattlicher schwäbischer Ritter, kühn und tapfer..." Johann Gottfried Pahls Ritterroman "Ulrich von Rosenstein" (Basel 1795) im Internet. In: einhorn-Jahrbuch Schwäbisch Gmünd 2005, S. 115-128 auf. Sie ist auch im (ansonsten schlechten) Raubritter-Artikel der Wikipedia nachlesbar.
Inzwischen bietet Google Book Search durch seine Volltexterschließung grandiose neue Suchmöglichkeiten für die begriffsgeschichtliche Forschung. Durch die Volltextsuche in Verbindung mit der Zeiteingrenzung kann man sich etwa darüber informieren, wo vor 1850 in den bei Google erfassten Büchern der Begriff Raubritter auftritt:
Suche
Es sind allerdings zwei Einschränkungen zu machen:
(1) Die von Google der Suche zugrundegelegte Datierung ist in jedem Fall zu überprüfen, da nicht selten eine fehlerhafte Einordnung vorliegt. Beispielsweise stammt ein für die "Frankfurter Dramaturgie" 1781 gefundener Beleg aus den Anmerkungen des Nachworts des (nicht gekennzeichneten) Nachdrucks.
(2) Bei Frakturschriften ist die Texterkennung durch Google so gut wie unbrauchbar. Bestimmte Worte, die in Frakturschrift wenig von Antiqua-Formen abweichen, können aber im Einzelfall trotzdem erkannt werden. Dazu gehört anscheinend Raubritter, denn Google weist mehrere Belege aus Frakturdrucken nach, obwohl der Rest der Seite inakzeptable OCR bietet.
So auch hier:
"fie geflanb 91е(ф ben eaitjfit
QSorfall, erjagte, roie n?ir ade lebten, unb bag »ir
Raubritter гоДгеп" (in dem Satz ist nur ein einziges Wort richtig gelesen, die korrekte Wiedergabe siehe unten).
Durch die Google-Book-Search-Suche konnte das Wort Raubritter nun knapp 20 früher als bislang bekannt in der deutschen Literatur nachgewiesen werden.
http://books.google.com/books?id=0SosAAAAMAAJ&pg=RA1-PA164
sie gestand gleich den ganzen Vorfall, erzählte, wie wir alle lebten, und daß wir Raub-Ritter wären heisst es in der Übersetzung des Schelmenromans
"Historia de la vida del Buscón" bzw. "Historia del gran Tacaño" (1626) von Francisco de Quevedo die in dem von Friedrich Justin Bertuch (dem Weimarer Verleger, damals noch im Staatsdienst) herausgegebenen Magazin der Spanischen und Portugiesischen Literatur Bd. 2, Dessau 1781 abgedruckt wurde (Seite 164). Im Internet wird als Übersetzer der Weimarer Romanist und Bibliothekssekretär Ernst August Schmid (1746-1809) genannt (was zu überprüfen wäre).

Die hübsche Pointe, dass der Erstbeleg für Raubritter sich im Titel eines trivialen Ritterromans findet, ist perdu (es sei denn, man differenziert zwischen Raub-Ritter und Raubritter). Niemand hätte durch systematische Suche in den unzähligen Büchern, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gedruckt wurden, die Verwendung bereits 1781 herausfinden können. Es steht zu erwarten, dass in den kommenden Jahren durch Google Book Search oder andere (freie oder lizenzpflichtige) Digitalisierungsprojekte mit Schrifterkennung weitere frühe Raubritter-Belege aufgefunden werden können.
Da der Pikaro-Roman ein Klassiker der spanischen Literatur ist, findet man die spanische Vorlage als freies E-Book im Netz (PDF). Die spanische Vorlage des zitierten Satzes lautet:
"Confesó luego todo el caso y dijo cómo
vivíamos todos y que éramos caballeros de rapiña." Raub-Ritter steht also für "caballeros de rapiña".
Cervantes Virtual hält ein (natürlich zitierfähiges) Faksimile der Erstausgabe Zaragoza 1626 bereit, in dem es auf fol. 56r "cavalleros de rapiña" heisst (Link)
Auch diese Verifizierung wäre ohne die E-Texte und Digitalisate des Internets nicht möglich gewesen. Es ließen sich am Bildschirm innerhalb weniger Stunden die wichtigsten Fakten zum Kontext des Belegs von 1781 recherchieren. Für die Frage der Verfasserschaft der Übersetzung muss allerdings eine gedruckte Quelle überprüft werden.
UPDATE 5.10.2008
Das Werk von 1781 ist nach wie vor online, der Raubritter-Beleg wird aber in Google Book Search nicht mehr gefunden. Offenbar hat man die OCR ausgetauscht - gegen eine ebenso schlechte, die aber Raubritter nicht mehr erkennt:
" raie wir alle lebten, Staub i «Ritter rearen"
UPDATE 4.5.2009
Der Beleg von 1781 wird wieder gefunden; außerdem zähle ich aus der Zeit vor 1800 sechs Belege, davon drei aus Ritterromanen.
http://tinyurl.com/dhlag2
UPDATE 3.3.2012
Kurt Andermann fand einen Beleg 1672
http://archiv.twoday.net/stories/18118553/ (2011)
#forschung
KlausGraf - am Samstag, 15. Dezember 2007, 18:19 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
http://www.clerus.org/bibliaclerus/index_deu.html
Zu jeder Bibelpassage können (moderne) Kommentare bzw. lehramtliche Texte abgerufen werden (in verschiedenen Sprachen, einschl. Latein).
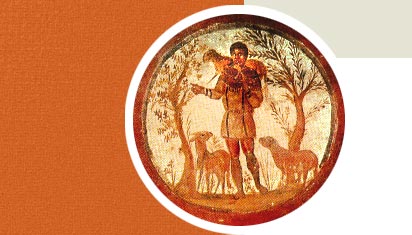
Zu jeder Bibelpassage können (moderne) Kommentare bzw. lehramtliche Texte abgerufen werden (in verschiedenen Sprachen, einschl. Latein).
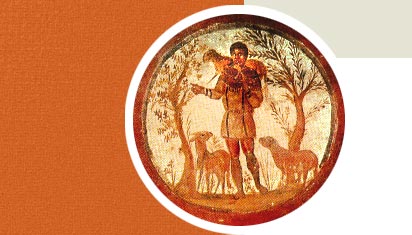
KlausGraf - am Samstag, 15. Dezember 2007, 15:46 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 15. Dezember 2007, 02:40 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein besonderes "Dezemberfieber" hat Teile der deutschen Wissenschaft befallen. Open-Access-Anhänger bangen: Wieviele Wissenschaftler werden sich bis zum Jahresende motivieren lassen, dem für sie zuständigen Open-Access-Schriftenserver einfache Nutzungsrechte ihrer älteren, vor 1995 erschienenen Fachpublikationen einzuräumen? Reicht das womöglich für eine deutsche Mini-Ausgabe "Cream of Science"? Cream of Science ist ja das einzigartige Open-Access-Projekt unserer niederländischen Nachbarn, die es geschafft haben, etwa 60 Prozent der über 48.000 wissenschaftlichen Publikationen der Forscher-Elite, nämlich von 229 prominenten Hochschullehrern, kostenfrei im Repositorien-Verbund DAREnet bereit zu stellen.[1]
Über die Urheberrechtsänderung zum 1. Januar 2008 und die Empfehlung der DFG und vieler Universitäten, unbedingt die im kommenden § 137 l Urheberrechtsgesetz vorgesehene Jahresfrist für einen Widerspruch gegenüber den Verlagen zu wahren, habe ich in H-SOZ-U-KULT Ende August 2007 berichtet.[2] Unmittelbar darauf hatte der Ilmenauer Bibliothekar und Jurist Eric Steinhauer eine zündende Idee: Der Widerspruch gegenüber den Verlagen bringt kein einziges Dokument automatisch in die Hochschulschriftenserver. Werden (nicht-ausschließliche) Nutzungsrechte aber vor dem Inkrafttreten am 1. Januar 2008 einem Dritten eingeräumt, unterbleibt der automatische Anfall der Rechte der früheren "unbekannten Nutzungsarten" an die Verlage. Der Autor muss sich in diesem Fall überhaupt nicht beim Verlag melden oder einen Widerspruch einlegen. Kommt der Verlag auf ihn zu, kann und sollte er diesem eine digitale Publikation gestatten. Der Verlag gewinnt aber nicht automatisch das ausschließliche Nutzungsrecht, denn ein Nutzungsrecht liegt ja bereits rechtmäßig bei einem Dritten. Und dieser Dritte sind die Hochschulschriftenserver und fachlichen Repositorien![3]
Leider haben die Bibliotheken diese elegante Idee nur sehr zögerlich aufgegriffen. Erst in der zweiten Novemberhälfte haben einige Hochschulleitungen und Bibliotheken die Wissenschaftler der Universität gebeten, formlos dem Hochschulschriftenserver noch bis zum Jahresende einfache Nutzungsrechte an allen vor 1995 erschienenen Fachpublikationen zu übertragen.[4] Am 6. Dezember haben DINI und das Aktionsbündnis "Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft" (www.urheberrechtsbuendnis.de) einen Rundbrief versandt, in dem sie alle Wissenschaftler dringend aufriefen, den Stichtag 31.12.2007 nicht verstreichen zu lassen und ihrem zuständigen Schriftenserver die Nutzungsrechte einzuräumen.[5] Eine kleine Sammlung von Antworten auf aktuelle Fragen zum Thema hat das Projekt open-access.net (www.open-access.net) zur Verfügung gestellt.[6]
Fast alle deutschen Universitäten unterhalten einen Open-Access-Schriftenserver, an den die Rechteeinräumung bis zum 31. Dezember formlos gerichtet werden kann. Die ihn betreibende Universitätsbibliothek bestätigt dann dem Autor die Rechteübertragung. Damit kann dieser später gegenüber einem Verlag belegen, dass er die Online-Rechte vor Inkrafttreten des Gesetzes einem Dritten eingeräumt hat. Es ist nicht erforderlich, die Schriften noch 2007 zu digitalisieren oder zugänglich zu machen. Schriftenserver und Autoren können 2008 in aller Ruhe sich über die Modalitäten der Einstellung einigen: Ob der Autor selbst scannt und hochlädt oder ob die Bibliothek für ihn digitalisiert.
In Hochschulschriftenservern können grundsätzlich immer nur die Angehörigen der Hochschule publizieren. Wer nicht einer Hochschule angehört, hat aber die Möglichkeit, die Rechte einem fachlichen Repositorium zu übertragen. Im Bereich der Kunstgeschichte betreibt die Universitätsbibliothek Heidelberg einen solchen Server: ART-Dok.[7] Für die Geschichtswissenschaft existiert noch kein fachliches Repositorium. Um aber auch Historikerinnen und Historikern ohne universitäre Anbindung die Möglichkeit zu bieten, ihre Fachpublikationen vor 1995 durch eine solche Rechteeinräumung "Open Access" zugänglich zu machen, ruft Gudrun Gersmann (Paris), die Mitbegründerin von historicum.net, dazu auf, dass die Autoren der "Bayerischen Staatsbibliothek als Betreiberin des geschichtswissenschaftlichen Informationsportals historicum.net" ein einfaches Nutzungsrecht einräumen sollen.
Für eine flächendeckende Mobilisierung der Wissenschaftler ist die Zeit vor der Weihnachtspause viel zu knapp. Die meisten werden von der Möglichkeit der Rechteeinräumung nichts mehr erfahren oder erst Anfang 2008, wenn es für den hier beschriebenen Weg zu spät ist. 2008 müssen Wissenschaftler, die Verlage daran hindern wollen, dass diese ihnen mittels eines ausschließlichen Nutzungsrechtes eine Open-Access-Publikation ihrer älteren Studien verbieten, möglichst bald gegenüber dem Verlag widersprechen. Der Verlag kann eine digitale Nutzung aufnehmen, wenn er den Autor unter der letzten bekannten Adresse davon unterrichtet. Dann hat der Autor drei Monate Zeit für einen Widerspruch. Es liegt auf der Hand, dass bei älteren Veröffentlichungen der Anteil der Briefe, die an den Verlag unzustellbar zurückgehen, sehr hoch sein dürfte. Daher empfehlen Urheberrechtsbündnis und DINI den Wissenschaftlern, möglichst innerhalb der ersten drei Monate von 2008 Widerspruch bei den Verlagen einzulegen.
Als "Schlag ins Wasser" sehen Open-Access-Anhänger die späte Kampagne trotzdem nicht. Sie setzt ein Zeichen für Open Access, macht die Repositorien, die ja dem "grünen Weg" von Open Access entsprechen[8], bekannter und verdeutlicht, dass die Hochschulleitungen hinter Open Access stehen und die eigenen Schriftenserver unterstützen. Weltweit beklagen Open-Access-Aktivisten die schwache Resonanz der Repositorien bei den Wissenschaftlern. Als Königsweg, sie mehr zu füllen, gelten ausdrückliche Verpflichtungen (Mandate) seitens der Hochschulen und Förderorganisationen. Bei deutschen Universitäten verbaut aber Verfassungsrecht nach Ansicht vieler Juristen diesen Weg: Universitäten dürfen ihre Wissenschaftler nicht zwingen, Open Access zu veröffentlichen.
Bereits jetzt lässt sich absehen, dass durch die Aktion in absehbarer Zeit eine große Anzahl wertvoller Fachbeiträge, etwa ältere Habilitationsschriften, kostenfrei im Internet einsehbar sein werden. Denn bei den (vergleichsweise wenigen) Universitäten, die ihre Wissenschaftler um Nutzungsrechte gebeten haben, ist die bisherige Resonanz durchaus positiv. Von der Universitätsbibliothek Bielefeld verlautete etwa: "Der Rücklauf ist inzwischen so gewaltig, dass wir für das Beschaffen, Scannen und Einstellen der Dokumente im nächsten Jahr wahrscheinlich zusätzliche Hilfskräfte einstellen müssen."[9]
(Die freie Verbreitung dieses Textes mit Quellenangabe ist gestattet.)
Anmerkungen:
[1] www.creamofscience.org/ (12.12.2007).
[2] Graf, Klaus, Urheberrechtsnovelle - Implikationen für die Wissenschaft, in: H-Soz-u-Kult, 29.08.2007, hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/type=diskussionen&id=930 (12.12.2007). Siehe auch meinen Beitrag zum gleichen Thema: Neues Urheberrecht: Autoren müssen reagieren, in: Kunstchronik 60 (2007), S. 530-523 (Themenheft Open Access), in ergänzter Form online: archiv.twoday.net/stories/4477889/ (12.12.2007).
[3] Eric Steinhauer, § 137 l UrhG und die Rolle der Bibliotheken, bibliotheksrecht.blog.de/2007/09/03/s_137_l_urhg_und_die_rolle_der_bibliothe~2915206 (14.12.2007)
[4] Lückenhafte Liste von Informationsseiten: archiv.twoday.net/stories/4474892/. Exemplarisch die Seite der Humboldt-Universität Berlin: edoc.hu-berlin.de/e_info/copyright.php
[5] www.urheberrechtsbuendnis.de/docs/Rundbrief1207.html (12.12.2007) mit Mustertexten.
[6] open-access.net/de/austausch/news/news/anzeige/aktuelle_fragen_zur_recht/ (12.12.2007).
[7] archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/ (12.12.2007).
[8] Ulrich Herb, Die Farbenlehre des Open Access, in: Telepolis vom 14.10.2006 www.heise.de/tp/r4/artikel/23/23672/1.html (12.12.2007).
[9] Laufende Berichterstattung unter archiv.twoday.net/topics/Open+Access/ (12.12.2007).
Zitierweise
Klaus Graf: Urheberrechtsnovelle - Jetzt noch Nutzungsrechte sichern!. In: H-Soz-u-Kult, 14.12.2007,
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/type=diskussionen&id=956
Über die Urheberrechtsänderung zum 1. Januar 2008 und die Empfehlung der DFG und vieler Universitäten, unbedingt die im kommenden § 137 l Urheberrechtsgesetz vorgesehene Jahresfrist für einen Widerspruch gegenüber den Verlagen zu wahren, habe ich in H-SOZ-U-KULT Ende August 2007 berichtet.[2] Unmittelbar darauf hatte der Ilmenauer Bibliothekar und Jurist Eric Steinhauer eine zündende Idee: Der Widerspruch gegenüber den Verlagen bringt kein einziges Dokument automatisch in die Hochschulschriftenserver. Werden (nicht-ausschließliche) Nutzungsrechte aber vor dem Inkrafttreten am 1. Januar 2008 einem Dritten eingeräumt, unterbleibt der automatische Anfall der Rechte der früheren "unbekannten Nutzungsarten" an die Verlage. Der Autor muss sich in diesem Fall überhaupt nicht beim Verlag melden oder einen Widerspruch einlegen. Kommt der Verlag auf ihn zu, kann und sollte er diesem eine digitale Publikation gestatten. Der Verlag gewinnt aber nicht automatisch das ausschließliche Nutzungsrecht, denn ein Nutzungsrecht liegt ja bereits rechtmäßig bei einem Dritten. Und dieser Dritte sind die Hochschulschriftenserver und fachlichen Repositorien![3]
Leider haben die Bibliotheken diese elegante Idee nur sehr zögerlich aufgegriffen. Erst in der zweiten Novemberhälfte haben einige Hochschulleitungen und Bibliotheken die Wissenschaftler der Universität gebeten, formlos dem Hochschulschriftenserver noch bis zum Jahresende einfache Nutzungsrechte an allen vor 1995 erschienenen Fachpublikationen zu übertragen.[4] Am 6. Dezember haben DINI und das Aktionsbündnis "Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft" (www.urheberrechtsbuendnis.de) einen Rundbrief versandt, in dem sie alle Wissenschaftler dringend aufriefen, den Stichtag 31.12.2007 nicht verstreichen zu lassen und ihrem zuständigen Schriftenserver die Nutzungsrechte einzuräumen.[5] Eine kleine Sammlung von Antworten auf aktuelle Fragen zum Thema hat das Projekt open-access.net (www.open-access.net) zur Verfügung gestellt.[6]
Fast alle deutschen Universitäten unterhalten einen Open-Access-Schriftenserver, an den die Rechteeinräumung bis zum 31. Dezember formlos gerichtet werden kann. Die ihn betreibende Universitätsbibliothek bestätigt dann dem Autor die Rechteübertragung. Damit kann dieser später gegenüber einem Verlag belegen, dass er die Online-Rechte vor Inkrafttreten des Gesetzes einem Dritten eingeräumt hat. Es ist nicht erforderlich, die Schriften noch 2007 zu digitalisieren oder zugänglich zu machen. Schriftenserver und Autoren können 2008 in aller Ruhe sich über die Modalitäten der Einstellung einigen: Ob der Autor selbst scannt und hochlädt oder ob die Bibliothek für ihn digitalisiert.
In Hochschulschriftenservern können grundsätzlich immer nur die Angehörigen der Hochschule publizieren. Wer nicht einer Hochschule angehört, hat aber die Möglichkeit, die Rechte einem fachlichen Repositorium zu übertragen. Im Bereich der Kunstgeschichte betreibt die Universitätsbibliothek Heidelberg einen solchen Server: ART-Dok.[7] Für die Geschichtswissenschaft existiert noch kein fachliches Repositorium. Um aber auch Historikerinnen und Historikern ohne universitäre Anbindung die Möglichkeit zu bieten, ihre Fachpublikationen vor 1995 durch eine solche Rechteeinräumung "Open Access" zugänglich zu machen, ruft Gudrun Gersmann (Paris), die Mitbegründerin von historicum.net, dazu auf, dass die Autoren der "Bayerischen Staatsbibliothek als Betreiberin des geschichtswissenschaftlichen Informationsportals historicum.net" ein einfaches Nutzungsrecht einräumen sollen.
Für eine flächendeckende Mobilisierung der Wissenschaftler ist die Zeit vor der Weihnachtspause viel zu knapp. Die meisten werden von der Möglichkeit der Rechteeinräumung nichts mehr erfahren oder erst Anfang 2008, wenn es für den hier beschriebenen Weg zu spät ist. 2008 müssen Wissenschaftler, die Verlage daran hindern wollen, dass diese ihnen mittels eines ausschließlichen Nutzungsrechtes eine Open-Access-Publikation ihrer älteren Studien verbieten, möglichst bald gegenüber dem Verlag widersprechen. Der Verlag kann eine digitale Nutzung aufnehmen, wenn er den Autor unter der letzten bekannten Adresse davon unterrichtet. Dann hat der Autor drei Monate Zeit für einen Widerspruch. Es liegt auf der Hand, dass bei älteren Veröffentlichungen der Anteil der Briefe, die an den Verlag unzustellbar zurückgehen, sehr hoch sein dürfte. Daher empfehlen Urheberrechtsbündnis und DINI den Wissenschaftlern, möglichst innerhalb der ersten drei Monate von 2008 Widerspruch bei den Verlagen einzulegen.
Als "Schlag ins Wasser" sehen Open-Access-Anhänger die späte Kampagne trotzdem nicht. Sie setzt ein Zeichen für Open Access, macht die Repositorien, die ja dem "grünen Weg" von Open Access entsprechen[8], bekannter und verdeutlicht, dass die Hochschulleitungen hinter Open Access stehen und die eigenen Schriftenserver unterstützen. Weltweit beklagen Open-Access-Aktivisten die schwache Resonanz der Repositorien bei den Wissenschaftlern. Als Königsweg, sie mehr zu füllen, gelten ausdrückliche Verpflichtungen (Mandate) seitens der Hochschulen und Förderorganisationen. Bei deutschen Universitäten verbaut aber Verfassungsrecht nach Ansicht vieler Juristen diesen Weg: Universitäten dürfen ihre Wissenschaftler nicht zwingen, Open Access zu veröffentlichen.
Bereits jetzt lässt sich absehen, dass durch die Aktion in absehbarer Zeit eine große Anzahl wertvoller Fachbeiträge, etwa ältere Habilitationsschriften, kostenfrei im Internet einsehbar sein werden. Denn bei den (vergleichsweise wenigen) Universitäten, die ihre Wissenschaftler um Nutzungsrechte gebeten haben, ist die bisherige Resonanz durchaus positiv. Von der Universitätsbibliothek Bielefeld verlautete etwa: "Der Rücklauf ist inzwischen so gewaltig, dass wir für das Beschaffen, Scannen und Einstellen der Dokumente im nächsten Jahr wahrscheinlich zusätzliche Hilfskräfte einstellen müssen."[9]
(Die freie Verbreitung dieses Textes mit Quellenangabe ist gestattet.)
Anmerkungen:
[1] www.creamofscience.org/ (12.12.2007).
[2] Graf, Klaus, Urheberrechtsnovelle - Implikationen für die Wissenschaft, in: H-Soz-u-Kult, 29.08.2007, hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/type=diskussionen&id=930 (12.12.2007). Siehe auch meinen Beitrag zum gleichen Thema: Neues Urheberrecht: Autoren müssen reagieren, in: Kunstchronik 60 (2007), S. 530-523 (Themenheft Open Access), in ergänzter Form online: archiv.twoday.net/stories/4477889/ (12.12.2007).
[3] Eric Steinhauer, § 137 l UrhG und die Rolle der Bibliotheken, bibliotheksrecht.blog.de/2007/09/03/s_137_l_urhg_und_die_rolle_der_bibliothe~2915206 (14.12.2007)
[4] Lückenhafte Liste von Informationsseiten: archiv.twoday.net/stories/4474892/. Exemplarisch die Seite der Humboldt-Universität Berlin: edoc.hu-berlin.de/e_info/copyright.php
[5] www.urheberrechtsbuendnis.de/docs/Rundbrief1207.html (12.12.2007) mit Mustertexten.
[6] open-access.net/de/austausch/news/news/anzeige/aktuelle_fragen_zur_recht/ (12.12.2007).
[7] archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/ (12.12.2007).
[8] Ulrich Herb, Die Farbenlehre des Open Access, in: Telepolis vom 14.10.2006 www.heise.de/tp/r4/artikel/23/23672/1.html (12.12.2007).
[9] Laufende Berichterstattung unter archiv.twoday.net/topics/Open+Access/ (12.12.2007).
Zitierweise
Klaus Graf: Urheberrechtsnovelle - Jetzt noch Nutzungsrechte sichern!. In: H-Soz-u-Kult, 14.12.2007,
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/type=diskussionen&id=956
KlausGraf - am Samstag, 15. Dezember 2007, 01:12 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 15. Dezember 2007, 01:11 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
‘Archive von unten’, die Überlieferung der Neuen Sozialen Bewegungen und der schlanke Staat – eine Herausforderung für öffentliche Archive?
Transferarbeit zum Abschluss des Referendariats für den Höheren Archivdienst, verfasst von Stefan Sudmann
http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/25/Transferarbeit_Sudmann.pdf
Transferarbeit zum Abschluss des Referendariats für den Höheren Archivdienst, verfasst von Stefan Sudmann
http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/25/Transferarbeit_Sudmann.pdf
Bernd Hüttner - am Freitag, 14. Dezember 2007, 21:58 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.columbia.edu/cgi-bin/cul/resolve?clio6345168
Unter den von der Columbia Universität digitalisierten über 100 Büchern sind auch einige deutschsprachige.
Tipp: In CLIO nach unrestricted access mit Filter Electronic Resources suchen!
Unter den von der Columbia Universität digitalisierten über 100 Büchern sind auch einige deutschsprachige.
Tipp: In CLIO nach unrestricted access mit Filter Electronic Resources suchen!
KlausGraf - am Freitag, 14. Dezember 2007, 20:04 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.columbia.edu/cu/lweb/news/libraries/2007/2007-12-13.googlefaq.html
Goole will digitize only PD titles at Columbia U.
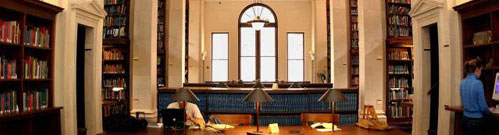
Goole will digitize only PD titles at Columbia U.
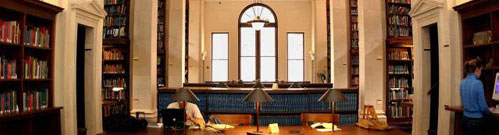
KlausGraf - am Freitag, 14. Dezember 2007, 19:53 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 14. Dezember 2007, 17:28 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Von den baden-württembergischen Universitätsbibliotheken
informieren laut Homepage ueber die Möglichkeit der
Nutzungsrechteübertragung:
Freiburg
Heidelberg
Karlsruhe
Konstanz
Stuttgart
Ulm
KEINE Informationen sind auffindbar bei den
Universitätsbibliotheken:
Hohenheim [siehe aber Kommentar]
Mannheim
Tübingen [siehe aber Kommentar]
Hohenheim sollte an sich allen Grund haben, Open Access zu
fördern, denn: "Der Etat der UB Hohenheim reicht in 2007
nicht aus, um die bisher abonnierten/lizenzierten
Zeitschriften und Datenbanken auch für das Jahr 2008 weiter
bezahlen zu können."
Anders in Rheinland-Pfalz:
Es gelang es mir nicht, auf der Website der
RP-UBs einen entsprechenden Hinweis zu entdecken:
Kaiserslautern
Koblenz/Landau (beide Standorte)
Mainz [UB informierte, siehe Kommentar]
DHV Speyer (kein Schriftenserver!)
Trier [Unileitung informierte, siehe Kommentar]
Von den UBs in Schleswig-Holstein informiert nur Kiel (Flensburg und Lübeck haben aber auch kaum Beiträge in ihren Schriftenservern).
Aus Hannover schrieb man mir: "Zumindest für Hannover kann ich Ihnen mitteilen, dass die Mitarbeiter aller Hochschulen flächendeckend und umfassend per Email und über verschiedenen Hochschulgremien auch mündlich informiert wurden. Die schnellste (positive) Reaktion auf die Info-Email hier an der FH Hannover kam übrigens in unter einer Minute nach Versand."
Liste der Infoseiten:
http://archiv.twoday.net/stories/4474892/
AKTUELL: Mein Beitrag in H-SOZ-U-KULT
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/type=diskussionen&id=956
informieren laut Homepage ueber die Möglichkeit der
Nutzungsrechteübertragung:
Freiburg
Heidelberg
Karlsruhe
Konstanz
Stuttgart
Ulm
KEINE Informationen sind auffindbar bei den
Universitätsbibliotheken:
Hohenheim [siehe aber Kommentar]
Mannheim
Tübingen [siehe aber Kommentar]
Hohenheim sollte an sich allen Grund haben, Open Access zu
fördern, denn: "Der Etat der UB Hohenheim reicht in 2007
nicht aus, um die bisher abonnierten/lizenzierten
Zeitschriften und Datenbanken auch für das Jahr 2008 weiter
bezahlen zu können."
Anders in Rheinland-Pfalz:
Es gelang es mir nicht, auf der Website der
RP-UBs einen entsprechenden Hinweis zu entdecken:
Kaiserslautern
Koblenz/Landau (beide Standorte)
Mainz [UB informierte, siehe Kommentar]
DHV Speyer (kein Schriftenserver!)
Trier [Unileitung informierte, siehe Kommentar]
Von den UBs in Schleswig-Holstein informiert nur Kiel (Flensburg und Lübeck haben aber auch kaum Beiträge in ihren Schriftenservern).
Aus Hannover schrieb man mir: "Zumindest für Hannover kann ich Ihnen mitteilen, dass die Mitarbeiter aller Hochschulen flächendeckend und umfassend per Email und über verschiedenen Hochschulgremien auch mündlich informiert wurden. Die schnellste (positive) Reaktion auf die Info-Email hier an der FH Hannover kam übrigens in unter einer Minute nach Versand."
Liste der Infoseiten:
http://archiv.twoday.net/stories/4474892/
AKTUELL: Mein Beitrag in H-SOZ-U-KULT
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/type=diskussionen&id=956
KlausGraf - am Freitag, 14. Dezember 2007, 16:23 - Rubrik: Open Access
Der Literaturnobelpreisträger Harold Pinter hat sein Archiv für 1,1 Millionen Pfund (1,5 Millionen Euro) an die Britische Nationalbibliothek verkauft.
Quelle u.a. :
http://www.focus.de/kultur/buecher/literatur_aid_229258.html
Quelle u.a. :
http://www.focus.de/kultur/buecher/literatur_aid_229258.html
Wolf Thomas - am Freitag, 14. Dezember 2007, 12:03 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Heft 4/2007 der Zeitschrift Archiv und Wirtschaft enthält folgende Beiträge:
Aufsätze:
Wilfried Feldenkirchen: 100 Jahre Siemens-Archiv – 100 Jahre erfolgreiches History Marketing
Elke Pfnür: Corporate History, Corporate Identity und Corporate Behavior in der HypoVereinsbank
Frauke Schmidt: Rheinische Kreditgenossenschaften und ihre Archive
Norman Biehl u. Dagmar Hennel: Transparenz und Auffindbarkeit von Audio-Inhalten. Funktion und Einsatzmöglichkeiten von Spracherkennungssystemen
Berichte:
Margarete Keck-Thorsson u. Elke Pfnür: 59. VdW-Lehrgang „Medienkompetenz für Wirtschaftsarchivare“ vom 10. bis 15. Juni 2007 in Heidelberg
Michael Farrenkopf: „Architektur im Archiv“ – Tagung in der Abtei Brauweiler
Martin Krauß: Lebendige Erinnerungskultur beim Adel und in der Wirtschaft. Gemeinsame Veranstaltung der Fachgruppen 4 (Archivare an Herrschafts-, Familien- und Hausarchiven) und 5 (Archivare an Archiven der Wirtschaft) im Rahmen des 77. Deutschen Archivtags in Mannheim
Rezensionen:
VdA – Verband deutscherArchivarinnen und Archivare (Hrsg.): Das deutsche Archivwesen und der Nationalsozialismus. 75. Deutscher Archivtag 2005 in Stuttgart (Volker Beckmann)
Barbara Hoen (Hrsg.): Planungen, Projekte, Perspektiven. Zum Stand der Archivierung elektronischer Unterlagen. 10. Tagung des Arbeitskreises „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“, 14./15. März 2006 in Düsseldorf (Britta Weschke)
Jörg Feldkamp u. Achim Dresler (Hrsg.): 120 Jahre Wanderer 1885–2005. Ein Unternehmen aus Chemnitz und seine Geschichte in der aktuellen Forschung (Evelyn Kroker)
Gerald D. Feldman, Oliver Rathkolb, Theodor Venus u. Ulrike Zimmerl: Österreichische Banken und Sparkassen im Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit. Band 1: Creditanstalt-Bankverein, Band 2: Regionalbanken, Länderbank und Zentralsparkasse (Ralf Ahrens)
Irmgard Zündorf: Der Preis der Marktwirtschaft. Staatliche Preispolitik und Lebensstandard in Westdeutschland 1948 bis 1963 (Siegfried Buchhaupt)
Sonstiges:
Personalnachrichten/Verschiedenes
Impressum
www.wirtschaftsarchive.de
Archiv und Wirtschaft, 40. Jg., 2007, H. 3
Jahresabonnement: 26 €
Einzelheft: 8 €
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Detlef Krause
Commerzbank AG
Aufsätze:
Wilfried Feldenkirchen: 100 Jahre Siemens-Archiv – 100 Jahre erfolgreiches History Marketing
Elke Pfnür: Corporate History, Corporate Identity und Corporate Behavior in der HypoVereinsbank
Frauke Schmidt: Rheinische Kreditgenossenschaften und ihre Archive
Norman Biehl u. Dagmar Hennel: Transparenz und Auffindbarkeit von Audio-Inhalten. Funktion und Einsatzmöglichkeiten von Spracherkennungssystemen
Berichte:
Margarete Keck-Thorsson u. Elke Pfnür: 59. VdW-Lehrgang „Medienkompetenz für Wirtschaftsarchivare“ vom 10. bis 15. Juni 2007 in Heidelberg
Michael Farrenkopf: „Architektur im Archiv“ – Tagung in der Abtei Brauweiler
Martin Krauß: Lebendige Erinnerungskultur beim Adel und in der Wirtschaft. Gemeinsame Veranstaltung der Fachgruppen 4 (Archivare an Herrschafts-, Familien- und Hausarchiven) und 5 (Archivare an Archiven der Wirtschaft) im Rahmen des 77. Deutschen Archivtags in Mannheim
Rezensionen:
VdA – Verband deutscherArchivarinnen und Archivare (Hrsg.): Das deutsche Archivwesen und der Nationalsozialismus. 75. Deutscher Archivtag 2005 in Stuttgart (Volker Beckmann)
Barbara Hoen (Hrsg.): Planungen, Projekte, Perspektiven. Zum Stand der Archivierung elektronischer Unterlagen. 10. Tagung des Arbeitskreises „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“, 14./15. März 2006 in Düsseldorf (Britta Weschke)
Jörg Feldkamp u. Achim Dresler (Hrsg.): 120 Jahre Wanderer 1885–2005. Ein Unternehmen aus Chemnitz und seine Geschichte in der aktuellen Forschung (Evelyn Kroker)
Gerald D. Feldman, Oliver Rathkolb, Theodor Venus u. Ulrike Zimmerl: Österreichische Banken und Sparkassen im Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit. Band 1: Creditanstalt-Bankverein, Band 2: Regionalbanken, Länderbank und Zentralsparkasse (Ralf Ahrens)
Irmgard Zündorf: Der Preis der Marktwirtschaft. Staatliche Preispolitik und Lebensstandard in Westdeutschland 1948 bis 1963 (Siegfried Buchhaupt)
Sonstiges:
Personalnachrichten/Verschiedenes
Impressum
www.wirtschaftsarchive.de
Archiv und Wirtschaft, 40. Jg., 2007, H. 3
Jahresabonnement: 26 €
Einzelheft: 8 €
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Detlef Krause
Commerzbank AG
KlausGraf - am Freitag, 14. Dezember 2007, 02:55 - Rubrik: Wirtschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
das Webarchiv des Deutschen Bundestages gehört weltweit zu den wenigen, die über das Internet direkt zur Verfügung stehen ( http://webarchiv.bundestag.de . Hier finden sich seit Januar 2005 angefertigte Kopien älterer Internetseiten des Deutschen Bundestages. Allein im Jahre 2007 wurde über 38.000mal auf dort verwahrte historische Internetseiten zugegriffen. Insbesondere die Präsentationsform des Webarchivs hat bereits mehrfach nationale und internationale Beachtung gefunden.
Wichtige Gesichtspunkte für die Webarchivierung beim Deutschen Bundestag waren von Beginn an die Benutzerfreundlichkeit, die Sicherung der Authentizität und - so weit wie möglich - der originalen Erscheinungsform sowie die Nachnutzbarkeit der Ergebnisse für andere Archive, Bibliotheken, Museen und weitere Gedächtnisorganisationen.
Das Verfahren und System zur Webarchivierung sind in Kooperation zwischen dem Parlamentsarchiv und den Online-Diensten des Deutschen Bundestages entstanden. Die dabei gefundenen Lösungen und behandelten Fragen können jetzt in dem aktualisierten Konzept zur „Archivierung von Netzressourcen des Deutschen Bundestages" nachgelesen werden, das seit heute über das Verzeichnis der Veröffentlichungen aus dem Parlamentsarchiv online abrufbar ist ( http://www.bundestag.de/wissen/archiv/oeffent/veroeffent.html Rubrik Digitale Überlieferungssicherung). In einer ersten Version ist dieses Konzept bereits seit Dezember 2005 online. Es wurde seitdem über 5.000mal heruntergeladen.
-- Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Angela Ullmann
Deutscher Bundestag
- Verwaltung -
Ref. ID 2 - Parlamentsarchiv
Sachgebietsleiterin DV-Koordination und Audiovisuelle Medien
Tel 030 / 227 35662, Fax 030 / 227 36749
www.bundestag.de/archiv
Ex: Archivliste
Wichtige Gesichtspunkte für die Webarchivierung beim Deutschen Bundestag waren von Beginn an die Benutzerfreundlichkeit, die Sicherung der Authentizität und - so weit wie möglich - der originalen Erscheinungsform sowie die Nachnutzbarkeit der Ergebnisse für andere Archive, Bibliotheken, Museen und weitere Gedächtnisorganisationen.
Das Verfahren und System zur Webarchivierung sind in Kooperation zwischen dem Parlamentsarchiv und den Online-Diensten des Deutschen Bundestages entstanden. Die dabei gefundenen Lösungen und behandelten Fragen können jetzt in dem aktualisierten Konzept zur „Archivierung von Netzressourcen des Deutschen Bundestages" nachgelesen werden, das seit heute über das Verzeichnis der Veröffentlichungen aus dem Parlamentsarchiv online abrufbar ist ( http://www.bundestag.de/wissen/archiv/oeffent/veroeffent.html Rubrik Digitale Überlieferungssicherung). In einer ersten Version ist dieses Konzept bereits seit Dezember 2005 online. Es wurde seitdem über 5.000mal heruntergeladen.
-- Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Angela Ullmann
Deutscher Bundestag
- Verwaltung -
Ref. ID 2 - Parlamentsarchiv
Sachgebietsleiterin DV-Koordination und Audiovisuelle Medien
Tel 030 / 227 35662, Fax 030 / 227 36749
www.bundestag.de/archiv
Ex: Archivliste
KlausGraf - am Freitag, 14. Dezember 2007, 02:54 - Rubrik: Webarchivierung
http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/verkauf.php
Das Schloss des Markgrafen von Baden in Salem (Bodenseekreis) hat einen Wert von 42 Millionen Euro. Seit Anfang der 90er Jahre hat er zur Instandhaltung des früheren Klosters 39 Millionen Euro aufgewandt - genau 1,566 Millionen Euro im Jahr.
Einmal mehr wiederholen wir: Der denkmalpflegerische Mehraufwand darf nach Rspr. des Bundesverfassungsgerichts keine enteignende Wirkung haben. Wendet sich ein Eigentümer aus "Adelsstolz" nicht an die öffentliche Hand, um die enteignende Wirkung abzuwenden, kann er kein Verständnis erwarten.
http://archiv.twoday.net/stories/2892308/

Das Schloss des Markgrafen von Baden in Salem (Bodenseekreis) hat einen Wert von 42 Millionen Euro. Seit Anfang der 90er Jahre hat er zur Instandhaltung des früheren Klosters 39 Millionen Euro aufgewandt - genau 1,566 Millionen Euro im Jahr.
Einmal mehr wiederholen wir: Der denkmalpflegerische Mehraufwand darf nach Rspr. des Bundesverfassungsgerichts keine enteignende Wirkung haben. Wendet sich ein Eigentümer aus "Adelsstolz" nicht an die öffentliche Hand, um die enteignende Wirkung abzuwenden, kann er kein Verständnis erwarten.
http://archiv.twoday.net/stories/2892308/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 14. Dezember 2007, 02:29 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00018415/image_1
Wie kann man eine so bedeutsame Handschrift zur hochmittelalterlichen Theologiegeschichte in so mieser Qualität digitalisiert dem Publikum anbieten?
Eine Dissertation von 2007 behandelt den Kreuzeslob-Dialog und bietet auf CD eine Transkription:
http://www.verlagdrkovac.de/3-8300-3000-2.htm
Update 2013: Nun in Farbe
http://www.bavarikon.de/de/bookviewer/kpbO-BSB-HSS-00000BSB00018415_00001
Update August 2013: Marco Rainini hat 2009 überzeugend den Text dem sog. Konrad von Hirsau zugewiesen.:
Oltre il velo delle immagini: il "Dialogus de cruce" (Clm 14159) e Corrado/Peregrinus di Hirsau
Rainini, Marco. (2009) - In: Rivista di storia del cristianesimo Bd. 6 (2009) S. 121-158
KlausGraf - am Freitag, 14. Dezember 2007, 01:55 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 14. Dezember 2007, 01:44 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bibliographic records are a key part of our shared cultural heritage. They too should therefore be made available to the public for access and re-use without restriction. Not only will this allow libraries to share records more efficiently and improve quality more rapidly through better, easier feedback, but will also make possible more advanced online sites for book-lovers, easier analysis by social scientists, interesting visualizations and summary statistics by journalists and others, as well as many other possibilities we cannot predict in advance.
Please sign the petition at
http://www.okfn.org/wiki/FutureOfBibliographicControl?action=show&redirect=OpenBibliographicData
Please sign the petition at
http://www.okfn.org/wiki/FutureOfBibliographicControl?action=show&redirect=OpenBibliographicData
KlausGraf - am Freitag, 14. Dezember 2007, 01:22 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.collectieantwerpen.be
Unter den Büchern (fast nur Einzelseiten) finden sich auch einige Rubens-Briefe.

Unter den Büchern (fast nur Einzelseiten) finden sich auch einige Rubens-Briefe.

KlausGraf - am Freitag, 14. Dezember 2007, 01:11 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.gac.culture.gov.uk/about/faqs.asp
Die Sammlung von Kunst in Regierungsgebäuden hat eine Datenbank mit kleinen Bildern zugänglich gemacht. Aus der Sammlung wird nichts verkauft, unter den FAQ vermisse ich aber eine Frage zur Sicherheitsproblematik. Wie verhindert man Diebstähle?

Die Sammlung von Kunst in Regierungsgebäuden hat eine Datenbank mit kleinen Bildern zugänglich gemacht. Aus der Sammlung wird nichts verkauft, unter den FAQ vermisse ich aber eine Frage zur Sicherheitsproblematik. Wie verhindert man Diebstähle?

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Based on a survey of thousands of early printed books, Used Books describes what readers wrote in and around their books and what we can learn from these marks by using the tools of archaeologists as well as historians and literary critics."
Used Books
Marking Readers in Renaissance England
William H. Sherman
280 pages | 6 x 9 | 36 illus.
Cloth Dec 2007 | ISBN 978-0-8122-4043-6 | $45.00s | £29.50
http://www.upenn.edu/pennpress/book/14394.html
Zum Thema siehe auch
http://log.netbib.de/?s=marginal
Used Books
Marking Readers in Renaissance England
William H. Sherman
280 pages | 6 x 9 | 36 illus.
Cloth Dec 2007 | ISBN 978-0-8122-4043-6 | $45.00s | £29.50
http://www.upenn.edu/pennpress/book/14394.html
Zum Thema siehe auch
http://log.netbib.de/?s=marginal
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://youtube.com/watch?v=ENgvBQg00B8 :
"Der Film zeigt das Gebäude, die Struktur und das Dienstleistungsangebot des Zentrums für Information und Bildung (zib) in Unna. Im zib sind Volkhochschule, Bibliothek, Stadtarchiv und Touristeninformation unter einem Dach vereint. Das zib ist Sitz der Verwaltung der Kulturbetriebe Unna (KBU)."
"Der Film zeigt das Gebäude, die Struktur und das Dienstleistungsangebot des Zentrums für Information und Bildung (zib) in Unna. Im zib sind Volkhochschule, Bibliothek, Stadtarchiv und Touristeninformation unter einem Dach vereint. Das zib ist Sitz der Verwaltung der Kulturbetriebe Unna (KBU)."
Wolf Thomas - am Donnerstag, 13. Dezember 2007, 16:58 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Video über eine Buchpräsentation zur Magdeburger Sportgeschichte im dortigen Stadtarchiv:
http://youtube.com/watch?v=5Qb_Si38XLE .
Wird youtube o. ä. aktiv von deutschen Archiven zur Öffentlichkeitsarbeit genutzt ?
http://youtube.com/watch?v=5Qb_Si38XLE .
Wird youtube o. ä. aktiv von deutschen Archiven zur Öffentlichkeitsarbeit genutzt ?
Wolf Thomas - am Donnerstag, 13. Dezember 2007, 16:55 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Quellen:
http://stephanscom.at/news/0/articles/2007/12/13/a13896/
http://www.oecumene.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=173557
http://www.kath.net/detail.php?id=18467
http://www.kreuz.net/article.6351.html
http://www.zenit.org/article-14035?l=german
http://www.zenit.org/article-14034?l=german
http://derstandard.at/?url=/?id=3149276
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/348880/index.do?_vl_backlink=/home/panorama/index.do
http://www.zenit.org/article-14061?l=german (17.12.2007)
http://stephanscom.at/news/0/articles/2007/12/22/a13974/ (23.12.2007)
http://stephanscom.at/news/0/articles/2007/12/13/a13896/
http://www.oecumene.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=173557
http://www.kath.net/detail.php?id=18467
http://www.kreuz.net/article.6351.html
http://www.zenit.org/article-14035?l=german
http://www.zenit.org/article-14034?l=german
http://derstandard.at/?url=/?id=3149276
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/348880/index.do?_vl_backlink=/home/panorama/index.do
http://www.zenit.org/article-14061?l=german (17.12.2007)
http://stephanscom.at/news/0/articles/2007/12/22/a13974/ (23.12.2007)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 13. Dezember 2007, 10:48 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Elke Immel berichtet heute im Berliner Tagesspiegel: „ ....Angefangen hat alles mit einer Unterrichtsstunde zum Mauerbau – das Band tauchte aus dem Nichts auf und machte uns auf das verschollene Archiv aufmerksam“, sagt Henning Schluß, Erziehungswissenschaftler von der Humboldt-Universität (HU). Schluß leitet ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziertes Projekt, das seit 2005 fast 100 aufgezeichnete Unterrichtseinheiten aus der DDR-Zeit gesichtet und gesichert hat. Jetzt machte Schluß das Material online zugänglich. Die Internetdatenbank betreut das HU-Institut gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung. ..."
Quelle mit weiterführenden Links:
http://www.tagesspiegel.de/magazin/wissen/;art304,2438167
Quelle mit weiterführenden Links:
http://www.tagesspiegel.de/magazin/wissen/;art304,2438167
Wolf Thomas - am Donnerstag, 13. Dezember 2007, 10:45 - Rubrik: Universitaetsarchive
".... Wenn man sie [ List der Wörter bzw. Unwörter des Jahres]im Internet nachliest, weiß man genau, was damals Thema war, was diskutierte wurde. Es ist eine Art Archiv des Zeitgeistes. ...."
Germanistik-Professor Armin Burghardt, Mitglied des Hauptvorstandes der Gesellschaft für deutsche Sprache und Mitglied der Jury für das Wort des Jahres
Quelle: http://www.newsclick.de/index.jsp/menuid/2184/artid/7699975
Germanistik-Professor Armin Burghardt, Mitglied des Hauptvorstandes der Gesellschaft für deutsche Sprache und Mitglied der Jury für das Wort des Jahres
Quelle: http://www.newsclick.de/index.jsp/menuid/2184/artid/7699975
Wolf Thomas - am Donnerstag, 13. Dezember 2007, 10:42 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die 45 minütige Dokumentation "Der Geheimdienstschatz: Zeugnisse gegen das Vergessen und dreiste Lügen" wird an folgenden Termin im Fernsehen zusehen sein:
ARD Eins Extra: 13.12. 20.15 - 21.00; 15.12. 18.05 - 18.50, 23.12. 22.15-23.00 und auf Phoenix 20.12. 21.00-21.45
„Die Berliner Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen unter der Leitung von Marianne Birthler gerät zunehmend in die Kritik vor allem wegen des Umgangs mit den so genannten Rosenholz-Dateien. Das weltweit einmalige Archiv der Stasi-Hinterlassenschaft soll nach Forderungen von Nutzern baldmöglichst dem Bundesarchiv angegliedert werden. In wenigen Jahren ist damit auch zu rechnen. Was die Stasi-Unterlagen-Behörde zur Aufarbeitung der DDR-Geschichte leistet und mit welchen Mitteln und Methoden der Geheimdienstapparat funktionierte, beschreibt der Film an einigen konkreten Beispielen. .....“
Quelle: http://www.cinefacts.de/tv/details.php?id=krkbe2000000000001369872
ARD Eins Extra: 13.12. 20.15 - 21.00; 15.12. 18.05 - 18.50, 23.12. 22.15-23.00 und auf Phoenix 20.12. 21.00-21.45
„Die Berliner Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen unter der Leitung von Marianne Birthler gerät zunehmend in die Kritik vor allem wegen des Umgangs mit den so genannten Rosenholz-Dateien. Das weltweit einmalige Archiv der Stasi-Hinterlassenschaft soll nach Forderungen von Nutzern baldmöglichst dem Bundesarchiv angegliedert werden. In wenigen Jahren ist damit auch zu rechnen. Was die Stasi-Unterlagen-Behörde zur Aufarbeitung der DDR-Geschichte leistet und mit welchen Mitteln und Methoden der Geheimdienstapparat funktionierte, beschreibt der Film an einigen konkreten Beispielen. .....“
Quelle: http://www.cinefacts.de/tv/details.php?id=krkbe2000000000001369872
Wolf Thomas - am Donnerstag, 13. Dezember 2007, 10:39 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blogs.lib.utexas.edu/freethebooks/
Das Weblog der UT at Austin (Google-Partner) will sich der schwierigen Frage der Public Domain von Büchern annehmen.
Das Weblog der UT at Austin (Google-Partner) will sich der schwierigen Frage der Public Domain von Büchern annehmen.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen



