Rechtzeitig vor dem „Tag der Archive“ liegt das 13. Heft der Archiv-Nachrichten Niedersachsen vor. Das Schwerpunktthema lautet: Archive im sicheren Hafen? Alte und neue Herausforderungen zu Sicherung, Erschließung und Beratung.
Sie erhalten das Heft zum Preis von 6,00 Euro (zuzügl. Versand) bei der ANKA-Geschäftsstelle (Adresse s.u.).
Inhaltsverzeichnis:
EDITORIAL (S.3)
47. ANKA-TAGUNG 2009 WILHELMSHAVEN
AXEL PRIEBS: Hafen und Stadt (S. 8)
HEINER SCHÜPP: Die Gebiets- und Verwaltungsreform in Niedersachsen. Einleitende Bemerkungen zu ersten Arbeitssitzung (S. 20)
GERD STEINWASCHER: Gebiets- und Verwaltungsreform in Niedersachsen (S. 21)
WOLFGANG JÜRRIES: Überlieferungsbildung in Kreisarchiven als Folge der Gebiets- und Verwaltungsreform in Niedersachsen (S. 31)
KLAUS FESCHE: Die Gebiets- und Verwaltungsreform in Niedersachsen und ihre Folgen für die Archive. Das Beispiel der Mittelstadt Wunstorf (S. 35)
BIRGIT KEHNE: Auswirkungen der Gebietsreform auf die archivische Überlieferung. Das Beispiel Osnabrück (S. 39)
KATRIN QUIRIN: Das Deutsche Auswandererhaus Bremerhaven. Archivische Quellen zum Themenbereich Auswanderung (S. 42)
WOLFGANG GRAMS: „Ist nicht hier, ist nicht da, ist wohl in Amerika.“ Archivische Quellen in der Auswanderungsforschung (S. 51)
ULRICH BREDEN: Die Datenbanken „Niedersächsische Bibliographie“ und „Niedersächsische Personen“ als Rechercheinstrumente für landeskundliche Literatur (S. 59)
ROMY MEYER UND HENNING STEINFÜHRER: Zur Übernahme digitaler Daten im Stadtarchiv Braunschweig. Ein Erfahrungsbericht (S. 64)
BETTINA JOERGENS: Open Access zum Personenstandsarchiv. Bereitstellung, Service und Kooperationen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen (S. 73)
AUS DER ARBEIT DER ARCHIVE
KIRSTEN HOFFMANN: Archivbenutzung im Wandel der Zeiten – ein etwas anderer Zugang zur Archivgeschichte des Niedersächsischen Landesarchivs – Hauptstaatsarchiv Hannover (S. 88)
SILKE WAGENER-FIMPEL: Die Flüchtlingsakten des Landkreises Wolfenbüttel (S. 96)
CLAUDIA BEI DER WIEDEN: Ein ganzheitliches Archivkonzept für die HBK Braunschweig (S. 103)
BIRGIT KEHNE: Bewertungshilfe für die Sammelakten zu den Personenstandsregistern (S. 107)
HANS-MARTIN ARNOLDT: Historische Quellen zur Eisenbahngeschichte im Landesarchiv. Ein Online-Inventar (S. 112)
ANKA-ANGELEGENHEITEN
HEINER SCHÜPP: Aus der Mitgliederversammlung der ANKA e. V. (S. 120)
SABINE MAEHNERT: Berichte aus den Regionalgruppen (S. 123)
48. Arbeitstagung der ANKA, 26. und 27. April 2010 in Osterholz-Scharmbeck (S. 126)
Vorschau auf die Mitgliederversammlung am Dienstag, 27. April 2010 (S. 127)
AKTUELL UND INTERESSANT
Archivjubiläen im Niedersächsischen Landesarchiv (S. 130)
BRAGE BEI DER WIEDEN: 600 Jahre Staatsarchiv Wolfenbüttel? (S. 130)
BIRGIT KEHNE: 140 Jahre Staatsarchiv Osnabrück? (S. 131)
ROBERT GAHDE: 50 Jahre Staatsarchiv Stade? (S. 133)
HANS-MARTIN ARNOLDT: Gebührenerhebung im Niedersächsischen Landesarchiv (S. 136)
MARTIN KLEINFELD: Die Archive im Landkreis Harburg gehen online! (S. 138)
NEU ERSCHIENEN (S. 139)
TERMINE (S. 142)
DAS LETZTE ZUM SCHLUSS (S. 145)
via Archivliste. Mit Dank an die Schriftleitung, Dr. Birgit Kehne und Rose Scholl
Link zur ANKA
Sie erhalten das Heft zum Preis von 6,00 Euro (zuzügl. Versand) bei der ANKA-Geschäftsstelle (Adresse s.u.).
Inhaltsverzeichnis:
EDITORIAL (S.3)
47. ANKA-TAGUNG 2009 WILHELMSHAVEN
AXEL PRIEBS: Hafen und Stadt (S. 8)
HEINER SCHÜPP: Die Gebiets- und Verwaltungsreform in Niedersachsen. Einleitende Bemerkungen zu ersten Arbeitssitzung (S. 20)
GERD STEINWASCHER: Gebiets- und Verwaltungsreform in Niedersachsen (S. 21)
WOLFGANG JÜRRIES: Überlieferungsbildung in Kreisarchiven als Folge der Gebiets- und Verwaltungsreform in Niedersachsen (S. 31)
KLAUS FESCHE: Die Gebiets- und Verwaltungsreform in Niedersachsen und ihre Folgen für die Archive. Das Beispiel der Mittelstadt Wunstorf (S. 35)
BIRGIT KEHNE: Auswirkungen der Gebietsreform auf die archivische Überlieferung. Das Beispiel Osnabrück (S. 39)
KATRIN QUIRIN: Das Deutsche Auswandererhaus Bremerhaven. Archivische Quellen zum Themenbereich Auswanderung (S. 42)
WOLFGANG GRAMS: „Ist nicht hier, ist nicht da, ist wohl in Amerika.“ Archivische Quellen in der Auswanderungsforschung (S. 51)
ULRICH BREDEN: Die Datenbanken „Niedersächsische Bibliographie“ und „Niedersächsische Personen“ als Rechercheinstrumente für landeskundliche Literatur (S. 59)
ROMY MEYER UND HENNING STEINFÜHRER: Zur Übernahme digitaler Daten im Stadtarchiv Braunschweig. Ein Erfahrungsbericht (S. 64)
BETTINA JOERGENS: Open Access zum Personenstandsarchiv. Bereitstellung, Service und Kooperationen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen (S. 73)
AUS DER ARBEIT DER ARCHIVE
KIRSTEN HOFFMANN: Archivbenutzung im Wandel der Zeiten – ein etwas anderer Zugang zur Archivgeschichte des Niedersächsischen Landesarchivs – Hauptstaatsarchiv Hannover (S. 88)
SILKE WAGENER-FIMPEL: Die Flüchtlingsakten des Landkreises Wolfenbüttel (S. 96)
CLAUDIA BEI DER WIEDEN: Ein ganzheitliches Archivkonzept für die HBK Braunschweig (S. 103)
BIRGIT KEHNE: Bewertungshilfe für die Sammelakten zu den Personenstandsregistern (S. 107)
HANS-MARTIN ARNOLDT: Historische Quellen zur Eisenbahngeschichte im Landesarchiv. Ein Online-Inventar (S. 112)
ANKA-ANGELEGENHEITEN
HEINER SCHÜPP: Aus der Mitgliederversammlung der ANKA e. V. (S. 120)
SABINE MAEHNERT: Berichte aus den Regionalgruppen (S. 123)
48. Arbeitstagung der ANKA, 26. und 27. April 2010 in Osterholz-Scharmbeck (S. 126)
Vorschau auf die Mitgliederversammlung am Dienstag, 27. April 2010 (S. 127)
AKTUELL UND INTERESSANT
Archivjubiläen im Niedersächsischen Landesarchiv (S. 130)
BRAGE BEI DER WIEDEN: 600 Jahre Staatsarchiv Wolfenbüttel? (S. 130)
BIRGIT KEHNE: 140 Jahre Staatsarchiv Osnabrück? (S. 131)
ROBERT GAHDE: 50 Jahre Staatsarchiv Stade? (S. 133)
HANS-MARTIN ARNOLDT: Gebührenerhebung im Niedersächsischen Landesarchiv (S. 136)
MARTIN KLEINFELD: Die Archive im Landkreis Harburg gehen online! (S. 138)
NEU ERSCHIENEN (S. 139)
TERMINE (S. 142)
DAS LETZTE ZUM SCHLUSS (S. 145)
via Archivliste. Mit Dank an die Schriftleitung, Dr. Birgit Kehne und Rose Scholl
Link zur ANKA
Wolf Thomas - am Donnerstag, 25. Februar 2010, 19:28 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bizarr verformtes Gebetbuch aus dem 15. Jh. Die Restaurierung soll die Pergamenthandschrift mit goldenen Zierinitialen und Ranken- und Blumenverzierungen wieder benutzbar machen
Die Kulturstiftung der Länder finanziert mit 200.000 Euro die Restaurierung wertvoller Handschriften des Historischen Archivs der Stadt Köln, die durch den Einsturz des Archivs im März 2009 stark beschädigt wurden.
Unterstützen auch Sie die Restaurierung der Bestände des Historischen Archivs! Auch jeder kleine Betrag hilft dabei, schnell die dringend notwendigen Arbeiten an den bedrohten Beständen des Kölner Archivs zu beginnen. Weitere Informationen zu Spendemodalitäten finden Sie unterhalb dieses Artikels!
Mit großer Bestürzung reagierten im März 2009 nicht nur Kulturinteressierte in aller Welt auf den tragischen Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln. Man befürchtete, dass ein großer Teil des wertvollen Archivguts – das kulturelle Gedächtnis der Stadt Köln – unrettbar im Krater der Einsturzstelle verlorenging. Ein Jahr nach dem Unglück und nach einer monatelangen konzertierten Rettungs- und Bergungsaktion vieler beteiligter Institutionen, professioneller Helfer und zahlloser Freiwilliger aus ganz Deutschland steht fest: Ein großer Teil – etwa 85 Prozent – der verschütteten Bestände des bedeutendsten kommunalen Archivs nördlich der Alpen konnte bis jetzt, wenn auch vielfach stark beschädigt, geborgen werden. Der Anblick ist allerdings erschütternd: Risse, Knicke, Quetschungen, Fehlstellen, Staub, massive Verschmutzungen, Wasserschäden, Schimmel und Mikrobenbefall bedrohen weiterhin die wertvollen Zeugnisse der europäischen Kultur aus über 1.000 Jahren. Das Historische Archiv beherbergte vor dem Einsturz rund 30 Regalkilometer Archivgut, vom Kölner „Verbundbrief“ von 1396, mit dem sich Köln erstmals eine Verfassung gab, bis hin zu Nachlässen bedeutender Künstler wie beispielsweise des Literatur-Nobelpreisträgers Heinrich Böll. Die Gesamtkosten für die notwendigen Restaurierungsarbeiten am beschädigten Kölner Bestand werden momentan auf 300 Millionen Euro geschätzt.
Die Kulturstiftung der Länder hatte bereits unmittelbar nach dem Einsturz im März 2009 eine Soforthilfe von 50.000 Euro bereitgestellt, mit der das Historische Archiv eine Gefriertrocknungmaschine erwerben konnte: Feucht geborgene Archivalien wurden nach ihrer Bergung eingefroren, um weitere Beschädigungen zu stoppen. Die neue Maschine entzieht den Stücken nun das Wasser, anschließend kann die Restaurierung beginnen.
Die Kulturstiftung der Länder will das Historische Archiv der Stadt Köln weiterhin bei der Restaurierung seiner beschädigten Schätze unterstützen. Dazu stellt sie jetzt aus eingeworbenen Drittmitteln 200.000 Euro zur Verfügung. Damit beginnt eine großangelegte Restaurierungsinitiative der Kulturstiftung der Länder mit einem benötigten Gesamtvolumen von ungefähr 1 Million Euro, die sich in den kommenden Monaten einigen der wertvollsten Stücke des Archivs widmet, dem Bestand Wallraf, einer Sammlung kostbarer Handschriften
Der Bestand Wallraf umfasste fast 400 Handschriften, das Archiv besaß insgesamt etwa 1.500 Handschriftenbände aus Pergament und Papier. Die Kulturstiftung der Länder will für die Restaurierung der zahlreichen Handschriften im Lauf des Jahres 2010 weitere Mittel zur Verfügung stellen.
Unterstützen auch Sie die Restaurierung der Bestände des Historischen Archivs mit einer Spende! Die Kulturstiftung der Länder ist berechtigt, steuerlich wirksame Spendenquittungen auszustellen. Bitte vermerken Sie Ihre Adresse bei der Überweisung, dann senden wir Ihnen eine Spendenquittung zu. Wir leiten Ihre Spende ohne jeglichen Abzug an das Historische Archiv weiter. Vielen Dank!
Spendenkonto der Kulturstiftung der Länder bei der Deutschen Bank,
Kto-Nr. 0120 441 100, BLZ 100 700 00, Stichwort „Köln“.
Für weitere Informationen:
Kulturstiftung der Länder, Telefon 030-89 36 350;
E-Mail: Hilfe-fuer-Koeln(at)kulturstiftung.de
Quelle: Kulturstiftung der Länder, Pressemitteilung 25.02.2010
Wolf Thomas - am Donnerstag, 25. Februar 2010, 19:17
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Knapp ein Jahr nach dem Einsturz des Stadtarchivs von Köln gibt es Streit ums Geld. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen wirft der Stadt vor, Versicherungsgelder in zweistelliger Millionenhöhe zum Füllen von Haushaltslöchern einzusetzen. In einer solchen Situation wäre es unverantwortlich, jetzt weitere Landesmittel zur Verfügung zu stellen, erklärte Kulturstaatssekretär Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff im Düsseldorfer Landtag. NRW werde sich deshalb vorerst auch nicht an einer "Stiftung Kölner Stadtarchiv" beteiligen. - Der Einsturz, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen, jährt sich am 3. März zum ersten Mal. "
Quelle: DeutschlandradioKultur, Kulturnachrichten
Nachtrag:
" .... „Es macht uns skeptisch, dass der Kämmerer dieses Geld für den Ausgleich des Defizits im Haushalt einsetzt“, sagte Grosse-Brockhoff. Er nannte es „unverantwortlich“, in einer solchen Situation öffentliche Gelder zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Köln haben mit den Versicherungssummen „eine Menge Geld“, das sie für die Restaurierung verwenden könne.
Zahlungen des Landes an die Stadt Köln im Zusammenhang mit einer Stiftung Kölner Stadtarchiv machte der CDU-Kulturpolitiker zudem davon abhängig, „dass ganz klar die Verantwortlichkeiten geklärt werden und die Frage, wer letztlich haftet. Im Zweifelsfall wird es die Stadt Köln sein“, so Grosse-Brockhoff. Vor einer Mitfinanzierung des Landes müssten auch eventuelle Versicherungsleistungen anderer Art „und Haftungen etwa des Bauunternehmens Bilfinger Berger geklärt“ werden. Erst wenn all diese Vorbedingungen erfüllt und „sauber definiert“ seien, stünde einem finanziellen Engagement der Landesregierung nichts im Wege, versicherte Grosse-Brockhoff. "
Quelle: Kölner Stadtanzeiger
FDP-Fraktion im Rat der Stadt Köln: Stiftung für Restaurierung der Archivalien des Archivs
"Versicherung der Kulturgüter als Grundstock der Stiftung für die Restaurierung der Archivalien des Historischen Archivs
Die FDP-Fraktion hat folgenden Antrag auf die Tagesordnung des Rates am 2. Februar 2010 setzen lassen.
Der Rat der Stadt Köln möge beschließen:
Der von der Provinzial-Versicherung als Ersatz für Kulturgüterverlust überwiesene Betrag von 61,5 Mio. Euro wird in voller Höhe der Stiftung für die Restaurierung der beschädigten Archivalien des Historischen Archivs der Stadt Köln zur Verfügung gestellt.
Begründung:
Eine Anfrage der FDP im Kulturausschuss hat ergeben, dass die von der Provinzial-Versicherung als Ersatz für den Verlust von Kulturgütern gezahlte Summe von 61,5 Mio. Euro nicht der vom Rat einstimmig beschlossenen Stiftung für die Restaurierung der Archivalien zur Verfügung gestellt werden soll, sondern im allgemeinen Haushalt verbleibt und mit allgemeinen Kosten im Zusammenhang mit dem Unglück verrechnet werden.. Diese Entscheidung ist in mehrfacher Hinsicht unbefriedigend und sogar kontraproduktiv. Sie muss deshalb dringend korrigiert werden.
Der Einsturz des Historischen Archivs am 3. März 2009 hat Kulturgüter zerstört und beschädigt. Im Fall des vollständigen Verlustes von Archivalien ist ein Ersatz der einzigartigen Bestände unmöglich. Der dadurch entstandene ideelle Schaden ist nicht zu beziffern. Die Kosten für die Restaurierung von Schäden an geborgenen Archivalien allerdings werden auf mindestens 350 Millionen Euro geschätzt. Die Stadt Köln muss sich dieser Herausforderung stellen und alles unternehmen, um zu retten, was noch zu retten ist. Dazu bedarf es einer gut ausgestatten Stiftung zur Restaurierung.
Die Gründe dafür sind klar:
- Die Stiftung zur Restaurierung gibt dem Bemühen der Stadt um mögliche Wiedergutmachung eine eindeutige und selbstständige Adresse und macht es so – unabhängig vom allgemeinen Verwaltungsapparat – für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch außerhalb der Stadt erkennbar. Diese Unabhängigkeit und Selbstständigkeit eröffnet überhaupt erst die Chance, potentielle Unterstützer zu finanziellen Beiträgen zu motivieren. Dies gilt sowohl für institutionelle Geber, als auch für – hoffentlich zahlreiche – Kleinspender. Niemand wird einfach in die Stadtkasse einzahlen.
- Die institutionelle Unabhängigkeit der zu gründenden Stiftung ist in diesem Sinne eine notwendige Bedingung, reicht aber für sich genommen noch nicht aus. Es bedarf darüber hinaus auch einer wirklich nennenswerten finanziellen Ausstattung durch die Stadt Köln. Es handelt sich beim Einsturz des Historischen Archivs nicht um eine Naturkatastrophe oder ein allgemeines Unglück. Vielmehr trägt die Stadt Köln – selbst und in Gestalt ihrer Verkehrsbetriebe – eine ganz wesentliche Verantwortung für das das Unglück auslösende Verkehrsbauwerk. Wenn der Rat der Stadt Köln vor diesem Hintergrund tatsächlich finanzielle Unterstützung von Dritten erwartet, wird er zunächst ganz deutlich in Vorleistung treten müssen. Erst wenn erkennbar wird, dass die Stadt Köln bereit ist, selbst große Anstrengungen zur möglichen Wiedergutmachung zu unternehmen, wird Unterstützung von außerhalb kommen – und die Stadt braucht diese Unterstützung!
- Schließlich bietet die Stiftung auch effiziente und kurzwegige Möglichkeiten zur Mittelverwendung. Den Herausforderungen, vor denen das Historische Archiv in den nächsten Jahren steht, kann so sehr viel flexibler entgegengetreten werden. Hier kann sich auch die richtige Systemstelle für die Etablierung eines professionellen Fundraisings bieten, über das gesondert zu beraten ist.
Es ist deshalb zwingend, dass der Rat der Stadt Köln die schon vereinnahmte Versicherungssumme – die schließlich für den Verlust von Kulturgut gezahlt wurde – tatsächlich für die Stiftung zur Restaurierung der Archivalien zur Verfügung stellt. Umgekehrt wäre es ein fatales Zeichen an die Öffentlichkeit in Köln und darüber hinaus, wenn diese Mittel im allgemeinen Haushalt mit allen damit verbundenen Unwägbarkeiten verbleiben würden. Wenn es nicht gelingt, Drittmittel zu akquirieren, werden die gesamten und noch deutlich höheren Kosten, ohne jede Unterstützung, zu Lasten des städtischen Haushaltes gehen.
Begründung der Dringlichkeit:
Die genannte Sitzung des Kulturausschusses, in der die nicht für die Restaurierung bestimmte Verwendung der Versicherungssumme offenkundig wurde, lag erst nach dem regulären Antragsschluss für diese Ratssitzung.
Für die Mobilisierung von finanzieller Unterstützung durch Dritte ist die Stadt Köln inzwischen schon spät dran. Der Einsturz des Archivs liegt bald ein Jahr zurück. Es wird deshalb höchste Zeit, offensiv mit der Einwerbung von Spendengeldern und Zustiftungen zugunsten der Stiftung zu beginnen. Die Eröffnung der Ausstellung des Archivs im Berliner Gropiusbau im März bietet hierfür eine besondere – und vielleicht die letzte – Chance. Die Stadt Köln sollte dort ein starkes Zeichen für die eigenen Bemühungen setzen."
Quelle: FDP Köln
s. dazu: http://archiv.twoday.net/stories/6195864/
Quelle: DeutschlandradioKultur, Kulturnachrichten
Nachtrag:
" .... „Es macht uns skeptisch, dass der Kämmerer dieses Geld für den Ausgleich des Defizits im Haushalt einsetzt“, sagte Grosse-Brockhoff. Er nannte es „unverantwortlich“, in einer solchen Situation öffentliche Gelder zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Köln haben mit den Versicherungssummen „eine Menge Geld“, das sie für die Restaurierung verwenden könne.
Zahlungen des Landes an die Stadt Köln im Zusammenhang mit einer Stiftung Kölner Stadtarchiv machte der CDU-Kulturpolitiker zudem davon abhängig, „dass ganz klar die Verantwortlichkeiten geklärt werden und die Frage, wer letztlich haftet. Im Zweifelsfall wird es die Stadt Köln sein“, so Grosse-Brockhoff. Vor einer Mitfinanzierung des Landes müssten auch eventuelle Versicherungsleistungen anderer Art „und Haftungen etwa des Bauunternehmens Bilfinger Berger geklärt“ werden. Erst wenn all diese Vorbedingungen erfüllt und „sauber definiert“ seien, stünde einem finanziellen Engagement der Landesregierung nichts im Wege, versicherte Grosse-Brockhoff. "
Quelle: Kölner Stadtanzeiger
FDP-Fraktion im Rat der Stadt Köln: Stiftung für Restaurierung der Archivalien des Archivs
"Versicherung der Kulturgüter als Grundstock der Stiftung für die Restaurierung der Archivalien des Historischen Archivs
Die FDP-Fraktion hat folgenden Antrag auf die Tagesordnung des Rates am 2. Februar 2010 setzen lassen.
Der Rat der Stadt Köln möge beschließen:
Der von der Provinzial-Versicherung als Ersatz für Kulturgüterverlust überwiesene Betrag von 61,5 Mio. Euro wird in voller Höhe der Stiftung für die Restaurierung der beschädigten Archivalien des Historischen Archivs der Stadt Köln zur Verfügung gestellt.
Begründung:
Eine Anfrage der FDP im Kulturausschuss hat ergeben, dass die von der Provinzial-Versicherung als Ersatz für den Verlust von Kulturgütern gezahlte Summe von 61,5 Mio. Euro nicht der vom Rat einstimmig beschlossenen Stiftung für die Restaurierung der Archivalien zur Verfügung gestellt werden soll, sondern im allgemeinen Haushalt verbleibt und mit allgemeinen Kosten im Zusammenhang mit dem Unglück verrechnet werden.. Diese Entscheidung ist in mehrfacher Hinsicht unbefriedigend und sogar kontraproduktiv. Sie muss deshalb dringend korrigiert werden.
Der Einsturz des Historischen Archivs am 3. März 2009 hat Kulturgüter zerstört und beschädigt. Im Fall des vollständigen Verlustes von Archivalien ist ein Ersatz der einzigartigen Bestände unmöglich. Der dadurch entstandene ideelle Schaden ist nicht zu beziffern. Die Kosten für die Restaurierung von Schäden an geborgenen Archivalien allerdings werden auf mindestens 350 Millionen Euro geschätzt. Die Stadt Köln muss sich dieser Herausforderung stellen und alles unternehmen, um zu retten, was noch zu retten ist. Dazu bedarf es einer gut ausgestatten Stiftung zur Restaurierung.
Die Gründe dafür sind klar:
- Die Stiftung zur Restaurierung gibt dem Bemühen der Stadt um mögliche Wiedergutmachung eine eindeutige und selbstständige Adresse und macht es so – unabhängig vom allgemeinen Verwaltungsapparat – für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch außerhalb der Stadt erkennbar. Diese Unabhängigkeit und Selbstständigkeit eröffnet überhaupt erst die Chance, potentielle Unterstützer zu finanziellen Beiträgen zu motivieren. Dies gilt sowohl für institutionelle Geber, als auch für – hoffentlich zahlreiche – Kleinspender. Niemand wird einfach in die Stadtkasse einzahlen.
- Die institutionelle Unabhängigkeit der zu gründenden Stiftung ist in diesem Sinne eine notwendige Bedingung, reicht aber für sich genommen noch nicht aus. Es bedarf darüber hinaus auch einer wirklich nennenswerten finanziellen Ausstattung durch die Stadt Köln. Es handelt sich beim Einsturz des Historischen Archivs nicht um eine Naturkatastrophe oder ein allgemeines Unglück. Vielmehr trägt die Stadt Köln – selbst und in Gestalt ihrer Verkehrsbetriebe – eine ganz wesentliche Verantwortung für das das Unglück auslösende Verkehrsbauwerk. Wenn der Rat der Stadt Köln vor diesem Hintergrund tatsächlich finanzielle Unterstützung von Dritten erwartet, wird er zunächst ganz deutlich in Vorleistung treten müssen. Erst wenn erkennbar wird, dass die Stadt Köln bereit ist, selbst große Anstrengungen zur möglichen Wiedergutmachung zu unternehmen, wird Unterstützung von außerhalb kommen – und die Stadt braucht diese Unterstützung!
- Schließlich bietet die Stiftung auch effiziente und kurzwegige Möglichkeiten zur Mittelverwendung. Den Herausforderungen, vor denen das Historische Archiv in den nächsten Jahren steht, kann so sehr viel flexibler entgegengetreten werden. Hier kann sich auch die richtige Systemstelle für die Etablierung eines professionellen Fundraisings bieten, über das gesondert zu beraten ist.
Es ist deshalb zwingend, dass der Rat der Stadt Köln die schon vereinnahmte Versicherungssumme – die schließlich für den Verlust von Kulturgut gezahlt wurde – tatsächlich für die Stiftung zur Restaurierung der Archivalien zur Verfügung stellt. Umgekehrt wäre es ein fatales Zeichen an die Öffentlichkeit in Köln und darüber hinaus, wenn diese Mittel im allgemeinen Haushalt mit allen damit verbundenen Unwägbarkeiten verbleiben würden. Wenn es nicht gelingt, Drittmittel zu akquirieren, werden die gesamten und noch deutlich höheren Kosten, ohne jede Unterstützung, zu Lasten des städtischen Haushaltes gehen.
Begründung der Dringlichkeit:
Die genannte Sitzung des Kulturausschusses, in der die nicht für die Restaurierung bestimmte Verwendung der Versicherungssumme offenkundig wurde, lag erst nach dem regulären Antragsschluss für diese Ratssitzung.
Für die Mobilisierung von finanzieller Unterstützung durch Dritte ist die Stadt Köln inzwischen schon spät dran. Der Einsturz des Archivs liegt bald ein Jahr zurück. Es wird deshalb höchste Zeit, offensiv mit der Einwerbung von Spendengeldern und Zustiftungen zugunsten der Stiftung zu beginnen. Die Eröffnung der Ausstellung des Archivs im Berliner Gropiusbau im März bietet hierfür eine besondere – und vielleicht die letzte – Chance. Die Stadt Köln sollte dort ein starkes Zeichen für die eigenen Bemühungen setzen."
Quelle: FDP Köln
s. dazu: http://archiv.twoday.net/stories/6195864/
Wolf Thomas - am Donnerstag, 25. Februar 2010, 12:07 - Rubrik: Kommunalarchive
KlausGraf - am Donnerstag, 25. Februar 2010, 11:32 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
KlausGraf - am Donnerstag, 25. Februar 2010, 11:31 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Aufzeichnung der gesamten Veranstaltung sowie ein kurzer Magazinbeitrag zum Thema sind jetzt online: http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2010/28711406_kw08_parlamentarischer_rat/index.html
Angela Ullmann - am Donnerstag, 25. Februar 2010, 10:27 - Rubrik: Veranstaltungen
"Beim Einsturz des Kölner Stadtarchivs am 3. März 2009, wurde nicht nur das historische Gedächtnis der Stadt Köln unter Tonnen von Beton begraben, es kamen auch zwei junge Menschen zu Tode.
Als Gedenken und Mahnung an diese Tragödie, findet am 5. März 2010 um 19.30 Uhr in der CRUX Kirche
St. Johann Baptist ein Gedenkgottesdienst statt.
Der Severinschor "Himmel und Ääd" unter der Leitung von Gerd Schmitz, lädt zusammen mit dem Ortspfarrer Johannes Quirl und dem Stadtjugendseelsorger Pfarrer Dr. Dominik Meierling zu einem musikalischen Gottesdienst ein, der auf das vergangene tragische Unglück zurück schaut und an das einschneidende Ereignis erinnert.
5. März 2010 / Beginn: 19.30 Uhr
CRUX Kirche St. Johann Baptist
An St. Katharinen 5
50678 Köln
Als Gedenken und Mahnung an diese Tragödie, findet am 5. März 2010 um 19.30 Uhr in der CRUX Kirche
St. Johann Baptist ein Gedenkgottesdienst statt.
Der Severinschor "Himmel und Ääd" unter der Leitung von Gerd Schmitz, lädt zusammen mit dem Ortspfarrer Johannes Quirl und dem Stadtjugendseelsorger Pfarrer Dr. Dominik Meierling zu einem musikalischen Gottesdienst ein, der auf das vergangene tragische Unglück zurück schaut und an das einschneidende Ereignis erinnert.
5. März 2010 / Beginn: 19.30 Uhr
CRUX Kirche St. Johann Baptist
An St. Katharinen 5
50678 Köln
Wolf Thomas - am Mittwoch, 24. Februar 2010, 19:16 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Die beiden Schüler Jaqueline Kuhlmann und Moritz Lümen lauschen angespannt an der Tür des Archivkellers. Sie warten auf ihren Einsatz. Gleich wird Regisseur Thomas Kipke "und Bitte" rufen, dann sollen die beiden durch die Tür stürmen und sich im düsteren Raum umsehen. Doch irgendwie klappt es auch beim dritten Anlauf nicht so, wie vom Regisseur verlangt. "Das Licht war zu früh aus", schreit Kipke aufgebracht. Und fügt ein "nochmal" hinzu. Alle sind hoch konzentriert. Die beiden Protagonisten des Kurzfilms stürmen noch ein viertes und ein fünftes Mal durch die Tür.
Dr. Hansjörg Riechert vom Kreisarchiv freut sich, dass alle sehr engagiert bei der Sache sind. Er sei gespannt auf das Ergebnis, verrät er. "Wir haben das Drehbuch gesehen, aber wie wird es wohl am Ende?", fragt Riechert. Er findet es richtig, dass beide Archive sich weiter für die neuen Medien öffnen. "Dieser Film ist unkonventionell. Wir wollten Jugendliche für unsere Arbeit begeistern. Und das klappt nur, wenn wir das Publikum auch zeitgemäß ansprechen."
Für die Schauspieler geht es inzwischen weiter zur nächsten Szene. "Jetzt sucht ihr die Regale ab und bleibt genau hier stehen", instruiert Kipke seine beiden Schauspieler. Die alten Dokumente verströmen einen leicht muffigen Duft. Vom schmalen Mittelgang ist seit Drehbeginn nicht mehr viel zu sehen. Überall liegen Kabel, Scheinwerfer und Kamerazubehör herum. Nicht ungewöhnlich für einen Kurzfilm.
Auch wenn Dr. Hansjörg Riechert nicht den gesamten Dreh verfolgen kann, so schaut er gerne am "Filmset" vorbei. "Erst beim Einsturz in Köln ist gerade jungen Menschen der Wert eines Archives bewusst geworden." Unter anderem deshalb seien er und Dr. Christian Reinecke vom Landesarchiv auf die Idee gekommen, diesen Werbefilm in Auftrag zu geben. "Wir haben die Hochschule und das Leopoldinum gefragt, und beide haben gleich zugesagt." Ein dreistelliger Betrag fließt in das Projekt. Das Ergebnis soll später bei Führungen, aber auch beim Archiv-Symposium im Mai gezeigt werden. "Viele werden zwar die Köpfe schütteln, aber solange wir die Jugendlichen erreichen, hat sich alles gelohnt."
Jaqueline und Moritz haben zwei Minuten Pause, bis es zur nächsten Einstellung geht. "Wir hinken unserem Plan hinterher. Aber ich denke, dass wir das noch aufholen werden", sagt Kipke zwischen prüfenden Blicken auf die Aufnahmen. Zwei Studenten montieren unterdessen Scheinwerfer auf die auserkorene Regalreihe und fixieren alles an Ort und Stelle. Bei jeder der 22 Einstellungen ist das Team bei der Sache. "Auch wenn es nach vielen Stunden anstrengend wird, macht das hier tierisch viel Spaß", sagen die Schauspieler. In drei bis vier Wochen will der Regisseur fertig sein mit dem Film. Für die passende Vertonung sollen anschließend Studenten der Musikhochschule sorgen. "Es steht zwar noch nicht fest, aber vielleicht wird er auch im Internet veröffentlicht."
Quelle: Lippische Landeszeitung
Dr. Hansjörg Riechert vom Kreisarchiv freut sich, dass alle sehr engagiert bei der Sache sind. Er sei gespannt auf das Ergebnis, verrät er. "Wir haben das Drehbuch gesehen, aber wie wird es wohl am Ende?", fragt Riechert. Er findet es richtig, dass beide Archive sich weiter für die neuen Medien öffnen. "Dieser Film ist unkonventionell. Wir wollten Jugendliche für unsere Arbeit begeistern. Und das klappt nur, wenn wir das Publikum auch zeitgemäß ansprechen."
Für die Schauspieler geht es inzwischen weiter zur nächsten Szene. "Jetzt sucht ihr die Regale ab und bleibt genau hier stehen", instruiert Kipke seine beiden Schauspieler. Die alten Dokumente verströmen einen leicht muffigen Duft. Vom schmalen Mittelgang ist seit Drehbeginn nicht mehr viel zu sehen. Überall liegen Kabel, Scheinwerfer und Kamerazubehör herum. Nicht ungewöhnlich für einen Kurzfilm.
Auch wenn Dr. Hansjörg Riechert nicht den gesamten Dreh verfolgen kann, so schaut er gerne am "Filmset" vorbei. "Erst beim Einsturz in Köln ist gerade jungen Menschen der Wert eines Archives bewusst geworden." Unter anderem deshalb seien er und Dr. Christian Reinecke vom Landesarchiv auf die Idee gekommen, diesen Werbefilm in Auftrag zu geben. "Wir haben die Hochschule und das Leopoldinum gefragt, und beide haben gleich zugesagt." Ein dreistelliger Betrag fließt in das Projekt. Das Ergebnis soll später bei Führungen, aber auch beim Archiv-Symposium im Mai gezeigt werden. "Viele werden zwar die Köpfe schütteln, aber solange wir die Jugendlichen erreichen, hat sich alles gelohnt."
Jaqueline und Moritz haben zwei Minuten Pause, bis es zur nächsten Einstellung geht. "Wir hinken unserem Plan hinterher. Aber ich denke, dass wir das noch aufholen werden", sagt Kipke zwischen prüfenden Blicken auf die Aufnahmen. Zwei Studenten montieren unterdessen Scheinwerfer auf die auserkorene Regalreihe und fixieren alles an Ort und Stelle. Bei jeder der 22 Einstellungen ist das Team bei der Sache. "Auch wenn es nach vielen Stunden anstrengend wird, macht das hier tierisch viel Spaß", sagen die Schauspieler. In drei bis vier Wochen will der Regisseur fertig sein mit dem Film. Für die passende Vertonung sollen anschließend Studenten der Musikhochschule sorgen. "Es steht zwar noch nicht fest, aber vielleicht wird er auch im Internet veröffentlicht."
Quelle: Lippische Landeszeitung
Wolf Thomas - am Mittwoch, 24. Februar 2010, 19:08 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Archiv-Bahn bei der Vorstellung auf dem Neumarkt
Dr. Ulrich Soénius (Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln) und Jürgen Fenske, Vorstandssprecher der KVB AG, stellten heute Mittag auf dem Neumarkt gemeinsam eine neu gestaltete „Archiv-Bahn“ vor. Die in Kooperation von KVB, Kölner Außenwerbung und Arbeitskreis Kölner Archivarinnen und Archivare (AKA) entstandene Bahn macht auf den bundesweit alle zwei Jahre stattfindenden Tag der Archive aufmerksam, der am 6. März im Straßenbahn-Museum Thielenbruch für die Besucher ein spannendes Programm bereithält.
Die „Archiv-Bahn“ zeigt, was Kölner Archive aufbewahren. Dazu gehören Fotos, Schriftstücke, Pläne und Filme. Auf und in der Bahn wird das Motto „Kölner Archive geben Antworten“ wörtlich genommen. Sie beantwortet z.B. die Frage nach dem Ursprung des FC-Maskott¬chens. Nahezu 40 Archive unterschiedlicher Sparten sind in Köln beheimatet.
Auch über den Tag der Archive hinaus wird die attraktiv gestaltete Bahn auf die Vielfalt und den Wert der Kölner Archive in der Öffentlichkeit hinweisen. "
Quelle: KVB, Pressemitteilung

Teilansicht (Quelle: Homepage Historische Straßenbahn Köln e.V., Straßenbahn-Museum Thielenbruch)
Wolf Thomas - am Mittwoch, 24. Februar 2010, 18:49 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
" ..... Alle Produkte des Stadtarchivs sind pflichtige Aufgaben nach dem Archivgesetz NRW. Dazu gehört auch der Öffentlichkeit den Zugang zu den Archivmaterialien zu ermöglichen.
Zusätzliche Informationen:
Eine Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 10 bis 15 % wäre möglich; dazu ist ein Ratsbeschluss erforderlich.
Einführung neuer Gebührentatbestände (Kopien Standesamtsregister etc.) ...."
Die Verwaltung geht von einer jährlichen Ertragserhöhung von 3.200 € aus.
Link zum HSK (PDF)
Zusätzliche Informationen:
Eine Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 10 bis 15 % wäre möglich; dazu ist ein Ratsbeschluss erforderlich.
Einführung neuer Gebührentatbestände (Kopien Standesamtsregister etc.) ...."
Die Verwaltung geht von einer jährlichen Ertragserhöhung von 3.200 € aus.
Link zum HSK (PDF)
Wolf Thomas - am Mittwoch, 24. Februar 2010, 17:13 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://pkp.sfu.ca/files/OJS%20Journal%20Survey.pdf
Ausgewertet werden Daten von knapp 1000 Zeitschriften, die als Software für den Webauftritt das Open Journal System der OKF benutzen.
52 % der Zeitschriften erhalten 1-10 Einreichungen im Monat. Diese Gruppe publiziert durchschnittlich 31 Artikel jährlich.
89 % der Zeitschriften praktizieren eine Form von Peer Review.
Artikelgebühren spielen nur eine kleine Rolle bei den Zeitschriften, von denen 83 % sofortigen Open Access bieten.
"The challenge
posed by this set of journals becomes starkly apparent, whether the one compares the first copy costs
from this journal sample of $188.39 per article, at roughly a tenth of the industry standard over the
last decade (RIN 2008, p. 35), or the annual budget for the majority of these journals, which stands at
less than what are held to be the “fixed” costs ($3,800) of a single article (Ware & Mabe, 2009, p. 52)."
Ausgewertet werden Daten von knapp 1000 Zeitschriften, die als Software für den Webauftritt das Open Journal System der OKF benutzen.
52 % der Zeitschriften erhalten 1-10 Einreichungen im Monat. Diese Gruppe publiziert durchschnittlich 31 Artikel jährlich.
89 % der Zeitschriften praktizieren eine Form von Peer Review.
Artikelgebühren spielen nur eine kleine Rolle bei den Zeitschriften, von denen 83 % sofortigen Open Access bieten.
"The challenge
posed by this set of journals becomes starkly apparent, whether the one compares the first copy costs
from this journal sample of $188.39 per article, at roughly a tenth of the industry standard over the
last decade (RIN 2008, p. 35), or the annual budget for the majority of these journals, which stands at
less than what are held to be the “fixed” costs ($3,800) of a single article (Ware & Mabe, 2009, p. 52)."
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Februar 2010, 13:03 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wer baut uns ein Stockwerk aufs Dach? Das Archiv der Sozialen Bewegungen braucht Unterstützung - personell, finanziell, materiell
Interview mit dem Hamburger Archiv in: ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis / Nr. 547 / 19.2.2010 (leider nur in Printversion).
Interview mit dem Hamburger Archiv in: ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis / Nr. 547 / 19.2.2010 (leider nur in Printversion).
Bernd Hüttner - am Mittwoch, 24. Februar 2010, 12:58 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
It seems that Sage provides authors with a proprietory application that allows one to print one's article on a single computer, but not save it or send it to colleagues. I guess it is just one more example of how commercial journal publishers rip off academic authors.
http://publishingarchaeology.blogspot.com/2010/02/journal-authors-may-not-get-pdfs-of.html
http://publishingarchaeology.blogspot.com/2010/02/journal-authors-may-not-get-pdfs-of.html
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Februar 2010, 12:49 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Februar 2010, 12:46 - Rubrik: Miscellanea
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Februar 2010, 12:40 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Februar 2010, 12:34 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://wisspub.net/2010/02/23/dfg-regeln-gegen-publikationsflut/
Wissenschaftler sollen in Förderanträgen und Abschlussberichten nur noch wenige und besonders wichtige Veröffentlichungen angeben
Wissenschaftler sollen in Förderanträgen und Abschlussberichten nur noch wenige und besonders wichtige Veröffentlichungen angeben
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Februar 2010, 12:28 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Februar 2010, 12:07 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
"1 Stadt in 100 Bildern / 1 Città 100 foto": Historische Aufnahmen und Baupläne aus dem Stadtarchiv Bozen, nach Sachbereichen sortiert:
http://www.gemeinde.bozen.it/cultura_context.jsp?ID_LINK=3548&area=11&page=1
http://www.gemeinde.bozen.it/cultura_context.jsp?ID_LINK=3548&area=11&page=1
ho - am Mittwoch, 24. Februar 2010, 08:25 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wer auf der Suche nach Tanz-Exempeln ist, wird folgende Suche zu schätzen wissen (die man am besten mit einem US-Proxy durchführt):
http://books.google.com/books?lr=&client=firefox-a&cd=1&num=100&as_brr=0&q=%2Blaudunum+%2Bchoreas&btnG=Search+Books
Siehe auch:
http://de.wikisource.org/wiki/Die_Mordgrube_zu_Freiberg
http://books.google.com/books?lr=&client=firefox-a&cd=1&num=100&as_brr=0&q=%2Blaudunum+%2Bchoreas&btnG=Search+Books
Siehe auch:
http://de.wikisource.org/wiki/Die_Mordgrube_zu_Freiberg
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Februar 2010, 01:02 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Wer im Düsseldorfer Museum K21 den Raum „El Caso“ betritt, spürt und denkt sogleich: Archiv, Gedenkstätte, Grabkammer, Trauer. Unregelmäßig verteilt, hängen 40 gerahmte Porträtfotos an den Wänden. Die Bilder zeigen unscharfe Gesichter von Männern, Frauen und Kindern. Über jedem Foto ist eine Klemmlampe angebracht. Sie sind die einzigen Lichtquellen im Raum und strahlen die Gesichter wie bei einem Verhör an. Lose schwarze Kabel zeichnen ein wirres Liniennetz auf die Wand. Unter jedem Bild hängt eine blecherne Keksdose. Dominiert wird der Raum von drei nebeneinander aufgestellten Holzregalen, die gefüllt sind mit Stapeln fein säuberlich aufgeschichteter Leintücher."
Christian Boltanski, 1944 in Paris geboren, hat diese Installation 1988 erstmals in Madrid gezeigt. „El Caso“ ist der Name eines spanischen Revolverblattes, das mit reißerischen Artikeln über spektakuläre Kriminalfälle eine hohe Auflage erzielt. Boltanski hat die Fotos für seine Installation „El Caso“ entnommen. Sie zeigen Täter und Opfer von Gewaltverbrechen. Die verschlossenen Keksdosen bewahren die Abbilder der Tatorte auf.
„Ich versuche, eine primäre Emotion herzustellen… So wie man im Kino weint“, hat Christian Boltanski einmal gesagt. In seinen Werken stellt er individuelles und kollektives Erfahren gegenüber und setzt sich mit Vergangenheit und Vergänglichkeit auseinander: „‚Zeit’ ist eine Wegführung, die von privater, öffentlicher und der Zeit Gottes spricht. Es gibt keine Antworten, aber viele Fragen.“ Das unkommentierte Nebeneinander von Tätern und Opfern zeigt auch die Paradoxie des Gedenkens. Beim Betrachter setzt „El Caso“ eine Kette von Assoziationen in Gang. Am Ende stehen Vergessen und Tod – oder vielleicht doch Erinnern und Leben."
Buchtipp
Christian Boltanski: Zeit.
Katalog zur Ausstellung Institut Mathildenhöhe Darmstadt, 2006/2007
Hrsg. von Ralf Beil
Hatje Cantz Verlag 2006; Preis: 39,80 Euro
Quelle: west.art, Mesterwerke mit weiterführenden Links
s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=Boltanski
Christian Boltanski, 1944 in Paris geboren, hat diese Installation 1988 erstmals in Madrid gezeigt. „El Caso“ ist der Name eines spanischen Revolverblattes, das mit reißerischen Artikeln über spektakuläre Kriminalfälle eine hohe Auflage erzielt. Boltanski hat die Fotos für seine Installation „El Caso“ entnommen. Sie zeigen Täter und Opfer von Gewaltverbrechen. Die verschlossenen Keksdosen bewahren die Abbilder der Tatorte auf.
„Ich versuche, eine primäre Emotion herzustellen… So wie man im Kino weint“, hat Christian Boltanski einmal gesagt. In seinen Werken stellt er individuelles und kollektives Erfahren gegenüber und setzt sich mit Vergangenheit und Vergänglichkeit auseinander: „‚Zeit’ ist eine Wegführung, die von privater, öffentlicher und der Zeit Gottes spricht. Es gibt keine Antworten, aber viele Fragen.“ Das unkommentierte Nebeneinander von Tätern und Opfern zeigt auch die Paradoxie des Gedenkens. Beim Betrachter setzt „El Caso“ eine Kette von Assoziationen in Gang. Am Ende stehen Vergessen und Tod – oder vielleicht doch Erinnern und Leben."
Buchtipp
Christian Boltanski: Zeit.
Katalog zur Ausstellung Institut Mathildenhöhe Darmstadt, 2006/2007
Hrsg. von Ralf Beil
Hatje Cantz Verlag 2006; Preis: 39,80 Euro
Quelle: west.art, Mesterwerke mit weiterführenden Links
s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=Boltanski
Wolf Thomas - am Dienstag, 23. Februar 2010, 23:19 - Rubrik: Wahrnehmung
http://www.metaarchive.org/sites/default/files/GDDP_Educopia.pdf
This collection is covered by the following Creative Commons License:
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License
This collection is covered by the following Creative Commons License:
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License
KlausGraf - am Dienstag, 23. Februar 2010, 22:56 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
The Society of California Archivists, the Society of Rocky Mountain Archivists, the Conference of Inter-Mountain Archivists, and the Northwest Archivists, Inc. are pleased to announce the establishment of a new peer reviewed open access, online journal—the Journal of Western Archives. The journal will explore important Western regional issues in archives, the development of the archival profession in the western United States, collaborative efforts and projects amongst cultural institutions, and other topics important to archivists working in the western United States. A first call for papers will be distributed early next week and will contain the new journal’s Web address. Contact Gordon Daines at gordon_daines@byu.edu with any questions.
KlausGraf - am Dienstag, 23. Februar 2010, 20:46 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Auch Schriftsteller schreiben heute längst nicht mehr mit der Schreibfeder, sondern am Computer. Das bedeutet eine neue Herausforderung für Archive und Bibliotheken.
Wie geht man mit einem Autorennachlass um, wenn er hauptsächlich aus Disketten besteht? Und was tun, wenn der Literat ein Netzliterat war?
Das Deutsche Literaturarchiv Marbach ist hier wegweisend. "
Quelle: SR/DRS, Reflexe
Link zur Audiodateien
Wie geht man mit einem Autorennachlass um, wenn er hauptsächlich aus Disketten besteht? Und was tun, wenn der Literat ein Netzliterat war?
Das Deutsche Literaturarchiv Marbach ist hier wegweisend. "
Quelle: SR/DRS, Reflexe
Link zur Audiodateien
Wolf Thomas - am Dienstag, 23. Februar 2010, 20:09 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Der traditionelle Winterausflug hat die Mitglieder und Freunde des FDP-Stadtverbandes Steinfurt jetzt in das Stadtarchiv An der Hohen Schule geführt. Stadtarchivar Dr. Ralf Klötzer hatte dabei allerdings nicht die facettenreiche und wechselvolle Geschichte der Stadt im Blick.
Sein Anliegen war es, den Liberalen zu zeigen, wie die wertvollen Urkunden und Akten im früheren Behördenhaus aufbewahrt werden.
Schnell wurde auch ohne Worte klar, dass hier ein Provisorium längst an seine Grenzen gekommen ist. Hoch unter dem Dach mit ständig wechselnden Temperaturen und unzureichendem Besucherservice sind die Möglichkeiten für eine angemessene und fachgerechte Unterbringung und Präsentation der Archivalien nicht mehr angemessen. Weil die eigentlichen Archivräume durch die naturgemäß weiter wachsenden Archivbestände aus ihren Nähten platzen, müssen wertvolle Dokumente der Stadtgeschichte in feuchten Kellerräumen verstaut werden. Eindrucksvoll konnte der Stadtarchivar die drohenden Verluste unersetzbarer Schätze demonstrieren.
Als Hausaufgabe gab Dr. Klötzer den Gästen mit auf den Weg, sich neben der räumlichen Problematik auch für eine bessere Personalausstattung des Archivs einzusetzen. Mit einer halben Stelle wie bisher müsse jegliche Forschungsarbeit liegen bleiben. Es bleibe nur Zeit, sich um den provisorischen Erhalt und die Beseitigung von Schäden bei den Archivalien zu kümmern.
Nach einem Rundgang durch das Stadtmuseum dankte Stadtverbandsvorsitzende Claudia Bögel dem scheidenden Stadtarchivar und versprach, dass sich FDP-Fraktion der offensichtlichen Probleme annehmen werde."
Quelle: Westfälische Nachrichten
Sein Anliegen war es, den Liberalen zu zeigen, wie die wertvollen Urkunden und Akten im früheren Behördenhaus aufbewahrt werden.
Schnell wurde auch ohne Worte klar, dass hier ein Provisorium längst an seine Grenzen gekommen ist. Hoch unter dem Dach mit ständig wechselnden Temperaturen und unzureichendem Besucherservice sind die Möglichkeiten für eine angemessene und fachgerechte Unterbringung und Präsentation der Archivalien nicht mehr angemessen. Weil die eigentlichen Archivräume durch die naturgemäß weiter wachsenden Archivbestände aus ihren Nähten platzen, müssen wertvolle Dokumente der Stadtgeschichte in feuchten Kellerräumen verstaut werden. Eindrucksvoll konnte der Stadtarchivar die drohenden Verluste unersetzbarer Schätze demonstrieren.
Als Hausaufgabe gab Dr. Klötzer den Gästen mit auf den Weg, sich neben der räumlichen Problematik auch für eine bessere Personalausstattung des Archivs einzusetzen. Mit einer halben Stelle wie bisher müsse jegliche Forschungsarbeit liegen bleiben. Es bleibe nur Zeit, sich um den provisorischen Erhalt und die Beseitigung von Schäden bei den Archivalien zu kümmern.
Nach einem Rundgang durch das Stadtmuseum dankte Stadtverbandsvorsitzende Claudia Bögel dem scheidenden Stadtarchivar und versprach, dass sich FDP-Fraktion der offensichtlichen Probleme annehmen werde."
Quelle: Westfälische Nachrichten
Wolf Thomas - am Dienstag, 23. Februar 2010, 20:06 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Dienstag, 23. Februar 2010, 19:43 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
Wolf Thomas - am Dienstag, 23. Februar 2010, 17:31 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Es begann mit einem dumpfen Grollen. Minuten später war das Kölner Stadtarchiv in einer Grube aus Schutt und Schlamm verschwunden. Zwei Menschen kamen bei der Katastrophe vor einem Jahr ums Leben. Unschätzbare Dokumente aus 1000 Jahren Geschichte schienen verloren. Hunderte Freiwillige halfen, um zu retten, was zu retten war. Im Einsatz für das „Gedächtnis des Rheinlands“.
west.art extra nimmt den bevorstehenden Jahrestag des Archiv-Einsturzes zum Anlass, sich mit der Kultur des Erinnerns und Bewahrens zu beschäftigen: Was ist mit den Überresten der Kölner Schätze bis heute passiert? Wie wird konserviert und restauriert? Wie gehen Betroffene, die beim Einsturz mit ihrer Wohnung meist auch alle Erinnerungsstücke verloren haben, heute damit um? Welche Bedeutung hat Erinnern und Archivieren für uns alle? Und wie kann Erinnern und Bewahren in einer digitalen Zukunft aussehen?
Katty Salié ist für west.art extra unterwegs und wird Antworten auf diese Fragen mitbringen."
Sendetermine: 23. Februar 2010, 22.30 - 23.10 Uhr, Montag, 01. März 2010, 10.50 - 11.30 Uhr (Wdh.).
Link zum Video der Sendung
Quelle: Programmvorschau auf wdr.de
west.art extra nimmt den bevorstehenden Jahrestag des Archiv-Einsturzes zum Anlass, sich mit der Kultur des Erinnerns und Bewahrens zu beschäftigen: Was ist mit den Überresten der Kölner Schätze bis heute passiert? Wie wird konserviert und restauriert? Wie gehen Betroffene, die beim Einsturz mit ihrer Wohnung meist auch alle Erinnerungsstücke verloren haben, heute damit um? Welche Bedeutung hat Erinnern und Archivieren für uns alle? Und wie kann Erinnern und Bewahren in einer digitalen Zukunft aussehen?
Katty Salié ist für west.art extra unterwegs und wird Antworten auf diese Fragen mitbringen."
Sendetermine: 23. Februar 2010, 22.30 - 23.10 Uhr, Montag, 01. März 2010, 10.50 - 11.30 Uhr (Wdh.).
Link zum Video der Sendung
Quelle: Programmvorschau auf wdr.de
Wolf Thomas - am Dienstag, 23. Februar 2010, 16:04 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 23. Februar 2010, 15:58 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 23. Februar 2010, 03:38 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Ausgaben von Eccard und Meuschen sind online sowie eine Handschrift aus St. Emmeram (die MGH-Edition sowieso). Nachweise unter
http://de.wikisource.org/wiki/Die_Mordgrube_zu_Freiberg#Die_T.C3.A4nzer_auf_der_Br.C3.BCcke
http://de.wikisource.org/wiki/Die_Mordgrube_zu_Freiberg#Die_T.C3.A4nzer_auf_der_Br.C3.BCcke
KlausGraf - am Dienstag, 23. Februar 2010, 03:34 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Inhalt
2 Grußwort Hortensia Völkers
3 Vorwort Madeline Ritter
6 Kommentar Klaus-Dieter Lehmann
Themen
14 Wolfgang Ernst, Transitorische Archive
22 Barbara Büscher/ Franz Anton Cramer, Beweglicher Zugang
26 Laurent Sebillotte, Das Archiv als Mittel
Statements
40 Xavier Le Roy
42 Reinhild Hoffmann
Fallstudien
50 Michelle Potter,Australien
54 Claire Rousier, Frankreich
59 »Aufruf« Verbund Deutsche Tanzarchive
64 Inhalt und Impressum
Link zur Downloadseite
Weitere Links:
http://www.tanzplan-deutschland.de/
http://www.tanzarchive.de/
2 Grußwort Hortensia Völkers
3 Vorwort Madeline Ritter
6 Kommentar Klaus-Dieter Lehmann
Themen
14 Wolfgang Ernst, Transitorische Archive
22 Barbara Büscher/ Franz Anton Cramer, Beweglicher Zugang
26 Laurent Sebillotte, Das Archiv als Mittel
Statements
40 Xavier Le Roy
42 Reinhild Hoffmann
Fallstudien
50 Michelle Potter,Australien
54 Claire Rousier, Frankreich
59 »Aufruf« Verbund Deutsche Tanzarchive
64 Inhalt und Impressum
Link zur Downloadseite
Weitere Links:
http://www.tanzplan-deutschland.de/
http://www.tanzarchive.de/
Wolf Thomas - am Montag, 22. Februar 2010, 22:37 - Rubrik: Kulturgut

(c) Marie Köhler
"eine Installation der pottfictiongruppe-bochum zum Thema
LIEBE & SEXUALITÄT am Jungen Schauspielhaus Bochum
Archivgut unter Wolke 7
Verschlossen in Köpfen lagern Schätze. Wir haben sie gesammelt und bewahrt. Tonbänder, Pläne und Karten, Filme und Schriftstücke voller Geschichten und Momente.
Archivgut.
Sie lieben und leben.
Sie haben gefragt und gesucht
Sie haben erfasst und erschlossen
Sie sind jung und haben alte Gedanken und Gedanken der neuen Welt
Jetzt öffnen sie die Türen ihres Archivs unter Wolke 7...
Die Jugendlichen der pottfictiongruppe-bochum haben drei Monate lang kleine eigene künstlerische Projekte realisiert. Sie haben selbständig konzeptioniert, geprobt und eine künstlerische Umsetzung ihrer Fragen an die LIEBE&SEXUALITÄT erarbeitet.
Die Inspiration der kleinen künstlerischen Projekte stammt aus gesammeltem Material von einem durch sie organisierten Werkstattwochenende im Oktober 2009 mit 150 Pottfiction-Jugendlichen aus der Metropole Ruhr.
In der Installation Archivgut unter Wolke 7 zeigen sie erste Versuche ihrer
künstlerischen Annäherungen zum Thema LIEBE & SEXUALITÄT.
Leitung: Nelly Thea Köster
Assistenz: Inga Sponheuer"
Wann
24. Februar 2010
19.30 Uhr
Was
pottfiction-gruppe bochum
Wo
Junges Schauspielhaus
Bochum
Quelle: http://www.pottfiction.de/?root=4&id=61
Wolf Thomas - am Montag, 22. Februar 2010, 22:29 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 22. Februar 2010, 21:31 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://wortvogel.de/2010/02/dr-hope-wortvogel-unter-beschuss/
http://www.op-online.de/nachrichten/kultur/fernsehen/wir-wollten-frau-krauss-arbeiten-642918.html
http://www.welt.de/fernsehen/article6440240/Plagiatsvorwuerfe-gegen-ZDF-Sendung-erhoben.html
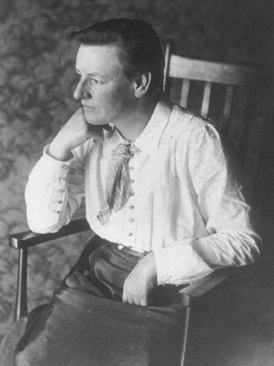
http://www.op-online.de/nachrichten/kultur/fernsehen/wir-wollten-frau-krauss-arbeiten-642918.html
http://www.welt.de/fernsehen/article6440240/Plagiatsvorwuerfe-gegen-ZDF-Sendung-erhoben.html
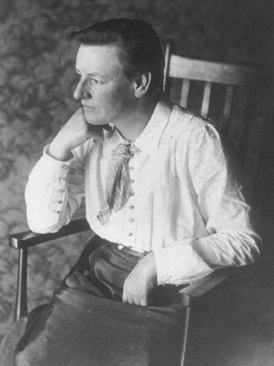
KlausGraf - am Montag, 22. Februar 2010, 21:13 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 22. Februar 2010, 20:55 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 22. Februar 2010, 20:50 - Rubrik: Bibliothekswesen
Wiener Diplomarbeit: http://othes.univie.ac.at/8415/
KlausGraf - am Montag, 22. Februar 2010, 20:29 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 22. Februar 2010, 19:04 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/1166944
Ausgabe von Alfons Hilka:
1. Einleitung, Exempla und Auszüge aus den Predigten des Caesarius von Heisterbach
3. Die beiden ersten Bücher der Libri VIII miraculorum. Leben, Leiden und Wunder des heiligen Engelbert, Erzbischofs von Köln. Die Schriften über die heilige Elisabeth von Thüringen
Ebenfalls online von Alfons Hilka die Ausgabe der Exempelsammlung des Heinemann von Bonn:
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/1166451
Ausgabe von Alfons Hilka:
1. Einleitung, Exempla und Auszüge aus den Predigten des Caesarius von Heisterbach
3. Die beiden ersten Bücher der Libri VIII miraculorum. Leben, Leiden und Wunder des heiligen Engelbert, Erzbischofs von Köln. Die Schriften über die heilige Elisabeth von Thüringen
Ebenfalls online von Alfons Hilka die Ausgabe der Exempelsammlung des Heinemann von Bonn:
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/1166451
KlausGraf - am Montag, 22. Februar 2010, 16:07 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://gallica.bnf.fr
Es gibt inzwischen viel mehr Handschriften, auch eine deutschsprachige:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7200024s
aber ohne Vergrößerungsmöglichkeit ist das ein Witz (und der PDF-Download funktioniert gerade nicht). Andere (lateinische) Handschriften bieten sehr wohl eine komfortable Zoom-Funktion, aber eine deutsche Handschrift ist wohl nicht so wichtig ...
In Chrome lässt sich der Permalien nicht kopieren.
 Originalgröße
Originalgröße
Es gibt inzwischen viel mehr Handschriften, auch eine deutschsprachige:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7200024s
aber ohne Vergrößerungsmöglichkeit ist das ein Witz (und der PDF-Download funktioniert gerade nicht). Andere (lateinische) Handschriften bieten sehr wohl eine komfortable Zoom-Funktion, aber eine deutsche Handschrift ist wohl nicht so wichtig ...
In Chrome lässt sich der Permalien nicht kopieren.
KlausGraf - am Montag, 22. Februar 2010, 15:12 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.sciencegate.ch
Der erste Eindruck ist ungünstig. Will man die Informationen zu einem Dokument sehen, ist man auf ein Popup-Fenster angewiesen, das häufig falsch liegt, also gar nicht ganz betrachtet werden kann. Es gibt keine Suchhilfe, eine ODER-Verknüpfung führt zu ungewollt hohen Trefferzahlen (bei Eingabe von klaus graf im Autor-Feld kommen zunächst Beiträge von Klaus Graf, dann Treffer, in denen nur Klaus vorkommt). ARTDOK ist nicht erfasst. Man muss häufig auf Clear drücken, sonst bleiben Suchanfragen eingestellt. Suche nach sorcellerie: 0 Treffer.
Der erste Eindruck ist ungünstig. Will man die Informationen zu einem Dokument sehen, ist man auf ein Popup-Fenster angewiesen, das häufig falsch liegt, also gar nicht ganz betrachtet werden kann. Es gibt keine Suchhilfe, eine ODER-Verknüpfung führt zu ungewollt hohen Trefferzahlen (bei Eingabe von klaus graf im Autor-Feld kommen zunächst Beiträge von Klaus Graf, dann Treffer, in denen nur Klaus vorkommt). ARTDOK ist nicht erfasst. Man muss häufig auf Clear drücken, sonst bleiben Suchanfragen eingestellt. Suche nach sorcellerie: 0 Treffer.
KlausGraf - am Montag, 22. Februar 2010, 14:43 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
A Report by the Preserving Digital Public Television Project Part of the National Digital Information Infrastructure and Preservation Program (NDIIPP) of the Library of Congress, by Yvonne Ng (NYU), Nan Rubin (WNET), and Kara Van Malssen (NYU) et alt., Feb. 2010.
Table of Contents
Executive Summary 3
Chapter 1 - Introduction and Overview: A Sustainable
Approach to Digital Preservation 5
Chapter 2 - Why Save Program Files? Making the Case
For Preservation 9
Chapter 3 - Requirements for Sustainable Preservation 19
Chapter 4 - Economics of Sustainable Preservation. 36
Chapter 5 - Case Study: Preserving Digital Public Television,
Costing the Prototype Repository 54
Chapter 6 - Conclusion: Public Television Has the Capacity
to Support Digital Preservation 66
Appendix A - Economic Models Based on Market Analysis
of Stakeholder Interests 69
Appendix B - NYU PDPTV Repository Costing Case Study 74
B-1 - Costs by Type / Function 75
B-2 - Staff By Type / Function. 79
B-3 - Start Up vs Ongoing Costs 80
Works Cited 85
Link to PDF
Table of Contents
Executive Summary 3
Chapter 1 - Introduction and Overview: A Sustainable
Approach to Digital Preservation 5
Chapter 2 - Why Save Program Files? Making the Case
For Preservation 9
Chapter 3 - Requirements for Sustainable Preservation 19
Chapter 4 - Economics of Sustainable Preservation. 36
Chapter 5 - Case Study: Preserving Digital Public Television,
Costing the Prototype Repository 54
Chapter 6 - Conclusion: Public Television Has the Capacity
to Support Digital Preservation 66
Appendix A - Economic Models Based on Market Analysis
of Stakeholder Interests 69
Appendix B - NYU PDPTV Repository Costing Case Study 74
B-1 - Costs by Type / Function 75
B-2 - Staff By Type / Function. 79
B-3 - Start Up vs Ongoing Costs 80
Works Cited 85
Link to PDF
Wolf Thomas - am Montag, 22. Februar 2010, 11:28 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"In Köln beginnen die Vorbereitungen zur Bergung der restlichen Dokumente aus dem eingestürzten Stadtarchiv. Dazu werden die Böschungen an der Einsturzstelle mit Spritzbeton befestigt und gesichert. Nach Schätzungen der Stadt werden die Vorarbeiten rund zwei Monate dauern. Dann könnten die Helfer die letzen Dokumente bergen. Seit dem Einsturz des Historischen Archivs vor einem Jahr sind gut 90 Prozent der Archivalien geborgen worden. Sie sind zum Teil extrem beschädigt."
Quelle: wdr.de, Kulturnachrichten
"Das Amt für Brücken und Stadtbahnbau wird ab dem kommenden Montag, 22. Februar 2010, damit beginnen, die Böschungen an der Einsturzstelle des Historischen Archivs zu sichern. Derzeit sind sie mit Planen abgedeckt und sollen nun mit Spritzbeton befestigt werden.
Bereits im Dezember hatte das Amt für Brücken und Stadtbahnbau angekündigt, in Kürze diese Arbeiten beginnen zu wollen, aufgrund der kalten Witterung und noch ausstehender Zustimmungen - die laufenden Beweissicherungen dürfen zu keiner Zeit beeinträchtigt werden - können die Arbeiten aber nun erst in der kommenden Woche beginnen. Sie sind weiterhin witterungsabhängig und werden rund acht Wochen dauern.
Ein konkreter Zeitpunkt für den Beginn der Errichtung des Bauwerks zur Bergung der Restarchivalien kann derzeit noch nicht genannt werden."
Quelle: Pressemitteilung der Stadt Köln
Quelle: wdr.de, Kulturnachrichten
"Das Amt für Brücken und Stadtbahnbau wird ab dem kommenden Montag, 22. Februar 2010, damit beginnen, die Böschungen an der Einsturzstelle des Historischen Archivs zu sichern. Derzeit sind sie mit Planen abgedeckt und sollen nun mit Spritzbeton befestigt werden.
Bereits im Dezember hatte das Amt für Brücken und Stadtbahnbau angekündigt, in Kürze diese Arbeiten beginnen zu wollen, aufgrund der kalten Witterung und noch ausstehender Zustimmungen - die laufenden Beweissicherungen dürfen zu keiner Zeit beeinträchtigt werden - können die Arbeiten aber nun erst in der kommenden Woche beginnen. Sie sind weiterhin witterungsabhängig und werden rund acht Wochen dauern.
Ein konkreter Zeitpunkt für den Beginn der Errichtung des Bauwerks zur Bergung der Restarchivalien kann derzeit noch nicht genannt werden."
Quelle: Pressemitteilung der Stadt Köln
Wolf Thomas - am Montag, 22. Februar 2010, 10:20 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 21. Februar 2010, 19:24 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Stelle der Leitung im Rosenheimer Stadtarchiv ist ab März erneut verwaist. Deshalb werden die Öffnungszeiten zeitweise eingeschränkt. Nachdem viele inzwischen das Internet nutzen, sieht der städtische Pressesprecher Thomas Bugl darin aber kein Problem.
Rosenheim - Die Stadt besetzt freiwerdende Stellen grundsätzlich erst nach einem Vierteljahr neu, also frühestens im Juni. Wie vor Teykes Dienstantritt vor rund zwei Jahren gelten deshalb ab März verkürzte Öffnungszeiten.
Ein Vierteljahr sei mit reduziertem Personal wohl zu überbrücken, meint Bugl. In den letzten Monaten wäre dies undenkbar gewesen, weil eine Mammutaufgabe zu bewältigen war: das Recherchieren für ein neues Buch des Historischen Vereins über die Rosenheimer Stadtgeschichte. Es wird im März offiziell präsentiert.
Die Benutzerstatistik zeigt insgesamt eine rückläufige Entwicklung. Der Rückgang der telefonischen Anfragen und Besucherzahlen ist vor allem auf das wesentlich verbesserte Internetangebot des Stadtarchivs zurückzuführen, das komfortable Recherchemöglichkeiten und ein Informationsangebot zur Stadtgeschichte einschließt.
Rund 128 000 Zugriffe auf die Internetseite www.stadtarchiv.de wurden gezählt; das zeigt, dass viele Nutzer dort die Anworten auf ihre Fragen finden und deswegen auf direkte Anfragen an das Stadtarchiv verzichten. Es ist geplant, das Informationsangebot im Internet weiter auszubauen.
Auswirkungen auf die Arbeit des Archivpersonals hatte auch das neue Personenstandsgesetz, das zum 1. Januar 2009 in Kraft trat. Für die Standesregister wurden Aufbewahrungsfristen festgelegt, die für die Geburten 110, die Heiraten 80 und die Sterbefälle 30 Jahre betragen. Die Standesbücher, die älter als diese Fristen waren, gelangten nebst den zugehörigen Sammelakten in das Stadtarchiv, wo sie nun der Forschung nach den Vorgaben des Archivgesetzes zur Verfügung stehen.
Da im vergangenen Jahr auch die Meldeakten mit über 23 000 Archivalieneinheiten vollständig erschlossen worden sind, bieten sich insbesondere für personen- und familiengeschichtliche Anfragen nunmehr wesentlich erweiterte und erleichterte Forschungsmöglichkeiten dar.
Wiederum gelangte auch eine Reihe interessanter Nachlässe in das Stadtarchiv. Bemerkenswert ist etwa der Nachlass des ehemaligen Bundesgrenzschutzbeamten Hans Friedrich Putz, der 2008 im Alter von 86 Jahren starb und dem Archiv eine Dokumentation zur Geschichte des Bundesgrenzschutzstandorts Rosenheim und militärgeschichtliches Forschungsmaterial hinterließ. Interessant sind zudem Überlieferungssplitter aus dem Oberbahnamt beziehungsweise Betriebsamt Rosenheim, die dem Stadtarchiv von privater Seite überlassen wurden."
Quelle: OVB-online
Rosenheim - Die Stadt besetzt freiwerdende Stellen grundsätzlich erst nach einem Vierteljahr neu, also frühestens im Juni. Wie vor Teykes Dienstantritt vor rund zwei Jahren gelten deshalb ab März verkürzte Öffnungszeiten.
Ein Vierteljahr sei mit reduziertem Personal wohl zu überbrücken, meint Bugl. In den letzten Monaten wäre dies undenkbar gewesen, weil eine Mammutaufgabe zu bewältigen war: das Recherchieren für ein neues Buch des Historischen Vereins über die Rosenheimer Stadtgeschichte. Es wird im März offiziell präsentiert.
Die Benutzerstatistik zeigt insgesamt eine rückläufige Entwicklung. Der Rückgang der telefonischen Anfragen und Besucherzahlen ist vor allem auf das wesentlich verbesserte Internetangebot des Stadtarchivs zurückzuführen, das komfortable Recherchemöglichkeiten und ein Informationsangebot zur Stadtgeschichte einschließt.
Rund 128 000 Zugriffe auf die Internetseite www.stadtarchiv.de wurden gezählt; das zeigt, dass viele Nutzer dort die Anworten auf ihre Fragen finden und deswegen auf direkte Anfragen an das Stadtarchiv verzichten. Es ist geplant, das Informationsangebot im Internet weiter auszubauen.
Auswirkungen auf die Arbeit des Archivpersonals hatte auch das neue Personenstandsgesetz, das zum 1. Januar 2009 in Kraft trat. Für die Standesregister wurden Aufbewahrungsfristen festgelegt, die für die Geburten 110, die Heiraten 80 und die Sterbefälle 30 Jahre betragen. Die Standesbücher, die älter als diese Fristen waren, gelangten nebst den zugehörigen Sammelakten in das Stadtarchiv, wo sie nun der Forschung nach den Vorgaben des Archivgesetzes zur Verfügung stehen.
Da im vergangenen Jahr auch die Meldeakten mit über 23 000 Archivalieneinheiten vollständig erschlossen worden sind, bieten sich insbesondere für personen- und familiengeschichtliche Anfragen nunmehr wesentlich erweiterte und erleichterte Forschungsmöglichkeiten dar.
Wiederum gelangte auch eine Reihe interessanter Nachlässe in das Stadtarchiv. Bemerkenswert ist etwa der Nachlass des ehemaligen Bundesgrenzschutzbeamten Hans Friedrich Putz, der 2008 im Alter von 86 Jahren starb und dem Archiv eine Dokumentation zur Geschichte des Bundesgrenzschutzstandorts Rosenheim und militärgeschichtliches Forschungsmaterial hinterließ. Interessant sind zudem Überlieferungssplitter aus dem Oberbahnamt beziehungsweise Betriebsamt Rosenheim, die dem Stadtarchiv von privater Seite überlassen wurden."
Quelle: OVB-online
Wolf Thomas - am Sonntag, 21. Februar 2010, 15:29 - Rubrik: Kommunalarchive

Bonn, Bundeskanzler Brandt empfängt Schauspieler. Von rechts: Genscher, Brandt, Roy Black, 23. Juni 1971
Quelle: Bundesarchiv, Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Germany License (CC-BY-SA)
".... Wir begleiteten Roy unzählige Male zu seinen Auftritten und Konzerten, bei Tourneen, Film- und Plattenaufnahmen. Wenn Roy’s Auftritte in unserer Nähe lagen, wohnte er bei uns. Aus dieser Zeit stammen auch die vielen Zeitungsberichte, Poster, Plakate, Schallplatten, Auszeichnungen, sowie viele Fotos, die Roy von seinen Reisen mitbrachte. Alles wurde bei uns archiviert. ..."
Quelle: http://royblackarchiv.ro.funpic.de/
s. Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Roy_Black
Wolf Thomas - am Sonntag, 21. Februar 2010, 15:18 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Freitag, den 26. Februar 2010, 20:15 - 21:00
Ein Jahr nach dem Einsturz - Wie Köln sein Gedächtnis wieder findet
Film von Werner Kubny, Per Schnell und Kamilla Pfeffer
Als am 3. März das Kölner Stadtarchiv einstürzte, richtete sich
verständlicherweise zunächst die Aufmerksamkeit und Sorge auf die
Verschütteten und auf diejenigen, die ihre Wohnungen verloren hatten.
Die nächste Frage gilt der Verantwortung für dieses Unglück. Doch
daneben und dahinter wird deutlich, wie unermesslich groß der kulturelle
Verlust ist. Das Stadtarchiv stand nie wirklich im Rampenlicht, doch es
war das größte und bedeutendste nördlich der Alpen, enthielt den
wichtigsten Bestand an mittelalterlichen Dokumenten, Tausende von
Urkunden von Kaisern, Fürsten und Kaufleuten, von Klöstern, Kirchen und
Päpsten, alle Ratsprotokolle der Stadt Köln seit dem 14. Jahrhundert,
wertvolle alte Handschriften - und fast 800 Nachlässe prominenter
Kölner. Das alles lag am 3. März plötzlich unter Trümmern und wird
seitdem mit höchstem Aufwand geborgen.
Werner Kubny, Per Schnell und Kamilla Pfeffer haben für die
Dokumentation "Das Archiv" seitdem - zum großen Teil exklusiv -
beobachtet, was alles getan wird, getan werden muss, um wenigstens einen
Teil der Archivbestände zu retten und wiederherzustellen. Sie haben
Profis und freiwillige Helfer bei ihrer Arbeit begleitet - und
herausgefunden, dass die Hinterlassenschaften der Vergangenheit für
manche von ihnen eine ganz persönliche Bedeutung haben. Sie haben die
seltenen Glücksmomente miterlebt, bei denen besonders wertvolle Urkunden
oder Bücher wenig oder gar nicht beschädigt geborgen werden konnten. Vor
allem aber haben sie mit Menschen gesprochen, die - wie die
Schriftsteller Dieter Wellershoff und Günter Wallraff - mit dem Einsturz
des Archivs große Teile der eigenen künstlerischen Arbeit oder - wie
René Böll - den Nachlass naher Angehöriger verloren haben.
So wird bei dieser Zwischenbilanz ein Jahr nach dem Unglück klar, dass
der Schuttberg mitten in Köln sehr vielfältige und sehr menschliche Züge
trägt - und dass der Weg hin zu einer vollständigen Wiederherstellung
des "Gedächtnisses" noch sehr, sehr lang sein wird.
Redaktion: Beate Schlanstein
(http://www.wdr.de/programmvorschau/object4Broadcast.jsp?broadcastId=3308663)
weitere Informationen unter:
http://www.kubnyfilm.de/frs1_aktuelles.htm
Aus: INETBIB
Ein Jahr nach dem Einsturz - Wie Köln sein Gedächtnis wieder findet
Film von Werner Kubny, Per Schnell und Kamilla Pfeffer
Als am 3. März das Kölner Stadtarchiv einstürzte, richtete sich
verständlicherweise zunächst die Aufmerksamkeit und Sorge auf die
Verschütteten und auf diejenigen, die ihre Wohnungen verloren hatten.
Die nächste Frage gilt der Verantwortung für dieses Unglück. Doch
daneben und dahinter wird deutlich, wie unermesslich groß der kulturelle
Verlust ist. Das Stadtarchiv stand nie wirklich im Rampenlicht, doch es
war das größte und bedeutendste nördlich der Alpen, enthielt den
wichtigsten Bestand an mittelalterlichen Dokumenten, Tausende von
Urkunden von Kaisern, Fürsten und Kaufleuten, von Klöstern, Kirchen und
Päpsten, alle Ratsprotokolle der Stadt Köln seit dem 14. Jahrhundert,
wertvolle alte Handschriften - und fast 800 Nachlässe prominenter
Kölner. Das alles lag am 3. März plötzlich unter Trümmern und wird
seitdem mit höchstem Aufwand geborgen.
Werner Kubny, Per Schnell und Kamilla Pfeffer haben für die
Dokumentation "Das Archiv" seitdem - zum großen Teil exklusiv -
beobachtet, was alles getan wird, getan werden muss, um wenigstens einen
Teil der Archivbestände zu retten und wiederherzustellen. Sie haben
Profis und freiwillige Helfer bei ihrer Arbeit begleitet - und
herausgefunden, dass die Hinterlassenschaften der Vergangenheit für
manche von ihnen eine ganz persönliche Bedeutung haben. Sie haben die
seltenen Glücksmomente miterlebt, bei denen besonders wertvolle Urkunden
oder Bücher wenig oder gar nicht beschädigt geborgen werden konnten. Vor
allem aber haben sie mit Menschen gesprochen, die - wie die
Schriftsteller Dieter Wellershoff und Günter Wallraff - mit dem Einsturz
des Archivs große Teile der eigenen künstlerischen Arbeit oder - wie
René Böll - den Nachlass naher Angehöriger verloren haben.
So wird bei dieser Zwischenbilanz ein Jahr nach dem Unglück klar, dass
der Schuttberg mitten in Köln sehr vielfältige und sehr menschliche Züge
trägt - und dass der Weg hin zu einer vollständigen Wiederherstellung
des "Gedächtnisses" noch sehr, sehr lang sein wird.
Redaktion: Beate Schlanstein
(http://www.wdr.de/programmvorschau/object4Broadcast.jsp?broadcastId=3308663)
weitere Informationen unter:
http://www.kubnyfilm.de/frs1_aktuelles.htm
Aus: INETBIB
KlausGraf - am Sonntag, 21. Februar 2010, 02:32 - Rubrik: Kommunalarchive
KlausGraf - am Samstag, 20. Februar 2010, 20:07 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Mit der Einrichtung einer Stiftungs-Juniorprofessur im Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften betont die Universität Kassel Werk und Wirkung der Gebrüder Grimm in Kassel. Die Stiftung der Juniorprofessur dokumentiert die Verbundenheit regionaler Förderer mit der Universität Kassel und der Grimm-Forschung. Unter den bislang 14 Stiftern sind Privatpersonen sowie Unternehmen aus der Region. Ein besonderer Dank gebührt Prof. Dr. Rainer Ludewig, der unermüdlich und mit großem Erfolg für die Einrichtung dieser Professor geworben hat. „Mit dieser Professur wird es möglich werden, die zahlreichen, vielfältigen, aber noch weitgehend unbeachtet in den Archiven schlummernden Grimm-Bestände auf hohem Niveau zu erschließen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen sowie eine seriöse Grimm-Forschung an der Universität Kassel zu etablieren", freut sich Prof. Dr. Claudia Brinker-von der Heyde, Vizepräsidentin der Universität Kassel. Das Berufungsverfahren startet jetzt.
Wie wirkten Jacob und Wilhelm Grimm regional und national? Wie wurden und werden sie über Deutschlands Grenzen hinaus rezipiert? Die Juniorprofessur nimmt das Leben der Brüder Grimm in Kassel zum Anlass, die bis heute erhaltenen Dokumente ihres Lebens und Arbeitens zu erschließen und erforschen und über ihr Wirken und ihr Nachwirken zu lehren. Der Fokus wird dabei auf sprach- und literaturwissenschaftlichen Fragen liegen. Ergründet wird die Bedeutung der Grimms im wissenschaftlichen Diskurs und geschichtlichen Kontext des 18. und 19. Jahrhunderts. Darüber hinaus sollen Themen verfolgt werden, die mit dem fachlichen und gesellschaftlichen Anliegen der Grimms zusammenhängen, jedoch über ihre historischen Persönlichkeiten hinausweisen."
Quelle: Universität Kassel, Pressemitteilung 24/10 – 19. Februar 2010
Wie wirkten Jacob und Wilhelm Grimm regional und national? Wie wurden und werden sie über Deutschlands Grenzen hinaus rezipiert? Die Juniorprofessur nimmt das Leben der Brüder Grimm in Kassel zum Anlass, die bis heute erhaltenen Dokumente ihres Lebens und Arbeitens zu erschließen und erforschen und über ihr Wirken und ihr Nachwirken zu lehren. Der Fokus wird dabei auf sprach- und literaturwissenschaftlichen Fragen liegen. Ergründet wird die Bedeutung der Grimms im wissenschaftlichen Diskurs und geschichtlichen Kontext des 18. und 19. Jahrhunderts. Darüber hinaus sollen Themen verfolgt werden, die mit dem fachlichen und gesellschaftlichen Anliegen der Grimms zusammenhängen, jedoch über ihre historischen Persönlichkeiten hinausweisen."
Quelle: Universität Kassel, Pressemitteilung 24/10 – 19. Februar 2010
Wolf Thomas - am Samstag, 20. Februar 2010, 18:23 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Beethoven-Haus - Digitales Archiv präsentiert die einzigartigen Sammlungen des Beethoven-Hauses: Musikhandschriften, Erstausgaben, Briefe und Bilder.
Die inhaltliche Vernetzung von über 5.000 Dokumenten auf 26.000 hochwertigen Farbscans, 1.600 Audiodateien (Musikbeispiele und Hörbriefe) und 7.600 Textdateien läßt Beethovens Denken, Leben und Arbeiten auf vielfältige Weise sichtbar und hörbar werden; Porträts und topographische Darstellungen zeigen den Künstler und seine Welt.
beethoven-haus-bonn.de
Die inhaltliche Vernetzung von über 5.000 Dokumenten auf 26.000 hochwertigen Farbscans, 1.600 Audiodateien (Musikbeispiele und Hörbriefe) und 7.600 Textdateien läßt Beethovens Denken, Leben und Arbeiten auf vielfältige Weise sichtbar und hörbar werden; Porträts und topographische Darstellungen zeigen den Künstler und seine Welt.
beethoven-haus-bonn.de
Sinfonie - am Samstag, 20. Februar 2010, 13:16 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Ab 1936 widmete sich Marcel Duchamp der Idee eines transportablen Künstlermuseums, der Boîte en valise, die er 1941 schließlich als limi- tierte Luxusausgabe herausbrachte: Ein Koffer, in dem komplexe Falt- systeme ca. 80 miniaturisierten Reproduktionen duchamp’schen Kunst- schaffens Platz boten, „jederzeit verfügbar und vorzeigbar“, ein Prototyp des mobilen Archivs.
STILL DIALING ALICE riskiert den Blick in die archivarische Schachtel, macht das Buch zum Musterkoffer und umgeht damit Duchamps Klappef- fekt, die Textschachtel (Buch) zu einem Museum umzufunktionieren. Denn nicht das Archiv ist die Grenzfigur, die den Text erst archivfähig macht, sondern der Archivar und seine archivarische Arbeit. Die dadasophische Archeologie widmet sich genau dieser unbekannten Arbeit am Text: Sie folgt den Spuren der Texte (Archivalien) mit dem archivarischen Blick und wird erst im Gebrauch aktiv. Sie stellt die Archivreife der Texte fest, erschließt, registriert, erstellt einen Index - das Findbuch, bearbeitet und entfernt Textteile, die nicht archivwürdig sind, führt sie der Kassation zu, ganz nach dem Muster der alten Schachtel.
Die dadasophische Archeologie stellt den Archivar als Steuermann direkt in den Text und beobachtet ihn in seiner Welt der machtvollen Steuerzei- chen. Nicht nur er blickt in die archivarische Schachtel wie der potentielle Käufer in den Musterkoffer, auch der Leser. Schließlich ist das dadaso- phische Archiv nicht nur ein ausgeklügeltes Faltensystem, bei näherem Hinsehen und im Regalfall auch Sargdeckel. "
205 Seiten, brosch. erschienen im Herbst 2009
ISBN: 978-3-85415-445-7
Quelle: Ankündigung Ritter Verlag, Klagenfurt
Leseprobe (PDF)
Wolf Thomas - am Freitag, 19. Februar 2010, 20:39 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Herzlich wenig, wenn man von
http://www.kunstgeschichte-ejournal.net
ausgeht. Hubertus Kohle danke ich für mehrere Auskünfte, aus denen sich ergab: Wenn das formale Erfordernis erfüllt ist ("As a rule, contributors to KUNSTGESCHICHTE. Open Peer Reviewed Journal
should hold a Master's degree in Art History or respective disciplines;
exceptions to this formal prerequisite can be agreed with the editorial
board") wird alles aufgenommen. Nach der Begutachtungsphase wird der Beitrag akzeptiert. Falls es Kommentare gegeben hatte, wird der Autor um Einarbeitung gebeten. Wenn es keine gab, kommt der Autor bzw. die Autorin ganz ohne Begutachtung zu einem Open-Access-Aufsatz. Um es klar zu sagen: ein solches Verfahren kann nicht einmal als Qualitätsprüfung gelten geschweige denn als Peer Review.
Update: http://archiv.twoday.net/search?q=peer+review
http://www.kunstgeschichte-ejournal.net
ausgeht. Hubertus Kohle danke ich für mehrere Auskünfte, aus denen sich ergab: Wenn das formale Erfordernis erfüllt ist ("As a rule, contributors to KUNSTGESCHICHTE. Open Peer Reviewed Journal
should hold a Master's degree in Art History or respective disciplines;
exceptions to this formal prerequisite can be agreed with the editorial
board") wird alles aufgenommen. Nach der Begutachtungsphase wird der Beitrag akzeptiert. Falls es Kommentare gegeben hatte, wird der Autor um Einarbeitung gebeten. Wenn es keine gab, kommt der Autor bzw. die Autorin ganz ohne Begutachtung zu einem Open-Access-Aufsatz. Um es klar zu sagen: ein solches Verfahren kann nicht einmal als Qualitätsprüfung gelten geschweige denn als Peer Review.
Update: http://archiv.twoday.net/search?q=peer+review
KlausGraf - am Freitag, 19. Februar 2010, 20:04 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"nach intensiven studien historischer quellen habe ich herausgefunden, daß Johann von Dalberg, galeonsfigur des Deutschen Frühhumanismus, 1455 in Oppenheim geboren, unter Churfürst Philipp von der Pfalz als Kanzler der Pfalz und Bischof von Worms vor seinem klerikal-feudalen interessen zuliebe offiziell behaupteten tod anno 1503 auch als Johann Virdung gewirkt und danach als Johann Virdung und Faustus bis 1539 weitergelebt hat.
um meine entdeckung des historischen faust in eine dieser faszinierenden Gestalt gerecht werdende form zu gießen, wählte ich bewußt nicht die einer systematisch wissenschaftlichen abhandlung, sondern eine poetische, jener aber im quellennachweis gleichzustellenden ausgestaltung.
über den historischen Faust in dreierlei Gestalt als Johann von Dalberg, Johann Virdung und Johann Faustus ist mir so unter dem titel ´johann von dalberg´ auf 48 blättern (szenen) ein tragisches gedicht in versen entstanden, mit welchem ich im sinn des lateinischen versus bisher gültige geschichtsbilder sowohl Johann von Dalbergs als auch Johann Fausts umgestürzt, was die Brodgelehrten (Fr. Schiller) zuständiger disziplinen, alle von mir darüber in kenntnis gesetzt, mit beredtem schweigen zu übergehen suchen, weil nicht sein kann, für sie, was nicht sein darf: history is always his(ruling clan) story."
http://www.ortwin-mohnkern.de/index.html
Soweit so wirr. Und nun schlagen wir den PND-Eintrag zu Johann von Dalberg (ja genau: http://archiv.twoday.net/stories/6196955/ ) in der PND auf:
Link zu diesem Datensatz http://d-nb.info/gnd/118985957
Person Johann (männlich)
Andere Namen Johann
Dalberg, Johann /von
Dalberg, Johannes /de
Virdung, Johann [Pseud.]
Faustus [Pseud.]
Dalberg, Johannes %(VD-16)
Quelle M/Reg.; www.ortwin-mohnkern.de/index.html
Lebensdaten 1455-1503
Land Deutschland (XA-DE)
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Johann_von_Dalberg
Zur Qualität der PND:
http://archiv.twoday.net/stories/6167023/
um meine entdeckung des historischen faust in eine dieser faszinierenden Gestalt gerecht werdende form zu gießen, wählte ich bewußt nicht die einer systematisch wissenschaftlichen abhandlung, sondern eine poetische, jener aber im quellennachweis gleichzustellenden ausgestaltung.
über den historischen Faust in dreierlei Gestalt als Johann von Dalberg, Johann Virdung und Johann Faustus ist mir so unter dem titel ´johann von dalberg´ auf 48 blättern (szenen) ein tragisches gedicht in versen entstanden, mit welchem ich im sinn des lateinischen versus bisher gültige geschichtsbilder sowohl Johann von Dalbergs als auch Johann Fausts umgestürzt, was die Brodgelehrten (Fr. Schiller) zuständiger disziplinen, alle von mir darüber in kenntnis gesetzt, mit beredtem schweigen zu übergehen suchen, weil nicht sein kann, für sie, was nicht sein darf: history is always his(ruling clan) story."
http://www.ortwin-mohnkern.de/index.html
Soweit so wirr. Und nun schlagen wir den PND-Eintrag zu Johann von Dalberg (ja genau: http://archiv.twoday.net/stories/6196955/ ) in der PND auf:
Link zu diesem Datensatz http://d-nb.info/gnd/118985957
Person Johann (männlich)
Andere Namen Johann
Dalberg, Johann /von
Dalberg, Johannes /de
Virdung, Johann [Pseud.]
Faustus [Pseud.]
Dalberg, Johannes %(VD-16)
Quelle M/Reg.; www.ortwin-mohnkern.de/index.html
Lebensdaten 1455-1503
Land Deutschland (XA-DE)
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Johann_von_Dalberg
Zur Qualität der PND:
http://archiv.twoday.net/stories/6167023/
Eine Auswahl der wichtigsten Links für den deutschsprachigen Bereich versucht zu bieten:
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Biographische_Recherche
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Biographische_Recherche
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 19. Februar 2010, 18:19 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3946&Alias=wzo&cob=471788
Der Blick auf die Geschichte des Urheberrechts endet recht affirmativ und wolkig: "Der Respekt vor eigentümlichen Werken bildet eine Kompetenz, die notwendig ist, damit aus der Überfülle frei zugänglicher Informationen selbstbewusstes Wissen entstehen kann. Nur dann kann man sich die Inhalte des Internet wirklich zueigen machen."
Der Blick auf die Geschichte des Urheberrechts endet recht affirmativ und wolkig: "Der Respekt vor eigentümlichen Werken bildet eine Kompetenz, die notwendig ist, damit aus der Überfülle frei zugänglicher Informationen selbstbewusstes Wissen entstehen kann. Nur dann kann man sich die Inhalte des Internet wirklich zueigen machen."
KlausGraf - am Freitag, 19. Februar 2010, 17:29 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Giacomo Casanovas handschriftlich verfasste Memoiren sind für den höchsten Preis, der je für ein historisch-literarisches Manuskript bezahlt wurde, an Frankreich gegangen.
Rund 7,2 Millionen Euro hat Paris für die 3700 Seiten bezahlt, die bisher der Wiesbadener Verlegerfamilie Brockhaus gehörten. «Ich wollte die Manuskripte der Öffentlichkeit zugänglich machen», sagte Hubertus Brockhaus bei der Unterzeichnung des Kaufvertrags in Paris.
Der Leipziger Verleger Friedrich Arnold Brockhaus hatte 1820 von einem Neffen Casanovas (1725-1798) die in Französisch verfassten Memoiren für rund 200 Taler gekauft. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Manuskript in einem Bunker. Dann übersiedelte die Familie Brockhaus - zusammen mit dem Manuskript - nach Wiesbaden. Seit 1945 waren die Memoiren in einem Tresor der Deutschen Bank deponiert, wie der Frankfurter Kunstberater Christoph Graf Douglas berichtete. Er hat das Geschäft mit den Franzosen eingefädelt.
http://www.zeit.de/newsticker/2010/2/18/iptc-bdt-20100218-477-23932376xml
Mehr dazu:
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=4327
Auch wenn man das Geschäft gutheißen kann, stellt sich einmal mehr die Frage nach der Vollständigkeit der Liste national wertvollen Kulturgutes, das ja ausdrücklich nicht nur Kulturgut deutscher Provenienz aufnehmen soll.

Rund 7,2 Millionen Euro hat Paris für die 3700 Seiten bezahlt, die bisher der Wiesbadener Verlegerfamilie Brockhaus gehörten. «Ich wollte die Manuskripte der Öffentlichkeit zugänglich machen», sagte Hubertus Brockhaus bei der Unterzeichnung des Kaufvertrags in Paris.
Der Leipziger Verleger Friedrich Arnold Brockhaus hatte 1820 von einem Neffen Casanovas (1725-1798) die in Französisch verfassten Memoiren für rund 200 Taler gekauft. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Manuskript in einem Bunker. Dann übersiedelte die Familie Brockhaus - zusammen mit dem Manuskript - nach Wiesbaden. Seit 1945 waren die Memoiren in einem Tresor der Deutschen Bank deponiert, wie der Frankfurter Kunstberater Christoph Graf Douglas berichtete. Er hat das Geschäft mit den Franzosen eingefädelt.
http://www.zeit.de/newsticker/2010/2/18/iptc-bdt-20100218-477-23932376xml
Mehr dazu:
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=4327
Auch wenn man das Geschäft gutheißen kann, stellt sich einmal mehr die Frage nach der Vollständigkeit der Liste national wertvollen Kulturgutes, das ja ausdrücklich nicht nur Kulturgut deutscher Provenienz aufnehmen soll.

Science is based on building on, reusing and openly criticising the published body of scientific knowledge.
For science to effectively function, and for society to reap the full benefits from scientific endeavours, it is crucial that science data be made open.
By open data in science we mean that it is freely available on the public internet permitting any user to download, copy, analyse, re-process, pass them to software or use them for any other purpose without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. To this end data related to published science should be explicitly placed in the public domain.
Formally, we recommend adopting and acting on the following principles:
1.
Where data or collections of data are published it is critical that they be published with a clear and explicit statement of the wishes and expectations of the publishers with respect to re-use and re-purposing of individual data elements, the whole data collection, and subsets of the collection. This statement should be precise, irrevocable, and based on an appropriate and recognized legal statement in the form of a waiver or license.
When publishing data make an explicit and robust statement of your wishes.
2.
Many widely recognized licenses are not intended for, and are not appropriate for, data or collections of data. A variety of waivers and licenses that are designed for and appropriate for the treatment of data are described here. Creative Commons licenses (apart from CCZero), GFDL, GPL, BSD, etc are NOT appropriate for data and their use is STRONGLY discouraged.
Use a recognized waiver or license that is appropriate for data.
3.
The use of licenses which limit commercial re-use or limit the production of derivative works by excluding use for particular purposes or by specific persons or organizations is STRONGLY discouraged. These licenses make it impossible to effectively integrate and re-purpose datasets and prevent commercial activities that could be used to support data preservation.
If you want your data to be effectively used and added to by others it should be open as defined by the Open Knowledge/Data Definition – in particular non-commercial and other restrictive clauses should not be used.
4.
Furthermore, in science it is STRONGLY recommended that data, especially where publicly funded, be explicitly placed in the public domain via the use of the Public Domain Dedication and Licence or Creative Commons Zero Waiver. This is in keeping with the public funding of much scientific research and the general ethos of sharing and re-use within the scientific community.
Explicit dedication of data underlying published science into the public domain via PDDL or CCZero is strongly recommended and ensures compliance with both the Science Commons Protocol for Implementing Open Access Data and the Open Knowledge/Data Definition.
Authored by:
Peter Murray-Rust, University of Cambridge (UK)
Cameron Neylon, STFC (UK)
Rufus Pollock, Open Knowledge Foundation and University of Cambridge (UK)
John Wilbanks, Science Commons (USA)
With the help of the members of the Open Knowledge Foundation Working Group on Open Data in Science
For science to effectively function, and for society to reap the full benefits from scientific endeavours, it is crucial that science data be made open.
By open data in science we mean that it is freely available on the public internet permitting any user to download, copy, analyse, re-process, pass them to software or use them for any other purpose without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. To this end data related to published science should be explicitly placed in the public domain.
Formally, we recommend adopting and acting on the following principles:
1.
Where data or collections of data are published it is critical that they be published with a clear and explicit statement of the wishes and expectations of the publishers with respect to re-use and re-purposing of individual data elements, the whole data collection, and subsets of the collection. This statement should be precise, irrevocable, and based on an appropriate and recognized legal statement in the form of a waiver or license.
When publishing data make an explicit and robust statement of your wishes.
2.
Many widely recognized licenses are not intended for, and are not appropriate for, data or collections of data. A variety of waivers and licenses that are designed for and appropriate for the treatment of data are described here. Creative Commons licenses (apart from CCZero), GFDL, GPL, BSD, etc are NOT appropriate for data and their use is STRONGLY discouraged.
Use a recognized waiver or license that is appropriate for data.
3.
The use of licenses which limit commercial re-use or limit the production of derivative works by excluding use for particular purposes or by specific persons or organizations is STRONGLY discouraged. These licenses make it impossible to effectively integrate and re-purpose datasets and prevent commercial activities that could be used to support data preservation.
If you want your data to be effectively used and added to by others it should be open as defined by the Open Knowledge/Data Definition – in particular non-commercial and other restrictive clauses should not be used.
4.
Furthermore, in science it is STRONGLY recommended that data, especially where publicly funded, be explicitly placed in the public domain via the use of the Public Domain Dedication and Licence or Creative Commons Zero Waiver. This is in keeping with the public funding of much scientific research and the general ethos of sharing and re-use within the scientific community.
Explicit dedication of data underlying published science into the public domain via PDDL or CCZero is strongly recommended and ensures compliance with both the Science Commons Protocol for Implementing Open Access Data and the Open Knowledge/Data Definition.
Authored by:
Peter Murray-Rust, University of Cambridge (UK)
Cameron Neylon, STFC (UK)
Rufus Pollock, Open Knowledge Foundation and University of Cambridge (UK)
John Wilbanks, Science Commons (USA)
With the help of the members of the Open Knowledge Foundation Working Group on Open Data in Science
KlausGraf - am Freitag, 19. Februar 2010, 17:11 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die nach wie vor klassische Studie des Erbachischen Archivars Morneweg von 1887 ist online:
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/urn/urn:nbn:de:hbz:061:1-16486
Der derzeit maßgebliche Sammelband (2005) zum Wormser Bischof ist ebenfalls kostenfrei im Netz:
http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2007/3943/

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/urn/urn:nbn:de:hbz:061:1-16486
Der derzeit maßgebliche Sammelband (2005) zum Wormser Bischof ist ebenfalls kostenfrei im Netz:
http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2007/3943/

KlausGraf - am Freitag, 19. Februar 2010, 16:49 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
http://imlsdcc.grainger.uiuc.edu/history/
Schon allein die Menge macht deutlich, dass es einer gemeinsamen Metasuche bedürfte, um gezielt z.B. ein Bild aufzufinden. Viele der Sammlungen sind im "deep web", also leistet Google diese Arbeit nicht.
Schon allein die Menge macht deutlich, dass es einer gemeinsamen Metasuche bedürfte, um gezielt z.B. ein Bild aufzufinden. Viele der Sammlungen sind im "deep web", also leistet Google diese Arbeit nicht.
KlausGraf - am Freitag, 19. Februar 2010, 16:41 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Breitseite von Seiten der US-Regierung gegen das Settlement:
http://www.publishersweekly.com/article/449946-At_Google_Fairness_Hearing_DoJ_Justice_Slams_Settlement.php
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/02/18/AR2010021800944.html
http://www.boersenblatt.net/362946/?t=newsletter
http://www.publishersweekly.com/article/449946-At_Google_Fairness_Hearing_DoJ_Justice_Slams_Settlement.php
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/02/18/AR2010021800944.html
http://www.boersenblatt.net/362946/?t=newsletter
KlausGraf - am Freitag, 19. Februar 2010, 15:52 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Freitag, 19. Februar 2010, 09:15 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen


