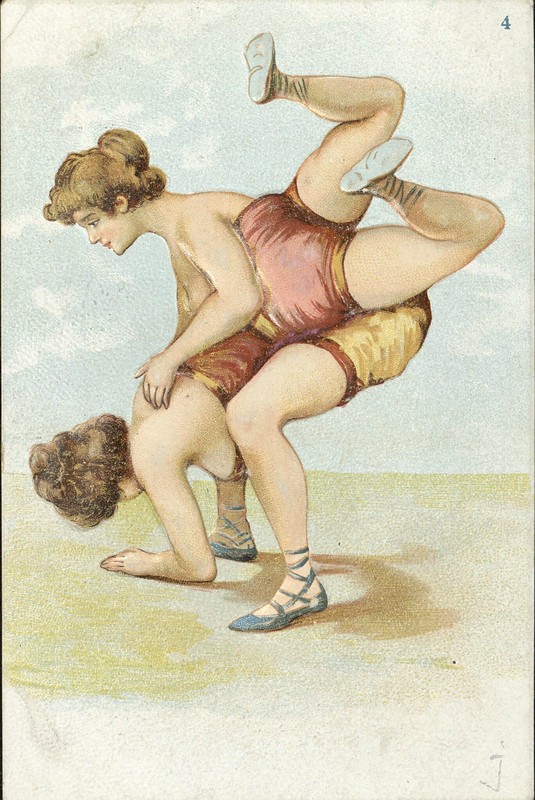Leider weiß auch die McKell Library nicht, wo das Manuskript hingekommen ist. Das SW-Faksimile wurde jetzt von der UB Heidelberg ins Netz gestellt:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/bpd/glanzlichter/oberdeutsche/lauber/lauberliste.html
[ http://archiv.twoday.net/stories/1022464426/ ]
Von gar nicht wenigen der Handschriften existieren Komplettdigitalisate.
Nachtrag: Übrigens ist der bekannte Lauber-Brief, siehe etwa
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/Kautzsch1895i/0006
online unter
http://bvmm.irht.cnrs.fr/resultRecherche/resultRecherche.php?COMPOSITION_ID=11286

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/bpd/glanzlichter/oberdeutsche/lauber/lauberliste.html
[ http://archiv.twoday.net/stories/1022464426/ ]
Von gar nicht wenigen der Handschriften existieren Komplettdigitalisate.
Nachtrag: Übrigens ist der bekannte Lauber-Brief, siehe etwa
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/Kautzsch1895i/0006
online unter
http://bvmm.irht.cnrs.fr/resultRecherche/resultRecherche.php?COMPOSITION_ID=11286

KlausGraf - am Samstag, 7. September 2013, 19:16 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Weblog berichtet über eine Reise zu unbekannteren Handschriftensammlungen der USA.
http://manuscriptroadtrip.wordpress.com/
Außerordentlich wichtige Übersicht zu den Sammlungen (Dezember 2012, Ergänzung zu de Ricci et al.):
http://www.bibsocamer.org/BibSite/Conway-Davis/Pre-1600.Mss.Holdings.pdf
Dieses PDF ersetzt die unter
http://archiv.twoday.net/stories/6190941/
im Internet Archive nachgewiesene frühere Website.
Bisher wurden 20.000 Handschriften vor 1600 und etwa 25.000 Einzelblätter in ungefähr 500 Sammlungen identifiziert.

http://manuscriptroadtrip.wordpress.com/
Außerordentlich wichtige Übersicht zu den Sammlungen (Dezember 2012, Ergänzung zu de Ricci et al.):
http://www.bibsocamer.org/BibSite/Conway-Davis/Pre-1600.Mss.Holdings.pdf
Dieses PDF ersetzt die unter
http://archiv.twoday.net/stories/6190941/
im Internet Archive nachgewiesene frühere Website.
Bisher wurden 20.000 Handschriften vor 1600 und etwa 25.000 Einzelblätter in ungefähr 500 Sammlungen identifiziert.

KlausGraf - am Samstag, 7. September 2013, 19:00 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten baut in Potsdam ein neues Wissenschafts- und Restaurierungszentrum. Es soll auf dem ehemaligen Gelände des Hans-Otto-Theaters entstehen, wie eine
Sprecherin am Freitag sagte. Der Grundstein werde am kommenden Donnerstag gelegt, die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis 2016.
Künftig soll das aus mehreren Gebäuden bestehende Zentrum wissenschaftliche Einrichtungen, Archive und Werkstätten
der Stiftung beherbergen. Die Kosten werden mit rund 26 Millionen Euro veranschlagt."
Quelle: rbb-text S. 139, 7.9.13
Sprecherin am Freitag sagte. Der Grundstein werde am kommenden Donnerstag gelegt, die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis 2016.
Künftig soll das aus mehreren Gebäuden bestehende Zentrum wissenschaftliche Einrichtungen, Archive und Werkstätten
der Stiftung beherbergen. Die Kosten werden mit rund 26 Millionen Euro veranschlagt."
Quelle: rbb-text S. 139, 7.9.13
Wolf Thomas - am Samstag, 7. September 2013, 17:14 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
UB Freiburg Hs. 273 (um 1500)
http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/hs273
Siehe auch
http://www.handschriftencensus.de/13860
http://archiv.twoday.net/search?q=thomas+finck
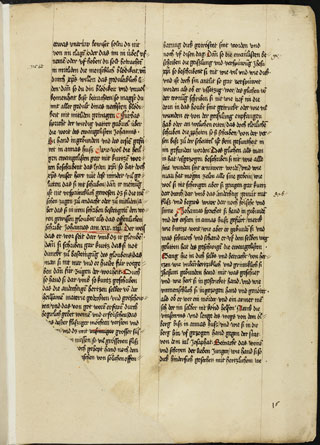
http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/hs273
Siehe auch
http://www.handschriftencensus.de/13860
http://archiv.twoday.net/search?q=thomas+finck
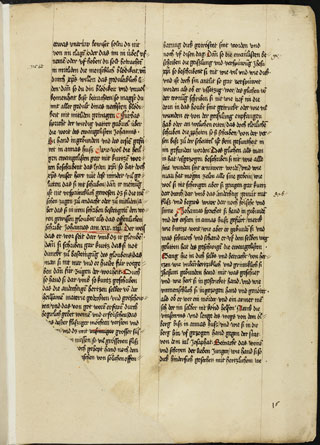
KlausGraf - am Samstag, 7. September 2013, 01:43 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 7. September 2013, 01:39 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Vortrag auf der 34. Tagung der AG sportwissenschaftlicher Bibliotheken in Bonn am 4.9.2013
Von Klaus Graf
„Der ehemalige Ringer-Weltmeister Adolf Seger hat im März 2012 das auf Mauritius ansässige VDM-Tochterunternehmen Betascript Publishing zu einer Unterlassungserklärung wegen eines Buches aufgefordert, das als seine ‚Biografie‘ verkauft wurde. Das 84 Seiten umfassende Büchlein war eine Sammlung von Wikipedia-Artikeln, enthielt tatsächlich nur eine Seite über das Leben des Sportlers und kostete 34 Euro. Man einigte sich gütlich, das Buch wurde von VDM vom Markt genommen“
https://de.wikipedia.org/wiki/VDM_Publishing_Group
Das Zitat stammt aus der Wikipedia. Ich habe also schon ein Tabu gebrochen: Zitiere niemals aus der Wikipedia! Und wer von mir im Folgenden das übliche Bashing gegen die Verlagsgruppe Dr. Müller (VDM Publishing Group) erwartet wird auch enttäuscht werden. Da es mir an jeglicher sportwissenschaftlicher Kompetenz mangelt, bin ich hier für die Visionen und Provokationen zuständig.
Meine erste These ist schon auf Krawall gebürstet: Lieber schlechte Bücher im Internet als auf Papier.
Beispielsweise stiftet eine schlechte Masterarbeit Open Access im Internet noch erheblich mehr Nutzen als unzugänglich in der Kellerablage eines Prüfungsamts. Ich komme auf den Fetisch „wissenschaftliche Qualitätssicherung“ noch mehrfach zurück, möchte aber schon jetzt anmerken, dass alle akzeptierten Qualifikationsarbeiten einen formalen Prozess der Qualitätssicherung hinter sich haben. Sie wurden von mindestens zwei universitären Gutachtern und dem zuständigen Prüfungsgremium akzeptiert. Den Kandidaten wird dabei bescheinigt, dass sie in ausreichendem Maße gezeigt haben, dass sie wissenschaftlich arbeiten können. Im Licht der aktuellen Plagiat-Skandale wird man oft ein Fragezeichen setzen müssen, aber jede akzeptierte Abschlussarbeit hat so etwas wie ein „Peer Review“ hinter sich, was man bis vor wenigen Jahren den meisten geisteswissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln im deutschsprachigen Raum nicht bescheinigen konnte. Nach wie vor gibt es in diesem Bereich sehr einflussreiche Organe ohne Peer Review.
Die VDM-Verlage verkaufen solche Abschlussarbeiten für teures Geld: Masterarbeiten, Dissertationen, sogar Habilitationsschriften. Für die Autoren ist das attraktiv: Die Bücher sehen optisch nicht schlechter aus als andere Wissenschafts-Publikationen, und es wird kein Cent Zuschuss fällig.
Das Problem sind die Bibliotheken, denn viele dieser Institutionen haben über die geschäftstüchtige Saarbrücker Verlagsgruppe des Dr. Müller einen Bann ausgesprochen: Sie kaufen solche Bücher nicht.
Nur wenige Bibliothekare äußern sich besonnen wie der Frankfurter Fachreferent Hartmut Bergenthum, der am 21. Oktober 2011 in der Mailingliste INETBIB zu einem Zitat des Verlegers Matthias Ulmer Stellung nahm. Ulmer schrieb: "Zum anderen ist VDM kein Verlag sondern ein absurdes Geschäftsmodell, das sowohl uns Verlegern die Schamesröte ins Gesicht treibt als auch den Bibliotheken, deren Gelder die Taschen von VDM füllt." Bergenthum aber kauft regelmäßig bei VDM für das von ihm betreute Sondersammelgebiet Afrika. Er verwies darauf, dass Print-on-Demand-Verlage florieren, weil nunmehr jeder ein Autor sein könne, und behauptete hinsichtlich der VDM-Produkte: „Sowohl für Studierende (als Leser) als auch für junge Wissenschaftler (als Autoren) scheint VDM attraktiv zu sein und erfüllt deren - wie auch immer gearteten – Bedürfnisse“.
Ich habe ein Beispiel Bergenthums nachrecherchiert. Es betrifft eine Trierer Habilitationsschrift von 2011 mit dem Titel „Third scramble for Africa“. Eine akzeptierte Habilitationsschrift des deutschsprachigen Raums sollte eigentlich von wissenschaftlichen Bibliotheken erworben werden, sonst stimmt etwas nicht. Wieder ein Zitat aus der Wikipedia, aus dem Artikel Habilitationsschrift: „Im Gegensatz zu einer Dissertation muss es sich um eine Arbeit mit hohem methodischen Anspruch handeln, durch welche die wissenschaftliche Forschung nicht nur in einem kleinen Segment vorangebracht werden soll“. Die fragliche Arbeit kostet bei Amazon 62,95 Euro, für 604 Seiten wahrlich kein überzogener Preis. Und wo kann man nun diese Arbeit laut Karlsruher Virtuellem Katalog einsehen? In der Deutschen Nationalbibliothek, dort ist als Pflichtexemplar auch eine elektronische Fassung für die Präsenznutzung hinterlegt, natürlich in Trier und in Frankfurt. Sonst nirgends, also auch nicht in Saarbrücken, wo der Verlag ansässig ist. Zuständig für das Pflichtexemplar ist die Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek, die offenbar keinerlei VDM-Bücher in ihren Bestand aufnimmt – im Gegensatz zu kleineren saarländischen Bibliotheken oder der Kölner Sporthochschule, die als Spezialbibliothek sehr wohl bei VDM einkauft.
Ich scheue mich nicht, von einem Skandal zu sprechen. Für die Fernleihe stehen genau zwei Exemplare der Habilitationsschrift zur Verfügung, falls Frankfurt und Trier die bibliophile Seltenheit außer Haus geben. Ich vermute, die meisten Inkunabelausgaben – das sind vor 1500 erschienene Bücher aus der Anfangszeit des Buchdrucks [Frage ans Auditorium: Wer verwahrt Inkunabeln? Rückmeldung: niemand] – sind in mehr Exemplaren in Bibliotheken verbreitet als diese Trierer Habilitationsschrift aus dem Jahr 2011.
Die zweite These, mit der ich Sie erzürnen könnte, lautet: Die Bibliotheken müssen endlich aufhören, ihre Leser durch Nichtanschaffung von Büchern oder Nichtanforderung von Pflichtexemplaren zu bevormunden.
Über Bibliothekare als Zensoren in der Geschichte könnte man sicher einen eigenen Vortrag halten. Es gibt vermutlich wenig empirische Untersuchungen, aber eigene Erfahrungen legen den Schluss nahe, dass sich die Bibliotheken seit dem 18. Jahrhundert nicht mit Ruhm bekleckert haben, was die vollständige Dokumentation des gedruckten Geistesschaffens angeht. Vergeblich suchte ich nach einer Rezension in einer gelehrten Zeitschrift aus dem 18. Jahrhundert, eine wissenschaftliche Zeitschrift zum Buchwesen aus dem Ende des 19. Jahrhunderts fand ich nur in einem Nachlass einigermaßen komplett und ein wichtiges Organ des deutschen Druckereiwesens um 1900 ist nur in einer österreichischen Spezialbibliothek mehr oder minder lückenlos vorhanden. Zu erinnern ist auch an den Kampf gegen den sogenannten „Schund“, dem sich auch die Bibliothekare der Pflichtexemplarbibliotheken verschrieben hatten – mit schmerzlichen Folgen für die Erforschung der populären Kultur.
Was sagte das Bundesverfassungsgericht in seiner Pflichtexemplar-Entscheidung aus dem Jahr 1981? Druckwerke würden im Lauf der Zeit geistiges und kulturelles Allgemeingut. Unter Berücksichtigung der Sozialpflichtigkeit des Eigentums stelle es ein legitimes Anliegen dar, die literarischen Erzeugnisse dem wissenschaftlich und kulturell Interessierten möglichst geschlossen zugänglich zu machen und künftigen Generationen einen umfassenden Eindruck vom geistigen Schaffen früherer Epochen zu vermitteln. Ich möchte ergänzen: Auch wenn es sich um Produkte aus dem Spam-Verlag VDM handelt.
Ich lege Wert auf die Feststellung, dass mich der VDM-Verlag leider nicht finanziert. Selbstverständlich verurteile ich die Täuschung der Verbraucher durch zwischen zwei Buchdeckel gepresste Wikipedia-Artikel, aber im Bereich des Hochschulschriftendrucks verhält sich VDM nicht grundsätzlich anders als andere einschlägige Verlage. Auch bei hochangesehenen Verlagen erhält man im Übrigen für viel Geld Arbeiten minderer Qualität.
Das „gute Buch“, das man behaglich im Lehnstuhl zu sich nimmt und das man gerne jungen Menschen empfiehlt, ist, wenn man es recht besieht, eigentlich nie unumstritten. Otfried Preußlers beliebtes Jugendbuch Krabat ist Schullektüre, aber dagegen wehrten sich jetzt vor Gericht Zeugen Jehovas als betroffene Eltern, die in ihm die Förderung schwarzer Magie sahen. Sogar die Bibel ist streckenweise politisch unkorrekt. Und das schlechte Buch? Wer legt die Kriterien fest, was etwa im Bereich der Wissenschaft schlechte Bücher sind? Und was sollten die Konsequenzen sein? Bücherverbrennungen wohl kaum.
Als Auslöser der Open-Access-Bewegung kann die sogenannte Zeitschriftenkrise in den naturwissenschaftlichen Fächern bezeichnet werden. Die führenden Fachorgane werden dort immer teurer, mitunter kostet ein Jahres-Abo nicht weniger als ein Mittelklassewagen. Dieser Kostendruck durch Elsevier & Gesellen hat natürlich Auswirkungen auf die Monographien-Anschaffungen in den Universitätsbibliotheken und damit auch auf die Geistes- und Sozialwissenschaften. Bücher werden immer teurer, und selbst Bücher, die ich als Standardwerke bezeichnen würde, gibt es nach meinen unrepräsentativen Beobachtungen leider nur noch an wenigen Standorten. Da die Preise so hoch sind, dass der Wissenschaftler nicht selbst anschaffen kann, führt dies zur Belastung der Fernleihe oder dazu, dass relevante Literatur nicht rezipiert wird.
Mein Lösungsvorschlag für das Monographien-Problem wird Sie wohl nicht überraschen:
Auch bei den Monographien müssen die Bibliotheken und die Träger und Finanzierer von Forschung konsequent auf Open Access setzen.
Längst nicht alle Universitätsverlage praktizieren Open Access. Ich habe zuhause eine altgermanistische Habilitationsschrift – gedruckt vom Düsseldorfer Universitätsverlag - zur Besprechung, die mehr als 600 Seiten umfasst. Dass weder ein Register noch eine oder mehrere Zusammenfassungen beigegeben sind, grenzt für mich beinahe schon an Körperverletzung. Ein E-Book wird nicht angeboten, obwohl man verzweifelt einen Volltext braucht, um sich die Lektüre zu erleichtern. Nun werden sie mir erwidern: Im Mittelalter hatten die Leute auch Grips und zwar ohne Volltextsuche. Das ist schon richtig, aber sollte sich unsere Publikationskultur nicht am digitalen Potential im 21. Jahrhundert orientieren und nicht an dem angeblichen Gold-Standard, dem im 15. Jahrhundert erfundenen gedruckten Buch?
Open Access sorgt für Chancengleichheit. Es kommt nicht mehr darauf an, wo sich ein Buch physisch befindet und ob sich eine Bibliothek ein üppiges kommerzielles E-Book-Angebot leisten kann. In den USA kann noch nicht einmal jede Hochschulbibliothek – Sie wissen, es gibt da unendlich viele Universitäten – ein JSTOR-Abo finanzieren. Laut Datenbank-Infosystem hat keine deutsche Institution eine Subskription von „Early European Books“ , einem von europäischen Nationalbibliotheken unterstützten groß angelegten und an sich wissenschaftlich wichtigem Digitalisierungsprojekt für alte Drucke. Deutsche Wissenschaftler gucken in die Röhre, da sie darauf angewiesen sind, dass Bibliotheken Lizenzen erwerben.
Wenn es die Bibliotheken wirklich ernst meinten mit Open Access, müssten sie bei den Hochschulschriften beginnen und massiv auf die Hochschulverwaltungen und die Fachbereiche einwirken, damit es flächendeckend ein Abschlussarbeiten-Mandat gibt.
Meine Forderung lautet also: 100 % aller Dissertationen, Habilitationen und aller anderen Qualifikationsarbeiten vom Bachelor aufwärts müssen Open Access auf den Hochschulschriftenservern zur Verfügung stehen.
Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft unterhält im Internet eine Übersicht zu den Dissertationen und Habilitationen an den deutschen Hochschulen, leider nicht zu den sonstigen Abschlussarbeiten. Für 2011/12 existieren nur für ein knappes Drittel Volltexte (35 von 114 Arbeiten). Besonders vorbildlich ist die Kölner Sporthochschule, bei der von 36 Arbeiten 20 als Volltext frei zugänglich sind. Ein Lob geht auch an die Universität Köln: 4 von 5 Arbeiten stehen Open Access zur Verfügung. Lässt man diese beiden Institutionen weg, so stehen 74 eingereichten Arbeiten nur 11 Volltext-Veröffentlichungen gegenüber. Das ist ärmlich!
http://www.bisp.de/DE/WissenVermitteln/Sammlungen/DissertationenHabilitationen/dissertationenhabilitationen_node.html
Leider ist das Internet für das Bundesinstitut offenbar immer noch #Neuland, sonst würde es nicht auf die Idee kommen, die Links zu den Schriftenservern und anderen Online-Ressourcen unanklickbar zu präsentieren. Will man eine Arbeit einsehen, muss man die Internetadresse in die Adresszeile des Browsers kopieren. Und selbstverständlich gibt es in den bibliographischen Datenbanken zur Sportwissenschaft keinen Online-Filter, und online vorliegende Arbeiten sindmeist [mitunter] durch den angebotenen Link-Resolver [bzw. die Online-Nachweise] nicht aufzuspüren. Der Wissenschaftler braucht aber in Fachdatenbanken Online-Nachweise, denn nicht selten sind Online-Fundstellen durch simples Googeln – und das ist ja das, was die meisten Dozenten und Studierenden nach meinen Erfahrungen allenfalls beherrschen – nicht ohne weiteres zu ermitteln.
Als Wissenschaftler hat man immer schon eine Auswahl nach pragmatischen Gesichtspunkten getroffen. Ein Sporthistoriker kann in der Regel nicht jede einzelne gedruckte Vereinsfestschrift zur Kenntnis nehmen, er muss sich auf das verlassen, was greifbar ist oder was gute Noten bekommen hat. Dabei könnten in den übersehenen Lokalstudien wahre Goldkörner zu finden sein. Wenn angesichts der Literaturflut eine erschöpfende Sichtung des Materials nicht mehr möglich ist, dann werden Wissenschaftler mehr und mehr das bevorzugen, was online verfügbar ist. Es hat bei Volltextverfügbarkeit eine hohe Sichtbarkeit auch für Aspekte, die in den üblichen Metadaten einschließlich der Inhaltsverzeichnisse nicht präsent sind. Und diese Präferenz ist nicht der Untergang des Abendlandes und des guten Buchs, sondern gut so.
Ein Bündnis der Ignoranten in den Hochschulverwaltungen, den Fachbereichen und nicht zuletzt in den Universitätsbibliotheken verhindert, dass die deutschen Abschlussarbeiten unterhalb der Dissertation lückenlos für die Wissenschaft greifbar sind. Seit 1989, als ich eine inzwischen auch online verfügbare Ausarbeitung zu diesem Thema schrieb, hat sich bei diesem Missstand so gut wie nichts getan, obwohl durch das Aufkommen des Internets und zuletzt auch durch die Causa Guttenberg die Problemlösung auf der Hand liegt: Wenn alle Arbeiten auf den Hochschulschriftenservern veröffentlicht werden müssen, hat die Wissenschaft – und die interessierte Öffentlichkeit - Zugriff auf diese oft sehr wertvollen Arbeiten; die Institutsbibliotheken und die Hochschularchive, die sich mit einem Bewertungsprofil abquälen müssen, würden entlastet.
Ein Blick nach Österreich zeigt, dass die Vernachlässigung der Abschlussarbeiten keineswegs ein bibliothekarisches Naturgesetz darstellt. In Österreich werden alle Diplomarbeiten in der Hochschulbibliothek und [leider nur bis 2004] in der Nationalbibliothek aufbewahrt.
[§ 86 des Österreichischen Universitätsgesetzes 2002 lautet:
"Veröffentlichungspflicht
§ 86. (1) Die Absolventin oder der Absolvent hat die positiv beurteilte Diplom- oder Masterarbeit, Dissertation oder künstlerische Diplom- oder Masterarbeit oder die Dokumentation der künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit durch Übergabe an die Bibliothek der Universität, an welcher der akademische Grad verliehen wird, zu veröffentlichen. Die Absolventin oder der Absolvent hat vor der Verleihung des akademischen Grades jeweils ein vollständiges Exemplar der positiv beurteilten Diplom- oder Masterarbeit, Dissertation oder künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit oder die Dokumentation der künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit abzuliefern. Von der Veröffentlichungspflicht ausgenommen sind die wissenschaftlichen Arbeiten oder deren Teile, die einer Massenvervielfältigung nicht zugänglich sind. Die positiv beurteilte Dissertation ist überdies durch Übergabe an die Österreichische Nationalbibliothek zu veröffentlichen. Sofern vorhanden, kann diese Übergabe auch in elektronischer Form erfolgen.
(2) Anlässlich der Ablieferung einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit ist die Verfasserin oder der Verfasser berechtigt, den Ausschluss der Benützung der abgelieferten Exemplare für längstens fünf Jahre nach der Ablieferung zu beantragen. Dem Antrag ist vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ stattzugeben, wenn die oder der Studierende glaubhaft macht, dass wichtige rechtliche oder wirtschaftliche Interessen der oder des Studierenden gefährdet sind."
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40124786
Frdl. Hw. Josef Pauser]
Für Sonderfälle – jemand möchte seine Arbeit zur Dissertation ausbauen, es sind Betriebsgeheimnisse drin usw. – ließen sich Ausnahmen finden.
Entscheidend ist, dass es eine unglaubliche Ressourcenverschwendung darstellt, wenn Studierende monatelang forschen, die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeiten aber zu nichts anderem dienen als zum Nachweis, dass sie wissenschaftlich arbeiten können. In der Regel lassen die Kandidaten ihre Arbeiten weder drucken (auch nicht ohne eigene Kosten bei VDM) noch stellen sie sie kostenlos oder kostenpflichtig im Internet ein. Die Studien verstauben in den Verliesen der Prüfungsämter oder Institute. Werden sie im Hochschularchiv als archivwürdig bewertet, ist eine Schutzfrist von 30 Jahren nach Entstehung die Mindeststrafe. Datenschutznahe Archivare ordnen sie den sonstigen Prüfungsunterlagen zu, die erst 10 Jahre nach dem Tod des Verfassers für die Benutzung zur Verfügung stehen.
In den für die Weiterentwicklung der Open-Access-Bewegung wichtigen Empfehlungen der Konferenz 10 Jahre Budapest Open Access Initiative heißt es: „Every institution of higher education offering advanced degrees should have a policy assuring that future theses and dissertations are deposited upon acceptance in the institution's OA repository. At the request of students who
want to publish their work, or seek a patent on a patentable discovery, policies should grant reasonable delays rather than permanent exemptions.“ Als gehobener akademischer Grad gilt dabei alles, was über dem Bachelor liegt, also auch Master-Arbeiten.
http://archiv.twoday.net/stories/444870012/
Alle Abschlussarbeiten und Dissertationen online – das würde nicht nur die Aufgabe der Plagiatjäger in VroniPlag und anderen Wikis, die ja erstaunlich viele Blattschüsse verbuchen konnten, erleichtern, sondern auch die öffentliche Bewertung und Überprüfung der jeweiligen Arbeit.
Selbst die schlechteste Bachelorarbeit, wurde sie denn akzeptiert, darf – zumindest in der Theorie - gewisse Mindeststandards des wissenschaftlichen Arbeiten nicht unterschreiten. Das „Summa cum laude“ für den Plagiator Guttenberg sollte uns eine gesunde Skepsis nahelegen, was akademische Notengebungen bei Qualifikationsarbeiten angeht. Mit welchem Recht bezeichnen Professoren und andere Verantwortliche z.B. in den Universitätsbibliotheken solche Arbeiten als wertlos bzw. als nicht dokumentationswürdig? Viele Hochschulschriftenserver nehmen Abschlussarbeiten nur bei positivem Votum des Betreuers; kaum einmal kümmert man sich um konsequente Acquise.
Natürlich gibt es unendlich viele solcher Arbeiten, die auch ich auf Anhieb als wissenschaftlich wertlos bewerten würde, aber ich bin Historiker und habe keine Ahnung vom Maschinenbau, dem Veterinärwesen oder der Sportwissenschaft. Wieso überlassen wir die Bewertung nicht den potentiellen Adressaten wissenschaftlicher Arbeiten, also den Wissenschaftlern?
An dieser Stelle muss auf die von Clay Shirky übernommene Devise des Kunsthistorikers Hubertus Kohle „publish first, filter later“ verwiesen werden. Kohles These: „Unter elektronischen Online-Bedingungen stellt sich das Problem der übergroßen Mengen gar nicht. Im Gegenteil, hier müsste man sie eher fordern“.
http://www.heise.de/tp/artikel/34/34434/1.html
Kohle schreibt weiter: „Im Druck ist das Wort schwerfällig und nicht universell adressierbar, im Digitalen dagegen extrem schnell verteilt und vielfältig rekonfigurierbar. Ist man im Druck gezwungen, einen Filterprozess vorzuschalten, also zum Beispiel in der Wissenschaft einen Peer-Reviewing-Prozess zu organisieren, der die Spreu vom Weizen trennt, ist das im Digitalen nicht notwendig, ja nicht einmal empfehlenswert. Der review in Form etwa von wertenden Kommentaren passiert post festum und kann als Filterungsprozess verstanden werden, der dem Nutzer die Auswahl aus der unübersehbaren Menge an Informationen ermöglicht.“
Noch ein Gedanke zu den „guten“ und den „schlechten“ Büchern. Was als gut oder schlecht angesehen wird, ist oft sehr zeitgebunden. Als Archivar weiß ich, dass keine Archivarsgeneration mit der Arbeit ihrer Vorgänger zufrieden war. Niemand ist glücklich damit, dass so unendlich viel kulturhistorisch wichtiges Material in den Orkus gewandert ist. Eine der spannendsten Archivabteilungen des Staatsarchivs Bern heißt „Unnütze Papiere“. Man hat diese Dokumente aus Spätmittelalter und früher Neuzeit zu vernichten vergessen, obwohl man sie dafür schon zusammengetragen hatte. Nun ist man heilfroh darüber, dass es sie noch gibt.
Um auf die Qualifikationsarbeiten zurückzukommen, die ja aus meiner Sicht eine riesige ungenutzte Ressource darstellen: Auch schlechtere Arbeiten können durch ihre Leistung, was die Reduktion und Komprimierung eines komplexen Themas angeht, im Internet für manche Zwecke von Nutzen sein. Gute Arbeiten hingegen werden gar nicht einmal so selten sogar in gedruckten Nachschlagewerken zitiert. Eine Masterarbeit zu einem Thema der regionalen Sportgeschichte ist oft die einzige wissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Thema.
Wenn nun aber die eitlen Verfasser eher mäßiger Arbeiten diese bei hausarbeiten.de einstellen oder bei Dr. Müller veröffentlichen, die guten Arbeiten aber überwiegend der Wissenschaft entzogen sind – wem ist damit geholfen? Wird die Existenz einer Arbeit bekannt, so werden die Wissenschaftler, die zu dem behandelten Thema forschen, trotzdem versuchen, an sie heranzukommen. Clevere telefonieren mit dem Betreuer, um herauszukriegen, ob sich ein Blick lohnt, andere jagen ihre Hilfskräfte in eine meistens sehr zeitraubende Recherche, wo man denn nun ein Exemplar auftreiben könne. Die Universitätsbibliotheken verweigern sich den Arbeiten ja in der Regel, manchmal werden sie mit Zustimmung des Verfassers in die Institutsbibliothek aufgenommen, oft aber auch nicht. Prüfungsämter und Archive geben nicht ohne weiteres Exemplare heraus, und wo mag eine Verfasserin, die Petra Müller heißt, jetzt erreichbar sein? Solche Arbeiten sind nicht selten „verwaiste Werke“ schon kurz nach ihrer Entstehung.
Wir brauchen also Hochschulsatzungen, die den Kandidaten vorschreiben, dass sie ihre Qualifikationsarbeiten Open Access veröffentlichen sollen. Sinnvollerweise sollten, da gerade auch der sogenannte libre Open Access (im Gegensatz zum bloß kostenlosen gratis Open Access) für die wissenschaftlich erwünschte Nachnutzbarkeit wichtig ist, Creative Commons-Lizenzen empfohlen werden.
Weniger ambitioniert, aber auch nicht einfach zu realisieren: Wir brauchen einen Gesamtnachweis der in Institutionen, sei es Bibliotheken oder Archiven, öffentlich zugänglichen oder dauerhaft vorhandenen Arbeiten. Dieser Nachweis ist sinnvollerweise nach Disziplinen zu organisieren. Und natürlich brauchen wir eine Selbstverpflichtung der Institutionen, diese Arbeiten genauso zu hegen und zu pflegen wie Handschriften oder kostbaren Altbestand. Mir wurde neulich zugetragen, die Bibliothek einer schwäbischen Pädagogischen Hochschule habe gerade ihren über Jahre zusammengetragenen Bestand an älteren Zulassungsarbeiten, darunter unersetzliche lokalgeschichtliche Pretiosen, entsorgt.
Was bereits publiziert wurde, sollte digitalisiert werden. Das gilt nicht nur für Abschlussarbeiten, sondern auch für Monographien, Zeitschriften und graue Literatur. Die Bibliotheken schützen gern die unbefriedigende Urheberrechtslage vor, die sich aber in Kürze etwas verbessern wird durch die aktuelle Gesetzgebung zu verwaisten und vergriffenen Werken, aber bereits heute könnten sie unendlich viel mehr leisten.
Für eine Disziplin, die es mit Bewegungskultur zu tun hat, ist die Sportwissenschaft reichlich unbeweglich und verharrt beim Alten. Es gibt so gut wie keine Digitalisierungsprojekte im Bereich der Sportgeschichte. Die Bibliothek der Kölner Sporthochschule unterhält keine digitale Sammlung.
[Die Diskussion warf mir vor, ich zeichne die Lage zu schwarz. Siehe zu sportwissenschaftlichen deutschen Zeitschriften und Open Access: http://archiv.twoday.net/stories/472713631/ und die Rückmeldung aus dem BISP in den Kommentaren]
Und wenn ein Wissenschaftler gerne seine Publikationen Open Access in einem Open-Access-Repositorium zweitveröffentlichen würde, an wen könnte er sich wenden? Der Schriftenserver der Sporthochschule enthält so gut wie nur Dissertationen und ist auch nur für die Hochschulangehörigen bestimmt. [Das ist falsch, es besteht die - nicht beworbene - Möglichkeit für jedermann, sportwissenschaftliche Arbeiten einzustellen.] Einen disziplinären Schriftenserver gibt es nicht, er wird auch nicht von der doch recht ärmlichen Virtuellen Fachbibliothek angeboten. Anders bei der (freilich ungleich besser aufgestellten) Kunstgeschichte: Der Schriftenserver Artdok floriert, die virtuelle Fachbibliothek Kunstgeschichte ist im Vergleich zu den anderen herausragend.
Wenn jemand für eine lokale Sportgeschichte die Rechte eingeholt hat und das Werk gerne auf einer dauerhaft gepflegten und für die Langzeitarchivierung ausgelegten bibliothekarischen Website mit persistentem Link wie URN oder DOI veröffentlichen wollte, könnte er das nur in wenigen Bundesländern tun wie zum Beispiel Baden-Württemberg oder dem Saarland. Nicht in Nordrhein-Westfalen. Hier gibt es noch kein einschlägiges Webarchivierungsportal.
Gerade im Bereich der Sportgeschichte gibt es viel graue Literatur, die teils in Sportarchiven oder anderen Dokumentationsstellen, teils in Bibliotheken verwahrt wird. Nicht nur bei der Digitalisierung dieser seltenen kleinen Schriften, die aber trotzdem wichtige Quellen darstellen können, sollten Sportarchive und Sportbibliotheken besser zusammenarbeiten als bisher.
Ich habe schon oft die Open-Access-Heuchelei der Bibliotheken gegeißelt. Sie halten sich nicht an das, was sie Wissenschaftlern predigen. Führende bibliothekarische Fachzeitschriften wie die ZfBB sind noch nicht einmal mit Verzögerung Open Access. Und ich ärgere mich immer wieder, wenn ich sehe, dass bibliothekseigene Publikationen, selbst wenn sie vergriffen sind, nicht als PDFs ins Netz gestellt werden. Selbst kleine Heimatvereine sind da mitunter weiter. Von der Schriftenreihe des Bundesinstituts für Sportwissenschaft gibt es keinen einzigen online verfügbaren Band, zumindest gibt es keinen Link in der Liste auf der Website.
Wenn sich viele kleine Bibliotheken zusammenschließen und gemeinsam digitalisieren, dann können sie Großartiges leisten. Und auch wenn die eigenen Ressourcen sehr begrenzt sind, kann durch Einbeziehung der Öffentlichkeit Erstaunliches geleistet werden. Stichwort: Crowdsourcing. So war ein Aufruf der Europeana an die Bürgerinnen und Bürger, Materialien aus dem Ersten Weltkrieg zum Scannen vorbeizubringen, ausgesprochen erfolgreich.
Bibliotheken können durch das Bündnis mit den freien Projekten Wikipedia und Wikisource nur gewinnen. Wer von Ihnen war schon einmal auf der Wikisource-Seite Sport? [Rückmeldung des Auditoriums: niemand.]
http://de.wikisource.org/wiki/Sport
Sie haben nicht viel versäumt, aber das lässt sich ja ändern, denn auch Wikisource ist wie die Wikipedia ein Wiki, das jede(r) bearbeiten darf. Der Nachweis digitalisierter Inhalte liegt bei den Bibliotheken im Argen, während Wikisource auf vielen Gebieten – zugegebenermaßen bisher nicht im Bereich Sport – Enormes leistet.
Was die Schriften bis etwa 1920 angeht, so sind sehr viele davon durch Massendigitalisierungsprojekte – an erster Stelle ist natürlich Google zu nennen - bereits im Netz. Diese Schätze gemeinsam sachkundig zu katalogisieren, wäre die genuine Aufgabe der Bibliotheken. Und es müssten noch bestehende Lücken – überwiegend, aber nicht nur im Bereich der Lokal- und Regionalliteratur – gezielt geschlossen werden.
Wer von Ihnen weiß, dass die Düsseldorfer Universitäts- und Landesbibliothek Schriften vor 1900 kostenlos für ihre Nutzer digitalisiert? [Rückmeldung des Auditoriums: niemand.]
Wer kennt die digitale Bibliothek HathiTrust in den USA? [Rückmeldung des Auditoriums: niemand.]
Es handelt sich um ein großes Sammelbecken für die Google-Scans des sogenannten Bibliotheken-Projekts. Ist ein Titel dort bereits gescannt, kann er vom Rechteinhaber problemlos für die Öffentlichkeit freigegeben werden.
Ein letzter Punkt: Web 2.0, das Mitmach-Web. Mit Wikisource und Wikipedia wurde es ja bereits angesprochen. Sie werden mittelfristig keinen Blumentopf mehr gewinnen, wenn Sie da nicht aktiv mitmischen.
Wieso haben Sie keinen Account auf Facebook, Google+ oder Twitter? Wieso führen Sie kein Blog?
Ein Präsentation beispielsweise alter Sportfotos auf Flickr, alter Filme auf YouTube könnte Ihnen ein neues Publikum erschließen und ihre bestehenden Nutzerkreise fester an Sie binden. Sie brauchen diesen Rückhalt, denn allmählich stellt sich die Frage nach der Existenzberechtigung der Bibliotheken außerhalb von Buchmuseen.
Ein Gemeinschaftsblog zur Sportgeschichte im wissenschaftlichen Blogportal de.hypotheses.org – wer kennt das? [Rückmeldung des Auditoriums: niemand.] – wäre eine schöne Sache und eine ausgezeichnete Bereicherung. Dass solche Gemeinschaftsblogs funktionieren können, zeigt das Gemeinschaftsblog http://ordensgeschichte.hypotheses.org. Sie finden in dem von der Doktorandin Maria Rottler betriebenen Blog übrigens auch einen Hinweis auf eine aktuelle Ausstellung zu Spiel und Sport im Kloster.
Natürlich werden Sie mein Referat in dem von mir betriebenen Gemeinschaftsblog Archivalia – wer war da schonmal drauf? – nachlesen können. Archivalia, das als das führende deutsche Geschichtsblog gilt, hat eine gelegentlich - auch von Peter Schermer - befüllte Rubrik Sportarchive. [Frage: Wer hat Archivalia schon einmal besucht. Rückmeldung des Auditoriums: ca. 6.]
Sollte der eine oder andere von Ihnen ein interessantes Open-Access-Angebot ins Netz stellen, würde ich mich freuen, darauf in Archivalia hinweisen zu können. Und natürlich bin ich gern bereit, Sie kostenlos zu beraten, wenn Sie nach dieser Tagung dafür einen Bedarf sehen.
Update: Siehe Kommentare. Weitere Veröffentlichung:
http://redaktionsblog.hypotheses.org/1644
http://www.sportwissenschaft.de/fileadmin/AGSB/2013graf.pdf
Von Klaus Graf
„Der ehemalige Ringer-Weltmeister Adolf Seger hat im März 2012 das auf Mauritius ansässige VDM-Tochterunternehmen Betascript Publishing zu einer Unterlassungserklärung wegen eines Buches aufgefordert, das als seine ‚Biografie‘ verkauft wurde. Das 84 Seiten umfassende Büchlein war eine Sammlung von Wikipedia-Artikeln, enthielt tatsächlich nur eine Seite über das Leben des Sportlers und kostete 34 Euro. Man einigte sich gütlich, das Buch wurde von VDM vom Markt genommen“
https://de.wikipedia.org/wiki/VDM_Publishing_Group
Das Zitat stammt aus der Wikipedia. Ich habe also schon ein Tabu gebrochen: Zitiere niemals aus der Wikipedia! Und wer von mir im Folgenden das übliche Bashing gegen die Verlagsgruppe Dr. Müller (VDM Publishing Group) erwartet wird auch enttäuscht werden. Da es mir an jeglicher sportwissenschaftlicher Kompetenz mangelt, bin ich hier für die Visionen und Provokationen zuständig.
Meine erste These ist schon auf Krawall gebürstet: Lieber schlechte Bücher im Internet als auf Papier.
Beispielsweise stiftet eine schlechte Masterarbeit Open Access im Internet noch erheblich mehr Nutzen als unzugänglich in der Kellerablage eines Prüfungsamts. Ich komme auf den Fetisch „wissenschaftliche Qualitätssicherung“ noch mehrfach zurück, möchte aber schon jetzt anmerken, dass alle akzeptierten Qualifikationsarbeiten einen formalen Prozess der Qualitätssicherung hinter sich haben. Sie wurden von mindestens zwei universitären Gutachtern und dem zuständigen Prüfungsgremium akzeptiert. Den Kandidaten wird dabei bescheinigt, dass sie in ausreichendem Maße gezeigt haben, dass sie wissenschaftlich arbeiten können. Im Licht der aktuellen Plagiat-Skandale wird man oft ein Fragezeichen setzen müssen, aber jede akzeptierte Abschlussarbeit hat so etwas wie ein „Peer Review“ hinter sich, was man bis vor wenigen Jahren den meisten geisteswissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln im deutschsprachigen Raum nicht bescheinigen konnte. Nach wie vor gibt es in diesem Bereich sehr einflussreiche Organe ohne Peer Review.
Die VDM-Verlage verkaufen solche Abschlussarbeiten für teures Geld: Masterarbeiten, Dissertationen, sogar Habilitationsschriften. Für die Autoren ist das attraktiv: Die Bücher sehen optisch nicht schlechter aus als andere Wissenschafts-Publikationen, und es wird kein Cent Zuschuss fällig.
Das Problem sind die Bibliotheken, denn viele dieser Institutionen haben über die geschäftstüchtige Saarbrücker Verlagsgruppe des Dr. Müller einen Bann ausgesprochen: Sie kaufen solche Bücher nicht.
Nur wenige Bibliothekare äußern sich besonnen wie der Frankfurter Fachreferent Hartmut Bergenthum, der am 21. Oktober 2011 in der Mailingliste INETBIB zu einem Zitat des Verlegers Matthias Ulmer Stellung nahm. Ulmer schrieb: "Zum anderen ist VDM kein Verlag sondern ein absurdes Geschäftsmodell, das sowohl uns Verlegern die Schamesröte ins Gesicht treibt als auch den Bibliotheken, deren Gelder die Taschen von VDM füllt." Bergenthum aber kauft regelmäßig bei VDM für das von ihm betreute Sondersammelgebiet Afrika. Er verwies darauf, dass Print-on-Demand-Verlage florieren, weil nunmehr jeder ein Autor sein könne, und behauptete hinsichtlich der VDM-Produkte: „Sowohl für Studierende (als Leser) als auch für junge Wissenschaftler (als Autoren) scheint VDM attraktiv zu sein und erfüllt deren - wie auch immer gearteten – Bedürfnisse“.
Ich habe ein Beispiel Bergenthums nachrecherchiert. Es betrifft eine Trierer Habilitationsschrift von 2011 mit dem Titel „Third scramble for Africa“. Eine akzeptierte Habilitationsschrift des deutschsprachigen Raums sollte eigentlich von wissenschaftlichen Bibliotheken erworben werden, sonst stimmt etwas nicht. Wieder ein Zitat aus der Wikipedia, aus dem Artikel Habilitationsschrift: „Im Gegensatz zu einer Dissertation muss es sich um eine Arbeit mit hohem methodischen Anspruch handeln, durch welche die wissenschaftliche Forschung nicht nur in einem kleinen Segment vorangebracht werden soll“. Die fragliche Arbeit kostet bei Amazon 62,95 Euro, für 604 Seiten wahrlich kein überzogener Preis. Und wo kann man nun diese Arbeit laut Karlsruher Virtuellem Katalog einsehen? In der Deutschen Nationalbibliothek, dort ist als Pflichtexemplar auch eine elektronische Fassung für die Präsenznutzung hinterlegt, natürlich in Trier und in Frankfurt. Sonst nirgends, also auch nicht in Saarbrücken, wo der Verlag ansässig ist. Zuständig für das Pflichtexemplar ist die Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek, die offenbar keinerlei VDM-Bücher in ihren Bestand aufnimmt – im Gegensatz zu kleineren saarländischen Bibliotheken oder der Kölner Sporthochschule, die als Spezialbibliothek sehr wohl bei VDM einkauft.
Ich scheue mich nicht, von einem Skandal zu sprechen. Für die Fernleihe stehen genau zwei Exemplare der Habilitationsschrift zur Verfügung, falls Frankfurt und Trier die bibliophile Seltenheit außer Haus geben. Ich vermute, die meisten Inkunabelausgaben – das sind vor 1500 erschienene Bücher aus der Anfangszeit des Buchdrucks [Frage ans Auditorium: Wer verwahrt Inkunabeln? Rückmeldung: niemand] – sind in mehr Exemplaren in Bibliotheken verbreitet als diese Trierer Habilitationsschrift aus dem Jahr 2011.
Die zweite These, mit der ich Sie erzürnen könnte, lautet: Die Bibliotheken müssen endlich aufhören, ihre Leser durch Nichtanschaffung von Büchern oder Nichtanforderung von Pflichtexemplaren zu bevormunden.
Über Bibliothekare als Zensoren in der Geschichte könnte man sicher einen eigenen Vortrag halten. Es gibt vermutlich wenig empirische Untersuchungen, aber eigene Erfahrungen legen den Schluss nahe, dass sich die Bibliotheken seit dem 18. Jahrhundert nicht mit Ruhm bekleckert haben, was die vollständige Dokumentation des gedruckten Geistesschaffens angeht. Vergeblich suchte ich nach einer Rezension in einer gelehrten Zeitschrift aus dem 18. Jahrhundert, eine wissenschaftliche Zeitschrift zum Buchwesen aus dem Ende des 19. Jahrhunderts fand ich nur in einem Nachlass einigermaßen komplett und ein wichtiges Organ des deutschen Druckereiwesens um 1900 ist nur in einer österreichischen Spezialbibliothek mehr oder minder lückenlos vorhanden. Zu erinnern ist auch an den Kampf gegen den sogenannten „Schund“, dem sich auch die Bibliothekare der Pflichtexemplarbibliotheken verschrieben hatten – mit schmerzlichen Folgen für die Erforschung der populären Kultur.
Was sagte das Bundesverfassungsgericht in seiner Pflichtexemplar-Entscheidung aus dem Jahr 1981? Druckwerke würden im Lauf der Zeit geistiges und kulturelles Allgemeingut. Unter Berücksichtigung der Sozialpflichtigkeit des Eigentums stelle es ein legitimes Anliegen dar, die literarischen Erzeugnisse dem wissenschaftlich und kulturell Interessierten möglichst geschlossen zugänglich zu machen und künftigen Generationen einen umfassenden Eindruck vom geistigen Schaffen früherer Epochen zu vermitteln. Ich möchte ergänzen: Auch wenn es sich um Produkte aus dem Spam-Verlag VDM handelt.
Ich lege Wert auf die Feststellung, dass mich der VDM-Verlag leider nicht finanziert. Selbstverständlich verurteile ich die Täuschung der Verbraucher durch zwischen zwei Buchdeckel gepresste Wikipedia-Artikel, aber im Bereich des Hochschulschriftendrucks verhält sich VDM nicht grundsätzlich anders als andere einschlägige Verlage. Auch bei hochangesehenen Verlagen erhält man im Übrigen für viel Geld Arbeiten minderer Qualität.
Das „gute Buch“, das man behaglich im Lehnstuhl zu sich nimmt und das man gerne jungen Menschen empfiehlt, ist, wenn man es recht besieht, eigentlich nie unumstritten. Otfried Preußlers beliebtes Jugendbuch Krabat ist Schullektüre, aber dagegen wehrten sich jetzt vor Gericht Zeugen Jehovas als betroffene Eltern, die in ihm die Förderung schwarzer Magie sahen. Sogar die Bibel ist streckenweise politisch unkorrekt. Und das schlechte Buch? Wer legt die Kriterien fest, was etwa im Bereich der Wissenschaft schlechte Bücher sind? Und was sollten die Konsequenzen sein? Bücherverbrennungen wohl kaum.
Als Auslöser der Open-Access-Bewegung kann die sogenannte Zeitschriftenkrise in den naturwissenschaftlichen Fächern bezeichnet werden. Die führenden Fachorgane werden dort immer teurer, mitunter kostet ein Jahres-Abo nicht weniger als ein Mittelklassewagen. Dieser Kostendruck durch Elsevier & Gesellen hat natürlich Auswirkungen auf die Monographien-Anschaffungen in den Universitätsbibliotheken und damit auch auf die Geistes- und Sozialwissenschaften. Bücher werden immer teurer, und selbst Bücher, die ich als Standardwerke bezeichnen würde, gibt es nach meinen unrepräsentativen Beobachtungen leider nur noch an wenigen Standorten. Da die Preise so hoch sind, dass der Wissenschaftler nicht selbst anschaffen kann, führt dies zur Belastung der Fernleihe oder dazu, dass relevante Literatur nicht rezipiert wird.
Mein Lösungsvorschlag für das Monographien-Problem wird Sie wohl nicht überraschen:
Auch bei den Monographien müssen die Bibliotheken und die Träger und Finanzierer von Forschung konsequent auf Open Access setzen.
Längst nicht alle Universitätsverlage praktizieren Open Access. Ich habe zuhause eine altgermanistische Habilitationsschrift – gedruckt vom Düsseldorfer Universitätsverlag - zur Besprechung, die mehr als 600 Seiten umfasst. Dass weder ein Register noch eine oder mehrere Zusammenfassungen beigegeben sind, grenzt für mich beinahe schon an Körperverletzung. Ein E-Book wird nicht angeboten, obwohl man verzweifelt einen Volltext braucht, um sich die Lektüre zu erleichtern. Nun werden sie mir erwidern: Im Mittelalter hatten die Leute auch Grips und zwar ohne Volltextsuche. Das ist schon richtig, aber sollte sich unsere Publikationskultur nicht am digitalen Potential im 21. Jahrhundert orientieren und nicht an dem angeblichen Gold-Standard, dem im 15. Jahrhundert erfundenen gedruckten Buch?
Open Access sorgt für Chancengleichheit. Es kommt nicht mehr darauf an, wo sich ein Buch physisch befindet und ob sich eine Bibliothek ein üppiges kommerzielles E-Book-Angebot leisten kann. In den USA kann noch nicht einmal jede Hochschulbibliothek – Sie wissen, es gibt da unendlich viele Universitäten – ein JSTOR-Abo finanzieren. Laut Datenbank-Infosystem hat keine deutsche Institution eine Subskription von „Early European Books“ , einem von europäischen Nationalbibliotheken unterstützten groß angelegten und an sich wissenschaftlich wichtigem Digitalisierungsprojekt für alte Drucke. Deutsche Wissenschaftler gucken in die Röhre, da sie darauf angewiesen sind, dass Bibliotheken Lizenzen erwerben.
Wenn es die Bibliotheken wirklich ernst meinten mit Open Access, müssten sie bei den Hochschulschriften beginnen und massiv auf die Hochschulverwaltungen und die Fachbereiche einwirken, damit es flächendeckend ein Abschlussarbeiten-Mandat gibt.
Meine Forderung lautet also: 100 % aller Dissertationen, Habilitationen und aller anderen Qualifikationsarbeiten vom Bachelor aufwärts müssen Open Access auf den Hochschulschriftenservern zur Verfügung stehen.
Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft unterhält im Internet eine Übersicht zu den Dissertationen und Habilitationen an den deutschen Hochschulen, leider nicht zu den sonstigen Abschlussarbeiten. Für 2011/12 existieren nur für ein knappes Drittel Volltexte (35 von 114 Arbeiten). Besonders vorbildlich ist die Kölner Sporthochschule, bei der von 36 Arbeiten 20 als Volltext frei zugänglich sind. Ein Lob geht auch an die Universität Köln: 4 von 5 Arbeiten stehen Open Access zur Verfügung. Lässt man diese beiden Institutionen weg, so stehen 74 eingereichten Arbeiten nur 11 Volltext-Veröffentlichungen gegenüber. Das ist ärmlich!
http://www.bisp.de/DE/WissenVermitteln/Sammlungen/DissertationenHabilitationen/dissertationenhabilitationen_node.html
Leider ist das Internet für das Bundesinstitut offenbar immer noch #Neuland, sonst würde es nicht auf die Idee kommen, die Links zu den Schriftenservern und anderen Online-Ressourcen unanklickbar zu präsentieren. Will man eine Arbeit einsehen, muss man die Internetadresse in die Adresszeile des Browsers kopieren. Und selbstverständlich gibt es in den bibliographischen Datenbanken zur Sportwissenschaft keinen Online-Filter, und online vorliegende Arbeiten sind
Als Wissenschaftler hat man immer schon eine Auswahl nach pragmatischen Gesichtspunkten getroffen. Ein Sporthistoriker kann in der Regel nicht jede einzelne gedruckte Vereinsfestschrift zur Kenntnis nehmen, er muss sich auf das verlassen, was greifbar ist oder was gute Noten bekommen hat. Dabei könnten in den übersehenen Lokalstudien wahre Goldkörner zu finden sein. Wenn angesichts der Literaturflut eine erschöpfende Sichtung des Materials nicht mehr möglich ist, dann werden Wissenschaftler mehr und mehr das bevorzugen, was online verfügbar ist. Es hat bei Volltextverfügbarkeit eine hohe Sichtbarkeit auch für Aspekte, die in den üblichen Metadaten einschließlich der Inhaltsverzeichnisse nicht präsent sind. Und diese Präferenz ist nicht der Untergang des Abendlandes und des guten Buchs, sondern gut so.
Ein Bündnis der Ignoranten in den Hochschulverwaltungen, den Fachbereichen und nicht zuletzt in den Universitätsbibliotheken verhindert, dass die deutschen Abschlussarbeiten unterhalb der Dissertation lückenlos für die Wissenschaft greifbar sind. Seit 1989, als ich eine inzwischen auch online verfügbare Ausarbeitung zu diesem Thema schrieb, hat sich bei diesem Missstand so gut wie nichts getan, obwohl durch das Aufkommen des Internets und zuletzt auch durch die Causa Guttenberg die Problemlösung auf der Hand liegt: Wenn alle Arbeiten auf den Hochschulschriftenservern veröffentlicht werden müssen, hat die Wissenschaft – und die interessierte Öffentlichkeit - Zugriff auf diese oft sehr wertvollen Arbeiten; die Institutsbibliotheken und die Hochschularchive, die sich mit einem Bewertungsprofil abquälen müssen, würden entlastet.
Ein Blick nach Österreich zeigt, dass die Vernachlässigung der Abschlussarbeiten keineswegs ein bibliothekarisches Naturgesetz darstellt. In Österreich werden alle Diplomarbeiten in der Hochschulbibliothek und [leider nur bis 2004] in der Nationalbibliothek aufbewahrt.
[§ 86 des Österreichischen Universitätsgesetzes 2002 lautet:
"Veröffentlichungspflicht
§ 86. (1) Die Absolventin oder der Absolvent hat die positiv beurteilte Diplom- oder Masterarbeit, Dissertation oder künstlerische Diplom- oder Masterarbeit oder die Dokumentation der künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit durch Übergabe an die Bibliothek der Universität, an welcher der akademische Grad verliehen wird, zu veröffentlichen. Die Absolventin oder der Absolvent hat vor der Verleihung des akademischen Grades jeweils ein vollständiges Exemplar der positiv beurteilten Diplom- oder Masterarbeit, Dissertation oder künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit oder die Dokumentation der künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit abzuliefern. Von der Veröffentlichungspflicht ausgenommen sind die wissenschaftlichen Arbeiten oder deren Teile, die einer Massenvervielfältigung nicht zugänglich sind. Die positiv beurteilte Dissertation ist überdies durch Übergabe an die Österreichische Nationalbibliothek zu veröffentlichen. Sofern vorhanden, kann diese Übergabe auch in elektronischer Form erfolgen.
(2) Anlässlich der Ablieferung einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit ist die Verfasserin oder der Verfasser berechtigt, den Ausschluss der Benützung der abgelieferten Exemplare für längstens fünf Jahre nach der Ablieferung zu beantragen. Dem Antrag ist vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ stattzugeben, wenn die oder der Studierende glaubhaft macht, dass wichtige rechtliche oder wirtschaftliche Interessen der oder des Studierenden gefährdet sind."
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40124786
Frdl. Hw. Josef Pauser]
Für Sonderfälle – jemand möchte seine Arbeit zur Dissertation ausbauen, es sind Betriebsgeheimnisse drin usw. – ließen sich Ausnahmen finden.
Entscheidend ist, dass es eine unglaubliche Ressourcenverschwendung darstellt, wenn Studierende monatelang forschen, die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeiten aber zu nichts anderem dienen als zum Nachweis, dass sie wissenschaftlich arbeiten können. In der Regel lassen die Kandidaten ihre Arbeiten weder drucken (auch nicht ohne eigene Kosten bei VDM) noch stellen sie sie kostenlos oder kostenpflichtig im Internet ein. Die Studien verstauben in den Verliesen der Prüfungsämter oder Institute. Werden sie im Hochschularchiv als archivwürdig bewertet, ist eine Schutzfrist von 30 Jahren nach Entstehung die Mindeststrafe. Datenschutznahe Archivare ordnen sie den sonstigen Prüfungsunterlagen zu, die erst 10 Jahre nach dem Tod des Verfassers für die Benutzung zur Verfügung stehen.
In den für die Weiterentwicklung der Open-Access-Bewegung wichtigen Empfehlungen der Konferenz 10 Jahre Budapest Open Access Initiative heißt es: „Every institution of higher education offering advanced degrees should have a policy assuring that future theses and dissertations are deposited upon acceptance in the institution's OA repository. At the request of students who
want to publish their work, or seek a patent on a patentable discovery, policies should grant reasonable delays rather than permanent exemptions.“ Als gehobener akademischer Grad gilt dabei alles, was über dem Bachelor liegt, also auch Master-Arbeiten.
http://archiv.twoday.net/stories/444870012/
Alle Abschlussarbeiten und Dissertationen online – das würde nicht nur die Aufgabe der Plagiatjäger in VroniPlag und anderen Wikis, die ja erstaunlich viele Blattschüsse verbuchen konnten, erleichtern, sondern auch die öffentliche Bewertung und Überprüfung der jeweiligen Arbeit.
Selbst die schlechteste Bachelorarbeit, wurde sie denn akzeptiert, darf – zumindest in der Theorie - gewisse Mindeststandards des wissenschaftlichen Arbeiten nicht unterschreiten. Das „Summa cum laude“ für den Plagiator Guttenberg sollte uns eine gesunde Skepsis nahelegen, was akademische Notengebungen bei Qualifikationsarbeiten angeht. Mit welchem Recht bezeichnen Professoren und andere Verantwortliche z.B. in den Universitätsbibliotheken solche Arbeiten als wertlos bzw. als nicht dokumentationswürdig? Viele Hochschulschriftenserver nehmen Abschlussarbeiten nur bei positivem Votum des Betreuers; kaum einmal kümmert man sich um konsequente Acquise.
Natürlich gibt es unendlich viele solcher Arbeiten, die auch ich auf Anhieb als wissenschaftlich wertlos bewerten würde, aber ich bin Historiker und habe keine Ahnung vom Maschinenbau, dem Veterinärwesen oder der Sportwissenschaft. Wieso überlassen wir die Bewertung nicht den potentiellen Adressaten wissenschaftlicher Arbeiten, also den Wissenschaftlern?
An dieser Stelle muss auf die von Clay Shirky übernommene Devise des Kunsthistorikers Hubertus Kohle „publish first, filter later“ verwiesen werden. Kohles These: „Unter elektronischen Online-Bedingungen stellt sich das Problem der übergroßen Mengen gar nicht. Im Gegenteil, hier müsste man sie eher fordern“.
http://www.heise.de/tp/artikel/34/34434/1.html
Kohle schreibt weiter: „Im Druck ist das Wort schwerfällig und nicht universell adressierbar, im Digitalen dagegen extrem schnell verteilt und vielfältig rekonfigurierbar. Ist man im Druck gezwungen, einen Filterprozess vorzuschalten, also zum Beispiel in der Wissenschaft einen Peer-Reviewing-Prozess zu organisieren, der die Spreu vom Weizen trennt, ist das im Digitalen nicht notwendig, ja nicht einmal empfehlenswert. Der review in Form etwa von wertenden Kommentaren passiert post festum und kann als Filterungsprozess verstanden werden, der dem Nutzer die Auswahl aus der unübersehbaren Menge an Informationen ermöglicht.“
Noch ein Gedanke zu den „guten“ und den „schlechten“ Büchern. Was als gut oder schlecht angesehen wird, ist oft sehr zeitgebunden. Als Archivar weiß ich, dass keine Archivarsgeneration mit der Arbeit ihrer Vorgänger zufrieden war. Niemand ist glücklich damit, dass so unendlich viel kulturhistorisch wichtiges Material in den Orkus gewandert ist. Eine der spannendsten Archivabteilungen des Staatsarchivs Bern heißt „Unnütze Papiere“. Man hat diese Dokumente aus Spätmittelalter und früher Neuzeit zu vernichten vergessen, obwohl man sie dafür schon zusammengetragen hatte. Nun ist man heilfroh darüber, dass es sie noch gibt.
Um auf die Qualifikationsarbeiten zurückzukommen, die ja aus meiner Sicht eine riesige ungenutzte Ressource darstellen: Auch schlechtere Arbeiten können durch ihre Leistung, was die Reduktion und Komprimierung eines komplexen Themas angeht, im Internet für manche Zwecke von Nutzen sein. Gute Arbeiten hingegen werden gar nicht einmal so selten sogar in gedruckten Nachschlagewerken zitiert. Eine Masterarbeit zu einem Thema der regionalen Sportgeschichte ist oft die einzige wissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Thema.
Wenn nun aber die eitlen Verfasser eher mäßiger Arbeiten diese bei hausarbeiten.de einstellen oder bei Dr. Müller veröffentlichen, die guten Arbeiten aber überwiegend der Wissenschaft entzogen sind – wem ist damit geholfen? Wird die Existenz einer Arbeit bekannt, so werden die Wissenschaftler, die zu dem behandelten Thema forschen, trotzdem versuchen, an sie heranzukommen. Clevere telefonieren mit dem Betreuer, um herauszukriegen, ob sich ein Blick lohnt, andere jagen ihre Hilfskräfte in eine meistens sehr zeitraubende Recherche, wo man denn nun ein Exemplar auftreiben könne. Die Universitätsbibliotheken verweigern sich den Arbeiten ja in der Regel, manchmal werden sie mit Zustimmung des Verfassers in die Institutsbibliothek aufgenommen, oft aber auch nicht. Prüfungsämter und Archive geben nicht ohne weiteres Exemplare heraus, und wo mag eine Verfasserin, die Petra Müller heißt, jetzt erreichbar sein? Solche Arbeiten sind nicht selten „verwaiste Werke“ schon kurz nach ihrer Entstehung.
Wir brauchen also Hochschulsatzungen, die den Kandidaten vorschreiben, dass sie ihre Qualifikationsarbeiten Open Access veröffentlichen sollen. Sinnvollerweise sollten, da gerade auch der sogenannte libre Open Access (im Gegensatz zum bloß kostenlosen gratis Open Access) für die wissenschaftlich erwünschte Nachnutzbarkeit wichtig ist, Creative Commons-Lizenzen empfohlen werden.
Weniger ambitioniert, aber auch nicht einfach zu realisieren: Wir brauchen einen Gesamtnachweis der in Institutionen, sei es Bibliotheken oder Archiven, öffentlich zugänglichen oder dauerhaft vorhandenen Arbeiten. Dieser Nachweis ist sinnvollerweise nach Disziplinen zu organisieren. Und natürlich brauchen wir eine Selbstverpflichtung der Institutionen, diese Arbeiten genauso zu hegen und zu pflegen wie Handschriften oder kostbaren Altbestand. Mir wurde neulich zugetragen, die Bibliothek einer schwäbischen Pädagogischen Hochschule habe gerade ihren über Jahre zusammengetragenen Bestand an älteren Zulassungsarbeiten, darunter unersetzliche lokalgeschichtliche Pretiosen, entsorgt.
Was bereits publiziert wurde, sollte digitalisiert werden. Das gilt nicht nur für Abschlussarbeiten, sondern auch für Monographien, Zeitschriften und graue Literatur. Die Bibliotheken schützen gern die unbefriedigende Urheberrechtslage vor, die sich aber in Kürze etwas verbessern wird durch die aktuelle Gesetzgebung zu verwaisten und vergriffenen Werken, aber bereits heute könnten sie unendlich viel mehr leisten.
Für eine Disziplin, die es mit Bewegungskultur zu tun hat, ist die Sportwissenschaft reichlich unbeweglich und verharrt beim Alten. Es gibt so gut wie keine Digitalisierungsprojekte im Bereich der Sportgeschichte. Die Bibliothek der Kölner Sporthochschule unterhält keine digitale Sammlung.
[Die Diskussion warf mir vor, ich zeichne die Lage zu schwarz. Siehe zu sportwissenschaftlichen deutschen Zeitschriften und Open Access: http://archiv.twoday.net/stories/472713631/ und die Rückmeldung aus dem BISP in den Kommentaren]
Und wenn ein Wissenschaftler gerne seine Publikationen Open Access in einem Open-Access-Repositorium zweitveröffentlichen würde, an wen könnte er sich wenden? Der Schriftenserver der Sporthochschule enthält so gut wie nur Dissertationen und ist auch nur für die Hochschulangehörigen bestimmt. [Das ist falsch, es besteht die - nicht beworbene - Möglichkeit für jedermann, sportwissenschaftliche Arbeiten einzustellen.] Einen disziplinären Schriftenserver gibt es nicht, er wird auch nicht von der doch recht ärmlichen Virtuellen Fachbibliothek angeboten. Anders bei der (freilich ungleich besser aufgestellten) Kunstgeschichte: Der Schriftenserver Artdok floriert, die virtuelle Fachbibliothek Kunstgeschichte ist im Vergleich zu den anderen herausragend.
Wenn jemand für eine lokale Sportgeschichte die Rechte eingeholt hat und das Werk gerne auf einer dauerhaft gepflegten und für die Langzeitarchivierung ausgelegten bibliothekarischen Website mit persistentem Link wie URN oder DOI veröffentlichen wollte, könnte er das nur in wenigen Bundesländern tun wie zum Beispiel Baden-Württemberg oder dem Saarland. Nicht in Nordrhein-Westfalen. Hier gibt es noch kein einschlägiges Webarchivierungsportal.
Gerade im Bereich der Sportgeschichte gibt es viel graue Literatur, die teils in Sportarchiven oder anderen Dokumentationsstellen, teils in Bibliotheken verwahrt wird. Nicht nur bei der Digitalisierung dieser seltenen kleinen Schriften, die aber trotzdem wichtige Quellen darstellen können, sollten Sportarchive und Sportbibliotheken besser zusammenarbeiten als bisher.
Ich habe schon oft die Open-Access-Heuchelei der Bibliotheken gegeißelt. Sie halten sich nicht an das, was sie Wissenschaftlern predigen. Führende bibliothekarische Fachzeitschriften wie die ZfBB sind noch nicht einmal mit Verzögerung Open Access. Und ich ärgere mich immer wieder, wenn ich sehe, dass bibliothekseigene Publikationen, selbst wenn sie vergriffen sind, nicht als PDFs ins Netz gestellt werden. Selbst kleine Heimatvereine sind da mitunter weiter. Von der Schriftenreihe des Bundesinstituts für Sportwissenschaft gibt es keinen einzigen online verfügbaren Band, zumindest gibt es keinen Link in der Liste auf der Website.
Wenn sich viele kleine Bibliotheken zusammenschließen und gemeinsam digitalisieren, dann können sie Großartiges leisten. Und auch wenn die eigenen Ressourcen sehr begrenzt sind, kann durch Einbeziehung der Öffentlichkeit Erstaunliches geleistet werden. Stichwort: Crowdsourcing. So war ein Aufruf der Europeana an die Bürgerinnen und Bürger, Materialien aus dem Ersten Weltkrieg zum Scannen vorbeizubringen, ausgesprochen erfolgreich.
Bibliotheken können durch das Bündnis mit den freien Projekten Wikipedia und Wikisource nur gewinnen. Wer von Ihnen war schon einmal auf der Wikisource-Seite Sport? [Rückmeldung des Auditoriums: niemand.]
http://de.wikisource.org/wiki/Sport
Sie haben nicht viel versäumt, aber das lässt sich ja ändern, denn auch Wikisource ist wie die Wikipedia ein Wiki, das jede(r) bearbeiten darf. Der Nachweis digitalisierter Inhalte liegt bei den Bibliotheken im Argen, während Wikisource auf vielen Gebieten – zugegebenermaßen bisher nicht im Bereich Sport – Enormes leistet.
Was die Schriften bis etwa 1920 angeht, so sind sehr viele davon durch Massendigitalisierungsprojekte – an erster Stelle ist natürlich Google zu nennen - bereits im Netz. Diese Schätze gemeinsam sachkundig zu katalogisieren, wäre die genuine Aufgabe der Bibliotheken. Und es müssten noch bestehende Lücken – überwiegend, aber nicht nur im Bereich der Lokal- und Regionalliteratur – gezielt geschlossen werden.
Wer von Ihnen weiß, dass die Düsseldorfer Universitäts- und Landesbibliothek Schriften vor 1900 kostenlos für ihre Nutzer digitalisiert? [Rückmeldung des Auditoriums: niemand.]
Wer kennt die digitale Bibliothek HathiTrust in den USA? [Rückmeldung des Auditoriums: niemand.]
Es handelt sich um ein großes Sammelbecken für die Google-Scans des sogenannten Bibliotheken-Projekts. Ist ein Titel dort bereits gescannt, kann er vom Rechteinhaber problemlos für die Öffentlichkeit freigegeben werden.
Ein letzter Punkt: Web 2.0, das Mitmach-Web. Mit Wikisource und Wikipedia wurde es ja bereits angesprochen. Sie werden mittelfristig keinen Blumentopf mehr gewinnen, wenn Sie da nicht aktiv mitmischen.
Wieso haben Sie keinen Account auf Facebook, Google+ oder Twitter? Wieso führen Sie kein Blog?
Ein Präsentation beispielsweise alter Sportfotos auf Flickr, alter Filme auf YouTube könnte Ihnen ein neues Publikum erschließen und ihre bestehenden Nutzerkreise fester an Sie binden. Sie brauchen diesen Rückhalt, denn allmählich stellt sich die Frage nach der Existenzberechtigung der Bibliotheken außerhalb von Buchmuseen.
Ein Gemeinschaftsblog zur Sportgeschichte im wissenschaftlichen Blogportal de.hypotheses.org – wer kennt das? [Rückmeldung des Auditoriums: niemand.] – wäre eine schöne Sache und eine ausgezeichnete Bereicherung. Dass solche Gemeinschaftsblogs funktionieren können, zeigt das Gemeinschaftsblog http://ordensgeschichte.hypotheses.org. Sie finden in dem von der Doktorandin Maria Rottler betriebenen Blog übrigens auch einen Hinweis auf eine aktuelle Ausstellung zu Spiel und Sport im Kloster.
Natürlich werden Sie mein Referat in dem von mir betriebenen Gemeinschaftsblog Archivalia – wer war da schonmal drauf? – nachlesen können. Archivalia, das als das führende deutsche Geschichtsblog gilt, hat eine gelegentlich - auch von Peter Schermer - befüllte Rubrik Sportarchive. [Frage: Wer hat Archivalia schon einmal besucht. Rückmeldung des Auditoriums: ca. 6.]
Sollte der eine oder andere von Ihnen ein interessantes Open-Access-Angebot ins Netz stellen, würde ich mich freuen, darauf in Archivalia hinweisen zu können. Und natürlich bin ich gern bereit, Sie kostenlos zu beraten, wenn Sie nach dieser Tagung dafür einen Bedarf sehen.
Update: Siehe Kommentare. Weitere Veröffentlichung:
http://redaktionsblog.hypotheses.org/1644
http://www.sportwissenschaft.de/fileadmin/AGSB/2013graf.pdf
KlausGraf - am Samstag, 7. September 2013, 00:47 - Rubrik: Sportarchive
http://www.sportwiss.uni-hannover.de/links_fachzeitschriften.html nennt eine Auswahl sportwissenschaftlicher Fachzeitschriften.
Die ersten drei Zeitschriften Sport & Spiel, Sportpädagogik und SportPraxis sind online überhaupt nicht abrufbar.
Die EZB hat nicht zur Kenntnis genommen, dass die Zeitschrift Sportunterricht von 2007 bis 2012 mit 12-Monats-Embargo online ist.
http://hofmann-verlag.de/index.php/sportunterricht/sportunterricht-archiv/sportunterricht-archiv-2012
Es wäre die Aufgabe der sportwissenschaftlichen Community, mit der EZB zusammenzuarbeiten und einen lückenlosen Nachweis sportwissenschaftlicher Online-Zeitschriften sicherzustellen.
Die Zeitschrift für Sportpsychologie bietet nur kostenpflichtige Inhalte an.
Das Gleiche gilt leider für die renommierteste Zeitschrift "Sportwissenschaft", die bei Springer gelandet ist. 2007 war eine Retrodigitalisierung geplant, aus der wohl nichts geworden ist:
http://www.sportwissenschaft.de/index.php?id=799
Es war mir nicht möglich, als sportwissenschaftlicher Laie den Titel "Gissel, N. (2000). Wozu noch Sportgeschichte? Gedanken zur Legitimation und Funktion sporthistorischer Forschung. In Sportwissenschaft 30 (3), 311-325" in der Datenbank Spolit oder den VIFA-Datenbanken ausfindig zu machen.
SportZeiten hat keine Online-Ausgabe.
Sport und Gesellschaft hat ein 12-Monats-Embargo, die Ausgaben vorher sind Open Access:
http://www.sportundgesellschaft.de/index.php/sportundgesellschaft/issue/archive
Die Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin ist komplett Open Access
http://www.zeitschrift-sportmedizin.de/Artikel.html
Soweit die Liste der Uni Hannover.
Bei der Zeitschrift "Leistungssport" schreibt die EZB: "Nur wenige Volltexte sind online verfügbar". Angesichts des Artikelarchivs 1971-2011 ist das nicht nachvollziehbar:
http://sport-iat.de/ls-archiv
Für den DDR-Sport ist wichtig: "Für die Datenbank des IAT wurden alle Beiträge der Zeitschrift „Theorie und Praxis des Leistungssports“ der DDR von 1963 bis 1989 digitalisiert. Über 3.500 Einzelartikel vom ersten Heft der Zeitschrift „Theorie und Praxis des Leistungssports“ bis zum letzten Heft der Nachfolgezeitschrift „Training und Wettkampf“ (1990) sind nun recherchierbar und als Volltext einsehbar."
http://www.iat.uni-leipzig.de:8080/rech_start.fau?prj=tupl6
Nur 15 Jahre gab es die dsv-Informationen (bis 2005). Die Jahrgänge sind unverständlicherweise erst ab 1995 online:
http://www.sportwissenschaft.de/index.php?id=218
Noch kürzer (nur von 2005-2008) existierte das Online-Journal "Bewegung und Training":
http://www.sportwissenschaft.de/index.php?id=291
Fazit: Es gibt durchaus positive Ansätze in Sachen Open Access, aber noch ist viel zu tun.
Die ersten drei Zeitschriften Sport & Spiel, Sportpädagogik und SportPraxis sind online überhaupt nicht abrufbar.
Die EZB hat nicht zur Kenntnis genommen, dass die Zeitschrift Sportunterricht von 2007 bis 2012 mit 12-Monats-Embargo online ist.
http://hofmann-verlag.de/index.php/sportunterricht/sportunterricht-archiv/sportunterricht-archiv-2012
Es wäre die Aufgabe der sportwissenschaftlichen Community, mit der EZB zusammenzuarbeiten und einen lückenlosen Nachweis sportwissenschaftlicher Online-Zeitschriften sicherzustellen.
Die Zeitschrift für Sportpsychologie bietet nur kostenpflichtige Inhalte an.
Das Gleiche gilt leider für die renommierteste Zeitschrift "Sportwissenschaft", die bei Springer gelandet ist. 2007 war eine Retrodigitalisierung geplant, aus der wohl nichts geworden ist:
http://www.sportwissenschaft.de/index.php?id=799
Es war mir nicht möglich, als sportwissenschaftlicher Laie den Titel "Gissel, N. (2000). Wozu noch Sportgeschichte? Gedanken zur Legitimation und Funktion sporthistorischer Forschung. In Sportwissenschaft 30 (3), 311-325" in der Datenbank Spolit oder den VIFA-Datenbanken ausfindig zu machen.
SportZeiten hat keine Online-Ausgabe.
Sport und Gesellschaft hat ein 12-Monats-Embargo, die Ausgaben vorher sind Open Access:
http://www.sportundgesellschaft.de/index.php/sportundgesellschaft/issue/archive
Die Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin ist komplett Open Access
http://www.zeitschrift-sportmedizin.de/Artikel.html
Soweit die Liste der Uni Hannover.
Bei der Zeitschrift "Leistungssport" schreibt die EZB: "Nur wenige Volltexte sind online verfügbar". Angesichts des Artikelarchivs 1971-2011 ist das nicht nachvollziehbar:
http://sport-iat.de/ls-archiv
Für den DDR-Sport ist wichtig: "Für die Datenbank des IAT wurden alle Beiträge der Zeitschrift „Theorie und Praxis des Leistungssports“ der DDR von 1963 bis 1989 digitalisiert. Über 3.500 Einzelartikel vom ersten Heft der Zeitschrift „Theorie und Praxis des Leistungssports“ bis zum letzten Heft der Nachfolgezeitschrift „Training und Wettkampf“ (1990) sind nun recherchierbar und als Volltext einsehbar."
http://www.iat.uni-leipzig.de:8080/rech_start.fau?prj=tupl6
Nur 15 Jahre gab es die dsv-Informationen (bis 2005). Die Jahrgänge sind unverständlicherweise erst ab 1995 online:
http://www.sportwissenschaft.de/index.php?id=218
Noch kürzer (nur von 2005-2008) existierte das Online-Journal "Bewegung und Training":
http://www.sportwissenschaft.de/index.php?id=291
Fazit: Es gibt durchaus positive Ansätze in Sachen Open Access, aber noch ist viel zu tun.
KlausGraf - am Freitag, 6. September 2013, 23:46 - Rubrik: Sportarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blog.wikimedia.de/2013/09/06/deutsche-digitale-bibliothek-cc0-api/
Information von M. Schindler.
Information von M. Schindler.
KlausGraf - am Freitag, 6. September 2013, 17:00 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Prof. Dr. Marko Demantowsky gibt bei Oldenbourg ein ambitioniertes Blogjournal Public History Weekly (auf Deutsch, Englisch soll folgen) heraus.
http://public-history-weekly.oldenbourg-verlag.de/
"Kommentare werden einmal täglich freigeschaltet (Mo-Fr)." Klar, wenn alles höchst anspruchsvoll sein soll, setzt man sich gern von den Blog-Junkies ab, die sogar am Wochenende Kommentare einigermaßen zeitnah freischalten.
http://public-history-weekly.oldenbourg-verlag.de/
"Kommentare werden einmal täglich freigeschaltet (Mo-Fr)." Klar, wenn alles höchst anspruchsvoll sein soll, setzt man sich gern von den Blog-Junkies ab, die sogar am Wochenende Kommentare einigermaßen zeitnah freischalten.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 6. September 2013, 05:02 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
http://erbloggtes.wordpress.com/2013/09/04/philosophie-erleichtert-schuldlose-verantwortung-oder-sein-konnen-wie-gott/
http://plagiatsgutachten.de/blog.php/der-fall-michel-friedman-oder-warum-dissertationsautopsie-die-interessanteste-neue-wissenschaft-ist/
Wär schön, wenn die zitierten Herrschaften in dieser schnelllebigen Welt es schaffen würden, klar und prägnant den Sachverhalt in wenigen Zeilen zusammenzufassen. Hilfreicher ist da die Printpresse:
http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/nz-themen/friedman-in-plagiatsfall-verwickelt-1.3134804
http://plagiatsgutachten.de/blog.php/der-fall-michel-friedman-oder-warum-dissertationsautopsie-die-interessanteste-neue-wissenschaft-ist/
Wär schön, wenn die zitierten Herrschaften in dieser schnelllebigen Welt es schaffen würden, klar und prägnant den Sachverhalt in wenigen Zeilen zusammenzufassen. Hilfreicher ist da die Printpresse:
http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/nz-themen/friedman-in-plagiatsfall-verwickelt-1.3134804
KlausGraf - am Freitag, 6. September 2013, 04:53 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
Via bibliothekarisch.de
KlausGraf - am Freitag, 6. September 2013, 04:50 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Jahrgänge 1, 1927 bis 14, 1940 der wichtigen Zeitschrift zur devotio moderna sind kostenlos einsehbar:
http://www.dbnl.org/tekst/_ons008onsg01_01/
Kostenpflichtig die jüngsten Jahrgänge:
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=OGE
http://www.dbnl.org/tekst/_ons008onsg01_01/
Kostenpflichtig die jüngsten Jahrgänge:
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=OGE
KlausGraf - am Freitag, 6. September 2013, 02:48 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?custom_att_2=simple_viewer&pid=4920100
Bamberg, Bibl. des Histor. Vereins in der Staatsbibl., H. V. Msc. 569 (Nr. 1789), Mitte 15. jahrhundert
Siehe http://www.handschriftencensus.de/3519
Bamberg, Bibl. des Histor. Vereins in der Staatsbibl., H. V. Msc. 569 (Nr. 1789), Mitte 15. jahrhundert
Siehe http://www.handschriftencensus.de/3519
KlausGraf - am Freitag, 6. September 2013, 02:28 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das tollste Archivale des Monats, das ich je sah:
http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bildung_schule/bildung/landesarchiv/weitere/ausstellungen/archivaledesmonats-2013/september_gruendungsgesch.htm
Das Vorarlberger Landesarchiv hat seinen Informationen ein Komplettdigitalisat der bisher ungedruckten „Cartha fundatorum“, 1519 beigegeben:
http://www.vorarlberg.at/pdf/vlaklostermehrerauhs152.pdf
Zu Mennel siehe
http://de.wikisource.org/wiki/Jakob_Mennel
Update: Ich habe auf das Stück auch hingewiesen unter
http://ordensgeschichte.hypotheses.org/6078

http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bildung_schule/bildung/landesarchiv/weitere/ausstellungen/archivaledesmonats-2013/september_gruendungsgesch.htm
Das Vorarlberger Landesarchiv hat seinen Informationen ein Komplettdigitalisat der bisher ungedruckten „Cartha fundatorum“, 1519 beigegeben:
http://www.vorarlberg.at/pdf/vlaklostermehrerauhs152.pdf
Zu Mennel siehe
http://de.wikisource.org/wiki/Jakob_Mennel
Update: Ich habe auf das Stück auch hingewiesen unter
http://ordensgeschichte.hypotheses.org/6078

KlausGraf - am Donnerstag, 5. September 2013, 15:47 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Archiverschließung und -verwaltung mit standardkonformer Software
Geschrieben für die Softwareanbieter der Archivistica 2013 ;-)
Geschrieben für die Softwareanbieter der Archivistica 2013 ;-)
Kühnel Karsten - am Donnerstag, 5. September 2013, 09:10 - Rubrik: Archivsoftware
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Mehrere hundert bisher nicht öffentlich bekannte Exponate stehen jetzt für die künftige „Grimm-Welt“ in Kassel zur Verfügung. Wissenschaftlern der Universität Kassel und der Humboldt-Universität gelang es, den Nachlass der Familie Grimm für die geplante Dauerausstellung nach Nordhessen zu holen.
Viele Kunstgegenstände, Gemälde, Zeichnungen, Fotos, Porzellan, Leinen, Silber, Möbel, Schmuck, Kleidungsstücke und Bücher erlauben es, von nahezu allen Lebensbereichen der Brüder Grimm und ihrer Familie museal zu erzählen. Diese Gegenstände aus dem Nachlass der Familie Grimm haben sich bis in unsere Zeit bei ihren Nachfahren bis hin zur Familie Wurf in Haldensleben erhalten. Gründe dafür waren der hohe symbolische Wert, den die späteren Generationen diesem Familienerbe zumaßen, die in der Familie gepflegte Sammelkultur und nicht zuletzt auch der gewohnheitsmäßige Gebrauchswert vieler Gegenstände.
„Für die Gestaltung einer neuen überregional und international wirksamen Ausstellung über die Brüder Grimm ist es ein Glücksfall, dass uns in Kassel jetzt derart vielfältige, vielgestaltige und vielfarbige Lebensdokumente aus der Kernfamilie der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm zur Verfügung stehen“, sagte Prof. Dr. Holger Ehrhardt, Inhaber der Grimm-Professur an der Universität Kassel.
Die Nachfahren Wilhelm und Dortchen Grimms sind seit über 100 Jahren in Haldensleben ansässig, einer kleinen Stadt am Mittellandkanal bei Magdeburg. Da ein Sohn der Familie nach dem Zweiten Weltkrieg in den Westen ging, kam es zu einer Teilung der verbliebenen Bestände. Erst in den letzten zehn Jahren wurde aus beiden Zweigen der Familie alles, was vom Grimm-Erbe noch vorhanden war, wieder zusammengeführt und – kurz vor dem 150. Todestag Jacob Grimms – nach Kassel gebracht.
Oberbürgermeister Bertram Hilgen freute sich über den kulturhistorisch bedeutsamen Nachlass, der nun in die Stadt Kassel kommt und schon bald in der entstehenden Grimm-Welt auf dem Weinberg zu sehen sein wird.
„Die Sammlung zeigt, dass es immer noch Neues zu den Grimms zu entdecken gibt“, sagte Hilgen. Der Kasseler Sparkasse, Prof. Dr. Holger Ehrhardt und Dr. Berthold Friemel von der Humboldt-Universität Berlin dankte er für das erfolgreiche Engagement, den Nachlass nach Kassel zu holen.
Ermöglicht hat das der Verein Brüder-Grimm-Platz e.V. Die Kasseler Sparkasse hat den Ankauf des Nachlasses der Familie Grimm mit einer Spende in Höhe von 30.000 Euro unterstützt. „Sehr gern tragen wir mit unserer Spende dazu bei, den Anspruch Kassels als Grimm-Hauptstadt zu untermauern“, sagte Ingo Buchholz, Vorstandsvorsitzender der Kasseler Sparkasse. „Wir freuen uns auf das neue Grimm-Museum!“
Info
Prof. Dr. Holger Ehrhardt
Universität Kassel
FB 2 Geistes- und Kulturwissenschaften
Fachgebiet Werk und Wirkung der Brüder Grimm
Tel.: 0561/804-7455
E-Mail: holger.ehrhardt@uni-kassel.de
"
Quelle: Universität Kassel, Pressemitteilung v. 4.9.2013
Wolf Thomas - am Mittwoch, 4. September 2013, 19:11 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Kritische Anmerkungen zur Tagung der AG Digitale Geschichtswissenschaft sowie weiterführende Überlegungen von KH Schneider:
"Für mich sind immer noch die Genealogen vorbildlich. Sie brauchen viele Daten, um Lebenswege und Biographien verfolgen zu können. Diese Daten kann ein Einzelner oder eine kleine Gruppe nie zusammen stellen, aber viele, miteinander verknüpft Arbeitende können das dann doch. Etwa mehrere Millionen Datensätze von Soldaten des Ersten Weltkriegs erfassen, damit sie anschließend von anderen ausgewertet werden können. Warum kriegen wir Wissenschaftler das nicht hin?"
http://digireg.twoday.net/stories/465680376/
"Für mich sind immer noch die Genealogen vorbildlich. Sie brauchen viele Daten, um Lebenswege und Biographien verfolgen zu können. Diese Daten kann ein Einzelner oder eine kleine Gruppe nie zusammen stellen, aber viele, miteinander verknüpft Arbeitende können das dann doch. Etwa mehrere Millionen Datensätze von Soldaten des Ersten Weltkriegs erfassen, damit sie anschließend von anderen ausgewertet werden können. Warum kriegen wir Wissenschaftler das nicht hin?"
http://digireg.twoday.net/stories/465680376/
SW - am Mittwoch, 4. September 2013, 16:44 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wir, das Stadtarchiv Limburg sind jetzt auch auf Facebook und freuen uns über jeden, der unsere Seite besucht.
https://www.facebook.com/pages/Stadtarchiv-Limburg-a-d-Lahn/341017489367680?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Stadtarchiv-Limburg-a-d-Lahn/341017489367680?fref=ts
StadtarchivLimburg - am Mittwoch, 4. September 2013, 14:39 - Rubrik: Kommunalarchive
In Leipzig wurde - wohl schon zu Beginn des Jahres - ein Archiv der queer-feministischen Zeitgeschichte gegründet. Katrin Rub und Jessica Bock erklären, warum dementsprechende Flyer und Plakate kein Altpapier sind und wo diese abgegeben werden können. Der ganze Artikel ist auf der website des feministischen Magazins "anschläge" aus Wien online und zwar genau HIER.
Bernd Hüttner - am Mittwoch, 4. September 2013, 14:16 - Rubrik: Archive von unten

"Kölner Beiträge zu einer geisteswissenschaftlichen Fachinformatik, Band 5
Hamburg 2013, 222 Seiten,
ISBN 978-3-8300-7278-2
Zum Inhalt
Das „Digitale Archiv NRW“ wurde als Projekt zur landesweiten digitalen Langzeitarchivierung durch das Land Nordrhein-Westfalen initiiert. Ziel dieser Initiative ist es, digitales kulturelles Erbe langfristig zu sichern und zugänglich zu machen. Hierfür wurde an der Professur für Historisch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung in Köln prototypisch eine funktional vollständige Softwarelösung erarbeitet, die in diesem Band sowohl konzeptuell als auch technisch dokumentiert wird.
Den Hauptbestandteil dieser „DA-NRW Software Suite“ bildet eine langfristig ausgerichtete und mehrfach redundante Speicher-Architektur. Diese unterstützt sowohl einen OAIS-konformen Workflow als auch diverse Langzeitarchivierungsstrategien. Die Lösung ermöglicht daneben die Aufbereitung und Bereitstellung der archivierten Dateien für Webportale – neben einem geplanten landesweiten Portal für das Land NRW insbesondere das Portal der Deutschen Digitalen Bibliothek und der Europeana."
Quelle: Verlagswerbung
Wolf Thomas - am Mittwoch, 4. September 2013, 10:20 - Rubrik: Digitale Unterlagen
http://www.literaturvermittlung.de/public/mails/rezbriefe.php?rid=17620#2508
Als Mitarbeiter des freien Projekts Wikisource möchte ich zu einer Bemerkung von Axel Winzer Stellung nehmen. Er schreibt: "Der Wikisource-Text transportiert nicht nur getreulich die Fehler des Originals, er fügt ihnen noch eine Reihe weiterer Fehler hinzu und entstellt den Originaltext. Für wissenschaftliches Arbeiten ist er untauglich.“ Wir wehren uns gegen diese Einschätzung unserer Arbeit. Wikisource, das als eigenständiges deutschsprachiges Projekt seit acht Jahren besteht, legt Wert auf die wissenschaftliche Verwertbarkeit seiner Texte und arbeitet mit Scans der Originale, die ein stets korrektes Zitieren der jeweiligen Vorlage ermöglichen. Für wissenschaftliches Arbeiten ist dieses Vorgehen ausgesprochen geeignet, zumal die vergleichsweise wenigen Aktiven keine absolut fehlerfreien Texte garantieren können. In der Regel werden brauchbare OCR-Texte von zwei Wikisource-Mitarbeitern korrigiert. Auch wenn große Firmen Bücher in China mehrfach abschreiben lassen, ist eine Fehlerfreiheit von 100 % kaum erreichbar. Ich bin sicher, dass auch Winzers Text irgendwo mindestens einen Fehler enthält, also weitere Fehler dem Original hinzufügt.
Das Projekt Wikisource hat kostenlos einen großartigen Service für die Grimm-Philologie ins Netz gestellt, nämlich nicht nur nur die 5. Auflage in Textform B, sondern alle großen Ausgaben von der Erstausgabe bis zur Ausgabe letzter Hand (7. Auflage), komplett als E-Text und Faksimile einsehbar: http://de.wikisource.org/wiki/Kinder_und_Hausm%C3%A4rchen
Jede Märchenfassung ist mit den anderen verknüpft, was einen sofortigen Vergleich der Änderungen ermöglicht. Keine Druckausgabe kann dies leisten.
Wer einen Transkriptions-Fehler in den Wikisource-KHM findet, darf ihn nicht nur behalten, sondern ist herzlich aufgerufen, auf der Diskussionsseite einen Hinweis zu hinterlassen, damit er verbessert werden kann.
Als Mitarbeiter des freien Projekts Wikisource möchte ich zu einer Bemerkung von Axel Winzer Stellung nehmen. Er schreibt: "Der Wikisource-Text transportiert nicht nur getreulich die Fehler des Originals, er fügt ihnen noch eine Reihe weiterer Fehler hinzu und entstellt den Originaltext. Für wissenschaftliches Arbeiten ist er untauglich.“ Wir wehren uns gegen diese Einschätzung unserer Arbeit. Wikisource, das als eigenständiges deutschsprachiges Projekt seit acht Jahren besteht, legt Wert auf die wissenschaftliche Verwertbarkeit seiner Texte und arbeitet mit Scans der Originale, die ein stets korrektes Zitieren der jeweiligen Vorlage ermöglichen. Für wissenschaftliches Arbeiten ist dieses Vorgehen ausgesprochen geeignet, zumal die vergleichsweise wenigen Aktiven keine absolut fehlerfreien Texte garantieren können. In der Regel werden brauchbare OCR-Texte von zwei Wikisource-Mitarbeitern korrigiert. Auch wenn große Firmen Bücher in China mehrfach abschreiben lassen, ist eine Fehlerfreiheit von 100 % kaum erreichbar. Ich bin sicher, dass auch Winzers Text irgendwo mindestens einen Fehler enthält, also weitere Fehler dem Original hinzufügt.
Das Projekt Wikisource hat kostenlos einen großartigen Service für die Grimm-Philologie ins Netz gestellt, nämlich nicht nur nur die 5. Auflage in Textform B, sondern alle großen Ausgaben von der Erstausgabe bis zur Ausgabe letzter Hand (7. Auflage), komplett als E-Text und Faksimile einsehbar: http://de.wikisource.org/wiki/Kinder_und_Hausm%C3%A4rchen
Jede Märchenfassung ist mit den anderen verknüpft, was einen sofortigen Vergleich der Änderungen ermöglicht. Keine Druckausgabe kann dies leisten.
Wer einen Transkriptions-Fehler in den Wikisource-KHM findet, darf ihn nicht nur behalten, sondern ist herzlich aufgerufen, auf der Diskussionsseite einen Hinweis zu hinterlassen, damit er verbessert werden kann.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ergänzend zu http://archiv.twoday.net/stories/465680396/
"Gericht: Allenfalls Abmahnung
Allenfalls eine Abmahnung oder eine Änderungskündigung wäre der rechte Weg gewesen, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Bei seiner Entscheidung hatte das Gericht die Pflichtverletzungen der Archivleiterin berücksichtigt. Die Stadt hatte ihr vorgeworfen, unerlaubt Bücher verkauft zu haben und sie daraufhin entlassen. Zudem hatte die Stadt Nehmzow vorgeworfen, nicht auf den Schimmelbefall der Bücher hingewiesen zu haben.
Nehmzow wies Vorwürfe zurück
Die Klägerin hatte sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen. Sie habe, wie auch schon ihr Vorgänger, lediglich Doubletten, also doppelt vorhandene Bücher, veräußert. Nur auf diese Weise habe das Archiv der Hansestadt Stralsund überhaupt das notwendige Geld für den Erwerb dessen erlöst, was eigentlich gesammelt werden sollte: nämlich Bücher aus Pommern, sogenannte Pommerania.
Posten schon an jemanden anderen vergeben
Nach Ansicht des Gerichts ist niemand ohne Fehler gewesen. Die Archivleiterin sei von der Stadt alleingelassen worden. Sie habe in bester Absicht gehandelt. Gegen Nehmzow hatte die Stadt zwischenzeitlich Strafanzeige gestellt und ihren Posten bereits an jemand anderen vergeben. Der sollte eigentlich Anfang November als neuer Direktor des Stralsunder Stadtarchives vorgestellt werden. Die Stadt kann gegen das Urteil Berufung einlegen."
http://www.ndr.de/regional/mecklenburg-vorpommern/archivstralsund101.html
Dieses erwartbare Urteil bestätigt meine Einschätzung, dass die fristlose Kündigung unangemessen war:
http://archiv.twoday.net/stories/219049894/
http://archiv.twoday.net/search?q=nehmzow
Nehmzow hat sehr schwere Schuld auf sich geladen. Sie hat eklatant gegen archivfachliche Standards verstoßen, indem sie nicht frühzeitig auf den Schimmelbefall entschieden reagierte und indem sie Kulturgut in ungeheuerlicher Weise veräußerte. Sie hat der Stadt Stralsund in so hohem Maße geschadet, dass sie ihren Posten als Archivleiterin verlieren musste. Eine Änderungskündigung unter Weiterbeschäftigung an einem Arbeitsplatz, wo sie keinen solchen Schaden mehr anrichten kann, wäre vertretbar gewesen.
Frau Nehmzow hat keine Archivausbildung und ist eine Schande für unsere Zunft. Sie begreift immer noch nicht, dass ihr Dublettenargument völliger Unsinn ist, da durch handschriftliche Beigaben oder andere Eigenheiten die verkauften Werke eben keine Dubletten sind. Ausdrücklich heißt es in einer Pressemeldung über rückgekaufte Bestände:
Ebenso wie die Bayrische Staatsbibliothek dafür sorgte, dass ein ganz besonderes Unikat wieder in die alte Heimat durfte: der so genannte Türkendruck. „Davon gibt es tatsächlich nur dieses eine Exemplar auf der Welt“, betont Kunkel.
http://kulturgut.hypotheses.org/253
Schon allein dieses wertvolle Stück überführt Nehmzow der LÜGE. Und wenn ich nicht durch die exorbitant hohen Prozesskosten meiner Auskunftsklage, die ich fast alleine tragen muss, weil die lieben Mitstreiter nur wenig beisteuern, abgeschreckt wäre, würde ich prüfen lassen, ob man die Verantwortlichen der Stadt Stralsund wegen Prozessbetrugs anzeigen kann, denn die Aussage von Kunkel ist offenkundig die Antwort auf eine von mir gestellte Frage, die zu beantworten die Stadt Stralsund sich im Prozess geweigert hatte.
http://archiv.twoday.net/stories/224317873/ (Frage 9)
"Gericht: Allenfalls Abmahnung
Allenfalls eine Abmahnung oder eine Änderungskündigung wäre der rechte Weg gewesen, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Bei seiner Entscheidung hatte das Gericht die Pflichtverletzungen der Archivleiterin berücksichtigt. Die Stadt hatte ihr vorgeworfen, unerlaubt Bücher verkauft zu haben und sie daraufhin entlassen. Zudem hatte die Stadt Nehmzow vorgeworfen, nicht auf den Schimmelbefall der Bücher hingewiesen zu haben.
Nehmzow wies Vorwürfe zurück
Die Klägerin hatte sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen. Sie habe, wie auch schon ihr Vorgänger, lediglich Doubletten, also doppelt vorhandene Bücher, veräußert. Nur auf diese Weise habe das Archiv der Hansestadt Stralsund überhaupt das notwendige Geld für den Erwerb dessen erlöst, was eigentlich gesammelt werden sollte: nämlich Bücher aus Pommern, sogenannte Pommerania.
Posten schon an jemanden anderen vergeben
Nach Ansicht des Gerichts ist niemand ohne Fehler gewesen. Die Archivleiterin sei von der Stadt alleingelassen worden. Sie habe in bester Absicht gehandelt. Gegen Nehmzow hatte die Stadt zwischenzeitlich Strafanzeige gestellt und ihren Posten bereits an jemand anderen vergeben. Der sollte eigentlich Anfang November als neuer Direktor des Stralsunder Stadtarchives vorgestellt werden. Die Stadt kann gegen das Urteil Berufung einlegen."
http://www.ndr.de/regional/mecklenburg-vorpommern/archivstralsund101.html
Dieses erwartbare Urteil bestätigt meine Einschätzung, dass die fristlose Kündigung unangemessen war:
http://archiv.twoday.net/stories/219049894/
http://archiv.twoday.net/search?q=nehmzow
Nehmzow hat sehr schwere Schuld auf sich geladen. Sie hat eklatant gegen archivfachliche Standards verstoßen, indem sie nicht frühzeitig auf den Schimmelbefall entschieden reagierte und indem sie Kulturgut in ungeheuerlicher Weise veräußerte. Sie hat der Stadt Stralsund in so hohem Maße geschadet, dass sie ihren Posten als Archivleiterin verlieren musste. Eine Änderungskündigung unter Weiterbeschäftigung an einem Arbeitsplatz, wo sie keinen solchen Schaden mehr anrichten kann, wäre vertretbar gewesen.
Frau Nehmzow hat keine Archivausbildung und ist eine Schande für unsere Zunft. Sie begreift immer noch nicht, dass ihr Dublettenargument völliger Unsinn ist, da durch handschriftliche Beigaben oder andere Eigenheiten die verkauften Werke eben keine Dubletten sind. Ausdrücklich heißt es in einer Pressemeldung über rückgekaufte Bestände:
Ebenso wie die Bayrische Staatsbibliothek dafür sorgte, dass ein ganz besonderes Unikat wieder in die alte Heimat durfte: der so genannte Türkendruck. „Davon gibt es tatsächlich nur dieses eine Exemplar auf der Welt“, betont Kunkel.
http://kulturgut.hypotheses.org/253
Schon allein dieses wertvolle Stück überführt Nehmzow der LÜGE. Und wenn ich nicht durch die exorbitant hohen Prozesskosten meiner Auskunftsklage, die ich fast alleine tragen muss, weil die lieben Mitstreiter nur wenig beisteuern, abgeschreckt wäre, würde ich prüfen lassen, ob man die Verantwortlichen der Stadt Stralsund wegen Prozessbetrugs anzeigen kann, denn die Aussage von Kunkel ist offenkundig die Antwort auf eine von mir gestellte Frage, die zu beantworten die Stadt Stralsund sich im Prozess geweigert hatte.
http://archiv.twoday.net/stories/224317873/ (Frage 9)
Das Arbeitsgericht Stralsund hat am Dienstag der Kündigungsschutzklage der Stadtarchivarin stattgegeben.
Damit ist die fristlose Kündigung seitens der Direktorin des Stadtarchives vom Dezember 2012 unwirksam, berichtete NDR 1 Radio MV. Allenfalls eine Abmahnung oder eine Änderungskündigung wäre
rechtens gewesen, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung.
Die Stadt hatte der Frau vorgeworfen, unerlaubt Bücher verkauft zu haben und sie daraufhin entlassen.
Quelle: NDR Videotext, S. 157 (3.9.2013)
Mehr Info: http://www.ndr.de/regional/mecklenburg-vorpommern/archivstralsund101.html
Damit ist die fristlose Kündigung seitens der Direktorin des Stadtarchives vom Dezember 2012 unwirksam, berichtete NDR 1 Radio MV. Allenfalls eine Abmahnung oder eine Änderungskündigung wäre
rechtens gewesen, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung.
Die Stadt hatte der Frau vorgeworfen, unerlaubt Bücher verkauft zu haben und sie daraufhin entlassen.
Quelle: NDR Videotext, S. 157 (3.9.2013)
Mehr Info: http://www.ndr.de/regional/mecklenburg-vorpommern/archivstralsund101.html
Wolf Thomas - am Dienstag, 3. September 2013, 19:14 - Rubrik: Archivrecht
https://www.change.org/de/Petitionen/stadt-aachen-landschaftsverband-rheinland-lousberg-h%C3%B6fe-gmbh-der-hochbunker-f%C3%B6rsterstr-in-aachen-soll-nicht-f%C3%BCr-stadtwohnungen-weichen#
Der Hochbunker an der Rütscherstr/Försterstr in Aachen, in der am 21. Oktober 1944 der letzte Wehrmachtskommandant in der Kaiserstadt kapitulierte, soll abgerissen werden. Die Begründung der Bezirksregierung Köln: „Aufgrund der umfangreichen Umbauten ist die Aussagekraft verloren gegangen.“
Dabei zeugt allein schon die kahle schroffe Betonhülle mit seinen tiefen Einschlagskratern von der Gewalt und Zerstörung, die mit der Vertreibung der nationalsozialistischen Diktatur einher ging. Jedem Passant, ob alt oder jung, fällt dieser Betonklotz mit seinen Schäden irgendwann auf, und er stellt die unangenehme Frage: "Was ist hier passiert?" Und eine mögliche Antwort lautet: "Hier endete die Diktatur und fing die Freiheit an."

Der Hochbunker an der Rütscherstr/Försterstr in Aachen, in der am 21. Oktober 1944 der letzte Wehrmachtskommandant in der Kaiserstadt kapitulierte, soll abgerissen werden. Die Begründung der Bezirksregierung Köln: „Aufgrund der umfangreichen Umbauten ist die Aussagekraft verloren gegangen.“
Dabei zeugt allein schon die kahle schroffe Betonhülle mit seinen tiefen Einschlagskratern von der Gewalt und Zerstörung, die mit der Vertreibung der nationalsozialistischen Diktatur einher ging. Jedem Passant, ob alt oder jung, fällt dieser Betonklotz mit seinen Schäden irgendwann auf, und er stellt die unangenehme Frage: "Was ist hier passiert?" Und eine mögliche Antwort lautet: "Hier endete die Diktatur und fing die Freiheit an."

http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015011813147
Ich hatte angeregt, dieses 1918 erschienene Werk für US-Leser zugänglich zu machen (und hätte dann veranlasst, dass es eine treue Helferin ins Internet Archive bringt), aber HathiTrust hat freundlicherweise das in den USA gemeinfreie gute Stück weltweit geöffnet. Danke!
Ich hatte angeregt, dieses 1918 erschienene Werk für US-Leser zugänglich zu machen (und hätte dann veranlasst, dass es eine treue Helferin ins Internet Archive bringt), aber HathiTrust hat freundlicherweise das in den USA gemeinfreie gute Stück weltweit geöffnet. Danke!
KlausGraf - am Dienstag, 3. September 2013, 18:29 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Dietrich Hakelberg hat seinen Aufsatz (2010) zum Breslauer Arzt und Sammler Johann Christian Kundmann (1684–1751) online gestellt:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/9160/
"Das Interesse Kundmanns an ausgegrabenen Dingen, Fossilien und archäologischen Funden, lässt sich durch den empirischen Ansatz in der frühneuzeitlichen Medizin und Naturgeschichte erklären, der peniblen Beobachtung und Beschreibung aussergewöhnlicher Naturerscheinungen." Merke: Auch Hiegell war Arzt:
http://archiv.twoday.net/stories/453145069/

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/9160/
"Das Interesse Kundmanns an ausgegrabenen Dingen, Fossilien und archäologischen Funden, lässt sich durch den empirischen Ansatz in der frühneuzeitlichen Medizin und Naturgeschichte erklären, der peniblen Beobachtung und Beschreibung aussergewöhnlicher Naturerscheinungen." Merke: Auch Hiegell war Arzt:
http://archiv.twoday.net/stories/453145069/
KlausGraf - am Dienstag, 3. September 2013, 17:16 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Stellt Mareike König klar:
http://redaktionsblog.hypotheses.org/1579
Ich gehöre bekanntlich der Redaktion an.
http://redaktionsblog.hypotheses.org/1579
Ich gehöre bekanntlich der Redaktion an.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Update zu: http://archiv.twoday.net/stories/444868249/
Bei Openjur ist noch nichts online, daher hier nach ZUM 2012, 574 ff. der Volltext vom Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 27. März 2012 – 11 U 66/11.
I. Die Klägerin macht Ansprüche wegen behaupteter Urheberrechtsverletzung an einem wissenschaftlichen Werk geltend.
Die Klägerin hat eine im Jahre 2006 veröffentlichte Habilitationsschrift mit dem Titel »Deutsch als internationale Wissenschaftssprache …« verfasst. Der Text der Arbeit umfasst (ohne Vorwort und Literaturverzeichnis) rund 425 Seiten; sie gliedert sich in die Abschnitte
I. Im Vorfeld des Boykotts
II. Der Boykott
III. Gegenaktionen
IV. Verhandlungen
V. Auswirkungen
Der Beklagte zu 2) hat im Jahre 2010 im Verlag der Beklagten zu 1) ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Die Macht der Sprache …«; der Text umfasst 106 Seiten. Auf Seite 33 beginnt das Kapitel »Deutsch als internationale Wissenschaftssprache«, auf Seite 43 das Folgekapitel »Der Erste Weltkrieg, der Wissenschafts- und Sprachboykott«. Bei beiden Kapiteln wird als Fußnote zur Kapitelüberschrift auf das Werk der Klägerin verwiesen. Das nächste Kapitel, »Die Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg«, beginnt auf Seite 70.
In den beiden Kapiteln »Deutsch als internationale Wissenschaftssprache« und »Der Erste Weltkrieg, der Wissenschafts- und Sprachboykott« sowie auf den ersten Seiten des nachfolgenden Kapitels finden sich zahlreiche Passagen, die Ähnlichkeiten mit Passagen aus dem Werk der Klägerin aufweisen.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Zur Begründung hat es ausgeführt, es komme nicht darauf an, ob das Buch der Klägerin in seiner Gesamtheit ein geschütztes Werk darstelle, da der Beklagte nicht das gesamte Buch übernommen habe.
Ob die jeweiligen Werkteile, auf die sich die Klägerin berufe, ihrerseits die nötige Schöpfungshöhe aufwiesen, könne dahinstehen, weil jedenfalls die Änderungen des Beklagten zu 2) weit genug seien, um aus dem engen Schutzbereich, auf den sich die Klägerin allenfalls berufen könne, hinauszuführen. Anhand zweier beanstandeter Textpassagen legt das Landgericht dar, dass die jeweilige wissenschaftliche Erkenntnis nicht urheberrechtsschutzfähig sei. Bezüglich der Formulierungen sei zweifelhaft, ob ihr die für den Urheberrechtsschutz notwendige Schöpfungshöhe zukomme; im Übrigen weise der Text des Beklagten Eigenarten auf, die nicht mit der des Textes der Klägerin übereinstimmten.
Auch hinsichtlich der Gliederung des streitgegenständlichen Buches könne keine Unterlassung begehrt werden. Diese orientiere sich am Gang der historischen Ereignisse und weise allenfalls eine geringe Schöpfungshöhe auf. Auch hier habe der Beklagte zu 2) im Übrigen ausreichende Änderungen vorgenommen.
Gegen das ihr am 16.5.2011 zugestellte Urteil hat die Klägerin am 30.5.2011 Berufung eingelegt und diese innerhalb verlängerter Frist am 8.8.2011 begründet.
Mit der Berufung verfolgt die Klägerin ihre erstinstanzlichen Anträge weiter, unter leichter Modifizierung des Wortlauts des Unterlassungsantrages und ergänzt um Hilfsanträge. Sie stellt klar, dass sie nicht die Übernahme einzelner Teile aus ihrem Werk beanstande, sondern dass der Beklagte zu 2) ihr gesamtes Werk benutzt habe. Ein knappes Drittel der Schrift des Beklagten zu 2) sei eine unzulässige Bearbeitung ihres Werkes i. S. d. § URHG § 23 UrhG.
Ihr Werk sei ein wissenschaftliches Sprachwerk i. S. d. § URHG § 2 Abs. URHG § 2 Absatz 1 Nr. 1 UrhG. Sie habe als Erste das sprach- und wissenschaftshistorische Thema erkannt; sie habe mit ihrer Studie ein neues Forschungsfeld eröffnet, mit neuen Fragestellungen, Gedanken und Argumentationssträngen. Sie habe als Erste die Sammlung, Auswahl, Auswertung, Anordnung und Darstellung bis dahin weitgehend unbekannten umfangreichen wissenschaftlichen Materials und die gedankliche Durchdringung des komplexen Stoffes vorgenommen sowie die Gliederung und sprachliche Darstellung entsprechend gestaltet. Sie habe dadurch ein »Gewebe« geschaffen, das ihrem Werk die für die Urheberrechtsfähigkeit erforderliche individuelle Prägung gebe. Der Beklagte zu 2) habe komplett den Denkansatz, die Themenstellung, den wesentlichen Inhalt und Begründungszusammenhang, die Gedankenführung und Gestaltung, den Aufbau und die Gliederung, die Auswahl der Beispiele und der Zitate sowie die wissenschaftlichen Ergebnisse und Schlussfolgerungen einschließlich der sprachlichen Darstellung übernommen.
Die Klägerin beantragt,
1. a) die Beklagte zu 1) zu verurteilen, es bei Meidung der Ordnungsmittel des § ZPO § 890 ZPO zu unterlassen, das in ihrem Verlag erscheinende Buch des Beklagten zu 2) »Die Macht der Sprache …« (ISBN …) zu verbreiten, sofern es den gesamten unter lit. c) aufgeführten Text enthält; hilfsweise
… sofern es den unter lit. c) aufgeführten Text ganz oder in Teilen ohne Kennzeichnung als Zitat aus dem Werk der Klägerin »Deutsch als internationale Wissenschaftssprache …« enthält,
b) den Beklagten zu 2) zu verurteilen, es bei Meidung der Ordnungsmittel des § ZPO § 890 ZPO zu unterlassen, in seinem Buch »Die Macht der Sprache …« den gesamten unter lit. c) aufgeführten Text zu vervielfältigen und zu verbreiten, hilfsweise,
… den unter lit. c) aufgeführten Text ganz oder in Teilen ohne Kennzeichnung als Zitat aus dem Werk der Klägerin »Deutsch als Internationale Wissenschaftssprache …« zu vervielfältigen und zu verbreiten.
c) (Die Seitenangaben beziehen sich auf »Die Macht der Sprache …« in der 1. Aufl. von …)(hier nur Beispiele für den auszugsweisen Abdruck wörtlicher Passagen im Klageantrag; Anm. d. Red.)
»S. 32:
Auf dem internationalen Historikerkongress 1908 in Berlin waren Vorträge zugelassen in Deutsch als der Sprache der Gastgeber, in Englisch, Französisch, Italienisch sowie in Latein. …
S. 33:
… Als Mittel zur Verständigung dienten neben persönlichen Schreiben und Besuchen im 19. Jahrhundert in zunehmendem Maße der Austausch von Schriften und Publikationen, die Erfassung der wissenschaftlichen Publikationen in Referatenzeitschriften sowie die Arbeit in wissenschaftlichen Vereinigungen und der Besuch von Konferenzen.
S. 33–34:
Anhand der Astronomie, die mit anderen Wissenschaften von der Mathematik bis zur Physik eng verbunden ist und im 19. Jahrhundert zu den führenden Wissenschaften gehörte, zeigt sich einerseits die Internationalität der Forschung, andererseits aber auch die Problematik der Wissenschaftssprache in sehr anschaulicher Weise. Die erfolgreichste Fachzeitschrift dieses Gebietes waren die 1821 in Altona bei Hamburg von Heinrich Christian Schumacher, Professor der Astronomie in Kopenhagen und Mitglied akademischer Gesellschaften in Kopenhagen, London, Edinburgh und Neapel, herausgegebenen Astronomischen Nachrichten. Bezüglich der Beiträge äußerte sich der Herausgeber im ersten Heft: ›Ich lasse die Beiträge der verschiedenen Herrn Verfasser so, sowie ich sie von ihnen erhalte … Was in englischer, französischer oder lateinischer Sprache mir zugesandt wird, erscheint im Original‹. Das hohe Ansehen [S. 576] des Herausgebers, seine unermüdliche Arbeit für seine Zeitschrift, sicherlich nicht zuletzt seine tolerant praktizierte Sprachregelung bewirkten, dass in der im 19. Jahrhundert langzeitig renommiertesten astronomischen Fachzeitschrift, den Astronomischen Nachrichten, alle bedeutenden Astronomen ihre Aufsätze publizierten. Die Analyse von rund 21 000 Beiträgen in dieser Zeitschrift aus dem Zeitraum von 1821 bis 1920 zeigt, dass 40 bis 60 % der Beiträge aus Deutschland kamen, jedoch 60 bis 83% in deutscher Sprache abgefasst waren. 4 bis 12 % der Beiträge kamen aus England, bis 18 % aus den USA, während in englischer Sprache von meistens englisch sprechenden Autoren 5 bis 25 % der Beiträge abgefasst waren; aus Frankreich kamen 2 bis 9 % der Beiträge, in Französisch abgefasst waren 5 bis 15 % der Beiträge. Die entsprechenden Zahlen für Italien bzw. Italienisch sind 3 bis 11 % bzw. 0 bis 10 %. Aus Russland kamen bis 9 % der Beiträge, deren Autoren sich des Französischen, aber auch des Deutschen als Publikationssprache bedienten.
S. 35–36:
Anders als die auf der persönlichen Mitgliedschaft einzelner Wissenschaftler beruhende Astronomische Gesellschaft kam die wissenschaftliche Institution, die sich mit der Landvermessung befasste, als internationale Vereinigung von Staaten zustande. Gegründet 1862 auf Initiative Preußens als ›Mitteleuropäische Gradmessung‹, 1867 umbenannt in ›Europäische Gradmessung‹ und 1886 wiederum umbenannt in »Internationale Erdmessung« hatte sie unter den 13 Gründungsmitgliedern sieben deutsche Staaten. Maßgebend für die Bedeutung dieser Institution, die von Preußen nicht nur initiiert, sondern auch stark subventioniert wurde, waren wissenschaftliche, wirtschaftliche und nicht zuletzt auch militärische Interessen. Das Zentralbüro dieser Institution befand sich in Berlin. Die Dominanz preußischer bzw. deutscher Interessen wurde 1869 durch die Gründung des Königlich Preußischen Geodätischen Instituts in Berlin und die Personalunion der Leitung dieses Instituts und des Zentralbüros gefestigt mit dem Ziel, … Obwohl Frankreich erst 1871 der Europäischen Gradmessung beitrat, war der offizielle Status der französischen Sprache in ihr bedingt durch die führende Stellung der französischen Geodäsie im 18. Jahrhundert sowie des Französischen als damalige Sprache der Wissenschaft und der Diplomatie. Mit dem Beitritt der USA 1889 und Großbritanniens 1898 war es für die Vertreter dieser anglophonen Länder eine Selbstverständlichkeit, dass sie sich innerhalb dieser Organisation sowohl mündlich als auch schriftlich ihrer eigenen Muttersprache bedienten. Entscheidungen über die 1916, während des Ersten Weltkrieges auslaufende Konvention sollten zwei Jahre nach dem Ende des Krieges getroffen werden.
S. 36–37:
Der deutsche Geograph Georg Gerland, 1875 auf den Lehrstuhl für Geographie der Universität Straßburg berufen und seit 1887 Herausgeber der Beiträge zur Geophysik, griff die ›Vorschläge zur Errichtung eines Systems von Erdbeben-Stationen‹ verbunden mit einer ›Centralstelle für die Sammlung und Publication von Erdbebennachrichten aus der ganzen Welt‹ auf und initiierte durch seine Bemühungen den Bau der »Kaiserlichen Hauptstation für Erdbebenforschung« in Straßburg. Gerland schwebte vor, eine Organisation ähnlich der Internationalen Erdmessung mit einem Zentralbüro in Straßburg zu errichten. Nachdem die deutsche Regierung Verhandlungen mit den anderen Staaten aufgenommen hatte, wurde 1903 auf der 2. Internationalen Seismologischen Konferenz, die Gerland wie die vorhergehende in Straßburg durchführte, die Gründung der Internationalen Seismologischen Assoziation festgelegt, wobei die deutsche sowie die Straßburger Dominanz nach den Vorstellungen von Gerland weitgehend festgeschrieben wurde. Gegen die Festschreibung von Straßburg als Sitz des Zentralbüros und die damit verbundene Dominanz Deutschlands regte sich in Großbritannien, Frankreich und Italien Widerspruch, der dazu führte, dass die 1903 getroffene ›Übereinkunft‹ durch eine Kommission unter der Leitung des britischen Geophysikers Arthur Schuster überarbeitet wurde. Unter Berücksichtigung der revidierten Fassung der Übereinkunft wurde 1905 in Berlin die Internationale Seismologische Assoziation gegründet. Ohne dass es in den Statuten festgelegt war, dominierte die deutsche Sprache in dieser Organisation infolge der deutschen Initiativen und der Anzahl der deutschen Teilnehmer. Wurden die Verhandlungsberichte anfangs in deutscher und französischer Sprache publiziert, so wurde schon 1906 festgelegt, dass die französische die authentische Fassung sein sollte. Unter der Präsidentschaft des britischen Geophysikers Schuster wurde 1909 ›aus Kostengründen‹ auf die deutschsprachige Fassung der Verhandlungsberichte verzichtet.
S. 42:
Da die Wissenschaftler über die Universitäten und die nationalen Wissenschaftsorganisationen direkt oder indirekt in die nationale Wissenschaftspolitik eingebunden waren, machten sich in zunehmendem Maße aber auch nationale Rivalitäten zwischen Deutsch, Englisch und Französisch bemerkbar. Der Verzicht auf die deutschsprachige Fassung der Verhandlungsberichte der Internationalen Seismologischen Assoziation unter der Präsidentschaft des britischen Geophysikers Schuster 1909 ›aus Kostengründen‹ dürfte dafür ein charakteristisches Beispiel sein. …
S. 52–53:
Im Ausland, dem nationalistische und chauvinistische Ambitionen wie gezeigt natürlich ebenfalls nicht fremd waren, stießen die beiden deutschen Dokumente auf Empörung. Hervorzuheben ist die Reaktion des britischen Chemikers William Ramsay, einst Student in Gießen bei Liebig, Mitglied renommierter Akademien und Nobelpreisträger von 1904, welcher forderte, dass die alliierten Kriegsgegner des Deutschen Reiches den ›teutonischen Despotismus‹ als ein Krebsgeschwür in der Moral der deutschen Nation ein für allemal vernichten sollten. Nicht als nachahmenswert sah er das Verhalten einiger deutscher Universitätslehrer an, welche die ihnen verliehenen Auszeichnungen aus England zurückgegeben haben. Seine von Ressentiments getragenen Betrachtungen, nach denen auf die von ihm in Frage gestellten wissenschaftlichen Leistungen Deutschlands – mit Ausnahme von herausragenden Leistungen einzelner deutscher Gelehrter – abgesehen werden könne …«
2. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, durch ihren Geschäftsführer an Eides statt die Richtigkeit ihrer Auskunft zu versichern, die erste Auflage von »Die Macht der Sprache …« von … sei in einer Auflage von nicht mehr als 55 Exemplaren hergestellt worden;
3. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an die Klägerin 1.023,16 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
Die Beklagten beantragen, die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigen das angefochtene Urteil. Der Beklagte zu 2) ist der Auffassung, der Antrag der Klägerin ziele darauf ab, ihm die Beschäftigung mit der von ihr behandelten Epoche gänzlich zu untersagen.
II. Die Berufung ist zulässig, insbesondere fristgerecht eingelegt und begründet worden. Sie hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.
A. Die Hauptanträge zu 1. sind unbegründet. Die Klägerin kann von den Beklagten nicht nach § URHG § 97 Abs. URHG § 97 Absatz 1 UrhG Unterlassung der Verbreitung bzw. Vervielfältigung des beanstandeten Textes verlangen. [S. 577]
1. Im Ergebnis zutreffend geht die Klägerin davon aus, dass es sich bei ihrem Werk um ein urheberrechtlich geschütztes Sprachwerk i. S. d. § URHG § 2 Abs. URHG § 2 Absatz 1 Nr. 1 UrhG handelt.
a) Bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit von wissenschaftlichen Werken besteht in Rechtsprechung und Schrifttum Einigkeit, dass die wissenschaftliche Lehre und das wissenschaftliche Ergebnis frei und jedermann zugänglich ist (BGH GRUR 1981, GRUR Jahr 1981 Seite 352, GRUR Jahr 1981 Seite 353 – Staatsexamensarbeit; GRUR 1991, GRUR Jahr 1991 Seite 130, GRUR Jahr 1991 Seite 132 – Themenkatalog; Senat ZUM-RD 2003, ZUM-RD Jahr 2003 Seite 532; Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 3. Aufl., § 62 Rn. 61; Dreier/Schulze, 3. Aufl., § 2 UrhG Rn. 93).
Der Inhalt der Arbeit der Klägerin ist daher nicht per se schutzfähig; dies gilt erst recht, soweit es sich dabei um die Wiedergabe historischer Tatsachen handelt, wie dies bei den … wiedergegebenen Ausschnitten ihres Werkes weit überwiegend der Fall ist. Darauf, ob solche historischen Tatsachen bis zur Veröffentlichung durch die Klägerin bekannt waren, kommt es nicht an. Das bloße Auffinden von nicht allgemein zugänglichen Informationen ist keine persönliche geistige Schöpfung. Damit hat der Beklagte allein dadurch, dass er dieselben Tatsachen wiedergibt wie die Klägerin, kein Urheberrecht verletzt.
Soweit die Klägerin darauf abhebt, dass in Fachkreisen u. a. die »wissenschaftsgeschichtliche und sprachenpolitische Bedeutung, der Fakten- und Materialreichtum, die sorgfältige Analyse« ihres Werks gelobt werde und hierfür entsprechende Belege anführt, ist darauf hinzuweisen, dass das Thema als solches der Wissenschaftsfreiheit unterfällt und dass auch »Fakten- und Materialreichtum« per se nichts mit einer »persönlichen geistigen Schöpfung« i. S. d. § URHG § 2 Abs. URHG § 2 Absatz 2 UrhG zu tun hat. Das Urheberrecht schützt nicht die Arbeitsleistung als solche, sondern allein die kreative Tätigkeit; maßgeblich ist nicht der Aufwand, sondern das Ergebnis (Dreier/Schulze, aaO., § 2 Rn. 53, 54).
b) Schutzfähig kann jedoch die Sammlung, Auswahl, Einteilung und Anordnung vorhandenen Stoffes sein (BGH GRUR 1980, GRUR Jahr 1980 Seite 227 – Monumenta Germaniae Historica; GRUR 1981, GRUR Jahr 1981 Seite 520 – Fragensammlung), ebenso wie die von der Gedankenführung geprägte Gestaltung der Sprache (BGH ZUM-RD 1997 ZUM-RD Jahr 1997 Seite 329 – CB-Infobank I; ZUM 2011, ZUM Jahr 2011 Seite 151 – Perlentaucher), wobei die Schutzfähigkeit der konkreten Darstellung dort ihre Grenze findet, wo sie aus wissenschaftlichen Gründen geboten oder in dem behandelten Gebiet weithin üblich ist (BGH GRUR 1981, GRUR Jahr 1981 Seite 352, GRUR Jahr 1981 Seite 355 – Staatsexamensarbeit).
Nach diesen Kriterien ist hier die Schutzfähigkeit zu bejahen.
Die Klägerin hat eine bestimmte Reihenfolge der Darstellung gewählt. Sie hat im ersten Abschnitt »Im Vorfeld des Boykotts« zunächst »Die Macht der deutschen Sprache« vor dem ersten Weltkrieg dargestellt. Darin werden nach allgemeinen Darstellungen zur Wissenschaftssprache im 19. Jahrhundert in jeweils eigenen Unterkapiteln zunächst zwei fachübergreifende Projekte behandelt, nämlich der »International Catalogue of Scientific Literature« und die »Internationale Assoziation der Akademien«, und anschließend bestimmte Fachgebiete ausführlich untersucht, nämlich die Astronomie, die Erdmessung, die Seismologie, die Geographie und die Tuberkulosebekämpfung. Das zweite Kapitel des ersten Abschnitts beschäftigt sich mit »Ansichten zum Krieg und zur deutschen Megalomanie« und behandelt auslandsfeindliche Aktionen deutscher Wissenschaftler nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges und die entsprechenden Reaktionen des Auslandes, insbesondere England und Frankreich. Das dritte Kapitel behandelt »Deutsche Fachliteratur im Krieg«.
Der zweite Abschnitt trägt die Überschrift »Der Boykott« und behandelt die verschiedenen Maßnahmen ab 1915, die zu einer Verdrängung des Deutschen führten, mit den Kapiteln »Die Institutionalisierung des Boykotts«, »Kritik, Ächtung und Verdrängung des Deutschen als internationale Publikationssprache der Wissenschaft« und »Die Ausschaltung des Deutschen als internationale Kongresssprache«.
Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit »Gegenaktionen« gegen den Boykott sowohl von Seiten mancher ausländischer Institutionen und Wissenschaftler als auch (und insbesondere) in Deutschland, in Form von »1. Protesten gegen den Boykott«, »2. Gegenveranstaltungen und -organisationen«, »3, Rettungsaktion für die deutschen Referatenorgane« und »4. Gegenboykott«.
Der vierte Abschnitt ist überschrieben mit »Verhandlungen« und beschäftigt sich mit verschiedenen Wissenschaftsorganisationen in den 1920er Jahren, namentlich »1. Conseil international de recherches«, »2. Union académique internationale«, »3. Union astronomique internationale«, »4. Union géodésique et géophysique internationale« und »5. Union internationale de la Chimie pure et appliquée«.
Im fünften Abschnitt »Auswirkungen« werden die Folgen der bislang dargestellten Entwicklung beschrieben, in den Kapiteln »Die Dominanz der französischen und englischen Sprache und der Rückgang des Deutschen« sowie »Nationale Repräsentation, Weltgeltung und Sprachpolitik«.
Die Klägerin hat auch bestimmte Schwerpunkte gesetzt. Sie hat beispielsweise einzelnen Fachgebieten eigene Unterkapitel gewidmet, andere nur erwähnt; sie hat einzelne Erklärungen und Stellungnahmen wörtlich abgedruckt, andere nur inhaltlich wiedergegeben. Sie hat bestimmte Fakten miteinander verknüpft, ausgewertet und Schlussfolgerungen gezogen.
Auch hat sie ihrem Werk eine bestimmte sprachliche Gestaltung gegeben.
2. a) Liegt somit ein urheberrechtlich geschütztes Werk der Klägerin vor, so hängt die Frage der Verletzung dieses Urheberrechts davon ab, ob es sich bei dem Werk des Beklagten um eine freie Benutzung i. S. d. § URHG § 24 UrhG oder um eine abhängige Bearbeitung i. S. d. § URHG § 23 UrhG handelt.
Bei der Beurteilung, ob eine (unfreie) Bearbeitung vorliegt, kommt es entscheidend auf den Abstand an, den das neue Werk zu den entlehnten eigenpersönlichen Zügen des benutzten Werkes hält. Eine freie Benutzung setzt voraus, dass angesichts der Eigenart des neuen Werkes die entlehnten eigenpersönlichen Züge des benutzten Werks verblassen (BGH ZUM 2011, ZUM Jahr 2011 Seite 151 – Perlentaucher; ZUM 1999, ZUM Jahr 1999 Seite 644 – Laras Tochter). Dabei ist zunächst durch Vergleich zu ermitteln, ob und ggf. in welchem Umfang eigenschöpferische Züge des älteren Werks übernommen worden sind (BGH ZUM 2004, ZUM Jahr 2004 Seite 748 – Hundefigur).
b) Die sprachliche Gestaltung des Werks des Beklagten zu 2) hält einen ausreichenden Abstand zum Werk der Klägerin.
Zwar ist die sprachliche Darstellung des Gesamtwerkes sowie einzelner selbstständiger Teile hieraus grundsätzlich ebenfalls urheberrechtsfähig. Dem Beklagten zu 2) wäre es daher verwehrt, etwa ein gesamtes Kapitel oder längere Passagen wortwörtlich zu übernehmen. Dies hat er jedoch unstreitig nicht getan.
Ähnlichkeiten in der Darstellung führen im vorliegenden Fall nicht dazu, dass das gesamte Werk des Beklagten (oder jedenfalls die auf das Werk der Klägerin Bezug nehmenden Teile) als nicht eigenständig erscheinen würde. Es wurde kein besonderer »Schreibstil« der Klägerin übernommen, sondern der Beklagte zu 2) verwendet lediglich an einzelnen Stellen ähnliche Formulierungen, die aber im Hinblick darauf, dass beide Parteien eine gut verständliche »Allgemeinsprache« benutzen, keinen konkreten Bezug zum Werk der Klägerin mehr erkennen lassen, soweit es sich nicht um ohnehin durch die Sache gebotene Fachbegriffe handelt.
Der Beklagte zu 2) hat auch in den konkret beanstandeten Textpassagen keine Formulierungen der Klägerin übernommen, die als solche besonders aussagekräftig oder originell [S. 578] erscheinen und deshalb eine schöpferische Eigenart begründen (vgl. BGH ZUM 2011, ZUM Jahr 2011 Seite 151 Rn. ZUM Seite 151 Randnummer 37, ZUM Seite 151 Randnummer 39 – Perlentaucher). Soweit originelle Formulierungen und Begriffe übernommen wurden, handelt es sich ersichtlich um Zitate Dritter (z. B. S. 52: »Krebsgeschwür in der Moral der deutschen Nation«).
c) Die synoptische Darstellung der Klägerin zeigt, dass die ohne Weiteres ins Auge springenden zahlreichen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Werken weit überwiegend auf inhaltlichen Übereinstimmungen beruhen, so etwa der Umstand, dass auf dem internationalen Historikerkongress 1908 Latein als Vortragssprache anerkannt war (S. 32); die Kommunikationsmittel des wissenschaftlichen Austausches (S. 33); die große Bedeutung der Astronomie und ihres Publikationsorgans »Astronomische Nachrichten« sowie die Gründung der Astronomischen Gesellschaft und die Zahl deren Gründungsmitglieder (S. 33 ff.); die Entwicklung der »Internationalen Erdmessung« als internationale Vereinigung von Staaten (S. 35); die Gründung des Preußischen Geodätischen Instituts; die Entwicklung der Erdbebenforschung in Deutschland und die Gründung der Internationalen Seismologischen Assoziation auf Initiative eines in Straßburg tätigen deutschen Geographen sowie der Widerstand anderer Länder gegen die deutsche Dominanz (S. 36 f.); die Gründung der Internationalen Assoziation der Akademien; die Verwendung der Sprachen auf wissenschaftlichen Kongressen; die Entstehung, Herausgabe und Finanzierung der »Bibliotheca Geographica« usw.
Im Hinblick darauf, dass, wie oben unter l. a) dargelegt, der Inhalt als Wiedergabe von Fakten nicht per se schutzfähig ist, können diese rein inhaltlichen Übereinstimmungen nicht zur Beurteilung eines ausreichenden Abstandes der beiden Werke herangezogen werden.
d) Das Werk des Beklagten zu 2) greift auch nicht durch die Übernahme von Auswertungen in das Urheberrecht der Klägerin ein.
Soweit es sich um Auswertungen handelt, die von Dritten stammen (so etwa die Diagramme), gilt dasselbe wie zu mitgeteilten Fakten – insoweit besteht bereits kein Urheberrechtsschutz zu Gunsten der Klägerin.
Das Diagramm auf S. 57 des Werks der Beklagten bezieht sich zwar auf eine schutzfähige Auswertung der Klägerin selbst zur Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts an amerikanischen Public High Schools; insoweit handelt es sich jedoch um ein nach § URHG § 51 Nr. 1, 2 UrhG zulässiges (und auch gesondert als solches gekennzeichnetes) wissenschaftliches Kleinzitat, das lediglich der inhaltlichen Untermauerung des Berichts über den Rückgang des Deutschunterrichts in der Folge des Ersten Weltkriegs dient.
e) Auch der Umstand, dass der Beklagte zu 2) überwiegend solche Fakten und Beispiele erwähnt, die sich auch im Werk der Klägerin finden, erscheint im konkreten Fall nur von eingeschränkter Relevanz. Zwar kommt, wie oben dargelegt, gerade bei wissenschaftlichen Werken auch der Auswahl des präsentierten Materials in der Regel ein eigenschöpferischer Gehalt zu. Allerdings ist nicht ersichtlich, dass im Hinblick auf den von den Kritikern gerühmten »Fakten- und Materialreichtum« des Werks der Klägerin, das das Thema offensichtlich erschöpfend behandelt, überhaupt noch andere in gleicher Weise einschlägige Beispiele zu dem – per se nicht schutzfähigen – Thema »Deutsch als internationale Wissenschaftssprache« in dem von der Klägerin behandelten Zeitraum zu finden sind. Unter diesen von der Klägerin behandelten Beispielen hat der Beklagte zu 2) seinerseits eine Auswahl getroffen; auch die Gewichtung ist nicht dieselbe wie bei der Klägerin.
f) Aufbau, Gliederung und Gewichtung der einzelnen Inhalte im Werk des Beklagten weichen von dem der Klägerin ab, wobei sich ein grundsätzlich chronologischer Aufbau durch das Thema geradezu »aufdrängt« und deshalb als solcher nicht als eigenschöpferische Leistung der Klägerin angesehen werden kann.
Der Beklagte zu 2) hat in zeitlicher Hinsicht ein umfassenderes Thema abgehandelt als die Klägerin, nämlich »von den Anfängen bis zur Gegenwart«, wie der Untertitel seines Buches lautet; die von der Klägerin behandelte Epoche nimmt darin nur etwa gut 1/3 ein. In seinen ersten, nicht das Werk der Klägerin berührenden vier Kapiteln beschäftigt sich der Beklagte zu 2) mit dem Verhältnis von Latein und den jeweiligen Nationalsprachen im Laufe der Jahrhunderte. Die erste Information, die so auch im Werk der Klägerin (dort im Kapitel I. 1.) steht, findet sich auf S. 32: die Verwendung des Lateinischen als Vortragssprache auf dem Historikerkongress 1908.
Weitergehende inhaltliche Übereinstimmungen mit dem Werk der Klägerin finden sich in den beiden folgenden Kapiteln: Das Kapitel »Deutsch als internationale Wissenschaftssprache« enthält kurze Darstellungen über die Fachgebiete Astronomie, Erdmessung, Seismologie und Geographie sowie über die Internationale Assoziation der Akademien. Sodann folgen allgemeine Ausführungen zur Bedeutung der deutschen Sprache bis zum ersten Weltkrieg.
Das nächste Kapitel ist überschrieben »Der Erste Weltkrieg, der Wissenschafts- und Sprachboykott« und beschäftigt sich zunächst mit der Haltung deutscher Wissenschaftler gegenüber dem Ausland zu Beginn des Ersten Weltkriegs und den verbalen Reaktionen ausländischer Wissenschaftler hierauf. Hieran schließt die Darstellung konkreter Zensur-, Boykott- und Ausschlussmaßnahmen von beiden Seiten während des Kriegs bis hin zur Auflösung bestehender zwischenstaatlicher Konventionen durch den Versailler Vertrag und deren Folgen an, sowie die Gründung neuer Wissenschaftsorganisationen unter Ausschluss Deutschlands nach dem Krieg. Es folgen Entwicklungen bis zum Zweiten Weltkrieg (Gründungen rein deutscher Gesellschaften, neue zwischenstaatliche Vereinbarungen).
Dabei übernimmt der Beklagte zu 2) zwar beispielhaft dieselben Fachgebiete wie die Klägerin (Astronomie, Erdmessung, Seismologie und Geographie), er behandelt jedoch die Internationale Assoziation der Akademien erst nach den Fachgebieten und lässt den »International Catalogue of Scientific Literature« gänzlich aus. Im Anschluss an die Akademien geht er auch auf die Herausgabe wissenschaftlicher Bibliographien ein, erwähnt aber in diesem Zusammenhang nur die »Bibliotheca Geographica«. Den nationalistischen Aufrufen »An die Kulturwelt« und »Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reichs« von 1914 wird beim Beklagten höhere Bedeutung eingeräumt als bei der Klägerin, was bereits optisch durch den Abdruck von Faksimiles geschieht, während bei der Klägerin lediglich der Text wiedergegeben wird. Das ist umso bemerkenswerter, als alle anderen thematischen Übernahmen naturgemäß beim Beklagten deutlich kürzer dargestellt sind. Außerdem hat der Beklagte in diesem Zusammenhang als Beispiel eines entsprechenden Nationalismus auf der Gegenseite noch ein »Gebet« im amerikanischen Repräsentantenhaus abgedruckt, welches sich bei der Klägerin nicht findet. Der Aufbau dieser Passage weicht vom Aufbau der Klägerin ab: Während die Klägerin die beiden deutschen Aufrufe im Rahmen des Kapitels 2 des ersten Abschnittes behandelt, finden sie sich beim Beklagten unter dem Kapitel »Der Erste Weltkrieg, der Wissenschafts- und Sprachboykott«. Ihm vorgeschaltet ist eine Zusammenfassung der internationalen Bedeutung der deutschen Sprache und des deutschen Hochschulwesens bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts; soweit hierin Textstellen der Klägerin zu finden sind, stammen diese aus völlig unterschiedlichen Stellen ihres Werkes. An dieser Stelle zeigt sich auch, dass der Beklagte aufbaumäßig strenger chronologisch vorgeht als die Klägerin, mit [S. 579] Ausnahme eines kleinen Einschubs (der sich bei der Klägerin nicht findet) auf S. 54 zur Namensgebung der Universität Hannover im Jahre 2006.
g) Der Schutzbereich der eigenschöpferischen Leistung der Klägerin könnte lediglich insoweit tangiert sein, als der Beklagte vereinzelt auch konkrete eigenständige Verknüpfungen, Schlussfolgerungen und Auswertungen von der Klägerin übernommen hat. Denn auch solche innere Verknüpfungen und inhaltliche Verarbeitungen können schutzfähig sein, wenn sie über den gemeinfreien Kern der wissenschaftlichen Lehren und Theorien hinausgehen (vgl. Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 3. Aufl., § 2 Rn. 64).
So könnte die konkrete Verknüpfung mancher Fakten, die sich im Werk des Beklagten zu 2) genauso findet wie im Werk der Klägerin – etwa der Umstand, dass über die Bedeutung des Französischen als Sprache der Diplomatie und der Wissenschaft gerade im Zusammenhang mit der Geodäsie berichtet wird (S. 35), oder die Anmerkung, dass Deutschland in der Erdbebenforschung führend wurde, obwohl es nicht zu den besonders Erdbeben gefährdeten Gebieten gehörte – ebenso urheberrechtlich relevant sein wie die Übernahme der Schlussfolgerung der Klägerin betreffend die Verquickung von Wissenschafts- mit nationalen Macht- und Prestigeinteressen (ähnlich bezogen auf die »Internationale Erdmessung«, S. 35).
Ob durch diese einzelnen Übernahmen das Urheberrecht der Klägerin verletzt wird, kann jedoch vorliegend offenbleiben, weil die Klägerin nicht das Unterlassen der Verbreitung einzelner konkreter Passagen begehrt, die urheberrechtsverletzende Inhalte enthalten, sondern das Unterlassen der Verbreitung des gesamten im Klageantrag wiedergegeben Textes, der die Seiten 33 bis 70 des Werks der Beklagten nahezu vollständig umfasst.
Der Senat war bei dieser Antragstellung nicht befugt, das Verbot auf einzelne – möglicherweise urheberrechtsverletzende – Passagen zu beschränken.
B. Die Hilfsanträge zu 1. sind unzulässig.
Mit den Hilfsanträgen begehrt die Klägerin den Beklagten zu untersagen, den beanstandeten Text »ohne Kennzeichnung als Zitat« zu verbreiten. Diese Anträge genügen nicht dem Bestimmtheitsgebot des § ZPO § 253 Abs. ZPO § 253 Absatz 2 Nr. 2 ZPO.
Bei der Auslegung dieser Anträge geht der Senat davon aus, dass die Klägerin damit nicht die Kennzeichnung des gesamten beanstandeten Textes als Zitat aus dem Werk der Klägerin begehrt, denn eine solche Kennzeichnung ist bereits dadurch erfolgt, dass der Beklagte zu 2) in der Überschrift zu den beiden Kapiteln »Deutsch als internationale Wissenschaftssprache« und »Der Erste Weltkrieg, der Wissenschafts- und Sprachboykott« ausdrücklich auf das Werk der Klägerin als Quelle hingewiesen hat. Wäre dies das Klagebegehren, wären die Anträge ohne Weiteres jedenfalls wegen Erfüllung eines etwaigen Anspruchs unbegründet.
Wenn die Klägerin jedoch eine weitergehende Kennzeichnung konkreter Textstellen anstrebt, wovon aus vorstehenden Gründen auszugehen ist, sind die Anträge zu unbestimmt, weil nicht ersichtlich ist, in Bezug auf welche konkreten Passagen welche (zusätzliche) Zitatkennzeichnung erfolgen soll. Die Klägerin hätte diese Stellen daher im Einzelnen bezeichnen müssen.
C. Im Hinblick darauf, dass nach dem oben unter A. Dargestellten durch den Gesamttext unter Ziff. 1. c) des Klageantrages das Urheberrecht der Klägerin nicht verletzt wird, steht ihr gegen die Beklagte zu 1) auch kein Anspruch auf Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung gemäß §§ URHG § 97, URHG § 101 UrhG, § BGB § 259 Abs. BGB § 259 Absatz 2 BGB zu.
Auch ein Anspruch auf Erstattung vorgerichtlicher Abmahnkosten, wie mit dem Klageantrag zu 3. geltend gemacht, besteht infolgedessen nicht.
D. (…)
Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Sache weder grundsätzliche Bedeutung hat noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordern (§ ZPO § 543 ZPO). Die Entscheidung beruht auf der Anwendung anerkannter Rechtssätze im konkreten Einzelfall.
Dem Urteil ist zuzustimmen. Durch eine erschöpfende Darstellung kann ein Wissenschaftsautor nicht andere ausführlichen Darstellungen zum gleichen Thema, die notwendigerweise erhebliche Überschneidungen aufweisen müssen, urheberrechtlich blockieren. Wird plagiatfrei und wissenschaftlich redlich die Grundlage verwertet, muss eine entsprechende "Ausbeutung" der eigenen Ergebnisse grundsätzlich hingenommen werden, auch wenn das "moralische Empfinden" vieler Wissenschaftler eher der Klägerin Recht geben würde. Auch wenn es sich nicht um eine kritische Überprüfung ("restudy") handelt, gebietet die Wissenschaftsfreiheit, bei dem Urheberrechtsschutz wissenschaftlicher Texte zurückhaltend zu sein.
Haberstumpf ist aber gar nicht einverstanden und schäumt in der ZUM 2012, S. 529ff.: "Die Piratenbewegung hat deshalb auch auf dem Gebiet der Wissenschaften nicht recht, wenn sie die Zurückdrängung des Urheberrechts fordert. Dass sich die deutsche Rechtsprechung auf ihre Seite geschlagen hat, kann deshalb nur bedauert werden."
Bei Openjur ist noch nichts online, daher hier nach ZUM 2012, 574 ff. der Volltext vom Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 27. März 2012 – 11 U 66/11.
I. Die Klägerin macht Ansprüche wegen behaupteter Urheberrechtsverletzung an einem wissenschaftlichen Werk geltend.
Die Klägerin hat eine im Jahre 2006 veröffentlichte Habilitationsschrift mit dem Titel »Deutsch als internationale Wissenschaftssprache …« verfasst. Der Text der Arbeit umfasst (ohne Vorwort und Literaturverzeichnis) rund 425 Seiten; sie gliedert sich in die Abschnitte
I. Im Vorfeld des Boykotts
II. Der Boykott
III. Gegenaktionen
IV. Verhandlungen
V. Auswirkungen
Der Beklagte zu 2) hat im Jahre 2010 im Verlag der Beklagten zu 1) ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Die Macht der Sprache …«; der Text umfasst 106 Seiten. Auf Seite 33 beginnt das Kapitel »Deutsch als internationale Wissenschaftssprache«, auf Seite 43 das Folgekapitel »Der Erste Weltkrieg, der Wissenschafts- und Sprachboykott«. Bei beiden Kapiteln wird als Fußnote zur Kapitelüberschrift auf das Werk der Klägerin verwiesen. Das nächste Kapitel, »Die Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg«, beginnt auf Seite 70.
In den beiden Kapiteln »Deutsch als internationale Wissenschaftssprache« und »Der Erste Weltkrieg, der Wissenschafts- und Sprachboykott« sowie auf den ersten Seiten des nachfolgenden Kapitels finden sich zahlreiche Passagen, die Ähnlichkeiten mit Passagen aus dem Werk der Klägerin aufweisen.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Zur Begründung hat es ausgeführt, es komme nicht darauf an, ob das Buch der Klägerin in seiner Gesamtheit ein geschütztes Werk darstelle, da der Beklagte nicht das gesamte Buch übernommen habe.
Ob die jeweiligen Werkteile, auf die sich die Klägerin berufe, ihrerseits die nötige Schöpfungshöhe aufwiesen, könne dahinstehen, weil jedenfalls die Änderungen des Beklagten zu 2) weit genug seien, um aus dem engen Schutzbereich, auf den sich die Klägerin allenfalls berufen könne, hinauszuführen. Anhand zweier beanstandeter Textpassagen legt das Landgericht dar, dass die jeweilige wissenschaftliche Erkenntnis nicht urheberrechtsschutzfähig sei. Bezüglich der Formulierungen sei zweifelhaft, ob ihr die für den Urheberrechtsschutz notwendige Schöpfungshöhe zukomme; im Übrigen weise der Text des Beklagten Eigenarten auf, die nicht mit der des Textes der Klägerin übereinstimmten.
Auch hinsichtlich der Gliederung des streitgegenständlichen Buches könne keine Unterlassung begehrt werden. Diese orientiere sich am Gang der historischen Ereignisse und weise allenfalls eine geringe Schöpfungshöhe auf. Auch hier habe der Beklagte zu 2) im Übrigen ausreichende Änderungen vorgenommen.
Gegen das ihr am 16.5.2011 zugestellte Urteil hat die Klägerin am 30.5.2011 Berufung eingelegt und diese innerhalb verlängerter Frist am 8.8.2011 begründet.
Mit der Berufung verfolgt die Klägerin ihre erstinstanzlichen Anträge weiter, unter leichter Modifizierung des Wortlauts des Unterlassungsantrages und ergänzt um Hilfsanträge. Sie stellt klar, dass sie nicht die Übernahme einzelner Teile aus ihrem Werk beanstande, sondern dass der Beklagte zu 2) ihr gesamtes Werk benutzt habe. Ein knappes Drittel der Schrift des Beklagten zu 2) sei eine unzulässige Bearbeitung ihres Werkes i. S. d. § URHG § 23 UrhG.
Ihr Werk sei ein wissenschaftliches Sprachwerk i. S. d. § URHG § 2 Abs. URHG § 2 Absatz 1 Nr. 1 UrhG. Sie habe als Erste das sprach- und wissenschaftshistorische Thema erkannt; sie habe mit ihrer Studie ein neues Forschungsfeld eröffnet, mit neuen Fragestellungen, Gedanken und Argumentationssträngen. Sie habe als Erste die Sammlung, Auswahl, Auswertung, Anordnung und Darstellung bis dahin weitgehend unbekannten umfangreichen wissenschaftlichen Materials und die gedankliche Durchdringung des komplexen Stoffes vorgenommen sowie die Gliederung und sprachliche Darstellung entsprechend gestaltet. Sie habe dadurch ein »Gewebe« geschaffen, das ihrem Werk die für die Urheberrechtsfähigkeit erforderliche individuelle Prägung gebe. Der Beklagte zu 2) habe komplett den Denkansatz, die Themenstellung, den wesentlichen Inhalt und Begründungszusammenhang, die Gedankenführung und Gestaltung, den Aufbau und die Gliederung, die Auswahl der Beispiele und der Zitate sowie die wissenschaftlichen Ergebnisse und Schlussfolgerungen einschließlich der sprachlichen Darstellung übernommen.
Die Klägerin beantragt,
1. a) die Beklagte zu 1) zu verurteilen, es bei Meidung der Ordnungsmittel des § ZPO § 890 ZPO zu unterlassen, das in ihrem Verlag erscheinende Buch des Beklagten zu 2) »Die Macht der Sprache …« (ISBN …) zu verbreiten, sofern es den gesamten unter lit. c) aufgeführten Text enthält; hilfsweise
… sofern es den unter lit. c) aufgeführten Text ganz oder in Teilen ohne Kennzeichnung als Zitat aus dem Werk der Klägerin »Deutsch als internationale Wissenschaftssprache …« enthält,
b) den Beklagten zu 2) zu verurteilen, es bei Meidung der Ordnungsmittel des § ZPO § 890 ZPO zu unterlassen, in seinem Buch »Die Macht der Sprache …« den gesamten unter lit. c) aufgeführten Text zu vervielfältigen und zu verbreiten, hilfsweise,
… den unter lit. c) aufgeführten Text ganz oder in Teilen ohne Kennzeichnung als Zitat aus dem Werk der Klägerin »Deutsch als Internationale Wissenschaftssprache …« zu vervielfältigen und zu verbreiten.
c) (Die Seitenangaben beziehen sich auf »Die Macht der Sprache …« in der 1. Aufl. von …)(hier nur Beispiele für den auszugsweisen Abdruck wörtlicher Passagen im Klageantrag; Anm. d. Red.)
»S. 32:
Auf dem internationalen Historikerkongress 1908 in Berlin waren Vorträge zugelassen in Deutsch als der Sprache der Gastgeber, in Englisch, Französisch, Italienisch sowie in Latein. …
S. 33:
… Als Mittel zur Verständigung dienten neben persönlichen Schreiben und Besuchen im 19. Jahrhundert in zunehmendem Maße der Austausch von Schriften und Publikationen, die Erfassung der wissenschaftlichen Publikationen in Referatenzeitschriften sowie die Arbeit in wissenschaftlichen Vereinigungen und der Besuch von Konferenzen.
S. 33–34:
Anhand der Astronomie, die mit anderen Wissenschaften von der Mathematik bis zur Physik eng verbunden ist und im 19. Jahrhundert zu den führenden Wissenschaften gehörte, zeigt sich einerseits die Internationalität der Forschung, andererseits aber auch die Problematik der Wissenschaftssprache in sehr anschaulicher Weise. Die erfolgreichste Fachzeitschrift dieses Gebietes waren die 1821 in Altona bei Hamburg von Heinrich Christian Schumacher, Professor der Astronomie in Kopenhagen und Mitglied akademischer Gesellschaften in Kopenhagen, London, Edinburgh und Neapel, herausgegebenen Astronomischen Nachrichten. Bezüglich der Beiträge äußerte sich der Herausgeber im ersten Heft: ›Ich lasse die Beiträge der verschiedenen Herrn Verfasser so, sowie ich sie von ihnen erhalte … Was in englischer, französischer oder lateinischer Sprache mir zugesandt wird, erscheint im Original‹. Das hohe Ansehen [S. 576] des Herausgebers, seine unermüdliche Arbeit für seine Zeitschrift, sicherlich nicht zuletzt seine tolerant praktizierte Sprachregelung bewirkten, dass in der im 19. Jahrhundert langzeitig renommiertesten astronomischen Fachzeitschrift, den Astronomischen Nachrichten, alle bedeutenden Astronomen ihre Aufsätze publizierten. Die Analyse von rund 21 000 Beiträgen in dieser Zeitschrift aus dem Zeitraum von 1821 bis 1920 zeigt, dass 40 bis 60 % der Beiträge aus Deutschland kamen, jedoch 60 bis 83% in deutscher Sprache abgefasst waren. 4 bis 12 % der Beiträge kamen aus England, bis 18 % aus den USA, während in englischer Sprache von meistens englisch sprechenden Autoren 5 bis 25 % der Beiträge abgefasst waren; aus Frankreich kamen 2 bis 9 % der Beiträge, in Französisch abgefasst waren 5 bis 15 % der Beiträge. Die entsprechenden Zahlen für Italien bzw. Italienisch sind 3 bis 11 % bzw. 0 bis 10 %. Aus Russland kamen bis 9 % der Beiträge, deren Autoren sich des Französischen, aber auch des Deutschen als Publikationssprache bedienten.
S. 35–36:
Anders als die auf der persönlichen Mitgliedschaft einzelner Wissenschaftler beruhende Astronomische Gesellschaft kam die wissenschaftliche Institution, die sich mit der Landvermessung befasste, als internationale Vereinigung von Staaten zustande. Gegründet 1862 auf Initiative Preußens als ›Mitteleuropäische Gradmessung‹, 1867 umbenannt in ›Europäische Gradmessung‹ und 1886 wiederum umbenannt in »Internationale Erdmessung« hatte sie unter den 13 Gründungsmitgliedern sieben deutsche Staaten. Maßgebend für die Bedeutung dieser Institution, die von Preußen nicht nur initiiert, sondern auch stark subventioniert wurde, waren wissenschaftliche, wirtschaftliche und nicht zuletzt auch militärische Interessen. Das Zentralbüro dieser Institution befand sich in Berlin. Die Dominanz preußischer bzw. deutscher Interessen wurde 1869 durch die Gründung des Königlich Preußischen Geodätischen Instituts in Berlin und die Personalunion der Leitung dieses Instituts und des Zentralbüros gefestigt mit dem Ziel, … Obwohl Frankreich erst 1871 der Europäischen Gradmessung beitrat, war der offizielle Status der französischen Sprache in ihr bedingt durch die führende Stellung der französischen Geodäsie im 18. Jahrhundert sowie des Französischen als damalige Sprache der Wissenschaft und der Diplomatie. Mit dem Beitritt der USA 1889 und Großbritanniens 1898 war es für die Vertreter dieser anglophonen Länder eine Selbstverständlichkeit, dass sie sich innerhalb dieser Organisation sowohl mündlich als auch schriftlich ihrer eigenen Muttersprache bedienten. Entscheidungen über die 1916, während des Ersten Weltkrieges auslaufende Konvention sollten zwei Jahre nach dem Ende des Krieges getroffen werden.
S. 36–37:
Der deutsche Geograph Georg Gerland, 1875 auf den Lehrstuhl für Geographie der Universität Straßburg berufen und seit 1887 Herausgeber der Beiträge zur Geophysik, griff die ›Vorschläge zur Errichtung eines Systems von Erdbeben-Stationen‹ verbunden mit einer ›Centralstelle für die Sammlung und Publication von Erdbebennachrichten aus der ganzen Welt‹ auf und initiierte durch seine Bemühungen den Bau der »Kaiserlichen Hauptstation für Erdbebenforschung« in Straßburg. Gerland schwebte vor, eine Organisation ähnlich der Internationalen Erdmessung mit einem Zentralbüro in Straßburg zu errichten. Nachdem die deutsche Regierung Verhandlungen mit den anderen Staaten aufgenommen hatte, wurde 1903 auf der 2. Internationalen Seismologischen Konferenz, die Gerland wie die vorhergehende in Straßburg durchführte, die Gründung der Internationalen Seismologischen Assoziation festgelegt, wobei die deutsche sowie die Straßburger Dominanz nach den Vorstellungen von Gerland weitgehend festgeschrieben wurde. Gegen die Festschreibung von Straßburg als Sitz des Zentralbüros und die damit verbundene Dominanz Deutschlands regte sich in Großbritannien, Frankreich und Italien Widerspruch, der dazu führte, dass die 1903 getroffene ›Übereinkunft‹ durch eine Kommission unter der Leitung des britischen Geophysikers Arthur Schuster überarbeitet wurde. Unter Berücksichtigung der revidierten Fassung der Übereinkunft wurde 1905 in Berlin die Internationale Seismologische Assoziation gegründet. Ohne dass es in den Statuten festgelegt war, dominierte die deutsche Sprache in dieser Organisation infolge der deutschen Initiativen und der Anzahl der deutschen Teilnehmer. Wurden die Verhandlungsberichte anfangs in deutscher und französischer Sprache publiziert, so wurde schon 1906 festgelegt, dass die französische die authentische Fassung sein sollte. Unter der Präsidentschaft des britischen Geophysikers Schuster wurde 1909 ›aus Kostengründen‹ auf die deutschsprachige Fassung der Verhandlungsberichte verzichtet.
S. 42:
Da die Wissenschaftler über die Universitäten und die nationalen Wissenschaftsorganisationen direkt oder indirekt in die nationale Wissenschaftspolitik eingebunden waren, machten sich in zunehmendem Maße aber auch nationale Rivalitäten zwischen Deutsch, Englisch und Französisch bemerkbar. Der Verzicht auf die deutschsprachige Fassung der Verhandlungsberichte der Internationalen Seismologischen Assoziation unter der Präsidentschaft des britischen Geophysikers Schuster 1909 ›aus Kostengründen‹ dürfte dafür ein charakteristisches Beispiel sein. …
S. 52–53:
Im Ausland, dem nationalistische und chauvinistische Ambitionen wie gezeigt natürlich ebenfalls nicht fremd waren, stießen die beiden deutschen Dokumente auf Empörung. Hervorzuheben ist die Reaktion des britischen Chemikers William Ramsay, einst Student in Gießen bei Liebig, Mitglied renommierter Akademien und Nobelpreisträger von 1904, welcher forderte, dass die alliierten Kriegsgegner des Deutschen Reiches den ›teutonischen Despotismus‹ als ein Krebsgeschwür in der Moral der deutschen Nation ein für allemal vernichten sollten. Nicht als nachahmenswert sah er das Verhalten einiger deutscher Universitätslehrer an, welche die ihnen verliehenen Auszeichnungen aus England zurückgegeben haben. Seine von Ressentiments getragenen Betrachtungen, nach denen auf die von ihm in Frage gestellten wissenschaftlichen Leistungen Deutschlands – mit Ausnahme von herausragenden Leistungen einzelner deutscher Gelehrter – abgesehen werden könne …«
2. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, durch ihren Geschäftsführer an Eides statt die Richtigkeit ihrer Auskunft zu versichern, die erste Auflage von »Die Macht der Sprache …« von … sei in einer Auflage von nicht mehr als 55 Exemplaren hergestellt worden;
3. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an die Klägerin 1.023,16 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
Die Beklagten beantragen, die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigen das angefochtene Urteil. Der Beklagte zu 2) ist der Auffassung, der Antrag der Klägerin ziele darauf ab, ihm die Beschäftigung mit der von ihr behandelten Epoche gänzlich zu untersagen.
II. Die Berufung ist zulässig, insbesondere fristgerecht eingelegt und begründet worden. Sie hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.
A. Die Hauptanträge zu 1. sind unbegründet. Die Klägerin kann von den Beklagten nicht nach § URHG § 97 Abs. URHG § 97 Absatz 1 UrhG Unterlassung der Verbreitung bzw. Vervielfältigung des beanstandeten Textes verlangen. [S. 577]
1. Im Ergebnis zutreffend geht die Klägerin davon aus, dass es sich bei ihrem Werk um ein urheberrechtlich geschütztes Sprachwerk i. S. d. § URHG § 2 Abs. URHG § 2 Absatz 1 Nr. 1 UrhG handelt.
a) Bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit von wissenschaftlichen Werken besteht in Rechtsprechung und Schrifttum Einigkeit, dass die wissenschaftliche Lehre und das wissenschaftliche Ergebnis frei und jedermann zugänglich ist (BGH GRUR 1981, GRUR Jahr 1981 Seite 352, GRUR Jahr 1981 Seite 353 – Staatsexamensarbeit; GRUR 1991, GRUR Jahr 1991 Seite 130, GRUR Jahr 1991 Seite 132 – Themenkatalog; Senat ZUM-RD 2003, ZUM-RD Jahr 2003 Seite 532; Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 3. Aufl., § 62 Rn. 61; Dreier/Schulze, 3. Aufl., § 2 UrhG Rn. 93).
Der Inhalt der Arbeit der Klägerin ist daher nicht per se schutzfähig; dies gilt erst recht, soweit es sich dabei um die Wiedergabe historischer Tatsachen handelt, wie dies bei den … wiedergegebenen Ausschnitten ihres Werkes weit überwiegend der Fall ist. Darauf, ob solche historischen Tatsachen bis zur Veröffentlichung durch die Klägerin bekannt waren, kommt es nicht an. Das bloße Auffinden von nicht allgemein zugänglichen Informationen ist keine persönliche geistige Schöpfung. Damit hat der Beklagte allein dadurch, dass er dieselben Tatsachen wiedergibt wie die Klägerin, kein Urheberrecht verletzt.
Soweit die Klägerin darauf abhebt, dass in Fachkreisen u. a. die »wissenschaftsgeschichtliche und sprachenpolitische Bedeutung, der Fakten- und Materialreichtum, die sorgfältige Analyse« ihres Werks gelobt werde und hierfür entsprechende Belege anführt, ist darauf hinzuweisen, dass das Thema als solches der Wissenschaftsfreiheit unterfällt und dass auch »Fakten- und Materialreichtum« per se nichts mit einer »persönlichen geistigen Schöpfung« i. S. d. § URHG § 2 Abs. URHG § 2 Absatz 2 UrhG zu tun hat. Das Urheberrecht schützt nicht die Arbeitsleistung als solche, sondern allein die kreative Tätigkeit; maßgeblich ist nicht der Aufwand, sondern das Ergebnis (Dreier/Schulze, aaO., § 2 Rn. 53, 54).
b) Schutzfähig kann jedoch die Sammlung, Auswahl, Einteilung und Anordnung vorhandenen Stoffes sein (BGH GRUR 1980, GRUR Jahr 1980 Seite 227 – Monumenta Germaniae Historica; GRUR 1981, GRUR Jahr 1981 Seite 520 – Fragensammlung), ebenso wie die von der Gedankenführung geprägte Gestaltung der Sprache (BGH ZUM-RD 1997 ZUM-RD Jahr 1997 Seite 329 – CB-Infobank I; ZUM 2011, ZUM Jahr 2011 Seite 151 – Perlentaucher), wobei die Schutzfähigkeit der konkreten Darstellung dort ihre Grenze findet, wo sie aus wissenschaftlichen Gründen geboten oder in dem behandelten Gebiet weithin üblich ist (BGH GRUR 1981, GRUR Jahr 1981 Seite 352, GRUR Jahr 1981 Seite 355 – Staatsexamensarbeit).
Nach diesen Kriterien ist hier die Schutzfähigkeit zu bejahen.
Die Klägerin hat eine bestimmte Reihenfolge der Darstellung gewählt. Sie hat im ersten Abschnitt »Im Vorfeld des Boykotts« zunächst »Die Macht der deutschen Sprache« vor dem ersten Weltkrieg dargestellt. Darin werden nach allgemeinen Darstellungen zur Wissenschaftssprache im 19. Jahrhundert in jeweils eigenen Unterkapiteln zunächst zwei fachübergreifende Projekte behandelt, nämlich der »International Catalogue of Scientific Literature« und die »Internationale Assoziation der Akademien«, und anschließend bestimmte Fachgebiete ausführlich untersucht, nämlich die Astronomie, die Erdmessung, die Seismologie, die Geographie und die Tuberkulosebekämpfung. Das zweite Kapitel des ersten Abschnitts beschäftigt sich mit »Ansichten zum Krieg und zur deutschen Megalomanie« und behandelt auslandsfeindliche Aktionen deutscher Wissenschaftler nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges und die entsprechenden Reaktionen des Auslandes, insbesondere England und Frankreich. Das dritte Kapitel behandelt »Deutsche Fachliteratur im Krieg«.
Der zweite Abschnitt trägt die Überschrift »Der Boykott« und behandelt die verschiedenen Maßnahmen ab 1915, die zu einer Verdrängung des Deutschen führten, mit den Kapiteln »Die Institutionalisierung des Boykotts«, »Kritik, Ächtung und Verdrängung des Deutschen als internationale Publikationssprache der Wissenschaft« und »Die Ausschaltung des Deutschen als internationale Kongresssprache«.
Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit »Gegenaktionen« gegen den Boykott sowohl von Seiten mancher ausländischer Institutionen und Wissenschaftler als auch (und insbesondere) in Deutschland, in Form von »1. Protesten gegen den Boykott«, »2. Gegenveranstaltungen und -organisationen«, »3, Rettungsaktion für die deutschen Referatenorgane« und »4. Gegenboykott«.
Der vierte Abschnitt ist überschrieben mit »Verhandlungen« und beschäftigt sich mit verschiedenen Wissenschaftsorganisationen in den 1920er Jahren, namentlich »1. Conseil international de recherches«, »2. Union académique internationale«, »3. Union astronomique internationale«, »4. Union géodésique et géophysique internationale« und »5. Union internationale de la Chimie pure et appliquée«.
Im fünften Abschnitt »Auswirkungen« werden die Folgen der bislang dargestellten Entwicklung beschrieben, in den Kapiteln »Die Dominanz der französischen und englischen Sprache und der Rückgang des Deutschen« sowie »Nationale Repräsentation, Weltgeltung und Sprachpolitik«.
Die Klägerin hat auch bestimmte Schwerpunkte gesetzt. Sie hat beispielsweise einzelnen Fachgebieten eigene Unterkapitel gewidmet, andere nur erwähnt; sie hat einzelne Erklärungen und Stellungnahmen wörtlich abgedruckt, andere nur inhaltlich wiedergegeben. Sie hat bestimmte Fakten miteinander verknüpft, ausgewertet und Schlussfolgerungen gezogen.
Auch hat sie ihrem Werk eine bestimmte sprachliche Gestaltung gegeben.
2. a) Liegt somit ein urheberrechtlich geschütztes Werk der Klägerin vor, so hängt die Frage der Verletzung dieses Urheberrechts davon ab, ob es sich bei dem Werk des Beklagten um eine freie Benutzung i. S. d. § URHG § 24 UrhG oder um eine abhängige Bearbeitung i. S. d. § URHG § 23 UrhG handelt.
Bei der Beurteilung, ob eine (unfreie) Bearbeitung vorliegt, kommt es entscheidend auf den Abstand an, den das neue Werk zu den entlehnten eigenpersönlichen Zügen des benutzten Werkes hält. Eine freie Benutzung setzt voraus, dass angesichts der Eigenart des neuen Werkes die entlehnten eigenpersönlichen Züge des benutzten Werks verblassen (BGH ZUM 2011, ZUM Jahr 2011 Seite 151 – Perlentaucher; ZUM 1999, ZUM Jahr 1999 Seite 644 – Laras Tochter). Dabei ist zunächst durch Vergleich zu ermitteln, ob und ggf. in welchem Umfang eigenschöpferische Züge des älteren Werks übernommen worden sind (BGH ZUM 2004, ZUM Jahr 2004 Seite 748 – Hundefigur).
b) Die sprachliche Gestaltung des Werks des Beklagten zu 2) hält einen ausreichenden Abstand zum Werk der Klägerin.
Zwar ist die sprachliche Darstellung des Gesamtwerkes sowie einzelner selbstständiger Teile hieraus grundsätzlich ebenfalls urheberrechtsfähig. Dem Beklagten zu 2) wäre es daher verwehrt, etwa ein gesamtes Kapitel oder längere Passagen wortwörtlich zu übernehmen. Dies hat er jedoch unstreitig nicht getan.
Ähnlichkeiten in der Darstellung führen im vorliegenden Fall nicht dazu, dass das gesamte Werk des Beklagten (oder jedenfalls die auf das Werk der Klägerin Bezug nehmenden Teile) als nicht eigenständig erscheinen würde. Es wurde kein besonderer »Schreibstil« der Klägerin übernommen, sondern der Beklagte zu 2) verwendet lediglich an einzelnen Stellen ähnliche Formulierungen, die aber im Hinblick darauf, dass beide Parteien eine gut verständliche »Allgemeinsprache« benutzen, keinen konkreten Bezug zum Werk der Klägerin mehr erkennen lassen, soweit es sich nicht um ohnehin durch die Sache gebotene Fachbegriffe handelt.
Der Beklagte zu 2) hat auch in den konkret beanstandeten Textpassagen keine Formulierungen der Klägerin übernommen, die als solche besonders aussagekräftig oder originell [S. 578] erscheinen und deshalb eine schöpferische Eigenart begründen (vgl. BGH ZUM 2011, ZUM Jahr 2011 Seite 151 Rn. ZUM Seite 151 Randnummer 37, ZUM Seite 151 Randnummer 39 – Perlentaucher). Soweit originelle Formulierungen und Begriffe übernommen wurden, handelt es sich ersichtlich um Zitate Dritter (z. B. S. 52: »Krebsgeschwür in der Moral der deutschen Nation«).
c) Die synoptische Darstellung der Klägerin zeigt, dass die ohne Weiteres ins Auge springenden zahlreichen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Werken weit überwiegend auf inhaltlichen Übereinstimmungen beruhen, so etwa der Umstand, dass auf dem internationalen Historikerkongress 1908 Latein als Vortragssprache anerkannt war (S. 32); die Kommunikationsmittel des wissenschaftlichen Austausches (S. 33); die große Bedeutung der Astronomie und ihres Publikationsorgans »Astronomische Nachrichten« sowie die Gründung der Astronomischen Gesellschaft und die Zahl deren Gründungsmitglieder (S. 33 ff.); die Entwicklung der »Internationalen Erdmessung« als internationale Vereinigung von Staaten (S. 35); die Gründung des Preußischen Geodätischen Instituts; die Entwicklung der Erdbebenforschung in Deutschland und die Gründung der Internationalen Seismologischen Assoziation auf Initiative eines in Straßburg tätigen deutschen Geographen sowie der Widerstand anderer Länder gegen die deutsche Dominanz (S. 36 f.); die Gründung der Internationalen Assoziation der Akademien; die Verwendung der Sprachen auf wissenschaftlichen Kongressen; die Entstehung, Herausgabe und Finanzierung der »Bibliotheca Geographica« usw.
Im Hinblick darauf, dass, wie oben unter l. a) dargelegt, der Inhalt als Wiedergabe von Fakten nicht per se schutzfähig ist, können diese rein inhaltlichen Übereinstimmungen nicht zur Beurteilung eines ausreichenden Abstandes der beiden Werke herangezogen werden.
d) Das Werk des Beklagten zu 2) greift auch nicht durch die Übernahme von Auswertungen in das Urheberrecht der Klägerin ein.
Soweit es sich um Auswertungen handelt, die von Dritten stammen (so etwa die Diagramme), gilt dasselbe wie zu mitgeteilten Fakten – insoweit besteht bereits kein Urheberrechtsschutz zu Gunsten der Klägerin.
Das Diagramm auf S. 57 des Werks der Beklagten bezieht sich zwar auf eine schutzfähige Auswertung der Klägerin selbst zur Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts an amerikanischen Public High Schools; insoweit handelt es sich jedoch um ein nach § URHG § 51 Nr. 1, 2 UrhG zulässiges (und auch gesondert als solches gekennzeichnetes) wissenschaftliches Kleinzitat, das lediglich der inhaltlichen Untermauerung des Berichts über den Rückgang des Deutschunterrichts in der Folge des Ersten Weltkriegs dient.
e) Auch der Umstand, dass der Beklagte zu 2) überwiegend solche Fakten und Beispiele erwähnt, die sich auch im Werk der Klägerin finden, erscheint im konkreten Fall nur von eingeschränkter Relevanz. Zwar kommt, wie oben dargelegt, gerade bei wissenschaftlichen Werken auch der Auswahl des präsentierten Materials in der Regel ein eigenschöpferischer Gehalt zu. Allerdings ist nicht ersichtlich, dass im Hinblick auf den von den Kritikern gerühmten »Fakten- und Materialreichtum« des Werks der Klägerin, das das Thema offensichtlich erschöpfend behandelt, überhaupt noch andere in gleicher Weise einschlägige Beispiele zu dem – per se nicht schutzfähigen – Thema »Deutsch als internationale Wissenschaftssprache« in dem von der Klägerin behandelten Zeitraum zu finden sind. Unter diesen von der Klägerin behandelten Beispielen hat der Beklagte zu 2) seinerseits eine Auswahl getroffen; auch die Gewichtung ist nicht dieselbe wie bei der Klägerin.
f) Aufbau, Gliederung und Gewichtung der einzelnen Inhalte im Werk des Beklagten weichen von dem der Klägerin ab, wobei sich ein grundsätzlich chronologischer Aufbau durch das Thema geradezu »aufdrängt« und deshalb als solcher nicht als eigenschöpferische Leistung der Klägerin angesehen werden kann.
Der Beklagte zu 2) hat in zeitlicher Hinsicht ein umfassenderes Thema abgehandelt als die Klägerin, nämlich »von den Anfängen bis zur Gegenwart«, wie der Untertitel seines Buches lautet; die von der Klägerin behandelte Epoche nimmt darin nur etwa gut 1/3 ein. In seinen ersten, nicht das Werk der Klägerin berührenden vier Kapiteln beschäftigt sich der Beklagte zu 2) mit dem Verhältnis von Latein und den jeweiligen Nationalsprachen im Laufe der Jahrhunderte. Die erste Information, die so auch im Werk der Klägerin (dort im Kapitel I. 1.) steht, findet sich auf S. 32: die Verwendung des Lateinischen als Vortragssprache auf dem Historikerkongress 1908.
Weitergehende inhaltliche Übereinstimmungen mit dem Werk der Klägerin finden sich in den beiden folgenden Kapiteln: Das Kapitel »Deutsch als internationale Wissenschaftssprache« enthält kurze Darstellungen über die Fachgebiete Astronomie, Erdmessung, Seismologie und Geographie sowie über die Internationale Assoziation der Akademien. Sodann folgen allgemeine Ausführungen zur Bedeutung der deutschen Sprache bis zum ersten Weltkrieg.
Das nächste Kapitel ist überschrieben »Der Erste Weltkrieg, der Wissenschafts- und Sprachboykott« und beschäftigt sich zunächst mit der Haltung deutscher Wissenschaftler gegenüber dem Ausland zu Beginn des Ersten Weltkriegs und den verbalen Reaktionen ausländischer Wissenschaftler hierauf. Hieran schließt die Darstellung konkreter Zensur-, Boykott- und Ausschlussmaßnahmen von beiden Seiten während des Kriegs bis hin zur Auflösung bestehender zwischenstaatlicher Konventionen durch den Versailler Vertrag und deren Folgen an, sowie die Gründung neuer Wissenschaftsorganisationen unter Ausschluss Deutschlands nach dem Krieg. Es folgen Entwicklungen bis zum Zweiten Weltkrieg (Gründungen rein deutscher Gesellschaften, neue zwischenstaatliche Vereinbarungen).
Dabei übernimmt der Beklagte zu 2) zwar beispielhaft dieselben Fachgebiete wie die Klägerin (Astronomie, Erdmessung, Seismologie und Geographie), er behandelt jedoch die Internationale Assoziation der Akademien erst nach den Fachgebieten und lässt den »International Catalogue of Scientific Literature« gänzlich aus. Im Anschluss an die Akademien geht er auch auf die Herausgabe wissenschaftlicher Bibliographien ein, erwähnt aber in diesem Zusammenhang nur die »Bibliotheca Geographica«. Den nationalistischen Aufrufen »An die Kulturwelt« und »Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reichs« von 1914 wird beim Beklagten höhere Bedeutung eingeräumt als bei der Klägerin, was bereits optisch durch den Abdruck von Faksimiles geschieht, während bei der Klägerin lediglich der Text wiedergegeben wird. Das ist umso bemerkenswerter, als alle anderen thematischen Übernahmen naturgemäß beim Beklagten deutlich kürzer dargestellt sind. Außerdem hat der Beklagte in diesem Zusammenhang als Beispiel eines entsprechenden Nationalismus auf der Gegenseite noch ein »Gebet« im amerikanischen Repräsentantenhaus abgedruckt, welches sich bei der Klägerin nicht findet. Der Aufbau dieser Passage weicht vom Aufbau der Klägerin ab: Während die Klägerin die beiden deutschen Aufrufe im Rahmen des Kapitels 2 des ersten Abschnittes behandelt, finden sie sich beim Beklagten unter dem Kapitel »Der Erste Weltkrieg, der Wissenschafts- und Sprachboykott«. Ihm vorgeschaltet ist eine Zusammenfassung der internationalen Bedeutung der deutschen Sprache und des deutschen Hochschulwesens bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts; soweit hierin Textstellen der Klägerin zu finden sind, stammen diese aus völlig unterschiedlichen Stellen ihres Werkes. An dieser Stelle zeigt sich auch, dass der Beklagte aufbaumäßig strenger chronologisch vorgeht als die Klägerin, mit [S. 579] Ausnahme eines kleinen Einschubs (der sich bei der Klägerin nicht findet) auf S. 54 zur Namensgebung der Universität Hannover im Jahre 2006.
g) Der Schutzbereich der eigenschöpferischen Leistung der Klägerin könnte lediglich insoweit tangiert sein, als der Beklagte vereinzelt auch konkrete eigenständige Verknüpfungen, Schlussfolgerungen und Auswertungen von der Klägerin übernommen hat. Denn auch solche innere Verknüpfungen und inhaltliche Verarbeitungen können schutzfähig sein, wenn sie über den gemeinfreien Kern der wissenschaftlichen Lehren und Theorien hinausgehen (vgl. Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 3. Aufl., § 2 Rn. 64).
So könnte die konkrete Verknüpfung mancher Fakten, die sich im Werk des Beklagten zu 2) genauso findet wie im Werk der Klägerin – etwa der Umstand, dass über die Bedeutung des Französischen als Sprache der Diplomatie und der Wissenschaft gerade im Zusammenhang mit der Geodäsie berichtet wird (S. 35), oder die Anmerkung, dass Deutschland in der Erdbebenforschung führend wurde, obwohl es nicht zu den besonders Erdbeben gefährdeten Gebieten gehörte – ebenso urheberrechtlich relevant sein wie die Übernahme der Schlussfolgerung der Klägerin betreffend die Verquickung von Wissenschafts- mit nationalen Macht- und Prestigeinteressen (ähnlich bezogen auf die »Internationale Erdmessung«, S. 35).
Ob durch diese einzelnen Übernahmen das Urheberrecht der Klägerin verletzt wird, kann jedoch vorliegend offenbleiben, weil die Klägerin nicht das Unterlassen der Verbreitung einzelner konkreter Passagen begehrt, die urheberrechtsverletzende Inhalte enthalten, sondern das Unterlassen der Verbreitung des gesamten im Klageantrag wiedergegeben Textes, der die Seiten 33 bis 70 des Werks der Beklagten nahezu vollständig umfasst.
Der Senat war bei dieser Antragstellung nicht befugt, das Verbot auf einzelne – möglicherweise urheberrechtsverletzende – Passagen zu beschränken.
B. Die Hilfsanträge zu 1. sind unzulässig.
Mit den Hilfsanträgen begehrt die Klägerin den Beklagten zu untersagen, den beanstandeten Text »ohne Kennzeichnung als Zitat« zu verbreiten. Diese Anträge genügen nicht dem Bestimmtheitsgebot des § ZPO § 253 Abs. ZPO § 253 Absatz 2 Nr. 2 ZPO.
Bei der Auslegung dieser Anträge geht der Senat davon aus, dass die Klägerin damit nicht die Kennzeichnung des gesamten beanstandeten Textes als Zitat aus dem Werk der Klägerin begehrt, denn eine solche Kennzeichnung ist bereits dadurch erfolgt, dass der Beklagte zu 2) in der Überschrift zu den beiden Kapiteln »Deutsch als internationale Wissenschaftssprache« und »Der Erste Weltkrieg, der Wissenschafts- und Sprachboykott« ausdrücklich auf das Werk der Klägerin als Quelle hingewiesen hat. Wäre dies das Klagebegehren, wären die Anträge ohne Weiteres jedenfalls wegen Erfüllung eines etwaigen Anspruchs unbegründet.
Wenn die Klägerin jedoch eine weitergehende Kennzeichnung konkreter Textstellen anstrebt, wovon aus vorstehenden Gründen auszugehen ist, sind die Anträge zu unbestimmt, weil nicht ersichtlich ist, in Bezug auf welche konkreten Passagen welche (zusätzliche) Zitatkennzeichnung erfolgen soll. Die Klägerin hätte diese Stellen daher im Einzelnen bezeichnen müssen.
C. Im Hinblick darauf, dass nach dem oben unter A. Dargestellten durch den Gesamttext unter Ziff. 1. c) des Klageantrages das Urheberrecht der Klägerin nicht verletzt wird, steht ihr gegen die Beklagte zu 1) auch kein Anspruch auf Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung gemäß §§ URHG § 97, URHG § 101 UrhG, § BGB § 259 Abs. BGB § 259 Absatz 2 BGB zu.
Auch ein Anspruch auf Erstattung vorgerichtlicher Abmahnkosten, wie mit dem Klageantrag zu 3. geltend gemacht, besteht infolgedessen nicht.
D. (…)
Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Sache weder grundsätzliche Bedeutung hat noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordern (§ ZPO § 543 ZPO). Die Entscheidung beruht auf der Anwendung anerkannter Rechtssätze im konkreten Einzelfall.
Dem Urteil ist zuzustimmen. Durch eine erschöpfende Darstellung kann ein Wissenschaftsautor nicht andere ausführlichen Darstellungen zum gleichen Thema, die notwendigerweise erhebliche Überschneidungen aufweisen müssen, urheberrechtlich blockieren. Wird plagiatfrei und wissenschaftlich redlich die Grundlage verwertet, muss eine entsprechende "Ausbeutung" der eigenen Ergebnisse grundsätzlich hingenommen werden, auch wenn das "moralische Empfinden" vieler Wissenschaftler eher der Klägerin Recht geben würde. Auch wenn es sich nicht um eine kritische Überprüfung ("restudy") handelt, gebietet die Wissenschaftsfreiheit, bei dem Urheberrechtsschutz wissenschaftlicher Texte zurückhaltend zu sein.
Haberstumpf ist aber gar nicht einverstanden und schäumt in der ZUM 2012, S. 529ff.: "Die Piratenbewegung hat deshalb auch auf dem Gebiet der Wissenschaften nicht recht, wenn sie die Zurückdrängung des Urheberrechts fordert. Dass sich die deutsche Rechtsprechung auf ihre Seite geschlagen hat, kann deshalb nur bedauert werden."
KlausGraf - am Dienstag, 3. September 2013, 16:28 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.arthistoricum.net/themen/portale/kuenstlersozialgeschichte/
Das Portal geht sein Thema extrem konventionell an statt auf digitale Kunstgeschichte zu setzen. Die übliche karge Kost (Ankündigungen,. Vortrags-Abstracts) statt opulenter Volltexte oder Bildsammlungen. Kein Web 2.0.
Das Portal geht sein Thema extrem konventionell an statt auf digitale Kunstgeschichte zu setzen. Die übliche karge Kost (Ankündigungen,. Vortrags-Abstracts) statt opulenter Volltexte oder Bildsammlungen. Kein Web 2.0.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 3. September 2013, 15:54 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
1) http://www.siwiarchiv.de/2013/09/suchanfrage-wappen-ii/
2) http://www.siwiarchiv.de/2013/08/sammlungsgut-im-kreisarchiv-2/
2) http://www.siwiarchiv.de/2013/08/sammlungsgut-im-kreisarchiv-2/
KlausGraf - am Dienstag, 3. September 2013, 13:16 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 3. September 2013, 02:14 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ausstellungseröffnung am Donnerstag, den 12. September 2013 um 18 Uhr Im Studienzentrum für Künstlerpublikationen in der Weserburg, Bremen.

Raumfahrthistorisches Archiv Bremen
Begrüßung Sigrid Dauks, Arbeitskreis Bremer Archive.
Einführung Bettina Brach, Studienzentrum für Künstlerpublikationen
"Archive sind Orte, an denen Informationen und Wissen erhalten und zugänglich gemacht werden, sie bilden unser kulturelles Gedächtnis. Auf der Schwelle zur digitalen Epoche dokumentiert Pia Pollmanns den Istzustand von Archiven. Das in 19 Häusern entstandene und 68 Fotografien umfassende Portrait Bremer Archive ist zugleich ein visuelles Plädoyer für deren Erhaltung und Nutzung. In Konzentration auf die drei Aspekte Raum, Struktur und Inhalt hat Pia Pollmanns die Archive auf jeweils gleiche Weise fotografiert. So ist eine einheitliche Bildsprache entstanden,
die es ermöglicht, die unterschiedlichen Archive miteinander in Verbindung zu setzen und sie in ihrer Vielfalt als eine Einheit zu betrachten. Mit der Arbeit was bleibt hat Pia Pollmanns 2012 ihr Diplom an der Hochschule für Künste Bremen bei Prof. Peter Bialobrzeski absolviert"
Öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag 11–18 Uhr, Donnerstag 11–20 Uhr,
Montag geschlossen
Die Ausstellung wird veranstaltet vom
Arbeitskreis Bremer Archive, www.bremer-archive.de
Im Rahmen von fotokunstbremen
Die Künstlerin ist anwesend
Quelle: Homepage Weserburg

Raumfahrthistorisches Archiv Bremen
Begrüßung Sigrid Dauks, Arbeitskreis Bremer Archive.
Einführung Bettina Brach, Studienzentrum für Künstlerpublikationen
"Archive sind Orte, an denen Informationen und Wissen erhalten und zugänglich gemacht werden, sie bilden unser kulturelles Gedächtnis. Auf der Schwelle zur digitalen Epoche dokumentiert Pia Pollmanns den Istzustand von Archiven. Das in 19 Häusern entstandene und 68 Fotografien umfassende Portrait Bremer Archive ist zugleich ein visuelles Plädoyer für deren Erhaltung und Nutzung. In Konzentration auf die drei Aspekte Raum, Struktur und Inhalt hat Pia Pollmanns die Archive auf jeweils gleiche Weise fotografiert. So ist eine einheitliche Bildsprache entstanden,
die es ermöglicht, die unterschiedlichen Archive miteinander in Verbindung zu setzen und sie in ihrer Vielfalt als eine Einheit zu betrachten. Mit der Arbeit was bleibt hat Pia Pollmanns 2012 ihr Diplom an der Hochschule für Künste Bremen bei Prof. Peter Bialobrzeski absolviert"
Öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag 11–18 Uhr, Donnerstag 11–20 Uhr,
Montag geschlossen
Die Ausstellung wird veranstaltet vom
Arbeitskreis Bremer Archive, www.bremer-archive.de
Im Rahmen von fotokunstbremen
Die Künstlerin ist anwesend
Quelle: Homepage Weserburg
Wolf Thomas - am Montag, 2. September 2013, 20:09 - Rubrik: Wahrnehmung
An welchen Archivstandorten kann man noch mit dem Boot vorbeifahren? Antworten bitte mit Beweis.
Wolf Thomas - am Sonntag, 1. September 2013, 16:26 - Rubrik: Kommunalarchive
"„Wiki Loves Monuments 2012“ ist vorüber und 2013 geht es weiter. Der weltweit größte Fotowettbewerb rund um Bau- und Kulturdenkmäler wird durchgeführt von Wikipedia.
Damit wird die kulturelle Vielfalt und die lange Geschichte Europas und der anderen Kontinente dokumentiert und ein Bewusstsein für Regionalgeschichte geschaffen werden. Es ging im Wettbewerb darum, im September möglichst viele Fotos von Kulturdenkmälern zu sammeln und allen Menschen zur Verfügung zu stellen. Die Listen der Denkmäler mit nationaler Bedeutung sind über diese Website erreichbar."
http://www.wikilovesmonuments.de/de/
Damit wird die kulturelle Vielfalt und die lange Geschichte Europas und der anderen Kontinente dokumentiert und ein Bewusstsein für Regionalgeschichte geschaffen werden. Es ging im Wettbewerb darum, im September möglichst viele Fotos von Kulturdenkmälern zu sammeln und allen Menschen zur Verfügung zu stellen. Die Listen der Denkmäler mit nationaler Bedeutung sind über diese Website erreichbar."
http://www.wikilovesmonuments.de/de/
SW - am Sonntag, 1. September 2013, 11:39 - Rubrik: Wikis
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen