Um auch auf dem Gebiet des Open Access die Verbundenheit der Alumni und der Hochschule zu stärken, wäre es sinnvoll, den Alumni die Möglichkeit zu eröffnen, wissenschaftliche Publikationen auf dem Hochschulschriftenserver zu deponieren.
Bereits jetzt dürften viele Hochschulen hinsichtlich der Qualifikationsarbeiten wie Dissertationen und Habilitationen, die an der Hochschule entstanden sind, eine Veröffentlichung auf dem Hochschulschriftenserver ohne zeitliche Begrenzung ermöglichen. Als ich vor Jahren in Tübingen wegen meiner Dissertation (1987) anklopfte, erhielt ich die Auskunft, diese könne auf dem Tübinger Schriftenserver veröffentlicht werden.
Es dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen, dass ein Hochschulschriftenserver (auch wenn ärmelschonerbewehrte bürokratische Verwalter nicht selten sind, wie ich von Freidok weiss) die Beiträge eines Alumnus, der Nobelpreisträger ist, aufnehmen würde, auch wenn dieser an einer anderer Universität inzwischen lehrt.
Eine Öffnung der Schriftenserver hätte überwiegend Vorteile:
(1) Der Schriftenserver würde weiter gefüllt, siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/3264283/
(2) Es besteht die Chance, wertvolle Fachpublikationen Open Access zu machen, etwa aus dem Bereich der Wirtschaft oder der Politik.
Es wäre vermutlich der Universität Leipzig hochwillkommen, Publikationen einer ehemaligen Diplomandin, Frau Angela Merkel, einstellen zu dürfen.
(3) Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Open Access für die Wissenschaftskommunikation wäre eine Stärkung der Bindungen zwischen Universität und Alumni auch auf diesem Gebiet wichtig.
Daher hat die Uni Göttingen 2007 auf dem Göttinger Alumni-Tag auch Open Access vorgestellt.
(4) Da Peter Suber und Brewster Kahle derzeit ihren Plan eines universalen Repositoriums nicht weiterverfolgen und für Publikationen aus vielen Disziplinen auch aus Sprachgründen ein disziplinäres Repositorium nicht in Betracht kommt, würde eine flächendeckende Alumni-Regelung eine große Lücke bei der Möglichkeit, Open Access-Publikationen in einem anerkannten OA-Server unterzubringen, schließen.
Die meisten wissenschaftlich Tätigen, die nicht an eine Hochschule angebunden sind, haben einen Hochschulabschluss, sind also Alumni. Ihre Publikationen wären also mit dem Alumni-Privileg ohne weiteres für OA (im Sinne des grünen Wegs) gesichert.
Auch Wissenschaftler (z.B. aus der Dritten Welt), die an einer Hochschule tätig sind, die noch keinen Schriftenserver unterhält, können auf diese Weise Self-Archiving betreiben.
Als Nachteile könnten angesprochen werden:
a) die strikte Begrenzung der Schriftenserver für Hochschulangehörige wird aufgeweicht
In vielen Hochschulen lässt man aber auch bereits jetzt schon nach Einzelfallprüfung hochwertige externe Publikationen zu (z.B. die FU Berlin die Vier Prinzen) zu.
b) einzelne Alumni-Publikationen genügen nicht wissenschaftlichen Standards
Das ist auch bei Publikationen von Hochschulangehörigen mitunter der Fall. Eine kursorische Prüfung vor Einstellung wäre sicher akzeptabel, sollte sich herausstellen, dass Inakzeptables eingeliefert wird.
Dieser Vorschlag plädiert dafür, von der mantra-artigen Behauptung, nur institutionelle Mandate könnten Dokumentenserver füllen, abzusehen und neue Wege auszuprobieren. Es ist definitiv falsch, dass nur institutionelle Mandate OA wirklich fördern können, wie das niederländische Programm "Cream of Science" beweist. Und die wissenschaftliche Produktion der nicht an einer Hochschule Tätigen wird durch dieses Mantra in schäbiger Weise mit Füßen getreten.
NVwZ-RR 2008, S. 700f.
Auszüge aus dem Urteil:
Am 29. 6. 2005 hielt sich der Kl. im Lesesaal der Badischen Landesbibliothek in K. [wo außer in Karlsruhe gibt es eine Badische Landesbibliothek??] auf. Dort fotografierte er ohne deren Einwilligung eine andere Bibliotheksnutzerin, Frau X, die ihm seiner Ansicht nach den von ihm benutzten Arbeitsplatz streitig gemacht hatte. Der Aufforderung von Frau X, den Film herauszugeben, kam der Kl. nicht nach. Der hinzu gerufene Polizeivollzugsdienst verbrachte den Kl. zum Polizeirevier K., wo der Film beschlagnahmt und in Verwahrung genommen wurde. In der dem Kl. ausgehändigten Beschlagnahmeverfügung wird als Grund für die Beschlagnahme angegeben „Schutz privater Rechte (KUG)“. Mit seinem am 29. 7. 2005 erhobenen Widerspruch machte der Kl. geltend, dass eine nach § 22 KUG allein verbotene Veröffentlichung oder Verbreitung des Bildes nicht zu befürchten sei. Eine andere Vorschrift, die das Fotografieren von Personen hindere, sei nicht ersichtlich. Mit Widerspruchsbescheid vom 28. 11. 2005 wies das Regierungspräsidium K. den Widerspruch zurück. Der Kl. hat hiergegen zunächst Anfechtungsklage erhoben. Mit Urteil vom 2. 4. 2007 hat das VG die Klage, mit der nunmehr sachdienlich ein Fortsetzungsfeststellungsbegehren verfolgt werde, abgewiesen.
Die hiergegen eingereichte Berufung des Kl. war ohne Erfolg.
[...]
§ 22 KUG erwähnt als - nach § 33 KUG strafbewehrte - Verletzungshandlungen nur die Verbreitung und öffentliche Zurschaustellung eines Bildnisses ohne Einwilligung des Abgebildeten. § 201a StGB stellt das unbefugte Herstellen von Bildaufnahmen aus dem höchstpersönlichen Lebensbereich unter Strafe. Es ist indessen anerkannt, dass - nicht zuletzt angesichts der nur fragmentarischen Natur des Strafrechts - diese Regelungen nicht abschließend sind. Vielmehr kann auch das bloße Herstellen einer Aufnahme einer Person, die sich nicht im persönlichen Rückzugsbereich, sondern in der Öffentlichkeit aufhält, gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht verstoßen (vgl. Wandtke/Bullinger/Fricke, UrheberR, 2. Aufl. [2006], § 22 KUG, Rdnr. 9; Steffen, in: Löffler, PresseR, 5. Aufl. [2006], § 6 LPressG, Rdnrn. 119, 123, jew. m.w. Nachw.; VGH Mannheim, Urt. v. 22. 2. 1995 - 1 S 3184/94). Denn schon dadurch wird das Erscheinungsbild des Betr. in einer bestimmten Situation von seiner Person abgelöst, datenmäßig fixiert und seiner Kontrolle und Verfügungsmacht entzogen, woraus ein Schutzbedürfnis erwächst (s. BVerfGE 101, 361 [380f.] = NJW 2000, 1021; BVerfG, NJW 2008, 1793). Die Feststellung eines unzulässigen Eingriffs in das Persönlichkeitsrecht des Betr. durch das Anfertigen eines Bildes erfordert eine Würdigung aller Umstände des Einzelfalls und eine Güter- und Interessenabwägung der schutzwürdigen Rechtsposition der Bet. (BGH, NJW 1995, 1955f. = GRUR 1995, 621). Hiernach ist nichts dafür ersichtlich, dass die Betr. die Anfertigung der Bilder durch den Kl. hätte dulden müssen. Ein anerkennenswertes Interesse, die Betr. zu fotografieren, hat der Kl. nicht dargetan. Die von ihm geäußerten Vermutungen und Verdächtigungen entziehen sich einer rationalen Bewertung. Sie sind vielmehr Ausdruck eines offensichtlich schon lang andauernden psychiatrischen Krankheitsbildes, das sich in Wahnvorstellungen äußert. In einer solchen Situation gewinnt das Interesse der Betr., nicht von einem Unbekannten fotografiert zu werden, besonderes Gewicht. Denn das Verhalten des Kl. stellte sich aus der Sicht der Betr. - auch ohne nähere Kenntnis des psycho-pathologischen Hintergrunds - so dar, dass die Bandbreite eines allgemein üblichen und verständlichen Vorgehens deutlich überschritten war; es konnte von ihr als unberechenbar, wenn nicht gar bedrohlich, angesehen werden. (Wird ausgeführt.)
b) Am polizeilichen Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts vor Beeinträchtigungen, die - wie hier - weder durch die Strafgesetze noch durch das Ordnungswidrigkeitenrecht sanktioniert sind und bei denen demnach nicht die Unversehrtheit der Rechtsordnung in Bezug auf Normen des öffentlichen Rechts in Rede steht, muss nach der ausdrücklichen Regelung in § 1 I 1 PolG ein öffentliches Interesse bestehen. Dieses Interesse kann sich insoweit allein aus dem im Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 III GG wurzelnden allgemeinen Justizgewährleistungsanspruch ergeben, der wirkungsvollen Rechtsschutz garantiert (vgl. zuletzt: BVerfGE 117, 71 [121f.] = NJW 2007, 1933 m.w. Nachw.; s. auch Denninger, in: Lisken/Denninger, Hdb. d. PolizeiR, 4. Aufl. [2007], Kap. E, Rdnr. 30). Damit wird auf die Bestimmung des § 2 II PolG Bezug genommen. Danach obliegt der Schutz privater Rechte der Polizei nur auf Antrag des Berechtigten und nur dann, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne polizeiliche Hilfe die Gefahr besteht, dass die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert wird.
Der Polizeivollzugsdienst des Bekl. hat diese Voraussetzung nicht verkannt. Er hat die Beschlagnahme als Sicherungsmaßnahme im Hinblick auf den erst noch zu beantragenden gerichtlichen Rechtsschutz angeordnet (vgl. VGH Mannheim, NVwZ 2001, 1292 = VBlBW 2001, 102f.). Dabei ist er zu Recht von einer besonderen Dringlichkeit ausgegangen, da gerade die unbefugte Verfügungsmöglichkeit des Kl. über eine Fotografie der Betr. in Rede stand und ohne einen sofortigen polizeilichen Zugriff unkontrollierte Vervielfältigungen zu besorgen waren.

Das Brauerstraßen-Bild stammt aus dem Karlsruher Stadtwiki, eine Lizenz ist nicht angegeben, denn die Standardlizenz CC-BY-NC-SA gilt nicht für Bilder. Wir sind bereit, auch ohne anwaltliche Abmahnung das Bild vom Netz zu nehmen, wenn der Rechteinhaber dies wünscht.
Wikipedia-Artikel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Otfried_Preu%C3%9Fler
Homepage Preußlers:
http://www.preussler.de/
Zu diesem über die Jahre stetig wachsenden Bestand kommen immer wieder Spezialsammlungen als Schenkungen hinzu. Auch aus Nachlassbeständen erhält die Bibliothek wertvolles Material,
z. B. Erstausgaben, teilweise signiert, Manuskripte, Autographen, Originalillustrationen, Plakate.
Besonders hervorzuheben sind die Nachlässe von Michael Ende, James Krüss und Heinrich Maria Denneborg sowie der Vorlass von Binette Schroeder und eine umfangreiche Schenkung der Bücher Erich Kästners. .....
Quelle:
http://www.ijb.de/
Habel musste sein Studium abbrechen und Heidelberg verlassen, nachdem er bei einem Säbelduell seinen Gegner lebensgefährlich verletzt hatte. Er ging nach Schierstein, wo sein Vater ebenfalls einen großen Gutshof mit rund 250 Morgen Land besaß. Als Friedrich Gustavs Vater 1814 starb, erbte er dieses Gehöft und war fortan wirtschaftlich unabhängig. So konnte er sich ganz seinem Hobby widmen, ohne seine Zeit in Staatsdiensten verbringen zu müssen.
Habel engagierte sich besonders im Verein für Nassauische Altertumskunde. Gut 30 Jahre lang wirkte er dort als Vereinssekretär. Seine ganz besondere Liebe jedoch galt den mittelalterlichen Burgen in der Region. Viele von ihnen waren im 19. Jahrhundert trotz der Geistesbewegung der Romantik vom endgültigen Verfall bedroht. Habel stemmte sich gegen diese Entwicklung - und ließ sich dies auch eine Stange Geld kosten. Vier Burgen, nämlich die in Eppstein, Burg Gutenfels bei Kaub, Burg "Maus" über St. Goarshausen und schließlich Burg Reichenberg im heutigen Rheinland-Pfalz, kaufte er einfach. Habels wohl größte Leistung war die Ausgrabung des Römerkastells Saalburg im Taunus.
Sein Leben beschloss Habel übrigens nicht in Schierstein. Eines Nachts waren ohne sein Wissen zehn Pappeln auf seinen dortigen Ländereien gefällt worden - auf Befehl des zuständigen Feldgerichtes, das in den Bäumen "schädliche Gewächse" sah. Habel war darüber so erbost, dass er das gesamte Gut verkaufte und nach Miltenberg zog. Hier starb er am 2. Juli 1867. ...."
Wäre schön, wenn weitere Beispiele folgen .....
Quelle:
http://www.main-rheiner.de/region/objekt.php3?artikel_id=3476746
"Die wichtigste Figur im Schach ist die Dame. Das weiß natürlich auch die Literaturstudentin Carla Winkler. Aber dass ausgerechnet eine Schachdame ihr Leben so gänzlich verändern würde, konnte sie nicht ahnen.
Für sie beginnt nach einem spektakulären Fund im Marbacher Literaturarchiv eine abenteuerliche Reise ins Quattrocento an den Hof der Medici. Ein außergewöhnliches Geheimnis umgibt den Sonettdichter und Erneuerer des Schachspiels Filippo Gattoni und seinen mysteriösen Schüler...
Mit ihrem neuesten Roman „Damenopfer“ stellt die Autorin eine raffiniert konstruierte Geschichte vor, die sie mit intellektueller Leidenschaft und Anmut erzählt. Begleiten Sie uns und die Autorin auf den Spuren ihrer Protagonistin und lassen Sie sich von dieser spannenden und klugen, vergnüglichen wie herausfordernden Geschichte in Bann schlagen und unterhalten.
Ulrike Zubal arbeitet neben ihrer Tätigkeit als freie Autorin auch als Journalistin und ist Mitarbeiterin beim SWR Fernsehen."
Quelle:
http://www.kulturkurier.de/veranstaltung_135039.html
Die dazugehörige Bilderserie vermittelt einen Eindruck über die Unterbringung des Archivs:

Im Keller des NCG türmen sich die alten Klausuren. (Bild: Neumann)

Auch alte Klassenhefte finden sich im Archiv. (Bild. Neumann)

Normalerweise schützt Plastikfolie die alten Hefte. (Bild: Neumann)

Die Siegener Zeitung (Link) stellt heute die Ausstellung "Archiv für nicht gestellte Fragen" des Mainz-Wiesbadener Malers Jens Andres in der Sparkasse Siegen-Weidenau vor. Die Präsentation "installativer Malerei" wird heute abend um 19:30 eröffnet.
https://online.sagepub.com/cgi/register?registration=FTOct2008-10
Kostenlose Registrierung notwendig
Mit Dank an fossa
Volker Braun, Bernd Jentzsch, Karl Mickel, Heinz Czechowski, Reiner Kunze oder Rainer und Sarah Kirsch zählten zur ersten Generation von Lyrikern, die der studierte Germanist als Lektor beim Mitteldeutschen Verlag Halle (Saale) in den 60er Jahren betreute. Wolf öffnete auch Autoren wie Werner Bräunig (1934-1976) den Weg, dessen Roman „Rummelplatz“ 2007 im Berliner Aufbau-Verlag postum erschien (mit einem Vorwort von Christa Wolf). Er wurde als literarische Entdeckung („sozialistischer Entwicklungsroman der DDR-Gründerjahre“) und als einer der besten deutschen Nachkriegsromane gefeiert.....
Die Berliner Akademie der Künste hat das Archiv Wolfs erworben und in einer Ausstellung vor zwei Jahren der Öffentlichkeit erste Einblicke gewährt. Zum Archivbestand gehören auch Lyrik-Grafik- Editionen und Publikationen aus der subkulturellen Bewegung vor allem der 80er Jahre in der DDR. ...."
Quelle:
http://www.berlinerliteraturkritik.de/index.cfm?id=19750
Die insgesamt 215 gezählten Handschriftenfragmente sind bei der Katalogisierung im 19. und 20. Jahrhundert aus Reichenauer Einbänden herausgelöst worden. Sie gehören zu den frühesten Schriftzeugnissen unseres Kulturraumes und finden international Beachtung.
Dank finanzieller Unterstützung aus dem Landesrestaurierungsprogramm Baden-Württemberg konnten die nötigen konservierenden Maßnahmen an den Reichenauer Fragmenten durchgeführt werden. Anschließend wurden sie digitalisiert und für das Internet aufbereitet.
Die Reichenauer Fragmente stehen vollständig im Internet zur Verfügung.
Zugang zu den digitalisierten Fragmenten: http://www.blb-karlsruhe.de/virt_bib/fragmenta_augiensia/
Gerade bei Fragmentabbildungen sollte man nicht mit der Auflösung geizen, da es hier auf kleinste Details ankommt. Leider ist die maximale Auflösung für minutiöse Forschungen nicht ausreichend.

Ich seh aber leider nur Zeichensalat (beim FF hilft "plein ecran"). Irgendwie werde ich den DFG-Viewer noch lieben müssen angesichts der Tatsache, dass irgendwelche Popel-Stadtbibliotheken Digitale Bibliotheken aufsetzen, die man nur mit viel Glück einsehen kann.
http://archiv.twoday.net/stories/5255903/
Der umstrittene „Intranet-Paragraph“ 52a des Urheberrechtsgesetzes wird vorerst um vier Jahre bis Ende 2012 verlängert. Damit dürfen Schulen und Hochschulen weiterhin in geringem Umfang urheberrechtlich geschützte Inhalte für den Unterricht im Intranet bereitstellen.
Die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD haben sich darauf verständigt, Paragraph 52a des Urheberrechtsgesetzes um weitere vier Jahre, bis zum 31. Dezember 2012 zu verlängern. Nach geltendem Gesetz wäre der „Intranet-Paragraph“ zum Jahresende ausgelaufen. Das hätte zur Folge gehabt, dass Schulen, Hochschulen und diverse andere Einrichtungen urheberrechtlich geschützte Texte aus Büchern und Zeitschriften, die sie für Unterrichtszwecke im Intranet einem eng begrenzten Personenkreis – etwa einer Gruppe von Seminarteilnehmern – zur Verfügung stellen, hätten entfernen müssen.
Meldet http://www.irights.info/index.php?id=81&tx_ttnews[tt_news]=410&cHash=6422b0ff19
Nachtrag: Die Verlängerung wurde beschlossen:
http://oebib.wordpress.com/2008/11/22/aktueller-stand-urheberrecht-die-dbv-rechtskommission-teilt-mit/
Nachdem Dr. Paul Katzenberger wiederholter Autor der DIN-Mitteilungen ist, wundert es nicht, dass er in seinem Kommentar (Schricker, UrhG) die Neuregelung sehr begrüßt. Eine Auseinandersetzung mit Fuchs
http://delegibus.org/2004,8.pdf
erfolgt nicht.
Zur Kritik
http://www.enev24.de/idin/news/pub/home.php
http://delegibus.org/2004,8.pdf
http://www.jur-abc.de/cms/index.php?id=142
http://normenblog.blogspot.com/2008/03/zitieren-verboten.html
http://archiv.twoday.net/stories/3114268
Beispiel zu Abdruckerlaubnissen: In einem Fachbuch (das unter keinen Umständen auch als E-Book vertrieben werden darf) sollen die Zitierregeln (Bezugspreis bei Versand 65,60 Euro) abgedruckt werden. Bei einer Auflage von 500 Stück wären 2 % je Exemplar 656 Euro. Glaubt man Hardcore-Lobbyisten wie Katzenberger ist alles, was der Beuth-Verlag will, "angemessen" im Sinne des Gesetzgebers.
Die Regelungen über die Vervielfältigung in § 53 UrhG gelten uneingeschränkt auch für Normen. Es spricht nichts dafür, dass insbesondere kürzere Normenausgaben als Bücher anzusehen sind, die nicht als Ganzes vervielfältigt werden dürfen (wohl aber abgeschrieben). Kleine Teile dürfen in jedem Fall für den sonstigen eigenen Gebrauch kopiert werden. Es ist daher RECHTSWIDRIG, wenn Bibliotheken das Kopieren von DIN-Normen grundsätzlich verbieten.
Die Rechtswidrigkeit ergibt sich bei der Datenbanknutzung von PERINORM unmittelbar aus § 87e UrhG und bei Nutzung gedruckter Texte aus der Tatsache, dass eine Rechtsgrundlage in der jeweiligen Benutzungsordnung, wenn eine zulässige Kopie vorliegt, nicht gegeben ist. Der Benutzer kann sich zudem auf die Informationsfreiheit des Art. 5 GG berufen.
Beispiel:
TU Ilmenau verbietet das Kopieren von DIN-Normen mit VDE-Klassifikation
http://www.tu-ilmenau.de/ub/INFO-8.info-8.0.html
Ebenso TIB ("Kopien daraus dürfen jedoch nur von Angehörigen der Leibniz Universität Hannover angefertigt werden.") und viele andere. Art. 3 GG ist hier eindeutig verletzt.
Oder in Darmstadt:
"Studenten und Hochschulangehörige der TUD und FHD dürfen DIN-Dokumente kopieren (€ 0,05/Seite), bitte Studenten- bzw. Dienstausweis mitbringen. Die Kopien müssen mit dem PIZ-Stempel kenntlich gemacht werden.
VDI-Dokumente dürfen nur auf spezielles VDI-Papier kopiert werden, in dem Kopierpreis ist eine Lizenzgebühr für den VDI enthalten.
TUD/FHD-Angehörige: € 0,70/Seite
Firmen/Privatpersonen: € 1,00/Seite "
Der Staat finanziert DIN kräftig mit, muss aber doppelt bezahlen, denn die Auslegestellen für DIN-Normen kosten den Steuerzahler erhebliche Summen. Die UB Stuttgart musste 2006 45.000 Euro dafür zahlen:
http://archiv.twoday.net/stories/3114268
Es ist schlichtweg unerträglich, dass im öffentlichen Interesse entwickelte Normen vom Staat zurückgekauft werden müssen, damit Bürger die Möglichkeit haben, sie einzusehen.
Während z.B. die UB Stuttgart behauptet, dass gemäß den Nutzungsbedingungen auch Walk-in-Usern Download und Ausdruck ermöglicht werden, sehen andere Auslegestellen das anders.
Beispiel: TU Harburg gestattet die Kopie nur Studierenden und TU-Angehörigen.
http://www.ub.tu-harburg.de/4751.html
DIN-Normen können auch nicht per Fernleihe bestellt werden, obwohl die Leihverkehrsordnung keine solche Bestimmung enthält. Beispiel:
http://www.zbsport.de/Haeufig-gestellte-Fragen-zur-Fernleihe.html
Rätselhaft ist auch der auf den Webseiten der Auslegestellen enthaltene Hinweis: "Die Normensammlung darf gemäß §53 des Urheberrechtsgesetzes nicht zu kommerziellen Zwecken genutzt werden." Ein (analoger) Ausdruck kleiner Teile erschienener Werke auch zu gewerblichen Zwecken ist ohne weiteres zulässig. Der Ausschluss der gewerblichen Vielfältigung bei Datenbankwerken bezieht sich nur auf diese als Ganzes oder deren schutzfähige Teile, nicht aber auf einzelne Elemente (Loewenheim in Schricker³, UrhG § 53 Rz. 51). Da es sich auch um eine geschützte einfache Datenbank handelt, sind die europarechtlich abschließenden Schranken der §§ 87a ff. UrhG und insbesondere § 87e UrhG anzuwenden, der kein grundsätzliches Nutzungsverbot bei Entnahme unwesentlicher Teile zu kommerziellen Zwecken vorsieht, wenn diese nicht systematisch erfolgt.
Klar ist: Technische Normen sind Bestandteil der Rechtsordnung und als solche müssen sie gemeinfrei sein. "Der dem Gesetz unterworfene Bürger soll sich über Vorschriften aller Art, Entscheidungen und über sonst rechtserhebliche Unterlagen und Äußerungen in gerichtlichen und behördlichen Verfahren frei unterrichten können". Diese Aussage des BVerfG bleibt auch nach der Novellierung des UrhG gültig:
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk19980729_1bvr114390.html
"Wenn man die Frage stellt: Gibt es Komponistinnen, so ergibt sich daraus zwangsläufig auch die nächste Frage: Wo sind ihre Werke?", so Renate Matthei, Vorsitzende des aktuellen Vorstandes des Arbeitskreises Frau und Musik. Diese Frage stellten sich wohl auch schon die Gründerinnen des Archivs. Mascha Blankenburg begann, den gesamten Noten-Bestand im musikwissenschaftlichen Institut Köln zu durchforsten, um schließlich auf eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Komponistinnen zu stoßen: "Ich platzte vor Spannung. Wie mochte diese Musik klingen? Wird sie so gut sein, wie die der männlichen Kollegen? Wie haben diese Frauen gelebt?" Ihre Entdeckung gab Anstoß, noch intensiver in diesem Bereich zu forschen, bis heute. Innerhalb von nur einem Jahr waren mit Hilfe der Mitglieder des Internationalen Arbeitskreises Frau und Musik rund 300 weibliche Namen in diversen Musikbibliotheken gefunden. Das Archiv Frau und Musik war geboren.
Was anfangs eher als Privatinitiative begann, wuchs schnell zu einer bedeutenden Institution im Bereich Frau und Musik heran. Nach sieben Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit ermöglichte eine feste finanzielle Förderung den regelmäßigen und qualifizierten Einsatz von ständigen MitarbeiterInnen, die jetzige Finanzierung ermöglicht 3 feste Stellen.
Außerdem zog das Archiv erstmals mit Hilfe der Stadt Kassel in eigene Räumlichkeiten. Nach drei weiteren Umzügen befindet sich das Archiv nun in den Hoffmanns Höfen, Frankfurt am Main, wo es nicht nur seinen festen Platz innerhalb einer hervorragenden Infrastrukur, sondern auch im Kulturleben der Mainmetropole gefunden hat.
Das Archiv wird langjährig geleitet vom Vorstand des Internationalen Arbeitskreises Frau und Musik e.V. Dies sind: Renate Brosch, Renate Matthei, Dietburg Spohr. ......
Mit seinen ca. 20.000 Medieneinheiten ist das Archiv Frau und Musik das umfangreichste internationale Komponistinnen-Archiv weltweit. Neben Kompositionen und sonstigen künstlerischen Nachlässen musikschaffender Frauen werden Sekundärliteratur, Hochschulschriften, Presseveröffentlichungen sowie graue Literatur, wie zum Beispiel Konzertprogramme, gesammelt. Zahlreiche Tonträger veröffentlichter Werke, Mitschnitte von Rundfunksendungen oder private Aufnahmen von Konzerten finden im Archiv ihren festen Platz. Video- und DVD-Aufzeichnungen runden den Bestand ab.
Zu den besonderen Schätzen des Archivs gehören ein Fundus an Erstdrucken, insbesondere des 19. Jahrhunderts, und Brief-Autografen von Clara Schumann. Den Bestand klassischer Kompositionen ergänzt eine Sondersammlung zu den Bereichen Rock, Pop, Jazz, Chanson und Weltmusik. ....."
Quelle:
http://www.archiv-frau-musik.de
Schnelle deutsch-englische Übersetzungen rief ich online bisher mit der Eingabe de-en in Google ab. Beispiel:
http://www.google.de/search?num=100&hl=de&rlz=1C1CHMB_deDE291&q=de-en+archiv&btnG=Suche&meta=
Ich habe mir jetzt aber ein Suchkürzel ( http://archiv.twoday.net/stories/4109286/ ) in Chrome angelegt. So komfortabel wie im FF gehts es nicht, aber es funktioniert.
Wenn man in Pons gesucht hat, kann man "Optionen" aufrufen (Teil des Schraubenschlüssel-Menüs rechts) und dort bei Standardsuche Verwalten wählen. Unten findet man dann auch die Pons-Suchanfrage. Diese kann man bearbeiten, indem man das Suchkürzel nach eigenem Gusto verändert. In der URL steht % für das Suchwort.
http://www.pons.eu/dict/search/results/?q=%r&l=deen
Wenn ich pons archiv in der Chrome-Adresszeile eingehe, erhalte ich sofort die PONS-Übersetzung ins Englische. Das würde aber auch mit LEO funktionieren ...
http://static.twoday.net/arcana/files/Ludwig-Bittner-Ein-politischer-Archivar.pdf
http://www.szon.de/lokales/markdorf/salem/200810140512.html
http://www.szon.de/lokales/markdorf/salem/200810140739.html
 Prälatur- und Konventgebäude Foto: Daniel Hüneborg flickr.com CC-BY
Prälatur- und Konventgebäude Foto: Daniel Hüneborg flickr.com CC-BYhttp://www.wissenschaftliches-arbeiten.org/zitieren/wikipedia.html
enthält auch den unvermeidlichen Absatz über die Wikipedia, der die Zitierfähigkeit in Bausch und Bogen abgesprochen wird. Ich seh das bekanntlich differenzierter.
Ein Archiv aber hat die Karawane trotzdem, auf dem Rücken der Kamele, inmitten des reichen Gefolges. Nicht wundern, nicht fragen, nur staunen und hineinversenken. So geht es manchem der Gelehrten, die in den schaukelnden Archiven alte Handschriften und Urkunden konsultieren. Zuweilen treffen sie auf ihresgleichen und diskutieren. Manchmal, heißt es, komme so vielleicht ein bisschen Wissen zustande - oder gar ein Geistesblitz. ....."
Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hedwig_Courths-Mahler
http://www.literaturtradition-sachsen-anhalt.de/html/courths_mahler.html
http://www.tourist-information-nebra.de/index.html
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/
I. Gastbeiträge (alphabetisch)
Gudrun Gersmann
http://archiv.twoday.net/stories/5252988/
Eberhard Hilf
http://archiv.twoday.net/stories/5255913/
Thomas Hoeren
http://archiv.twoday.net/stories/5253008/
Rainer Kuhlen
http://archiv.twoday.net/stories/5254044/
Eric Steinhauer
http://archiv.twoday.net/stories/5253711/
Peter Suber
http://archiv.twoday.net/stories/5254012/
II. Allgemeine Informationen
Open Access - eine sehr kurze Einführung
http://archiv.twoday.net/stories/5251765/
Schlüsselbegriffe der Open-Access-Terminologie
http://archiv.twoday.net/stories/5253977/
Wo finde ich Informationen zu Open Access?
http://archiv.twoday.net/stories/5251767/
Wie finde ich Open-Access-Dokumente?
http://archiv.twoday.net/stories/5256264/
Nicht nur Zeitschriftenartikel ...
http://archiv.twoday.net/stories/5251764/
Nicht nur Zeitschriftenartikel ... Open Access auch für Kulturgut
http://archiv.twoday.net/stories/5254099/
Nicht nur Zeitschriftenartikel ... Open Educational Resources
http://archiv.twoday.net/stories/5252935/
III. Spezielle Themen
Heute ist internationaler Open Access Tag
http://archiv.twoday.net/stories/5252968/
Open Access im Küchenradio
http://archiv.twoday.net/stories/5253559/
Ideen, wie man die Dokumentenserver füllen kann
http://archiv.twoday.net/stories/5254162/
Dean Giustini's Top Five Ways for Librarians to Contribute to Open Access Movement
http://archiv.twoday.net/stories/5254166/
Dramatic Growth of Open Access, September 30, 2008
http://archiv.twoday.net/stories/5254167/
Wo kann ich archivische Fachbeiträge Open Access veröffentlichen?
http://archiv.twoday.net/stories/5251769/
Tagungsband Offener Bildungsraum Hochschule gratis im Netz
http://archiv.twoday.net/stories/5251716/
Tagungsband zum Social Tagging gratis im Netz
http://archiv.twoday.net/stories/5251739/
Offene Bildungsressourcen - Ausgabe der eLearning-Papers
http://archiv.twoday.net/stories/5251751/
Wie kam ich zu Open Access?
http://archiv.twoday.net/stories/5254157/
Neue Version des Hoeren-Skripts zum Download bereit
http://archiv.twoday.net/stories/5254830/
Die Public Domain festigen - eine Idee für Google
http://archiv.twoday.net/stories/5254117/
Kurzer Bericht von den Open Access Tagen Berlin
http://archiv.twoday.net/stories/5255238/
Einladung zum Creative Commons Salon Berlin
http://archiv.twoday.net/stories/5255243/
Open Access Scholarly Publishers Association, OASPA launched
http://archiv.twoday.net/stories/5255673/
Open Access Tag weltweit voller Erfolg
http://archiv.twoday.net/stories/5255679/
Open Access Haiku
http://archiv.twoday.net/stories/5255704/
Make all research results CC-BY (and the data PD)!
http://archiv.twoday.net/stories/5255746/
(zu libre Oben Access)
Elektronische Semesterapparate und Open Access
http://archiv.twoday.net/stories/5255903/
(auch zum § 52a UrhG)

http://www.dlib.org/dlib/july08/hagedorn/07hagedorn.html
Der OAI-Metadaten-Harvester OAIster ist die vielleicht wichtigste Ressource, die man kennen sollte:
http://www.oaister.org
Zu nennen ist auch das mangelhafte Konkurrenz-Angebot von
http://en.scientificcommons.org/
Was die deutschen Schriftenserver angeht, so sind die einschlägigen Links und Erläuterungen auf
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Bibliographieren
zu finden (samt Hinweisen auf Archivalia-Einträge). Die genannte Seite bezieht sich zwar schwerpunktmäßig auf Digitalisate, die genannten Internetquellen (z.B. der wissenschaftlichen Volltextssuchmaschinen) können aber auch beim Auffinden von aktueller OA-Forschungsliteratur nützlich sein.
Einen Teilbestand aus Google, nämlich die Volltexte in Repositorien, durchsucht (wenig zuverlässig):
http://www.opendoar.org/search.php
Zu den Open-Access-Aufsätzen gibt es zwei spezielle Datenbanken:
http://www.doaj.org (kleiner Bestand)
http://www.openj-gate.com (sehr viel größerer Bestand, englischsprachig)
Seit neuestem kennzeichnet Google Scholar kostenfreie Literatur mit einem grünen Dreieck:
http://archiv.twoday.net/stories/5185684/
Eine eigene Datenbank für OA-Monographien existiert nicht. Zahlreiche moderne Bücher (natürlich nur ein winziger Bruchteil des Verlagsprogrammes von Google Book Search) sind in Google Book Search mit der Einschränkung auf Volltext und entsprechendem Zeitfilter zu finden. In Worldcat ist ein gezieltes Filtern nach freien Quellen unmöglich, diese gehen unter in den NetLibrary-Treffern oder anderen kostenpflichtigen Angeboten. Unzählige Institutionen und manche Firmen bieten weltweit freie Online-Versionen von Büchern an. Hier hilft meist nur die Google Websuche, OAIster und die Bibliothekskataloge versagen weitgehend. Als Geheimtipp kann
die Suche nach fri e-bok in
http://webbgunda.ub.gu.se/cgi-bin/chameleon
gelten. Digital Book Index und die Online Book Page (für englischsprachige Fachliteratur) und weitere Quellen durchsucht die Meta-Suche:
http://libweb.lib.buffalo.edu/ft/EBooks.html

Fünfzehn Jahre digitaler Open Access wissenschaftlicher Ergebnisse
ein Beitrag zum Tag des Open Access 2008Eberhard R. Hilf (hilf (at) isn-oldenburg.de)
Zeitlose Anforderungen
Wissenschaftler brauchen bei ihrer Arbeit Informationen und Erkenntnisse anderer Forscher, und sie erzeugen Informationen, die andere Forscher nutzen können. Der Forschungsprozess wird also am effektivsten unterstützt, wenn man möglichst weltweit alle relevanten wissenschaftlichen Informationen bequem findet, sowie lesen und verarbeiten kann.Ausserdem wollen die Forscher, dass ihre Arbeiten möglichst von allen denkbar Interessierten gelesen werden können.
Dass Jedermann weltweit ohne Verzug seine wissenschaftlichen Dokumente verbreiten bzw. die anderer weltweit verteilter Autoren lesen kann, nennt man heute 'Open Access' OA.
Diese Anforderungen der Wissenschaft an das Management wissenschaftlicher Informationen ist unverändert und unabhängig von aktuellen technischen Realisierungsmöglichkeiten. Im Laufe der letzten hundertfünfzig Jahre hat sich international ein für das Papierzeitalter effektives System von wiss. referierten Zeitschriften herausgebildet, die gedruckt an die wiss. Bibliotheken vertrieben wurden. Das natürliche Geschäftsmodell war verdecktes Referieren vor der Veröffentlichung und 'toll-access', also das Subskriptionsmodell, die Bibliotheken bezahlen im Voraus und ohne dass sich bereits ein Leser gefunden hätte.
Dieses lässt sich kommerziell durch Verlage als Provider gut finanzieren, der Verlag hatte ja dank der Copyright-Vergabe durch den Autor an den Verlag das Monopol darüber, wer was lesen darf.
Als vor 15 Jahren das World Wide Web erfunden wurde, ergaben sich nun technisch ideale Möglichkeiten [1],
die zeitlosen Anforderungen der Wissenschaft [2]
viel effektiver zu realisieren. Mittels des WWW kann jeder ohne (auch finanziellen) Aufwand sein Dokument aller Welt zu lesen geben. Suchmaschinen mögen dem armen potentiellen Leser helfen, es zu finden,- und jedes so digital verbreitete Dokument auch zu lesen.
Technische Realisierungen von Open Access
Zwei Wege zur Organisation dieser weltweiten Bibliothek wissenschaftlicher Dokumente - unabhängig vom Stadium ihrer Begutachtung oder Publikation durch Verlage haben sich herausgebildet:Zentrale Vernetzung der Autoren-Webserver: die Autorin legt eine digitale Kopie ihrer Dokumente auf den Webserver ihres Institutes oder ihrer Arbeitsgruppe, z.B. geordnet als Publikationsliste. Ein zentraler Dienst listet die Webadressen möglichst aller Autoren und bietet Zusatzdienste wie Suchmaschine, Ordnung nach Instituten oder Universitäten, geographische Koordinaten, usf.. Fachbezogene Beispiele hierfür sind PhysNet [3] und Math-Net [4].
Verteilte Repositorien und Dienste-Anbieter: die digitalen Kopien werden lokal an zentraler Stelle, z.B. der Bibliothek einer Universität, gesammelt und auf dem Web angeboten.
Dabei fügt dieser lokale Data-Provider Metadaten nach einheitlicher (OAI-MPH) internationaler Vereinbarung hinzu. Weltweit haben inzwischen fast alle Universitäten einen Data-Provider [5]. Dies ermöglicht anderen Institutionen, einen Service-Provider aufzusetzen und anzubieten, der nach eigenen Kriterien Dokumente (z.B. fachbezogen) auswählt und synoptisch mit Zusatzdiensten anbietet und dabei die OAI-Metadaten nutzt. Weltweit gibt es eine Fülle von Service-Providern [6]. Ihre Nutzung und ihre Füllung wird statistisch untersucht [18].
Schließlich gibt es eine Reihe von (meist fachbezogenen) Suchmaschinen mit Zitationsdiensten, die eine Vielzahl von (auch nicht OAI-kompatiblen) Dokumentensammlungen anbieten [7].
Wem nützt Open Access?
OA beschleunigt den Wissenschaftsprozess und ermöglicht effektiveres Arbeiten. Es fördert dadurch auch katalytisch die industrielle Entwicklung.
OA nützt den Universitäten. Die Universitäten können in einer OA-Welt sehr effektiv weltweit
Werbung machen für die Leistungsfähigkeit ihrer Wissenschaftler, wenn deren Dokumente auf einem eigenen IR-Server online OA zugänglich sind. Zugleich lassen sich Publikationslisten von Autoren generieren, ein
Universitätsprofil erstellen, sich mit anderen Universitäten wettbewerblich vergleichen etc. und auch Evaluationen sachgerechter durchführen. Es lässt sich die Nutzung und Verlinkung der Arbeiten automatisiert einfach messen, Zitationen online besser verbreiten. Schliesslich kann in der Open Access Welt die Universität eine Fülle von Zusatzdiensten anbieten, um die wissenschaftliche Arbeit weiter zu unterstützen [8].
Derzeit baut DINI Deutsche Initiative für NetzwerkInformation e.V.[9] einen synergetischen umfassenden Dienst auf, der die Vorteile der Open Access verfügbaren wissenschaftlichen Volltexte, die verteilt auf Universitäts-Repositories liegen, heben soll durch einheitliche Standards,
semantische Navigation, Nachweis der Nutzung, Verarbeitung der Zitationen sowie einer Fülle weiterer Leser- und Autorendiensten. DINI zertifiziert insbesondere OAI-Data-Provider,die ihre strengen Anforderungen an einen zuverlässigen und konformen Dienst erfüllen.
Eine Liste der in Deutschland betriebenen und der zertifizierten Provider ist in [10] gegeben.
Die Universitäten werden zunehmend ihre Autoren anhalten,
eine digitale Kopie jeden Forschungsartikels in das zentral betriebene Universitäts-Open Access Repository einzuspeisen.
Die OA-Repositorien der Universitäten decken bisher oft sehr viel weniger an Dokumenten ab, als was in den Publikationslisten der Autoren aufgelistet ist. Viele Autoren sind auch unwillig, oder zögern, eine digitale Kopie ihres Dokumentes auf den Universitäts-IR hochzuladen. Im Ausland [11,12] wurde durch Studien von A. Swan und A. Sale eruiert, dass nur wenn die Autoren verpflichtet werden, eine Kopie zu liefern, sie das auch
mehrheitlich tun. Sonst ist zumeist die sog. Abdeckung gering (10-30 %). Daher wird von den Universitäten zunehmend der Weg der Autorenverpflichtung beschritten (oder auch des finanziellen Anreizes).
Nutzen für die Autoren
Autoren haben von der weltweiten flächendeckenden Einführung große Vorteile: sie werden viel öfter gelesen [13], bei DINI-zertifizierten OAI-Data Providern wird ihnen die dauerhafte und langfristige Lesbarkeit, die Langzeitarchivierung garantiert, die Zitation wird in alle wesentlichen internationalen Informationsdienste (Suchmaschinen, Nachweisdienste) eingespeist und so die Auffindbarkeit weiter erleichtert. Sie sind bei ihrer Institution und deren evtl. Evaluationen automatisch optimal präsent.Was muss ein Autor tun?
Autoren haben es nun leicht, sie müssen nur eine digitale Kopie ihres neuesten Werkes dem lokalen (oder einem seiner Wahl) OA-Data-Provider zugänglich machen und die Erlaubnis zur Web-Verbreitung geben. Dabei ist gerade nicht die äußere Form des Dokumentes, wie es der Verlag dann erstellen mag, wichtig, sondern der möglichst volle Inhalt,also ein html oder latex oder word-file, aus dem sich dann z.B. ein pdf file ertellen lässt.
Die meisten Verlage der heute riesigen Zahl von wissenschaftlichen Zeitschriften[14] erlauben es den Autoren explizit, eine digitale Kopie dem lokalen OA-Repository anzubieten.
Neue Dienste durch kommerzielle Service-Provider?
Während die Vertreter-Organisationen der kommerziellen Verlage nach wie vor militant das Subskriptionsmodell verteidigen (sollen), stellen sich die Verlage allmählich auf Open Access um, einige bieten bereits OA-Zeitschriften, Springer hat jüngst BioMedCentral gekauft, einen OA-Verlag mit ca. 600 Mitarbeitern.Eigentlich haben aber gerade kleine Verlage es leichter, auf ein neues Geschäftsmodell umzusteigen, das den Anforderungen der Wissenschaft besser gerecht wird,- sofern sie denn die technische Konzeption, Entwicklung und Installation neuer Dienste outsourcen an kompetente Firmen und Institute. (Zur generellen Diskussion siehe [14,15,16]).
Literatur-Hinweise
[1] M. Groetschel, J. Luegger, and W. Sperber;Wissenschaftliches Publizieren und elektronische Information am Wendepunkt; 1993;
[2] Eberhard R. Hilf; Vortrag; Universität Halle; 1994;
http://www.isn-oldenburg.de/~hilf/vortraege/halle-ebs/halle-ebs.html
[3] PhysNet http://www.physnet.net ; siehe auch
E.R.Hilf, Report at the APS E-Print; Los Alamos, 1995; International Workshop of the American Physical Society on the future of scientific information.
http://publish.aps.org/EPRINT/ebs.html
[4] Math-Net http://www.math-net.org
[5] OAI-Registrierte Data Provider
http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites
[6] OAI-registrierte Service Provider
http://www.openarchives.org/service/listproviders.html
[7] Citebase http://www.citebase.org
[8] Digitale Verlagsdienste in einer Open Access Welt
- Zusammenstellung möglicher add-on Dienste; Thomas Severiens und Eberhard R. Hilf;
http://www.isn-oldenburg.de/~hilf/kampffmeyer4.pdf
[10] Liste DINI-zertifizierter OA-Data-Provider an Universitäten
http://www.dini.de/no_cache/service/dini-zertifikat/zertifizierte-server/
Eine Liste aller aller OAI-Dataprovider in Deutschland findet sich auf dem DINI-Server.
[11] A. Sale http://eprints.utas.edu.au/view/authors/Sale,_AHJ.html
[12] Studie; A. Swan http://www.keyperspectives.co.uk/openaccessarchive/index.html
[13] Stevan Harnad and Tim Brody and François Vallières and Les Carr and Steve Hitchcock and Yves Gingras and Charles Oppenheim and Chawki Hajjem and Eberhard R. Hilf;
The green and the gold roads to Open Access;
2004 and updates; http://eprints.ecs.soton.ac.uk/9940/
[14] Ulrich's Liste aller Zeitschriften: http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/
und die kleinen Anzahlen, die sich Universitäten heute noch leisten können
http://fisher.lib.virginia.edu/cgi-local/arlbin/arl.cgi?task=setupstats
(Statistische Erhebungsdaten der Association of Research Libraries)
[15] Publisher copyright policies & self-archiving Romeo-Liste
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
[16] Eberhard R. Hilf (2007), Digitaler Open Access zu wissenschaftlichen Informationen - Ein Umbruch zu neuen professionellen Diensten, in B. Lutterbeck, Matthias Biärwolff, R. A. Gehring (Hrsg.), 'Open Source Jahrbuch 2007 - Zwischen freier Software und Gesellschaftsmodell', Lehmanns Media, Berlin.
http://www.opensourcejahrbuch.de/portal/article_show?article=osjb2007-06-02-hilf.pdf
und
E.R.Hilf; Zehn Jahre Open Access - und nun die wirtschaftliche Nutzung? Medien Wirtschaft;
Vol.3,ISSN 1613-0669, S. 146-148; 2004
http://www.isn-oldenburg.de/~hilf/publications/medienwirtschaft/openaccess/
[17] The effect of open access and downloads ('hits') on citation impact: a bibliography of studies
http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html
[18] Interoperable Repository Statistics
http://trac.eprints.org/projects/irstats
Der Autor ist Geschäftsführer des
Institute for Science Networking Oldenburg GmbH, das neue Dienste für das Informationsmanagement wissenschaftlicher Dokumente im Auftrag entwickelt.

Aber sie kann auch von ganz anderen Ursachen herrühren, deshalb hat eine Gruppe um Anne Osborne (Bristol) ein zweites Archiv erschlossen, das von Samarium und Neodym, beide sind „seltene Erden“. Auch sie sind in Foraminifera eingelagert, ihr Verhältnis zeigt, ob das Wasser über frisch gebildete Erdkruste ins Meer kam oder über alte. Das, das durch die Straße von Gibraltar ins Mittelmeer fließt, kam über alte Gesteine – die der Flüsse in den Atlantik –, aber das in der östlichen Ägäis kam, wieder vor etwa 120.000 Jahren, durch frisch durchströmte Flusstäler. Davon haben die Forscher nun Spuren in der westlichen Ägäis gefunden. ...."
Quelle:
http://diepresse.com/home/techscience/wissenschaft/422291/index.do?_vl_backlink=/home/techscience/index.do
http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/10/08/segen-fluch-sect-52a-urhg-4840376
Siehe auch:
http://www.heise.de/newsticker/Neuer-Streit-um-Intranet-Klausel-fuer-Lehrer-im-Urheberrecht--/meldung/116072
Umfrage der Uni Bamberg:
http://typo3.urz.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/wissenschaft_einricht/universitaetsbibliothek/Allgemein/urheberrecht_umfrage52a.pdf
7. Welche Auswirkungen hätte der Wegfall von § 52a Abs. 1 Nr. 1 UrhG für die von Ihnen vertretenen Bildungseinrichtungen?
[...]
- fataler Rückschritt ins Papierzeitalter
- erhöhter Arbeitsaufwand durch Erstellen und Vervielfältigen von Papierunterlagen
- schlechtere Lehrqualität und schlechterer Lehrservice
- schnellere Veralterung der Arbeitsmaterialien
- schlechtere Zugänglichkeit der Literatur und damit verbunden geringerer
Rezeptionsgrad bei den Studierenden und sinkende Veranstaltungsqualität
Man kann es sich eigentlich nicht vorstellen, dass elektronische Semesterapparate ab 1.1.2009 illegal sein sollten.
Gewonnen hätte damit z.B. der Börsenverein, der immer schon gegen den § 52a UrhG war. Stellungnahme zum Evaluationsbericht des BMJ vom April 2008, der die Aufhebung der Entfristung empfahl:
http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/976/STELLUNGNAHME%2052A%20EVALUATION%20080618.pdf
Aber stellt nicht auch diese finstere Aussicht ein Fall Erfolgreichen Scheiterns? dar, der die Erkenntnis fördert, dass Wissen frei sein muss und Open Access auch im Bildungsbereich das Gebot der Zeit?
Siehe dazu den Gastbeitrag von Rainer Kuhlen heute:
http://archiv.twoday.net/stories/5254044/
Sollte man nicht mehr freie Quellen, freie Lehrbücher und Unterrichtsmaterialien nutzen? Also Open Educational Resources, die zur Zeit in der Bildungsforschung ausgesprochen "hip" sind, siehe
http://archiv.twoday.net/stories/5252935/
Und sollte man nicht eine Idee weiterentwickeln, auf die die Heather Morrison und ich unabhängig gekommen sind?
http://archiv.twoday.net/stories/4931438/
Es geht darum, bei der Anlage elektronischer Semesterapparate Open Access dadurch zu fördern, dass man versucht, eine Freigabe für das allgemeine Internet zu erreichen.
2005 formulierte ich:
Im Sinne der Foerderung von Open Access und der staerkeren
Befuellung der Dokumentenserver schlage ich vor,
- 1.im Rahmen von Semesterapparaten erstellte Digitalisate
gemeinfreier (aelterer) Werke (auch wenn das eher selten
der Fall sein duerfte) oeffentlich zugaenglich zu machen
und
- 2. Hochschullehrer zu ermutigen, bei der Erstellung von
Semesterapparaten Genehmigungen der Rechteinhaber
(Autoren/Verlage) zur Einstellung ins allgemeine Internet
einzuholen.
Morrison über Course Reserves:
"If you're planning to use an article or book chapter year after year - or it is clear that others would and should read the items - it is worthwhile contacting the author to inquire about making a copy open access, and it is worth the author's time to make this happen."
Bei Zeitschriftenartikeln dürften in vielen Fällen nach deutschem Recht die Rechte bei den Autoren liegen (§ 38 UrhG) - diese werden in vielen wenn nicht den meisten Fällen die Einwilligung geben, sofern sie nicht unrichtig über ihre Rechte unterrichtet sind.
Aber auch bei den Verlagen wird man - insbesondere bei älterer Literatur oder kürzeren Buchauszügen - manchmal Glück haben.
Damit ergibt sich für Open Access in diesem Bereich ein goldener und ein grüner Weg:
* Gold: OER nutzen!
* Grün: Anreicherung der Dokumentenserver mit Open-Access-Dokumenten, die für den elektronischen Semesterapparat bestimmt waren.
NACHTRAG:
http://archiv.twoday.net/stories/5258477/ § 52a UrhG soll bis 2012 verlängert werden.

MAKE ALL RESEARCH RESULTS CC-BY (AND THE DATA PD)!
Die CC-BY-Lizenz ist die Standardlizenz der PLoS und auch in sehr vielen anderen Open-Access-Zeitschriften verbreitet.
Bei Forschungsdaten kann aber die Forderung nach Urhebernennung bei komplexen Datennutzungen die wissenschaftliche Forschung behindern, daher müssen die Daten Public Domain sein. Nach den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis wird man aber auch dann den Datenurheber angeben, wenn dies in vernünftiger Weise erfolgen kann.
Ausführlich begründet ist diese Position unter
http://archiv.twoday.net/stories/4931334/
"Warum brauchen wir Open Access mit Bearbeitungsrecht und kommerzieller Nutzung?"

Let's create a rule
Information is a tool
Everyone can use!
Posted by Allyson Mower at
http://mlitr.blogspot.com/2008/10/open-access-day.html

Allerdings wirkt die Seite der UB Heidelberg als einziger deutscher Beitrag auf:
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Europe:_Open_Access_Day_2008
doch ein wenig ärmlich. Bei den niederländischen Kollegen sieht es aber nicht besser aus, obwohl man dort Stattliches vorzuweisen hat:
http://zeemanspraat.wordpress.com/2008/10/14/open-access-day-2/

Excerpt from the Bylaws:
Full members of the OASPA shall adhere to the extent possible a common interpretation of Open Access scholarly publishing inspired by the Budapest, Bethesda and Berlin Declarations on Open Access. This interpretation includes the following components:
* The dissemination of peer-reviewed manuscripts containing original research or scholarship immediately upon publication, at no charge to user groups, without requiring registration or other restrictions to access.
* Requirement that copyright holders allow users to "copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship..."
Full member OA journal(s) must adhere to component “A” of the interpretation. Members should, to the extent possible given their business model and individual circumstances, strive to adhere to “B” of the interpretation above.

Ein sehr technischer Blick auf beide Projekte. Die OCA schneidet in Sachen Transparenz längst nicht so gut ab, wie man anzunehmen geneigt war.
Via Blog-Eintrag
Urteilsanmerkung:
Es ist im eV-Verfahren nicht zu erwarten, dass ein Gericht nachdenkt oder gar die BGH-Rspr. zur Kenntnis nimmt. Ich habe in der Kunstchronik 2005 http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2007/371/pdf/Graf_Urheberrecht_2005.pdf bemängelt, dass sich der Bundesgesetzgeber nicht mit der einschlägigen Entscheidung "Parfumflakon" http://www.rechtsanwaltmoebius.de/urteil/bgh_urteil_I-ZR-256-97_parfumflakon.html auseinandergesetzt hat, und dies gilt nun auch für das OLG Köln. Dem Urteil hätte es entnehmen müssen, dass die Katalogbildfreiheit ersichtlich für die Präsentation von urheberrechtlich geschützten Werken der bildenden einschließlich der angewandten Kunst auf Auktionsplattformen nicht in Betracht kommt, sondern dass im Interesse des Warenverkehrs Abbildungen urheberrechtlich geschützter Gegenstände zulässig sein müssen. Dies betrifft beispielsweise technische Zeichnungen (keine Werke der bildenden Kunst) oder Autographen, deren Inhalt (z.B. ein geschütztes Gedicht) geschützt ist. Um Käufern einen Eindruck von dem zu verkaufenden Gegenstand zu vermitteln, wird man zulässigerweise ihn auf der Auktionsplattform abbilden dürfen (z.B. Buchcover, Plattencover usw.). Nach Abwicklung des Verkaufs entfällt die Werbewirkung und das Bild muss entfernt werden, wobei die strikte Betonung einer Wochenfrist durch das Gericht zu kleinlich erscheint. Eine dauerhafte öffentliche Zugänglichmachung - auch im Rahmen eines kostenpflichtigen Angebots (Branchendatenbank) - ohne Zustimmung des Urhebers ist in jedem Fall ausgeschlossen.
Der Beitrag ist das ausgearbeitete und teilweise erweiterte Manuskript eines Vortrages, den Professor Dr. Uwe Berlit auf dem diesjährigen EDV-Gerichtstag in Saarbrücken gehalten hat.
http://www.jurpc.de/aufsatz/20080157.htm
Alle Infos: http://newthinking-store.de/vortrag/ccsalon/20081015
http://www.irights.info/index.php?id=81&tx_ttnews[tt_news]=408&cHash=72f623028e
http://www.project10tothe100.com/intl/DE/index.html
Ich habe die folgende Idee eingereicht. Die Zahlen beziehen sich auf die Nummer der Eingabefelder bei Google (die URL wurde nicht akzeptiert)
5: Histo
8: Die Public Domain festigen
9: Bildung
10: Die Namen von Urhebern, die ab 1850 geboren oder gestorben sind, werden mit ihren Lebensdaten und Werken verknüpft.
11: Erstellt werden soll eine internationale Datenbank, die, selbst Public Domain, die biographischen Kerndaten (Name, Namensformen, Geburtstag, Geburtsort, Todestag, Todesort) von Urhebern und Liste ihrer Werke enthält. Dazu sollen Angaben aus Bibliothekskatalogen und "Authorities Files" weltweit zusammengeführt und verbunden werden mit käuflich erworbenen Daten aus kommerziellen biographischen Datenbanken sowie automatisiert aus digitalisierten gedruckten Nachschlagewerken extrahierten Daten und den Arbeitsergebnissen von Mitarbeitern freier Projekte, die unentgeltlich oder gegen Entgelt solche Daten zusammentragen. Ein Abgleich mit genealogischen Datenbanken sollte stattfinden. Das Arbeitsergebnis wäre eine universelle Personennamendatei, die, bearbeitbar in der Art der Wikipedia, zugleich als primäre Referenz für alle biographischen Recherchen dienen könnte, da z.B. auch Politiker oft als Autoren erscheinen.
12: Wir brauchen eine globale Public Domain, Werke, die frei von urheberrechtlichen Beschränkungen frei genutzt werden können, als Quelle der Menschen-Bildung. Die Urheberrechts-Regelungen der meisten Staaten machen den Schutz vom Todesjahr der Urheber abhängig. Die Kenntnis der Lebensdaten ist daher eine entscheidende Voraussetzung für die Festigung der durch "Copyfraud" bedrohten Public Domain.
13: Am meisten würden diejenigen profitieren, die das literarische oder künstlerische oder wissenschaftliche Erbe der Menschheit für ihre Bildung nutzen oder als Ausgangspunkt eigener kreativer Neuschöpfungen nehmen möchten.
14: Zusammenführen der bereits online verfügbaren Daten aus Bibliothekskatalogen und anderen Datenbanken.
15: Der Großteil der namentlich bekannten Urheber auf der Welt aus der Zeit ab 1850 wäre in einer zentralen freien Datenbank erfasst. Die Anzahl der Datensätze im Vergleich zu bisherigen Datenbanken - siehe etwa http://onlinebooks.library.upenn.edu/deathdates.html - wäre das Maß, um den Fortschritt zu messen.
18: Freie Organisationen wie die Wikimedia Foundation oder die OpenLibrary/InternetArchive.

Im September 2007 wurde die Kapstadter Erklärung zu "Open Education" verabschiedet.
Eine Vereinigung von Lehrern, Stiftungen und Internetpionieren hat eine Petition lanciert, in der Regierungen und Verlage aufgefordert werden, mit staatlichen Geldern geförderte Unterrichtsmaterialien frei verfügbar zu machen. Die dahinter stehende, noch junge Bewegung "verbindet die alte Tradition Wissen und Ideen gemeinsam zu entwickeln und auszutauschen mit den neuen Möglichkeiten der Vernetzung und Interaktivität" des Internet, heißt es in der entsprechenden Kapstädter Erklärung zu "Open Education". Sie basiere auf dem Grundprinzip, dass jeder die Freiheit haben sollte, Bildungsmaterialien ohne Einschränkungen "zu nutzen, zu verändern, zu verbessern und weiterzugeben".
http://www.heise.de/newsticker/meldung/102423
Deutscher Text der Erklärung:
http://www.capetowndeclaration.org/translations/translations/german-translation
Wer an Universitäten, Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen tätig ist, ist aufgerufen zu unterzeichnen:
http://www.capetowndeclaration.org/sign-the-declaration
Internetquellen zum Thema findet man vor allem mit dem Stichwort "Open Educational Resources" (OER)
http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Educational_Resources
Portale für freie Materialien:
OER Commons
http://www.oercommons.org/
LeMill - Finding, authoring and sharing of learning resources
http://lemill.net/
WikiEducator
http://www.wikieducator.org
OpenCourseWare Consortium
http://ocwconsortium.org/
Aktuelles:
Offene Bildungsressourcen - Ausgabe der eLearning-Papers
http://archiv.twoday.net/stories/5251751/
Tagungsband Offener Bildungsraum Hochschule gratis im Netz
http://archiv.twoday.net/stories/5251716/
Magisterarbeit zum Thema 2008
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/volltexte/2008/8676/pdf/masterarbeit_barbara_braun.pdf

Am 15. April 1997 stellte ich meine Homepage (damals auf dem Server der Uni Koblenz) ins Netz - sie enthielt nicht wenige Volltexte wissenschaftlicher Arbeiten von mir:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/
Die Zugriffszahlen waren überzeugend. Mit meinen gedruckten Publikationen erreichte ich nur ein kleines Fachpublikum, während das Internet eine weitaus größere Breitenwirkung versprach. Da mir eine Uni den Speicherplatz zur Verfügung stellte, war die Homepage eine einfache und billige Möglichkeit, Wissenschaft zu vermitteln. Als Historiker mit einem Schwerpunkt auf der Landesgeschichte war mir das populärwissenschaftliche Genre, die Vermittlung von historischem Wissen an Laien alles andere als fremd, hatte ich doch etwa ein Jahrzehnt ab 1975 in den Schwäbisch Gmünder Tageszeitungen historische Beiträge geschrieben.
Die teuren Preise für wissenschaftliche Bücher haben mich immer geärgert. Während mein erstes Buch (die "Gmünder Chroniken", inzwischen online bei ALO http://www.literature.at ) in guter Zusammenarbeit mit dem Verlag entstand und sich auch nicht schlecht verkaufte, hat mich der Kontakt mit dem Verlag meiner Dissertation (ebenfalls bei ALO einsehbar) dauerhaft traumatisiert.
Ein wirkliches Interesse an dem Buch war nicht vorhanden, man wollte die Subventionen abgreifen, und ich musste mich lange wegen eines deutschen und eines englischen Werbeblatts mit dem Verlag herumstreiten. Obwohl ich - dummerweise - den Ladenpreis niedrig angesetzt hatte (da ich den fertigen Film lieferte, wäre mir bei höherem Preis mehr ausbezahlt worden), verkaufte sich das Buch außerordentlich schlecht - und das, obwohl die Rezensionen gut oder sehr gut waren. Als ich vor einigen Jahren anklopfte, um meine Dissertation online veröffentlichen zu können, beschied mich Prof. Dr. Z. aus P., das könne man ja auf keinen Fall dulden, da würde ja der Verkauf einbrechen. Wie bitteschön soll der Verkauf einbrechen, wenn im Jahr 1-3 Exemplare verkauft werden? Da man auf eine rechtliche Auseinandersetzung keinen Wert legte (und ich die "unbekannte Nutzungsart" auf meiner Seite hatte), erteilte man großzügig die Genehmigung. (Bei meinen "Sagen rund um Stuttgart" und den demnächst erscheinenden "Sagen der Schwäbischen Alb" war das Verhältnis zum - anderen - Verlag wieder gut.)
Das Subventionswesen machte die Verlage fett und die Bücher teuer, erkannte ich.
In dem Bereich, in dem ich publiziere, sind Jahre zwischen Ablieferung des Manuskripts und dem Erscheinen keine Seltenheit. Bei Erscheinen ist der Aufsatz in der Regel zwar nicht veraltet, aber eben nicht auf dem gewünschten aktuellen Stand. Da ich mir rasch die einfachsten HTML-Befehle beigebracht und ein Makro organisiert hatte, aus meinen WordPerfect-Dateien mit Fußnoten eine HTML-Datei mit Endnoten zu machen, konnte ich innerhalb weniger Stunden einen Aufsatz ins Netz stellen. "Peer Review" war damals und ist auch heute in der Geschichtswissenschaft noch kein Thema.
Eine Internetpublikation ist schneller veröffentlicht und erreicht mehr Leute, wurde mir klar.
Als ich auf Peter Subers materialreichen Newsletter zum Free Online Scholarly Publishing stieß, wusste ich sofort, dass ich diese Sache mit ganzen Herzen und voller Überzeugung unterstütze.
Im Listenarchiv von INETBIB 2001 ist nachzulesen, dass ich in einem Vortrag in Bamberg bereits damals für "Open Access" (ohne ihn so zu nennen) plädierte:
E-Mediävistik im Spannungsfeld von Wirtschaftsinteressen und
Informationsfreiheit, in: Mediaevistik und Neue Medien, hrsg. von
Klaus van Eickels/Ruth Weichselbaumer/Ingrid Bennewitz, Ostfildern 2004, S. 41-47
Online (E-Text, Vortragsfassung):
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg20555.html (Teil 1)
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg20554.html (Teil 2)
Seither habe ich in gedruckten Publikationen, aber noch mehr in Mailinglisten sowie in Weblogs (netbib, Archivalia) für Open Access gekämpft. Ich habe dabei immer wieder auch auf problematische Aspekte und Fehlentwicklungen aufmerksam gemacht, etwa die Open-Access-Heuchelei der Bibliotheken.
Inzwischen bringe ich meine gedruckten wissenschaftlichen Publikationen gemäß dem "grünen Weg" vorwiegend in Repositorien unter. Über 100 meiner Arbeiten (darunter die einflußreichsten Aufsätze und die genannten zwei Monographien) stehen online zur Verfügung:
http://archiv.twoday.net/stories/4974627/
Zum Thema Open Access habe ich an gedruckten Veröffentlichungen publiziert:
Wissenschaftliches E-Publizieren mit "Open Access" - Initiativen
und Widerstände, in: Neue Medien in den Sozial-, Geistes- und
Kulturwissenschaften. Elektronisches Publizieren und Open Access:
Stand und Perspektiven, hrsg. von Katja Mruck/Gudrun Gersmann (= Historical Social Research. Historische Sozialforschung 29 H. 1), Köln 2004, S. 64-75
Online:
http://hsr-trans.zhsf.uni-koeln.de/hsrretro/docs/artikel/hsr/hsr2004_599.pdf
http://eprints.rclis.org/archive/00006887/
Edition und Open Access, in: Vom Nutzen des Edierens. Akten des
internationalen Kongresses zum 150-jährigen Bestehen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Wien, 3.-5. Juni 2004, hrsg. von Brigitte Merta/Andrea Sommerlechner/Herwig Weigl (= Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungsband 47),
Wien/München 2005, S. 197-203
Online (E-Text, Preprint-Fassung mit Ergänzungen):
http://archiv.twoday.net/stories/230198/
Kulturgut muß frei sein!, in: Kunstchronik 60 (2007), S. 507-510
Online (E-Text, Preprint-Fassung mit Nachträgen):
http://archiv.twoday.net/stories/4477824/
Online (Scan):
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2008/529/
Neues Urheberrecht: Autoren müssen reagieren, in: Kunstchronik 60
(2007), S. 520-523
Online (E-Text, Preprint-Fassung mit Nachträgen):
http://archiv.twoday.net/stories/4477889/

Diese Ausgabe der eLearning Papers ist der florierenden Arbeit engagierter Personen, Institutionen und Nutzergemeinschaften rund um die offenen Bildungsressourcen (Open Educational Resources, OER) gewidmet. In fünf von Gast-Herausgebern ausgewählten Arbeiten werden die organisatorischen, sozialen, kulturellen, pädagogischen und technischen Aspekte der OER-Implementierung ergründet.
Offene Bildungsressourcen (OER) sind Lern- und Lehrmaterialien, die unter Lizenzen, die die Verwendung, Veränderung und Verbreitung der einzelnen Elemente erlauben, für jedermann kostenlos angeboten werden. Aber das ist noch nicht alles. Die weltweite OER-Bewegung bietet mit zahlreichen nutzergenerierten Inhalten und der zugrunde liegenden Web 2.0-Technologie zahlreiche Vorteile und Chancen für Lehrkräfte, Autoren, e-Learning-Fachleute, Entwickler und Inhaltsanbieter und nicht zuletzt auch für die Lernenden.

http://www.waxmann.com/index2.html?kat/2039.html

"Wissenschaftliche Publikationen entstehen heute fast ausnahmslos am Bildschirm. Die Verfügbarkeit gerade spezieller Forschungsliteratur im Internet erleichtert die Arbeit ungemein und eröffnet spannende neue Perspektiven. Da Wissenschaft, wenn sie gut ist, nicht knauserig, sondern extensiv andere Ansichten berücksichtigen möchte, können teure Verlagsangebote hier immer nur einen Bruchteil der relevanten und interessanten Quellen abdecken. Dagegen bietet Open Access für den wissenschaftlichen Austausch optimale Bedingungen. Spätestens dann, wenn wirksame Werkzeuge zur Messung der Relevanz wissenschaftlicher Quellen zur Verfügung stehen, die insbesondere die frei verfügbaren Texte berücksichtigen, wird jeder, der gesehen werden will, seine Texte frei zugänglich anbieten. Bibliotheken, Hochschulen und Forschungseinrichtungen stehen in der Pflicht, den Wissenschaftlern das freie Publizieren im Internet so leicht wie möglich zu machen und die Vernetzung der Repositoren in Fachportalen und speziellen Suchmaschinen voranzutreiben. Von der Güte der Publikations- und Rechercheinfrastruktur wird weitere Erfolg von Open Access abhängen. Dabei geht es nicht mehr um die Frage, ob Open Access sich durchsetzt, sondern nur, wie schnell und flächendeckend das in den einzelnen Fächern sein wird.
Und wie begeht man den Open-Access Tag am besten? Man sollte über Open Access reden und es propagieren! Ich selbst werde - natürlich mit dem passenden Button am Sakko - heute an der FH Potsdam über Urheberrecht lesen und dabei Open Access viel Raum geben."

Download Tagungsband: http://www.waxmann.com/kat/2058.html
Viele Artikel zum E-Learning, z.B.:
Klaus Wannemacher
Wikipedia – Störfaktor oder Impulsgeberin für die Lehre? S. 147ff.

"Warum ich Open Access unterstütze? Unterstütze ich überhaupt Open Accesss? Manches in der Bewegung erscheint mir naiv, undurchdacht, oberflächlich; das Scheitern des OA-Pioniers Klopstock wird unterbewertet. Doch das Anliegen selbst
unterstütze ich aus vollem Herzen. Im Kampf gegen die Übermacht der Rechteverwerter ist Open Access die alternativenlose Selbstbesinnung der Kreativen auf sich selbst und die Tatsache, daß sie die wahren Herren der Inhalte sind. Ein frischer Geist durchweht den Contentmarkt und ein Funken der Angst flackert in den
Augen der Verleger auf. Allein dafür lohnt sich der Einsatz."

"Open Access verkörpert für mich den Inbegriff des Traums von der freien Wissenschaft, von einer schnellen und demokratischen Verbreitung und Rezeption von Forschungsergebnissen. Tief beeindruckt hat mich Mitte der 1990er Jahre das "Gallica-Projekt" der Bibliothèque Nationale in Paris, das es sich zum Ziel setzte, das französische Kultur- und Literaturerbe weltweit frei im Netz zur Verfügung zu stellen. Für jeden, der vorher das alte Bestellsystem der BN kennengelernt hatte - stundenlanges Anstehen für einen freien Leserplatz, stundenlanges Warten auf die bestellten Werke, nicht auffindbare Bücher etc- , bedeutete dies eine unglaubliche Arbeitserleichterung! Ich unterstütze den Open-Access-Gedanken aber nicht nur aus den bereits genannten - durchaus egoistischen - Gründen, sondern auch deshalb, weil ich glaube, dass die Publikation in OA-Zeitschriften oder auf entsprechenden online-Plattformen gerade für junge Wissenschaftler eine hervorragende Möglichkeit darstellt, mit ihren Arbeiten intensiv von der Fachwelt (und nicht nur dieser) wahrgenommen zu werden. Ich selber bin an drei OA-Journalen beteiligt - dem Rezensionsjournal "sehepunkte", den "zeitenblicken" sowie neuerdings "Trivium", einer online-Zeitschrift, die der deutsch-französischen Verständigung dienen soll - und glaube, dass diese Neugründungen den wissenschaftlichen Austausch bereichert haben: Es ergibt für mich in der heutigen Zeit überhaupt keinen Sinn mehr, zum Beispiel Rezensionen in gedruckter Form zu veröffentlichen - hier haben OA-Angebote den klassischen Fachzeitschriften aus meiner Sicht deutlich den Rang abgelaufen. Ein weiteres OA-Projekt geht Ende Oktober 2008 online: Unter dem Namen "perspectivia.net" haben wir eine online-Publikationsform für die Publikationen der deutschen geisteswissenschaftlichen Institute im Ausland, die in der Stiftung DGIA zusammengefaßt sind, und ihrer Kooperationspartner gebaut. Künftig werden darüber zum Beispiel Sammelbände, die aus Sommerkursen und Tagungen entstanden sind, veröffentlicht werden. Mein eigenes Institut, das Deutsche Historische Institut Paris, geht mit der Retrodigitalisierung der Fachzeitschrift Francia voran: Ab 31.10.2008 werden sämtliche Bände der 1973 gegründeten Francia - bis auf die "moving wall" der beiden letzten Jahrgänge - OA online verfügbar sein. Die Francia-Rezensionen werden künftig nur noch im Netz erscheinen. Die Retrodigitalisierung der großen Publikationsreihen des Instituts wie der "Instrumenta" und der "Beihefte der Francia" ist in Planung. Für mich persönlich ist das ein wichtiger Beitrag gerade mit Blick auf die Internationalisierung der Wissenschaft".
Aufsätze in anderen Zeitschriften oder Sammelbänden können in Open-Access-Repositorien eingebracht werden. Hochschularchivare können die institutionellen Server ihrer Hochschule nutzen. Siehe z.B.:
http://www.opus-bayern.de/uni-augsburg/volltexte/2005/113/
Leider gibt es für deutschsprachige archivische Fachpublikationen keinen eigenen deutschsprachigen Schriftenserver. Es wäre Aufgabe der Archivschule Marburg, in Zusammenarbeit mit der UB Marburg einen solchen Server für archivische Fachpublikationen zu schaffen.
Ich habe das ohne Erfolg auf dem Essener Archivtag angeregt:
http://archiv.twoday.net/stories/2712317/
Es ist aber ohne weiteres möglich, deutschsprachige archivische Fachpublikationen auf dem Server E-LIS unterzubringen:

http://archiv.twoday.net/stories/3661200/
Während in der Sachgruppe Archive
http://eprints.rclis.org/view/subjects/DL.html
derzeit 111 Publikationen einsehbar sind, waren es 2006 nur 55.
Natürlich ist es möglich (und sinnvoll), Fachbeiträge auch auf der Archivhomepage einzustellen, aber die zusätzliche Hinterlegung in einem Repositorium wie E-LIS sichert die Langzeitarchivierung und die Auffindbarkeit mittels des OAI-Protokolls.

http://open-access.net/de/austausch/links
Ergänzend:
Verzeichnis der Beiträge zum OA-Tag 2008
http://archiv.twoday.net/stories/5256322/
und
http://archiv.twoday.net/stories/2967274/
Zur Einführung ein einziger Link
UNESCO-Handbuch zu Open Access (Mai 2007)
http://oa.helmholtz.de/fileadmin/Links/Artikel/Handbuch_Open_Access.pdf
Aktuelle Informationen
Um Positionen und Debatten zum Thema OA nachvollziehen zu können, ist es unumgänglich, das von Peter Suber unterhaltene Weblog "Open Access News" am besten täglich zu lesen.
http://www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html
Neuigkeiten zum Thema OA finden sich auf deutsch in diesem Weblog (Rubrik Open Access), im Weblog http://log.netbib.de (Rubrik Open Access) und bei Heise ( http://www.heise.de ). Häufiger berichtet aus der Sicht eines Medizinbibliothekars http://medinfo.netbib.de/ über Open Access, immer wieder erwähnen aber auch andere bibliothekarische Weblogs das Thema.
Links zu Dokumentenservern (grüner Weg)
http://archiv.twoday.net/stories/2966942/
Links zu Open Access Journals (goldener Weg)
http://archiv.twoday.net/stories/2963132/
***
Neben der Durchsicht der seit 26.10.2003 bestehenden Kategorie Open Access
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/
kommt die Nutzung der Suchfunktion in Betracht (es wird automatisch trunkiert, AND erforderlich, sonst oder voreingestellt).
Eine Auswahl wichtiger Beiträge:
http://archiv.twoday.net/stories/4931334/
Warum brauchen wir Open Access mit Bearbeitungsrecht und kommerzieller Nutzung?
http://archiv.twoday.net/stories/2712317/
OA und die Archive (Kurzreferat auf dem Essener Archivtag)
http://archiv.twoday.net/stories/1435124/
OA nicht nur aus Kostengründen
http://archiv.twoday.net/stories/230198/
OA und Edition (Referat zum IOG-Kolloquium Wien 2004)
http://archiv.twoday.net/stories/145113/
OA für Archivalien

Open Access - mehr als ein Publikationsprinzip
Open Access ist für mich eine Selbstverständlichkeit geworden, als ich an dem 1995 erschienenen Informationsmarkt-Buch arbeitete und schon sehr früh in Deutschland Erfahrungen mit dem World Wide Web machte. Dort wurde mir klar, dass durch das Internet - damals eher noch das Privileg der Wissenschaft und des Militär - sehr bald für jedermann die Vorinvestitionen beliebig billig zu Verfügung stehen werden, die für das Publikmachen von Wissen erforderlich sind und die bis dahin das Privileg und die Legitimation der Informationsverlage als "Vorlegen" des Kapitals gewesen sind.
Seitdem, und nicht erst durch Web 2.0, haben die proprietären kommerziellen Verwertungsmärkte Konkurrenz (mit Substitutionstendenz)durch die freien Austauschmärkte bekommen. Dass im elektronischen Umfeld Information als die mediale Repräsentation von Wissen frei sein will, frei sein muss, ist dann durch Open Access auf den Begriff gebracht worden.
Man kann es auch anders ausdrücken: Es wird der Öffentlichkeit zunehmend bewusst, dass nicht nur materielle Gemeingüter wie die Luft, das Wasser oder der öffentliche Raum niemals privates Eigentum werden können, so wird es, wenn auch noch zögerlich, zum Gemeingut, dass auch Wissen ein Commons ist. Auch Wissen gehört allen.
Man kann sich höchstens begrenzt private Nutzungsrechte am Commons Wissen sichern. Das ist ja auch in den letzten 20 Jahren auf unerhörte Weise mit den vielfältigen Formen der Verknappung auch im Schutz des sogenannten Urheberrechts geschehen, ohne dass der Öffentlichkeit eine angemessene Kompensation geleistet wurde. Im Gegenteil: Sie bezahlt den gesamten Prozess des Entstehens von Wissen und muss dann sogar die fertigen infomationsprodukte zurückkaufen. Und das alles mit der Unterstützung der staatlichen und interstaatlichen Regulierung.
Trotz des deutlich gewordenen Marktversagens, vor allem der internationalen Verlagswirtschaft - es muss und soll vielleicht nicht geschehen, dass die Informationswirtschaft sich aus den Märkten der wissenschaftlichen Kommunikation und des Handels mit Kulturgütern allgemein verabschieden muss. Aber sie kann nur eine Zukunft haben, wenn im Rahmen einer "commons-based economy" nur noch Geschäftsmodelle möglich sein werden, die das Paradigma von Open Access anerkennen. Ob man das Freeconomics nennen wird, sei dahin gestellt, aber ohne die freie Nutzung von Wissen und Information werden kaum noch Geschäfte gemacht werden können. Das klingt paradox, ist aber dennoch richtig.
Nur wird man es nicht alleine dem Marktgeschehen überlassen können, dass sich Open Access durchsetzt. Auch wird man nicht darauf vertrauen können, dass sich die Mehrheit der Wissenschaftler von der objektiven Überlegenheit des Öffentlichmachens von Wissen und Information überzeugen lassen wird (Senkung der Transaktionskosten, höhere Sichtbarkeit und Zitierung wissenschaftlicher Arbeiten, erleichterte Innovationen in der Wirtschaft, Durchbrechen von Wissensbarrieren in globaler Perspektive,...).
Hier, so seltsam das auch angesichts der Erfahrungen der letzten Jahren eines wissenschaftsverlagsfreundlichen Urheberrechts auch klingen mag, wird auch das Urheberrecht seinen Beitrag leisten können (wenn denn die Idee von Wissen als Commons auch politisches Allgemeingut wird):
Wird man im Urhebervertragsrecht verankern können, dass in Zukunft nur noch einfache Nutzungsrechte an die Informationswirtschaft (und nicht nur in der Wissenschaft) vergeben werden können?
Wird man durch ein verändertes Verständnis von Wissenschaftsfreiheit - Wissen ist auch kein privates, beliebig verfügbares Eigentum der Wissenschaftler oder der Kulturschaffenden, sondern bleibt der Allgemeinheit als Eigentum verpflichtet - Regeln entwerfen können, die die freie Zugänglichkeit zum Wissen - über welche Informationsprodukte auch immer - zum Default-Wert machen?
Open Access ist mehr als "Autoren zahlen", damit die Nutzer freien Zugriff haben. Open Access ist die Grundlage eines neuen Verständnisses von Markt und Wirtschaft, bei dem nicht mehr die bedingungslose private Profitmaximierung im Vordergrund steht, sondern die Mehrung von Wissen als Entwicklungsbedingung für jedermann und für jedes soziale System. Auf dem Weg dahin ist jede persönliche und institutionelle Unterstützung von Open Access im eigenen Umfeld dringend nötig.
Rainer Kuhlen
Professor für Informationswissenschaft an der Universität Konstanz
UNESCO Chair for Communication
Sprecher des Aktionsbündnisses Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft

Frühere Beiträge:
http://archiv.twoday.net/search?q=salem

BBB-Definition = Definition von Open Access gemäß den Erklärungen von Budapest (BOAI), Bethesda und Berlin.
BOAI, Budapest 2001, deutsche Version
http://www.soros.org/openaccess/g/read.shtml
Bethesda Statement, Juni 2003, deutsche Version:
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda_ger.htm
Die wichtige Berliner Erklärung vom Oktober 2003, der sich zahlreiche Wissenschaftsorganisationen angeschlossen haben, liegt inzwischen in einer verbesserten Übersetzung vor:
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/Berliner_Erklaerung_dt_Version_07-2006.pdf
BOAI = Budapest Open Access Initiative, 2001, siehe BBB-Definition
CC, CC-BY usw. = Creative Commons bietet einen Lizenzbaukasten für freie Lizenzen an (CC-BY für bloße Urhebernennung, NC für den Ausschluß kommerzieller Nutzung, ND für den Ausschluß von Bearbeitungsmöglichkeiten, SA für Weitergabe der Bearbeitungen unter der gleichen Lizenz):
http://www.creativecommons.org
DOAJ = Directory of Open Access Journals, von der Uni Lund unterhaltenes Verzeichnis der Open-Access-Zeitschriften, siehe
http://www.doaj.org
http://archiv.twoday.net/search?q=doaj
ETD = Electronic Theses and Dissertations. Open Access wird auch für Dissertationen und vergleichbare Abschlussarbeiten gefordert. Siehe
http://www.dissonline.de/
Gratis/libre Open Access = Im August 2008 von Peter Suber und Stevan Harnad eingeführte wichtige terminologische Unterscheidung. Gratis Open Access bedeutet den kostenfreien Zugang zu den Veröffentlichungen, während libre Open Access Nachnutzungsmöglichkeiten, die über "fair use" oder die Schranken des Urheberrechts hinausgehen, einräumt, also "permission barriers", vor allem urheberrechtlich begründete Nutzungsbeschränkungen, beseitigt. Siehe
http://archiv.twoday.net/stories/5101764/
Grauer Weg = Sehr seltene Bezeichnung für die Open-Access-Bereitstellung grauer Literatur, siehe
http://open-access.net/?id=169
Siehe auch: ETD
Grüner/goldener (green/golden) Open Access = Grüner Open Access bedeutet das Einstellen ("Selbstarchivieren", Self-Archiving) von Arbeiten in Repositorien, während goldener Open Access sich auf die Veröffentlichung in Open-Access-Zeitschriften (siehe DOAJ) bezieht. Zur Farbenlehre siehe
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/23/23672/1.html
Hybrides Publizieren = Parallele Veröffentlichung einer gedruckten Veröffentlichung und einer kostenfreien Online-Ausgabe, siehe
http://archiv.twoday.net/stories/3678599/
Hybride Zeitschriften = Kostenpflichtige Zeitschriften, die gegen zusätzliche Bezahlung Open Access für einzelne Beiträge ermöglichen, siehe
http://info-libraries.mit.edu/scholarly/faculty-and-researchers/hybrid-journals/
Mandat = Von Institutionen (als Arbeitgebern), Departments oder Förderorganisationen auferlegte Verpflichtung an Wissenschaftler, Beiträge Open Access in einem Repositorium zu veröffentlichen. Liste ROARMAP der bekannten Open-Access-Mandate:
http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/
OAI = Open Archives Initiative
http://www.openarchives.org/, wird nicht selten mit der Open-Access-Bewegung verwechselt. Sie hat das OAI Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) zum Einsammeln und Weiterverarbeiten von Metadaten entwickelt. Wichtigster Harvester ist der OAIster http://www.oaister.org . Siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Archives_Initiative
OER = Open Educational Resources
Permission barriers = siehe Gratis/libre Open Access
PLoS = Public Library of Science, führender Open-Access-Verlag (alle Aufsätze stehen unter CC-BY zur Verfügung), siehe
http://www.plos.org
Repositorium = Auch Dokumentenserver, Schriftenserver, Hochschulschriftenserver. Elektronisches Angebot zur Verwirklichung des grünen Wegs (Selbstarchivieren), unterhalten von Institutionen (institutional repositories) oder Fächern (disciplinary repositories). Repositorien werden meist mit eigener Software betrieben (DSpace, Eprints, OPUS u.a.m.).
SHERPA/RoMEO-Liste = Verzeichnis der Verlagsregeln hinsichtlich des Urheberrechts und des Self-Archiving:
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
TA = Toll access, kostenpflichtige Internetangebote, Gegenteil von Open Access

US-Original
http://www.earlham.edu/~peters/fos/brief.htm
Von Peter Suber nach den Grundsätzen von "Open Access" freigegeben.
Übersetzung: Klaus Graf u.a.
http://wiki.netbib.de/coma/OpenAccess
"Open Access"-Publikationen (OA-Publikationen) liegen digital, online, kostenfrei und frei von den meisten urheberrechtlichen und Lizenz-Beschränkungen (permission barriers) vor. Ermöglicht wird dies durch das Internet und die Zustimmung des Urhebers oder Rechteinhabers.
In den meisten Fächern bezahlen wissenschaftliche Zeitschriften die Autoren nicht, welche daher OA unterstützen können, ohne Einkünfte zu verlieren. In dieser Hinsicht unterscheiden sich Wissenschaftler von den meisten Musikern oder Filmproduzenten, weshalb die Kontroversen über OA für Musik und Filme die Frage der Forschungsliteratur nicht tangieren.
OA ist vollständig vereinbar mit dem Qualitätsprinzip des "Peer Review", und alle wichtigen OA-Initiativen betonen die Bedeutung des Qualitätsprinzips. Nicht nur die Autoren stellen ihre Arbeit kostenfrei zur Verfügung, sondern auch die meisten Zeitschriftenherausgeber und Gutachter.
OA-Veröffentlichungen sind nicht kostenfrei in dem Sinne, dass es nichts kostet, sie zu erstellen, wenngleich sie kostengünstiger produziert werden können als konventionelle Forschungsliteratur. Es stellt sich nicht die Frage, ob wissenschaftliche Studien kostenfrei produziert werden können, sondern ob es bessere Wege der Finanzierung gibt als die Leser bezahlen zu lassen und Zugangsbeschränkungen einzurichten. Die Geschäftsmodelle für die Finanzierung hängen davon ab, wie OA gewährleistet wird.
Dafür gibt es zwei grundlegende Instrumente: OA-Zeitschriften und OA-Archive (Eprint-Server, Repositorien).
OA-Archive unterliegen nicht dem "Peer Review", sondern machen einfach ihre Inhalte frei weltweit zugänglich. Sie können unbegutachtete Preprints (Vorabveröffentlichungen vor der Drucklegung), begutachtete Postprints oder beides enthalten. OA-Archive können von Institutionen wie Universitäten oder von Fächern wie Physik oder den Wirtschaftswissenschaften unterhalten werden. Autoren können ihre Preprints dort einstellen, ohne jemand um Erlaubnis zu fragen, und eine überwiegende Mehrheit der Zeitschriften gestattet auch das Einstellen der Postprints. Wenn solche Archive sich an das Metadata-Harvesting-Protokoll der Open Archives Initiative (OAI) halten, ist Interoperabilität gegeben und Nutzer können die Inhalte auffinden, ohne zu wissen, welche Archive existieren, wo sie sich befinden und was sie enthalten. Es gibt inzwischen Open Source Software, um solche, dem OAI-Standard genügenden Archive einzurichten und zu unterhalten, und weltweit gibt es eine breite Akzeptanz für die Nutzung dieser Software. Die Kosten der Archive sind vernachlässigbar: Man benötigt nur etwas Server-Platz und ein wenig Techniker-Zeit zur Betreuung.
OA-Zeitschriften unterliegen einem "Peer Review" und machen nach dieser Begutachtung den akzeptierten Beitrag weltweit frei zugänglich. Die entstehenden Kosten beziehen sich auf den "Peer Review", die redaktionelle Tätigkeit und den Server-Platz. OA-Zeitschriften finanzieren sich in ähnlicher Weise wie private Fernsehsender und Radiostationen. Wer den Inhalt verbreiten möchte, zahlt die Produktionskosten, so dass der Zugang für alle, die über die passenden Empfangsgeräte verfügen, unentgeltlich ist. Übertragen auf OA heisst dies: Oft erhalten die Zeitschriften Unterstützung von den Universitäten, die den Netzplatz bereitstellen, oder den sie tragenden wissenschaftlichen Gesellschaften. Es kann aber auch bedeuten, dass Zeitschriften bei akzeptierten Artikel Publikationsgebühren erheben, die vom Autor oder seinem Geldgeber (etwa dem Arbeitgeber, z.B. der Universität, einer Stiftung oder einem Forschungsunterstützungsfond) aufgebracht werden müssen. Üblicherweise verzichten OA-Zeitschriften auf die Bezahlung dieser Gebühren, wenn dies eine unzumutbare Härte bedeuten würde. OA-Zeitschriften mit institutioneller Unterstützung erheben im allgemeinen keine solche Publikationsgebühren. OA-Zeitschriften können die Kosten reduzieren, indem sie Einkünfte aus anderen Publikationen, aus Werbung, bezahlten Premiumdiensten oder anderen Nebeneinkünften zuschiessen. Institutionen und Konsortien können Ermäßigung der Publikationsgebühren vereinbaren. Manche OA-Verleger verzichten auf Publikationsgebühren bei Forschern, die Institutionen angehören, die eine auf jährlicher Basis Mitglied sind. Es ist eine Menge Kreativität und Ideenreichtum gefragt, wenn es darum geht, die Kosten von "Peer Review"-Zeitschriften aufzubringen, und wir sind weit davon entfernt, alle Möglichkeiten bereits ausgeschöpft zu haben.
Eine längere Einführung auf Englisch und weiterführende Links findet man in Peter Subers "Open Access Overview": http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm

Auch wenn das Open-Access.net die anderen Felder weitgehend ignoriert, ist eine umfassendere Definition von Open Access unumgänglich.
Open Access im weiteren Sinn meint den kostenlosen (gratis Open Access) und mit Nachnutzungsmöglichkeiten (libre Open Access) versehenen Zugang zu Materialien via Internet, die geeignet sind, die wissenschaftliche Forschung und die Bildungsbestrebungen der Bürgerinnen und Bürger weltweit zu fördern: wissenschaftliche Fachliteratur in Form von Aufsätzen und Büchern, Primärdaten aus Forschung und öffentlicher Verwaltung, Digitalisate von Kulturgut, Wissenssammlungen freier Projekte, Medien für die Lehre (Open Educational Resources).
Während eine klare Abgrenzung zur "Open Content"-Bewegung, die ja auch künstlerische und unterhaltsame Zwecke verfolgen kann, nicht möglich ist, ist es sinnvoll, die Open-Source-Bewegung, die freie Software propagiert, als eigenständigen Bereich nicht in die Definition einzubeziehen.
(1) Open Access für Bücher
Einschließlich: Dissertationen und Prüfungsarbeiten.
http://archiv.twoday.net/search?q=prüfungsarbeit
Open Access unterstützt entgegen einem landläufigen Vorurteil den Verkauf der gedruckten Version! Siehe
http://delicious.com/Klausgraf/monograph_open_access
(2) Open Access für Primärdaten - Open Data
http://open-access.net/de/allgemeines/was_bedeutet_open_access/open_access_zu_daten/
http://open-access.net/de/oa_informationen_der/helmholtzgemeinschaft/offener_zugang_zu_daten/
(2a) Forschungsdaten
http://sciencecommons.org/weblog/archives/2007/12/16/announcing-protocol-for-oa-data/
http://archiv.twoday.net/search?q=murray+and+rust
(2b) Daten des öffentlichen Sektors
http://archiv.twoday.net/search?q=geodat
(2c) Rechts- und Industrienormen, Gerichtsentscheidungen
http://archiv.twoday.net/stories/4507288/
http://de.wikipedia.org/wiki/Initiative_gegen_die_Direktgeltung_privater_Normen_im_Bauwesen
http://archiv.twoday.net/stories/3114268
http://de.wikipedia.org/wiki/Public.resource.org
(3) Digitalisate von Kulturgut - für eine reichere Public Domain
Kulturgut muss frei sein! (Kunstchronik 2007)
http://archiv.twoday.net/stories/4477824/
Beispiel: Wikisource
http://archiv.twoday.net/search?q=wikisource
Gegen Copyfraud!
http://archiv.twoday.net/search?q=copyfraud
(4) Wissenssammlungen freier Projekte
Beispiel: Wikipedia
http://archiv.twoday.net/topics/Wikis/
(5) Open Educational Resources

Heute Abend wird ein Podcast mit Katja Mruck und Günter Mey erstellt zum Thema: "Open Access als öffentliches Gut".
NACHTRAG: http://www.kuechenradio.org/wp/?p=322

The short answer is that I started providing OA to my own work, and advocating it for other work, before I knew what "it" was and before I heard about "it" from others.
For details, see my Richard Poynder interview from last year, pp. 23ff.
http://ia310134.us.archive.org/1/items/The_Basement_Interviews/Suber.pdf
Unfortunatley we don't have a collection of Open Access quotations (at Wikiquote I only found http://en.wikiquote.org/wiki/Nick_Bostrom ) but here is a great quote from Suber himself:
The more knowledge matters, the more OA to that knowledge matters.
http://ur1.ca/8ow

In der Berliner Erklärung für Open Access heisst es:
"Das Internet hat die praktischen und wirtschaftlichen Bedingungen für die Verbreitung von wissenschaftlichem
Wissen und kulturellem Erbe grundlegend verändert. Mit dem Internet ist zum ersten Mal die Möglichkeit
einer umfassenden und interaktiven Repräsentation des menschlichen Wissens, einschließlich des
kulturellen Erbes, bei gleichzeitiger Gewährleistung eines weltweiten Zugangs gegeben.
Wir, die Unterzeichner, fühlen uns verpflichtet, die Herausforderungen des Internets als dem zunehmend an
Bedeutung gewinnenden Medium der Wissensverbreitung aufzugreifen. Die damit verbundenen Entwicklungen
werden zwangsläufig zu erheblichen Veränderungen im Wesen des wissenschaftlichen Publizierens
führen und einen Wandel der bestehenden Systeme wissenschaftlicher Qualitätssicherung einleiten.
Im Sinne der Budapester Initiative (Budapest Open Access Initiative), der ECHO-Charta und der Bethesda-
Erklärung (Bethesda Statement on Open Access Publishing) haben wir diese Berliner Erklärung mit dem
Ziel aufgesetzt, das Internet als Instrument für eine weltweite Basis wissenschaftlicher Kenntnisse und
menschlicher Reflektion zu fördern und die erforderlichen Maßnahmen zu formulieren, die von Entscheidungsträgern,
Forschungsorganisationen, Förderinstitutionen, Bibliotheken, Archiven und Museen zu bedenken
sind." (Hervorhebungen von mir).
Das herrschende Bildrechte-Regime, das auf Reproduktionsgebühren setzt und Gemeinfreies mittels Copyfraud remonopolisiert, ist mit Open Access, wie ihn die Berliner Erklärung ausdrücklich auch für Kulturgüter fordert, nicht vereinbar. Wenn es die Forschung behindert, hat es keine Berechtigung, denn es ist eine Illusion anzunehmen, die Bildrechte-Vermarktung könne eine tragende Einnahmequelle werden.
Meinen programmatischen Beitrag "Kulturgut muss frei sein" (2007) veröffentliche ich daher anlässlich des Open-Access-Tags erneut.
Klaus Graf: Kulturgut muss frei sein!
Erschienen in: Kunstchronik 60 (2007), S. 507-510 [Themenheft Open Access, http://archiv.twoday.net/stories/4477176/ ]. Im folgenden mit ausgewählten Nachweisen angereichert.
Scan des Kunstchronik-Artikels:
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2008/529/
„Alle Werke des Geistes gehören der Nation, gehören der Menschheit an und in diesem Sinne allein krönen sie den Besitzer mit dem Golde ihres Reichtums.“ Was der Sammler Ludwig von Oettingen-Wallerstein 1811 formulierte, geht auf die Ideen der Französischen Revolution zurück. [1] Diese hatte die Kunstwerke der Feudalklasse zum Volkseigentum erklärt. Indem Friedrich Schlegel die Schönheit nicht mehr als aristokratisches Privileg sah, sondern als „heiliges Eigentum der Menschheit“ bestimmte, verlieh er einem Gedanken Ausdruck, der in der Gegenwart vor allem die internationalen Abkommen über den Kulturgutschutz bestimmt. Der Begriff Kulturgut – im Englischen deutlicher: „cultural property“ – weist der Kultur die Eigentumsrechte an jenen Gütern zu, für die der Anspruch auf dauernde Bewahrung geltend gemacht wird. Kulturgut ist kulturelles Allgemeingut. [2]
Im deutschsprachigen Rechtsraum vermisst man so eindringliche Reflexionen über das rechtlich schützenswerte Interesse der Öffentlichkeit an kulturellen Schätzen, wie sie der US-Jurist Joseph L. Sax 1999 in seinem hierzulande nahezu unbekanntem Buch „Playing Darts with a Rembrandt“ vorgelegt hat. Obwohl die Aura des Originals bei spektakulären Ausstellungen für Besucherströme (und entsprechende Einnahmen) sorgt, ist das Kunstwerk längst in das Zeitalter seiner digitalen Reproduzierbarkeit eingetreten, und es stellt sich die Frage, wie unter den neuen Auspizien der mediale Zugang zu den Werken der Kunst, Literatur und Wissenschaft, die in Museen, Bibliotheken, Archiven und Denkmalämtern verwahrt werden, ausgestaltet sein sollte. Es unterliegt keinem Zweifel, dass der noble Bildungsauftrag dieser im Kern philanthropischen Institutionen durch das Internet in vorher nicht gekannter Weise gefördert werden könnte. Über das World Wide Web kann ein Museum mehr Menschen Kunstgenuss verschaffen als je zuvor. Wir können uns an erlesenen japanischen Holzschnitten in bester Scan-Qualität virtuell delektieren, ohne auch nur ein einziges der sie umgebenden Schriftzeichen zu verstehen. Angebote, die Kulturgüter in dieser Weise zugänglich machen, können in der Regel exzellente Zugriffszahlen registrieren.
Oft genug aber verhält es sich anders, denn es geht um viel Geld. Digitale Kulturgüter sind Waren, die in den Augen vieler ihrer Hüter an Wert verlieren, wenn sie frei verfügbar sind. Die Angst vor dem digitalen Bilder-Klau geht um. Drakonische Bildrechte-Regimes erschüttern die Grundlagen nicht nur des kunsthistorischen Publikationswesens. „Wem gehört die Mona Lisa?“ fragte DIE ZEIT in ihrer Ausgabe vom 8. Januar 2004 [3]. Leonardo da Vinci ist länger als 70 Jahre tot, seine Werke sind nicht mehr urheberrechtlich geschützt, also „gemeinfrei“. Jeder sollte sie ohne irgendwelche Beschränkungen frei nutzen dürfen, zu welchem Zweck auch immer. Das Urheberrecht ist in allen nationalen Gesetzgebungen und internationalen Konventionen befristet (abgesehen von vereinzelten Regelungen zum „droit moral“). Nach Ablauf der Schutzfrist, so die amtliche Begründung zum geltenden Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965, müssten die Verbreitung und Wiedergabe der “Meisterwerke der Literatur und Kunst, die in den Kulturbestand eines Volkes eingehen […] im allgemeinen Interesse […] jedermann freistehen“ [4]. Davon wollen Archive, Bibliotheken, Museen und Denkmalämter nichts wissen, sie beanspruchen eine Art ewiges Urheberrecht an den Abbildungen des ihnen anvertrauten Inventars. Der US-Jurist Jason Mazzone hat den anschaulichen Begriff „Copyfraud“ für die unberechtigten Ansprüche hinsichtlich von Werken in der „Public Domain“ eingeführt [5].
Dass bei der originalgetreuen Wiedergabe von zweidimensionalen Vorlagen nach herrschender juristischer Lehre (die der Fotografenlobby natürlich nicht genehm ist) kein Schutzrecht nach § 72 Urheberrechtsgesetz entsteht, ignoriert man [6]. Archive stempeln einen Urhebervermerk auch auf einfache Fotokopien, bei deren Herstellung – darin sind sich alle Juristen einig - nun wirklich kein Urheberrecht entsteht. Das eigene Fotografieren der Benutzer bzw. Besucher wird unterbunden, schließlich will man ja jede Nutzung kontrollieren - und abkassieren. Allgemeine Geschäftsbedingungen der Bildagenturen differenzieren nicht zwischen gemeinfreien und geschützten Bildern mit der Konsequenz, dass ihre Vertragspartner nie in den Genuss der Gemeinfreiheit nach Ablauf der Schutzfrist kommen. Dritte können diese gemeinfreien Bilder selbstverständlich nutzen, denn sie sind an die Knebelverträge nicht gebunden. Es gibt, so die Gerichte, kein „Recht am Bild der eigenen Sache“ [7]. Nach wie vor gültig ist die Entscheidung „Apfel-Madonna“ des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 1965, bei der es um die Nachbildung einer gemeinfreien Skultptur des Aachener Suermondt-Museums ging: „Zwar ist der Eigentümer des Originalstückes kraft der Sachherrschaft, die ihm das Eigentum verleiht, in der Lage, andere Personen vom Zugang zu dem Kunstwerk auszuschließen und ihnen damit auch die Nachbildungsmöglichkeit abzuschneiden oder doch weitgehend zu erschweren. Es mag auch ein durchaus berechtigtes Interesse der Museen bestehen, daß von den in ihrem Eigentum stehenden Kunstwerken nur möglichst getreue Nachbildungen in den Handel gelangen. Hat der Eigentümer jedoch einem Dritten gestattet, das gemeinfreie Werk nachzubilden und diese Nachbildung in den Verkehr zu bringen, so kann er […] weitere Nachbildungen des Originals durch andere Personen, die hierbei die mit seiner Erlaubnis hergestellte Kopie als Vorlage benutzen, nicht verhindern.“ [8]
Kulturgut-Kuratoren sind Treuhänder, keine Zwingherren. Anders als private Sammlungen unterliegen öffentliche dem Regelwerk des öffentlichen Rechts, das die Tätigkeit der Institutionen strikt an ihre gesetzlichen Aufgaben bindet. Im Falle der Archive wird diese umfassend in den Archivgesetzen des Bundes und der Länder geregelt. Die Etablierung eines Verwertungs-Monopols bei Reproduktionen von Kulturgut ist diesen Aufgabenbeschreibungen nicht zu entnehmen [9]. Da die nach dem Muster urheberrechtlicher Lizenzen ausgestalteten Reproduktionsgebühren Wissenschaft und Presse behindern, liegt eine eindeutige Überschneidung mit der Kernaufgabe der Institutionen, das Kulturgut nutzbar zu machen, vor. Benutzungsbeschränkungen, die der Kommerzialisierung dienen, sind als staatliche Eingriffe zu qualifizieren, denen die Grundrechte des Benutzers, also die durch Artikel 5 Grundgesetz geschützte Forschungs- und Pressefreiheit entgegengehalten werden können. 1994/95 kamen Bibliotheksjuristen zu dem Schluss, dass die in Handschriftenbibliotheken üblichen Genehmigungsvorbehalte bei der Edition von Schriftstücken nicht rechtmäßig sind [10]. Dieses Resultat lässt sich ohne weiteres auf Bilder übertragen.
Wird die Vermarktung zur tragenden Einnahmequelle, so sind insbesondere die steuerlichen Privilegien der Kulturinstitutionen bedroht. Zudem ist völlig zweifelhaft, ob die ökonomischen Blütenträume in Erfüllung gehen werden. Gerade bei kleineren Häusern besteht das Risiko, dass die erhofften Einnahmen ausbleiben, durch ein rigides Rechte-Management aber kulturpolitisches Porzellan zerschlagen wird, indem wichtige Partner der Öffentlichkeitsarbeit verprellt werden.
Eine Herausforderung des traditionellen, verlagsgestützten wissenschaftlichen Publikationswesens stellt die Forderung nach „Open Access“ dar [11]. Open Access meint den kostenlosen und von urheberrechtlichen Beschränkungen freien Zugang zu wissenschaftlichen Dokumenten und Daten via Internet. Das herrschende Bildrechte-Regime ist mit den von allen bedeutenden Wissenschaftsorganisationen unterstützten Grundsätzen von Open Access nicht kompatibel. Es war eine geniale Fügung, dass das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Gastgeber der Berliner Konferenz von 2003, auf der die maßgebliche „Berliner Erklärung für Open Access“ verabschiedet wurde, in ihr den Verweis auf die ECHO-Charta [12] verankern konnte, der es um die freie Nutzung des Kulturguts im digitalen Kontext geht. Die Berliner Erklärung richtet sich ausdrücklich auch an die Kulturgut verwahrenden Institutionen, an die Archive, Bibliotheken und Museen. Sie unterstreicht, dass Open Access nicht nur kostenfrei bedeutet, sondern dass alle wissenschaftlich verantwortbaren Nachnutzungen der unter Open Access stehenden Werke möglich sein müssen. Einen Ausschluss kommerzieller Nutzung oder ein Verbot von Bearbeitungen (z.B. Übersetzungen) kann man weder der Berliner Erklärung noch der vorangegangenen „Budapest Open Access Initiative“ von 2001 entnehmen. Als eine Standard-Lizenz führender Open-Access-Zeitschriften hat sich die „Creative Commons“-Lizenz CC-BY etabliert, die ganz im Sinne der genannten Open-Access-Definitionen lediglich die Urhebernennung bei der Nachnutzung fordert, kommerzielle Nutzung und Bearbeitungen also erlaubt.
Digitale Abbildungen von Kulturgütern zählen zu den wissenschaftlichen „Daten“, die nach den Zielen der Open-Access-Bewegung frei genutzt werden sollen. Je weniger Schranken bestehen, um so mehr kann das eigentliche Ziel von Wissenschaft, die maximale Verbreitung ihrer Erkenntnisse, erreicht werden. Es ist mit „Open Access“ nicht vereinbar, wenn Bilder im Internet nur in einer Auflösung zugänglich gemacht werden, die für wissenschaftliche Zwecke unbrauchbar ist. Kostenpflichtige Digitalisierungsprojekte schließen diejenigen Institutionen aus, die sich den Zugang nicht leisten können.
Der Schwerpunkt der Open-Access-Bewegung liegt auf den wissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln. Den größten Rückhalt findet die Forderung nach Open Access daher bei den unter den steigenden Zeitschriftenpreisen ächzenden Bibliotheken, wenngleich diese die Implikationen von Open Access für das von ihnen verwahrte Kulturgut negieren. Es ist ein klarer Fall von Doppelmoral, auf der einen Seite die kostenfreie Verfügbarkeit von Fachaufsätzen von Verlagen und Wissenschaftlern einzufordern, auf der anderen Seite aber die Digitalisate des eigenen gemeinfreien Bibliotheksguts mit martialischem Copyfraud einzuzäunen [13].
Noch nicht „angekommen“ ist Open Access bei den Archiven, Museen und Denkmalämtern. Zwar haben 2003 die Dresdener Kunstsammlungen die Berliner Erklärung als einziges Museum unterzeichnet, doch sind auf der Website der Institution vier Jahre später keinerlei Anzeichen zu finden, dass Open Access in irgendeiner Weise unterstützt wird. Renommierte Museen wie das Germanische Nationalmuseum gehören der Leibniz Gemeinschaft an, die 2003 der Berliner Erklärung beitrat. Von Open Access ist bei ihnen aber ebenfalls keine Spur zu finden, und auch nicht bei den allermeisten anderen geisteswissenschaftlichen Instituten dieser Wissenschaftsorganisation (siehe im einzelnen eine Fortsetzungsserie im Weblog „Archivalia“ im Sommer 2007, resümiert unter http://archiv.twoday.net/stories/4113065/ ).
Open Access ist nicht nur für Wissenschaftler wichtig. Auch Bürgerinnen und Bürger profitieren von freien Inhalten. Daher ist eine strikte Abgrenzung der Open-Access-Bewegung von den Projekten, die freie Inhalte („Open Content“, eine „digitale Allmende“) schaffen möchten, oder der „Creative Commons“-Bewegung, die Urheber dazu motivieren möchte, ihre Urheberrechte teilweise an die Allgemeinheit abzugeben, nicht möglich. Der riesige Zulauf, den die freie Mitmach-Enzyklopädie Wikipedia findet, oder der beachtliche Umfang des vom gleichen Träger, der einem Bildungsauftrag verpflichteten Wikimedia Foundation, betriebenen freie Bild- und Multimedia-Archivs Wikimedia Commons [14] zeigen, dass hier eine selbstbewusste Lobby für freie Inhalte wächst, mit der die kulturgutverwahrenden Einrichtungen zu rechnen haben werden.
Das „Digital Rights Management“ befindet sich in der Musikindustrie bereits wieder auf dem Rückzug, denn die Kunden meutern. Bei den Verlagen haben einige wenige bereits erkannt, dass sie mit Open Access, also kostenfreier Online-Zugänglichkeit, nachweislich mehr gedruckte Bücher verkaufen als ohne [15]. Von daher liegt es nahe, den Archiven, Bibliotheken, Museen und Denkmalämtern dringend zu empfehlen, mit Open Access ernst zu machen, die gemeinfreien Inhalte freizugeben und freie Projekte als Partner zu gewinnen. Die auf Verbote, künstliche Verknappung und Reproduktionsgebühren setzende kleinliche Krämermentalität schadet erwiesenermaßen dem kulturellen Auftrag der Institute, sieht man davon ab, dass sie auch juristisch fragwürdig ist. Anders als „Open Access“, für den es bereits erfolgreiche Geschäftsmodelle gibt, trägt sie auch den beispiellosen Chancen des digitalen Zeitalters nicht Rechnung: alter Wein in neuen Schläuchen. Es bleibt zu hoffen, dass die Open-Access-Bewegung und freie Projekte bald auch den Kulturgut-Bereich mit ihrer Dynamik anstecken werden. Wissenschaft und Bildung werden es ihm danken.
[Nachweise - nicht in der Druckfassung:]
[1] http://archiv.twoday.net/stories/3724405/
[2] http://www.jurawiki.de/FotoRecht
[3] http://www.zeit.de/2004/03/Bildrechte-digital
[4] BT-DS IV/270 Text
[5] Mazzone, Jason, "Copyfraud" . Brooklyn Law School, Legal Studies Paper No. 40 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=787244
Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzrechtsber%C3%BChmung
[6] http://archiv.twoday.net/stories/3203578/
[7] http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fotos_von_fremdem_Eigentum
[8] BGHZ 44, 288
http://de.wikisource.org/wiki/Bundesgerichtshof_-_Apfel-Madonna
[9] Kurzreferat "Open Access und die Archive" (Essen 2006)
http://archiv.twoday.net/stories/2712317/
[10] Volltexte von Gödan et al.
http://deposit.ddb.de/ep/netpub/89/96/96/967969689/_data_stat/www.dbi-berlin.de/dbi_pub/einzelth/rechtpub/re_pu_00.htm
[11] Zu Open Access siehe ausser
http://www.open-access.net
http://archiv.twoday.net/stories/2967274/
[12] http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/policy/oa_basics/charter
Siehe auch den Beitrag von Simone Rieger/Urs Schoepflin in: Kunstchronik 60 (2007), S. 510-513
[13] http://archiv.twoday.net/stories/2518568/
[14] http://commons.wikimedia.org/wiki/Hauptseite
[15] http://archiv.twoday.net/stories/3326893/

http://openaccessday.org/
Sonderseite der UB Heidelberg:
http://www.ub.uni-heidelberg.de/news/oa_day.html

PS: Morgen ist Internationaler Open Access Tag. Archivalia wird im Rahmen seiner Beiträge, darunter Gastbeiträge von Thomas Hoeren und Eric Steinhauer, auch auf freie Lizenzen eingehen.
Quelle:
http://www.derwesten.de/nachrichten/wr/2008/10/13/news-83170898/detail.html
Quelle:
http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=12418
s. a. http://de.wikipedia.org/wiki/Christa_Reinig
Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/5124116/
http://archiv.twoday.net/stories/3521495/
Quelle:
http://www.schekker.de/magazin/topthema/175175.html
Quelle:
http://www.cinefacts.de/tv/details.php?id=krkbe2000000000001434561
Homepage der Serie:
http://www.daserste.de/roterosen/
Aus den nur grob geordneten Materialien, die in Umzugskisten zum Grüneburgplatz gebracht werden, wächst langsam ein funktionsfähiges Archiv, auf das Wissenschaftler aus dem In- und Ausland zugreifen können. Die Peter Suhrkamp Stiftung stellte der Universität in der ersten Phase ein etwa 250.000 Blatt umfassendes Konvolut als Dauerleihgabe zur Verfügung, damit der Verbleib des Bestandes in Frankfurt, seine wissenschaftliche Aufarbeitung und seine Erschließung für die Forschung gewährleistet werden. Dazu gehören heute bereits der Nachlaß des Verlagsgründers Peter Suhrkamp sowie sämtliche Korrespondenzen des Verlags, die erhaltenen Manuskripte und Herstellungsunterlagen sowie die Rezensionen der Bücher aus dem ersten Verlagsjahrzehnt bis zur Übernahme der verlegerischen Verantwortung durch Siegfried Unseld im Jahr 1959. Hinzu kommt die Korrespondenz des Insel Verlags mit seinen Autoren von 1945 bis 1963. ...."
Homepage des Archivs:
http://www.archiv-suhrkamp-stiftung.de/archiv.html
diesem Tag zu spät, um noch Veranstaltungen organisieren zu können, zumal
der Termin zwischen den OA Tagen in Berlin und der Berlin Konferenz in
Düsseldorf liegt.
Für das kommende Jahr planen die Allianzorganisationen eine
Aktivität/Veranstaltung." (IP-OA-Mailingliste)
Hier wird morgen Open Access unser Schwerpunktthema sein. Gastbeiträge renommierter Aktivisten liegen bereits vor bzw. sind fest zugesagt. Es lohnt sich, vorbeizuschauen!
Alle Beiträge werden unter
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/
erscheinen.

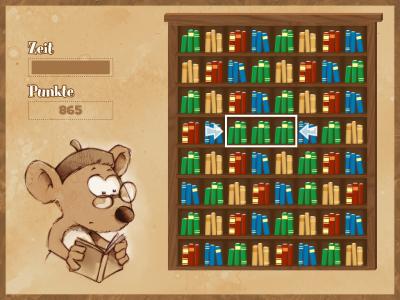
Eine Komponete des Spiels: das archivische Minispiel. Hier müssen die Amtsbücher farblich vorsortiert werden, bevor sie in das Archiv gelangen ...
Laurin ist Archivar. Er hat einen kleinen Freund, die Maus Lambert. Die beiden sind die Helden des Computerspiels „Die Amtskette des Bürgermeisters“. Das Spiel wurde gemeinsam von Kreisarchivar Thomas Wolf, dem Archivar der Stadt Siegen Ludwig Burwitz und Gamedesigner Tobias Müller von Outline Development entwickelt. Landrat Paul Breuer und Bürgermeister Steffen Mues haben „Lambert und Laurin“ jetzt gemeinsam mit einigen Jugendlichen im Stadtarchiv vorgestellt. Ab 20. Oktober kann das Computerspiel kostenlos im Internet unter www.lambert-und-laurin.de (Link) heruntergeladen werden.
„Unsere heimischen Archive bergen viele Schätze zur Geschichte der Region. Uns ist es ein gemeinsames Anliegen, diese einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen. Um junge Leute für die Archive zu begeistern, sind attraktive Ideen wie „Lambert und Laurin“ unerlässlich“, so Breuer und Mues übereinstimmend.
Entstanden ist das Computerspiel aus Anlass des Landeswettbewerbes „Archiv und Jugend“. „Wir hatten uns schon länger mit der Frage beschäftigt, was man machen kann, um Kinder und Jugendliche für die Arbeit der Archive zu begeistern. Und so haben wir gemeinsam die Idee geboren, ein Computerspiel zu programmieren, mit dem Kinder und Jugendliche auf spielerische Art und Weise lernen können, was Archive sind, wie sie arbeiten und welche Wissensschätze in ihnen gehütet werden“, sagt Kreisarchivar Thomas Wolf.
Die Idee eines „archivischen Computerspiels“ haben Kreis, Stadt und Outline Development beim Landeswettbewerb eingereicht - mit großem Erfolg! Die Jury aus Experten der Staatskanzlei und der Archivämter der Landschaftsverbände sichtete die eingegangenen Konzepte und sprach „Lambert und Laurin“ den maximalen Förderbetrag von 8.000 Euro zu. Der Kreis unterstützte die Realisierung des Projektes zusätzlich noch einmal mit 2.000 Euro.
Rahmenhandlung des Spieles ist die Amtskette des Bürgermeisters, die auf kuriose Weise verschwindet. Die Spieler haben die Aufgabe, sie wiederzufinden. Um bei der Suche erfolgreich sein zu können, müssen Quizfragen beantwortet und Geschicklichkeitsspiele bestanden werden. Das Team von Outline Development ist Spezialist für kinder- und jugendgerechte Computerspiele. So stammt aus der Siegener Spieleschmiede z.B. „Frag doch mal die Maus“, das Spiel zur entsprechenden ARD-Rateshow mit Jörg Pilawa. Entsprechend professionell ist das Design von „Lambert und Laurin“. Die beiden Charaktere hat der Düsseldorfer Diplom-Designer Oliver Freudenreich entwickelt und illustriert. „Die Grafiken sind hell und fröhlich, gar nicht so angestaubt, wie das Image von Archiven ja oft fälschlicherweise ist“, freut sich Kreiskulturreferent Wolfgang Suttner.
Jetzt ist „Lambert und Laurin“ fertig. Die Veröffentlichung wird vom 20. Oktober bis 5. November mit einem großen Gewinnspiel begleitet. „Nicht alle Fragen wird man direkt zuhause beantworten können. Wer möglichst viele Punkte und damit einen Preis gewinnen will, muss das Stadtarchiv im Krönchencenter und das Kreisarchiv im Altbau des Kreishauses aufsuchen“, sagt Ludwig Burwitz. Verschiedene Schulklassen haben bereits angekündigt, sich am Gewinnspiel zu beteiligen. Die Lehrer wollen die Inhalte im Unterricht begleiten. „Damit erreichen wir unser angestrebtes Ziel, mit dem Computerspiel 10- bis 20-Jährige auf das neugierig zu machen, was in unseren Archiven passiert“, so Thomas Wolf.
Für Schulklassen wie auch Einzelspieler gibt es interessante Preise zu gewinnen. Hauptpreis ist eine Klassenfahrt mit der Bahn in ein Museum des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe, zum Beispiel zur Zeche Zollern in Dortmund. Außerdem gibt es Führungen durchs Siegerlandmuseum mit anschließender Bewirtung, historische Stadtführungen rund um’s Krönchen, einen iPod shuffel, Computerspiele von Outline Development, Eintrittskarten zu Veranstaltungen im Lÿz und für Konzerte der Philharmonie Südwestfalen sowie Buchpreise zu gewinnen.
Kinder- und Jugendliche, die sich bereits vor dem Online-Start am 20. Oktober von „Lambert und Laurin“ für das Computerspiel fit machen wollen, können bei zwei Terminen einen Einblick in die Arbeit des Stadtarchivs bekommen. Archivar Ludwig Burwitz lädt am Dienstag, 14. Oktober, von 16:30 bis 18:00 Uhr und am Donnerstag, 16. Oktober, von 14:00 bis 15:30 Uhr in den Gruppenarbeitsraum des KrönchenCenters ein und wird einen Blick hinter die Kulissen des Stadtarchivs geben. Dabei erfahren die Teilnehmer bereits vieles von dem, was ihnen hilft, bei „Lambert und Laurin“ möglichst erfolgreich mitzumachen.
http://historikertag.de/blog/?p=2120
http://www.heureux.de/alert/index.php?/archives/28-Call-for-Papers-LIBREAS-Ausgabe-No-14.html
Am 5. September 2009 wurde verabschiedet:
Berliner Manifest: Öffentliche Dienste 2.0
Die Daseinsvorsorge in der Informationsgesellschaft stärken!
1. Grundversorgung und offener Zugang!
Offener Zugang zum Internet gehört heute zu den unverzichtbaren Voraussetzungen einer Informationsgesellschaft. Nicht am Internet teilhaben zu können, bedeutet den Ausschluss aus weiten Teilen des gesellschaftlichen und familiären Lebens, Ausschluss von Bildungs- und Informationsmöglichkeiten, von demokratischer Teilhabe – privat, wie beruflich.
Jeder Bürger - ob in Stadt oder Land, ob arm oder reich, ob behindert oder nicht - benötigt Zugang zum Internet mit ausreichender Bandbreite. Um die „digitale Spaltung“ von Arbeits-welt und Gesellschaft zu verhindern, gilt es: Die Grundversorgung neu zu definieren, Zugang für alle Menschen auch dadurch zu garantieren, dass Dienstleistungen von „Mensch zu Mensch“ erhalten bleiben und in der Arbeitswelt alle Beschäftigten (z.B. auch ArbeiterInnen) Zugang zu Intra- und Internet bekommen.
2. Wissen teilen, Wissen mehren!
Bildung und Zugang zu Wissen sind Grundrechte von zunehmender Bedeutung. Neue Technologien haben Zugang und Austausch von Informationen und Wissen grundlegend erleichtert. Diese Chancen sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Teilhabe sowie kooperativen Arbeitens wollen wir erhalten, nutzen und fortentwickeln.
Eine kalkulierte Verknappung der Informationsvielfalt, die Einführung technischer Barrieren und die schrittweise Privatisierung von öffentlichen Wissensbeständen ist ein Vergehen an der Allgemeinheit. Demokratische Teilhabe am öffentlichen Geschehen ist auf offenen Zugang zu Wissensbeständen angewiesen.
Gesetze müssen so gefasst sein, dass sie die Teilhabe an Wissen und Kultur nicht behindern, sondern fördern. Gemeinschaftsgüter müssen durch offene Nutzungslizenzen, wie Creative Commons und General Public License, vor privater Vereinnahmung geschützt werden.
3. Keine Privatisierung öffentlicher Güter im virtuellen Raum!
Öffentliche Archive, Bibliotheken, Museen und andere Kulturstätten gehören der Allgemeinheit – deren Bestände und Schätze auch in digitalisierter Form. Ihre Veräußerung oder Abtretung an private Einrichtungen muss unterbleiben.
Was mit öffentlichen Geldern oder Zuschüssen finanziert wurde, muss für die Öffentlichkeit frei zugänglich sein und sollte entsprechend der neuen technischen Möglichkeiten auch digital öffentlich und weitgehend kostenfrei nutzbar gemacht werden.
4. Selbstverwaltung und öffentliche Steuerungsfähigkeit stärken!
Die öffentliche Daseinsvorsorge hat in vielen europäischen Ländern eine lange Tradition, die gesellschaftliche Errungenschaften wie soziale Kohärenz und Chancengleichheit fördert. Bei der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie darf die öffentliche Selbstverwaltung und demokratische Steuerungsfähigkeit öffentlicher Körperschaften nicht ausgehöhlt werden.
Die Öffentliche Hand muss auch in der Informationsgesellschaft weiterhin die Grundversor-gung mit öffentlichen Leistungen gewährleisten können. Durch Auslagerungen, Privatisie-rungen und sogenannten öffentlich-privaten Partnerschaften (PPP) werden Selbstverwaltung und Steuerungsfähigkeit wegen vorgeblicher „Effizienzsteigerungen“ oder „Kostenreduktionen“ oft genug an private Unternehmen abgetreten – mit oftmals nicht zu vertretenden Folgen für die breite Öffentlichkeit.
Die öffentliche Hand muss im IT-Bereich in der Lage sein, zu beurteilen, was sie einkauft, Kosten realistisch einzuschätzen, um Investitionsruinen zu vermeiden und, wo erforderlich, Leistungen selbst zu erbringen. Dazu benötigt sie ausreichendes und gut qualifiziertes (IT-) Personal. Mangelnde technische Kompetenz im eigenen Hause würde einen unüberschaubar hohen Grad der Abhängigkeit von privaten Unternehmen erzeugen. Das wäre ein Steue-rungs- und somit ein Demokratieproblem.
5. Verlässliche demokratische Verfahren und Standards!
Verfahrenstransparenz und Vertrauenswürdigkeit von Informationsquellen sind zentraler Bestandteil des eGovernment. Wir müssen vermeiden, dass öffentliche Verwaltungsprozesse im Zuge ihrer Elektronifizierung intransparent und unkontrollierbar werden. Das gilt sowohl für technische als auch organisatorische Aspekte.
Drei zentrale Bereiche: 1. BürgerInnen müssen sicher sein können, dass Wahlen korrekt verlaufen. Durch den Ein-satz von Wahlcomputern, würde der Bürger derzeit gezwungen, die Kontrolle über das Ver-fahren abzugeben und könnte nur hoffen, dass der Computer die Daten, entsprechend seines Wahlentscheids, weiterleitet.
1.
Die städtische Domain ist das virtuelle Tor zur Stadt. Sie zu verkaufen oder mehrheitlich an private Betreiber abzutreten, löscht öffentlichen Raum im Internet. Die Vermarktung der Site darf nicht wichtiger werden, als die Bereitstellung öffentlicher Informationen und Angebote; die städtische Präsenz im Netz nicht auf eine Nische in einem Medienmischkonzern reduziert werden. Bei Privaten Anbietern wäre unternehmenspolitisch motivierte Information von offizieller, gemeinwohlorientierter Information nur schwer zu unterscheiden.
2.
Ob Call Center oder elektronische Bürgerplattform - wenn sich der Bürger an seine öffent-lichen Einrichtungen wendet, sei es telefonisch oder per eMail, muss er wissen, dass er tat-sächlich öffentlich Bedienstete kontaktiert.
Für die Verlässlichkeit demokratischer Standards und Strukturen muss das öffentliche Ange-bot vom privaten klar unterscheidbar, Transparenz und Vertrauenswürdigkeit der Quelle bei öffentlichen Angeboten gewährleistet sein.
6. eGovernment mit offenen Standards!
Der Austausch mit der Verwaltung muss technisch so gestaltet werden, dass Bürgerinnen und Bürger ihre private Computer-Ausstattung nicht den Vorgaben bestimmter (proprietärer) Computer- oder Software-Produkte unterwerfen müssen, um an den öffentlichen Angeboten teilnehmen zu können.
eGovernment benötigt Netzneutralität sowie offene Standards, beispielsweise bei Dokument-formaten, Signaturen, Softwareanwendungen. Nur sie ermöglichen problemlosen techni-schen Austausch und die Konkurrenz kommerzieller Ausstatter.
Die digitalen Infrastrukturen des Staates dürfen nicht in Abhängigkeit von Herstellern geraten. E-Government-Anwendungen müssen auf einer transparenten, verlässlichen und demo-kratisch kontrollierten technischen Infrastruktur aufgebaut werden und dürfen nicht zu Ein-schränkungen der öffentlichen Selbstverwaltung führen.
7. Kritische Infrastrukturen sichern!
Ob Kernkraftwerke, Krankenhäuser oder Hartz IV-Vergabestellen - die Nutzung von IKT darf weder selbst zur Gefährdung dieser Einrichtungen (durch Online-Manipulation) führen noch dürfen Einrichtungen, die der Grundversorgung dienen, derart von IKT abhängig sein, dass sie, bspw. durch einen anhaltenden Stromausfall, nicht mehr funktionsfähig wären.
Technische Krisen (bspw. Computerausfall zum Zeitpunkt der Hartz IV-Auszahlung) haben bereits in einigen Gemeinden dazu geführt, „manuelle Back-Up-Systeme“ bereitzustellen. Es ist wichtig, auch im sozialen Bereich, sogenannte „kritische Infrastrukturen“ zu identifizieren und gegebenenfalls Alternativen zu digitalen Arbeitsprozessen anzubieten.
8. Daten- und Persönlichkeitsschutz verwirklichen!
Jegliche Form des Datenmissbrauchs muss gesetzlich (im öffentlichen und privaten Bereich) und durch entsprechende technisch-organisatorische Vorkehrungen unterbunden werden, so die Weitergabe und Verknüpfung von personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken, zur Erstellung von Personenprofilen etc. Die elektronische Überwachung von Arbeitnehmer-Innen muss geahndet, das Arbeitnehmerdatenschutzgesetz endlich eingeführt werden.
Bei jeder personenbeziehbaren Datensammlung und –speicherung ist das Prinzip der Datensparsamkeit zu beachten; in manchen Fällen muss gänzlich auf elektronische Datener-fassung verzichtet werden. Datenvorratsspeicherung und Online-Durchsuchungen müssen unterbleiben, bereits angelegte Vorratsdatenspeicher reduziert, der Schutz der Privatsphäre (privat und beruflich) gewahrt werden. BürgerInnen müssen die letzte Entscheidungshoheit über die Verwendung ihrer persönlichen Daten behalten. Das „Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung“ (BVerfG) ist in der Informationsgesellschaft unverzichtbar.
9. eDemokratie für ArbeitnehmerInnen, Mitbestimmung stärken!
eDemokratie muss auch für die Erbringer der Öffentlichen Dienste gelten: Eine demokratische Gesellschaft braucht Mitbestimmung und Koalitionsfreiheit. Die entspre-chenden Gesetze (wie BetrVG, BPersVG, LPersVGs) müssen gestärkt und dem Informati-onszeitalter angepasst, aktuelle Verschlechterungen zurückgenommen werden.
Die Koalitionsfreiheit und das Recht, sich betrieblich gewerkschaftlich zu betätigen, muss auch in einer elektronisch vernetzten Welt mit veränderter Arbeitsorganisation gewährleistet sein. Wenn das „schwarze Brett“ verstaubt und die Arbeit zunehmend dezentral erbracht wird, bedarf es des Zugangs von Beschäftigten, Personal- und Betriebsräten sowie von Ge-werkschaften zum Intranet und E-Mail-System der Verwaltungen und Betriebe. Alle Beschäftigten benötigen einen freien und unzensierten Zugang zum Intra- und Internet.
10. Öffentliche Daseinsvorsorge nicht IT-Lobbyisten überlassen!
Öffentliche IKT-Infrastrukturplanung und die Gestaltung gesetzlicher Rahmenbedingungen für Arbeitswelt und Gesellschaft dürfen nicht in die Hand von IT-Lobbyisten gelegt werden. Es müssen (wieder) Strukturen aufgebaut werden, die nicht am privaten Gewinn, sondern am Gemeinwohl orientiert sind. Dazu benötigen wir engagierte medienkompetente Politiker und BürgerInnen. Unsere Gesellschaft sozial zu gestalten, heißt auch, die Daseinsvorsorge in der Informationsgesellschaft zu stärken!
Mit diesem Manifest anlässlich der ver.di-Konferenz „Öffentliche Dienste 2.0“ wollen wir die politische Debatte anregen. Wir freuen uns über Ihre/Deine Kommentare und Anregungen auf www.governet.de/7/, wo wir dieses Manifest zur öffentlichen Diskussion stellen.
Berlin, den 5.09.08
Achim Meerkamp, Mitglied des ver.di Bundesvorstands, Bundesfachbereichsleiter Bund, Länder, Gemeinden
André auf der Heiden, Mitglied des Präsidiums des ver.di Bundesfachbereichsvorstands Gemeinden
Annette Mühlberg, Leiterin Referat eGovernment, Neue Medien, Verwaltungsmodernisierung beim ver.di Bundesvorstand, Fachbereich Gemeinden
ErstunterzeichnerInnen:
Achim Meerkamp, Mitglied des ver.di Bundesvorstands, Bundesfachbereichsleiter Bund, Länder, Gemeinden
André auf der Heiden, Mitglied des Präsidiums des ver.di Bundesfachbereichsvorstands Ge-meinden
Annette Mühlberg, Leiterin Referat eGovernment, Neue Medien, Verwaltungsmodernisie-rung ver.di Fachbereich Gemeinden; Europäische Internetnutzervertreterin bei ICANN
Henning Lühr, Staatsrat bei der Senatorin für Finanzen Bremen
Carola Fischbach-Pyttel, Generalsekretärin des Europäischen Gewerkschaftsverbands für den öffentlichen Dienst (EGÖD), Brüssel
Franz-Reinhard Habbel, Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebunds (DStGB)
Prof. Dr. Klaus Lenk, Universität Oldenburg, Verwaltungswissenschaft
Heide Rühle, Mitglied des Europäischen Parlaments (MdEP)
Prof. Dr. Wolfgang Coy, Informatik in Bildung und Gesellschaft, Humboldt-Universität zu Berlin
Kathrin Lang, Vorsitzende Gesamtpersonalrat Landeshauptstadt Düsseldorf, Mitglied des ver.di Bundesfachbereichsvorstands Gemeinden
Petra Buhr, Koordinatorin Netzwerk Freies Wissen, Dresden
padeluun, FoeBuD e.V., Bielefeld
Gisela Schwellach, IT-Direktorin bei der Senatorin für Finanzen Bremen
Dr. Werner Rügemer, Publizist, Vorsitzender von Business Crime Control (BCC)
Wolf Ludwig, Vorstand comunica-ch, Neuchâtel
Doris Hülsmeier, Gesamtpersonalrat für das Land und die Stadtgemeinde Bremen
Dr. Volker Grassmuck, Projektleiter iRights.info, Berlin
Constanze Kurz, Chaos Computer Club (CCC), Berlin
Markus Beckedahl, netzpolitik.org, Berlin
Peter Bittner, Mitglied des Beirats des Forums InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung (FIfF), Köln
Dr. Imke Sommer, IT-Rechtsreferentin bei der Senatorin für Finanzen Bremen
Harald Giesecke, ver.di Bundesfachgruppe Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe (SKJ), Berlin
Matthias „Wetterfrosch“ Mehldau, Chaos Computer Club (CCC), Hamburg
Stefan Neugebauer, Gesamtpersonalrat Landeshauptstadt Düsseldorf
Andreas Schmidt, Leiter der Arbeitsgruppe Sicherheit und Geheimschutz der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS), Berlin
Harald Letsch, ehrenamtlicher Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes Jena/Saale-Holzland-Kreis
[Hervorhebung von mir, KG]
Der Mannheimer, der mit Leib und Seele Ludwigshafener wurde und in Heidelberg neben Geschichte auch Germanistik und Philosophie studierte, hat immer die archivische mit der historisch-wissenschaftlichen Arbeit verbunden. Seine von Hermann Conze betreute Dissertation zu den sozialen Verhältnissen und der sozialistischen Arbeiterbewegung in Ludwigshafen 1869 bis 1919 war eine der ersten anspruchsvollen Arbeiten zur Ludwigshafener Stadtgeschichte. In den folgenden Jahr-zehnten hat er zahlreiche Wissenschaftler zu weiteren Forschungen angeregt und selbst seine immer tiefere Kenntnis der jungen Stadt am Rhein zu zahlreichen Veröffentlichungen besonders im Bereich der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte genutzt.
Von 1995 an wurde er zum "Vater der Stadtgeschichte", als er den Stadtrat dazu bewegte, die Mittel für die erstmalige umfassende wissenschaftliche Darstellung der Entwicklung Ludwigshafens für das 150-jährige Stadtjubiläum 2003 bereitzustellen. Das Werk, in dem auch er einen Abschnitt verfasste, erschien in den Jahren 2003 bis 2005. Auch im Ruhestand bleibt Dr. Breunig einer der besten Kenner der Stadt, dem allerdings neben der Geschichte auch Musik, Theater und Philosophie viel bedeuten.
Quelle:
http://www.luaktiv.de/scripts/cms_luaktiv_temp/news.php?id=9648

Sonja Killinger, med. Dokumentationsassistentin, und Ulrich Wirth, wiss. Dokumentar
"In dem Forschungslabor arbeitete Sonja Killinger in dem 50-köpfigen internationalen wie interdisziplinären Team mit Wissenschaftlern und Studierenden aus Deutschland, Österreich, Australien und afrikanischen Staaten zusammen. Viele der angehenden Mediziner forschen hier für ihre Promotion oder nutzen den Aufenthalt in Afrika, um ihre französischen Sprachkenntnisse zu vertiefen. Die Grundidee Albert Schweitzers spielt in der modernen Forschung und dem Aufbau internationaler Karrieren eher eine untergeordnete Rolle.
Als angehende Medizinische Dokumentationsassistentin waren Killingers Hauptaufgaben das Erstellen einer Datenbank für Klinische Studien sowie das Erarbeiten von Formularen für die Dokumentation der Blutproben. Die meiste Zeit der drei Monate benötigte sie jedoch in den Aufbau eines Archivs. “Wir müssen alle Studien dauerhaft und sicher archivieren”, erläutert Judith Kammer, die als Medizinisch-Technische Assistentin (MTA) für das Qualitätsmanagement des Labors in Lambaréné verantwortlich ist.
Bei der Einrichtung des Archivs, in dem hauptsächlich papierene Studienunterlagen und Blutproben auf Glasträgern verwahrt werden, müsse ganz besonders auf das tropische Klima geachtet werden, erläutert der Wissenschaftliche Dokumentar und Schulleiter Ulrich Wirth. “Bei bis zu 100 Prozent Luftfeuchtigkeit werden andere Anforderungen an die Räumlichkeiten gestellt als in einem mitteleuropäischen Archiv.”
Vor allem Improvisationstalent und Durchhaltevermögen musste Sonja Killinger hier beweisen. “Wenn keine Regale da sind, dann fährt man eben nicht in den Baumarkt”, so die pragmatische Frau. “Im Lambaréné gibt es so etwas ja nicht. Mit Selbsthandanlegen bin ich hier ganz gut weiter gekommen.” Bei der Ausstattung des Raumes musste auf Vorhandenes zurückgegriffen werden, Werkzeug konnte sie sich bei den einheimischen Handwerkern borgen, und auf die perfekte Beschilderung der Regale musste sie fürs Erste verzichten. “Hier konnte ich mir mit Papierstreifen helfen. Wichtig ist, dass alle Unterlagen nun so geordnet sind, dass die Mitarbeiter sie auch wieder finden können.”
Quelle:
http://www.16vor.de/index.php/2008/10/11/von-trier-uber-tubingen-in-die-tropen/
Stimmt das ? Denn laut Wikipedia hat das Landesarchiv seinen Neubau 1996 bezogen. Sollte Haider das Landesarchiv zwischen 1989 und 1991 durchgeboxt haben ?
Wikipedia-Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rntner_Landesarchiv
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6rg_Haider
Allerdings nicht in der deutschsprachigen Welt. Auf
http://www.open-access.net/
sind die Berliner Open-Access-Tage am 9. und 10. Oktober viel wichtiger.
Archivalia lädt dazu ein, am 14. Oktober viele Beiträge über Open-Access hier mitzuteilen.

Nik Welter, Batty Weber, Marcel Noppeney, Edmond Dune, Aline Mayrisch de St. Hubert, Rosemarie Kieffer, Paul Brück...
Homepage des Archivs:
http://www.cnl.public.lu/fonds_documentaire/archives/index.html
"Das Problem ist auch schon auf dem Radarschirm der Allianz der Wissenschaftsorganisationen in der Bundesrepublik aufgetaucht, die mit der im Juni gestarteten Initiative Digitale Information auch ein "Aktionsfeld Forschungsprimärdaten" definierte und einen dringenden Handlungsbedarf in der systematischen Sicherung der in den Forschungsprozessen erzeugten Rohdaten sieht; diese müssten dauerhaft archiviert werden und erschließbar sein, damit sie für eine spätere Nutzung noch zur Verfügung stehen. Im Dezember wollen die Spitzen der deutschen Forschungsgesellschaften hierzu ein Aktionsprogramm vorlegen."
Forschungsprimärdaten z.B. an Universitäten sind - das wird wie üblich übersehen - auch ein archivisches Problem. Wenn sie nicht mehr benötigt werden, müssten sie den Archiven angeboten werden.
Wer Versionen hat sollte zum Arzt gehen?
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2008/1011/magazin/0039/index.html
Kommentar eines Wissenschaftlers:
http://digireg.twoday.net/stories/5250254/

Quelle: http://www.nytimes.com/2008/03/17/technology/17wikipedia.html?_r=1&oref=slogin
Die Junge Welt interviewt Gaby Weber, die in einem Theaterstück behauptet, der NS-Massenmörder Adolf Eichmann sei 1960 nicht vom Mossad entführt worden.
"Wäre nicht der BND als Regierungsbehörde verpflichtet gewesen, seine Erkenntnisse an die Staatsanwaltschaft weiterzugeben?
Diese Frage müßte das Bundeskanzleramt beantworten, ich war mit meiner Anwältin dort. Es wurde mir in der Tat eine Akte gezeigt – die begann aber erst nach 1960. Ich habe dann beim BND die Freigabe der Akte beantragt, ich meine die Dokumente zum Zeitraum vor Eichmanns Verhaftung in Israel. Zu meiner Überraschung wurde mir mitgeteilt, daß sie diese Akte gefunden haben, sie wollten sie aber bis mindestens 2017 geheimhalten. Ich habe jetzt gegen den BND Klage erhoben, weil es nicht angeht, daß dort Erkenntnisse über einen Massenmörder mit dem Argument unter Verschluß gehalten werden, der Geheimdienst müsse seine Methoden und Quellen schützen. [...]
Ich vermute, die Israelis haben die Deutschen erpreßt. Wahrscheinlich auch die Frankfurter Firma Degussa, die in den 50ern die Wiedergeburt der deutschen Atomindustrie eingeleitet hat. Eine Degussa-Tochter hatte bekanntlich das Giftgas Zyklon B produziert, mit dem Millionen Juden in den Konzentrationslagern ermordet wurden. Die 1960 gegründete Tochterfirma NUKEM hat jedenfalls für Israel einen Teil des nötigen Urans aus Argentinien beschafft. Ich habe versucht, bei Degussa zu recherchieren – aber leider läßt man mich nicht ins Archiv."

