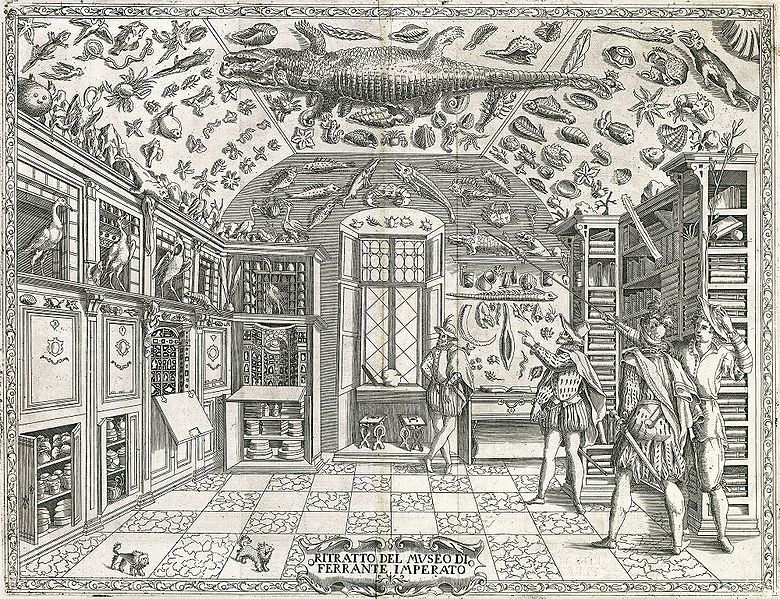"Notariële akten zijn de bron van informatie, maar soms dienen ze ook ter inspiratie. Michel Ball, medewerker van het Gemeentearchief Rotterdam, publiceerde in 2007 het boek Rotterdam 1600-1630 dat in feite een wandeling biedt door het Rotterdam van begin 17e eeuw. Het doen en laten van de Rotterdammers komt uitvoerig aan de orde aan de hand van bewaard gebleven verklaringen in notariële akten.
Daarnaast zijn de oude notariële akten gebruikt als bron van inspiratie voor beeldend kunstenaar Raph de Haas (Gulpen, 1952) en Peter Sonneveld, artistiek leider van theater Bonheur. Gebaseerd op verhalen uit de notariële archieven over hekserij (toverij), diefstal, moord en doodslag, ongelukken, ziekten en seks maakten zij filmpjes, korte clips, waarbij Raph de Haas voor het oog van de camera ononderbroken associatieve beelden tekent bij een door Peter Sonneveld gesproken tekst. Dat levert verrassende beelden op. Een lijn die door de straten van de stad lijkt te worden getrokken verandert in een hond en hé... wat gebeurt daar?"
1. Film der Reihe: http://archiv.twoday.net/stories/6482876/ (Seksschandalen)
2. Film der Reihe: http://archiv.twoday.net/stories/6484508/ (Diefstal)
3. Film der Reihe: http://archiv.twoday.net/stories/6485642/ (Hekserij)
4. Film der Reihe: http://archiv.twoday.net/stories/6489846/ (Ongelukken)
5. Film der Reihe: http://archiv.twoday.net/stories/6492815/ (Pest- en Dolhuis)
Wolf Thomas - am Freitag, 3. September 2010, 15:55 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Dr. Alexandra Lutz übernimmt zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Leitung des Kasseler Stadtarchivs. Dies hat der Magistrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, wie Oberbürgermeister Bertram Hilgen am 2. September 2010 im städtischen Pressedienst mitteilte.
Dr. Alexandra Lutz ist derzeit noch als Archivoberrätin an der Archivschule in Marburg tätig. Die 41-jährige Archivarin sammelte dort berufliche Erfahrungen als Dozentin und Koordinatorin für Archivwissenschaft.
Ihr Studium der Mittleren und Neueren Geschichte, Volkskunde und Soziologie absolvierte Dr. Lutz an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, wo sie im Juni 2003 mit der Disputation abschloss.
Aufgrund ihrer archivarischen und historischen Fachkenntnisse und Berufserfahrungen sei Dr. Alexandra Lutz die geeignete Bewerberin für die Aufgaben und Anforderungen im Kasseler Stadtarchiv, erklärte Oberbürgermeister Hilgen.
Mit dem Stadtarchiv Kassel hat Dr. Alexandra Lutz bereits schon einmal zusammengearbeitet. Von September bis Dezember 2009 erschlossen die 24 Teilnehmer des 46. Fachhochschulkurses der Archivschule Marburg unter ihrer Leitung den Bestand "Willi-Seidel-Haus / Jugendarchiv" aus dem Kasseler Archiv."
Quelle: Pressemitteilung der Stadt Kassel
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/6039336/
http://archiv.twoday.net/stories/6385869/
Dr. Alexandra Lutz ist derzeit noch als Archivoberrätin an der Archivschule in Marburg tätig. Die 41-jährige Archivarin sammelte dort berufliche Erfahrungen als Dozentin und Koordinatorin für Archivwissenschaft.
Ihr Studium der Mittleren und Neueren Geschichte, Volkskunde und Soziologie absolvierte Dr. Lutz an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, wo sie im Juni 2003 mit der Disputation abschloss.
Aufgrund ihrer archivarischen und historischen Fachkenntnisse und Berufserfahrungen sei Dr. Alexandra Lutz die geeignete Bewerberin für die Aufgaben und Anforderungen im Kasseler Stadtarchiv, erklärte Oberbürgermeister Hilgen.
Mit dem Stadtarchiv Kassel hat Dr. Alexandra Lutz bereits schon einmal zusammengearbeitet. Von September bis Dezember 2009 erschlossen die 24 Teilnehmer des 46. Fachhochschulkurses der Archivschule Marburg unter ihrer Leitung den Bestand "Willi-Seidel-Haus / Jugendarchiv" aus dem Kasseler Archiv."
Quelle: Pressemitteilung der Stadt Kassel
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/6039336/
http://archiv.twoday.net/stories/6385869/
Wolf Thomas - am Freitag, 3. September 2010, 15:34 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Freitag, 3. September 2010, 12:02 - Rubrik: Unterhaltung
Wolf Thomas - am Donnerstag, 2. September 2010, 22:16 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
Wolf Thomas - am Donnerstag, 2. September 2010, 22:07 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Learn about the Life Squared project which reanimated of part of the Lynn Hershman-Leeson archives housed at Stanford University Libraries Special Collections.
To learn more about Life Squared see:
http://lib.stanford.edu/women-art-revolution/life-squared/...
Kategorie:
Wolf Thomas - am Donnerstag, 2. September 2010, 21:25 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

XV-15 tilt rotor takeoff - first NASA Dryden flight
Collection: NASA Image eXchange Collection
Title: XV-15 tilt rotor takeoff - first NASA Dryden flight
Description: This photo shows the 1st XV-15 tilt rotor flight for NASA/Dryden at the Army contingent at Edwards Air Force Base, Edwards, California, October 1980. The former XB-70 hangar can be seen to the lower right. The two smaller cutouts on each side of the tail section slot were extra modifications for the large twin-tailed plane. The Bell XV-15 Tiltrotor aircraft were involved in limited research at the Hugh L. Dryden Flight Research Center in 1980 and 1981. The development of the XV-15 Tiltrotor research aircraft was initiated in 1973 with joint Army/NASA funding as a "proof of concept", or "technology demonstrator" program, with two aircraft being built by Bell Helicopter Textron (BHT) in 1977. NASA Ames Research Center, where most of the NASA research is conducted, continues to be in charge of the joint NASA/Army/Bell program. The aircraft are powered by twin Lycoming T-53 turboshaft engines that are connected by a cross-shaft and drive three-bladed, 25 ft diameter metal rotors (the size extensively tested in a wind tunnel). The engines and main transmissions are located in wingtip nacelles to minimize the operational loads on the cross-shaft system and, with the rotors, tilt as a single unit. For takeoff, the proprotors and their engines are used in the straight-up position where the thrust is directed downward. The XV-15 then climbs vertically into the air like a helicopter. In this VTOL mode, the vehicle can lift off and hover for approximately one hour. Once off the ground, the XV-15 has the ability to fly in one of two different modes. It can fly as a helicopter, in the partially converted airplane mode. The XV-15 can also then convert from the helicopter mode to the airplane mode. This is accomplished by continuous rotation of the proprotors from the helicopter rotor position to the conventional airplane propeller position. During the ten to fifteen second conversion period, the aircraft speed increases and lift is transferred from the rotors to the wing. To land, the proprotors are rotated up to the helicopter rotor position and flown as a helicopter to a vertical landing.
Date: 10.01.1980
Credit: NASA Dryden Flight Research Center (NASA-DFRC) [ www.dfrc.nasa.gov/gallery/ ]
ID: ECN-13850
UID: SPD-NIX-ECN-13850
Original url: nix.ksc.nasa.gov/info?id=ECN-13850&orgid=7
SOURCE: nasaimages.org/luna/servlet/detail/nasaNAS~2~2~2968~104492
Link to the complete fotostream on flickr
Wolf Thomas - am Donnerstag, 2. September 2010, 20:23 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Tagungsbericht von Grit Richter-Laugwitz
Wolf Thomas - am Donnerstag, 2. September 2010, 20:21 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Donnerstag, 2. September 2010, 20:19 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Link zum Tagungsblog.
Für den deutschen Archivtag ist dies wohl noch eine Utopie.
Für den deutschen Archivtag ist dies wohl noch eine Utopie.
Wolf Thomas - am Donnerstag, 2. September 2010, 20:16 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Stereofoto: Blick vom Maximilianeum gegen Westen 1865
Im Vordergrund Maximiliansbrücke und Isar, im Hintergrund Maximilianstraße und Silhouette der Altstadt.
Stadtarchiv München - Fotosammlung (Sammlung Valentin 1405)
"Dass Karl Valentin auch Fotos gesammelt hat, dürfte dem breiten Publikum entgangen sein. Das Münchner Stadtarchiv hat in den vergangenen Jahren den Bestand des Komikers und Volkssängers digitalisiert. Die rund 2.200 Fotos können nun im Lesesaal des Archivs abgerufen werden. Karl Valentin begann um 1925, Fotos über die Stadtgeschichte von 1855 bis 1910 zu sammeln. Mit dabei sind auch Stereoskop-Ansichten mit einem dreidimensionalen Blick auf das alte München. Im August 1939 verkaufte er die Sammlung an die Stadt und meinte besorgt, mit den ersten Wolkenkratzern beginne die Stadt gewissermaßen zu "neuyorkeln"."
Quelle: Deutschlandradio Kultur, 2.9.2010
Wolf Thomas - am Donnerstag, 2. September 2010, 20:12 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://paecht-archiv.univie.ac.at/ki/stams.html
Es steht der gesamte Katalog der Stamser Handschriften von Pater Maurus Grebenc 1966 als PDF zur Verfügung:
http://paecht-archiv.univie.ac.at/ki/stams/stams_kat-maurus-grebenc.pdf
Leider fehlt ein Hinweis, dass die Beschreibungen Harnacks online sind unter
http://www.archive.org/stream/xenia0202bernargoog#page/n475/mode/1up/search/stams

Es steht der gesamte Katalog der Stamser Handschriften von Pater Maurus Grebenc 1966 als PDF zur Verfügung:
http://paecht-archiv.univie.ac.at/ki/stams/stams_kat-maurus-grebenc.pdf
Leider fehlt ein Hinweis, dass die Beschreibungen Harnacks online sind unter
http://www.archive.org/stream/xenia0202bernargoog#page/n475/mode/1up/search/stams

KlausGraf - am Mittwoch, 1. September 2010, 21:52 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Hubert Hüppe (CDU), hat eine zentrale Berliner Erinnerungs- und Dokumentationsstätte für die Opfer der NS-"Euthanasie" gefordert. Beim Gedenken an die Opfer des Nazi-Regimes dürfe diese Gruppe nicht vergessen werden, sagte Hüppe zum Jahrestag des sogenannten "Euthanasie"-Erlasses vom 1. September 1939. Auch bei der Opferentschädigung dürften keine Unterschiede gemacht werden, erklärte Hüppe am 31. August 2010 in Berlin.
Mit Veranstaltungen soll am 3. bis 5. September 2010 in Berlin an die Ermordung von über 300.000 Behinderten und anderen Menschen auf der Grundlage des "Euthanasie"-Erlasses erinnert werden. Dazu findet am 3. September 2010 um 14 Uhr in der Philharmonie eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung statt. Am 4. September 2010 folgt vor der Philharmonie eine weitere Gedenkveranstaltung von mehreren Verbänden, darunter die Diakonie und die Caritas. Zu beiden Terminen hat auch Hüppe als Vertreter der Bundesregierung zugesagt.
Vor dem Eingang der Berliner Philharmonie erinnert ein Denkmal an die NS-Opfer der sogenannten T4-Aktion, bei der Psychiatrie-Patienten und behinderte Menschen durch SS-Ärzte und Pfleger getötet wurden. T4 stand für Tiergartenstraße 4, damals Sitz der Zentrale für die Leitung des Massenmordes an behinderten Menschen.In Deutschland dürfe nicht wieder zwischen angeblich lebensunwertem und lebenswertem Leben unterschieden werden, betonte Hüppe. Diese Mahnung gelte gerade angesichts neu aufkommenden eugenischen Gedankenguts in der Diskussion um Spätabtreibung oder Pränataldiagnostik.
Systematischer Massenmord an Behinderten
Am 5. September 1939 unterzeichnete Hitler den "Euthanasie"-Erlass. Hinter der verharmlosenden Bezeichnung verbarg sich der systematische Massenmord an Tausenden behinderten und kranken Menschen, die als "unwertes Leben" eingestuft wurden. Um den Vernichtungskrieg nach innen und außen zeitgleich beginnen zu lassen, wurde der Erlass auf den 1. September zurückdatiert. An diesem Tag hatte mit dem Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg begonnen.
An die Opfer der sogenannten Euthanasie-Aktion T4 wird am 1. September 2010 in Brandenburg an der Havel mit einer Gedenkveranstaltung erinnert. Zu Ansprachen und Kranzniederlegung nahm unter anderen die Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann (CDU) teil. Die traditionelle Rede eines Schülers bei der Gedenkveranstaltung an der Euthanasie-Gedenkstätte Nicolaiplatz wurde am 1. September 2010 von Marian Malinowski für das Bertolt-Brecht-Gymnasium gehalten."
Quelle: 3 sat Kulturzeit-Nachrichten, 1.9.10
Link zur Pressemitteilung des Behindertenbeauftragten
Mit Veranstaltungen soll am 3. bis 5. September 2010 in Berlin an die Ermordung von über 300.000 Behinderten und anderen Menschen auf der Grundlage des "Euthanasie"-Erlasses erinnert werden. Dazu findet am 3. September 2010 um 14 Uhr in der Philharmonie eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung statt. Am 4. September 2010 folgt vor der Philharmonie eine weitere Gedenkveranstaltung von mehreren Verbänden, darunter die Diakonie und die Caritas. Zu beiden Terminen hat auch Hüppe als Vertreter der Bundesregierung zugesagt.
Vor dem Eingang der Berliner Philharmonie erinnert ein Denkmal an die NS-Opfer der sogenannten T4-Aktion, bei der Psychiatrie-Patienten und behinderte Menschen durch SS-Ärzte und Pfleger getötet wurden. T4 stand für Tiergartenstraße 4, damals Sitz der Zentrale für die Leitung des Massenmordes an behinderten Menschen.In Deutschland dürfe nicht wieder zwischen angeblich lebensunwertem und lebenswertem Leben unterschieden werden, betonte Hüppe. Diese Mahnung gelte gerade angesichts neu aufkommenden eugenischen Gedankenguts in der Diskussion um Spätabtreibung oder Pränataldiagnostik.
Systematischer Massenmord an Behinderten
Am 5. September 1939 unterzeichnete Hitler den "Euthanasie"-Erlass. Hinter der verharmlosenden Bezeichnung verbarg sich der systematische Massenmord an Tausenden behinderten und kranken Menschen, die als "unwertes Leben" eingestuft wurden. Um den Vernichtungskrieg nach innen und außen zeitgleich beginnen zu lassen, wurde der Erlass auf den 1. September zurückdatiert. An diesem Tag hatte mit dem Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg begonnen.
An die Opfer der sogenannten Euthanasie-Aktion T4 wird am 1. September 2010 in Brandenburg an der Havel mit einer Gedenkveranstaltung erinnert. Zu Ansprachen und Kranzniederlegung nahm unter anderen die Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann (CDU) teil. Die traditionelle Rede eines Schülers bei der Gedenkveranstaltung an der Euthanasie-Gedenkstätte Nicolaiplatz wurde am 1. September 2010 von Marian Malinowski für das Bertolt-Brecht-Gymnasium gehalten."
Quelle: 3 sat Kulturzeit-Nachrichten, 1.9.10
Link zur Pressemitteilung des Behindertenbeauftragten
Wolf Thomas - am Mittwoch, 1. September 2010, 21:49 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Notariële akten zijn de bron van informatie, maar soms dienen ze ook ter inspiratie. Michel Ball, medewerker van het Gemeentearchief Rotterdam, publiceerde in 2007 het boek 'Rotterdam 1600-1630' dat in feite een wandeling biedt door het Rotterdam van begin 17e eeuw. Het doen en laten van de Rotterdammers komt uitvoerig aan de orde aan de hand van bewaard gebleven verklaringen in notariële akten.
Daarnaast zijn de oude notariële akten gebruikt als bron van inspiratie voor beeldend kunstenaar Raph de Haas (Gulpen, 1952) en Peter Sonneveld, artistiek leider van theater Bonheur. Gebaseerd op verhalen uit de notariële archieven over hekserij (toverij), diefstal, moord en doodslag, ongelukken, ziekten en seks maakten zij filmpjes, korte clips, waarbij Raph de Haas voor het oog van de camera ononderbroken associatieve beelden tekent bij een door Peter Sonneveld gesproken tekst. Dat levert verrassende beelden op. Een lijn die door de straten van de stad lijkt te worden getrokken verandert in een hond en hé... wat gebeurt daar?"
1. Film der Reihe: http://archiv.twoday.net/stories/6482876/ (Seksschandalen)
2. Film der Reihe: http://archiv.twoday.net/stories/6484508/ (Diefstal)
3. Film der Reihe: http://archiv.twoday.net/stories/6485642/ (Hekserij)
4. Film der Reihe: http://archiv.twoday.net/stories/6489846/ (Ongelukken)
Wolf Thomas - am Mittwoch, 1. September 2010, 20:57 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die politische Debatte um einen Termin für die Beendigung der Arbeit in der Stasiunterlagenbehörde wird beim Bundesarchiv in Koblenz mit großer Gelassenheit verfolgt. «Da sind wir hier leidenschaftslos», sagte der Präsident des Bundesarchivs, Hartmut Weber, in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. «Das Parlament entscheidet letzten Endes, wann das geschieht. Dass die Unterlagen zu uns kommen, ist ganz sicher.» Der Bundestag will in dieser Legislaturperiode eine Expertenkommission einsetzen, die Vorschläge zur Zukunft der Einrichtung erarbeiten soll. Weber warnte vor einem Schnellschuss: «Alle Beteiligten sollten drei Jahre Vorlaufzeit haben.»"
Quelle: Rhein-Neckar-Fernsehen
Quelle: Rhein-Neckar-Fernsehen
Wolf Thomas - am Mittwoch, 1. September 2010, 20:43 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Skandale in der Geschichte." - das Wettbewerbsthema des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten.

"Von Skandalen erfahren wir fast täglich in Zeitungen, im Fernsehen oder im Internet, aus Gesprächen mit Freunden, in der Schule oder in der Familie. Enthüllt werden sie in allen Lebensbereichen – in der Politik und in der Wirtschaft ebenso wie in Kunst und Kultur, in der Wissenschaft oder im Sport. Ob Machtmissbrauch in politischen Ämtern, Bestechungen in Wirtschaftsunternehmen oder Betrug beim Sport – immer werden Wertvorstellungen verletzt, die allgemein als hoch geachtet gelten.
Skandale sagen sehr viel über die gesellschaftlichen Werte zu unterschiedlichen Zeiten in der Geschichte aus. Manche Skandale haben zu einer Demokratisierung beitragen und Reformen in die Wege geleitet, andere haben bestehende Vorurteile verschärft oder ein Klima des Misstrauens erzeugt. Die historische Beschäftigung mit Skandalen soll uns zeigen, wie Wertkonflikte zu verschiedenen Zeiten ausgetragen wurden, wer von ihnen profitierte und zu wessen Lasten sie gingen.
Im Wettbewerbsmagazin spurensuchen stellen wir u.a. Themenbeispiele für Schüler aller Altersgruppen vor, und die Historiker Prof. Dr. Frank Bösch und Prof. Dr. Martin Sabrow erläutern Skandale aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive."
Link zur Wettbewerbsseite der Körber-Stiftung
Link zu Anregungen des Stadtarchiv Bergisch Gladbach

"Von Skandalen erfahren wir fast täglich in Zeitungen, im Fernsehen oder im Internet, aus Gesprächen mit Freunden, in der Schule oder in der Familie. Enthüllt werden sie in allen Lebensbereichen – in der Politik und in der Wirtschaft ebenso wie in Kunst und Kultur, in der Wissenschaft oder im Sport. Ob Machtmissbrauch in politischen Ämtern, Bestechungen in Wirtschaftsunternehmen oder Betrug beim Sport – immer werden Wertvorstellungen verletzt, die allgemein als hoch geachtet gelten.
Skandale sagen sehr viel über die gesellschaftlichen Werte zu unterschiedlichen Zeiten in der Geschichte aus. Manche Skandale haben zu einer Demokratisierung beitragen und Reformen in die Wege geleitet, andere haben bestehende Vorurteile verschärft oder ein Klima des Misstrauens erzeugt. Die historische Beschäftigung mit Skandalen soll uns zeigen, wie Wertkonflikte zu verschiedenen Zeiten ausgetragen wurden, wer von ihnen profitierte und zu wessen Lasten sie gingen.
Im Wettbewerbsmagazin spurensuchen stellen wir u.a. Themenbeispiele für Schüler aller Altersgruppen vor, und die Historiker Prof. Dr. Frank Bösch und Prof. Dr. Martin Sabrow erläutern Skandale aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive."
Link zur Wettbewerbsseite der Körber-Stiftung
Link zu Anregungen des Stadtarchiv Bergisch Gladbach
Wolf Thomas - am Mittwoch, 1. September 2010, 20:12 - Rubrik: Archivpaedagogik
" .... In keinem Archivfachbuch, das ich besitze, wird der Archivknoten erklärt; seit den 60er Jahren liest man überall nur "veraltet, nicht mehr in Anwendung". Auch im Internet: Fehlanzeige. ...." schreibt Archivalia-Leser ff. Dem Desiderat hat sich ff angenommen und eine Bildstory zum Thema auf Wikimedia Commons veröffentlicht.
Wolf Thomas - am Mittwoch, 1. September 2010, 19:35 - Rubrik: Bestandserhaltung
" ..... Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat jetzt formelle Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Verdachtes der Untreue im Zusammenhang mit der Errichtung des Landesarchives in den Räumen und auf dem Gelände des RWSG-Speichers aufgenommen.
Die bestätigte heute Nachmittag Rolf Haferkamp, Sprecher der Behörde. Wie die NRZ bereits im Mai berichtete, war bei der Duisburger Behörde dazu die Anzeige eines Privatdetektivs aus Frankfurt eingegangen. Konkret geht es um den Umstand, dass sich die Projektkosten des geplanten Archivbaus – möglicherweise durch eine Indiskretion vom Januar 2007 – um mindestens 10 Mio. Euro verteuert haben, zulasten des Steuerzahlers.
Strategischen Vorteil aus diesem Vorgang soll ein Essener Projektentwickler gezogen haben. Hierdurch sei es dem Unternehmen möglich gemacht worden, ein Grundstück am Innenhafen samt denkmalgeschütztem Speicher dem Land vor der Nase wegzuschnappen. Später hätten diese Unternehmer dem Land das Objekt zu einem Vielfachen des Kaufpreises zurückverkauft. Der Schaden, der dem Steuerzahler entstanden sei, liegt nach Einschätzung von Experten zwischen 10 und 20 Milo. Euro.
Die Gesamtkosten für den Bau des neuen Landesarchivs in Duisburg liegen derzeit bei 158 Millionen Euro. "
Quelle: derwesten.de, 31.08.2010
Zum Landesarchiv in Duisburg: s. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg
Die bestätigte heute Nachmittag Rolf Haferkamp, Sprecher der Behörde. Wie die NRZ bereits im Mai berichtete, war bei der Duisburger Behörde dazu die Anzeige eines Privatdetektivs aus Frankfurt eingegangen. Konkret geht es um den Umstand, dass sich die Projektkosten des geplanten Archivbaus – möglicherweise durch eine Indiskretion vom Januar 2007 – um mindestens 10 Mio. Euro verteuert haben, zulasten des Steuerzahlers.
Strategischen Vorteil aus diesem Vorgang soll ein Essener Projektentwickler gezogen haben. Hierdurch sei es dem Unternehmen möglich gemacht worden, ein Grundstück am Innenhafen samt denkmalgeschütztem Speicher dem Land vor der Nase wegzuschnappen. Später hätten diese Unternehmer dem Land das Objekt zu einem Vielfachen des Kaufpreises zurückverkauft. Der Schaden, der dem Steuerzahler entstanden sei, liegt nach Einschätzung von Experten zwischen 10 und 20 Milo. Euro.
Die Gesamtkosten für den Bau des neuen Landesarchivs in Duisburg liegen derzeit bei 158 Millionen Euro. "
Quelle: derwesten.de, 31.08.2010
Zum Landesarchiv in Duisburg: s. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg
Wolf Thomas - am Mittwoch, 1. September 2010, 19:20 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Gerda Laufenberg, Kalenderbild Januar 2011
"Die 12 original Bilder des Kalenders, aquarelierte Federzeichnungen ca. 20 x 27 cm, werden dieses Jahr erstmalig für einen guten Zweck von Gerda Laufenberg versteigert. Bei dem Thema Kult und Kultur ist die Verbindung zum Erhalt unserer Kultur und Stadtgeschichte nach dem Einsturz des Stadtarchivs Köln nicht weit. Das urkölsche Motto “Wat fott es, es fott!” hilft uns hier nicht viel weiter, jetzt heißt es lasst uns gemeinsam retten was zu retten ist.
Vom 1. bis 26. September 2010 freuen wir uns unter dem Menüpunkt Versteigerung auf Ihr Gebot!!! Die Auktion endet am 26.09.2010 um 17 Uhr.
Sie sind herzlich eingeladen zum Atelierfest von Gerda Laufenberg am 26.09.2010 ab 14 Uhr im Mühlenweg 3 in Köln-Rodenkirchen.
Die letzte Stunde der Online-Auktion leitet Dr. Ulrich Soénius von der IHK Köln.
Mitsteigern und mithelfen bis zum 26. September 2010!"
Quelle: http://www.koeln-ist-kult.de/
Wolf Thomas - am Mittwoch, 1. September 2010, 15:43 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Ricarda Baronin von Diepenbroick-Grüter will ganz sicher gehen, dass die rund 1500 Archivalien auf Haus Marck in Tecklenburg der Forschung für die Zukunft erhalten bleiben, deshalb fährt sie mehrgleisig: Neben dem Wasserschloss Haus Marck, auf dem die Originalakten lagern, werden die doppelt vorhandenen Microfiches vom Adelsarchiv zum einen vom LWL-Archivamt für Westfalen in Münster und zum anderen vom Kreisarchiv Steinfurt archiviert. Eigentümerin der Microfiches bleibt die Familie von Diepenbroick-Grüter.
Viel Zeit und Geld wurde investiert, um das Archiv Haus Marck zu erforschen, zu erhalten und für die Zukunft sicher aufzubewahren. Bestens verpackt in Archivkartons, sicher gelagert in Archivschränken und gut erschlossen durch ein detailliertes Findbuch können die Unterlagen auf Haus Marck direkt eingesehen werden. Baronin von Diepenbroick-Grüter betont, dass sie gerne Besucher nach Voranmeldung in ihren Archivräumen willkommen heißt.
Gefahren, denen Archivgut ausgesetzt sein kann, sind nicht zu unterschätzen. Die Kölner Stadtarchivkatastrophe steckt jedem Archivar noch in den Knochen. So ist die Idee von Baronin Diepenbroick-Grüter, in verschiedenen Archiven das Aktengut sicher verwahrt zu wissen, nachahmenswert.
Im Kreis Steinfurt können sich die Forscher freuen, wie bequem sie die Geschichte rund um Haus Marck erforschen können. Im Kreisarchiv in Steinfurt steht ein Readerprinter zur Verfügung, mit dem die Microfiches gelesen und ausgedruckt werden können. Microfiche bedeutet, dass jede Seite einer Urkunde, eines Tagebuchs, eines Aktennotiz oder einer Stammtafel microverfilmt
und dann auf einem Fiche, einer DIN A 5 großen Plastikfolienkarte, kopiert wurde.
Interessierte können jetzt in Münster oder in Steinfurt forschen. Sie wenden sich an das LWL-Archivamt für Westfalen in Münster, das die Adelsarchive in Westfalen-Lippe betreut, oder sie gehen ins Kreisarchiv, das sich im Kreishaus in Steinfurt-Burgsteinfurt befindet und an allen Werktagen ganztägig geöffnet hat."
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Viel Zeit und Geld wurde investiert, um das Archiv Haus Marck zu erforschen, zu erhalten und für die Zukunft sicher aufzubewahren. Bestens verpackt in Archivkartons, sicher gelagert in Archivschränken und gut erschlossen durch ein detailliertes Findbuch können die Unterlagen auf Haus Marck direkt eingesehen werden. Baronin von Diepenbroick-Grüter betont, dass sie gerne Besucher nach Voranmeldung in ihren Archivräumen willkommen heißt.
Gefahren, denen Archivgut ausgesetzt sein kann, sind nicht zu unterschätzen. Die Kölner Stadtarchivkatastrophe steckt jedem Archivar noch in den Knochen. So ist die Idee von Baronin Diepenbroick-Grüter, in verschiedenen Archiven das Aktengut sicher verwahrt zu wissen, nachahmenswert.
Im Kreis Steinfurt können sich die Forscher freuen, wie bequem sie die Geschichte rund um Haus Marck erforschen können. Im Kreisarchiv in Steinfurt steht ein Readerprinter zur Verfügung, mit dem die Microfiches gelesen und ausgedruckt werden können. Microfiche bedeutet, dass jede Seite einer Urkunde, eines Tagebuchs, eines Aktennotiz oder einer Stammtafel microverfilmt
und dann auf einem Fiche, einer DIN A 5 großen Plastikfolienkarte, kopiert wurde.
Interessierte können jetzt in Münster oder in Steinfurt forschen. Sie wenden sich an das LWL-Archivamt für Westfalen in Münster, das die Adelsarchive in Westfalen-Lippe betreut, oder sie gehen ins Kreisarchiv, das sich im Kreishaus in Steinfurt-Burgsteinfurt befindet und an allen Werktagen ganztägig geöffnet hat."
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Wolf Thomas - am Dienstag, 31. August 2010, 14:21 - Rubrik: Herrschaftsarchive
"Notariële akten zijn de bron van informatie, maar soms dienen ze ook ter inspiratie. Michel Ball, medewerker van het Gemeentearchief Rotterdam, publiceerde in 2007 het boek Rotterdam 1600-1630 dat in feite een wandeling biedt door het Rotterdam van begin 17e eeuw. Het doen en laten van de Rotterdammers komt uitvoerig aan de orde aan de hand van bewaard gebleven verklaringen in notariële akten.
Daarnaast zijn de oude notariële akten gebruikt als bron van inspiratie voor beeldend kunstenaar Raph de Haas (Gulpen, 1952) en Peter Sonneveld, artistiek leider van theater Bonheur. Gebaseerd op verhalen uit de notariële archieven over hekserij (toverij), diefstal, moord en doodslag, ongelukken, ziekten en seks maakten zij filmpjes, korte clips, waarbij Raph de Haas voor het oog van de camera ononderbroken associatieve beelden tekent bij een door Peter Sonneveld gesproken tekst. Dat levert verrassende beelden op. Een lijn die door de straten van de stad lijkt te worden getrokken verandert in een hond en hé... wat gebeurt daar?"
1. Film der Reihe: http://archiv.twoday.net/stories/6482876/ (Seksschandalen)
2. Film der Reihe: http://archiv.twoday.net/stories/6484508/ (Diefstal)
3. Film der Reihe: http://archiv.twoday.net/stories/6485642/ (Hekserij)
Wolf Thomas - am Montag, 30. August 2010, 22:08 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Leitung des Kölner Stadtarchivs hat Meldungen zurückgewiesen, man habe große Schwierigkeiten mit der Bearbeitung des geborgenen Archivguts. Bundesweit würden etwa 100 Menschen damit beschäftigt sein, sagte uns der stellvertretende Leiter des Stadtrachifs, Ulrich Fischer.
Die Unterlagen, Akten und Dokumente würden in ingesamt vier Gefriertrockungsanlagen bearbeitet. Eine der vier Trocknungsanlagen ist in privater Hand - auf diese Hilfe sei man angewiesen, sagte uns Fischer weiter. Langfristig wolle das Stadtarchiv versuchen, eine eigene Anlage zu betreiben."
Quelle: Radio Köln, 30.08.2010
Anmerkung: Die erwähnten "Meldungen" konnten weder gestern noch heute morgen (31.8.) ermittelt werden.
Die Unterlagen, Akten und Dokumente würden in ingesamt vier Gefriertrockungsanlagen bearbeitet. Eine der vier Trocknungsanlagen ist in privater Hand - auf diese Hilfe sei man angewiesen, sagte uns Fischer weiter. Langfristig wolle das Stadtarchiv versuchen, eine eigene Anlage zu betreiben."
Quelle: Radio Köln, 30.08.2010
Anmerkung: Die erwähnten "Meldungen" konnten weder gestern noch heute morgen (31.8.) ermittelt werden.
Wolf Thomas - am Montag, 30. August 2010, 16:49 - Rubrik: Kommunalarchive
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33210/1.html
Eile ist angesagt, wer sie online kostenlos lesen will: "Many of the files are available at DocumentsOnline. You can download them for free for one month."
Eile ist angesagt, wer sie online kostenlos lesen will: "Many of the files are available at DocumentsOnline. You can download them for free for one month."
KlausGraf - am Montag, 30. August 2010, 15:22 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 30. August 2010, 15:20 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Seit 2009 verwahrt das Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg die Materialien zur politischen Ikonographie und Ikonologie aus dem Nachlass des 2006 verstorbenen Historikers Reinhart Koselleck, während der schriftliche Nachlass in das Deutsche Literaturarchiv nach Marbach gelangt ist. Beide Institutionen haben die Aufgabe übernommen in enger Kooperation diese Dokumente der Wissenschaft zugänglich zu machen, Forschung dazu anzuregen und selbst zu betreiben. Nach der im Frühjahr 2009 in Marbach veranstalteten Tagung zum Thema „Sprache und Geschichte“ steht in Marburg vom 18.-20. November 2010 die Bildforschung des Historikers im Mittelpunkt. Unter dem von Reinhart Koselleck mitgeprägten und programmatisch vertretenen Begriff der „politischen Ikonologie“ sollen erste Einsichten zu dem bis dahin noch nicht erschlossenen Bestand in Marburg präsentiert werden, vor allem aber soll das Interesse des Historikers am Bild und seinem politischen Potenzial im weiteren interdisziplinären Feld der einschlägigen kunsthistorischen, historischen, ethnologisch-kulturwissenschaftlichen und philosophischen Debatten behandelt werden.
Die nach Marburg gelangten Bestände umfassen in der Hauptsache teils eigenhändige, teils aus anderen Quellen bezogene Fotografien und dazu gehörige Notizen zur Geschichte und Verbreitung des Kriegs- und Reiterdenkmals vorzugsweise in Europa. Die Schwerpunkte der eigenwillig geordneten, über Jahrzehnte zusammengetragenen Sammlung liegen in Deutschland und Frankreich. Zeitungsausschnitte, Postkarten und eigene Schnappschüsse zeugen vom umfassenden kunst- und kulturgeschichtlichen Interesse Kosellecks, aber auch von seiner bis in die Prozesse des Alltags reichenden Aufmerksamkeit für die politische Wirksamkeit von Bildern in Geschichte und Gegenwart. In einigen Aufsätzen hat Koselleck seine Überlegungen dazu ausformuliert, es haben Tagungen stattgefunden, deren Beiträge teilweise publiziert wurden. Viele Argumentationslinien sind aber erst angelegt und manche interessante Idee ist im Stadium einer Notiz verblieben.
Die sammelnde und kommentierende Auseinandersetzung des als Begriffshistoriker profilierten Forschers mit dem Bild in dessen politischer Funktion kann als Reaktion auf die von Koselleck früh erkannte und selbst erlebte Wirkmacht des Bildes verstanden werden. Deren Erforschung suchte er in der Zusammenarbeit mit Historikern und Kunsthistorikern immer wieder voranzutreiben. Der Nachlass zeugt von diesem die disziplinären Grenzen immer schon überschreitenden Erkenntnisinteresse, das in vieler Hinsicht heute aktueller ist denn je. Kosellecks Interesse an der politischen Instrumentalisierung des Bildes, beispielhaft greifbar im Denkmal, und seine damit zu verbindenden begriffsgeschichtlichen Überlegungen geben Anlass, über die Ursache und Wirkung politischer Bilder weiter nachzudenken. In den unterschiedlichsten Formen bedient sich auch heutige Politik – wie Politik seit jeher – der Bildmedien. Doch erhält dieses Feld im 21. Jahrhundert eine besondere Aktualität, indem die Bildmedien buchstäblich als Kriegsschauplätze genutzt werden. Seit dem Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 wird verstärkt diskutiert, inwiefern dergleichen Attentate nach Maßgabe ihrer visuellen Wirksamkeit in den Bildmedien geplant und durchgeführt werden. Die sogenannten neuen, asymmetrischen Kriege müssen als Phänomene der Globalisierung verstanden werden, die sich in einem Krieg der Bilder niederschlagen. Dies legt es nahe, eine Erforschung des politischen Bildgebrauchs aus den verschiedensten Blickpunkten und unter Einbeziehung unterschiedlicher geisteswissenschaftlicher Disziplinen zu betreiben.
Die Fragen, welche Reinhart Koselleck an das Bild richtete, an das politisch instrumentalisierte, in politischer Absicht geschaffene Kunstwerk, aber auch der Umgang, dener selbst mit Bildern pflegte, können in diesem Sinn Ausgangspunkt sein für eine historiographische Kontextualisierung und Aktualisierung einer an der Dimension des Politischen interessierten Kulturwissenschaft, welche das Bild in seiner politischen Aussage- und Gestaltungskraft im Sinne einer „politischen Ikonologie“ ernst nimmt.
Tagungsprogramm (Stand 2. August 2010)
Donnerstag, 18. November 2010
14.00 Begrüßung
14.15 Hubert Locher, Marburg, Politische Kommunikation. Für eine Geschichte der „politischen Sinnlichkeit“ nach Koselleck
1. Kosellecks (Bild-)Themen. Moderation: Frank Druffner, Marbach
14.45 Adriana Markantonatos, Marburg, Eine Sichtung der Bildsammlung Kosellecks aus kulturwissenschaftlicher Perspektive
15.30 Kaffeepause
16.00 Dietrich Schubert, Heidelberg, Politische Ikonographie der Opfer - im Hinblick auf Denkmäler für 1914-18
16.45 Monika Flacke, Berlin, Geschichte ausstellen
Pause
18.00 Abendvortrag
Beat Wyss, Karlsruhe/ Zürich, Die Nachträglichkeit der Geschichte. Überlegungen zur ‚Sattelzeit’
Gemeinsames Abendessen der Referenten
Freitag, 19. November 2010
2. Politische Absicht in den Bildmedien. Moderation: Christian Bracht, Marburg
9.00 Simone Derix, Köln, Performative Bildpolitiken
9.45 Andreas Dörner, Marburg, Audiovisuelle Geschichtspolitik. Zur Konstruktion von Vergangenheiten im populären deutschen Fernsehfilm
10.30 Kaffeepause
11.00 Michael Diers, Berlin, Ereignis Bild. Fotografie, Politik und (Be-)Deutung
11.45 Godehard Janzing, Paris, Asymmetrische Gegenbilder
Mittagspause. Imbiss für die Referenten in den Räumen von Foto Marburg
3. Worte, Bilder und Ideen. Moderation: Hubert Locher, Marburg
14.30 Barbara Stollberg-Rilinger, Münster, Die vergessenen Bilder der Begriffsgeschichte
15.15 Ulrich Hägele, Tübingen, Fotografie, Heimat und Folklore. Zur visuellen Konstruktion nationaler Identität
16.00 Kaffeepause
16.30 Bettina Brandt, Bielefeld, Politische Sinnstiftung in Geschlechterbildern
17.15 Barbara Klemm, Frankfurt am Main, Der Anteil der Fotografin
Pause
19.00 Abendvortrag. Ulrich Raulff, Marbach: Das letzte Jahrhundert der Pferde. Historische Hippologie nach Koselleck
Empfang im Ernst-von-Hülsen-Haus, gemeinsames Abendessen der Referenten und Gäste
Samstag, 20. November 2010
4. Historiographischer Kontext. Moderation: Marcel Lepper, Marbach
9.00 Daniela Bohde, Frankfurt am Main, Politische Ikonologie im Nationalsozialismus
9.45 Jost Philipp Klenner, Berlin
Kugelmensch. Percy Ernst Schramms politische Ikonologie
10.30 Kaffeepause
11.00 Gerhard Paul, Flensburg, Politische Bilder und historisches Denken
11.45 Jörg Probst, Marburg, Ikonologie und Prognose
12.30 Schlussdiskussion und Resumée
Mittagsimbiss für die Referenten und Abschluss der Tagung
Am Nachmittag besteht die Möglichkeit zu einem geführten Rundgang im Bildarchiv
Verantwortlich:
Prof. Dr. Hubert Locher
Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg
Kontakt:
Adriana Markantonatos, Tel. 06421 / 28 23 603, markanta@fotomarburg.de
Jörg Probst, Tel. 06421 / 28 22 174, probst@fotomarburg.de
Anmeldung und Information:
Andrea Schutte, Tel. 06421 / 28 23 676; Fax 06421 / 28 28 931, schutte@fotomarburg.de
http://www.fotomarburg.de
via Archivliste
Die nach Marburg gelangten Bestände umfassen in der Hauptsache teils eigenhändige, teils aus anderen Quellen bezogene Fotografien und dazu gehörige Notizen zur Geschichte und Verbreitung des Kriegs- und Reiterdenkmals vorzugsweise in Europa. Die Schwerpunkte der eigenwillig geordneten, über Jahrzehnte zusammengetragenen Sammlung liegen in Deutschland und Frankreich. Zeitungsausschnitte, Postkarten und eigene Schnappschüsse zeugen vom umfassenden kunst- und kulturgeschichtlichen Interesse Kosellecks, aber auch von seiner bis in die Prozesse des Alltags reichenden Aufmerksamkeit für die politische Wirksamkeit von Bildern in Geschichte und Gegenwart. In einigen Aufsätzen hat Koselleck seine Überlegungen dazu ausformuliert, es haben Tagungen stattgefunden, deren Beiträge teilweise publiziert wurden. Viele Argumentationslinien sind aber erst angelegt und manche interessante Idee ist im Stadium einer Notiz verblieben.
Die sammelnde und kommentierende Auseinandersetzung des als Begriffshistoriker profilierten Forschers mit dem Bild in dessen politischer Funktion kann als Reaktion auf die von Koselleck früh erkannte und selbst erlebte Wirkmacht des Bildes verstanden werden. Deren Erforschung suchte er in der Zusammenarbeit mit Historikern und Kunsthistorikern immer wieder voranzutreiben. Der Nachlass zeugt von diesem die disziplinären Grenzen immer schon überschreitenden Erkenntnisinteresse, das in vieler Hinsicht heute aktueller ist denn je. Kosellecks Interesse an der politischen Instrumentalisierung des Bildes, beispielhaft greifbar im Denkmal, und seine damit zu verbindenden begriffsgeschichtlichen Überlegungen geben Anlass, über die Ursache und Wirkung politischer Bilder weiter nachzudenken. In den unterschiedlichsten Formen bedient sich auch heutige Politik – wie Politik seit jeher – der Bildmedien. Doch erhält dieses Feld im 21. Jahrhundert eine besondere Aktualität, indem die Bildmedien buchstäblich als Kriegsschauplätze genutzt werden. Seit dem Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 wird verstärkt diskutiert, inwiefern dergleichen Attentate nach Maßgabe ihrer visuellen Wirksamkeit in den Bildmedien geplant und durchgeführt werden. Die sogenannten neuen, asymmetrischen Kriege müssen als Phänomene der Globalisierung verstanden werden, die sich in einem Krieg der Bilder niederschlagen. Dies legt es nahe, eine Erforschung des politischen Bildgebrauchs aus den verschiedensten Blickpunkten und unter Einbeziehung unterschiedlicher geisteswissenschaftlicher Disziplinen zu betreiben.
Die Fragen, welche Reinhart Koselleck an das Bild richtete, an das politisch instrumentalisierte, in politischer Absicht geschaffene Kunstwerk, aber auch der Umgang, dener selbst mit Bildern pflegte, können in diesem Sinn Ausgangspunkt sein für eine historiographische Kontextualisierung und Aktualisierung einer an der Dimension des Politischen interessierten Kulturwissenschaft, welche das Bild in seiner politischen Aussage- und Gestaltungskraft im Sinne einer „politischen Ikonologie“ ernst nimmt.
Tagungsprogramm (Stand 2. August 2010)
Donnerstag, 18. November 2010
14.00 Begrüßung
14.15 Hubert Locher, Marburg, Politische Kommunikation. Für eine Geschichte der „politischen Sinnlichkeit“ nach Koselleck
1. Kosellecks (Bild-)Themen. Moderation: Frank Druffner, Marbach
14.45 Adriana Markantonatos, Marburg, Eine Sichtung der Bildsammlung Kosellecks aus kulturwissenschaftlicher Perspektive
15.30 Kaffeepause
16.00 Dietrich Schubert, Heidelberg, Politische Ikonographie der Opfer - im Hinblick auf Denkmäler für 1914-18
16.45 Monika Flacke, Berlin, Geschichte ausstellen
Pause
18.00 Abendvortrag
Beat Wyss, Karlsruhe/ Zürich, Die Nachträglichkeit der Geschichte. Überlegungen zur ‚Sattelzeit’
Gemeinsames Abendessen der Referenten
Freitag, 19. November 2010
2. Politische Absicht in den Bildmedien. Moderation: Christian Bracht, Marburg
9.00 Simone Derix, Köln, Performative Bildpolitiken
9.45 Andreas Dörner, Marburg, Audiovisuelle Geschichtspolitik. Zur Konstruktion von Vergangenheiten im populären deutschen Fernsehfilm
10.30 Kaffeepause
11.00 Michael Diers, Berlin, Ereignis Bild. Fotografie, Politik und (Be-)Deutung
11.45 Godehard Janzing, Paris, Asymmetrische Gegenbilder
Mittagspause. Imbiss für die Referenten in den Räumen von Foto Marburg
3. Worte, Bilder und Ideen. Moderation: Hubert Locher, Marburg
14.30 Barbara Stollberg-Rilinger, Münster, Die vergessenen Bilder der Begriffsgeschichte
15.15 Ulrich Hägele, Tübingen, Fotografie, Heimat und Folklore. Zur visuellen Konstruktion nationaler Identität
16.00 Kaffeepause
16.30 Bettina Brandt, Bielefeld, Politische Sinnstiftung in Geschlechterbildern
17.15 Barbara Klemm, Frankfurt am Main, Der Anteil der Fotografin
Pause
19.00 Abendvortrag. Ulrich Raulff, Marbach: Das letzte Jahrhundert der Pferde. Historische Hippologie nach Koselleck
Empfang im Ernst-von-Hülsen-Haus, gemeinsames Abendessen der Referenten und Gäste
Samstag, 20. November 2010
4. Historiographischer Kontext. Moderation: Marcel Lepper, Marbach
9.00 Daniela Bohde, Frankfurt am Main, Politische Ikonologie im Nationalsozialismus
9.45 Jost Philipp Klenner, Berlin
Kugelmensch. Percy Ernst Schramms politische Ikonologie
10.30 Kaffeepause
11.00 Gerhard Paul, Flensburg, Politische Bilder und historisches Denken
11.45 Jörg Probst, Marburg, Ikonologie und Prognose
12.30 Schlussdiskussion und Resumée
Mittagsimbiss für die Referenten und Abschluss der Tagung
Am Nachmittag besteht die Möglichkeit zu einem geführten Rundgang im Bildarchiv
Verantwortlich:
Prof. Dr. Hubert Locher
Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg
Kontakt:
Adriana Markantonatos, Tel. 06421 / 28 23 603, markanta@fotomarburg.de
Jörg Probst, Tel. 06421 / 28 22 174, probst@fotomarburg.de
Anmeldung und Information:
Andrea Schutte, Tel. 06421 / 28 23 676; Fax 06421 / 28 28 931, schutte@fotomarburg.de
http://www.fotomarburg.de
via Archivliste
Wolf Thomas - am Montag, 30. August 2010, 13:29 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der spielmännische Legenden- und Abenteuerroman Orendel (oder: Der Graue Rock) war nur in einer einzigen elsässischen Handschrift von 1477 überliefert, die 1870 in Straßburg verbrannte:
http://www.handschriftencensus.de/werke/1492
Er liegt außerdem in einem Druck von Hans Froschauer (Augsburg 1512) vor. Digitalisat:
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00009164/image_1
Bei Johann Otmar erschien ebenfalls in Augsburg im gleichen Jahr eine Prosaauflösung (der VD 16 verzeichnet sie in zwei variierenden Ausgaben):
VD16 ZV 12009
Digitalisat von VD16 ZV 12008
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00011538/image_5
Die Prosaauflösung P geht auf eine alte Handschrift zurück und hat eigenen textkritischen Wert.
Literatur zur Orendelforschung: Siehe etwa die Hinweise von Michael Embach in: Wallfahrt und Kommunikation. Mainz 2004, S. 239 Anm. 21 sowie Christian Kiening in: Literarische und religiöse Kommunikation in Mittelalter und früher Neuzeit, 2009, S. 389ff.:
http://books.google.com/books?id=Iilp4omCmuwC&pg=PA389 bzw.
http://paperc.de (nach Registrierung komplett einsehbar)
Der Artikel von Achim Masser in der Enzyklopädie des Märchens 10 (2002), Sp. 358-362 ist ganz einsehbar unter
http://www.libreka.de/9783110168419/195
Friedrich Heinrich von der Hagen legte die Erstausgabe des Textes 1844 vor und besprach auch kurz die Prosaauflösung (S. XXV):
http://books.google.com/books?id=dts6AAAAcAAJ&pg=PR25
Sehr viel ausführlicher handelte sie Bergers Ausgabe von 1888 ab (Wiedergabe des Schluss der Prosaauflösung P S. 183-186):
http://books.google.com/books?id=oGESAAAAMAAJ&pg=PA183 (US-Proxy) bzw.
http://www.archive.org/details/orendel00orengoog
Abschrift von einem dieser beiden extrem seltenen Otmar-Drucke von 1512 dürfte die 1547 datierte Sigmaringer Handschrift (Hofbibliothek, Cod. 372) sein, die nach der Findkartei aus 32 beschriebenen und 2 unbeschriebenen Blättern besteht (ich habe sie nicht gesehen). Die Karteikarte gibt als Überschrift "Von dem vntrenlichen ungenäten rock vnssers heren" und weist darauf hin, sie stimme mit dem Augsburger Druck von 1512 überein.
Sicher galt das Interesse des Abschreibers der Heilig-Rock-Reliquie und nicht dem für die Altgermanistik so wichtigen Orendel-Text, aber als Rezeptionszeugnis der Augsburger Prosaauflösung sollte man das Sigmaringer Manuskript durchaus notieren.
#forschung
#fnzhss

http://www.handschriftencensus.de/werke/1492
Er liegt außerdem in einem Druck von Hans Froschauer (Augsburg 1512) vor. Digitalisat:
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00009164/image_1
Bei Johann Otmar erschien ebenfalls in Augsburg im gleichen Jahr eine Prosaauflösung (der VD 16 verzeichnet sie in zwei variierenden Ausgaben):
VD16 ZV 12009
Digitalisat von VD16 ZV 12008
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00011538/image_5
Die Prosaauflösung P geht auf eine alte Handschrift zurück und hat eigenen textkritischen Wert.
Literatur zur Orendelforschung: Siehe etwa die Hinweise von Michael Embach in: Wallfahrt und Kommunikation. Mainz 2004, S. 239 Anm. 21 sowie Christian Kiening in: Literarische und religiöse Kommunikation in Mittelalter und früher Neuzeit, 2009, S. 389ff.:
http://books.google.com/books?id=Iilp4omCmuwC&pg=PA389 bzw.
Der Artikel von Achim Masser in der Enzyklopädie des Märchens 10 (2002), Sp. 358-362 ist ganz einsehbar unter
Friedrich Heinrich von der Hagen legte die Erstausgabe des Textes 1844 vor und besprach auch kurz die Prosaauflösung (S. XXV):
http://books.google.com/books?id=dts6AAAAcAAJ&pg=PR25
Sehr viel ausführlicher handelte sie Bergers Ausgabe von 1888 ab (Wiedergabe des Schluss der Prosaauflösung P S. 183-186):
http://books.google.com/books?id=oGESAAAAMAAJ&pg=PA183 (US-Proxy) bzw.
http://www.archive.org/details/orendel00orengoog
Abschrift von einem dieser beiden extrem seltenen Otmar-Drucke von 1512 dürfte die 1547 datierte Sigmaringer Handschrift (Hofbibliothek, Cod. 372) sein, die nach der Findkartei aus 32 beschriebenen und 2 unbeschriebenen Blättern besteht (ich habe sie nicht gesehen). Die Karteikarte gibt als Überschrift "Von dem vntrenlichen ungenäten rock vnssers heren" und weist darauf hin, sie stimme mit dem Augsburger Druck von 1512 überein.
Sicher galt das Interesse des Abschreibers der Heilig-Rock-Reliquie und nicht dem für die Altgermanistik so wichtigen Orendel-Text, aber als Rezeptionszeugnis der Augsburger Prosaauflösung sollte man das Sigmaringer Manuskript durchaus notieren.
#forschung
#fnzhss

KlausGraf - am Montag, 30. August 2010, 01:59 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Hofbibliothek Sigmaringen Cod. 399 besteht aus 5 Pergamentstreifen des 13. Jahrhunderts mit Nachträgen des 15. Jahrhunderts.
Zum regulierten Augustinerchorherrenstift Lonnig (im 14. Jahrhundert nach Mayen verlegt) siehe
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00048846/image_75
http://www.digitalis.uni-koeln.de/Schorn/schorn_1_762-768.pdf
#forschung
Zum regulierten Augustinerchorherrenstift Lonnig (im 14. Jahrhundert nach Mayen verlegt) siehe
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00048846/image_75
http://www.digitalis.uni-koeln.de/Schorn/schorn_1_762-768.pdf
#forschung
KlausGraf - am Montag, 30. August 2010, 01:35 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Wikipedia-Artikel gibt einen kurzen Überblick zu Person und Werk der 1447/48 gestorbenen elsässischen Nonne Margaretha Ursula von Masmünster, die eine geistliche Andachtsübung, eine Pilgerfahrt im Geiste, verfasste.
http://de.wikipedia.org/wiki/Margaretha_Ursula_von_Masmünster
Anders als der Handschriftencensus listet die Wikipedia die bekannte handschriftliche Überlieferung vollständig auf.
http://www.handschriftencensus.de/werke/4349
Bei einem Besuch der Hofbibliothek Sigmaringen konnte nicht nur (aufgrund der Karteikarten, nicht durch Autopsie) eine weitere Überlieferung des Textes festgestellt werden, sondern auch eine der germanistischen Forschung bislang entgangene Wiedergabe des Textes in heutiger Sprache. Eine Edition existiert nicht, bislang kannte man nur ein Referat F. Landmanns mit ausführlichen Textzitaten (siehe ²VL 5, 1250f.).
Hofbibliothek Sigmaringen Cod. 443 ist ein in der Findkartei der Bibliothek als Gebetbuch bezeichneter Codex (213 Blatt, Oktavformat), der nach Bl. 212b 1543 von Schwester Anna Heltzlin im Kloster Stetten bei Hechingen geschrieben wurde. Als Textbeginn von Bl. 1a wird angegeben: "Das ist ain kurtze ordnung wie sich ain mensch schicken mag vff yettliche fest im iar doch on verbund".
Vom hohenzollerischen Heimatforscher Johann Adam Kraus stammt die Wiedergabe des Textes in heutiger Sprache, der sich nach Kraus auf den Seiten 178-212 (vermutlich: Blatt 178-212) des Gebetbuchs befindet:
Johann Adam Kraus: Ein 500jähriger Bericht aus Jerusalem. In: Das Heilige Land 87 (1955), H. 1/2, S. 10-15
Update: http://archiv.twoday.net/stories/49616172/
#forschung
http://de.wikipedia.org/wiki/Margaretha_Ursula_von_Masmünster
Anders als der Handschriftencensus listet die Wikipedia die bekannte handschriftliche Überlieferung vollständig auf.
http://www.handschriftencensus.de/werke/4349
Bei einem Besuch der Hofbibliothek Sigmaringen konnte nicht nur (aufgrund der Karteikarten, nicht durch Autopsie) eine weitere Überlieferung des Textes festgestellt werden, sondern auch eine der germanistischen Forschung bislang entgangene Wiedergabe des Textes in heutiger Sprache. Eine Edition existiert nicht, bislang kannte man nur ein Referat F. Landmanns mit ausführlichen Textzitaten (siehe ²VL 5, 1250f.).
Hofbibliothek Sigmaringen Cod. 443 ist ein in der Findkartei der Bibliothek als Gebetbuch bezeichneter Codex (213 Blatt, Oktavformat), der nach Bl. 212b 1543 von Schwester Anna Heltzlin im Kloster Stetten bei Hechingen geschrieben wurde. Als Textbeginn von Bl. 1a wird angegeben: "Das ist ain kurtze ordnung wie sich ain mensch schicken mag vff yettliche fest im iar doch on verbund".
Vom hohenzollerischen Heimatforscher Johann Adam Kraus stammt die Wiedergabe des Textes in heutiger Sprache, der sich nach Kraus auf den Seiten 178-212 (vermutlich: Blatt 178-212) des Gebetbuchs befindet:
Johann Adam Kraus: Ein 500jähriger Bericht aus Jerusalem. In: Das Heilige Land 87 (1955), H. 1/2, S. 10-15
Update: http://archiv.twoday.net/stories/49616172/
#forschung
KlausGraf - am Montag, 30. August 2010, 00:56 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Volker Rieble: Das Wissenschaftsplagiat. Frankfurt a. M. 2010, S. 83: "Auch der tote Freisler bleibt ein Rechtsgenosse".
Rieble plädiert, man dürfe kein Zitatverbot gegen arbeitsrechtliche Veröffentlichungen Freislers aussprechen.
Wes Geistes Kind dieser Rieble ist, gibt zu erkennen:
http://archiv.twoday.net/search?q=rieble
 Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive), Bild 151-17-15 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de
Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive), Bild 151-17-15 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de
Rieble plädiert, man dürfe kein Zitatverbot gegen arbeitsrechtliche Veröffentlichungen Freislers aussprechen.
Wes Geistes Kind dieser Rieble ist, gibt zu erkennen:
http://archiv.twoday.net/search?q=rieble
 Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive), Bild 151-17-15 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de
Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive), Bild 151-17-15 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.deKlausGraf - am Montag, 30. August 2010, 00:14 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
KlausGraf - am Sonntag, 29. August 2010, 20:47 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Fragt das Österreichische Staatsarchiv auf Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Wien-Austria/Osterreichisches-Staatsarchiv/132810356745747
http://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=946400
In einem von blau und rot geteilten Schild unten etwas undefinierbares Graues ;-)

http://www.facebook.com/pages/Wien-Austria/Osterreichisches-Staatsarchiv/132810356745747
http://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=946400
In einem von blau und rot geteilten Schild unten etwas undefinierbares Graues ;-)
KlausGraf - am Sonntag, 29. August 2010, 15:12 - Rubrik: Hilfswissenschaften
Herbert Blume: Hermann Bote. Braunschweiger Stadtschreiber und Literat. Studien zu seinem Leben und Werk (= Braunschweiger Beiträge zur deutschen Sprache und Literatur 15). Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 2009. ISBN 978-3-89534-875-4. Gb. 24x16 cm. 368 S. 10 sw. Abb. 6 farb. Abb. 24,00 €
Inhaltsverzeichnis: http://d-nb.info/992808820/04 (PDF)
Blume ist salopp formuliert der "Bote-Papst". Kein anderer Wissenschaftler hat sich so intensiv mit dem wohl 1520 gestorbenen Braunschweiger Autor befasst wie Blume. Das nun vorliegende Buch ist zwar keine Gesamtdarstellung, sondern aus einzelnen früher veröffentlichten Aufsätzen zusammengesetzt, weist aber ein vergleichsweise hohes Maß an Geschlossenheit auf. Blume hat erfreulicherweise die älteren Arbeiten revidiert, teilweise erweitert und auf den neuesten Forschungsstand gebracht. Ein Schwerpunkt der gründlichen und quellennahen Studien sind jene Texte Botes, die mit den Braunschweiger Bürgerkonflikten zusammenhängen: das Schichtbuch und die Ludeke-Holland-Lieder. Leider werden die beiden Weltchroniken nur in der zusammenfassenden Einführung in Botes Leben und Werk sehr knapp vorgestellt. Aber immerhin fällt durch die Überlieferungs-Studien zum Schichtbuch und zu den Liedern etwas Licht auf die frühneuzeitliche Braunschweiger Stadtchronistik.
Der zweite Teil gilt dem Eulenspiegelbuch. Blume verficht vehement die Verfasserschaft Botes, die er als beinahe sicher ansieht. Nun mag es zwar zutreffen, dass bis zum Erscheinen von Schulz-Groberts Studien zum Eulenspiegelbuch 1999 überwiegend von der Verfasserschaft Botes ausgegangen wurde. Aber gilt das heute immer noch? Weder in seinem Buch noch in der Daphnis-Rezension von 2001 findet Blume zu einer fairen Würdigung der Leistung von Schulz-Grobert. Schaut man sich andere Rezensionen des Buchs von Schulz-Grobert an, so werden diese dem Werk eher gerecht.
Man lese etwa John L. Flood, früher ein klarer Vertreter der Bote-Verfasserschaft, der Schulz-Groberts Buch in der ZfdA 129 (2000), S. 469-474 rezensierte. Es dürfte, meint Flood S. 473, nunmehr erwiesen sein, dass die Ansprüche der Bote-Forschung der 1970er und 1980er mit Blick auf das Eulenspiegelbuch übertrieben waren. Blume will dies nicht wahrhaben.
"Mit der Beschreibung des Ulenspiegel als eines „gelehrten literarischen Scherzartikel[s]“ (S. 275), wie Schulz-Grobert sie konsequent durchführt, um in der bisherigen Forschung „weitgehend marginalisierte[ ] Subjekte[ ]“ (S. 26) der ,Straßburger Intelligenz‘ als Produktionsinstanzen ins Licht zu rücken, geht die Gefahr einer neuen Einseitigkeit einher: Das Bild einer humanistisch-scherzfreudigen Elite, die in kongenialem Zusammenspiel [...] auf hohem Reflexionsniveau einen „komischen Geschmack“ (S. 269) bedient habe, setzt einen neuen Mythos an die Stelle des zu Recht kritisierten alten. Dabei werden diesbezüglich als Störmomente zu wertende Fakten des Überlieferten bagatellisiert." (Anna Mühlherr, Arbitrium 2001, S. 177f.)
Blume hinwiederum bagatellisiert eindeutig all das, was gegen Bote als Autor spricht.
Ist die von Honegger 1973 als Akrostichon Herman Botes ausgegebene Zeichenfolge ERMANB überhaupt ein Akrostichon? Und wenn ja, bezieht sie sich auf tatsächlich auf Bote? Blume, der sich auf die Verfasserschaft Botes festgelegt hat, konnte kein Interesse daran haben, den 2005, also nach dem Erscheinen der Arbeit von Schulz-Grobert, veröffentlichten Aufsatz von Ulrich Seelbach zur Akrostichon-Problematik auf Herz und Nieren zu prüfen.
Ohne Zweifel sind Schulz-Grobert grobe Fehleinschätzungen unterlaufen. Die von Blume unverständlicherweise nicht zitierte Dissertation von Julia Buchloh (online seit September 2005!) zu den Illustrationen der Straßburger Drucke, die auch das lange der Forschung entzogene Hucker-Exemplar einsehen (aber nicht fotografieren!) durfte, kommt zu dem Schluss, dass Honeggers Fragment und Huckers unvollständiges Exemplar ein- und derselben Ausgabe angehören und vor der Ausgabe von 1515 anzusetzen sind (Schulz-Grobert hatte das bezweifelt).
http://opus.kobv.de/tuberlin/volltexte/2005/1095/pdf/buchloh_julia.pdf
Schlüssig wiederlegt Blume Schulz-Groberts Argumentation mit den geographischen Kenntnissen von Sebastian Brant. Nicht nur das Lokalkolorit, auch die niederdeutschen Spuren im oberdeutschen Straßburger Druck sind nicht ganz wegzudiskutieren.
Auf der anderen Seite steht die von Schulz-Grobert überzeugend belegte Straßburger Intertextualität der frühesten Ausgaben. Wenn man nicht annehmen will, dass die Wigalois-Vorrede (siehe Flood, ZfdA 1976) nach Braunschweig gelangt ist und dort von Bote verwendet wurde, muss man sie der erschlossenen niederdeutschen Vorlage absprechen. Welcher Textbestand bleibt für eine niederdeutsche, womöglich Braunschweiger Vorlage übrig? Unverzichtbar für die "Boteaner" sind die Historien, die das vermeintliche Akrostichon ERMANB überliefern.
Buchloh S. 33 bildet das von Sodmann 1980 entdeckte Titelblatt zum Liber-vagatorum-Druck des Braunschweiger Druckers Hans Dorn (VD16 L 1567) von ca. 1510 ab, das eine Eulenspiegeldarstellung zeigt. Dorn druckte 1509 auch eine Schrift Murners mit Beigabe von Sebastian Brant (VD16 M 7051). Einflüsse Straßburg-Braunschweig sind in beiden Richtungen möglich. Denkbar ist, dass Dorn eine Straßburger Auflage des Eulenspiegelbuchs vorlag und er eine eigene wohl in niederdeutscher Sprache (zum Wechsel der Druckersprache Dorns, ablesbar am Wortlaut der Titel, sehe man den VD 16 http://www.vd16.de) vorlegte oder auch nur plante. Man muss ja nicht an eine Gesamtillustration wie in den Grüninger-Drucken denken. Der Holzschnitt kann als Titelholzschnitt und einzige Illustration gedient haben. Denkbar ist aber auch, dass eine Braunschweiger Eulenspiegelausgabe Dorns nach Straßburg gelangte und Vorlage für die erheblich erweiterte Redaktion der Grüninger-Drucke war.
S. 221 erwägt Blume, ob ein fingierter Hinweis auf dem Titelblatt eines Drucks von 1618, das Buch sei aus sächsischer Sprache ins Hochdeutsche übersetzt, auf die Kenntnis eines über 100 Jahre früher veröffentlichten niederdeutschen Drucks hindeuten könnte. Ich halte das mit Verlaub für reines Wunschdenken.
Die Annahme einer niederdeutschen Vorlage (ob als Druck oder in handschriftlicher Form, sei dahingestellt) für den Straßburger Druck scheint mir plausibel. Aber ob Bote - wenn man das umstrittene Akrostichon beiseite lässt - unbedingt der Autor sein muss? Weder sind die Gegenargumente gegen ihn als Verfasser sonderlich zwingend noch die Argumente für ihn. Schlagende Übereinstimmungen mit Bote-Werken sind nicht namhaft gemacht worden. Einen Einblick in die Argumente vermittelt online
http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/108532.html
Auch wenn Blume das Gegenteil beteuert: Bote als Autor des Eulenspiegelbuchs ist mit einem dicken Fragezeichen zu versehen. Ob sich so bald nach Schulz-Groberts Habilitationsschrift jemand die philologische Kleinarbeit aufhalst, möglichst unvoreingenommen mögliche niederdeutsche Spuren im Text zu sichern und mit den stoffgeschichtlichen Resultaten von Schulz-Grobert zu konfrontieren, darf dahingestellt bleiben. Bis dahin wird der "Bote-Papst" Blume fortfahren, die Verfasserschaft Botes zu dekretieren (etwa in Killys Literaturlexikon, nach Registrierung einsehbar bei http://paperc.de).

Inhaltsverzeichnis: http://d-nb.info/992808820/04 (PDF)
Blume ist salopp formuliert der "Bote-Papst". Kein anderer Wissenschaftler hat sich so intensiv mit dem wohl 1520 gestorbenen Braunschweiger Autor befasst wie Blume. Das nun vorliegende Buch ist zwar keine Gesamtdarstellung, sondern aus einzelnen früher veröffentlichten Aufsätzen zusammengesetzt, weist aber ein vergleichsweise hohes Maß an Geschlossenheit auf. Blume hat erfreulicherweise die älteren Arbeiten revidiert, teilweise erweitert und auf den neuesten Forschungsstand gebracht. Ein Schwerpunkt der gründlichen und quellennahen Studien sind jene Texte Botes, die mit den Braunschweiger Bürgerkonflikten zusammenhängen: das Schichtbuch und die Ludeke-Holland-Lieder. Leider werden die beiden Weltchroniken nur in der zusammenfassenden Einführung in Botes Leben und Werk sehr knapp vorgestellt. Aber immerhin fällt durch die Überlieferungs-Studien zum Schichtbuch und zu den Liedern etwas Licht auf die frühneuzeitliche Braunschweiger Stadtchronistik.
Der zweite Teil gilt dem Eulenspiegelbuch. Blume verficht vehement die Verfasserschaft Botes, die er als beinahe sicher ansieht. Nun mag es zwar zutreffen, dass bis zum Erscheinen von Schulz-Groberts Studien zum Eulenspiegelbuch 1999 überwiegend von der Verfasserschaft Botes ausgegangen wurde. Aber gilt das heute immer noch? Weder in seinem Buch noch in der Daphnis-Rezension von 2001 findet Blume zu einer fairen Würdigung der Leistung von Schulz-Grobert. Schaut man sich andere Rezensionen des Buchs von Schulz-Grobert an, so werden diese dem Werk eher gerecht.
Man lese etwa John L. Flood, früher ein klarer Vertreter der Bote-Verfasserschaft, der Schulz-Groberts Buch in der ZfdA 129 (2000), S. 469-474 rezensierte. Es dürfte, meint Flood S. 473, nunmehr erwiesen sein, dass die Ansprüche der Bote-Forschung der 1970er und 1980er mit Blick auf das Eulenspiegelbuch übertrieben waren. Blume will dies nicht wahrhaben.
"Mit der Beschreibung des Ulenspiegel als eines „gelehrten literarischen Scherzartikel[s]“ (S. 275), wie Schulz-Grobert sie konsequent durchführt, um in der bisherigen Forschung „weitgehend marginalisierte[ ] Subjekte[ ]“ (S. 26) der ,Straßburger Intelligenz‘ als Produktionsinstanzen ins Licht zu rücken, geht die Gefahr einer neuen Einseitigkeit einher: Das Bild einer humanistisch-scherzfreudigen Elite, die in kongenialem Zusammenspiel [...] auf hohem Reflexionsniveau einen „komischen Geschmack“ (S. 269) bedient habe, setzt einen neuen Mythos an die Stelle des zu Recht kritisierten alten. Dabei werden diesbezüglich als Störmomente zu wertende Fakten des Überlieferten bagatellisiert." (Anna Mühlherr, Arbitrium 2001, S. 177f.)
Blume hinwiederum bagatellisiert eindeutig all das, was gegen Bote als Autor spricht.
Ist die von Honegger 1973 als Akrostichon Herman Botes ausgegebene Zeichenfolge ERMANB überhaupt ein Akrostichon? Und wenn ja, bezieht sie sich auf tatsächlich auf Bote? Blume, der sich auf die Verfasserschaft Botes festgelegt hat, konnte kein Interesse daran haben, den 2005, also nach dem Erscheinen der Arbeit von Schulz-Grobert, veröffentlichten Aufsatz von Ulrich Seelbach zur Akrostichon-Problematik auf Herz und Nieren zu prüfen.
Ohne Zweifel sind Schulz-Grobert grobe Fehleinschätzungen unterlaufen. Die von Blume unverständlicherweise nicht zitierte Dissertation von Julia Buchloh (online seit September 2005!) zu den Illustrationen der Straßburger Drucke, die auch das lange der Forschung entzogene Hucker-Exemplar einsehen (aber nicht fotografieren!) durfte, kommt zu dem Schluss, dass Honeggers Fragment und Huckers unvollständiges Exemplar ein- und derselben Ausgabe angehören und vor der Ausgabe von 1515 anzusetzen sind (Schulz-Grobert hatte das bezweifelt).
http://opus.kobv.de/tuberlin/volltexte/2005/1095/pdf/buchloh_julia.pdf
Schlüssig wiederlegt Blume Schulz-Groberts Argumentation mit den geographischen Kenntnissen von Sebastian Brant. Nicht nur das Lokalkolorit, auch die niederdeutschen Spuren im oberdeutschen Straßburger Druck sind nicht ganz wegzudiskutieren.
Auf der anderen Seite steht die von Schulz-Grobert überzeugend belegte Straßburger Intertextualität der frühesten Ausgaben. Wenn man nicht annehmen will, dass die Wigalois-Vorrede (siehe Flood, ZfdA 1976) nach Braunschweig gelangt ist und dort von Bote verwendet wurde, muss man sie der erschlossenen niederdeutschen Vorlage absprechen. Welcher Textbestand bleibt für eine niederdeutsche, womöglich Braunschweiger Vorlage übrig? Unverzichtbar für die "Boteaner" sind die Historien, die das vermeintliche Akrostichon ERMANB überliefern.
Buchloh S. 33 bildet das von Sodmann 1980 entdeckte Titelblatt zum Liber-vagatorum-Druck des Braunschweiger Druckers Hans Dorn (VD16 L 1567) von ca. 1510 ab, das eine Eulenspiegeldarstellung zeigt. Dorn druckte 1509 auch eine Schrift Murners mit Beigabe von Sebastian Brant (VD16 M 7051). Einflüsse Straßburg-Braunschweig sind in beiden Richtungen möglich. Denkbar ist, dass Dorn eine Straßburger Auflage des Eulenspiegelbuchs vorlag und er eine eigene wohl in niederdeutscher Sprache (zum Wechsel der Druckersprache Dorns, ablesbar am Wortlaut der Titel, sehe man den VD 16 http://www.vd16.de) vorlegte oder auch nur plante. Man muss ja nicht an eine Gesamtillustration wie in den Grüninger-Drucken denken. Der Holzschnitt kann als Titelholzschnitt und einzige Illustration gedient haben. Denkbar ist aber auch, dass eine Braunschweiger Eulenspiegelausgabe Dorns nach Straßburg gelangte und Vorlage für die erheblich erweiterte Redaktion der Grüninger-Drucke war.
S. 221 erwägt Blume, ob ein fingierter Hinweis auf dem Titelblatt eines Drucks von 1618, das Buch sei aus sächsischer Sprache ins Hochdeutsche übersetzt, auf die Kenntnis eines über 100 Jahre früher veröffentlichten niederdeutschen Drucks hindeuten könnte. Ich halte das mit Verlaub für reines Wunschdenken.
Die Annahme einer niederdeutschen Vorlage (ob als Druck oder in handschriftlicher Form, sei dahingestellt) für den Straßburger Druck scheint mir plausibel. Aber ob Bote - wenn man das umstrittene Akrostichon beiseite lässt - unbedingt der Autor sein muss? Weder sind die Gegenargumente gegen ihn als Verfasser sonderlich zwingend noch die Argumente für ihn. Schlagende Übereinstimmungen mit Bote-Werken sind nicht namhaft gemacht worden. Einen Einblick in die Argumente vermittelt online
http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/108532.html
Auch wenn Blume das Gegenteil beteuert: Bote als Autor des Eulenspiegelbuchs ist mit einem dicken Fragezeichen zu versehen. Ob sich so bald nach Schulz-Groberts Habilitationsschrift jemand die philologische Kleinarbeit aufhalst, möglichst unvoreingenommen mögliche niederdeutsche Spuren im Text zu sichern und mit den stoffgeschichtlichen Resultaten von Schulz-Grobert zu konfrontieren, darf dahingestellt bleiben. Bis dahin wird der "Bote-Papst" Blume fortfahren, die Verfasserschaft Botes zu dekretieren (etwa in Killys Literaturlexikon, nach Registrierung einsehbar bei http://paperc.de).

KlausGraf - am Sonntag, 29. August 2010, 00:42 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Petitionsausschuß des Deutschen Bundestages hat gegen die Stimmen der Fraktion der Grünen und der Linken die Weiterleitung der Petition über die Abschaffung der Eintrittsgebühren in das Lesekabinett der Deutschen Bibliothek an die Bundesregierung abgelehnt.
werkvermittlung - am Samstag, 28. August 2010, 19:41 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 28. August 2010, 16:14 - Rubrik: Museumswesen
http://www.herder-institut.de/startseite/publikationen/zfo/zfo-datenbank.html
Sie sind aber nicht via
http://www.clio-online.de/site/40208174/default.aspx
suchbar!
Ebensowenig wie
http://www.kbl.badw-muenchen.de/zblg-online/
Sie sind aber nicht via
http://www.clio-online.de/site/40208174/default.aspx
suchbar!
Ebensowenig wie
http://www.kbl.badw-muenchen.de/zblg-online/
KlausGraf - am Samstag, 28. August 2010, 15:50 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Notariële akten zijn de bron van informatie, maar soms dienen ze ook ter inspiratie. Michel Ball, medewerker van het Gemeentearchief Rotterdam, publiceerde in 2007 het boek Rotterdam 1600-1630 dat in feite een wandeling biedt door het Rotterdam van begin 17e eeuw. Het doen en laten van de Rotterdammers komt uitvoerig aan de orde aan de hand van bewaard gebleven verklaringen in notariële akten.
Daarnaast zijn de oude notariële akten gebruikt als bron van inspiratie voor beeldend kunstenaar Raph de Haas (Gulpen, 1952) en Peter Sonneveld, artistiek leider van theater Bonheur. Gebaseerd op verhalen uit de notariële archieven over hekserij (toverij), diefstal, moord en doodslag, ongelukken, ziekten en seks maakten zij filmpjes, korte clips, waarbij Raph de Haas voor het oog van de camera ononderbroken associatieve beelden tekent bij een door Peter Sonneveld gesproken tekst. Dat levert verrassende beelden op. Een lijn die door de straten van de stad lijkt te worden getrokken verandert in een hond en hé... wat gebeurt daar?"
1. Film der Reihe: http://archiv.twoday.net/stories/6482876/ (Seksschandalen)
2. Film der Reihe: http://archiv.twoday.net/stories/6484508/ (Diefstal)
Wolf Thomas - am Samstag, 28. August 2010, 09:40 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"El Día Nacional del Archivero, que se festejará este sábado en Argentina, rescata la labor de cientos de personas que son guardianes de documentos históricos y refuerzan la memoria de olvidadizos investigadores o periodistas que necesitan datos para su trabajo.
El Día Nacional del Archivero se celebra en recuerdo de la fundación, el 28 de agosto de 1821, del Archivo General de la Nación situado -en la actualidad- en Leandro N. Alem 246 de Capital Federal, con el fin de centralizar los documentos referidos a la historia argentina.
La guarda de documentos no nació con esa medida, ya que previamente los periódicos y bibliotecas locales habían inaugurado sus propios archivos, prosiguiendo con una costumbre ancestral y con la necesidad cultural que tiene el hombre de testimoniar sobre su tiempo.
No obstante, la fundación del Archivo General de la Nación dio paso al nacimiento de la figura del archivero, trabajador que estaría de allí en más encargado de conocer en detalle la ubicación de documentos con peso histórico.
Con el tiempo, y gracias a la modernización de los sistemas de archivo, también este trabajador debió asumir la responsabilidad de iniciarse en el conocimiento de palabras como “digitalización de documentos” o “microfilmes”, y pasar del recorte de diarios y el ensobrado de noticias, a la computadora.
La búsqueda de los discursos de ex presidentes como Julio Argentino Roca, Victorino de la Plaza, José Evaristo Uriburu o de Juan Domingo Perón, dejó de ser -en algunos lugares- un revolver de viejos sobres amarillos, para pasar a depender de un “click” de un equipo de computación.
La iniciativa oficial en 1821 de crear, más allá de las hemerotecas, un archivo organizado y eficiente para los documentos históricos del país, surgió de Bernardino Rivadavia, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de Martín Rodríguez, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Rivadavia dispuso que la documentación fuera clasificada de acuerdo a “Ramos y épocas”, adelantándose cien años a los preceptos de la moderna archivística, y destacando la doble función del archivo como centro de investigación histórica y como elemento indispensable para la tarea administrativa."
Link
El Día Nacional del Archivero se celebra en recuerdo de la fundación, el 28 de agosto de 1821, del Archivo General de la Nación situado -en la actualidad- en Leandro N. Alem 246 de Capital Federal, con el fin de centralizar los documentos referidos a la historia argentina.
La guarda de documentos no nació con esa medida, ya que previamente los periódicos y bibliotecas locales habían inaugurado sus propios archivos, prosiguiendo con una costumbre ancestral y con la necesidad cultural que tiene el hombre de testimoniar sobre su tiempo.
No obstante, la fundación del Archivo General de la Nación dio paso al nacimiento de la figura del archivero, trabajador que estaría de allí en más encargado de conocer en detalle la ubicación de documentos con peso histórico.
Con el tiempo, y gracias a la modernización de los sistemas de archivo, también este trabajador debió asumir la responsabilidad de iniciarse en el conocimiento de palabras como “digitalización de documentos” o “microfilmes”, y pasar del recorte de diarios y el ensobrado de noticias, a la computadora.
La búsqueda de los discursos de ex presidentes como Julio Argentino Roca, Victorino de la Plaza, José Evaristo Uriburu o de Juan Domingo Perón, dejó de ser -en algunos lugares- un revolver de viejos sobres amarillos, para pasar a depender de un “click” de un equipo de computación.
La iniciativa oficial en 1821 de crear, más allá de las hemerotecas, un archivo organizado y eficiente para los documentos históricos del país, surgió de Bernardino Rivadavia, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de Martín Rodríguez, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Rivadavia dispuso que la documentación fuera clasificada de acuerdo a “Ramos y épocas”, adelantándose cien años a los preceptos de la moderna archivística, y destacando la doble función del archivo como centro de investigación histórica y como elemento indispensable para la tarea administrativa."
Link
Wolf Thomas - am Samstag, 28. August 2010, 09:30 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 28. August 2010, 03:02 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 28. August 2010, 02:32 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.archive.org/details/ausmittelalteru00bezo
Hier das Inhaltsverzeichnis in der OCR des Internet Archive:
I. Die feljre oon bet PoIfsfouDcränetät tuäljtenb bes JTtittelaltets \
II. Die „armen £eute" «nb bie beutfdjc üteratur bes fpätetcn ,^
inittelaltcrs ^9
III. Konrab <£eltts, „bet beutfcfje ^ratjuntanift" 82
IV. <Ein Kölner (Sebenfbud? bes XVI. 3af?rt)unbert5 ;53^
V. itftrologifd^e (Sefcfjicfjtsfonftruftion im ITtittelalter \65
VI. über bie ^infänge ber Selbftbiograpljie unb iljrc ^ntroicflung im
lUittelalter 19«
VII. Die älteren beutfcfjcn Unioerfitäten in ifjrem Pertjältnis 3um
Staat 220
VIII. Hepublif unb lUonarcfjie in ber italienifd/en iitcratur bes
XVI. 3atjr{junbert5 2^6
IX. §ur (Sefcf?icf?te bes politifdjen ITIeudjelmorbs 2:^
X. 3ean Bobin als ©ffultift unb feine Dämonomanie 2^%
XI. 2Ius bem Brief roccfjfel ber ITTarfgräfin 3fabeIIa oon (Efte-öonsaga 329
XII. §ur (Entftefjungsgefd^idjte ber Ijifkorifd?en UTetljobif 562
@(£)
I.
X)ie Cel?re von 6er X)oIl5fout)eränetät
xoäitvcnb bcs Jltittelalters.
(Ejiftorifcfte gcitfdjrift, Sanö 36, \876.)
Hier das Inhaltsverzeichnis in der OCR des Internet Archive:
I. Die feljre oon bet PoIfsfouDcränetät tuäljtenb bes JTtittelaltets \
II. Die „armen £eute" «nb bie beutfdjc üteratur bes fpätetcn ,^
inittelaltcrs ^9
III. Konrab <£eltts, „bet beutfcfje ^ratjuntanift" 82
IV. <Ein Kölner (Sebenfbud? bes XVI. 3af?rt)unbert5 ;53^
V. itftrologifd^e (Sefcfjicfjtsfonftruftion im ITtittelalter \65
VI. über bie ^infänge ber Selbftbiograpljie unb iljrc ^ntroicflung im
lUittelalter 19«
VII. Die älteren beutfcfjcn Unioerfitäten in ifjrem Pertjältnis 3um
Staat 220
VIII. Hepublif unb lUonarcfjie in ber italienifd/en iitcratur bes
XVI. 3atjr{junbert5 2^6
IX. §ur (Sefcf?icf?te bes politifdjen ITIeudjelmorbs 2:^
X. 3ean Bobin als ©ffultift unb feine Dämonomanie 2^%
XI. 2Ius bem Brief roccfjfel ber ITTarfgräfin 3fabeIIa oon (Efte-öonsaga 329
XII. §ur (Entftefjungsgefd^idjte ber Ijifkorifd?en UTetljobif 562
@(£)
I.
X)ie Cel?re von 6er X)oIl5fout)eränetät
xoäitvcnb bcs Jltittelalters.
(Ejiftorifcfte gcitfdjrift, Sanö 36, \876.)
KlausGraf - am Samstag, 28. August 2010, 02:23 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen