http://www.nationaalarchief.nl/organisatie/projecten/beeldenvoordetoekomst/
Freiwillige sollen die digitalisierten Bilder erschließen.
Freiwillige sollen die digitalisierten Bilder erschließen.
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Dezember 2007, 23:30 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.nationaalarchief.nl/bronnenbox
De Bronnenbox is een database met gescande bronnen uit het Nationaal Archief. Hij is gemaakt voor scholieren in het voortgezet onderwijs.
De Bronnenbox is een database met gescande bronnen uit het Nationaal Archief. Hij is gemaakt voor scholieren in het voortgezet onderwijs.
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Dezember 2007, 23:24 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

(Gefunden in Archivalia Dez. 2006)
Übertragen Sie noch bis Jahresende Nutzungsrechte an Ihren Hochschulschriftenserver oder für historische Publikationen an historicum.net. Anleitungen und Hintergründe unter:
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Dezember 2007, 21:28 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://yourarchives.nationalarchives.gov.uk/index.php?title=Home_page
"These pages are for you to contribute your knowledge of archival sources held by The National Archives and by other archives throughout the UK."
Benutzer erstellen in diesem Wiki (Mediawiki-Software) archivübergreifende thematische Inventare.

"These pages are for you to contribute your knowledge of archival sources held by The National Archives and by other archives throughout the UK."
Benutzer erstellen in diesem Wiki (Mediawiki-Software) archivübergreifende thematische Inventare.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.archive-in-bern.ch/
Die Website informiert kurz (und ohne Bilder) über die einzelnen Archive in Bern.
Zu weiteren Kooperationen verschiedener Archive siehe
http://del.icio.us/Klausgraf/archiv_coop
Die Website informiert kurz (und ohne Bilder) über die einzelnen Archive in Bern.
Zu weiteren Kooperationen verschiedener Archive siehe
http://del.icio.us/Klausgraf/archiv_coop
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Dezember 2007, 18:24 - Rubrik: Kooperationsmodelle
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Australian Army war diaries
http://archiv.twoday.net/stories/4548232/
Census of Ireland, Dublin 1911
http://archiv.twoday.net/stories/4540473/
Sevilla University Archives (Spanien)
http://archiv.twoday.net/stories/4496084/
Mark Twain project
http://archiv.twoday.net/stories/4455098/
250+ Killer Digital Libraries and Archives (US)
http://oedb.org/library/features/250-plus-killer-digital-libraries-and-archives
Turning the Page: The Hooke Folio (UK)
http://archiv.twoday.net/stories/4342458/
CIA Electronic Reading Room
http://www.foia.cia.gov
Irish Virtual Research Library and Archive
http://archiv.twoday.net/stories/4284578/
KGB Documents Online
http://archiv.twoday.net/stories/4243325/
Danish Church Books [and Censuses]
http://archiv.twoday.net/stories/3967842/
Diary of Roberto Murphy (Argentinien)
http://archiv.twoday.net/stories/3662187/
US: City of Tumwater (Washington) puts public records online
http://archiv.twoday.net/stories/3585510/
American Jewish Committee's Archives
http://archiv.twoday.net/stories/2060706/
Album Amicorum (Digital Edition in Hungary)
http://archiv.twoday.net/stories/1079816/
Bilddatenbank Nationalarchiv (NL)
http://archiv.twoday.net/stories/195188/
Australia: Digitisation on Demand
http://archiv.twoday.net/stories/175809/
Library and Archival Exhibitions on the Web
http://www.sil.si.edu/SILPublications/Online-Exhibitions/
Lithuanian Parchments
http://archiv.twoday.net/stories/129943/
http://archiv.twoday.net/stories/4548232/
Census of Ireland, Dublin 1911
http://archiv.twoday.net/stories/4540473/
Sevilla University Archives (Spanien)
http://archiv.twoday.net/stories/4496084/
Mark Twain project
http://archiv.twoday.net/stories/4455098/
250+ Killer Digital Libraries and Archives (US)
http://oedb.org/library/features/250-plus-killer-digital-libraries-and-archives
Turning the Page: The Hooke Folio (UK)
http://archiv.twoday.net/stories/4342458/
CIA Electronic Reading Room
http://www.foia.cia.gov
Irish Virtual Research Library and Archive
http://archiv.twoday.net/stories/4284578/
KGB Documents Online
http://archiv.twoday.net/stories/4243325/
Danish Church Books [and Censuses]
http://archiv.twoday.net/stories/3967842/
Diary of Roberto Murphy (Argentinien)
http://archiv.twoday.net/stories/3662187/
US: City of Tumwater (Washington) puts public records online
http://archiv.twoday.net/stories/3585510/
American Jewish Committee's Archives
http://archiv.twoday.net/stories/2060706/
Album Amicorum (Digital Edition in Hungary)
http://archiv.twoday.net/stories/1079816/
Bilddatenbank Nationalarchiv (NL)
http://archiv.twoday.net/stories/195188/
Australia: Digitisation on Demand
http://archiv.twoday.net/stories/175809/
Library and Archival Exhibitions on the Web
http://www.sil.si.edu/SILPublications/Online-Exhibitions/
Lithuanian Parchments
http://archiv.twoday.net/stories/129943/
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Dezember 2007, 17:55 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.digi-archives.org/
Es stehen digitalisierte Bestände vor allem aus kirchlichen Institutionen der französischsprachigen Schweiz und aus dem Staatsarchiv Turin gegen eine jährliche Einschreibegebühr von 48 Franken zur Verfügung.
Verglichen mit den Kosten eines Archivbesuches in der teuren Schweiz wäre es ziemlich albern, hier von "Abzocke" zu sprechen. Die Gebühr kann von so gut wie jedem Forscher getragen werden. Aber darum geht es nicht.
* Wissenschaftliche Forschung mit Archivgut ist zu fördern und nicht durch Gebühren zu "bestrafen". Forscher, die Archivbestände nutzen, sollten belohnt werden, weil sie den schwereren Weg gehen und weil sie mit ihren Publikationen Öffentlichkeitsarbeit für die Archive betreiben.
* Eine Refinanzierung des Angebots durch eine so moderate Gebühr erscheint ausgeschlossen. Von daher könnte man auf diese Einkünfte auch ganz verzichten.
* Da (anders als etwa bei manuscritporium.cz) die Erschließungsinformationen ebenfalls kostenpflichtig sind, kauf ein potentieller Nutzer die "Katze im Sack". das erscheint unfair, die Suche in archivischen Findmitteln hat grundsätzlich kostenfrei zu sein!
Es stehen digitalisierte Bestände vor allem aus kirchlichen Institutionen der französischsprachigen Schweiz und aus dem Staatsarchiv Turin gegen eine jährliche Einschreibegebühr von 48 Franken zur Verfügung.
Verglichen mit den Kosten eines Archivbesuches in der teuren Schweiz wäre es ziemlich albern, hier von "Abzocke" zu sprechen. Die Gebühr kann von so gut wie jedem Forscher getragen werden. Aber darum geht es nicht.
* Wissenschaftliche Forschung mit Archivgut ist zu fördern und nicht durch Gebühren zu "bestrafen". Forscher, die Archivbestände nutzen, sollten belohnt werden, weil sie den schwereren Weg gehen und weil sie mit ihren Publikationen Öffentlichkeitsarbeit für die Archive betreiben.
* Eine Refinanzierung des Angebots durch eine so moderate Gebühr erscheint ausgeschlossen. Von daher könnte man auf diese Einkünfte auch ganz verzichten.
* Da (anders als etwa bei manuscritporium.cz) die Erschließungsinformationen ebenfalls kostenpflichtig sind, kauf ein potentieller Nutzer die "Katze im Sack". das erscheint unfair, die Suche in archivischen Findmitteln hat grundsätzlich kostenfrei zu sein!
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Dezember 2007, 16:31 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bundesarchiv (D)
Kanzlei Rosenberg
http://archiv.twoday.net/stories/4455899/
Bayerisches Hauptstaatsarchiv
Freisinger Handschriften
http://archiv.twoday.net/stories/3508133/
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf
Urkunden der Dürener Jesuiten
http://archiv.twoday.net/stories/3050132/
Hauptstaatsarchiv Stuttgart
Württembergische Regesten
http://archiv.twoday.net/stories/123084/
Bundesarchiv (D)
Wochenschauarchiv
http://archiv.twoday.net/stories/102768/
http://archiv.twoday.net/stories/41581/
+ Staatsarchiv Bremen
Fotos der Vulkan-Werft
http://archiv.twoday.net/stories/10409/
Das Angebot ist nicht mehr im Netz!
Kanzlei Rosenberg
http://archiv.twoday.net/stories/4455899/
Bayerisches Hauptstaatsarchiv
Freisinger Handschriften
http://archiv.twoday.net/stories/3508133/
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf
Urkunden der Dürener Jesuiten
http://archiv.twoday.net/stories/3050132/
Hauptstaatsarchiv Stuttgart
Württembergische Regesten
http://archiv.twoday.net/stories/123084/
Bundesarchiv (D)
Wochenschauarchiv
http://archiv.twoday.net/stories/102768/
http://archiv.twoday.net/stories/41581/
+ Staatsarchiv Bremen
Fotos der Vulkan-Werft
http://archiv.twoday.net/stories/10409/
Das Angebot ist nicht mehr im Netz!
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Dezember 2007, 15:48 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die ägyptische Regierung will eine Art Urheberrecht auf sämtliche berühmte Altertümer des Landes einführen. Nach einem neuen Gesetz, das schon bald vom Parlament verabschiedet werden könnte, sollen alle Kopien der Pyramiden, der Sphinx und anderer antiker Monumente künftig mit einer Abgabe belegt werden.
Mit dem Geld solle die Instandhaltung der antiken Sehenswürdigkeiten finanziert werden, teilte der Chef der ägyptischen Altertümerverwaltung, Zahi Hawass, am Dienstag in Kairo mit. Nach seinen Angaben soll das Gesetz für alle Länder gelten.
"Ägypten hat das alleinige Recht zur Reproduktion seiner antiken Monumente", verteidigte Hawass den Plan. Er betonte, ägyptische und ausländische Künstler dürften sich jedoch weiterhin von den ägyptischen Kulturschätzen "inspirieren" lassen - solange sie diese nicht einfach nur kopierten.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,525326,00.html
KOMMENTAR
Aus der deutschen Meldung wird nicht klar, ob nur Nachbauten oder auch Abbildungen betroffen sind.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/7160057.stm
"Mr Hawass said the law would apply to full-scale replicas of any object in any museum in Egypt.
"Commercial use" of ancient monuments like the pyramids or the sphinx would also be controlled, he said.
"Even if it is for private use, they must have permission from the Egyptian government," he added.
Die AFP-Meldung hat ergänzend:
"However, the law "does not forbid local or international artists from profiting from drawings and other reproductions of pharaonic and Egyptian monuments from all eras -- as long as they don't make exact copies.""
http://afp.google.com/article/ALeqM5hGhJUxebdPsEOUZ3O5S8f_6VhHww
Daraus könnte man schließen, dass auch originalgetreue Zeichnungen erfasst sind.
Ägypten kann seinen Anspruch nur vor ägyptischen Gerichten durchsetzen, ausländische Rechtsordnungen dürfen ihn nur respektieren, wenn Gesetze oder Verträge dies zulassen. Effektiver als eine Klage dürfte das Durchsetzen in den Fällen sein, in denen der angebliche Verletzer auf die Zusammenarbeit mit der Altertümerverwaltung angewiesen ist.
Durch internationalen Druck sollten Länder wie Ägypten oder Italien (siehe http://archiv.twoday.net/stories/4559922/ ) gezwungen werden, solche Gesetze wieder abzuschaffen, da sie mit den Grundsätzen internationaler Abkommen über das Urheberrecht nicht in Einklang stehen. Urheberverwertungsrechte sind grundsätzlich befristet. Die Freiheit der Public Domain ist gleichsam die Gegenleistung für die Respektierung des Urheberrechts. Solche Staats-Monopole stehen im Gegensatz zum freien Handel.

Mit dem Geld solle die Instandhaltung der antiken Sehenswürdigkeiten finanziert werden, teilte der Chef der ägyptischen Altertümerverwaltung, Zahi Hawass, am Dienstag in Kairo mit. Nach seinen Angaben soll das Gesetz für alle Länder gelten.
"Ägypten hat das alleinige Recht zur Reproduktion seiner antiken Monumente", verteidigte Hawass den Plan. Er betonte, ägyptische und ausländische Künstler dürften sich jedoch weiterhin von den ägyptischen Kulturschätzen "inspirieren" lassen - solange sie diese nicht einfach nur kopierten.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,525326,00.html
KOMMENTAR
Aus der deutschen Meldung wird nicht klar, ob nur Nachbauten oder auch Abbildungen betroffen sind.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/7160057.stm
"Mr Hawass said the law would apply to full-scale replicas of any object in any museum in Egypt.
"Commercial use" of ancient monuments like the pyramids or the sphinx would also be controlled, he said.
"Even if it is for private use, they must have permission from the Egyptian government," he added.
Die AFP-Meldung hat ergänzend:
"However, the law "does not forbid local or international artists from profiting from drawings and other reproductions of pharaonic and Egyptian monuments from all eras -- as long as they don't make exact copies.""
http://afp.google.com/article/ALeqM5hGhJUxebdPsEOUZ3O5S8f_6VhHww
Daraus könnte man schließen, dass auch originalgetreue Zeichnungen erfasst sind.
Ägypten kann seinen Anspruch nur vor ägyptischen Gerichten durchsetzen, ausländische Rechtsordnungen dürfen ihn nur respektieren, wenn Gesetze oder Verträge dies zulassen. Effektiver als eine Klage dürfte das Durchsetzen in den Fällen sein, in denen der angebliche Verletzer auf die Zusammenarbeit mit der Altertümerverwaltung angewiesen ist.
Durch internationalen Druck sollten Länder wie Ägypten oder Italien (siehe http://archiv.twoday.net/stories/4559922/ ) gezwungen werden, solche Gesetze wieder abzuschaffen, da sie mit den Grundsätzen internationaler Abkommen über das Urheberrecht nicht in Einklang stehen. Urheberverwertungsrechte sind grundsätzlich befristet. Die Freiheit der Public Domain ist gleichsam die Gegenleistung für die Respektierung des Urheberrechts. Solche Staats-Monopole stehen im Gegensatz zum freien Handel.

KlausGraf - am Mittwoch, 26. Dezember 2007, 14:16 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Dezember 2007, 03:44 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Dezember 2007, 03:32 - Rubrik: Parlamentsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Dezember 2007, 01:42 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.fotoerbe.de/index.php?t=zahlen&s=materialien&b=bestand_digitalisiert&mn=[Digitalisiert]
listet 109 digitalisierte Bestände (von insgesamt 2691) auf. Davon haben 57 eine Webpräsentation, wenn ich recht gezählt habe. Webpräsentation kann auch Bilder im thumbnail-Format meinen.
listet 109 digitalisierte Bestände (von insgesamt 2691) auf. Davon haben 57 eine Webpräsentation, wenn ich recht gezählt habe. Webpräsentation kann auch Bilder im thumbnail-Format meinen.
KlausGraf - am Mittwoch, 26. Dezember 2007, 01:31 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.morbihan.fr/dossier/default.aspx?idDos=46&id=1035
Depuis dix ans le Conseil général du Morbihan a lancé une vaste opération de numérisation de ses fonds d'archives les plus consultés et les plus fragiles (état civil, cadastre et presse). Près de quatre millions de pages ont été ainsi numérisées.
Depuis dix ans le Conseil général du Morbihan a lancé une vaste opération de numérisation de ses fonds d'archives les plus consultés et les plus fragiles (état civil, cadastre et presse). Près de quatre millions de pages ont été ainsi numérisées.
KlausGraf - am Dienstag, 25. Dezember 2007, 22:32 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.sceaux.fr/fr/sceaux/les-archives-en-ligne/index.html
Dans le cadre de la valorisation de son patrimoine, la ville de Sceaux (hauts de seine) a trié, scanné et mis en ligne ses archives d'état civil. Ainsi, les documents les plus anciens remontent à 1609 pour aller jusqu'en 1887! On y trouve aussi bien les registres que les tables décennales.
Le téléchargement des images peut être un peu long mais il est bon de relever cette initiative très heureuse pour les chercheurs d'ancêtres.
Via
http://www.lebloggenealogie.com/
Dans le cadre de la valorisation de son patrimoine, la ville de Sceaux (hauts de seine) a trié, scanné et mis en ligne ses archives d'état civil. Ainsi, les documents les plus anciens remontent à 1609 pour aller jusqu'en 1887! On y trouve aussi bien les registres que les tables décennales.
Le téléchargement des images peut être un peu long mais il est bon de relever cette initiative très heureuse pour les chercheurs d'ancêtres.
Via
http://www.lebloggenealogie.com/
KlausGraf - am Dienstag, 25. Dezember 2007, 22:29 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Urkundenfragmente der UB Graz
http://archiv.twoday.net/stories/1085441/
Autographensammlung Dr. Georg Heberlein (CH)
http://archiv.twoday.net/stories/259033/
http://archiv.twoday.net/stories/1085441/
Autographensammlung Dr. Georg Heberlein (CH)
http://archiv.twoday.net/stories/259033/
KlausGraf - am Dienstag, 25. Dezember 2007, 22:12 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 25. Dezember 2007, 22:06 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
International Institute of Social History, Amsterdam (NL)
RAF-Dokumente
http://archiv.twoday.net/stories/4365437/
Historisches Archiv, Tartu (Estland)
Baupläne
http://archiv.twoday.net/stories/4292694/
A. Dép. Mayenne (F)
http://archiv.twoday.net/stories/4122459/
Region Trentino (Italien)
Pergamenturkunden
http://archiv.twoday.net/stories/3713621/
Region Murcia (Spanien)
Mittelalterliche Archivalien
http://archiv.twoday.net/stories/3689695/
National Archives (UK)
Petitionen
http://archiv.twoday.net/stories/3302138/
A. Mun. Toulouse (F)
http://archiv.twoday.net/stories/2981631/
Familienarchiv Montiano (Spanien)
http://archiv.twoday.net/stories/2322014/
Gemeentearchief Amsterdam (NL)
http://archiv.twoday.net/stories/1761231/
Region Savoyen (F)
http://archiv.twoday.net/stories/1597386/
UB Granada (Spanien)
http://archiv.twoday.net/stories/1429073/
A. Dép. Yvelines (F)
http://archiv.twoday.net/stories/1271574/
Digitale Atlas Geschiedenis (NL)
http://archiv.twoday.net/stories/1116872/
Storia di Venezia (Italien)
http://archiv.twoday.net/stories/856433/
Region Wales (UK)
http://archiv.twoday.net/stories/145678/
Nationalarchiv Mexiko
Virtuelle Ausstellung
http://archiv.twoday.net/stories/144938/
Canada France
http://archiv.twoday.net/stories/107224/
RAF-Dokumente
http://archiv.twoday.net/stories/4365437/
Historisches Archiv, Tartu (Estland)
Baupläne
http://archiv.twoday.net/stories/4292694/
A. Dép. Mayenne (F)
http://archiv.twoday.net/stories/4122459/
Region Trentino (Italien)
Pergamenturkunden
http://archiv.twoday.net/stories/3713621/
Region Murcia (Spanien)
Mittelalterliche Archivalien
http://archiv.twoday.net/stories/3689695/
National Archives (UK)
Petitionen
http://archiv.twoday.net/stories/3302138/
A. Mun. Toulouse (F)
http://archiv.twoday.net/stories/2981631/
Familienarchiv Montiano (Spanien)
http://archiv.twoday.net/stories/2322014/
Gemeentearchief Amsterdam (NL)
http://archiv.twoday.net/stories/1761231/
Region Savoyen (F)
http://archiv.twoday.net/stories/1597386/
UB Granada (Spanien)
http://archiv.twoday.net/stories/1429073/
A. Dép. Yvelines (F)
http://archiv.twoday.net/stories/1271574/
Digitale Atlas Geschiedenis (NL)
http://archiv.twoday.net/stories/1116872/
Storia di Venezia (Italien)
http://archiv.twoday.net/stories/856433/
Region Wales (UK)
http://archiv.twoday.net/stories/145678/
Nationalarchiv Mexiko
Virtuelle Ausstellung
http://archiv.twoday.net/stories/144938/
Canada France
http://archiv.twoday.net/stories/107224/
KlausGraf - am Dienstag, 25. Dezember 2007, 21:25 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.archives-aube.com/index_archives.htm
Das Verbindungsamt wurde 1940 gegründet. Es war verantwortlich für die Verbindung zwischen den französischen und deutschen Behörden, sowie die logischerweise notwendigen Übersetzungen. Das Amt verfügte über keine Weisungsbefugnis und nahm somit auch keinen direkten Einfluss auf die zeitgeschichtlichen Ereignisse. Das Verbindungsamtarchiv besteht im Wesentlichem aus Schriftverkehr in der deutschen Sprache, verbunden mit dessen Übersetzungen in die französische Sprache, sowie der Dokumentation bezüglich jener Maßnahmen, die nach Aufforderung der Besatzungsmacht von der lokalen Regierung durchzuführen waren: Beschlagnahmungen, Nachschübe, Anwendung von Gesetzen gegen die Juden, Waffenbesitz, Asylante, usw. Das Besondere dieses Archivs ist, dass es über umfassende und vollständige Informationen über die tagtäglichen Geschehnisse der Periode von November 1940 bis August 1944 verfügt.
Sehenswerte Navigation! (Schieberegler.)

Das Verbindungsamt wurde 1940 gegründet. Es war verantwortlich für die Verbindung zwischen den französischen und deutschen Behörden, sowie die logischerweise notwendigen Übersetzungen. Das Amt verfügte über keine Weisungsbefugnis und nahm somit auch keinen direkten Einfluss auf die zeitgeschichtlichen Ereignisse. Das Verbindungsamtarchiv besteht im Wesentlichem aus Schriftverkehr in der deutschen Sprache, verbunden mit dessen Übersetzungen in die französische Sprache, sowie der Dokumentation bezüglich jener Maßnahmen, die nach Aufforderung der Besatzungsmacht von der lokalen Regierung durchzuführen waren: Beschlagnahmungen, Nachschübe, Anwendung von Gesetzen gegen die Juden, Waffenbesitz, Asylante, usw. Das Besondere dieses Archivs ist, dass es über umfassende und vollständige Informationen über die tagtäglichen Geschehnisse der Periode von November 1940 bis August 1944 verfügt.
Sehenswerte Navigation! (Schieberegler.)

KlausGraf - am Dienstag, 25. Dezember 2007, 05:21 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://archives.vendee.fr/recherche/
Diese Druckschrift würde man nicht unbedingt zuallererst unter den Digitalisaten der Archives départementales de la Vendée suchen, gelt? Aber sie findet sich (mit anderen deutschsprachigen Dokumenten) unter den online einsehbaren Papiers Léon de Mornac.

Diese Druckschrift würde man nicht unbedingt zuallererst unter den Digitalisaten der Archives départementales de la Vendée suchen, gelt? Aber sie findet sich (mit anderen deutschsprachigen Dokumenten) unter den online einsehbaren Papiers Léon de Mornac.

KlausGraf - am Dienstag, 25. Dezember 2007, 04:15 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 24. Dezember 2007, 15:54
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wikimedia Commons
it.Wikipedia

Siehe auch:
http://archiv.twoday.net/stories/4562544/
Zu Griechenland siehe Commons
it.Wikipedia

Siehe auch:
http://archiv.twoday.net/stories/4562544/
Zu Griechenland siehe Commons
KlausGraf - am Montag, 24. Dezember 2007, 15:54 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Winfried Klein, Die Domänenfrage im deutschen Verfassungsrecht des 19.
Jahrhunderts (= Schriften zur Verfassungsgeschichte Bd. 78). Berlin:
Duncker & Humblot 2007. 242 S., Brosch. EUR 69,80
Rezension erschienen in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 155 (2007), S. 606-608
Selten erlebt ein Doktorand, dass seine Erstlingsarbeit politischen
Zündstoff birgt. Als im Herbst 2006 das ungeheuerliche Vorhaben der
baden-württembergischen Landesregierung, die Handschriftenschätze der
Badischen Landesbibliothek zur Finanzierung einer Vereinbarung mit dem
Haus Baden zu verwenden, Handschriftenforscher und Öffentlichkeit weit
über Baden hinaus empörte, meldete sich in der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung nicht nur der Doktorvater des Autors, der Heidelberger Jurist
und Kulturgut-Spezialist Reinhard Mußgnug, zu Wort (am 29. September
2006). Auch Klein selbst durfte dort am 5. Oktober 2006 darlegen, wie
haltlos die Ansprüche der ehemals regierenden Dynastie sind. Ein
Auszug aus seiner Dissertation liegt dem Aufsatz „Eigentum und
Herrschaft. Grundfragen zum Rechtsstatus der Handschriften der
Badischen Landesbibliothek" in dem von Peter Michael Ehrle und Ute
Obhof herausgegebenen Sammelband „Die Handschriftensammlung der
Badischen Landesbibliothek" (Gernsbach 2007, S. 127-144) zugrunde. Die
potentielle Brisanz der Studien Kleins war den nach wie vor
unbeschränkt Verfügungsberechtigten über das im Generallandesarchiv
verwahrte Badische Familienarchiv klar: Sie verweigerten ihm,
ungewöhnlich genug, die Benutzungserlaubnis!
Über die Domänenfrage hat man im 19. Jahrhundert viel Tinte vergossen.
Selbstverständlich standen sich bei dem Verfassungskonflikt um die
Frage, wem das in den Domänen organisierte Eigentum gehöre, keine
gleichberechtigten Parteien gegenüber. Die Monarchen konnten zwar
nicht alle, aber doch viele Spielregeln diktieren. Begleitet wurde das
machtpolitische Ringen um die Zuweisung der Domänenerträge und die
Reichweite des ständischen Budgetrechts von der staatstheoretischen
Reflexion über den Staat als Rechtspersönlichkeit. Klein skizziert
zunächst in straffer und prägnanter Darstellung die Problemlage, um
sich im umfangreichen Mittelteil seiner Untersuchung drei Fallstudien
zuzuwenden, die auch auf der Grundlage archivalischer Quellen
erarbeitet wurden. Außer dem Großherzogtum Baden werden das
Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach und das Herzogtum
Sachsen-Meiningen in den Blick genommen.
Dem Großherzogtum Baden widmen sich die Seiten 81 bis 114. Im
Mittelpunkt steht die Genese der Regelung in § 59 der
Verfassungsurkunde von 1818, wonach die Domänen „unstreitiges
Patrimonialeigentum des Regenten und seiner Familie" seien (S. 93).
Klein konnte sich auf Weechs „Geschichte der Badischen Verfassung" von
1868 stützen, hat aber auch Archivalien aus dem Bestand 48 und dem
Nachlass von Carl Friedrich Nebenius ergänzend herangezogen. Der
Großherzog Carl vermochte sich mit seiner Forderung, dass die Domänen
als „Familien-Privat-Gut" angesehen werden sollten (S. 95), nicht
durchzusetzen. Als was sie denn dann gelten sollten, darüber haben
sich die badischen Juristen des 19. Jahrhunderts immer wieder
gestritten. Neben der Frage des Domäneneigentums erörtert Klein auch
die badische Haushaltsverfassung, wobei ihm vor allem die gedruckten
Verhandlungen der Ständeversammlungen als Quelle dienen (S. 102-110).
Vergleichsweise kurz wird auf die Revolution von 1918 und die
anschließende Vermögensauseinandersetzung eingegangen (S. 110-112).
Kleins klar und schlüssig argumentierende Studie ist ein wertvoller
Beitrag zu einem wichtigen verfassungs- und rechtshistorischen Thema.
Kritische Punkte fallen kaum ins Gewicht. Eine lückenlose und
erschöpfende Heranziehung aller relevanten Literatur wird man bei
einem in den letzten Jahren kaum behandelten Sujet nicht erwarten
dürfen. So vermisst man etwa Otmar Jung: Die Fundierung der sozialen
Republik mißlingt. Das Exempel des Streits um das Kammergut zwischen
dem Freistaat Braunschweig und dem ehemaligen Herzog (von der
Novemberrevolution bis zur Volksbewegung zur Fürstenenteignung 1926),
in: Braunschweigisches Jahrbuch für Landesgeschichte 78 (1997), S.
189-225, der S. 218 auf das Urteil des Reichsgerichts vom 27. Mai 1932
(RGZ 136, S. 211 ff.) hinweist, in dem klar ausgesprochen wurde, dass
„nach gemeinem deutschen Privatfürstenrecht [...] das Domänenvermögen
(Kammergut) im Unterschied von den ein reines Privateigentum
darstellenden Schatull- oder Kabinettsgütern schon zur Zeit des alten
Deutschen Reichs den landesfürstlichen Familien nur als Zubehör der
Landeshoheit" gehörte, „so daß es ihnen im Zweifel nur so lange
zustand, als sie die Herrschaft im Staat innehatten" (S. 222).
Dass Klein korrekt mit dem Aufsatz von Hannelore Schneider, die 1993
in der Festschrift für Hans Eberhardt den Meininger Domänenstreit
dargestellt hatte, umgeht, wird man bezweifeln dürfen. Man erwartet
ihn eigentlich bei den vereinzelten Untersuchungen zur Domänenfrage,
die S. 17 aufgelistet werden. Der Meininger Abschnitt beginnt auf S.
149, doch die erste Fußnote, die Schneider zitiert, steht erst auf S.
176. „Unklar und mehrdeutig" findet Klein S. 169 einen Gesetzentwurf
von 1848, „unklar und mehrdeutig" fand ihn aber bereits Schneider (S.
434). Wer wie Klein Pionierarbeit auf selten beackertem Feld leistet,
hätte die Souveränität aufbringen müssen, der von historischer Seite
vorgelegten Vorarbeit mit mehr Respekt zu begegnen.
Leider ist das Register viel zu lückenhaft. In ihm fehlt
beispielsweise der Nationalökonom Johann von Helferich (1817-1897),
der im Literaturverzeichnis unidentifiziert als N.N. Helferich
auftaucht. Die drei Sätze, die Klein dem heute noch beeindruckenden
Aufsatz Helferichs S. 97 widmet, werden diesem beileibe nicht gerecht.
Auf die Problematik der Sammlungen und des im großherzoglichen
Hausfideikommiss vereinigten Mobiliarvermögens geht Klein nicht ein.
Ergänzend sei auf diverse Einträge des Weblogs ARCHIVALIA
(https://archiv.twoday.net) und die Ausführungen von Karl von Salza und
Lichtenau, Die Lehre von Familien, Stamm- und
Geschlechts-Fideicommissen, nach den Grundsätzen des gemeinen
deutschen Privatrechts und mit Rücksicht auf die Abweichungen der
einzelnen Particularrechte, Leipzig 1838, S. 22 ff. aufmerksam
gemacht. Die beim Wechsel der Dynastie beim Lande bleibenden
Kronfideikommisse haben die gleiche Mittellage zwischen Staat und
Dynastie wie das Domänenvermögen. Bleibt zu hoffen, dass im Zuge der
Auseinandersetzung mit den Ansprüchen des Hauses Baden auch für das
Familienarchiv im Generallandesarchiv eine Lösung gefunden wird, die
es jedem Wissenschaftler ermöglicht, dem bislang unerforschten
Fideikommissvermögen und den hausgesetzlichen Normen der Markgrafen
und Großherzöge von Baden nachzuspüren.
Klaus Graf
Jahrhunderts (= Schriften zur Verfassungsgeschichte Bd. 78). Berlin:
Duncker & Humblot 2007. 242 S., Brosch. EUR 69,80
Rezension erschienen in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 155 (2007), S. 606-608
Selten erlebt ein Doktorand, dass seine Erstlingsarbeit politischen
Zündstoff birgt. Als im Herbst 2006 das ungeheuerliche Vorhaben der
baden-württembergischen Landesregierung, die Handschriftenschätze der
Badischen Landesbibliothek zur Finanzierung einer Vereinbarung mit dem
Haus Baden zu verwenden, Handschriftenforscher und Öffentlichkeit weit
über Baden hinaus empörte, meldete sich in der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung nicht nur der Doktorvater des Autors, der Heidelberger Jurist
und Kulturgut-Spezialist Reinhard Mußgnug, zu Wort (am 29. September
2006). Auch Klein selbst durfte dort am 5. Oktober 2006 darlegen, wie
haltlos die Ansprüche der ehemals regierenden Dynastie sind. Ein
Auszug aus seiner Dissertation liegt dem Aufsatz „Eigentum und
Herrschaft. Grundfragen zum Rechtsstatus der Handschriften der
Badischen Landesbibliothek" in dem von Peter Michael Ehrle und Ute
Obhof herausgegebenen Sammelband „Die Handschriftensammlung der
Badischen Landesbibliothek" (Gernsbach 2007, S. 127-144) zugrunde. Die
potentielle Brisanz der Studien Kleins war den nach wie vor
unbeschränkt Verfügungsberechtigten über das im Generallandesarchiv
verwahrte Badische Familienarchiv klar: Sie verweigerten ihm,
ungewöhnlich genug, die Benutzungserlaubnis!
Über die Domänenfrage hat man im 19. Jahrhundert viel Tinte vergossen.
Selbstverständlich standen sich bei dem Verfassungskonflikt um die
Frage, wem das in den Domänen organisierte Eigentum gehöre, keine
gleichberechtigten Parteien gegenüber. Die Monarchen konnten zwar
nicht alle, aber doch viele Spielregeln diktieren. Begleitet wurde das
machtpolitische Ringen um die Zuweisung der Domänenerträge und die
Reichweite des ständischen Budgetrechts von der staatstheoretischen
Reflexion über den Staat als Rechtspersönlichkeit. Klein skizziert
zunächst in straffer und prägnanter Darstellung die Problemlage, um
sich im umfangreichen Mittelteil seiner Untersuchung drei Fallstudien
zuzuwenden, die auch auf der Grundlage archivalischer Quellen
erarbeitet wurden. Außer dem Großherzogtum Baden werden das
Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach und das Herzogtum
Sachsen-Meiningen in den Blick genommen.
Dem Großherzogtum Baden widmen sich die Seiten 81 bis 114. Im
Mittelpunkt steht die Genese der Regelung in § 59 der
Verfassungsurkunde von 1818, wonach die Domänen „unstreitiges
Patrimonialeigentum des Regenten und seiner Familie" seien (S. 93).
Klein konnte sich auf Weechs „Geschichte der Badischen Verfassung" von
1868 stützen, hat aber auch Archivalien aus dem Bestand 48 und dem
Nachlass von Carl Friedrich Nebenius ergänzend herangezogen. Der
Großherzog Carl vermochte sich mit seiner Forderung, dass die Domänen
als „Familien-Privat-Gut" angesehen werden sollten (S. 95), nicht
durchzusetzen. Als was sie denn dann gelten sollten, darüber haben
sich die badischen Juristen des 19. Jahrhunderts immer wieder
gestritten. Neben der Frage des Domäneneigentums erörtert Klein auch
die badische Haushaltsverfassung, wobei ihm vor allem die gedruckten
Verhandlungen der Ständeversammlungen als Quelle dienen (S. 102-110).
Vergleichsweise kurz wird auf die Revolution von 1918 und die
anschließende Vermögensauseinandersetzung eingegangen (S. 110-112).
Kleins klar und schlüssig argumentierende Studie ist ein wertvoller
Beitrag zu einem wichtigen verfassungs- und rechtshistorischen Thema.
Kritische Punkte fallen kaum ins Gewicht. Eine lückenlose und
erschöpfende Heranziehung aller relevanten Literatur wird man bei
einem in den letzten Jahren kaum behandelten Sujet nicht erwarten
dürfen. So vermisst man etwa Otmar Jung: Die Fundierung der sozialen
Republik mißlingt. Das Exempel des Streits um das Kammergut zwischen
dem Freistaat Braunschweig und dem ehemaligen Herzog (von der
Novemberrevolution bis zur Volksbewegung zur Fürstenenteignung 1926),
in: Braunschweigisches Jahrbuch für Landesgeschichte 78 (1997), S.
189-225, der S. 218 auf das Urteil des Reichsgerichts vom 27. Mai 1932
(RGZ 136, S. 211 ff.) hinweist, in dem klar ausgesprochen wurde, dass
„nach gemeinem deutschen Privatfürstenrecht [...] das Domänenvermögen
(Kammergut) im Unterschied von den ein reines Privateigentum
darstellenden Schatull- oder Kabinettsgütern schon zur Zeit des alten
Deutschen Reichs den landesfürstlichen Familien nur als Zubehör der
Landeshoheit" gehörte, „so daß es ihnen im Zweifel nur so lange
zustand, als sie die Herrschaft im Staat innehatten" (S. 222).
Dass Klein korrekt mit dem Aufsatz von Hannelore Schneider, die 1993
in der Festschrift für Hans Eberhardt den Meininger Domänenstreit
dargestellt hatte, umgeht, wird man bezweifeln dürfen. Man erwartet
ihn eigentlich bei den vereinzelten Untersuchungen zur Domänenfrage,
die S. 17 aufgelistet werden. Der Meininger Abschnitt beginnt auf S.
149, doch die erste Fußnote, die Schneider zitiert, steht erst auf S.
176. „Unklar und mehrdeutig" findet Klein S. 169 einen Gesetzentwurf
von 1848, „unklar und mehrdeutig" fand ihn aber bereits Schneider (S.
434). Wer wie Klein Pionierarbeit auf selten beackertem Feld leistet,
hätte die Souveränität aufbringen müssen, der von historischer Seite
vorgelegten Vorarbeit mit mehr Respekt zu begegnen.
Leider ist das Register viel zu lückenhaft. In ihm fehlt
beispielsweise der Nationalökonom Johann von Helferich (1817-1897),
der im Literaturverzeichnis unidentifiziert als N.N. Helferich
auftaucht. Die drei Sätze, die Klein dem heute noch beeindruckenden
Aufsatz Helferichs S. 97 widmet, werden diesem beileibe nicht gerecht.
Auf die Problematik der Sammlungen und des im großherzoglichen
Hausfideikommiss vereinigten Mobiliarvermögens geht Klein nicht ein.
Ergänzend sei auf diverse Einträge des Weblogs ARCHIVALIA
(https://archiv.twoday.net) und die Ausführungen von Karl von Salza und
Lichtenau, Die Lehre von Familien, Stamm- und
Geschlechts-Fideicommissen, nach den Grundsätzen des gemeinen
deutschen Privatrechts und mit Rücksicht auf die Abweichungen der
einzelnen Particularrechte, Leipzig 1838, S. 22 ff. aufmerksam
gemacht. Die beim Wechsel der Dynastie beim Lande bleibenden
Kronfideikommisse haben die gleiche Mittellage zwischen Staat und
Dynastie wie das Domänenvermögen. Bleibt zu hoffen, dass im Zuge der
Auseinandersetzung mit den Ansprüchen des Hauses Baden auch für das
Familienarchiv im Generallandesarchiv eine Lösung gefunden wird, die
es jedem Wissenschaftler ermöglicht, dem bislang unerforschten
Fideikommissvermögen und den hausgesetzlichen Normen der Markgrafen
und Großherzöge von Baden nachzuspüren.
Klaus Graf
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 24. Dezember 2007, 15:09 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 24. Dezember 2007, 14:40 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Seit Freitag, dem 14.12.2007, ist das "Gedenkbuch - Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945" auf der Internetseite des Bundesarchivs unter http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch zugänglich.
Gut eineinhalb Jahre nach der Veröffentlichung des Gedenkbuches in seiner 2., wesentlich erweiterten Auflage vom Frühjahr 2006 (und 21 Jahre nach der 1. Auflage von 1986) sind nun die Namen der Opfer im Internet recherchierbar.
Mit Hilfe eines individuell zu nutzenden Suchfeldes und verschiedener Suchoptionen (Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnort, Deportationsdatum und Deportationsort) kann in der nunmehr fast 159 000 Personen umfassenden Datenbank gesucht werden. Anhand der Trefferliste können die biographischen Einträge zu den jeweiligen Opfern und ihrem Schicksal ausgewählt werden.
Neben dem zentralen Namenverzeichnis und der Suchfunktion stehen die Texte der Druckauflage, die Chronologie der Deportationen sowie die Auswahlbibliographie zur Verfügung.
Die Startseite informiert über die geleistete Arbeit seit der Veröffentlichung im Jahr 2006. Erstmals enthält das Gedenkbuch auch die Namen der Personen, die 1938/1939 nach Polen abgeschoben wurden.
Die Internetnutzer werden gebeten, Ergänzungen und Korrekturen direkt an das Bundesarchiv unter gedenkbuch@barch.bund.de zu richten, um die laufenden Arbeiten daran zu unterstützen.
Mit freundlichen Grüßen
Claudia Zenker-Oertel und Undine Völschow
Dr. Claudia Zenker-Oertel
Bundesarchiv
Potsdamer Str. 1
56075 Koblenz
c.zenker-oertel@barch.bund.de
Undine Völschow
Bundesarchiv
Finckensteinallee 63
12205 Berlin
u.voelschow@barch.bund.de
Ex: Archivliste
Gut eineinhalb Jahre nach der Veröffentlichung des Gedenkbuches in seiner 2., wesentlich erweiterten Auflage vom Frühjahr 2006 (und 21 Jahre nach der 1. Auflage von 1986) sind nun die Namen der Opfer im Internet recherchierbar.
Mit Hilfe eines individuell zu nutzenden Suchfeldes und verschiedener Suchoptionen (Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnort, Deportationsdatum und Deportationsort) kann in der nunmehr fast 159 000 Personen umfassenden Datenbank gesucht werden. Anhand der Trefferliste können die biographischen Einträge zu den jeweiligen Opfern und ihrem Schicksal ausgewählt werden.
Neben dem zentralen Namenverzeichnis und der Suchfunktion stehen die Texte der Druckauflage, die Chronologie der Deportationen sowie die Auswahlbibliographie zur Verfügung.
Die Startseite informiert über die geleistete Arbeit seit der Veröffentlichung im Jahr 2006. Erstmals enthält das Gedenkbuch auch die Namen der Personen, die 1938/1939 nach Polen abgeschoben wurden.
Die Internetnutzer werden gebeten, Ergänzungen und Korrekturen direkt an das Bundesarchiv unter gedenkbuch@barch.bund.de zu richten, um die laufenden Arbeiten daran zu unterstützen.
Mit freundlichen Grüßen
Claudia Zenker-Oertel und Undine Völschow
Dr. Claudia Zenker-Oertel
Bundesarchiv
Potsdamer Str. 1
56075 Koblenz
c.zenker-oertel@barch.bund.de
Undine Völschow
Bundesarchiv
Finckensteinallee 63
12205 Berlin
u.voelschow@barch.bund.de
Ex: Archivliste
KlausGraf - am Montag, 24. Dezember 2007, 10:45 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine Antwort finndet sich hier:
http://canoo.net/blog/2007/12/22/zu-durchforsten-oder-durchzuforsten/ .
http://canoo.net/blog/2007/12/22/zu-durchforsten-oder-durchzuforsten/ .
Wolf Thomas - am Sonntag, 23. Dezember 2007, 14:45 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Einspielung des Konzerts für Violine und Orchester e-moll, op. 24, von Ferdinand Ries durch das Schwedische Kammerorchester unter Leitung seines Chefdirigenten Thomas Dausgaard und der Geigerin Jeanne Christée bespricht das Deutschlandradio wie folgt:
" ..... Da ist dann, offen gesagt, die Enttäuschung doch einigermaßen groß, und schließlich kann man die beim Hören immer drängender werdenden Fragen nicht mehr unterdrücken: Schlummert manches in den Archiven nicht auch zu Recht, muss denn auch Zweitrangiges ans Licht geholt werden? Vieles, was wir inzwischen von Ferdinand Ries, dem Beethoven-Zeitgenossen, kennen, hat durchaus gute Qualität: Klavierwerke vor allem, Kammermusik, auch Sinfonien, die an dieser Stelle bereits positiv besprochen wurden. Aber diesem Violinkonzert von 1810 hätte man vielleicht doch besser weiterhin den Archiv-Schlaf des Gerechten gönnen sollen, zu banal scheinen die Themen, zu vorhersehbar und ohne größere Überraschungen die Durchführungsteile, zu langatmig die Sequenzen und Wiederholungen, zu ermüdend die Aneinanderreihung einfacher Standardfloskeln. ...."
Apropos Standardfloskeln !
Quelle: http://www.dradio.de/dlf/sendungen/neueplatte/714833/
" ..... Da ist dann, offen gesagt, die Enttäuschung doch einigermaßen groß, und schließlich kann man die beim Hören immer drängender werdenden Fragen nicht mehr unterdrücken: Schlummert manches in den Archiven nicht auch zu Recht, muss denn auch Zweitrangiges ans Licht geholt werden? Vieles, was wir inzwischen von Ferdinand Ries, dem Beethoven-Zeitgenossen, kennen, hat durchaus gute Qualität: Klavierwerke vor allem, Kammermusik, auch Sinfonien, die an dieser Stelle bereits positiv besprochen wurden. Aber diesem Violinkonzert von 1810 hätte man vielleicht doch besser weiterhin den Archiv-Schlaf des Gerechten gönnen sollen, zu banal scheinen die Themen, zu vorhersehbar und ohne größere Überraschungen die Durchführungsteile, zu langatmig die Sequenzen und Wiederholungen, zu ermüdend die Aneinanderreihung einfacher Standardfloskeln. ...."
Apropos Standardfloskeln !
Quelle: http://www.dradio.de/dlf/sendungen/neueplatte/714833/
Wolf Thomas - am Sonntag, 23. Dezember 2007, 14:28 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 23. Dezember 2007, 01:52 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.zugang-zum-wissen.de/journal/
"Die Deutsche Physikalische Gesellschaft DPG mit ihren 45.000 Mitgliedern informiert ihre 60+ alten Mitglieder über die Möglichkeit der Rechtevergabe bis 31.12.2007 auf Initiative ihres Arbeitskreises Information." Wieso nur die? Wer 1995 30 war, ist heute 42.
"Die Deutsche Physikalische Gesellschaft DPG mit ihren 45.000 Mitgliedern informiert ihre 60+ alten Mitglieder über die Möglichkeit der Rechtevergabe bis 31.12.2007 auf Initiative ihres Arbeitskreises Information." Wieso nur die? Wer 1995 30 war, ist heute 42.
KlausGraf - am Samstag, 22. Dezember 2007, 17:41 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 22. Dezember 2007, 17:22 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus einer Glosse der Wiener Zeitung:
" .... Also jene üppig dimensionierten Fernsehsendungen, die in Wahrheit einfach kaschieren soll, dass es aufgrund von Feiertagen und Urlauben eben nicht viel Aktuelles zu berichten gibt und man daher keks- und punschschwer ins Archiv wankt, das alte Material mit ein paar flockigen Moderationen aufpeppt und es dem p. t. Publikum auf’s Neue serviert. ....." (Quelle: http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3956&Alias=wzo&cob=318506 )
Diese Beobachtung zum Anlass nehmend würde ich es begrüßen, wenn Archivalia-Leserinnen und -Leser über ihre schönsten, interessantesten, seltsamsten etc. weihnachtlichen Benutzerinnen und Benutzer berichten.
" .... Also jene üppig dimensionierten Fernsehsendungen, die in Wahrheit einfach kaschieren soll, dass es aufgrund von Feiertagen und Urlauben eben nicht viel Aktuelles zu berichten gibt und man daher keks- und punschschwer ins Archiv wankt, das alte Material mit ein paar flockigen Moderationen aufpeppt und es dem p. t. Publikum auf’s Neue serviert. ....." (Quelle: http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3956&Alias=wzo&cob=318506 )
Diese Beobachtung zum Anlass nehmend würde ich es begrüßen, wenn Archivalia-Leserinnen und -Leser über ihre schönsten, interessantesten, seltsamsten etc. weihnachtlichen Benutzerinnen und Benutzer berichten.
Wolf Thomas - am Samstag, 22. Dezember 2007, 10:46 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
s. dazu http://www.echo-online.de/suedhessen/template_detail.php3?id=550344
Die Probleme sind hausgemacht, solange man sich nicht für eine ordentliche Anstellung stark macht. Für kleinere Gemeinde stellen Verbundarchive eine Alternative dar.
Die Probleme sind hausgemacht, solange man sich nicht für eine ordentliche Anstellung stark macht. Für kleinere Gemeinde stellen Verbundarchive eine Alternative dar.
Wolf Thomas - am Samstag, 22. Dezember 2007, 10:44 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Damals, nach dem Abi, fragte ich sie, was sie werden wolle. ‚Archivarin’, antwortete sie. Ich schüttelte den Kopf. ‚Katja, für diesen Beruf bist du doch viel zu unruhig.’“
Quelle: http://www.tagesspiegel.de/berlin/Nachrufe;art127,2443102
Quelle: http://www.tagesspiegel.de/berlin/Nachrufe;art127,2443102
Wolf Thomas - am Samstag, 22. Dezember 2007, 10:44 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.zevep.com/
Ein durchaus nützliches Werkzeug, leider ohne Filtermöglichkeiten für kostenfreie Inhalte.
Ein durchaus nützliches Werkzeug, leider ohne Filtermöglichkeiten für kostenfreie Inhalte.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Uta Siebeky im Wissenschaftsforschung-Jahrbuch 2007:
http://www.wissenschaftsforschung.de/Jahrbuch_2007.pdf
Am 12. März 2007 lagen auf eDoc 14934 Volltextfiles gesamt, von denen 5245 Open Access geschaltet waren.
Diese Zahl ergänzt unsere Feststellungen zur OA-Praxis der MPG:
http://archiv.twoday.net/stories/4159366/
Am Schluss heisst es:
So bleibt zum Schluss nur noch die Feststellung der Tatsache, dass es zur Zeit
immer noch so ist, dass alle Open-Access-Angebote benutzen wollen, aber nur
wenige bereit sind, ihre Publikationen Open Access anzubieten.
http://www.wissenschaftsforschung.de/Jahrbuch_2007.pdf
Am 12. März 2007 lagen auf eDoc 14934 Volltextfiles gesamt, von denen 5245 Open Access geschaltet waren.
Diese Zahl ergänzt unsere Feststellungen zur OA-Praxis der MPG:
http://archiv.twoday.net/stories/4159366/
Am Schluss heisst es:
So bleibt zum Schluss nur noch die Feststellung der Tatsache, dass es zur Zeit
immer noch so ist, dass alle Open-Access-Angebote benutzen wollen, aber nur
wenige bereit sind, ihre Publikationen Open Access anzubieten.
KlausGraf - am Freitag, 21. Dezember 2007, 19:21 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.wissenschaftsforschung.de/Jahrbuch_2007.pdf
Das Jahrbuch steht unter einer CC-NC-Lizenz und enthält mehrere Beiträge zum Thema "Open Access".
Einen Hinweis wert ist auch eine Einführung zu OA, die besonders die Wirtschaftsinformatik thematisiert:
http://www.wirtschaftsinformatik.de/dateien/beitraege/wi2007_6_456_459.pdf
Das Jahrbuch steht unter einer CC-NC-Lizenz und enthält mehrere Beiträge zum Thema "Open Access".
Einen Hinweis wert ist auch eine Einführung zu OA, die besonders die Wirtschaftsinformatik thematisiert:
http://www.wirtschaftsinformatik.de/dateien/beitraege/wi2007_6_456_459.pdf
KlausGraf - am Freitag, 21. Dezember 2007, 18:55 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 21. Dezember 2007, 18:33 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ....[Eine] Ausstellung in Galerie am Domplatz in Halle erinnert an Gründer Uwe Büchler. ... Dass Uwe Büchler ein Archäologe der Zukunft war, der nach noch nicht Vorhandenem grub, unterstreicht die als Archiv ohne Etiketten geordnete Schau auf treffende Weise. ....."Quelle: Mitteldeutsche Zeitung
Wolf Thomas - am Freitag, 21. Dezember 2007, 15:21 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Über die Umzugspläne des Landesarchivs Nordrhein-Westfaeln hat Archivalia bereits zweimal berichtet ( Link 1 ; Link 2 ). Nun liegt eine Pressemitteilung der Stadt Duisburg vor (Link) und ein Artikel in der Rheinischen Post (Link) vor. Interessant in RP- Artikel dürfte folgender Satz sein: ".... Neben dem Archiv wird es eine Schule für die künftigen Archivare geben. ...."
Nachtrag 03.01.2008:
http://www.property-magazine.de/landesarchiv-nrw-kommt-in-den-rwsg-speicher-im-duisburger-innenhafen-9032.html (mit Abbildung des Architekturmodells)
Nachtrag 03.01.2008:
http://www.property-magazine.de/landesarchiv-nrw-kommt-in-den-rwsg-speicher-im-duisburger-innenhafen-9032.html (mit Abbildung des Architekturmodells)
Wolf Thomas - am Freitag, 21. Dezember 2007, 15:13 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus juristischen Gründen verzichte ich auf die Formulierung "Siebenmorgen lügt".
BLM-Museumschef und Zähringer-Stiftungsrat-Mitglied Harald Siebenmorgen stellt einem Artikel der BNN vom 21.12.2007 wahrheitswidrige Aussagen auf. Er müsste es besser wissen.
Die laut dem staatlichen Gutachten dem Haus Baden zufallenden Bestände im Wert von 5,6 Millionen Euro sind laut Siebenmorgen nie im Zusammenhang der Zähringer-Stiftung genannt worden. Die Objekte wären mithin auch dann Eigentum der Adelsfamilie, wenn die Stiftung mit dem vorgesehenen Vermögen rechtskräftig ausgestattet worden wäre, unterstreicht der Kunsthistoriker. Etwa das derzeit im Karlsruher Schloss aufwendig inszenierte "Kopf'sche Kunstmuseum". Diese Samnmlung habe das Landesmuseum 1983 auf Anforderung des Markgrafen "in völlig heruntergekommenem Zustand" aus einem Keller des Neuen Schlosses in Baden-Baden abgeholt. Dort sei es entgegen dem Testament gelagert gewesen. Verschollen war laut Siebenmorgen die Juncke'sche Gemäldesammlung, nachdem auch sie nach 1918 testamentswidrig nicht mehr in Baden-Baden ausgestellt gewesen sei. Vor einigen Jahren fand man sie auf einem Dachbolden in Salem nahe dem Bodensee wieder. Laut dem Karlsruher Museumschef handelt es sich um dritt- und viertklassige Bilder, "und ich wüsste nicht, wer sie haben wollte, wenn sie jetzt vom Staat erworben werden"
Am 2. Oktober 2006 veröffentlichte ich hier die Satzung der Zähringer Stiftung:
http://archiv.twoday.net/stories/2750198/
Aus ihr geht einwandfrei hervor, dass die beiden von Siebenmorgen explizit genannten Sammlungen Teil der Stiftung waren:
Die Stiftung umfasst folgende Sammlungen:
1. Die ehem. von Wessenbergische Gemäldesammlung in Konstanz.
2. Das Kopf’sche Kunstmuseum in Baden-Baden.
3. Die Louis Jüncke'sche Gemäldesammlung in Baden-Baden.
4. Die Türkensammlung in Karlsruhe.
5. Die Großherzogl. Münzensammlung im staatl. Münzkabinett.
6. Die hofeigenen Bestände der früheren vereinigten Sammlungen in Karlsruhe.
7. Die hofeigenen Bestände der Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe.
Hinsichtlich der Satzung Kopf ergibt sich die Zugehörigkeit aus dem von mir mitgeteilten Protokoll des Stiftungsrates von 1983:
http://archiv.twoday.net/stories/2989084/
Unter Siebenmorgens Museumsleitung erfolgte 1995 die Überweisung der Pietà von Kopf an das Badische Landesmuseum, siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_von_Kopf
Aus eigenem Aktenstudium der Akten über die Stiftung kann ich bestätigen, dass die drei nicht vom Landesmuseum bzw. der BLB Karlsruhe verwahrten Sammlungen Kopf, Jüncke und Wessenberg hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zur Zähringer Stiftung nie bestritten waren. (Umfangreiche Dossiers zu diesen drei Sammlungen sind durch die Suchfunktion dieses Weblogs auf der rechten Seite auffindbar, wenn man dort die Namen des jeweiligen Stifters eingibt.)
Hinsichtlich der Archivalien im GLAK hat meines Wissens niemand jemals eine Zugehörigkeit zur Zähringer Stiftung behauptet.
BLM-Museumschef und Zähringer-Stiftungsrat-Mitglied Harald Siebenmorgen stellt einem Artikel der BNN vom 21.12.2007 wahrheitswidrige Aussagen auf. Er müsste es besser wissen.
Die laut dem staatlichen Gutachten dem Haus Baden zufallenden Bestände im Wert von 5,6 Millionen Euro sind laut Siebenmorgen nie im Zusammenhang der Zähringer-Stiftung genannt worden. Die Objekte wären mithin auch dann Eigentum der Adelsfamilie, wenn die Stiftung mit dem vorgesehenen Vermögen rechtskräftig ausgestattet worden wäre, unterstreicht der Kunsthistoriker. Etwa das derzeit im Karlsruher Schloss aufwendig inszenierte "Kopf'sche Kunstmuseum". Diese Samnmlung habe das Landesmuseum 1983 auf Anforderung des Markgrafen "in völlig heruntergekommenem Zustand" aus einem Keller des Neuen Schlosses in Baden-Baden abgeholt. Dort sei es entgegen dem Testament gelagert gewesen. Verschollen war laut Siebenmorgen die Juncke'sche Gemäldesammlung, nachdem auch sie nach 1918 testamentswidrig nicht mehr in Baden-Baden ausgestellt gewesen sei. Vor einigen Jahren fand man sie auf einem Dachbolden in Salem nahe dem Bodensee wieder. Laut dem Karlsruher Museumschef handelt es sich um dritt- und viertklassige Bilder, "und ich wüsste nicht, wer sie haben wollte, wenn sie jetzt vom Staat erworben werden"
Am 2. Oktober 2006 veröffentlichte ich hier die Satzung der Zähringer Stiftung:
http://archiv.twoday.net/stories/2750198/
Aus ihr geht einwandfrei hervor, dass die beiden von Siebenmorgen explizit genannten Sammlungen Teil der Stiftung waren:
Die Stiftung umfasst folgende Sammlungen:
1. Die ehem. von Wessenbergische Gemäldesammlung in Konstanz.
2. Das Kopf’sche Kunstmuseum in Baden-Baden.
3. Die Louis Jüncke'sche Gemäldesammlung in Baden-Baden.
4. Die Türkensammlung in Karlsruhe.
5. Die Großherzogl. Münzensammlung im staatl. Münzkabinett.
6. Die hofeigenen Bestände der früheren vereinigten Sammlungen in Karlsruhe.
7. Die hofeigenen Bestände der Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe.
Hinsichtlich der Satzung Kopf ergibt sich die Zugehörigkeit aus dem von mir mitgeteilten Protokoll des Stiftungsrates von 1983:
http://archiv.twoday.net/stories/2989084/
Unter Siebenmorgens Museumsleitung erfolgte 1995 die Überweisung der Pietà von Kopf an das Badische Landesmuseum, siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_von_Kopf
Aus eigenem Aktenstudium der Akten über die Stiftung kann ich bestätigen, dass die drei nicht vom Landesmuseum bzw. der BLB Karlsruhe verwahrten Sammlungen Kopf, Jüncke und Wessenberg hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zur Zähringer Stiftung nie bestritten waren. (Umfangreiche Dossiers zu diesen drei Sammlungen sind durch die Suchfunktion dieses Weblogs auf der rechten Seite auffindbar, wenn man dort die Namen des jeweiligen Stifters eingibt.)
Hinsichtlich der Archivalien im GLAK hat meines Wissens niemand jemals eine Zugehörigkeit zur Zähringer Stiftung behauptet.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/newsticker/meldung/100957
"Bislang ist die Resonanz auf die Aufrufe offenbar sehr unterschiedlich. Während an der TU Berlin erst knapp 30 Antworten eingingen, heißt es aus der Universität Bielefeld, "der Rücklauf ist inzwischen so gewaltig, dass wir für das Beschaffen, Scannen und Einstellen der Dokumente im nächsten Jahr wahrscheinlich zusätzliche Hilfskräfte einstellen müssen""
Da die Bibliotheken INETBIB nicht nützen, sich über ihre Erfahrungen mit der Aktion auszutauschen und auch keine Zahlen veröffentlichen, ist die mir neue Angabe zur mangelnden Resonanz an der TU Berlin aufschlussreich. Bisher durfte ich aufgrund vereinzelter Rückmeldungen davon ausgehen, dass die Aktion bei denjenigen Bibliotheken, die ihre Wissenschaftler informieren, sehr erfolgreich sei.
"Bislang ist die Resonanz auf die Aufrufe offenbar sehr unterschiedlich. Während an der TU Berlin erst knapp 30 Antworten eingingen, heißt es aus der Universität Bielefeld, "der Rücklauf ist inzwischen so gewaltig, dass wir für das Beschaffen, Scannen und Einstellen der Dokumente im nächsten Jahr wahrscheinlich zusätzliche Hilfskräfte einstellen müssen""
Da die Bibliotheken INETBIB nicht nützen, sich über ihre Erfahrungen mit der Aktion auszutauschen und auch keine Zahlen veröffentlichen, ist die mir neue Angabe zur mangelnden Resonanz an der TU Berlin aufschlussreich. Bisher durfte ich aufgrund vereinzelter Rückmeldungen davon ausgehen, dass die Aktion bei denjenigen Bibliotheken, die ihre Wissenschaftler informieren, sehr erfolgreich sei.
KlausGraf - am Freitag, 21. Dezember 2007, 10:44 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Merkblatt: Neue urheberrechtliche Nutzungsarten (pdf, 101.7 kB)
[Link-Update: http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/976/Merkblatt%20unbekannte%20Nutzungsarten%2020071212.pdf ]
Erwerb von unbekannten und Umgang mit neuen urheberrechtlichen Nutzungsarten.
Eine Handreichung für Mitgliedsverlage des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Stand: Dezember 2007
Nachdem open-access.net inzwischen eine FAQ anbietet (§ 137 l der Urheberrechtsreform - FAQ zur Rechteübertragung), ist es sicherlich auch hilfreich, die Position des Börsenvereins zu kennen. Der DBV hat ja - wie Klaus Graf zu Recht in INETBIB am 11. November 2007 festgestellt hat - bislang zu diesem Thema nur unzureichend und leider hinsichtlich einiger Aspekte auch definitiv falsch informiert, zuletzt im DBV Newsletter 115 vom November 2007, wo aber nur auf eine erste Stellungnahme vom Juli 2007 verwiesen wurde. Bedauerlich ist dies vor allem, weil der Börsenverein zu Recht feststellt:
"Leider ist die Neuregelung im Detail sehr kompliziert und unklar. Über viele Einzelheiten der neuen Vorschriften wird vermutlich erst in einigen Jahren durch Urteile des Bundesgerichtshofs Klarheit geschaffen. Nachfolgend werden die für die Praxis wichtigsten Auswirkungen der Neuregelung in Form von Fragen und Antworten diskutiert. Im Hinblick auf die erheblichen Unklarheiten im Wortlaut der neuen Normen und ihrer amtlichen Begründung kann leider nicht ausgeschlossen werden, dass sich bei einzelnen Aspekten andere Auslegungen als die hier vertretenen vor den Gerichten durchsetzen."
In C.3 "Kann ein Autor die Nutzung seines "Archivwerks" auf eine neue Nutzungsart durch seinen Verlag verhindern" wird die Möglichkeit der Rechteübertragung ausdrücklich erwähnt:
"Dafür hat er grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
- Er kann der Nutzung seines Werkes durch seinen Verlag widersprechen, und zwar entweder bezogen auf eine konkrete Nutzungsart (z.B. Internetnutzung) oder auf alle nach Vertragsschluss bekannt gewordenen und zukünftig bekannt werdenden Nutzungsarten. Bezüglich aller am 1.1.2008 bekannten Nutzungsarten muss dieser Widerspruch bis zum 31.12.2008 erfolgen. Handelt es sich bei dem Werk um einen Beitrag zu einem Sammelwerk, kann der Urheber sein Widerspruchsrecht nicht wider Treu und glauben ausüben.
- Er kann einem Dritten die ausschließlichen Rechte an einer oder allen neuen Nutzungsarten seines Werkes übertragen, solange sein Verlag die entsprechenden Nutzungen noch nicht aufgrund der neuen Gesetzeslage aufgenommen hat. (Der Dritte darf das Werk allerdings nicht in der Form nutzen, in der der Verlag es veröffentlicht hat, vgl. oben B Frage 8)."
Bemerkenswert ist, dass der Börsenverein den 31.12.2007 offenbar nicht als Ausschlussgrenze ansieht. Hiernach wären Rechteübertragungen auch später noch möglich, solange der Verlag noch nicht selbst die Nutzung aufgenommen hat.
Dass der Börsenverein sich in C.3 auf die Frage fokussiert, ob und wie ein Autor die Wahrnehmung der neuen Nutzungsarten für Altwerke durch den Verlag verhindern könne, ist aus seiner Perspektive verständlich. Um das "Verhindern" geht es den Befürwortern einer Rechteübertragung etwa an institutionelle Publikationsserver aber gar nicht. Die Autoren sollen diesen gar keine ausschließlichen Rechte an den entsprechenden Nutzungen einräumen, sondern nur einfache Nutzungsrechte. In diesem Fall dürften nach neuer Rechtslage einfache Nutzungsrechte weiter automatisch an den Verlag fallen, wenn der Autor nicht widerspricht (vgl. hierzu die Begründung zum Regierungsentwurf BT Drs 16/1828, S. 33: "Absatz 1 enthält eine Übertragungsfiktion für Rechte an neuen Nutzungsarten zugunsten eines Erwerbers aller wesentlichen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses übertragbaren Nutzungsrechte. (...) Erfolgte die Rechtseinräumung nur beschränkt (z. B. durch Erteilung einer nicht ausschließlichen Berechtigung), so greift die Fiktion in dem verbleibenden Umfang."). Ein Ausschluß etwa einer Digitalisierung durch den Verlag läge in vielen Fällen auch gar nicht im Interesse des Autors, da es die Sichtbarkeit seiner wissenschaflichen Veröffentlichungen nur erhöhen kann. Worum es geht ist, zu verhindern, dass ausschließlich der Verlag dieses Recht hat, womit eine Zugänglichmachung als Open access Publikation nicht mehr möglich wäre.
Des weiteren vertritt die Handreichung des Börsenvereins offenbar die Auffassung, dass einfaches Scannen der Originale nicht zulässig sei, indem er Leistungsschutzrechte des Verlags reklamiert (Lektorat des Ursprungstextes, Satzbild, Marke, ggf. Titelschutzrechte; vgl. B.8 der Handreichung). Dieser Auffassung widersprechen Steinhauer (§ 38 UrhG - Scannen der Originale?, in: bibliotheksrecht.blog.de, 13. Februar 2007 und Graf (Scannen der Originale bei Aufsatz-Retrodigitalisierung zulässig, in: Archivalia, 14. Februar 2007).
Laut Börsenverein sind nach den bisherigen Erfahrungen Widersprüche durch Autoren aus rechtlichen Gründen häufig unwirksam; er empfiehlt daher eine gründliche Prüfung aller eingehenden Widersprüche (C.4). Interessant wäre es natürlich, das nur separat von der Rechtsabteilung des Börsenvereins anzufordernde Merkblatt für die Prüfung von Widersprüchen gegen die Nutzung von Werken auf bei Vertragsabschluss unbekannte Nutzungsarten und die dazu passenden Musterschreiben für die Autorenkorrespondenz zu kennen ...
Der Börsenverein empfiehlt seinen Mitgliedern (in C.6), bei für die kommerziellen Verwertung interessanten älteren Werken den Abschluss eines Ergänzungsvertrages anzustreben und nur wo dies administrativ nur schwer möglich ist - so z.B. bei Sammelwerken mit Beiträgen verschiedener Autoren - eine Nutzung unter der neuen gesetzlichen Regelung für "Archivwerke" (gemeint ist die Übergangsregelung von §137 l), bei der die Vergütungsregelung den Verwertungsgesellschaften überlassen bleibt. Für den Verlag sei dies mit einem deutlichen Mehr an Rechtssicherheit und Verfügungsbefugnis verbunden als eine Nutzung unter der neuen gesetzlichen Regelung für "Archivwerke". Aber auch für den Autor bzw. seine Erben sei ein solcher Ergänzungsvertrag vorteilhaft, weil so klar definierte Vergütungen vereinbart werden können, die wie die anderen Erlöse aus dem Werk direkt an den Autor abgerechnet werden. Auch für solche Ergänzungsvereinbarungen mit Autoren von Altwerken gibt es Musterschreiben für vertragliche Regelungen "in schlanker, aber rechtswirksamer Form".
B.2, 3 und 5 der Handreichung würde übrigens einen schönen Anknüpfungspunkt für den Plot eines Urheberrechts-Krimis bieten, nach dem Motto "Nur ein toter (unproduktiv gewordener) Autor ist ein guter Autor ..."
[Link-Update: http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/976/Merkblatt%20unbekannte%20Nutzungsarten%2020071212.pdf ]
Erwerb von unbekannten und Umgang mit neuen urheberrechtlichen Nutzungsarten.
Eine Handreichung für Mitgliedsverlage des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Stand: Dezember 2007
Nachdem open-access.net inzwischen eine FAQ anbietet (§ 137 l der Urheberrechtsreform - FAQ zur Rechteübertragung), ist es sicherlich auch hilfreich, die Position des Börsenvereins zu kennen. Der DBV hat ja - wie Klaus Graf zu Recht in INETBIB am 11. November 2007 festgestellt hat - bislang zu diesem Thema nur unzureichend und leider hinsichtlich einiger Aspekte auch definitiv falsch informiert, zuletzt im DBV Newsletter 115 vom November 2007, wo aber nur auf eine erste Stellungnahme vom Juli 2007 verwiesen wurde. Bedauerlich ist dies vor allem, weil der Börsenverein zu Recht feststellt:
"Leider ist die Neuregelung im Detail sehr kompliziert und unklar. Über viele Einzelheiten der neuen Vorschriften wird vermutlich erst in einigen Jahren durch Urteile des Bundesgerichtshofs Klarheit geschaffen. Nachfolgend werden die für die Praxis wichtigsten Auswirkungen der Neuregelung in Form von Fragen und Antworten diskutiert. Im Hinblick auf die erheblichen Unklarheiten im Wortlaut der neuen Normen und ihrer amtlichen Begründung kann leider nicht ausgeschlossen werden, dass sich bei einzelnen Aspekten andere Auslegungen als die hier vertretenen vor den Gerichten durchsetzen."
In C.3 "Kann ein Autor die Nutzung seines "Archivwerks" auf eine neue Nutzungsart durch seinen Verlag verhindern" wird die Möglichkeit der Rechteübertragung ausdrücklich erwähnt:
"Dafür hat er grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
- Er kann der Nutzung seines Werkes durch seinen Verlag widersprechen, und zwar entweder bezogen auf eine konkrete Nutzungsart (z.B. Internetnutzung) oder auf alle nach Vertragsschluss bekannt gewordenen und zukünftig bekannt werdenden Nutzungsarten. Bezüglich aller am 1.1.2008 bekannten Nutzungsarten muss dieser Widerspruch bis zum 31.12.2008 erfolgen. Handelt es sich bei dem Werk um einen Beitrag zu einem Sammelwerk, kann der Urheber sein Widerspruchsrecht nicht wider Treu und glauben ausüben.
- Er kann einem Dritten die ausschließlichen Rechte an einer oder allen neuen Nutzungsarten seines Werkes übertragen, solange sein Verlag die entsprechenden Nutzungen noch nicht aufgrund der neuen Gesetzeslage aufgenommen hat. (Der Dritte darf das Werk allerdings nicht in der Form nutzen, in der der Verlag es veröffentlicht hat, vgl. oben B Frage 8)."
Bemerkenswert ist, dass der Börsenverein den 31.12.2007 offenbar nicht als Ausschlussgrenze ansieht. Hiernach wären Rechteübertragungen auch später noch möglich, solange der Verlag noch nicht selbst die Nutzung aufgenommen hat.
Dass der Börsenverein sich in C.3 auf die Frage fokussiert, ob und wie ein Autor die Wahrnehmung der neuen Nutzungsarten für Altwerke durch den Verlag verhindern könne, ist aus seiner Perspektive verständlich. Um das "Verhindern" geht es den Befürwortern einer Rechteübertragung etwa an institutionelle Publikationsserver aber gar nicht. Die Autoren sollen diesen gar keine ausschließlichen Rechte an den entsprechenden Nutzungen einräumen, sondern nur einfache Nutzungsrechte. In diesem Fall dürften nach neuer Rechtslage einfache Nutzungsrechte weiter automatisch an den Verlag fallen, wenn der Autor nicht widerspricht (vgl. hierzu die Begründung zum Regierungsentwurf BT Drs 16/1828, S. 33: "Absatz 1 enthält eine Übertragungsfiktion für Rechte an neuen Nutzungsarten zugunsten eines Erwerbers aller wesentlichen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses übertragbaren Nutzungsrechte. (...) Erfolgte die Rechtseinräumung nur beschränkt (z. B. durch Erteilung einer nicht ausschließlichen Berechtigung), so greift die Fiktion in dem verbleibenden Umfang."). Ein Ausschluß etwa einer Digitalisierung durch den Verlag läge in vielen Fällen auch gar nicht im Interesse des Autors, da es die Sichtbarkeit seiner wissenschaflichen Veröffentlichungen nur erhöhen kann. Worum es geht ist, zu verhindern, dass ausschließlich der Verlag dieses Recht hat, womit eine Zugänglichmachung als Open access Publikation nicht mehr möglich wäre.
Des weiteren vertritt die Handreichung des Börsenvereins offenbar die Auffassung, dass einfaches Scannen der Originale nicht zulässig sei, indem er Leistungsschutzrechte des Verlags reklamiert (Lektorat des Ursprungstextes, Satzbild, Marke, ggf. Titelschutzrechte; vgl. B.8 der Handreichung). Dieser Auffassung widersprechen Steinhauer (§ 38 UrhG - Scannen der Originale?, in: bibliotheksrecht.blog.de, 13. Februar 2007 und Graf (Scannen der Originale bei Aufsatz-Retrodigitalisierung zulässig, in: Archivalia, 14. Februar 2007).
Laut Börsenverein sind nach den bisherigen Erfahrungen Widersprüche durch Autoren aus rechtlichen Gründen häufig unwirksam; er empfiehlt daher eine gründliche Prüfung aller eingehenden Widersprüche (C.4). Interessant wäre es natürlich, das nur separat von der Rechtsabteilung des Börsenvereins anzufordernde Merkblatt für die Prüfung von Widersprüchen gegen die Nutzung von Werken auf bei Vertragsabschluss unbekannte Nutzungsarten und die dazu passenden Musterschreiben für die Autorenkorrespondenz zu kennen ...
Der Börsenverein empfiehlt seinen Mitgliedern (in C.6), bei für die kommerziellen Verwertung interessanten älteren Werken den Abschluss eines Ergänzungsvertrages anzustreben und nur wo dies administrativ nur schwer möglich ist - so z.B. bei Sammelwerken mit Beiträgen verschiedener Autoren - eine Nutzung unter der neuen gesetzlichen Regelung für "Archivwerke" (gemeint ist die Übergangsregelung von §137 l), bei der die Vergütungsregelung den Verwertungsgesellschaften überlassen bleibt. Für den Verlag sei dies mit einem deutlichen Mehr an Rechtssicherheit und Verfügungsbefugnis verbunden als eine Nutzung unter der neuen gesetzlichen Regelung für "Archivwerke". Aber auch für den Autor bzw. seine Erben sei ein solcher Ergänzungsvertrag vorteilhaft, weil so klar definierte Vergütungen vereinbart werden können, die wie die anderen Erlöse aus dem Werk direkt an den Autor abgerechnet werden. Auch für solche Ergänzungsvereinbarungen mit Autoren von Altwerken gibt es Musterschreiben für vertragliche Regelungen "in schlanker, aber rechtswirksamer Form".
B.2, 3 und 5 der Handreichung würde übrigens einen schönen Anknüpfungspunkt für den Plot eines Urheberrechts-Krimis bieten, nach dem Motto "Nur ein toter (unproduktiv gewordener) Autor ist ein guter Autor ..."
BCK - am Freitag, 21. Dezember 2007, 07:53 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Quelle: Pressemitteilung des Marbacher Literaturarchivs
Medienresonanz:
http://www.berlinerliteraturkritik.de/index.cfm?id=16532
http://www.swr.de/nachrichten/bw/-/id=1622/nid=1622/did=2965680/1nr6em7/
http://www.derwesten.de/nachrichten/kultur/2007/12/20/news-11878837/detail.html
http://www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=1696844
Informationen zu Ror Wolf:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ror_Wolf
Medienresonanz:
http://www.berlinerliteraturkritik.de/index.cfm?id=16532
http://www.swr.de/nachrichten/bw/-/id=1622/nid=1622/did=2965680/1nr6em7/
http://www.derwesten.de/nachrichten/kultur/2007/12/20/news-11878837/detail.html
http://www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=1696844
Informationen zu Ror Wolf:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ror_Wolf
Wolf Thomas - am Donnerstag, 20. Dezember 2007, 22:20 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 20. Dezember 2007, 20:44 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Im Südkurier kommentiert Uli Fricker
http://www.suedkurier.de/nachrichten/kommentare/leitartikel/art4648,2969059,0
Die Position Baden-Württembergs ist nicht von der Hand zu weisen: Die Familie Baden hat seine Kunstschätze in seiner Eigenschaft als regierendes Haus angesammelt. Mit der Abdankung des letzten Großherzogs am 22. November 1918 löste sich diese Bindung auf: Die meisten Bilder und Stücke gingen auf den Rechtsnachfolger über - das Land Baden und später Baden-Württemberg. Diese säuberliche Unterscheidung zwischen Privatbesitz und Staatsgut ist kein juristischer Trick, sondern ein wirksamer Schutz. Schließlich hat diese Familie - wie alle Dynastien - nicht als privater Mäzen gehandelt. Nicht die eigene Schatulle wurde für Käufe ausgeräumt, sondern die großherzogliche Kasse. Wenn überhaupt bezahlt wurde, siehe Säkularisation. Was die Allgemeinheit vorstreckt, sollte auch bei ihr verbleiben.
Verständlich, dass Bernhard Prinz von Baden diese Argumentation nicht behagt. Seine Gutachter gehen von der optimistischen Auffassung aus, dass die über Jahrhunderte angehäuften Kulturgüter still schweigend ins Privatvermögen flossen. Das Ende der Monarchie ist den Verfassern des Hof-Gutachtens in seiner vollen Tragweite wohl entgangen.
Gerne werden historische Tatsachen vor den Karren der eigenen Interessen gespannt. Für die markgräfliche Familie firmiert Salem immer als "Stammsitz". Das ist eine merkwürdige Interpretation, in jeder Landeschronik findet man die Burg Hohenbaden bei Baden-Baden als namensgebende Residenz des Geschlechts. Solche kleinen Akzentverschiebungen stören nicht nur Pedanten und Historiker; sie zeigen auch, dass die Historie für die eigenen Interessen zurecht gebogen wird.

http://www.suedkurier.de/nachrichten/kommentare/leitartikel/art4648,2969059,0
Die Position Baden-Württembergs ist nicht von der Hand zu weisen: Die Familie Baden hat seine Kunstschätze in seiner Eigenschaft als regierendes Haus angesammelt. Mit der Abdankung des letzten Großherzogs am 22. November 1918 löste sich diese Bindung auf: Die meisten Bilder und Stücke gingen auf den Rechtsnachfolger über - das Land Baden und später Baden-Württemberg. Diese säuberliche Unterscheidung zwischen Privatbesitz und Staatsgut ist kein juristischer Trick, sondern ein wirksamer Schutz. Schließlich hat diese Familie - wie alle Dynastien - nicht als privater Mäzen gehandelt. Nicht die eigene Schatulle wurde für Käufe ausgeräumt, sondern die großherzogliche Kasse. Wenn überhaupt bezahlt wurde, siehe Säkularisation. Was die Allgemeinheit vorstreckt, sollte auch bei ihr verbleiben.
Verständlich, dass Bernhard Prinz von Baden diese Argumentation nicht behagt. Seine Gutachter gehen von der optimistischen Auffassung aus, dass die über Jahrhunderte angehäuften Kulturgüter still schweigend ins Privatvermögen flossen. Das Ende der Monarchie ist den Verfassern des Hof-Gutachtens in seiner vollen Tragweite wohl entgangen.
Gerne werden historische Tatsachen vor den Karren der eigenen Interessen gespannt. Für die markgräfliche Familie firmiert Salem immer als "Stammsitz". Das ist eine merkwürdige Interpretation, in jeder Landeschronik findet man die Burg Hohenbaden bei Baden-Baden als namensgebende Residenz des Geschlechts. Solche kleinen Akzentverschiebungen stören nicht nur Pedanten und Historiker; sie zeigen auch, dass die Historie für die eigenen Interessen zurecht gebogen wird.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Badische Zeitung vom Mittwoch, 19. Dezember 2007
GÜTERTRENNUNG
Landeseigentum
--- 511 Gemälde und 25 000 Blätter des Kupferstichkabinetts der
Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe;
--- Die drei unter dem Titel "Antiken, vaterländische Altertümer und
Waffen" vereinten Sammlungen im Badischen Landesmuseum Karlsruhe;
--- die türkische Sammlung (so genannte Türkenbeute) im Landesmuseum;
--- das Münzkabinett ebendort;
--- alle Kunstgegenstände aus den 1803/6 säkularisierten Klöstern, da
runter die wertvollen mittelalterlichen Handschriften;
--- das Naturalienkabinett im Naturkundemuseum Karlsruhe;
--- die Bestände der ehemaligen Großherzoglichen Hofbibliothek, späteren
Großherzoglichen Hof- und Landesbibliothek Karlsruhe;
--- die badischen Kroninsignien;
--- das Schriftgut der Hofbehörden.
Eigentum Haus Baden
--- das Kopf'sche Kunstmuseum im Badischen Landesmuseum;
--- die ehemals Wessenberg'sche Gemäldesammlung in Konstanz;
--- die Louis-Jüncke'sche Gemäldesammlung in Schloss Salem;
--- 36 so genannte Hinterlegungen in der Badische Landesbibliothek;
--- vier Plastiken in der Kunsthalle Karlsruhe).
Geteilte Rechte
Im Eigentum des Hauses Baden, aber in dauerhaftem Besitzrecht des Landes:
--- 13 Signaturen mit Handschriften Johann Peter Hebels;
--- vier Bücher mit Blumenmalerei ("Tulpenbücher" ) in der
Landesbibliothek und im Generallandesarchiv Karlsruhe;
--- Großherzogliches Familienarchiv.
Badische Zeitung vom Donnerstag, 20. Dezember 2007
"Bis auf die Knochen blamiert"
Landtag diskutiert über die badischen Kunstschätze
Von unserer Korrespondentin Bettina Wieselmann
STUTTGART. Heftige Kritik musste sich gestern die Landesregierung
wegen ihres Umgangs mit den badischen Kunstschätzen anhören: Die
Opposition im Landtag kreidete ihr an, sich in Unkenntnis der
Rechtslage blamiert zu haben --- die nun durch das Gutachten der
Expertenkommission klar sei.
"Das Gutachten ist ein Manifest der Unfähigkeit" , stieg der
kulturpolitische Sprecher der Grünen, Jürgen Walter, krachend in die
Debatte ein ---- und meinte doch, es sei Beweis für die Unfähigkeit der
Landesregierung. Erst jetzt habe sie die Rechtsposition des Landes
gegenüber dem Adelshaus Baden erkannt. Nachträglich "schaudert uns
noch, wie man ohne Prüfung" fast einen Vergleich zur Rettung von
Schloss Salem abgeschlossen hätte, dem jetzt die Grundlage fehle.
Auch der stellvertretende Fraktionschef der SPD, Nils Schmid, hieb in
diese Kerbe: "Die Landesregierung hat sich bis auf die Knochen
blamiert und fahrlässig Landesinteressen preisgegeben." Wie Walter,
der davor warnte, dem Haus Baden zu sehr entgegenzukommen, forderte
Schmid: "Wir sollten selbstbewusst und standesbewusst als Republikaner
in die Verhandlungen gehen."
Auf Seiten der Regierungsfraktionen war man bemüht, Kritik am Haus
Baden abzuwehren. Christoph Palm, kulturpolitischer Sprecher der
CDU-Fraktion, erkannte "neoklassenkämpferische Züge" bei der
Opposition. Heiderose Berroth (FDP) äußerte "Respekt vor der Leistung
des Hauses Baden" , das kulturhistorisch wertvolle Salemer Ensemble
gesichert zu haben. In der FDP hat man zudem immer noch Zweifel, ob
das Land vor Gericht gegen das Haus Baden Recht bekäme.
Mit den Stimmen der Opposition forderte der Landtag die Regierung auf,
das neue Rechtsgutachten zur Grundlage von Verhandlungen mit dem Haus
Baden zu machen, um Schloss Salem als Kulturgut ersten Ranges
langfristig für die Öffentlichkeit zu sichern und öffentlich
zugänglich zu halten.
Badische Zeitung vom Donnerstag, 20. Dezember 2007
Überrascht vom eigenen Ergebnis
FREIBURG. Die Expertenkommission des Landes zu den badischen
Kunstschätzen hat einstimmig festgestellt, dass die Mehrzahl der
strittigen Kunstwerke und Dokumente bereits dem Land gehört als
Rechtsnachfolgerin des badischen Großherzogs. Das Gutachten schafft
Klarheit in einer Frage, an der sich schon viele andere versucht
haben, zumeist ohne große Überzeugungskraft. Der emeritierte
Freiburger Historiker Professor Dieter Mertens war eines der sechs
Kommissionsmitglieder. Mit ihm sprach Wulf Rüskamp.
BZ: Das Resultat Ihres gemeinsamen Gutachtens hat offenbar manches
Kommissionsmitglied etwas überrascht. Sie auch?
Mertens: Ja. Denn am Anfang war es für uns alle offen, in welche
Richtung das Gutachten laufen würde. Was uns in der Kommission jetzt
als stichhaltig erscheint und was wir auch nachweisen können, das war
vorher nicht abzusehen.
BZ: Man hat zudem den Eindruck, dass das Ergebnis in seiner
Deutlichkeit und in der Einstimmigkeit aller Kommissionsmitglieder,
Ihnen allen etwas peinlich ist.
Mertens: Naja, natürlich hätte ein Ergebnis, das die Kunstschätze 50
zu 50 aufgeteilt hätte, eher den Eindruck des Unparteiischen gemacht.
Wir nehmen dennoch für uns in Anspruch, dass wir uns niemandem zulieb
und niemandem zuleid, sondern nur anhand der nachweisbaren Fakten
entschieden haben.
BZ: Woran liegt es, dass früher niemand so tief in die Akten geschaut hat?
Mertens: Diese Untersuchungen sind sehr aufwendig. Wir waren in der
Kommission zu sechst, und zeitweise war mit Peter Michael Ehrle
(Direktor der Karlsruher Landesbibliothek) noch ein Sachverständiger
für die Handschriften dabei. Damit kann man in der Aufarbeitung der
Materie mehr schaffen als ein Einzelner. Aber uns haben auch die
gemeinsamen Diskussionen weiter gebracht, etwa was die jeweiligen
Kriterien für die Zuschreibung einzelner Kunstgegenstände oder
Dokumente sind.
BZ: Sind die vielen anderen Gutachten, die zur Besitzfrage angefertigt
worden sind, also wenig oder gar nichts wert?
Mertens: Die Gutachten sind sehr unterschiedlich. Manche sind auf sehr
schmaler Datenbasis geschrieben worden, weil die Autoren glaubten, sie
könnten sich das rechtlich leisten. Andere gehen von falschen
Voraussetzungen aus, was die Auffassung von Staatlichkeit angeht. Nur
ein Gutachten aus dem Jahr 1967 ist rechtsgeschichtlich fundiert --- und
das hat bekanntlich nach Ansicht des Hauses Baden Unfrieden gestiftet.
BZ: Die große rechtliche Unklarheit hat dazu geführt, dass manche
Gemälde zweimal an Land verkauft worden sind.
Mertens: Man muss hier in Rechnung stellen, dass unmittelbar nach dem
Untergang der Monarchie die Rechtsbegriffe nicht so klar waren,
jedenfalls nicht in den Ministerien. Da gab es verschiedene
Rechtsauffassungen im Finanzministerium und im Kultusministerium. Die
damaligen Vorstände der einzelnen Sammlungen hatten noch den besten
Blick auf die Rechtslage, wie wir im Gutachten zeigen können. Das hat
dazu geführt, dass man 1930 manche Gemälde, die einem wohl schon
gehörten, nochmals gekauft hat. Das ist sicherlich auf beiden Seiten
gutgläubig geschehen. Es war eben eine rechtlich schwierige Situation.
BZ: Umso mehr erstaunt, dass die vier Juristen in ihrer Kommission so
einig sind.
Mertens: Es wurde auch lange genug diskutiert. Das Ergebnis war nicht
von vorneherein so klar. Aber es wurden immer mehr historische Quellen
herangezogen. Eine sehr wichtige war das Testament Großherzogs
Friedrichs II. von 1907. Denn daraus werden die Prinzipien des
Fürstenrechts deutlich, wie vererbt wird, nämlich dasjenige, was zur
Herrschaft gehört, nicht unter die Erben verteilt wird, im Unterschied
zu Privateigentum, bei dem das Bürgerliche Gesetzbuch gilt. Diese
Klarheit hat uns überrascht, aber sie uns zur einhelligen Auffassung
in der Frage der Besitzverhältnisse verholfen.
BZ: Das Gutachten liest sich wie ein Lehrbuch zu privatem und
öffentlichen Eigentum &
Mertens: Diese Klarstellungen waren uns wichtig, weil sie in vielen
früheren Gutachten nicht berücksichtigt worden sind. Deshalb haben wir
diesen gesicherten Forschungsstand dargelegt.
BZ: Was raten Sie jetzt der Landesregierung, wie soll sie vorgehen?
Mertens: Solche Ratschläge wollten wir ausdrücklich nicht machen. Wir
legen unser Ergebnis in die Hände der Politiker. Und die müssen jetzt
entscheiden. Für einen Vergleich schaut nach diesem Ergebnis aber
nicht mehr viel heraus.
GÜTERTRENNUNG
Landeseigentum
--- 511 Gemälde und 25 000 Blätter des Kupferstichkabinetts der
Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe;
--- Die drei unter dem Titel "Antiken, vaterländische Altertümer und
Waffen" vereinten Sammlungen im Badischen Landesmuseum Karlsruhe;
--- die türkische Sammlung (so genannte Türkenbeute) im Landesmuseum;
--- das Münzkabinett ebendort;
--- alle Kunstgegenstände aus den 1803/6 säkularisierten Klöstern, da
runter die wertvollen mittelalterlichen Handschriften;
--- das Naturalienkabinett im Naturkundemuseum Karlsruhe;
--- die Bestände der ehemaligen Großherzoglichen Hofbibliothek, späteren
Großherzoglichen Hof- und Landesbibliothek Karlsruhe;
--- die badischen Kroninsignien;
--- das Schriftgut der Hofbehörden.
Eigentum Haus Baden
--- das Kopf'sche Kunstmuseum im Badischen Landesmuseum;
--- die ehemals Wessenberg'sche Gemäldesammlung in Konstanz;
--- die Louis-Jüncke'sche Gemäldesammlung in Schloss Salem;
--- 36 so genannte Hinterlegungen in der Badische Landesbibliothek;
--- vier Plastiken in der Kunsthalle Karlsruhe).
Geteilte Rechte
Im Eigentum des Hauses Baden, aber in dauerhaftem Besitzrecht des Landes:
--- 13 Signaturen mit Handschriften Johann Peter Hebels;
--- vier Bücher mit Blumenmalerei ("Tulpenbücher" ) in der
Landesbibliothek und im Generallandesarchiv Karlsruhe;
--- Großherzogliches Familienarchiv.
Badische Zeitung vom Donnerstag, 20. Dezember 2007
"Bis auf die Knochen blamiert"
Landtag diskutiert über die badischen Kunstschätze
Von unserer Korrespondentin Bettina Wieselmann
STUTTGART. Heftige Kritik musste sich gestern die Landesregierung
wegen ihres Umgangs mit den badischen Kunstschätzen anhören: Die
Opposition im Landtag kreidete ihr an, sich in Unkenntnis der
Rechtslage blamiert zu haben --- die nun durch das Gutachten der
Expertenkommission klar sei.
"Das Gutachten ist ein Manifest der Unfähigkeit" , stieg der
kulturpolitische Sprecher der Grünen, Jürgen Walter, krachend in die
Debatte ein ---- und meinte doch, es sei Beweis für die Unfähigkeit der
Landesregierung. Erst jetzt habe sie die Rechtsposition des Landes
gegenüber dem Adelshaus Baden erkannt. Nachträglich "schaudert uns
noch, wie man ohne Prüfung" fast einen Vergleich zur Rettung von
Schloss Salem abgeschlossen hätte, dem jetzt die Grundlage fehle.
Auch der stellvertretende Fraktionschef der SPD, Nils Schmid, hieb in
diese Kerbe: "Die Landesregierung hat sich bis auf die Knochen
blamiert und fahrlässig Landesinteressen preisgegeben." Wie Walter,
der davor warnte, dem Haus Baden zu sehr entgegenzukommen, forderte
Schmid: "Wir sollten selbstbewusst und standesbewusst als Republikaner
in die Verhandlungen gehen."
Auf Seiten der Regierungsfraktionen war man bemüht, Kritik am Haus
Baden abzuwehren. Christoph Palm, kulturpolitischer Sprecher der
CDU-Fraktion, erkannte "neoklassenkämpferische Züge" bei der
Opposition. Heiderose Berroth (FDP) äußerte "Respekt vor der Leistung
des Hauses Baden" , das kulturhistorisch wertvolle Salemer Ensemble
gesichert zu haben. In der FDP hat man zudem immer noch Zweifel, ob
das Land vor Gericht gegen das Haus Baden Recht bekäme.
Mit den Stimmen der Opposition forderte der Landtag die Regierung auf,
das neue Rechtsgutachten zur Grundlage von Verhandlungen mit dem Haus
Baden zu machen, um Schloss Salem als Kulturgut ersten Ranges
langfristig für die Öffentlichkeit zu sichern und öffentlich
zugänglich zu halten.
Badische Zeitung vom Donnerstag, 20. Dezember 2007
Überrascht vom eigenen Ergebnis
FREIBURG. Die Expertenkommission des Landes zu den badischen
Kunstschätzen hat einstimmig festgestellt, dass die Mehrzahl der
strittigen Kunstwerke und Dokumente bereits dem Land gehört als
Rechtsnachfolgerin des badischen Großherzogs. Das Gutachten schafft
Klarheit in einer Frage, an der sich schon viele andere versucht
haben, zumeist ohne große Überzeugungskraft. Der emeritierte
Freiburger Historiker Professor Dieter Mertens war eines der sechs
Kommissionsmitglieder. Mit ihm sprach Wulf Rüskamp.
BZ: Das Resultat Ihres gemeinsamen Gutachtens hat offenbar manches
Kommissionsmitglied etwas überrascht. Sie auch?
Mertens: Ja. Denn am Anfang war es für uns alle offen, in welche
Richtung das Gutachten laufen würde. Was uns in der Kommission jetzt
als stichhaltig erscheint und was wir auch nachweisen können, das war
vorher nicht abzusehen.
BZ: Man hat zudem den Eindruck, dass das Ergebnis in seiner
Deutlichkeit und in der Einstimmigkeit aller Kommissionsmitglieder,
Ihnen allen etwas peinlich ist.
Mertens: Naja, natürlich hätte ein Ergebnis, das die Kunstschätze 50
zu 50 aufgeteilt hätte, eher den Eindruck des Unparteiischen gemacht.
Wir nehmen dennoch für uns in Anspruch, dass wir uns niemandem zulieb
und niemandem zuleid, sondern nur anhand der nachweisbaren Fakten
entschieden haben.
BZ: Woran liegt es, dass früher niemand so tief in die Akten geschaut hat?
Mertens: Diese Untersuchungen sind sehr aufwendig. Wir waren in der
Kommission zu sechst, und zeitweise war mit Peter Michael Ehrle
(Direktor der Karlsruher Landesbibliothek) noch ein Sachverständiger
für die Handschriften dabei. Damit kann man in der Aufarbeitung der
Materie mehr schaffen als ein Einzelner. Aber uns haben auch die
gemeinsamen Diskussionen weiter gebracht, etwa was die jeweiligen
Kriterien für die Zuschreibung einzelner Kunstgegenstände oder
Dokumente sind.
BZ: Sind die vielen anderen Gutachten, die zur Besitzfrage angefertigt
worden sind, also wenig oder gar nichts wert?
Mertens: Die Gutachten sind sehr unterschiedlich. Manche sind auf sehr
schmaler Datenbasis geschrieben worden, weil die Autoren glaubten, sie
könnten sich das rechtlich leisten. Andere gehen von falschen
Voraussetzungen aus, was die Auffassung von Staatlichkeit angeht. Nur
ein Gutachten aus dem Jahr 1967 ist rechtsgeschichtlich fundiert --- und
das hat bekanntlich nach Ansicht des Hauses Baden Unfrieden gestiftet.
BZ: Die große rechtliche Unklarheit hat dazu geführt, dass manche
Gemälde zweimal an Land verkauft worden sind.
Mertens: Man muss hier in Rechnung stellen, dass unmittelbar nach dem
Untergang der Monarchie die Rechtsbegriffe nicht so klar waren,
jedenfalls nicht in den Ministerien. Da gab es verschiedene
Rechtsauffassungen im Finanzministerium und im Kultusministerium. Die
damaligen Vorstände der einzelnen Sammlungen hatten noch den besten
Blick auf die Rechtslage, wie wir im Gutachten zeigen können. Das hat
dazu geführt, dass man 1930 manche Gemälde, die einem wohl schon
gehörten, nochmals gekauft hat. Das ist sicherlich auf beiden Seiten
gutgläubig geschehen. Es war eben eine rechtlich schwierige Situation.
BZ: Umso mehr erstaunt, dass die vier Juristen in ihrer Kommission so
einig sind.
Mertens: Es wurde auch lange genug diskutiert. Das Ergebnis war nicht
von vorneherein so klar. Aber es wurden immer mehr historische Quellen
herangezogen. Eine sehr wichtige war das Testament Großherzogs
Friedrichs II. von 1907. Denn daraus werden die Prinzipien des
Fürstenrechts deutlich, wie vererbt wird, nämlich dasjenige, was zur
Herrschaft gehört, nicht unter die Erben verteilt wird, im Unterschied
zu Privateigentum, bei dem das Bürgerliche Gesetzbuch gilt. Diese
Klarheit hat uns überrascht, aber sie uns zur einhelligen Auffassung
in der Frage der Besitzverhältnisse verholfen.
BZ: Das Gutachten liest sich wie ein Lehrbuch zu privatem und
öffentlichen Eigentum &
Mertens: Diese Klarstellungen waren uns wichtig, weil sie in vielen
früheren Gutachten nicht berücksichtigt worden sind. Deshalb haben wir
diesen gesicherten Forschungsstand dargelegt.
BZ: Was raten Sie jetzt der Landesregierung, wie soll sie vorgehen?
Mertens: Solche Ratschläge wollten wir ausdrücklich nicht machen. Wir
legen unser Ergebnis in die Hände der Politiker. Und die müssen jetzt
entscheiden. Für einen Vergleich schaut nach diesem Ergebnis aber
nicht mehr viel heraus.
Während nur ganz vereinzelt in Weblogs zur Terminsache der Nutzungsrechts-Übertragung (siehe dazu Archivalia in der Rubrik Open Access passim) etwas geschrieben wird und das Thema auch für Heise kein Thema ist (von der gedruckten Journaille ganz abgesehen) und auch die Mailinglisten nur kleine Teile der wissenschaftlichen Öffentlichkeit erreichen (meinen Beitrag in H-SOZ-U-KULT habe ich auch weiteren H-Net-Listen angeboten, H-MUSEUM und H-ARTHIST haben als x-post veröffentlicht, H-Germanistik hat ihn ignoriert), unterrichtet mich Lambert Heller, dass die Piratenpartei das Thema aufgegriffen hat:
http://www.piratenpartei.de/node/346
Aber wer bitteschön kennt die Piratenpartei???
Leserinnen und Leser von Archivalia, die "Open Access" unterstützen wollen, sind aufgerufen, Urheber in ihrem Bekanntenkreis und geeignete mediale Multiplikatoren auf die nur noch bis 31. Dezember 2007 bestehende Möglichkeit der Nutzungsrechtsübertragung hinzuweisen.

http://www.piratenpartei.de/node/346
Aber wer bitteschön kennt die Piratenpartei???
Leserinnen und Leser von Archivalia, die "Open Access" unterstützen wollen, sind aufgerufen, Urheber in ihrem Bekanntenkreis und geeignete mediale Multiplikatoren auf die nur noch bis 31. Dezember 2007 bestehende Möglichkeit der Nutzungsrechtsübertragung hinzuweisen.

KlausGraf - am Donnerstag, 20. Dezember 2007, 19:36 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus INETBIB:
"... Virulent wurde in den vergangenen Tagen erneut die verwickelte Rechtslage an den Sammlungen der Badischen Landesbibliothek und der Kunsthalle zu Karlsruhe durch ein vom Hause des Markgrafen von Baden in Auftrag gegebenes Gutachten, das zu einem nicht verwunderlichen Ergebnis gelangte: Mehr als 80% der Kunstschätze beansprucht das Haus Baden als sein Eigentum.
Vor diesem Hintergrund ist das
Referat von Herrn Professor Dr. Dr. h.c. Adolf Laufs am 15. Januar 2008 um 20.00 Uhr c.t. im Bibliothekssaal des Instituts für geschichtliche Rechtswissenschaft (Friedrich-Ebert-Platz 2, 69117 Heidelberg) zu dem Thema
„Der badische Kulturgüterstreit: Erträge der Kommission“
von erheblicher Brisanz. Aus „erster Hand“ werden uns die Ergebnisse
präsentiert, zu der die Gutachter der von der Landesregierung eingesetzten Kommission gelangt sind.“
Mit freundlichen Grüßen
Katrin Siebler
Inst. f. gesch. Rechtswiss.
Bibliothek
Friedrich-Ebert-Platz 2
69117 Heidelberg
In der gleichen Vortragsreihe der Heidelberger Rechtshistorischen Gesellschaft berichtete am 10. Juli 2007 Prof. Dr. Reinhard Mussgnug, Heidelberg, über den "vormals Großherzoglich Badische Kulturbesitz zwischen dem Fürstenrecht des 19. und dem Staatsrecht des 20. Jahrhunderts". Sein Vortrag erschien im September 2007 in der Zeitschrift StudZR Heft 3/2007 (Studentische Zeitschrift für Rechtswissenschaft Heidelberg) unter dem Titel "Die Großherzoglich Badischen Sammlungen zwischen Monarchie und Republik".
"... Virulent wurde in den vergangenen Tagen erneut die verwickelte Rechtslage an den Sammlungen der Badischen Landesbibliothek und der Kunsthalle zu Karlsruhe durch ein vom Hause des Markgrafen von Baden in Auftrag gegebenes Gutachten, das zu einem nicht verwunderlichen Ergebnis gelangte: Mehr als 80% der Kunstschätze beansprucht das Haus Baden als sein Eigentum.
Vor diesem Hintergrund ist das
Referat von Herrn Professor Dr. Dr. h.c. Adolf Laufs am 15. Januar 2008 um 20.00 Uhr c.t. im Bibliothekssaal des Instituts für geschichtliche Rechtswissenschaft (Friedrich-Ebert-Platz 2, 69117 Heidelberg) zu dem Thema
„Der badische Kulturgüterstreit: Erträge der Kommission“
von erheblicher Brisanz. Aus „erster Hand“ werden uns die Ergebnisse
präsentiert, zu der die Gutachter der von der Landesregierung eingesetzten Kommission gelangt sind.“
Mit freundlichen Grüßen
Katrin Siebler
Inst. f. gesch. Rechtswiss.
Bibliothek
Friedrich-Ebert-Platz 2
69117 Heidelberg
In der gleichen Vortragsreihe der Heidelberger Rechtshistorischen Gesellschaft berichtete am 10. Juli 2007 Prof. Dr. Reinhard Mussgnug, Heidelberg, über den "vormals Großherzoglich Badische Kulturbesitz zwischen dem Fürstenrecht des 19. und dem Staatsrecht des 20. Jahrhunderts". Sein Vortrag erschien im September 2007 in der Zeitschrift StudZR Heft 3/2007 (Studentische Zeitschrift für Rechtswissenschaft Heidelberg) unter dem Titel "Die Großherzoglich Badischen Sammlungen zwischen Monarchie und Republik".
BCK - am Donnerstag, 20. Dezember 2007, 17:17 - Rubrik: Kulturgut
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.academiccommons.org/commons/review/gregory-crane
Excerpt:
The repository movement has, as yet, failed to exert a significant impact upon intellectual life. Libraries have failed to articulate what they can provide and, far more often, have failed to provide repository services of compelling interest. Repository efforts remain fragmented: small, locally customized projects that are not interoperable--insofar as they operate at all. Administrations have failed to show leadership. Happy to complain about exorbitant prices charged by publishers, they have not done the one thing that would lead to serious change: implement a transitional period by the end of which only publications deposited within the institutional repository under an open access license will count for tenure, promotion, and yearly reviews. Of course, senior faculty would object to such action, content with their privileged access to primary sources through expensive subscriptions. Also, publications in prestigious venues (owned and controlled by ruthless publishers) might be lost. Unfortunately, faculty have failed to look beyond their own immediate needs: verbally welcoming initiatives to open our global cultural heritage to the world but not themselves engaging in any meaningful action that will make that happen.
Excerpt:
The repository movement has, as yet, failed to exert a significant impact upon intellectual life. Libraries have failed to articulate what they can provide and, far more often, have failed to provide repository services of compelling interest. Repository efforts remain fragmented: small, locally customized projects that are not interoperable--insofar as they operate at all. Administrations have failed to show leadership. Happy to complain about exorbitant prices charged by publishers, they have not done the one thing that would lead to serious change: implement a transitional period by the end of which only publications deposited within the institutional repository under an open access license will count for tenure, promotion, and yearly reviews. Of course, senior faculty would object to such action, content with their privileged access to primary sources through expensive subscriptions. Also, publications in prestigious venues (owned and controlled by ruthless publishers) might be lost. Unfortunately, faculty have failed to look beyond their own immediate needs: verbally welcoming initiatives to open our global cultural heritage to the world but not themselves engaging in any meaningful action that will make that happen.
KlausGraf - am Donnerstag, 20. Dezember 2007, 03:30 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Update zu http://archiv.twoday.net/stories/4292275/
Ein kleines Buch stellt der Katalog zu der angebotenen Urkunde dar:
http://www.sothebys.com/liveauctions/event/N08461_MagnaCarta.pdf
An die 15 Mio. Euro zahlte ein US-Anwalt für das Dokument. Er will es dem Nationalarchiv überlassen:
http://www.tagesspiegel.de/kultur/Magna-Charta;art772,2442001

Ein kleines Buch stellt der Katalog zu der angebotenen Urkunde dar:
http://www.sothebys.com/liveauctions/event/N08461_MagnaCarta.pdf
An die 15 Mio. Euro zahlte ein US-Anwalt für das Dokument. Er will es dem Nationalarchiv überlassen:
http://www.tagesspiegel.de/kultur/Magna-Charta;art772,2442001

KlausGraf - am Donnerstag, 20. Dezember 2007, 02:45 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www2.bsz-bw.de/cms/swb/fernleihe/zkbw-dialog/zkdial55.html#Wikisource
Wikisource ( http://de.wikisource.org/wiki/Hauptseite ) sammelt Quellentexte in deutscher Sprache. Darunter werden alle Dialekte der deutschen Sprache und deren älteren Varianten wie Althochdeutsch oder Mittelhochdeutsch verstanden. Voraussetzung ist, dass die Texte von Urheberrechten frei sind (gemeinfrei, in der Regel 70 Jahre nach dem Tod des Autors) oder unter einer freien Lizenz zur Verfügung gestellt wurden.. Die erfassten Texte sind in der Regel schon einmal veröffentlicht worden. Sie werden in diesem Projekt digitalisiert bzw. transkribiert, also in elektronischen Text (E-Text) umgesetzt. Es ist auch möglich, unveröffentlichte Texte einzubringen, die nur handschriftlich vorliegen. Wikisource berücksichtigt vorzugsweise ältere Texte, die als historische Quellen gelten können. Wikisource ist einem überlieferungs- und rezeptionsgeschichtlichen Ansatz verpflichtet, was bedeutet, dass mehrere Versionen eines Textes gleichberechtigt dokumentiert werden können. Als Textgrundlage kommen - die Wiedergabe der maßgeblichen kritischen Edition (sofern urheberrechtsfrei), - einer Erstausgabe, - einer Ausgabe letzter Hand oder - einer anderen maßgeblichen Werkausgabe eines Autors. Kurze einführende und erklärende Texte zu Quelleneditionen sind erwünscht. Außerdem können Texte mit Anmerkungen versehen werden, die etwa veraltete oder fremdsprachliche Ausdrücke erklären. Solche Anmerkungen und Erläuterungen können sein:
* Daten zur Quelle selbst,
* bibliographische Informationen (wie z. B. VD16 und VD17),
* erklärende Fußnoten zu Wörtern und Wendungen,
* Verweise auf vergleichbare Werke,
* Strukturierung des Quellentextes,
* Einführungen,
* Indizes von Personen, Wörtern usw.
Übersetzungen anderssprachiger Texte sind erwünscht. Im Falle von Übersetzungen darf bei Texten zum Vergleich auch der Text in der Originalsprache vorhanden sein. Außerdem ist es erwünscht, die Quellentexte, aber auch die Autoren-, Orts- und Themenseiten mit multimedialen Inhalten anzureichern (nach Wikisource : Über Wikisource). Anfänger, die am Aufbau der Wikisource-Sammlung mitwirken möchten, können sich im Wikisource-Portal und in den FAQ – Häufigen Fragen informieren. Im Wikisource-Bestand finden sich bereits die Zimmerische Chronik, die Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), Handschriften wie das Georgslied, bibliophile Kostbarkeiten wie „Der Struwwelpeter“, Flugschriften und Einblattdrucke der Frühen Neuzeit, stadtgeschichtliche Darstellungen (wie z. B. zu Schwäbisch Gmünd) und Württembergische Oberamtsbeschreibungen und vieles mehr. Von besonderem Interesse ist die Liste von „Biographischen Nachschlagewerken“ (http://de.wikisource.org/wiki/Biographische_Nachschlagewerke), einer ausführlichen Zusammenstellung von frei zugänglichen biographischen Nachschlagewerken in deutscher Sprache sowie fremdsprachiger Germanica.

Wikisource ( http://de.wikisource.org/wiki/Hauptseite ) sammelt Quellentexte in deutscher Sprache. Darunter werden alle Dialekte der deutschen Sprache und deren älteren Varianten wie Althochdeutsch oder Mittelhochdeutsch verstanden. Voraussetzung ist, dass die Texte von Urheberrechten frei sind (gemeinfrei, in der Regel 70 Jahre nach dem Tod des Autors) oder unter einer freien Lizenz zur Verfügung gestellt wurden.. Die erfassten Texte sind in der Regel schon einmal veröffentlicht worden. Sie werden in diesem Projekt digitalisiert bzw. transkribiert, also in elektronischen Text (E-Text) umgesetzt. Es ist auch möglich, unveröffentlichte Texte einzubringen, die nur handschriftlich vorliegen. Wikisource berücksichtigt vorzugsweise ältere Texte, die als historische Quellen gelten können. Wikisource ist einem überlieferungs- und rezeptionsgeschichtlichen Ansatz verpflichtet, was bedeutet, dass mehrere Versionen eines Textes gleichberechtigt dokumentiert werden können. Als Textgrundlage kommen - die Wiedergabe der maßgeblichen kritischen Edition (sofern urheberrechtsfrei), - einer Erstausgabe, - einer Ausgabe letzter Hand oder - einer anderen maßgeblichen Werkausgabe eines Autors. Kurze einführende und erklärende Texte zu Quelleneditionen sind erwünscht. Außerdem können Texte mit Anmerkungen versehen werden, die etwa veraltete oder fremdsprachliche Ausdrücke erklären. Solche Anmerkungen und Erläuterungen können sein:
* Daten zur Quelle selbst,
* bibliographische Informationen (wie z. B. VD16 und VD17),
* erklärende Fußnoten zu Wörtern und Wendungen,
* Verweise auf vergleichbare Werke,
* Strukturierung des Quellentextes,
* Einführungen,
* Indizes von Personen, Wörtern usw.
Übersetzungen anderssprachiger Texte sind erwünscht. Im Falle von Übersetzungen darf bei Texten zum Vergleich auch der Text in der Originalsprache vorhanden sein. Außerdem ist es erwünscht, die Quellentexte, aber auch die Autoren-, Orts- und Themenseiten mit multimedialen Inhalten anzureichern (nach Wikisource : Über Wikisource). Anfänger, die am Aufbau der Wikisource-Sammlung mitwirken möchten, können sich im Wikisource-Portal und in den FAQ – Häufigen Fragen informieren. Im Wikisource-Bestand finden sich bereits die Zimmerische Chronik, die Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), Handschriften wie das Georgslied, bibliophile Kostbarkeiten wie „Der Struwwelpeter“, Flugschriften und Einblattdrucke der Frühen Neuzeit, stadtgeschichtliche Darstellungen (wie z. B. zu Schwäbisch Gmünd) und Württembergische Oberamtsbeschreibungen und vieles mehr. Von besonderem Interesse ist die Liste von „Biographischen Nachschlagewerken“ (http://de.wikisource.org/wiki/Biographische_Nachschlagewerke), einer ausführlichen Zusammenstellung von frei zugänglichen biographischen Nachschlagewerken in deutscher Sprache sowie fremdsprachiger Germanica.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 20. Dezember 2007, 01:26 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://peel.library.ualberta.ca/bibliography/
Hier sind auch 27 deutschsprachige Bücher digitalisiert, darunter die Lieder der Hutterischen Brüder. Siehe dazu:
Wikisource
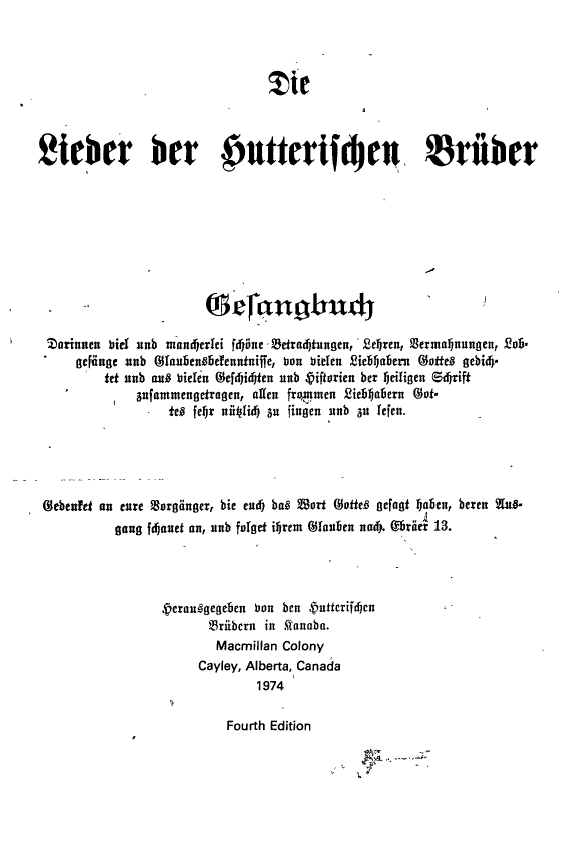
Hier sind auch 27 deutschsprachige Bücher digitalisiert, darunter die Lieder der Hutterischen Brüder. Siehe dazu:
Wikisource
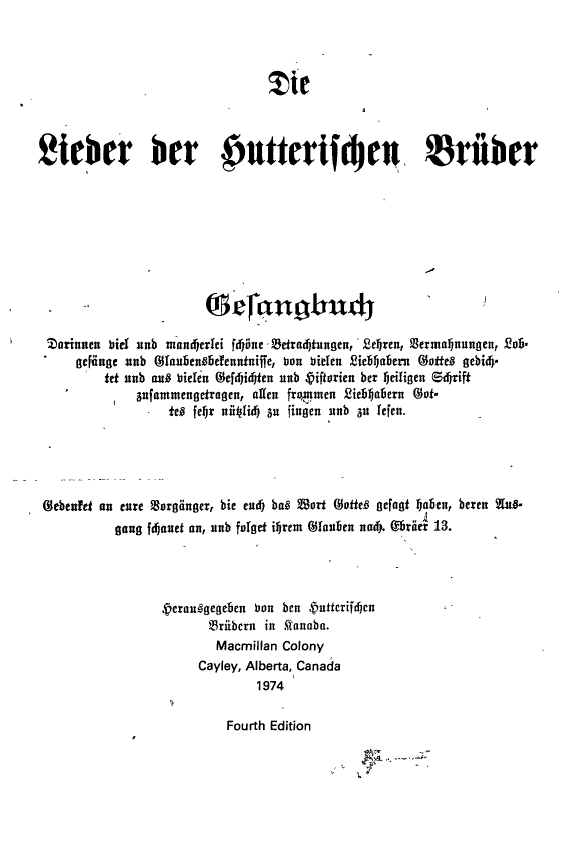
KlausGraf - am Donnerstag, 20. Dezember 2007, 01:16 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sehr geehrte Damen und Herren,
das EU-Projekt „MICHAEL“ (=„Multilingual Inventory of Cultural Heritage in
Europe“) wurde 2004 von Frankreich, Großbritannien und Italien ins Leben
gerufen. Seit 2006 haben sich weitere 15 europäische Länder dem Folgeprojekt
„MICHAEL Plus“ angeschlossen, so auch Deutschland. Sieben deutsche
Institutionen aus unterschiedlichen Kulturgutsparten beteiligen sich an
„MICHAEL Plus“ (www.michael-culture.org): das Bundesarchiv, die Deutsche
Nationalbibliothek, die Bayerische Staatsbibliothek, das Deutsche Museum,
das Landesarchiv Baden-Württemberg, die Senckenbergische Naturforschende
Gesellschaft und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Im Rahmen von „MICHAEL Plus“ wird ein mehrsprachiges Kulturportal für den
Nachweis digitaler und digitalisierter Bestände und Sammlungen in Europa
aufgebaut. Das internationale MICHAEL-Portal wird das digitale Kulturerbe
von Archiven, Bibliotheken und Museen auf europäischer Ebene präsentieren
und den Zugang dazu vereinfachen.
Zu jedem digitalisierten Bestand und jeder digitalisierten Sammlung wird
eine Beschreibung im MICHAEL-Informationssystem hinterlegt. Neben im
Internet bereitgestellten Digitalisaten sollen auch im Intranet oder offline
(auf Massenspeichern, CD-ROMs, DVDs etc.) verfügbare digitalisierte Bestände
nachgewiesen werden, z.B. für die Lesesaal-Nutzung aufbereitete
digitalisierte Zeitungssammlungen.
MICHAEL bietet keinen direkten Zugriff auf einzelne Objekte, sondern stellt
auf der Bestands- oder Sammlungsebene jeweils eine eigens angelegte
Beschreibung bereit. Diese soll einen Überblick über den Inhalt der Sammlung
oder des Bestandes liefern und dem Nutzer einen Hinweis auf die
Zugangsmöglichkeiten geben, z.B. über den Link zum entsprechenden Webangebot
oder durch die Nennung von Adressen oder Bezugsquellen.
Die Aufnahme archivischer digitaler Bestände erfolgt durch das Landesarchiv
Baden-Württemberg und das Bundesarchiv: Das Landesarchiv Baden-Württemberg
koordiniert die Erfassung der Bestandsbeschreibungen von Archiven in den
westdeutschen Bundesländern; das Bundesarchiv nimmt die Angaben zu
digitalisierten Beständen in Berlin und den ostdeutschen Bundesländern
entgegen.
Damit das deutsche Portal (www.michael-portal.de) im Mai 2008 erfolgreich
online gehen kann, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe: Nennen Sie uns bitte
Ihre digitalen und digitalisierten Bestände, so dass diese sowohl im
deutschen als auch im europäischen MICHAEL-Portal präsentiert werden können!
Die Aufnahme Ihrer Bestandsbeschreibungen erfolgt kostenlos. Alle benötigten
Angaben werden in einem Meldeformular abgefragt, das Sie per E-Mail bei uns
anfordern oder direkt von der Website des Landesarchivs Baden-Württemberg
(www.landesarchiv-bw.de/michaelplus) herunterladen können. Füllen Sie das
Formular bitte so vollständig wie möglich aus und schicken Sie es uns bis
spätestens 29. Februar 2008 per E-Mail zu. Bei Rückfragen helfen wir Ihnen
gerne jederzeit weiter.
Für den weiteren Kontakt stehen Ihnen zur Verfügung
- im Landesarchiv Baden-Württemberg:
Christina Wolf
Landesarchiv Baden-Württemberg
Referat 13 „Informations- und Kommunikationstechnologie, Elektronische
Dienste“
Eugenstraße 7, 70182 Stuttgart
Tel. 0711 – 212-4270
E-Mail: christina.wolf@la-bw.de
- im Bundesarchiv:
Petra Rauschenbach
Bundesarchiv
Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR
Referat StA 1
Finckensteinallee 63, 12205 Berlin
Tel. 030 – 187770-740
E-Mail: p.rauschenbach@barch.bund.de
Wir freuen uns Ihre Beteiligung am MICHAEL-Portal!
Mit freundlichen Grüßen
Christina Wolf
____________
Christina Wolf
Projektbearbeiterin MICHAEL Plus
Landesarchiv Baden-Württemberg
Eugenstraße 7 - 70182 Stuttgart
Tel. 0711/212-4270
Ex: Archivliste
das EU-Projekt „MICHAEL“ (=„Multilingual Inventory of Cultural Heritage in
Europe“) wurde 2004 von Frankreich, Großbritannien und Italien ins Leben
gerufen. Seit 2006 haben sich weitere 15 europäische Länder dem Folgeprojekt
„MICHAEL Plus“ angeschlossen, so auch Deutschland. Sieben deutsche
Institutionen aus unterschiedlichen Kulturgutsparten beteiligen sich an
„MICHAEL Plus“ (www.michael-culture.org): das Bundesarchiv, die Deutsche
Nationalbibliothek, die Bayerische Staatsbibliothek, das Deutsche Museum,
das Landesarchiv Baden-Württemberg, die Senckenbergische Naturforschende
Gesellschaft und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Im Rahmen von „MICHAEL Plus“ wird ein mehrsprachiges Kulturportal für den
Nachweis digitaler und digitalisierter Bestände und Sammlungen in Europa
aufgebaut. Das internationale MICHAEL-Portal wird das digitale Kulturerbe
von Archiven, Bibliotheken und Museen auf europäischer Ebene präsentieren
und den Zugang dazu vereinfachen.
Zu jedem digitalisierten Bestand und jeder digitalisierten Sammlung wird
eine Beschreibung im MICHAEL-Informationssystem hinterlegt. Neben im
Internet bereitgestellten Digitalisaten sollen auch im Intranet oder offline
(auf Massenspeichern, CD-ROMs, DVDs etc.) verfügbare digitalisierte Bestände
nachgewiesen werden, z.B. für die Lesesaal-Nutzung aufbereitete
digitalisierte Zeitungssammlungen.
MICHAEL bietet keinen direkten Zugriff auf einzelne Objekte, sondern stellt
auf der Bestands- oder Sammlungsebene jeweils eine eigens angelegte
Beschreibung bereit. Diese soll einen Überblick über den Inhalt der Sammlung
oder des Bestandes liefern und dem Nutzer einen Hinweis auf die
Zugangsmöglichkeiten geben, z.B. über den Link zum entsprechenden Webangebot
oder durch die Nennung von Adressen oder Bezugsquellen.
Die Aufnahme archivischer digitaler Bestände erfolgt durch das Landesarchiv
Baden-Württemberg und das Bundesarchiv: Das Landesarchiv Baden-Württemberg
koordiniert die Erfassung der Bestandsbeschreibungen von Archiven in den
westdeutschen Bundesländern; das Bundesarchiv nimmt die Angaben zu
digitalisierten Beständen in Berlin und den ostdeutschen Bundesländern
entgegen.
Damit das deutsche Portal (www.michael-portal.de) im Mai 2008 erfolgreich
online gehen kann, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe: Nennen Sie uns bitte
Ihre digitalen und digitalisierten Bestände, so dass diese sowohl im
deutschen als auch im europäischen MICHAEL-Portal präsentiert werden können!
Die Aufnahme Ihrer Bestandsbeschreibungen erfolgt kostenlos. Alle benötigten
Angaben werden in einem Meldeformular abgefragt, das Sie per E-Mail bei uns
anfordern oder direkt von der Website des Landesarchivs Baden-Württemberg
(www.landesarchiv-bw.de/michaelplus) herunterladen können. Füllen Sie das
Formular bitte so vollständig wie möglich aus und schicken Sie es uns bis
spätestens 29. Februar 2008 per E-Mail zu. Bei Rückfragen helfen wir Ihnen
gerne jederzeit weiter.
Für den weiteren Kontakt stehen Ihnen zur Verfügung
- im Landesarchiv Baden-Württemberg:
Christina Wolf
Landesarchiv Baden-Württemberg
Referat 13 „Informations- und Kommunikationstechnologie, Elektronische
Dienste“
Eugenstraße 7, 70182 Stuttgart
Tel. 0711 – 212-4270
E-Mail: christina.wolf@la-bw.de
- im Bundesarchiv:
Petra Rauschenbach
Bundesarchiv
Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR
Referat StA 1
Finckensteinallee 63, 12205 Berlin
Tel. 030 – 187770-740
E-Mail: p.rauschenbach@barch.bund.de
Wir freuen uns Ihre Beteiligung am MICHAEL-Portal!
Mit freundlichen Grüßen
Christina Wolf
____________
Christina Wolf
Projektbearbeiterin MICHAEL Plus
Landesarchiv Baden-Württemberg
Eugenstraße 7 - 70182 Stuttgart
Tel. 0711/212-4270
Ex: Archivliste
KlausGraf - am Donnerstag, 20. Dezember 2007, 00:52 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Ambivalenz der Archive" - Das Archiv als Ort der Wissensproduktion
Medizinhistorisches Museum der Charité, Berlin
17.-18. Januar 2008
Veranstalter: Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik der
Humboldt-Universität in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für
Wissenschaftsgeschichte und dem Berliner Medizinhistorischen Museum an der
Charité
Die Tagung untersucht die Rolle von Archiven im Hinblick auf die
Konstitution von Wissen. Die Objekte, die das Archiv bevölkern, verweisen
sowohl auf ein "Davor" als auch auf ein "Danach" des Archivs, wobei davon
auszugehen ist, dass beide Übergänge produktiv sind in dem Sinne, dass sie
das Objekt als distinktive Entität und damit als Objekt des Wissens erst
erzeugen. Das Archiv fasziniert daher, es dient seit jeher als Ort der
Wahrheitsproduktion. Aber es bereitet auch Unbehagen.
Ein Beispiel dafür sind Aufnahmen des Berliner Lautarchivs, die in den
Jahren 1915-18 im nahegelegenen Kriegsgefangenenlager Wünsdorf gemacht
wurden. Welchen Einfluss haben die Umstände, unter denen sie entstanden, auf
die Aufnahmen selbst? Welche verborgenen Botschaften enthalten sie?
Welche Geschichten erzählen sie? Oder besteht ihre Substanz in einem
Schweigen, das erst durch die imaginative Aktivität des Forschers zu einer
vermeintlich kohärenten Erzählung gerinnt? Sprechen die Archive über die
Objekte als Dokumente einer außerhalb ihrer selbst existierenden Realität
oder sagen sie vielmehr etwas über die zur Zeit ihrer Entstehung
hegemonialen wissenschaftlichen Praxis aus?
Oder beides? Was sind die Konnektoren?
Die Tagung widmet sich diesen Fragen unter den Gesichtspunkten
Wissensorganisation und Sammlungspolitik, Kolonialismus und Archiv, Objekt
und Inszenierung, Benutzung und Ökonomisierung sowie Inszenierung und
Verwertung.
Programm:
Donnerstag, 17. Januar 2008
10-13 Uhr: Widerspenstige Objekte, moderiert von Jürgen Mahrenholz
(Helmholtz-Zentrum)
Im Inventar des Körpers. Die neue Dauerausstellung des Berliner
Medizinhistorischen Museums der Charité
Thomas Schnalke (Charité - Universitätsmedizin Berlin, Medizinhistorisches
Museum)
Film als Ausdruck von Kultur
Wolfgang Davis (Staatliche Museen zu Berlin - Generaldirektion/
BesucherDienste, Lehrbeauftragter am Institut für Ethnologie der Freien
Universität Berlin)
Töne, Laute, Stimmen, Sprache, Musik. Zur Sammlungspolitik und
Sammlungsgeschichte der Berliner Schallarchive
Susanne Ziegler (Staatliche Museen zu Berlin - Ethnologisches Museum/ Abt.
Musikethnologie)
15-17 Uhr: Archive im Wandel, moderiert von Michael Willenbücher
(Helmholtz-Zentrum)
Langzeitsicherung von Filmen - nicht nur eine technische Frage
Beate Engelbrecht (IWF Wissen und Medien gGmbH, Göttingen)
Die Ambivalenz der Medienarchive: Wie die audiovisuellen (und dann
digitalen) Archive den klassischen Archivbegriff unterlaufen
Wolfgang Ernst (Humboldt-Universität zu Berlin, Seminar für
Medienwissenschaft)
Freitag, 18. Januar 2008
10-13 Uhr: Strategien der Entzifferung, moderiert von Britta Lange
(Max-Plank-Institut für Wissenschaftsgeschichte)
Der Film "Halfmoonfiles" und die Gegenwärtigkeiten der Archive
Nicole Wolf (Goldsmiths University of London, Department of Visual Cultures)
Koloniale Unordnung: Postkartensammlungen als Archive populärer Rassismen in
den Konflikt- und Fluchtlinien des schwarzen Atlantik, 1890er-1920er Jahre
Astrid Kusser (Universität zu Köln, Kulturwissenschaftliches
Forschungskolleg (SFB/FK 427) "Medien und kulturelle
Kommunikation")
Kontrollton 435 Hz - Die Experimentalwalzen des Psychologischen Instituts,
Berlin, im "Virtuellen Labor"
Julia Kursell (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte)
15-17 Uhr: Lautpolitik, moderiert von Philip Scheffner (Dokumentarfilmer /
pong Berlin)
Urheberrecht und die Konstruktion von Identitäten - Gedanken zum Umgang mit
wissenschaftlichen Schallarchiven
Lars-Christian Koch (Staatliche Museen zu Berlin - Ethnologisches Museum/
Abt. Musikethnologie)
Fragen an das Borno Music Documentation Project (Nigeria)
Raimund Vogels (Hochschule für Musik und Theater Hannover, Musikethnologie)
Abendprogramm am Do, 17.1.2008, 19 Uhr:
Screening von "Halfmoonfiles" (Philip Scheffner, 2006) in der Ausstellung
"The making of " und Bilder verkehren
Ort: Kunstraum Kreuzberg / Bethanien, Mariannenplatz 2, 10997 Berlin,
U-Bahn: Kottbusser Tor
Der Dokumentarfilm folgt den Spuren von Aufnahmen des Berliner Lautarchivs,
die in den Jahren 1915-18 im Kriegsgefangenenlager Wünsdorf bei Berlin
gemacht wurden. Er untersucht die einmalige Allianz aus Militär,
Wissenschaft und Unterhaltungsindustrie, die diese Aufnahmen ermöglichte.
Weitere Informationen und Kontakt:
Michael Willenbuecher
Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik
HU Berlin
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Tel.: 2093-2715, Fax 2093-1961
Email: kabinette@hu-berlin.de
http://www.sammlungen.hu-berlin.de/redaktion/archive
--
H-MUSEUM
H-Net Network for Museums and Museum Studies
E-Mail: h-museum@h-net.msu.edu
WWW: http://www.h-museum.net
KOMMENTAR:
Die Objekte, die das Archiv bevölkern, verweisen
sowohl auf ein "Davor" als auch auf ein "Danach" des Archivs, wobei davon auszugehen ist, dass beide Übergänge produktiv sind in dem Sinne, dass sie das Objekt als distinktive Entität und damit als Objekt des Wissens erst erzeugen.
Wie nennt man so etwas am besten?
Prätentiös?
Postmodernes Geschwurbel?
Oder einfach: Gequirtlte ***?
Medizinhistorisches Museum der Charité, Berlin
17.-18. Januar 2008
Veranstalter: Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik der
Humboldt-Universität in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für
Wissenschaftsgeschichte und dem Berliner Medizinhistorischen Museum an der
Charité
Die Tagung untersucht die Rolle von Archiven im Hinblick auf die
Konstitution von Wissen. Die Objekte, die das Archiv bevölkern, verweisen
sowohl auf ein "Davor" als auch auf ein "Danach" des Archivs, wobei davon
auszugehen ist, dass beide Übergänge produktiv sind in dem Sinne, dass sie
das Objekt als distinktive Entität und damit als Objekt des Wissens erst
erzeugen. Das Archiv fasziniert daher, es dient seit jeher als Ort der
Wahrheitsproduktion. Aber es bereitet auch Unbehagen.
Ein Beispiel dafür sind Aufnahmen des Berliner Lautarchivs, die in den
Jahren 1915-18 im nahegelegenen Kriegsgefangenenlager Wünsdorf gemacht
wurden. Welchen Einfluss haben die Umstände, unter denen sie entstanden, auf
die Aufnahmen selbst? Welche verborgenen Botschaften enthalten sie?
Welche Geschichten erzählen sie? Oder besteht ihre Substanz in einem
Schweigen, das erst durch die imaginative Aktivität des Forschers zu einer
vermeintlich kohärenten Erzählung gerinnt? Sprechen die Archive über die
Objekte als Dokumente einer außerhalb ihrer selbst existierenden Realität
oder sagen sie vielmehr etwas über die zur Zeit ihrer Entstehung
hegemonialen wissenschaftlichen Praxis aus?
Oder beides? Was sind die Konnektoren?
Die Tagung widmet sich diesen Fragen unter den Gesichtspunkten
Wissensorganisation und Sammlungspolitik, Kolonialismus und Archiv, Objekt
und Inszenierung, Benutzung und Ökonomisierung sowie Inszenierung und
Verwertung.
Programm:
Donnerstag, 17. Januar 2008
10-13 Uhr: Widerspenstige Objekte, moderiert von Jürgen Mahrenholz
(Helmholtz-Zentrum)
Im Inventar des Körpers. Die neue Dauerausstellung des Berliner
Medizinhistorischen Museums der Charité
Thomas Schnalke (Charité - Universitätsmedizin Berlin, Medizinhistorisches
Museum)
Film als Ausdruck von Kultur
Wolfgang Davis (Staatliche Museen zu Berlin - Generaldirektion/
BesucherDienste, Lehrbeauftragter am Institut für Ethnologie der Freien
Universität Berlin)
Töne, Laute, Stimmen, Sprache, Musik. Zur Sammlungspolitik und
Sammlungsgeschichte der Berliner Schallarchive
Susanne Ziegler (Staatliche Museen zu Berlin - Ethnologisches Museum/ Abt.
Musikethnologie)
15-17 Uhr: Archive im Wandel, moderiert von Michael Willenbücher
(Helmholtz-Zentrum)
Langzeitsicherung von Filmen - nicht nur eine technische Frage
Beate Engelbrecht (IWF Wissen und Medien gGmbH, Göttingen)
Die Ambivalenz der Medienarchive: Wie die audiovisuellen (und dann
digitalen) Archive den klassischen Archivbegriff unterlaufen
Wolfgang Ernst (Humboldt-Universität zu Berlin, Seminar für
Medienwissenschaft)
Freitag, 18. Januar 2008
10-13 Uhr: Strategien der Entzifferung, moderiert von Britta Lange
(Max-Plank-Institut für Wissenschaftsgeschichte)
Der Film "Halfmoonfiles" und die Gegenwärtigkeiten der Archive
Nicole Wolf (Goldsmiths University of London, Department of Visual Cultures)
Koloniale Unordnung: Postkartensammlungen als Archive populärer Rassismen in
den Konflikt- und Fluchtlinien des schwarzen Atlantik, 1890er-1920er Jahre
Astrid Kusser (Universität zu Köln, Kulturwissenschaftliches
Forschungskolleg (SFB/FK 427) "Medien und kulturelle
Kommunikation")
Kontrollton 435 Hz - Die Experimentalwalzen des Psychologischen Instituts,
Berlin, im "Virtuellen Labor"
Julia Kursell (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte)
15-17 Uhr: Lautpolitik, moderiert von Philip Scheffner (Dokumentarfilmer /
pong Berlin)
Urheberrecht und die Konstruktion von Identitäten - Gedanken zum Umgang mit
wissenschaftlichen Schallarchiven
Lars-Christian Koch (Staatliche Museen zu Berlin - Ethnologisches Museum/
Abt. Musikethnologie)
Fragen an das Borno Music Documentation Project (Nigeria)
Raimund Vogels (Hochschule für Musik und Theater Hannover, Musikethnologie)
Abendprogramm am Do, 17.1.2008, 19 Uhr:
Screening von "Halfmoonfiles" (Philip Scheffner, 2006) in der Ausstellung
"The making of " und Bilder verkehren
Ort: Kunstraum Kreuzberg / Bethanien, Mariannenplatz 2, 10997 Berlin,
U-Bahn: Kottbusser Tor
Der Dokumentarfilm folgt den Spuren von Aufnahmen des Berliner Lautarchivs,
die in den Jahren 1915-18 im Kriegsgefangenenlager Wünsdorf bei Berlin
gemacht wurden. Er untersucht die einmalige Allianz aus Militär,
Wissenschaft und Unterhaltungsindustrie, die diese Aufnahmen ermöglichte.
Weitere Informationen und Kontakt:
Michael Willenbuecher
Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik
HU Berlin
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Tel.: 2093-2715, Fax 2093-1961
Email: kabinette@hu-berlin.de
http://www.sammlungen.hu-berlin.de/redaktion/archive
--
H-MUSEUM
H-Net Network for Museums and Museum Studies
E-Mail: h-museum@h-net.msu.edu
WWW: http://www.h-museum.net
KOMMENTAR:
Die Objekte, die das Archiv bevölkern, verweisen
sowohl auf ein "Davor" als auch auf ein "Danach" des Archivs, wobei davon auszugehen ist, dass beide Übergänge produktiv sind in dem Sinne, dass sie das Objekt als distinktive Entität und damit als Objekt des Wissens erst erzeugen.
Wie nennt man so etwas am besten?
Prätentiös?
Postmodernes Geschwurbel?
Oder einfach: Gequirtlte ***?
KlausGraf - am Donnerstag, 20. Dezember 2007, 00:33 - Rubrik: Veranstaltungen


