Update zu: http://archiv.twoday.net/stories/6167165/
Nachdem es einige Tage gut als US-Proxy bei Google Books funktioniert, zickte das Programm gestern erstmals, indem es zwar die Bücher voll anzeigte, aber bei der Suche wie eine deutsche IP agierte. Heute war überhaupt nichts mehr von einem US-Proxy zu spüren. Schade.
Nachdem es einige Tage gut als US-Proxy bei Google Books funktioniert, zickte das Programm gestern erstmals, indem es zwar die Bücher voll anzeigte, aber bei der Suche wie eine deutsche IP agierte. Heute war überhaupt nichts mehr von einem US-Proxy zu spüren. Schade.
KlausGraf - am Donnerstag, 4. Februar 2010, 23:43 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
http://archiv.ub.uni-marburg.de/eb/2010/0012 (PDF, 343 MB)
KlausGraf - am Donnerstag, 4. Februar 2010, 22:36 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind1002&L=netlaw-l&P=4063
Aus einer spannenden Filesharing-Diskussion in NETLAW-L.
 Al Capone
Al Capone
Aus einer spannenden Filesharing-Diskussion in NETLAW-L.
 Al Capone
Al CaponeKlausGraf - am Donnerstag, 4. Februar 2010, 22:20 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Hinweis auf Digitalisate:
http://www.rambow.de/geschichtsquellen-livland-estland-kurland.html#more-5588
http://www.rambow.de/geschichtsquellen-livland-estland-kurland.html#more-5588
KlausGraf - am Donnerstag, 4. Februar 2010, 22:17 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Margit Rambow, deren genealogisches Blog für mich eine interessante Lektüre & Quelle darstellt, stellt den Freiburger Dokumentenserver vor (und mich):
http://www.rambow.de/freiburger-dokumentenserver.html
http://www.rambow.de/freiburger-dokumentenserver.html
KlausGraf - am Donnerstag, 4. Februar 2010, 22:06 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
The following is a letter drafted by the Advocacy Committee of the ICMA and mailed today to Kings College. It represents our unease at the potential loss of so valuable a position and our hopes that the relevant authorities will reconsider their position. Many thanks to James D'Emilio, Chair of Advocacy and his committee for working so diligently on this. Colum Professor Rick Trainor. The Principal
King's College
The Strand, London WC2R 2LS
United Kingdom
principal@kcl.ac.uk
Professor Jan Palmowski, Head
School of Arts and Humanities
King's College
The Strand, London WC2R 2LS
United Kingdom
jan.palmowski@kcl.ac.uk
Dear Profs. Trainor and Palmowski:
We are writing on behalf of the International Center of Medieval Art, an organization with over five hundred members in twenty countries, to express our dismay over the reported plan to eliminate the Chair in Palaeography at King's College. We understand the financial challenges facing educational and cultural institutions, but we believe that this would be an ill-advised and short-sighted action with negative repercussions for a broad spectrum of disciplines, programs, and professionals in the Humanities, and, therefore, for the wider public that enjoys and benefits from the presentation of the European historical and cultural heritage in diverse settings and media.
Palaeography is not an everyday word, and the idea of dedicating oneself to the study of "old writing" can easily be caricatured as the most esoteric of pursuits. Nothing could be further from the truth. It is only through handwritten manuscripts and documents that the history and written culture of the Middle Ages was recorded, and the legacy of classical antiquity transmitted. The edicts of kings, the sentences of judges, the contracts of merchants, the meditations of nuns, the debates of schoolmen, the songs of poets, and the wills of ordinary women and men come down to us in handwriting that must be authenticated, deciphered, contextualized and interpreted, with the patient and careful application of visual skills, linguistic expertise, and understanding of the material technology of writing. Acquiring such knowledge and experience is a painstaking task demanding intellectual rigor and a rare combination of skills, and the corps of scholars who study and teach in this field are at the heart of the Humanities. The methods and skills they teach are valuable tools across many disciplines in the contemporary university, but, for those in the Humanities, the loss of their expertise would silence a thousand years of European civilization.
Remarkable though these skills are, they are not the whole story of what makes palaeography a critical discipline, for it does far more than provide a "service" to students of the history, art, literature, music, and learning of the past. In a world before printing, writing was a fundamental technology, and the study of the written word is itself a door to understanding the European past. To investigate writing, education, and literacy in the Middle Ages is to penetrate to the core of the processes that sustained the culture and institutions of medieval Christianity, and that laid the foundations of modern states, cities, universities, and commercial enterprises. It is sadly ironic that it would be an educational institution, and one with such a distinguished history, that would deal this blow to the study of written culture.
We urge you to reconsider this decision. King's College has a long history of distinction in the fields of medieval studies, and Francis Wormald, Julian Brown and Tilly de la Mare, past holders of the chair of Palaeography, have been among the most renowned scholars in this discipline. The present chair, David Ganz, is a distinguished historian and philologist, well-known to many of our members. The extraordinary collections of the British Library, the proximity of the manuscript collections at Cambridge and Oxford, and the concentration of faculty and students in the region make King's College, London an ideal venue for the only established chair in Palaeography in the United Kingdom. We sincerely hope that the Chair will flourish for a long time to come.
James D' Emilio,
Chair of The Advocacy Committee, International Center of Medieval Art
King's College
The Strand, London WC2R 2LS
United Kingdom
principal@kcl.ac.uk
Professor Jan Palmowski, Head
School of Arts and Humanities
King's College
The Strand, London WC2R 2LS
United Kingdom
jan.palmowski@kcl.ac.uk
Dear Profs. Trainor and Palmowski:
We are writing on behalf of the International Center of Medieval Art, an organization with over five hundred members in twenty countries, to express our dismay over the reported plan to eliminate the Chair in Palaeography at King's College. We understand the financial challenges facing educational and cultural institutions, but we believe that this would be an ill-advised and short-sighted action with negative repercussions for a broad spectrum of disciplines, programs, and professionals in the Humanities, and, therefore, for the wider public that enjoys and benefits from the presentation of the European historical and cultural heritage in diverse settings and media.
Palaeography is not an everyday word, and the idea of dedicating oneself to the study of "old writing" can easily be caricatured as the most esoteric of pursuits. Nothing could be further from the truth. It is only through handwritten manuscripts and documents that the history and written culture of the Middle Ages was recorded, and the legacy of classical antiquity transmitted. The edicts of kings, the sentences of judges, the contracts of merchants, the meditations of nuns, the debates of schoolmen, the songs of poets, and the wills of ordinary women and men come down to us in handwriting that must be authenticated, deciphered, contextualized and interpreted, with the patient and careful application of visual skills, linguistic expertise, and understanding of the material technology of writing. Acquiring such knowledge and experience is a painstaking task demanding intellectual rigor and a rare combination of skills, and the corps of scholars who study and teach in this field are at the heart of the Humanities. The methods and skills they teach are valuable tools across many disciplines in the contemporary university, but, for those in the Humanities, the loss of their expertise would silence a thousand years of European civilization.
Remarkable though these skills are, they are not the whole story of what makes palaeography a critical discipline, for it does far more than provide a "service" to students of the history, art, literature, music, and learning of the past. In a world before printing, writing was a fundamental technology, and the study of the written word is itself a door to understanding the European past. To investigate writing, education, and literacy in the Middle Ages is to penetrate to the core of the processes that sustained the culture and institutions of medieval Christianity, and that laid the foundations of modern states, cities, universities, and commercial enterprises. It is sadly ironic that it would be an educational institution, and one with such a distinguished history, that would deal this blow to the study of written culture.
We urge you to reconsider this decision. King's College has a long history of distinction in the fields of medieval studies, and Francis Wormald, Julian Brown and Tilly de la Mare, past holders of the chair of Palaeography, have been among the most renowned scholars in this discipline. The present chair, David Ganz, is a distinguished historian and philologist, well-known to many of our members. The extraordinary collections of the British Library, the proximity of the manuscript collections at Cambridge and Oxford, and the concentration of faculty and students in the region make King's College, London an ideal venue for the only established chair in Palaeography in the United Kingdom. We sincerely hope that the Chair will flourish for a long time to come.
James D' Emilio,
Chair of The Advocacy Committee, International Center of Medieval Art
KlausGraf - am Donnerstag, 4. Februar 2010, 21:57 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.openthesis.org
http://www.prweb.com/releases/2010/01/prweb3523094.htm
Wenn die suchbaren Metadaten so aussehen:
rhBMP-2 zur Knochenaugmentation bei transgingivaler Implantateinheilung
by
Abstract (Summary)
Bibliographical Information:
Advisor:
School:Fachhochschule Aachen
School Location:Germany
Source Type:Master's Thesis
Keywords:
ISBN:
Date of Publication:
also noch nicht einmal den Namen des Autors oder eine Datenquelle enthalten, ist das Urteil über dieses neue Projekt schon gesprochen.
Dass "All rights reserved" unten steht und die Advanced Search keine Einschränkung online verfügbarer Dissertationen zulässt, passt dann ebenfalls ins Bild.
Zu seriösen Dissertationssuchmaschinen siehe
http://ref-notes.blogspot.com/
http://www.prweb.com/releases/2010/01/prweb3523094.htm
Wenn die suchbaren Metadaten so aussehen:
rhBMP-2 zur Knochenaugmentation bei transgingivaler Implantateinheilung
by
Abstract (Summary)
Bibliographical Information:
Advisor:
School:Fachhochschule Aachen
School Location:Germany
Source Type:Master's Thesis
Keywords:
ISBN:
Date of Publication:
also noch nicht einmal den Namen des Autors oder eine Datenquelle enthalten, ist das Urteil über dieses neue Projekt schon gesprochen.
Dass "All rights reserved" unten steht und die Advanced Search keine Einschränkung online verfügbarer Dissertationen zulässt, passt dann ebenfalls ins Bild.
Zu seriösen Dissertationssuchmaschinen siehe
http://ref-notes.blogspot.com/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Zwei wertvolle Handschriften des Theologen Albertus Magnus aus dem 13. Jahrhundert sind restauriert worden. Sie waren beim Einsturz des Kölner Stadtarchivs vor elf Monaten schwer beschädigt worden. Es handelt sich um einen Kommentar zum Matthäus-Evangelium und ein einzigartiges wissenschaftliches Werk über die Tierwelt. Die Dokumente konnten mit Spendengeld gereinigt und repariert werden....."(1)
"... Die Autographen aus dem 13. Jahrhundert wur den mit Pinseln und Schwämmchen Pergamentseite für Pergamentseite von Staub und Schmutz befreit.
Die beschädigten Einbände konnten repariert werden, teilte die Leiterin des Historischen Stadtarchivs, Bettina Schmidt-Czaia, am Donnerstag mit. Der gefährliche alkalische Baustaub stecke in allen verschütteten Archivalien. "('2)
Ergänzung 05.02.2010:
" .... .Mit 3000 Euro waren die Restaurierungskosten relativ gering. Die Kosten für diese und weitere Restaurierungsarbeiten hatten die Paten Dirk Rodekirchen, Wolfgang Schönenberg, Gertrud Schröter, Albert Hopmann, Wolfgang Dahl im Namen des Bank-Verlags, Hans-Dieter Krebs, Peter Schmitz und Kornelia Reinhard-Schmitz sowie die Johannis-Freimaurerloge „Albertus Magnus“ übernommen. Insgesamt gibt es derzeit 20 Paten, die 30 000 Euro für Restaurierungsarbeiten zur Verfügung gestellt haben. ...."(3)
Quellen:
(1) WDR.de Kulturnachrichten
(2) WDR Videotext, S. 147 (4.2.2010)
(3) Kölner Stadtanzeiger, 5.2.2010
"... Die Autographen aus dem 13. Jahrhundert wur den mit Pinseln und Schwämmchen Pergamentseite für Pergamentseite von Staub und Schmutz befreit.
Die beschädigten Einbände konnten repariert werden, teilte die Leiterin des Historischen Stadtarchivs, Bettina Schmidt-Czaia, am Donnerstag mit. Der gefährliche alkalische Baustaub stecke in allen verschütteten Archivalien. "('2)
Ergänzung 05.02.2010:
" .... .Mit 3000 Euro waren die Restaurierungskosten relativ gering. Die Kosten für diese und weitere Restaurierungsarbeiten hatten die Paten Dirk Rodekirchen, Wolfgang Schönenberg, Gertrud Schröter, Albert Hopmann, Wolfgang Dahl im Namen des Bank-Verlags, Hans-Dieter Krebs, Peter Schmitz und Kornelia Reinhard-Schmitz sowie die Johannis-Freimaurerloge „Albertus Magnus“ übernommen. Insgesamt gibt es derzeit 20 Paten, die 30 000 Euro für Restaurierungsarbeiten zur Verfügung gestellt haben. ...."(3)
Quellen:
(1) WDR.de Kulturnachrichten
(2) WDR Videotext, S. 147 (4.2.2010)
(3) Kölner Stadtanzeiger, 5.2.2010
Wolf Thomas - am Donnerstag, 4. Februar 2010, 20:10 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nutze ich so gut wie nie.
Zu Federico Borromeo gibt es einen neuen Aufsatz aus dem Jahr 2009:
http://www.google.de/search?hl=de&num=100&q=federico+borromeo+%2Bhelmstutler&btnG=Suche&meta=&aq=f&oq=
Ingenta Connect hat den Aufsatz und noch 3 andere zu Federico Borromeo:
http://www.ingentaconnect.com
http://www4.infotrieve.com/search/databases/newsearch.asp
hat ihn nicht und nur einen einzigen Artikel zu Federico Borromeo.
http://www.scirus.com
hat den Aufsatz zwar (Platz 4), aber nicht bei der Sucheinschränkung articles!
http://scholar.google.com
hat den Aufsatz und noch einen weiteren mit Federico Borromeo im Titel
KVK hat den Aufsatz via BASE.
http://www.worldcat.org hat den Aufsatz nicht, aber 47 andere Aufsätze.
Da Borromeo ein Kunstmäzen war, liegt es nahe, den kunsthistorischen Verbundkatalog zu befragen:
http://artlibraries.net/index_de.php
Hier ist er sowohl über OLC-SSG als auch den Fachverbund Florenz-München-ROM präsent.
Jedenfalls für Studierende. die ein möglichst überschaubares Werkzeug brauchen, erscheint mir der Hinweis auf fachübergreifende Artikeldatenbanken wie Ingenta oder Infotrieve entbehrlich. Es genügt, wenn sie mit dem KVK, Google Scholar/BASE und Worldcat umgehen können.
Zu Federico Borromeo gibt es einen neuen Aufsatz aus dem Jahr 2009:
http://www.google.de/search?hl=de&num=100&q=federico+borromeo+%2Bhelmstutler&btnG=Suche&meta=&aq=f&oq=
Ingenta Connect hat den Aufsatz und noch 3 andere zu Federico Borromeo:
http://www.ingentaconnect.com
http://www4.infotrieve.com/search/databases/newsearch.asp
hat ihn nicht und nur einen einzigen Artikel zu Federico Borromeo.
http://www.scirus.com
hat den Aufsatz zwar (Platz 4), aber nicht bei der Sucheinschränkung articles!
http://scholar.google.com
hat den Aufsatz und noch einen weiteren mit Federico Borromeo im Titel
KVK hat den Aufsatz via BASE.
http://www.worldcat.org hat den Aufsatz nicht, aber 47 andere Aufsätze.
Da Borromeo ein Kunstmäzen war, liegt es nahe, den kunsthistorischen Verbundkatalog zu befragen:
http://artlibraries.net/index_de.php
Hier ist er sowohl über OLC-SSG als auch den Fachverbund Florenz-München-ROM präsent.
Jedenfalls für Studierende. die ein möglichst überschaubares Werkzeug brauchen, erscheint mir der Hinweis auf fachübergreifende Artikeldatenbanken wie Ingenta oder Infotrieve entbehrlich. Es genügt, wenn sie mit dem KVK, Google Scholar/BASE und Worldcat umgehen können.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://lotse.uni-muenster.de
Murks!
Beispiel: Thematische Literatursuche
http://lotse.uni-muenster.de/fachuebergreifend/literatur_suchen/suchstrategien/thematische_literatursuche-de.php
Stand: 2002!
Beispiel:
http://lotse.uni-muenster.de/fachuebergreifend/literatur_suchen/bibliographien/fachuebergreifende_aufsatzbibliographien-de.php?page=1
Es fehlt die zentrale Information, dass GVK-PLUS nur im Hochschulnetz verfügbar ist!
Google Scholar fehlt.
Siehe auch: http://archiv.twoday.net/stories/6173216/
Beispiel:
http://lotse.uni-muenster.de/fachuebergreifend/literatur_suchen/bibliographien/landeskundliche_bibliographien-de.php?page=1
Wieso unter den drei Titeln ausgerechnet die Steirische Bibliographie ist, zu deren Benutzung man vor Ort sein muss, ist unverständlich.
Der Link zu
http://titan.bsz-bw.de/cms/recherche/links/fabio/fabioLAN.html#Landeskunde
erscheint mir ziemlich sinnfrei.
Beispiel:
http://lotse.uni-muenster.de/fachuebergreifend/literatur_suchen/kataloge/elektronische_buecher-de.php?page=2
Dass BASE der Karlsruher Virtuelle Volltextangebot ist, wird die Bielefelder wundern
Der OAIster-Link ist überholt.
Der Link zu http://www.hki.uni-koeln.de/retrodig/ ist veraltet
Der Link nach Berlin ist veraltet, gemeint ist wohl
http://www.ub.fu-berlin.de/service_neu/internetquellen/literatur/volltexte.html
Besser wäre:
http://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen
usw.
Murks!
Beispiel: Thematische Literatursuche
http://lotse.uni-muenster.de/fachuebergreifend/literatur_suchen/suchstrategien/thematische_literatursuche-de.php
Stand: 2002!
Beispiel:
http://lotse.uni-muenster.de/fachuebergreifend/literatur_suchen/bibliographien/fachuebergreifende_aufsatzbibliographien-de.php?page=1
Es fehlt die zentrale Information, dass GVK-PLUS nur im Hochschulnetz verfügbar ist!
Google Scholar fehlt.
Siehe auch: http://archiv.twoday.net/stories/6173216/
Beispiel:
http://lotse.uni-muenster.de/fachuebergreifend/literatur_suchen/bibliographien/landeskundliche_bibliographien-de.php?page=1
Wieso unter den drei Titeln ausgerechnet die Steirische Bibliographie ist, zu deren Benutzung man vor Ort sein muss, ist unverständlich.
Der Link zu
http://titan.bsz-bw.de/cms/recherche/links/fabio/fabioLAN.html#Landeskunde
erscheint mir ziemlich sinnfrei.
Beispiel:
http://lotse.uni-muenster.de/fachuebergreifend/literatur_suchen/kataloge/elektronische_buecher-de.php?page=2
Dass BASE der Karlsruher Virtuelle Volltextangebot ist, wird die Bielefelder wundern
Der OAIster-Link ist überholt.
Der Link zu http://www.hki.uni-koeln.de/retrodig/ ist veraltet
Der Link nach Berlin ist veraltet, gemeint ist wohl
http://www.ub.fu-berlin.de/service_neu/internetquellen/literatur/volltexte.html
Besser wäre:
http://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen
usw.
Swisstopo und andere Organisationen haben eine Ethik-Charta unterzeichnet, aber auf der rechts angegebenen Website der Charte finde ich keinen Text des Dokuments, nur eine Imagebroschüre. Das ist ja wohl ein Witz, eine verpflichtende Charta, die nur den Beteiligten gegen Entgelt oder Beitritt zugänglich ist.
http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&msg-id=31504
Update: PDF der Charta
http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&msg-id=31504
Update: PDF der Charta
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://poeticeconomics.blogspot.com/2010/01/google-books-settlement-open-access-to.html
"I wonder how many other authors hadn't thought about their chapters being included in Google Books?"
I had thought on it since the first coverage of the Settlement and made a suggestion that authors should make their "inserts" (this is the name of such contributions in the Settlement language) Open Access.
See in English
http://archiv.twoday.net/stories/6074287/
See in German
http://archiv.twoday.net/stories/5598988/#5599382 (2009, March 22)
Rainer Kuhlen speaker of the Urheberrechtsbündnis has spoken with Google on this topic. The Urheberrechtsbündnis is aware of the fact that in most cases German authors are copyright owner of their book chapters (§ 38 UrhG = German Copyright Act).
I think due to publisher's lobbyism there will be only an opt-out for "inserts" in Google Book Search but no an Open Access possibility like in the books case.
Please remember that I was able to make two books of mine free in Google Book Search (in the frame of the "partner" program of Google). I did not send PDFs or books to Google - Google used the scanned books of the library program. I also made the two books free in HathiTrust.
Every author who is rights holder (concerning at least the online rights) can TODAY decide to make its books free in HathiTrust if there are copies in HathiTrust. After some days and few mail exchange and a permission fax they are gratis OPEN ACCESS.
I hope that in the near future all authors which are rights holders will have the same possibility like me to make their scanned books FREE in Google.
For "inserts"/book chapters I have not tried the following: Become a Google Book Search Partner (like me) and send Google offprints or PDFs of your articles. (If you can use publisher's PDF is a question of contract and national law.)
Tired of Harnadian Open Access orthodoxy (mandates, request buttons, IR not Central repositories and the whole other boring shit)? USE GOOGLE AS THE OPEN ACCESS "REPOSITORY" OF YOUR CHOICE!
Update: http://archiv.twoday.net/stories/6185222/
HathiTrust: "we don’t have any way right now to open access to individual chapters or “inserts”."
"I wonder how many other authors hadn't thought about their chapters being included in Google Books?"
I had thought on it since the first coverage of the Settlement and made a suggestion that authors should make their "inserts" (this is the name of such contributions in the Settlement language) Open Access.
See in English
http://archiv.twoday.net/stories/6074287/
See in German
http://archiv.twoday.net/stories/5598988/#5599382 (2009, March 22)
Rainer Kuhlen speaker of the Urheberrechtsbündnis has spoken with Google on this topic. The Urheberrechtsbündnis is aware of the fact that in most cases German authors are copyright owner of their book chapters (§ 38 UrhG = German Copyright Act).
I think due to publisher's lobbyism there will be only an opt-out for "inserts" in Google Book Search but no an Open Access possibility like in the books case.
Please remember that I was able to make two books of mine free in Google Book Search (in the frame of the "partner" program of Google). I did not send PDFs or books to Google - Google used the scanned books of the library program. I also made the two books free in HathiTrust.
Every author who is rights holder (concerning at least the online rights) can TODAY decide to make its books free in HathiTrust if there are copies in HathiTrust. After some days and few mail exchange and a permission fax they are gratis OPEN ACCESS.
I hope that in the near future all authors which are rights holders will have the same possibility like me to make their scanned books FREE in Google.
For "inserts"/book chapters I have not tried the following: Become a Google Book Search Partner (like me) and send Google offprints or PDFs of your articles. (If you can use publisher's PDF is a question of contract and national law.)
Tired of Harnadian Open Access orthodoxy (mandates, request buttons, IR not Central repositories and the whole other boring shit)? USE GOOGLE AS THE OPEN ACCESS "REPOSITORY" OF YOUR CHOICE!
Update: http://archiv.twoday.net/stories/6185222/
HathiTrust: "we don’t have any way right now to open access to individual chapters or “inserts”."
KlausGraf - am Mittwoch, 3. Februar 2010, 21:29 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 3. Februar 2010, 21:15 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 3. Februar 2010, 20:56 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 3. Februar 2010, 20:50 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 3. Februar 2010, 20:48 - Rubrik: Staatsarchive
http://www.indicommons.org/2010/02/01/welcome-the-u-s-national-archives-to-the-commons/
http://www.flickr.com/photos/usnationalarchives/
 http://www.flickr.com/photos/usnationalarchives/3874714878/in/set-72157622070929269/
http://www.flickr.com/photos/usnationalarchives/3874714878/in/set-72157622070929269/
http://www.flickr.com/photos/usnationalarchives/
 http://www.flickr.com/photos/usnationalarchives/3874714878/in/set-72157622070929269/
http://www.flickr.com/photos/usnationalarchives/3874714878/in/set-72157622070929269/KlausGraf - am Mittwoch, 3. Februar 2010, 20:28 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 3. Februar 2010, 20:15 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Gerne komme ich dieser Bitte von Werner Weigold, Stadtverwaltung Hof Sachgebiet Organisation, nach:
" .... im Auftrag von Herrn Oberbürgermeister Dr. Fichtner danke ich für Ihre Mitteilung bzgl. des Benützungsverbotes von Notebooks im Archiv der Stadt Hof.
Für den Bereich der Stadt Hof ist am 1.1.2010 eine neue Allgemeine Geschäftsordnung (AGA) in Kraft getreten, die den Geschäftsablauf, den allgemeinen Dienstbetrieb und das Verhalten der städtischen Bediensteten regelt.
Besondere Dienst- oder Geschäftsanweisungen, wie z.B. die Benutzungsordnung für das das Stadtarchiv Hof, werden durch die neue AGA nicht aufgehoben. Für die Benützung des Stadtarchivs Hof durch Besucher gilt also nach wie vor die o.g. Benutzungsordnung. Die Archivleitung wurde von Herrn Oberbürgermeister Dr. Fichtner aufgrund Ihres Schreibens zwischenzeitlich angewiesen, den missverständlichen Aushang (Ziffer. 3.9.2. Abs. 5 der AGA) aus dem Schaukasten des Archivs zu entfernen und wie seither zu verfahren.
Wir bitten Sie, Ihren Hinweis im Weblog „Archivalia“ entsprechend zu ändern und danken nochmals für Ihre Aufmerksamkeit."
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/6117530/
" .... im Auftrag von Herrn Oberbürgermeister Dr. Fichtner danke ich für Ihre Mitteilung bzgl. des Benützungsverbotes von Notebooks im Archiv der Stadt Hof.
Für den Bereich der Stadt Hof ist am 1.1.2010 eine neue Allgemeine Geschäftsordnung (AGA) in Kraft getreten, die den Geschäftsablauf, den allgemeinen Dienstbetrieb und das Verhalten der städtischen Bediensteten regelt.
Besondere Dienst- oder Geschäftsanweisungen, wie z.B. die Benutzungsordnung für das das Stadtarchiv Hof, werden durch die neue AGA nicht aufgehoben. Für die Benützung des Stadtarchivs Hof durch Besucher gilt also nach wie vor die o.g. Benutzungsordnung. Die Archivleitung wurde von Herrn Oberbürgermeister Dr. Fichtner aufgrund Ihres Schreibens zwischenzeitlich angewiesen, den missverständlichen Aushang (Ziffer. 3.9.2. Abs. 5 der AGA) aus dem Schaukasten des Archivs zu entfernen und wie seither zu verfahren.
Wir bitten Sie, Ihren Hinweis im Weblog „Archivalia“ entsprechend zu ändern und danken nochmals für Ihre Aufmerksamkeit."
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/6117530/
Wolf Thomas - am Mittwoch, 3. Februar 2010, 19:12 - Rubrik: Kommunalarchive
In einen früheren Beitrag wurde schon einmal über die Editionsabfrage verschiedener Bibliotheken bei Google Books berichtet. Dies ist jetzt auch für München möglich.
Ich habe mal eine laufende Abfrage für 100 Nummern gemacht und war sehr überrascht welche Bücher alles schon digitalisiert wurden, aber teilweise bei Google Books noch nicht online sind.
Beispiel:
editions:BSBBSB10000807 Johann Heinrich von Falckenstein Antiquitates et moralia Marchiae Brandenburgicae
Ich habe mal eine laufende Abfrage für 100 Nummern gemacht und war sehr überrascht welche Bücher alles schon digitalisiert wurden, aber teilweise bei Google Books noch nicht online sind.
Beispiel:
editions:BSBBSB10000807 Johann Heinrich von Falckenstein Antiquitates et moralia Marchiae Brandenburgicae
Fregu - am Mittwoch, 3. Februar 2010, 17:34 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Hallo Klaus,
MyHeritage hat das größte deutsche Familiennertzwerk verwandt.de gekauft. Somit wird die Seite nun zum weltweit größten Familiennetzwerk für Ahnenforschung und Familienstammbäume im Internet. Auch Techrunch hat schon berichtet: http://tcrn.ch/verwandt
Unsere Pressemitteilung kannst du hier finden: http://www.businesswire.com/news/home/20100202007404/de/
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Schöne Grüße
Silvia da Silva
Country Manager Germany
Tel.: +49 40 181 928 57
MyHeritage hat das größte deutsche Familiennertzwerk verwandt.de gekauft. Somit wird die Seite nun zum weltweit größten Familiennetzwerk für Ahnenforschung und Familienstammbäume im Internet. Auch Techrunch hat schon berichtet: http://tcrn.ch/verwandt
Unsere Pressemitteilung kannst du hier finden: http://www.businesswire.com/news/home/20100202007404/de/
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Schöne Grüße
Silvia da Silva
Country Manager Germany
Tel.: +49 40 181 928 57
KlausGraf - am Mittwoch, 3. Februar 2010, 14:48 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Liste der an die 160 Bände (zuzüglich einige Indexbände):
http://de.wikisource.org/wiki/%C3%96sterreichische_Akademie_der_Wissenschaften
Danke an Paulis!
http://de.wikisource.org/wiki/%C3%96sterreichische_Akademie_der_Wissenschaften
Danke an Paulis!
KlausGraf - am Mittwoch, 3. Februar 2010, 14:10 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
You may sign the petition online by following this link:
http://www.petitiononline.com/spkcl10/petition.html

http://www.petitiononline.com/spkcl10/petition.html

KlausGraf - am Mittwoch, 3. Februar 2010, 14:00 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://geschichtsweberei.blogspot.com/2010/02/nationallizenzen-suchkiste.html meldet, dass
http://finden.nationallizenzen.de/
offiziell am Netz sei. Schön ist das Angebot sicher nicht, vor allem völlig Bug-übersät (jedenfalls benutzt mit Chrome).
http://finden.nationallizenzen.de/
offiziell am Netz sei. Schön ist das Angebot sicher nicht, vor allem völlig Bug-übersät (jedenfalls benutzt mit Chrome).
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Members of the Caribbean Archives Association (CARBICA) wish to express their heart-felt sympathy and solidarity with their colleagues and their families, and the Haitian people.
CARBICA, of which the National Archives of Haiti is a member, stands ready to help its fellow archivists to conduct damage assessments to establish the state of records and archives at the National Archives, government ministries and other allied institutions, as well as their eventual salvage and conservation.
Concerned that the compromise of vital records and archives would mean a compromise of good governance and national memory, members of CARBICA are invited to continue to make pledges towards a pool of resources for the salvage and preservation of vital records and archives. As part of the regional effort, members are asked to communicate to CARBICA any other initiatives they or their countries are making in that regard.
CARBICA is resolved to collaborate with the International Council on Archives, Blue Shield, and other allied organizations and NGOs working in Haiti, in order to lend support and aid that is practical, appropriate, and productive according to the priorities expected to be identified by the recently formed Haitian crisis unit “Patrimony in danger”."
"The Caribbean Archives Taskforce for Disaster Preparedness (CARTAS) is the initiative of the Caribbean Archives Association (CARBICA) to co-ordinate CARBICA's response to disasters affecting its membership."
Link: http://cartas-carbica.blogspot.com/2010/02/carbica-statement-on-records-and.html
CARBICA, of which the National Archives of Haiti is a member, stands ready to help its fellow archivists to conduct damage assessments to establish the state of records and archives at the National Archives, government ministries and other allied institutions, as well as their eventual salvage and conservation.
Concerned that the compromise of vital records and archives would mean a compromise of good governance and national memory, members of CARBICA are invited to continue to make pledges towards a pool of resources for the salvage and preservation of vital records and archives. As part of the regional effort, members are asked to communicate to CARBICA any other initiatives they or their countries are making in that regard.
CARBICA is resolved to collaborate with the International Council on Archives, Blue Shield, and other allied organizations and NGOs working in Haiti, in order to lend support and aid that is practical, appropriate, and productive according to the priorities expected to be identified by the recently formed Haitian crisis unit “Patrimony in danger”."
"The Caribbean Archives Taskforce for Disaster Preparedness (CARTAS) is the initiative of the Caribbean Archives Association (CARBICA) to co-ordinate CARBICA's response to disasters affecting its membership."
Link: http://cartas-carbica.blogspot.com/2010/02/carbica-statement-on-records-and.html
Wolf Thomas - am Dienstag, 2. Februar 2010, 12:11 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.epd.de/niedersachsen_bremen/niedersachsen_bremen_index_71305.html
Update zu: http://archiv.twoday.net/search?q=jalb+emden
Update zu: http://archiv.twoday.net/search?q=jalb+emden
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nach Angaben der Landtagsverwaltung verlief die Anhörung sehr zufriedenstellend. Die abschließende Beratung des Archivgesetzes im Kulturausschuss wird in der Sitzung am 24. Februar 2010 erfolgen. Im Landtagsplenum wird das Archivgesetz am 10. oder 11. März 2010 behandelt werden.
An dieser Stelle möchte ich mich bei der zuständigen Ausschussassitentin herzlich für die freundlichen und schnellen E-Mail-Auskünfte bedanken!
An dieser Stelle möchte ich mich bei der zuständigen Ausschussassitentin herzlich für die freundlichen und schnellen E-Mail-Auskünfte bedanken!
Wolf Thomas - am Dienstag, 2. Februar 2010, 06:58 - Rubrik: Archivrecht
http://mediatheques.grand-dole.fr/
Auch hier war Falk Eisermann der Hinweisgeber. Im Gegensatz zu Schlettstadt ein reines Vergnügen, wenngleich man sich in Sachen Navigation schon ein wenig einarbeiten sollte. Man wird dann mit über 50 Inkunabeln belohnt und wie in Troyes gibt es Zoomify. Die Auflösung ist gut.
KlausGraf - am Montag, 1. Februar 2010, 22:48 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.ville-selestat.fr/bh/index.php?page=accueil
Danke an Falk Eisermann für den Hinweis. Die Pretiosen, unter anderem eine deutschsprachige Handschrift Ottos von Passau und einige deutschsprachige Geiler-Drucke, werden in einem schwerfälligen Viewer präsentiert, die Flashversion funktioniert nicht immer, ein Browsen ist nur über die Menüs der erweiterten Suche möglich. Am besten öffnet man die Seiten in einem neuen Fenster in brauchbarer Qualität, denn die Lupenfunktion ist für die Lektüre nicht wirklich geeignet. Die Digitale Bibliothek ist recht reichhaltig, aber die Benutzerfreundlichkeit lässt arg zu wünschen übrig.
Hier die Liste der Geiler-Werke:
Fragmenta passionis domini nostri Jesu christi. (1511)
Navicula sive speculum fatuorum (1511)
Das Evangelibuch. (Postill) Das buoch der Evangelien durch das gantz iar. Mitt Predig und ußlegungen durch den wirdigen hochgelerten Doctor Johannes Geiler von Keisersberg der Zeit Predicant in dem hohen Stifft der kerserlichen freien stat Straßburg/ die er in seinen fier letzten Jahren gepredigt hat. (1515)
Ein heilsam Kostlische Predig Doctor iohans geiler von Keisersberg predicanten und loblichen stat Straßburg : die er zuo bischoff Albrechten von Straßburg und andern erwirdigen prelaten, und seiner gantzen Ersamen priesterschafft vor zeiten gethon hat ... (1513)
Sermones (1519) du recueil : «Recueil d'oeuvres diverses»
Sermones et varii Tractatus Keiserspergii. Jam recens excusi : quorum indicem versa. (1518) du recueil : «Recueil d'oeuvres diverses»
Ain gaistliche bedeutung des Aussgangs der kinder Israhel von Egipto. (1510)
Das Schiff der Penitentz und buß würckung : gepredigt in dem hohen Stifft, in unser lieben frauwen münster zu Stroßburg… (1514)
Danke an Falk Eisermann für den Hinweis. Die Pretiosen, unter anderem eine deutschsprachige Handschrift Ottos von Passau und einige deutschsprachige Geiler-Drucke, werden in einem schwerfälligen Viewer präsentiert, die Flashversion funktioniert nicht immer, ein Browsen ist nur über die Menüs der erweiterten Suche möglich. Am besten öffnet man die Seiten in einem neuen Fenster in brauchbarer Qualität, denn die Lupenfunktion ist für die Lektüre nicht wirklich geeignet. Die Digitale Bibliothek ist recht reichhaltig, aber die Benutzerfreundlichkeit lässt arg zu wünschen übrig.
Hier die Liste der Geiler-Werke:
Fragmenta passionis domini nostri Jesu christi. (1511)
Navicula sive speculum fatuorum (1511)
Das Evangelibuch. (Postill) Das buoch der Evangelien durch das gantz iar. Mitt Predig und ußlegungen durch den wirdigen hochgelerten Doctor Johannes Geiler von Keisersberg der Zeit Predicant in dem hohen Stifft der kerserlichen freien stat Straßburg/ die er in seinen fier letzten Jahren gepredigt hat. (1515)
Ein heilsam Kostlische Predig Doctor iohans geiler von Keisersberg predicanten und loblichen stat Straßburg : die er zuo bischoff Albrechten von Straßburg und andern erwirdigen prelaten, und seiner gantzen Ersamen priesterschafft vor zeiten gethon hat ... (1513)
Sermones (1519) du recueil : «Recueil d'oeuvres diverses»
Sermones et varii Tractatus Keiserspergii. Jam recens excusi : quorum indicem versa. (1518) du recueil : «Recueil d'oeuvres diverses»
Ain gaistliche bedeutung des Aussgangs der kinder Israhel von Egipto. (1510)
Das Schiff der Penitentz und buß würckung : gepredigt in dem hohen Stifft, in unser lieben frauwen münster zu Stroßburg… (1514)
KlausGraf - am Montag, 1. Februar 2010, 22:33 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Durch eine Mitteilung in der Genealogischen Brandenburgliste wurde ich auf die Linksammlung des Österreichischen Landesmuseum in Linz aufmerksam. Die Veröffentlichung betrifft hauptsächlich die Naturwissenschaften, aber es gibt dabei auch einen Scan der für die Militärgeschichtler und Genealogen interessant ist.
Dies sind die Gefallenenlisten der 45 Division.
Dies sind die Gefallenenlisten der 45 Division.
Fregu - am Montag, 1. Februar 2010, 17:56 - Rubrik: Museumswesen
INFORMATIONBESCHAFFUNG
Das ICOM Sekretariat in Paris und der ICOM Krisenstab (Disaster Relief Task Force / DRTF) haben rasch auf das Erbeben in Haiti reagiert und in den letzten Wochen intensiv zum Schicksal der Museumskollegen,Museen und Sammlungen recherchiert. Im Zuge dieser Ermittlungen wurden selbstverständlich auch Informationen zu anderen Kultureinrichtungen zusammengetragen. Wie alle anderen NGO’s standen wir dabei vor ungewöhnlich großen Schwierigkeiten. Sehr geholfen hat uns, dass es im anderen Teil der Insel Hispaniola das sehr aktive ICOM Nationalkomitee der Dominikanischen Republik gibt. DRTF hat zunächst eine Liste aller Museen in der Erdbebenregion zusammenstellt: 3 etablierte Museen, 6 Museumsprojekte mit wichtigen Sammlungen und 4 Museumsprojekte ohne Sammlungen. Auf dieser Basis wurden dann die Satellitenaufnahmen vor und nach dem Erdbeben analysiert, um einen groben Eindruck zu gewinnen. Die Erkenntnisse wurden mit einer täglich aktualisierten Suchliste („watch list“) im BLUE SHIELD Netzwerk kommuniziert.
Inzwischen hat ICOM direkten Kontakt zu mehreren Museumskollegen in Haiti. Letzten Freitag konnte der erste Bericht veröffentlicht werden: http://icom.museum/icbs-press/100121_haiti_damages_statement_UK.pdf
SCHÄDEN AN KULTUREINRICHTUNGEN
Am 16. Januar hat UNOSAT eine Analyse von 110 wichtigen öffentlichen Gebäude in Port-au-Prince ins Internet gestellt – mehr als die Hälfte davon sind zerstört oder beschädigt!
http://unosat-maps.web.cern.ch/unosat-maps/HT/EQ20100114HTI/UNOSAT_HTI_= EQ2010_BldDamages_v1_LR.pdf
Am 24. Januar veröffentlichte die “New York Times” einen Arti kel von Marc Lacey über “Cultural Riches Turn to Rubble in Haiti Quake”. http://www.nytimes.com/2010/01/24/world/americas/24heritage.html
Auf der Basis meiner persönlichen Einschätzung möchte ich einen ersten Überblick versuchen:
1) Am härtesten wurden die Baudenkmale getroffen, berühmte Gebäude in der Hauptstadt wie auch denkmalgeschützte Quartiere in kleineren Städten, z.B. der Hafenstadt Jacmel.
2) Viele Bibliotheken von Schulen und Hochschulen sind eingestürzt. Vier Bibliotheken verfügen über wertvolle alte Bestände: Saint Martial wurde zerstört; die Nationalbibliothek, die Bibliothek der Staatlichen Universität und die Gonzaga Bibliothek (Frère de Saint-Louis de Gonzague / F.I.C.) sind nicht eingestürzt, aber schwer beschädigt und kaum zugänglich.
Der Verlust dieses Kulturguts hängt völlig davon ab, wie schnell es gelingt, die Gebäude zu stabilisieren und die Sammlungen zu bergen.
3) Das Hauptgebäude des Nationalarchivs scheint in Ordnung zu sein, aber über dessen zweites Gebäude gibt es noch keine Informationen. Das Hauptproblem besteht darin, dass noch viele Alt-Registraturen in den Ministerien und Behörden liegen, deren Gebäude völlig eingestürzt sind. Die Regierung drängt auf rasche Beräumung der Ruinen und die Archivare klagen, dass sie kaum eine Chance auf Bergung dieser wertvollen Archive haben.
4) Von den beiden klassischen Museen ist das Nationalmuseum kaum beschädigt, das Gebäude des Kunstmuseums in instabilem Zustand (Siehe ICOM Bericht und die untenstehenden Links.) Aber mehrere Galerien und Kunstzentren sind eingestürzt oder schwer beschädigt, z.B. „Musée d’art George S. Nader“, "Centre d’Art Haitien", "Fondation Culture et Creation et Fondation Tiga".
Musée du Panthéon National Haïtien, Port au Prince
http://www.facebook.com/photo_search.php?oid=247281734340&view=all#/photo.php?pid=116883&op=1&o=all&view=all&subj=247281734340&aid=-1&oid=247281734340&id=100000514369339&fbid=104361802924298
Musée d’art haïtien, Port au Prince
http://www.facebook.com/photo_search.php?oid=247281734340&view=all#/photo.php?pid=127210&op=1&o=all&view=all&subj=247281734340&aid=-1&oid=247281734340&id=100000514369339
[Musée Vaudou] Collection Marianne Lehmann, Pétion-Ville
Interview mit Marianne Lehmann im Schweizer Fernsehen am 17 Januar: http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=500000&bcid=730313#vid=11727423
WAS DRINGEND NÖTIG IST ...
… für das Kulturgut allgemein:
Alle Beteiligten müssen auch den Schaden an Kulturgütern ernst nehmen:
- Regierung und Behörden in Haiti,
- die in Haiti operierenden einheimischen und ausländischen Sicherheitskräfte,
- die internationale Gemeinschaft.
Das Problem: Die Medien der westlichen Welt nehmen Haiti nur als “Armenhaus”, als „Bürgerkriegsland“ und als „zerrütteten Staat“ wahr. Längst ist vergessen, dass Haiti vom 16. bis 19. Jahrundert eine der reichsten Kolonien war und als Perle der Karibik galt – und über dementsprechend viele Kulturschätze verfügt.
Außerdem geht es um schnelle Hilfe, denn der größte Feind wird die Regenzeit (Februar/ März) sein.
… für Museen, Archive und Bibliotheken:
Dank repräsentativer und solider Backsteingebäude aus dem 19. und frühen 20. Jh. sind nur zwei Totalverluste zu beklagen. Aber viele sind so fragil, dass eine geordnete Bergung der Sammlungen derzeit nicht möglich ist. Die Regierung hat zwei (!) Architekten beauftragt, die einsturzgefährdeten öffentlichen Gebäude zu begutachten, aber zuerst die Krankenhäuser und andere wichtige Infrastruktur. Deshalb bitten unsere Kollegen in Haiti dringend um ausländische Architekten und Statiker, die in der Lage sind, ohne Baupläne und Computer die Stabilität einzuschätzen, Sicherungsmaßnahmen vorzuschlagen und zu überwachen und unnötigen Abriss zu verhindern.
Ebenso dringend sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, da die normalen Systeme (Gebäude, Elektronik, Personal) nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sind.
… für Baudenkmale:
Die Denkmalpfleger in Haiti sind sehr besorgt wegen der zügigen Beräumung der Straßen von Schutt im Bereich von Baudenkmalen. Die Bulldozer schaffen so eine zweite Welle von Zerstörung, die eine künftige fachgerechte Rekonstruktion fast unmöglich macht. Ein angesehener Kollege von ICOMOS mahnte: „Hört auf mit der Dauerklage ‘Alles ist zerstört’ und konzentriert euch darauf, die beschädigten Monumente von Beräumung und Abbruch zu schützen!“
VORBEREITUNG FÜR HILFSAKTIONEN
Auf Initiative von ICOM Haiti wurde der Krisenstab "Patrimoine en Danger“ gegründet, geleitet von Lewis A. Clormeus (Kulturministerium). Dieses kleine Team soll die Hilfsmaßnahmen koordinieren, Überschneidungen verhindern und für die vordringlichen Schutzmaßnahmen sorgen. Es geht dabei um Kulturgut aller Art, und auch nicht nur um die etablierten öffentlichen Einrichtungen, denn in Haiti liegen wertvolle Bestände in Ministerien (z.B. das gesamte Archiv für Außenpolitik!) oder in Privathäusern von Sammlern.
Das Team hat eine erste Objektliste erstellt. Für die erste Aktion wurde die „Generaldirektion der Staatlichen Archive“ ausgewählt.
In den nächsten Tagen wird das ICOM Secretariat (Kontakt: Stanislas Tarnowski) und DRTF (Kontakt: Thomas Schuler) über die schnellsten und effizientesten Wege der ersten Hilfeleistung entscheiden - durch ein Expertenteam (allein oder mit Partnern) und/oder mit Geld (DRFM Fund, Unterstützungsaufruf).
ICA (Kontakt: Christophe Jacobs) und IFLA (Kontakt: Danielle Mincio) arbeiten ebenfalls sehr intensiv an der Vorbereitung der Unterstützung – durch das internationale Sekretariat, die Komitees und Mitglieder. Gestern hat ICA ein aktuelles Statement veröffentlicht: http://www.ica.org/en/2010/01/27/second-ica-statement-haiti-reconstruction
ICOMOS hat einen Newsletter (E-News #53) publiziert, der die geplanten Aktivitäten beschreibt. Es wurde eine neue Arbeitsgruppe (“ICOMOS Haiti Heritage Recovery Steering Committee”) eingerichtet, die von Dinu Bumbaru, dem früheren ICOMOS Generalsekretär, geleitet wird.
UNESCO plant eine Erkundungsmission für den Februar. Ihr Büro in Haiti steht noch, aber das Schicksal einiger Mitarbeiter ist noch unbekannt. UNESCO will auch mit Militär und Interpol zusammenarbeiten, um den Schutz zu verbessern. Außerdem möchte man sich wegen eines Appells an den UNO Sicherheitsrat wenden.
BLUE SHIELD
Diese Dachorganisation (für Archive, Bibliotheken, Denkmale und Museen) war sehr aktiv und hat – erstmals nach einer Katastrophe – web 2.0 Instrumente eingesetzt.
1) ANCBS agierte von Anfang als Koordinator zwischen den Verbänden (ICA, IFLA, ICOMOS and ICOM).
2) ICBS publizierte ein Statement:
http://ancbs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=103:statement-earthquake-haiti2010&catid=10:statements&Itemid=20
3) ANCBS stellte eine spezielle Website auf Englisch, Französisch und Spanisch ins Internet. Dort können sich Freiwillige online anmelden: "Haiti 2010 Blue Shield Solidarity". http://haiti2010.blueshield-international.org
Über 180 Freiwillige aus aller Welt haben sich schon eingetragen.
Übrigens: Den Anstoß zu dieser Initiative gaben die guten Erfahrungen aus dem Einsatz für das Stadtarchiv Köln. In den beiden „Internationalen Wochen“ waren dort zwei BLUE SHIELD Teams mit mehr als 100 internationalen Fachkräften tätig.
4) Diese Website wird ergänzt durch die Facebook Gruppe "Haiti 2010 Blue Shield Solidarity" (mit über 650 Mitgliedern). Das ist die derzeit beste Informationsquelle zur Rettung von Kulturgut in Haiti:
http://www.facebook.com/group.php?v=info&gid=247281734340
5) Bei Twitter gibt es "Blueshieldcoop": http://twitter.com/blueshieldcoop.
Dort geht es noch ganz ruhig zu, aber das wird sich ändern – wie das Beispiel Köln gezeigt hat – sobald auswärtige Freiwillige in Haiti im Einsatz sind.
-->> For English translation: see comment #1
Das ICOM Sekretariat in Paris und der ICOM Krisenstab (Disaster Relief Task Force / DRTF) haben rasch auf das Erbeben in Haiti reagiert und in den letzten Wochen intensiv zum Schicksal der Museumskollegen,Museen und Sammlungen recherchiert. Im Zuge dieser Ermittlungen wurden selbstverständlich auch Informationen zu anderen Kultureinrichtungen zusammengetragen. Wie alle anderen NGO’s standen wir dabei vor ungewöhnlich großen Schwierigkeiten. Sehr geholfen hat uns, dass es im anderen Teil der Insel Hispaniola das sehr aktive ICOM Nationalkomitee der Dominikanischen Republik gibt. DRTF hat zunächst eine Liste aller Museen in der Erdbebenregion zusammenstellt: 3 etablierte Museen, 6 Museumsprojekte mit wichtigen Sammlungen und 4 Museumsprojekte ohne Sammlungen. Auf dieser Basis wurden dann die Satellitenaufnahmen vor und nach dem Erdbeben analysiert, um einen groben Eindruck zu gewinnen. Die Erkenntnisse wurden mit einer täglich aktualisierten Suchliste („watch list“) im BLUE SHIELD Netzwerk kommuniziert.
Inzwischen hat ICOM direkten Kontakt zu mehreren Museumskollegen in Haiti. Letzten Freitag konnte der erste Bericht veröffentlicht werden: http://icom.museum/icbs-press/100121_haiti_damages_statement_UK.pdf
SCHÄDEN AN KULTUREINRICHTUNGEN
Am 16. Januar hat UNOSAT eine Analyse von 110 wichtigen öffentlichen Gebäude in Port-au-Prince ins Internet gestellt – mehr als die Hälfte davon sind zerstört oder beschädigt!
http://unosat-maps.web.cern.ch/unosat-maps/HT/EQ20100114HTI/UNOSAT_HTI_= EQ2010_BldDamages_v1_LR.pdf
Am 24. Januar veröffentlichte die “New York Times” einen Arti kel von Marc Lacey über “Cultural Riches Turn to Rubble in Haiti Quake”. http://www.nytimes.com/2010/01/24/world/americas/24heritage.html
Auf der Basis meiner persönlichen Einschätzung möchte ich einen ersten Überblick versuchen:
1) Am härtesten wurden die Baudenkmale getroffen, berühmte Gebäude in der Hauptstadt wie auch denkmalgeschützte Quartiere in kleineren Städten, z.B. der Hafenstadt Jacmel.
2) Viele Bibliotheken von Schulen und Hochschulen sind eingestürzt. Vier Bibliotheken verfügen über wertvolle alte Bestände: Saint Martial wurde zerstört; die Nationalbibliothek, die Bibliothek der Staatlichen Universität und die Gonzaga Bibliothek (Frère de Saint-Louis de Gonzague / F.I.C.) sind nicht eingestürzt, aber schwer beschädigt und kaum zugänglich.
Der Verlust dieses Kulturguts hängt völlig davon ab, wie schnell es gelingt, die Gebäude zu stabilisieren und die Sammlungen zu bergen.
3) Das Hauptgebäude des Nationalarchivs scheint in Ordnung zu sein, aber über dessen zweites Gebäude gibt es noch keine Informationen. Das Hauptproblem besteht darin, dass noch viele Alt-Registraturen in den Ministerien und Behörden liegen, deren Gebäude völlig eingestürzt sind. Die Regierung drängt auf rasche Beräumung der Ruinen und die Archivare klagen, dass sie kaum eine Chance auf Bergung dieser wertvollen Archive haben.
4) Von den beiden klassischen Museen ist das Nationalmuseum kaum beschädigt, das Gebäude des Kunstmuseums in instabilem Zustand (Siehe ICOM Bericht und die untenstehenden Links.) Aber mehrere Galerien und Kunstzentren sind eingestürzt oder schwer beschädigt, z.B. „Musée d’art George S. Nader“, "Centre d’Art Haitien", "Fondation Culture et Creation et Fondation Tiga".
Musée du Panthéon National Haïtien, Port au Prince
http://www.facebook.com/photo_search.php?oid=247281734340&view=all#/photo.php?pid=116883&op=1&o=all&view=all&subj=247281734340&aid=-1&oid=247281734340&id=100000514369339&fbid=104361802924298
Musée d’art haïtien, Port au Prince
http://www.facebook.com/photo_search.php?oid=247281734340&view=all#/photo.php?pid=127210&op=1&o=all&view=all&subj=247281734340&aid=-1&oid=247281734340&id=100000514369339
[Musée Vaudou] Collection Marianne Lehmann, Pétion-Ville
Interview mit Marianne Lehmann im Schweizer Fernsehen am 17 Januar: http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=500000&bcid=730313#vid=11727423
WAS DRINGEND NÖTIG IST ...
… für das Kulturgut allgemein:
Alle Beteiligten müssen auch den Schaden an Kulturgütern ernst nehmen:
- Regierung und Behörden in Haiti,
- die in Haiti operierenden einheimischen und ausländischen Sicherheitskräfte,
- die internationale Gemeinschaft.
Das Problem: Die Medien der westlichen Welt nehmen Haiti nur als “Armenhaus”, als „Bürgerkriegsland“ und als „zerrütteten Staat“ wahr. Längst ist vergessen, dass Haiti vom 16. bis 19. Jahrundert eine der reichsten Kolonien war und als Perle der Karibik galt – und über dementsprechend viele Kulturschätze verfügt.
Außerdem geht es um schnelle Hilfe, denn der größte Feind wird die Regenzeit (Februar/ März) sein.
… für Museen, Archive und Bibliotheken:
Dank repräsentativer und solider Backsteingebäude aus dem 19. und frühen 20. Jh. sind nur zwei Totalverluste zu beklagen. Aber viele sind so fragil, dass eine geordnete Bergung der Sammlungen derzeit nicht möglich ist. Die Regierung hat zwei (!) Architekten beauftragt, die einsturzgefährdeten öffentlichen Gebäude zu begutachten, aber zuerst die Krankenhäuser und andere wichtige Infrastruktur. Deshalb bitten unsere Kollegen in Haiti dringend um ausländische Architekten und Statiker, die in der Lage sind, ohne Baupläne und Computer die Stabilität einzuschätzen, Sicherungsmaßnahmen vorzuschlagen und zu überwachen und unnötigen Abriss zu verhindern.
Ebenso dringend sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, da die normalen Systeme (Gebäude, Elektronik, Personal) nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sind.
… für Baudenkmale:
Die Denkmalpfleger in Haiti sind sehr besorgt wegen der zügigen Beräumung der Straßen von Schutt im Bereich von Baudenkmalen. Die Bulldozer schaffen so eine zweite Welle von Zerstörung, die eine künftige fachgerechte Rekonstruktion fast unmöglich macht. Ein angesehener Kollege von ICOMOS mahnte: „Hört auf mit der Dauerklage ‘Alles ist zerstört’ und konzentriert euch darauf, die beschädigten Monumente von Beräumung und Abbruch zu schützen!“
VORBEREITUNG FÜR HILFSAKTIONEN
Auf Initiative von ICOM Haiti wurde der Krisenstab "Patrimoine en Danger“ gegründet, geleitet von Lewis A. Clormeus (Kulturministerium). Dieses kleine Team soll die Hilfsmaßnahmen koordinieren, Überschneidungen verhindern und für die vordringlichen Schutzmaßnahmen sorgen. Es geht dabei um Kulturgut aller Art, und auch nicht nur um die etablierten öffentlichen Einrichtungen, denn in Haiti liegen wertvolle Bestände in Ministerien (z.B. das gesamte Archiv für Außenpolitik!) oder in Privathäusern von Sammlern.
Das Team hat eine erste Objektliste erstellt. Für die erste Aktion wurde die „Generaldirektion der Staatlichen Archive“ ausgewählt.
In den nächsten Tagen wird das ICOM Secretariat (Kontakt: Stanislas Tarnowski) und DRTF (Kontakt: Thomas Schuler) über die schnellsten und effizientesten Wege der ersten Hilfeleistung entscheiden - durch ein Expertenteam (allein oder mit Partnern) und/oder mit Geld (DRFM Fund, Unterstützungsaufruf).
ICA (Kontakt: Christophe Jacobs) und IFLA (Kontakt: Danielle Mincio) arbeiten ebenfalls sehr intensiv an der Vorbereitung der Unterstützung – durch das internationale Sekretariat, die Komitees und Mitglieder. Gestern hat ICA ein aktuelles Statement veröffentlicht: http://www.ica.org/en/2010/01/27/second-ica-statement-haiti-reconstruction
ICOMOS hat einen Newsletter (E-News #53) publiziert, der die geplanten Aktivitäten beschreibt. Es wurde eine neue Arbeitsgruppe (“ICOMOS Haiti Heritage Recovery Steering Committee”) eingerichtet, die von Dinu Bumbaru, dem früheren ICOMOS Generalsekretär, geleitet wird.
UNESCO plant eine Erkundungsmission für den Februar. Ihr Büro in Haiti steht noch, aber das Schicksal einiger Mitarbeiter ist noch unbekannt. UNESCO will auch mit Militär und Interpol zusammenarbeiten, um den Schutz zu verbessern. Außerdem möchte man sich wegen eines Appells an den UNO Sicherheitsrat wenden.
BLUE SHIELD
Diese Dachorganisation (für Archive, Bibliotheken, Denkmale und Museen) war sehr aktiv und hat – erstmals nach einer Katastrophe – web 2.0 Instrumente eingesetzt.
1) ANCBS agierte von Anfang als Koordinator zwischen den Verbänden (ICA, IFLA, ICOMOS and ICOM).
2) ICBS publizierte ein Statement:
http://ancbs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=103:statement-earthquake-haiti2010&catid=10:statements&Itemid=20
3) ANCBS stellte eine spezielle Website auf Englisch, Französisch und Spanisch ins Internet. Dort können sich Freiwillige online anmelden: "Haiti 2010 Blue Shield Solidarity". http://haiti2010.blueshield-international.org
Über 180 Freiwillige aus aller Welt haben sich schon eingetragen.
Übrigens: Den Anstoß zu dieser Initiative gaben die guten Erfahrungen aus dem Einsatz für das Stadtarchiv Köln. In den beiden „Internationalen Wochen“ waren dort zwei BLUE SHIELD Teams mit mehr als 100 internationalen Fachkräften tätig.
4) Diese Website wird ergänzt durch die Facebook Gruppe "Haiti 2010 Blue Shield Solidarity" (mit über 650 Mitgliedern). Das ist die derzeit beste Informationsquelle zur Rettung von Kulturgut in Haiti:
http://www.facebook.com/group.php?v=info&gid=247281734340
5) Bei Twitter gibt es "Blueshieldcoop": http://twitter.com/blueshieldcoop.
Dort geht es noch ganz ruhig zu, aber das wird sich ändern – wie das Beispiel Köln gezeigt hat – sobald auswärtige Freiwillige in Haiti im Einsatz sind.
-->> For English translation: see comment #1
thomschu - am Montag, 1. Februar 2010, 05:53 - Rubrik: Internationale Aspekte
Googles Buchsuche und die wenig erfreuliche Tatsache, dass riesige Mengen wertvoller Fachliteratur 1870/1910/23 (einschließlich älterer) Nicht-US-Bürgern verborgen bleiben, weil Google sie blockiert, ist einer der "running gags" dieses Weblogs.
http://archiv.twoday.net/search?q=us-proxy
Ein toller Hinweis kam gerade von einem Stephan:
http://archiv.twoday.net/stories/4748288/#6167148
Ich habe http://www.googlesharing.net bzw. das dort verlinkte FF-Addon sofort in meinem wenig genutzten FF installiert und kann bestätigen, dass ein US-Proxy vorliegt, mit dem man die blockierten Bücher einsehen kann und zwar ohne die für Webanonymizer sonst üblichen Einschränkungen. Besonders lästig war in letzter Zeit, dass eine Suche im Buch bei den von mir genutzten Proxy nicht möglich war - Googlesharing verhält sich dagegen wie eine ganz normale Google-Buchsuche. Der Seitenaufbau ist nicht auffällig langsam und vor allem fällt die lästige Werbung weg.
Bei dem Download (den ich eher selten nutze) kann man Pech, aber auch Glück haben. Bei einem ersten Test brach er bei 1,7 MB ab, während bei dem zweiten Versuch der komplette Band der Basler Chroniken Bd. 1 (30 MB) heruntergeladen wurde.
Man klickt einfach rechts unten, wenn man Googlesharing aktivieren oder deaktivieren will. Lädt man bei deaktiviertem Sharing die Buchsuche-Seite neu, sieht man die Schnipsel; aktiviert man wieder die ganze Seite.
Der erste Eindruck ist also schlichtweg großartig, und man kann nur hoffen, dass das Angebot lange in dieser Form besteht.
Update: Sonderlich lange hielt meine Begeisterung nicht an.
http://archiv.twoday.net/stories/6173772/
Problemlösung: Immer google.com, nie google.de verwenden!
Update August 2010: Ich bin bisher mit GoogleSharing sehr zufrieden und nütze es immer zum Browsen in Google.

http://archiv.twoday.net/search?q=us-proxy
Ein toller Hinweis kam gerade von einem Stephan:
http://archiv.twoday.net/stories/4748288/#6167148
Ich habe http://www.googlesharing.net bzw. das dort verlinkte FF-Addon sofort in meinem wenig genutzten FF installiert und kann bestätigen, dass ein US-Proxy vorliegt, mit dem man die blockierten Bücher einsehen kann und zwar ohne die für Webanonymizer sonst üblichen Einschränkungen. Besonders lästig war in letzter Zeit, dass eine Suche im Buch bei den von mir genutzten Proxy nicht möglich war - Googlesharing verhält sich dagegen wie eine ganz normale Google-Buchsuche. Der Seitenaufbau ist nicht auffällig langsam und vor allem fällt die lästige Werbung weg.
Bei dem Download (den ich eher selten nutze) kann man Pech, aber auch Glück haben. Bei einem ersten Test brach er bei 1,7 MB ab, während bei dem zweiten Versuch der komplette Band der Basler Chroniken Bd. 1 (30 MB) heruntergeladen wurde.
Man klickt einfach rechts unten, wenn man Googlesharing aktivieren oder deaktivieren will. Lädt man bei deaktiviertem Sharing die Buchsuche-Seite neu, sieht man die Schnipsel; aktiviert man wieder die ganze Seite.
Der erste Eindruck ist also schlichtweg großartig, und man kann nur hoffen, dass das Angebot lange in dieser Form besteht.
Update: Sonderlich lange hielt meine Begeisterung nicht an.
http://archiv.twoday.net/stories/6173772/
Problemlösung: Immer google.com, nie google.de verwenden!
Update August 2010: Ich bin bisher mit GoogleSharing sehr zufrieden und nütze es immer zum Browsen in Google.

KlausGraf - am Montag, 1. Februar 2010, 01:50 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
http://patrimoine.agglo-troyes.fr
Neben dem Zoomify wird auch eine herunterladbare Großansicht der Seite angeboten. Ein riesiger Bestand liegt bereits digitalisiert vor.

Neben dem Zoomify wird auch eine herunterladbare Großansicht der Seite angeboten. Ein riesiger Bestand liegt bereits digitalisiert vor.

KlausGraf - am Sonntag, 31. Januar 2010, 23:05 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Es geht nicht nur um Lorenz Fries, aber das folgende ist schlimm genug.
http://d-nb.info/gnd/118536028
Straßburger Arzt und Würzburger Sekretär sind definitiv zwei Personen. War wohl wieder die unfähige BSB München, die bei den Straßburger Drucken im VD 16 die falsche PND vergeben hat:
118536028
Der Schaden ist unübersehbar: einer der wichtigsten Landes-Chronisten des 16. Jahrhunderts, bekannt als Lorenz Fries wird mit einem Straßburger Arzt Laurentius Fries, der gedruckte Werke veröffentlichte, in einen Topf geworfen. Das ist schlicht und einfach skandalös und unentschuldbar.
http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Fries,_Lorenz_(Arzt) +ca. 1531
http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Fries,_Lorenz_(Chronist) +1550
http://d-nb.info/gnd/118536028
Straßburger Arzt und Würzburger Sekretär sind definitiv zwei Personen. War wohl wieder die unfähige BSB München, die bei den Straßburger Drucken im VD 16 die falsche PND vergeben hat:
118536028
Der Schaden ist unübersehbar: einer der wichtigsten Landes-Chronisten des 16. Jahrhunderts, bekannt als Lorenz Fries wird mit einem Straßburger Arzt Laurentius Fries, der gedruckte Werke veröffentlichte, in einen Topf geworfen. Das ist schlicht und einfach skandalös und unentschuldbar.
http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Fries,_Lorenz_(Arzt) +ca. 1531
http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Fries,_Lorenz_(Chronist) +1550
Aus den FAQ des Hilty-Gutachtens
http://www.oai.uzh.ch/index.php?option=content&task=view&id=444&Itemid=323#A1
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/6166799/
10. Darf der Autor seine Werke in einem Repositorium geschlossen hinterlegen und sie von aussen abfragbar machen, indem er „request a copy“-Anfragen einzeln beantwortet und das Werk individuell verschickt?
Die „request a copy“-Funktion unterscheidet sich von der normalen Hinterlegung insbesondere dadurch, dass das Werk nicht ohne weiteres allgemein zugänglich gemacht wird.
Soweit zwischen Autor und Verlag keine vertraglichen Vereinbarungen bestehen und das Gesetzesrecht zur Anwendung kommt (Art. 380 ff. OR, Frage 16), spielt der Unterscheid zwischen „request a copy“-Funktion und normaler Hinterlegung keine praktisch relevante Rolle. Das heisst, die gesetzlichen Bestimmungen gelten auch für die „request a copy“-Funktion.
Im Falle eines Verlagsvertrags zwischen Autor und Verlag gelten die dort formulierten Vereinbarungen. Soweit der Autor dem Verlag das Vervielfältigungs- und das Verbreitungsrecht übertragen oder ihm eine ausschliessliche Lizenz daran eingeräumt hat, ist er grundsätzlich nicht mehr zum Versenden des Werks per „request a copy“-Funktion berechtigt. Die „request a copy“-Funktion ist jedoch – anders als die normale Hinterlegung – dann zulässig und nützlich, wenn der Verlagsvertrag die Verbreitung des Werks nur an einen beschränkten Personenkreis erlaubt, und dies wird in vielen Verlagsverträgen so formuliert. Denn die „request a copy“-Funktion entspricht der Verbreitung in einem solchen Personenkreis.
Bei der Anwendung der „request a copy“-Funktion sind allfällige Urheberrechtsverletzungen grundsätzlich schwieriger zu beweisen als bei einer normalen Hinterlegung, insbesondere weil für einen Aussenstehenden nicht transparent ist, ob die allfällige Urheberrechtsverletzung nur durch den Urheber oder auch durch den Betreiber des Repositoriums erfolgt.
Nach Schweizer Recht kann sich der universitätsweite Zugriff auf elektronische Dokumente in Repositorien, soweit es sich nicht nur vollständige Monographien oder pay-per-view einzeln vertriebene Aufsätze handelt, auf den "betriebsinternen Gebrauch" berufen.
Für Deutschland sehe ich diese Möglichkeit nicht und halte an meinen Ausführungen fest:
http://archiv.twoday.net/stories/5193609/
http://archiv.twoday.net/search?q=request
Auszug:
"Nach deutschem Recht ist bereits die Einstellung einer Vervielfältigung eines Aufsatzes nicht nach § 53 UrhG zu rechtfertigen und damit nicht rechtmäßig. [...]
Nach deutschem Recht kann ein "immediate deposit" in einem Repositorium mit Request-Button nur dann erfolgen, wenn der Verleger kein ausschließliches Nutzungsrecht hat (aber dann wäre auch sofortiger Open Access möglich) oder wenn der Autor sich diese Option in einem Autor-Addendum ausdrücklich vertraglich vorbehalten hat."
Es ist nicht damit zu rechnen, dass die Verlage gegen den Request-Button vorgehen werden. Auch wenn er in den meisten Ländern möglicherweise illegal ist, kann man das aus der Sicht der Praxis ignorieren.
Ich bin aber auch aus anderen Gründen gegen den Request-Button.
1. Ein Instrument, das auf dem Prinzip der Willkür (es ist in das Belieben des Autors gestellt, ob er den Wunsch erfüllt) und damit auf Vorwissen, Vorurteilen oder kontingenten Faktoren wie Semesterstress beruht, kann kein Teil einer Open-Access-Strategie sein.
Der Button macht den Wisssenschaftler zum Bittsteller.
2. Bisherige Erfahrungen (siehe die verlinkten Archivalia-Beiträge) lassen den Schluss zu, dass die Chance auf ein Eprint bei einem direkten Anschreiben des Wissenschaftlers per Mail größer ist. Hat jemand keine Reaktion auf seine Anforderung via Button erhalten (was häufig der Fall sein dürfte), könnten seine Chancen sinken, wenn er nach einigen Tagen nochmals und diesmal direkt schreibt und die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer solchen Erinnerung kommt, ist möglicherweise nicht allzu hoch, da niemand lästig fallen möchte.
Als Musterbrief kann gelten (abgewandelt nach http://plindenbaum.blogspot.com/2006/08/bookmarklet-for-offprint-requests.html ):
Hello, my name is Klaus Graf, I'm a historian working as archivist of the university archive of Aachen University.
Your recent paper titled
"A method for finding communities of related genes -- Wilkinson and Huberman 101 (Supplement 1): 5241 -- Proceedings of the National Academy of Sciences"
caught my attention today. Would it be possible for you to send a PDF copy of the paper?
Best regards,
Dr Klaus Graf
RWTH Aachen
P.S. If you've already deposited this paper in an open access repository I could get it from there, if you have the address.
3. Dark deposits sind unsinnig, wenn kein definierter Embargo-Zeitraum besteht. IR-Manager sollten unter keinen Umständen Wissenschaftlern die Entscheidung überlassen, ob sie dark oder open deponieren. Dann lieber gar kein Deposit, denn mit dem Erlöschen des Urheberrechts 70 Jahre nach dem Tod des Autors kann niemand ernsthaft argumentieren, solange IRs selbst keine Langzeitarchivierung garantieren.
Aus der Sicht eines Archivars liegt diese Position nahe: es ist inzwischen anerkannt, dass bei neuen archivischen Deposita nach Möglichkeit keine Verpflichtung eingegangen wird, unbefristet bei jeder Benutzung den Rechteinhaber um Zustimmung zu bitten. Dauerhafte dark deposits verunklären nur die Open-Access-Statistik des IR, haben aber keinerlei Nutzen. Soweit eine universitätsweite Zugänglichkeit zulässig ist, ist es schlicht und einfach unfair, publizierte Forschungsergebnisse externen Nutzern nicht zugänglich zu machen.
http://www.oai.uzh.ch/index.php?option=content&task=view&id=444&Itemid=323#A1
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/6166799/
10. Darf der Autor seine Werke in einem Repositorium geschlossen hinterlegen und sie von aussen abfragbar machen, indem er „request a copy“-Anfragen einzeln beantwortet und das Werk individuell verschickt?
Die „request a copy“-Funktion unterscheidet sich von der normalen Hinterlegung insbesondere dadurch, dass das Werk nicht ohne weiteres allgemein zugänglich gemacht wird.
Soweit zwischen Autor und Verlag keine vertraglichen Vereinbarungen bestehen und das Gesetzesrecht zur Anwendung kommt (Art. 380 ff. OR, Frage 16), spielt der Unterscheid zwischen „request a copy“-Funktion und normaler Hinterlegung keine praktisch relevante Rolle. Das heisst, die gesetzlichen Bestimmungen gelten auch für die „request a copy“-Funktion.
Im Falle eines Verlagsvertrags zwischen Autor und Verlag gelten die dort formulierten Vereinbarungen. Soweit der Autor dem Verlag das Vervielfältigungs- und das Verbreitungsrecht übertragen oder ihm eine ausschliessliche Lizenz daran eingeräumt hat, ist er grundsätzlich nicht mehr zum Versenden des Werks per „request a copy“-Funktion berechtigt. Die „request a copy“-Funktion ist jedoch – anders als die normale Hinterlegung – dann zulässig und nützlich, wenn der Verlagsvertrag die Verbreitung des Werks nur an einen beschränkten Personenkreis erlaubt, und dies wird in vielen Verlagsverträgen so formuliert. Denn die „request a copy“-Funktion entspricht der Verbreitung in einem solchen Personenkreis.
Bei der Anwendung der „request a copy“-Funktion sind allfällige Urheberrechtsverletzungen grundsätzlich schwieriger zu beweisen als bei einer normalen Hinterlegung, insbesondere weil für einen Aussenstehenden nicht transparent ist, ob die allfällige Urheberrechtsverletzung nur durch den Urheber oder auch durch den Betreiber des Repositoriums erfolgt.
Nach Schweizer Recht kann sich der universitätsweite Zugriff auf elektronische Dokumente in Repositorien, soweit es sich nicht nur vollständige Monographien oder pay-per-view einzeln vertriebene Aufsätze handelt, auf den "betriebsinternen Gebrauch" berufen.
Für Deutschland sehe ich diese Möglichkeit nicht und halte an meinen Ausführungen fest:
http://archiv.twoday.net/stories/5193609/
http://archiv.twoday.net/search?q=request
Auszug:
"Nach deutschem Recht ist bereits die Einstellung einer Vervielfältigung eines Aufsatzes nicht nach § 53 UrhG zu rechtfertigen und damit nicht rechtmäßig. [...]
Nach deutschem Recht kann ein "immediate deposit" in einem Repositorium mit Request-Button nur dann erfolgen, wenn der Verleger kein ausschließliches Nutzungsrecht hat (aber dann wäre auch sofortiger Open Access möglich) oder wenn der Autor sich diese Option in einem Autor-Addendum ausdrücklich vertraglich vorbehalten hat."
Es ist nicht damit zu rechnen, dass die Verlage gegen den Request-Button vorgehen werden. Auch wenn er in den meisten Ländern möglicherweise illegal ist, kann man das aus der Sicht der Praxis ignorieren.
Ich bin aber auch aus anderen Gründen gegen den Request-Button.
1. Ein Instrument, das auf dem Prinzip der Willkür (es ist in das Belieben des Autors gestellt, ob er den Wunsch erfüllt) und damit auf Vorwissen, Vorurteilen oder kontingenten Faktoren wie Semesterstress beruht, kann kein Teil einer Open-Access-Strategie sein.
Der Button macht den Wisssenschaftler zum Bittsteller.
2. Bisherige Erfahrungen (siehe die verlinkten Archivalia-Beiträge) lassen den Schluss zu, dass die Chance auf ein Eprint bei einem direkten Anschreiben des Wissenschaftlers per Mail größer ist. Hat jemand keine Reaktion auf seine Anforderung via Button erhalten (was häufig der Fall sein dürfte), könnten seine Chancen sinken, wenn er nach einigen Tagen nochmals und diesmal direkt schreibt und die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer solchen Erinnerung kommt, ist möglicherweise nicht allzu hoch, da niemand lästig fallen möchte.
Als Musterbrief kann gelten (abgewandelt nach http://plindenbaum.blogspot.com/2006/08/bookmarklet-for-offprint-requests.html ):
Hello, my name is Klaus Graf, I'm a historian working as archivist of the university archive of Aachen University.
Your recent paper titled
"A method for finding communities of related genes -- Wilkinson and Huberman 101 (Supplement 1): 5241 -- Proceedings of the National Academy of Sciences"
caught my attention today. Would it be possible for you to send a PDF copy of the paper?
Best regards,
Dr Klaus Graf
RWTH Aachen
P.S. If you've already deposited this paper in an open access repository I could get it from there, if you have the address.
3. Dark deposits sind unsinnig, wenn kein definierter Embargo-Zeitraum besteht. IR-Manager sollten unter keinen Umständen Wissenschaftlern die Entscheidung überlassen, ob sie dark oder open deponieren. Dann lieber gar kein Deposit, denn mit dem Erlöschen des Urheberrechts 70 Jahre nach dem Tod des Autors kann niemand ernsthaft argumentieren, solange IRs selbst keine Langzeitarchivierung garantieren.
Aus der Sicht eines Archivars liegt diese Position nahe: es ist inzwischen anerkannt, dass bei neuen archivischen Deposita nach Möglichkeit keine Verpflichtung eingegangen wird, unbefristet bei jeder Benutzung den Rechteinhaber um Zustimmung zu bitten. Dauerhafte dark deposits verunklären nur die Open-Access-Statistik des IR, haben aber keinerlei Nutzen. Soweit eine universitätsweite Zugänglichkeit zulässig ist, ist es schlicht und einfach unfair, publizierte Forschungsergebnisse externen Nutzern nicht zugänglich zu machen.
KlausGraf - am Sonntag, 31. Januar 2010, 21:16 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.oai.uzh.ch/images/stories/oa_medien/oa_rechtsgutachten_hilty.pdf
FAQ:
http://www.oai.uzh.ch/index.php?option=content&task=view&id=444&Itemid=323#A1
Zusammenfassung von Ehmann:
https://www.xing.com/net/wissenschaftsurheberrecht/links-auf-relevante-quellen-448259/hilty-gutachten-zu-open-access-27773575/27773575/#27773575
Das Gutachtet bewertet die Rechtslage etwas zu einseitig zugunsten der Verlage. Angesichts der klaren Belege, dass auch bei Monographien Open Access den Verkauf nicht mindert, ist der Verweis auf die Enthaltungspflicht des Autors verfehlt.

FAQ:
http://www.oai.uzh.ch/index.php?option=content&task=view&id=444&Itemid=323#A1
Zusammenfassung von Ehmann:
https://www.xing.com/net/wissenschaftsurheberrecht/links-auf-relevante-quellen-448259/hilty-gutachten-zu-open-access-27773575/27773575/#27773575
Das Gutachtet bewertet die Rechtslage etwas zu einseitig zugunsten der Verlage. Angesichts der klaren Belege, dass auch bei Monographien Open Access den Verkauf nicht mindert, ist der Verweis auf die Enthaltungspflicht des Autors verfehlt.

KlausGraf - am Sonntag, 31. Januar 2010, 20:13 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.xing.com/net/wissenschaftsurheberrecht
Juristischer Schwerpunkt, aber durchaus pro Open Access.
Juristischer Schwerpunkt, aber durchaus pro Open Access.
KlausGraf - am Sonntag, 31. Januar 2010, 19:59 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/31/31971/1.html
Siehe hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=voynich

Siehe hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=voynich

KlausGraf - am Sonntag, 31. Januar 2010, 16:49 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 31. Januar 2010, 16:42 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 31. Januar 2010, 16:08 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://britainloveswikipedia.org/wiki/Main_Page
Britain Loves Wikipedia is a scavenger hunt and free content photography contest running in museums and cultural institutions across the UK through February. The aim is to increase the number of pictures available to illustrate Wikipedia articles, and to inspire new articles.
Britain Loves Wikipedia is a scavenger hunt and free content photography contest running in museums and cultural institutions across the UK through February. The aim is to increase the number of pictures available to illustrate Wikipedia articles, and to inspire new articles.
KlausGraf - am Sonntag, 31. Januar 2010, 14:17 - Rubrik: English Corner
"Una excavadora amarilla retrocede y toma fuerza para poder trepar por la pila de escombros en que quedó convertido el Vicariato General de Puerto Príncipe después del terremoto del 12 de enero.
En ese lugar, frente a la devastada Catedral de Puerto Príncipe, la máquina intenta recuperar los documentos históricos de la Iglesia católica haitiana, informó DPA.
"Estamos buscando los archivos de la Catedral en el edificio episcopal. Contienen la historia de la iglesia desde 1800", dijo a DPA el padre Georgino Rameau, de la Sociedad de Saint Jacques.
Un grupo de personas carga cajas con documentación hacia una camioneta, mientras la excavadora, manejada por una mujer, levanta una nube de polvo al mover las piedras.
La catedral, la residencia episcopal y las oficinas administrativas del vicariato están en el centro de la ciudad, la zona más dañada por el terremoto de la capital haitiana. Ahí murieron el arzobispo de Puerto Príncipe, Joseph Serge Miot, y el vicario general, Charles Benoit.
Durante varios días, la iglesia estuvo intentando que el gobierno de Haití o alguna embajada los ayudara a recuperar los archivos, hasta que finalmente el viernes recibieron la esperada excavadora, cuenta Rameau.
Dos hombres armados supervisan la labor. Las acciones de remoción de escombros coinciden con una visita del nuncio apostólico Bernardito Auza con una delegación de obispos dominicanos, a los restos de la sede episcopal.
"Cuando vi que la catedral se había derrumbado, fue un shock total para mí", dijo Auza a DPA. "Es una gran pérdida material, pero también histórica. Todo el patrimonio histórico de la Iglesia se perdió".
Varias cajas de papeles quedaron intactas. Unos jóvenes que acompañan al padre Rameau las cargan en una camioneta.
La bella catedral de Nuestra Señora de la Asunción, cuya primera piedra se colocó en 1884, observa la escena desde sus propias ruinas.
Cerca de ahí, están también destruidos los principales edificios del gobierno, el Palacio Nacional, el Ministerio de Justicia, la oficina de impuestos.
El terremoto de siete grados en la escala de Richter no sólo mató a cerca de 180.000 personas, sino que destruyó los símbolos del poder terrenal y celestial.
"Hemos venido un grupo de obispos de República Dominicana a Haití para expresar nuestra solidaridad", dice el arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez, uno de los integrantes de la comitiva que recorrió la zona con el nuncio.
Muchos sacerdotes y seminaristas murieron en Haití. Después del terremoto, Auza declaró a la agencia católica Fides que había hecho un recorrido y había encontrado sacerdotes y religiosas en la calle, sin casas.
"El rector del seminario se salvó, también el decano de estudios, pero muchos seminaristas han quedado atrapados entre los escombros. Por todas partes se escuchan gritos", relató.
Pero, contra la creencia de muchos haitianos, Auza subraya que el terremoto "no fue un castigo de Dios".
Pasado el duelo, la tarea es rescatar ahora la memoria de la iglesia a través de sus papeles. La excavadora mueve su enorme mano de acero y vuelve a rascar entre las piedras."
Link: El Universal (Caracas), 30.01.2010
Kann dies jemand übersetzen und einen Abstract verfassen? Danke!
En ese lugar, frente a la devastada Catedral de Puerto Príncipe, la máquina intenta recuperar los documentos históricos de la Iglesia católica haitiana, informó DPA.
"Estamos buscando los archivos de la Catedral en el edificio episcopal. Contienen la historia de la iglesia desde 1800", dijo a DPA el padre Georgino Rameau, de la Sociedad de Saint Jacques.
Un grupo de personas carga cajas con documentación hacia una camioneta, mientras la excavadora, manejada por una mujer, levanta una nube de polvo al mover las piedras.
La catedral, la residencia episcopal y las oficinas administrativas del vicariato están en el centro de la ciudad, la zona más dañada por el terremoto de la capital haitiana. Ahí murieron el arzobispo de Puerto Príncipe, Joseph Serge Miot, y el vicario general, Charles Benoit.
Durante varios días, la iglesia estuvo intentando que el gobierno de Haití o alguna embajada los ayudara a recuperar los archivos, hasta que finalmente el viernes recibieron la esperada excavadora, cuenta Rameau.
Dos hombres armados supervisan la labor. Las acciones de remoción de escombros coinciden con una visita del nuncio apostólico Bernardito Auza con una delegación de obispos dominicanos, a los restos de la sede episcopal.
"Cuando vi que la catedral se había derrumbado, fue un shock total para mí", dijo Auza a DPA. "Es una gran pérdida material, pero también histórica. Todo el patrimonio histórico de la Iglesia se perdió".
Varias cajas de papeles quedaron intactas. Unos jóvenes que acompañan al padre Rameau las cargan en una camioneta.
La bella catedral de Nuestra Señora de la Asunción, cuya primera piedra se colocó en 1884, observa la escena desde sus propias ruinas.
Cerca de ahí, están también destruidos los principales edificios del gobierno, el Palacio Nacional, el Ministerio de Justicia, la oficina de impuestos.
El terremoto de siete grados en la escala de Richter no sólo mató a cerca de 180.000 personas, sino que destruyó los símbolos del poder terrenal y celestial.
"Hemos venido un grupo de obispos de República Dominicana a Haití para expresar nuestra solidaridad", dice el arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez, uno de los integrantes de la comitiva que recorrió la zona con el nuncio.
Muchos sacerdotes y seminaristas murieron en Haití. Después del terremoto, Auza declaró a la agencia católica Fides que había hecho un recorrido y había encontrado sacerdotes y religiosas en la calle, sin casas.
"El rector del seminario se salvó, también el decano de estudios, pero muchos seminaristas han quedado atrapados entre los escombros. Por todas partes se escuchan gritos", relató.
Pero, contra la creencia de muchos haitianos, Auza subraya que el terremoto "no fue un castigo de Dios".
Pasado el duelo, la tarea es rescatar ahora la memoria de la iglesia a través de sus papeles. La excavadora mueve su enorme mano de acero y vuelve a rascar entre las piedras."
Link: El Universal (Caracas), 30.01.2010
Kann dies jemand übersetzen und einen Abstract verfassen? Danke!
Wolf Thomas - am Sonntag, 31. Januar 2010, 11:45 - Rubrik: Kirchenarchive
"UNESCO is launching a campaign to protect Haiti’s moveable heritage, notably art collections in the country’s damaged museums, galleries and churches, from pillaging.
The Director-General of the Organization, Irina Bokova, on Wednesday wrote to the Secretary-General of the United Nations, Ban Ki-moon, asking for his support in preventing the dispersion of Haiti’s cultural heritage.
“I would be most grateful,” she wrote, “if you would request Mr John Holmes, your Special Envoy for Haiti and Under-Secretary-General for Humanitarian affairs, as well as the relevant authorities in charge of the overall coordination of UN humanitarian support in Port-au-Prince – the UN Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) and the Department of Peace Keeping Operations (DPKO) – to ensure, as far as possible, the immediate security of the sites containing these artefacts.”
Ms Bokova further asked Mr Ban to consider recommending that the Security Council adopt a resolution instituting a temporary ban on the trade or transfer of Haitian cultural property. The Director-General also suggested that institutions such as Interpol, the World Customs Organization (WCO) and others assist in the implementation of such a ban.
The Director-General is also seeking to mobilize the support of the whole international community and of art market and museum professionals in enforcing the ban. “It is particularly important,” she urged in her letter, “to verify the origin of cultural property that might be imported, exported and/or offered for sale, especially on the Internet.”
Referring to UNESCO’s previous experiences in Afghanistan and Iraq, the Director-General said she intended to draw on national and international experts to orient and coordinate the assistance required to protect Haiti’s cultural heritage. “This heritage,” she insisted “is an invaluable source of identity and pride for the people on the island and will be essential to the success of their national reconstruction.”
It is important to prevent treasure hunters from rifling through the rubble of the numerous cultural landmarks that collapsed in the earthquake. Among them are the former Presidential Palace and Cathedral of Port-au-Prince, along with many edifices in Jacmel, the 17th century French colonial town Haiti planned to propose for inscription on UNESCO’s World Heritage List.
The one property already inscribed on the List – the National History Park - Citadel, Sans Souci, Ramiers - with its royal palace and large fortress appears to have been spared by the quake. As were the country’s main museums and archives.
UNESCO has already helped salvage the exceptionally rich historical archives of George Corvington, the historian of Haiti. It is also contributing to attempts to rescue whatever panels or significant fragments remain of the remarkable painted murals that decorated the Episcopal Cathedral of the Holy Trinity in Port-au-Prince."
Press releases of the UNESCO
The Director-General of the Organization, Irina Bokova, on Wednesday wrote to the Secretary-General of the United Nations, Ban Ki-moon, asking for his support in preventing the dispersion of Haiti’s cultural heritage.
“I would be most grateful,” she wrote, “if you would request Mr John Holmes, your Special Envoy for Haiti and Under-Secretary-General for Humanitarian affairs, as well as the relevant authorities in charge of the overall coordination of UN humanitarian support in Port-au-Prince – the UN Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) and the Department of Peace Keeping Operations (DPKO) – to ensure, as far as possible, the immediate security of the sites containing these artefacts.”
Ms Bokova further asked Mr Ban to consider recommending that the Security Council adopt a resolution instituting a temporary ban on the trade or transfer of Haitian cultural property. The Director-General also suggested that institutions such as Interpol, the World Customs Organization (WCO) and others assist in the implementation of such a ban.
The Director-General is also seeking to mobilize the support of the whole international community and of art market and museum professionals in enforcing the ban. “It is particularly important,” she urged in her letter, “to verify the origin of cultural property that might be imported, exported and/or offered for sale, especially on the Internet.”
Referring to UNESCO’s previous experiences in Afghanistan and Iraq, the Director-General said she intended to draw on national and international experts to orient and coordinate the assistance required to protect Haiti’s cultural heritage. “This heritage,” she insisted “is an invaluable source of identity and pride for the people on the island and will be essential to the success of their national reconstruction.”
It is important to prevent treasure hunters from rifling through the rubble of the numerous cultural landmarks that collapsed in the earthquake. Among them are the former Presidential Palace and Cathedral of Port-au-Prince, along with many edifices in Jacmel, the 17th century French colonial town Haiti planned to propose for inscription on UNESCO’s World Heritage List.
The one property already inscribed on the List – the National History Park - Citadel, Sans Souci, Ramiers - with its royal palace and large fortress appears to have been spared by the quake. As were the country’s main museums and archives.
UNESCO has already helped salvage the exceptionally rich historical archives of George Corvington, the historian of Haiti. It is also contributing to attempts to rescue whatever panels or significant fragments remain of the remarkable painted murals that decorated the Episcopal Cathedral of the Holy Trinity in Port-au-Prince."
Press releases of the UNESCO
Wolf Thomas - am Sonntag, 31. Januar 2010, 09:37 - Rubrik: Kulturgut
http://www.kirtasbooks.com
Die Möglichkeit "Read Book!" führt nicht nur zu Google Book Search, sondern bei bereits digitalisierten Titeln, die für 1,95 Dollar zum Download angeboten werden (das Digitalisieren aus dem Katalog kostet 20 Dollar: http://archiv.twoday.net/stories/6165196/ ), zu einem Viewer, in dem man Seiten größer betrachten kann, wenn ein entsprechendes Symbol (unter dem X für Schließen) sichtbar ist. Hat man eine solche Seite erreicht, kann man in der URL blättern oder einen automatisierten Download mittel Offline-Browser etc. starten. Beispiel:
http://www.kirtasbooks.com/linktobooks_online/R0006481243/800x/R0006481243_000008.jpg
Zum Download siehe auch die Hinweise unter
http://de.wikisource.org/w/index.php?title=Wikisource:Skriptorium&oldid=1013726

Die Möglichkeit "Read Book!" führt nicht nur zu Google Book Search, sondern bei bereits digitalisierten Titeln, die für 1,95 Dollar zum Download angeboten werden (das Digitalisieren aus dem Katalog kostet 20 Dollar: http://archiv.twoday.net/stories/6165196/ ), zu einem Viewer, in dem man Seiten größer betrachten kann, wenn ein entsprechendes Symbol (unter dem X für Schließen) sichtbar ist. Hat man eine solche Seite erreicht, kann man in der URL blättern oder einen automatisierten Download mittel Offline-Browser etc. starten. Beispiel:
http://www.kirtasbooks.com/linktobooks_online/R0006481243/800x/R0006481243_000008.jpg
Zum Download siehe auch die Hinweise unter
http://de.wikisource.org/w/index.php?title=Wikisource:Skriptorium&oldid=1013726

KlausGraf - am Samstag, 30. Januar 2010, 22:30 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
We have just finished implementing what we are calling "Digitize and Download". Listening to feedback from our customers, many people only wanted the digital file, not a paperback or hardcover copy of a book. In the past, the digital file was only available after a book was digitized and a reprint of that book was created.
Now with the new "Digitize and Download" model you can order just the digital file. The cost is the same as a soft cover book $20, but you save big on the shipping costs, and we'll all save a few trees in the process. In many cases shipping costs which is out of our control far exceed the cost of the book.
Here is how it works:
1. Find a book you'd like to purchase
2. Under the "options" section for that book select "Digitize and Download +$18.05" (Total cost = $20.00) and finish the checkout process.
3. We then send the request to the library partner to Pull and Digitize your book.
4. Once that is completed (3-4 weeks typically) you will receive a link to the email address supplied during the checkout process, providing you with a link to your book.
5. Once a book is digitized the future download price is $1.95 with instant access.
Help us spread the word!
Tell your friends and associates, that you can now order a digital copy of any book on KirtasBooks.com.
http://www.kirtasbooks.com
Now with the new "Digitize and Download" model you can order just the digital file. The cost is the same as a soft cover book $20, but you save big on the shipping costs, and we'll all save a few trees in the process. In many cases shipping costs which is out of our control far exceed the cost of the book.
Here is how it works:
1. Find a book you'd like to purchase
2. Under the "options" section for that book select "Digitize and Download +$18.05" (Total cost = $20.00) and finish the checkout process.
3. We then send the request to the library partner to Pull and Digitize your book.
4. Once that is completed (3-4 weeks typically) you will receive a link to the email address supplied during the checkout process, providing you with a link to your book.
5. Once a book is digitized the future download price is $1.95 with instant access.
Help us spread the word!
Tell your friends and associates, that you can now order a digital copy of any book on KirtasBooks.com.
http://www.kirtasbooks.com
KlausGraf - am Samstag, 30. Januar 2010, 19:34 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Pressemitteilung Nr.: 13/2010 - 14.01.2010
„Abendgespräche zum Alten Buch“ ist der Titel einer neuen Veranstaltungsreihe, zu der die Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha alle Interessierte einlädt. Die Veranstaltungen finden jeweils am dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr statt und dauern etwa eine halbe Stunde.
Darin zeigen Mitarbeiter wichtige Handschriften und alte Drucke aus der berühmten „Bibliotheca Amploniana“ sowie aus der Sondersammlung der Bibliothek. Mit Blick auf die Jahresausstellung der Sondersammlung, die vom 20. Mai bis 1. Juli zu sehen sein wird, lautet der Titel der Präsentationen in den nächsten Monaten „Astronomie und Astrologie“. Bei der Veranstaltung erhalten die Besucher jeweils detaillierte Informationen zu den einzelnen Objekten und haben Gelegenheit, Fragen an die Spezialisten zu stellen.
Die nächste Veranstaltung ist am 18. Februar. Treffpunkt ist jeweils die Sondersammlung der UB im zweiten Obergeschoss. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Der Eintritt ist frei.
„Abendgespräche zum Alten Buch“ ist der Titel einer neuen Veranstaltungsreihe, zu der die Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha alle Interessierte einlädt. Die Veranstaltungen finden jeweils am dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr statt und dauern etwa eine halbe Stunde.
Darin zeigen Mitarbeiter wichtige Handschriften und alte Drucke aus der berühmten „Bibliotheca Amploniana“ sowie aus der Sondersammlung der Bibliothek. Mit Blick auf die Jahresausstellung der Sondersammlung, die vom 20. Mai bis 1. Juli zu sehen sein wird, lautet der Titel der Präsentationen in den nächsten Monaten „Astronomie und Astrologie“. Bei der Veranstaltung erhalten die Besucher jeweils detaillierte Informationen zu den einzelnen Objekten und haben Gelegenheit, Fragen an die Spezialisten zu stellen.
Die nächste Veranstaltung ist am 18. Februar. Treffpunkt ist jeweils die Sondersammlung der UB im zweiten Obergeschoss. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Der Eintritt ist frei.
Nowak - am Samstag, 30. Januar 2010, 19:08 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 30. Januar 2010, 18:49 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Für Studierende der Universität Erfurt führen wir auf Anfrage in der UB medien- und kulturgeschichtliche Veranstaltungen durch. Im Mittelpunkt stehen in den Veranstaltungen unsere historischen Bestände (z. B. die Werke der Bibliotheca Amploniana ).
Nowak - am Samstag, 30. Januar 2010, 17:37 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Public Domain und die Archive
Von Klaus Graf
[Preprint des Beitrags für den Tagungsband des 79. Deutschen Archivtags in Regensburg 2009, Programm: http://www.archivtag.de/at2009/programm/progheft_2009.pdf
Gedruckt:
Klaus Graf: Die Public Domain und die Archive, in: Archive im digitalen Zeitalter. Überlieferung - Erschließung - Präsentation. 79. Deutscher Archivtag in Regensburg (=
Tagungsdokumentationen zum Deutschen Archivtag 14), Fulda 2010, S. 177-185
]
Beginnen möchte ich mit der Erläuterung von drei Definitionen:
1. Was ist Open Access?
2. Was ist die Public Domain?
3. Was ist Copyfraud?
Zu Punkt 1: Open Access ist zwar kein juristisch definierter Begriff, aber man kann trotzdem nicht behaupten, dass unklar wäre, was man in der Forschungspolitik darunter versteht. „Als Open Access (englisch offener Zugang) wird der freie Zugang zu wissenschaftlicher Literatur und anderen Materialien im Internet bezeichnet“, definiert die deutschsprachige Wikipedia.
Eine wichtige Unterscheidung in der Open-Access-Community betrifft gratis und libre Open Access [1].
Gratis Open Access heißt: Die Inhalte werden kostenlos für den Nutzer im allgemein zugänglichen Internet dauerhaft zugänglich gemacht.
Libre Open Access meint dagegen mehr: Es wird zusätzlich zur kostenlosen Nutzung die Möglichkeit einer Nachnutzung gewährt, ohne dass eine ausdrückliche Zustimmung eingeholt werden muss.
Als Beispiel für libre Open Access können die vom Bundesarchiv der Wikipedia zur Verfügung gestellten Fotos genannt werden. Diese befinden sich im „Wikimedia Commons“ genannten Multimedia-Pool der Wikimedia Foundation, der Trägerin der Wikipedia, und können nicht nur von den Wikipedia-Projekten, sondern von beliebigen externen Nutzern kostenlos verwendet werden. Soweit sie nicht gemeinfrei sind, weil die deutsche urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist, sind alle mit einer Creative Commons Lizenz versehen, die es ermöglicht, die Fotos zu verändern und sie beliebig – auch kommerziell – kostenlos zu nutzen, also etwa für andere Webprojekte. Erfolgt eine solche Nutzung, ist der Nachnutzer aufgrund der Creative Commons Lizenz verpflichtet, den Urheber des Fotos und die Lizenz zu nennen. Werden diese Lizenzbedingungen nicht eingehalten, liegt eine Urheberrechtsverletzung vor. Open Access heißt also nicht Public Domain: der Urheber bzw. Rechteinhaber verzichtet zwar auf die meisten, nicht aber auf alle Rechte. Der Nutzer kann mit den Medien nicht machen, was er will, sondern muss sich an bestimmte Spielregeln halten.
Die Abkürzung von Creative Commons ist CC. Die weltweit führenden Open Access Zeitschriftenverlage verwenden die liberalste CC-Lizenz CC-BY. BY steht für „Attribution“ (Urhebernennung). Beispielsweise darf man die dort veröffentlichten Artikel in andere Sprachen übersetzen, ohne den Urheber oder den Verlag zu fragen, solange der Urheber genannt wird.
Die grundlegende „Berliner Erklärung für Open Access“ vom Oktober 2003, die inzwischen weltweit von sehr vielen Wissenschaftsorganisationen unterzeichnet wurde und sich ausdrücklich auch an die kulturgutverwahrenden Institutionen wie die Archive wendet, sieht ausdrücklich nicht nur gratis Open Access, sondern auch libre Open Access vor. Es heißt dort: „Die Urheber und die Rechteinhaber solcher Veröffentlichungen gewähren allen Nutzern unwiderruflich das freie, weltweite Zugangsrecht zu diesen Veröffentlichungen und erlauben ihnen, diese Veröffentlichungen – in jedem beliebigen digitalen Medium und für jeden verantwortbaren Zweck – zu kopieren, zu nutzen, zu verbreiten, zu übertragen und öffentlich wiederzugeben sowie Bearbeitungen davon zu erstellen und zu verbreiten, sofern die Urheberschaft korrekt angegeben wird.“ [2]
Aber nicht überall, wo Open Access draufsteht, ist auch Open Access drin. Weder der Verkauf von Kirchenbuch-CD-ROMs noch der kostenlose Inhouse-Zugriff auf Digitalisate für Personal und Benutzer darf mit Fug und Recht als Open Access bezeichnet werden.
Zu Punkt 2: Was ist die Public Domain?
Public Domain ist ein urheberrechtlicher Begriff, der all das umfasst, was nicht oder nicht mehr urheberrechtlich geschützt ist. Rechteinhaber der Public Domain ist die Öffentlichkeit, sie gehört uns allen. Was zur Public Domain gehört, darf von allen ohne urheberrechtliche Beschränkungen zu beliebigen Zwecken und ohne Auflagen genutzt werden.
Zur Public Domain zählt zunächst einmal alles, was aus der Sicht des Urheberrechts überhaupt nicht schutzfähig ist, beispielsweise eine seltsam geformte Muschel, die am Strand liegt oder Nachbars Apfelbaum. Das sind keine menschlichen geistigen Schöpfungen im Sinne des Urheberrechts. Ebenfalls nicht schutzfähig sind einfache Gestaltungen, denen die sogenannte Schöpfungshöhe [3] fehlt. Ein sehr kurzer alltäglicher Aktenvermerk im Archivgut würde beispielsweise unter die nicht urheberrechtlich geschützte Gattung einfacher Gebrauchstexte fallen.
Sodann zählt zur Public Domain alles, was ein nationaler Gesetzgeber vom Urheberrechtsschutz ausgenommen hat. Beispielsweise sind nach deutschem Recht (§ 5 Urheberrechtsgesetz = UrhG) Gesetze und Verordnungen als „amtliche Werke“ nicht geschützt. In den USA sind die dienstlichen Werke der Bundesbediensteten vom Copyright ausgenommen.
Zur Public Domain gehört schließlich auch, was alt genug ist, damit der Urheberrechtsschutz abgelaufen ist.
In Deutschland und der Europäischen Union läuft der Urheberrechtsschutz 70 Jahre lang nach dem Tod des Urhebers, wobei die Frist jeweils am Jahresende endet. Da der Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud 1939 starb, sind seine Werke seit dem 1. Januar 2010 nicht mehr geschützt. Sie sind „gemeinfrei“, denn das deutsche Urheberrecht spricht statt Public Domain von „Gemeinfreiheit“.
Selbstverständlich sind auch mittelalterliche Urkunden gemeinfrei, auch wenn es im Mittelalter noch gar keine Urheberrechtsgesetze gab. Auf die aus meiner Sicht problematische Regelung des § 71 UrhG über die sogenannten „nachgelassenen Werke“, die durch Erstveröffentlichung für 25 Jahre der Public Domain wieder entrissen werden können, kann ich hier nicht näher eingehen.
Dass es kein ewiges Urheberrecht gibt, war eine bewusste Entscheidung des Bundesgesetzgebers. In der amtlichen Begründung zum Urheberrechtsgesetz heißt es, Verbreitung und Wiedergabe der „Meisterwerke der Literatur und Kunst, die in den Kulturbestand eines Volkes eingehen“, müssten „im allgemeinen Interesse jedermann freistehen“ [4]. Welche Vorteile eine reiche Public Domain für das geistige Schaffen und die Kreativität stiftet, wurde vor allem von US-Juristen breit diskutiert [5].
Eine Abgabe auf gemeinfreie Werke, die z.B. als „Goethegroschen“ bezeichnet wurde, wurde wiederholt erwogen, aber nie Gesetz.
Aus der Sicht des Urheberrechts darf man mit gemeinfreien Werken anstellen, was man möchte. Man darf seinen Namen unter ein Goethe-Gedicht setzen, es stümperhaft in Aargauer Dialekt übersetzen oder es verhohnepipeln. Goethes Erben sind dagegen machtlos. Veröffentlicht man eine solche Entstellung bei einem modernen geschützten Gedicht, kann der Urheber dagegen vorgehen.
Entscheidend ist folgende Feststellung: Gemeinfreiheit oder Public Domain bezieht sich nur auf das Urheberrecht (man kann auch ergänzen: auf das jeweilige nationale Urheberrecht).
Ein einfach gestaltetes Logo kann nach urheberrechtlicher Lehre in Deutschland als Geschmacksmuster geschützt sein, nicht aber nach dem Urheberrecht. Die Form des Zugs IntercityExpress (ICE) ist nach dem Geschmacksmustergesetz geschützt [6]. Wer kommerziell Postkarten von ICEs vertreibt, kann Ärger mit der Deutschen Bahn bekommen.
Ein traditionelles altes Stadtwappen ist urheberrechtlich gemeinfrei. Wenn aber ein Unternehmer damit wirbt, verletzt er das im bürgerlichen Recht geschützte Namensrecht der Stadt, und er verstößt gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften über die Führung kommunaler Hoheitszeichen [7].
Bei einer mittelalterlichen Urkunde kommen aber nach deutschem Recht keine solchen konkurrierenden Rechte in Betracht.
Zu Punkt 3: Was ist Copyfraud?
Copyfraud ist ein von dem US-Juristen Jason Mazzone in einem inzwischen einflussreichen Aufsatz aus dem Jahr 2006 [8] geprägter Begriff, der sich – in der Form eines Wortspiels, vergleichbar Copyleft statt Copyright – gegen die unberechtigte Beanspruchung von Urheberrechten bei gemeinfreien Werken wendet. In der deutschen Rechtssprache begegnet man dem Begriff „Schutzrechtsberühmung“ [9].
Firmen, die unberechtigt abgemahnt werden, weil sie angeblich ein Schutzrecht verletzen, können gegenüber dem Abmahner einen Schadensersatzanspruch geltend machen, also beispielsweise die eigenen Anwaltskosten ersetzt verlangen. Die „Wirkung des Ausschließlichkeitsrechts“, befand der Bundesgerichtshof, „verlangt nach einem Korrelat, welches sicherstellt, dass der Wettbewerb nicht über die objektiven Grenzen hinaus eingeschränkt wird, durch die das Gesetz den für schutzfähig erachteten Gegenstand und seinen Schutzbereich bestimmt“ [10]. Wenn man verlangt, dass man das Urheberrecht respektiert, muss man auch die Grenzen des Urheberrechts respektieren.
Wird eine gemeinfreie Notenausgabe mit einem Copyright-Zeichen versehen, so kann ein Mitbewerber nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb dagegen vorgehen [11].
Copyfraud liegt beispielsweise vor, wenn ein Archiv auf Fotokopien einen Stempel anbringt, wonach diese Kopien urheberrechtlich geschützt sind. Dass beim Fotokopieren keine neuen Urheberrechte entstehen, ist unbestritten.
Es leuchtet ein, dass Copyfraud die Public Domain rechtswidrig schädigt. Wer unberechtigte Ansprüche erhebt und ein nicht-existierendes Schutzrecht behauptet, verstößt gegen die gesetzlichen Wertungen. Fügt er anderen einen Vermögensschaden zu, kann sogar eine Strafbarkeit als Betrug gegeben sein.
Copyfraud liegt übrigens auch dann vor, wenn man Medien unter eine Creative Commons Lizenz stellt, die in Wirklichkeit gemeinfrei sind.
Ist ein Fotograf 70 Jahre tot, dürfen Reproduktionen seiner Bilder nicht unter eine solche Lizenz gestellt werden. Seit der Entscheidung „Bibelreproduktion“ des Bundesgerichtshofs vom 8. November 1989 ist klar, dass originalgetreue Reproduktionen von Fotos („Bild vom Bild“) nicht schutzfähig sind [12].
Auch bei der üblichen Flachware in Archiven kann davon ausgegangen werden, dass kein Leistungsschutzrecht nach § 72 UrhG, der sogenannte Schutz einfacher Lichtbilder, besteht [13]. Schriftstücke sind zweidimensionale Vorlagen (auch wenn sie unter dem Mikroskop gebirgig aussehen). Werden sie digitalisiert oder sonst originalgetreu reproduziert, kommt kein Urheberrechtsschutz zustande. Rainer Polley sieht das ebenso wie ich [14]. Also: Die archivüblichen Reproduktionen sind urheberrechtlich nicht geschützt.
Nach diesen ersten drei Punkten, die Open Access, Public Domain und Copyfraud erläutert haben, möchte ich im zweiten Teil meiner Ausführungen die folgende These zu widerlegen versuchen:
Die urheberrechtliche Gemeinfreiheit oder Public Domain ist für die Archive irrelevant, weil sie überlagert wird vom Eigentumsrecht des Archivträgers und archivrechtlichen Rechtsvorschriften.
Zunächst zum Eigentumsrecht. Es ist gerichtlich hinreichend geklärt, dass es kein „Recht am Bild der eigenen Sache“ gibt [15]. Selbst wenn sich aus dem Eigentum oder vertraglichen Vereinbarungen eine Bindung des Erstnutzers ergäbe, könnte ein Dritter, der das Stück verwertet, nicht belangt werden.
Der Bundesgerichtshof hat das in seiner noch immer maßgeblichen Entscheidung „Apfel-Madonna“ 1965 geklärt [16]. Es ging um die Nachbildung einer gemeinfreien mittelalterlichen Marien-Skulptur aus einem Aachener Museum. Ich zitiere aus dem Urteil: Hat „der Eigentümer […] einem Dritten gestattet, das gemeinfreie Werk nachzubilden und diese Nachbildung in den Verkehr zu bringen, so kann er […] weitere Nachbildungen des Originals durch andere Personen, die hierbei die mit seiner Erlaubnis hergestellte Kopie als Vorlage benutzen, nicht verhindern“.
Gestattet ein Unternehmensarchiv einem Benutzer, ein als Kopie zur Verfügung gestelltes Aktenstück in einem Buch als Faksimile abzudrucken, so kann es die weitere Verwertung durch Dritte, die das Schriftstück aus dem Buch scannen und ins Internet stellen können, nicht mehr kontrollieren. Es ist dann irrelevant, welche Knebel- oder Honorarverträge das Archiv mit dem Benutzer geschlossen haben mag. Sobald ein gemeinfreies Werk (vorausgesetzt es handelt sich um „Flachware“) in originalgetreuer Reproduktion in die Öffentlichkeit gelangt, endet die Verfügungsmacht des Eigentümers.
Bei „öffentlichen Sachen“ [17] kommt hinzu, dass die Sachherrschaft des Eigentümers überlagert wird von ihrer öffentlich-rechtlichen Zweckbestimmung. Diese Zweckbestimmung ergibt sich bei Archivalien in öffentlichen Archiven aus dem Archivrecht, also aus den Archivgesetzen.
Ist die Public Domain irrelevant, weil alles Archivgut eingebunden ist in die durch Rechtsnormen, nämlich die Archivgesetze, geregelte Verwaltung des Archivguts in den Archiven?
Zunächst einmal ist festzustellen: Alle deutschen Archivgesetze enthalten keine Befugnisnormen, die es Archiven erlauben, Bildrechte gemeinfreier Vorlagen zu vermarkten. Bis hin zum Landesgesetzgeber von Nordrhein-Westfalen, der bei Niederschrift dieser Zeilen gerade die Novellierung des Archivgesetzes diskutiert, haben die Parlamente des Bundes und der Länder keine Veranlassung gesehen, einen meines Erachtens durchaus wesentlichen Punkt zu regeln: Ob und wie das im Archivgut verkörperte geistige Eigentum vermarktet, also kommerziell verwertet werden darf, und wie sich diese Vermarktung zu den archivrechtlich gewährleisteten Nutzungsrechten der Benutzer verhält [18]. Wesentliche Entscheidungen müssen durch Gesetz getroffen werden, sie der Verwaltungspraxis zu überlassen, kann Eingriffe in Benutzerrechte nicht rechtfertigen.
Nach der jetzigen Systematik der Archivgesetze kommt eine Kontrolle des geistigen Gehalts des Archivguts nur dann in Betracht, wenn es um die Schutzgüter geht, denen diese Gesetze verpflichtet sind. An erster Stelle stehen der Datenschutz und das informationelle Selbstbestimmungsrecht sowie das postmortale Persönlichkeitsrecht, es sind aber auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, soweit sie im Archivgut dokumentiert sind, zu wahren. Soweit das Wohl des Bundes oder eines Landes betroffen ist, liegt die Hürde für die Einsichtsverweigerung so hoch, dass es ausgeschlossen ist, das fiskalische Interesse an der Vermarktung von Bildrechten damit zu verbinden.
Man kann es auch so formulieren: Es gehört nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der Archive, Bildrechte gemeinfreier Vorlagen zu kommerzialisieren. Die Archive dürfen aber nur im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben tätig werden.
Entsprechende Genehmigungsvorbehalte in Archivbenutzungsordnungen, die die Veröffentlichung und Weitergabe von Reproduktionen an die Zustimmung des Archivs knüpfen, sind nicht hinreichend ermächtigt [19]. Für Textwiedergaben ist hinreichend geklärt, dass Bibliotheken oder Archive in öffentlicher Trägerschaft keine Befugnis haben, die Edition von ihrer Genehmigung abhängig zu machen. Ein solcher Eingriff in die Forschungsfreiheit bedürfte einer gesetzlichen Ermächtigung [20]. Ich sehe keinen Grund, dieses Ergebnis nicht auch auf die Bilder des Archivguts zu übertragen.
Nicht vernachlässigt werden darf der Gesichtspunkt, dass Archive ein „Monopol“ an ihren Beständen haben. Sie haben den exklusiven Zugriff auf das Vermarktungs-Potential, der von der gemeinsamen Wirtschaftsordnung der EU gewünschte Wettbewerb findet nicht statt. Wer das Bild eines alten Aktenstücks veröffentlichen will, muss mit dem Archiv handelseinig werden. Er kann sich nicht an einen billigeren Anbieter wenden.
Nach der jetzigen Rechtslage wird die Public Domain des Urheberrechts also keineswegs von den Archivgesetzen ausgehebelt. Die Schutzgüter der Archivgesetze, allen voran das Persönlichkeitsrecht, erlauben eine Kontrolle der Benutzung und der Abgabe von Reproduktionen. Sind diese Schutzgüter aber nicht tangiert, etwa bei mittelalterlichen Dokumenten, ist diese Kontrollbefugnis nicht gegeben. Wird sie trotzdem ausgeübt, ist das rechtswidrig.
Eine Änderung der Rechtslage durch Landesgesetz wäre nicht erfolgversprechend, denn das Recht des geistigen Eigentums ist abschließend vom Bund geregelt worden. Urheberrechtsgesetz, Patentgesetz, Geschmacksmustergesetz usw. sind Bundesgesetze. Die Kompetenzenordnung des Grundgesetzes schließt es aus, dass ein Landesgesetzgeber ein „Immaterialgüterrecht“ am Archivgut begründet, das mit dem Bundesgesetz über das Urheberrecht kollidiert.
Die Grundsatzentscheidung des Bundesgesetzgebers, das geistige Eigentum bei Werken, die in das Feld des Urheberrechts gehören, zu befristen, ist auch vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet worden. Das Urheberrecht als Bundesrecht blockiert also ein „geistiges Eigentum des Landes“ (bzw. des öffentlichen Archivträgers) am Archivgut als Exklusiv- oder Ausschließlichkeitsrecht.
Kulturgut ist kulturelles Allgemeingut, das sich, so das Bundesverfassungsgericht, privatrechtlicher Verfügbarkeit entzieht [21]. Versteht man Kulturgut in diesem Sinn als Eigentum der Allgemeinheit, so muss man das rechtlich geschützte Interesse der Allgemeinheit respektieren, wenn dieses den Privatinteressen der jeweiligen bürgerlichrechtlichen Eigentümer und der urheberrechtlichen Rechtsinhaber entgegengehalten wird [22]. 1811 formulierte Ludwig von Oettingen-Wallerstein über seine Kunstsammlungen: „Alle Werke des Geistes gehören der Nation, gehören der Menschheit an und in diesem Sinne allein krönen sie den Besitzer mit dem Golde ihres Reichtums“ [23].
Wenn die Kulturgüter uns allen gehören, wieso sollen wir dafür zahlen, wenn wir sie nutzen wollen?
Im Januar 2010 wurde ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 17. Dezember 2009 bekannt [24], das vermutlich erhebliche Auswirkungen auf die Bildrechtegebühren-Praxis der Archive haben wird. Es ging um das Abfilmen von Archivalien im Landesarchiv. Die bildliche Wiedergabe im Rahmen eines Fernsehbeitrags wurde vom Gericht nicht als Benutzungshandlung im Sinne der Benutzungsordnung angesehen. Ich bezweifle, dass das zugrunde liegende Problem mit ein paar flinken Umformulierungen in der Benutzungsordnung beseitigt werden kann. Wenn man den Prüfungsaufwand bei der Abgabe von Reproduktionen der Gebühr zugrunde legt, ist es fraglich, ob beliebig Nachnutzungen eingerechnet werden können, denn das Äquivalenzprinzip verlangt, so das Verwaltungsgericht Dresden schon am 25. Juli 2002 [25], eine Obergrenze der Gebühr. Reproduktionsgebühren nach dem Muster urheberrechtlicher Vergütungen zu erheben ist, um es vorsichtig zu formulieren, nach dem Münsteraner Urteil eher schwieriger als leichter geworden. Es wäre zu wünschen, wenn die Archivverwaltungen diesen „Schuss vor den Bug“ als solchen wahrnehmen würden und auf „libre Open Access“ setzen würden.
Nicht zu verkennen ist ja das Gerechtigkeitsproblem, das sich aus der Ungleichbehandlung von Erstnutzer und Nachnutzer ergibt. Der Erstnutzer einer gemeinfreien Reproduktion ist sozusagen „der Dumme“, während der Zweitnutzer die bestehende Veröffentlichung vergütungsfrei nutzen kann, ohne das Archiv zu fragen. Das Benutzungsverhältnis bindet immer nur den Benutzer, der vor Ort oder durch Bestellung einer Reproduktion nutzt. Ein Dritter, der Archivgut in Veröffentlichungen oder anhand von ihm zugänglichen Reproduktionen nutzt, ist kein Benutzer im Sinne der Archivbenutzungsordnungen. Sonst wäre auch jeder, der im Lesesaal einer Universitätsbibliothek den Abdruck einer in einem Archiv befindlichen Kaiserurkunde im Rahmen der MGH Diplomata nutzt, ein Archivbenutzer.
Für viele Archivarinnen und Archivare ist die Rechtslage längst nicht so klar. Sie fühlen sich unsicher und haben den Wunsch, die Nutzung ihres Archivguts umfassend zu kontrollieren und bei kommerziellen Nutzungen Geld für den Haushalt ihres Trägers zu vereinnahmen. Sie überspielen die Unsicherheit mit Copyfraud, indem sie nicht bestehende Archivgut-Verwertungsrechte für das Archiv postulieren. Dabei kann kein Zweifel daran bestehen, dass die nach wie vor bestehende Bindung an Recht und Gesetz der öffentlichen Verwaltung Copyfraud ausschließt. Auch wenn es dem Stadtkämmerer nicht gefällt: Es können nicht Rechte behauptet werden, die es nicht gibt.
Was gemeinfrei ist, muss gemeinfrei bleiben. Auch die Archive müssen die Public Domain respektieren. Bei älteren Dokumenten, bei denen Rechte Betroffener wie der Datenschutz nicht zu beachten sind, sollte der Benutzer mit den vom Archiv oder ihm selbst erstellten Reproduktionen von Archivgut machen dürfen, was er möchte. Ihn daran hindernde Gebühren-Schranken stehen, das hat das erwähnte Münsteraner Urteil gezeigt, auf äußerst wackeliger juristischer Grundlage. Wenn die Archive die Public Domain achten und wie das Bundesarchiv Medien, über deren Urheberrechte sie verfügen, unter Creative Commons Lizenz zur Nachnutzung („libre Open Access“) insbesondere für freie Projekte wie die Wikipedia bereitstellen, genügen sie ihrem Bildungsauftrag und der Aufgabe, das Archivgut nutzbar zu machen, am besten.
[1] Vgl. dazu Peter Suber 2008, online: http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/08-02-08.htm (alle Internetadressen wurden am 25. Januar 2010 überprüft). Zu Open Access gibt es eine Fülle von Online-Ressourcen. Materialreich und zum Einstieg geeignet ist das deutschsprachige Portal: http://www.open-access.net/. Aus archivischer Sicht beschäftigen sich viele Beiträge der Rubrik „Open Access“ des Weblogs Archivalia http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/ mit Open Access. Hier ist auch mein Kurzreferat über Open Access auf dem Essener Archivtag am 28. September 2006 nachlesbar: http://archiv.twoday.net/stories/2712317/ .
[2] Zitiert nach der nicht-offiziellen deutschen Übersetzung: http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/Berliner_Erklaerung_dt_Version_07-2006.pdf .
[3] Siehe dazu instruktiv: http://de.wikipedia.org/wiki/Schöpfungshöhe. Zu den hier und im Folgenden angesprochenen urheberrechtlichen Problemen habe ich ausführlich kritisch Stellung bezogen in dem Buch: Klaus Graf, Urheberrechtsfibel – nicht nur für Piraten. Der Text des deutschen Urheberrechtsgesetzes, erklärt und kritisch kommentiert (PiratK-UrhG). Berlin 2009 Online unter CC-BY-SA 3.0
http://ebooks.contumax.de/02-urheberrechtsfibel.pdf
oder
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-63164 .
[4] Bundestags-Drucksache IV/270, auch online: http://www.urheberrecht.org/law/normen/urhg/1965-09-09/materialien/ds_IV_270_B_01_08.php3 .
[5] Es genüge der Hinweis auf die jüngste Monographie: James Boyle, The Public Domain. Enclosing the commons of the mind. New Haven [u.a.] 2008. Online: http://www.thepublicdomain.org/download/ .
[6] http://de.wikipedia.org/wiki/Geschmacksmuster .
[7] http://de.wikipedia.org/wiki/Amtliches_Wappen .
[8] Jason Mazzone, Copyfraud. In: New York University Law Review 81 (2006), S.1026–1100. Online:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=787244 .
[9] http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzrechtsberühmung .
[10] Urteil vom 15. Juli 2005, Az.: GSZ 1/04. Online: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2005&Sort=3&nr=33818&linked=bes&Blank=1&file=dokument.pdf
[11] So das Landgericht München am 21. September 1995, Az: 7 O 1384/95.
[12] Az.: I ZR 14/88. Online: http://de.wikisource.org/wiki/Bundesgerichtshof_-_Bibelreproduktion .
[13] Vgl. Klaus Graf, Urheberrecht: Schutz der Reproduktionsfotografie? In: Kunstchronik 61 (2008), S. 206-208. Online: http://archiv.twoday.net/stories/4850312/
[14] Rainer Polley, Rechtsfragen bei der Präsentation und Benutzung digitaler Publikationen im archivischen Kontext. In. Archivpflege in Westfalen-Lippe 63 (2005), S. 33-39, hier S. 36. Online: http://www.lwl.org/waa-download/archivpflege/heft63/seite033_039_polley.pdf .
[15] Vgl. dazu Henrik Lehment, Das Fotografieren von Kunstgegenständen (Schriften zum deutschen und internationalen Persönlichkeits- und Immaterialgüterrecht 20). Göttingen 2008, S. 99-109.
[16] Az.: ZR 111/63. Online: http://de.wikisource.org/wiki/Bundesgerichtshof_-_Apfel-Madonna .
[17] Vgl. Dieter Strauch, Das Archivalieneigentum (Archivhefte 31). Köln 1998, S. 27-36.
[18] Wie sich Urheberrecht und Archivrecht bei der Benutzung urheberrechtlich geschützter Unterlagen verhalten, ist alles andere als geklärt. Ich konstruiere ein Beispiel: Ein Benutzer des Bundesarchivs will aus einer unveröffentlichten Denkschrift eines Bundesbeamten zitieren, der noch keine 70 Jahre tot ist. Wenn er eine Textpassage auswählt, die selbst Schöpfungshöhe hat, bedarf er nach § 51 UrhG der Zustimmung des Rechteinhabers. Unterstellt, der Bund als Dienstherr ist dieser Rechteinhaber, wird man aus der Sicht der Archivpraxis argumentieren können, dass das Bundesarchiv konkludent allen seinen Benutzern solche Zitate erlaubt, zumal alles andere offenkundig eine Behinderung der zeithistorischen Forschung wäre. Aber wenn man es genau nimmt, stehen die Nutzung eines geschützten Fotos oder Films, bei dem die Rechte vom Bundesarchiv gegen Entgelt wahrgenommen werden, und die soeben beschriebene „Zitat-Nutzung“ bei einem unveröffentlichten Werk urheberrechtlich auf derselben Stufe.
[19] Siehe etwa http://archiv.twoday.net/stories/3177566/ mit weiteren Hinweisen.
[20] Die einschlägigen Beiträge von Jürgen-Christoph Gödan und anderen im Bibliotheksdienst 1994 und 1995 sind online greifbar unter: http://deposit.ddb.de/ep/netpub/89/96/96/967969689/_data_stat/www.dbi-berlin.de/dbi_pub/einzelth/rechtpub/re_pu_00.htm . Wer Archivgut verwerten will – ob in Form textlicher Auszüge oder durch Bildveröffentlichung – kann sich auf die Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Grundgesetz) und die Pressefreiheit (Art. 5 Grundgesetz) berufen.
[21] So BVerfGE 58, 137 vom 14. Juli 1981. Online: http://www.servat.unibe.ch/law/dfr/bv058137.html .
[22] Vgl. Klaus Graf, Kulturgut muß frei sein! In: Kunstchronik 60 (2007), S. 507-510. Online: http://archiv.twoday.net/stories/4477824/ bzw. http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2008/529/ .
[23] Zitiert nach Jahrbuch des Historischen Vereins für Nördlingen 1917, S. 73f.
[24] Az.: 9 A 2984/07. Online: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2009/9_A_2984_07urteil20091218.html .
[25] Az.: 7 K 613/00. Online: http://www.jurpc.de/rechtspr/20030076.htm .
Von Klaus Graf
[Preprint des Beitrags für den Tagungsband des 79. Deutschen Archivtags in Regensburg 2009, Programm: http://www.archivtag.de/at2009/programm/progheft_2009.pdf
Gedruckt:
Klaus Graf: Die Public Domain und die Archive, in: Archive im digitalen Zeitalter. Überlieferung - Erschließung - Präsentation. 79. Deutscher Archivtag in Regensburg (=
Tagungsdokumentationen zum Deutschen Archivtag 14), Fulda 2010, S. 177-185
]
Beginnen möchte ich mit der Erläuterung von drei Definitionen:
1. Was ist Open Access?
2. Was ist die Public Domain?
3. Was ist Copyfraud?
Zu Punkt 1: Open Access ist zwar kein juristisch definierter Begriff, aber man kann trotzdem nicht behaupten, dass unklar wäre, was man in der Forschungspolitik darunter versteht. „Als Open Access (englisch offener Zugang) wird der freie Zugang zu wissenschaftlicher Literatur und anderen Materialien im Internet bezeichnet“, definiert die deutschsprachige Wikipedia.
Eine wichtige Unterscheidung in der Open-Access-Community betrifft gratis und libre Open Access [1].
Gratis Open Access heißt: Die Inhalte werden kostenlos für den Nutzer im allgemein zugänglichen Internet dauerhaft zugänglich gemacht.
Libre Open Access meint dagegen mehr: Es wird zusätzlich zur kostenlosen Nutzung die Möglichkeit einer Nachnutzung gewährt, ohne dass eine ausdrückliche Zustimmung eingeholt werden muss.
Als Beispiel für libre Open Access können die vom Bundesarchiv der Wikipedia zur Verfügung gestellten Fotos genannt werden. Diese befinden sich im „Wikimedia Commons“ genannten Multimedia-Pool der Wikimedia Foundation, der Trägerin der Wikipedia, und können nicht nur von den Wikipedia-Projekten, sondern von beliebigen externen Nutzern kostenlos verwendet werden. Soweit sie nicht gemeinfrei sind, weil die deutsche urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist, sind alle mit einer Creative Commons Lizenz versehen, die es ermöglicht, die Fotos zu verändern und sie beliebig – auch kommerziell – kostenlos zu nutzen, also etwa für andere Webprojekte. Erfolgt eine solche Nutzung, ist der Nachnutzer aufgrund der Creative Commons Lizenz verpflichtet, den Urheber des Fotos und die Lizenz zu nennen. Werden diese Lizenzbedingungen nicht eingehalten, liegt eine Urheberrechtsverletzung vor. Open Access heißt also nicht Public Domain: der Urheber bzw. Rechteinhaber verzichtet zwar auf die meisten, nicht aber auf alle Rechte. Der Nutzer kann mit den Medien nicht machen, was er will, sondern muss sich an bestimmte Spielregeln halten.
Die Abkürzung von Creative Commons ist CC. Die weltweit führenden Open Access Zeitschriftenverlage verwenden die liberalste CC-Lizenz CC-BY. BY steht für „Attribution“ (Urhebernennung). Beispielsweise darf man die dort veröffentlichten Artikel in andere Sprachen übersetzen, ohne den Urheber oder den Verlag zu fragen, solange der Urheber genannt wird.
Die grundlegende „Berliner Erklärung für Open Access“ vom Oktober 2003, die inzwischen weltweit von sehr vielen Wissenschaftsorganisationen unterzeichnet wurde und sich ausdrücklich auch an die kulturgutverwahrenden Institutionen wie die Archive wendet, sieht ausdrücklich nicht nur gratis Open Access, sondern auch libre Open Access vor. Es heißt dort: „Die Urheber und die Rechteinhaber solcher Veröffentlichungen gewähren allen Nutzern unwiderruflich das freie, weltweite Zugangsrecht zu diesen Veröffentlichungen und erlauben ihnen, diese Veröffentlichungen – in jedem beliebigen digitalen Medium und für jeden verantwortbaren Zweck – zu kopieren, zu nutzen, zu verbreiten, zu übertragen und öffentlich wiederzugeben sowie Bearbeitungen davon zu erstellen und zu verbreiten, sofern die Urheberschaft korrekt angegeben wird.“ [2]
Aber nicht überall, wo Open Access draufsteht, ist auch Open Access drin. Weder der Verkauf von Kirchenbuch-CD-ROMs noch der kostenlose Inhouse-Zugriff auf Digitalisate für Personal und Benutzer darf mit Fug und Recht als Open Access bezeichnet werden.
Zu Punkt 2: Was ist die Public Domain?
Public Domain ist ein urheberrechtlicher Begriff, der all das umfasst, was nicht oder nicht mehr urheberrechtlich geschützt ist. Rechteinhaber der Public Domain ist die Öffentlichkeit, sie gehört uns allen. Was zur Public Domain gehört, darf von allen ohne urheberrechtliche Beschränkungen zu beliebigen Zwecken und ohne Auflagen genutzt werden.
Zur Public Domain zählt zunächst einmal alles, was aus der Sicht des Urheberrechts überhaupt nicht schutzfähig ist, beispielsweise eine seltsam geformte Muschel, die am Strand liegt oder Nachbars Apfelbaum. Das sind keine menschlichen geistigen Schöpfungen im Sinne des Urheberrechts. Ebenfalls nicht schutzfähig sind einfache Gestaltungen, denen die sogenannte Schöpfungshöhe [3] fehlt. Ein sehr kurzer alltäglicher Aktenvermerk im Archivgut würde beispielsweise unter die nicht urheberrechtlich geschützte Gattung einfacher Gebrauchstexte fallen.
Sodann zählt zur Public Domain alles, was ein nationaler Gesetzgeber vom Urheberrechtsschutz ausgenommen hat. Beispielsweise sind nach deutschem Recht (§ 5 Urheberrechtsgesetz = UrhG) Gesetze und Verordnungen als „amtliche Werke“ nicht geschützt. In den USA sind die dienstlichen Werke der Bundesbediensteten vom Copyright ausgenommen.
Zur Public Domain gehört schließlich auch, was alt genug ist, damit der Urheberrechtsschutz abgelaufen ist.
In Deutschland und der Europäischen Union läuft der Urheberrechtsschutz 70 Jahre lang nach dem Tod des Urhebers, wobei die Frist jeweils am Jahresende endet. Da der Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud 1939 starb, sind seine Werke seit dem 1. Januar 2010 nicht mehr geschützt. Sie sind „gemeinfrei“, denn das deutsche Urheberrecht spricht statt Public Domain von „Gemeinfreiheit“.
Selbstverständlich sind auch mittelalterliche Urkunden gemeinfrei, auch wenn es im Mittelalter noch gar keine Urheberrechtsgesetze gab. Auf die aus meiner Sicht problematische Regelung des § 71 UrhG über die sogenannten „nachgelassenen Werke“, die durch Erstveröffentlichung für 25 Jahre der Public Domain wieder entrissen werden können, kann ich hier nicht näher eingehen.
Dass es kein ewiges Urheberrecht gibt, war eine bewusste Entscheidung des Bundesgesetzgebers. In der amtlichen Begründung zum Urheberrechtsgesetz heißt es, Verbreitung und Wiedergabe der „Meisterwerke der Literatur und Kunst, die in den Kulturbestand eines Volkes eingehen“, müssten „im allgemeinen Interesse jedermann freistehen“ [4]. Welche Vorteile eine reiche Public Domain für das geistige Schaffen und die Kreativität stiftet, wurde vor allem von US-Juristen breit diskutiert [5].
Eine Abgabe auf gemeinfreie Werke, die z.B. als „Goethegroschen“ bezeichnet wurde, wurde wiederholt erwogen, aber nie Gesetz.
Aus der Sicht des Urheberrechts darf man mit gemeinfreien Werken anstellen, was man möchte. Man darf seinen Namen unter ein Goethe-Gedicht setzen, es stümperhaft in Aargauer Dialekt übersetzen oder es verhohnepipeln. Goethes Erben sind dagegen machtlos. Veröffentlicht man eine solche Entstellung bei einem modernen geschützten Gedicht, kann der Urheber dagegen vorgehen.
Entscheidend ist folgende Feststellung: Gemeinfreiheit oder Public Domain bezieht sich nur auf das Urheberrecht (man kann auch ergänzen: auf das jeweilige nationale Urheberrecht).
Ein einfach gestaltetes Logo kann nach urheberrechtlicher Lehre in Deutschland als Geschmacksmuster geschützt sein, nicht aber nach dem Urheberrecht. Die Form des Zugs IntercityExpress (ICE) ist nach dem Geschmacksmustergesetz geschützt [6]. Wer kommerziell Postkarten von ICEs vertreibt, kann Ärger mit der Deutschen Bahn bekommen.
Ein traditionelles altes Stadtwappen ist urheberrechtlich gemeinfrei. Wenn aber ein Unternehmer damit wirbt, verletzt er das im bürgerlichen Recht geschützte Namensrecht der Stadt, und er verstößt gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften über die Führung kommunaler Hoheitszeichen [7].
Bei einer mittelalterlichen Urkunde kommen aber nach deutschem Recht keine solchen konkurrierenden Rechte in Betracht.
Zu Punkt 3: Was ist Copyfraud?
Copyfraud ist ein von dem US-Juristen Jason Mazzone in einem inzwischen einflussreichen Aufsatz aus dem Jahr 2006 [8] geprägter Begriff, der sich – in der Form eines Wortspiels, vergleichbar Copyleft statt Copyright – gegen die unberechtigte Beanspruchung von Urheberrechten bei gemeinfreien Werken wendet. In der deutschen Rechtssprache begegnet man dem Begriff „Schutzrechtsberühmung“ [9].
Firmen, die unberechtigt abgemahnt werden, weil sie angeblich ein Schutzrecht verletzen, können gegenüber dem Abmahner einen Schadensersatzanspruch geltend machen, also beispielsweise die eigenen Anwaltskosten ersetzt verlangen. Die „Wirkung des Ausschließlichkeitsrechts“, befand der Bundesgerichtshof, „verlangt nach einem Korrelat, welches sicherstellt, dass der Wettbewerb nicht über die objektiven Grenzen hinaus eingeschränkt wird, durch die das Gesetz den für schutzfähig erachteten Gegenstand und seinen Schutzbereich bestimmt“ [10]. Wenn man verlangt, dass man das Urheberrecht respektiert, muss man auch die Grenzen des Urheberrechts respektieren.
Wird eine gemeinfreie Notenausgabe mit einem Copyright-Zeichen versehen, so kann ein Mitbewerber nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb dagegen vorgehen [11].
Copyfraud liegt beispielsweise vor, wenn ein Archiv auf Fotokopien einen Stempel anbringt, wonach diese Kopien urheberrechtlich geschützt sind. Dass beim Fotokopieren keine neuen Urheberrechte entstehen, ist unbestritten.
Es leuchtet ein, dass Copyfraud die Public Domain rechtswidrig schädigt. Wer unberechtigte Ansprüche erhebt und ein nicht-existierendes Schutzrecht behauptet, verstößt gegen die gesetzlichen Wertungen. Fügt er anderen einen Vermögensschaden zu, kann sogar eine Strafbarkeit als Betrug gegeben sein.
Copyfraud liegt übrigens auch dann vor, wenn man Medien unter eine Creative Commons Lizenz stellt, die in Wirklichkeit gemeinfrei sind.
Ist ein Fotograf 70 Jahre tot, dürfen Reproduktionen seiner Bilder nicht unter eine solche Lizenz gestellt werden. Seit der Entscheidung „Bibelreproduktion“ des Bundesgerichtshofs vom 8. November 1989 ist klar, dass originalgetreue Reproduktionen von Fotos („Bild vom Bild“) nicht schutzfähig sind [12].
Auch bei der üblichen Flachware in Archiven kann davon ausgegangen werden, dass kein Leistungsschutzrecht nach § 72 UrhG, der sogenannte Schutz einfacher Lichtbilder, besteht [13]. Schriftstücke sind zweidimensionale Vorlagen (auch wenn sie unter dem Mikroskop gebirgig aussehen). Werden sie digitalisiert oder sonst originalgetreu reproduziert, kommt kein Urheberrechtsschutz zustande. Rainer Polley sieht das ebenso wie ich [14]. Also: Die archivüblichen Reproduktionen sind urheberrechtlich nicht geschützt.
Nach diesen ersten drei Punkten, die Open Access, Public Domain und Copyfraud erläutert haben, möchte ich im zweiten Teil meiner Ausführungen die folgende These zu widerlegen versuchen:
Die urheberrechtliche Gemeinfreiheit oder Public Domain ist für die Archive irrelevant, weil sie überlagert wird vom Eigentumsrecht des Archivträgers und archivrechtlichen Rechtsvorschriften.
Zunächst zum Eigentumsrecht. Es ist gerichtlich hinreichend geklärt, dass es kein „Recht am Bild der eigenen Sache“ gibt [15]. Selbst wenn sich aus dem Eigentum oder vertraglichen Vereinbarungen eine Bindung des Erstnutzers ergäbe, könnte ein Dritter, der das Stück verwertet, nicht belangt werden.
Der Bundesgerichtshof hat das in seiner noch immer maßgeblichen Entscheidung „Apfel-Madonna“ 1965 geklärt [16]. Es ging um die Nachbildung einer gemeinfreien mittelalterlichen Marien-Skulptur aus einem Aachener Museum. Ich zitiere aus dem Urteil: Hat „der Eigentümer […] einem Dritten gestattet, das gemeinfreie Werk nachzubilden und diese Nachbildung in den Verkehr zu bringen, so kann er […] weitere Nachbildungen des Originals durch andere Personen, die hierbei die mit seiner Erlaubnis hergestellte Kopie als Vorlage benutzen, nicht verhindern“.
Gestattet ein Unternehmensarchiv einem Benutzer, ein als Kopie zur Verfügung gestelltes Aktenstück in einem Buch als Faksimile abzudrucken, so kann es die weitere Verwertung durch Dritte, die das Schriftstück aus dem Buch scannen und ins Internet stellen können, nicht mehr kontrollieren. Es ist dann irrelevant, welche Knebel- oder Honorarverträge das Archiv mit dem Benutzer geschlossen haben mag. Sobald ein gemeinfreies Werk (vorausgesetzt es handelt sich um „Flachware“) in originalgetreuer Reproduktion in die Öffentlichkeit gelangt, endet die Verfügungsmacht des Eigentümers.
Bei „öffentlichen Sachen“ [17] kommt hinzu, dass die Sachherrschaft des Eigentümers überlagert wird von ihrer öffentlich-rechtlichen Zweckbestimmung. Diese Zweckbestimmung ergibt sich bei Archivalien in öffentlichen Archiven aus dem Archivrecht, also aus den Archivgesetzen.
Ist die Public Domain irrelevant, weil alles Archivgut eingebunden ist in die durch Rechtsnormen, nämlich die Archivgesetze, geregelte Verwaltung des Archivguts in den Archiven?
Zunächst einmal ist festzustellen: Alle deutschen Archivgesetze enthalten keine Befugnisnormen, die es Archiven erlauben, Bildrechte gemeinfreier Vorlagen zu vermarkten. Bis hin zum Landesgesetzgeber von Nordrhein-Westfalen, der bei Niederschrift dieser Zeilen gerade die Novellierung des Archivgesetzes diskutiert, haben die Parlamente des Bundes und der Länder keine Veranlassung gesehen, einen meines Erachtens durchaus wesentlichen Punkt zu regeln: Ob und wie das im Archivgut verkörperte geistige Eigentum vermarktet, also kommerziell verwertet werden darf, und wie sich diese Vermarktung zu den archivrechtlich gewährleisteten Nutzungsrechten der Benutzer verhält [18]. Wesentliche Entscheidungen müssen durch Gesetz getroffen werden, sie der Verwaltungspraxis zu überlassen, kann Eingriffe in Benutzerrechte nicht rechtfertigen.
Nach der jetzigen Systematik der Archivgesetze kommt eine Kontrolle des geistigen Gehalts des Archivguts nur dann in Betracht, wenn es um die Schutzgüter geht, denen diese Gesetze verpflichtet sind. An erster Stelle stehen der Datenschutz und das informationelle Selbstbestimmungsrecht sowie das postmortale Persönlichkeitsrecht, es sind aber auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, soweit sie im Archivgut dokumentiert sind, zu wahren. Soweit das Wohl des Bundes oder eines Landes betroffen ist, liegt die Hürde für die Einsichtsverweigerung so hoch, dass es ausgeschlossen ist, das fiskalische Interesse an der Vermarktung von Bildrechten damit zu verbinden.
Man kann es auch so formulieren: Es gehört nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der Archive, Bildrechte gemeinfreier Vorlagen zu kommerzialisieren. Die Archive dürfen aber nur im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben tätig werden.
Entsprechende Genehmigungsvorbehalte in Archivbenutzungsordnungen, die die Veröffentlichung und Weitergabe von Reproduktionen an die Zustimmung des Archivs knüpfen, sind nicht hinreichend ermächtigt [19]. Für Textwiedergaben ist hinreichend geklärt, dass Bibliotheken oder Archive in öffentlicher Trägerschaft keine Befugnis haben, die Edition von ihrer Genehmigung abhängig zu machen. Ein solcher Eingriff in die Forschungsfreiheit bedürfte einer gesetzlichen Ermächtigung [20]. Ich sehe keinen Grund, dieses Ergebnis nicht auch auf die Bilder des Archivguts zu übertragen.
Nicht vernachlässigt werden darf der Gesichtspunkt, dass Archive ein „Monopol“ an ihren Beständen haben. Sie haben den exklusiven Zugriff auf das Vermarktungs-Potential, der von der gemeinsamen Wirtschaftsordnung der EU gewünschte Wettbewerb findet nicht statt. Wer das Bild eines alten Aktenstücks veröffentlichen will, muss mit dem Archiv handelseinig werden. Er kann sich nicht an einen billigeren Anbieter wenden.
Nach der jetzigen Rechtslage wird die Public Domain des Urheberrechts also keineswegs von den Archivgesetzen ausgehebelt. Die Schutzgüter der Archivgesetze, allen voran das Persönlichkeitsrecht, erlauben eine Kontrolle der Benutzung und der Abgabe von Reproduktionen. Sind diese Schutzgüter aber nicht tangiert, etwa bei mittelalterlichen Dokumenten, ist diese Kontrollbefugnis nicht gegeben. Wird sie trotzdem ausgeübt, ist das rechtswidrig.
Eine Änderung der Rechtslage durch Landesgesetz wäre nicht erfolgversprechend, denn das Recht des geistigen Eigentums ist abschließend vom Bund geregelt worden. Urheberrechtsgesetz, Patentgesetz, Geschmacksmustergesetz usw. sind Bundesgesetze. Die Kompetenzenordnung des Grundgesetzes schließt es aus, dass ein Landesgesetzgeber ein „Immaterialgüterrecht“ am Archivgut begründet, das mit dem Bundesgesetz über das Urheberrecht kollidiert.
Die Grundsatzentscheidung des Bundesgesetzgebers, das geistige Eigentum bei Werken, die in das Feld des Urheberrechts gehören, zu befristen, ist auch vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet worden. Das Urheberrecht als Bundesrecht blockiert also ein „geistiges Eigentum des Landes“ (bzw. des öffentlichen Archivträgers) am Archivgut als Exklusiv- oder Ausschließlichkeitsrecht.
Kulturgut ist kulturelles Allgemeingut, das sich, so das Bundesverfassungsgericht, privatrechtlicher Verfügbarkeit entzieht [21]. Versteht man Kulturgut in diesem Sinn als Eigentum der Allgemeinheit, so muss man das rechtlich geschützte Interesse der Allgemeinheit respektieren, wenn dieses den Privatinteressen der jeweiligen bürgerlichrechtlichen Eigentümer und der urheberrechtlichen Rechtsinhaber entgegengehalten wird [22]. 1811 formulierte Ludwig von Oettingen-Wallerstein über seine Kunstsammlungen: „Alle Werke des Geistes gehören der Nation, gehören der Menschheit an und in diesem Sinne allein krönen sie den Besitzer mit dem Golde ihres Reichtums“ [23].
Wenn die Kulturgüter uns allen gehören, wieso sollen wir dafür zahlen, wenn wir sie nutzen wollen?
Im Januar 2010 wurde ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 17. Dezember 2009 bekannt [24], das vermutlich erhebliche Auswirkungen auf die Bildrechtegebühren-Praxis der Archive haben wird. Es ging um das Abfilmen von Archivalien im Landesarchiv. Die bildliche Wiedergabe im Rahmen eines Fernsehbeitrags wurde vom Gericht nicht als Benutzungshandlung im Sinne der Benutzungsordnung angesehen. Ich bezweifle, dass das zugrunde liegende Problem mit ein paar flinken Umformulierungen in der Benutzungsordnung beseitigt werden kann. Wenn man den Prüfungsaufwand bei der Abgabe von Reproduktionen der Gebühr zugrunde legt, ist es fraglich, ob beliebig Nachnutzungen eingerechnet werden können, denn das Äquivalenzprinzip verlangt, so das Verwaltungsgericht Dresden schon am 25. Juli 2002 [25], eine Obergrenze der Gebühr. Reproduktionsgebühren nach dem Muster urheberrechtlicher Vergütungen zu erheben ist, um es vorsichtig zu formulieren, nach dem Münsteraner Urteil eher schwieriger als leichter geworden. Es wäre zu wünschen, wenn die Archivverwaltungen diesen „Schuss vor den Bug“ als solchen wahrnehmen würden und auf „libre Open Access“ setzen würden.
Nicht zu verkennen ist ja das Gerechtigkeitsproblem, das sich aus der Ungleichbehandlung von Erstnutzer und Nachnutzer ergibt. Der Erstnutzer einer gemeinfreien Reproduktion ist sozusagen „der Dumme“, während der Zweitnutzer die bestehende Veröffentlichung vergütungsfrei nutzen kann, ohne das Archiv zu fragen. Das Benutzungsverhältnis bindet immer nur den Benutzer, der vor Ort oder durch Bestellung einer Reproduktion nutzt. Ein Dritter, der Archivgut in Veröffentlichungen oder anhand von ihm zugänglichen Reproduktionen nutzt, ist kein Benutzer im Sinne der Archivbenutzungsordnungen. Sonst wäre auch jeder, der im Lesesaal einer Universitätsbibliothek den Abdruck einer in einem Archiv befindlichen Kaiserurkunde im Rahmen der MGH Diplomata nutzt, ein Archivbenutzer.
Für viele Archivarinnen und Archivare ist die Rechtslage längst nicht so klar. Sie fühlen sich unsicher und haben den Wunsch, die Nutzung ihres Archivguts umfassend zu kontrollieren und bei kommerziellen Nutzungen Geld für den Haushalt ihres Trägers zu vereinnahmen. Sie überspielen die Unsicherheit mit Copyfraud, indem sie nicht bestehende Archivgut-Verwertungsrechte für das Archiv postulieren. Dabei kann kein Zweifel daran bestehen, dass die nach wie vor bestehende Bindung an Recht und Gesetz der öffentlichen Verwaltung Copyfraud ausschließt. Auch wenn es dem Stadtkämmerer nicht gefällt: Es können nicht Rechte behauptet werden, die es nicht gibt.
Was gemeinfrei ist, muss gemeinfrei bleiben. Auch die Archive müssen die Public Domain respektieren. Bei älteren Dokumenten, bei denen Rechte Betroffener wie der Datenschutz nicht zu beachten sind, sollte der Benutzer mit den vom Archiv oder ihm selbst erstellten Reproduktionen von Archivgut machen dürfen, was er möchte. Ihn daran hindernde Gebühren-Schranken stehen, das hat das erwähnte Münsteraner Urteil gezeigt, auf äußerst wackeliger juristischer Grundlage. Wenn die Archive die Public Domain achten und wie das Bundesarchiv Medien, über deren Urheberrechte sie verfügen, unter Creative Commons Lizenz zur Nachnutzung („libre Open Access“) insbesondere für freie Projekte wie die Wikipedia bereitstellen, genügen sie ihrem Bildungsauftrag und der Aufgabe, das Archivgut nutzbar zu machen, am besten.
[1] Vgl. dazu Peter Suber 2008, online: http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/08-02-08.htm (alle Internetadressen wurden am 25. Januar 2010 überprüft). Zu Open Access gibt es eine Fülle von Online-Ressourcen. Materialreich und zum Einstieg geeignet ist das deutschsprachige Portal: http://www.open-access.net/. Aus archivischer Sicht beschäftigen sich viele Beiträge der Rubrik „Open Access“ des Weblogs Archivalia http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/ mit Open Access. Hier ist auch mein Kurzreferat über Open Access auf dem Essener Archivtag am 28. September 2006 nachlesbar: http://archiv.twoday.net/stories/2712317/ .
[2] Zitiert nach der nicht-offiziellen deutschen Übersetzung: http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/Berliner_Erklaerung_dt_Version_07-2006.pdf .
[3] Siehe dazu instruktiv: http://de.wikipedia.org/wiki/Schöpfungshöhe. Zu den hier und im Folgenden angesprochenen urheberrechtlichen Problemen habe ich ausführlich kritisch Stellung bezogen in dem Buch: Klaus Graf, Urheberrechtsfibel – nicht nur für Piraten. Der Text des deutschen Urheberrechtsgesetzes, erklärt und kritisch kommentiert (PiratK-UrhG). Berlin 2009 Online unter CC-BY-SA 3.0
http://ebooks.contumax.de/02-urheberrechtsfibel.pdf
oder
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-63164 .
[4] Bundestags-Drucksache IV/270, auch online: http://www.urheberrecht.org/law/normen/urhg/1965-09-09/materialien/ds_IV_270_B_01_08.php3 .
[5] Es genüge der Hinweis auf die jüngste Monographie: James Boyle, The Public Domain. Enclosing the commons of the mind. New Haven [u.a.] 2008. Online: http://www.thepublicdomain.org/download/ .
[6] http://de.wikipedia.org/wiki/Geschmacksmuster .
[7] http://de.wikipedia.org/wiki/Amtliches_Wappen .
[8] Jason Mazzone, Copyfraud. In: New York University Law Review 81 (2006), S.1026–1100. Online:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=787244 .
[9] http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzrechtsberühmung .
[10] Urteil vom 15. Juli 2005, Az.: GSZ 1/04. Online: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2005&Sort=3&nr=33818&linked=bes&Blank=1&file=dokument.pdf
[11] So das Landgericht München am 21. September 1995, Az: 7 O 1384/95.
[12] Az.: I ZR 14/88. Online: http://de.wikisource.org/wiki/Bundesgerichtshof_-_Bibelreproduktion .
[13] Vgl. Klaus Graf, Urheberrecht: Schutz der Reproduktionsfotografie? In: Kunstchronik 61 (2008), S. 206-208. Online: http://archiv.twoday.net/stories/4850312/
[14] Rainer Polley, Rechtsfragen bei der Präsentation und Benutzung digitaler Publikationen im archivischen Kontext. In. Archivpflege in Westfalen-Lippe 63 (2005), S. 33-39, hier S. 36. Online: http://www.lwl.org/waa-download/archivpflege/heft63/seite033_039_polley.pdf .
[15] Vgl. dazu Henrik Lehment, Das Fotografieren von Kunstgegenständen (Schriften zum deutschen und internationalen Persönlichkeits- und Immaterialgüterrecht 20). Göttingen 2008, S. 99-109.
[16] Az.: ZR 111/63. Online: http://de.wikisource.org/wiki/Bundesgerichtshof_-_Apfel-Madonna .
[17] Vgl. Dieter Strauch, Das Archivalieneigentum (Archivhefte 31). Köln 1998, S. 27-36.
[18] Wie sich Urheberrecht und Archivrecht bei der Benutzung urheberrechtlich geschützter Unterlagen verhalten, ist alles andere als geklärt. Ich konstruiere ein Beispiel: Ein Benutzer des Bundesarchivs will aus einer unveröffentlichten Denkschrift eines Bundesbeamten zitieren, der noch keine 70 Jahre tot ist. Wenn er eine Textpassage auswählt, die selbst Schöpfungshöhe hat, bedarf er nach § 51 UrhG der Zustimmung des Rechteinhabers. Unterstellt, der Bund als Dienstherr ist dieser Rechteinhaber, wird man aus der Sicht der Archivpraxis argumentieren können, dass das Bundesarchiv konkludent allen seinen Benutzern solche Zitate erlaubt, zumal alles andere offenkundig eine Behinderung der zeithistorischen Forschung wäre. Aber wenn man es genau nimmt, stehen die Nutzung eines geschützten Fotos oder Films, bei dem die Rechte vom Bundesarchiv gegen Entgelt wahrgenommen werden, und die soeben beschriebene „Zitat-Nutzung“ bei einem unveröffentlichten Werk urheberrechtlich auf derselben Stufe.
[19] Siehe etwa http://archiv.twoday.net/stories/3177566/ mit weiteren Hinweisen.
[20] Die einschlägigen Beiträge von Jürgen-Christoph Gödan und anderen im Bibliotheksdienst 1994 und 1995 sind online greifbar unter: http://deposit.ddb.de/ep/netpub/89/96/96/967969689/_data_stat/www.dbi-berlin.de/dbi_pub/einzelth/rechtpub/re_pu_00.htm . Wer Archivgut verwerten will – ob in Form textlicher Auszüge oder durch Bildveröffentlichung – kann sich auf die Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Grundgesetz) und die Pressefreiheit (Art. 5 Grundgesetz) berufen.
[21] So BVerfGE 58, 137 vom 14. Juli 1981. Online: http://www.servat.unibe.ch/law/dfr/bv058137.html .
[22] Vgl. Klaus Graf, Kulturgut muß frei sein! In: Kunstchronik 60 (2007), S. 507-510. Online: http://archiv.twoday.net/stories/4477824/ bzw. http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2008/529/ .
[23] Zitiert nach Jahrbuch des Historischen Vereins für Nördlingen 1917, S. 73f.
[24] Az.: 9 A 2984/07. Online: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2009/9_A_2984_07urteil20091218.html .
[25] Az.: 7 K 613/00. Online: http://www.jurpc.de/rechtspr/20030076.htm .
KlausGraf - am Samstag, 30. Januar 2010, 17:04 - Rubrik: Open Access
KlausGraf - am Samstag, 30. Januar 2010, 15:33 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 30. Januar 2010, 15:32 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 30. Januar 2010, 15:28 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus der Besprechung Andreas Platthaus´in der FAZ": " .... Er erzählt von Hans Frambach, der in Berlin als Archivar in einem „Institut für Vergangenheitsbewirtschaftung“ arbeitet. Dort wird „die Dunkelheit, aus der dieser Staat vor langer Zeit hervorgekrochen war, in das hellste Licht gestellt und zu seinem Eigentlichen erklärt“. Deshalb der Titel des Romans – und weil das Leiden an der deutschen Vergangenheit für den 1962 geborenen Frambach das selbstverständliche Unglück begründet, dem er sich verpflichtet fühlt. Denn „es war nicht sein Unglück, sondern Das Unglück. Wenn er es von sich abzog, blieb nichts von ihm übrig.“ Dieses Unglück ist sein Eigentliches. ...."
Literaturverlag Droschl, Wien 2010. 176 S.
Wolf Thomas - am Samstag, 30. Januar 2010, 15:00 - Rubrik: Wahrnehmung
KlausGraf - am Samstag, 30. Januar 2010, 14:59 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
King’s College London is undertaking what they call ‘strategic
disinvestment’ and have recently informed Professor David Ganz that funding for his Chair in Palaeography will cease from 31 August this year, when he will be out of a job. This is part of a wider context whereby all academic staff in the School of Arts and Humanities at King’s have to re-apply for their own jobs before the 1st of March. They think this the “most humane way” of losing 22 academic posts.
This is the only established chair in Palaeography in the UK
(previously held by Julian Brown and Tilly de la Mare). The more
people who write in protest the better.
The people to write to are:
Professor Richard Trainor, MA DPhil FRHistS AcSS FKC
The Principal
King’s College
The Strand
London WC2R 2LS
United Kingdom
principal@kcl.ac.uk
copied to:
Professor Jan Palmowski
Head of the School of Arts and Humanities
King’s College
The Strand
London WC2R 2LS
United Kingdom
jan.palmowski@kcl.ac.uk
--
George FERZOCO
gpferzoco@gmail.com
See
http://archiv.twoday.net/stories/6162072/
disinvestment’ and have recently informed Professor David Ganz that funding for his Chair in Palaeography will cease from 31 August this year, when he will be out of a job. This is part of a wider context whereby all academic staff in the School of Arts and Humanities at King’s have to re-apply for their own jobs before the 1st of March. They think this the “most humane way” of losing 22 academic posts.
This is the only established chair in Palaeography in the UK
(previously held by Julian Brown and Tilly de la Mare). The more
people who write in protest the better.
The people to write to are:
Professor Richard Trainor, MA DPhil FRHistS AcSS FKC
The Principal
King’s College
The Strand
London WC2R 2LS
United Kingdom
principal@kcl.ac.uk
copied to:
Professor Jan Palmowski
Head of the School of Arts and Humanities
King’s College
The Strand
London WC2R 2LS
United Kingdom
jan.palmowski@kcl.ac.uk
--
George FERZOCO
gpferzoco@gmail.com
See
http://archiv.twoday.net/stories/6162072/
KlausGraf - am Samstag, 30. Januar 2010, 14:42 - Rubrik: English Corner

Quelle: Hochschule für bildende Künste Braunschweig
" ..... In seinem "begehbaren Archiv" zeigt der renommierte Bildhauer und HBK-Professor Raimund Kummer in der Galerie der Kunsthochschule 200 Farbfotos. Sie liegen in offenen Schachteln, die wiederum auf geschlossene Schachteln gestapelt sind, was zweierlei suggeriert. Erstens: Es muss in Kummers Archiv noch unendlich viel mehr Bilder geben, wir sehen nur die oberste Schicht. Zweitens: Mit der U-förmigen Anordnung der gestapelten Archiv-Kästen wird diese Foto-Schau zugleich zur Raum-Installation.
Auch in den Fotos selbst, die offenbar entweder Kummers Objekte festhalten oder einen Ideen-Findungs-Prozess dokumentieren, verschwimmen die Grenzen zwischen dem zweidimensionalen Bild und dem dreidimensionalen Objekt. Sie sind fast immer so kunstvoll inszeniert, so effektvoll beleuchtet, dass man sie sich sofort als Real-Inszenierungen vorstellen kann.
Da ist natürlich wie immer bei solchen Bildermassen die Gefahr der Beliebigkeit, manchmal auch der Gefälligkeit, gegeben. Aber: Wer so verschwenderisch mit so starken Fotos umgeht, der muss schon über eine unheimliche Fülle inszenatorischer Fantasie verfügen. Und man bekommt eine Ahnung von dem, was den Bildhauer Kummer umtreibt: die Körperlichkeit, das pulsierende Leben, das Sehen selbst in Kunst zu verwandeln. ...."
Quelle: Braunschweiger Zeitung
Ort: Kunsthochschule Braunschweig, bis 12. Februar, montags - freitags 13 - 18 Uhr, donnerstags 13 - 20 Uhr.
Wolf Thomas - am Samstag, 30. Januar 2010, 14:38 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Das brüchige Plakat kündigt einen Auftritt von Albert Mangelsdorff in Zaragoza 1966 an. Behutsam entfernt Restauratorin Jana Moczarski Jahrzehnte alte Klebestreifen von dem Exponat. Ins Papier bereits eingedrungenen Klebstoff muss sie mit Lösungsmitteln heraussaugen, Risse werden mit sogenanntem Japanpapier geklebt. «Die Arbeit ist schon sehr aufwendig», gesteht die Restauratorin. Insgesamt 40 Regalmeter voll Utensilien hat das Frankfurter Institut für Stadtgeschichte aus dem Nachlass des weltberühmten Jazzposaunisten und -komponisten Albert Mangelsdorff erworben. In etwa einem Jahr soll das bis dahin angelegte Archiv der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Im Laufe der Jahrzehnte hat sich bei dem 2005 gestorbenen Musiker so einiges angesammelt. Die Archivare staunten nicht schlecht, als sie den von Witwe Ilo Mangelsdorff zur Verfügung gestellten Nachlass aus der Wohnung im Frankfurter Westend abholten. Schallplattenpreise, Verdienstorden, Tourneepläne, Tonbänder, Kisten voll mit Notenpapier, Instrumente, Briefe und selbst die Rechnung von Mangelsdorffs erster «King»-Posaune hatte die Jazz-Legende aufgehoben. «Es ist einer der größten Nachlässe, die ich bislang bearbeitet habe», sagt Diplom-Archivarin Silvia Stenger, die schon seit rund 20 Jahren beim Institut für Stadtgeschichte arbeitet. .....
«Es ist mir ungeheuer schwer gefallen, mich von den Sachen zu trennen», sagt Ilo Mangelsdorff und ergänzt: «Es wäre aber sicherlich im Interesse meines Mannes gewesen, und ich weiß die Sachen beim Institut für Stadtgeschichte in guten Händen.»
Dort lagern die Exponate im Magazin 4 der Außenstelle des Instituts im Stadtteil Bergen-Enkheim. Insgesamt verwahrt das Institut in seinen Kellern im Karmeliterkloster und in seiner Außenstelle rund 20 Regalkilometer historisches Material. Dagegen nehmen sich die 40 Regalmeter aus dem Nachlass Mangelsdorffs doch recht bescheiden aus.
Nun wird dieser Nachlass akribisch aufbereitet. Die Blätter und Schriften werden konservatorisch verpackt, um sie für die Nachwelt zu erhalten. «Schlechtes Verpackungsmaterial wie etwa Schnellhefter aus Plastik setzt beim Altern Säure frei und beschädigt die Dokumente», verrät Restauratorin Moczarski. Derweil ist ein eigens engagierter Musikwissenschaftler dabei, fünf Kisten voll mit losen Notenblättern zu sortieren und die Kompositionen Note für Note zu erfassen.
«Es würde uns natürlich freuen, wenn die Arbeit sich lohnt und das Archiv später auch genutzt wird», sagt Archivarin Stenger. Allerdings wird der komplette Nachlass nicht für die breite Öffentlichkeit zugänglich sein, sondern nur «zu berechtigten Forschungszwecken» eingesehen werden können. Der Nachlass des berühmten Musikers soll der Grundstock für ein «Jazz-Archiv» mit weiteren bedeutenden Zeugnissen der Frankfurter Jazzgeschichte werden. Dazu hatte die Stadt einen Aufruf unter den Bürgern gestartet und so auch eine kleine Sammlung vom ehemaligen Jazzkeller-Wirt Willi Geipel erhalten.
Ein Teil des Nachlasses soll später aber auch in Ausstellungen zu sehen sein, wie etwa die derzeit eingelagerten Instrumente Mangelsdorffs oder auch ein Trikot von Thomas Rohrbach, einst Spieler des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Das Trikot seines Freundes Rohrbach trug Mangelsdorff bei einem Konzert in den 70er Jahren in der Jahrhunderthalle, weil anderntags ein DFB-Pokalendspiel seines Lieblingsvereins anstand."
Link
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/5510382/
Im Laufe der Jahrzehnte hat sich bei dem 2005 gestorbenen Musiker so einiges angesammelt. Die Archivare staunten nicht schlecht, als sie den von Witwe Ilo Mangelsdorff zur Verfügung gestellten Nachlass aus der Wohnung im Frankfurter Westend abholten. Schallplattenpreise, Verdienstorden, Tourneepläne, Tonbänder, Kisten voll mit Notenpapier, Instrumente, Briefe und selbst die Rechnung von Mangelsdorffs erster «King»-Posaune hatte die Jazz-Legende aufgehoben. «Es ist einer der größten Nachlässe, die ich bislang bearbeitet habe», sagt Diplom-Archivarin Silvia Stenger, die schon seit rund 20 Jahren beim Institut für Stadtgeschichte arbeitet. .....
«Es ist mir ungeheuer schwer gefallen, mich von den Sachen zu trennen», sagt Ilo Mangelsdorff und ergänzt: «Es wäre aber sicherlich im Interesse meines Mannes gewesen, und ich weiß die Sachen beim Institut für Stadtgeschichte in guten Händen.»
Dort lagern die Exponate im Magazin 4 der Außenstelle des Instituts im Stadtteil Bergen-Enkheim. Insgesamt verwahrt das Institut in seinen Kellern im Karmeliterkloster und in seiner Außenstelle rund 20 Regalkilometer historisches Material. Dagegen nehmen sich die 40 Regalmeter aus dem Nachlass Mangelsdorffs doch recht bescheiden aus.
Nun wird dieser Nachlass akribisch aufbereitet. Die Blätter und Schriften werden konservatorisch verpackt, um sie für die Nachwelt zu erhalten. «Schlechtes Verpackungsmaterial wie etwa Schnellhefter aus Plastik setzt beim Altern Säure frei und beschädigt die Dokumente», verrät Restauratorin Moczarski. Derweil ist ein eigens engagierter Musikwissenschaftler dabei, fünf Kisten voll mit losen Notenblättern zu sortieren und die Kompositionen Note für Note zu erfassen.
«Es würde uns natürlich freuen, wenn die Arbeit sich lohnt und das Archiv später auch genutzt wird», sagt Archivarin Stenger. Allerdings wird der komplette Nachlass nicht für die breite Öffentlichkeit zugänglich sein, sondern nur «zu berechtigten Forschungszwecken» eingesehen werden können. Der Nachlass des berühmten Musikers soll der Grundstock für ein «Jazz-Archiv» mit weiteren bedeutenden Zeugnissen der Frankfurter Jazzgeschichte werden. Dazu hatte die Stadt einen Aufruf unter den Bürgern gestartet und so auch eine kleine Sammlung vom ehemaligen Jazzkeller-Wirt Willi Geipel erhalten.
Ein Teil des Nachlasses soll später aber auch in Ausstellungen zu sehen sein, wie etwa die derzeit eingelagerten Instrumente Mangelsdorffs oder auch ein Trikot von Thomas Rohrbach, einst Spieler des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Das Trikot seines Freundes Rohrbach trug Mangelsdorff bei einem Konzert in den 70er Jahren in der Jahrhunderthalle, weil anderntags ein DFB-Pokalendspiel seines Lieblingsvereins anstand."
Link
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/5510382/
Wolf Thomas - am Samstag, 30. Januar 2010, 14:27 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Bericht der Sendung "nano" (3sat) zum Erhalt historischer Buntfilme: "Wo Farbfilme verblassen, soll ein dreimal längerer Schwarzweißfilm die Filmkunst der Deutschen für die Ewigkeit konservieren."
Link zum Video
Link zum Video
Wolf Thomas - am Samstag, 30. Januar 2010, 13:57 - Rubrik: Filmarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zur Zeit wird die gedruckte Opernpartitur "La vestale" von Gaspare Spontini, die als Oper 1807 in Paris uraufgeführt wurde und bei Erard 1808 als Druck von 511 Seiten im Folio-Format erschien, in der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg (Frankfurt am Main) restauriert und anschließend digitalisiert.
werkvermittlung - am Samstag, 30. Januar 2010, 10:29 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://bibliothekarisch.de/blog/2010/01/29/aus-aktuellem-anlass-ueber-den-zustand-der-bibliotheken-und-anderer-kultureinrichtungen-in-haiti

Logan Abassi http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de

Logan Abassi http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Librarians are in general very favourable to the principles of Open Access, but surprisingly few libraries have so far set free the data they produce themselves. As one of the first scientific libraries in the world, the CERN Library offers now the bibliographic book records, held in its library catalog, to be freely downloaded by any third party. The records are provided under the Public Domain Data License, a license that permits colleagues around the world to reuse and upgrade the data for any purpose.
Jens Vigen, Head of the CERN Library, says: "Books should only be catalogued once. Currently the public purse pays for having the same book catalogued over and over again. Librarians should act as they preach: data sets created through public funding should be made freely available to anyone interested. Open Access is natural for us, here at CERN we believe in openness and reuse. There is a tremendous potential. By getting academic libraries worldwide involved in this movement, it will lead to a natural atmosphere of sharing and reusing bibliographic data in a rich landscape of so-called mash-up services, where most of the actors who will be involved, both among the users and the providers, will not even be library users or librarians. Our action is made in the spirit of the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities; bibliographic data belongs to the cultural heritage.All other signatories should align their policy accordingly."
The data of CERN Library will be used by the Open Library Project to provide a webpage for every book and allow users to add content like table of contents, classifications and summaries.
For massive reuse of data, the data will be provided soon by an open Z39.50, SRU and OAI interface via biblios.net, a repository of open bibliographic data.
The whole dataset can be downloaded from
http://cern.ch/bookdata
The press announcement is accompanied by a YouTube Video that can be found at:
http://www.youtube.com/watch?v=-CSmieTXbsk (My emphasis, KG)
Jens Vigen, Head of the CERN Library, says: "Books should only be catalogued once. Currently the public purse pays for having the same book catalogued over and over again. Librarians should act as they preach: data sets created through public funding should be made freely available to anyone interested. Open Access is natural for us, here at CERN we believe in openness and reuse. There is a tremendous potential. By getting academic libraries worldwide involved in this movement, it will lead to a natural atmosphere of sharing and reusing bibliographic data in a rich landscape of so-called mash-up services, where most of the actors who will be involved, both among the users and the providers, will not even be library users or librarians. Our action is made in the spirit of the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities; bibliographic data belongs to the cultural heritage.All other signatories should align their policy accordingly."
The data of CERN Library will be used by the Open Library Project to provide a webpage for every book and allow users to add content like table of contents, classifications and summaries.
For massive reuse of data, the data will be provided soon by an open Z39.50, SRU and OAI interface via biblios.net, a repository of open bibliographic data.
The whole dataset can be downloaded from
http://cern.ch/bookdata
The press announcement is accompanied by a YouTube Video that can be found at:
http://www.youtube.com/watch?v=-CSmieTXbsk (My emphasis, KG)
KlausGraf - am Freitag, 29. Januar 2010, 23:46 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://oaister.worldcat.org/advancedsearch
Zwar sind die Suchoptionen geringfügig besser, aber der lästige Worldcat-Frame behindert einen und die Präsentation der Metadaten ist inakzeptabel. Früher sah man sofort den Datenanbieter und die Rechtslage.
Zwar sind die Suchoptionen geringfügig besser, aber der lästige Worldcat-Frame behindert einen und die Präsentation der Metadaten ist inakzeptabel. Früher sah man sofort den Datenanbieter und die Rechtslage.
KlausGraf - am Freitag, 29. Januar 2010, 23:38 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
zwitschert blueshieldcoop hier.
Wolf Thomas - am Freitag, 29. Januar 2010, 18:30 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Freitag, 29. Januar 2010, 18:22 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Freitag 26. Februar 2010 im Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, Karlsruhe
Für Schülerinnen und Schüler ist der Umgang mit dem Internet absolut selbstverständlich. Informationen, Nachrichten, Unterhaltung und Spiele werden gleichermaßen im Internet gesucht. Wie können Archive diese Dominanz des Internets nutzen und auf ihre Aufgaben und Angebote aufmerksam machen? Sind neue mediale Formen der Internetpräsenz gefragt? Zugleich ist es aber auch erforderlich, die Aufmerksamkeit auf (Online)Angebote zu lenken, die in Archiven längst erarbeitet wurden und zur Nachahmung von Schülern und Lehrern einladen: Wie gestalte ich einen motivierenden Einstieg bei einer Archivführung? Welche Erfahrungen gibt es mit Quellenarbeit? Wie sehen Archivprojekte aus, die „machbar“ sind? Können Wettbewerbe eine eigenständige Beschäftigung von Schülerinnen und Schülern mit detektivischer Archivarbeit fördern? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Vorträge, Workshops und Diskussionen der elften Tagung für Archivpädagogik in Karlsruhe.
Auf dem Markt der Möglichkeiten am Nachmittag präsentieren sich Projekte des aktuellen Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten ebenso wie weitere Präsentationen zum Thema.
Ziel ist es, Lehrerinnen und Lehrern Schwellenängste vor „schwieriger“ Projektarbeit zu nehmen und interessierten Archivarinnen und Archivaren Anregungen zu bieten, wie für die Zielgruppe Schule ein passendes und effektiv zu betreibendes Programm erarbeitet werden kann.
PROGRAMM
10.00 Uhr Begrüssung
10.15 Uhr Merit Kegel, Sächsisches Staatsarchiv - Staatsarchiv Leipzig - : Neue Wege in der Archivpädagogik des sächsischen Staatsarchivs
10.45 Uhr Diskussion
11.00 Uhr Kaffeepause
11.30 Uhr Workshop
Dr. Wolfhart Beck, Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Münster: Erstkontakt / Einstiegsmodule
Dr. Monika Schaupp, Landesarchiv Baden-Württemberg
- Archivverbund Main-Tauber - : Archivpädagogische Angebote:
Ein Themenkanon für die Jahrgangsstufen 6-13
Dr. Rainer Hennl, Regierungspräsidium Karlsruhe, Abt. 7 Schule und Bildung: Kleine „machbare“ Projekte
Freiburger Netzwerk Geschichte
Regionale Wettbewerbe
12.45 – 13.45 Mittagspause
13.45 Uhr
Projektvorstellung / Markt der Möglichkeiten
Stände der Projekte in der Ausstellungsfläche, u.a. Schülerarbeiten aus dem Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten und
Internetanwendungen
15.30 Uhr Schlussdiskussion
16.00 Uhr Ende
TAGUNGSORT
Landesmedienzentrum
Baden-Württemberg, Karlsruhe, Moltkestraße 64 (Parkplätze im Hof)
Wegbeschreibung:
http://www.lmz-bw.de/uploads/media/anfahrt_ka_neu.pdf
...........................................................
ANMELDUNG BITTE AN
(es wird keine Tagungsgebühr erhoben)
landesarchiv@la-bw.de
...........................................................
ANSPRECHPARTNER
Landesarchiv Baden-Württemberg
Prof. Dr. Sabine Holtz
sabine.holtz@la-bw.de
Regierungspräsidium Karlsruhe
Abt. 7 Schule und Bildung
Dr. Rainer Hennl
Rainer.Hennl@rpk-bwl.de
Für Schülerinnen und Schüler ist der Umgang mit dem Internet absolut selbstverständlich. Informationen, Nachrichten, Unterhaltung und Spiele werden gleichermaßen im Internet gesucht. Wie können Archive diese Dominanz des Internets nutzen und auf ihre Aufgaben und Angebote aufmerksam machen? Sind neue mediale Formen der Internetpräsenz gefragt? Zugleich ist es aber auch erforderlich, die Aufmerksamkeit auf (Online)Angebote zu lenken, die in Archiven längst erarbeitet wurden und zur Nachahmung von Schülern und Lehrern einladen: Wie gestalte ich einen motivierenden Einstieg bei einer Archivführung? Welche Erfahrungen gibt es mit Quellenarbeit? Wie sehen Archivprojekte aus, die „machbar“ sind? Können Wettbewerbe eine eigenständige Beschäftigung von Schülerinnen und Schülern mit detektivischer Archivarbeit fördern? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Vorträge, Workshops und Diskussionen der elften Tagung für Archivpädagogik in Karlsruhe.
Auf dem Markt der Möglichkeiten am Nachmittag präsentieren sich Projekte des aktuellen Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten ebenso wie weitere Präsentationen zum Thema.
Ziel ist es, Lehrerinnen und Lehrern Schwellenängste vor „schwieriger“ Projektarbeit zu nehmen und interessierten Archivarinnen und Archivaren Anregungen zu bieten, wie für die Zielgruppe Schule ein passendes und effektiv zu betreibendes Programm erarbeitet werden kann.
PROGRAMM
10.00 Uhr Begrüssung
10.15 Uhr Merit Kegel, Sächsisches Staatsarchiv - Staatsarchiv Leipzig - : Neue Wege in der Archivpädagogik des sächsischen Staatsarchivs
10.45 Uhr Diskussion
11.00 Uhr Kaffeepause
11.30 Uhr Workshop
Dr. Wolfhart Beck, Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Münster: Erstkontakt / Einstiegsmodule
Dr. Monika Schaupp, Landesarchiv Baden-Württemberg
- Archivverbund Main-Tauber - : Archivpädagogische Angebote:
Ein Themenkanon für die Jahrgangsstufen 6-13
Dr. Rainer Hennl, Regierungspräsidium Karlsruhe, Abt. 7 Schule und Bildung: Kleine „machbare“ Projekte
Freiburger Netzwerk Geschichte
Regionale Wettbewerbe
12.45 – 13.45 Mittagspause
13.45 Uhr
Projektvorstellung / Markt der Möglichkeiten
Stände der Projekte in der Ausstellungsfläche, u.a. Schülerarbeiten aus dem Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten und
Internetanwendungen
15.30 Uhr Schlussdiskussion
16.00 Uhr Ende
TAGUNGSORT
Landesmedienzentrum
Baden-Württemberg, Karlsruhe, Moltkestraße 64 (Parkplätze im Hof)
Wegbeschreibung:
http://www.lmz-bw.de/uploads/media/anfahrt_ka_neu.pdf
...........................................................
ANMELDUNG BITTE AN
(es wird keine Tagungsgebühr erhoben)
landesarchiv@la-bw.de
...........................................................
ANSPRECHPARTNER
Landesarchiv Baden-Württemberg
Prof. Dr. Sabine Holtz
sabine.holtz@la-bw.de
Regierungspräsidium Karlsruhe
Abt. 7 Schule und Bildung
Dr. Rainer Hennl
Rainer.Hennl@rpk-bwl.de
Wolf Thomas - am Freitag, 29. Januar 2010, 17:19 - Rubrik: Archivpaedagogik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte hat anlässlich einer Ausstellung im Sommer 2009 eine Broschüre veröffentlicht. Sie enthält 12 kurze und deswegen teilweise etwas oberflächliche Aufsätze von an der Ausstellung mitwirkenden Studierenden, zwei Interviews mit ZeitzeugInnen, eine kurze Chronologie und ein Vorwort. Die Broschüre zeigt, dass „1968“ auch in der Provinz stattgefunden hat. Die Themen der einzelnen Beiträge sind die klassischen, in einem solchen Rahmen erwartbaren, wenn es um das weite Feld von „1968“ geht: Schüler- und Studierendenproteste, Musik und Subkultur, Internationalismus und feministischer Aufbruch. Die Artikel zum Verhalten der Polizei 1968/69, zu den Burschenschaften in Kiel und zur Gründung der ersten alternativen Kinderläden ab Anfang 1969 liegen etwas außer dieser Reihe und haben etwas mehr Lokalbezug als andere Beiträge. Der Aufsatz zur Kieler Woche zeigt, wie die außerparlamentarischen Gruppen diese als Protestplattform nutzten, während ein weiterer anlässlich der wilden, 12 Tage andauernden, sog. „Septemberstreiks“ auf der Howaldtwerft das Verhältnis zwischen Studierenden und Arbeitern untersucht. Er endet mit der Einschätzung, dass der Streik und die Proteste zwar gleichzeitig stattgefunden hätten, aber doch unverbunden gewesen seien.
Leider verfügt der Band nicht über ein Inhaltsverzeichnis und Informationen zu den AutorInnen. Amüsant ist dagegen ein Fehler auf Seite 35. Hier hat der Autor nicht bemerkt, dass die auf Seite 36 dokumentierte und von ihm als Zeichen von „Sympathie“ gewertete „Solidaritätsadresse der (Kieler Studentenzeitung) ´res nostra´ an den SDS-Weiberrat“ zum berühmten „Schwanz ab“-Plakat des Weiberrates des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) eindeutig eine bitterböse Satire und damit eine – heute würden man sagen: antifeministische - Kritik am Weiberrat ist. Dieser Ausrutscher kann aber den Stellenwert dieser Broschüre für die Aufarbeitung der Kieler Stadt- und Protestgeschichte nicht wirklich schmälern.
Bernd Hüttner, Bremen
Christoph Cornelißen u.a.: Die 68er in Kiel. Sozialprotest und kultureller Aufbruch; (Mitteilungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte, Band 85, Heft 1), 56 S., Kiel 2009
Leider verfügt der Band nicht über ein Inhaltsverzeichnis und Informationen zu den AutorInnen. Amüsant ist dagegen ein Fehler auf Seite 35. Hier hat der Autor nicht bemerkt, dass die auf Seite 36 dokumentierte und von ihm als Zeichen von „Sympathie“ gewertete „Solidaritätsadresse der (Kieler Studentenzeitung) ´res nostra´ an den SDS-Weiberrat“ zum berühmten „Schwanz ab“-Plakat des Weiberrates des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) eindeutig eine bitterböse Satire und damit eine – heute würden man sagen: antifeministische - Kritik am Weiberrat ist. Dieser Ausrutscher kann aber den Stellenwert dieser Broschüre für die Aufarbeitung der Kieler Stadt- und Protestgeschichte nicht wirklich schmälern.
Bernd Hüttner, Bremen
Christoph Cornelißen u.a.: Die 68er in Kiel. Sozialprotest und kultureller Aufbruch; (Mitteilungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte, Band 85, Heft 1), 56 S., Kiel 2009
Bernd Hüttner - am Freitag, 29. Januar 2010, 13:35 - Rubrik: Kommunalarchive
KlausGraf - am Freitag, 29. Januar 2010, 00:52 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
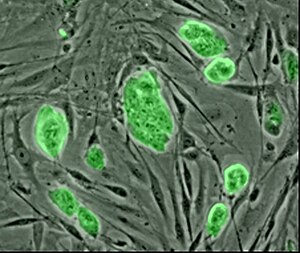
 Dettelbach (Foto von mir)
Dettelbach (Foto von mir)
