Eine schlechte und eine gute Nachricht:
Das DFG-Projekt hat ordentlich Knete abgezockt, aber die online gestellten Projektinhalte verschwanden beim Umzug der Projektleiterin Schlotheuber nach Düsseldorf. Sie sind noch im Internet Archive auffindbar:
http://web.archive.org/web/20100528134618/http://www.uni-muenster.de/Geschichte/hist-sem/MA-G/L3/forschen/DFGProjekt.html
Siehe auch
http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/schriftlichkeitinsueddeutschenfrauenkloestern
Die gute Nachricht: Ohne dass es von der BSB- oder der Münsteraner Seite oder der Lehrstuhlseite Schlotheuber einen Link gibt, sind sie in Düsseldorf wieder online:
http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/geschichte/lehrstuehle/mittelalterliche-geschichte/forschung/dfg-projekt-schriftlichkeit-in-sueddeutschen-frauenkloestern/
Das DFG-Projekt hat ordentlich Knete abgezockt, aber die online gestellten Projektinhalte verschwanden beim Umzug der Projektleiterin Schlotheuber nach Düsseldorf. Sie sind noch im Internet Archive auffindbar:
http://web.archive.org/web/20100528134618/http://www.uni-muenster.de/Geschichte/hist-sem/MA-G/L3/forschen/DFGProjekt.html
Siehe auch
http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/schriftlichkeitinsueddeutschenfrauenkloestern
Die gute Nachricht: Ohne dass es von der BSB- oder der Münsteraner Seite oder der Lehrstuhlseite Schlotheuber einen Link gibt, sind sie in Düsseldorf wieder online:
http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/geschichte/lehrstuehle/mittelalterliche-geschichte/forschung/dfg-projekt-schriftlichkeit-in-sueddeutschen-frauenkloestern/
KlausGraf - am Samstag, 25. Februar 2012, 19:24 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Durch Zufall habe ich diese sehr interesssante Seite zur Berliner Geschichte gefunden.
Neben Artikeln wie zur Archäologie, Bräuchen u.a. findet man auch Artikel über Bücher. Der Autor stellt unter anderem einige Fechtbücher sowie den Berliner Totentanz der Berliner Staatbibliothek vor.
Neben Artikeln wie zur Archäologie, Bräuchen u.a. findet man auch Artikel über Bücher. Der Autor stellt unter anderem einige Fechtbücher sowie den Berliner Totentanz der Berliner Staatbibliothek vor.
FredLo - am Samstag, 25. Februar 2012, 18:00 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
http://www.betterplace.org/de/projects/8626-es-werde-licht-licht-in-unserer-bibliothek
Unser Engagement - wirtschaftliches Gedächtnis für die Region!
Das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv e.V. sichert die wirtschaftliche Geschichte und Identität der Region Berlin-Brandenburg - Geschäftsunterlagen, Werbung, Patente, Protokolle: das Gedächtnis der Wirtschaft
Diese stehen für Öffentlichkeit, Forschung und Bildung zur Verfügung. Unsere Arbeit ist auf Wertschöpfung, Nachhaltigkeit und Kontinuität angelegt. Wir schaffen Arbeitsplätze. Studenten mehrerer Universitäten erwerben bei uns ihr Berufspraktikum. Wir führen ab 2012 Berufsschulprojekte durch, die die Chancen der Schüler am Arbeitsmarkt vergrößern.
Das Wirtschaftsarchiv ist gemeinnützig und als kulturelle Einrichtung anerkannt.
Doch unsere Bibliothek und Magazine sind düster - man kann in ihnen nur schwer arbeiten.
Deshalb setzen wir auf Ihre Hilfe!
- Unterstützung erhielten wir bereits durch den Europäischen Sozialfond sowie durch Unternehmen der Region für unsere reguläre Arbeit.
- Im Trägerverein des Wirtschaftsarchivs sind 80 Mitglieder, die von 2009-2011 fast 5.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit geleistet haben.
- Ab 2012 werden mindestens 80 Schüler im Wirtschaftsarchiv an ihren Projekten arbeiten.
- Neben der Beleuchtungsanlage wird auch ein Umbau des Magazins nötig. Die Kosten hierfür bestreiten wir aus persönlich eingeworbenen Großspenden von Privatpersonen und Unternehmen.
- Am dringlichsten ist das Licht im Leseraum / der Bibliothek, weil hier täglich gearbeitet wird.
Unser Engagement - wirtschaftliches Gedächtnis für die Region!
Das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv e.V. sichert die wirtschaftliche Geschichte und Identität der Region Berlin-Brandenburg - Geschäftsunterlagen, Werbung, Patente, Protokolle: das Gedächtnis der Wirtschaft
Diese stehen für Öffentlichkeit, Forschung und Bildung zur Verfügung. Unsere Arbeit ist auf Wertschöpfung, Nachhaltigkeit und Kontinuität angelegt. Wir schaffen Arbeitsplätze. Studenten mehrerer Universitäten erwerben bei uns ihr Berufspraktikum. Wir führen ab 2012 Berufsschulprojekte durch, die die Chancen der Schüler am Arbeitsmarkt vergrößern.
Das Wirtschaftsarchiv ist gemeinnützig und als kulturelle Einrichtung anerkannt.
Doch unsere Bibliothek und Magazine sind düster - man kann in ihnen nur schwer arbeiten.
Deshalb setzen wir auf Ihre Hilfe!
- Unterstützung erhielten wir bereits durch den Europäischen Sozialfond sowie durch Unternehmen der Region für unsere reguläre Arbeit.
- Im Trägerverein des Wirtschaftsarchivs sind 80 Mitglieder, die von 2009-2011 fast 5.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit geleistet haben.
- Ab 2012 werden mindestens 80 Schüler im Wirtschaftsarchiv an ihren Projekten arbeiten.
- Neben der Beleuchtungsanlage wird auch ein Umbau des Magazins nötig. Die Kosten hierfür bestreiten wir aus persönlich eingeworbenen Großspenden von Privatpersonen und Unternehmen.
- Am dringlichsten ist das Licht im Leseraum / der Bibliothek, weil hier täglich gearbeitet wird.
KlausGraf - am Freitag, 24. Februar 2012, 18:52 - Rubrik: Wirtschaftsarchive
KlausGraf - am Freitag, 24. Februar 2012, 18:40 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/urheberrechte-im-internet-acta-oder-der-schutz-der-raubritter-11658717.html
Man ist versucht zu sagen: Die einzelnen Künstler und Autoren werden als menschliche Schutzschilde eingesetzt. Denn Urheberrechte manifestieren oftmals eine im vordigitalen Zeitalter erworbene Machtposition, mittels derer die Unterhaltungsindustrie eine Rente, das heißt ein leistungsloses Einkommen, erwirtschaftet. Wie ehedem die Raubritter: Auch diese nahmen die Bauern aus, die ihre Waren in die Stadt bringen wollten, ebenso die Städter, die auf dem Markt einkaufen wollten - und rechtfertigten dies damit, dass sie die Sicherheit der Wege gewährleisteten.
So sehr ich der Analyse der beiden Ökonomen hinsichtlich der Nachteile des Urheberrechts zustimme, was sie über Raubritter schreiben, ist ersichtlich albern und kenntnisfrei. Die sogenannten Raubritter rechtfertigten ihre Überfälle mit dem Fehderecht.
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45355
Man ist versucht zu sagen: Die einzelnen Künstler und Autoren werden als menschliche Schutzschilde eingesetzt. Denn Urheberrechte manifestieren oftmals eine im vordigitalen Zeitalter erworbene Machtposition, mittels derer die Unterhaltungsindustrie eine Rente, das heißt ein leistungsloses Einkommen, erwirtschaftet. Wie ehedem die Raubritter: Auch diese nahmen die Bauern aus, die ihre Waren in die Stadt bringen wollten, ebenso die Städter, die auf dem Markt einkaufen wollten - und rechtfertigten dies damit, dass sie die Sicherheit der Wege gewährleisteten.
So sehr ich der Analyse der beiden Ökonomen hinsichtlich der Nachteile des Urheberrechts zustimme, was sie über Raubritter schreiben, ist ersichtlich albern und kenntnisfrei. Die sogenannten Raubritter rechtfertigten ihre Überfälle mit dem Fehderecht.
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45355
KlausGraf - am Freitag, 24. Februar 2012, 18:36 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 24. Februar 2012, 18:34 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
Liste der Jahrgänge im Internet Archive, leider mit Links zum PDF
http://raumgegenzement.blogsport.de/2012/02/05/zeitschrift-fuer-sozialforschung-1932-1941/
Es besteht nicht der allergeringste Grund, Menschen in dieser Weise zu bevormunden. Da das Internet Archive nun mal verschiedenste Formate anbietet und auch einen Viewer, sollte man die Entscheidung derjenigen, die nicht automatisch ein Riesen-PDF herunterladen wollen, respektieren! Um alle Metadatenseiten aufzurufen, muss man die URL unten entsprechend ändern (also z.B. 1 statt 9)
http://www.archive.org/details/ZeitschriftFrSozialforschung9.Jg
Via
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/64982965/
http://raumgegenzement.blogsport.de/2012/02/05/zeitschrift-fuer-sozialforschung-1932-1941/
Es besteht nicht der allergeringste Grund, Menschen in dieser Weise zu bevormunden. Da das Internet Archive nun mal verschiedenste Formate anbietet und auch einen Viewer, sollte man die Entscheidung derjenigen, die nicht automatisch ein Riesen-PDF herunterladen wollen, respektieren! Um alle Metadatenseiten aufzurufen, muss man die URL unten entsprechend ändern (also z.B. 1 statt 9)
http://www.archive.org/details/ZeitschriftFrSozialforschung9.Jg
Via
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/64982965/
KlausGraf - am Freitag, 24. Februar 2012, 18:24 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/bamberg-bibliotheken
Die Säkularisation der Stifts- und Klosterbibliotheken 1803 betraf in Bamberg das Domkapitel (Staatsbibliothek Bamberg, Msc.Misc.179), die Stifte St. Jakob (Msc.Misc.181), St. Gangolf und St. Stephan, die Benediktinerabtei Michelsberg (Msc.Misc.182, 1. Band und 2. Band), die Klöster der Karmeliten (HV.Msc.295, Msc.Misc.183 und Msc.Misc.185), Dominikaner (Msc.Misc.188), (Msc.Misc.190) und Kapuziner (Msc.Misc.192 und Msc.Misc.193), sowie die Nonnenklöster der Klarissen und der Dominikanerinnen zum Heiligen Grab; im Hochstift Bamberg die Zisterzienserabtei Langheim (Msc.Misc.207, Msc.Misc.208 und Msc.Misc.209 mit der Kanzleibibliothek in Kulmbach) und die Benediktinerabtei Banz (Msc.Misc.199), außerdem die Kapuzinerklöster in Höchstadt an der Aisch (Msc.Misc.205) und in Gößweinstein (Msc.Misc.202), weiter die Franziskanerklöster in Kronach (Msc.Misc.206) und Marienweiher, dann zwei Franziskanerhospize in Forchheim (Msc.Misc.201) und in Glosberg bei Kronach. Nicht nach Bamberg säkularisiert wurden die kirchlich zum Bistum Bamberg, politisch zur Oberpfalz gehörigen Benediktinerabteien Weißenohe und Michelfeld und das zum Bistum Regensburg gehörende Bambergische Kapuzinerhospiz Vilseck.
Die Bestände wurden in der Bibliothek der aufgelösten Universität Bamberg der (heutigen) Staatsbibliothek Bamberg zugeordnet. Es ist davon auszugehen, dass zu etwa 10.000 hier vorhandenen Büchern etwa 37.000 aus dem Säkularisationsgut (von etwa 63.000) kamen. Die Institutionen sollten Kataloge einliefern, die oft ad hoc angefertigt wurden, manchmal aber auch älter waren (Msc.Misc.179-193, 197-202, 205-209 der Staatsbibliothek Bamberg). Die Auswahl wurde in der Regel aber direkt vor Ort vorgenommen und bezog in mehreren Fällen auch die Regale mit ein. Der Vorgang der Aufstellung, 1805 im Wesentlichen abgeschlossen, zog sich bei den Mendikantenklöstern, besonders den weiter entfernten und nicht so leicht erreichbaren, oft Jahrzehnte hin und unterblieb im Fall von Marienweiher ganz. Die Auswahl des "Seltenen, Schönen und Nützlichen" wurde von spätaufklärerischen Wissenschaftlichkeitsvorstellungen bestimmt und nahm abgesehen von Dubletten Verluste oder gar den Untergang in Kauf. Sammler wie P. Pius Brunnquell (1752-1828) konnten missachtete Bücher, soweit nicht gleich makuliert, nur zum Teil sichern und später der Öffentlichkeit zugänglich machen.
Zu den Bibliothekskatalogen der Staatsbibliothek bzw. des Historischen Vereins Bamberg sowie des Archivs des Erzbistums sind mit digitalisiert das Verzeichnis des Bamberger Domschatzes (HV.Msc.224) und der Katalog der Banzer Naturaliensammlung (Msc.Misc.200).

Die Säkularisation der Stifts- und Klosterbibliotheken 1803 betraf in Bamberg das Domkapitel (Staatsbibliothek Bamberg, Msc.Misc.179), die Stifte St. Jakob (Msc.Misc.181), St. Gangolf und St. Stephan, die Benediktinerabtei Michelsberg (Msc.Misc.182, 1. Band und 2. Band), die Klöster der Karmeliten (HV.Msc.295, Msc.Misc.183 und Msc.Misc.185), Dominikaner (Msc.Misc.188), (Msc.Misc.190) und Kapuziner (Msc.Misc.192 und Msc.Misc.193), sowie die Nonnenklöster der Klarissen und der Dominikanerinnen zum Heiligen Grab; im Hochstift Bamberg die Zisterzienserabtei Langheim (Msc.Misc.207, Msc.Misc.208 und Msc.Misc.209 mit der Kanzleibibliothek in Kulmbach) und die Benediktinerabtei Banz (Msc.Misc.199), außerdem die Kapuzinerklöster in Höchstadt an der Aisch (Msc.Misc.205) und in Gößweinstein (Msc.Misc.202), weiter die Franziskanerklöster in Kronach (Msc.Misc.206) und Marienweiher, dann zwei Franziskanerhospize in Forchheim (Msc.Misc.201) und in Glosberg bei Kronach. Nicht nach Bamberg säkularisiert wurden die kirchlich zum Bistum Bamberg, politisch zur Oberpfalz gehörigen Benediktinerabteien Weißenohe und Michelfeld und das zum Bistum Regensburg gehörende Bambergische Kapuzinerhospiz Vilseck.
Die Bestände wurden in der Bibliothek der aufgelösten Universität Bamberg der (heutigen) Staatsbibliothek Bamberg zugeordnet. Es ist davon auszugehen, dass zu etwa 10.000 hier vorhandenen Büchern etwa 37.000 aus dem Säkularisationsgut (von etwa 63.000) kamen. Die Institutionen sollten Kataloge einliefern, die oft ad hoc angefertigt wurden, manchmal aber auch älter waren (Msc.Misc.179-193, 197-202, 205-209 der Staatsbibliothek Bamberg). Die Auswahl wurde in der Regel aber direkt vor Ort vorgenommen und bezog in mehreren Fällen auch die Regale mit ein. Der Vorgang der Aufstellung, 1805 im Wesentlichen abgeschlossen, zog sich bei den Mendikantenklöstern, besonders den weiter entfernten und nicht so leicht erreichbaren, oft Jahrzehnte hin und unterblieb im Fall von Marienweiher ganz. Die Auswahl des "Seltenen, Schönen und Nützlichen" wurde von spätaufklärerischen Wissenschaftlichkeitsvorstellungen bestimmt und nahm abgesehen von Dubletten Verluste oder gar den Untergang in Kauf. Sammler wie P. Pius Brunnquell (1752-1828) konnten missachtete Bücher, soweit nicht gleich makuliert, nur zum Teil sichern und später der Öffentlichkeit zugänglich machen.
Zu den Bibliothekskatalogen der Staatsbibliothek bzw. des Historischen Vereins Bamberg sowie des Archivs des Erzbistums sind mit digitalisiert das Verzeichnis des Bamberger Domschatzes (HV.Msc.224) und der Katalog der Banzer Naturaliensammlung (Msc.Misc.200).

KlausGraf - am Freitag, 24. Februar 2012, 18:11 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,817219,00.html
Der mutmaßliche Dieb ist ein 45-jähriger Mitarbeiter des hessischen Wissenschaftsministeriums. Laut Polizei war er am Dienstag auf frischer Tat ertappt worden, als er mit 53 Büchern die Fürstlich Waldeckischen Hofbibliothek des Bad Arolser Schlosses verlassen wollte. Dabei handelte es sich um Werke aus den Fachgebieten Mineralogie, Geophysik und Naturlehre, die jeweils bis zu 7000 Euro wert sind.
Wissenschaftler erhalten zu den meisten privaten Adelsbibliotheken ohnehin kaum Zutritt (Arolsen ist da eher die Ausnahme) - nun wird es noch viel schwieriger, mit diesen Quellen zu forschen ...
Der mutmaßliche Dieb ist ein 45-jähriger Mitarbeiter des hessischen Wissenschaftsministeriums. Laut Polizei war er am Dienstag auf frischer Tat ertappt worden, als er mit 53 Büchern die Fürstlich Waldeckischen Hofbibliothek des Bad Arolser Schlosses verlassen wollte. Dabei handelte es sich um Werke aus den Fachgebieten Mineralogie, Geophysik und Naturlehre, die jeweils bis zu 7000 Euro wert sind.
Wissenschaftler erhalten zu den meisten privaten Adelsbibliotheken ohnehin kaum Zutritt (Arolsen ist da eher die Ausnahme) - nun wird es noch viel schwieriger, mit diesen Quellen zu forschen ...
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Antwort der Landesregierung auf die Mündliche Anfrage d. Abg. Wenzel, Helmhold und Limburg (Grüne);
Transparenz und Zugang zum niedersächsischen Staatsarchiv
Die Anfrage steht im Zusammenhang mit zivilrechtlichen Erbstreitigkeiten innerhalb der Familie SchaumburgLippe. Dabei geht es nach hiesiger Kenntnis insbesondere um die Frage, in welchem Umfang das Vermögen der bis 1918 regierenden Fürsten zu Schaumburg-Lippe fideikommissrechtlich (Fideikommiss: unveräußerliches und unteilbares Vermögen einer Familie) gebunden oder privates Eigentum einzelner Familienmitglieder im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) war. Im ersteren Fall gelten die besonderen Regeln des Fideikommissauflösungsrechtes, in letzterem Fall die gewöhnlichen erbrechtlichen Vorschriften des BGB. Über die durchgeführten Erb- bzw. Fideikommiss-auflösungsverfahren nach dem Tod von Adolf Fürst zu Schaumburg Lippe im Jahre 1936 bestehen offenbar unterschiedliche Auffassungen zwischen einzelnen Familienmitgliedern. Nach der Herstellung der Einheit Deutschlands wurden nach hiesiger Kenntnis von einem Teil der Erben von Adolf Fürst zu Schaumburg-Lippe mehrere Anträge auf Rückübereignung bei den zuständigen Behörden in Brandenburg und Mecklenburg - Vorpommern über dortige früher der Familie gehörende Güter eingeleitet. Ein anderer Teil der Familie hat - vertreten durch einen in Madrid als Rechtsanwalt tätigen Enkel von Heinrich Prinz zu Schaumburg-Lippe, dem jüngeren Bruder von Adolf Fürst zu Schaumburg-Lippe - diese Ansprüche auf Rückübereignung angezweifelt: Er vertritt die Auffassung, dass mindestens insoweit die üblichen BGB- rechtlichen Erbregelungen und nicht die fideikommissrechtlichen Bestimmungen gelten. Um seine Rechtsauffassung zu belegen, hat er seit Ende der 1990er Jahre diverse Bestände des Niedersächsischen Landesarchivs (NLA) in den Abteilungen Hauptstaatsarchiv Hannover und Staatsarchiv Bückeburg eingesehen, insbesondere die Akten des seinerzeitigen Fideikommissauflösungsverfahrens beim Oberlandesgericht Celle sowie Nachlass, Register- und sonstige Akten des Landgerichts Bückeburg und der Amtsgerichte Bückeburg und Stadthagen. Der Zugang zu diesem staatlichen Archivgut des Landes Niedersachsen unterliegt gemäß § 5 Abs. 1 des Niedersächsischen Archivgesetzes (NArchG) grundsätzlich keinerlei Beschränkungen; allenfalls Schutzrechte könnten den Zugang ggf. hinausschieben. Da derartige Einschränkungen in diesem konkreten Fall nicht mehr gegeben waren, wurden die gewünschten Einsichten in dieses staatliche Archivgut in vollem Umfang gewährt.
Neben dem staatlichen Archivgut verwahrt das NLA auch Archivbestände privater Herkunft, die als sog. Deposita zwar grundsätzlich der öffentlichen Benutzung zur Verfügung stehen, aber weiterhin privates Eigentum des jeweiligen Deponenten
bleiben. Die Rechte und Pflichten zwischen dem NLA und dem jeweiligen Eigentümer der Deposita sind, insbesondere im Hinblick auf die Modalitäten der Benutzung, in einem sog. Depositalvertrag geregelt. Nach § 3 Abs. 7 NArchG darf insoweit ausdrücklich von den für staatliches Archivgut geltenden Regelungen der §§ 5 und 6 NArchG für die Benutzung abgewichen werden. Es ist damals auch abgewichen worden: Seit 1971 besteht ein solches Depositum über das Haus- und Kammerarchiv der Fürsten zu Schaumburg-Lippe. Dieses Depositum wird im NLA in der Abteilung Staatsarchiv Bückeburg verwahrt und betreut. Nach dem Depositalvertrag hat der Eigentümer sich für bestimmte Benutzungsfälle die Genehmigung über den Zugang zu diesen Archivalien vorbehalten. Die Anträge des Rechtsanwaltes auf Einsicht in bestimmte Archivalien des Haus- und Kammerarchivs wurden unter Anwendung dieser Regelung vom Eigentümer verweigert. An diese Entscheidung war das NLA gebunden und hat demzufolge den Antrag auf Einsicht abgelehnt. In dem daraufhin angestrengten verwaltungsgerichtlichen Verfahren gegen die ablehnende Entscheidung des NLA hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg letztinstanzlich mit Urteil vom 17.09.2002 entschieden, dass das NLA ordnungsgemäß gehandelt hat, weil in diesem konkreten Fall die Bestimmungen des § 3 Abs. 7 NArchG Vorrang haben gegenüber den für staatliches Archivgut geltenden Benutzungsregelungen der §§ 5 und 6 NArchG. Auch eine dagegen erhobene Restitutionsklage ist mit Beschluss des Oberverwaltungsgericht Lüneburg vom 25.11.2005 verworfen und diese Entscheidung mit Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes vom 08.03.2006 bestätigt worden. In diesem Beschluss ist u. a. festgestellt worden, dass das beklagte Land nicht verpflichtet ist, Nachlassunterlagen, die nicht Teil des staatlichen Archivgutes sind, gemäß § 2259 BGB an das zuständige Nachlassgericht abzuliefern. Die betreffenden Unterlagen sind auch nicht Teil des staatlichen Archivguts (Bestand Amtsgericht Bückeburg), sondern Teil des Depositums „Schaumburg - Lippisches Haus- und Kammerarchiv“.
In den Jahren 2007/2008 war dann offenbar bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder ein Strafverfahren anhängig, in dem es vermutlich um Unterschlagung von Beweismitteln und Ähnlichem ging. Im November 2007 wurde hierzu eine Durch-suchungs- und Beschlagnahmeanordnung des Amtsgerichts Frankfurt/Oder erlassen, die sich u. a. gegen die Abteilungen Hauptstaatsarchiv Hannover und Staatsarchiv Bückeburg des NLA gerichtet haben soll. Diese Anordnung wurde dann von den zuständigen Stellen des Landes Brandenburg wohl im Frühjahr 2008 wieder aufgehoben, jedenfalls niemals vollzogen. Zum damaligen Zeitpunkt waren weder dem NLA noch der Staatsanwaltschaft Bückeburg oder der Niedersächsischen Staatskanzlei - als zuständiger Aufsichtsbehörde - irgendwelche Informationen hierüber bekannt. Erst mit einer E-Mail vom 03.07.2009 hat der o. g. Rechtsanwalt den Präsidenten des NLA davon - beiläufig - unterrichtet.
Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:
Zu 1 bis 3:
Staatssekretärin des Ministerpräsidenten
Siehe Vorbemerkungen
ENDE DER ANTWORT
Anmerkung:
Die Abgeordneten werden nach meiner Auffassung in die Irre geleitet. Das Staatsarchiv ist nicht von der Ablieferungspflicht von Testamenten gerichtlich entbunden worden. Das Amtsgericht Bückeburg, als Nachlassgericht, hatte im Dezember 2005 und im Januar 2006 zur Ablieferung gemäss Paragraf 2259 BGB sowohl das Staatsarchiv als auch Alexander Prinz zu Schaumburg-Lippe aufgefordert. Diese Aufforderung unterlag nicht einer verwaltungsgerichtlichen Überprüfung. Die von einem Zivilgericht durch hoheitlichen Akt angeordnete Ablieferung an das Nachlassgericht unterlag nicht der Entscheidung der Verwaltungsgerichtsbarkeit die über ein öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis zu entscheiden hatte (Einsichtnahme durch Nutzer). Fordert ein Zivilgericht zur Ablieferung auf, so unterliegt diese Pflicht der zivilen Gerichtsbarkeit. Die Ablieferungspflicht des § 2259 BGB (und um die geht es in der Anfrage der Abgeordneten) war noch nie Gegenstand einer zivilgerichtlichen Entscheidung. Sie ist keine Frage des öffentlich-rechtlichen Benutzungsverhältnisses aufgrund des Archivgesetzes. Die im BGB geregelte Ablieferungspflicht ist nicht dispositiv. Staatliche Behörden sind zur Ablieferung verpflichtet, vor allem wenn sie Besitzer sind. Möge die Landesregierung eine gerichtliche Entscheidung vorlegen, die die Aufforderung des Amtsgerichts Bückeburg, Testamente an das Gericht abzuliefern, aufgehoben hat. Eine derartige Entscheidung hat es noch nie gegeben, weil sie rechtswidrig wäre. Kein Gericht hat dem NLA untersagt, letztwillige Verfügungen an das Nachlassgericht abzuliefern.
Wenn die Landesregierung behauptet, dass in einem Beschluss des OVG Lüneburg festgestellt wurde, dass das beklagte Land nicht verpflichtet ist, Nachlassunterlagen, die nicht Teil des staatlichen Archivgutes sind, gemäß § 2259 BGB an das zuständige Nachlassgericht abzuliefern, dann liegt hierin eine bewusste Täuschung der rechtlich möglicherweise nicht bewanderten Abgeordneten vor. Es wird der Anschein erweckt, als ob das Land Niedersachsen von der Ablieferung absehen dürfe. Richtig ist, dass die Ablieferungspflicht aufgrund zivilrechtlicher Vorschriften ausnahmslos besteht, unabhängig davon, was das OVG Lüneburg in einem Beschluss ausgeführt haben mag. Streitgegenstand des Verfahrens vor dem OVG Lüneburg war das Einsichtnahmerecht aufgrund Archivgesetz. Dieser Streitgegenstand ist zu unterscheiden von der allgemeinen Ablieferungspflicht an das Nachlassgericht gemäss § 2259 BGB. Sind die letztwilligen Verfügungen beim Nachlassgericht, dann kommt es zur Testamentseröffnung und die Frage, ob Erben oder Vermächtnisnehmer ein Einsichtnahmerecht haben, entscheidet dann der zuständige Richter (des Nachlassgerichtes), kein Verwaltungsgericht. Ich werte die Ausführungen der Staatskanzlei als Täuschungsversuch und begeht fortgesetzt Urkundenunterdrueckung und / oder Beihilfe dazu.
Erinnert stark an die Taktik des doppelten Dementi. Wird nach dem Vorwurf A gefragt, wird geantwortet, man habe B nicht verwirklicht oder X habe es zugelassen. Dass X nicht befugt war wird verschwiegen.
Sollte Strafanzeige in Hannover gegen den Ministerpräsidenten wegen Beihilfe zur Urkundenunterdrückung eingereicht werden ?
Wie wäre es wenn nun endlich die Unterlagen an das Gericht übergeben werden ? Die Ablieferungspflicht besteht auch heute noch.
Weitere Informationen hier:
http://www.vierprinzen.com/2012/02/sachdienliche-hinweise-zur-kleinen.html
UPDATE 26-2-2012:
Bitte nachfolgenden link anklicken. Staatskanzlei täuscht offensichtlich doch die Abgeordneten.
http://www.vierprinzen.com/2012/02/lugen-haben-kurze-beine-oder-por-la.html
Zutreffend hebt das Bundesverwaltungsgericht hervor, dass die Frage der allgemeinen Ablieferungspflicht nach Paragraf 2259 BGB den archivrechtlichen Streitgegenstand (Einsichtnahme) verfehlt. Die Staatskanzlei kann somit diese Entscheidung nicht bemühen, um die Nichtablieferung an das Nachlassgericht zu rechtfertigen. Insoweit sind die Ausführungen in der Beantwortung der Anfrage der Abgeordneten unrichtig.
Da ich seit 26 Jahren mit der Gegenseite zu tun habe, bin ich vielleicht nicht ganz so diplomatisch.
Ich bemühe mich stets darum, meine Behauptungen zu untermauern.
Ich hoffe, dass die Damen und Herren Landtagsabgeordneten sich zu wehren wissen. Natürlich würde es mich sehr freuen, wenn dieser Sachverhalt Gegenstand einer öffentlichen Diskussion wird. Es betrifft viele aktuelle Fragen (Transparenz, Vorrechte der "Eliten", Verstrickungen ......, Geschichte).
Eine Gegenfrage: "Wie soll ich meinen spanischen Kindern erklären, dass die niedersächsische Landesregierung letztwillige Verfügungen zurückhält ? Denn auch meine Kinder werden eines Tages Erbeserben sein".
Transparenz und Zugang zum niedersächsischen Staatsarchiv
Die Anfrage steht im Zusammenhang mit zivilrechtlichen Erbstreitigkeiten innerhalb der Familie SchaumburgLippe. Dabei geht es nach hiesiger Kenntnis insbesondere um die Frage, in welchem Umfang das Vermögen der bis 1918 regierenden Fürsten zu Schaumburg-Lippe fideikommissrechtlich (Fideikommiss: unveräußerliches und unteilbares Vermögen einer Familie) gebunden oder privates Eigentum einzelner Familienmitglieder im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) war. Im ersteren Fall gelten die besonderen Regeln des Fideikommissauflösungsrechtes, in letzterem Fall die gewöhnlichen erbrechtlichen Vorschriften des BGB. Über die durchgeführten Erb- bzw. Fideikommiss-auflösungsverfahren nach dem Tod von Adolf Fürst zu Schaumburg Lippe im Jahre 1936 bestehen offenbar unterschiedliche Auffassungen zwischen einzelnen Familienmitgliedern. Nach der Herstellung der Einheit Deutschlands wurden nach hiesiger Kenntnis von einem Teil der Erben von Adolf Fürst zu Schaumburg-Lippe mehrere Anträge auf Rückübereignung bei den zuständigen Behörden in Brandenburg und Mecklenburg - Vorpommern über dortige früher der Familie gehörende Güter eingeleitet. Ein anderer Teil der Familie hat - vertreten durch einen in Madrid als Rechtsanwalt tätigen Enkel von Heinrich Prinz zu Schaumburg-Lippe, dem jüngeren Bruder von Adolf Fürst zu Schaumburg-Lippe - diese Ansprüche auf Rückübereignung angezweifelt: Er vertritt die Auffassung, dass mindestens insoweit die üblichen BGB- rechtlichen Erbregelungen und nicht die fideikommissrechtlichen Bestimmungen gelten. Um seine Rechtsauffassung zu belegen, hat er seit Ende der 1990er Jahre diverse Bestände des Niedersächsischen Landesarchivs (NLA) in den Abteilungen Hauptstaatsarchiv Hannover und Staatsarchiv Bückeburg eingesehen, insbesondere die Akten des seinerzeitigen Fideikommissauflösungsverfahrens beim Oberlandesgericht Celle sowie Nachlass, Register- und sonstige Akten des Landgerichts Bückeburg und der Amtsgerichte Bückeburg und Stadthagen. Der Zugang zu diesem staatlichen Archivgut des Landes Niedersachsen unterliegt gemäß § 5 Abs. 1 des Niedersächsischen Archivgesetzes (NArchG) grundsätzlich keinerlei Beschränkungen; allenfalls Schutzrechte könnten den Zugang ggf. hinausschieben. Da derartige Einschränkungen in diesem konkreten Fall nicht mehr gegeben waren, wurden die gewünschten Einsichten in dieses staatliche Archivgut in vollem Umfang gewährt.
Neben dem staatlichen Archivgut verwahrt das NLA auch Archivbestände privater Herkunft, die als sog. Deposita zwar grundsätzlich der öffentlichen Benutzung zur Verfügung stehen, aber weiterhin privates Eigentum des jeweiligen Deponenten
bleiben. Die Rechte und Pflichten zwischen dem NLA und dem jeweiligen Eigentümer der Deposita sind, insbesondere im Hinblick auf die Modalitäten der Benutzung, in einem sog. Depositalvertrag geregelt. Nach § 3 Abs. 7 NArchG darf insoweit ausdrücklich von den für staatliches Archivgut geltenden Regelungen der §§ 5 und 6 NArchG für die Benutzung abgewichen werden. Es ist damals auch abgewichen worden: Seit 1971 besteht ein solches Depositum über das Haus- und Kammerarchiv der Fürsten zu Schaumburg-Lippe. Dieses Depositum wird im NLA in der Abteilung Staatsarchiv Bückeburg verwahrt und betreut. Nach dem Depositalvertrag hat der Eigentümer sich für bestimmte Benutzungsfälle die Genehmigung über den Zugang zu diesen Archivalien vorbehalten. Die Anträge des Rechtsanwaltes auf Einsicht in bestimmte Archivalien des Haus- und Kammerarchivs wurden unter Anwendung dieser Regelung vom Eigentümer verweigert. An diese Entscheidung war das NLA gebunden und hat demzufolge den Antrag auf Einsicht abgelehnt. In dem daraufhin angestrengten verwaltungsgerichtlichen Verfahren gegen die ablehnende Entscheidung des NLA hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg letztinstanzlich mit Urteil vom 17.09.2002 entschieden, dass das NLA ordnungsgemäß gehandelt hat, weil in diesem konkreten Fall die Bestimmungen des § 3 Abs. 7 NArchG Vorrang haben gegenüber den für staatliches Archivgut geltenden Benutzungsregelungen der §§ 5 und 6 NArchG. Auch eine dagegen erhobene Restitutionsklage ist mit Beschluss des Oberverwaltungsgericht Lüneburg vom 25.11.2005 verworfen und diese Entscheidung mit Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes vom 08.03.2006 bestätigt worden. In diesem Beschluss ist u. a. festgestellt worden, dass das beklagte Land nicht verpflichtet ist, Nachlassunterlagen, die nicht Teil des staatlichen Archivgutes sind, gemäß § 2259 BGB an das zuständige Nachlassgericht abzuliefern. Die betreffenden Unterlagen sind auch nicht Teil des staatlichen Archivguts (Bestand Amtsgericht Bückeburg), sondern Teil des Depositums „Schaumburg - Lippisches Haus- und Kammerarchiv“.
In den Jahren 2007/2008 war dann offenbar bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder ein Strafverfahren anhängig, in dem es vermutlich um Unterschlagung von Beweismitteln und Ähnlichem ging. Im November 2007 wurde hierzu eine Durch-suchungs- und Beschlagnahmeanordnung des Amtsgerichts Frankfurt/Oder erlassen, die sich u. a. gegen die Abteilungen Hauptstaatsarchiv Hannover und Staatsarchiv Bückeburg des NLA gerichtet haben soll. Diese Anordnung wurde dann von den zuständigen Stellen des Landes Brandenburg wohl im Frühjahr 2008 wieder aufgehoben, jedenfalls niemals vollzogen. Zum damaligen Zeitpunkt waren weder dem NLA noch der Staatsanwaltschaft Bückeburg oder der Niedersächsischen Staatskanzlei - als zuständiger Aufsichtsbehörde - irgendwelche Informationen hierüber bekannt. Erst mit einer E-Mail vom 03.07.2009 hat der o. g. Rechtsanwalt den Präsidenten des NLA davon - beiläufig - unterrichtet.
Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:
Zu 1 bis 3:
Staatssekretärin des Ministerpräsidenten
Siehe Vorbemerkungen
ENDE DER ANTWORT
Anmerkung:
Die Abgeordneten werden nach meiner Auffassung in die Irre geleitet. Das Staatsarchiv ist nicht von der Ablieferungspflicht von Testamenten gerichtlich entbunden worden. Das Amtsgericht Bückeburg, als Nachlassgericht, hatte im Dezember 2005 und im Januar 2006 zur Ablieferung gemäss Paragraf 2259 BGB sowohl das Staatsarchiv als auch Alexander Prinz zu Schaumburg-Lippe aufgefordert. Diese Aufforderung unterlag nicht einer verwaltungsgerichtlichen Überprüfung. Die von einem Zivilgericht durch hoheitlichen Akt angeordnete Ablieferung an das Nachlassgericht unterlag nicht der Entscheidung der Verwaltungsgerichtsbarkeit die über ein öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis zu entscheiden hatte (Einsichtnahme durch Nutzer). Fordert ein Zivilgericht zur Ablieferung auf, so unterliegt diese Pflicht der zivilen Gerichtsbarkeit. Die Ablieferungspflicht des § 2259 BGB (und um die geht es in der Anfrage der Abgeordneten) war noch nie Gegenstand einer zivilgerichtlichen Entscheidung. Sie ist keine Frage des öffentlich-rechtlichen Benutzungsverhältnisses aufgrund des Archivgesetzes. Die im BGB geregelte Ablieferungspflicht ist nicht dispositiv. Staatliche Behörden sind zur Ablieferung verpflichtet, vor allem wenn sie Besitzer sind. Möge die Landesregierung eine gerichtliche Entscheidung vorlegen, die die Aufforderung des Amtsgerichts Bückeburg, Testamente an das Gericht abzuliefern, aufgehoben hat. Eine derartige Entscheidung hat es noch nie gegeben, weil sie rechtswidrig wäre. Kein Gericht hat dem NLA untersagt, letztwillige Verfügungen an das Nachlassgericht abzuliefern.
Wenn die Landesregierung behauptet, dass in einem Beschluss des OVG Lüneburg festgestellt wurde, dass das beklagte Land nicht verpflichtet ist, Nachlassunterlagen, die nicht Teil des staatlichen Archivgutes sind, gemäß § 2259 BGB an das zuständige Nachlassgericht abzuliefern, dann liegt hierin eine bewusste Täuschung der rechtlich möglicherweise nicht bewanderten Abgeordneten vor. Es wird der Anschein erweckt, als ob das Land Niedersachsen von der Ablieferung absehen dürfe. Richtig ist, dass die Ablieferungspflicht aufgrund zivilrechtlicher Vorschriften ausnahmslos besteht, unabhängig davon, was das OVG Lüneburg in einem Beschluss ausgeführt haben mag. Streitgegenstand des Verfahrens vor dem OVG Lüneburg war das Einsichtnahmerecht aufgrund Archivgesetz. Dieser Streitgegenstand ist zu unterscheiden von der allgemeinen Ablieferungspflicht an das Nachlassgericht gemäss § 2259 BGB. Sind die letztwilligen Verfügungen beim Nachlassgericht, dann kommt es zur Testamentseröffnung und die Frage, ob Erben oder Vermächtnisnehmer ein Einsichtnahmerecht haben, entscheidet dann der zuständige Richter (des Nachlassgerichtes), kein Verwaltungsgericht. Ich werte die Ausführungen der Staatskanzlei als Täuschungsversuch und begeht fortgesetzt Urkundenunterdrueckung und / oder Beihilfe dazu.
Erinnert stark an die Taktik des doppelten Dementi. Wird nach dem Vorwurf A gefragt, wird geantwortet, man habe B nicht verwirklicht oder X habe es zugelassen. Dass X nicht befugt war wird verschwiegen.
Sollte Strafanzeige in Hannover gegen den Ministerpräsidenten wegen Beihilfe zur Urkundenunterdrückung eingereicht werden ?
Wie wäre es wenn nun endlich die Unterlagen an das Gericht übergeben werden ? Die Ablieferungspflicht besteht auch heute noch.
Weitere Informationen hier:
http://www.vierprinzen.com/2012/02/sachdienliche-hinweise-zur-kleinen.html
UPDATE 26-2-2012:
Bitte nachfolgenden link anklicken. Staatskanzlei täuscht offensichtlich doch die Abgeordneten.
http://www.vierprinzen.com/2012/02/lugen-haben-kurze-beine-oder-por-la.html
Zutreffend hebt das Bundesverwaltungsgericht hervor, dass die Frage der allgemeinen Ablieferungspflicht nach Paragraf 2259 BGB den archivrechtlichen Streitgegenstand (Einsichtnahme) verfehlt. Die Staatskanzlei kann somit diese Entscheidung nicht bemühen, um die Nichtablieferung an das Nachlassgericht zu rechtfertigen. Insoweit sind die Ausführungen in der Beantwortung der Anfrage der Abgeordneten unrichtig.
Da ich seit 26 Jahren mit der Gegenseite zu tun habe, bin ich vielleicht nicht ganz so diplomatisch.
Ich bemühe mich stets darum, meine Behauptungen zu untermauern.
Ich hoffe, dass die Damen und Herren Landtagsabgeordneten sich zu wehren wissen. Natürlich würde es mich sehr freuen, wenn dieser Sachverhalt Gegenstand einer öffentlichen Diskussion wird. Es betrifft viele aktuelle Fragen (Transparenz, Vorrechte der "Eliten", Verstrickungen ......, Geschichte).
Eine Gegenfrage: "Wie soll ich meinen spanischen Kindern erklären, dass die niedersächsische Landesregierung letztwillige Verfügungen zurückhält ? Denn auch meine Kinder werden eines Tages Erbeserben sein".
vierprinzen - am Freitag, 24. Februar 2012, 14:42 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die heutige Tagung in Siegen brachte wenig Konkretes zum "Digitalen Archiv NRW". Hingegen erfuhr man einiges zur Bedeutung von Universitätsjubiläen für die Archive.
Neuigkeiten: Auch in Bielefeld gibt es einen Notfallverbund der Archive (mit den Bibliotheken), an dem das Uniarchiv beteiligt ist. Die (bekanntlich ebenfalls zu einem Notfallverbund zusammengeschlossenen) Archive in Münster veranstalten gemeinsam ein Treffen mit LehrerInnen. Der Universitätsarchivar von Hannover, ein ständiger Gast, berichtete, dass die norddeutschen Universitätsarchivare (aus Niedersachsen, Hamburg und Bremen, man sei aber auch für SH und MV offen) nun auch ihre eigene AG haben.
Neuigkeiten: Auch in Bielefeld gibt es einen Notfallverbund der Archive (mit den Bibliotheken), an dem das Uniarchiv beteiligt ist. Die (bekanntlich ebenfalls zu einem Notfallverbund zusammengeschlossenen) Archive in Münster veranstalten gemeinsam ein Treffen mit LehrerInnen. Der Universitätsarchivar von Hannover, ein ständiger Gast, berichtete, dass die norddeutschen Universitätsarchivare (aus Niedersachsen, Hamburg und Bremen, man sei aber auch für SH und MV offen) nun auch ihre eigene AG haben.
KlausGraf - am Donnerstag, 23. Februar 2012, 21:10 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Digitalisiert von der ULB Düsseldorf:
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/periodical/structure/3571312
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/periodical/structure/3571312
KlausGraf - am Mittwoch, 22. Februar 2012, 13:07 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Diesmal mit Beständen des Stadtarchiv Dresden (s.a. familienarchiv-post.info).
This week FamilySearch added 12 million new, free records online (6.5 million indexed names and 5.6 million browsable images) for Canada, England, Germany, Italy, Korea, Netherlands, Spain, and the U.S. The Florida Death Index 1877-1998, received 5 million searchable records and another million records each for Oklahoma and Wisconsin.
--> Germany, Saxony, Dresden, Citizen's Documents and Business Licenses, 1820-1962
Bilder: 386.107
Indexiert: 0
New browsable image collection.
This week FamilySearch added 12 million new, free records online (6.5 million indexed names and 5.6 million browsable images) for Canada, England, Germany, Italy, Korea, Netherlands, Spain, and the U.S. The Florida Death Index 1877-1998, received 5 million searchable records and another million records each for Oklahoma and Wisconsin.
--> Germany, Saxony, Dresden, Citizen's Documents and Business Licenses, 1820-1962
Bilder: 386.107
Indexiert: 0
New browsable image collection.
Sebastian Post - am Dienstag, 21. Februar 2012, 23:00 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Auf 48 Seiten stellt die Stiftung ihre Arbeit beim Aufbau des Pina-Bausch-Archivs vor. Lesens- und sehenswert!
Link zur PDF-Datei.
s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=pina+bausch
Wolf Thomas - am Dienstag, 21. Februar 2012, 15:51 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass die Existenz des FrauenMediaTurm (FMT) nicht länger bedroht ist. Die Bundesministerin für Frauen, Dr. Kristina Schröder, wird aus ihrem Etat für die Dauer von insgesamt vier Jahren jeweils 150.000 Euro an Fördermitteln bereitstellen, damit der FrauenMediaTurm trotz der vom Land NRW gekürzten Mittel weiter solide arbeiten kann.
„Ich mache das aus Freude und Überzeugung, denn bei der Förderung von Projekten geht es nicht um die Übereinstimmung in jeder Tonlage oder Argumentationsweise, sondern um den Grundkonsens, dass wir bedeutende Zeugnisse dieser bedeutenden Bewegung als Gesellschaft erhalten, unterstützen und befördern“, begründete Schröder ihre Zusage.
Damit hat das über 28 Jahre überwiegend aus privaten Kräften und mit acht Millionen Euro aufgebaute Universalarchiv zur aktuellen wie historischen Frauengeschichte wieder eine Perspektive, was Voraussetzung ist für die aktive Existenz eines Archivs. Die einmalige Sammlung des FMT von Texten, Dokumenten und Bildern ist schon heute voll computergestützt erschlossen, die FMT-Literatur-Datenbank steht online und ist integriert in das Hochschulbibliothekszentrum NRW. Doch mit angemessenem Personal kann der FMT seine Bestände wieder offensiver in die gesellschaftlichen Debatten einbringen.
Die rotgrüne „Frauenregierung“ hatte dem FrauenMediaTurm in 2011 die von Minister-präsident Rüttgers bis 2017 zugesagte Förderung überraschend von 210.000 € auf 70.000 € gekürzt (gerade mal die Betriebskosten). Der zur Funktion des Archivs notwendige Kernbetrieb mit mindestens drei Mitarbeiterinnen wäre nicht mehr aufrecht zu erhalten gewesen. Am 31. Januar 2012 machte der Vorstand der gemeinnützigen Stiftung FMT den Skandal auf einer Pressekonferenz öffentlich. Seither wurde vielfach darüber berichtet.
In anderen Ländern nimmt die Förderung der Sichtbarmachung der Frauengeschichte schon längst einen ganz anderen Raum ein. So fördern zum Beispiel die Niederlande ihr „Institut für Frauen- geschichte, Aletta“ mit 2,3 Millionen Euro im Jahr und hat das US-Repräsentantenhaus jüngst 400 Millionen Dollar für den von Feministinnen geplanten Bau eines National Women’s History Museum in Washington bewilligt.
Das Dokumentieren des Ringens um Emanzipation ist nicht nur für die Kontinuität einer wirklichen Gleichberechtigung der Geschlechter von großer Bedeutung. Ein gesichertes Archiv zur Geschichte der Emanzipation wäre auch für die folgenden Generationen ein lehrreicher Augenöffner. Und für Frauen ist es unverzichtbar; die angebliche „Geschichtslosigkeit“ von Frauen – das heißt ihre bis heute immer wieder geleugnete, ja ausradierte Geschichte – war schließlich bisher eines der größten Hindernisse zum Fortschritt. Denn ohne Geschichte keine Zukunft.
Alice Schwarzer, Vorstandsvorsitzende
Ursula Scheu, stellv. Vorsitzende
Barbara Schneider-Kempf, Vorstandsmitglied + Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin"
Quelle: FMT, Pressemitteilung v. 21.2.2012
3 Anmerkungen bzw. Fragen müssen allerdings nach der sowohl auf Facebook als auch hier geführten, intensiven Diskussion gemacht werden:
1) Trotz alledem: Herzlichen Glückwunsch nach Köln!
2) Ist die Förderung aus Berlin wenigstens mit archivischen Auflagen verbunden?
3) Wer recherchiert, ob es sich wenigstens hier um eine gerechte Mittelvergabe handelt?
„Ich mache das aus Freude und Überzeugung, denn bei der Förderung von Projekten geht es nicht um die Übereinstimmung in jeder Tonlage oder Argumentationsweise, sondern um den Grundkonsens, dass wir bedeutende Zeugnisse dieser bedeutenden Bewegung als Gesellschaft erhalten, unterstützen und befördern“, begründete Schröder ihre Zusage.
Damit hat das über 28 Jahre überwiegend aus privaten Kräften und mit acht Millionen Euro aufgebaute Universalarchiv zur aktuellen wie historischen Frauengeschichte wieder eine Perspektive, was Voraussetzung ist für die aktive Existenz eines Archivs. Die einmalige Sammlung des FMT von Texten, Dokumenten und Bildern ist schon heute voll computergestützt erschlossen, die FMT-Literatur-Datenbank steht online und ist integriert in das Hochschulbibliothekszentrum NRW. Doch mit angemessenem Personal kann der FMT seine Bestände wieder offensiver in die gesellschaftlichen Debatten einbringen.
Die rotgrüne „Frauenregierung“ hatte dem FrauenMediaTurm in 2011 die von Minister-präsident Rüttgers bis 2017 zugesagte Förderung überraschend von 210.000 € auf 70.000 € gekürzt (gerade mal die Betriebskosten). Der zur Funktion des Archivs notwendige Kernbetrieb mit mindestens drei Mitarbeiterinnen wäre nicht mehr aufrecht zu erhalten gewesen. Am 31. Januar 2012 machte der Vorstand der gemeinnützigen Stiftung FMT den Skandal auf einer Pressekonferenz öffentlich. Seither wurde vielfach darüber berichtet.
In anderen Ländern nimmt die Förderung der Sichtbarmachung der Frauengeschichte schon längst einen ganz anderen Raum ein. So fördern zum Beispiel die Niederlande ihr „Institut für Frauen- geschichte, Aletta“ mit 2,3 Millionen Euro im Jahr und hat das US-Repräsentantenhaus jüngst 400 Millionen Dollar für den von Feministinnen geplanten Bau eines National Women’s History Museum in Washington bewilligt.
Das Dokumentieren des Ringens um Emanzipation ist nicht nur für die Kontinuität einer wirklichen Gleichberechtigung der Geschlechter von großer Bedeutung. Ein gesichertes Archiv zur Geschichte der Emanzipation wäre auch für die folgenden Generationen ein lehrreicher Augenöffner. Und für Frauen ist es unverzichtbar; die angebliche „Geschichtslosigkeit“ von Frauen – das heißt ihre bis heute immer wieder geleugnete, ja ausradierte Geschichte – war schließlich bisher eines der größten Hindernisse zum Fortschritt. Denn ohne Geschichte keine Zukunft.
Alice Schwarzer, Vorstandsvorsitzende
Ursula Scheu, stellv. Vorsitzende
Barbara Schneider-Kempf, Vorstandsmitglied + Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin"
Quelle: FMT, Pressemitteilung v. 21.2.2012
3 Anmerkungen bzw. Fragen müssen allerdings nach der sowohl auf Facebook als auch hier geführten, intensiven Diskussion gemacht werden:
1) Trotz alledem: Herzlichen Glückwunsch nach Köln!
2) Ist die Förderung aus Berlin wenigstens mit archivischen Auflagen verbunden?
3) Wer recherchiert, ob es sich wenigstens hier um eine gerechte Mittelvergabe handelt?
Wolf Thomas - am Dienstag, 21. Februar 2012, 11:37 - Rubrik: Frauenarchive
meldet der Standard aus Wien: ""Derzeit weiß ich noch nichts": Luzia Owajko, stellvertretende Generaldirektorin für administrative Belange im Staatsarchiv, hat zwar " darüber gelesen", dass ihre Institution mit dem Heeresgeschichtlichen Museum in Wien zusammengelegt werden soll. Ein Gespräch über das Vorhaben gab es noch nicht. "Ich gehe aber davon aus, dass es dazu kommen wird", sagt sie auf Anfrage des Standard. Ob eine Fusion überhaupt sinnvoll ist? Owajko: "Das muss man sich anschauen."
Viel Zeit bleibt nicht. Ab 2013 soll die im Rahmen des Sparpakets beschlossene Zusammenlegung budgetär schlagend werden, heißt es im Verteidigungsministerium. Das Sparziel: 600.000 Euro pro Jahr. Wie die Neukonstruktion aussehen soll, lässt man offen. Eine Expertenrunde des Verteidigungsressorts (Museum) und des Bundeskanzleramtes (zuständig für das Archiv) arbeitet daran.
Die spärliche Information sorgt in der Historikerzunft für Irritation. " Was soll das?", fragt sich Gerhard Botz. Das Museum und das Archiv seien " nicht die richtigen Partner". Er glaubt, dass "hier keine großen museumsgeschichtlichen Neuorientierungen eine Rolle spielen". Auch in den Niederlanden wird das Staatsarchiv mit einer anderen Institution verschmolzen. Dort ist es allerdings die Nationalbibliothek.
"Ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen soll", sagt der Historiker Manfried Rauchensteiner, selbst langjähriger Direktor des Heeres-Museums. Eines ist für ihn aber klar: "Dass das ein Haus der Geschichte wird, sehe ich nicht."
Botz will auch als "ÖsterreichKenner" wissen, wie für den Direktor des Museums eine adäquate Position geschaffen würde. Zufall oder nicht: Das Staatsarchiv hat die Generaldirektorenstelle vor kurzem ausgeschrieben. "
Quelle: pm, DER STANDARD Printausgabe, 21.2.2012
Viel Zeit bleibt nicht. Ab 2013 soll die im Rahmen des Sparpakets beschlossene Zusammenlegung budgetär schlagend werden, heißt es im Verteidigungsministerium. Das Sparziel: 600.000 Euro pro Jahr. Wie die Neukonstruktion aussehen soll, lässt man offen. Eine Expertenrunde des Verteidigungsressorts (Museum) und des Bundeskanzleramtes (zuständig für das Archiv) arbeitet daran.
Die spärliche Information sorgt in der Historikerzunft für Irritation. " Was soll das?", fragt sich Gerhard Botz. Das Museum und das Archiv seien " nicht die richtigen Partner". Er glaubt, dass "hier keine großen museumsgeschichtlichen Neuorientierungen eine Rolle spielen". Auch in den Niederlanden wird das Staatsarchiv mit einer anderen Institution verschmolzen. Dort ist es allerdings die Nationalbibliothek.
"Ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen soll", sagt der Historiker Manfried Rauchensteiner, selbst langjähriger Direktor des Heeres-Museums. Eines ist für ihn aber klar: "Dass das ein Haus der Geschichte wird, sehe ich nicht."
Botz will auch als "ÖsterreichKenner" wissen, wie für den Direktor des Museums eine adäquate Position geschaffen würde. Zufall oder nicht: Das Staatsarchiv hat die Generaldirektorenstelle vor kurzem ausgeschrieben. "
Quelle: pm, DER STANDARD Printausgabe, 21.2.2012
Wolf Thomas - am Dienstag, 21. Februar 2012, 10:47 - Rubrik: Kooperationsmodelle
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.facebook.com/pages/Stadtarchiv-Brilon/131399860311655?sk=wall
Das Briloner Stadtarchiv präsentiert dort das Fundstück der Woche.
[Link korrigiert, KG]
Das Briloner Stadtarchiv präsentiert dort das Fundstück der Woche.
[Link korrigiert, KG]
Wolf Thomas - am Dienstag, 21. Februar 2012, 10:32 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"— das neue von der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena (ThULB) bereit gestellte Portal — bietet einen zentralen Sucheinstieg zu einer Vielzahl digitalisierter Kulturgüter des Freistaats Thüringen.
Das 2011 auf den Weg gebrachte Portal bündelt den außergewöhnlich vielfältigen Quellen- und Wissensfundus an kultureller Überlieferung aus und über Thüringen. Mit Hilfe innovativer Suchmaschinentechnologie sind Bestände der zahlreich beteiligten Thüringer Wissenschafts- und Kultureinrichtungen unter einer einheitlichen attraktiven Oberfläche gemeinsam recherchierbar. In ihrer Gesamtheit bilden diese Ressourcen die außergewöhnlich reichhaltige Kulturviefalt ab, welche als international bekanntes Signum der „Kulturlandschaft Thüringen“ gelten kann.
Zahlreiche Bibliotheken, Archive, Museen und weitere Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen unterstützen dieses Vorhaben bereits in der Startphase. Mit ihren Beständen tragen sie dazu bei, das überaus reichhaltige Angebot an digital vorliegenden Kulturgütern gezielt und kompakt über einen zentralen Zugangspunkt auffindbar zu machen. digitales thüringen ermöglicht die Vernetzung der in verschiedenen Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen digitalisierten und qualifiziert erschlossenen Kulturgüter. Damit wird eine strukturierte Bereitstellung digitaler Kulturgüter im Kontext einer zukünftigen Deutschen Digitalen Bibliothek sowie weiterer Regionalportale gewährleistet.
Das Angebot wird ständig erweitert. Neben den im Rahmen der Universal Multimedia Electronic Library (UrMEL) der ThULB Jena und ihrer Partner verfügbaren Angebote umfasst digitales thüringen eine Vielzahl weiterer historischer Bestände aus verschiedenen Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen. Die Anzahl der Beitragenden wächst dabei wie die der recherchierbaren Objekte selbst kontinuierlich an.
Nutzerinnen und Nutzer sind eingeladen, sich im Rahmen von digitales thüringen neue Wissenswelten zu erschließen. Einzelne Objekte und wissenschaftliche Online-Ressourcen können gezielt recherchiert und angezeigt werden. Darüber hinaus werden Suchergebnisse im Kontext aufbereitet. Der technische Rahmen von digitales thüringen basiert auf der Software VuFind mit der integrierten Suchmaschine Solr. "
Link zum Portal
Der thüringische BAM-Klon.
Das 2011 auf den Weg gebrachte Portal bündelt den außergewöhnlich vielfältigen Quellen- und Wissensfundus an kultureller Überlieferung aus und über Thüringen. Mit Hilfe innovativer Suchmaschinentechnologie sind Bestände der zahlreich beteiligten Thüringer Wissenschafts- und Kultureinrichtungen unter einer einheitlichen attraktiven Oberfläche gemeinsam recherchierbar. In ihrer Gesamtheit bilden diese Ressourcen die außergewöhnlich reichhaltige Kulturviefalt ab, welche als international bekanntes Signum der „Kulturlandschaft Thüringen“ gelten kann.
Zahlreiche Bibliotheken, Archive, Museen und weitere Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen unterstützen dieses Vorhaben bereits in der Startphase. Mit ihren Beständen tragen sie dazu bei, das überaus reichhaltige Angebot an digital vorliegenden Kulturgütern gezielt und kompakt über einen zentralen Zugangspunkt auffindbar zu machen. digitales thüringen ermöglicht die Vernetzung der in verschiedenen Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen digitalisierten und qualifiziert erschlossenen Kulturgüter. Damit wird eine strukturierte Bereitstellung digitaler Kulturgüter im Kontext einer zukünftigen Deutschen Digitalen Bibliothek sowie weiterer Regionalportale gewährleistet.
Das Angebot wird ständig erweitert. Neben den im Rahmen der Universal Multimedia Electronic Library (UrMEL) der ThULB Jena und ihrer Partner verfügbaren Angebote umfasst digitales thüringen eine Vielzahl weiterer historischer Bestände aus verschiedenen Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen. Die Anzahl der Beitragenden wächst dabei wie die der recherchierbaren Objekte selbst kontinuierlich an.
Nutzerinnen und Nutzer sind eingeladen, sich im Rahmen von digitales thüringen neue Wissenswelten zu erschließen. Einzelne Objekte und wissenschaftliche Online-Ressourcen können gezielt recherchiert und angezeigt werden. Darüber hinaus werden Suchergebnisse im Kontext aufbereitet. Der technische Rahmen von digitales thüringen basiert auf der Software VuFind mit der integrierten Suchmaschine Solr. "
Link zum Portal
Der thüringische BAM-Klon.
Wolf Thomas - am Dienstag, 21. Februar 2012, 09:02 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
"Michael Bullington gives a tour of his office in former Hamburger University ....."
See more: Chicago Tribune, 20.02.2012
See more: Chicago Tribune, 20.02.2012
Wolf Thomas - am Dienstag, 21. Februar 2012, 08:56 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Dienstag, 21. Februar 2012, 08:40 - Rubrik: Genealogie
Link: http://twitter.com/isg_mannheim
Jetzt twittert auch erstmals (?) ein Vorstandsmitglied der Fachgruppe 2 (Kommunalarchive) und somit edin Mitglied des Gesamtvorstandes des Vereins deutscher Archivarinnen und Archivare institutionell! Ein Wunder? Ein Wunder!
Jetzt twittert auch erstmals (?) ein Vorstandsmitglied der Fachgruppe 2 (Kommunalarchive) und somit edin Mitglied des Gesamtvorstandes des Vereins deutscher Archivarinnen und Archivare institutionell! Ein Wunder? Ein Wunder!
Wolf Thomas - am Dienstag, 21. Februar 2012, 08:19 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Mit ihrem "Memo-Mobil", einem Mini-Archiv auf Rädern, wanderte die Regisseurin und Autorin Mirjam Strunk im Kulturhauptstadtjahr 2010 durch das Ruhrgebiet und sammelte Erinnerungen der Bewohner. Das dabei in Form von Schriftstücken, Filmen, Fotos und Tönen entstandene "Gedächtnis des Ruhrgebiets" wird jetzt im Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte gezeigt.
Für die Ausstellung hat die Künstlerin Cordula Körber das Projekt als Multimedia-Installation neu inszeniert. In den Räumen des Bochumer Stadtarchives soll das Projekt "das Verhältnis von individueller und kollektiver Erinnerung" thematisieren und nach dem Wert von Erinnerungskultur für eine Stadt und ihre Bewohner fragen.
Zur Eröffnung am 26. Februar 2012 lesen die Schauspieler Anke Zillich und Manfred Böll Auszüge aus den gesammelten Erinnerungen. Mirjam Strunk wird von ihren Erlebnissen während ihrer Wanderung berichten. "
Stadt Bochum, Ausstellungsvorschau
Wolf Thomas - am Dienstag, 21. Februar 2012, 07:55 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Link zum PDF: MIÖG Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 56 (2011)
Wolf Thomas - am Dienstag, 21. Februar 2012, 07:50 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
Linked Open Data from europeana on Vimeo.
Simple animation to explain what Linked Open Data is and why it's a good thing, both for users and for data providers.Wolf Thomas - am Dienstag, 21. Februar 2012, 07:47 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Carové, Friedrich Wilhelm, in: Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes, 2. Aufl., Bd. 2, Berlin/New York 2008, S. 372-373
Carové, Friedrich Wilhelm, * 20.6.1789
Koblenz, † 18.3.1852 Heidelberg. – Literat,
Publizist u. Religionsphilosoph.
Nach einer Ausbildung zum Juristen an der
Koblenzer Rechtsfakultät (Licencié en droit
1809) u. verschiedenen Posten im frz. Verwaltungsdienst
studierte C. ab 1816 in Heidelberg
Philosophie, wo er sich eng an Hegel
anschloss. Auf dem Wartburgfest in Eisenach
1817 war er einer der Hauptredner u. Vertreter
der Heidelberger Burschenschaft. 1818
in Heidelberg zum Dr. phil. promoviert,
folgte er Hegel nach Berlin. Doch seine frei-
[S. 373]
heitl. Gesinnung verbaute ihm sowohl dort
als auch in Breslau u. Heidelberg die angestrebte
Universitätslaufbahn als Philosoph.
Er lebte fortan als Privatgelehrter u. Publizist
abwechselnd in Frankfurt/M. u. in Heidelberg.
1848 war er Mitgl. des Frankfurter
Vorparlaments.
C. vertrat in seinen rd. 40 monograf.
Schriften u. zahlreichen Zeitschriftenartikeln
die Ideale der Humanität. Der Kosmopolit
engagierte sich in der internat. Friedensbewegung
u. gegen die Sklaverei. Katholischer
Herkunft, setzte C. sich in religions- u. geschichtsphilosoph.
Arbeiten kritisch mit dem
Machtanspruch seiner Kirche auseinander,
die er weder für unfehlbar noch alleinseligmachend
hielt. An ihre Stelle sollte eine auf
christl. Prinzipien gegründete Menschheitsreligion
treten. Begeistert von altdt. Literatur
u. Kunst, gab er gemeinsam mit dem Kölner
Eberhard von Groote zu dieser Thematik ein
Taschenbuch auf das Jahr 1816 heraus. Für
die Brüder Grimm sammelte er Volkserzählungen
u. Bräuche aus dem Rheinland u. von
der Mosel (1816. Aus dem Grimm-Nachl. hg.
v. Leander Petzoldt 1997). Der romant. Poetik
sind seine Prosadichtungen in den Bänden
Romantische Blätter (Eisenach 1818) u. Moosblüthen
(Ffm. 1830) verpflichtet (beide liegen
vor als Mikrofiche-Ed. Mchn. 1994). Das im
ersteren enthaltene Kunstmärchen Kinderleben
oder das Mährchen ohne Ende wurde durch die
Übersetzung von Sarah Austin (The Story
without an End) im angloamerikan. Raum äußerst
populär.
Literatur: Albert Schürmann: F. W. C. Sein
Werk als Beitr. zur Kritik an Staat u. Kirche im
frühliberalen Hegelianismus. Diss. Bochum 1971. –
Christoph E. Schweitzer: F. W. C., Autor eines
einzigartigen Kunstmärchens. In: ABNG 31–33
(1991), S. 133–153. – Helge Dvorak: Biogr. Lexikon
der Dt. Burschenschaft. Bd. 1,1 (1996), S. 165. –
Klaus Graf: F. W. C. (1789–1852): Ein Tag auf dem
Stadtturm zu Andernach. In: Andernacher Annalen
4 (2001/02), S. 57–76. Klaus Graf
Kopie des Online-E-Textes.
Zu Carové:
Der Beitrag in den Andernacher Annalen geht auf die Internetseite
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/carove.htm
zurück.
[ http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hebis:30-1137973 ]
Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Carov%C3%A9
Wikisource
http://de.wikisource.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Carov%C3%A9

Carové, Friedrich Wilhelm, * 20.6.1789
Koblenz, † 18.3.1852 Heidelberg. – Literat,
Publizist u. Religionsphilosoph.
Nach einer Ausbildung zum Juristen an der
Koblenzer Rechtsfakultät (Licencié en droit
1809) u. verschiedenen Posten im frz. Verwaltungsdienst
studierte C. ab 1816 in Heidelberg
Philosophie, wo er sich eng an Hegel
anschloss. Auf dem Wartburgfest in Eisenach
1817 war er einer der Hauptredner u. Vertreter
der Heidelberger Burschenschaft. 1818
in Heidelberg zum Dr. phil. promoviert,
folgte er Hegel nach Berlin. Doch seine frei-
[S. 373]
heitl. Gesinnung verbaute ihm sowohl dort
als auch in Breslau u. Heidelberg die angestrebte
Universitätslaufbahn als Philosoph.
Er lebte fortan als Privatgelehrter u. Publizist
abwechselnd in Frankfurt/M. u. in Heidelberg.
1848 war er Mitgl. des Frankfurter
Vorparlaments.
C. vertrat in seinen rd. 40 monograf.
Schriften u. zahlreichen Zeitschriftenartikeln
die Ideale der Humanität. Der Kosmopolit
engagierte sich in der internat. Friedensbewegung
u. gegen die Sklaverei. Katholischer
Herkunft, setzte C. sich in religions- u. geschichtsphilosoph.
Arbeiten kritisch mit dem
Machtanspruch seiner Kirche auseinander,
die er weder für unfehlbar noch alleinseligmachend
hielt. An ihre Stelle sollte eine auf
christl. Prinzipien gegründete Menschheitsreligion
treten. Begeistert von altdt. Literatur
u. Kunst, gab er gemeinsam mit dem Kölner
Eberhard von Groote zu dieser Thematik ein
Taschenbuch auf das Jahr 1816 heraus. Für
die Brüder Grimm sammelte er Volkserzählungen
u. Bräuche aus dem Rheinland u. von
der Mosel (1816. Aus dem Grimm-Nachl. hg.
v. Leander Petzoldt 1997). Der romant. Poetik
sind seine Prosadichtungen in den Bänden
Romantische Blätter (Eisenach 1818) u. Moosblüthen
(Ffm. 1830) verpflichtet (beide liegen
vor als Mikrofiche-Ed. Mchn. 1994). Das im
ersteren enthaltene Kunstmärchen Kinderleben
oder das Mährchen ohne Ende wurde durch die
Übersetzung von Sarah Austin (The Story
without an End) im angloamerikan. Raum äußerst
populär.
Literatur: Albert Schürmann: F. W. C. Sein
Werk als Beitr. zur Kritik an Staat u. Kirche im
frühliberalen Hegelianismus. Diss. Bochum 1971. –
Christoph E. Schweitzer: F. W. C., Autor eines
einzigartigen Kunstmärchens. In: ABNG 31–33
(1991), S. 133–153. – Helge Dvorak: Biogr. Lexikon
der Dt. Burschenschaft. Bd. 1,1 (1996), S. 165. –
Klaus Graf: F. W. C. (1789–1852): Ein Tag auf dem
Stadtturm zu Andernach. In: Andernacher Annalen
4 (2001/02), S. 57–76. Klaus Graf
Kopie des Online-E-Textes.
Zu Carové:
Der Beitrag in den Andernacher Annalen geht auf die Internetseite
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/carove.htm
zurück.
[ http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hebis:30-1137973 ]
Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Carov%C3%A9
Wikisource
http://de.wikisource.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Carov%C3%A9

KlausGraf - am Montag, 20. Februar 2012, 22:50 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Drei Schülerinnen und Schüler von der Wichern-Schule in Hamburg haben zum neuen Wettbewerbsthema »Ärgernis, Aufsehen, Empörung: Skandale in der Geschichte« eine Pilotstudie verfasst. Ihr Thema: Der Skandal um die Aufführung des Theaterstücks »Die Verbrecher« von Ferdinand Bruckner am Hamburger Schauspielhaus 1928.
Der Filmemacher Ulrich Raatz hat die Jugendlichen bei ihren Recherchen unter anderem im Staatsarchiv Hamburg mit der Kamera begleitet und ihren Arbeitsprozess dokumentiert.
Wolf Thomas - am Montag, 20. Februar 2012, 20:52 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.richardpoynder.co.uk/Eisen_Interview.pdf
Interessantes Detail: In etwa 10 % der Fälle erlässt PLoS die Artikelgebühren.
Interessantes Detail: In etwa 10 % der Fälle erlässt PLoS die Artikelgebühren.
KlausGraf - am Montag, 20. Februar 2012, 16:20 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://netzpolitik.org/2012/interesse-am-gutachten-zur-abgeordnetenkorruption/
Stefan Wehrmeyer hat eine Anfrage nach dem Gutachten gestellt und es für die private Einsicht erhalten. Er hat es auch schon eingescannt und würde es am liebsten als PDF online zu stellen. Aber der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat ihm die Veröffentlichung verboten und droht bei Zuwiderhandlung mit zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen.
Angeblich hat der Wissenschaftliche Dienst ein Urheberrecht auf alle Gutachten und somit könnte er entscheiden, ob und wer diese Gutachten veröffentlichen darf. Leider ist nur ein Bruchteil aller Gutachten, auf deren Grundlage unsere Bundestagsabgeordneten immerhin ihre Entscheidungen fällen, öffentlich verfügbar. Damit andere möglichst einfachen und legalen Zugang zu diesem Dokument erhalten können, gibt es auf FragDenStaat.de jetzt für Nutzer die Möglichkeit mit einem Klick die gleiche Anfrage in ihrem Namen zu stellen.
Es wurde auch vorgeschlagen, das Gutachten zu leaken, also anonym online zu verbreiten. Viel interessanter ist es den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags dazu zu bringen, seine Gutachten selbst online zu stellen. Was sollte eigentlich dagegen sprechen? Und was ist überzeugender, als wenn möglichst viele Bürger Interesse an diesen Gutachten zeigen und sie anfragen?
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/156270567/
Stefan Wehrmeyer hat eine Anfrage nach dem Gutachten gestellt und es für die private Einsicht erhalten. Er hat es auch schon eingescannt und würde es am liebsten als PDF online zu stellen. Aber der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat ihm die Veröffentlichung verboten und droht bei Zuwiderhandlung mit zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen.
Angeblich hat der Wissenschaftliche Dienst ein Urheberrecht auf alle Gutachten und somit könnte er entscheiden, ob und wer diese Gutachten veröffentlichen darf. Leider ist nur ein Bruchteil aller Gutachten, auf deren Grundlage unsere Bundestagsabgeordneten immerhin ihre Entscheidungen fällen, öffentlich verfügbar. Damit andere möglichst einfachen und legalen Zugang zu diesem Dokument erhalten können, gibt es auf FragDenStaat.de jetzt für Nutzer die Möglichkeit mit einem Klick die gleiche Anfrage in ihrem Namen zu stellen.
Es wurde auch vorgeschlagen, das Gutachten zu leaken, also anonym online zu verbreiten. Viel interessanter ist es den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags dazu zu bringen, seine Gutachten selbst online zu stellen. Was sollte eigentlich dagegen sprechen? Und was ist überzeugender, als wenn möglichst viele Bürger Interesse an diesen Gutachten zeigen und sie anfragen?
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/156270567/
KlausGraf - am Montag, 20. Februar 2012, 14:59 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 20. Februar 2012, 14:46 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Im RSS-Feed waren heute eine ganze Menge neu eingestellte Digitalisate, vermutlich Auftragsreproduktionen. Inzwischen bietet die Staatsbibliothek 78 Handschriften kostenlos online zur Einsicht an:
http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/suche/?DC=handschriften
Darunter ist auch die neu erworbene Handschrift aus dem Brandis-Archiv:
http://archiv.twoday.net/stories/8474674/
http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/suche/?DC=handschriften
Darunter ist auch die neu erworbene Handschrift aus dem Brandis-Archiv:
http://archiv.twoday.net/stories/8474674/
KlausGraf - am Montag, 20. Februar 2012, 14:01 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/tp/artikel/36/36442/1.html
Das deutsche Immaterialgüterrecht ist so veraltet, dass eigentlich nur totale Technikverweigerer unter Schweigegelübde nicht mit ihm in Konflikt kommen können. Manche Politiker fordern deshalb eine Liberalisierung - andere dagegen eine Verschärfung. Allerdings sind auch Urheberrechtsextremisten keineswegs vor versehentlichen Verletzungshandlungen gefeit, wie das Wiki Netend zeigt. Dort werden Immaterialgüterrechtsverstöße von Politikern gesammelt, die durch besonderen Einsatz für mehr Monopol- und Verbotsrechte für die Rechteverwerterindustrie auf sich aufmerksam machten.
http://de.netend.wikia.com/wiki/Netend_Wiki
Das deutsche Immaterialgüterrecht ist so veraltet, dass eigentlich nur totale Technikverweigerer unter Schweigegelübde nicht mit ihm in Konflikt kommen können. Manche Politiker fordern deshalb eine Liberalisierung - andere dagegen eine Verschärfung. Allerdings sind auch Urheberrechtsextremisten keineswegs vor versehentlichen Verletzungshandlungen gefeit, wie das Wiki Netend zeigt. Dort werden Immaterialgüterrechtsverstöße von Politikern gesammelt, die durch besonderen Einsatz für mehr Monopol- und Verbotsrechte für die Rechteverwerterindustrie auf sich aufmerksam machten.
http://de.netend.wikia.com/wiki/Netend_Wiki
KlausGraf - am Montag, 20. Februar 2012, 13:48 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Weil der Verlag Gallimard die Verbreitung einer in den Handel gelangten Hemingway-Neuübersetzung unterbinden ließ, steht er und das geltende Urheberrecht im Kreuzfeuer der Kritik. Mareike König berichtet:
http://plan3t.info/2012/02/20/twitter-krieg-gegen-verlage-auch-gallimard-im-kreuzfeuer/
Viele Links dazu:
http://oreilletendue.com/2012/02/17/appui-a-francois-bon/
http://plan3t.info/2012/02/20/twitter-krieg-gegen-verlage-auch-gallimard-im-kreuzfeuer/
Viele Links dazu:
http://oreilletendue.com/2012/02/17/appui-a-francois-bon/
KlausGraf - am Montag, 20. Februar 2012, 13:33 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Les archives départementales se mettent à la page... internet - spectacles.fr
Les archives départementales ont ouvert leur site internet au début de l'année. Ce nouveau média permet notamment au public de trouver des informations pratiques et également de consulter de nombreux documents en ligne. Le site couvre les archives, les bibliothèques et l'archéologie. Un outil indispensable pour tous les chercheurs chevronnés ou en herbe. www.archives.hauts-de-seine.net
Les archives départementales ont ouvert leur site internet au début de l'année. Ce nouveau média permet notamment au public de trouver des informations pratiques et également de consulter de nombreux documents en ligne. Le site couvre les archives, les bibliothèques et l'archéologie. Un outil indispensable pour tous les chercheurs chevronnés ou en herbe. www.archives.hauts-de-seine.net
Video de cg92-videos
Wolf Thomas - am Sonntag, 19. Februar 2012, 21:57 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 19. Februar 2012, 19:26 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Sonntag, 19. Februar 2012, 18:22 - Rubrik: Archivpaedagogik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Einige Links dazu stellt bereit:
http://blog.hapke.de/libraries-in-general/diskussionen-um-wissenschaftsverlage-open-access-etc/
Ergänzend dazu der Beitrag von Giesbert Damaschke:
http://blog.zdf.de/hyperland/2012/02/wissen-muss-frei-sein/
Auch das Handelsblatt berichtet:
http://www.handelsblatt.com/politik/oekonomie/nachrichten/teure-wissenschaft-neue-magazine-haben-es-schwer/6203330-2.html
" Nach Einschätzung von Analysten der Bank Exane Paribas haben die Proteste bereits wirtschaftliche Folgen und belasten den Aktienkurs des Mutterhauses Reed Elsevier. [...]
Insgesamt sind Journale, die von kommerziellen Verlagen herausgegeben werden, im Schnitt dreimal so teuer wie Fachzeitschriften von Non-Profit-Institutionen wie Universitätsverlagen, zeigen Daten von Bergstrom und Mcaffee. Die beiden Forscher erfassen die Preise von Wissenschaftsverlagen systematisch in einer Datenbank. Elsevier versuchte Hochschulbibliotheken mit juristischen Mitten daran zu hindern, den Forschern die Vertragsdetails zu offenbaren - verlor aber 2009 einen Prozess gegen die Washington State University."
Zur Intransparenz von Elsevier siehe auch die von mir unter http://archiv.twoday.net/stories/64967798/ bekanntgemachte Weigerung des Robert-Koch-Instituts die einzelnen Embargoperioden der Elsevier-Zeitschriften offenzulegen, da es sich um ein geheimhaltungsbedürftiges Geschäftsgeheimnis von Elsevier handle!
http://blog.hapke.de/libraries-in-general/diskussionen-um-wissenschaftsverlage-open-access-etc/
Ergänzend dazu der Beitrag von Giesbert Damaschke:
http://blog.zdf.de/hyperland/2012/02/wissen-muss-frei-sein/
Auch das Handelsblatt berichtet:
http://www.handelsblatt.com/politik/oekonomie/nachrichten/teure-wissenschaft-neue-magazine-haben-es-schwer/6203330-2.html
" Nach Einschätzung von Analysten der Bank Exane Paribas haben die Proteste bereits wirtschaftliche Folgen und belasten den Aktienkurs des Mutterhauses Reed Elsevier. [...]
Insgesamt sind Journale, die von kommerziellen Verlagen herausgegeben werden, im Schnitt dreimal so teuer wie Fachzeitschriften von Non-Profit-Institutionen wie Universitätsverlagen, zeigen Daten von Bergstrom und Mcaffee. Die beiden Forscher erfassen die Preise von Wissenschaftsverlagen systematisch in einer Datenbank. Elsevier versuchte Hochschulbibliotheken mit juristischen Mitten daran zu hindern, den Forschern die Vertragsdetails zu offenbaren - verlor aber 2009 einen Prozess gegen die Washington State University."
Zur Intransparenz von Elsevier siehe auch die von mir unter http://archiv.twoday.net/stories/64967798/ bekanntgemachte Weigerung des Robert-Koch-Instituts die einzelnen Embargoperioden der Elsevier-Zeitschriften offenzulegen, da es sich um ein geheimhaltungsbedürftiges Geschäftsgeheimnis von Elsevier handle!
KlausGraf - am Sonntag, 19. Februar 2012, 16:20 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Jeffrey Beall is a librarian living in Colorado with high merits in studying predatory Open Access publishers and journals. He is the leading expert in this area.
http://archiv.twoday.net/search?q=predatory
http://archiv.twoday.net/stories/5935318/ (first mention of Beall here in 2009)
I have his blog Scholarly Open Access http://scholarlyoa.com/ in my feeds and read his new piece on Greener Journals
http://scholarlyoa.com/2012/02/18/the-open-access-movement-reaches-a-new-low-greener-journals/
The publisher’s website boasts bright colors but uses unidiomatic English filled with grammatical errors. [...] I cannot understand why any serious researcher would pay to have their scholarly articles published by this ridiculous publisher.
As my own English isn't much better I cannot see bad English as reason to condemn an OA publisher. But browsing through the journal contents I found an article by a serious scientist, Patrick D. Biber:
http://www.gjournals.org/GJAS/GJAS%20Abstract/Abstract%202011/August/Biber.html
He has published in various reputable journals:
http://www.usm.edu/gcrl/cv/biber.patrick/publications.biber.php
What the hell motivates an US Associate professor to publish in such a bogus journal? But looking closer on his publications list it is clear that he has published the article already in 2006:
Biber, P.D. 2006. Measuring the effects of salinity stress in the red mangrove, Rhizophora mangle L., African Journal of Agricultural Research 1(1): 1-4 [pdf]
Curiously enough there isn't a link under "pdf" like the most other publikations. The African Journal of Agricultural Research is an other Open Access journal which is due its publisher Academic Journals on Beall's Black list:
http://scholarlyoa.com/publishers/
Nevertheless Biber's contribution seems serious because it was cited several times including Elsevier journals - according to Google Scholar.
It is not marked in the article nor in the frontdoor page by Academic Journals that the article is CC-BY but this is indeed the case according to the general statement:
http://www.academicjournals.org/Creative%20Common%20Attribution%20License.htm
Academic Journal (with contact adresses in Kenia and Lagos) writes on handling fees: Academic Journals is a self supporting organization and does not receive funding from any institution/government. Hence, the operation of the Journal is solely financed by the handling fees received from authors. The handling fees are required to meet operations expenses such as employees’ salaries, internet services, electricity etc. Being an Open Access Publisher, Academic Journals does not receive payment for subscription as the journals are freely accessible over the internet.
Greener Journals (with a contact adress in Lagos) has exact the same wording.
http://www.gjournals.org/Open%20Access%20Journal.html
Pure plagiarism or indication of personal connections between the two publishers?
I cannot find any evidence on the websites that it is allowed to the publisher on the ground of a copyright transfer or a contract to re-use the arcticle. (And this would only work under the premise that the publisher of Academic Journals and Greener Journals is the same.)
Now we have to examine if the CC license allows this dubious re-use of an old OA article. It is clear what the intention of Greener Journals is: By copying the PDF from Academic Journals (omitting the date of the acceptance 10, August 2006 and changing the copyright notice) the very small contents of the Greener Journal Archives are enriched by a good article of a serious US scientist.
Obviously this practice is highly misleading and unethical - but it is legal according the CC terms?
As readers of my blog entries will know for me the CC-BY license is the only appropriate license to fulfill the BBB OA definitions. Make all research results CC-BY and the data CC0!
But this only works if the terms of the license are respected. You cannot say "Hey scholars look at this case - this can happen if you make your articles CC-BY!" Thus my aim is to show that the re-use isn't legal and this sceptical argument isn't valid. CC-BY is the best way for the progress of science and arts!
First you have to ask if there is a specification on the original website defining the attribution like "By attributing this article according the CC-BY license you have to mention the name of the author, the name of the journal and the following URL". Read the legal code at
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
4b If You Distribute, or Publicly Perform the Work or any Adaptations or Collections, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and (iv) , consistent with Section 3(b), in the case of an Adaptation, a credit identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g., "French translation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). The credit required by this Section 4 (b) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Adaptation or Collection, at a minimum such credit will appear, if a credit for all contributing authors of the Adaptation or Collection appears, then as part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing authors. For the avoidance of doubt, You may only use the credit required by this Section for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising Your rights under this License, You may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of You or Your use of the Work, without the separate, express prior written permission of the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties.
Therefore it is possible to designate the name of the author the journal title and the publisher as "attribution parties".
I am unaware of any OA CC-BY journal with such a designation. For me it is ethical to mirror a CC-BY article with the standard bibliographic citation like Biber, P.D. 2006. Measuring the effects of salinity stress in the red mangrove, Rhizophora mangle L., African Journal of Agricultural Research 1(1): 1-4 adding the source URL (or DOI - please keep in mind that both publishers doesn't offer DOIs!). If I have some critical comments on Biber's work I can reproduce the whole article for reader's comfort. This is the sense of CC-BY.
As there is no such designation on the Academic journals website there is no license violation by Greener Journals in this regard.
But there are two other violations of the license terms:
1. There is no mentioning of the CC-license in the PDF nor on the abstract page by Greener Journals.
The CC-BY legal code reads: You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform.
2. The original copyright notices are not kept ("keep intact all copyright notices for the Work", quoted above). For German law see also § 95c UrhG (German Copyright Act).
I cannot image that Professor Biber has made an individual contract with the Lagos company or persons behind Greener Journals allowing them to re-use its 2006 article. Thus one has to conclude that the fraudulent re-use by Greener Journals clearly violates the CC-BY license terms. Violating the CC terms is violation of copyright. It is illegal and this clearly confirms Beall's judgement on this bogus OA publisher.
------------
CC-BY (URL quoted above). You are free to distribute this blog entry (without the picture below), to build upon or adapt it (especially by meliorating its English) if you distribute it with the following Copyright notice: "(c) Klaus Graf: Greener Journals. In: Archivalia, 2012, Februar 19, http://archiv.twoday.net/stories/64979561/" And don't forget to mention the license URI!
 Source: Greener Journals website
Source: Greener Journals website
http://archiv.twoday.net/search?q=predatory
http://archiv.twoday.net/stories/5935318/ (first mention of Beall here in 2009)
I have his blog Scholarly Open Access http://scholarlyoa.com/ in my feeds and read his new piece on Greener Journals
http://scholarlyoa.com/2012/02/18/the-open-access-movement-reaches-a-new-low-greener-journals/
The publisher’s website boasts bright colors but uses unidiomatic English filled with grammatical errors. [...] I cannot understand why any serious researcher would pay to have their scholarly articles published by this ridiculous publisher.
As my own English isn't much better I cannot see bad English as reason to condemn an OA publisher. But browsing through the journal contents I found an article by a serious scientist, Patrick D. Biber:
http://www.gjournals.org/GJAS/GJAS%20Abstract/Abstract%202011/August/Biber.html
He has published in various reputable journals:
http://www.usm.edu/gcrl/cv/biber.patrick/publications.biber.php
What the hell motivates an US Associate professor to publish in such a bogus journal? But looking closer on his publications list it is clear that he has published the article already in 2006:
Biber, P.D. 2006. Measuring the effects of salinity stress in the red mangrove, Rhizophora mangle L., African Journal of Agricultural Research 1(1): 1-4 [pdf]
Curiously enough there isn't a link under "pdf" like the most other publikations. The African Journal of Agricultural Research is an other Open Access journal which is due its publisher Academic Journals on Beall's Black list:
http://scholarlyoa.com/publishers/
Nevertheless Biber's contribution seems serious because it was cited several times including Elsevier journals - according to Google Scholar.
It is not marked in the article nor in the frontdoor page by Academic Journals that the article is CC-BY but this is indeed the case according to the general statement:
http://www.academicjournals.org/Creative%20Common%20Attribution%20License.htm
Academic Journal (with contact adresses in Kenia and Lagos) writes on handling fees: Academic Journals is a self supporting organization and does not receive funding from any institution/government. Hence, the operation of the Journal is solely financed by the handling fees received from authors. The handling fees are required to meet operations expenses such as employees’ salaries, internet services, electricity etc. Being an Open Access Publisher, Academic Journals does not receive payment for subscription as the journals are freely accessible over the internet.
Greener Journals (with a contact adress in Lagos) has exact the same wording.
http://www.gjournals.org/Open%20Access%20Journal.html
Pure plagiarism or indication of personal connections between the two publishers?
I cannot find any evidence on the websites that it is allowed to the publisher on the ground of a copyright transfer or a contract to re-use the arcticle. (And this would only work under the premise that the publisher of Academic Journals and Greener Journals is the same.)
Now we have to examine if the CC license allows this dubious re-use of an old OA article. It is clear what the intention of Greener Journals is: By copying the PDF from Academic Journals (omitting the date of the acceptance 10, August 2006 and changing the copyright notice) the very small contents of the Greener Journal Archives are enriched by a good article of a serious US scientist.
Obviously this practice is highly misleading and unethical - but it is legal according the CC terms?
As readers of my blog entries will know for me the CC-BY license is the only appropriate license to fulfill the BBB OA definitions. Make all research results CC-BY and the data CC0!
But this only works if the terms of the license are respected. You cannot say "Hey scholars look at this case - this can happen if you make your articles CC-BY!" Thus my aim is to show that the re-use isn't legal and this sceptical argument isn't valid. CC-BY is the best way for the progress of science and arts!
First you have to ask if there is a specification on the original website defining the attribution like "By attributing this article according the CC-BY license you have to mention the name of the author, the name of the journal and the following URL". Read the legal code at
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
4b If You Distribute, or Publicly Perform the Work or any Adaptations or Collections, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and (iv) , consistent with Section 3(b), in the case of an Adaptation, a credit identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g., "French translation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). The credit required by this Section 4 (b) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Adaptation or Collection, at a minimum such credit will appear, if a credit for all contributing authors of the Adaptation or Collection appears, then as part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing authors. For the avoidance of doubt, You may only use the credit required by this Section for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising Your rights under this License, You may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of You or Your use of the Work, without the separate, express prior written permission of the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties.
Therefore it is possible to designate the name of the author the journal title and the publisher as "attribution parties".
I am unaware of any OA CC-BY journal with such a designation. For me it is ethical to mirror a CC-BY article with the standard bibliographic citation like Biber, P.D. 2006. Measuring the effects of salinity stress in the red mangrove, Rhizophora mangle L., African Journal of Agricultural Research 1(1): 1-4 adding the source URL (or DOI - please keep in mind that both publishers doesn't offer DOIs!). If I have some critical comments on Biber's work I can reproduce the whole article for reader's comfort. This is the sense of CC-BY.
As there is no such designation on the Academic journals website there is no license violation by Greener Journals in this regard.
But there are two other violations of the license terms:
1. There is no mentioning of the CC-license in the PDF nor on the abstract page by Greener Journals.
The CC-BY legal code reads: You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform.
2. The original copyright notices are not kept ("keep intact all copyright notices for the Work", quoted above). For German law see also § 95c UrhG (German Copyright Act).
I cannot image that Professor Biber has made an individual contract with the Lagos company or persons behind Greener Journals allowing them to re-use its 2006 article. Thus one has to conclude that the fraudulent re-use by Greener Journals clearly violates the CC-BY license terms. Violating the CC terms is violation of copyright. It is illegal and this clearly confirms Beall's judgement on this bogus OA publisher.
------------
CC-BY (URL quoted above). You are free to distribute this blog entry (without the picture below), to build upon or adapt it (especially by meliorating its English) if you distribute it with the following Copyright notice: "(c) Klaus Graf: Greener Journals. In: Archivalia, 2012, Februar 19, http://archiv.twoday.net/stories/64979561/" And don't forget to mention the license URI!
 Source: Greener Journals website
Source: Greener Journals websiteKlausGraf - am Sonntag, 19. Februar 2012, 14:04 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Interview mit dem Forscher, der die Untersuchung vornahm:
http://www.heise.de/tp/artikel/36/36307/1.html
Die Handschrift war hier schon mehrmals Thema:
http://archiv.twoday.net/search?q=voynich
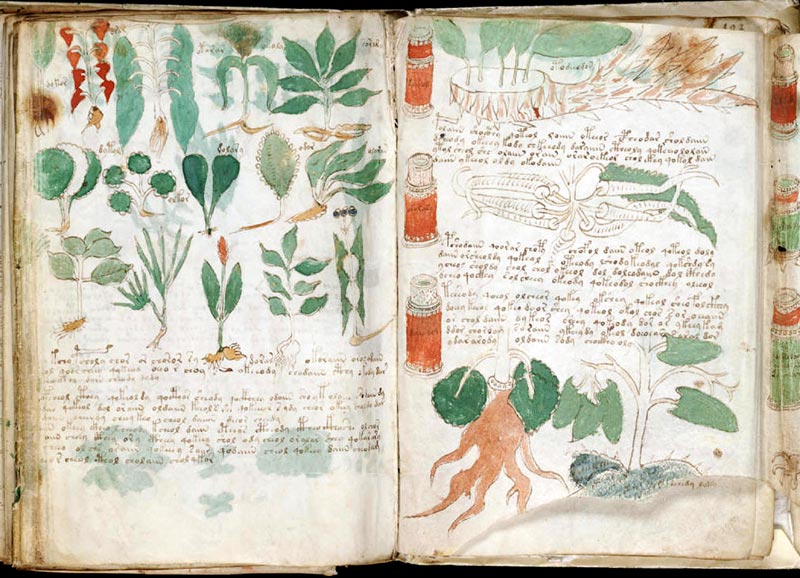
http://www.heise.de/tp/artikel/36/36307/1.html
Die Handschrift war hier schon mehrmals Thema:
http://archiv.twoday.net/search?q=voynich
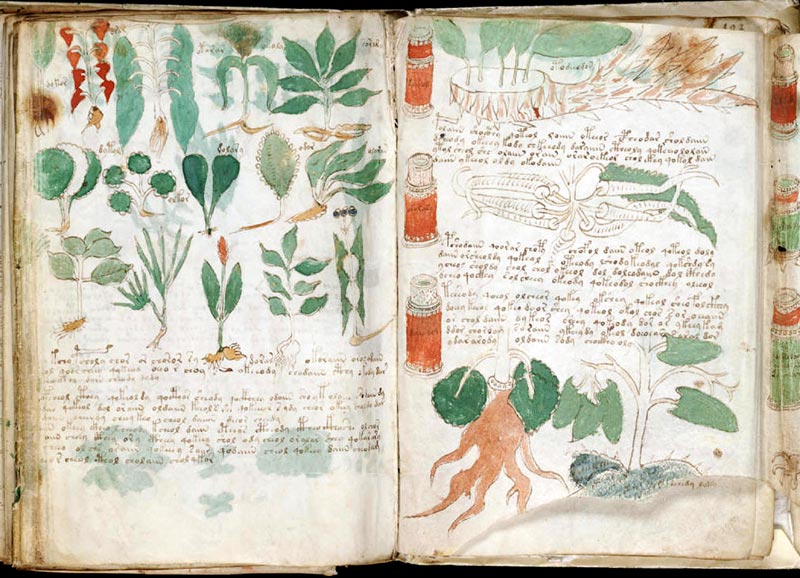
KlausGraf - am Sonntag, 19. Februar 2012, 13:37 - Rubrik: Kodikologie
Ein ausgezeichneter Beitrag von Peter Hirtle zu einem US-Rechtsstreit:
http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2012/02/update-on-a-legal-action-against-a-cultural-institution.html
What lessons can a cultural heritage repository take away from this case? First and foremost, it emphasizes the need to respect and follow the terms in a deed of gift. Sometimes deeds require practices and procedures that are outside of the ordinary, but that just means that our workflows have to be such that anomalous items are consistently identified.
Second, we should make sure that the terms in the deed are as clear as possible. Pearse-Hocker’s Deed of Gift (Exhibit B of the original complaint) states “I hereby also assign and transfer all copyright that I possess to the National Museum of the American Indian, subject only to the conditions which may be specified below.” What conditions were specified below? “I do not, by this gift, transfer copyright in the photographs to the Smithsonian Institution”! Why have a deed with two conflicting sections in it?
In addition, the deed granted to the museum “an irrevocable, non-exclusive, royalty-free, license to use, reproduce, display, and publish, in all media, including electronic media and on-line, the photographs for all standard, educational, museum, and archival purposes.” Many would argue that providing copies for non-profit documentaries on PBS is part of the standard educational mission of the museum. Yet this interpretation could be in conflict with the next sentence of the deed, which states that “requests by people or entities outside the Smithsonian to reproduce or publish the photographs shall be directed to the donor.” If the Smithsonian felt that only for-profit uses should be referred to the donor, it should have made this clear in the deed.
Third, this case reminds us that running a repository involves taking risks. We run the risk that users might steal collection material or that dirty documents caked in lead dust or mold might injure staff or patrons. We particularly run risks when we duplicate materials for patrons. It is an essential part of our service, but one that needs to be managed by knowledgeable practice and procedures. One wonders, for example, if the museum may have weakened its own defenses by charging a permission fee that is separate from the cost of making the reproduction. Such fees are designed to generate money for the museum, pure and simple. They are unconnected to “standard, educational, museum, and archival purposes,” and hence could not be supported by even the most generous reading of the license grant in the contract. Could the desire to secure $150 in permission fees have cost the museum almost $50,000 in damages?
Lastly, I would reiterate the point I made in my original post. Since the case against Firelight Media did not get very far, we do not know what its fair use defense might have looked like. I continue to suspect, however, that Firelight, like most of our users, did not really understand the difference between the permission given by the repository and the permission it needed from the copyright owner. And it may not have understood that both were needed for its use of the photographs. The museum's invoice stated that “[p]ermission is granted for the use of the following imagery, worldwide, all media rights for the life of the project.” By providing only one of the permissions that users need, we may in the end be misleading them.
As with most lawsuits, I suspect that this was a bad experience for everyone except the lawyers. Pearse-Hocker will be lucky if her $40,000 cash payment covers her legal fees in the case. The museum is out that same amount of money, as well as its time and expense in defending itself. Most of all, therefore, this case reminds us about the importance of working with donors so that a disagreement never reaches this stage.
http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2012/02/update-on-a-legal-action-against-a-cultural-institution.html
What lessons can a cultural heritage repository take away from this case? First and foremost, it emphasizes the need to respect and follow the terms in a deed of gift. Sometimes deeds require practices and procedures that are outside of the ordinary, but that just means that our workflows have to be such that anomalous items are consistently identified.
Second, we should make sure that the terms in the deed are as clear as possible. Pearse-Hocker’s Deed of Gift (Exhibit B of the original complaint) states “I hereby also assign and transfer all copyright that I possess to the National Museum of the American Indian, subject only to the conditions which may be specified below.” What conditions were specified below? “I do not, by this gift, transfer copyright in the photographs to the Smithsonian Institution”! Why have a deed with two conflicting sections in it?
In addition, the deed granted to the museum “an irrevocable, non-exclusive, royalty-free, license to use, reproduce, display, and publish, in all media, including electronic media and on-line, the photographs for all standard, educational, museum, and archival purposes.” Many would argue that providing copies for non-profit documentaries on PBS is part of the standard educational mission of the museum. Yet this interpretation could be in conflict with the next sentence of the deed, which states that “requests by people or entities outside the Smithsonian to reproduce or publish the photographs shall be directed to the donor.” If the Smithsonian felt that only for-profit uses should be referred to the donor, it should have made this clear in the deed.
Third, this case reminds us that running a repository involves taking risks. We run the risk that users might steal collection material or that dirty documents caked in lead dust or mold might injure staff or patrons. We particularly run risks when we duplicate materials for patrons. It is an essential part of our service, but one that needs to be managed by knowledgeable practice and procedures. One wonders, for example, if the museum may have weakened its own defenses by charging a permission fee that is separate from the cost of making the reproduction. Such fees are designed to generate money for the museum, pure and simple. They are unconnected to “standard, educational, museum, and archival purposes,” and hence could not be supported by even the most generous reading of the license grant in the contract. Could the desire to secure $150 in permission fees have cost the museum almost $50,000 in damages?
Lastly, I would reiterate the point I made in my original post. Since the case against Firelight Media did not get very far, we do not know what its fair use defense might have looked like. I continue to suspect, however, that Firelight, like most of our users, did not really understand the difference between the permission given by the repository and the permission it needed from the copyright owner. And it may not have understood that both were needed for its use of the photographs. The museum's invoice stated that “[p]ermission is granted for the use of the following imagery, worldwide, all media rights for the life of the project.” By providing only one of the permissions that users need, we may in the end be misleading them.
As with most lawsuits, I suspect that this was a bad experience for everyone except the lawyers. Pearse-Hocker will be lucky if her $40,000 cash payment covers her legal fees in the case. The museum is out that same amount of money, as well as its time and expense in defending itself. Most of all, therefore, this case reminds us about the importance of working with donors so that a disagreement never reaches this stage.
KlausGraf - am Sonntag, 19. Februar 2012, 13:25 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Les Archives départementales des Alpes-Maritimes contribuent sur Wikisource depuis janvier 2012 en important et corrigeant un ensemble de visites paroissiales du XVIIIe siècle. Les Archives font intervenir des étudiants en paléographie sur ce projet, coordonnés par Mme Cavalié, directrice adjointe des Archives.
La mise en ligne et correction de ces visites est faite dans le but d'une édition de l'ensemble du corpus.
Wikimédia France coordonne l'aide à ce projet."
Link zur Wikisource-Seite
La mise en ligne et correction de ces visites est faite dans le but d'une édition de l'ensemble du corpus.
Wikimédia France coordonne l'aide à ce projet."
Link zur Wikisource-Seite
Wolf Thomas - am Sonntag, 19. Februar 2012, 11:03 - Rubrik: Wikis
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zur kleinen Anfrage an die Landesregierung in Hannover
http://archiv.twoday.net/stories/64975792/
werden hier
http://www.vierprinzen.com/2012/02/sachdienliche-hinweise-zur-kleinen.html
einige interessante Dokumente eingestellt.
http://www.vierprinzen.com
http://archiv.twoday.net/stories/64975792/
werden hier
http://www.vierprinzen.com/2012/02/sachdienliche-hinweise-zur-kleinen.html
einige interessante Dokumente eingestellt.
http://www.vierprinzen.com
vierprinzen - am Sonntag, 19. Februar 2012, 08:45 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Dies behaupten die Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters:
http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_01047.html
[29.3.2012: Der Eintrag wurde - ohne Hinweis auf Archivalia - korrigiert, ist aber nicht zitierbar, da sich die URL mit jedem Datenbankupdate ändert!!]
Werk
Neuzeitliche Fälschung, angeblich eine Chronik aus Dortmund bis zum Jahr 1391.
Handschriften - Mss.
v. Edd., pp. 495-497
Ausgaben - Edd.
J. Hansen , Chronik der Pseudorektoren der Benediktskapelle zu Dortmund, Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 11, 1886, 513-550 mit einem Urkundenanhang
Literatur - Comm.
v. Edd., pp. 493-512
Lorenz, II (1887) 79
R. Sprandel , Fälschungen in der öffentlichen Meinung, in Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreß der MGH, 16.-19. Sept. 1986, MGH Schriften , 33/1, 1988, 257
H. J. Mierau , Continuationes: Die Fortsetzungen zu Papst-Kaiser-Chroniken des späten Mittelalters, Die Geschichtsschreibung in Mitteleuropa. Projekte und Forschungsprobleme, cur. J. Wenta, in Subsidia historiographica, 1, Torún 1999, 174
Da man seit Hansen annimmt, dass die Fälschung der Kapellenchronik durch Heinrich von Broke am Ende des 14. Jahrhunderts erfolgte, muss man die beiden jüngsten Titel (Sprandel und Mierau) sichten. Sprandel ist ein für eine Quellenkunde ganz unerheblicher Titel, der es bei einer bloßen Erwähnung des Textes belässt. Was Frau Mierau schreibt, habe ich nicht zur Hand, aber der Schnipsel aus ihrem Aufsatz ist eindeutig: "Heinrich von Broke, der mit großer Wahrscheinlichkeit am Ende des 14. Jahrhunderts in Dortmund die Chronik der Pseudorektoren fälschte,"
http://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22*+Jahrhunderts+in+Dortmund+die+Chronik+der+Pseudorektoren+f%C3%A4lschte%22
Nun habe ich für meine Studien zum Dortmunder Stadtpatron Reinold eine Menge Dortmunder Literatur gesichtet, erinnere mich aber nicht, jemals von einer neuzeitlichen Fälschung gelesen zu haben. Peter Johanek hat dem Text 2006 in "Ferne Welten" mehrere Abschnitte gewidmet, die zu zitieren gewesen wären (S. 45f.). Ebenso Henn im Sammelband Spätmittelalterliche städtische Geschichtsschreibung 2001, S. 50: "Fälschung des ausgehenden 14. Jahrhunderts". In der Stadtgeschichte/Festschrift 1982: Fälschung um 1380:
http://books.google.de/books?id=DhNWAAAAYAAJ&q=%22heinrich+von+broke%22
Unerlässlich ist die Zusammenfassung der Ergebnisse des Editors Hansen in seiner späteren Ausgabe der Dortmunder Chroniken:
http://www.archive.org/stream/diechronikender00unkngoog#page/n19/mode/2up
Wie eine neuzeitliche Fälschung von den Chroniken Nederhoffs und Westhoffs benutzt worden sein soll, sagen die Geschichtsquellen nicht (Edition Hansen S. 510f.). Was ist mit den von Hansen aufgezeigten Übereinstimmungen der Chronik mit dem Notariatsinstrument von 1381 (S. 502)? Dass die drei vollständigen Handschriften A, B, C, nach denen Hansen edierte, erst der Zeit um 1600 entstammen, ist ja nicht untypisch für die Überlieferung der Dortmunder Historiographie. Hansens Darlegungen sind insgesamt schlüssig, während die Geschichtsquellen den Benutzer verantwortungslos in die Irre führen. Schlimmstenfalls verbreitet er die Falschaussage weiter, aber auch die mögliche Zeitverschwendung durch Prüfung des Unsinns ist nicht zu unterschätzen.
[29.3.2012: Der Eintrag wurde - ohne Hinweis auf Archivalia - korrigiert, ist aber nicht zitierbar, da sich die URL mit jedem Datenbankupdate ändert!!]
Werk
Neuzeitliche Fälschung, angeblich eine Chronik aus Dortmund bis zum Jahr 1391.
Handschriften - Mss.
v. Edd., pp. 495-497
Ausgaben - Edd.
J. Hansen , Chronik der Pseudorektoren der Benediktskapelle zu Dortmund, Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 11, 1886, 513-550 mit einem Urkundenanhang
Literatur - Comm.
v. Edd., pp. 493-512
Lorenz, II (1887) 79
R. Sprandel , Fälschungen in der öffentlichen Meinung, in Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreß der MGH, 16.-19. Sept. 1986, MGH Schriften , 33/1, 1988, 257
H. J. Mierau , Continuationes: Die Fortsetzungen zu Papst-Kaiser-Chroniken des späten Mittelalters, Die Geschichtsschreibung in Mitteleuropa. Projekte und Forschungsprobleme, cur. J. Wenta, in Subsidia historiographica, 1, Torún 1999, 174
Da man seit Hansen annimmt, dass die Fälschung der Kapellenchronik durch Heinrich von Broke am Ende des 14. Jahrhunderts erfolgte, muss man die beiden jüngsten Titel (Sprandel und Mierau) sichten. Sprandel ist ein für eine Quellenkunde ganz unerheblicher Titel, der es bei einer bloßen Erwähnung des Textes belässt. Was Frau Mierau schreibt, habe ich nicht zur Hand, aber der Schnipsel aus ihrem Aufsatz ist eindeutig: "Heinrich von Broke, der mit großer Wahrscheinlichkeit am Ende des 14. Jahrhunderts in Dortmund die Chronik der Pseudorektoren fälschte,"
http://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22*+Jahrhunderts+in+Dortmund+die+Chronik+der+Pseudorektoren+f%C3%A4lschte%22
Nun habe ich für meine Studien zum Dortmunder Stadtpatron Reinold eine Menge Dortmunder Literatur gesichtet, erinnere mich aber nicht, jemals von einer neuzeitlichen Fälschung gelesen zu haben. Peter Johanek hat dem Text 2006 in "Ferne Welten" mehrere Abschnitte gewidmet, die zu zitieren gewesen wären (S. 45f.). Ebenso Henn im Sammelband Spätmittelalterliche städtische Geschichtsschreibung 2001, S. 50: "Fälschung des ausgehenden 14. Jahrhunderts". In der Stadtgeschichte/Festschrift 1982: Fälschung um 1380:
http://books.google.de/books?id=DhNWAAAAYAAJ&q=%22heinrich+von+broke%22
Unerlässlich ist die Zusammenfassung der Ergebnisse des Editors Hansen in seiner späteren Ausgabe der Dortmunder Chroniken:
http://www.archive.org/stream/diechronikender00unkngoog#page/n19/mode/2up
Wie eine neuzeitliche Fälschung von den Chroniken Nederhoffs und Westhoffs benutzt worden sein soll, sagen die Geschichtsquellen nicht (Edition Hansen S. 510f.). Was ist mit den von Hansen aufgezeigten Übereinstimmungen der Chronik mit dem Notariatsinstrument von 1381 (S. 502)? Dass die drei vollständigen Handschriften A, B, C, nach denen Hansen edierte, erst der Zeit um 1600 entstammen, ist ja nicht untypisch für die Überlieferung der Dortmunder Historiographie. Hansens Darlegungen sind insgesamt schlüssig, während die Geschichtsquellen den Benutzer verantwortungslos in die Irre führen. Schlimmstenfalls verbreitet er die Falschaussage weiter, aber auch die mögliche Zeitverschwendung durch Prüfung des Unsinns ist nicht zu unterschätzen.
KlausGraf - am Sonntag, 19. Februar 2012, 01:22 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Digitalisate und Hinweise:
http://de.wikisource.org/wiki/August_Potthast
Siehe auch
http://web.archive.org/web/200012120820/http://allserv.rug.ac.be/~jdploige/sources/6.html
http://de.wikisource.org/wiki/August_Potthast
Siehe auch
http://web.archive.org/web/200012120820/http://allserv.rug.ac.be/~jdploige/sources/6.html
KlausGraf - am Sonntag, 19. Februar 2012, 00:06 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

 Ablasskrämer
Ablasskrämer