Das Schweizerische Institut für Informationswissenschaft an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur (CH) führte mit Förderung der Stiftung Datenbank Schweizerischer Kulturgüter (DSK) im Sommer 2006 eine umfassende Bestandsaufnahme zum Stand der Digitalisierung in den rund 1000 Museen der Schweiz durch. Die Ergebnisse werden in folgender Studie umfassend dargestellt:
Ch. Bieber, J. Herget:
Stand der Digitalisierung in den Museen der Schweiz - Internationale Referenzprojekte und Handlungsempfehlungen
Die Arbeit steht, wie alle weiteren Veröffentlichungen unserer elektronischen Publikationsreihe, langfristig zum Download bereit unter:
http://www.informationswissenschaft.ch/fileadmin/uploads/pdf/csi/Churer_Schriften_14_Teil_Komplett.pdf
Aus INETBIB
Ch. Bieber, J. Herget:
Stand der Digitalisierung in den Museen der Schweiz - Internationale Referenzprojekte und Handlungsempfehlungen
Die Arbeit steht, wie alle weiteren Veröffentlichungen unserer elektronischen Publikationsreihe, langfristig zum Download bereit unter:
http://www.informationswissenschaft.ch/fileadmin/uploads/pdf/csi/Churer_Schriften_14_Teil_Komplett.pdf
Aus INETBIB
KlausGraf - am Dienstag, 27. Februar 2007, 23:37 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Ruhe der Riesenschildkröte
Von Andreas Kilb
Es ist so einfach: Man nimmt ein Buch oder ein Bild, legt es auf den Scanner, liest es ein und stellt es ins Internet. Und es ist doch so schwierig. Denn das Bild, der Text, das Buch unterliegen dem Urheberrecht, seine Veröffentlichung im Netz ist also honorarpflichtig oder ganz untersagt. Und dann gibt es noch die Zeit- und die Kostenfrage: Ein Buch zu scannen dauert ein paar Stunden. Was aber ist mit zehntausend, hunderttausend Büchern, einer ganzen Bibliothek? Und wer stellt fest, ob ein Buch oder Bild vielleicht schon anderswo digitalisiert wurde, so dass man sich Geld und Mühe sparen kann? Wer bezahlt das Digitalisat, wer verlinkt und vernetzt es, wer bietet es an?
Beginnen wir mit einer Zahl. Ungefähr fünf Milliarden Euro, schätzt Angelika Menne-Haritz, die Vizepräsidentin des Koblenzer Bundesarchivs, würde die Digitalisierung ihrer gesamten Archivbestände kosten. Wer diese Zahl, die am Ende einer Berliner Fachkonferenz über „Europas kulturelles und wissenschaftliches Erbe in einer digitalen Welt“ fiel, auf kontinentale Verhältnisse hochrechnet, bekommt eine Ahnung von den Einführungskosten des elektronischen Zeitalters. In Europa gibt es mehr als 30.000 Museen, Bibliotheken und staatliche Archive und zwanzig verschiedene Sprachen. Die Digitalisierung des europäischen Kulturerbes als Sisyphosaufgabe zu bezeichnen wäre untertrieben. Dennoch führt kein Weg an ihr vorbei.
Braucht man die Erlaubnis überhaupt?
[...] Nein, sagt der Stanforder Jurist Lawrence Lessig, dessen Vortrag der emotionale Höhepunkt dieses zimmerwarmen Expertentreffens war, jedenfalls nicht in dem Ausmaß, in dem die Copyright-Besitzer heute ins Internet hineinregieren. Lessig, der das „Creative Commons“-Projekt zur weltweiten Verbreitung eines eingeschränkten Urheberrechts begründet hat, erblickt in der Zitier- und Kopierwut der Netzteilnehmer die ersten Triebe einer „rewrite culture“, einer Kultur des Überschreibens und Remixens, die das einundzwanzigste Jahrhundert dominieren werde. Wo heute Anwälte für die Musik- und Bildrechte ihrer Klienten streiten und Websites schließen lassen, sieht Lessig die zukünftige digitale Sonne aufgehen. „Wir können die Kreativität unserer Kinder nicht abtöten, wir können sie nur kriminalisieren“, beschwor er die Versammlung, und die von Youtube heruntergeladenen Clips mit Anime-Verschnitten und neu vertonten George-Bush-Fernsehbildern, mit denen er seinen Vortrag unterlegte, lieferten dazu das klingende und leuchtende Anschauungsmaterial.
Es wäre so leicht, wenn es nicht so schwierig wäre
In deutschen Landen klingt das alles anders. Man befinde sich in „ausgesprochen schwierigen“ Verhandlungen mit der Verwertungsgesellschaft Bild, erklärte etwa Frauke Rehder, die das schleswig-holsteinische Museumsnetzwerk DigiCult vorstellte, in dem zur Zeit eine Datenbank mit Bildern und Informationen aus den angeschlossenen Sammlungen aufgebaut wird. [...]
Dass es gelingen kann, bis zum Jahr 2010 eine europäische digitale Bibliothek mit sechs Millionen verfügbaren Bild- und Textobjekten einzurichten, wie es die Europäische Kommission will, mag man jedenfalls nach dieser Konferenz nicht so recht glauben. Aber vielleicht gilt für die europäischen Kulturdinge ja das Motto, mit dem ein Entwickler von Archivierungssoftware sein Projekt in Berlin anpries: „Lentius, profundius, durabilius“ - langsamer, gründlicher, haltbarer. Es wäre so leicht, den Reichtum der Kultur zu digitalisieren, wenn es eben nicht so schwierig wäre.
Text: FAZ 26.02.2007, Nr. 48 / Seite 35
Von Andreas Kilb
Es ist so einfach: Man nimmt ein Buch oder ein Bild, legt es auf den Scanner, liest es ein und stellt es ins Internet. Und es ist doch so schwierig. Denn das Bild, der Text, das Buch unterliegen dem Urheberrecht, seine Veröffentlichung im Netz ist also honorarpflichtig oder ganz untersagt. Und dann gibt es noch die Zeit- und die Kostenfrage: Ein Buch zu scannen dauert ein paar Stunden. Was aber ist mit zehntausend, hunderttausend Büchern, einer ganzen Bibliothek? Und wer stellt fest, ob ein Buch oder Bild vielleicht schon anderswo digitalisiert wurde, so dass man sich Geld und Mühe sparen kann? Wer bezahlt das Digitalisat, wer verlinkt und vernetzt es, wer bietet es an?
Beginnen wir mit einer Zahl. Ungefähr fünf Milliarden Euro, schätzt Angelika Menne-Haritz, die Vizepräsidentin des Koblenzer Bundesarchivs, würde die Digitalisierung ihrer gesamten Archivbestände kosten. Wer diese Zahl, die am Ende einer Berliner Fachkonferenz über „Europas kulturelles und wissenschaftliches Erbe in einer digitalen Welt“ fiel, auf kontinentale Verhältnisse hochrechnet, bekommt eine Ahnung von den Einführungskosten des elektronischen Zeitalters. In Europa gibt es mehr als 30.000 Museen, Bibliotheken und staatliche Archive und zwanzig verschiedene Sprachen. Die Digitalisierung des europäischen Kulturerbes als Sisyphosaufgabe zu bezeichnen wäre untertrieben. Dennoch führt kein Weg an ihr vorbei.
Braucht man die Erlaubnis überhaupt?
[...] Nein, sagt der Stanforder Jurist Lawrence Lessig, dessen Vortrag der emotionale Höhepunkt dieses zimmerwarmen Expertentreffens war, jedenfalls nicht in dem Ausmaß, in dem die Copyright-Besitzer heute ins Internet hineinregieren. Lessig, der das „Creative Commons“-Projekt zur weltweiten Verbreitung eines eingeschränkten Urheberrechts begründet hat, erblickt in der Zitier- und Kopierwut der Netzteilnehmer die ersten Triebe einer „rewrite culture“, einer Kultur des Überschreibens und Remixens, die das einundzwanzigste Jahrhundert dominieren werde. Wo heute Anwälte für die Musik- und Bildrechte ihrer Klienten streiten und Websites schließen lassen, sieht Lessig die zukünftige digitale Sonne aufgehen. „Wir können die Kreativität unserer Kinder nicht abtöten, wir können sie nur kriminalisieren“, beschwor er die Versammlung, und die von Youtube heruntergeladenen Clips mit Anime-Verschnitten und neu vertonten George-Bush-Fernsehbildern, mit denen er seinen Vortrag unterlegte, lieferten dazu das klingende und leuchtende Anschauungsmaterial.
Es wäre so leicht, wenn es nicht so schwierig wäre
In deutschen Landen klingt das alles anders. Man befinde sich in „ausgesprochen schwierigen“ Verhandlungen mit der Verwertungsgesellschaft Bild, erklärte etwa Frauke Rehder, die das schleswig-holsteinische Museumsnetzwerk DigiCult vorstellte, in dem zur Zeit eine Datenbank mit Bildern und Informationen aus den angeschlossenen Sammlungen aufgebaut wird. [...]
Dass es gelingen kann, bis zum Jahr 2010 eine europäische digitale Bibliothek mit sechs Millionen verfügbaren Bild- und Textobjekten einzurichten, wie es die Europäische Kommission will, mag man jedenfalls nach dieser Konferenz nicht so recht glauben. Aber vielleicht gilt für die europäischen Kulturdinge ja das Motto, mit dem ein Entwickler von Archivierungssoftware sein Projekt in Berlin anpries: „Lentius, profundius, durabilius“ - langsamer, gründlicher, haltbarer. Es wäre so leicht, den Reichtum der Kultur zu digitalisieren, wenn es eben nicht so schwierig wäre.
Text: FAZ 26.02.2007, Nr. 48 / Seite 35
KlausGraf - am Dienstag, 27. Februar 2007, 23:30 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
DIE ZEIT interviewte unter diesem Titel den Marbacher Literaturarchiv-Leiter Ulrich Raulff zur neu gegründeten "Zeitschrift für Ideengeschichte" (leider nicht Open Access!):
http://www.zeit.de/2007/09/KA-Ideengeschichte?page=all
Unsere Zeitschrift ist hoffentlich dadurch unverwechselbar, dass wir für die Leser jenen reichen Rohstoff aus den Archiven heben, der noch nicht von zahllosen Deutungen verschüttet wurde, sondern neue Deutungsenergie freisetzen kann. Wer heute Neues denken und sich nicht im undurchdringlichen Deutungsuniversum verlieren will, kann in den Kammern, in denen das Älteste liegt, fündig werden: in den Archiven.
http://www.zeit.de/2007/09/KA-Ideengeschichte?page=all
Unsere Zeitschrift ist hoffentlich dadurch unverwechselbar, dass wir für die Leser jenen reichen Rohstoff aus den Archiven heben, der noch nicht von zahllosen Deutungen verschüttet wurde, sondern neue Deutungsenergie freisetzen kann. Wer heute Neues denken und sich nicht im undurchdringlichen Deutungsuniversum verlieren will, kann in den Kammern, in denen das Älteste liegt, fündig werden: in den Archiven.
KlausGraf - am Dienstag, 27. Februar 2007, 23:09 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der in Eichstätt für die Kirchliche Stiftung des Öffentlichen Rechts "Katholische Universität Eichstätt" am 25. Juni 1999 und in München für die Provinz der Bayerischen Kapuziner am 23. Juni 1999 unterzeichnete Überlassungvertrag liegt mir im Wortlaut vor.
§ 1 Vertragsobjekt
(1) Die Kapuzinerprovinz überträgt der Universität die Bestände ihrer in Altötting untergebrachten Zentralbibliothek mit einem Umfang von ca. 300.000 Bänden. Hierbei sind die im Eigentum des Freistaates Bayern stehenden Bände mit eingeschlossen (ca. 10 v.H. des Gesamtbestandes).
(2) Die Übertragung erfolgt unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.
§ 5 Eigentumsübertragung an den Beständen
(1) Erst im Zuge der bibliothekarischen Aufarbeitung der Bestände kann das Eigentum an den Büchern im Einzelfall bestimmt werden. Als staatliches Eigentum haben hierbei in der Regel alle bis zum Jahr 1802 erschienenen Bände zu gelten, die nach 1802 im Besitz eines sog. Zentralklosters verblieben sind. Diese Bestände verbleiben im Eigentum des Freistaats Bayern und werden auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern, der Stiftung Katholische Universität Eichstätt und dem Bischöflichen Seminar St. Willibald vom Oktober 1981 als Dauerleihgabe in die Universitätsbibliothek eingegliedert und entsprechend kenntlich gemacht.
(2) Die vertragsschließenden Parteien sind sich darüber einig, dass die nicht im Eigentum des Freistaates Bayern stehenden Teile des Gesamtbestandes der Stiftung übereignet werden.
Aus den §§ 1 Abs. 2, 5 Abs. 2 ergibt sich, dass es sich um eine Schenkung zugunsten der Stiftung handelt. Dies gilt auch für die übergebene Fahrregalanlage (§ 3).
§ 2 Durchführung der Übertragung
Mit Abschluss der Vereinbarung erwirbt die Stiftung den mittelbaren Besitz an den Beständen der Zentralbibliothek der Kapuziner.
(2) Vor Überprüfung der Bestände nach Eichstätt wird die Universitätsbibliothek Eichstätt prüfen, welche Teil des Bestandes vorab ausgeschieden und ggf. veräußert werden können. Der Erlös aus dem Verkauf fließt der Kapuzinerprovinz zu, die ihn für die Durchführung der Übernahme zur Verfügung stellen wird; dies gilt nicht für den Verkauf von Bänden, die im Eigentum des Freistaates Bayern stehen (vgl. § 5).
[...] (4) Mit dem Ausladen der Bestände in Eichstätt erwirbt die Stiftung den unmittelbaren Besitz hieran.
Wie in der Causa Karlsruhe lässt auch hier der sachenrechtliche Bestimmtheitsgrundsatz, über den wir http://archiv.twoday.net/stories/3076941/ handelten, grüßen. Denn die Zentralbibliothek war ja ein Mischbestand von Ordenseigentum und Staatseigentum, wobei erst bei der bibliothekarischen Bearbeitung (also der Katalogisierung) "im Einzelfall" eine Zuweisung erfolgen sollte. Das ist sinnvoll und sachgerecht, auch wenn offen bleibt, aufgrund welcher Kriterien die Eichstätter Bibliothekare (ohne oder mit Abstimmung mit dem Bayerischen Staat) die Eigentumsbestimmung vornehmen wollten. Eine Kenntlichmachung im OPAC der Bestände vor 1802 als Staatseigentum ist nicht erfolgt. Wenn man diese Vertragsregelung als vernünftig ansieht, wird man auch im Fall Karlsruhe die Anforderungen an den Bestimmtheitsgrundsatz nicht überspannen dürfen. Die Vereinbarung betrifft den Kern des Rechtsgeschäfts, die Übereignung als Schenkung. Wäre der Bestimmtheitsgrundsatz verletzt, wäre der ganze Vertrag hinfällig. Da kein anderer Termin genannt ist, dürften die Bücher jeweils (erst) mit der Katalogisierung/Bearbeitung Eigentum der Stiftung geworden sein. Unbearbeitete Teile sind Eigentum des Kapuzinerordens geblieben.
Was Bearbeitung bedeutet definiert § 4 "Bibliothekarische Aufbereitung der Bestände" (formale und sachliche Erschließung im Bayerischen Verbund mit Möglichkeit der Internetrecherche, Ausleihe gemäß Leihverkehrsrichtlinien im Einzelfall auch an Privatpersonen - in den Schlußbestimmungen § 8 findet sich eine Sonderregelung für die Benutzung durch die Mitglieder der Kapuzinerprovinz -; fachgemäße Restaurierung ggf. in Zusammenarbeit mit dem Institut für Buchrestaurierung (IBR) der Bay. Staatsbibliothek). Abs. 2 ist eine Absichtserklärung, dass die bibliothekarische Aufarbeitung innerhalb von "ca. 10 Jahren" bewerkstelligt werden soll. Die Stiftung verpflichtet sich: Sie wird die Bestände bis zu ihrer Aufarbeitung sicher aufbewahren.
Während die Bearbeitung ein abschlossener Vorgang ist, ist die in § 4 angesprochene Benutzbarkeit als Auflage zu qualifizieren (siehe § 525 BGB, http://archiv.twoday.net/stories/2835396/), da dadurch ein Dauerschuldverhältnis begründet wird. Es wird davon ausgegangen, dass die Bibliothek dauerhaft nutzbar sein soll. Die gleichen Bedingungen wurden durch die "Erweiterungsoption" in § 7 auch für künftig aufgelöste Klosterbibliotheken verbindlich gemacht, die, um eine Zersplitterung der Bestände zu vermeiden, vorrangig der Stiftung angeboten werden sollen.
Aussonderungen sollten VOR der Überführung nach Eichstätt erfolgen, Verkäufe wurden ausdrücklich vorgesehen (§ 2 Abs. 2). Es versteht sich wohl von selbst, dass ohne Zustimmung des Freistaats Bayern weder Bestände verkauft werden können noch der dadurch erzielte Erlös zweckgebunden der Kapuzinerprovinz zufließen kann. Über die Finanzierung handelt § 7 (Sondermittel vom Überdiözesanen Fonds Bayern für 1999, Fortsetzungsantrag war vorgesehen, das dürfte das Drittmittelprojekt der KU Eichstätt-Ingolstadt sein; Finanzierung eines Diplombibliothekars BAT IVb für 5 Jahre durch die Provinz.)
Änderungen des Vertrags durch mündliche Nebenabreden waren nicht ausgeschlossen. Wenn sich Stiftung und Provinz darüber einig waren, dass die Aussonderung (einschließlich Verkauf) erst in Eichstätt erfolgen sollte (anders als § 2 vorsieht) und nach dem Ausscheiden von Holzbauer zusätzlich vereinbart wurde, dass Aussonderungen durch Vernichtungen erfolgen sollten, so stellt das grundsätzlich keinen Vertragsbruch dar.
Die ordensinterne Erklärung des Provinzials Mittermaier vom 19.2.2006 gibt dazu Auskunft: "Da der Vertrag der Provinz der Bayerischen Kapuziner mit der Katholischen Universität Eichstätt von 1999 keine konkreten Richtlinien für die Aussonderung enthielt, gab es am 19.05.2005 ein Gespräch von Provinzial und Ökonom mit der Leiterin der Bibliothek, Frau Dr. Katharina Reich, in dem Folgendes festgehalten wurde:
Alle Bestände vor 1802 werden zunächst übernommen; falls es sich um Dubletten handelt, werden diese verkauft. Der Erlös dient der Einstellung von Arbeitskräften, die sich um die Bearbeitung kümmern.
Die Entscheidung, ob Bände mit Erscheinungsjahr nach 1802 in die UB Eichstätt eingearbeitet werden, liegt bei der Direktion. (So sehen es auch die vom Ministerium erlassenen Aussonderungsrichtlinien von 2003 vor.)
Kleinschrifttum Trivialliteratur, Taschenbücher, lose Zeitschriftenhefte werden ausgesondert.
Sicher genommen werden die Bücher, Kleinschriften und Zeitschriften, die zum Wesensbestand einer Zentralbibliothek der Kapuziner gehören. Es muss bei der Überlassung der Zentralbibliothek gewährleistet sein, dass die Geschichte und die Spiritualität der Bayerischen Kapuziner, das theologische Schaffen und die Leistungen in Predigt und anderen Apostolatsformen in all den Ausprägungen an der Universitätsbibliothek Eichstätt nachgesehen und erforscht werden können."
Die Erklärung (deren Wahrheitsgehalt hier nicht überprüft werden kann, der Pater Provinzial hat auf Nachfragen keine Stellungnahme abgeben wollen) lässt den Schluss zu, dass Dubletten vor 1802, obwohl im Vertrag dem Freistaat Bayern zugewiesen, verkauft und der Erlös entgegen den Vorschriften des Vertrags zur Finanzierung der Arbeitskräfte dienen sollte. Ein Vertrag kann aber keinesfalls Rechtsverhältnisse zu Lasten eines Dritten regeln.
Von ALLGEMEINEN Aussonderungsrichtlinien des Ministeriums 2003 kann keine Rede sein, es gibt nur die Richtlinien von 1998
http://www.bib-bvb.de/AuB/richtlin.html
Gegen die Punkte 2.1 (in der Regel keine Aussonderung von Drucken vor 1830/50) und 2.4 (Makulierung an letzter Stelle) wurde massiv verstoßen.
Bisherige Kontakte zum Bayerischen Wissenschaftsministerium, das die Angelegenheit natürlich aufmerksam beobachtet, lassen unter Vorbehalt die Aussage zu, dass dort von speziellen Aussonderungsrichtlinien 2003 oder Vereinbarungen in Sachen Eichstätt nichts bekannt ist.
Mit dem Überlassungsvertrag haben die beiden Vertragsparteien zum Ausdruck gebracht, dass die Zentralbibliothek der Kapuziner ein wertvolles Kulturgut darstellt, das dauerhaft zugänglich sein soll und das durch die UB Eichstätt fachgerecht erschlossen und betreut werden soll.
Eine Konkretisierung der nun einmal nicht in Altötting erfolgten Aussonderung (samt "Dubletten"-Verkauf) auf der Ebene der Bibliothek ist sicher rechtlich weitgehend unbedenklich, wenn bibliotheksfachliche Standards gewahrt werden und sich die Abrede nicht gegen den Geist des Überlassungsvertrags richtet. Entscheidende Änderungen hätte nicht die Bibliotheksdirektorin vornehmen dürfen, sie hätten der Zustimmung des Stiftungsvorstands bedurft (von der eigentumsrechtlichen Problematik des bayerischen Staatseigentums einmal abgesehen).
Wenn man von der in der Presse genannten Zahl von 100.000 vernichteten Bänden ausgeht, so ist eine Vernichtung eines Drittels der im Überlassungsvertrag mit 300.000 Bänden bezifferten Bibliothek keinesfalls vom Vertrag gedeckt. Da eine Prüfung jeden einzelnen Buches auf die Eigentumsverhältnisse (§ 5) vorgesehen war, ist die undokumentierte Vernichtung eines riesigen Bestands schlichtweg nicht mit dem Vertrag zu vereinbaren, auch wenn die Ordensleitung damit einverstanden war. Schon allein aufgrund der Eigentumsproblematik hätte eine genaue Dokumentation der zur Vernichtung vorgesehenen Bände erfolgen müssen, etwa indem man wenigstens kursorisch den Inhalt der einzelnen Kisten beschrieben hätte.
Nach Angaben des früheren Direktors Holzbauer wurden aus Altötting nur Bände übernommen, deren Erhaltung zu rechtfertigen war. Allerdings scheinen die Vorwürfe des Provinzials, dass eine ungeeignete und feuchte Aufbewahrung der Bücherkisten in einer zugigen Turnhalle, nicht aus der Luft gegriffen. Die Stiftung hätte also gegen die Auflage verstoßen, die Bestände "sicher" aufzubewahren, und es ist auch möglich, dass der Schimmel durch die Lagerung entstanden ist.
Zur Zusammensetzung des Vernichtungsguts der Provinzial:
"In der Tat wurden in diesem Zeitraum insgesamt von den eingelagerten Bücher und Materialen 83 t Bücher und Zeitschriften entsorgt. Davon entfielen auf Kapuzinerbestände 68,40 t. Davon waren 20,60 t Zeitschriften-Dubletten. Die Zeitschriften machten bei der Kapuzineraktion ca. 30% des Bestandes aus, analog dann auch bei der Entsorgung. Zeitschriften wie "Katholische Missionen", "Bayerland", "Die schöne Zukunft" waren anscheinend in allen Niederlassungen vorhanden und schlugen vom Gewicht her stark zu Buche. Dem Vorwurf, hier wäre in einem so kurzen Zeitraum so vieles entsorgt worden, kann man auf dem Gebiet der Zeitschriften mit einer dem gesunden Menschenverstand sehr einsichtigen Argumentation entgegentreten: Zeitschriftenkisten waren als solche leicht zuerkennen und der Inhalt schnell zu bestimmen.
Der Anteil an verschimmelten Büchern betrug 4,20 t, der der Monographiendubletten 40,8 t. 2,8 t machten Varia aus. Dabei handelte es sich um Reiseführer, Straßenkarten, alte und schlecht erhaltene Breviere, Taschenbücher in schlechtem Zustand, schöne Literatur in unkritischen Ausgaben, Bücher zu Geschichte und Theologie in schlechtem Zustand."
Natürlich versucht der Provinzial sich reinzuwaschen, indem er die Bedeutung des Schriftguts herunterspielt.
Holzbauer muss aber aus eigener Erfahrung durchaus zuverlässig sagen können, ob tatsächlich ein so großer Anteil der Kapuzinerbibliothek "Schrott" bzw. vernichtungswürdig war. Er bestreitet das ja entschieden.
Es spricht alles dafür, dass keine sorgfältige Aussonderung des Bestands vorgenommen wurde. Dies ist auch die Aussage der anonymen Mail, die ich im Sommer 2006 erhielt und die ich in meinem Beitrag http://archiv.twoday.net/stories/3143469/ zitiert habe.
In der Kanzlei von Frau RA Dr. Männlein
(s. http://archiv.twoday.net/stories/3359620/) wurden fünf Bücher abgegeben, die aus den Containern gerettet wurden (es handelt sich sicher wohl um die gleichen Bücher, die dem Eichstätter Kurier vorlagen). Sie werden am Donnerstag der Staatsanwaltschaft übergeben. Über ihren Inhalt schreibt die Rechtsanwältin:
"Im Gegensatz zur Behauptung, dass es sich nur um Schundliteratur gehandelt hat, und im Gegensatz zur Behauptung, dass es sich nicht um Bücher vor 1800 gehandelt hat, und im Gegensatz zur Behauptung, dass diese Bücher alle in einem schlechten Zustand seien, kann ich Ihnen folgende Bücher benennen.
Das eine stammt aus dem Jahr 1626 und hat den Titel „Kurze katholische Auslegung aller feiertäglichen Evangelien“, schweinsledergebunden, besterhalten.
„Historische Katechese in auserlesenen Beispielen, Erzählungen und Parabeln über die gesamte christkatholische Glaubens-, Sitten- und Tugendmittel-Lehre aus dem Jahre 1853.
„Deutscher Hausgarten“ von 1859.
„Sermones Sancti“ Thomae a Villa nova aus dem Jahre 1661 (lateinische Sprache, schweinslederner Umschlag, besterhalten) und
Theatrum Asceticum, Sive Meditationes Sacre in Theatro congregationis latinae aus dem Jahre 1747.
Es bedarf wohl keiner langen Ausführungen, dass eine Vernichtung solcher Drucke in keiner Hinsicht zu rechtfertigen ist.
Der Provinzial schreibt dazu: "Am 2. Februar [2007] zeigte mir der ehemalige Bibliotheksdirektor, Dr. Herrmann Holzbauer, vier Exemplare historisch und theologisch wertvoller Büchern, die Mitarbeiter der Universitätsbibliothek aus dem Abfall gezogen hätten. Dies wurde von unserer Seite der Universitätsbibliothek gemeldet. Der Provinzial weigerte sich allerdings, in die Presseagitation gegen die Universität einzusteigen. Am Freitag, 16. Februar lag dem Eichstätter Kurier eine eidesstattliche Erklärung eines anonym sich gebenden Mitbürgers der Stadt Eichstätt über diesen Bücherfund vor."
Durch die Vernichtung eines beträchtlichen Teils der Kapuzinerbibliothek, bei dem offenbar auch wertvolle Altbestände betroffen waren, wurde der im Interesse der Allgemeinheit getroffene Überlassungsvertrag, der in Eichstätt eben keine Aussonderung vorsah, eindeutig verletzt. Wenn man nachträglich festgestellt hat, dass fachlich begründete Aussonderungen unvermeidlich sind, hätte man angesichts des Umfangs den Vertrag von Seiten der Vertragspartner (auf der Seite der UB der Stiftungsvorstand!) abändern müssen oder durch Dokumentation sicherstellen müssen, dass nachvollziehbar bleibt, dass weder Interessen der Allgemeinheit noch Vermögensinteressen des bayerischen Staates beeinträchtigt wurden. Da dies nicht erfolgt ist, müssen die Verantwortlichen strafrechtlich Verantwortung tragen. Eine grob fahrlässige undokumentierte Vernichtung eines Buchbestands erfüllt den Tatbestand der Untreue, wobei als Maßstab eine am Zweck des Überlassungsvertrags orientierte Auslegung der Vertragspflichten der Hochschule sehr wohl dienen kann. Die Hochschule konnte weder durch die Bibliotheksleiterin noch durch Kanzler oder Rektor den Kerngehalt des Überlassungsvertrags abändern. Ebensowenig konnte sie über bayerisches Staatseigentum verfügen, für dessen Aussonderung ein Jahr vor dem Überlassungsvertrag ausdrückliche Vorschriften erlassen worden waren, gegen die in Eichstätt verstoßen wurden.
Wie beim Umgang mit anderen Schenkungen (z.B. Schallplattensammlung Sievers) hat die Bibliotheksleiterin offensichtlich völlig ihre Pflichten verkannt. Sie hat selbstherrlich nach Gutdünken entschieden, indem sie Entscheidungen und Wertungen ihres Vorgängers (der hinsichtlich der Dublettenverscherbelungen natürlich ebenso wie Dr. Littger wissenschaftlich große Schuld auf sich geladen hat) revidierte, weil sie die Platzprobleme nicht glaubte anders in den Griff bekommen zu können. Aber wenn man eine Schenkung annimmt, muss man sich auch daran halten, wenn die Verhältnisse sich geändert haben.
Nachtrag: Der Donaukurier vom 24./25.2.2007 enthält zwei Abbildungen einer Predigtsammlung aus Kapuzinerbeständen, die aus dem Altpapier gezogen wurde. Das eine Bild zeigt den gut erhaltenen Einband, auf dem Rücken beschriftet
Lucian
Dom.Quad.
P. I
mit Signaturschild "Cap. Pred. 8° R5", darunter groß der Gruppenbuchst. R
das andere die Titelseite des spanischen Drucks von 1634 mit Kapuziner-Stempel (Altötting). Es handelt sich offenbar um einen weiteren Band, der anscheinend nicht mit einem Band der oben angeführten Liste identisch ist.
 Titelblatt
Titelblatt
§ 1 Vertragsobjekt
(1) Die Kapuzinerprovinz überträgt der Universität die Bestände ihrer in Altötting untergebrachten Zentralbibliothek mit einem Umfang von ca. 300.000 Bänden. Hierbei sind die im Eigentum des Freistaates Bayern stehenden Bände mit eingeschlossen (ca. 10 v.H. des Gesamtbestandes).
(2) Die Übertragung erfolgt unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.
§ 5 Eigentumsübertragung an den Beständen
(1) Erst im Zuge der bibliothekarischen Aufarbeitung der Bestände kann das Eigentum an den Büchern im Einzelfall bestimmt werden. Als staatliches Eigentum haben hierbei in der Regel alle bis zum Jahr 1802 erschienenen Bände zu gelten, die nach 1802 im Besitz eines sog. Zentralklosters verblieben sind. Diese Bestände verbleiben im Eigentum des Freistaats Bayern und werden auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern, der Stiftung Katholische Universität Eichstätt und dem Bischöflichen Seminar St. Willibald vom Oktober 1981 als Dauerleihgabe in die Universitätsbibliothek eingegliedert und entsprechend kenntlich gemacht.
(2) Die vertragsschließenden Parteien sind sich darüber einig, dass die nicht im Eigentum des Freistaates Bayern stehenden Teile des Gesamtbestandes der Stiftung übereignet werden.
Aus den §§ 1 Abs. 2, 5 Abs. 2 ergibt sich, dass es sich um eine Schenkung zugunsten der Stiftung handelt. Dies gilt auch für die übergebene Fahrregalanlage (§ 3).
§ 2 Durchführung der Übertragung
Mit Abschluss der Vereinbarung erwirbt die Stiftung den mittelbaren Besitz an den Beständen der Zentralbibliothek der Kapuziner.
(2) Vor Überprüfung der Bestände nach Eichstätt wird die Universitätsbibliothek Eichstätt prüfen, welche Teil des Bestandes vorab ausgeschieden und ggf. veräußert werden können. Der Erlös aus dem Verkauf fließt der Kapuzinerprovinz zu, die ihn für die Durchführung der Übernahme zur Verfügung stellen wird; dies gilt nicht für den Verkauf von Bänden, die im Eigentum des Freistaates Bayern stehen (vgl. § 5).
[...] (4) Mit dem Ausladen der Bestände in Eichstätt erwirbt die Stiftung den unmittelbaren Besitz hieran.
Wie in der Causa Karlsruhe lässt auch hier der sachenrechtliche Bestimmtheitsgrundsatz, über den wir http://archiv.twoday.net/stories/3076941/ handelten, grüßen. Denn die Zentralbibliothek war ja ein Mischbestand von Ordenseigentum und Staatseigentum, wobei erst bei der bibliothekarischen Bearbeitung (also der Katalogisierung) "im Einzelfall" eine Zuweisung erfolgen sollte. Das ist sinnvoll und sachgerecht, auch wenn offen bleibt, aufgrund welcher Kriterien die Eichstätter Bibliothekare (ohne oder mit Abstimmung mit dem Bayerischen Staat) die Eigentumsbestimmung vornehmen wollten. Eine Kenntlichmachung im OPAC der Bestände vor 1802 als Staatseigentum ist nicht erfolgt. Wenn man diese Vertragsregelung als vernünftig ansieht, wird man auch im Fall Karlsruhe die Anforderungen an den Bestimmtheitsgrundsatz nicht überspannen dürfen. Die Vereinbarung betrifft den Kern des Rechtsgeschäfts, die Übereignung als Schenkung. Wäre der Bestimmtheitsgrundsatz verletzt, wäre der ganze Vertrag hinfällig. Da kein anderer Termin genannt ist, dürften die Bücher jeweils (erst) mit der Katalogisierung/Bearbeitung Eigentum der Stiftung geworden sein. Unbearbeitete Teile sind Eigentum des Kapuzinerordens geblieben.
Was Bearbeitung bedeutet definiert § 4 "Bibliothekarische Aufbereitung der Bestände" (formale und sachliche Erschließung im Bayerischen Verbund mit Möglichkeit der Internetrecherche, Ausleihe gemäß Leihverkehrsrichtlinien im Einzelfall auch an Privatpersonen - in den Schlußbestimmungen § 8 findet sich eine Sonderregelung für die Benutzung durch die Mitglieder der Kapuzinerprovinz -; fachgemäße Restaurierung ggf. in Zusammenarbeit mit dem Institut für Buchrestaurierung (IBR) der Bay. Staatsbibliothek). Abs. 2 ist eine Absichtserklärung, dass die bibliothekarische Aufarbeitung innerhalb von "ca. 10 Jahren" bewerkstelligt werden soll. Die Stiftung verpflichtet sich: Sie wird die Bestände bis zu ihrer Aufarbeitung sicher aufbewahren.
Während die Bearbeitung ein abschlossener Vorgang ist, ist die in § 4 angesprochene Benutzbarkeit als Auflage zu qualifizieren (siehe § 525 BGB, http://archiv.twoday.net/stories/2835396/), da dadurch ein Dauerschuldverhältnis begründet wird. Es wird davon ausgegangen, dass die Bibliothek dauerhaft nutzbar sein soll. Die gleichen Bedingungen wurden durch die "Erweiterungsoption" in § 7 auch für künftig aufgelöste Klosterbibliotheken verbindlich gemacht, die, um eine Zersplitterung der Bestände zu vermeiden, vorrangig der Stiftung angeboten werden sollen.
Aussonderungen sollten VOR der Überführung nach Eichstätt erfolgen, Verkäufe wurden ausdrücklich vorgesehen (§ 2 Abs. 2). Es versteht sich wohl von selbst, dass ohne Zustimmung des Freistaats Bayern weder Bestände verkauft werden können noch der dadurch erzielte Erlös zweckgebunden der Kapuzinerprovinz zufließen kann. Über die Finanzierung handelt § 7 (Sondermittel vom Überdiözesanen Fonds Bayern für 1999, Fortsetzungsantrag war vorgesehen, das dürfte das Drittmittelprojekt der KU Eichstätt-Ingolstadt sein; Finanzierung eines Diplombibliothekars BAT IVb für 5 Jahre durch die Provinz.)
Änderungen des Vertrags durch mündliche Nebenabreden waren nicht ausgeschlossen. Wenn sich Stiftung und Provinz darüber einig waren, dass die Aussonderung (einschließlich Verkauf) erst in Eichstätt erfolgen sollte (anders als § 2 vorsieht) und nach dem Ausscheiden von Holzbauer zusätzlich vereinbart wurde, dass Aussonderungen durch Vernichtungen erfolgen sollten, so stellt das grundsätzlich keinen Vertragsbruch dar.
Die ordensinterne Erklärung des Provinzials Mittermaier vom 19.2.2006 gibt dazu Auskunft: "Da der Vertrag der Provinz der Bayerischen Kapuziner mit der Katholischen Universität Eichstätt von 1999 keine konkreten Richtlinien für die Aussonderung enthielt, gab es am 19.05.2005 ein Gespräch von Provinzial und Ökonom mit der Leiterin der Bibliothek, Frau Dr. Katharina Reich, in dem Folgendes festgehalten wurde:
Alle Bestände vor 1802 werden zunächst übernommen; falls es sich um Dubletten handelt, werden diese verkauft. Der Erlös dient der Einstellung von Arbeitskräften, die sich um die Bearbeitung kümmern.
Die Entscheidung, ob Bände mit Erscheinungsjahr nach 1802 in die UB Eichstätt eingearbeitet werden, liegt bei der Direktion. (So sehen es auch die vom Ministerium erlassenen Aussonderungsrichtlinien von 2003 vor.)
Kleinschrifttum Trivialliteratur, Taschenbücher, lose Zeitschriftenhefte werden ausgesondert.
Sicher genommen werden die Bücher, Kleinschriften und Zeitschriften, die zum Wesensbestand einer Zentralbibliothek der Kapuziner gehören. Es muss bei der Überlassung der Zentralbibliothek gewährleistet sein, dass die Geschichte und die Spiritualität der Bayerischen Kapuziner, das theologische Schaffen und die Leistungen in Predigt und anderen Apostolatsformen in all den Ausprägungen an der Universitätsbibliothek Eichstätt nachgesehen und erforscht werden können."
Die Erklärung (deren Wahrheitsgehalt hier nicht überprüft werden kann, der Pater Provinzial hat auf Nachfragen keine Stellungnahme abgeben wollen) lässt den Schluss zu, dass Dubletten vor 1802, obwohl im Vertrag dem Freistaat Bayern zugewiesen, verkauft und der Erlös entgegen den Vorschriften des Vertrags zur Finanzierung der Arbeitskräfte dienen sollte. Ein Vertrag kann aber keinesfalls Rechtsverhältnisse zu Lasten eines Dritten regeln.
Von ALLGEMEINEN Aussonderungsrichtlinien des Ministeriums 2003 kann keine Rede sein, es gibt nur die Richtlinien von 1998
http://www.bib-bvb.de/AuB/richtlin.html
Gegen die Punkte 2.1 (in der Regel keine Aussonderung von Drucken vor 1830/50) und 2.4 (Makulierung an letzter Stelle) wurde massiv verstoßen.
Bisherige Kontakte zum Bayerischen Wissenschaftsministerium, das die Angelegenheit natürlich aufmerksam beobachtet, lassen unter Vorbehalt die Aussage zu, dass dort von speziellen Aussonderungsrichtlinien 2003 oder Vereinbarungen in Sachen Eichstätt nichts bekannt ist.
Mit dem Überlassungsvertrag haben die beiden Vertragsparteien zum Ausdruck gebracht, dass die Zentralbibliothek der Kapuziner ein wertvolles Kulturgut darstellt, das dauerhaft zugänglich sein soll und das durch die UB Eichstätt fachgerecht erschlossen und betreut werden soll.
Eine Konkretisierung der nun einmal nicht in Altötting erfolgten Aussonderung (samt "Dubletten"-Verkauf) auf der Ebene der Bibliothek ist sicher rechtlich weitgehend unbedenklich, wenn bibliotheksfachliche Standards gewahrt werden und sich die Abrede nicht gegen den Geist des Überlassungsvertrags richtet. Entscheidende Änderungen hätte nicht die Bibliotheksdirektorin vornehmen dürfen, sie hätten der Zustimmung des Stiftungsvorstands bedurft (von der eigentumsrechtlichen Problematik des bayerischen Staatseigentums einmal abgesehen).
Wenn man von der in der Presse genannten Zahl von 100.000 vernichteten Bänden ausgeht, so ist eine Vernichtung eines Drittels der im Überlassungsvertrag mit 300.000 Bänden bezifferten Bibliothek keinesfalls vom Vertrag gedeckt. Da eine Prüfung jeden einzelnen Buches auf die Eigentumsverhältnisse (§ 5) vorgesehen war, ist die undokumentierte Vernichtung eines riesigen Bestands schlichtweg nicht mit dem Vertrag zu vereinbaren, auch wenn die Ordensleitung damit einverstanden war. Schon allein aufgrund der Eigentumsproblematik hätte eine genaue Dokumentation der zur Vernichtung vorgesehenen Bände erfolgen müssen, etwa indem man wenigstens kursorisch den Inhalt der einzelnen Kisten beschrieben hätte.
Nach Angaben des früheren Direktors Holzbauer wurden aus Altötting nur Bände übernommen, deren Erhaltung zu rechtfertigen war. Allerdings scheinen die Vorwürfe des Provinzials, dass eine ungeeignete und feuchte Aufbewahrung der Bücherkisten in einer zugigen Turnhalle, nicht aus der Luft gegriffen. Die Stiftung hätte also gegen die Auflage verstoßen, die Bestände "sicher" aufzubewahren, und es ist auch möglich, dass der Schimmel durch die Lagerung entstanden ist.
Zur Zusammensetzung des Vernichtungsguts der Provinzial:
"In der Tat wurden in diesem Zeitraum insgesamt von den eingelagerten Bücher und Materialen 83 t Bücher und Zeitschriften entsorgt. Davon entfielen auf Kapuzinerbestände 68,40 t. Davon waren 20,60 t Zeitschriften-Dubletten. Die Zeitschriften machten bei der Kapuzineraktion ca. 30% des Bestandes aus, analog dann auch bei der Entsorgung. Zeitschriften wie "Katholische Missionen", "Bayerland", "Die schöne Zukunft" waren anscheinend in allen Niederlassungen vorhanden und schlugen vom Gewicht her stark zu Buche. Dem Vorwurf, hier wäre in einem so kurzen Zeitraum so vieles entsorgt worden, kann man auf dem Gebiet der Zeitschriften mit einer dem gesunden Menschenverstand sehr einsichtigen Argumentation entgegentreten: Zeitschriftenkisten waren als solche leicht zuerkennen und der Inhalt schnell zu bestimmen.
Der Anteil an verschimmelten Büchern betrug 4,20 t, der der Monographiendubletten 40,8 t. 2,8 t machten Varia aus. Dabei handelte es sich um Reiseführer, Straßenkarten, alte und schlecht erhaltene Breviere, Taschenbücher in schlechtem Zustand, schöne Literatur in unkritischen Ausgaben, Bücher zu Geschichte und Theologie in schlechtem Zustand."
Natürlich versucht der Provinzial sich reinzuwaschen, indem er die Bedeutung des Schriftguts herunterspielt.
Holzbauer muss aber aus eigener Erfahrung durchaus zuverlässig sagen können, ob tatsächlich ein so großer Anteil der Kapuzinerbibliothek "Schrott" bzw. vernichtungswürdig war. Er bestreitet das ja entschieden.
Es spricht alles dafür, dass keine sorgfältige Aussonderung des Bestands vorgenommen wurde. Dies ist auch die Aussage der anonymen Mail, die ich im Sommer 2006 erhielt und die ich in meinem Beitrag http://archiv.twoday.net/stories/3143469/ zitiert habe.
In der Kanzlei von Frau RA Dr. Männlein
(s. http://archiv.twoday.net/stories/3359620/) wurden fünf Bücher abgegeben, die aus den Containern gerettet wurden (es handelt sich sicher wohl um die gleichen Bücher, die dem Eichstätter Kurier vorlagen). Sie werden am Donnerstag der Staatsanwaltschaft übergeben. Über ihren Inhalt schreibt die Rechtsanwältin:
"Im Gegensatz zur Behauptung, dass es sich nur um Schundliteratur gehandelt hat, und im Gegensatz zur Behauptung, dass es sich nicht um Bücher vor 1800 gehandelt hat, und im Gegensatz zur Behauptung, dass diese Bücher alle in einem schlechten Zustand seien, kann ich Ihnen folgende Bücher benennen.
Das eine stammt aus dem Jahr 1626 und hat den Titel „Kurze katholische Auslegung aller feiertäglichen Evangelien“, schweinsledergebunden, besterhalten.
„Historische Katechese in auserlesenen Beispielen, Erzählungen und Parabeln über die gesamte christkatholische Glaubens-, Sitten- und Tugendmittel-Lehre aus dem Jahre 1853.
„Deutscher Hausgarten“ von 1859.
„Sermones Sancti“ Thomae a Villa nova aus dem Jahre 1661 (lateinische Sprache, schweinslederner Umschlag, besterhalten) und
Theatrum Asceticum, Sive Meditationes Sacre in Theatro congregationis latinae aus dem Jahre 1747.
Es bedarf wohl keiner langen Ausführungen, dass eine Vernichtung solcher Drucke in keiner Hinsicht zu rechtfertigen ist.
Der Provinzial schreibt dazu: "Am 2. Februar [2007] zeigte mir der ehemalige Bibliotheksdirektor, Dr. Herrmann Holzbauer, vier Exemplare historisch und theologisch wertvoller Büchern, die Mitarbeiter der Universitätsbibliothek aus dem Abfall gezogen hätten. Dies wurde von unserer Seite der Universitätsbibliothek gemeldet. Der Provinzial weigerte sich allerdings, in die Presseagitation gegen die Universität einzusteigen. Am Freitag, 16. Februar lag dem Eichstätter Kurier eine eidesstattliche Erklärung eines anonym sich gebenden Mitbürgers der Stadt Eichstätt über diesen Bücherfund vor."
Durch die Vernichtung eines beträchtlichen Teils der Kapuzinerbibliothek, bei dem offenbar auch wertvolle Altbestände betroffen waren, wurde der im Interesse der Allgemeinheit getroffene Überlassungsvertrag, der in Eichstätt eben keine Aussonderung vorsah, eindeutig verletzt. Wenn man nachträglich festgestellt hat, dass fachlich begründete Aussonderungen unvermeidlich sind, hätte man angesichts des Umfangs den Vertrag von Seiten der Vertragspartner (auf der Seite der UB der Stiftungsvorstand!) abändern müssen oder durch Dokumentation sicherstellen müssen, dass nachvollziehbar bleibt, dass weder Interessen der Allgemeinheit noch Vermögensinteressen des bayerischen Staates beeinträchtigt wurden. Da dies nicht erfolgt ist, müssen die Verantwortlichen strafrechtlich Verantwortung tragen. Eine grob fahrlässige undokumentierte Vernichtung eines Buchbestands erfüllt den Tatbestand der Untreue, wobei als Maßstab eine am Zweck des Überlassungsvertrags orientierte Auslegung der Vertragspflichten der Hochschule sehr wohl dienen kann. Die Hochschule konnte weder durch die Bibliotheksleiterin noch durch Kanzler oder Rektor den Kerngehalt des Überlassungsvertrags abändern. Ebensowenig konnte sie über bayerisches Staatseigentum verfügen, für dessen Aussonderung ein Jahr vor dem Überlassungsvertrag ausdrückliche Vorschriften erlassen worden waren, gegen die in Eichstätt verstoßen wurden.
Wie beim Umgang mit anderen Schenkungen (z.B. Schallplattensammlung Sievers) hat die Bibliotheksleiterin offensichtlich völlig ihre Pflichten verkannt. Sie hat selbstherrlich nach Gutdünken entschieden, indem sie Entscheidungen und Wertungen ihres Vorgängers (der hinsichtlich der Dublettenverscherbelungen natürlich ebenso wie Dr. Littger wissenschaftlich große Schuld auf sich geladen hat) revidierte, weil sie die Platzprobleme nicht glaubte anders in den Griff bekommen zu können. Aber wenn man eine Schenkung annimmt, muss man sich auch daran halten, wenn die Verhältnisse sich geändert haben.
Nachtrag: Der Donaukurier vom 24./25.2.2007 enthält zwei Abbildungen einer Predigtsammlung aus Kapuzinerbeständen, die aus dem Altpapier gezogen wurde. Das eine Bild zeigt den gut erhaltenen Einband, auf dem Rücken beschriftet
Lucian
Dom.Quad.
P. I
mit Signaturschild "Cap. Pred. 8° R5", darunter groß der Gruppenbuchst. R
das andere die Titelseite des spanischen Drucks von 1634 mit Kapuziner-Stempel (Altötting). Es handelt sich offenbar um einen weiteren Band, der anscheinend nicht mit einem Band der oben angeführten Liste identisch ist.
"Quer / durch die Woche mit Christoph Süß" wird am Donnerstag, 1. März um 20.15 über den Fall Eichstätt berichten. (Wdh. Samstag, 3. März auf 3sat, Mo, 5.3., 22:15 bei EinsFestival.)
- Schätze im Müll: Bibliothek wirft wertvolle Bücher weg
100.000 Bücher aus einem Vermächtnis hat die Universitäts-Bibliothek Eichstätt entsorgt. Doch im Müllcontainer landeten nicht nur alte Zeitschriften und abgenutzte Bücher. Ein Bücherfreund fand dort auch einzigartige, wertvolle Schriften der Kapuziner-Mönche. Jetzt ist die Aufregung groß: Sind noch mehr unersetzliche Bücher in den Müll gewandert? quer auf den Spuren eines Bücherkrimis.
- Schätze im Müll: Bibliothek wirft wertvolle Bücher weg
100.000 Bücher aus einem Vermächtnis hat die Universitäts-Bibliothek Eichstätt entsorgt. Doch im Müllcontainer landeten nicht nur alte Zeitschriften und abgenutzte Bücher. Ein Bücherfreund fand dort auch einzigartige, wertvolle Schriften der Kapuziner-Mönche. Jetzt ist die Aufregung groß: Sind noch mehr unersetzliche Bücher in den Müll gewandert? quer auf den Spuren eines Bücherkrimis.
Due technical reasons I cannot incorporate the chart in this entry as suggested by OpenDOAR nor can I put a link correctly
http://www.opendoar.org/
http://digbig.com/4rqtp
OAI-Metadata should be Open Access (CC-BY)!
On the legal problem see my statement (in German):
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg29811.html
http://www.opendoar.org/
http://digbig.com/4rqtp
OAI-Metadata should be Open Access (CC-BY)!
On the legal problem see my statement (in German):
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg29811.html
KlausGraf - am Dienstag, 27. Februar 2007, 19:55 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
There is an article in Zvi S Rosen that I thought you might like to read:
Zvi S. Rosen (2006) The Twilight of the Opera Pirates: A Prehistory of the Exclusive Right of Public Performance for Musical Compositions,
http://works.bepress.com/zvi_rosen/1.
I hope you enjoy this article, which may be viewed without charge.
Interesting project: the bepress "Selected Works".
Zvi S. Rosen (2006) The Twilight of the Opera Pirates: A Prehistory of the Exclusive Right of Public Performance for Musical Compositions,
http://works.bepress.com/zvi_rosen/1.
I hope you enjoy this article, which may be viewed without charge.
Interesting project: the bepress "Selected Works".
KlausGraf - am Dienstag, 27. Februar 2007, 18:47 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Originaltext, Übersetzung, heraldische Noten und Sekundärquellen zum Adelsbrief André Falquet von 1725 (Nobilitierungsurkunde Karl VI.):
Adelsbrief André Falquet
.
Adelsbrief André Falquet
.
Appi Appi - am Dienstag, 27. Februar 2007, 18:24 - Rubrik: Hilfswissenschaften
"Wenn der Wind des Wandels weht, bauen einige Mauern und andere Windmühlen"
(Chinesisches Sprichwort)
Gefunden auf http://www.usedsoft.com/
Das sollte man den gegen Open Access eingestellten Verlagen ins Stammbuch schreiben.
(Chinesisches Sprichwort)
Gefunden auf http://www.usedsoft.com/
Das sollte man den gegen Open Access eingestellten Verlagen ins Stammbuch schreiben.
KlausGraf - am Dienstag, 27. Februar 2007, 18:04 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.utlib.ee/ee/index.php?cat=ea&sisu=autogr&amenu=dg&taht=a
Sehr reichhaltig für die deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts!
Sehr reichhaltig für die deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts!
KlausGraf - am Dienstag, 27. Februar 2007, 04:26 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Bibliothek des Leo-Baeck-Instituts hat auch diverse deutsche alte Drucke digitalisiert:
http://www.lbi.org/lbirarebooks.html
http://www.lbi.org/lbirarebooks.html
KlausGraf - am Dienstag, 27. Februar 2007, 03:54 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.deutsches-buchbindermuseum.de/55.0.html
Das Buchbindermuseum im Mainzer Gutenberg-Museum hat einige alte Drucke digitalisiert, die man möglicherweise bei
http://de.wikisource.org/wiki/Buchhandel
ergänzen sollte.
Das Buchbindermuseum im Mainzer Gutenberg-Museum hat einige alte Drucke digitalisiert, die man möglicherweise bei
http://de.wikisource.org/wiki/Buchhandel
ergänzen sollte.
KlausGraf - am Dienstag, 27. Februar 2007, 03:25 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 27. Februar 2007, 03:17 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://193.52.215.194/
Derzeit 186 Titel, darunter auch:
Auteur : Eberlin von Günzburg, Johann
Titre : Ain klegliche klag an den Christlichen Römischen kaiser Karolum von wegen Doctor Luthers und Ulrich von Huten Auch von wegen der Curtisanen und betelmünch das Kay. Maie. sich nit laßsolich leüt Der erst bundtsgnoss.
Édition : [Augsburg] : [Jörg Nadler], [1521]
***
Auteur : Wimpfeling, Jakob
Titre : Hic subnotata continentur : Vita. M. Catonis. Sextus Aurelius de vitis Caesarum. Beneuenutus de eadem re. Philippi Beroaldi & Thomae Vuolphij Iunioris disceptatio / de nomine imperatorio. Epithoma rerum Germanicarum vsque ad nostra tempora. Thomae aucuparij Distichon. Multa breui doceo mire breuitatis amator Nos eme;nam breuibus discere multa potes.
Édition : [Iohannes. Prüs in aedibus Thiiergarten Argentinae imprimebat. Mathias Schürer recognouit.], 1505
Ein zentrales Werk der humanistischen Geschichtsschreibung in Deutschland!
***
Auteur : Melanchthon, Philipp
Titre : Von der Kierchen / und alten Kierchenleren.
Édition : Wittemberg : [Gedruckt zu Wittemberg / durch Ioseph Klug], 1540
Format : 4°
Collation : 175, [1 bl.] f. (sig. A-Y4)
Langue : Allemand
Matière : Religion, Théologie -
Bibliographie :
Imprimeur : Klug, Josef
Libraire : Klug, Josef
Traducteur : Justus, Jonas
Traducteur : Maior, Georg
Particularités : Trois ouvrages de Melanchthon reliés ensemble : 1) Von der Kirchen / vnd alten Kirchenlerern ; 2) Das die Fursten aus Gottes beuelh vnd gebot schuldig sind […] ; 3) Widder den unreinen Bapsts Celibat / und verbot der Priesterche. Reliure en papier marbré avec une pièce de titre en basane au dos : "Melanchton (sic)". Quelques annotations manuscrites.
***
Auteur : Kymeus, Johannes
Titre : Des Babsts Hercules / wider die Deudschen. Die auch vor dieser Zeit / nicht haben wollen dem Babst / beide die christlichen / und des heiligen romischen Reichs Freiheit und dignitet / ubergeben. Durch Johannem Kymeum.
Édition : [Gedruckt zu Wittemberg] : [durch Georgen Rhaw], 1538
Derzeit 186 Titel, darunter auch:
Auteur : Eberlin von Günzburg, Johann
Titre : Ain klegliche klag an den Christlichen Römischen kaiser Karolum von wegen Doctor Luthers und Ulrich von Huten Auch von wegen der Curtisanen und betelmünch das Kay. Maie. sich nit laßsolich leüt Der erst bundtsgnoss.
Édition : [Augsburg] : [Jörg Nadler], [1521]
***
Auteur : Wimpfeling, Jakob
Titre : Hic subnotata continentur : Vita. M. Catonis. Sextus Aurelius de vitis Caesarum. Beneuenutus de eadem re. Philippi Beroaldi & Thomae Vuolphij Iunioris disceptatio / de nomine imperatorio. Epithoma rerum Germanicarum vsque ad nostra tempora. Thomae aucuparij Distichon. Multa breui doceo mire breuitatis amator Nos eme;nam breuibus discere multa potes.
Édition : [Iohannes. Prüs in aedibus Thiiergarten Argentinae imprimebat. Mathias Schürer recognouit.], 1505
Ein zentrales Werk der humanistischen Geschichtsschreibung in Deutschland!
***
Auteur : Melanchthon, Philipp
Titre : Von der Kierchen / und alten Kierchenleren.
Édition : Wittemberg : [Gedruckt zu Wittemberg / durch Ioseph Klug], 1540
Format : 4°
Collation : 175, [1 bl.] f. (sig. A-Y4)
Langue : Allemand
Matière : Religion, Théologie -
Bibliographie :
Imprimeur : Klug, Josef
Libraire : Klug, Josef
Traducteur : Justus, Jonas
Traducteur : Maior, Georg
Particularités : Trois ouvrages de Melanchthon reliés ensemble : 1) Von der Kirchen / vnd alten Kirchenlerern ; 2) Das die Fursten aus Gottes beuelh vnd gebot schuldig sind […] ; 3) Widder den unreinen Bapsts Celibat / und verbot der Priesterche. Reliure en papier marbré avec une pièce de titre en basane au dos : "Melanchton (sic)". Quelques annotations manuscrites.
***
Auteur : Kymeus, Johannes
Titre : Des Babsts Hercules / wider die Deudschen. Die auch vor dieser Zeit / nicht haben wollen dem Babst / beide die christlichen / und des heiligen romischen Reichs Freiheit und dignitet / ubergeben. Durch Johannem Kymeum.
Édition : [Gedruckt zu Wittemberg] : [durch Georgen Rhaw], 1538
KlausGraf - am Dienstag, 27. Februar 2007, 02:54 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Noch einzuarbeiten in http://archiv.twoday.net/stories/113113/:
bvh
http://archiv.twoday.net/stories/3370065/
NEU auf
http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/rara/
Vnnsers Johans...Bischoffen zu Münster...verfaste / vnd durch vnsere Münsterische Stiffts Stende
angenommene...Münsterische Hoffgerichtsordnung (1571)
Vnnsers Johans ... Bischoffen zu Münster ... verfaste/ vnd durch vnsere Münsterische Stiffts Stende
angenommene ... Münsterische Landtgerichts Ordnung (1571)
Vnnsers Johans ... Bischoffen zu Münster ... verfaste/ vnd durch vnsere Münsterische Stiffts Stende
angenommene ... Münsterische Gemeine Ordnungen (1571)
Der freien vnd heimlichen Gerichten Reformation / davon im dritten Titull / des dritten theils
vnser Johans ... Bischoffen zu Münster ...
Landtgerichts/Ordnung relation vnd meldung geschicht ... (1571)
Weitere, z.T. ältere Neufunde, die ich noch nicht eingearbeitet habe:
http://num-scd-ulp.u-strasbg.fr:8080/
UB Kiel
http://www.uni-kiel.de/ub/digiport/bis1800/Ka5144(7).html
http://www.uni-kiel.de/ub/digiport/bis1800/the9.html
ECHO Chemie (3)
http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/content/chemistry/chemistry
Gloning
http://homepage.univie.ac.at/thomas.gloning/at-dak.htm
http://www.uni-giessen.de/gloning/at-dak.htm
Ryff
http://fermi.imss.fi.it/rd/bd
Weimar, HAAB, knapp vor der "großen Sammlung"
Murner-Faksimile
http://www.archive.org/details/muhleschwindel00murnuoft
Luther gegen die Juden
http://digital.cjh.org:1801/webclient/DeliveryManager?pid=148798&custom_att_2=simple_viewer
Sevilla Münster
http://fondosdigitales.us.es/books/digitalbook_view?oid_page=363178
In Japan
Ordnung, Statuten und Edict, Keiser Carols des funfften publicirt in der namhafften Stat Brussel, 1540
http://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/infolib/user_contents/fukuda/0215.djvu
historicum.net
http://archiv.twoday.net/stories/4323315/
Coler
http://www.digitalis.uni-koeln.de/Coler/coler_index.html
UIUC
http://archiv.twoday.net/stories/4503374/
UB München
http://archiv.twoday.net/stories/4826873/
UB Umea
http://archiv.twoday.net/stories/4846724/
bvh
http://archiv.twoday.net/stories/3370065/
NEU auf
http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/rara/
Vnnsers Johans...Bischoffen zu Münster...verfaste / vnd durch vnsere Münsterische Stiffts Stende
angenommene...Münsterische Hoffgerichtsordnung (1571)
Vnnsers Johans ... Bischoffen zu Münster ... verfaste/ vnd durch vnsere Münsterische Stiffts Stende
angenommene ... Münsterische Landtgerichts Ordnung (1571)
Vnnsers Johans ... Bischoffen zu Münster ... verfaste/ vnd durch vnsere Münsterische Stiffts Stende
angenommene ... Münsterische Gemeine Ordnungen (1571)
Der freien vnd heimlichen Gerichten Reformation / davon im dritten Titull / des dritten theils
vnser Johans ... Bischoffen zu Münster ...
Landtgerichts/Ordnung relation vnd meldung geschicht ... (1571)
Weitere, z.T. ältere Neufunde, die ich noch nicht eingearbeitet habe:
http://num-scd-ulp.u-strasbg.fr:8080/
UB Kiel
http://www.uni-kiel.de/ub/digiport/bis1800/Ka5144(7).html
http://www.uni-kiel.de/ub/digiport/bis1800/the9.html
ECHO Chemie (3)
http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/content/chemistry/chemistry
Gloning
http://www.uni-giessen.de/gloning/at-dak.htm
Ryff
http://fermi.imss.fi.it/rd/bd
Weimar, HAAB, knapp vor der "großen Sammlung"
Murner-Faksimile
http://www.archive.org/details/muhleschwindel00murnuoft
Luther gegen die Juden
http://digital.cjh.org:1801/webclient/DeliveryManager?pid=148798&custom_att_2=simple_viewer
Sevilla Münster
http://fondosdigitales.us.es/books/digitalbook_view?oid_page=363178
In Japan
Ordnung, Statuten und Edict, Keiser Carols des funfften publicirt in der namhafften Stat Brussel, 1540
http://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/infolib/user_contents/fukuda/0215.djvu
historicum.net
http://archiv.twoday.net/stories/4323315/
Coler
http://www.digitalis.uni-koeln.de/Coler/coler_index.html
UIUC
http://archiv.twoday.net/stories/4503374/
UB München
http://archiv.twoday.net/stories/4826873/
UB Umea
http://archiv.twoday.net/stories/4846724/
KlausGraf - am Dienstag, 27. Februar 2007, 01:52 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Rodeck, Franz Rudolph, 1885-
Title: Beiträge zur Geschichte des Eherechts deutscher Fürsten bis zur Durchführung des Tridentinums. / Von Dr. Franz Rodeck.
Münster in Westfalen,: Druck der westfälischen vereins druckerei, 1910.
URL: http://name.umdl.umich.edu/ajb0367.0001.001
Title: Beiträge zur Geschichte des Eherechts deutscher Fürsten bis zur Durchführung des Tridentinums. / Von Dr. Franz Rodeck.
Münster in Westfalen,: Druck der westfälischen vereins druckerei, 1910.
URL: http://name.umdl.umich.edu/ajb0367.0001.001
KlausGraf - am Dienstag, 27. Februar 2007, 01:31 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Mark Buzinkay erstellte ein ausgezeichnetes Produkt, das kostenfrei heruntergeladen werden kann unter
http://www.buzinkay.net/bib-marketing.html
und auch für Archivare manche Anregung bietet!
http://www.buzinkay.net/bib-marketing.html
und auch für Archivare manche Anregung bietet!
KlausGraf - am Montag, 26. Februar 2007, 23:55 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Prozess gegen die Mitglieder eines Heimatbundes, die in Sachsen-Anhalt das Tagebuch der Anne Frank verbrannten, hat begonnen.
http://strafblog.myblog.de/strafblog/art/109816964
 1933
1933
Zum Thema:
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCcherverbrennung
Zitat:
"Am 3. Oktober 1965 verbrannte eine Gruppe Jugendlicher des Düsseldorfer EC (Entschiedene Christen) Groschenromane, Sex-Magazine und Bravo-Hefte, aber auch Bücher namhafter Autoren, wie Grass, Kästner oder Nabokow unter feierlichem Rezitieren von Bibelstellen, um Schriften zu vernichten, „die negative Wirkung auf sie gehabt hätten”. Die Idee kam den Jugendlichen nach der Lektüre der Apostelgeschichte, wo es heißt: „Viele aber, die da Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich.” (19,19)."
Der Pressesprecher der KH Eichstätt-Ingolstadt gab 2007 an, unter den vernichteten Büchern sei Trivialliteratur gewesen.
http://strafblog.myblog.de/strafblog/art/109816964
 1933
1933Zum Thema:
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCcherverbrennung
Zitat:
"Am 3. Oktober 1965 verbrannte eine Gruppe Jugendlicher des Düsseldorfer EC (Entschiedene Christen) Groschenromane, Sex-Magazine und Bravo-Hefte, aber auch Bücher namhafter Autoren, wie Grass, Kästner oder Nabokow unter feierlichem Rezitieren von Bibelstellen, um Schriften zu vernichten, „die negative Wirkung auf sie gehabt hätten”. Die Idee kam den Jugendlichen nach der Lektüre der Apostelgeschichte, wo es heißt: „Viele aber, die da Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich.” (19,19)."
Der Pressesprecher der KH Eichstätt-Ingolstadt gab 2007 an, unter den vernichteten Büchern sei Trivialliteratur gewesen.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wie kommt Dante nach Indien? Ich suchte nach dem Begriff medieval in der neuen Metasuche CASSIR http://casin.ncsi.iisc.ernet.in/oai/ der indischen Open-Access-Repositorien und stiess auf folgendes DSpace-Angebot, das zahlreiche englischsprachige Aufsätze aus dem 19. Jahrhundert enthält:
http://prints.iiap.res.in/browse-date?order=oldestfirst
http://prints.iiap.res.in/browse-date?order=oldestfirst
KlausGraf - am Montag, 26. Februar 2007, 23:29 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Have you tried Google Books? You can view the pages of armorial reference books by Burke, Papworth, Boutell, Worthy, Crozier, and others online.
Go to Google.com Select "MORE." Click on "Books." Select "Full view Books." Perform searches for "armory, general armory,"heraldry," etc..
best,
Jerry Morris, MOOPL
>Dear Colleagues
>
>Wondered whether any have come across any online resources for UK &
>European
>armorials that they may be able to share with me?
>
>Best wishes
>
>J.A.Eaton
***
Gabriel Austin
Jerry,
There are two BILLION+ hits if one enters More on Google.
What now/
Gabriel
***
John Beekman
Gabriel,
Don't search "more" on Google - rather, click the link over the search box that says "more," which will open a box from which you can choose "books." Then click the radio button (little circle thing) for "full view books." Then, as Jerry said: "Perform searches for "armory, general armory, heraldry," etc.."
JWB
Go to Google.com Select "MORE." Click on "Books." Select "Full view Books." Perform searches for "armory, general armory,"heraldry," etc..
best,
Jerry Morris, MOOPL
>Dear Colleagues
>
>Wondered whether any have come across any online resources for UK &
>European
>armorials that they may be able to share with me?
>
>Best wishes
>
>J.A.Eaton
***
Gabriel Austin
Jerry,
There are two BILLION+ hits if one enters More on Google.
What now/
Gabriel
***
John Beekman
Gabriel,
Don't search "more" on Google - rather, click the link over the search box that says "more," which will open a box from which you can choose "books." Then click the radio button (little circle thing) for "full view books." Then, as Jerry said: "Perform searches for "armory, general armory, heraldry," etc.."
JWB
KlausGraf - am Montag, 26. Februar 2007, 23:13 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Antwort auf die kleine Anfrage der FDP/DVP liegt jetzt vor. Siehe
http://archiv.twoday.net/stories/3025890/#3368552
http://archiv.twoday.net/stories/3025890/#3368552
BCK - am Montag, 26. Februar 2007, 23:12 - Rubrik: Kulturgut
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 26. Februar 2007, 21:28 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 Unter der Signatur KS Nische C 13 bewahrt die Badische Landesbibliothek einen Band mit 72 Blumendarstellungen aus der Zeit Karl Wilhelms (um 1730). Dieses berühmte "Karlsruher Tulpenbuch" ist jetzt im Internet frei zugänglich unter
Unter der Signatur KS Nische C 13 bewahrt die Badische Landesbibliothek einen Band mit 72 Blumendarstellungen aus der Zeit Karl Wilhelms (um 1730). Dieses berühmte "Karlsruher Tulpenbuch" ist jetzt im Internet frei zugänglich unter http://www.blb-karlsruhe.de/virt_bib/tulpen/.
(Einführungstexte: Dr. Gerhard Stamm, Abb.: Helene Börner und Beate Ehlig, BLB Karlsruhe)
Es ist sehr erfreulich, dass die Badische Landesbibliothek jetzt daran geht, ihre Preziosen im Internet verfügbar zu machen.
BCK - am Montag, 26. Februar 2007, 19:19 - Rubrik: Kulturgut
Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 14/847 26.01.2007
Antrag der Fraktion der SPD
und Stellungnahme
des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Die Entwicklung beim Drei-Säulen-Modell der Landesregierung
zur Finanzierung der badischen Kulturgüter
Eingegangen: 26. 01. 2007 / Ausgegeben: 23. 02. 2007 1
Stellungnahme
Mit Schreiben vom 16. Februar 2007 Nr. 53–7962.7–12/57 nimmt das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst zu dem Antrag wie folgt Stellung:
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,
1. in welchem Umfang nach heutigem Kenntnisstand über die Inaussichtstellung eines 10-Millionen-€-Betrags der Landesstiftung hinaus die Landesregierung aus Mitteln des Landeshaushalts zur Finanzierung ihrer Verständigung mit dem Haus Baden über die badischen Kulturgüter beitragen wird (Säule I des Drei-Säulen-Modells);
2. in welchem Umfang zum gegenwärtigen Zeitpunkt Privatpersonen und die Wirtschaft finanzielle Beiträge geleistet oder in Aussicht gestellt haben zur Finanzierung dieser Verständigung der Landesregierung mit dem Haus Baden (Säule II des Drei-Säulen-Modells);
3. in welchem Umfang zum gegenwärtigen Zeitpunkt der „Kunst- und Bibliotheksbereich'“ in der Zuständigkeit des Landes durch teilweisen Verzicht auf Beschaffungsetats, durch Verkäufe oder durch andere finanzielle Beiträge zur Finanzierung dieser Verständigung der Landesregierung mit dem Haus Baden beigetragen hat oder es beabsichtigt (Säule III des Drei-Säulen-Modells).
Das Wissenschaftsministerium hat eine unabhängige Expertengruppe damit beauftragt, die Sach- und Rechtsfragen bezüglich des Eigentums an den Kulturgütern aus den früheren Beständen des Hauses Baden zu klären. Ihr konkreter Arbeitsauftrag ergibt sich aus der Stellungnahme des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zur Landtagsdrucksache 14/744. Bis zum Abschluss der Arbeit der Expertengruppe sind die Vergleichsverhandlungen mit dem Haus Baden ausgesetzt. Es ist deshalb derzeit offen, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe Finanzierungsbeiträge aus verschiedenen Quellen erforderlich werden können.
Vor der Einsetzung der Expertengruppe war geplant, einen Vergleich gegebenenfalls durch Einsatz von Mitteln der Landesstiftung, durch Einwerbung privater Mittel und durch den Einsatz von Haushaltsmitteln zu finanzieren. Diese Haushaltsmittel sollten in Höhe von 10 Mio. € im Rahmen der vorhandenen Ansätze umgeschichtet werden. Im Einzelplan 14 („Kunst- und Bibliotheksbereich“) des Staatshaushaltsplanes 2007/2008 wurden hierfür bereits 6,1 Mio € als Beitrag für die 3. Säule vorgemerkt.
Aus dem privaten Sektor wurden auf ein für diesen Zweck eingerichtetes Spendenkonto insgesamt bislang 3.325,01 € einbezahlt. Darüber hinaus gab es eine Reihe von Gesprächen mit Privatpersonen und Vertretern der Wirtschaft, die in unterschiedlicher Konkretisierung zu Inaussichtstellungen in
siebenstelliger Höhe geführt haben. Im Oktober 2006 haben sich die WGV-Versicherungen zu einem Beitrag zur Sicherung badischen Kulturguts in Höhe von 1,5 Mio. Euro bereit erklärt.
Dr. Frankenberg
Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Antrag der Fraktion der SPD
und Stellungnahme
des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Die Entwicklung beim Drei-Säulen-Modell der Landesregierung
zur Finanzierung der badischen Kulturgüter
Eingegangen: 26. 01. 2007 / Ausgegeben: 23. 02. 2007 1
Stellungnahme
Mit Schreiben vom 16. Februar 2007 Nr. 53–7962.7–12/57 nimmt das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst zu dem Antrag wie folgt Stellung:
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,
1. in welchem Umfang nach heutigem Kenntnisstand über die Inaussichtstellung eines 10-Millionen-€-Betrags der Landesstiftung hinaus die Landesregierung aus Mitteln des Landeshaushalts zur Finanzierung ihrer Verständigung mit dem Haus Baden über die badischen Kulturgüter beitragen wird (Säule I des Drei-Säulen-Modells);
2. in welchem Umfang zum gegenwärtigen Zeitpunkt Privatpersonen und die Wirtschaft finanzielle Beiträge geleistet oder in Aussicht gestellt haben zur Finanzierung dieser Verständigung der Landesregierung mit dem Haus Baden (Säule II des Drei-Säulen-Modells);
3. in welchem Umfang zum gegenwärtigen Zeitpunkt der „Kunst- und Bibliotheksbereich'“ in der Zuständigkeit des Landes durch teilweisen Verzicht auf Beschaffungsetats, durch Verkäufe oder durch andere finanzielle Beiträge zur Finanzierung dieser Verständigung der Landesregierung mit dem Haus Baden beigetragen hat oder es beabsichtigt (Säule III des Drei-Säulen-Modells).
Das Wissenschaftsministerium hat eine unabhängige Expertengruppe damit beauftragt, die Sach- und Rechtsfragen bezüglich des Eigentums an den Kulturgütern aus den früheren Beständen des Hauses Baden zu klären. Ihr konkreter Arbeitsauftrag ergibt sich aus der Stellungnahme des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zur Landtagsdrucksache 14/744. Bis zum Abschluss der Arbeit der Expertengruppe sind die Vergleichsverhandlungen mit dem Haus Baden ausgesetzt. Es ist deshalb derzeit offen, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe Finanzierungsbeiträge aus verschiedenen Quellen erforderlich werden können.
Vor der Einsetzung der Expertengruppe war geplant, einen Vergleich gegebenenfalls durch Einsatz von Mitteln der Landesstiftung, durch Einwerbung privater Mittel und durch den Einsatz von Haushaltsmitteln zu finanzieren. Diese Haushaltsmittel sollten in Höhe von 10 Mio. € im Rahmen der vorhandenen Ansätze umgeschichtet werden. Im Einzelplan 14 („Kunst- und Bibliotheksbereich“) des Staatshaushaltsplanes 2007/2008 wurden hierfür bereits 6,1 Mio € als Beitrag für die 3. Säule vorgemerkt.
Aus dem privaten Sektor wurden auf ein für diesen Zweck eingerichtetes Spendenkonto insgesamt bislang 3.325,01 € einbezahlt. Darüber hinaus gab es eine Reihe von Gesprächen mit Privatpersonen und Vertretern der Wirtschaft, die in unterschiedlicher Konkretisierung zu Inaussichtstellungen in
siebenstelliger Höhe geführt haben. Im Oktober 2006 haben sich die WGV-Versicherungen zu einem Beitrag zur Sicherung badischen Kulturguts in Höhe von 1,5 Mio. Euro bereit erklärt.
Dr. Frankenberg
Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst
BCK - am Montag, 26. Februar 2007, 18:28 - Rubrik: Kulturgut
Aus der Archivliste:
Das Landesarchiv NRW Staatsarchiv Münster bietet eine nicht mehr benötigte Fahrregalanlage zum Kauf an.
Hersteller: Arbitec
Baujahr: 1998
Regalbreite: 1,10 m
Regalboden: 1,07 m x 0,40 m
Gesamthöhe: 2,45 m
Einlegeböden je Feld: 5
Zulässige Nutzlast: pro Fach 42kg/m, pro Feld 210 kg/m, pro Wagen 1848 kg
Preis: auf Anfrage
Die Regalanlage besteht aus 14 beidseitig bestückbaren Regalsträngen ("Wagen") mit jeweils 8 x 5 Regalböden sowie den dazugehörigen Schienen. Die Anlage wurde kaum genutzt und ist in einem außerordentlich guten Zustand. Die Regale sind auch als Standregale nutzbar.
Montage und Transport müssen vom Käufer durchgeführt werden.
Eine Besichtigung der Anlage ist nach vorheriger Absprache möglich. Standort ist Nottuln.
Ansprechpartnerin ist Frau Bücker, Tel. 0251/4885-128, melanie.buecker@lav.nrw.de.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Mechthild Black-Veldtrup
Das Landesarchiv NRW Staatsarchiv Münster bietet eine nicht mehr benötigte Fahrregalanlage zum Kauf an.
Hersteller: Arbitec
Baujahr: 1998
Regalbreite: 1,10 m
Regalboden: 1,07 m x 0,40 m
Gesamthöhe: 2,45 m
Einlegeböden je Feld: 5
Zulässige Nutzlast: pro Fach 42kg/m, pro Feld 210 kg/m, pro Wagen 1848 kg
Preis: auf Anfrage
Die Regalanlage besteht aus 14 beidseitig bestückbaren Regalsträngen ("Wagen") mit jeweils 8 x 5 Regalböden sowie den dazugehörigen Schienen. Die Anlage wurde kaum genutzt und ist in einem außerordentlich guten Zustand. Die Regale sind auch als Standregale nutzbar.
Montage und Transport müssen vom Käufer durchgeführt werden.
Eine Besichtigung der Anlage ist nach vorheriger Absprache möglich. Standort ist Nottuln.
Ansprechpartnerin ist Frau Bücker, Tel. 0251/4885-128, melanie.buecker@lav.nrw.de.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Mechthild Black-Veldtrup
KlausGraf - am Montag, 26. Februar 2007, 13:41 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Abstracts und andere Inhaltsmitteilungen im Urheberrecht / Pohl, Bettina
Osnabrück, Univ., Diss., 2006.
Fachbereich: Rechtswissenschaften
Betreuer: Prof. Dr. Willi Erdmann
Gutachter:Prof. Dr. Willi Erdmann, Prof. Dr. Hans-Jürgen Ahrens
Thesis.pdf Size: 1359347 [2006.11.14/02:07:53]
http://elib.ub.uni-osnabrueck.de/publications/diss/E-Diss610_thesis.pdf
DNB: 19 BK: 86.28
Keywords: Abstract, Inhaltsmitteilung, §§ 23, 24 UrhG, verkürzte Darstellung, Substitutionswirkung, Beteiligungsgrundsatz, abhängige Bearbeitung
Abstract: Abstracts gewinnen als Mittel zur Bewältigung der Informationsflut zunehmend an Bedeutung. Die verkürzte Darstellung eines Originalwerkes in Form eines abstracts – aber auch im Rahmen von Opernführern, Unterrichtshilfen und Rezensionen – kann problematisch sein, wenn das Originalwerk urheberrechtlich geschützt ist und der Urheber der Anfertigung der verkürzten Darstellung nicht zugestimmt hat. Die Arbeit widmet sich der Frage, in welchem Umfang solche verkürzten Darstellungen in urheberrechtlicher Hinsicht zulässig sind. Es wird untersucht, ob verkürzte Darstellungen als abhängige Bearbeitungen im Sinne des § 23 UrhG zu werten sind oder ob eine freie Benutzung nach § 24 UrhG in Betracht kommt. Im Rahmen dieser Abgrenzung ist die dem § 12 Abs. 2 UrhG zugrundeliegende Wertung der Gemeinfreiheit bloßer Inhaltsmitteilungen zu berücksichtigen. Eine abhängige Bearbeitung im Sinne des § 23 UrhG liegt in jedem Fall dann vor, wenn eine verkürzte Darstellung zur Substitution des Originalwerkes geeignet ist. Dies ergibt sich in dogmatischer Hinsicht unmittelbar aus dem in § 11 Satz 2 UrhG verankerten Beteiligungsgrundsatz. Zur Abgrenzung zwischen zulässiger (gemeinfreier) Inhaltsmitteilung im Sinne des § 12 Abs. 2 UrhG und (ohne die Zustimmung des Urhebers) unzulässiger abhängiger Bearbeitung im Sinne des § 23 UrhG wird ein Katalog objektiver Kriterien entwickelt, durch den die Verwertungsinteressen des Urhebers mit den Informationsinteressen der Allgemeinheit in Einklang gebracht werden können.
--
Die Problematik hat natürlich auch Bedeutung für die archivische Verzeichnung, denn bei unveröffentlichten Werken könnte ein ausführliches Regest als unerlaubte Inhaltsmitteilung angesehen werden. Sie ist vor der Veröffentlichung dem Urheber vorbehalten.
Es ist erfreulich, dass die gründliche Aufarbeitung der urheberrechtlichen Problematik unautorisierter "verkürzter darstellungen" online vorliegt.
Zur Rechtsprechung über die Zulässigkeit der Anfertigung von Abstracts ohne Zustimmung des Urhebers:
http://log.netbib.de/archives/2005/09/16/abstracts-und-urheberrecht-2/
http://www.jurpc.de/rechtspr/20040054.htm
Osnabrück, Univ., Diss., 2006.
Fachbereich: Rechtswissenschaften
Betreuer: Prof. Dr. Willi Erdmann
Gutachter:Prof. Dr. Willi Erdmann, Prof. Dr. Hans-Jürgen Ahrens
Thesis.pdf Size: 1359347 [2006.11.14/02:07:53]
http://elib.ub.uni-osnabrueck.de/publications/diss/E-Diss610_thesis.pdf
DNB: 19 BK: 86.28
Keywords: Abstract, Inhaltsmitteilung, §§ 23, 24 UrhG, verkürzte Darstellung, Substitutionswirkung, Beteiligungsgrundsatz, abhängige Bearbeitung
Abstract: Abstracts gewinnen als Mittel zur Bewältigung der Informationsflut zunehmend an Bedeutung. Die verkürzte Darstellung eines Originalwerkes in Form eines abstracts – aber auch im Rahmen von Opernführern, Unterrichtshilfen und Rezensionen – kann problematisch sein, wenn das Originalwerk urheberrechtlich geschützt ist und der Urheber der Anfertigung der verkürzten Darstellung nicht zugestimmt hat. Die Arbeit widmet sich der Frage, in welchem Umfang solche verkürzten Darstellungen in urheberrechtlicher Hinsicht zulässig sind. Es wird untersucht, ob verkürzte Darstellungen als abhängige Bearbeitungen im Sinne des § 23 UrhG zu werten sind oder ob eine freie Benutzung nach § 24 UrhG in Betracht kommt. Im Rahmen dieser Abgrenzung ist die dem § 12 Abs. 2 UrhG zugrundeliegende Wertung der Gemeinfreiheit bloßer Inhaltsmitteilungen zu berücksichtigen. Eine abhängige Bearbeitung im Sinne des § 23 UrhG liegt in jedem Fall dann vor, wenn eine verkürzte Darstellung zur Substitution des Originalwerkes geeignet ist. Dies ergibt sich in dogmatischer Hinsicht unmittelbar aus dem in § 11 Satz 2 UrhG verankerten Beteiligungsgrundsatz. Zur Abgrenzung zwischen zulässiger (gemeinfreier) Inhaltsmitteilung im Sinne des § 12 Abs. 2 UrhG und (ohne die Zustimmung des Urhebers) unzulässiger abhängiger Bearbeitung im Sinne des § 23 UrhG wird ein Katalog objektiver Kriterien entwickelt, durch den die Verwertungsinteressen des Urhebers mit den Informationsinteressen der Allgemeinheit in Einklang gebracht werden können.
--
Die Problematik hat natürlich auch Bedeutung für die archivische Verzeichnung, denn bei unveröffentlichten Werken könnte ein ausführliches Regest als unerlaubte Inhaltsmitteilung angesehen werden. Sie ist vor der Veröffentlichung dem Urheber vorbehalten.
Es ist erfreulich, dass die gründliche Aufarbeitung der urheberrechtlichen Problematik unautorisierter "verkürzter darstellungen" online vorliegt.
Zur Rechtsprechung über die Zulässigkeit der Anfertigung von Abstracts ohne Zustimmung des Urhebers:
http://log.netbib.de/archives/2005/09/16/abstracts-und-urheberrecht-2/
http://www.jurpc.de/rechtspr/20040054.htm
KlausGraf - am Montag, 26. Februar 2007, 01:08 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.paperofrecord.com/
The project has the aim to build the largest library of searchable newspapers in the world. It' now FREE. You can search after a short registration (password is mailed) over 21 million images.
Unfortunately there is no browsing option and no cross-newspaper search.
I have searched the "Cambridge Tribune" (Maryland): "We found 37 hits for hitler on 21 pages between 1/1/1937 and 12/31/1942." Either the search is bad or the German politician was not estimated very important in Maryland ...
The project has the aim to build the largest library of searchable newspapers in the world. It' now FREE. You can search after a short registration (password is mailed) over 21 million images.
Unfortunately there is no browsing option and no cross-newspaper search.
I have searched the "Cambridge Tribune" (Maryland): "We found 37 hits for hitler on 21 pages between 1/1/1937 and 12/31/1942." Either the search is bad or the German politician was not estimated very important in Maryland ...
KlausGraf - am Montag, 26. Februar 2007, 00:51 - Rubrik: English Corner
Zwei wenig umfangreiche sind bereits digitalisiert, weitere sollen folgen:
http://www3.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=1238

Hübsch ist natürlich Rudolf von Eros, >Weltchronik<.
http://www3.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=1238

Hübsch ist natürlich Rudolf von Eros, >Weltchronik<.
KlausGraf - am Sonntag, 25. Februar 2007, 23:35 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 25. Februar 2007, 19:06 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus der Archivliste: Sehr geehrte Damen und Herren,
gerne unterstütze ich die Initiative meines Kollegen Huening. Ich habe seinem Aufruf eine Darstellung aus der Benutzerperspektive beigefügt. Bitte geben Sie zumindest den Aufruf in Ihrem Wirkungskreis weiter. Es ist nicht mehr viel Zeit.
Freundliche Grüße
Gerd Simon
Burgholzweg 52
D-72070 Tübingen
Tel: (49)(0)7071-408828
Fax: (49(0)7071-440161
Internet: http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon
----- Original Message ----- From: "Dr. Ludger Huening"
To:
Sent: Wednesday, January 24, 2007 3:02 PM
Subject: Information ueber geplante Aenderung des Urheberrechts
Sehr geehrter Kunde,
Sie haben in der letzten Zeit die Kopie eines Zeitschriftenaufsatzes
per E-Mail über uns erhalten.
Möchten Sie zukünftig 30 Euro für die elektronische Lieferung eines
Zeitschriftenartikels zahlen?
Diese Gefahr ist Realität!
Die Gesetzesvorlage zur Änderung des Urheberrechts sieht vor, dass
eine elektronische Lieferung durch Bibliotheken nur noch dann erlaubt
ist, wenn die Verlage nicht selbst über das Internet liefern können.
Und diese Angebote haben es in sich: Im "Pay-per-view-Verfahren"
können Sie zwar auf Artikel sofort zugreifen. Allerdings wird Ihre
Kreditkarte in der Regel dabei mit 20 bis 30 Euro pro Artikel
belastet!
Wenn Sie diese Gesetzesänderung nicht wollen, drucken
Sie das beigefügte Schreiben aus und senden es an Ihre/n
Bundestagsabgeordnete/n! Zögern Sie nicht! Nur noch durch massive
Proteste kann die Literaturversorgung durch Bibliotheken in der
bisherigen Form aufrechterhalten werden.
Hier finden Sie Ihre/n Bundestagsabgeordnete/n:
http://www.bundestag.de/mdb/wkmap/index.html
Wir stehen auf Ihrer Seite - für eine freie und kostengünstige
Literaturversorgung. Für Wissenschaft, Forschung, Lehre und Studium!
Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.ub.uni-tuebingen.de/pro/aktuell/urhg.php
Ihre Universitätsbibliothek Tübingen
--------------------------------------------------------------------------
Beispiel für ein Schreiben an Ihren Bundestagsabgeordneten
--------------------------------------------------------------------------
Absender:
Datum:
An:
Sehr geehrte/r Frau/Herr ...
für meine wissenschaftliche Arbeit benötige ich regelmäßig Kopien von Artikeln aus Zeitschriften oder Büchern. Meine Bibliothek bietet einen Lieferdienst, der aus den Originalzeitschriften und Büchern der Bibliothek die Artikel für mich elektronisch einliest und per E-Mail an mich versendet. Die Kosten dafür liegen bei 5 Euro pro Artikel. Darin enthalten ist eine Urheberabgabe, die an Verlage und Autoren abgeführt wird.
Durch die vorgesehene Formulierung in § 53a Urheberrechtsgesetz (UrhG) soll eine elektronische Lieferung zukünftig nur noch dann möglich sein, wenn der Verlag nicht selbst seine Artikel im Internet gegen Kosten zum Abruf anbietet. Dabei entstünden mir Kosten von bis zu 30 Euro pro Artikel. Dieses Geld erhält allein der Verlag, der Autor geht leer aus.
Das ist für mich wirtschaftlich nicht tragbar. Es wird dazu führen, dass mir Informationen aus Zeitschriften und Büchern zum großen Teil nicht mehr zur Verfügung stehen werden, da ich mir einen solch teuren Zugriff nicht leisten kann. Auch der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zur Formulierung von § 53a UrhG gefordert, dass diese neue wissenschaftsfeindliche Bedingung entfällt. § 53a soll wie folgt lauten:
"Die Vervielfältigung und Übermittlung in sonstiger elektronischer Form ist ausschließlich als graphische Datei zulässig."
Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass § 53a UrhG so wie vom Bundesrat gefordert formuliert wird. Damit ist der Zugang zu wissenschaftlicher Information auch zukünftig bezahlbar und sichergestellt.
Mit freundlichen Grüßen
Gerd Simon
Burgholzweg 52
D-72070 Tübingen
Tel: (49)(0)7071-408828
Fax: (49(0)7071-440161
Internet: http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon
Eine Stellungnahme aus der Benutzperspektive
Als 1990 das Internet für Wissenschaftler zugängig gemacht wurde, köderte man diese mit dem Versprechen, in absehbarer Zeit würde diese zweifellos revolutionäre Erfindung auch alle Bücher und Zeitschriften in Reproduktionen kostenlos auf dem Bildschirm des PCs lesen können. Heute sind wir immer noch weit von einer Einlösung dieses Versprechens entfernt. Da bis heute nicht vorstellbar ist, wie das Einlesen bzw. Scannen von Texten ohne Menschen möglich ist, scheint das auch nach wie vor illusorisch. Die Bibliotheken bieten aber inzwischen einen kostengünstigen Service an, einzelne Texte auf Antrag per E-mail zu versenden. Das ist ein erheblicher Zeitgewinn für die Wissenschaftler.
Wenn es nach den Plänen der Politik geht, die vermutlich durch die Verleger-Lobby dazu angestiftet wurde, wird das in Zukunft mehr als 400% teurer [.].
Ein Blick in die Geschichte zeigt uns zumindest wie man in der Vergangenheit mit vergleichbaren Problemen umging. Als Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts infolge der Inflation insbesondere ausländische Bücher und Zeitschriften unerschwinglich wurden, griff man die Idee des kostenfreien auswärtigen Leihverkehrs auf, um die vorherzusehende Wirkung nicht zuletzt eines erheblichen Zeitverlusts wenigstens abzumildern. Die >Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft<, die heute >DFG< heißt, war ein weiterer Versuch, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Wenn die Wissenschaftsforschung heute konstatiert, dass der Niedergang der deutschen Wissenschaft genau in dieser Zeit einsetzte, so bestand trotzdem eine der gravierendsten Ursachen in den Hindernissen und Schwierigkeiten der Informationsbeschaffung. Im 3. Reich hatte übrigens die Zensur die gleiche Wirkung. Weil die Zensurbehörden einfach überlastet waren und die neuesten Informationen z.T. erst nach Jahren - wenn überhaupt - die Forscher erreichten, wurde die deutsche Wissenschaft früher oder später hoffnungslos abgehängt.
Da sich auch sonst ökonomische und politische Prozesse selten als wissenschaftsfreundlich erwiesen, hat man deren Folgen in der Vergangenheit immer wieder durch Begünstigungen für die Wissenschaft einzudämmen versucht, so z.B. im Archivgesetz oder im Vereinsgesetz. Damit ist keineswegs gesagt, dass diese Gesetze nichts zu wünschen übrig ließen. Es ist aber überhaupt nicht einzusehen, warum im Urhebergesetz für die Wissenschaft nicht entsprechende (möglichst bessere) Regelungen möglich sind. Die wissenschaftlichen Bibliotheken haben
seit Jahren einen Service eingerichtet, der für die Wissenschaftler nicht nur eine Geld-, sondern vor allem eine deutliche Zeitersparnis bedeutet. Eine Kostenexplosion wie sie die geplante Urhebergesetznovellierung zur Folge hätte, wirft die Wissenschaftler in steinzeitliche Verhältnisse zurück. Ihnen bleibt dann nur die Alternative:
- Entweder sie fahren wieder von der Wirkungsstätte zur Bibliothek, nehmen dort anderen den Parkplatz weg, wenn sie überhaupt einen finden, ermitteln dort das Buch bzw. die Zeitschrift, aus dem bzw. der sie eine Information benötigen - immer vorausgesetzt, die Bibliothek verfügt über diesen Informationsträger -, exzerpieren oder - was natürlich auch einiges kostet - kopieren diese und fahren wieder zurück. Bei mir - und ich denke, das wäre im Schnitt so - wäre das ein Zeitverlust von mehr als 1 Stunde pro Text. Wenn ich den auswärtigen Leihverkehr bemühen müsste, der seit einigen Dezennien auch eine Schutzgebühr bedeutet, heißt das zusätzlich im Schnitt eine erhebliche Wartezeit.
- Oder sie lassen sich auf die geplante Kostenexplosion ein, dann müssen sie nach Instanzen oder Sponsoren suchen, die ihnen das bezahlen. Vor einem Jahr weiterer Wartezeit - wenn überhaupt - verspricht diese bürokratieträchtige Einwerbung gesonderter Forschungsgelder keinen Erfolg.
- Oder sie hören überhaupt auf zu forschen. Für viele Einzelforscher dürfte das in der Tat das Ende ihrer Forschung bedeuten. Nur nebenbei bemerkt sei, dass Wissenschaftler auch als Autor zu 99% nichts vom neuen Urhebergesetz haben werden. Sie oder ihre geldgebundenen Instanzen werden ja von den Verlagen, damit die Forschungsergebnisse überhaupt publiziert werden können, inzwischen nahezu ausnahmslos dafür zur Kasse gebeten. Vorteile hätte das allein für die Verlage, allerdings nur, solange sich die Wissenschaftler deren Abzockerei (bei den Käufern und den Autoren) gefallen lassen und nicht kollektiv dazu übergehen, kostenlos im Internet zu publizieren. Da die wissenschaftlichen Verlage es mit einer Kundschaft zu tun haben, die zu über der Hälfte aus Bibliotheken bestehen, und ihre Preise entsprechend hoch veranschlagen, wäre zu prüfen, ob die Novellierung des Urhebergesetzes die Verlage nicht dazu einlädt, abermals doppelt abzukassieren.
Tübingen, 1.2.2007
Gerd Simon
(Linguist und Wissenschaftshistoriker, Vorsitzender der
Gesellschaft für interdisziplinäre Forschung Tübingen)
gerne unterstütze ich die Initiative meines Kollegen Huening. Ich habe seinem Aufruf eine Darstellung aus der Benutzerperspektive beigefügt. Bitte geben Sie zumindest den Aufruf in Ihrem Wirkungskreis weiter. Es ist nicht mehr viel Zeit.
Freundliche Grüße
Gerd Simon
Burgholzweg 52
D-72070 Tübingen
Tel: (49)(0)7071-408828
Fax: (49(0)7071-440161
Internet: http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon
----- Original Message ----- From: "Dr. Ludger Huening"
To:
Sent: Wednesday, January 24, 2007 3:02 PM
Subject: Information ueber geplante Aenderung des Urheberrechts
Sehr geehrter Kunde,
Sie haben in der letzten Zeit die Kopie eines Zeitschriftenaufsatzes
per E-Mail über uns erhalten.
Möchten Sie zukünftig 30 Euro für die elektronische Lieferung eines
Zeitschriftenartikels zahlen?
Diese Gefahr ist Realität!
Die Gesetzesvorlage zur Änderung des Urheberrechts sieht vor, dass
eine elektronische Lieferung durch Bibliotheken nur noch dann erlaubt
ist, wenn die Verlage nicht selbst über das Internet liefern können.
Und diese Angebote haben es in sich: Im "Pay-per-view-Verfahren"
können Sie zwar auf Artikel sofort zugreifen. Allerdings wird Ihre
Kreditkarte in der Regel dabei mit 20 bis 30 Euro pro Artikel
belastet!
Wenn Sie diese Gesetzesänderung nicht wollen, drucken
Sie das beigefügte Schreiben aus und senden es an Ihre/n
Bundestagsabgeordnete/n! Zögern Sie nicht! Nur noch durch massive
Proteste kann die Literaturversorgung durch Bibliotheken in der
bisherigen Form aufrechterhalten werden.
Hier finden Sie Ihre/n Bundestagsabgeordnete/n:
http://www.bundestag.de/mdb/wkmap/index.html
Wir stehen auf Ihrer Seite - für eine freie und kostengünstige
Literaturversorgung. Für Wissenschaft, Forschung, Lehre und Studium!
Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.ub.uni-tuebingen.de/pro/aktuell/urhg.php
Ihre Universitätsbibliothek Tübingen
--------------------------------------------------------------------------
Beispiel für ein Schreiben an Ihren Bundestagsabgeordneten
--------------------------------------------------------------------------
Absender:
Datum:
An:
Sehr geehrte/r Frau/Herr ...
für meine wissenschaftliche Arbeit benötige ich regelmäßig Kopien von Artikeln aus Zeitschriften oder Büchern. Meine Bibliothek bietet einen Lieferdienst, der aus den Originalzeitschriften und Büchern der Bibliothek die Artikel für mich elektronisch einliest und per E-Mail an mich versendet. Die Kosten dafür liegen bei 5 Euro pro Artikel. Darin enthalten ist eine Urheberabgabe, die an Verlage und Autoren abgeführt wird.
Durch die vorgesehene Formulierung in § 53a Urheberrechtsgesetz (UrhG) soll eine elektronische Lieferung zukünftig nur noch dann möglich sein, wenn der Verlag nicht selbst seine Artikel im Internet gegen Kosten zum Abruf anbietet. Dabei entstünden mir Kosten von bis zu 30 Euro pro Artikel. Dieses Geld erhält allein der Verlag, der Autor geht leer aus.
Das ist für mich wirtschaftlich nicht tragbar. Es wird dazu führen, dass mir Informationen aus Zeitschriften und Büchern zum großen Teil nicht mehr zur Verfügung stehen werden, da ich mir einen solch teuren Zugriff nicht leisten kann. Auch der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zur Formulierung von § 53a UrhG gefordert, dass diese neue wissenschaftsfeindliche Bedingung entfällt. § 53a soll wie folgt lauten:
"Die Vervielfältigung und Übermittlung in sonstiger elektronischer Form ist ausschließlich als graphische Datei zulässig."
Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass § 53a UrhG so wie vom Bundesrat gefordert formuliert wird. Damit ist der Zugang zu wissenschaftlicher Information auch zukünftig bezahlbar und sichergestellt.
Mit freundlichen Grüßen
Gerd Simon
Burgholzweg 52
D-72070 Tübingen
Tel: (49)(0)7071-408828
Fax: (49(0)7071-440161
Internet: http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon
Eine Stellungnahme aus der Benutzperspektive
Als 1990 das Internet für Wissenschaftler zugängig gemacht wurde, köderte man diese mit dem Versprechen, in absehbarer Zeit würde diese zweifellos revolutionäre Erfindung auch alle Bücher und Zeitschriften in Reproduktionen kostenlos auf dem Bildschirm des PCs lesen können. Heute sind wir immer noch weit von einer Einlösung dieses Versprechens entfernt. Da bis heute nicht vorstellbar ist, wie das Einlesen bzw. Scannen von Texten ohne Menschen möglich ist, scheint das auch nach wie vor illusorisch. Die Bibliotheken bieten aber inzwischen einen kostengünstigen Service an, einzelne Texte auf Antrag per E-mail zu versenden. Das ist ein erheblicher Zeitgewinn für die Wissenschaftler.
Wenn es nach den Plänen der Politik geht, die vermutlich durch die Verleger-Lobby dazu angestiftet wurde, wird das in Zukunft mehr als 400% teurer [.].
Ein Blick in die Geschichte zeigt uns zumindest wie man in der Vergangenheit mit vergleichbaren Problemen umging. Als Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts infolge der Inflation insbesondere ausländische Bücher und Zeitschriften unerschwinglich wurden, griff man die Idee des kostenfreien auswärtigen Leihverkehrs auf, um die vorherzusehende Wirkung nicht zuletzt eines erheblichen Zeitverlusts wenigstens abzumildern. Die >Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft<, die heute >DFG< heißt, war ein weiterer Versuch, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Wenn die Wissenschaftsforschung heute konstatiert, dass der Niedergang der deutschen Wissenschaft genau in dieser Zeit einsetzte, so bestand trotzdem eine der gravierendsten Ursachen in den Hindernissen und Schwierigkeiten der Informationsbeschaffung. Im 3. Reich hatte übrigens die Zensur die gleiche Wirkung. Weil die Zensurbehörden einfach überlastet waren und die neuesten Informationen z.T. erst nach Jahren - wenn überhaupt - die Forscher erreichten, wurde die deutsche Wissenschaft früher oder später hoffnungslos abgehängt.
Da sich auch sonst ökonomische und politische Prozesse selten als wissenschaftsfreundlich erwiesen, hat man deren Folgen in der Vergangenheit immer wieder durch Begünstigungen für die Wissenschaft einzudämmen versucht, so z.B. im Archivgesetz oder im Vereinsgesetz. Damit ist keineswegs gesagt, dass diese Gesetze nichts zu wünschen übrig ließen. Es ist aber überhaupt nicht einzusehen, warum im Urhebergesetz für die Wissenschaft nicht entsprechende (möglichst bessere) Regelungen möglich sind. Die wissenschaftlichen Bibliotheken haben
seit Jahren einen Service eingerichtet, der für die Wissenschaftler nicht nur eine Geld-, sondern vor allem eine deutliche Zeitersparnis bedeutet. Eine Kostenexplosion wie sie die geplante Urhebergesetznovellierung zur Folge hätte, wirft die Wissenschaftler in steinzeitliche Verhältnisse zurück. Ihnen bleibt dann nur die Alternative:
- Entweder sie fahren wieder von der Wirkungsstätte zur Bibliothek, nehmen dort anderen den Parkplatz weg, wenn sie überhaupt einen finden, ermitteln dort das Buch bzw. die Zeitschrift, aus dem bzw. der sie eine Information benötigen - immer vorausgesetzt, die Bibliothek verfügt über diesen Informationsträger -, exzerpieren oder - was natürlich auch einiges kostet - kopieren diese und fahren wieder zurück. Bei mir - und ich denke, das wäre im Schnitt so - wäre das ein Zeitverlust von mehr als 1 Stunde pro Text. Wenn ich den auswärtigen Leihverkehr bemühen müsste, der seit einigen Dezennien auch eine Schutzgebühr bedeutet, heißt das zusätzlich im Schnitt eine erhebliche Wartezeit.
- Oder sie lassen sich auf die geplante Kostenexplosion ein, dann müssen sie nach Instanzen oder Sponsoren suchen, die ihnen das bezahlen. Vor einem Jahr weiterer Wartezeit - wenn überhaupt - verspricht diese bürokratieträchtige Einwerbung gesonderter Forschungsgelder keinen Erfolg.
- Oder sie hören überhaupt auf zu forschen. Für viele Einzelforscher dürfte das in der Tat das Ende ihrer Forschung bedeuten. Nur nebenbei bemerkt sei, dass Wissenschaftler auch als Autor zu 99% nichts vom neuen Urhebergesetz haben werden. Sie oder ihre geldgebundenen Instanzen werden ja von den Verlagen, damit die Forschungsergebnisse überhaupt publiziert werden können, inzwischen nahezu ausnahmslos dafür zur Kasse gebeten. Vorteile hätte das allein für die Verlage, allerdings nur, solange sich die Wissenschaftler deren Abzockerei (bei den Käufern und den Autoren) gefallen lassen und nicht kollektiv dazu übergehen, kostenlos im Internet zu publizieren. Da die wissenschaftlichen Verlage es mit einer Kundschaft zu tun haben, die zu über der Hälfte aus Bibliotheken bestehen, und ihre Preise entsprechend hoch veranschlagen, wäre zu prüfen, ob die Novellierung des Urhebergesetzes die Verlage nicht dazu einlädt, abermals doppelt abzukassieren.
Tübingen, 1.2.2007
Gerd Simon
(Linguist und Wissenschaftshistoriker, Vorsitzender der
Gesellschaft für interdisziplinäre Forschung Tübingen)
KlausGraf - am Sonntag, 25. Februar 2007, 13:07 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://vergeblich.de/?p=13
Ein kundiger Weblogbeitrag zum Thema Eichstätt. Zitat:
Typische Begründungen für die Aussortierung sind »Wertlosigkeit« und das Vorhandensein von »Dubletten«. Es ist fraglich, ob Bibliothekare, die solche Begründungen abgeben, einen Schimmer von kulturhistorischer Forschung haben. Dort geht es nicht nur um Inhalte von christlicher Gebrauchsliteratur (Traktätchen oder Blumenkunde), sondern auch und gerade um Spuren von Personen und Orten, von Netzwerken, von Transfers. Diese Spuren lassen sich nun nicht mehr nachvollziehen.
Ein kundiger Weblogbeitrag zum Thema Eichstätt. Zitat:
Typische Begründungen für die Aussortierung sind »Wertlosigkeit« und das Vorhandensein von »Dubletten«. Es ist fraglich, ob Bibliothekare, die solche Begründungen abgeben, einen Schimmer von kulturhistorischer Forschung haben. Dort geht es nicht nur um Inhalte von christlicher Gebrauchsliteratur (Traktätchen oder Blumenkunde), sondern auch und gerade um Spuren von Personen und Orten, von Netzwerken, von Transfers. Diese Spuren lassen sich nun nicht mehr nachvollziehen.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://books.google.com/books?id=JDMfAAAAMAAJ
Genealogen sollten alles daran setzen, dieses alte Standardwerk mittels eines US-Proxy herunterzuladen. Das schaffen auch technisch weniger versierte Internetnutzer. Mit http://www.proxyguy.com habe ich gute Erfahrungen gemacht. Schön wäre es natürlich, wenn die genealogischen Vereine denjenigen, die am Proxy scheitern, das PDF zur Verfügung stellen könnten ("Kultur des Austauschs").
UPDATE: Das Buch liegt auf Wikimedia Commons (siehe Kommentar):
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Heydenreich_Genalogie_1.djvu
Genealogen sollten alles daran setzen, dieses alte Standardwerk mittels eines US-Proxy herunterzuladen. Das schaffen auch technisch weniger versierte Internetnutzer. Mit http://www.proxyguy.com habe ich gute Erfahrungen gemacht. Schön wäre es natürlich, wenn die genealogischen Vereine denjenigen, die am Proxy scheitern, das PDF zur Verfügung stellen könnten ("Kultur des Austauschs").
UPDATE: Das Buch liegt auf Wikimedia Commons (siehe Kommentar):
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Heydenreich_Genalogie_1.djvu
KlausGraf - am Sonntag, 25. Februar 2007, 02:49 - Rubrik: Genealogie
http://oaister.umdl.umich.edu/
Nachdem seit neuestem die großen Sammlungen des Internetarchivs und des französischen medizinhistorischen Digitalisierungsprojekts Medic@ im OAIster suchbar sind, findet man nun auch Nachweise, welche Schriften von Sudhoff bereits online sind.
Diverse polnische DLibra-Bibliotheken mit Altbeständen sind ebenfalls über OAIster recherchierbar, desgleichen das Münchner Digitalisierungszentrum. (Mit munchener und icon findet man derzeit 63 digitalisierte Münchner Bilderhandschriften!).
Hinweisen möchte ich auf das in Polen digitalisierte Wappenbuch der schlesischen Städte (gefunden über die Suche nach:wappenbuch):
http://www.sbc.org.pl/Content/1027/%21wappen.djvu
Nachdem seit neuestem die großen Sammlungen des Internetarchivs und des französischen medizinhistorischen Digitalisierungsprojekts Medic@ im OAIster suchbar sind, findet man nun auch Nachweise, welche Schriften von Sudhoff bereits online sind.
Diverse polnische DLibra-Bibliotheken mit Altbeständen sind ebenfalls über OAIster recherchierbar, desgleichen das Münchner Digitalisierungszentrum. (Mit munchener und icon findet man derzeit 63 digitalisierte Münchner Bilderhandschriften!).
Hinweisen möchte ich auf das in Polen digitalisierte Wappenbuch der schlesischen Städte (gefunden über die Suche nach:wappenbuch):
http://www.sbc.org.pl/Content/1027/%21wappen.djvu
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=6798
Ich melde dies mehr pflichtgemäß denn aus Neigung, denn beim lieben Kurskollegen Rehm, der bereits die Nettigkeit besaß mich in einer Mail zu siezen, ist ARCHIVALIA anscheinend in Ungnade gefallen. Da das Landesarchiv alles daran setzt, mich bei meinen Recherchen über die badischen Kulturgüter zu schikanieren, wundert mich das nicht.
Ich melde dies mehr pflichtgemäß denn aus Neigung, denn beim lieben Kurskollegen Rehm, der bereits die Nettigkeit besaß mich in einer Mail zu siezen, ist ARCHIVALIA anscheinend in Ungnade gefallen. Da das Landesarchiv alles daran setzt, mich bei meinen Recherchen über die badischen Kulturgüter zu schikanieren, wundert mich das nicht.
KlausGraf - am Sonntag, 25. Februar 2007, 02:05 - Rubrik: Archivpaedagogik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Da möchte man doch die Fidel rausholen (alt sei sie), wenn man ein interessantes neues Geschichtsblog entdeckt, das uns noch dazu in der Blogroll hat:
http://referendar.wordpress.com/
http://referendar.wordpress.com/
KlausGraf - am Sonntag, 25. Februar 2007, 01:51 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 25. Februar 2007, 01:49 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.golem.de/0702/50722.html
Wir zitieren dazu die Amtliche Begründung zum Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965:
Wie jedes absolute Recht, ist auch das Urheberrecht ein sozialgebundenes Recht, das gewissen Schranken im Interesse der Gemeinschaft unterliegt. Die sachgemäße Abgrenzung der Rechte des Urhebers gegenüber den berechtigten Interessen der Allgemeinheit (z. B. an dem ungehinderten Zugang zu Kulturgütern, an der Freiheit des geistigen Schaffens und an der freien Berichterstattung über Tagesereignisse) ist ein Kernproblem der Urheberrechtsreform und steht im Vordergrund der Diskussion. [...]
Zu den Schranken, denen das Urheberrecht im Interesse der Allgemeinheit unterliegt, gehört auch die Befristung des Urheberrechtsschutzes, die wie im geltenden Recht und in Übereinstimmung mit Artikel 7 Abs. 1 der Brüsseler Fassung der Berner Übereinkunft auf die Dauer von 50 Jahren nach dem Tode des Urhebers bemessen ist (§§ 67 ff.). Diese Schutzfrist ist unter Hinweis auf die unbegrenzte Dauer des Sacheigentums wiederholt als ungerechtfertigte Beschränkung des Urheberrechts angegriffen worden. Der Fortfall der Schutzfrist würde jedoch dem Wesen des Urheberrechts widersprechen, weil Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst anders als körperliche Gegenstände ihrer Natur nach Mitteilungsgut, sind und nach einer die geistigen und wirtschaftlichen Interessen des Urhebers und seiner Erben angemessen berücksichtigenden Frist der Allgemeinheit frei zugänglich sein müssen. Die Befristung des Urheberrechtsschutzes entspricht demgemäß der Auffassung fast aller Kulturstaaten. Der Fortfall der Schutzfrist würde zudem zu erheblichen praktischen Schwierigkeiten führen, da schon nach wenigen Generationen die verfügungsberechtigten Erben des Urhebers nicht mehr ermittelt werden könnten.
Wir zitieren dazu die Amtliche Begründung zum Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965:
Wie jedes absolute Recht, ist auch das Urheberrecht ein sozialgebundenes Recht, das gewissen Schranken im Interesse der Gemeinschaft unterliegt. Die sachgemäße Abgrenzung der Rechte des Urhebers gegenüber den berechtigten Interessen der Allgemeinheit (z. B. an dem ungehinderten Zugang zu Kulturgütern, an der Freiheit des geistigen Schaffens und an der freien Berichterstattung über Tagesereignisse) ist ein Kernproblem der Urheberrechtsreform und steht im Vordergrund der Diskussion. [...]
Zu den Schranken, denen das Urheberrecht im Interesse der Allgemeinheit unterliegt, gehört auch die Befristung des Urheberrechtsschutzes, die wie im geltenden Recht und in Übereinstimmung mit Artikel 7 Abs. 1 der Brüsseler Fassung der Berner Übereinkunft auf die Dauer von 50 Jahren nach dem Tode des Urhebers bemessen ist (§§ 67 ff.). Diese Schutzfrist ist unter Hinweis auf die unbegrenzte Dauer des Sacheigentums wiederholt als ungerechtfertigte Beschränkung des Urheberrechts angegriffen worden. Der Fortfall der Schutzfrist würde jedoch dem Wesen des Urheberrechts widersprechen, weil Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst anders als körperliche Gegenstände ihrer Natur nach Mitteilungsgut, sind und nach einer die geistigen und wirtschaftlichen Interessen des Urhebers und seiner Erben angemessen berücksichtigenden Frist der Allgemeinheit frei zugänglich sein müssen. Die Befristung des Urheberrechtsschutzes entspricht demgemäß der Auffassung fast aller Kulturstaaten. Der Fortfall der Schutzfrist würde zudem zu erheblichen praktischen Schwierigkeiten führen, da schon nach wenigen Generationen die verfügungsberechtigten Erben des Urhebers nicht mehr ermittelt werden könnten.
KlausGraf - am Sonntag, 25. Februar 2007, 01:38 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.opus-bayern.de/uni-passau/volltexte/2007/84/
Ernst, Marcus D.
Der Bayerische Adel und das Moderne Bayern. Die Gesetzgebung und Debatte über die persönlichen Privilegien des in Bayern immatrikulierten Adels (1808-1818)
pdf-Format:
Dokument 1.pdf (4,049 KB)
Kurzfassung in deutsch
Die Gesetzgebung und Debatten 1808-1818 über das Adelsrecht im engeren Sinn sind Gegenstand dieser Arbeit. Dabei werden, mit dem Jahre 1808 einsetzend und fortdauernd bis zur Verfassung im Jahre 1818, nicht nur die Entwicklung der materiellen Gesetze untersucht, sondern auch die Herkunft, Tätigkeit, sowie die Stimmung und das Abstimmungsverhalten der mit der Adelsrechtsgesetzgebung befassten Mitglieder und Referenten der einschlägigen Gremien (die Ministerialkonferenz im Jahre 1808; der Geheime Rat samt seiner Gremien in den Jahren 1808 bis 1812; die Verfassungskommission von 1814/15; die Lehen- und Hoheitssektion im Jahre 1816, sowie die Ministerialkonferenz von 1818). Unter Adelsrecht im engeren Sinne waren die persönlichen Rechte und Vorrechte der Adeligen, insbesondere die Frage des Erwerbs und Verlusts des Adels, sowie die einzelnen persönlichen Adelsprivilegien zu verstehen. Von letzteren werden das Recht auf Titel- und Wappenführung samt Rechtsschutz, das Recht auf befreiten Gerichtsstand, das Kadettenprivileg, das Recht der Siegelmäßigkeit und die politischen Beteiligungsrechte in der Ständeversammlung besprochen. Das Recht zur politischen Partizipation in der Kammer der Reichsräte werden ebenso behandelt, wie etwas ausführlicher die Vertretung der Adeligen in der Kammer der Abgeordneten. Außerdem wird die Diskussion über die grundsätzliche Einräumung der Privilegien bezüglich der Fideikommisse und der gutsherrlichen Gerichtsbarkeit untersucht. Die Debatten zu den Spezialedikten, wie über das Fideikommissrecht, die Patrimonialgerichtsbarkeit und die Grundherrschaft, werden insoweit herangezogen, als sie die persönlichen Privilegien des Adels betrafen. Die Arbeit gliedert sich in zwei Abschnitte, wobei der erste in chronologischer Folge die Entwicklung der zentralen adelsrelevanten Gesetzgebung von 1803 beginnend über 1808/11 bis 1818 aufzeigt. Im zweiten Abschnitt wird das Adelsedikt vom 26. Mai 1818 entsprechend seines Aufbaus (Erwerb des Adels, einzelne Privilegien, Verlust des Adels) besprochen. Im Anhang finden sich die ausführliche Biogramme aller beteiligten 50 Personen (inkl. Familienverhältnisse, Ausbildung, Beruf, Ämter, Adelserhebungen und verwandtschaftlicher und beruflicher Verbindungen der Beteiligten). Die Arbeit zeigt, dass Montgelas keineswegs Adelsgegner war, ebenso wenig wie Verfechter des revolutionären Gleichheitsgedankens, vielmehr war die Nivellierung des Adels nötig, um einen modernen, effizienten Zentralstaat zu schaffen. Montgelas hatte großes Gewicht in der Gesetzgebung, doch waren viele -auch adelige- Amtsträger beteiligt, die zumeist ihrem Rang und Stand entsprechend handelten, wobei einzelne Positionszuweisungen schwierig sind. Die Adelsgesetzgebung erfuhr nach einer radikalen Reform im Jahre 1808 mit dem Adelsedikt von 1818 einen lang dauernden Kompromiss, der für alle Beteiligten angemessen war. Von einer konservativen Revision der Reform von 1808 kann keine Rede sein, vielmehr erkannten die Entscheidungsträger, dass zum einen sich der Staat selbst schadet, wenn er die soziale und gleichzeitig funktionale Elite einebnet, zum anderen, dass die Adelsgesetzgebung von 1808-1811 in der Lebenswirklichkeit nicht funktionierte.
Ernst, Marcus D.
Der Bayerische Adel und das Moderne Bayern. Die Gesetzgebung und Debatte über die persönlichen Privilegien des in Bayern immatrikulierten Adels (1808-1818)
pdf-Format:
Dokument 1.pdf (4,049 KB)
Kurzfassung in deutsch
Die Gesetzgebung und Debatten 1808-1818 über das Adelsrecht im engeren Sinn sind Gegenstand dieser Arbeit. Dabei werden, mit dem Jahre 1808 einsetzend und fortdauernd bis zur Verfassung im Jahre 1818, nicht nur die Entwicklung der materiellen Gesetze untersucht, sondern auch die Herkunft, Tätigkeit, sowie die Stimmung und das Abstimmungsverhalten der mit der Adelsrechtsgesetzgebung befassten Mitglieder und Referenten der einschlägigen Gremien (die Ministerialkonferenz im Jahre 1808; der Geheime Rat samt seiner Gremien in den Jahren 1808 bis 1812; die Verfassungskommission von 1814/15; die Lehen- und Hoheitssektion im Jahre 1816, sowie die Ministerialkonferenz von 1818). Unter Adelsrecht im engeren Sinne waren die persönlichen Rechte und Vorrechte der Adeligen, insbesondere die Frage des Erwerbs und Verlusts des Adels, sowie die einzelnen persönlichen Adelsprivilegien zu verstehen. Von letzteren werden das Recht auf Titel- und Wappenführung samt Rechtsschutz, das Recht auf befreiten Gerichtsstand, das Kadettenprivileg, das Recht der Siegelmäßigkeit und die politischen Beteiligungsrechte in der Ständeversammlung besprochen. Das Recht zur politischen Partizipation in der Kammer der Reichsräte werden ebenso behandelt, wie etwas ausführlicher die Vertretung der Adeligen in der Kammer der Abgeordneten. Außerdem wird die Diskussion über die grundsätzliche Einräumung der Privilegien bezüglich der Fideikommisse und der gutsherrlichen Gerichtsbarkeit untersucht. Die Debatten zu den Spezialedikten, wie über das Fideikommissrecht, die Patrimonialgerichtsbarkeit und die Grundherrschaft, werden insoweit herangezogen, als sie die persönlichen Privilegien des Adels betrafen. Die Arbeit gliedert sich in zwei Abschnitte, wobei der erste in chronologischer Folge die Entwicklung der zentralen adelsrelevanten Gesetzgebung von 1803 beginnend über 1808/11 bis 1818 aufzeigt. Im zweiten Abschnitt wird das Adelsedikt vom 26. Mai 1818 entsprechend seines Aufbaus (Erwerb des Adels, einzelne Privilegien, Verlust des Adels) besprochen. Im Anhang finden sich die ausführliche Biogramme aller beteiligten 50 Personen (inkl. Familienverhältnisse, Ausbildung, Beruf, Ämter, Adelserhebungen und verwandtschaftlicher und beruflicher Verbindungen der Beteiligten). Die Arbeit zeigt, dass Montgelas keineswegs Adelsgegner war, ebenso wenig wie Verfechter des revolutionären Gleichheitsgedankens, vielmehr war die Nivellierung des Adels nötig, um einen modernen, effizienten Zentralstaat zu schaffen. Montgelas hatte großes Gewicht in der Gesetzgebung, doch waren viele -auch adelige- Amtsträger beteiligt, die zumeist ihrem Rang und Stand entsprechend handelten, wobei einzelne Positionszuweisungen schwierig sind. Die Adelsgesetzgebung erfuhr nach einer radikalen Reform im Jahre 1808 mit dem Adelsedikt von 1818 einen lang dauernden Kompromiss, der für alle Beteiligten angemessen war. Von einer konservativen Revision der Reform von 1808 kann keine Rede sein, vielmehr erkannten die Entscheidungsträger, dass zum einen sich der Staat selbst schadet, wenn er die soziale und gleichzeitig funktionale Elite einebnet, zum anderen, dass die Adelsgesetzgebung von 1808-1811 in der Lebenswirklichkeit nicht funktionierte.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Kosmas Wührer: Bayerische Kapuzinerbibliotheken
In: Entwicklungen und Bestände : bayerische Bibliotheken im Übergang zum 21. Jahrhundert ; Hermann Holzbauer zum 65. Geburtstag / unter Mitarb. von Stefan Kellner und Christian Büchele. Hrsg. von Klaus Walter Littger
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 252 S. : Ill., graph. Darst., S. 229 - 238
Nach einer allgemeinen Einführung zitiert W. kurz die Ordensstatuten zu den Bibliotheken, um sich dann dem Stand von 1898 zuzuwenden (nach: Eberl, G. d. bay. Kap.pr., 1902, 658-60). Von 1868 (ca. 63.000) bis 1898 (ca. 133.000 Bände) verdoppelte sich der Bibliotheksbestand der 13 älteren Klöster. Nach den ganz zu zitierenden Ausführungen zu den Staatsbibliotheken geht W. auf die von P. Eberl verfasste umfangreiche gedruckte Bibliotheksordnung von 1898 ein. Abschließend wendet sich der Autor der Geschichte der Ordenshäuser zu und der Errichtung der Zentralbibliothek in Altötting. Die Idee wurde im Juni 1974 mit dem Bayerischen Unterrichtsministerium besprochen, das keine Einwände hatte. Im November 1976 kamen die ersten Büchertransporte in Altötting an.
1802 blieben 14 Zentralklöster erhalten. Wir erinnern uns: was vor 1802 gedruckt wurde und in deren Bestand sich befand, wurde durch den Überlassungsvertrag 1999 dem Eigentum des Freistaats zugeschlagen:
„Erst im Zuge der bibliothekarischen Aufarbeitung der Bestände kann das Eigentum an den Büchern im Einzelfall bestimmt werden“, heißt es in dem Vertrag weiter. „Als staatliches Eigentum haben hierbei in der Regel alle bis zum Jahr 1802 erschienenen Bände zu gelten, die nach 1802 im Besitz eines so genannten Zentralklosters verblieben sind. Diese Bestände „verbleiben im Eigentum des Freistaats Bayern und werden auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern, der Stiftung Katholische Universität Eichstätt und dem Bischöflichen Seminar St. Willibald vom Oktober vom Oktober 1981 als Dauerleihgabe in die Universitätsbibliothek eingegliedert und entsprechend kenntlich gemacht.“
http://archiv.twoday.net/stories/3359620
Zu staatlichen Deposita schreibt Wührer S. 233f. (vielen Dank an BCK!):
"Drei Klöster der Provinz besaßen außer ihren eigentlichen
Klosterbibliotheken noch sogenannte Staats- resp. Stadtbibliotheken, die ihnen
leihweise überlassen waren, nämlich Altötting II, Immenstadt und Burghausen:
In der Kustodie Altötting war die sogenannte Jesuitenbibliothek aufgestellt, die ursprünglich Eigentum der Jesuiten war, aber nach deren Aufhebung im Jahre
1773 auf diesem billigen Wege zum Rang einer "Staatsbibliothek" avancierte. Die
selbe stand früher im Noviziatsgebäude der Redemptoristen und wurde dann in die
Kustodie zum Gebrauche der Kapuziner übertragen. Sie umfaßte 1.468 Nummern mit
2.272 Bänden, meist in Folio und Schweinslederband, und enthielt klassische
Werke, z.B. die Polyglotta regia in sechs Imperialfolianten, die Biblioteca
Maxima Patrum, den ganzen Gretser, die Acta Sanctorum der Bollandisten, die auf
Befehl des damaligen Regierungspräsidenten v. Pfeuffer, der im Jahre 1883 der
Kustodie einen Besuch abstattete, für alle Zukunft auf Kosten der königlichen
Kapellstiftungs-Administration nachgeschafft werden mußte. Zu dieser Bibliothek
gehörte auch ein Autograph des seligen P. Petrus Canisius, das jedoch der
Wichtigkeit wegen im Hausarchiv aufbewahrt wurde.
Eine zweite Staatsbibliothek war dem Kloster Immenstadt überlassen. Über sie
besaß das Haus einen 53 Folioseiten starken Katalog, der ungefähr 2.800 Bände
aufweist, darunter, wie sich ein königliches Regierungsschreiben vom 25. Januar
1877 auf das Gutachten der Direktion der königlichen Hof- und Staatsbibliothek
hierüber ausdrückt, "Interessante und gesuchte Werke", so Toletus Laymann, Soto,
Bellarmin, Le Blanc, Lyranus, Rosweyde, Ribadenira, Kardinal Hugo, Nider,
Drexel, Granada, Augustinus und Hieronymus; ferner von Kapuzinerautoren: Die
Annalen, das Bullarium, den Prokopius (11 Bde.) die Enzyklopedie des Marcellinus
de Pisis, den Ivo Parisiensis Nikolaus Dijon. Ein Versuch in den Jahren 1876 -
1878, die Bibliothek für das Kloster anzukaufen, ist gescheitert.
Eine dritte Staatsbibliothek besaß das Kloster zu Burghausen. Die Kapuziner
konnten sich früher von der Zwecklosigkeit und der Verwahrlosung des über der
Sakristei des ehemaligen Jesuitengebäudes untergebrachten Restes des
Jesuitenbibliothek selber überzeugen, weshalb der damalige Koadjutor des
Magisters, nämlich P. Dominikus Schuberth bei König Max II. um Überlassung der
Bücher bittlich einkam. Auf das Gesuch hin erschien der Hof- und
Staatsbibliothekar Dr. Halm aus München und besichtigte die Bibliothek, von der
er die besseren Werke z.B. eine Kirchengeschichte von Japan in mehreren
Foliobänden und vielen Kupferstichen, mit sich nach München nahm, worauf dann
unterm 26. August 1861 der Rest dem Kloster unter Vorbehalt des Staatseigentums
überlassen wurde. Wäre diese Jesuitenbibliothek nicht ins Kapuzinerkloster
transferiert worden, dann wäre sie bei dem Brande am 2. August 1863 eine Beute
der Flamme geworden! - Unterm 16. Mai 1861 erhielt das Kloster auf sein Gesuch
an den Stadtmagistrat hin auch von diesem einige Bibliothekswerke, so z. B. das
große Leipziger Universallexikon in 64 Bänden (inkomplett) und anderes, unter
dem Vorbehalt des Stadteigentums zur Benutzung überlassen."
Daraus ergibt sich: Wenn wir in Wolfenbüttel via Provenienzerschließung von www.vd17.de zwei Werke aus der Kapuzinerbibliothek Burghausen finden, die zuvor im 18. Jahrhundert den Jesuiten gehörten, dann sind diese mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch bayerisches Staatseigentum, da mit Verkäufen erst ab 1999 zu rechnen ist und eine gutgläubige Ersitzung erst nach 10 Jahren erfolgt. Die Kapuziner hatten, soweit bekannt, keine Erlaubnis, über Staatseigentum zu verfügen. Dasselbe ist für die UB Eichstätt als Besitzer anzunehmen. Der Besitzer einer Sache ist nicht befugt, über das Eigentum zu verfügen. Für Aussonderungen der vor 1802 entstandenen Bücher aus den Zentralklöstern (das Gros des Altbestands, auch wenn in den jüngeren Klöstern durch Übernahmen von Altbeständen anderer Klöster z.B. aus Südtirol ebenfalls Altbestände vorhanden sind) gilt zum einen die bayerische Verwaltungsvorschrift, die Aussonderungen von Büchern, die vor 1830/50 gedruckt wurden, "in der Regel" nicht vorsieht, und zum anderen gelten die Haushaltsvorschriften des Landes hinsichtlich der Veräußerung von Landesvermögen. Aus fachlicher Sicht ist es nicht hinzunehmen, dass die Bände nicht zuallererst anderen staatlichen Bibliotheken Bayerns angeboten wurden.
Insgesamt gibt es gute Gründe, auch die Dublettenverkäufe von Drucken vor 1802 aus Zentralklöstern als rechtswidrig anzusehen. Um so mehr gilt das für die vernichteten Altbestände.
 Kapuzinerkloster Burghausen, Handzeichnung aus der Datenbank http://nonbook.ku-eichstaett.de/cgi-bin/lars.pl
Kapuzinerkloster Burghausen, Handzeichnung aus der Datenbank http://nonbook.ku-eichstaett.de/cgi-bin/lars.pl
In dieser Datenbank findet man auch folgendes Exlibris, das aus einem als Dublette verkauften Druck stammt, der als Staatseigentum bezeichnet wird:
In Manu D[omi]ni Sortes Meae : [2 Engel neben einem Wappen, darüber klein das Schweißtuch der Veronika ; Exlibris] , [16. Jh.]. - [1] Bl.
Fußnote: Holzschnitt, koloriert; 9,8 x 9,6 cm. - Ringsum beschnitten, oberer Rand abgeschnitten und wieder angeklebt, zahlreiche Beschädigungen an den Rändern. - Ausgelöst aus: Decreta synodalia dioecesis Augustanae. - Dillingen : Meyer, [1567] (als Dublette ausgeschieden). - Provenienz: Zentralbibliothek der Bayerischen Kapuziner, Altötting; vorher Kapuzinerkloster Burghausen
Eigentümer: Staat 20000718
Schlagworte: Exlibris ; Engel ; Wappen ; Veronika < Heilige> / Schweißtuch
Signatur: GS(1)7.235
Nachtrag: http://archiv.twoday.net/stories/3375748/
In: Entwicklungen und Bestände : bayerische Bibliotheken im Übergang zum 21. Jahrhundert ; Hermann Holzbauer zum 65. Geburtstag / unter Mitarb. von Stefan Kellner und Christian Büchele. Hrsg. von Klaus Walter Littger
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 252 S. : Ill., graph. Darst., S. 229 - 238
Nach einer allgemeinen Einführung zitiert W. kurz die Ordensstatuten zu den Bibliotheken, um sich dann dem Stand von 1898 zuzuwenden (nach: Eberl, G. d. bay. Kap.pr., 1902, 658-60). Von 1868 (ca. 63.000) bis 1898 (ca. 133.000 Bände) verdoppelte sich der Bibliotheksbestand der 13 älteren Klöster. Nach den ganz zu zitierenden Ausführungen zu den Staatsbibliotheken geht W. auf die von P. Eberl verfasste umfangreiche gedruckte Bibliotheksordnung von 1898 ein. Abschließend wendet sich der Autor der Geschichte der Ordenshäuser zu und der Errichtung der Zentralbibliothek in Altötting. Die Idee wurde im Juni 1974 mit dem Bayerischen Unterrichtsministerium besprochen, das keine Einwände hatte. Im November 1976 kamen die ersten Büchertransporte in Altötting an.
1802 blieben 14 Zentralklöster erhalten. Wir erinnern uns: was vor 1802 gedruckt wurde und in deren Bestand sich befand, wurde durch den Überlassungsvertrag 1999 dem Eigentum des Freistaats zugeschlagen:
„Erst im Zuge der bibliothekarischen Aufarbeitung der Bestände kann das Eigentum an den Büchern im Einzelfall bestimmt werden“, heißt es in dem Vertrag weiter. „Als staatliches Eigentum haben hierbei in der Regel alle bis zum Jahr 1802 erschienenen Bände zu gelten, die nach 1802 im Besitz eines so genannten Zentralklosters verblieben sind. Diese Bestände „verbleiben im Eigentum des Freistaats Bayern und werden auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern, der Stiftung Katholische Universität Eichstätt und dem Bischöflichen Seminar St. Willibald vom Oktober vom Oktober 1981 als Dauerleihgabe in die Universitätsbibliothek eingegliedert und entsprechend kenntlich gemacht.“
http://archiv.twoday.net/stories/3359620
Zu staatlichen Deposita schreibt Wührer S. 233f. (vielen Dank an BCK!):
"Drei Klöster der Provinz besaßen außer ihren eigentlichen
Klosterbibliotheken noch sogenannte Staats- resp. Stadtbibliotheken, die ihnen
leihweise überlassen waren, nämlich Altötting II, Immenstadt und Burghausen:
In der Kustodie Altötting war die sogenannte Jesuitenbibliothek aufgestellt, die ursprünglich Eigentum der Jesuiten war, aber nach deren Aufhebung im Jahre
1773 auf diesem billigen Wege zum Rang einer "Staatsbibliothek" avancierte. Die
selbe stand früher im Noviziatsgebäude der Redemptoristen und wurde dann in die
Kustodie zum Gebrauche der Kapuziner übertragen. Sie umfaßte 1.468 Nummern mit
2.272 Bänden, meist in Folio und Schweinslederband, und enthielt klassische
Werke, z.B. die Polyglotta regia in sechs Imperialfolianten, die Biblioteca
Maxima Patrum, den ganzen Gretser, die Acta Sanctorum der Bollandisten, die auf
Befehl des damaligen Regierungspräsidenten v. Pfeuffer, der im Jahre 1883 der
Kustodie einen Besuch abstattete, für alle Zukunft auf Kosten der königlichen
Kapellstiftungs-Administration nachgeschafft werden mußte. Zu dieser Bibliothek
gehörte auch ein Autograph des seligen P. Petrus Canisius, das jedoch der
Wichtigkeit wegen im Hausarchiv aufbewahrt wurde.
Eine zweite Staatsbibliothek war dem Kloster Immenstadt überlassen. Über sie
besaß das Haus einen 53 Folioseiten starken Katalog, der ungefähr 2.800 Bände
aufweist, darunter, wie sich ein königliches Regierungsschreiben vom 25. Januar
1877 auf das Gutachten der Direktion der königlichen Hof- und Staatsbibliothek
hierüber ausdrückt, "Interessante und gesuchte Werke", so Toletus Laymann, Soto,
Bellarmin, Le Blanc, Lyranus, Rosweyde, Ribadenira, Kardinal Hugo, Nider,
Drexel, Granada, Augustinus und Hieronymus; ferner von Kapuzinerautoren: Die
Annalen, das Bullarium, den Prokopius (11 Bde.) die Enzyklopedie des Marcellinus
de Pisis, den Ivo Parisiensis Nikolaus Dijon. Ein Versuch in den Jahren 1876 -
1878, die Bibliothek für das Kloster anzukaufen, ist gescheitert.
Eine dritte Staatsbibliothek besaß das Kloster zu Burghausen. Die Kapuziner
konnten sich früher von der Zwecklosigkeit und der Verwahrlosung des über der
Sakristei des ehemaligen Jesuitengebäudes untergebrachten Restes des
Jesuitenbibliothek selber überzeugen, weshalb der damalige Koadjutor des
Magisters, nämlich P. Dominikus Schuberth bei König Max II. um Überlassung der
Bücher bittlich einkam. Auf das Gesuch hin erschien der Hof- und
Staatsbibliothekar Dr. Halm aus München und besichtigte die Bibliothek, von der
er die besseren Werke z.B. eine Kirchengeschichte von Japan in mehreren
Foliobänden und vielen Kupferstichen, mit sich nach München nahm, worauf dann
unterm 26. August 1861 der Rest dem Kloster unter Vorbehalt des Staatseigentums
überlassen wurde. Wäre diese Jesuitenbibliothek nicht ins Kapuzinerkloster
transferiert worden, dann wäre sie bei dem Brande am 2. August 1863 eine Beute
der Flamme geworden! - Unterm 16. Mai 1861 erhielt das Kloster auf sein Gesuch
an den Stadtmagistrat hin auch von diesem einige Bibliothekswerke, so z. B. das
große Leipziger Universallexikon in 64 Bänden (inkomplett) und anderes, unter
dem Vorbehalt des Stadteigentums zur Benutzung überlassen."
Daraus ergibt sich: Wenn wir in Wolfenbüttel via Provenienzerschließung von www.vd17.de zwei Werke aus der Kapuzinerbibliothek Burghausen finden, die zuvor im 18. Jahrhundert den Jesuiten gehörten, dann sind diese mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch bayerisches Staatseigentum, da mit Verkäufen erst ab 1999 zu rechnen ist und eine gutgläubige Ersitzung erst nach 10 Jahren erfolgt. Die Kapuziner hatten, soweit bekannt, keine Erlaubnis, über Staatseigentum zu verfügen. Dasselbe ist für die UB Eichstätt als Besitzer anzunehmen. Der Besitzer einer Sache ist nicht befugt, über das Eigentum zu verfügen. Für Aussonderungen der vor 1802 entstandenen Bücher aus den Zentralklöstern (das Gros des Altbestands, auch wenn in den jüngeren Klöstern durch Übernahmen von Altbeständen anderer Klöster z.B. aus Südtirol ebenfalls Altbestände vorhanden sind) gilt zum einen die bayerische Verwaltungsvorschrift, die Aussonderungen von Büchern, die vor 1830/50 gedruckt wurden, "in der Regel" nicht vorsieht, und zum anderen gelten die Haushaltsvorschriften des Landes hinsichtlich der Veräußerung von Landesvermögen. Aus fachlicher Sicht ist es nicht hinzunehmen, dass die Bände nicht zuallererst anderen staatlichen Bibliotheken Bayerns angeboten wurden.
Insgesamt gibt es gute Gründe, auch die Dublettenverkäufe von Drucken vor 1802 aus Zentralklöstern als rechtswidrig anzusehen. Um so mehr gilt das für die vernichteten Altbestände.
In dieser Datenbank findet man auch folgendes Exlibris, das aus einem als Dublette verkauften Druck stammt, der als Staatseigentum bezeichnet wird:
In Manu D[omi]ni Sortes Meae : [2 Engel neben einem Wappen, darüber klein das Schweißtuch der Veronika ; Exlibris] , [16. Jh.]. - [1] Bl.
Fußnote: Holzschnitt, koloriert; 9,8 x 9,6 cm. - Ringsum beschnitten, oberer Rand abgeschnitten und wieder angeklebt, zahlreiche Beschädigungen an den Rändern. - Ausgelöst aus: Decreta synodalia dioecesis Augustanae. - Dillingen : Meyer, [1567] (als Dublette ausgeschieden). - Provenienz: Zentralbibliothek der Bayerischen Kapuziner, Altötting; vorher Kapuzinerkloster Burghausen
Eigentümer: Staat 20000718
Schlagworte: Exlibris ; Engel ; Wappen ; Veronika < Heilige> / Schweißtuch
Signatur: GS(1)7.235
Nachtrag: http://archiv.twoday.net/stories/3375748/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.guardian.co.uk/international/story/0,,2002303,00.html
Heir of Victor Hugo fails to stop Les Mis II
The case set French copyright laws, which put a literary work in the public domain 70 years after the author's death, against the concept of an author's "moral rights". The latter are considered timeless and passed on to descendants.
I found this at the comments of Lessig's new Orphan Works suggestion
http://lessig.org/blog/archives/003696.shtml
Heir of Victor Hugo fails to stop Les Mis II
The case set French copyright laws, which put a literary work in the public domain 70 years after the author's death, against the concept of an author's "moral rights". The latter are considered timeless and passed on to descendants.
I found this at the comments of Lessig's new Orphan Works suggestion
http://lessig.org/blog/archives/003696.shtml
KlausGraf - am Samstag, 24. Februar 2007, 14:35 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Otmar Jung: Die Fundierung der sozialen Republik mißlingt. Das Exempel des Streits um das Kammergut zwischen dem Freistaat Braunschweig und dem ehemaligen Herzog (von der Novemberrevolution bis zur Volksbewegung zur Fürstenenteignung 1926), in: Braunschweigisches Jahrbuch für Landesgeschichte 78 (1997), S. 189-225, hier S. 218 weist auf das Urteil vom 27.5.1932 RGZ 136, S. 211 ff. hin, in der im lippischen Domanialprozess festgestellt wurde, dass "nach gemeinem deutschen Privatfürstenrecht ... das Domänenvermögen (Kammergut) im Unterschied von den ein reines Privateigentum darstellenden Schatull- oder Kabinettsgütern schon zur Zeit des alten Deutschen Reichs den landesfürstlichen Familien nur als Zubehör der Landeshoheit" gehörte, "so daß es ihnen im Zweifel nur so lange zustand, als sie die Herrschaft im Staat innehatten".
Fortsetzung: http://archiv.twoday.net/stories/3541045/
Fortsetzung: http://archiv.twoday.net/stories/3541045/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 24. Februar 2007, 01:58 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Strafanzeige gegen Leiterin der Bibliothek
Eichstätt (EK) Der Verdacht, dass an der Eichstätter Unibibliothek massenhaft Bücher im Altpapier gelandet sind, beschäftigt nun auch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt. Wie der stellvertretende Leiter der Behörde, Wolfram Herrle, bestätigte, wurde Strafanzeige wegen Untreue gestellt.
Die Anzeige stammt von der Erlanger Rechtsanwältin Dr. Ulrike Männlein und richtet sich gegen Mitarbeiter der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, "insbesondere gegen die leitende Bibliotheksdirektorin" Dr. Angelika Reich, (Aktenzeichen 20 JS 3138/07).
Schon im Vorfeld allerdings war die Ingolstädter Behörde selbst tätig geworden und hatte, nachdem der EICHSTÄTTER KURIER darüber berichtet hatte, einen Akt zu der Angelegenheit angelegt. Das sei immer dann der Fall, wenn der Verdacht einer Straftat bestehe, so Herrle.
Den jedenfalls sieht Ulrike Männlein gegeben. Sie führt an, dass, wie berichtet, die Uni-bibliothek die Schallplattensammlung des Musikprofessors Heinrich Sievers für 1100 Euro an ein Antiquariat in Leipzig verkauft habe. Der Wert der Sammlung allerdings habe, wie aus einer bei der Übergabe von der Universität ausgestellten Spendenquittung ersichtlich sei, 30 000 Mark betragen. Zwar habe die Universitätsbibliothek das Recht über fremdes Vermögen, nämlich das Vermögen der Allgemeinheit, zu verfügen.
Das bedeute aber nicht, "dass sie eine Sammlung, die einen Wert von 30 000 Mark hat, für 1100 Euro verscherbeln darf", zumal diese Schenkung für wissenschaftliche Zwecke erfolgt sei und bei einem Verkauf an ein Antiquariat wohl der wissenschaftlich Zweck nicht mehr vorhanden sein.
Hinzu komme, so Männlein , ein "steuerlich relevantes Delikt", da die Schenkerin die Spendenquittung in ihrer Steuererklärung steuermindernd verwendet haben dürfte. Männlein weiter: "Wenn die Zeit der Schallplatte vorbei war, dann war sie das bereits im Jahr 2000, wobei diese Argumentation wirklich jeglicher Intelligenz entbehrt. Dann hat aber die Universitätsbibliothek schon damals eine falsche Spendenbescheinigung ausgestellt und somit Steuerverkürzung betrieben oder Beihilfe dazu geleistet."
Auch im Umgang mit Büchern aus der Bibliothek der bayerischen Kapuziner sieht Männlein den Tatbestand der Untreue gegeben. Denn: "Der Inhalt von Bibliotheken ist Allgemeingut", schreibt sie, und die Bücher der Kapuziner sollten der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. "Eine Bibliotheksdirektorin kann das nicht wie ihr Eigentum behandeln", so Männlein.
Es sei schließlich Aufgabe der Leitung der Universitätsbibliothek, dieses Vermögen zu betreuen und zu erhalten. Es dürfe nicht einfach unbesehen weggeworfen werden. Männlein abschließend: "Im unbesehenen Wegwerfen von 30 000 Bänden aus Kapuzinermönchsbibliotheken meine ich auch einen Treuebruchstatbestand zu sehen."
Die Anzeige wurde, wie Ulrike Männlein gestern ergänzte, nun auch gegen den Kanzler der Universität und Dienstvorgesetzten Reichs, Gottfried Freiherr von der Heydte, und den Provinzial der bayerischen Kapuziner, Pater Josef Mittermaier, ausgedehnt.
Mittermaier hatte laut einem Zeitungsbericht in einem internen Rundschreiben erklärt, das Vorgehen der Bibliotheksleitung sei "von unserer Seite mitgetragen" worden.
(Eichstätter Kurier, 23.02.2007 22:00)
Zu den derzeit eingeleiteten Untersuchungen gegen die leitende Bibliotheksdirektorin, die wegen des Verdachts, Bücher massenhaft vernichtet zu haben, von der Betreuung der Kapuzinerbibliothek entbunden wurde, erklärte Bischof Hanke, der auch Großkanzler der einzigen katholischen Universität im deutschen Sprachraum ist, es müssten jetzt Bestandsaufnahmen und Analysen gemacht und die Ergebnisse der Untersuchung abgewartet werden. (nach: Katholische Uni "braucht ein schärferes Profil" / Hermann Redl, Eichstätter Kurier 23.02.2007)
Update 24.2.2007: Auch die Kirchenzeitung für das Bistum Eichstätt berichtet in ihrer morgigen Ausgabe (Nr. 8 vom 25. Februar 2007) als "Meldung der Woche" über die "Büchervernichtung an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt". (Text liegt uns noch nicht vor.)
Eichstätt (EK) Der Verdacht, dass an der Eichstätter Unibibliothek massenhaft Bücher im Altpapier gelandet sind, beschäftigt nun auch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt. Wie der stellvertretende Leiter der Behörde, Wolfram Herrle, bestätigte, wurde Strafanzeige wegen Untreue gestellt.
Die Anzeige stammt von der Erlanger Rechtsanwältin Dr. Ulrike Männlein und richtet sich gegen Mitarbeiter der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, "insbesondere gegen die leitende Bibliotheksdirektorin" Dr. Angelika Reich, (Aktenzeichen 20 JS 3138/07).
Schon im Vorfeld allerdings war die Ingolstädter Behörde selbst tätig geworden und hatte, nachdem der EICHSTÄTTER KURIER darüber berichtet hatte, einen Akt zu der Angelegenheit angelegt. Das sei immer dann der Fall, wenn der Verdacht einer Straftat bestehe, so Herrle.
Den jedenfalls sieht Ulrike Männlein gegeben. Sie führt an, dass, wie berichtet, die Uni-bibliothek die Schallplattensammlung des Musikprofessors Heinrich Sievers für 1100 Euro an ein Antiquariat in Leipzig verkauft habe. Der Wert der Sammlung allerdings habe, wie aus einer bei der Übergabe von der Universität ausgestellten Spendenquittung ersichtlich sei, 30 000 Mark betragen. Zwar habe die Universitätsbibliothek das Recht über fremdes Vermögen, nämlich das Vermögen der Allgemeinheit, zu verfügen.
Das bedeute aber nicht, "dass sie eine Sammlung, die einen Wert von 30 000 Mark hat, für 1100 Euro verscherbeln darf", zumal diese Schenkung für wissenschaftliche Zwecke erfolgt sei und bei einem Verkauf an ein Antiquariat wohl der wissenschaftlich Zweck nicht mehr vorhanden sein.
Hinzu komme, so Männlein , ein "steuerlich relevantes Delikt", da die Schenkerin die Spendenquittung in ihrer Steuererklärung steuermindernd verwendet haben dürfte. Männlein weiter: "Wenn die Zeit der Schallplatte vorbei war, dann war sie das bereits im Jahr 2000, wobei diese Argumentation wirklich jeglicher Intelligenz entbehrt. Dann hat aber die Universitätsbibliothek schon damals eine falsche Spendenbescheinigung ausgestellt und somit Steuerverkürzung betrieben oder Beihilfe dazu geleistet."
Auch im Umgang mit Büchern aus der Bibliothek der bayerischen Kapuziner sieht Männlein den Tatbestand der Untreue gegeben. Denn: "Der Inhalt von Bibliotheken ist Allgemeingut", schreibt sie, und die Bücher der Kapuziner sollten der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. "Eine Bibliotheksdirektorin kann das nicht wie ihr Eigentum behandeln", so Männlein.
Es sei schließlich Aufgabe der Leitung der Universitätsbibliothek, dieses Vermögen zu betreuen und zu erhalten. Es dürfe nicht einfach unbesehen weggeworfen werden. Männlein abschließend: "Im unbesehenen Wegwerfen von 30 000 Bänden aus Kapuzinermönchsbibliotheken meine ich auch einen Treuebruchstatbestand zu sehen."
Die Anzeige wurde, wie Ulrike Männlein gestern ergänzte, nun auch gegen den Kanzler der Universität und Dienstvorgesetzten Reichs, Gottfried Freiherr von der Heydte, und den Provinzial der bayerischen Kapuziner, Pater Josef Mittermaier, ausgedehnt.
Mittermaier hatte laut einem Zeitungsbericht in einem internen Rundschreiben erklärt, das Vorgehen der Bibliotheksleitung sei "von unserer Seite mitgetragen" worden.
(Eichstätter Kurier, 23.02.2007 22:00)
Zu den derzeit eingeleiteten Untersuchungen gegen die leitende Bibliotheksdirektorin, die wegen des Verdachts, Bücher massenhaft vernichtet zu haben, von der Betreuung der Kapuzinerbibliothek entbunden wurde, erklärte Bischof Hanke, der auch Großkanzler der einzigen katholischen Universität im deutschen Sprachraum ist, es müssten jetzt Bestandsaufnahmen und Analysen gemacht und die Ergebnisse der Untersuchung abgewartet werden. (nach: Katholische Uni "braucht ein schärferes Profil" / Hermann Redl, Eichstätter Kurier 23.02.2007)
Update 24.2.2007: Auch die Kirchenzeitung für das Bistum Eichstätt berichtet in ihrer morgigen Ausgabe (Nr. 8 vom 25. Februar 2007) als "Meldung der Woche" über die "Büchervernichtung an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt". (Text liegt uns noch nicht vor.)
BCK - am Freitag, 23. Februar 2007, 23:55 - Rubrik: Kulturgut
http://commons.wikimedia.org/wiki/Zwischenarchiv
Geklagt hatte ein dänischer Journalist gegen das Universitätsarchiv Rostock. Das OVG MV wies die Klage 2001 in zweiter Instanz zurück.
Das Urteil des OVG als E-Text:
http://de.wikisource.org/wiki/Oberverwaltungsgericht_Mecklenburg-Vorpommern_-_Benutzung_von_Zwischenarchivgut
Geklagt hatte ein dänischer Journalist gegen das Universitätsarchiv Rostock. Das OVG MV wies die Klage 2001 in zweiter Instanz zurück.
Das Urteil des OVG als E-Text:
http://de.wikisource.org/wiki/Oberverwaltungsgericht_Mecklenburg-Vorpommern_-_Benutzung_von_Zwischenarchivgut
KlausGraf - am Freitag, 23. Februar 2007, 23:53 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.b2i.de/b2iGuide/
Der Fachinformationsführer Bibliotheks-, Buch- und Informationswissenschaften (b2i Guide) stellt wissenschaftlich relevante Internetquellen zu den Bibliotheks-, Buch und Informationswissenschaften bereit. Die Internetquellen werden mit einem Metadaten-Set beschrieben, dass auf Dublin Core (DC) basiert. (Information des Anbieters)
Archivalia und unsere Drucke des 16. Jahrhunderts sind auch vertreten.
Das ändert aber nichts an der anderweitig geäußerten Kritik an solchen Linksammlungen:
http://log.netbib.de/archives/2007/01/10/vifa-bbi-ist-jetzt-b2-i/
Dass ein DFG-gefördertes Projekt das und dass nicht mehr unterscheiden kann, wird man in die Annalen der Informationswissenschaft eintragen dürfen.
Der Fachinformationsführer Bibliotheks-, Buch- und Informationswissenschaften (b2i Guide) stellt wissenschaftlich relevante Internetquellen zu den Bibliotheks-, Buch und Informationswissenschaften bereit. Die Internetquellen werden mit einem Metadaten-Set beschrieben, dass auf Dublin Core (DC) basiert. (Information des Anbieters)
Archivalia und unsere Drucke des 16. Jahrhunderts sind auch vertreten.
Das ändert aber nichts an der anderweitig geäußerten Kritik an solchen Linksammlungen:
http://log.netbib.de/archives/2007/01/10/vifa-bbi-ist-jetzt-b2-i/
Dass ein DFG-gefördertes Projekt das und dass nicht mehr unterscheiden kann, wird man in die Annalen der Informationswissenschaft eintragen dürfen.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/verkauf.php
entnehmen wir:
* Momente, Beiträge zur Landeskunde von Baden-Württemberg, Heft 1/07, S. 46, Beitrag von Prof. Dr. Volker Himmelein, langjähriger Leiter des Badischen und des Württembergischen Landesmuseums im Ruhestand, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats von "Momente":
Darf das Land Kulturgut verkaufen?
Es gibt ein Gesetz zum Schutz deutschen Kulturguts, das Objekte, "deren Abwanderung einen wesentlichen Verlust für den deutschen Kulturbesitz bedeuten würde", vor einer Ausfuhr (und damit vor uneingeschränkter Vermarktung) schützen soll. ... Die Landesregierung war bereit, Handschriften aus dem Besitz der Badischen Landesbibliothek (ohne Rücksprache mit den Betroffenen!) zu verkaufen, um mit dem Erlös den Erhalt anderer Kulturgüter zu finanzieren. Als das dann am öffentlichen Protest scheiterte, hat sie die Museen des Landes aufgefordert, "aus Solidarität" Sammlungsgegenstände zum Verkauf frei zu geben. Darf das Land überhaupt Kulturgut aus dem öffentlichen Besitz verkaufen? Museen, Archive und Bibliotheken verwalten ja den Kunstbesitz des Landes nur treuhänderisch und haben die Verpflichtung, diesen Besitz ungeschmälert an kommende Generationen weiterzugeben. Und da die Bedeutung von Museen, Archiven und Bibliotheken ja nicht allein auf den Prunkstücken in den Schausammlungen beruht, sondern sie auch und vor allem "Sacharchive" der Geschichte sind, dürfen ihre Bestände nicht einfach zur Disposition gestellt werden.
Deshalb ist der Protest gegen solche Verkaufsabsichten - das "hysterische Geschrei, wenn an das Tabu eines Verkaufs von Kunstwerken gerührt wird", über das sich Bettina Wieselmann im SWR2 Forum am 16. November 2006, glaubte mokieren zu müssen - nur zu berechtigt. Denn es ist zu befürchten, dass der Staat in seinen Geldnöten nach einem Bruch dieses Tabus über weitere Verkäufe nachdenken wird. Wenn die Museen ihrer Verantwortung für das kulturelle Erbe des Landes gerecht werden wollen, kann Solidarität in diesem Zusammenhang nur bedeuten, dass sie sich einig sind, keine Sammlungsstücke zu veräußern.
Weitere Hinweise:
* Sindelfinger / Böblinger Zeitung, 22.02.2007: Asche auf das Haupt der anderen
... Die Landes-SPD verlegte ihre Kundgebung diesmal nach Oberkochen, wo die Partei in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen feiert. ... Aber Oettinger fehle es auch an Verständnis für "unser kulturelles Erbe und unsere historische Vergangenheit" - das zeige sein Versuch, dem Adelshaus Baden aus der Finanznot zu helfen. Mit seinem Plan, ein acht Millionen teures Gemälde von Hans Baldung Grien zu kaufen, das dem Land bereits gehöre, habe er bundesweit für Spott gesorgt. "Jetzt weiß ganz Deutschland: Wer sein Bier zweimal zahlt, stammt aus Baden-Württemberg. Wer aber kauft, was ihm bereits gehört, ist in Stuttgart mindestens Minister." [...]
* Badische Neueste Nachrichten, 21.02.2007: Millionen sind vorgemerkt - Vorbereitungen für Vergleich
Der Stuttgarter Wissenschaftsminister Peter Frankenberg hat im Doppelhaushalt 2007/ 2008 des Landes bereits 6,1 Millionen Euro aus dem Kunst- und Bibliotheksetat für das so genannte Drei-Säulen-Modell im Zusammenhang mit dem Handschriftenstreit vorgemerkt. Das geht aus einer Antwort des Wissenschaftsministeriums auf einen Antrag des Karlsruher Landtagsabgeordneten Johannes Stober (SPD) hervor. [...]
entnehmen wir:
* Momente, Beiträge zur Landeskunde von Baden-Württemberg, Heft 1/07, S. 46, Beitrag von Prof. Dr. Volker Himmelein, langjähriger Leiter des Badischen und des Württembergischen Landesmuseums im Ruhestand, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats von "Momente":
Darf das Land Kulturgut verkaufen?
Es gibt ein Gesetz zum Schutz deutschen Kulturguts, das Objekte, "deren Abwanderung einen wesentlichen Verlust für den deutschen Kulturbesitz bedeuten würde", vor einer Ausfuhr (und damit vor uneingeschränkter Vermarktung) schützen soll. ... Die Landesregierung war bereit, Handschriften aus dem Besitz der Badischen Landesbibliothek (ohne Rücksprache mit den Betroffenen!) zu verkaufen, um mit dem Erlös den Erhalt anderer Kulturgüter zu finanzieren. Als das dann am öffentlichen Protest scheiterte, hat sie die Museen des Landes aufgefordert, "aus Solidarität" Sammlungsgegenstände zum Verkauf frei zu geben. Darf das Land überhaupt Kulturgut aus dem öffentlichen Besitz verkaufen? Museen, Archive und Bibliotheken verwalten ja den Kunstbesitz des Landes nur treuhänderisch und haben die Verpflichtung, diesen Besitz ungeschmälert an kommende Generationen weiterzugeben. Und da die Bedeutung von Museen, Archiven und Bibliotheken ja nicht allein auf den Prunkstücken in den Schausammlungen beruht, sondern sie auch und vor allem "Sacharchive" der Geschichte sind, dürfen ihre Bestände nicht einfach zur Disposition gestellt werden.
Deshalb ist der Protest gegen solche Verkaufsabsichten - das "hysterische Geschrei, wenn an das Tabu eines Verkaufs von Kunstwerken gerührt wird", über das sich Bettina Wieselmann im SWR2 Forum am 16. November 2006, glaubte mokieren zu müssen - nur zu berechtigt. Denn es ist zu befürchten, dass der Staat in seinen Geldnöten nach einem Bruch dieses Tabus über weitere Verkäufe nachdenken wird. Wenn die Museen ihrer Verantwortung für das kulturelle Erbe des Landes gerecht werden wollen, kann Solidarität in diesem Zusammenhang nur bedeuten, dass sie sich einig sind, keine Sammlungsstücke zu veräußern.
Weitere Hinweise:
* Sindelfinger / Böblinger Zeitung, 22.02.2007: Asche auf das Haupt der anderen
... Die Landes-SPD verlegte ihre Kundgebung diesmal nach Oberkochen, wo die Partei in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen feiert. ... Aber Oettinger fehle es auch an Verständnis für "unser kulturelles Erbe und unsere historische Vergangenheit" - das zeige sein Versuch, dem Adelshaus Baden aus der Finanznot zu helfen. Mit seinem Plan, ein acht Millionen teures Gemälde von Hans Baldung Grien zu kaufen, das dem Land bereits gehöre, habe er bundesweit für Spott gesorgt. "Jetzt weiß ganz Deutschland: Wer sein Bier zweimal zahlt, stammt aus Baden-Württemberg. Wer aber kauft, was ihm bereits gehört, ist in Stuttgart mindestens Minister." [...]
* Badische Neueste Nachrichten, 21.02.2007: Millionen sind vorgemerkt - Vorbereitungen für Vergleich
Der Stuttgarter Wissenschaftsminister Peter Frankenberg hat im Doppelhaushalt 2007/ 2008 des Landes bereits 6,1 Millionen Euro aus dem Kunst- und Bibliotheksetat für das so genannte Drei-Säulen-Modell im Zusammenhang mit dem Handschriftenstreit vorgemerkt. Das geht aus einer Antwort des Wissenschaftsministeriums auf einen Antrag des Karlsruher Landtagsabgeordneten Johannes Stober (SPD) hervor. [...]
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
A project to put historical constituency data online runs into familiar problems with Ordnance Survey
SA Mathieson
Thursday February 22, 2007
The Guardian
A project to put historical election data online has run into a problem familiar to supporters of Technology Guardian's Free Our Data campaign: Ordnance Survey's copyright.
http://technology.guardian.co.uk/weekly/story/0,,2017958,00.html
Quote:
"Taxpayers would be amazed what is available within higher education, which is paid for by the general public but isn't available to the general public."
The Open Access "Taxpayer Argument" is also applicable when requesting "Remote access" to university databases for taxpayers in Germany, see (in German)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bibliotheksrecherche#Bestehende_M.C3.B6glichkeit_zum_Zugang_zu_Informationen_von_zuhause
SA Mathieson
Thursday February 22, 2007
The Guardian
A project to put historical election data online has run into a problem familiar to supporters of Technology Guardian's Free Our Data campaign: Ordnance Survey's copyright.
http://technology.guardian.co.uk/weekly/story/0,,2017958,00.html
Quote:
"Taxpayers would be amazed what is available within higher education, which is paid for by the general public but isn't available to the general public."
The Open Access "Taxpayer Argument" is also applicable when requesting "Remote access" to university databases for taxpayers in Germany, see (in German)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bibliotheksrecherche#Bestehende_M.C3.B6glichkeit_zum_Zugang_zu_Informationen_von_zuhause
KlausGraf - am Freitag, 23. Februar 2007, 20:39 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Vortrag über die Lesefähigkeit im Mittelalter als Audiodatei
http://www.ub.uni-dortmund.de/ubblog/rara-sunt-cara
http://www.ub.uni-dortmund.de/ubblog/rara-sunt-cara
KlausGraf - am Freitag, 23. Februar 2007, 20:30 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Regelmäßig mache ich in meinen Freiburger Übungen "Internet für Historiker" darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, Offline-Suchen (in Büchern, Fragen bei Bibliothekaren, dem Dozenten usw.) und Online-Recherchen zu kombinieren.
Vergleichsweise trivial ist die Nutzung des Internets für bibliographische Recherchen.
Anspruchsvoller ist die Nutzung gedruckter Fachliteratur, um Suchbegriffe zu optimieren.
Einen konkreten Suchweg, der von Google Books ausgeht und über das gedruckte Buch wieder zu einem Digitalisat führt, präsentiert instruktiv:
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/3358004/
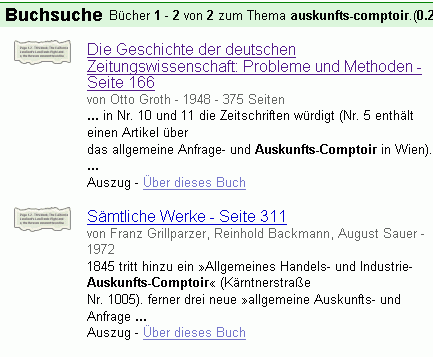
Vergleichsweise trivial ist die Nutzung des Internets für bibliographische Recherchen.
Anspruchsvoller ist die Nutzung gedruckter Fachliteratur, um Suchbegriffe zu optimieren.
Einen konkreten Suchweg, der von Google Books ausgeht und über das gedruckte Buch wieder zu einem Digitalisat führt, präsentiert instruktiv:
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/3358004/
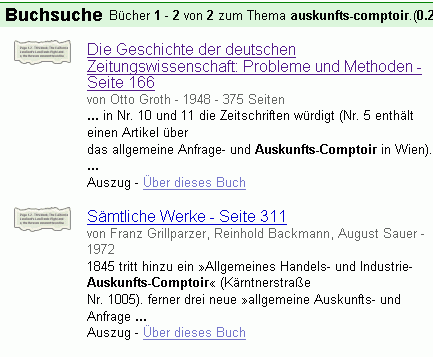
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
So titelt ein Blawg:
http://obiterdictum.wordpress.com/2007/02/21/bayerische-bucherschander/
Der Casus findet doch mehr Aufmerksamkeit bei den Bloggern als die Causa Karlsruhe:
http://blogsearch.google.com/blogsearch?hl=en&tab=pb&ie=UTF-8&scoring=d&q=eichst%C3%A4tt+bibliothek&btnG=Search+Blogs
In den Kommentaren (auch bei STERN shortnews) überwiegt das Unverständnis.
http://obiterdictum.wordpress.com/2007/02/21/bayerische-bucherschander/
Der Casus findet doch mehr Aufmerksamkeit bei den Bloggern als die Causa Karlsruhe:
http://blogsearch.google.com/blogsearch?hl=en&tab=pb&ie=UTF-8&scoring=d&q=eichst%C3%A4tt+bibliothek&btnG=Search+Blogs
In den Kommentaren (auch bei STERN shortnews) überwiegt das Unverständnis.
Über einen dpa-Beitrag des freien Mitarbeiters Frederik Obermaier hat es der Eichstätter Skandal in diverse Online- und Printmedien geschafft.
Auszug:
In den vergangenen Wochen häuften sich die Vorwürfe gegen die KU- Bibliotheksleitung. Laut Klaus Graf, Geschäftsführer des Aachener Hochschularchivs, sind auch „unersetzliche Einzelstücke“ aus dem Bestand der Eichstätter Bibliothek in „großem Maße“ in deutschen Antiquariaten aufgetaucht. Dies sei „Vernichtung von Kulturgut“.
Der Kanzler der KU sah lange Zeit keinen Handlungsbedarf. Es handle sich bei diesen Büchern um Doubletten, die nach sorgfältiger Prüfung abgegeben worden seien ein „ganz normaler Vorgang“. Erst als dem Ingolstädter Donaukurier fünf historisch wertvolle Bände zugespielt wurden, die in einem Altpapiercontainer gelandet sein sollten, ging Von der Heydte den Vorwürfen nach.
Das vorläufige Ergebnis: Es bestehe der Verdacht, dass Reich nicht mit der nötigen bibliothekarischen Sorgfalt vorgegangen sei. Reich wollte sich bislang nicht zu den Vorwürfen äußern. Der frühere Bibliotheksdirektor Hermann Holzbauer, zeigte sich erschüttert über das Vorgehen seiner Nachfolgerin: „Nach meiner Kenntnis ist so was in Bibliothekskreisen noch nie vorgekommen.“
Der Provinzial der bayerischen Kapuziner, Josef Mittermaier, betonte dagegen in einem internen Rundschreiben, dass das Vorgehen der Bibliotheksleitung „von unserer Seite mitgetragen“ wurde. Die Äußerung Holzbauers, dass es sich bei den vernichteten Büchern großteils um völlig unbeschädigte Werke des 17. und 18. Jahrhunderts handelte, sei „rational nicht nachvollziehbar“.
Diese Einschätzung sei wohl im „Tumult der schon länger andauernden Privatfehde“ Holzbauers mit Reich erfolgt. Der Kanzler der KU hat indes angekündigt, das Verhalten der Bibliotheksleitung weiter zu untersuchen und von einem externen bibliothekarischen Gutachter überprüfen zu lassen. Dienstrechtliche Schritte gegen die Bibliothekschefin seien nicht auszuschließen.
(dpa/Frederik Obermaier)
SZ
Siehe auch Google News.
Auszug:
In den vergangenen Wochen häuften sich die Vorwürfe gegen die KU- Bibliotheksleitung. Laut Klaus Graf, Geschäftsführer des Aachener Hochschularchivs, sind auch „unersetzliche Einzelstücke“ aus dem Bestand der Eichstätter Bibliothek in „großem Maße“ in deutschen Antiquariaten aufgetaucht. Dies sei „Vernichtung von Kulturgut“.
Der Kanzler der KU sah lange Zeit keinen Handlungsbedarf. Es handle sich bei diesen Büchern um Doubletten, die nach sorgfältiger Prüfung abgegeben worden seien ein „ganz normaler Vorgang“. Erst als dem Ingolstädter Donaukurier fünf historisch wertvolle Bände zugespielt wurden, die in einem Altpapiercontainer gelandet sein sollten, ging Von der Heydte den Vorwürfen nach.
Das vorläufige Ergebnis: Es bestehe der Verdacht, dass Reich nicht mit der nötigen bibliothekarischen Sorgfalt vorgegangen sei. Reich wollte sich bislang nicht zu den Vorwürfen äußern. Der frühere Bibliotheksdirektor Hermann Holzbauer, zeigte sich erschüttert über das Vorgehen seiner Nachfolgerin: „Nach meiner Kenntnis ist so was in Bibliothekskreisen noch nie vorgekommen.“
Der Provinzial der bayerischen Kapuziner, Josef Mittermaier, betonte dagegen in einem internen Rundschreiben, dass das Vorgehen der Bibliotheksleitung „von unserer Seite mitgetragen“ wurde. Die Äußerung Holzbauers, dass es sich bei den vernichteten Büchern großteils um völlig unbeschädigte Werke des 17. und 18. Jahrhunderts handelte, sei „rational nicht nachvollziehbar“.
Diese Einschätzung sei wohl im „Tumult der schon länger andauernden Privatfehde“ Holzbauers mit Reich erfolgt. Der Kanzler der KU hat indes angekündigt, das Verhalten der Bibliotheksleitung weiter zu untersuchen und von einem externen bibliothekarischen Gutachter überprüfen zu lassen. Dienstrechtliche Schritte gegen die Bibliothekschefin seien nicht auszuschließen.
(dpa/Frederik Obermaier)
SZ
Siehe auch Google News.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Heute traf sich die Arbeitsgemeinschaft der Hochschularchivare des Landes Nordrhein-Westfalen in Aachen. Eingeladen hatten die Archive der FH Aachen und der RWHT Aachen, vertreten durch die ArchivarInnen Dr. Bettina Frindt (FH Aachen) und Prof. Dr. Christine Roll (wiss. Leiterin)/Dr. Klaus Graf (Geschäftsführer).
Im Vorfeld hatte die Pressestelle der FH folgenden Text ins Netz gestellt:
http://www.fh-aachen.de/232.html?&tx_ttnews[tt_news]=1319&tx_ttnews[backPid]=22&cHash=385b5a500d
Treffen der Hochschularchivare am 22.2.07 in Aachen
Archivare sind graue Mäuse, die auf einem Berg unnützen Wissens sitzen und die benötigten Informationen dann doch nicht finden?
Weit entfernt.
Wie aber bringt man das der unwissenden Öffentlichkeit bei?
Und wie weckt man Interesse für einen Besuch im Archiv?
Am Donnerstag, 22. Februar 2007, findet das jährliche Treffen der AG Hochschularchivare NRW in Aachen statt, diesmal mit dem Schwerpunktthema „Öffentlichkeitsarbeit in Archiven“. Das Treffen beginnt mit einem Besuch des Hochschularchivs der FH Aachen im Gebäude Boxgraben 100, wo die Teilnehmer von FH-Kanzler Reiner Smeetz begrüßt werden. Die Experten aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen folgen der Einladung des Zentralarchivs der FH und des Hochschularchivs der RWTH Aachen. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit, so der Plan der Veranstalter, soll das Image der Archive, speziell der Hochschularchive, grundlegend aufpoliert werden. Damit belegt die Veranstaltung nicht nur, dass Kooperationen zwischen Hochschularchiven möglich sind, sondern auch, dass sich in Aachen daraus ein lebendiges hochschulübergreifendes Archivwesen mit innovativen Ideen entwickelt. Die Aachener Archivare verstehen sich als moderne, serviceorientierte Informationsverwalter, die neben ihren Tätigkeiten als Dienstleister für hochschulinterne Angelegenheiten zugleich als ideelles Gedächtnis ihrer Hochschulen fungieren. Die Aachener Hochschularchive planen, zukünftig durch gemeinsame Ausstellungen die Inhalte dieses Gedächtnisses der Öffentlichkeit näher zu bringen und so ihre Zusammenarbeit noch zu vertiefen.
Sehr modern, und gar nicht verstaubt!
Nach der Begrüßung durch den Kanzler der FH führte Frau Frindt durch die Räumlichkeiten des Archivs. Eine Stunde später wurde die Veranstaltung im Gästehaus der RWTH fortgesetzt. Der Senatsvorsitzende und Mediävist Prof. Dr. Kerner stellte in seiner Begrüßungsrede die Herausforderungen für die Geisteswissenschaften an den potentiellen Elite-Hochschulen heraus. Frau Roll unterstrich in ihrer Begrüßung den Gesichtspunkt der Kooperation der verschiedenen Archive. Eine engere Zusammenarbeit der beiden Aachener Hochschularchive ist fest vorgesehen, mittelfristig sollten sich auch andere Aachener Archive zu einem Netzwerk zusammenschließen, wie es in anderen Städten (Düsseldorf, Bonn, Münster) bereits gut funktioniert.
Da eine Archivführung nicht vorgesehen war, stellte der Geschäftsführer des Hochschularchivs der RWTH das Archiv mittels einer Powerpoint-Präsentation vor.
Ein besonderer Schwerpunkt der Tätigkeit des RWTH-Archivs ist die Öffentlichkeitsarbeit (wechselnde Präsentationen im Hauptgebäude, Internetseite mit eigener Domain http://www.hochschularchiv-aachen.de, Archivkalender für 2007, Führungen u.a.m.). Dieses Thema war der Schwerpunkt der diesjährigen Zusammenkunft. Es bestand Konsens, dass Öffentlichkeitsarbeit zu den Kernaufgaben eines Hochschularchivs gehört. Insbesondere dient sie dazu, hochschulintern immer wieder auf die Existenz des Archivs hinzuweisen.
Abschließend dienten die Berichte aus den einzelnen Archiven dem Erfahrungsaustausch.
Im Vorfeld hatte die Pressestelle der FH folgenden Text ins Netz gestellt:
http://www.fh-aachen.de/232.html?&tx_ttnews[tt_news]=1319&tx_ttnews[backPid]=22&cHash=385b5a500d
Treffen der Hochschularchivare am 22.2.07 in Aachen
Archivare sind graue Mäuse, die auf einem Berg unnützen Wissens sitzen und die benötigten Informationen dann doch nicht finden?
Weit entfernt.
Wie aber bringt man das der unwissenden Öffentlichkeit bei?
Und wie weckt man Interesse für einen Besuch im Archiv?
Am Donnerstag, 22. Februar 2007, findet das jährliche Treffen der AG Hochschularchivare NRW in Aachen statt, diesmal mit dem Schwerpunktthema „Öffentlichkeitsarbeit in Archiven“. Das Treffen beginnt mit einem Besuch des Hochschularchivs der FH Aachen im Gebäude Boxgraben 100, wo die Teilnehmer von FH-Kanzler Reiner Smeetz begrüßt werden. Die Experten aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen folgen der Einladung des Zentralarchivs der FH und des Hochschularchivs der RWTH Aachen. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit, so der Plan der Veranstalter, soll das Image der Archive, speziell der Hochschularchive, grundlegend aufpoliert werden. Damit belegt die Veranstaltung nicht nur, dass Kooperationen zwischen Hochschularchiven möglich sind, sondern auch, dass sich in Aachen daraus ein lebendiges hochschulübergreifendes Archivwesen mit innovativen Ideen entwickelt. Die Aachener Archivare verstehen sich als moderne, serviceorientierte Informationsverwalter, die neben ihren Tätigkeiten als Dienstleister für hochschulinterne Angelegenheiten zugleich als ideelles Gedächtnis ihrer Hochschulen fungieren. Die Aachener Hochschularchive planen, zukünftig durch gemeinsame Ausstellungen die Inhalte dieses Gedächtnisses der Öffentlichkeit näher zu bringen und so ihre Zusammenarbeit noch zu vertiefen.
Sehr modern, und gar nicht verstaubt!
Nach der Begrüßung durch den Kanzler der FH führte Frau Frindt durch die Räumlichkeiten des Archivs. Eine Stunde später wurde die Veranstaltung im Gästehaus der RWTH fortgesetzt. Der Senatsvorsitzende und Mediävist Prof. Dr. Kerner stellte in seiner Begrüßungsrede die Herausforderungen für die Geisteswissenschaften an den potentiellen Elite-Hochschulen heraus. Frau Roll unterstrich in ihrer Begrüßung den Gesichtspunkt der Kooperation der verschiedenen Archive. Eine engere Zusammenarbeit der beiden Aachener Hochschularchive ist fest vorgesehen, mittelfristig sollten sich auch andere Aachener Archive zu einem Netzwerk zusammenschließen, wie es in anderen Städten (Düsseldorf, Bonn, Münster) bereits gut funktioniert.
Da eine Archivführung nicht vorgesehen war, stellte der Geschäftsführer des Hochschularchivs der RWTH das Archiv mittels einer Powerpoint-Präsentation vor.
Ein besonderer Schwerpunkt der Tätigkeit des RWTH-Archivs ist die Öffentlichkeitsarbeit (wechselnde Präsentationen im Hauptgebäude, Internetseite mit eigener Domain http://www.hochschularchiv-aachen.de, Archivkalender für 2007, Führungen u.a.m.). Dieses Thema war der Schwerpunkt der diesjährigen Zusammenkunft. Es bestand Konsens, dass Öffentlichkeitsarbeit zu den Kernaufgaben eines Hochschularchivs gehört. Insbesondere dient sie dazu, hochschulintern immer wieder auf die Existenz des Archivs hinzuweisen.
Abschließend dienten die Berichte aus den einzelnen Archiven dem Erfahrungsaustausch.
KlausGraf - am Donnerstag, 22. Februar 2007, 17:57 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Zusammenbinden mehrerer Drucke in der frühen Neuzeit erfolgte alles anderes als willkürlich. Historische Sammelbände sind daher immer auch historische Zeugnisse, die zeitgenössische Textgemeinschaften und Textverwandtschaften erkennen lassen.
Eine beliebte Praxis der Antiquariate ist es, diese Sammelbände auseinanderzunehmen und die Drucke einzeln zu verkaufen. Damit wird die historische Aussage der Mitüberlieferung zerstört.
Gibt es einen Grund, in der folgenden historischen Zusammenstellung keinen erhaltenswerten Bestand, den man tunlichst NICHT in den Antiquariatsverkauf geben sollte, zu sehen?
Sammelband mit 8 antilutherischen Schriften,
davon die ersten 7 von Konrad Vetter verfasst. Alle zwischen 1601-1608 in Ingolstadt bei Anergermayer erschienen. I.: Puffer Das ist/ Zerschmetterungen deß Predicantischen Jesuwiderspiegels Philip Heilbrunners: mit lebendiger Beschreibung sein unnd seiner Zunfftgenossen Predicantischen Geistes/ das ist/ Lugen- Läster- Lermen- Auffrhur- Mord- unnd Blutgirigen Geistes/ gar ordenlich in vier Püff abgetheylet..
Ingolstadt, Angermayer 1601
4 Bll., 348 S. - II.: Revocation Und offentlicher Widerruf: Wie M. Conradus Andreae &c. bald nach dem/ Anno 1601. zu Regenspurg gehaltenem Postcolloquio, vonn freyen stücken unnd unversehens inn sein Gewissen gangen/ unnd in optima forma an jetzo bekent/ welcher massen er dem theuren Mann D. Martin Luther/ in den 15. bißhero außgangenen Tractätlein deß unschuldigen Luthers genant/ unrecht gethan habe ... 1 Bl., 17 S. -III.: Der sanfftmütig unnd der Juristisch Luther/ Das ist: Die siebenzehend und achtzehend Prob/ wie Luther am verwüsten Teutschlandt unschuldig. 6 Bll., 46 S. - IV.: Heilbrunnischer Trumpff. Das ist/ Gründtliche Erklärung/ wie die zwen Predicanten Lip und Jacob Heilbrunner deß unschuldigen Luthers/ wie auch deß Regenspurgischen Postcolloquii halber/ so schwach und müde worden/ daß sie an jetzo von M. Conrado Andreae, ein freundtliches Urlaub zunemmen/ und am Hag hinab zudeichen gedrungen worden. 4 Bll., 116 S. - V.: Lutherisch Disciplin Büchel. Zur Bekrefftigung/ unnd Handhabung deß treffelichen Buchs D. Jacobi Heilbronners/ wider das Papistische Geißlen und Disciplinieren. 1 Bl., 20 S. - VI. Scharwerck. Und Frondienst für den Würdigen Herrn Abraha[m] Brucker Evangelischen Diener deß Worts: Wider Die nichtige/ untüchtige/ unnd unmügliche Ehrnrettung/ und Retorsion/ M. Bartl Rülichs Lutherischen Clamantens zu Augspurg/ Durch Andream de Cornu. Titelblatt mit Holzschnitt, einen gehörnten Luther zeigend. 1 Bl., 30 S. - VII.: Mantissa Ein gute/ völlige/ eingerüttelte/ und uberschüttelte versprochene Zugab/ stattlicher/ und unwidertreiblicher Argumenten/ unnd Beweysungen/ das Johan Deltzer Lutherischer Diacon von Tonawerth/ sein Communicanten Becherle/ oder Kelchle nicht gestolen hab/ [et]c./ Durch: Andream De Cornu. Titelblatt mit wiederholtem Holzschnitt des vorgebundenen Werkes. 1 Bl., 26 S. - VIII.: Pomerius, Georg: Kehrbesen Das ist: Reine Außkehrung der reinen Predigt/ deß Kehrwirdigen Herrens M. Melchioris Volcii/ reinen Predicantens/ inn der reinen Kirchen bey S. Anna in Augspurg/ gehalten an S. Andreae Tag Getruckt zu Tübingen in der Zellerischen Truckerey 1607. Zu besserer Nachrichtung aller deren/ so bemelte Volzische Predigt gelesen haben/ oder noch lesen möchten/ gestellet durch Georgium Pomerium. Titelblatt mit Holzschnitt. 1 Bl., 25 S. In einem sehr dekorativen Manuskriptpergament des 16. Jahrhunderts. Quarto. - VD17 12:109426D; 12:109457F; 12:109357A; 12:109444B; 12:109344W; 12:109551R; 12:109376F; 12:111907U. Zu Konrad Vetter: ADB XXXIX, 664. Unwesentliche Altersspuren, mit zeitgen. Besitzeintrag des Altöttinger Kapuzinerklosters. Schönes Exemplar des Sammelbandes mit 8 seltenen Polemiken!
Anbieter Antiquariat Uwe Turszynski, Deutschland
Preis: 1500 Euro.
Nachtrag: "Das Buch ist auf einer Messe im Ausland letzte Woche verkauft worden" (Mitteilung des Antiquars, 22.2.)
Übrigens geben auch hochangesehene kirchliche Institutionen protestantische Sammelbände (keineswegs Dubletten!) ab (weil sie nicht zum liturgisch-theologischen Sammelprofil gehören?): " So schenkte ein Löwensteiner 1894 dem wiedergegründeten Kloster Maria Laach Bücher, die im 18. Jahrhundert den Benediktinern von Neustadt am Main gehört hatten. (Aus dieser frommen Gabe ist - erstaunlich genug - ein wertvoller Sammelband jüngst von einem Händler dem Staatsarchiv Wertheim angeboten worden.)"
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/wertheim.htm (1995)
Eine beliebte Praxis der Antiquariate ist es, diese Sammelbände auseinanderzunehmen und die Drucke einzeln zu verkaufen. Damit wird die historische Aussage der Mitüberlieferung zerstört.
Gibt es einen Grund, in der folgenden historischen Zusammenstellung keinen erhaltenswerten Bestand, den man tunlichst NICHT in den Antiquariatsverkauf geben sollte, zu sehen?
Sammelband mit 8 antilutherischen Schriften,
davon die ersten 7 von Konrad Vetter verfasst. Alle zwischen 1601-1608 in Ingolstadt bei Anergermayer erschienen. I.: Puffer Das ist/ Zerschmetterungen deß Predicantischen Jesuwiderspiegels Philip Heilbrunners: mit lebendiger Beschreibung sein unnd seiner Zunfftgenossen Predicantischen Geistes/ das ist/ Lugen- Läster- Lermen- Auffrhur- Mord- unnd Blutgirigen Geistes/ gar ordenlich in vier Püff abgetheylet..
Ingolstadt, Angermayer 1601
4 Bll., 348 S. - II.: Revocation Und offentlicher Widerruf: Wie M. Conradus Andreae &c. bald nach dem/ Anno 1601. zu Regenspurg gehaltenem Postcolloquio, vonn freyen stücken unnd unversehens inn sein Gewissen gangen/ unnd in optima forma an jetzo bekent/ welcher massen er dem theuren Mann D. Martin Luther/ in den 15. bißhero außgangenen Tractätlein deß unschuldigen Luthers genant/ unrecht gethan habe ... 1 Bl., 17 S. -III.: Der sanfftmütig unnd der Juristisch Luther/ Das ist: Die siebenzehend und achtzehend Prob/ wie Luther am verwüsten Teutschlandt unschuldig. 6 Bll., 46 S. - IV.: Heilbrunnischer Trumpff. Das ist/ Gründtliche Erklärung/ wie die zwen Predicanten Lip und Jacob Heilbrunner deß unschuldigen Luthers/ wie auch deß Regenspurgischen Postcolloquii halber/ so schwach und müde worden/ daß sie an jetzo von M. Conrado Andreae, ein freundtliches Urlaub zunemmen/ und am Hag hinab zudeichen gedrungen worden. 4 Bll., 116 S. - V.: Lutherisch Disciplin Büchel. Zur Bekrefftigung/ unnd Handhabung deß treffelichen Buchs D. Jacobi Heilbronners/ wider das Papistische Geißlen und Disciplinieren. 1 Bl., 20 S. - VI. Scharwerck. Und Frondienst für den Würdigen Herrn Abraha[m] Brucker Evangelischen Diener deß Worts: Wider Die nichtige/ untüchtige/ unnd unmügliche Ehrnrettung/ und Retorsion/ M. Bartl Rülichs Lutherischen Clamantens zu Augspurg/ Durch Andream de Cornu. Titelblatt mit Holzschnitt, einen gehörnten Luther zeigend. 1 Bl., 30 S. - VII.: Mantissa Ein gute/ völlige/ eingerüttelte/ und uberschüttelte versprochene Zugab/ stattlicher/ und unwidertreiblicher Argumenten/ unnd Beweysungen/ das Johan Deltzer Lutherischer Diacon von Tonawerth/ sein Communicanten Becherle/ oder Kelchle nicht gestolen hab/ [et]c./ Durch: Andream De Cornu. Titelblatt mit wiederholtem Holzschnitt des vorgebundenen Werkes. 1 Bl., 26 S. - VIII.: Pomerius, Georg: Kehrbesen Das ist: Reine Außkehrung der reinen Predigt/ deß Kehrwirdigen Herrens M. Melchioris Volcii/ reinen Predicantens/ inn der reinen Kirchen bey S. Anna in Augspurg/ gehalten an S. Andreae Tag Getruckt zu Tübingen in der Zellerischen Truckerey 1607. Zu besserer Nachrichtung aller deren/ so bemelte Volzische Predigt gelesen haben/ oder noch lesen möchten/ gestellet durch Georgium Pomerium. Titelblatt mit Holzschnitt. 1 Bl., 25 S. In einem sehr dekorativen Manuskriptpergament des 16. Jahrhunderts. Quarto. - VD17 12:109426D; 12:109457F; 12:109357A; 12:109444B; 12:109344W; 12:109551R; 12:109376F; 12:111907U. Zu Konrad Vetter: ADB XXXIX, 664. Unwesentliche Altersspuren, mit zeitgen. Besitzeintrag des Altöttinger Kapuzinerklosters. Schönes Exemplar des Sammelbandes mit 8 seltenen Polemiken!
Anbieter Antiquariat Uwe Turszynski, Deutschland
Preis: 1500 Euro.
Nachtrag: "Das Buch ist auf einer Messe im Ausland letzte Woche verkauft worden" (Mitteilung des Antiquars, 22.2.)
Übrigens geben auch hochangesehene kirchliche Institutionen protestantische Sammelbände (keineswegs Dubletten!) ab (weil sie nicht zum liturgisch-theologischen Sammelprofil gehören?): " So schenkte ein Löwensteiner 1894 dem wiedergegründeten Kloster Maria Laach Bücher, die im 18. Jahrhundert den Benediktinern von Neustadt am Main gehört hatten. (Aus dieser frommen Gabe ist - erstaunlich genug - ein wertvoller Sammelband jüngst von einem Händler dem Staatsarchiv Wertheim angeboten worden.)"
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/wertheim.htm (1995)
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wieso entsetzt die Vernichtung riesiger Mengen (alter) Bücher so viele Menschen?
Wieso haben sehr viele Menschen, die Bücher lieben, eine Scheu davor, Bücher in den Müll zu werfen, auch wenn sie keinen Bedarf mehr dafür haben?
Besteht zwischen der Scheu, Bücher wegzuwerfen, und der Abscheu, mit der wir die NS-Bücherverbrennungen quittieren, eine geheime Verbindung?
Überregional bekanntgeworden ist die von dem Pfarrer Martin Weskott betriebene "Bücherburg Katlenburg" bei Göttingen, wo man gegen eine Spende Bücher mitnehmen kann. Nach der Wende wurden riesige Mengen DDR-Bücher vor der Entsorgung gerettet.
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/profil/443006/
http://www.buecherburg.de/
Sie haben überflüssige Bücher oder kennen jemanden, der gut erhaltene Bücher ins Altpapier wirft?
Bücher gehören nicht auf den Müll!
Bitte unterstützen Sie die Aktion
"BÜCHER WEITERGEBEN STATT WEGWERFEN"
Wussten Sie, ...
... dass der Physiker Hans Lauche vom Max-Planck-Institut für Aeronomie in einem Buch aus dem Büchermagazin Hinweise auf Materialkombinationen gefunden hat, die für den Bau eines Spektral-Fotometers für die Saturn-Sonde Cassini hervorragend geeignet waren?
Dazu auch:
http://www.tagesspiegel.de/dritte-seite/archiv/08.06.2006/2549283.asp
"Ein Ingenieur vom Max-Planck-Institut für Sonnenfeldforschung ganz in der Nähe hatte bei ihm ein altes DDR-Physik-Fachbuch gefunden. Und da stand drin, wie man eine Fassung macht aus Magnesiumsilikat. Eine Fassung, wie er sie brauchte für das Fotospektrometer der „Cassini“-Sonde."
Immer wieder werfen aber Bibliotheken kaltschnäuzig Bücher weg, die andere gerne gehabt hätten:
http://www.flickr.com/photos/ants_in_my_pants/91875957/
zur badischen Landesbibliothek

Foto: JochenB
Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://www.ib.hu-berlin.de/~ben/humboldt_buecher/
zur UB der Humboldt-Uni
http://weblog.ib.hu-berlin.de/?p=3299
Fürs Verschenken überzähliger Bücher plädiert:
http://www.rbb-online.de/_/themen/beitrag_jsp/key=5168898.html
Die Berliner Stadtreinigung listet auf, wer in Berlin Bücher für wohltätige Zwecke entgegennimmt:
http://www.bsr.de/bsr/html/5095.htm
Sie betreibt auch einen Verschenkmarkt:
http://www.bsr-verschenkmarkt.de/list.asp
Bücher nehmen insbesondere die Oxfam-Shops an:
http://www.oxfam.de/a_51_sachen_spenden.asp?me=51
Die Bibliotheken haben ihren Tausch über eine Mailingliste organisiert:
http://homepages.uni-tuebingen.de/juergen.plieninger/dubletten.htm
Weitere Hinweise zu Bücherprojekten in einer Liste von Umsonstökonomie-Projekten:
http://www.autoorganisation.org/mediawiki/index.php/Anders_Leben/Anders_wirtschaften/Umsonst%C3%B6konomien
Beispiel eines Umsonstladens:
http://www.neue-arbeit-hamburg.de/pmwiki.php/Main/BildetUmsonstl%e4den
Zur Bookcrossing-Szene
http://de.wikipedia.org/wiki/Bookcrossing
Beispiel einer Büchertauschbörse im WWW
http://www.meinbuch-deinbuch.com/
In manchen (viel zu wenigen) Städten gibt es öffentliche Bücherschränke, wie z.B. in Bonn:
 Quelle: http://www.guntherkrauss.de/bilder/bonn/oeffentlicher-buecherschrank.html
Quelle: http://www.guntherkrauss.de/bilder/bonn/oeffentlicher-buecherschrank.html
Weitere Hinweise, Ideen?
Wieso haben sehr viele Menschen, die Bücher lieben, eine Scheu davor, Bücher in den Müll zu werfen, auch wenn sie keinen Bedarf mehr dafür haben?
Besteht zwischen der Scheu, Bücher wegzuwerfen, und der Abscheu, mit der wir die NS-Bücherverbrennungen quittieren, eine geheime Verbindung?
Überregional bekanntgeworden ist die von dem Pfarrer Martin Weskott betriebene "Bücherburg Katlenburg" bei Göttingen, wo man gegen eine Spende Bücher mitnehmen kann. Nach der Wende wurden riesige Mengen DDR-Bücher vor der Entsorgung gerettet.
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/profil/443006/
http://www.buecherburg.de/
Sie haben überflüssige Bücher oder kennen jemanden, der gut erhaltene Bücher ins Altpapier wirft?
Bücher gehören nicht auf den Müll!
Bitte unterstützen Sie die Aktion
"BÜCHER WEITERGEBEN STATT WEGWERFEN"
Wussten Sie, ...
... dass der Physiker Hans Lauche vom Max-Planck-Institut für Aeronomie in einem Buch aus dem Büchermagazin Hinweise auf Materialkombinationen gefunden hat, die für den Bau eines Spektral-Fotometers für die Saturn-Sonde Cassini hervorragend geeignet waren?
Dazu auch:
http://www.tagesspiegel.de/dritte-seite/archiv/08.06.2006/2549283.asp
"Ein Ingenieur vom Max-Planck-Institut für Sonnenfeldforschung ganz in der Nähe hatte bei ihm ein altes DDR-Physik-Fachbuch gefunden. Und da stand drin, wie man eine Fassung macht aus Magnesiumsilikat. Eine Fassung, wie er sie brauchte für das Fotospektrometer der „Cassini“-Sonde."
Immer wieder werfen aber Bibliotheken kaltschnäuzig Bücher weg, die andere gerne gehabt hätten:
http://www.flickr.com/photos/ants_in_my_pants/91875957/
zur badischen Landesbibliothek

Foto: JochenB
Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://www.ib.hu-berlin.de/~ben/humboldt_buecher/
zur UB der Humboldt-Uni
http://weblog.ib.hu-berlin.de/?p=3299
Fürs Verschenken überzähliger Bücher plädiert:
http://www.rbb-online.de/_/themen/beitrag_jsp/key=5168898.html
Die Berliner Stadtreinigung listet auf, wer in Berlin Bücher für wohltätige Zwecke entgegennimmt:
http://www.bsr.de/bsr/html/5095.htm
Sie betreibt auch einen Verschenkmarkt:
http://www.bsr-verschenkmarkt.de/list.asp
Bücher nehmen insbesondere die Oxfam-Shops an:
http://www.oxfam.de/a_51_sachen_spenden.asp?me=51
Die Bibliotheken haben ihren Tausch über eine Mailingliste organisiert:
http://homepages.uni-tuebingen.de/juergen.plieninger/dubletten.htm
Weitere Hinweise zu Bücherprojekten in einer Liste von Umsonstökonomie-Projekten:
http://www.autoorganisation.org/mediawiki/index.php/Anders_Leben/Anders_wirtschaften/Umsonst%C3%B6konomien
Beispiel eines Umsonstladens:
http://www.neue-arbeit-hamburg.de/pmwiki.php/Main/BildetUmsonstl%e4den
Zur Bookcrossing-Szene
http://de.wikipedia.org/wiki/Bookcrossing
Beispiel einer Büchertauschbörse im WWW
http://www.meinbuch-deinbuch.com/
In manchen (viel zu wenigen) Städten gibt es öffentliche Bücherschränke, wie z.B. in Bonn:
 Quelle: http://www.guntherkrauss.de/bilder/bonn/oeffentlicher-buecherschrank.html
Quelle: http://www.guntherkrauss.de/bilder/bonn/oeffentlicher-buecherschrank.htmlWeitere Hinweise, Ideen?
http://opac.ku-eichstaett.de/InfoGuideClient/start.do?Login=opacw0
Die Sucheinschränkung nach Erscheinungsdatum (von bis) funktioniert nicht. Die Vernüpfung burghausen und kapuziner* erbringt nur wenige Treffer, obwohl Burghausen allein Treffer aufweist, die aus dem Kapuzinerkloster stammen, aber von der ersten Suche nicht angezeigt werden. Vielleicht kann mal ein Bibliothekar das klären ...
Auf jeden Fall kann man sehen, was die hochwürdigen Kapuziner so lesen und sich dann fragen, wieso frühneuzeitliche Drucke im Müll landen, aber so etwas sorgfältig katalogisiert wird:
Allert-Wybranietz, Kristiane
Titel Wenn's doch nur so einfach wär
Untertitel Verschenktexte
Verfasserangabe von Kristiane Allert-Wybranietz
Ausgabe 10. Auf.
Verlagsort Fellbach
Verlag Körner
ISBN 3-922028-09-8
Jahr 1987
Umfang 61 S. : Ill.
Sprache ger
Lokale Bemerkung Provenienz: Bibliothek der PP. Kapuziner Altötting / St. Konrad. - Alte Sign.: 8¹ Allert-Wybranietz Poe II 75
Die Sucheinschränkung nach Erscheinungsdatum (von bis) funktioniert nicht. Die Vernüpfung burghausen und kapuziner* erbringt nur wenige Treffer, obwohl Burghausen allein Treffer aufweist, die aus dem Kapuzinerkloster stammen, aber von der ersten Suche nicht angezeigt werden. Vielleicht kann mal ein Bibliothekar das klären ...
Auf jeden Fall kann man sehen, was die hochwürdigen Kapuziner so lesen und sich dann fragen, wieso frühneuzeitliche Drucke im Müll landen, aber so etwas sorgfältig katalogisiert wird:
Allert-Wybranietz, Kristiane
Titel Wenn's doch nur so einfach wär
Untertitel Verschenktexte
Verfasserangabe von Kristiane Allert-Wybranietz
Ausgabe 10. Auf.
Verlagsort Fellbach
Verlag Körner
ISBN 3-922028-09-8
Jahr 1987
Umfang 61 S. : Ill.
Sprache ger
Lokale Bemerkung Provenienz: Bibliothek der PP. Kapuziner Altötting / St. Konrad. - Alte Sign.: 8¹ Allert-Wybranietz Poe II 75
Die Oxford Journals konnte ich mit keinem Browser und keinem Computer jemals zum Laufen bringen. Die Seiten sind dort derart wirr programmiert und benutzerunfreundlich, dass die fehlende Funktionalität dann nicht mehr wundert. Der Support in Frankfurt ist ratlos.
Das WBIS (bei dem ohnehin das Deutsche Archiv fehlt, ein Witz sondersgleichen, aber das ist eine andere Geschichte) hat seit kurzem eine neue Optik, und der Zugriff ist, Zitat: "Bei externem Zugriff (Einzelnutzer) [...] derzeit nur mit neueren Versionen des Internet Explorers möglich."
Wieso läßt die DFG, die für diese Abos einen ganzen Haufen Geld zahlt, den Verlagen eigentlichen diesen Bockmist durchgehen? Ich empfehle zumindest eine Kürzung der Zahlungen.
Das WBIS (bei dem ohnehin das Deutsche Archiv fehlt, ein Witz sondersgleichen, aber das ist eine andere Geschichte) hat seit kurzem eine neue Optik, und der Zugriff ist, Zitat: "Bei externem Zugriff (Einzelnutzer) [...] derzeit nur mit neueren Versionen des Internet Explorers möglich."
Wieso läßt die DFG, die für diese Abos einen ganzen Haufen Geld zahlt, den Verlagen eigentlichen diesen Bockmist durchgehen? Ich empfehle zumindest eine Kürzung der Zahlungen.
Ladislaus - am Mittwoch, 21. Februar 2007, 15:23 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
In einer Stellungnahme schrieb der Hamburger evangelische Kirchenhistoriker Johann Anselm Steiger (siehe http://archiv.twoday.net/stories/3337360/ ):
Als die Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Flammen aufging, war das Entsetzen groß, noch größer aber der unwiederbringliche Verlust historischer Buchbestände. Doch immer noch ist es nicht nur solch höhere Gewalt, die die historische Bibliothekslandschaft nachhaltig schädigt. Ein Beispiel für einen eklatanten Eingriff in die Vielfalt der mitteleuropäisch-historischen Buchkultur durch Menschenhand liefert nun offenbar die Universitätsbibliothek Eichstätt, die Dutzende von Tonnen an historischem Bestand hat vernichten lassen. Das in diesem wie in ähnlich gelagerten Fällen apologetische Standard-Argument lautet, man habe nur Doubletten ausgesondert. Sollte sich der Verdacht erhärten, daß von der Vernichtung auch frühneuzeitliche Bestandssegmente betroffen sind, wofür manches spricht, wäre dies ein Skandal. Wann endlich dringt es ins Bewußtsein ein, daß es bezüglich der frühneuzeitlichen Drucke Doubletten nicht gibt, da Benutzungsspuren wie Besitzeinträge, Notizen usw. jedem Exemplar eine spezifische Charakteristik verleihen? Die zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach dem Reichsdeputationshauptschluß einsetzende Säkularisierung der Klöster hat in Bayern (und nicht nur hier) zu einem wahren Kahlschlag bezüglich der in diesen Institutionen aufbewahrten Buch- und Manuskriptschätze geführt. Offenbar ist man in Eichstätt bestrebt, just an diese unrühmliche Tradition anknüpfen. Tatsache aber ist: Aufgeklärt ist man nicht schon darum, weil man die Fehler dieser Epoche wiederholt.
(Gekürzt zitiert in: http://archiv.twoday.net/stories/3344981/ )
 Blick in die Kapuziner-Zentralbibliothek in Altötting
Blick in die Kapuziner-Zentralbibliothek in Altötting
Als die Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Flammen aufging, war das Entsetzen groß, noch größer aber der unwiederbringliche Verlust historischer Buchbestände. Doch immer noch ist es nicht nur solch höhere Gewalt, die die historische Bibliothekslandschaft nachhaltig schädigt. Ein Beispiel für einen eklatanten Eingriff in die Vielfalt der mitteleuropäisch-historischen Buchkultur durch Menschenhand liefert nun offenbar die Universitätsbibliothek Eichstätt, die Dutzende von Tonnen an historischem Bestand hat vernichten lassen. Das in diesem wie in ähnlich gelagerten Fällen apologetische Standard-Argument lautet, man habe nur Doubletten ausgesondert. Sollte sich der Verdacht erhärten, daß von der Vernichtung auch frühneuzeitliche Bestandssegmente betroffen sind, wofür manches spricht, wäre dies ein Skandal. Wann endlich dringt es ins Bewußtsein ein, daß es bezüglich der frühneuzeitlichen Drucke Doubletten nicht gibt, da Benutzungsspuren wie Besitzeinträge, Notizen usw. jedem Exemplar eine spezifische Charakteristik verleihen? Die zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach dem Reichsdeputationshauptschluß einsetzende Säkularisierung der Klöster hat in Bayern (und nicht nur hier) zu einem wahren Kahlschlag bezüglich der in diesen Institutionen aufbewahrten Buch- und Manuskriptschätze geführt. Offenbar ist man in Eichstätt bestrebt, just an diese unrühmliche Tradition anknüpfen. Tatsache aber ist: Aufgeklärt ist man nicht schon darum, weil man die Fehler dieser Epoche wiederholt.
(Gekürzt zitiert in: http://archiv.twoday.net/stories/3344981/ )
 Blick in die Kapuziner-Zentralbibliothek in Altötting
Blick in die Kapuziner-Zentralbibliothek in Altöttingnoch kein Kommentar - Kommentar verfassen


