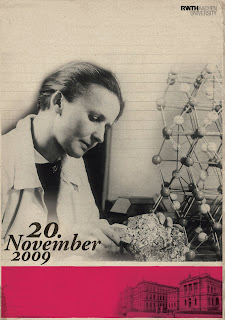KlausGraf - am Dienstag, 17. November 2009, 21:47 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wie den "Neuigkeiten"des Handschriftencensus zu entnehmen ist, befinden sich unter den digitalisierten Manuskripten auch zwei deutsche Handschriften des Mittelalters:
http://dla.library.upenn.edu/dla/medren/index.html

http://dla.library.upenn.edu/dla/medren/index.html

KlausGraf - am Dienstag, 17. November 2009, 21:31 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.perlentaucher.de/feuilletons/2009-11-17.html
Wenns schon mal vorgekommen sein sollte, ist es mir nicht aufgefallen. Ausgezahlt hat es sich laut Twoday-Referrern nicht: 10 Besucher kamen von da. Aber nett ist es trotzdem.
Wenns schon mal vorgekommen sein sollte, ist es mir nicht aufgefallen. Ausgezahlt hat es sich laut Twoday-Referrern nicht: 10 Besucher kamen von da. Aber nett ist es trotzdem.
KlausGraf - am Dienstag, 17. November 2009, 19:39 - Rubrik: Allgemeines
KlausGraf - am Dienstag, 17. November 2009, 18:52 - Rubrik: Archivrecht
Erb Gut Kunst - unter diesem Titel lädt der Deutsche Kunstrat zu einer öffentlichen Tagung ein, die anlässlich der EXPONATEC COLOGNE, der internationalen Fachmesse für Museen, Konservierung und Kulturerbe (17.-20.11.2009), stattfindet. Auf zwei Podien diskutieren Kunstexperten, Künstler und Wissenschaftler über den gesellschaftlichen Umgang mit dem kulturellen Erbe im Allgemeinen und der Archivierung von Künstlernachlässen im Besonderen.
Die Teilnahme ist für Besucher der EXPONATEC COLOGNE und der gleichzeitig stattfindenden Cologne Fine Art & Antiques kostenlos.
.....
26 Regalkilometer Akten, 65.000 Urkunden, 104.000 Karten und Pläne, 50.000 Plakate sowie 800 Nachlässe und Sammlungen verschüttet - so lautete die Schadensmeldung nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs. Infolge der Katastrophe ist die Debatte nach dem Umgang mit dem kulturellen Erbe weit über die Domstadt hinaus neu entflammt. Gleichzeitig haben weitere Entwicklungen bildgebender Verfahren die Diskussion über die Bedeutung von Original versus Reproduktion verstärkt. Braucht der Betrachter das Original, wenn er eine digitale Version oder Reproduktionen mit nach Hause nehmen oder auf dem Bildschirm abrufen kann? Oder schafft der digitale Zugriff gar eine neue Sehnsucht, ein neues Bewusstsein für Originale und deren Werte?
Vor diesem Hintergrund befasst sich das von Thomas Wulffen moderierte Podium mit der Frage nach neuen Formen der Rezeption und mit der gesellschaftlichen Verantwortung für das kulturelle Erbe. Seine Gesprächspartner sind Dr. Holger Simon (Verband Deutscher Kunsthistoriker), Dr. Ursel Berger (Georg-Kolbe-Museum, Berlin) und Ingo Terrumanum (Ver.di / Künstler, Köln).
Welche Kriterien entscheiden über die Bewahrung von Kunst- und Kulturgut? Mit dem Thema Archivierung und Präsentation am Beispiel von Künstler- bzw. Kunstvermittler-Nachlässen beschäftigen sich Dr. Birgit Jooss (Deutsches Kunstarchiv, Nürnberg), Prof. Dr. Günter Herzog (ZADIK - Zentralarchiv des internationalen Kunsthandels, Köln) und der Künstler Ingo Ronkholz (Krefeld). Die Moderation übernimmt Kathy Kaaf.
Den Podiumsdiskussionen vorangestellt ist ein Eröffnungsvortrag von Dr. Katharina Corsepius über den Einsturz des Kölner Stadtarchivs und seine Folgen.
Organisation: Birgit Maria Sturm, Sprecherin des Deutschen Kunstrats.
Link zum Flyer (PDF)
Wolf Thomas - am Dienstag, 17. November 2009, 18:26
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Dokumentationsstelle der Stiftung Sächsische Gedenkstätten Dresden hat zwei Datenbanken freigeschaltet, die eine Recherche nach vermissten Opfern des Zweiten Weltkrieges ermöglichen.
Eine Datenbank zu ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen mit 700.000 Datensätzen und eine Datenbank zu von sowjetischen Kriegstribunalen verurteilten Deutschen mit 10.000 Daten.
www.dokst.de
via sachsen.de
Eine Datenbank zu ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen mit 700.000 Datensätzen und eine Datenbank zu von sowjetischen Kriegstribunalen verurteilten Deutschen mit 10.000 Daten.
www.dokst.de
via sachsen.de
Cherubinos - am Dienstag, 17. November 2009, 17:35 - Rubrik: Staatsarchive
KlausGraf - am Dienstag, 17. November 2009, 13:03 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 17. November 2009, 12:52 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ....Die Stadt muss sparen. Auch im kulturellen Bereich. Angesichts der drohenden Preiserhöhungen in den meisten städtischen Kulturtreffs spricht die im Rat vertretene „Soziale Liste” schon von „kultureller Eiszeit”. Aber auch in den anderen Parteien herrschen kollektive Bauchschmerzen. .....Massive Veränderungen drohen dagegen dem Stadtarchiv: Das hatte erst 2007 u.a. wegen Schimmelpilz das Gebäude an der Kronenstraße geräumt und war in das BP/Aral-Gebäude an der Wittener Straße gezogen. Doch Miete und Nebenkosten belaufen sich dort auf 1,9 Millionen Euro jährlich, wobei allein die Klimaanlage mit 700 000 Euro zu Buche schlägt. Die Idee der Stadtverwaltung: Neubau eines Magazingebäudes ohne Flächen für ein stadthistorische Museum. Der Bau würde etwa 9,5 Mio Euro kosten, die jährlichen Belastungen dabei bei rund 700 000 Euro liegen. Somit könnten 1,13 Mio laufende Kosten jährlich einge-spart werden. Wo dabei die Kosten für die Klimaanlage abgeblieben sind, geht aus den Unterlagen allerdings nicht hervor. Weitere 250 000 Euro Einsparung soll die Schließung der Außenstelle Wattenscheid und die Aufgabe der Lagerräume für kontaminiertes Archivmaterial bringen. Außerdem sind Gebühren (25,50 Euro) für Einsicht in Archivarien geplant. ....."
Stadtarchivbezogene Kommentare:
#8 (Sublimer): " ... Bei anderem, wie dem Stadtarchiv fasse ich mir nur an den Kopf, wer hatte denn die Idee bei den Preisen überhaupt jemals da einzuziehen? Manche der Sparideen beim Archiv allerdings empfinde ich dann schon als eine Vernachlässigung des städtischen Kulturauftrags. ...."
#22 (BochuminNot): "Gott sei Dank, jetzt werden die hochtrabenen Pläne von Wölk, Pätzold & Co. vom Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte - sprich Stadtarchiv - endlich in die Ecke verwiesen. Das geschwollene Gelaber zur Pflege persönlicher Interessen geht fast jedem Bochumer seit Wagners Zeiten gehörig auf den Wecker. Was dabei herauskommt konnte jede in der merkwürdigen Ausstellung besichtigen. Das Stadtarchiv sollte sich auf seine genuinen Aufgaben beschränken und nicht Katapult für Großmanns/frausträume sein."
Quelle: derwesten.de
Stadtarchivbezogene Kommentare:
#8 (Sublimer): " ... Bei anderem, wie dem Stadtarchiv fasse ich mir nur an den Kopf, wer hatte denn die Idee bei den Preisen überhaupt jemals da einzuziehen? Manche der Sparideen beim Archiv allerdings empfinde ich dann schon als eine Vernachlässigung des städtischen Kulturauftrags. ...."
#22 (BochuminNot): "Gott sei Dank, jetzt werden die hochtrabenen Pläne von Wölk, Pätzold & Co. vom Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte - sprich Stadtarchiv - endlich in die Ecke verwiesen. Das geschwollene Gelaber zur Pflege persönlicher Interessen geht fast jedem Bochumer seit Wagners Zeiten gehörig auf den Wecker. Was dabei herauskommt konnte jede in der merkwürdigen Ausstellung besichtigen. Das Stadtarchiv sollte sich auf seine genuinen Aufgaben beschränken und nicht Katapult für Großmanns/frausträume sein."
Quelle: derwesten.de
Wolf Thomas - am Dienstag, 17. November 2009, 09:46 - Rubrik: Kommunalarchive
" .... Gut acht Monate nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs kommt es zum ersten Prozess. Das Landgericht in Köln befasst sich am Dienstag (17.11.09) mit der Forderung nach Schadenersatz dreier Leihgeber, die dem Archiv Materialien überlassen hatten. .....Dazu zählte auch der "Bestand 1577", hinter dem sich der Nachlass des 1995 verstorben amerikanischen Baritons William Pearson verbirgt. Der Regisseur Franz-Josef Heumannskämper hatte dem Archiv 1998 insgesamt 47 Kartons mit Noten, Briefen und Fotos des in der deutschen und Kölner Musikszene bekannten US-Musikers übergeben. Neben Heumannskämper fordern auch die Gebrüder König und die Familie von Wittgenstein Schadenersatz von der Stadt. Die Wittgensteins hatten bereits 1952 das gesamte Familienarchiv an die Stadt gegeben. Zum Bestand des Historischen Archivs gehörte auch der Nachlass des Soziologen René König. Er zählt neben Helmut Schelsky und Theodor W. Adorno zu den führenden deutschen Soziologen der Nachkriegszeit. Die Familie übertrug in Abstimmung mit der René-König-Gesellschaft 2001 die Archivierung und Betreuung des Nachlasses dem Kölner Stadtarchiv....."
Quelle: http://www.wdr.de/themen/panorama/26/koeln_hauseinsturz/091117.jhtml
Nachtrag: Frank Überall twittert: "Richter am Landgericht scheint die Stadt in Schutz zu nehmen"
2. Nachtrag:Frank Überall twittert: "Prozess Stadtarchiv-Einsturz vertagt: Urteil geplant am 12.1.2010"
Quelle: http://www.wdr.de/themen/panorama/26/koeln_hauseinsturz/091117.jhtml
Nachtrag: Frank Überall twittert: "Richter am Landgericht scheint die Stadt in Schutz zu nehmen"
2. Nachtrag:Frank Überall twittert: "Prozess Stadtarchiv-Einsturz vertagt: Urteil geplant am 12.1.2010"
Wolf Thomas - am Dienstag, 17. November 2009, 09:34 - Rubrik: Kommunalarchive
KlausGraf - am Dienstag, 17. November 2009, 01:17 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.internet-law.de/2009/11/bild-darf-foto-eines-berliner.html
http://www.kanzleikompa.de/2009/08/31/kollege-e-the-man-without-a-face/
http://www.eisenberg-koenig.de/entscheidung.php?id=34
In der Google-Bildsuche habe ich ein Bild des bildscheuen Rechtsanwalts gefunden, das ich hier exklusiv präsentiere:

http://www.kanzleikompa.de/2009/08/31/kollege-e-the-man-without-a-face/
http://www.eisenberg-koenig.de/entscheidung.php?id=34
In der Google-Bildsuche habe ich ein Bild des bildscheuen Rechtsanwalts gefunden, das ich hier exklusiv präsentiere:

KlausGraf - am Dienstag, 17. November 2009, 00:27 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 16. November 2009, 23:48 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.perlentaucher.de/blog/64_schutzlos_ausgeliefert_im_internet%3f
Das Kräftegleichgewicht zwischen Urhebern und Verwertern droht sich durch die Einführung eines Leistungsschutzrechts für Verleger zu verschieben. Zu diesem Ergebnis kommt ein im Auftrag des Bayerischen Journalistenverbands verfasstes Gutachten, das am 3. Dezember 2009 in der Zeitschrift Kommunikation und Recht erscheinen und ab dem 14. Dezember auch online zur Verfügung stehen wird.
Zum Vorschlag:
Der § 38 des Urheberrechtsgesetzes sollte nach Ansicht der Autoren zu zwingendem Recht werden. Das würde bedeuten, dass der heutzutage gängigen Buyout-Praxis, die dazu führt, dass Autoren alle Rechte an ihren Texten an den Verlag verlieren, ein Riegel vorgeschoben würde.
Siehe dazu auch meinen Kommentar "Urheberrechtsfibel" http://www.contumax.de zu § 38 UrhG. Wäre § 38 UrhG zwingendes Recht, könnte man sich Sonderregelungen für öffentlich geförderte Publikationen, wie sie in der Diskussion sind, sparen.
Update:
http://www.irights.info/index.php?id=81&tx_ttnews[tt_news]=439&cHash=bcbdee822d
http://futurezone.orf.at/stories/1632090/
http://carta.info/18439/leistungsschutzrecht-alter-wein-in-alten-schlaeuchen/
Das Kräftegleichgewicht zwischen Urhebern und Verwertern droht sich durch die Einführung eines Leistungsschutzrechts für Verleger zu verschieben. Zu diesem Ergebnis kommt ein im Auftrag des Bayerischen Journalistenverbands verfasstes Gutachten, das am 3. Dezember 2009 in der Zeitschrift Kommunikation und Recht erscheinen und ab dem 14. Dezember auch online zur Verfügung stehen wird.
Zum Vorschlag:
Der § 38 des Urheberrechtsgesetzes sollte nach Ansicht der Autoren zu zwingendem Recht werden. Das würde bedeuten, dass der heutzutage gängigen Buyout-Praxis, die dazu führt, dass Autoren alle Rechte an ihren Texten an den Verlag verlieren, ein Riegel vorgeschoben würde.
Siehe dazu auch meinen Kommentar "Urheberrechtsfibel" http://www.contumax.de zu § 38 UrhG. Wäre § 38 UrhG zwingendes Recht, könnte man sich Sonderregelungen für öffentlich geförderte Publikationen, wie sie in der Diskussion sind, sparen.
Update:
http://www.irights.info/index.php?id=81&tx_ttnews[tt_news]=439&cHash=bcbdee822d
http://futurezone.orf.at/stories/1632090/
http://carta.info/18439/leistungsschutzrecht-alter-wein-in-alten-schlaeuchen/
KlausGraf - am Montag, 16. November 2009, 23:20 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.sueddeutsche.de/computer/307/494641/text/
Die SZ geht anlässlich der Vorstellung des überarbeiteten Settlement auch auf Libreka ein.
Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels fordert bekanntlich die "Schaffung einer Deutschen Digitalen Bibliothek." Das klingt sinnvoll. Wer aber die bestehenden Projekte aus deutscher Hand im Netz kennt, zweifelt am Erfolg eines solchen Modells. Einerseits, weil die Konkurrenz übermächtig ist: Google ist mit schier unendlichen Bargeldreserven ausgestattet. Andererseits aber auch deshalb, weil deutsche Verlage und öffentliche Einrichtungen nach wie vor das Netz als Ort für den erweiterten Abverkauf begreifen - aber nicht als Chance für mediengerechte Innovationen.
Sinnfreie Volltext-Suche
Deutlich wird dies am Projekt Libreka des Börsenvereins, das oft zum Google-Books-Konkurrenten ernannt wurde. Die Webseite ist aber nichts als eine schlichte Plattform für den Buchverkauf, auf der man in ein paar digitalisierten Buchseiten blättern kann.
Die gepriesene Volltext-Suche, mit der man gelistete Bücher durchsuchen kann, funktioniert zwar, bleibt aber aufgrund der begrenzten Funktion des Angebotes sinnfrei. Was hat der Suchende davon, zu wissen, dass Mephisto zwar in Goethes "Faust" zu finden ist, solange er den eigentlichen Treffer seiner Suche nicht sehen kann, weil Libreka von "Faust" nur das Vorspiel auf dem Theater bereit hält.
Die SZ geht anlässlich der Vorstellung des überarbeiteten Settlement auch auf Libreka ein.
Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels fordert bekanntlich die "Schaffung einer Deutschen Digitalen Bibliothek." Das klingt sinnvoll. Wer aber die bestehenden Projekte aus deutscher Hand im Netz kennt, zweifelt am Erfolg eines solchen Modells. Einerseits, weil die Konkurrenz übermächtig ist: Google ist mit schier unendlichen Bargeldreserven ausgestattet. Andererseits aber auch deshalb, weil deutsche Verlage und öffentliche Einrichtungen nach wie vor das Netz als Ort für den erweiterten Abverkauf begreifen - aber nicht als Chance für mediengerechte Innovationen.
Sinnfreie Volltext-Suche
Deutlich wird dies am Projekt Libreka des Börsenvereins, das oft zum Google-Books-Konkurrenten ernannt wurde. Die Webseite ist aber nichts als eine schlichte Plattform für den Buchverkauf, auf der man in ein paar digitalisierten Buchseiten blättern kann.
Die gepriesene Volltext-Suche, mit der man gelistete Bücher durchsuchen kann, funktioniert zwar, bleibt aber aufgrund der begrenzten Funktion des Angebotes sinnfrei. Was hat der Suchende davon, zu wissen, dass Mephisto zwar in Goethes "Faust" zu finden ist, solange er den eigentlichen Treffer seiner Suche nicht sehen kann, weil Libreka von "Faust" nur das Vorspiel auf dem Theater bereit hält.
KlausGraf - am Montag, 16. November 2009, 23:17 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.inf.uni-konstanz.de/netethicsblog/?p=181
Auf dem “First Forum on Free culture and access to knowledge: Organization and action”, das in Barcelona vom 20. Oktober bis zum 1. November mit Teilnehmern aus 20 Ländern durchgeführt wurde, wurde die “Charter for Innovation, Creativity and Access to Knowledge. Citizens’ and artists’ human rights in the digital age” verabschiedet.
Auf dem “First Forum on Free culture and access to knowledge: Organization and action”, das in Barcelona vom 20. Oktober bis zum 1. November mit Teilnehmern aus 20 Ländern durchgeführt wurde, wurde die “Charter for Innovation, Creativity and Access to Knowledge. Citizens’ and artists’ human rights in the digital age” verabschiedet.
KlausGraf - am Montag, 16. November 2009, 23:16 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die berühmte Walberberger Dominikanerbibliothek mit über 140.000 Bänden wurde nicht in alle Winde zerstreut, sondern als Depositum der Dom- und Diözesanbibliothek Köln übergeben, die nun eine Auswahl aus den Schätzen im Rahmen einer Ausstellung zeigt. Die Website enthält auch einige Beiträge aus der Sekundärliteratur zur Walberberger Bibliothek als Volltexte:
http://www.dombibliothek-koeln.de/index1.html?/veranstaltung/fest_alb_09/index.html

http://www.dombibliothek-koeln.de/index1.html?/veranstaltung/fest_alb_09/index.html

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.lib.colum.edu/archives/mss_fischetti/
Via
http://blog.scad.edu/vrc/2009/11/13/the-john-fischetti-editorial-cartoon-sketchbook-project/

Via
http://blog.scad.edu/vrc/2009/11/13/the-john-fischetti-editorial-cartoon-sketchbook-project/

KlausGraf - am Montag, 16. November 2009, 23:01 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 16. November 2009, 20:13 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Von meinem Buch "Sagen der Schwäbischen Alb"
http://www.amazon.de/Sagen-Schw%C3%A4bischen-Alb-Klaus-Graf/dp/3871810312
http://archiv.twoday.net/stories/5401895/
http://archiv.twoday.net/search?q=sagen+schw%C3%A4bischen+alb
stehen 24 Seiten, nämlich das Kapitel "Auf der rauhen Alb" (S. 147-170) auf der Verlagswebsite zur Verfügung:
http://www.drw-verlag.de/buch/download/sagenderschwalb/Leseprobe.pdf

http://www.amazon.de/Sagen-Schw%C3%A4bischen-Alb-Klaus-Graf/dp/3871810312
http://archiv.twoday.net/stories/5401895/
http://archiv.twoday.net/search?q=sagen+schw%C3%A4bischen+alb
stehen 24 Seiten, nämlich das Kapitel "Auf der rauhen Alb" (S. 147-170) auf der Verlagswebsite zur Verfügung:
http://www.drw-verlag.de/buch/download/sagenderschwalb/Leseprobe.pdf

KlausGraf - am Montag, 16. November 2009, 16:05 - Rubrik: Landesgeschichte
Dank des freundlichen Entgegenkommens des Verlegers konnte ich meine "Sagen rund um Stuttgart" (Braun Verlag: Karlsruhe 1995) durch GINDOK scannen und einstellen lassen:
http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2009/13809/
Das PDF ist mit unkorrigierter OCR versehen.

Einige Kostproben aus
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/sagslg.htm
Stuttgart: Das mutige Heer in Stuttgart
(1785 aufgezeichnet vom Gymnasiasten Hegel,
dem späteren Philosophen)
Samstags den 9 Julii. Hat je der Aberglaube ein schrökliches unter aller Menschen-Vernunfft dummes Abentheuer ausgebrütet, so ist es gewiß das sogenannte Muthes Heer (muthige Heer). Am vergangenen Sonntag Nachts um 1 oder 2 haben viele Leute behauptet sie haben es [gesehen], sogar (pudendum dictu) Leute, von denen man mehr Aufklärung erwartet, und die in offentlichen Amtern stehen. Dieses alte Weib will einen feurigen Wagen mit Menschen gesehen haben, jene wieder was anders. Gemeiniglich sagt man, es seye der Teufel in einem feurigen Wagen, vornen daraus fliege ein Engel Gottes, und rufe jedermann zu: Aus dem Weg das mutige Heer kommt, wer dieser göttlichen Warnung nicht folge werde von Herrn Teufel in seine Residenz geschleift.
Sonntags den 10 Julii. Doch auf das Mutige Heer von Sonntag zu kommen, so erzält man es mit den nemliche Umstände, und verschiedene Personen sind mir genannt worden, die es gesehen oder gehört haben (es ist nemlich ein abscheuliches Gerassel). Einige Tage hernach klärte es sich auf, daß es -- (o Schande! Schande!) Gutschen waren. Herr von Türkheim gab nemlich ein Concert, das sehr zalreich war; es dauerte bis um 2; um nun die Gäste nicht in der Finsterniß heimtappen zu lassen, ließ [er] alle mit Gutschen und Faklen heimfüren. Und das war dieß Muthige Heer. Ha! Ha! Ha! O tempora! o mores! geschehen Anno 1785. O! O!
Monntags den 11 Julii. Bei diesem Vorfall trug sich noch folgende Anekdote zu. Burgersleute kamen auf die Hauptwacht, und erzählten diesen Vorfall, batten zugleich den kommandierenden Officier, er möchte Acht geben lassen, ob denn das muthige Heer wiederkomme. Der Lieutenant gab der Wacht den Befel, er sollte Acht geben. Der Soldat, der villeicht noch nichts davon gehört hatt fragte: Wenn es kommt, befelen Ewr Gnade der Herr Lieutenant, daß ich es anhalten soll. Ja, ja, sagte der Lieutenant, halt er es nur an. Es blieb aber aus.
Dienstags den 12 Julii. Eine änliche Geschichte ereignete sich neulich. 4 Frauenzimmer furen von ChausséeHaus, auf der Ludwigsburger Strasse hieher (man kommt am Galgen vorbei) und es war um 12 Uhr Nachts. Bei ChausséeHaüslein seye nun ein reutender Postknecht OHNE KOPF zu inen gekommen, und immer bald neben bald vor bald hinter der Gutsche mit inen geritten. Der Gutscher wollte ausweichen allein der Postknecht folgte immer, bis er endlich am Thor verschwand. Dies beruhte doch auf der Aussage von 5 oder 6 Personen. Erst etliche Tage nachher erklärte ein Officier, daß er gerade an dem Ort und zu der Zeit zu einer Gutsche gekommen, und mitgeritten sey, er habe aber nicht durch dieses Thor hinein mögen, seye also da von inen hinweg und einen andern Weg geritten. Er sagte dabei, Er habe nicht begriffen können, warum ihm der Gutscher immer habe ausweichen wollen. (1)
***
Stuttgart: Das Muotisheer über Stuttgart
Das "Muotisheer" nimmt manchmal in der Nacht seinen Weg über die Stadt Stuttgart hin, und wenn das geschieht, kann man sich darauf verlassen, daß es am folgenden Tage brennt. Oft wird ein solcher Brand freilich nicht offenbar, weil ihn die Hausbewohner vertuschen; aber mit der Sache hat es nichts desto weniger seine Richtigkeit. Einmal wird das Muotisheer auch wieder den Weg über die Stadt hin machen und diese dann ganz in Feuer aufgehn. (2)
***
Stuttgart: Die weiße Frau zu Stuttgart
Es ist bekannt, daß sich, bevor eine fürstliche Person unseres Landes stirbt, in dem alten Schlosse eine weiße Frau sehen läßt. So viel ich gehört habe, steigt sie dann allemal aus der Gruft in der Stiftskirche und wandelt über den sogenannten Schillersplatz dorthin. Vor etwa 60 Jahren bekam der hiesige Kaufmann M. einen Schlaganfall. Die Magd mußte sogleich in die Apotheke und zwar in die Hofapotheke. Wie sie beim alten Canzleigebäude hineingehen will, versperrt ein riesiges Weib ihr den Weg. Alles mögliche versucht sie, hinein zu gelangen, ohne sich im Geringsten zu fürchten. Vergebens! Sie muß wieder umkehren. Bei ihrer Herrschaft angelangt, erzählt sie das Vorgefallene. Man hält sie für eine furchtsame Träumerin und schickt den Knecht fort. Aber diesem widerfuhr dasselbe: eine Gestalt huscht immer vor ihm her, so daß er unmöglich hinein kommen kann. Er geht weg und in den König von England, wo sein Kamerade als Hausknecht dient. Er sagt ihm, was er gesehen hat: "Hä", ruft dieser "das ist nichts so Seltenes! Gieb Acht, da ruft der Tod Jemand vom Hofe wieder ab!" Er wartet bei ihm ein wenig, und geht dann wieder hinüber. Alles ist ruhig, und er gelangt ungefährdet in die Apotheke und von da zurück. Wenige Tage darauf starb eine Herzogin; welche? kann ich nicht angeben. (3)
***
Stuttgart: Das Bettelhaus zu Stuttgart
In einem der Gebäude, welche den Bebenhäuser Hof zu Stuttgart bilden, im sogenannten Bettelhause, muß zu einer gewissen Zeit des Jahres Brot an die Armen gereicht werden. Unterbleibt es, so entsteht in dem Haus ein solcher Unfug, daß es niemand aushalten kann. (6)

***
Hohengehren (Schurwald): Hexenwald und Teufelsbrücke
Im Hexenwald und an der Teufelsbrücke spukts. Die Eltern haben uns verboten, da durchzugehen. Aber wir sind mit zwölf als Mutprobe durch den Hexenwald gegangen. An der Teufelsbrücke hat man vor ungefähr 20 Jahren Kinder umgebracht. (114)
***
Plochingen: Der Mann ohne Kopf (eine Anti-Sage)
Zwischen Plochingen und Altbach an der Straße konnte man bei Nacht einen Mann ohne Kopf mit feurigem Schwert in der Hand sehen.
Der Vater einer Gewährsfrau ging der Sache nach und stellte fest, daß es ein Baum ist mit "Schein". Dieser Mann hat nicht an Gespenster geglaubt. (128)
***
Ludwigsburg: Das Vehmgericht
Einst, so erzählt die Sage, als das Vehmgericht noch in Deutschland waltete, hauste in der Gegend der heutigen Stadt Ludwigsburg ein Graf namens Emich, welcher von Raubzügen lebte und beinahe zu einem gemeinen Straßenräuber herabgesunken war. Er hatte schon manche Mordthat an armen Reisenden begangen und seine Strafe sollte auch nicht ausbleiben. Als er einst wieder durch den Wald zog und auf der Lauer stand, nahten sich ihm einige Männer; eben wollte er sie anhalten, als sie sich für Schöffen des Vehmgerichts ausgaben, welche gesandt seyen, um ihn vor die heilige Vehme zu laden. Der Graf, welcher wohl wußte, daß er nichts gewinnen würde, wenn er dem Aufgebot nicht Folge leisten würde, gieng willig mit ihnen und gelangte so auf manchen Umwegen und durch verworrene Gänge zu einer tief im Wald verborgenen Höhle. Als er eingetreten war, erblickte er in einem scharz ausgeschlagenen, schwach beleuchteten Raum 12 vermummte schwarze Richter vor einem Tisch, auf welchem Schädel und Kreuz standen. Einer der Richter erhob sich und las die Beschuldigung und das Urtheil vor, welches auf Tod lautete. Ruhig hörte der Graf zu; als aber die Henker, welche auf einen Wink des obersten Richters herbeieilten, ihn greifen wollten, zog er kurz besonnen sein so oft erprobtes Schwert, wand sich aus den Händen der Henker und legte mit Einem Schlag einem der Richter den Kopf vor die Füsse. Gleiches Schicksal theilten mit ihm noch 10 der Richter, lauter starke und handfeste Leute; den 12ten aber ließ er wie aus Zufall entspringen und indem er sich stets an seinem langen Gewand hielt, gelangte er so wieder ins Freie, was ihm ohne diese List schwerlich gelungen wäre. Natürlich hatte der Ritter von dieser Zeit an weder Ruh noch Rast und wandelt noch jetzt als Gespenst in jenem Walde. (246)
Kaum ein Text aus den "Sagen rund um Stuttgart" demonstriert deutlicher den Einfluß der Ritterromane und populären Vorstellungen über das Mittelalter auf die vermeintlichen "Volkssagen". In der Ludwigsburger Emichsburg, einer Nachbildung einer zerfallenen Ritterburg, saß Ritter Emich, der angebliche Stammvater des württembergischen Hauses, der uns bereits in Beutelsbach begnete, mit seinem Beichtvater an einem Tisch. Noch größeren Eindruck muß damals eine Grotte bei Schloß Monrepos auf ihre Besucher gemacht haben. Dargestellt war ein Vehmgericht. Zwölf Ritter saßen an einem Tisch, auf dem - wie in der Erzählung angegeben - ein Kruxifix und ein Totenkopf lagen.
Nachweise
(1) G. W. F. Hegel, Tagebuch, in: Gesammelte Werke Bd. 1, 1989, S. 8f.
(2)Württembergische Landesbibliothek Stuttgart Cod. poet. et phil. qt. 134 (=Schott) II, Bl. 236.
(3) Schott II, Bl. 240-240v (Mühlbach VIII. 1847).
(6) Schott II, Bl. 242 ("Mündlich v. Hauptm. Dürrich").
(114) Erzählerin (28.8.1993): Anhalterin aus Hohengehren, ca. 20.
(128) O. Wurster, Heimat-Geschichte Plochingen, 1949, S. 479
(246) Schott I, Bl. 339-340v (Häring IX. 1847, "Mündlich aus der Gegend von Ludwigsburg"). Emichsburg: J.D.G. Memminger, Stuttgart und Ludwigsburg, 1817, S. 433f. Vehmgericht: Zs. württ. Landesgesch. 51 (1992) S. 284.
http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2009/13809/
Das PDF ist mit unkorrigierter OCR versehen.

Einige Kostproben aus
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/sagslg.htm
Stuttgart: Das mutige Heer in Stuttgart
(1785 aufgezeichnet vom Gymnasiasten Hegel,
dem späteren Philosophen)
Samstags den 9 Julii. Hat je der Aberglaube ein schrökliches unter aller Menschen-Vernunfft dummes Abentheuer ausgebrütet, so ist es gewiß das sogenannte Muthes Heer (muthige Heer). Am vergangenen Sonntag Nachts um 1 oder 2 haben viele Leute behauptet sie haben es [gesehen], sogar (pudendum dictu) Leute, von denen man mehr Aufklärung erwartet, und die in offentlichen Amtern stehen. Dieses alte Weib will einen feurigen Wagen mit Menschen gesehen haben, jene wieder was anders. Gemeiniglich sagt man, es seye der Teufel in einem feurigen Wagen, vornen daraus fliege ein Engel Gottes, und rufe jedermann zu: Aus dem Weg das mutige Heer kommt, wer dieser göttlichen Warnung nicht folge werde von Herrn Teufel in seine Residenz geschleift.
Sonntags den 10 Julii. Doch auf das Mutige Heer von Sonntag zu kommen, so erzält man es mit den nemliche Umstände, und verschiedene Personen sind mir genannt worden, die es gesehen oder gehört haben (es ist nemlich ein abscheuliches Gerassel). Einige Tage hernach klärte es sich auf, daß es -- (o Schande! Schande!) Gutschen waren. Herr von Türkheim gab nemlich ein Concert, das sehr zalreich war; es dauerte bis um 2; um nun die Gäste nicht in der Finsterniß heimtappen zu lassen, ließ [er] alle mit Gutschen und Faklen heimfüren. Und das war dieß Muthige Heer. Ha! Ha! Ha! O tempora! o mores! geschehen Anno 1785. O! O!
Monntags den 11 Julii. Bei diesem Vorfall trug sich noch folgende Anekdote zu. Burgersleute kamen auf die Hauptwacht, und erzählten diesen Vorfall, batten zugleich den kommandierenden Officier, er möchte Acht geben lassen, ob denn das muthige Heer wiederkomme. Der Lieutenant gab der Wacht den Befel, er sollte Acht geben. Der Soldat, der villeicht noch nichts davon gehört hatt fragte: Wenn es kommt, befelen Ewr Gnade der Herr Lieutenant, daß ich es anhalten soll. Ja, ja, sagte der Lieutenant, halt er es nur an. Es blieb aber aus.
Dienstags den 12 Julii. Eine änliche Geschichte ereignete sich neulich. 4 Frauenzimmer furen von ChausséeHaus, auf der Ludwigsburger Strasse hieher (man kommt am Galgen vorbei) und es war um 12 Uhr Nachts. Bei ChausséeHaüslein seye nun ein reutender Postknecht OHNE KOPF zu inen gekommen, und immer bald neben bald vor bald hinter der Gutsche mit inen geritten. Der Gutscher wollte ausweichen allein der Postknecht folgte immer, bis er endlich am Thor verschwand. Dies beruhte doch auf der Aussage von 5 oder 6 Personen. Erst etliche Tage nachher erklärte ein Officier, daß er gerade an dem Ort und zu der Zeit zu einer Gutsche gekommen, und mitgeritten sey, er habe aber nicht durch dieses Thor hinein mögen, seye also da von inen hinweg und einen andern Weg geritten. Er sagte dabei, Er habe nicht begriffen können, warum ihm der Gutscher immer habe ausweichen wollen. (1)
***
Stuttgart: Das Muotisheer über Stuttgart
Das "Muotisheer" nimmt manchmal in der Nacht seinen Weg über die Stadt Stuttgart hin, und wenn das geschieht, kann man sich darauf verlassen, daß es am folgenden Tage brennt. Oft wird ein solcher Brand freilich nicht offenbar, weil ihn die Hausbewohner vertuschen; aber mit der Sache hat es nichts desto weniger seine Richtigkeit. Einmal wird das Muotisheer auch wieder den Weg über die Stadt hin machen und diese dann ganz in Feuer aufgehn. (2)
***
Stuttgart: Die weiße Frau zu Stuttgart
Es ist bekannt, daß sich, bevor eine fürstliche Person unseres Landes stirbt, in dem alten Schlosse eine weiße Frau sehen läßt. So viel ich gehört habe, steigt sie dann allemal aus der Gruft in der Stiftskirche und wandelt über den sogenannten Schillersplatz dorthin. Vor etwa 60 Jahren bekam der hiesige Kaufmann M. einen Schlaganfall. Die Magd mußte sogleich in die Apotheke und zwar in die Hofapotheke. Wie sie beim alten Canzleigebäude hineingehen will, versperrt ein riesiges Weib ihr den Weg. Alles mögliche versucht sie, hinein zu gelangen, ohne sich im Geringsten zu fürchten. Vergebens! Sie muß wieder umkehren. Bei ihrer Herrschaft angelangt, erzählt sie das Vorgefallene. Man hält sie für eine furchtsame Träumerin und schickt den Knecht fort. Aber diesem widerfuhr dasselbe: eine Gestalt huscht immer vor ihm her, so daß er unmöglich hinein kommen kann. Er geht weg und in den König von England, wo sein Kamerade als Hausknecht dient. Er sagt ihm, was er gesehen hat: "Hä", ruft dieser "das ist nichts so Seltenes! Gieb Acht, da ruft der Tod Jemand vom Hofe wieder ab!" Er wartet bei ihm ein wenig, und geht dann wieder hinüber. Alles ist ruhig, und er gelangt ungefährdet in die Apotheke und von da zurück. Wenige Tage darauf starb eine Herzogin; welche? kann ich nicht angeben. (3)
***
Stuttgart: Das Bettelhaus zu Stuttgart
In einem der Gebäude, welche den Bebenhäuser Hof zu Stuttgart bilden, im sogenannten Bettelhause, muß zu einer gewissen Zeit des Jahres Brot an die Armen gereicht werden. Unterbleibt es, so entsteht in dem Haus ein solcher Unfug, daß es niemand aushalten kann. (6)

***
Hohengehren (Schurwald): Hexenwald und Teufelsbrücke
Im Hexenwald und an der Teufelsbrücke spukts. Die Eltern haben uns verboten, da durchzugehen. Aber wir sind mit zwölf als Mutprobe durch den Hexenwald gegangen. An der Teufelsbrücke hat man vor ungefähr 20 Jahren Kinder umgebracht. (114)
***
Plochingen: Der Mann ohne Kopf (eine Anti-Sage)
Zwischen Plochingen und Altbach an der Straße konnte man bei Nacht einen Mann ohne Kopf mit feurigem Schwert in der Hand sehen.
Der Vater einer Gewährsfrau ging der Sache nach und stellte fest, daß es ein Baum ist mit "Schein". Dieser Mann hat nicht an Gespenster geglaubt. (128)
***
Ludwigsburg: Das Vehmgericht
Einst, so erzählt die Sage, als das Vehmgericht noch in Deutschland waltete, hauste in der Gegend der heutigen Stadt Ludwigsburg ein Graf namens Emich, welcher von Raubzügen lebte und beinahe zu einem gemeinen Straßenräuber herabgesunken war. Er hatte schon manche Mordthat an armen Reisenden begangen und seine Strafe sollte auch nicht ausbleiben. Als er einst wieder durch den Wald zog und auf der Lauer stand, nahten sich ihm einige Männer; eben wollte er sie anhalten, als sie sich für Schöffen des Vehmgerichts ausgaben, welche gesandt seyen, um ihn vor die heilige Vehme zu laden. Der Graf, welcher wohl wußte, daß er nichts gewinnen würde, wenn er dem Aufgebot nicht Folge leisten würde, gieng willig mit ihnen und gelangte so auf manchen Umwegen und durch verworrene Gänge zu einer tief im Wald verborgenen Höhle. Als er eingetreten war, erblickte er in einem scharz ausgeschlagenen, schwach beleuchteten Raum 12 vermummte schwarze Richter vor einem Tisch, auf welchem Schädel und Kreuz standen. Einer der Richter erhob sich und las die Beschuldigung und das Urtheil vor, welches auf Tod lautete. Ruhig hörte der Graf zu; als aber die Henker, welche auf einen Wink des obersten Richters herbeieilten, ihn greifen wollten, zog er kurz besonnen sein so oft erprobtes Schwert, wand sich aus den Händen der Henker und legte mit Einem Schlag einem der Richter den Kopf vor die Füsse. Gleiches Schicksal theilten mit ihm noch 10 der Richter, lauter starke und handfeste Leute; den 12ten aber ließ er wie aus Zufall entspringen und indem er sich stets an seinem langen Gewand hielt, gelangte er so wieder ins Freie, was ihm ohne diese List schwerlich gelungen wäre. Natürlich hatte der Ritter von dieser Zeit an weder Ruh noch Rast und wandelt noch jetzt als Gespenst in jenem Walde. (246)
Kaum ein Text aus den "Sagen rund um Stuttgart" demonstriert deutlicher den Einfluß der Ritterromane und populären Vorstellungen über das Mittelalter auf die vermeintlichen "Volkssagen". In der Ludwigsburger Emichsburg, einer Nachbildung einer zerfallenen Ritterburg, saß Ritter Emich, der angebliche Stammvater des württembergischen Hauses, der uns bereits in Beutelsbach begnete, mit seinem Beichtvater an einem Tisch. Noch größeren Eindruck muß damals eine Grotte bei Schloß Monrepos auf ihre Besucher gemacht haben. Dargestellt war ein Vehmgericht. Zwölf Ritter saßen an einem Tisch, auf dem - wie in der Erzählung angegeben - ein Kruxifix und ein Totenkopf lagen.
Nachweise
(1) G. W. F. Hegel, Tagebuch, in: Gesammelte Werke Bd. 1, 1989, S. 8f.
(2)Württembergische Landesbibliothek Stuttgart Cod. poet. et phil. qt. 134 (=Schott) II, Bl. 236.
(3) Schott II, Bl. 240-240v (Mühlbach VIII. 1847).
(6) Schott II, Bl. 242 ("Mündlich v. Hauptm. Dürrich").
(114) Erzählerin (28.8.1993): Anhalterin aus Hohengehren, ca. 20.
(128) O. Wurster, Heimat-Geschichte Plochingen, 1949, S. 479
(246) Schott I, Bl. 339-340v (Häring IX. 1847, "Mündlich aus der Gegend von Ludwigsburg"). Emichsburg: J.D.G. Memminger, Stuttgart und Ludwigsburg, 1817, S. 433f. Vehmgericht: Zs. württ. Landesgesch. 51 (1992) S. 284.
KlausGraf - am Montag, 16. November 2009, 15:19 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ab sofort ist die überarbeitete Seite von "SHERPA/RoMEO deutsch" mit neuen Funktionen freigeschaltet.
Sie erreichen die Datenbank, in der Sie Informationen zu den Open Access Policies von Verlagen finden,
unter der altbekannten Adresse oder wenn Sie dem Link
http://www.dini.de/sherparomeo/
folgen.
Im Rahmen des Projektes "Open Access Policies" wurde eine deutsche Seite auf Grundlage der englischen SHERPA/RoMEO-Datenbank entwickelt. Bereits bisher war es möglich, sich über die Standardbedingungen der Verlage bei Open Access-Publikationen zu informieren. Es konnte sowohl über Zeitschriften als auch über Verlage recherchiert werden. Durch die Zusammenarbeit mit der EZB wurde nun die Datenbasis für die Zeitschrifteninformationen erheblich erweitert und die Suche über Abkürzungen möglich. Neu hinzugekommen sind zudem Links (PDFs) zu Informationen über Copyright-Bedingungen und über Paid-Access-Optionen, sofern diese von den Verlagen bereitgestellt werden. Neben der schon bisher möglichen Vorauswahl der Verlage nach den RoMEO-Farben, wurde das Angebot um einen alphabetischen Index aller gelisteten Verlage erweitert.
Die Zusammenarbeit mit der EZB führte darüber hinaus dazu, daß jetzt auch die EZB Informationen hinsichtlich der Open Access Bedingungen der Verlage zur Verfügung stellt.
Sie erreichen die Datenbank, in der Sie Informationen zu den Open Access Policies von Verlagen finden,
unter der altbekannten Adresse oder wenn Sie dem Link
http://www.dini.de/sherparomeo/
folgen.
Im Rahmen des Projektes "Open Access Policies" wurde eine deutsche Seite auf Grundlage der englischen SHERPA/RoMEO-Datenbank entwickelt. Bereits bisher war es möglich, sich über die Standardbedingungen der Verlage bei Open Access-Publikationen zu informieren. Es konnte sowohl über Zeitschriften als auch über Verlage recherchiert werden. Durch die Zusammenarbeit mit der EZB wurde nun die Datenbasis für die Zeitschrifteninformationen erheblich erweitert und die Suche über Abkürzungen möglich. Neu hinzugekommen sind zudem Links (PDFs) zu Informationen über Copyright-Bedingungen und über Paid-Access-Optionen, sofern diese von den Verlagen bereitgestellt werden. Neben der schon bisher möglichen Vorauswahl der Verlage nach den RoMEO-Farben, wurde das Angebot um einen alphabetischen Index aller gelisteten Verlage erweitert.
Die Zusammenarbeit mit der EZB führte darüber hinaus dazu, daß jetzt auch die EZB Informationen hinsichtlich der Open Access Bedingungen der Verlage zur Verfügung stellt.
KlausGraf - am Montag, 16. November 2009, 14:50 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 15. November 2009, 22:42 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
schlagen auch in den Kommentaren hier auf:
http://archiv.twoday.net/stories/5434966/#6044778
Siehe dazu (Danke, AP):
http://erdferkel.supersized.org/archives/442-Mehr-zu-El-Naschie,-mit-Kleinigkeiten-von-meinem-Schreibtisch.html#c1696
http://archiv.twoday.net/stories/5434966/#6044778
Siehe dazu (Danke, AP):
http://erdferkel.supersized.org/archives/442-Mehr-zu-El-Naschie,-mit-Kleinigkeiten-von-meinem-Schreibtisch.html#c1696
KlausGraf - am Sonntag, 15. November 2009, 22:17 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 15. November 2009, 18:38 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.evlka.de/content.php?contentTypeID=4&id=11662
Emden (epd). Die seit einem Jahr geschlossene Emder Johannes-a-Lasco-Bibliothek soll im Januar wieder den wissenschaftlichen Betrieb aufnehmen. Der Chefjurist der Evangelisch-reformierten Kirche, Johann Weusmann, sagte am Donnerstag vor der in Emden tagenden Synode, dass die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) zusätzliche Haushaltsmittel für das laufende Geschäft im Jahr 2010 in Aussicht gestellt habe.
Die Bibliothek gilt als die weltweit bedeutendste Bibliothek des reformierten Protestantismus. Das Haus musste im Dezember 2008 geschlossen werden, nachdem das Stiftungskapital unter der Leitung des inzwischen entlassenen und wegen Untreue verurteilten Bibliotheksdirektors Walter Schulz um 6,2 Millionen Euro auf heute noch 1,6 Millionen Euro abgeschmolzen war.
Inzwischen sind Weusmann zufolge nach Untersuchungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon weitere Details zum Kapitalverlust bekanntgeworden. Die Kirche habe zudem eine renommierte Rechtskanzlei in Hannover beauftragt. Sie solle feststellen, ob und inwieweit das Kuratorium, der damalige Stiftungsvorstand Schulz und das kirchenleitende Moderamen als Stiftungsaufsicht für den Verlust haften muss.
Schulz habe 2001 rund 80 Prozent des Stiftungskapitals in hochspekulativen Aktien angelegt, berichtete Weusmann. Laut Curacon habe es sich dabei um Wertpapiere mit dem Warnhinweis des Bundesfinanzministers gehandelt, dass der Anleger bereit und in der Lage sein muss, den Verlust des Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. Durch diese nicht vom Kuratorium genehmigten Geschäfte seien 1,2 Millionen Euro verloren gegangen.
Weiter habe Schulz dem Curacon-Bericht zufolge zwischen 2001 und 2008 große Teile des Personals unerlaubt mit Geldern aus dem Stiftungskapital bezahlt. Aus den Erträgen des Kapitals hätte die Bibliothek sechs Vollzeitstellen finanzieren sollen und können, sagte Weusmann. Schulz habe dagegen über Jahre bis zu 12,5 Vollzeitstellen eingerichtet. Insgesamt seien so 3,2 Millionen aus dem Stiftungskapital verschwunden.
Auch Bücher und Kunstgegenstände hätte die Bibliothek nur aus den Erlösen des Stiftungskapitals oder mit Zustiftungen finanzieren dürfen, betonte Weusmann. Curacon habe festgestellt, dass mehr als 2,13 Millionen Euro für den Ankauf von Literatur, Gemälden und Silber unerlaubt aus dem Stiftungskapital entnommen wurden. Gutachter sollen prüfen, ob die angekauften Archive, Bücher und Kunstgegenstände mit dem Auftrag der Bibliothek übereinstimmen.
Die Bibliothek solle künftig zu einem Kompetenzzentrum des deutschen Protestantismus ausgebaut werden, erläuterte der Jurist. Die EKD und die Landeskirchen werden dazu sechs Millionen Euro in das Stiftungskapital der Bibliothek einzahlen. Zusammen mit einer weiteren Million Euro der reformierten Kirche und dem noch vorhandenem Rest von 1,6 Millionen Euro sei das Stiftungskapital etwa wieder so hoch wie am Anfang. Das Geld werde jedoch künftig von der EKD angelegt und die Erträge an die Bibliothek ausgezahlt.
Das Gemeinsame kirchliche Verwaltungsgericht der reformierten Kirche und der lippischen Landeskirche in Detmold habe in den vergangenen Wochen Schulz "der groben Pflichtverletzung" nach dem Niedersächsischen Stiftungsgesetz für schuldig befunden, sagte Weusmann. Es verwies dabei auf den Curacon-Bericht. Die fristlose Kündigung von Walter Schulz sei somit rechtmäßig.
S.a.
http://jeversches-wochenblatt.de/Redaktion/tabid/146/Default.aspx?ArtikelID=326797
Gegen das vor zwei Wochen ergangene Urteil – der Pastor und Ex-Bibliotheksdirektor war am 13. Oktober vor dem Landgericht Aurich wegen Untreue in acht Fällen zu einer Geldstrafe von 2600 Euro verurteilt worden – haben die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft Revision vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe eingelegt.
Zu Schulz in Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/5612857/
Emden (epd). Die seit einem Jahr geschlossene Emder Johannes-a-Lasco-Bibliothek soll im Januar wieder den wissenschaftlichen Betrieb aufnehmen. Der Chefjurist der Evangelisch-reformierten Kirche, Johann Weusmann, sagte am Donnerstag vor der in Emden tagenden Synode, dass die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) zusätzliche Haushaltsmittel für das laufende Geschäft im Jahr 2010 in Aussicht gestellt habe.
Die Bibliothek gilt als die weltweit bedeutendste Bibliothek des reformierten Protestantismus. Das Haus musste im Dezember 2008 geschlossen werden, nachdem das Stiftungskapital unter der Leitung des inzwischen entlassenen und wegen Untreue verurteilten Bibliotheksdirektors Walter Schulz um 6,2 Millionen Euro auf heute noch 1,6 Millionen Euro abgeschmolzen war.
Inzwischen sind Weusmann zufolge nach Untersuchungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon weitere Details zum Kapitalverlust bekanntgeworden. Die Kirche habe zudem eine renommierte Rechtskanzlei in Hannover beauftragt. Sie solle feststellen, ob und inwieweit das Kuratorium, der damalige Stiftungsvorstand Schulz und das kirchenleitende Moderamen als Stiftungsaufsicht für den Verlust haften muss.
Schulz habe 2001 rund 80 Prozent des Stiftungskapitals in hochspekulativen Aktien angelegt, berichtete Weusmann. Laut Curacon habe es sich dabei um Wertpapiere mit dem Warnhinweis des Bundesfinanzministers gehandelt, dass der Anleger bereit und in der Lage sein muss, den Verlust des Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. Durch diese nicht vom Kuratorium genehmigten Geschäfte seien 1,2 Millionen Euro verloren gegangen.
Weiter habe Schulz dem Curacon-Bericht zufolge zwischen 2001 und 2008 große Teile des Personals unerlaubt mit Geldern aus dem Stiftungskapital bezahlt. Aus den Erträgen des Kapitals hätte die Bibliothek sechs Vollzeitstellen finanzieren sollen und können, sagte Weusmann. Schulz habe dagegen über Jahre bis zu 12,5 Vollzeitstellen eingerichtet. Insgesamt seien so 3,2 Millionen aus dem Stiftungskapital verschwunden.
Auch Bücher und Kunstgegenstände hätte die Bibliothek nur aus den Erlösen des Stiftungskapitals oder mit Zustiftungen finanzieren dürfen, betonte Weusmann. Curacon habe festgestellt, dass mehr als 2,13 Millionen Euro für den Ankauf von Literatur, Gemälden und Silber unerlaubt aus dem Stiftungskapital entnommen wurden. Gutachter sollen prüfen, ob die angekauften Archive, Bücher und Kunstgegenstände mit dem Auftrag der Bibliothek übereinstimmen.
Die Bibliothek solle künftig zu einem Kompetenzzentrum des deutschen Protestantismus ausgebaut werden, erläuterte der Jurist. Die EKD und die Landeskirchen werden dazu sechs Millionen Euro in das Stiftungskapital der Bibliothek einzahlen. Zusammen mit einer weiteren Million Euro der reformierten Kirche und dem noch vorhandenem Rest von 1,6 Millionen Euro sei das Stiftungskapital etwa wieder so hoch wie am Anfang. Das Geld werde jedoch künftig von der EKD angelegt und die Erträge an die Bibliothek ausgezahlt.
Das Gemeinsame kirchliche Verwaltungsgericht der reformierten Kirche und der lippischen Landeskirche in Detmold habe in den vergangenen Wochen Schulz "der groben Pflichtverletzung" nach dem Niedersächsischen Stiftungsgesetz für schuldig befunden, sagte Weusmann. Es verwies dabei auf den Curacon-Bericht. Die fristlose Kündigung von Walter Schulz sei somit rechtmäßig.
S.a.
http://jeversches-wochenblatt.de/Redaktion/tabid/146/Default.aspx?ArtikelID=326797
Gegen das vor zwei Wochen ergangene Urteil – der Pastor und Ex-Bibliotheksdirektor war am 13. Oktober vor dem Landgericht Aurich wegen Untreue in acht Fällen zu einer Geldstrafe von 2600 Euro verurteilt worden – haben die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft Revision vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe eingelegt.
Zu Schulz in Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/5612857/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 15. November 2009, 00:19 - Rubrik: Museumswesen
http://blog.fefe.de/?ts=b403305a
Na, wenn das der Führer wüsste ...
 Fefe und Juliana im Gespräch, Foto Ralf Roletschek.
Fefe und Juliana im Gespräch, Foto Ralf Roletschek.
Na, wenn das der Führer wüsste ...
 Fefe und Juliana im Gespräch, Foto Ralf Roletschek.
Fefe und Juliana im Gespräch, Foto Ralf Roletschek.E. Steinhauers Beitrag vom Februar 2009 ist nach wie vor aktuell.
http://www.bibliotheksrecht.de/2009/02/17/scannen-originale-5594501/
http://www.bibliotheksrecht.de/2009/02/17/scannen-originale-5594501/
KlausGraf - am Samstag, 14. November 2009, 23:56 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 14. November 2009, 23:38 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.lawblog.de/index.php/archives/2009/11/13/gute-presse-per-kleingedrucktem/
Udo Vetter meint - zurecht -, dass es nicht zulässig sei, dass die Bundesagentur für Arbeit durch AGB die Presse dazu zwingen will, für die Presse vorgefertigte Themenartikel unverändert zu übernehmen.
Udo Vetter meint - zurecht -, dass es nicht zulässig sei, dass die Bundesagentur für Arbeit durch AGB die Presse dazu zwingen will, für die Presse vorgefertigte Themenartikel unverändert zu übernehmen.
KlausGraf - am Samstag, 14. November 2009, 22:23 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.digizeitschriften.de
Zum Wochenende haben wir eine Lucéne Volltextsuche freigeschaltet. Um genauer abschätzen zu können wie sich diese neue Funktion auf die Performance der Seite auswirkt haben wir derzeit nur einen Teilbestand von 1.300 Bänden indexiert. Wenn das Angebot stabil läuft werden wir kontinuierlich auch die weiteren Bände hinzufügen.
Nach jeder Suche findet man nun rechts die Filtermöglichkeit Metadaten Volltext", "Volltext" und "Metadaten". Mit diesen drei Optionen kann man den Suchraum bestimmen.
Volltexttreffer laden ferner den Zeilenkontext der gefundenen Textpassage nach. Ein Klick auf das dort rot hinterlegte Suchwort öffnet das Digitalisat, in dem ebenfalls die Suchworte farbig hinterlegt sind.
Phrasensuche scheint zu funktionieren. OCR ist eher schlecht, daher auch die Suchergebnisse.
Zum Wochenende haben wir eine Lucéne Volltextsuche freigeschaltet. Um genauer abschätzen zu können wie sich diese neue Funktion auf die Performance der Seite auswirkt haben wir derzeit nur einen Teilbestand von 1.300 Bänden indexiert. Wenn das Angebot stabil läuft werden wir kontinuierlich auch die weiteren Bände hinzufügen.
Nach jeder Suche findet man nun rechts die Filtermöglichkeit Metadaten Volltext", "Volltext" und "Metadaten". Mit diesen drei Optionen kann man den Suchraum bestimmen.
Volltexttreffer laden ferner den Zeilenkontext der gefundenen Textpassage nach. Ein Klick auf das dort rot hinterlegte Suchwort öffnet das Digitalisat, in dem ebenfalls die Suchworte farbig hinterlegt sind.
Phrasensuche scheint zu funktionieren. OCR ist eher schlecht, daher auch die Suchergebnisse.
KlausGraf - am Samstag, 14. November 2009, 21:43 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Harnadianische Orthodoxie wird nicht müde, den grünen Weg als wichtigsten Weg zu Open Access herauszustellen.
http://epublishingtrust.blogspot.com/2009/11/oa-priority.html
bläst nun ins gleiche Horn.
Traditionell gelten der goldene Weg (OA-Zeitschriften) und der grüne Weg (Repositorien) als Marschrouten, die man beide verfolgen sollte. Harnads Trommelfeuer gegen den goldenen Weg beschädigt die OA-Community.
Wer libre OA als wichtig ansieht, kommt um den goldenen Weg nicht herum, da IRs kaum einmal die Vergabe von CC-Lizenzen ermöglichen.
http://epublishingtrust.blogspot.com/2009/11/oa-priority.html
bläst nun ins gleiche Horn.
Traditionell gelten der goldene Weg (OA-Zeitschriften) und der grüne Weg (Repositorien) als Marschrouten, die man beide verfolgen sollte. Harnads Trommelfeuer gegen den goldenen Weg beschädigt die OA-Community.
Wer libre OA als wichtig ansieht, kommt um den goldenen Weg nicht herum, da IRs kaum einmal die Vergabe von CC-Lizenzen ermöglichen.
KlausGraf - am Samstag, 14. November 2009, 21:20 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.buchreport.de/nachrichten/online/online_nachricht/datum/2009/11/14/google-verzichtet-auf-deutsche-buecher.htm
http://irights.info/blog/arbeit2.0/2009/11/14/amended-google-book-settlement/#more-1613
Googles Zusammenfassung: http://tinyurl.com/yzylfkw
Der Vergleich wird bezüglich der urheberrechtlich geschützten Bücher, die außerhalb der USA verlegt wurden, nur diejenigen mitabdecken, die entweder beim U.S. Copyright Office (das die Urheberrechte in den USA verwaltet) registriert oder in Großbritannien, Australien oder Kanada veröffentlicht wurden.
Ergo werden Bücher aus Deutschland oder sonstigen europäischen Ländern (außer GB) nicht mehr vom Vergleich abgedeckt. Internationale Bücher, die noch von den Verlagen vertrieben werden und also noch verfügbar sind, werden zunächst nicht von Google in Auszügen dargestellt, es sei denn auf Wunsch der Rechteinhaber/Verlage.
Wer die Stümper von Libreka kennt, weiß, dass von dort kein vollgültiger Ersatz zu erwarten ist.
Laut FAQ-PDF gilt allerdings:
"Outside the United States, the users’ experience with Google Books will be the same as it is today."
Dies könnte bedeuten, dass auch geschützte deutschsprachige Werke weiterhin im Volltext durchsuchbar sind und in Schnipselform angezeigt werden.
Eine kostenlose auszugsweise teilweise Darstellung eines Buchs wird es für US-Nutzer nur dann geben, wenn das Buch in den USA erschienen oder registriert ist oder wenn es im UK, in Kanada und Australien erschienen ist. Dies gilt auch für die kostenpflichtige Möglichkeit, ganze Bücher zu kaufen oder ein institutionelles Abonnement der kompletten Volltexte (oder von Teilsammlungen) zu erwerben.
Hinfällig ist erst einmal die Möglichkeit, für Nicht-mehr-Mitglieder des Settlements (also fast alle deutschen Autoren/Rechteinhaber) den Preis im Rahmen des Settlements auf Null zu setzen und damit eine weltweit kostenlose Anzeige zu bewirken:
http://archiv.twoday.net/stories/5908654/
http://iuwis.de/blog/zwischenbericht-des-sprechers-des-aktionsb%C3%BCndnisses-zu-den-direkten-verhandlungen-mit-google-mo
Die künftig bestehenden Optionen werden unter
http://books.google.com/support/partner/bin/answer.py?answer=166297
bekannt gegeben.
Es heißt dazu in dem Gerichtsdokument
"The Amended Settlement provides that the Registry will facilitate Rightsholders’ wishes to allow their works to be made available through alternative licenses for Consumer Purchase, including through a Creative Commons license…The Amended Settlement also clarifies that Rightsholders are free to set the Consumer Purchase price of their Books at zero."
Zitiert nach: http://www.resourceshelf.com/2009/11/13/press-review-google-book-search-revised-settlement-settlement-2-0-released/ (s.a. S. 59 im Settlement 2.0-PDF http://tinyurl.com/ylztkb8 )
Update:
Gute Linksammlung unter http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=3252
Update 2:
Antwort von Google. Bei Teilnahme am Partnerprogramm muss das Buch nochmals erfasst werden, auch wenn es im Rahmen des Bibliotheksprogramms bereits gescannt wurde. Hier der Wortlaut der Antwort vom 17.11.2009:
Zu diesem Zeitpunkt ist es leider noch nicht möglich, Bücher, die durch
das Bibilotheksprogramm in unserem Index angezeigt werden und noch unter
Urheberrecht stehen, freizugeben.
Sie können allerdings in diesem Fall dem Google Buch Partner-Programm
beitreten und uns Informationen zu Ihrem Buch zur Verfügung stellen.
Folgen Sie bitte hierzu diesen Schritten:
1. Besuchen Sie die Startseite der Google Bücher unter
http://books.google.de/partner.
2. Klicken Sie auf "Anmeldung für Neukunden".
3. Füllen Sie den Antrag aus und senden Sie ihn an uns. Sie erhalten dann
von uns eine E-Mail, in der Sie zur Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse
aufgefordert werden.
Nachdem Sie Ihre E-Mail-Adresse bestätigt haben, werden wir Ihren Antrag
überprüfen und Ihnen innerhalb weniger Tage eine Antwort per E-Mail
zuschicken. Sie können sich dann bei Ihrem Google Bücher-Konto mit der
E-Mail-Adresse und dem Passwort, die Sie mit Ihrem Antrag für Google
Bücher an uns gesendet haben, anmelden und uns Informationen zu Ihrem Buch
übermitteln. Sie können uns dann Ihr Buch zuschicken oder als PDF-Datei
hochladen. Nachdem wir Ihr Buch erhalten und verarbeitet haben, werden die
gescannten Seiten in Google-Suchergebnissen angezeigt.
http://irights.info/blog/arbeit2.0/2009/11/14/amended-google-book-settlement/#more-1613
Googles Zusammenfassung: http://tinyurl.com/yzylfkw
Der Vergleich wird bezüglich der urheberrechtlich geschützten Bücher, die außerhalb der USA verlegt wurden, nur diejenigen mitabdecken, die entweder beim U.S. Copyright Office (das die Urheberrechte in den USA verwaltet) registriert oder in Großbritannien, Australien oder Kanada veröffentlicht wurden.
Ergo werden Bücher aus Deutschland oder sonstigen europäischen Ländern (außer GB) nicht mehr vom Vergleich abgedeckt. Internationale Bücher, die noch von den Verlagen vertrieben werden und also noch verfügbar sind, werden zunächst nicht von Google in Auszügen dargestellt, es sei denn auf Wunsch der Rechteinhaber/Verlage.
Wer die Stümper von Libreka kennt, weiß, dass von dort kein vollgültiger Ersatz zu erwarten ist.
Laut FAQ-PDF gilt allerdings:
"Outside the United States, the users’ experience with Google Books will be the same as it is today."
Dies könnte bedeuten, dass auch geschützte deutschsprachige Werke weiterhin im Volltext durchsuchbar sind und in Schnipselform angezeigt werden.
Eine kostenlose auszugsweise teilweise Darstellung eines Buchs wird es für US-Nutzer nur dann geben, wenn das Buch in den USA erschienen oder registriert ist oder wenn es im UK, in Kanada und Australien erschienen ist. Dies gilt auch für die kostenpflichtige Möglichkeit, ganze Bücher zu kaufen oder ein institutionelles Abonnement der kompletten Volltexte (oder von Teilsammlungen) zu erwerben.
Hinfällig ist erst einmal die Möglichkeit, für Nicht-mehr-Mitglieder des Settlements (also fast alle deutschen Autoren/Rechteinhaber) den Preis im Rahmen des Settlements auf Null zu setzen und damit eine weltweit kostenlose Anzeige zu bewirken:
http://archiv.twoday.net/stories/5908654/
http://iuwis.de/blog/zwischenbericht-des-sprechers-des-aktionsb%C3%BCndnisses-zu-den-direkten-verhandlungen-mit-google-mo
Die künftig bestehenden Optionen werden unter
http://books.google.com/support/partner/bin/answer.py?answer=166297
bekannt gegeben.
Es heißt dazu in dem Gerichtsdokument
"The Amended Settlement provides that the Registry will facilitate Rightsholders’ wishes to allow their works to be made available through alternative licenses for Consumer Purchase, including through a Creative Commons license…The Amended Settlement also clarifies that Rightsholders are free to set the Consumer Purchase price of their Books at zero."
Zitiert nach: http://www.resourceshelf.com/2009/11/13/press-review-google-book-search-revised-settlement-settlement-2-0-released/ (s.a. S. 59 im Settlement 2.0-PDF http://tinyurl.com/ylztkb8 )
Update:
Gute Linksammlung unter http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=3252
Update 2:
Antwort von Google. Bei Teilnahme am Partnerprogramm muss das Buch nochmals erfasst werden, auch wenn es im Rahmen des Bibliotheksprogramms bereits gescannt wurde. Hier der Wortlaut der Antwort vom 17.11.2009:
Zu diesem Zeitpunkt ist es leider noch nicht möglich, Bücher, die durch
das Bibilotheksprogramm in unserem Index angezeigt werden und noch unter
Urheberrecht stehen, freizugeben.
Sie können allerdings in diesem Fall dem Google Buch Partner-Programm
beitreten und uns Informationen zu Ihrem Buch zur Verfügung stellen.
Folgen Sie bitte hierzu diesen Schritten:
1. Besuchen Sie die Startseite der Google Bücher unter
http://books.google.de/partner.
2. Klicken Sie auf "Anmeldung für Neukunden".
3. Füllen Sie den Antrag aus und senden Sie ihn an uns. Sie erhalten dann
von uns eine E-Mail, in der Sie zur Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse
aufgefordert werden.
Nachdem Sie Ihre E-Mail-Adresse bestätigt haben, werden wir Ihren Antrag
überprüfen und Ihnen innerhalb weniger Tage eine Antwort per E-Mail
zuschicken. Sie können sich dann bei Ihrem Google Bücher-Konto mit der
E-Mail-Adresse und dem Passwort, die Sie mit Ihrem Antrag für Google
Bücher an uns gesendet haben, anmelden und uns Informationen zu Ihrem Buch
übermitteln. Sie können uns dann Ihr Buch zuschicken oder als PDF-Datei
hochladen. Nachdem wir Ihr Buch erhalten und verarbeitet haben, werden die
gescannten Seiten in Google-Suchergebnissen angezeigt.
KlausGraf - am Samstag, 14. November 2009, 19:58 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
KlausGraf - am Samstag, 14. November 2009, 16:45 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eichstätter Kurier 12.11.2009
Berufung gegen Reich-Freispruch
http://www.donaukurier.de/lokales/eichstaett/Berufung-gegen-Reich-Freispruch;art575,2208734
Eichstätt/Ingolstadt (EK) Mit dem Freispruch vor dem Amtsgericht am 23. September ist der Untreue-Vorwurf gegen die Leiterin der Eichstätter Universitäts-Bibliothek, Angelika Reich, doch noch nicht vom Tisch: Die Staatsanwaltschaft hat Berufung eingelegt.
Das bestätigte der Leitende Oberstaatsanwalt in Ingolstadt, Dr. Helmut Walter, gestern auf Anfrage: "Wir gehen davon aus, dass es zu einer Verurteilung hätte kommen müssen." (...)
Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt wartet laut Walter nun auf die schriftliche Urteilsbegründung vom September. Wenn die vorliegt, dann wird das gesamte Verfahren vor dem Landgericht neu aufgerollt: Mit Zeugenaussagen und Beweisaufnahmen. "Das wird dann noch mal voll umfänglich verhandelt", bestätigt der Leitende Oberstaatsanwalt Helmut Walter. (...)
Vgl. auch http://archiv.twoday.net/stories/5960023/
Berufung gegen Reich-Freispruch
http://www.donaukurier.de/lokales/eichstaett/Berufung-gegen-Reich-Freispruch;art575,2208734
Eichstätt/Ingolstadt (EK) Mit dem Freispruch vor dem Amtsgericht am 23. September ist der Untreue-Vorwurf gegen die Leiterin der Eichstätter Universitäts-Bibliothek, Angelika Reich, doch noch nicht vom Tisch: Die Staatsanwaltschaft hat Berufung eingelegt.
Das bestätigte der Leitende Oberstaatsanwalt in Ingolstadt, Dr. Helmut Walter, gestern auf Anfrage: "Wir gehen davon aus, dass es zu einer Verurteilung hätte kommen müssen." (...)
Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt wartet laut Walter nun auf die schriftliche Urteilsbegründung vom September. Wenn die vorliegt, dann wird das gesamte Verfahren vor dem Landgericht neu aufgerollt: Mit Zeugenaussagen und Beweisaufnahmen. "Das wird dann noch mal voll umfänglich verhandelt", bestätigt der Leitende Oberstaatsanwalt Helmut Walter. (...)
Vgl. auch http://archiv.twoday.net/stories/5960023/
BCK - am Samstag, 14. November 2009, 14:28 - Rubrik: Kulturgut
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Im Wiener Dorotheum gelangt ein Archivinventar des Schlosses Erpeldingen zu Versteigerung, Lot Nr. 43. Beschrieben wird sie folgendermassen: Handschrift, knapp 180 Seiten, Pergamenteinband. Ausrufungspreis € 80,-.
Zu Erpeldinge siehe in der Wikipedia unter http://de.wikipedia.org/wiki/Erpeldange#Das_Schloss
Da ich sowieso einige Sachen, die bei dieser Versteigerung angeboten werden, vorher ansehen muss, kann ich bei Interesse, auch einen Blick auf dieses Stück werfen.
["Das vorliegende Inventar verzeichnet in erster Linie Archivalien der Freiherren Du Prel, die sich von 1691 bis 1840 im Besitz des Schlosses befanden, aber auch einige ältere, die Herren von Gondersdorf betreffende Urkunden." Zoombare Abb. - Zusatz Klaus Graf]
Zu Erpeldinge siehe in der Wikipedia unter http://de.wikipedia.org/wiki/Erpeldange#Das_Schloss
Da ich sowieso einige Sachen, die bei dieser Versteigerung angeboten werden, vorher ansehen muss, kann ich bei Interesse, auch einen Blick auf dieses Stück werfen.
["Das vorliegende Inventar verzeichnet in erster Linie Archivalien der Freiherren Du Prel, die sich von 1691 bis 1840 im Besitz des Schlosses befanden, aber auch einige ältere, die Herren von Gondersdorf betreffende Urkunden." Zoombare Abb. - Zusatz Klaus Graf]
ThomasJust - am Samstag, 14. November 2009, 12:20 - Rubrik: Herrschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Garnicht erst ignorieren, sowas. Nirgendwo wird da Kritik geäußert, die irgendwie zutrifft. Dies kommt aber, weil die Kritiker überhaupt keine Ahnung von Wikipedia haben - sie wollen nur herumkrakeelen Daher empfehle ich eine "Vogel-Strauß-Politik", also den Kopf metaphorisch in den Sand zu stecken und sich so solch unliebsamer Wahrnehmungen und Eindrücke einfach zu entledigen. Wahlweise auch die berühmten drei Affen: nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Bald haben die paar Blogger dann ihre Sau durchs Dorf getrieben, und dann wird schon wieder Ruhe einkehren. Der Sturm im Wasserglas kann abgewettert, ausgesessen werden. Ein wenig Positives Denken kann auch nicht schaden: "Es ist alles okay. Es ist alles okay." Wir sollten nur Geschlossenheit zeigen, und lieber nach vorne schauen, als uns immer in selbstquälerischen Diskussionen zu ergehen. Wikipedia ist sehr gut aufgestellt, wir haben ein starkes Team, und unsere Leser wählen uns zur Nummer eins, weil sie wissen, dass Wikipedia für höchste Qualität und besten Service steht.
IP in: http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_Diskussion:Kurier#Es_klingelt_in_der_Kasse
Siehe auch den sehr lesenswerten Beitrag "Communitygift":
http://blog.koehntopp.de/archives/2675-Communitygift.html
IP in: http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_Diskussion:Kurier#Es_klingelt_in_der_Kasse
Siehe auch den sehr lesenswerten Beitrag "Communitygift":
http://blog.koehntopp.de/archives/2675-Communitygift.html
http://www.handschriftencensus.de/news
Die seit über 100 Jahren verschollene Berliner Handschrift von Felix Fabris 'Geistlicher Pilgerfahrt' ('Sionpilger') konnte in einem im Jahr 2005 aus Anlaß des 200-Jahr-Jubiläums der Gründung der Handschriftensammlung der Russischen Nationalbibliothek erschienenen Ausstellungskatalog wiederentdeckt werden. Der in kyrillischer Schrift veröffentlichte Katalog, den uns Marie Reusch (Marburg) "entschlüsselt" hat, verzeichnet unter 45 Handschriften der Russischen Nationalbibliothek und 20 Handschriften der Eremitage auch die 1494 von der bekannten Schwester Felicitas Lieberin im Dominikanerinnenkloster Medlingen geschriebene Handschrift; sie wird heute in der Eremitage von St. Petersburg unter der Inv.-Nr. 169562 aufbewahrt.
Zu den Handschriften dieser Schreiberin haben wir hier ausführliche Informationen mitgeteilt:
http://archiv.twoday.net/stories/4230116/
Die seit über 100 Jahren verschollene Berliner Handschrift von Felix Fabris 'Geistlicher Pilgerfahrt' ('Sionpilger') konnte in einem im Jahr 2005 aus Anlaß des 200-Jahr-Jubiläums der Gründung der Handschriftensammlung der Russischen Nationalbibliothek erschienenen Ausstellungskatalog wiederentdeckt werden. Der in kyrillischer Schrift veröffentlichte Katalog, den uns Marie Reusch (Marburg) "entschlüsselt" hat, verzeichnet unter 45 Handschriften der Russischen Nationalbibliothek und 20 Handschriften der Eremitage auch die 1494 von der bekannten Schwester Felicitas Lieberin im Dominikanerinnenkloster Medlingen geschriebene Handschrift; sie wird heute in der Eremitage von St. Petersburg unter der Inv.-Nr. 169562 aufbewahrt.
Zu den Handschriften dieser Schreiberin haben wir hier ausführliche Informationen mitgeteilt:
http://archiv.twoday.net/stories/4230116/
KlausGraf - am Freitag, 13. November 2009, 21:41 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
| The Daily Show With Jon Stewart | Mon - Thurs 11p / 10c | |||
| Want Ads - Grateful Dead Archivist | ||||
| ||||
KlausGraf - am Freitag, 13. November 2009, 21:16 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 13. November 2009, 19:11 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 13. November 2009, 18:32 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 13. November 2009, 18:26 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 13. November 2009, 17:33 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
1988-2008: 20 Jahre Umweltbibliothek Leipzig
Die Umweltbibliothek Leipzig hat jetzt ihren Jahresbericht für 2007/2008 vorgelegt. Auf 25 Seiten werden die erfreulichen und schwierigen Seiten ihrer Entwicklung in den vergangenen beiden Jahren dokumentiert. In den zwanzig Jahren des Bestehens der Umweltbibliothek Leipzig seit 1988, haben eine Vielzahl von Personen, Institutionen, Vereinen, Verbänden und Firmen mit ihren kleinen und großen Unterstützungsleistungen den Betrieb und die Ausstattung der überregional anerkannten und genutzten Umweltbibliothek ermöglicht. Als kleiner Dank finden sich deren Namen auf Vorder- und Rückseite des Jahresberichtes 2007/2008: Jahresbericht 2007/2008.pdf (PDF, fast 10 MB !)
Umweltbibliothek Leipzig, Bernhard-Göring-Str. 152, 04277 Leipzig; www.umweltbibliothek-leipzig.de
Die Umweltbibliothek Leipzig hat jetzt ihren Jahresbericht für 2007/2008 vorgelegt. Auf 25 Seiten werden die erfreulichen und schwierigen Seiten ihrer Entwicklung in den vergangenen beiden Jahren dokumentiert. In den zwanzig Jahren des Bestehens der Umweltbibliothek Leipzig seit 1988, haben eine Vielzahl von Personen, Institutionen, Vereinen, Verbänden und Firmen mit ihren kleinen und großen Unterstützungsleistungen den Betrieb und die Ausstattung der überregional anerkannten und genutzten Umweltbibliothek ermöglicht. Als kleiner Dank finden sich deren Namen auf Vorder- und Rückseite des Jahresberichtes 2007/2008: Jahresbericht 2007/2008.pdf (PDF, fast 10 MB !)
Umweltbibliothek Leipzig, Bernhard-Göring-Str. 152, 04277 Leipzig; www.umweltbibliothek-leipzig.de
Bernd Hüttner - am Freitag, 13. November 2009, 16:51 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 13. November 2009, 15:30 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Erneut will das Adelshaus Waldburg-Wolfegg Kunstschätze verkaufen. Der Fürst hat sich vor einiger Zeit auf Gespräche mit dem Land eingelassen, in denen es um den Verkauf weiterer Teile des Kunstbesitzes seines Hauses geht. Darunter auch um die aus dem Jahr 1468 stammende Handschrift "Ptolomaeus Cosmographia", ein frühes kartographisches Handbuch. Weil die Württembergische Landesbibliothek ein ähnliches Werk besitzt, will das Land aber auf den Erwerb dieses Objekts verzichten.
Da es auf der Liste des national wertvollen Kulturguts steht, darf das Buch auch nicht ohne weiteres außer Landes. Dass er das trotzdem schaffen kann, hat Waldburg-Wolfegg schon einmal bewiesen: 2001 verkaufte er die Weltkarte des Freiburger Kartographen Martin Waldmüllers, die erstmals den Namen "Amerika" für den neu entdeckten Kontinent verwendet, an die US-Kongressbibliothek.
Diesmal aber, so sagt der Sprecher des Wissenschaftsministeriums, werde alles auf eine einvernehmliche, für beide Seiten zufriedenstellende Lösung hinauslaufen. Zu klären ist – neben der der "Cosmographia" – die Zukunft von vier weiteren Kunstwerken aus Waldburg-Wolfegg’schem Besitz. So sollen zwei spätgotische Altartafeln, die Hans Multscher und dessen Werkstatt zugeschrieben werden, im Ulmer Museum bleiben; die beiden Gemälde, die die Kreuzprobe der heiligen Helena und die Kreuztragung des Kaisers Heraklios zeigen, sind mit 350 000 Euro veranschlagt, für die das Land angeblich einen Sponsor gefunden hat.
Das Zehnfache will das Adelshaus für den sogenannten kleinen Klebeband haben, in dem rund 100 Zeichnungen aus dem 15. Jahrhundert mit Porträts sowie höfischen und religiösen Motiven zusammengefasst sind. Für das Land ist das, wie verlautet, zu viel Geld. So muss ein anderer Käufer gesucht werden. Auch das letzte Kunstobjekt ist im Verzeichnis des national wertvollen Kulturguts aufgeführt, das im frühen 16. Jahrhundert verfasste Gebetbuch des "Bauernjörg".
http://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/ausverkauf-im-fuerstenhaus--22239079.html
Zum Hausbuch-Verkauf und den Wolfegger Sammlungen haben wir hier zahlreiche Einträge:
http://archiv.twoday.net/search?q=wolfegg
Zusammenschau:
http://archiv.twoday.net/stories/4775647/
Ein neues Expertengremium soll das Land Baden-Württemberg künftig über den Umgang von Kulturgütern beraten. Die Kommission solle die «Kardinalfrage» lösen helfen, ob das Land in dem jeweiligen Fall sein Vorkaufsrecht im Anspruch nimmt, sagte Wissenschaftsminister Peter Frankenberg (CDU) nach einem entsprechenden Beschluss des Kabinetts am Dienstag in Stuttgart. «Das Land hat nicht die finanziellen Spielräume, alle Kulturgüter, die ihm angeboten werden, zu erwerben.
http://www.pr-inside.com/de/baden-w-uuml-rttemberg-richtet-kommission-zu-r1574649.htm
Pressemitteilung:
http://www.mwk.baden-wuerttemberg.de/no_cache/service/presse/pressemitteilungen/pressedetailseite/article/1988/135/
Wurde die Ptolemäus-Handschrift zwischenzeitlich aus Wolfegg entfernt?
Nach einer Inspektion steht jetzt fest: Die Handschrift "Ptolemaeus Cosmographia" ist auf Schloss Wolfegg. Ob noch oder wieder, bleibt offen. Doch solche Zweifelsfälle soll es in Zukunft nicht mehr geben. Denn um den Verkauf von wertvollen Kulturgütern in Privatbesitz besser zu kontrollieren und zu managen, ruft die Landesregierung ein neues Expertengremium ins Leben.
Am Dienstag durften ein Beamter des Wissenschaftsressorts und ein Sachverständiger Kulturgüter inspizieren, die dem oberschwäbischen Adelshaus Waldburg-Wolfegg gehören, aber nur mit Einverständnis des Landes verkauft werden dürfen. Dabei hätten sie die wertvolle Handschrift "Ptolemaeus Cosmographia" aus dem Jahr 1468 "wohlbehalten angetroffen", berichtete Wissenschaftsminister Peter Frankenberg. Die Experten hätten das Kulturgut auch wiedererkennen können, da sie es im Dezember schon einmal inspiziert hätten.
Die Botschaft, dass alles mit rechten Dingen zugehe, war mit Bedacht gesetzt. Der im Ministerium schriftlich hinterlegte Verdacht, das Adelshaus habe diese Handschrift am Land vorbei verkauft, sollte auf diese Weise aus der Welt geschafft werden. Schließlich verhandeln beide Seiten derzeit über verschiedene Kulturgüter in Waldburg-Wolfegg’schem Besitz – auch wenn sich beide Seiten über die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht einig sind. Trotz der gestrigen Klarstellung bleibt offen, ob die "Cosmographia" tatsächlich die ganze Zeit über auf Schloss Wolfegg gewesen ist. Nach Informationen der Badischen Zeitung hat das Fürstenhaus der zuständigen Denkmalschutzbehörde bei deren letzten Visite im Sommer die Handschrift nicht vorgelegt – wie schon bei einem früheren Besuch. Das hatte den Verdacht aufkommen lassen, das Buch sei schon veräußert, zumal das Adelshaus für den Verkauf der Weltkarte des Freiburger Kartographen Waldseemüller (und nicht, wie gestern fälschlich angegeben, Waldmüller) 2001 und des mittelalterlichen Wolfegger Hausbuchs 2008 erst nachträglich die Erlaubnis eingeholt hatte.
In der Kabinettsvorlage hieß es vieldeutig, für die "Cosmographia" solle es einen Käufer geben. Frankenberg sagte, das Land werde sein Vorkaufsrecht nicht in Anspruch nehmen; ein Verkauf der Handschrift an einen Privatmann werde wohl unter Auflagen genehmigt.
http://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/als-kunstkaeufer-will-sich-das-land-zurueckhalten--22287161.html
Meines Wissens gibt es kein Faksimile der Wolfegger Handschrift! Sie wird in Pressemeldungen mit dem Ulmer Frühdruck, dessen Vorlage sie war, verwechselt.
Der Fürst behauptet, die Ptolemäus-Handschrift sei kein Bestandteil der durch Fideikommisrecht (siehe http://tinyurl.com/y9d6o4r ) geschützten Bibliothek - eine hahnebüchene Argumentation!
 Kreuztragung des Heraklius (Weiteres)
Kreuztragung des Heraklius (Weiteres)
Da es auf der Liste des national wertvollen Kulturguts steht, darf das Buch auch nicht ohne weiteres außer Landes. Dass er das trotzdem schaffen kann, hat Waldburg-Wolfegg schon einmal bewiesen: 2001 verkaufte er die Weltkarte des Freiburger Kartographen Martin Waldmüllers, die erstmals den Namen "Amerika" für den neu entdeckten Kontinent verwendet, an die US-Kongressbibliothek.
Diesmal aber, so sagt der Sprecher des Wissenschaftsministeriums, werde alles auf eine einvernehmliche, für beide Seiten zufriedenstellende Lösung hinauslaufen. Zu klären ist – neben der der "Cosmographia" – die Zukunft von vier weiteren Kunstwerken aus Waldburg-Wolfegg’schem Besitz. So sollen zwei spätgotische Altartafeln, die Hans Multscher und dessen Werkstatt zugeschrieben werden, im Ulmer Museum bleiben; die beiden Gemälde, die die Kreuzprobe der heiligen Helena und die Kreuztragung des Kaisers Heraklios zeigen, sind mit 350 000 Euro veranschlagt, für die das Land angeblich einen Sponsor gefunden hat.
Das Zehnfache will das Adelshaus für den sogenannten kleinen Klebeband haben, in dem rund 100 Zeichnungen aus dem 15. Jahrhundert mit Porträts sowie höfischen und religiösen Motiven zusammengefasst sind. Für das Land ist das, wie verlautet, zu viel Geld. So muss ein anderer Käufer gesucht werden. Auch das letzte Kunstobjekt ist im Verzeichnis des national wertvollen Kulturguts aufgeführt, das im frühen 16. Jahrhundert verfasste Gebetbuch des "Bauernjörg".
http://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/ausverkauf-im-fuerstenhaus--22239079.html
Zum Hausbuch-Verkauf und den Wolfegger Sammlungen haben wir hier zahlreiche Einträge:
http://archiv.twoday.net/search?q=wolfegg
Zusammenschau:
http://archiv.twoday.net/stories/4775647/
Ein neues Expertengremium soll das Land Baden-Württemberg künftig über den Umgang von Kulturgütern beraten. Die Kommission solle die «Kardinalfrage» lösen helfen, ob das Land in dem jeweiligen Fall sein Vorkaufsrecht im Anspruch nimmt, sagte Wissenschaftsminister Peter Frankenberg (CDU) nach einem entsprechenden Beschluss des Kabinetts am Dienstag in Stuttgart. «Das Land hat nicht die finanziellen Spielräume, alle Kulturgüter, die ihm angeboten werden, zu erwerben.
http://www.pr-inside.com/de/baden-w-uuml-rttemberg-richtet-kommission-zu-r1574649.htm
Pressemitteilung:
http://www.mwk.baden-wuerttemberg.de/no_cache/service/presse/pressemitteilungen/pressedetailseite/article/1988/135/
Wurde die Ptolemäus-Handschrift zwischenzeitlich aus Wolfegg entfernt?
Nach einer Inspektion steht jetzt fest: Die Handschrift "Ptolemaeus Cosmographia" ist auf Schloss Wolfegg. Ob noch oder wieder, bleibt offen. Doch solche Zweifelsfälle soll es in Zukunft nicht mehr geben. Denn um den Verkauf von wertvollen Kulturgütern in Privatbesitz besser zu kontrollieren und zu managen, ruft die Landesregierung ein neues Expertengremium ins Leben.
Am Dienstag durften ein Beamter des Wissenschaftsressorts und ein Sachverständiger Kulturgüter inspizieren, die dem oberschwäbischen Adelshaus Waldburg-Wolfegg gehören, aber nur mit Einverständnis des Landes verkauft werden dürfen. Dabei hätten sie die wertvolle Handschrift "Ptolemaeus Cosmographia" aus dem Jahr 1468 "wohlbehalten angetroffen", berichtete Wissenschaftsminister Peter Frankenberg. Die Experten hätten das Kulturgut auch wiedererkennen können, da sie es im Dezember schon einmal inspiziert hätten.
Die Botschaft, dass alles mit rechten Dingen zugehe, war mit Bedacht gesetzt. Der im Ministerium schriftlich hinterlegte Verdacht, das Adelshaus habe diese Handschrift am Land vorbei verkauft, sollte auf diese Weise aus der Welt geschafft werden. Schließlich verhandeln beide Seiten derzeit über verschiedene Kulturgüter in Waldburg-Wolfegg’schem Besitz – auch wenn sich beide Seiten über die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht einig sind. Trotz der gestrigen Klarstellung bleibt offen, ob die "Cosmographia" tatsächlich die ganze Zeit über auf Schloss Wolfegg gewesen ist. Nach Informationen der Badischen Zeitung hat das Fürstenhaus der zuständigen Denkmalschutzbehörde bei deren letzten Visite im Sommer die Handschrift nicht vorgelegt – wie schon bei einem früheren Besuch. Das hatte den Verdacht aufkommen lassen, das Buch sei schon veräußert, zumal das Adelshaus für den Verkauf der Weltkarte des Freiburger Kartographen Waldseemüller (und nicht, wie gestern fälschlich angegeben, Waldmüller) 2001 und des mittelalterlichen Wolfegger Hausbuchs 2008 erst nachträglich die Erlaubnis eingeholt hatte.
In der Kabinettsvorlage hieß es vieldeutig, für die "Cosmographia" solle es einen Käufer geben. Frankenberg sagte, das Land werde sein Vorkaufsrecht nicht in Anspruch nehmen; ein Verkauf der Handschrift an einen Privatmann werde wohl unter Auflagen genehmigt.
http://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/als-kunstkaeufer-will-sich-das-land-zurueckhalten--22287161.html
Meines Wissens gibt es kein Faksimile der Wolfegger Handschrift! Sie wird in Pressemeldungen mit dem Ulmer Frühdruck, dessen Vorlage sie war, verwechselt.
Der Fürst behauptet, die Ptolemäus-Handschrift sei kein Bestandteil der durch Fideikommisrecht (siehe http://tinyurl.com/y9d6o4r ) geschützten Bibliothek - eine hahnebüchene Argumentation!
 Kreuztragung des Heraklius (Weiteres)
Kreuztragung des Heraklius (Weiteres)Eberhard Hilf in INETBIB:
zur technischen Unterstuetzung der Verbreitung der Information ueber die
ePetition zu Open Access fuer die Wissenschaft hat das Aktionsbuendnis
'Urheberrecht fuer Bildung und Wissenschaft' einen Flyer entworfen.
Quelltext und pdf-Fassung ist abrufbar unter
http://www.urheberrechtsbuendnis.de/aktiv.html.de#publ
gleich optimiert, so dass man zwei Flyer auf ein Blatt A4-Papier drucken
kann. Den Quelltext koennen Sie dann auch lokal geeignet anpassen.
Der Flyer kann z.B. hausintern verteilt, in der Bibliothek ausgelegt,
per Rund-email Institutionsintern, etc. verbreitet werden, so wie das hier diskutiert wurde.
Uebrigens findet sich eine englische Fassung unter
http://www.zugang-zum-wissen.de/journal/archives/105-Open-Access-Petition-to-the-German-Parliament.html
dem ein klaerender und unterstuetzender Kommentar von Stevan Harnad beigefuegt ist.
Links zur Entstehung der Petition von Lars Fischer, zur Presse-Erklaerung
des Aktionsbuendnisses und zur Stellungnahme 'Open Access: Positionen,
Prozesse, Perspektiven' der Arbeitsgruppe Open Access in der Allianz der
deutschen Wissenschaftsorganisationen finden Sie in
http://www.zugang-zum-wissen.de/journal/archives/100-e-Petition-zu-Open-Access-an-den-Deutschen-Bundestag.html
zur technischen Unterstuetzung der Verbreitung der Information ueber die
ePetition zu Open Access fuer die Wissenschaft hat das Aktionsbuendnis
'Urheberrecht fuer Bildung und Wissenschaft' einen Flyer entworfen.
Quelltext und pdf-Fassung ist abrufbar unter
http://www.urheberrechtsbuendnis.de/aktiv.html.de#publ
gleich optimiert, so dass man zwei Flyer auf ein Blatt A4-Papier drucken
kann. Den Quelltext koennen Sie dann auch lokal geeignet anpassen.
Der Flyer kann z.B. hausintern verteilt, in der Bibliothek ausgelegt,
per Rund-email Institutionsintern, etc. verbreitet werden, so wie das hier diskutiert wurde.
Uebrigens findet sich eine englische Fassung unter
http://www.zugang-zum-wissen.de/journal/archives/105-Open-Access-Petition-to-the-German-Parliament.html
dem ein klaerender und unterstuetzender Kommentar von Stevan Harnad beigefuegt ist.
Links zur Entstehung der Petition von Lars Fischer, zur Presse-Erklaerung
des Aktionsbuendnisses und zur Stellungnahme 'Open Access: Positionen,
Prozesse, Perspektiven' der Arbeitsgruppe Open Access in der Allianz der
deutschen Wissenschaftsorganisationen finden Sie in
http://www.zugang-zum-wissen.de/journal/archives/100-e-Petition-zu-Open-Access-an-den-Deutschen-Bundestag.html
KlausGraf - am Donnerstag, 12. November 2009, 23:27 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Erneut-Rechtsstreit-um-Namensnennung-in-der-Wikipedia-858795.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/EuGH-soll-Zustaendigkeit-bei-Persoenlichkeitsrechtsverletzungen-auslaendischer-Internet-Firmen-pruefen-855513.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/EuGH-soll-Zustaendigkeit-bei-Persoenlichkeitsrechtsverletzungen-auslaendischer-Internet-Firmen-pruefen-855513.html
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
An die 80 Stück bisher online bei der SLUB Dresden:
http://digital.slub-dresden.de/sammlungen/kollektionen/projekt-bibliotheca-gastronomica/nachTitel/
http://digital.slub-dresden.de/sammlungen/kollektionen/projekt-bibliotheca-gastronomica/nachTitel/
KlausGraf - am Donnerstag, 12. November 2009, 23:15 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ich habe vor Jahren intensiv die Frage des strafrechtlichen Denkmalschutzes recherchiert, zu dem nun das Bundesverfassungsgericht Stellung genommen hat:
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/lk20091006_2bvl000509.html
Dieser arrogante und in der Sache nicht überzeugende Beschluss überspannt einmal mehr die Anforderungen an einen Vorlagebeschluss. Das AG Meißen hat knapp, aber vernünftig und nachvollziehbar das kompetenzrechtliche Problem aufgezeigt. Es wäre die Sache des Bundesverfassungsgerichts gewesen, die Rechtslage umfassend zu erörtern. Ein Amtsrichter oder eine Amtsrichterin ist nun einmal kein Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin, der ein hieb- und stichfestes Gutachten zu einer diffizilen und kaum erörterten Rechtsfrage ohne weiteres aus dem Ärmel schütteln kann.
Das Bundesverfassungsgericht setzt sich zu wenig mit dem entscheidenden Faktum auseinander, dass die auf gesetzte Denkmäler (prospektive Dimension der Erinnerungskultur) schon früh durch die Rechtsprechung auf die Kulturdenkmäler (retrospektive Dimension der Erinnerungskultur) ausgeweitet wurde. Dann ist aber das geschützte Rechtsgut der bundesrechtlichen Vorschrift im wesentlichen identisch mit den Strafvorschriften der Landesdenkmalgesetze. Im Interesse der Normenklarheit sollte eine bundesrechtliche Vorschrift abschließend die Strafbarkeit von gravierenden Verstößen gegen das Denkmalschutzrecht regeln. Da solche Verfahren aber sehr selten sind (während gravierende Verstöße eher häufig sind), stellt sich die Frage, ob wir das Problem überhaupt im Strafrecht regeln sollten und nicht das Ordnungswidrigkeitenrecht geeigneter ist.
Mit seiner hochnäsigen, auf extreme juristische Spitzfindigkeiten abhebenden Argumentation hat das Bundesverfassungsgericht der Normenklarheit im Bereich des Denkmalschutzrechts einen Bärendienst erwiesen.
Der Aufsatz von Weber, der anderer Ansicht ist als das BVerfG, ist teilweise online:
http://books.google.de/books?id=OumydERAANUC&pg=RA4-PA346
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/lk20091006_2bvl000509.html
Dieser arrogante und in der Sache nicht überzeugende Beschluss überspannt einmal mehr die Anforderungen an einen Vorlagebeschluss. Das AG Meißen hat knapp, aber vernünftig und nachvollziehbar das kompetenzrechtliche Problem aufgezeigt. Es wäre die Sache des Bundesverfassungsgerichts gewesen, die Rechtslage umfassend zu erörtern. Ein Amtsrichter oder eine Amtsrichterin ist nun einmal kein Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin, der ein hieb- und stichfestes Gutachten zu einer diffizilen und kaum erörterten Rechtsfrage ohne weiteres aus dem Ärmel schütteln kann.
Das Bundesverfassungsgericht setzt sich zu wenig mit dem entscheidenden Faktum auseinander, dass die auf gesetzte Denkmäler (prospektive Dimension der Erinnerungskultur) schon früh durch die Rechtsprechung auf die Kulturdenkmäler (retrospektive Dimension der Erinnerungskultur) ausgeweitet wurde. Dann ist aber das geschützte Rechtsgut der bundesrechtlichen Vorschrift im wesentlichen identisch mit den Strafvorschriften der Landesdenkmalgesetze. Im Interesse der Normenklarheit sollte eine bundesrechtliche Vorschrift abschließend die Strafbarkeit von gravierenden Verstößen gegen das Denkmalschutzrecht regeln. Da solche Verfahren aber sehr selten sind (während gravierende Verstöße eher häufig sind), stellt sich die Frage, ob wir das Problem überhaupt im Strafrecht regeln sollten und nicht das Ordnungswidrigkeitenrecht geeigneter ist.
Mit seiner hochnäsigen, auf extreme juristische Spitzfindigkeiten abhebenden Argumentation hat das Bundesverfassungsgericht der Normenklarheit im Bereich des Denkmalschutzrechts einen Bärendienst erwiesen.
Der Aufsatz von Weber, der anderer Ansicht ist als das BVerfG, ist teilweise online:
http://books.google.de/books?id=OumydERAANUC&pg=RA4-PA346
KlausGraf - am Donnerstag, 12. November 2009, 22:42 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Wikipedia-Unmut-bei-Spendenaktion-858463.html
Natürlich ist es reine Heuchelei zu behaupten Wikimedia Deutschland e.V. beziehe in der Relevanzdebatte keine Position. Dieser Verein ist Teil des Admin-Problems der Wikipedia, er bevormundet die Community unerträglich. Ich rufe selbstverständlich nicht dazu auf, den Verein finanziell zu schädigen. Ich bekunde lediglich meinen Respekt gegenüber allen, die ihren Unmut äußern.
Natürlich ist es reine Heuchelei zu behaupten Wikimedia Deutschland e.V. beziehe in der Relevanzdebatte keine Position. Dieser Verein ist Teil des Admin-Problems der Wikipedia, er bevormundet die Community unerträglich. Ich rufe selbstverständlich nicht dazu auf, den Verein finanziell zu schädigen. Ich bekunde lediglich meinen Respekt gegenüber allen, die ihren Unmut äußern.
KlausGraf - am Donnerstag, 12. November 2009, 22:16 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 12. November 2009, 22:13 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 12. November 2009, 22:04 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
will der dortige Kulturreferent Peter Grab. Viel Erfolg!
Quelle: Augsburger Allgemeine
s dazu:
http://archiv.twoday.net/stories/6012519/
http://archiv.twoday.net/stories/6006796/
http://archiv.twoday.net/stories/5952139/
http://archiv.twoday.net/stories/5820528/
Quelle: Augsburger Allgemeine
s dazu:
http://archiv.twoday.net/stories/6012519/
http://archiv.twoday.net/stories/6006796/
http://archiv.twoday.net/stories/5952139/
http://archiv.twoday.net/stories/5820528/
Wolf Thomas - am Donnerstag, 12. November 2009, 21:55 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Mein neues Buch liegt mir nun auch gedruckt vor. Es ist für 19,90 Euro erhältlich z.B. bei
http://www.versand-as.de/shop/product_info.php?products_id=2004
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/41788561/

http://www.versand-as.de/shop/product_info.php?products_id=2004
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/41788561/

KlausGraf - am Donnerstag, 12. November 2009, 21:25 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Für das Diözesanarchiv bei der Diözesanverwaltung in Rottenburg suchen wir für eine Projektstelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet für die Dauer von 3 Jahren eine/n
Archivarin/Archivar
Aufgaben:
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere die Erfassung, Bewertung und Erschließung
jüngerer Aktenübernahmen aus der Diözesanverwaltung und die Erarbeitung von Bewertungskonzeptionen.
Anforderungen:
. eine abgeschlossene Ausbildung für den gehobenen Archivdienst oder ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium als Diplomarchivar/Diplomarchivarin
. Vertrautheit mit dem aktuellen Stand der archivwissenschaftlichen Bewertung und Überlieferungsbildung
. Sicherheit im Umgang mit der gängigen Archivsoftware und IT-Standardsoftware
. Die Fähigkeit zu konzeptionellem, selbstständigem und zielorientiertem Arbeiten
. Interesse an kirchen- und zeitgeschichtlichen Themen
Angebote:
ein interessantes Aufgabenfeld und die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen. Anstellung und Vergütung erfolgen nach den dienstrechtlichen Regelungen der Diözese Rottenburg-Stuttgart, die im Wesentlichen dem Bundes-Angestelltentarifvertrag entsprechen. Die Stelle ist nach Vergütungsgruppe Vb–IVa BAT (entsprechend Berufserfahrung) bewertet.
Die Mitgliedschaft in der katholischen Kirche und die Identifikation mit ihrem Auftrag setzen wir voraus. Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis 27.11.2009 an die
Diözesanverwaltung -Personalverwaltung-, Postfach 9, 72108 Rottenburg.
Ihr Ansprechpartner ist Herr Lothar Baur, Tel. 07472/169-532, e-mail LBaur@bo.drs.de.
Archivarin/Archivar
Aufgaben:
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere die Erfassung, Bewertung und Erschließung
jüngerer Aktenübernahmen aus der Diözesanverwaltung und die Erarbeitung von Bewertungskonzeptionen.
Anforderungen:
. eine abgeschlossene Ausbildung für den gehobenen Archivdienst oder ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium als Diplomarchivar/Diplomarchivarin
. Vertrautheit mit dem aktuellen Stand der archivwissenschaftlichen Bewertung und Überlieferungsbildung
. Sicherheit im Umgang mit der gängigen Archivsoftware und IT-Standardsoftware
. Die Fähigkeit zu konzeptionellem, selbstständigem und zielorientiertem Arbeiten
. Interesse an kirchen- und zeitgeschichtlichen Themen
Angebote:
ein interessantes Aufgabenfeld und die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen. Anstellung und Vergütung erfolgen nach den dienstrechtlichen Regelungen der Diözese Rottenburg-Stuttgart, die im Wesentlichen dem Bundes-Angestelltentarifvertrag entsprechen. Die Stelle ist nach Vergütungsgruppe Vb–IVa BAT (entsprechend Berufserfahrung) bewertet.
Die Mitgliedschaft in der katholischen Kirche und die Identifikation mit ihrem Auftrag setzen wir voraus. Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis 27.11.2009 an die
Diözesanverwaltung -Personalverwaltung-, Postfach 9, 72108 Rottenburg.
Ihr Ansprechpartner ist Herr Lothar Baur, Tel. 07472/169-532, e-mail LBaur@bo.drs.de.
Wolf Thomas - am Donnerstag, 12. November 2009, 20:37 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der kirchliche Dienst ist durch den Auftrag der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat bestimmt. Nach ihren Gaben, Qualifikationen, Aufgaben und Verantwortungsbereichen tragen alle Mitarbeitenden der Evangelischen Kirche im Rheinland gleichermaßen zur Erfüllung dieses Auftrages bei.
Im Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland in Düsseldorf ist zum 1. Januar 2010 die Stelle einer/eines
Diplom-Archivarin/ Diplom-Archivars
zu besetzen.
Aufgaben:
Die Aufgabenbereiche umfassen insbesondere:
- Sicherung, Bewertung und Erschließung des Archivgutes der Evangelischen Kirche im Rheinland
- Mitarbeit in der Archivpflege und Archivberatung
- Mitarbeit bei Digitalisierungs- und Publikationsprojekten
Anforderungen:
Wir suchen eine engagierte Mitarbeiterin/einen engagierten Mitarbeiter, die/der die Laufbahnbefähigung für den gehobenen Archivdienst oder eine abgeschlossene Fachhochschulausbildung als Dipl. Archivarin bzw. Dipl. Archivar besitzt und gute Kenntnisse in rheinischer Landes- und Kirchengeschichte erworben hat.
Zudem erwarten wir hohe soziale Kompetenz und Teamfähigkeit. EDV-Kenntnisse in den gängigen MS-Office Programmen sowie einer Archiv-Software setzen wir voraus.
Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 9 TVöD bewertet; ggf. kommt auch eine Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis in Betracht (A 9 BBesG). Wir sind nach dem audit beruf und familie als familienfreundlicher Betrieb zertifiziert.
Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Bewerbungen von Frauen bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Bewerbungen von Schwerbehinderten sind ausdrücklich erwünscht.
Wenn Sie evangelisch sind und sich Ihrer Kirche verbunden fühlen, richten Sie Ihre Bewerbung bitte bis zum 30. November 2009 an Verwaltungsdirektor Rüdiger Rentzsch, Landeskirchenamt der Evangelische Kirche im Rheinland, Hans-Böckler-Straße 7, 40476 Düsseldorf.
Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Leiter des Archivs, Herr Dr. Flesch, Tel.: (0211) 4562 – 225; email: archiv@ekir-lka.de.
Im Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland in Düsseldorf ist zum 1. Januar 2010 die Stelle einer/eines
Diplom-Archivarin/ Diplom-Archivars
zu besetzen.
Aufgaben:
Die Aufgabenbereiche umfassen insbesondere:
- Sicherung, Bewertung und Erschließung des Archivgutes der Evangelischen Kirche im Rheinland
- Mitarbeit in der Archivpflege und Archivberatung
- Mitarbeit bei Digitalisierungs- und Publikationsprojekten
Anforderungen:
Wir suchen eine engagierte Mitarbeiterin/einen engagierten Mitarbeiter, die/der die Laufbahnbefähigung für den gehobenen Archivdienst oder eine abgeschlossene Fachhochschulausbildung als Dipl. Archivarin bzw. Dipl. Archivar besitzt und gute Kenntnisse in rheinischer Landes- und Kirchengeschichte erworben hat.
Zudem erwarten wir hohe soziale Kompetenz und Teamfähigkeit. EDV-Kenntnisse in den gängigen MS-Office Programmen sowie einer Archiv-Software setzen wir voraus.
Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 9 TVöD bewertet; ggf. kommt auch eine Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis in Betracht (A 9 BBesG). Wir sind nach dem audit beruf und familie als familienfreundlicher Betrieb zertifiziert.
Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Bewerbungen von Frauen bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Bewerbungen von Schwerbehinderten sind ausdrücklich erwünscht.
Wenn Sie evangelisch sind und sich Ihrer Kirche verbunden fühlen, richten Sie Ihre Bewerbung bitte bis zum 30. November 2009 an Verwaltungsdirektor Rüdiger Rentzsch, Landeskirchenamt der Evangelische Kirche im Rheinland, Hans-Böckler-Straße 7, 40476 Düsseldorf.
Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Leiter des Archivs, Herr Dr. Flesch, Tel.: (0211) 4562 – 225; email: archiv@ekir-lka.de.
Wolf Thomas - am Donnerstag, 12. November 2009, 20:34 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Auf Basis einer hoch emotionalen Debatte bewerfen sich Leute gegenseitig mit Dreck und versuchen, sich mit maximierter Wucht gegen den virtuellen Karren zu fahren. Man bekommt fast den Eindruck, das „Wiki“ in Wikipedia stünde, wie andernorts behauptet, wirklich für „wie im Kindergarten“.
http://scytale.name/blog/2009/11/jedem-seine-wikipedia
http://scytale.name/blog/2009/11/jedem-seine-wikipedia
Zu den Motiven des Einstellers:
http://www.wissenslogs.de/wblogs/blog/fischblog/allgemein/2009-11-11/kurz-zu-meiner-epetition-kostenloser-erwerb-wissenschaftlicher-publikationen
Siehe auch:
http://www.wissenslogs.de/wblogs/blog/gute-stube/allgemein/2009-11-11/wissenschaftskommunikation-open-access
Unterschreiben kann man hier:
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=7922
http://www.wissenslogs.de/wblogs/blog/fischblog/allgemein/2009-11-11/kurz-zu-meiner-epetition-kostenloser-erwerb-wissenschaftlicher-publikationen
Siehe auch:
http://www.wissenslogs.de/wblogs/blog/gute-stube/allgemein/2009-11-11/wissenschaftskommunikation-open-access
Unterschreiben kann man hier:
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=7922
KlausGraf - am Donnerstag, 12. November 2009, 12:38 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Nach nur elf Monaten hat die Leiterin des Kasseler Stadtarchivs ihren Dienst quittiert. Dr. Sigrid Schieber (37) wechselt nach Wiesbaden und wird dort Abteilungsleiterin im hessischen Hauptstatsarchiv. Das bestätigte Stadtsprecher Hans-Jürgen Schweinsberg.
Private Gründe hätten den Ausschlag für die Kündigung in Kassel gegeben. Der Ehemann von Sigrid Schieber arbeitet in Frankfurt. Die Archivarin und promovierte Historikerin hatte im Dezember 2008 die Nachfolge von Frank-Roland Klaube angetreten, der das Archiv vier Jahrzehnte lang geleitet hat.
Die Stadt Kassel schreibt die Stelle jetzt neu aus. ...."
Quelle: HNA.de
Private Gründe hätten den Ausschlag für die Kündigung in Kassel gegeben. Der Ehemann von Sigrid Schieber arbeitet in Frankfurt. Die Archivarin und promovierte Historikerin hatte im Dezember 2008 die Nachfolge von Frank-Roland Klaube angetreten, der das Archiv vier Jahrzehnte lang geleitet hat.
Die Stadt Kassel schreibt die Stelle jetzt neu aus. ...."
Quelle: HNA.de
Wolf Thomas - am Donnerstag, 12. November 2009, 09:41 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Informationen bereitstellen und Benutzung fördern ist eine der hervorragendsten Aufgaben von Archiven und verwandten Gedächtnisorganisationen. Diesem Anliegen ist das anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Archivschule Marburg stattfindende 14. Archivwissenschaftliche Kolloquium gewidmet. Zugleich ist das Thema durch die an der Archivschule im Sommer 2007 eingerichtete Koordinierungsstelle Retrokonversion motiviert, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit dem Auftrag zur Koordinierung und Durchführung der Digitalisierung der Findmittel des deutschen Archivwesens gefördert wird. Das Interesse der historischen Forschung ist ein Leitmotiv für die Durchführung der Digitalisierung der Findmittel deutscher Archive.
Nach einer zweijährigen Tätigkeit sollen die besonderen Herausforderungen archivischer Retrokonversionsprojekte beleuchtet, aber auch durch Einbeziehung ähnlicher Programme in anderen Ländern oder in anderen Sparten befruchtet werden. Zu berücksichtigen sind neben den spezifischen Erfahrungen der Archive aber auch jene von Dienstleistern, denen im Rahmen der Tagung sowohl auf dem Podium als auch in Posterausstellungen Möglichkeiten zur Darstellung ihrer Leistungen und Wünsche gegeben werden.
Mehr Informationen, das Tagungsprogramm sowie das Anmeldeformular finden Sie unter http://www.archivschule.de
via Archivliste!
Nach einer zweijährigen Tätigkeit sollen die besonderen Herausforderungen archivischer Retrokonversionsprojekte beleuchtet, aber auch durch Einbeziehung ähnlicher Programme in anderen Ländern oder in anderen Sparten befruchtet werden. Zu berücksichtigen sind neben den spezifischen Erfahrungen der Archive aber auch jene von Dienstleistern, denen im Rahmen der Tagung sowohl auf dem Podium als auch in Posterausstellungen Möglichkeiten zur Darstellung ihrer Leistungen und Wünsche gegeben werden.
Mehr Informationen, das Tagungsprogramm sowie das Anmeldeformular finden Sie unter http://www.archivschule.de
via Archivliste!
Wolf Thomas - am Donnerstag, 12. November 2009, 08:45 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 12. November 2009, 03:17 - Rubrik: Literaturarchive
" .... [Oberbürgermeister Eberhard] Menzel dankte Ulrich Räcker-Wellnitz vom Stadtarchiv, der seit sechs Jahren maßgeblich an der Organisation der Weihnachtsmärkte beteiligt war. In diesem Jahr zum letzten Mal. ...."
Quelle:
http://www.wzonline.de/index.php?id=1050&tx_ttnews[tt_news]=136865&tx_ttnews[backPid]=624&cHash=4da17447e0
Quelle:
http://www.wzonline.de/index.php?id=1050&tx_ttnews[tt_news]=136865&tx_ttnews[backPid]=624&cHash=4da17447e0
Wolf Thomas - am Mittwoch, 11. November 2009, 21:40 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Seinen Dienst als neuer Leiter des Krefelder Stadtarchivs hat Dr. Olaf Richter angetreten. Der 41-jährige ist Nachfolger von Paul-Günther Schulte, der nach 21 Jahren als Archiv-Leiter Ende Juli mit Vollendung des 65. Lebensjahres in den Ruhestand gegangen war. Dr. Olaf Richter war zuletzt im Hauptstaatsarchiv Nordrhein-Westfalen als Dezernent tätig. Nach einem Studium der Geschichte und Philosophie an der Heinrich-Heine- Universität Düsseldorf und der Promotion im Fach „Neuere Geschichte“ hat Richter die Laufbahn im höheren Archivdienst für das Land Nordrhein-Westfalen begonnen. Mit der Archivarischen Staatsprüfung wechselte er im Jahr 2002 in das Hauptstaatsarchiv NRW. Dr. Olaf Richter ist verheiratet und zur Zeit wohnhaft in Mönchengladbach."
Quelle: Link
Quelle: Link
Wolf Thomas - am Mittwoch, 11. November 2009, 21:30 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus dem Bericht von Sylvia Staude in der Frankfurter Rundschau (Link): " .....Andere Ideen kreisen um eine bessere Dokumentierung und Archivierung einer trotz moderner Aufzeichnungstechniken immer noch flüchtigen, weil vor allem vom Live-Erlebnis getragenen Kunst. Jochen Sandig, der umtriebige Berliner Impresario, war an Stelle der Choreografin Sasha Waltz gekommen, um die Anstrengungen in deren Umkreis und Company vorzustellen, die Choreografien Waltz´ lebendig zu erhalten und weiterzugeben.
Daraus entstand, mit dem Tanzjournalisten und -wissenschaftler Franz Anton Cramer und dem Publikum, die vielleicht interessanteste Diskussion des Kongresses. Denn plötzlich wurde deutlich, welche spezifischen Probleme der Tanz hat, indem ihm eben kein Text und keine Partitur zugrunde liegen, die freigegeben sind zu wiederholter Interpretation. So will es jedenfalls die Tradition. Ein Tanzstück könnte theoretisch für mal mehr, mal weniger werktreue Deutungen zur Verfügung gestellt werden, die Praxis aber sieht anders aus: Merce Cunningham hat testamentarisch festgelegt, wann die allerletzte Aufführung seiner Company sein soll, William Forsythe hat sich geäußert, dass nach seinem Tod seine Stücke nicht mehr aufgeführt werden sollen, Alain Platel hat das Bühnenbild verbrannt, als er "Lets op Bach" für abgespielt hielt, Pina Bausch hat nur dem Pariser Ballett erlaubt, zwei ihrer Werke ins Repertoire zu nehmen.
Sandig plädierte demgegenüber für ein "lebendes Archiv" in Form einer Company, ihm schweben 40, 50 Tänzer mindestens vor, die Meisterwerke der Tanzmoderne aufführen und in einem Repertoire regelmäßig zugänglich machen. Widerspruch gab es sofort, er betraf aber die Schwierigkeiten der Ausführung, nicht die Tatsache, dass Choreografien bewahrt werden sollten. Auf die Eingeschworenheit vieler Ensembles auf einen bestimmten Choreografen verwies etwa eine Zuhörerin, es sei wohl kaum möglich, dass eine Company an einem Abend eine tolle Bausch-Vorstellung gibt und am nächsten die gleichen Tänzer einen kühlen Cunningham. Und wer, fragte Cramer, solle auch noch zehn, zwanzig Jahre nach dem Tod eines Choreografen über die Weitergabe seines Werks entscheiden? Und wie, fügte Sandig selbst hinzu, geht man damit um, dass heute die beteiligten Tänzer oft Co-Autoren sind? Und bereits eine Neubesetzung auch eine Neuinterpretation ist.
Diese Einwände bedurften eigentlich keiner Illustration, um einzuleuchten, aber ein Auftritt des ehemaligen Bausch-Tänzers und jetzigen Leiters des Folkwang-Tanzstudios, Lutz Förster, lieferte sie. Jérôme Bel hatte mit ihm ein Solo mit dem Titel "Lutz Förster" erarbeitet; natürlich enthält es, neben einem Ausschnitt aus José Limóns "The Moor´s Pavane", Zitate aus Stücken von Pina Bausch. An deren Entstehung wiederum Lutz Förster beteiligt war. Wer hat das Copyright etwa der wunderbaren Gebärdensprach-Szene aus "Nelken"? Und wer soll sie, wenn Lutz Förster dies nicht mehr kann, uns so hinreißend zeigen?"
Daraus entstand, mit dem Tanzjournalisten und -wissenschaftler Franz Anton Cramer und dem Publikum, die vielleicht interessanteste Diskussion des Kongresses. Denn plötzlich wurde deutlich, welche spezifischen Probleme der Tanz hat, indem ihm eben kein Text und keine Partitur zugrunde liegen, die freigegeben sind zu wiederholter Interpretation. So will es jedenfalls die Tradition. Ein Tanzstück könnte theoretisch für mal mehr, mal weniger werktreue Deutungen zur Verfügung gestellt werden, die Praxis aber sieht anders aus: Merce Cunningham hat testamentarisch festgelegt, wann die allerletzte Aufführung seiner Company sein soll, William Forsythe hat sich geäußert, dass nach seinem Tod seine Stücke nicht mehr aufgeführt werden sollen, Alain Platel hat das Bühnenbild verbrannt, als er "Lets op Bach" für abgespielt hielt, Pina Bausch hat nur dem Pariser Ballett erlaubt, zwei ihrer Werke ins Repertoire zu nehmen.
Sandig plädierte demgegenüber für ein "lebendes Archiv" in Form einer Company, ihm schweben 40, 50 Tänzer mindestens vor, die Meisterwerke der Tanzmoderne aufführen und in einem Repertoire regelmäßig zugänglich machen. Widerspruch gab es sofort, er betraf aber die Schwierigkeiten der Ausführung, nicht die Tatsache, dass Choreografien bewahrt werden sollten. Auf die Eingeschworenheit vieler Ensembles auf einen bestimmten Choreografen verwies etwa eine Zuhörerin, es sei wohl kaum möglich, dass eine Company an einem Abend eine tolle Bausch-Vorstellung gibt und am nächsten die gleichen Tänzer einen kühlen Cunningham. Und wer, fragte Cramer, solle auch noch zehn, zwanzig Jahre nach dem Tod eines Choreografen über die Weitergabe seines Werks entscheiden? Und wie, fügte Sandig selbst hinzu, geht man damit um, dass heute die beteiligten Tänzer oft Co-Autoren sind? Und bereits eine Neubesetzung auch eine Neuinterpretation ist.
Diese Einwände bedurften eigentlich keiner Illustration, um einzuleuchten, aber ein Auftritt des ehemaligen Bausch-Tänzers und jetzigen Leiters des Folkwang-Tanzstudios, Lutz Förster, lieferte sie. Jérôme Bel hatte mit ihm ein Solo mit dem Titel "Lutz Förster" erarbeitet; natürlich enthält es, neben einem Ausschnitt aus José Limóns "The Moor´s Pavane", Zitate aus Stücken von Pina Bausch. An deren Entstehung wiederum Lutz Förster beteiligt war. Wer hat das Copyright etwa der wunderbaren Gebärdensprach-Szene aus "Nelken"? Und wer soll sie, wenn Lutz Förster dies nicht mehr kann, uns so hinreißend zeigen?"
Wolf Thomas - am Mittwoch, 11. November 2009, 20:54 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Neben "Wir sind das Volk" ist dies sicher ein weiterer Satz, der in Erinnerung bleibt. Die Auswirkungen der Volkskammerrede Erich Mielkes vom 13.11.1989 für das Mfs beleuchtet das Blog-Magazin "GeschichtePlus" in seinem lesenswerten Beitrag.
Wolf Thomas - am Mittwoch, 11. November 2009, 12:07 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus dem Protokoll der Landtagssitzung (Link): " .....Lutz Lienenkämper, Minister für Bauen und Verkehr: Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Kolleginnen und Kollegen! Die bei Behörden, Gerichten und sonstigen öffentlichen Stellen anfallenden Unterlagen der Dokumentation und Information von heute sind die historischen Quellen von morgen. Es muss gewährleistet sein, dass die bei diesen Stellen nicht mehr benötigten Unterlagen den Archiven angeboten werden. Die Archive werden so in die Lage versetzt, den archivwürdigen Teil zur umfassenden Dokumentation der politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Verhältnisse zu übernehmen, dauerhaft zu erhalten und für die Nutzung aufzubereiten.
Die in den Archiven verwahrten Unterlagen sichern die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung und sind zugleich als objektive Quellen die unverzichtbare Grundlage für die Erforschung der Geschichte. Ihre Erhaltung und Nutzung liegt damit im öffentlichen Interesse.
Dieses wertvolle und unersetzliche Archivgut gegen Vernichtung und Zersplitterung zu schützen und für seine Erhaltung und Nutzung zu sorgen, ist eine politisch wichtige Aufgabe, der im Land Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf Art. 18 der Landesverfassung verfassungsrechtlicher Rang zukommt. Der Verfassungsauftrag richtet sich gleichermaßen an das Land wie an die Gemeinden und die Gemeindeverbände.
Zur Erfüllung dieses Auftrags ist eine gesetzliche Regelung unverzichtbar. Das geltende Archivgesetz vom 16. Mai 1989 tritt am 31. Dezember 2009 außer Kraft. Das Gesetz wird jetzt den technischen Anforderungen angepasst. Für die Übernahme elektronischer Unterlagen müssen die IT-Systeme der abgebenden Behörden und der aufnehmenden Archive kompatibel sein. Um unkalkulierbare Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme nicht kompatibler elektronischer Unterlagen zu vermeiden, müssen die Archive schon in der Phase des Systemdesigns einbezogen werden.
Neu ist der normierte Schutz auch kommunalen Archivguts vor Veräußerung. Die Unveräußerlichkeit von Archivgut als Kulturgut und Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses ist im geltenden Gesetz nur bezogen auf das im Landesarchiv befindliche Archivgut normiert. Der Entwurf folgt den Forderungen der kommunalen Archive und sieht vor, diesen Schutz auf das kommunale Archivgut auszuweiten. Der Gesetzentwurf stellt in diesem Zusammenhang klar, dass mit dem geschützten Archivgut nur solches gemeint ist, das aus dem Verwaltungshandeln des Archivträgers – in Abgrenzung zum Beispiel zu Künstlernachlässen oder Künstlerarchiven – entstanden ist.
Ein spezielles Nutzungsinteresse ist die wissenschaftliche Erforschung des Schicksals von Personen unter nationalsozialistischer Herrschaft. Mit der sogenannten Yad-Vashem-Befugnisnorm wird die Rechtsgrundlage für die Ermittlung von Daten aus noch gesperrtem Archivgut geschaffen.
Der Einsturz des Gebäudes des historischen Archivs der Stadt Köln am 3. März 2009 hat die Bedeutung von Archiven auf tragische Weise ins Bewusstsein gerückt und das Landesarchiv sowie die kommunalen Archive vor besondere Herausforderungen gestellt.
Die Landesregierung hat den Entwurf des Archivgesetzes zunächst zurückgestellt und unterschiedliche Konsequenzen für das Landesarchiv und das den Kommunen obliegende Archivwesen geprüft. Die archivrechtlichen Prüfungen sind abgeschlossen. Aus fachlicher Sicht besteht keine Notwendigkeit, diesbezüglich konkrete Regelungen des Archivgesetzes zu ändern oder zu ergänzen. Das geltende Archivgesetz und der Entwurf des Archivgesetzes bieten eine ausreichende Grundlage für die dauerhafte und sichere Verwahrung von Archivgut. Dies ist zuletzt auch durch die im Auftrag der Landesregierung vom Landesarchiv durchgeführte Expertenanhörung am 24. Juni 2009 bestätigt worden.
Die Staatskanzlei wird in Umsetzung der Ergebnisse der Expertenanhörung und in Abstimmung mit dem Innenministerium das Gespräch mit den Archivträgern, also den kommunalen Spitzenverbänden und den Landschaftsverbänden, aufnehmen, um zu klären, wie das von der Expertenanhörung geforderte standort- und gebäudebezogene Risikomanagement vor Ort umgesetzt werden kann. Infrage kommen zum Beispiel freiwillige Selbstverpflichtungen der Archivträger.
Weiter gehende Vorschriften den Kommunen gegenüber, ob in Gesetzesform oder auch im Wege von Verwaltungsvorschriften, zu fixieren, erscheint gerade vor dem Hintergrund der angespannten Kommunalhaushalte problematisch.
(Beifall von der CDU)
Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, Herr Minister Lienenkämper. – Eine Debatte ist heute nicht vorgesehen.
Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 14/10028 an den Kulturausschuss. Wer dieser Überweisungsempfehlung folgen kann, den bitte ich um das Handzeichen. – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? – Dann ist das einstimmig so beschlossen. ...."
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/6024356/
Die in den Archiven verwahrten Unterlagen sichern die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung und sind zugleich als objektive Quellen die unverzichtbare Grundlage für die Erforschung der Geschichte. Ihre Erhaltung und Nutzung liegt damit im öffentlichen Interesse.
Dieses wertvolle und unersetzliche Archivgut gegen Vernichtung und Zersplitterung zu schützen und für seine Erhaltung und Nutzung zu sorgen, ist eine politisch wichtige Aufgabe, der im Land Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf Art. 18 der Landesverfassung verfassungsrechtlicher Rang zukommt. Der Verfassungsauftrag richtet sich gleichermaßen an das Land wie an die Gemeinden und die Gemeindeverbände.
Zur Erfüllung dieses Auftrags ist eine gesetzliche Regelung unverzichtbar. Das geltende Archivgesetz vom 16. Mai 1989 tritt am 31. Dezember 2009 außer Kraft. Das Gesetz wird jetzt den technischen Anforderungen angepasst. Für die Übernahme elektronischer Unterlagen müssen die IT-Systeme der abgebenden Behörden und der aufnehmenden Archive kompatibel sein. Um unkalkulierbare Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme nicht kompatibler elektronischer Unterlagen zu vermeiden, müssen die Archive schon in der Phase des Systemdesigns einbezogen werden.
Neu ist der normierte Schutz auch kommunalen Archivguts vor Veräußerung. Die Unveräußerlichkeit von Archivgut als Kulturgut und Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses ist im geltenden Gesetz nur bezogen auf das im Landesarchiv befindliche Archivgut normiert. Der Entwurf folgt den Forderungen der kommunalen Archive und sieht vor, diesen Schutz auf das kommunale Archivgut auszuweiten. Der Gesetzentwurf stellt in diesem Zusammenhang klar, dass mit dem geschützten Archivgut nur solches gemeint ist, das aus dem Verwaltungshandeln des Archivträgers – in Abgrenzung zum Beispiel zu Künstlernachlässen oder Künstlerarchiven – entstanden ist.
Ein spezielles Nutzungsinteresse ist die wissenschaftliche Erforschung des Schicksals von Personen unter nationalsozialistischer Herrschaft. Mit der sogenannten Yad-Vashem-Befugnisnorm wird die Rechtsgrundlage für die Ermittlung von Daten aus noch gesperrtem Archivgut geschaffen.
Der Einsturz des Gebäudes des historischen Archivs der Stadt Köln am 3. März 2009 hat die Bedeutung von Archiven auf tragische Weise ins Bewusstsein gerückt und das Landesarchiv sowie die kommunalen Archive vor besondere Herausforderungen gestellt.
Die Landesregierung hat den Entwurf des Archivgesetzes zunächst zurückgestellt und unterschiedliche Konsequenzen für das Landesarchiv und das den Kommunen obliegende Archivwesen geprüft. Die archivrechtlichen Prüfungen sind abgeschlossen. Aus fachlicher Sicht besteht keine Notwendigkeit, diesbezüglich konkrete Regelungen des Archivgesetzes zu ändern oder zu ergänzen. Das geltende Archivgesetz und der Entwurf des Archivgesetzes bieten eine ausreichende Grundlage für die dauerhafte und sichere Verwahrung von Archivgut. Dies ist zuletzt auch durch die im Auftrag der Landesregierung vom Landesarchiv durchgeführte Expertenanhörung am 24. Juni 2009 bestätigt worden.
Die Staatskanzlei wird in Umsetzung der Ergebnisse der Expertenanhörung und in Abstimmung mit dem Innenministerium das Gespräch mit den Archivträgern, also den kommunalen Spitzenverbänden und den Landschaftsverbänden, aufnehmen, um zu klären, wie das von der Expertenanhörung geforderte standort- und gebäudebezogene Risikomanagement vor Ort umgesetzt werden kann. Infrage kommen zum Beispiel freiwillige Selbstverpflichtungen der Archivträger.
Weiter gehende Vorschriften den Kommunen gegenüber, ob in Gesetzesform oder auch im Wege von Verwaltungsvorschriften, zu fixieren, erscheint gerade vor dem Hintergrund der angespannten Kommunalhaushalte problematisch.
(Beifall von der CDU)
Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, Herr Minister Lienenkämper. – Eine Debatte ist heute nicht vorgesehen.
Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 14/10028 an den Kulturausschuss. Wer dieser Überweisungsempfehlung folgen kann, den bitte ich um das Handzeichen. – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? – Dann ist das einstimmig so beschlossen. ...."
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/6024356/
Wolf Thomas - am Mittwoch, 11. November 2009, 09:46 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sabina Kaeser (*1973, lebt in Zürich) und Thomas J. Hauck (*1958, lebt in Berlin) schaffen Raumbilder von absoluter Poesie. Das Archiv reagiert mit rotem Faden auf vorhandene Örtlichkeiten und stellt Bezüge zwischen Außen- und Innenräumen her. Die Gießener Installation wird unter Einbeziehung der Umgebung speziell die Kiosk-Situation thematisieren und mittels Faden und Zeichnungen auf die Bündelung von Wegen und Räumen durch Kioske eingehen.
polypolar - am Mittwoch, 11. November 2009, 09:11 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen