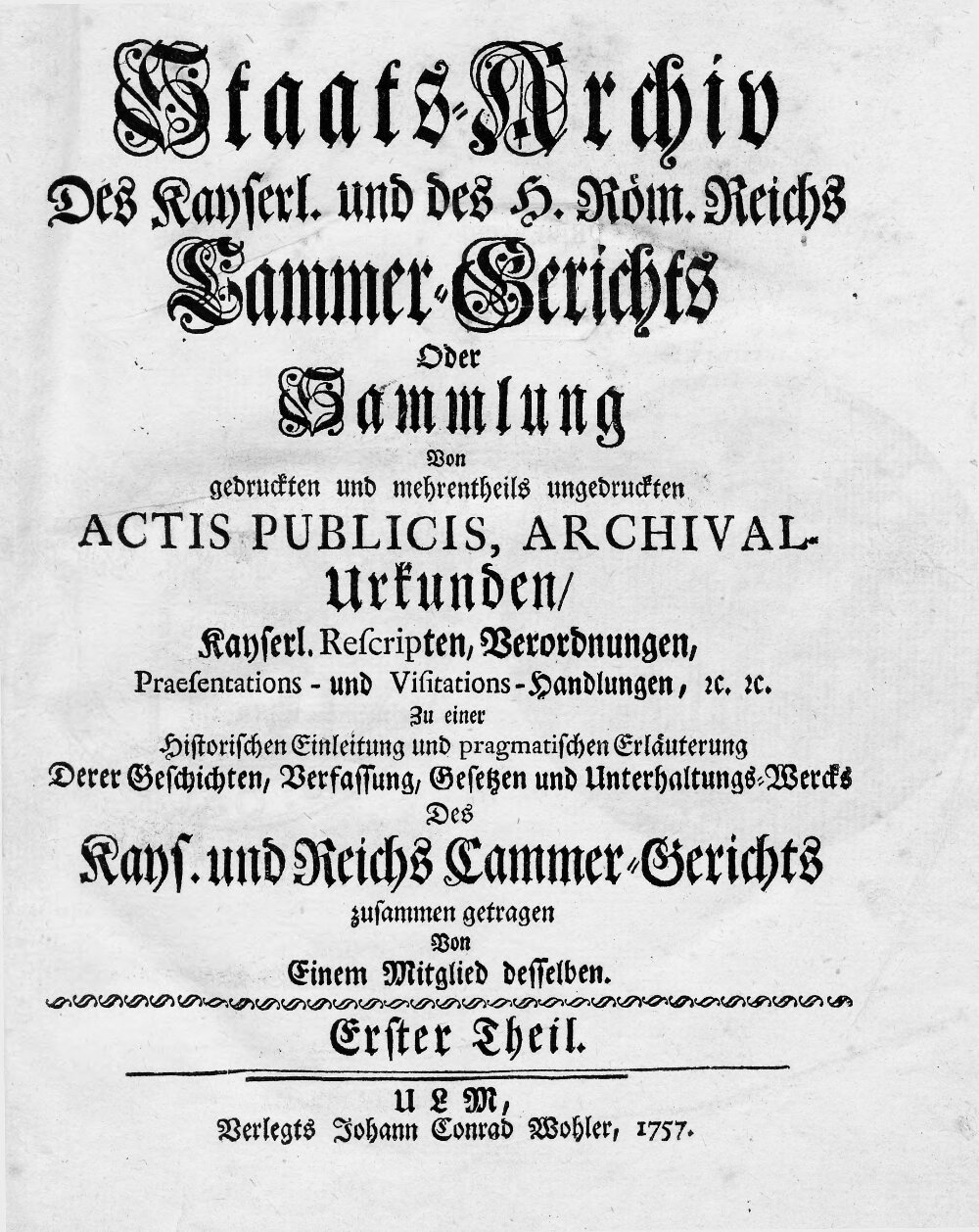Diese Aufnahmen sind ein wissenschaftlicher Schatz, aber beinahe wurden sie weggeworfen: Nur weil eine Archivarin der Nasa einschritt, überlebten Hunderte Magnetbänder mit Fotos von Mond und Erde. Jetzt rekonstruieren Ingenieure die eindrucksvollen Bilder - ein Wettlauf gegen die Zeit.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,684948,00.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,684948,00.html
Ada Sturm - am Dienstag, 23. März 2010, 19:27
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
FAZ.net vom 23. März 2010: In einem der letzten NS-Kriegsverbrecherprozesse hat das Landgericht Aachen am Dienstag einen 88 Jahre alten früheren SS-Mann zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Ex-Bergmann Heinrich Boere hatte sich in dem Verfahren wegen dreier Morde in den Niederlanden verantworten müssen. Boere hatte gestanden, 1944 als Mitglied eines SS-Sonderkommandos drei Zivilisten erschossen zu haben. Der heute in einem Altenheim bei Aachen lebende Angeklagte hatte sich aber auf einen Befehlsnotstand berufen: Bei Befehlsverweigerung habe ihm die Todesstrafe oder die Einlieferung in ein Konzentrationslager gedroht."
Bei dieser Gelegenheit fällt mir Henrikus Maria Vierling ein, ein 23 Jahre alter Holländer der im Steinbruch Steinbergen zusammen mit 36 weiteren Strafgefangenen ermordet wurde. Es ist mir bis heute nicht gelungen, über ihn oder seine Familie irgend etwas zu erfahren. Ich weiss nur, dass er am 19.5.1920 in Brandreng (?) geboren sein soll. Er verstarb angeblich am 28.12.1943, der Meldebericht über seinen Tod wurde erst am 18 April 1944 erstellt.
Dazu Kapitel 18, Seite 149 ff (152) in:
http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000100
http://vierprinzen.blogspot.com/
Bei dieser Gelegenheit fällt mir Henrikus Maria Vierling ein, ein 23 Jahre alter Holländer der im Steinbruch Steinbergen zusammen mit 36 weiteren Strafgefangenen ermordet wurde. Es ist mir bis heute nicht gelungen, über ihn oder seine Familie irgend etwas zu erfahren. Ich weiss nur, dass er am 19.5.1920 in Brandreng (?) geboren sein soll. Er verstarb angeblich am 28.12.1943, der Meldebericht über seinen Tod wurde erst am 18 April 1944 erstellt.
Dazu Kapitel 18, Seite 149 ff (152) in:
http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000100
http://vierprinzen.blogspot.com/
vom hofe - am Dienstag, 23. März 2010, 13:25 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
"Sie arbeitet bereits seit 2004 im Stader Staatsarchiv. Ihre Forschungsschwerpunkte passen ebenso zur Hansestadt: Schifffahrts- und Hafengeschichte. Ihre Doktorarbeit hat sie zum Beispiel über die Häfen in Hamburg und Kopenhagen geschrieben.
Im Stader Stadtarchiv möchte Deggim unter anderem die Historie des Stader Zolls in Brunshausen erkunden. "Es gibt in Stade noch viele spannende Themen zu erforschen", sagt die 43-Jährige, die ein Faible für Norddeutschland und Skandinavien hat, und sich mit der Küste eng verbunden fühlt. Ihre Sprachkenntnisse untermauern das eindrucksvoll: Neben Englisch, Niederdeutsch und Latein gehören auch Norwegisch, Dänisch und Schwedisch zu ihrem Repertoire.
Wenn Deggim am 1. Juni ihren Dienst im Stadtarchiv antritt und damit Jürgen Bohmbach ablöst, möchte sie als erstes den Internetauftritt des Archivs ausbauen. "Mittelfristig plane ich ein Verzeichnisprogramm für die Bestände, also einen Onlinekatalog", sagt die 43-Jährige. Außerdem möchte sie mehr Studierende und weitere Wissenschaftler nach Stade locken, die ihre Forschungsarbeiten in der Hansestadt schreiben. Daher plant sie unter anderem eine Kooperation mit dem Historischen Seminar an der Universität Hamburg, an der Deggim als Lehrbeauftragte unterrichtet hat. "Das Stadtarchiv soll über die Stadtgrenzen hinweg bekannter werden", sagt die Neustaderin, die als Ausgleich zur Archivarbeit gerne im offenen Wasser schwimmen geht oder in ihrem Garten arbeitet.
Der jetzige Stadtarchivar Bohmbach wechselt wiederum zu Deggims altem Arbeitgeber: Er wird sich von Juli an im Niedersächsischen Landesarchiv und im Staatsarchiv Stade einbringen. Doch zunächst wird er vier Wochen "sein" Archiv an die Nachfolgerin übergeben, bevor Bohmbach endgültig in den Ruhestand geht - so wie es eigentlich vor drei Jahren geplant war. Er hatte das Stadtarchiv kommissarisch weitergeleitet.
Deggim hat sich gegen vier weitere Kandidaten durchgesetzt, die in der engeren Wahl waren. Insgesamt hatten sich 23 Historiker für die Stelle beworben. Doch Deggim hatte stets die Nase vorn. Sowohl beim achtseitigen Fragebogen als auch bei der schriftlichen Aufgabe und beim spontanen Redenschreiben habe sich die Archivarin durchsetzten können, sagt Stades Bürgermeister Andreas Rieckhof. Das Verfahren sei nicht einfach gewesen. "Die Bewerber mussten zum Beispiel in 30 Minuten ein Redemanuskript für mich schreiben. Damit wollten wir testen, ob die Kandidaten mehr als Sachkenntnisse zu bieten haben", sagt der studierte Historiker Rieckhof, der die Besetzung des Stadtarchivars als eine der wichtigsten Personalentscheidungen während seiner Amtszeit bezeichnet. Die Hanse- und Hafengeschichte müsse beispielsweise noch weiter erforscht werden."
Wird jetzt Redenschreiben in die neuen Lehrpläne bzw. Prüfungsordnungen für den höheren Archivdienst aufgenommen?
Quelle: Hamburger Abdendblatt
Im Stader Stadtarchiv möchte Deggim unter anderem die Historie des Stader Zolls in Brunshausen erkunden. "Es gibt in Stade noch viele spannende Themen zu erforschen", sagt die 43-Jährige, die ein Faible für Norddeutschland und Skandinavien hat, und sich mit der Küste eng verbunden fühlt. Ihre Sprachkenntnisse untermauern das eindrucksvoll: Neben Englisch, Niederdeutsch und Latein gehören auch Norwegisch, Dänisch und Schwedisch zu ihrem Repertoire.
Wenn Deggim am 1. Juni ihren Dienst im Stadtarchiv antritt und damit Jürgen Bohmbach ablöst, möchte sie als erstes den Internetauftritt des Archivs ausbauen. "Mittelfristig plane ich ein Verzeichnisprogramm für die Bestände, also einen Onlinekatalog", sagt die 43-Jährige. Außerdem möchte sie mehr Studierende und weitere Wissenschaftler nach Stade locken, die ihre Forschungsarbeiten in der Hansestadt schreiben. Daher plant sie unter anderem eine Kooperation mit dem Historischen Seminar an der Universität Hamburg, an der Deggim als Lehrbeauftragte unterrichtet hat. "Das Stadtarchiv soll über die Stadtgrenzen hinweg bekannter werden", sagt die Neustaderin, die als Ausgleich zur Archivarbeit gerne im offenen Wasser schwimmen geht oder in ihrem Garten arbeitet.
Der jetzige Stadtarchivar Bohmbach wechselt wiederum zu Deggims altem Arbeitgeber: Er wird sich von Juli an im Niedersächsischen Landesarchiv und im Staatsarchiv Stade einbringen. Doch zunächst wird er vier Wochen "sein" Archiv an die Nachfolgerin übergeben, bevor Bohmbach endgültig in den Ruhestand geht - so wie es eigentlich vor drei Jahren geplant war. Er hatte das Stadtarchiv kommissarisch weitergeleitet.
Deggim hat sich gegen vier weitere Kandidaten durchgesetzt, die in der engeren Wahl waren. Insgesamt hatten sich 23 Historiker für die Stelle beworben. Doch Deggim hatte stets die Nase vorn. Sowohl beim achtseitigen Fragebogen als auch bei der schriftlichen Aufgabe und beim spontanen Redenschreiben habe sich die Archivarin durchsetzten können, sagt Stades Bürgermeister Andreas Rieckhof. Das Verfahren sei nicht einfach gewesen. "Die Bewerber mussten zum Beispiel in 30 Minuten ein Redemanuskript für mich schreiben. Damit wollten wir testen, ob die Kandidaten mehr als Sachkenntnisse zu bieten haben", sagt der studierte Historiker Rieckhof, der die Besetzung des Stadtarchivars als eine der wichtigsten Personalentscheidungen während seiner Amtszeit bezeichnet. Die Hanse- und Hafengeschichte müsse beispielsweise noch weiter erforscht werden."
Wird jetzt Redenschreiben in die neuen Lehrpläne bzw. Prüfungsordnungen für den höheren Archivdienst aufgenommen?
Quelle: Hamburger Abdendblatt
Wolf Thomas - am Dienstag, 23. März 2010, 12:12 - Rubrik: Personalia
Arbeit im Archiv, Forschung an der Überlieferung: das ist Arbeit am Erhalt des kulturellen Gedächtnisses der Nation. Wie gefährdet dieses Gedächtnis ist, wenn wir im Umgang damit nicht größte Umsicht walten lassen, haben uns in den letzten Jahren der Brand der Anna-Amalia-Bibliothek und der Einsturz des Kölner Stadtarchivs vor Augen geführt. Vieles kann - durch Unachtsamkeit, manchmal sogar durch Schlamperei und kriminelles Handeln verursacht - unrettbar verloren gehen.
http://archiv.twoday.net/stories/6252200/#6252301
http://archiv.twoday.net/stories/6252200/#6252301
KlausGraf - am Montag, 22. März 2010, 12:41 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 22. März 2010, 12:23 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
Über den Festakt am vergangenen Wochenende berichtet die Leipziger Volkszeitung:
http://nachrichten.lvz-online.de/leipzig/citynews/bundespraesident-koehler-eroeffnet-bach-archiv-in-leipzig--besucherandrang-am-sonnabend/r-citynews-a-22620.html
Das Grußwort Horst Köhlers ist im vollen Wortlaut auf der Internetpräsenz des Bundespräsidenten nachlesbar.
http://www.bundespraesident.de/-,11057/Reden-und-Interviews.htm
http://nachrichten.lvz-online.de/leipzig/citynews/bundespraesident-koehler-eroeffnet-bach-archiv-in-leipzig--besucherandrang-am-sonnabend/r-citynews-a-22620.html
Das Grußwort Horst Köhlers ist im vollen Wortlaut auf der Internetpräsenz des Bundespräsidenten nachlesbar.
http://www.bundespraesident.de/-,11057/Reden-und-Interviews.htm
ingobobingo - am Montag, 22. März 2010, 11:16 - Rubrik: Musikarchive
KlausGraf - am Montag, 22. März 2010, 00:27 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Liest man den Lebenslauf von Ernst Torgler, ebenso den von Hinrich Wilhelm Kopf und den von Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg Lippe so ergeben sich markante Überschneidungen.
Torglers Lebenslauf wird in der website des dgb dargestellt.
http://www.niedersachsen.dgb.de/themen/arbeitergeschichte/hakenkreuz_hannover.pdf.
Im Reichstagsbrandprozess wurde er von RA Dr. Alfons Sack vertreten, ein NS Staranwalt.
zu Kopf:
http://archiv.twoday.net/stories/6250553/
zu Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg Lippe:
Der Adjutant von Goebbels Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg Lippe verlieh Geld an Robert Ley zwecks Finanzierung von Druckereien. Die Tilgung des Darlehens sollte durch die Übergabe eines Gutes in Posen erfolgen. Zitat aus Sonne im Nebel Seite 69, 70, Verfasser Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg Lippe: "Der anständige Mann, über den diese Angelegenheit bei der Treuhandstelle Ost laufen sollte und den ich daher damals kennen und auch schätzen lernte, hiess Hinrich Kopf. Er war nach dem Kriege viele Jahre hindurch der sehr geachtete Ministerpräsident des Landes Niedersachsen. Er bot mir in den fünfziger Jahren an, in Schaumburg Lippe Landrat zu werden.Aber auch das musste ich leider ablehnen, weil ich fürchtete, dadurch mit dem Fürstlichen Haus Schaumburg - Lippe in Interessenkollision zu kommen. Aber Hinrich Kopf- der auch Mitglied des Bundesvorstandes der Sozialdemokratischen Partei war-blieb mir doch, bis zu seinem Tode, ein treuer Freund."
Weiter S. 204 und 205:
"Ernst Torgler und ich trafen uns dann in Bonn während der Sitzungsperioden des Bundestages. Er war Abgeordneter der SPD geworden. Die Begegnungen mit diesem Mann...waren zustandegekommen, weil er während des Krieges mit der Treuhandstelle Ost, in der auch Hinrich Kopf arbeitete, nach Bückeburg evakuiert wurde..."
Der Reichstagsbrand fand am 28.2.1933 statt.
Am 1.4.1933 wurde Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg Lippe Adjutant von Goebbels.
Das am 13. März 1933 gegründete Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda unter Joseph Goebbels war im März/April 1933 noch im Aufbau begriffen. Goebbels lässt am 9. Mai durch seinen persönlichen Adjutanten Friedrich Christian Prinz Schaumburg-Lippe seine Bereitschaft erklären, am 10. Mai in Berlin die „Feuerrede“ zur Bücherverbrennung zu halten. Feuerrede: Wieder ist Feuer Protagonist.
http://www.hdbg.de/buecher/Frames/text2.htm
Ernst Torgler arbeitet 1940 für das Propagandaministerium. Ernst Torgler war verdächtigt worden den Reichstag in Brand gesetzt zu haben. Feuer als Propagandamittel ?
Mal zur Dramatisierung der Reinigung von bösartigen Schriften (Bücherverbrennung).
Mal zur Inszenierung eines bösartigen Angriffs gegen staatliche Institutionen (Reichstagsbrand).
Mal zur Inszenierung des Angriffs gegen das Judentum (Reichspogromnacht).
Ein Faible für´s Gokeln attestiert Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg Lippe "entschlossenen Männern" hier:
http://archiv.twoday.net/stories/5596336/
Torgler wird von Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg Lippe, dem Adjutanten von Goebbels, der die Feuerrede ankündigt geschätzt. Torgler arbeitet für die HTO und wird gegen 1945 mit der HTO Ausweichstelle ausgerechnet nach Bückeburg evakuiert. Lernten sich Torgler, Kopf und Schaumburg Lippe wirklich erst 1940 kennen ?
Es drängt sich der Verdacht auf, dass Torgler ein undercover Agent der Nazis war und als solcher in Wahrheit am Reichstagsbrand beteiligt gewesen war. Mit diesem Ansatz könnte die Alleintäterthese zum Reichstagsbrand widerlegt werden. Torglers Freispruch ebnete den Weg für die Alleintäterthese. Torgler als unechter KPDler liefert propagandastisch durch seine Selbstverdächtigung das Alibi für die Kommunistenhetze. Ferner wird das Verfassungsorgan der Weimarer Republik physisch und rechtlich vernichtet. Ganz im Sinne eines Grossteils des ehemaligen Hochadels (womit wir wieder beim Prinzen zu Schaumburg Lippe sind), dessen Bruder an Karl Dreier, Landespräsident Schaumburg Lippes , "als Nationalsozialist seiner Sippe" schreiben wird: "...wenn ich nicht ALLES täte, um meinem Hause die Eigentumsrechte wieder zu verschaffen, die ihm von der seinerzeitigen marxistisch beeinflussten Regierung unter Ausserachtlassung der Rechtslage und unter dem Druck einer gefälschten öffentlichen Meinung zu Unrecht genommen sind" (S. 54 der Vier Prinzen).
http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000100
Die Lebenstabellen von Torgler und Kopf sind in höchstem Grad undurchsichtig. Sie weisen jedoch erhebliche Parallelen auf: die HTO, die nach Bückeburg verlegt wird. Beide finden sich später in der SPD wieder. Und sowohl die Briten als auch die niedersächssische Landesregierung tun alles, damit über die Tätigkeiten von Torgler und Kopf fast gar nichts bekannt wird. Kopfs Berichte zum Auslieferungsverfahren werden 1948 im Eilverfahren vernichtet. Willy Brandt rettet Kopf vor der Auslieferung an Polen. Noch heute lasten auf den britischen Akten sogenannte green card Vermerke (Sperre auf Dauer).
Zu klären wäre, ob es sich bei Kopf und Torgler in Wahrheit um stramme Nationalsozialisten handelte. So sieht es doch aus. Und wieso sollte Torgler nicht als "agent provocateur" beim Reichstagsbrand gehandelt haben ?
Zu Kopf noch ein Hinweis:
FAZ vom 27 März 2010 Seite 33. Artikel: "Die Welt als Willy und Vorstellung", von Martin Otto: "Mit der ironischen Einführung "Ich bin kein Brandt-Experte, nur verwandt" (Einführung in die zehnbändige Berliner Ausgabe von Reden, Artikeln und Briefen Brandts) betonte dagegen der Historiker Peter Brandt (Hagen), Willy Brandts 1948 geborener Sohn, dass sch alle Parteien der frühen Bundesrepublik um die "kleinen Nazis" bemüht hätten. Waren Kopf und Torgler "kleine Nazis" ? Eigentlich egal, denn sie waren Nazis. Nur Nazis dürfen in der HTO arbeiten, das wird doch jedem einleuchten. Ergebnis: Torgler, ein Nazi ist in den Reichstagsbrandvorgang verstrickt und weil er Nazi ist, wird er freigesprochen. Sein Auftritt im Prozess, verkleidet als KPDler.
Eine Klärung der Frage ob kleine oder grosse Nazis verhinderten und verhindern diejenigen die die polnischen Berichte vernichtet haben oder unter Verschluss halten, insbesondere das Foreign Office, aber auch die Niedersächssische Staatskanzlei.
Dies als kleine Skizze. Vielleicht ist diese Option von namhaften Historikern schon längst widerlegt worden. Sollte es so sein, dann bitte ich um eine entsprechende Fundstelle.
http://vierprinzen.blogspot.com/
Torglers Lebenslauf wird in der website des dgb dargestellt.
http://www.niedersachsen.dgb.de/themen/arbeitergeschichte/hakenkreuz_hannover.pdf.
Im Reichstagsbrandprozess wurde er von RA Dr. Alfons Sack vertreten, ein NS Staranwalt.
zu Kopf:
http://archiv.twoday.net/stories/6250553/
zu Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg Lippe:
Der Adjutant von Goebbels Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg Lippe verlieh Geld an Robert Ley zwecks Finanzierung von Druckereien. Die Tilgung des Darlehens sollte durch die Übergabe eines Gutes in Posen erfolgen. Zitat aus Sonne im Nebel Seite 69, 70, Verfasser Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg Lippe: "Der anständige Mann, über den diese Angelegenheit bei der Treuhandstelle Ost laufen sollte und den ich daher damals kennen und auch schätzen lernte, hiess Hinrich Kopf. Er war nach dem Kriege viele Jahre hindurch der sehr geachtete Ministerpräsident des Landes Niedersachsen. Er bot mir in den fünfziger Jahren an, in Schaumburg Lippe Landrat zu werden.Aber auch das musste ich leider ablehnen, weil ich fürchtete, dadurch mit dem Fürstlichen Haus Schaumburg - Lippe in Interessenkollision zu kommen. Aber Hinrich Kopf- der auch Mitglied des Bundesvorstandes der Sozialdemokratischen Partei war-blieb mir doch, bis zu seinem Tode, ein treuer Freund."
Weiter S. 204 und 205:
"Ernst Torgler und ich trafen uns dann in Bonn während der Sitzungsperioden des Bundestages. Er war Abgeordneter der SPD geworden. Die Begegnungen mit diesem Mann...waren zustandegekommen, weil er während des Krieges mit der Treuhandstelle Ost, in der auch Hinrich Kopf arbeitete, nach Bückeburg evakuiert wurde..."
Der Reichstagsbrand fand am 28.2.1933 statt.
Am 1.4.1933 wurde Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg Lippe Adjutant von Goebbels.
Das am 13. März 1933 gegründete Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda unter Joseph Goebbels war im März/April 1933 noch im Aufbau begriffen. Goebbels lässt am 9. Mai durch seinen persönlichen Adjutanten Friedrich Christian Prinz Schaumburg-Lippe seine Bereitschaft erklären, am 10. Mai in Berlin die „Feuerrede“ zur Bücherverbrennung zu halten. Feuerrede: Wieder ist Feuer Protagonist.
http://www.hdbg.de/buecher/Frames/text2.htm
Ernst Torgler arbeitet 1940 für das Propagandaministerium. Ernst Torgler war verdächtigt worden den Reichstag in Brand gesetzt zu haben. Feuer als Propagandamittel ?
Mal zur Dramatisierung der Reinigung von bösartigen Schriften (Bücherverbrennung).
Mal zur Inszenierung eines bösartigen Angriffs gegen staatliche Institutionen (Reichstagsbrand).
Mal zur Inszenierung des Angriffs gegen das Judentum (Reichspogromnacht).
Ein Faible für´s Gokeln attestiert Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg Lippe "entschlossenen Männern" hier:
http://archiv.twoday.net/stories/5596336/
Torgler wird von Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg Lippe, dem Adjutanten von Goebbels, der die Feuerrede ankündigt geschätzt. Torgler arbeitet für die HTO und wird gegen 1945 mit der HTO Ausweichstelle ausgerechnet nach Bückeburg evakuiert. Lernten sich Torgler, Kopf und Schaumburg Lippe wirklich erst 1940 kennen ?
Es drängt sich der Verdacht auf, dass Torgler ein undercover Agent der Nazis war und als solcher in Wahrheit am Reichstagsbrand beteiligt gewesen war. Mit diesem Ansatz könnte die Alleintäterthese zum Reichstagsbrand widerlegt werden. Torglers Freispruch ebnete den Weg für die Alleintäterthese. Torgler als unechter KPDler liefert propagandastisch durch seine Selbstverdächtigung das Alibi für die Kommunistenhetze. Ferner wird das Verfassungsorgan der Weimarer Republik physisch und rechtlich vernichtet. Ganz im Sinne eines Grossteils des ehemaligen Hochadels (womit wir wieder beim Prinzen zu Schaumburg Lippe sind), dessen Bruder an Karl Dreier, Landespräsident Schaumburg Lippes , "als Nationalsozialist seiner Sippe" schreiben wird: "...wenn ich nicht ALLES täte, um meinem Hause die Eigentumsrechte wieder zu verschaffen, die ihm von der seinerzeitigen marxistisch beeinflussten Regierung unter Ausserachtlassung der Rechtslage und unter dem Druck einer gefälschten öffentlichen Meinung zu Unrecht genommen sind" (S. 54 der Vier Prinzen).
http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000100
Die Lebenstabellen von Torgler und Kopf sind in höchstem Grad undurchsichtig. Sie weisen jedoch erhebliche Parallelen auf: die HTO, die nach Bückeburg verlegt wird. Beide finden sich später in der SPD wieder. Und sowohl die Briten als auch die niedersächssische Landesregierung tun alles, damit über die Tätigkeiten von Torgler und Kopf fast gar nichts bekannt wird. Kopfs Berichte zum Auslieferungsverfahren werden 1948 im Eilverfahren vernichtet. Willy Brandt rettet Kopf vor der Auslieferung an Polen. Noch heute lasten auf den britischen Akten sogenannte green card Vermerke (Sperre auf Dauer).
Zu klären wäre, ob es sich bei Kopf und Torgler in Wahrheit um stramme Nationalsozialisten handelte. So sieht es doch aus. Und wieso sollte Torgler nicht als "agent provocateur" beim Reichstagsbrand gehandelt haben ?
Zu Kopf noch ein Hinweis:
FAZ vom 27 März 2010 Seite 33. Artikel: "Die Welt als Willy und Vorstellung", von Martin Otto: "Mit der ironischen Einführung "Ich bin kein Brandt-Experte, nur verwandt" (Einführung in die zehnbändige Berliner Ausgabe von Reden, Artikeln und Briefen Brandts) betonte dagegen der Historiker Peter Brandt (Hagen), Willy Brandts 1948 geborener Sohn, dass sch alle Parteien der frühen Bundesrepublik um die "kleinen Nazis" bemüht hätten. Waren Kopf und Torgler "kleine Nazis" ? Eigentlich egal, denn sie waren Nazis. Nur Nazis dürfen in der HTO arbeiten, das wird doch jedem einleuchten. Ergebnis: Torgler, ein Nazi ist in den Reichstagsbrandvorgang verstrickt und weil er Nazi ist, wird er freigesprochen. Sein Auftritt im Prozess, verkleidet als KPDler.
Eine Klärung der Frage ob kleine oder grosse Nazis verhinderten und verhindern diejenigen die die polnischen Berichte vernichtet haben oder unter Verschluss halten, insbesondere das Foreign Office, aber auch die Niedersächssische Staatskanzlei.
Dies als kleine Skizze. Vielleicht ist diese Option von namhaften Historikern schon längst widerlegt worden. Sollte es so sein, dann bitte ich um eine entsprechende Fundstelle.
http://vierprinzen.blogspot.com/
vom hofe - am Sonntag, 21. März 2010, 20:52 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Kölns OB Roters (SPD) hat einen gegen Baudezernenten Bernd Streitberger (CDU) vom damaligen OB Schramma (CDU) verhängten Verweis wegen des Einsturzes des Stadtarchivs aufgehoben. Der Verweis wurde ausgesprochen, weil Streitberger dem städtischen Krisenstab nach dem Unglück mehrere Tage Informationen vorenthalten habe. Er hatte von Protokollen aus Bausprechungen der KVB erfahren, die schon Monate vor dem Archiveinsturz von Wasserdurchlässigkeiten in der nahen U-Bahn-Haltestelle berichteten
Gegen diese Disziplinarmaßnahme hatte Streitberger vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht geklagt. Das Gericht habe signalisiert, dass die Klage erfolgreich wäre.
Quelle: Westfäische Rundschau, 19.03.2010
Gegen diese Disziplinarmaßnahme hatte Streitberger vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht geklagt. Das Gericht habe signalisiert, dass die Klage erfolgreich wäre.
Quelle: Westfäische Rundschau, 19.03.2010
Wolf Thomas - am Sonntag, 21. März 2010, 19:46 - Rubrik: Kommunalarchive
Sagen der Schwäbischen Alb und in Hohenzollern
Vortrag von Dr. Klaus Graf, Aachen
Montag, 22.03.2010, 20 Uhr
Staatsarchiv Sigmaringen
sowie
Über "Sagen der Alb und in Hohenzollern" referiert am Dienstag, 23. März, im Hohenzollerischen Landesmuseum der Historiker und Archivar Klaus Graf.
Der Veranstalter des Vortragsabend ist der Hohenzollerische Geschichtsverein. Los geht es um 20 Uhr im Alten Schloss in Hechingen. Was hat es mit jenen alten Geschichten auf sich, die man gemeinhin Sagen nennt? Dr. Klaus Graf, Autor des Buches "Sagen der Schwäbischen Alb", will die Zuhörer zu einem Streifzug durch die hohenzollerische Sagenwelt entführen. Zur Sprache kommen bekannte Sagen wie die vom "Höllischen Schuss", aber auch unbekanntere. Es soll vor allem um die Geschichte des Sagensammelns und der Sagenforschung gehen, denn es gilt: Die Sammler machen die Sagen. Sagen sind also - entgegen dem geläufigen Klischee - keine Botschaften aus uralter Zeit, die von Generation zu Generation mündlich weitergetragen wurden. Sagen sind zuallererst Kinder ihrer eigenen Zeit, und das heißt des 19. und 20. Jahrhunderts, als sie aufgezeichnet (und manchmal auch erfunden) wurden.
Hier noch einige Links zum Thema:
Blätter für literarische Unterhaltung 1862: Rezension des Sagenbuchs von Ludwig Egler
http://books.google.com/books?id=b1EFAAAAQAAJ&pg=PA241
25 Sagen aus Hohenzollern aus Grässe 1871
Sagen in der Alemannia 12, 1884, 7ff.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Alemannia_XII_015.jpg
Stefan Schmidt-Lawrenz: Hechingen - die Sage vom höllischen Schuss
http://web.archive.org/web/20080518045650/http://www.schwaebischer-heimatbund.de/natur_schuetzen/index.php?cid=448
Graf, Schwabensagen
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3459/pdf/Graf_schwabensagen.pdf
Materialien
http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind0509&L=HEXENFORSCHUNG&P=R1334&I=-3
Aus dem Buch "Sagen der Schwäbischen Alb" 2008 S. 97-101 Nr. 69
Hechingen
Der höllische Schuss
Nach der Burg [Hohenzollern] führt zunächst die Balinger Landstrasse, von welcher über die Wiesen ein Fussweg, und ausserhalb des Brühlhofes die eigentliche Burgstrasse abzweigt. Bei guter Witterung wählt sich indessen der rüstige Bergsteiger den kürzeren und schattigen Waldweg, vorbei an der Gottesackerkapelle zum hl. Kreuz. Der Freund der Sage wird diese Kapelle nicht unbesucht lassen. Im Innern derselben findet er zwei Votivbilder mit erklärendem Text, von welchem die Sage etwas abweicht. Diese erzählt: Einst war ein Graf auf Zollern, der glänzenden Hof hielt, und grosse Festlichkeiten liebte. Einmal lud er viele Gäste, ritterliche Herren, zu einem Schützenfeste ein, welches auf der Zollerburg gehalten werden, und wobei der Siegesdank des Burgherrn wegen ihrer Schönheit weithin bekannte jungfräuliche Tochter ertheilen sollte. Der Graf hatte aber einen Junker, der zu dem minniglichen Burgfräulein glühende Liebe im Herzen trug, und aus ihrer Hand den Siegespreis zu erhalten war sein einziges Sinnen und Trachten. Aber wie sollte ihm dies möglich werden, da er kein sehr guter Schütze war? Zur Uebung war die Zeit zu kurz, und ein anderes Mittel mochte es nicht leicht geben. Am Vorabende des Festes, da schon viele Gäste auf der Burg eingezogen waren, liess es ihm aber keine Ruhe, und er stieg herab in’s Thal, ging in Gedanken vertieft dem Wald entlang, da, plötzlich fühlte er sich angehalten, er sah sich um und – ein seltsam gestalteter und wunderlich gekleideter Mann redete ihn an: „Was fehlt Euch? Ihr seht gar so traurig aus. Weiss schon, Ihr möchtet Morgen beim Schützenfeste glücklicher Sieger sein!“ „Ja, das wünschte ich“ entgegnete der Jüngling, „aber wie dieses angehen, dass es mir auch wirklich gelingt?“ „O! da kann ich schon rathen, wenn der Herr Junker nur Muth hat, und das Mittel, das ich ihm sage, nicht scheut.“ „Heraus damit,“ rief hastig der Jüngling, „um jeden Preis, wenn es mir nur Glück bringt, ich will es wissen!“ Da sprach der geheimnissvolle Mann: „Seht Ihr dort unten am Kreuzwege die grosse Linde“ – „mit dem Christusbilde“ fiel der Jüngling ein, „Ja!“ versetzte schaudernd der Fremde, „schiesset Ihr auf das Bild mit einem Pfeile dreimal, so werdet Ihr mit diesem Pfeile Morgen unfehlbar jedes Ziel treffen und Sieger sein.“ „Das ist ein schreckliches Opfer,“ klagte bestürzt der Jüngling, „wer sollte so Gottloses vollbringen können?“ „Thut, was Ihr wollt, erwiederte kalt der höllische Mann, „so, und nicht anders, werdet Ihr das Gewünschte erlangen;“ und er verschwand mit diesen Worten im Gebüsche. Der Junker, kaum noch voller Hoffnung, versank wieder in grosse Traurigkeit, und schlug den Rückweg zur Burg ein. Unterwegs überlegte er noch einmal was ihm der Fremde gesagt. Es kämpfte der böse und der gute Geist in ihm. Endlich wurde der böse Geist Sieger und der unglückliche Junker nahm sich vor, dem Rathe des Fremden zu folgen. In kurzer Zeit stieg er wieder zu Thal, mit Pfeil und Bogen gerüstet. Er stand vor der Linde, und wollte schon mit dem Geschosse auf das hl. Bild anlegen, als ihm ein altes Männlein erschien, das ihn ermahnte, so frevelhaftes nicht zu vollbringen. Der Junker hörte nicht darauf, und spannte den Bogen. Da warnte das Männlein zum zweitenmal. Umsonst! der Junker liess sich nicht abhalten und der gute Geist, nachdem er zum drittenmal gewarnt, entfernte sich weheklagend. Nun schoss der Junker dreimal auf das Crucifix, das letztemal traf er die Seitenwunde, und – es floss Blut daraus. Der Frevler zitterte, und wollte den Pfeil der Brust des Bildes entnehmen, allein, er konnte nicht von der Stelle, die Erde fesselte ihn. So verblieb er in Todesangst bis zum andern Morgen, wo er von der Burg aus bemerkt wurde. man sah nach, und erkannte seine Frevelthat. Da liess ihm der Graf sofort das Haupt abschlagen. Noch steht die Linde, vom Alter gehöhlt, und erinnert an die schauerliche Sage. Die Kapelle wurde vom Grafen Friedrich, genannt Ostertag, von Zollern erbaut, und von seinem Sohn, dem bekannten Oettinger, vielfach mit Stiftungen bedacht.
Die Geschichte vom höllischen Schuss, die dem Freischütz-Stoff angehört, ist diejenige Sage Hohenzollerns, die am meisten Bearbeitungen erfahren hat. Als man beim Wiederaufbau der Burg Hohenzollern für die Motive der Gemälde in der 1864 fertig gestellten Bibliothek Sagen aus Hohenzollern auswählte, hat man selbstverständlich „Die Strafe des Frevlers am heiligen Kreuze bei Stetten“ berücksichtigt. Eine erste Version begegnet schon im berüchtigten „Hexenhammer“ aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Später erzählte Froben Christoph von Zimmern (gestorben 1566) die Geschichte in seiner Zimmerischen Chronik.
Im 19. Jahrhundert wurde dem Stoff eine romantische Liebesgeschichte aufgepfropft. Kurz vor Ludwig Eglers Hechinger Führer (1863), aus dem der hier wiedergegebene Text stammt, hatte der Thiergartener Volksschullehrer Jakob Barth (1825-1895) in seiner „Hohenzollernsche Chronik oder Geschichte und Sage der hohenzollernschen Lande“ eine erzählerische Bearbeitung vorgelegt. Die Liebesromanze erzählt, wie ein Edelknappe Wilhelm von Hohenberg von einem unheimlichen Mann in einem roten Mantel dazu verleitet wird, auf ein Kruzifix in der Nähe von Stetten drei Schüsse abzugeben. Er weigert sich zunächst. Dann könne er aber zusehen, gibt ihm der Rotmantel zu verstehen, wie sein Nebenbuhler um die Liebe der lieblich blühenden Berta von Zollern im für den folgenden Tag angesetzten Wettkampf siegen werde, „wie der glückliche Bräutigam eure angebetete Bertha zum Altare führt, könnt dabei sehen, wie er vor Aller Augen den feurigen Kuß auf ihre Rosenlippen drückt, ungescheut seine Arme um ihren reizenden Leib schlingt und die Gewonnene triumphirend sein treueigenes Weib nennt“. Kurz: Wilhelm schießt, ohne sich von den eindringlichen Warnungen eines Zwerg abhalten zu lassen und wird vom Tode ergriffen, doch ein Beichtvater des nahe gelegenen Klosters Gnadental kann gerade noch seine ewige Seligkeit retten. Egler hat offenkundig diese Fassung auf den „Sagenton“ zurechtgestutzt. Erfunden hat Barth diese Liebesgeschichte nicht. Dieses Verdienst dürfte Wilhelm Binder zukommen, der eine Erzählung „Der höllische Schuß“ mit der gleichen Personenkonstellation in seinen „Alemannischen Volkssagen“ 1843 veröffentlicht hatte.
Wer der Sage vor Ort nachspüren möchte, sollte nicht nur die Friedhofskapelle zum Heiligen Kreuz aufsuchen, sondern auch das Hohenzollerische Landesmuseum in Hechingen, wo nicht nur der (inzwischen leere) Bildstock aus Holz zu sehen ist, in dem sich das beschossene Kruzifix befunden haben soll, sondern auch zwei Gemälde des 18. Jahrhunderts, auf denen die Überlieferung bildlich dargestellt ist.
Quelle: Ludwig Egler, Führer durch Hechingen und die Burg Hohenzollern, 1863, S. 29-31. Vgl. Graf, Schwabensagen, mit weiteren Nachweisen. Ergänzend: Wilhelm Binder, Alemannische Volkssagen, Geschichten und Märchen, Bd. 2, 1843, S. 1-24
 Heiligkreuzkapelle Hechingen, eigenes Foto http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Heiligkreuzkapelle_Hechingen
Heiligkreuzkapelle Hechingen, eigenes Foto http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Heiligkreuzkapelle_Hechingen
 Bildstock im Hechinger Landesmuseum
Bildstock im Hechinger Landesmuseum
 Gemälde ebenda http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:H%C3%B6llischer_Schuss
Gemälde ebenda http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:H%C3%B6llischer_Schuss
Vortrag von Dr. Klaus Graf, Aachen
Montag, 22.03.2010, 20 Uhr
Staatsarchiv Sigmaringen
sowie
Über "Sagen der Alb und in Hohenzollern" referiert am Dienstag, 23. März, im Hohenzollerischen Landesmuseum der Historiker und Archivar Klaus Graf.
Der Veranstalter des Vortragsabend ist der Hohenzollerische Geschichtsverein. Los geht es um 20 Uhr im Alten Schloss in Hechingen. Was hat es mit jenen alten Geschichten auf sich, die man gemeinhin Sagen nennt? Dr. Klaus Graf, Autor des Buches "Sagen der Schwäbischen Alb", will die Zuhörer zu einem Streifzug durch die hohenzollerische Sagenwelt entführen. Zur Sprache kommen bekannte Sagen wie die vom "Höllischen Schuss", aber auch unbekanntere. Es soll vor allem um die Geschichte des Sagensammelns und der Sagenforschung gehen, denn es gilt: Die Sammler machen die Sagen. Sagen sind also - entgegen dem geläufigen Klischee - keine Botschaften aus uralter Zeit, die von Generation zu Generation mündlich weitergetragen wurden. Sagen sind zuallererst Kinder ihrer eigenen Zeit, und das heißt des 19. und 20. Jahrhunderts, als sie aufgezeichnet (und manchmal auch erfunden) wurden.
Hier noch einige Links zum Thema:
Blätter für literarische Unterhaltung 1862: Rezension des Sagenbuchs von Ludwig Egler
http://books.google.com/books?id=b1EFAAAAQAAJ&pg=PA241
25 Sagen aus Hohenzollern aus Grässe 1871
Sagen in der Alemannia 12, 1884, 7ff.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Alemannia_XII_015.jpg
Stefan Schmidt-Lawrenz: Hechingen - die Sage vom höllischen Schuss
http://web.archive.org/web/20080518045650/http://www.schwaebischer-heimatbund.de/natur_schuetzen/index.php?cid=448
Graf, Schwabensagen
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3459/pdf/Graf_schwabensagen.pdf
Materialien
http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind0509&L=HEXENFORSCHUNG&P=R1334&I=-3
Aus dem Buch "Sagen der Schwäbischen Alb" 2008 S. 97-101 Nr. 69
Hechingen
Der höllische Schuss
Nach der Burg [Hohenzollern] führt zunächst die Balinger Landstrasse, von welcher über die Wiesen ein Fussweg, und ausserhalb des Brühlhofes die eigentliche Burgstrasse abzweigt. Bei guter Witterung wählt sich indessen der rüstige Bergsteiger den kürzeren und schattigen Waldweg, vorbei an der Gottesackerkapelle zum hl. Kreuz. Der Freund der Sage wird diese Kapelle nicht unbesucht lassen. Im Innern derselben findet er zwei Votivbilder mit erklärendem Text, von welchem die Sage etwas abweicht. Diese erzählt: Einst war ein Graf auf Zollern, der glänzenden Hof hielt, und grosse Festlichkeiten liebte. Einmal lud er viele Gäste, ritterliche Herren, zu einem Schützenfeste ein, welches auf der Zollerburg gehalten werden, und wobei der Siegesdank des Burgherrn wegen ihrer Schönheit weithin bekannte jungfräuliche Tochter ertheilen sollte. Der Graf hatte aber einen Junker, der zu dem minniglichen Burgfräulein glühende Liebe im Herzen trug, und aus ihrer Hand den Siegespreis zu erhalten war sein einziges Sinnen und Trachten. Aber wie sollte ihm dies möglich werden, da er kein sehr guter Schütze war? Zur Uebung war die Zeit zu kurz, und ein anderes Mittel mochte es nicht leicht geben. Am Vorabende des Festes, da schon viele Gäste auf der Burg eingezogen waren, liess es ihm aber keine Ruhe, und er stieg herab in’s Thal, ging in Gedanken vertieft dem Wald entlang, da, plötzlich fühlte er sich angehalten, er sah sich um und – ein seltsam gestalteter und wunderlich gekleideter Mann redete ihn an: „Was fehlt Euch? Ihr seht gar so traurig aus. Weiss schon, Ihr möchtet Morgen beim Schützenfeste glücklicher Sieger sein!“ „Ja, das wünschte ich“ entgegnete der Jüngling, „aber wie dieses angehen, dass es mir auch wirklich gelingt?“ „O! da kann ich schon rathen, wenn der Herr Junker nur Muth hat, und das Mittel, das ich ihm sage, nicht scheut.“ „Heraus damit,“ rief hastig der Jüngling, „um jeden Preis, wenn es mir nur Glück bringt, ich will es wissen!“ Da sprach der geheimnissvolle Mann: „Seht Ihr dort unten am Kreuzwege die grosse Linde“ – „mit dem Christusbilde“ fiel der Jüngling ein, „Ja!“ versetzte schaudernd der Fremde, „schiesset Ihr auf das Bild mit einem Pfeile dreimal, so werdet Ihr mit diesem Pfeile Morgen unfehlbar jedes Ziel treffen und Sieger sein.“ „Das ist ein schreckliches Opfer,“ klagte bestürzt der Jüngling, „wer sollte so Gottloses vollbringen können?“ „Thut, was Ihr wollt, erwiederte kalt der höllische Mann, „so, und nicht anders, werdet Ihr das Gewünschte erlangen;“ und er verschwand mit diesen Worten im Gebüsche. Der Junker, kaum noch voller Hoffnung, versank wieder in grosse Traurigkeit, und schlug den Rückweg zur Burg ein. Unterwegs überlegte er noch einmal was ihm der Fremde gesagt. Es kämpfte der böse und der gute Geist in ihm. Endlich wurde der böse Geist Sieger und der unglückliche Junker nahm sich vor, dem Rathe des Fremden zu folgen. In kurzer Zeit stieg er wieder zu Thal, mit Pfeil und Bogen gerüstet. Er stand vor der Linde, und wollte schon mit dem Geschosse auf das hl. Bild anlegen, als ihm ein altes Männlein erschien, das ihn ermahnte, so frevelhaftes nicht zu vollbringen. Der Junker hörte nicht darauf, und spannte den Bogen. Da warnte das Männlein zum zweitenmal. Umsonst! der Junker liess sich nicht abhalten und der gute Geist, nachdem er zum drittenmal gewarnt, entfernte sich weheklagend. Nun schoss der Junker dreimal auf das Crucifix, das letztemal traf er die Seitenwunde, und – es floss Blut daraus. Der Frevler zitterte, und wollte den Pfeil der Brust des Bildes entnehmen, allein, er konnte nicht von der Stelle, die Erde fesselte ihn. So verblieb er in Todesangst bis zum andern Morgen, wo er von der Burg aus bemerkt wurde. man sah nach, und erkannte seine Frevelthat. Da liess ihm der Graf sofort das Haupt abschlagen. Noch steht die Linde, vom Alter gehöhlt, und erinnert an die schauerliche Sage. Die Kapelle wurde vom Grafen Friedrich, genannt Ostertag, von Zollern erbaut, und von seinem Sohn, dem bekannten Oettinger, vielfach mit Stiftungen bedacht.
Die Geschichte vom höllischen Schuss, die dem Freischütz-Stoff angehört, ist diejenige Sage Hohenzollerns, die am meisten Bearbeitungen erfahren hat. Als man beim Wiederaufbau der Burg Hohenzollern für die Motive der Gemälde in der 1864 fertig gestellten Bibliothek Sagen aus Hohenzollern auswählte, hat man selbstverständlich „Die Strafe des Frevlers am heiligen Kreuze bei Stetten“ berücksichtigt. Eine erste Version begegnet schon im berüchtigten „Hexenhammer“ aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Später erzählte Froben Christoph von Zimmern (gestorben 1566) die Geschichte in seiner Zimmerischen Chronik.
Im 19. Jahrhundert wurde dem Stoff eine romantische Liebesgeschichte aufgepfropft. Kurz vor Ludwig Eglers Hechinger Führer (1863), aus dem der hier wiedergegebene Text stammt, hatte der Thiergartener Volksschullehrer Jakob Barth (1825-1895) in seiner „Hohenzollernsche Chronik oder Geschichte und Sage der hohenzollernschen Lande“ eine erzählerische Bearbeitung vorgelegt. Die Liebesromanze erzählt, wie ein Edelknappe Wilhelm von Hohenberg von einem unheimlichen Mann in einem roten Mantel dazu verleitet wird, auf ein Kruzifix in der Nähe von Stetten drei Schüsse abzugeben. Er weigert sich zunächst. Dann könne er aber zusehen, gibt ihm der Rotmantel zu verstehen, wie sein Nebenbuhler um die Liebe der lieblich blühenden Berta von Zollern im für den folgenden Tag angesetzten Wettkampf siegen werde, „wie der glückliche Bräutigam eure angebetete Bertha zum Altare führt, könnt dabei sehen, wie er vor Aller Augen den feurigen Kuß auf ihre Rosenlippen drückt, ungescheut seine Arme um ihren reizenden Leib schlingt und die Gewonnene triumphirend sein treueigenes Weib nennt“. Kurz: Wilhelm schießt, ohne sich von den eindringlichen Warnungen eines Zwerg abhalten zu lassen und wird vom Tode ergriffen, doch ein Beichtvater des nahe gelegenen Klosters Gnadental kann gerade noch seine ewige Seligkeit retten. Egler hat offenkundig diese Fassung auf den „Sagenton“ zurechtgestutzt. Erfunden hat Barth diese Liebesgeschichte nicht. Dieses Verdienst dürfte Wilhelm Binder zukommen, der eine Erzählung „Der höllische Schuß“ mit der gleichen Personenkonstellation in seinen „Alemannischen Volkssagen“ 1843 veröffentlicht hatte.
Wer der Sage vor Ort nachspüren möchte, sollte nicht nur die Friedhofskapelle zum Heiligen Kreuz aufsuchen, sondern auch das Hohenzollerische Landesmuseum in Hechingen, wo nicht nur der (inzwischen leere) Bildstock aus Holz zu sehen ist, in dem sich das beschossene Kruzifix befunden haben soll, sondern auch zwei Gemälde des 18. Jahrhunderts, auf denen die Überlieferung bildlich dargestellt ist.
Quelle: Ludwig Egler, Führer durch Hechingen und die Burg Hohenzollern, 1863, S. 29-31. Vgl. Graf, Schwabensagen, mit weiteren Nachweisen. Ergänzend: Wilhelm Binder, Alemannische Volkssagen, Geschichten und Märchen, Bd. 2, 1843, S. 1-24
 Heiligkreuzkapelle Hechingen, eigenes Foto http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Heiligkreuzkapelle_Hechingen
Heiligkreuzkapelle Hechingen, eigenes Foto http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Heiligkreuzkapelle_Hechingen Bildstock im Hechinger Landesmuseum
Bildstock im Hechinger Landesmuseum Gemälde ebenda http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:H%C3%B6llischer_Schuss
Gemälde ebenda http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:H%C3%B6llischer_SchussKlausGraf - am Sonntag, 21. März 2010, 18:31 - Rubrik: Landesgeschichte
Das Bildungsportal "Lernen aus der Geschichte" besteht aus vier Hauptbereichen:
Lernen & Lehren
"Lernen & Lehren" bietet einen kostenlosen Fundus von Unterrichtsmaterialien und Methodenvorschlägen für Lehrer/innen und Pädagog/innen. Zwei Suchfunktionen unterstützen Sie beim Stöbern: Der Didaktik-Filter sortiert nach Methoden und didaktischen Ansätzen; im Themen-Filter finden Sie Materialien und Anregungen zu bestimmten Themen, Ereignissen und Personen. Durch Anklicken eines Schlagwortes werden Ihre Suchergebnisse in den Kategorien „Praxis & Material“ und „Anregung & Reflexion“ angezeigt. Darüberhinaus können Sie selbst eigene Projekte vorstellen und Rezensionen schreiben.
Über Aktuelles aus der historisch-politischen Bildungsarbeit informiert Sie in diesem Bereich auch unser "Magazin", das Sie als Newsletter abonnieren können. Das monatlich erscheinende "Magazin" enthält zu einem jeweiligen Schwerpunkt Diskussionsbeiträge, Berichte aus der Praxis und Rezensionen von Materialien für die Bildungsarbeit.
Teilnehmen & Vernetzen
In diesem Bereich können Sie Fragen und Ideen aus Ihrer Bildungsarbeit einbringen und an Expertenchats teilnehmen. Sie können sich bundesweit und international vernetzen und andere Mitglieder kontaktieren, Veranstaltungen ankündigen, Tipps und Tricks weitergeben und Wettbewerbe und Förderprogramme vorstellen oder suchen. Registrieren Sie sich kostenlos, um sich aktiv am Portal zu beteiligen. Ihr Profil und ihre Kontaktdaten werden nur dann für andere registrierte Mitglieder sichtbar, wenn Sie diese freigeben.
Online Lernen
"Online Lernen" präsentiert Web-Seminare von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis zu relevanten Themen der historisch-politischen Bildung. Als registrierter Nutzer können Sie Web-Seminare zeitgleich besuchen und eigene Fragen stellen. Alle Web-Seminare werden aufgezeichnet und archiviert, sodass Sie auch später die Möglichkeit haben, ein Web-Seminar anzusehen. Auf unserer Moodleplattform bieten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Portals eigene Kurse an. Zusätzlich zeigen wir Ihnen durch Beispielkurse, wie Sie Moodle in Ihrem Unterricht anwenden können.
International Diskutieren
Dies ist ein hauptsächlich englischsprachiger Bereich, der durch internationale Fachbeiträge, Projektvorstellungen und Expert/innenchats vielseitige Perspektiven eröffnet. Hier sind Sie eingeladen, einen Blick über den eigenen Tellerrand zu werfen und Ansätze der historisch-politischen Bildungsarbeit auf internationaler Ebene zu diskutieren und auszutauschen.
Link zur Homepage
Lernen & Lehren
"Lernen & Lehren" bietet einen kostenlosen Fundus von Unterrichtsmaterialien und Methodenvorschlägen für Lehrer/innen und Pädagog/innen. Zwei Suchfunktionen unterstützen Sie beim Stöbern: Der Didaktik-Filter sortiert nach Methoden und didaktischen Ansätzen; im Themen-Filter finden Sie Materialien und Anregungen zu bestimmten Themen, Ereignissen und Personen. Durch Anklicken eines Schlagwortes werden Ihre Suchergebnisse in den Kategorien „Praxis & Material“ und „Anregung & Reflexion“ angezeigt. Darüberhinaus können Sie selbst eigene Projekte vorstellen und Rezensionen schreiben.
Über Aktuelles aus der historisch-politischen Bildungsarbeit informiert Sie in diesem Bereich auch unser "Magazin", das Sie als Newsletter abonnieren können. Das monatlich erscheinende "Magazin" enthält zu einem jeweiligen Schwerpunkt Diskussionsbeiträge, Berichte aus der Praxis und Rezensionen von Materialien für die Bildungsarbeit.
Teilnehmen & Vernetzen
In diesem Bereich können Sie Fragen und Ideen aus Ihrer Bildungsarbeit einbringen und an Expertenchats teilnehmen. Sie können sich bundesweit und international vernetzen und andere Mitglieder kontaktieren, Veranstaltungen ankündigen, Tipps und Tricks weitergeben und Wettbewerbe und Förderprogramme vorstellen oder suchen. Registrieren Sie sich kostenlos, um sich aktiv am Portal zu beteiligen. Ihr Profil und ihre Kontaktdaten werden nur dann für andere registrierte Mitglieder sichtbar, wenn Sie diese freigeben.
Online Lernen
"Online Lernen" präsentiert Web-Seminare von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis zu relevanten Themen der historisch-politischen Bildung. Als registrierter Nutzer können Sie Web-Seminare zeitgleich besuchen und eigene Fragen stellen. Alle Web-Seminare werden aufgezeichnet und archiviert, sodass Sie auch später die Möglichkeit haben, ein Web-Seminar anzusehen. Auf unserer Moodleplattform bieten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Portals eigene Kurse an. Zusätzlich zeigen wir Ihnen durch Beispielkurse, wie Sie Moodle in Ihrem Unterricht anwenden können.
International Diskutieren
Dies ist ein hauptsächlich englischsprachiger Bereich, der durch internationale Fachbeiträge, Projektvorstellungen und Expert/innenchats vielseitige Perspektiven eröffnet. Hier sind Sie eingeladen, einen Blick über den eigenen Tellerrand zu werfen und Ansätze der historisch-politischen Bildungsarbeit auf internationaler Ebene zu diskutieren und auszutauschen.
Link zur Homepage
Wolf Thomas - am Sonntag, 21. März 2010, 16:51 - Rubrik: Archivpaedagogik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Interview mit Mag. Ernst Kieninger (GF Filmarchiv) zur momentan Lage am Augartenspitz sowie zur Zukunft des Augartens
Wolf Thomas - am Sonntag, 21. März 2010, 16:44 - Rubrik: Filmarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Sonntag, 21. März 2010, 16:35 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Lisa Kudrow visits the final resting place of her grandmother, where many other Jews were executed by the Nazis during World War II.
Link: http://www.nbc.com/who-do-you-think-you-are/
Wolf Thomas - am Sonntag, 21. März 2010, 16:31 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bände aus der BSB 1, 1843 - 14, 1862 mit Lücken
http://books.google.de/books?q=editions:BSBBSB10477929&id=JPw-AAAAcAAJ
11, 1857 - 18, 1868 aus Princeton
http://books.google.de/books?id=zP4qAAAAYAAJ
Neue Reihe 1, 1869 - 3, 1871 aus Princeton
http://books.google.com/books?id=Bv8qAAAAYAAJ (mit US-Proxy)
http://books.google.de/books?id=Bv8qAAAAYAAJ&pg=RA1-PA31 ist Seuffers Ausgabe der Anonymen Chronik von Ulm, siehe http://archiv.twoday.net/stories/914849/
Vom Rest der Verhandlungen bzw. dem Korrespondenzblatt und den Mitt(h)eilungen gibt es noch keine Spur.
http://books.google.de/books?q=editions:BSBBSB10477929&id=JPw-AAAAcAAJ
11, 1857 - 18, 1868 aus Princeton
http://books.google.de/books?id=zP4qAAAAYAAJ
Neue Reihe 1, 1869 - 3, 1871 aus Princeton
http://books.google.com/books?id=Bv8qAAAAYAAJ (mit US-Proxy)
http://books.google.de/books?id=Bv8qAAAAYAAJ&pg=RA1-PA31 ist Seuffers Ausgabe der Anonymen Chronik von Ulm, siehe http://archiv.twoday.net/stories/914849/
Vom Rest der Verhandlungen bzw. dem Korrespondenzblatt und den Mitt(h)eilungen gibt es noch keine Spur.
KlausGraf - am Sonntag, 21. März 2010, 13:55 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ich habe mir erlaubt, die von Herrn RA vom Hofe soeben angegebene Internetadresse aus dem von Google betriebenen Angebot Google Buchsuche zu kürzen. Dadurch wird auch die Startseite von Archivalia wieder lesbarer, denn längere Links können ungekürzt zu Darstellungsproblemen führen.
Zum folgenden siehe
http://de.wikisource.org/wiki/Gbs#Verlinken_von_einzelnen_Seiten
Für das Wiederauffinden von Stellen in http://books.google.com genügen genau zwei Parameter in der URL:
* die gleichbleibende ID
und
* die Angabe der Seite.
Beide bleiben, soweit man das absehen kann, konstant, wenngleich es sein kann, dass bei Vorschau-Büchern die derzeit betrachtbaren Seiten durch andere ersetzt werden, der Link also nicht mehr funktioniert.
Google bietet zu jeder Seite einen Link an, der aber unnötig aufgebläht ist:
Link
Welche Seite als erstes besucht wurde (lpg=PA197) geht ja niemand was an und welche Suchworte verwendet wurden auch nicht. Man braucht nur die id=vsk9eEZTStEC und pg=PA209:
http://books.google.de/books?id=vsk9eEZTStEC&pg=PA209
Was ots=cx_HJMRbYA bedeutet, ist mir nicht bekannt. Man sollte generell bei der "Datenkrake" Google nur die kürzestmöglichen Informationen weitergeben.
Zum folgenden siehe
http://de.wikisource.org/wiki/Gbs#Verlinken_von_einzelnen_Seiten
Für das Wiederauffinden von Stellen in http://books.google.com genügen genau zwei Parameter in der URL:
* die gleichbleibende ID
und
* die Angabe der Seite.
Beide bleiben, soweit man das absehen kann, konstant, wenngleich es sein kann, dass bei Vorschau-Büchern die derzeit betrachtbaren Seiten durch andere ersetzt werden, der Link also nicht mehr funktioniert.
Google bietet zu jeder Seite einen Link an, der aber unnötig aufgebläht ist:
Link
Welche Seite als erstes besucht wurde (lpg=PA197) geht ja niemand was an und welche Suchworte verwendet wurden auch nicht. Man braucht nur die id=vsk9eEZTStEC und pg=PA209:
http://books.google.de/books?id=vsk9eEZTStEC&pg=PA209
Was ots=cx_HJMRbYA bedeutet, ist mir nicht bekannt. Man sollte generell bei der "Datenkrake" Google nur die kürzestmöglichen Informationen weitergeben.
KlausGraf - am Sonntag, 21. März 2010, 12:03 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
KlausGraf - am Sonntag, 21. März 2010, 11:54 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
in meinem Buch Vier Prinzen beschrieb ich auf
S. 222 ff. in:
http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000100
das Auslieferungsverfahren gegen Hinrich Wilhelm Kopf.
Er sollte wegen Kriegsverbrechen an Polen im Jahr 1948 ausgeliefert werden. Er war der erste Ministerpräsident Niedersachsens (SPD). Details hatte ich vor 5 Jahren recherchiert. Eine heutige Anfrage nach diesem Vorgang veranlasste mich dazu, heute erneut die britischen Akten durchzugehen. Interessant war dabei folgende Passage die mir damals entgangen war:
FO 1049/1132 206253 BLATT 711/49/48
16.3.48
Control Commission for Germany
Incoming Top Secret Telegram
Subject Herr Kopf
"All necessary action is in hand. Kopf´s rebuttal and witness statements etc. are being prepared by counsel and Chief Judge is giving all assistance." Willy Brandt übergab die Zeugenaussage Koch, wonach Kopf Opfer einer kommunistischen Hetzkampagne gewesen sein soll.
FO 1032/1885 204193
8. April 1948
Subject: War Crimes Charge against Herr Kopf.
"The Chief Judge wished me to inform you that, although as stated there was no case for extradition on the charges and evidence produced, in the opinion of the Chief Judge there is more than a suspicion that there is some substance in the allegations. For example it is established that Kopf was head of the German organisation "Treuhandstelle" in East Poland, which it is understood was the Nazi looting organisation. The Chief Judge suggests that no comment on this prouncments should be made". Wenn Justiz und Politik zusammentreffen zieht die Justiz damals wie heute immer den Kürzeren.
Dieser Aktenauszug ist aussagekräftiger als
http://books.google.de/books?id=vsk9eEZTStEC&pg=PA197
weil der Autor des Buches die britischen Akten nicht eingesehen hat.
zu Willy Brandt noch dieser Hinweis: FAZ vom 27 März 2010 Seite 33. Artikel: "Die Welt als Willy und Vorstellung", von Martin Otto: "Mit der ironischen Einführung "Ich bin kein Brandt-Experte, nur verwandt" (Einführung in die zehnbändige Berliner Ausgabe von Reden, Artikeln und Briefen Brandts) betonte dagegen der Historiker Peter Brandt (Hagen), Willy Brandts 1948 geborener Sohn, dass sch alle Parteien der frühen Bundesrepublik um die "kleinen Nazis" bemüht hätten. War Kopf ein "kleiner Nazi" ?
http://archiv.twoday.net/stories/3810499/#6250225
update 25.10.2010
FAZ online
Steinmeier kritisiert Willy Brandt
„Ein eher betrübliches Kapitel“
Frank-Walter Steinmeier hat Willy Brandt für seine Amtsführung als Leiter des Auswärtigen Amtes kritisiert. Steinmeier reagiert auf den Historikerbericht, der zeigt, wie Brandt sich in seiner Zeit als Außenminister für die ehrenvolle Verabschiedung nationalsozialistisch kompromittierter Diplomaten einsetzte".
Wen wundert es ?
http://vierprinzen.blogspot.com/
S. 222 ff. in:
http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000100
das Auslieferungsverfahren gegen Hinrich Wilhelm Kopf.
Er sollte wegen Kriegsverbrechen an Polen im Jahr 1948 ausgeliefert werden. Er war der erste Ministerpräsident Niedersachsens (SPD). Details hatte ich vor 5 Jahren recherchiert. Eine heutige Anfrage nach diesem Vorgang veranlasste mich dazu, heute erneut die britischen Akten durchzugehen. Interessant war dabei folgende Passage die mir damals entgangen war:
FO 1049/1132 206253 BLATT 711/49/48
16.3.48
Control Commission for Germany
Incoming Top Secret Telegram
Subject Herr Kopf
"All necessary action is in hand. Kopf´s rebuttal and witness statements etc. are being prepared by counsel and Chief Judge is giving all assistance." Willy Brandt übergab die Zeugenaussage Koch, wonach Kopf Opfer einer kommunistischen Hetzkampagne gewesen sein soll.
FO 1032/1885 204193
8. April 1948
Subject: War Crimes Charge against Herr Kopf.
"The Chief Judge wished me to inform you that, although as stated there was no case for extradition on the charges and evidence produced, in the opinion of the Chief Judge there is more than a suspicion that there is some substance in the allegations. For example it is established that Kopf was head of the German organisation "Treuhandstelle" in East Poland, which it is understood was the Nazi looting organisation. The Chief Judge suggests that no comment on this prouncments should be made". Wenn Justiz und Politik zusammentreffen zieht die Justiz damals wie heute immer den Kürzeren.
Dieser Aktenauszug ist aussagekräftiger als
http://books.google.de/books?id=vsk9eEZTStEC&pg=PA197
weil der Autor des Buches die britischen Akten nicht eingesehen hat.
zu Willy Brandt noch dieser Hinweis: FAZ vom 27 März 2010 Seite 33. Artikel: "Die Welt als Willy und Vorstellung", von Martin Otto: "Mit der ironischen Einführung "Ich bin kein Brandt-Experte, nur verwandt" (Einführung in die zehnbändige Berliner Ausgabe von Reden, Artikeln und Briefen Brandts) betonte dagegen der Historiker Peter Brandt (Hagen), Willy Brandts 1948 geborener Sohn, dass sch alle Parteien der frühen Bundesrepublik um die "kleinen Nazis" bemüht hätten. War Kopf ein "kleiner Nazi" ?
http://archiv.twoday.net/stories/3810499/#6250225
update 25.10.2010
FAZ online
Steinmeier kritisiert Willy Brandt
„Ein eher betrübliches Kapitel“
Frank-Walter Steinmeier hat Willy Brandt für seine Amtsführung als Leiter des Auswärtigen Amtes kritisiert. Steinmeier reagiert auf den Historikerbericht, der zeigt, wie Brandt sich in seiner Zeit als Außenminister für die ehrenvolle Verabschiedung nationalsozialistisch kompromittierter Diplomaten einsetzte".
Wen wundert es ?
http://vierprinzen.blogspot.com/
vom hofe - am Sonntag, 21. März 2010, 11:16 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Landrat Dr. Olaf Gericke, Kreisarchivar Dr. Mark-Alexander Steinert und Dezernent Dr. Stefan Funke (v.l.) nahmen die neue Rollregalanlage in Augenschein
"Nach mehrmonatigen Umbauarbeiten ist das Kreisarchiv Warendorf jetzt technisch auf dem neuesten Stand. Im Magazin, das im Kreishaus traditionell als "Endarchiv" bekannt ist, wurde eine neue Rollregalanlage eingebaut. Sie bietet Lagerplatz für mehr als 3.000 laufende Meter Archivgut.
Im Zuge der Umbaumaßnahmen nahmen die Mitarbeiter des Archivs eine komplette Neuordnung der Archivbestände vor. Dazu wurden rund 2.000 laufende Meter Archivgut umgelagert, 7.000 Archivkartons neu geordnet und rund 3.000 neu angeschaffte Archivkartons mit Archivalien gefüllt.
Dr. Mark Steinert, Leiter des Kreisarchivs erklärt: "Der Einbau der Rollregalanlage und die Neuordnung der Archivbestände war nach zahlreichen Archivalienübernahmen im Laufe der letzten Jahre und angesichts neuer Aufgaben unbedingt erforderlich. Unser Magazin platzte aus allen Nähten".
Beim Neubau des Kreishauses vor rund 30 Jahren ging man davon aus, dass das Magazin bei üblichem Zuwachs an Archivgut bis in die ersten Jahre des neuen Jahrtausends ausreichen würde. Diese Planung ging auch auf. Ende 2007 stand dann aber endgültig fast, dass die Kapazitäten in absehbarer Zeit erschöpft sein würden, zumal sich die Übernahme umfangreicher neuer Bestände abzeichnete: Das Archiv der Stadt Sendenhorst sollte in die Obhut des Kreisarchivs überführt werden, und zum 1. Januar 2009 wurden die - bisher in den Standesämtern verbliebenen - historischen Personenstandsregister zu Archivgut. Das bedeutete, dass nicht nur umfangreiche zusätzliche Aufgaben auf die Mitarbeiter des Kreisarchivs zukamen, sondern auch Platz geschaffen werden musste.
Nach dem Umbau ist das Kreisarchiv für diese neuen Aufgaben gewappnet: Die Kapazität des Endarchivs konnte annähernd verdoppelt werden. Das Stadtarchiv Sendenhorst konnte bereits zum größten Teil in das Kreishaus überführt werden, und die Übergabe der Personenstandsregister wird in den nächsten Wochen sukzessive erfolgen.
Dr. Steinert erklärt: "Die Neuordnung des Archivs war für uns alle eine Herausforderung, und alle haben fleißig mit angepackt. Aber nun sind wir froh, dass die Bau- und Räumarbeiten weitgehend abgeschlossen sind und dass wir das Archiv am vergangenen Montag wieder für Benutzer öffnen konnten. Die neuen Bestände, also das Stadtarchiv Sendenhorst und die Personenstandsregister müssen zwar noch für die Benutzung erschlossen werden, aber sonst stehen seit der Wiedereröffnung des Kreisarchivs alle seine Bestände Benutzern wieder zur Verfügung."
Quelle: Pressemitteilung Kreis Warendorf
s. a. zum Kreisarchiv Warendorf:
http://archiv.twoday.net/search?q=Warendorf+Kreisarchiv
Wolf Thomas - am Sonntag, 21. März 2010, 08:20 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://archiv.twoday.net/stories/5918219
There are now 123 articles by Professor Knoll.
None of the 23 newest articles (at the time of my test there were 100 Knoll articles in DASH) is Open Access in DASH - all are only providing links to the published version: "At the direction of the depositing author this work is not currently accessible through DASH."
There is now an field "Other sources" with links to eventually free online versions. But these links are not complete, see e.g.
http://dash.harvard.edu/handle/1/3190372
With Google Scholar one can find a free version for this article.
It seems that all links I gave for free versions are now added as "other sources" (I didn't check all), including
http://dash.harvard.edu/handle/1/3119240
Let's conclude:
(i) Regarding Open Access to the works of the famous Professor Knoll all other webpages are more important than DASH.
(ii) It is useful that DASH gives hints to free versions elsewhere in the web but most OA advocates would have thought that the core mission of Harvard's repository is another.
(iii) It seems clear that Professor Knoll doesn't like the Harvard FAS OA Policy which is described at
http://osc.hul.harvard.edu/OpenAccess/policytexts.php
"Harvard Faculty of Arts and Sciences Open-Access Policy
voted February 12, 2008
The Faculty of Arts and Sciences of Harvard University is committed to disseminating the fruits of its research and scholarship as widely as possible. In keeping with that commitment, the Faculty adopts the following policy: Each Faculty member grants to the President and Fellows of Harvard College permission to make available his or her scholarly articles and to exercise the copyright in those articles. In legal terms, the permission granted by each Faculty member is a nonexclusive, irrevocable, paid-up, worldwide license to exercise any and all rights under copyright relating to each of his or her scholarly articles, in any medium, and to authorize others to do the same, provided that the articles are not sold for a profit. The policy will apply to all scholarly articles written while the person is a member of the Faculty except for any articles completed before the adoption of this policy and any articles for which the Faculty member entered into an incompatible licensing or assignment agreement before the adoption of this policy. The Dean or the Dean's designate will waive application of the policy for a particular article upon written request by a Faculty member explaining the need."
Did I miss something? It seems that Professor Knoll has received a permanent waiver for all his publications completed after the adoption of the policy.
Now we see that Harvard's OA policy is pure bragging.
There are now 123 articles by Professor Knoll.
None of the 23 newest articles (at the time of my test there were 100 Knoll articles in DASH) is Open Access in DASH - all are only providing links to the published version: "At the direction of the depositing author this work is not currently accessible through DASH."
There is now an field "Other sources" with links to eventually free online versions. But these links are not complete, see e.g.
http://dash.harvard.edu/handle/1/3190372
With Google Scholar one can find a free version for this article.
It seems that all links I gave for free versions are now added as "other sources" (I didn't check all), including
http://dash.harvard.edu/handle/1/3119240
Let's conclude:
(i) Regarding Open Access to the works of the famous Professor Knoll all other webpages are more important than DASH.
(ii) It is useful that DASH gives hints to free versions elsewhere in the web but most OA advocates would have thought that the core mission of Harvard's repository is another.
(iii) It seems clear that Professor Knoll doesn't like the Harvard FAS OA Policy which is described at
http://osc.hul.harvard.edu/OpenAccess/policytexts.php
"Harvard Faculty of Arts and Sciences Open-Access Policy
voted February 12, 2008
The Faculty of Arts and Sciences of Harvard University is committed to disseminating the fruits of its research and scholarship as widely as possible. In keeping with that commitment, the Faculty adopts the following policy: Each Faculty member grants to the President and Fellows of Harvard College permission to make available his or her scholarly articles and to exercise the copyright in those articles. In legal terms, the permission granted by each Faculty member is a nonexclusive, irrevocable, paid-up, worldwide license to exercise any and all rights under copyright relating to each of his or her scholarly articles, in any medium, and to authorize others to do the same, provided that the articles are not sold for a profit. The policy will apply to all scholarly articles written while the person is a member of the Faculty except for any articles completed before the adoption of this policy and any articles for which the Faculty member entered into an incompatible licensing or assignment agreement before the adoption of this policy. The Dean or the Dean's designate will waive application of the policy for a particular article upon written request by a Faculty member explaining the need."
Did I miss something? It seems that Professor Knoll has received a permanent waiver for all his publications completed after the adoption of the policy.
Now we see that Harvard's OA policy is pure bragging.
KlausGraf - am Sonntag, 21. März 2010, 02:24 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Veraltet! Drei Jahre alt und erst jetzt in E-LIS:
http://eprints.rclis.org/17571/
Interessant immerhin der Hinweis auf die Lücken von SHERPA/ROMEO:
"Für 56 % der 2004 an der Medizinischen Universität Wien veröffentlichten
Publikationen gestatten die Verlage eine Selbstarchivierung, für 10 % ist sie nicht
gestattet, für 34 % ist sie unklar."
http://eprints.rclis.org/17571/
Interessant immerhin der Hinweis auf die Lücken von SHERPA/ROMEO:
"Für 56 % der 2004 an der Medizinischen Universität Wien veröffentlichten
Publikationen gestatten die Verlage eine Selbstarchivierung, für 10 % ist sie nicht
gestattet, für 34 % ist sie unklar."
KlausGraf - am Sonntag, 21. März 2010, 01:54 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://iuwis.de/blog/%E2%80%9Enichtkommerziell%E2%80%9C-als-cc-lizenzbestimmung
Die dort referierte Position von Maracke ist alles andere als hilfreich. Wenn es keine klaren Vorgaben von CC gibt, was kommerziell ist (und auch keinen Konsens bei Verwendern und Nutzern), dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein Gericht sich dazu äußern muss.
Man kann natürlich Glück haben und der Rechteinhaber sieht das ebenso wie der Nutzer, aber letzlich ist die Position des Urhebers aus Sicht des deutschen Rechts stark. Zweifel gehen zu Lasten des Nutzers.
Ein Gebrauch im akademischen Kontext ist zumindest in den USA alles andere als unproblematisch, da die Universitäten mit ihren Angeboten Geld verdienen wollen: http://archiv.twoday.net/stories/6158250/ Zu Deutschland siehe etwa: http://archiv.twoday.net/stories/5742955/
Ein Gebrauch von CC-NC-Bildern in Fachzeitschriften, die in kommerziellen Verlagen erschienen, erscheint mir nicht möglich. Selbst bei Zeitschriften wissenschaftlicher Gesellschaften erscheint mir eine Berufung auf NC nicht möglich.
Die dort referierte Position von Maracke ist alles andere als hilfreich. Wenn es keine klaren Vorgaben von CC gibt, was kommerziell ist (und auch keinen Konsens bei Verwendern und Nutzern), dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein Gericht sich dazu äußern muss.
Man kann natürlich Glück haben und der Rechteinhaber sieht das ebenso wie der Nutzer, aber letzlich ist die Position des Urhebers aus Sicht des deutschen Rechts stark. Zweifel gehen zu Lasten des Nutzers.
Ein Gebrauch im akademischen Kontext ist zumindest in den USA alles andere als unproblematisch, da die Universitäten mit ihren Angeboten Geld verdienen wollen: http://archiv.twoday.net/stories/6158250/ Zu Deutschland siehe etwa: http://archiv.twoday.net/stories/5742955/
Ein Gebrauch von CC-NC-Bildern in Fachzeitschriften, die in kommerziellen Verlagen erschienen, erscheint mir nicht möglich. Selbst bei Zeitschriften wissenschaftlicher Gesellschaften erscheint mir eine Berufung auf NC nicht möglich.
KlausGraf - am Sonntag, 21. März 2010, 01:38 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.wien.gv.at/verwaltung/personal/jobangebote/leitung-ma8.html#bew
Absurde Konsonantenhäufungen im Nachnamen dürften keinen Hinderungsgrund darstellen, sich zu bewerben.
Absurde Konsonantenhäufungen im Nachnamen dürften keinen Hinderungsgrund darstellen, sich zu bewerben.
KlausGraf - am Sonntag, 21. März 2010, 01:33 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.nytimes.com/2010/03/16/arts/television/16cspan.html
http://www.c-spanvideo.org/videoLibrary/
What is C-Span? http://en.wikipedia.org/wiki/C-SPAN
http://www.c-spanvideo.org/videoLibrary/
What is C-Span? http://en.wikipedia.org/wiki/C-SPAN
KlausGraf - am Samstag, 20. März 2010, 23:48 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://archiv.twoday.net/search?q=hinrich+kopf
Bei der verschwundenen NDR-Seite handelte es sich offenkundig um eine unspektakuläre Nachricht, wonach die NS-Vergangenheit von niedersächsischen Landtagsabgeordneten durchleuchtet werden soll. Diese ist auch anderweitig online:
http://www.google.de/search?num=100&hl=de&q=Niedersachsens+Landtagspr%C3%A4sident+Dinkla+setzt+sich+daf%C3%BCr+ein,+die+NS-Vergangenheit+&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
http://www.linksfraktion-niedersachsen.de/fileadmin/linksfraktion-niedersachsen/Kritikpunkt/Newsletter_Landtagsfraktion_Kritikpunkt_4_09.pdf
Kopf fehlt in der Broschüre
http://linksfraktion-niedersachsen.linkes-cms.de/fileadmin/linksfraktion-niedersachsen/Texte/Broschueren_PDF/Broschuere_Nazis_internet.pdf

Bei der verschwundenen NDR-Seite handelte es sich offenkundig um eine unspektakuläre Nachricht, wonach die NS-Vergangenheit von niedersächsischen Landtagsabgeordneten durchleuchtet werden soll. Diese ist auch anderweitig online:
http://www.google.de/search?num=100&hl=de&q=Niedersachsens+Landtagspr%C3%A4sident+Dinkla+setzt+sich+daf%C3%BCr+ein,+die+NS-Vergangenheit+&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
http://www.linksfraktion-niedersachsen.de/fileadmin/linksfraktion-niedersachsen/Kritikpunkt/Newsletter_Landtagsfraktion_Kritikpunkt_4_09.pdf
Kopf fehlt in der Broschüre
http://linksfraktion-niedersachsen.linkes-cms.de/fileadmin/linksfraktion-niedersachsen/Texte/Broschueren_PDF/Broschuere_Nazis_internet.pdf

KlausGraf - am Samstag, 20. März 2010, 23:27 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
http://findbuch.luebeck.de
Nichts Berauschendes, keine Möglichkeit die Digitalisate zu filtern.
Keine permanenten Links, keine Möglichkeit, die einzelnen Einträge zu verlinken.
Das Ganze im benutzerunfreundlichen AUGIAS-Design.
Die Auflösung der Barbarossa-Urkunde ist ein Witz:
http://tinyurl.com/yldoo7h
Siehe auch:
http://www.ln-online.de/regional/2749904
Nichts Berauschendes, keine Möglichkeit die Digitalisate zu filtern.
Keine permanenten Links, keine Möglichkeit, die einzelnen Einträge zu verlinken.
Das Ganze im benutzerunfreundlichen AUGIAS-Design.
Die Auflösung der Barbarossa-Urkunde ist ein Witz:
http://tinyurl.com/yldoo7h
Siehe auch:
http://www.ln-online.de/regional/2749904
KlausGraf - am Samstag, 20. März 2010, 17:46 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"... scan a 200-page book in under a minute. You just hold the book under the camera and flip through the pages as if shuffling a deck of cards"
via wired.com
Cherubinos - am Samstag, 20. März 2010, 17:00 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Geocoding/de
Referenziert wird die Kameraposition, nicht etwa die Lage des Objekts.
Referenziert wird die Kameraposition, nicht etwa die Lage des Objekts.
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0568_b472_jpg.htm (2004, neu online)
Frau Bushey unterschlägt, dass ich es war, der als erster auf die Ankäufe bei der Ebner-Versteigerung hingewiesen hatte.
http://www.digizeitschriften.de/main/dms/img/?PPN=PPN345204123_0118&DMDID=dmdlog20 (ZfdA 1989, S. 214f. - gratis Open Access)
Ich hatte auch Herrn Pensel darauf aufmerksam gemacht, der dann die Notizen im Weimarer Exemplar des Katalogs fand, das bei dem Weimarer Bibliotheksbrand 2004 verloren ging.
Frau Bushey unterschlägt, dass ich es war, der als erster auf die Ankäufe bei der Ebner-Versteigerung hingewiesen hatte.
http://www.digizeitschriften.de/main/dms/img/?PPN=PPN345204123_0118&DMDID=dmdlog20 (ZfdA 1989, S. 214f. - gratis Open Access)
Ich hatte auch Herrn Pensel darauf aufmerksam gemacht, der dann die Notizen im Weimarer Exemplar des Katalogs fand, das bei dem Weimarer Bibliotheksbrand 2004 verloren ging.
KlausGraf - am Samstag, 20. März 2010, 16:02 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/projekt_gotha.htm
Nach wie vor ist es denkbar benutzerunfreundlich, dass auf dieser Seite nur die Signaturen, nicht aber die Schlagzeile der Beschreibung angegeben werden. Wer nicht nach einer bestimmten Handschrift sucht, muss ermüdend oft ein PDF nach dem anderen öffnen. Und weil man mich gelegentlich darauf hinweist, ich könnte doch solche Monita direkt anbringen, bevor oder anstatt dass ich sie öffentlich mache - das habe ich mehrfach getan - ohne jegliche Resonanz.
Nach wie vor ist es denkbar benutzerunfreundlich, dass auf dieser Seite nur die Signaturen, nicht aber die Schlagzeile der Beschreibung angegeben werden. Wer nicht nach einer bestimmten Handschrift sucht, muss ermüdend oft ein PDF nach dem anderen öffnen. Und weil man mich gelegentlich darauf hinweist, ich könnte doch solche Monita direkt anbringen, bevor oder anstatt dass ich sie öffentlich mache - das habe ich mehrfach getan - ohne jegliche Resonanz.
KlausGraf - am Samstag, 20. März 2010, 15:21 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.telemedicus.info/article/1678-Beck-Verlag-will-Google-wegen-Snippets-verklagen.html
Hoffentlich holt sich da der Beck-Verlag eine blutige Nase. In Hamburg musste ja schon vor Jahren die WBG einen Antrag auf einstweilige Verfügung wegen Google Book Search zurückziehen.

Hoffentlich holt sich da der Beck-Verlag eine blutige Nase. In Hamburg musste ja schon vor Jahren die WBG einen Antrag auf einstweilige Verfügung wegen Google Book Search zurückziehen.
KlausGraf - am Samstag, 20. März 2010, 13:46 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 20. März 2010, 13:40 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 20. März 2010, 13:26 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aufsätze:
Jutta Hanitsch: Der Mittelstand im Zentrum der Überlieferung – die Bestände des Wirtschaftsarchivs Baden-Württemberg
Clemens Heitmann unter Mitarbeit von Matthias Fiedler und Sebastian Müller: Entstehung, Entwicklung und Bedeutung der Lausitzer und mitteldeutschen Braunkohlenindustrie im Spiegel ihrer Überlieferung im Bergarchiv Freiberg
Gerold Bönnen: Quellen zur Geschichte der Lederindustrie im Stadtarchiv Worms
Berichte:
Wolfgang Wimmer: Chemiearchivare zeigen, was sie haben. Jahrestreffen des Arbeitskreises der Chemiearchivare am 21. November 2009 in Darmstadt
Rezensionen:
Werner Abelshauser: Nach dem Wirtschaftswunder. Der Gewerkschafter, Politiker und Unternehmer Hans Matthöfer (Martin Münzel)
Ralf Banken: Edelmetallmangel und Großraubwirtschaft. Die Entwicklung des deutschen Edelmetallsektors im „Dritten Reich“ 1933-1945 (Benjamin Obermüller)
Ian Blanchard: The International Economy in the „Age of the Discoveries” 1470–1570. Antwerp and the English Merchants’ World (Wilfried Reininghaus)
Alexander Engel: Farben der Globalisierung. Die Entstehung moderner Märkte für Farbstoffe 1500-1900 (Wilfried Reininghaus)
Silke Fengler: Entwickelt und fixiert. Zur Unternehmens- und Technikgeschichte der deutschen Fotoindustrie, dargestellt am Beispiel der Agfa AG Leverkusen und des VEB Filmfabrik Wolfen (1945-1995) (Renate Schwärzel)
Andrea Franc: Wie die Schweiz zur Schokolade kam. Der Kakaohandel der Basler Handelsgesellschaft mit der Kolonie Goldküste (1893–1960) (Wolfgang Thomsen)
Daniel Hütter: Nachfolge im Familienunternehmen. Eszet Staengel & Ziller und Freudenberg & Co. KG im 19. und 20. Jahrhundert (Benjamin Obermüller)
Nachrichten
Rezensionsliste
Impressum
Kontakt: Redaktionsleiter:
Dr. Helen Müller und Dr. Martin Münzel
c/o Bertelsmann AG
Corporate History
Carl-Bertelsmann-Straße 270
33311 Gütersloh
Telefon: 05241-80-89992 / 030-25561150
Telefax: 05241-80-6-89992
E-Mail: Helen.Mueller@Bertelsmann.de
Martin_Muenzel@Yahoo.com
via Marburger Mailingliste
Jutta Hanitsch: Der Mittelstand im Zentrum der Überlieferung – die Bestände des Wirtschaftsarchivs Baden-Württemberg
Clemens Heitmann unter Mitarbeit von Matthias Fiedler und Sebastian Müller: Entstehung, Entwicklung und Bedeutung der Lausitzer und mitteldeutschen Braunkohlenindustrie im Spiegel ihrer Überlieferung im Bergarchiv Freiberg
Gerold Bönnen: Quellen zur Geschichte der Lederindustrie im Stadtarchiv Worms
Berichte:
Wolfgang Wimmer: Chemiearchivare zeigen, was sie haben. Jahrestreffen des Arbeitskreises der Chemiearchivare am 21. November 2009 in Darmstadt
Rezensionen:
Werner Abelshauser: Nach dem Wirtschaftswunder. Der Gewerkschafter, Politiker und Unternehmer Hans Matthöfer (Martin Münzel)
Ralf Banken: Edelmetallmangel und Großraubwirtschaft. Die Entwicklung des deutschen Edelmetallsektors im „Dritten Reich“ 1933-1945 (Benjamin Obermüller)
Ian Blanchard: The International Economy in the „Age of the Discoveries” 1470–1570. Antwerp and the English Merchants’ World (Wilfried Reininghaus)
Alexander Engel: Farben der Globalisierung. Die Entstehung moderner Märkte für Farbstoffe 1500-1900 (Wilfried Reininghaus)
Silke Fengler: Entwickelt und fixiert. Zur Unternehmens- und Technikgeschichte der deutschen Fotoindustrie, dargestellt am Beispiel der Agfa AG Leverkusen und des VEB Filmfabrik Wolfen (1945-1995) (Renate Schwärzel)
Andrea Franc: Wie die Schweiz zur Schokolade kam. Der Kakaohandel der Basler Handelsgesellschaft mit der Kolonie Goldküste (1893–1960) (Wolfgang Thomsen)
Daniel Hütter: Nachfolge im Familienunternehmen. Eszet Staengel & Ziller und Freudenberg & Co. KG im 19. und 20. Jahrhundert (Benjamin Obermüller)
Nachrichten
Rezensionsliste
Impressum
Kontakt: Redaktionsleiter:
Dr. Helen Müller und Dr. Martin Münzel
c/o Bertelsmann AG
Corporate History
Carl-Bertelsmann-Straße 270
33311 Gütersloh
Telefon: 05241-80-89992 / 030-25561150
Telefax: 05241-80-6-89992
E-Mail: Helen.Mueller@Bertelsmann.de
Martin_Muenzel@Yahoo.com
via Marburger Mailingliste
Wolf Thomas - am Freitag, 19. März 2010, 18:41 - Rubrik: Wirtschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das merkt man jetzt in Hannover siehe
http://www.haz.de/Hannover/Dossiers/Landtag-Abriss-oder-Umbau/Juristen-pruefen-Rechtslage-in-Hannovers-Plenarsaalstreit
„Der Abriss dürfte objektiv rechtswidrig sein“, sagt Reinald Wiechert und pflichtet damit dem langjährigen Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Ernst Gottfried Mahrenholz, in seiner Einschätzung bei. Auch Wiechert ist vom Fach: Fast 30 Jahre lang war der Ministerialdirigent im juristischen Dienst des Landtages tätig, er hat 1998 den Kommentar zum Niedersächsischen Denkmalgesetz verfasst und kennt die Materie wie kaum ein anderer. Wiechert schätzt die Möglichkeit einer direkten Klage gegen den Gesetzesverstoß allerdings in Ermangelung eines geschädigten Individuums als extrem gering ein. „Eine Strafanzeige hätte vermutlich eher Erfolg“, sagt er, „aber die darf man ja erst stellen, wenn der Abriss vollzogen wird.“
Der Grünen-Abgeordnete Enno Hagenah mag das kaum akzeptieren. „Wenn man gegen einen Gesetzesverstoß nicht klagen kann, dann muss das Gesetz geändert werden“, sagt er. Die Grünen lassen derzeit ermitteln, welche Juristen den Auftrag einer juristischen Prüfung übernehmen sollen. „Wenn wir Abgeordneten eine Möglichkeit zur Klage gegen den Denkmalrechtsverstoß haben, dann werden wir sie wohl nutzen“, sagt Hagenah. Besser aber noch sei es, wenn Organisationen wie der Heimatbund klagen könnten – das hatte Verfassungsrechtler Mahrenholz im HAZ-Interview vorgeschlagen.
Archivalia hat in der Vergangenheit immer wieder für die Verbandsklage im Denkmalschutzrecht geworben:
http://archiv.twoday.net/search?q=verbandsklage
http://www.haz.de/Hannover/Dossiers/Landtag-Abriss-oder-Umbau/Juristen-pruefen-Rechtslage-in-Hannovers-Plenarsaalstreit
„Der Abriss dürfte objektiv rechtswidrig sein“, sagt Reinald Wiechert und pflichtet damit dem langjährigen Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Ernst Gottfried Mahrenholz, in seiner Einschätzung bei. Auch Wiechert ist vom Fach: Fast 30 Jahre lang war der Ministerialdirigent im juristischen Dienst des Landtages tätig, er hat 1998 den Kommentar zum Niedersächsischen Denkmalgesetz verfasst und kennt die Materie wie kaum ein anderer. Wiechert schätzt die Möglichkeit einer direkten Klage gegen den Gesetzesverstoß allerdings in Ermangelung eines geschädigten Individuums als extrem gering ein. „Eine Strafanzeige hätte vermutlich eher Erfolg“, sagt er, „aber die darf man ja erst stellen, wenn der Abriss vollzogen wird.“
Der Grünen-Abgeordnete Enno Hagenah mag das kaum akzeptieren. „Wenn man gegen einen Gesetzesverstoß nicht klagen kann, dann muss das Gesetz geändert werden“, sagt er. Die Grünen lassen derzeit ermitteln, welche Juristen den Auftrag einer juristischen Prüfung übernehmen sollen. „Wenn wir Abgeordneten eine Möglichkeit zur Klage gegen den Denkmalrechtsverstoß haben, dann werden wir sie wohl nutzen“, sagt Hagenah. Besser aber noch sei es, wenn Organisationen wie der Heimatbund klagen könnten – das hatte Verfassungsrechtler Mahrenholz im HAZ-Interview vorgeschlagen.
Archivalia hat in der Vergangenheit immer wieder für die Verbandsklage im Denkmalschutzrecht geworben:
http://archiv.twoday.net/search?q=verbandsklage
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der unter Denkmalschutz stehende Plenarsaal des niedersächsischen Landtages wird abgerissen. Der 1962 eingeweihte Oesterlen-Bau gilt als wichtiges Zeugnis moderner deutscher Nachkriegsarchitektur.
http://www.haz.de/Nachrichten/Meinung/Uebersicht/Beschaemend
http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Kammer_gegen_Abriss_von_Oesterlen-Bau_in_Hannover_684476.html

http://www.haz.de/Nachrichten/Meinung/Uebersicht/Beschaemend
http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Kammer_gegen_Abriss_von_Oesterlen-Bau_in_Hannover_684476.html

Über eine Podiumsdiskussion der BStU am 17.03.2010 zum Thema "Die Vernichtung von Stasi-Unterlagen und die Folgen für die Aufarbeitung" berichtet die Berliner Zeitung vom 19.03.2010:
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2010/0319/feuilleton/0048/index.html
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2010/0319/feuilleton/0048/index.html
ingobobingo - am Freitag, 19. März 2010, 12:21 - Rubrik: Staatsarchive
"Rund zehn Prozent der verschütteten Archivalien liegen noch immer in der Grube am Waidmarkt. Bis Ende August sollen auch sie geborgen werden. Gestern erläuterte Stadtdirektor Guido Kahlen im Hauptausschuss den Plan, bis 1. Juli ein so genanntes Bergungsbauwerk zu errichten. Durch diesen Schacht können die verschütteten Dokumente gerettet werden. Seit einer Woche laufe das europaweite Ausschreibungsverfahren.
Nachdem alle Archivalien sowie in die Grube gestürzte Betonblöcke geborgen sind, kann der Bau des Besichtigungsschachts erfolgen. Der ist nötig, um die Ursache des Archiveinsturzes herauszufinden. Damit diese Arbeit nicht in eine Hochwasserperiode fällt, muss der Schacht ab dem 1. September gebaut und zügig fertiggestellt werden, so Kahlen."
Quelle: Welt, 19.03.2010
Nachdem alle Archivalien sowie in die Grube gestürzte Betonblöcke geborgen sind, kann der Bau des Besichtigungsschachts erfolgen. Der ist nötig, um die Ursache des Archiveinsturzes herauszufinden. Damit diese Arbeit nicht in eine Hochwasserperiode fällt, muss der Schacht ab dem 1. September gebaut und zügig fertiggestellt werden, so Kahlen."
Quelle: Welt, 19.03.2010
Wolf Thomas - am Freitag, 19. März 2010, 12:14 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 19. März 2010, 00:24 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Außerordentlich dürftig, trotzdem mehr als fast alle anderen Stadtarchive digital anbieten
http://www.pforzheim.de/kultur-bildung/geschichte/stadtarchiv/virtuelles-stadtarchiv.html
http://www.pforzheim.de/kultur-bildung/geschichte/stadtarchiv/virtuelles-stadtarchiv.html
KlausGraf - am Donnerstag, 18. März 2010, 23:31 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Proteste gegen Stilnachahmung und Historismus sowie die Veränderung der sozialen Strukturen der Gesellschaft am Ende des 19. Jahrhunderts waren die auslösenden Faktoren für die experimentelle moderne Architektur. Die Entwicklung einer neuen Formensprache, neuer Raumkonzeptionen sowie die Einführung neuer Konstruktionsverfahren und Materialien machten den Weg für die Umsetzung einer neuen Philosophie in der Architektur und im Städtebau frei.
Die Familie Plange, der in Soest, Hamburg und Düsseldorf große Mühlenwerke gehörten, lies eine der drei in Soest erstellten Bauwerke vom Architekten Bruno Paul (1874-1968) bauen. Villa Plange, Villa Sternberg und Villa Jahn stehen bis heute in der Stadt Soest, wobei sich nur die erste im Besitz der öffentlichen Hand befindet. Die Villa Plange beherbergt heute das Kreisarchiv.
Die Formensprache der Villa Plange folgt ihrer damaligen Funktion und den Gestaltungsprinzipien der Architektenkollegen von Bruno Paul: „Weniger ist Mehr“ / Mies van der Rohe und „Ein Ornament ist ein Gestaltungsverbrechen“ / Adolf Loos. Max Berg, Hans Pelzig sowie Bruno Taut und Walter Gropius gehörten ebenso zu dieser Familie der damaligen Avantgarde der Weltarchitektur.
Ein sehr breites Ideenspektrum der Moderne umfasste einige gemeinsame Gestaltungsprinzipien, die die Formensprache dieser Architekten beeinflusst haben. Das Prinzip war eine moralische Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft – Stadtplanung, Architektur und Industrie sollten deren gesellschaftspolitisches Pflichtgebot erfüllen.
Die Bauwerke waren Ergebnis der geplanten Funktion und der verwendeten Konstruktion. Diese gestalterischen Gemeinsamkeiten spiegelt auch die Villa Plange wieder:
Flexibilität der räumlichen Aufteilung mit großen Fenstern, die eine Verbindung mit der umgebenden Natur und Landschaft herstellten; eine kubische leichte Form des Baukörpers, oft mit flachen Dächern; Vermeidung der Symmetrie und weiße bzw. in Pastellfarben gehaltene Fensterrahmen - dies waren die Hauptgestaltungsmerkmale.
Lichtdurchflutete Räume betreten Sie beim Besuch der Villa Plange, wie im populären Lied vom Herbert Grönemeyer. Eine Folge sich verändernder Perspektiven prägt diese in den zwanzigen Jahren neu definierte Raumgestaltung, schlicht und sachlich, wie in der „Neuen Sachlichkeit“, einer Strömung der Bildenden Künste damaliger Zeit.
Die von Bruno Paul 1927 entworfenen Möbel sind Teil des Denkmals. Sie wurden von den Deutschen Werkstätten in Dresden/Hellerau gefertigt und vom Richmondishaus in Köln ausgeliefert.
Während des zweiten Weltkriegs wurde die Villa Plange bei einem Bombenangriff stark beschädigt und, abgesehen von der Nordfassade, nach den alten Plänen wiederhergestellt.
Als „Denkmal des Monats März 2010“ wurde die Villa Plange ausgewählt, weil sie zusammen mit den beiden anderen Bruno-Paul-Villen in Soest, der Villa Sternberg und der Villa Jahn, den Repräsentationswillen mittelständischer Unternehmer dieser Zeit dokumentiert. Ein weiterer Grund für diese Auswahl war es, dass es in den 1920er Jahren in der westfälischen Kleinstadt Soest, also fernab von den damaligen großen kulturellen und wirtschaftlichen Zentren, alteingesessene mittelständische Unternehmer gab, deren Geschmack in keiner Weise dem Klischeebild von provinziellen Honoratioren mit dem beschränkten Horizont fortschrittfeindlicher „Bodenständigkeit“ entsprochen hat. Die genannten Soester Bauwerke aus dieser Zeit zählen zu den avantgardistischsten und fortschrittlichsten in Europa wie jene Bauwerke aus dem Mittelalter zu ihrer Zeit."
Quelle:
Arbeitsgemeinschaft Historischer Stadt- und Ortkerne NRW, Regionalgruppe südliches Westfalen,
http://www.hist-stadt.nrw.de/
Die Familie Plange, der in Soest, Hamburg und Düsseldorf große Mühlenwerke gehörten, lies eine der drei in Soest erstellten Bauwerke vom Architekten Bruno Paul (1874-1968) bauen. Villa Plange, Villa Sternberg und Villa Jahn stehen bis heute in der Stadt Soest, wobei sich nur die erste im Besitz der öffentlichen Hand befindet. Die Villa Plange beherbergt heute das Kreisarchiv.
Die Formensprache der Villa Plange folgt ihrer damaligen Funktion und den Gestaltungsprinzipien der Architektenkollegen von Bruno Paul: „Weniger ist Mehr“ / Mies van der Rohe und „Ein Ornament ist ein Gestaltungsverbrechen“ / Adolf Loos. Max Berg, Hans Pelzig sowie Bruno Taut und Walter Gropius gehörten ebenso zu dieser Familie der damaligen Avantgarde der Weltarchitektur.
Ein sehr breites Ideenspektrum der Moderne umfasste einige gemeinsame Gestaltungsprinzipien, die die Formensprache dieser Architekten beeinflusst haben. Das Prinzip war eine moralische Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft – Stadtplanung, Architektur und Industrie sollten deren gesellschaftspolitisches Pflichtgebot erfüllen.
Die Bauwerke waren Ergebnis der geplanten Funktion und der verwendeten Konstruktion. Diese gestalterischen Gemeinsamkeiten spiegelt auch die Villa Plange wieder:
Flexibilität der räumlichen Aufteilung mit großen Fenstern, die eine Verbindung mit der umgebenden Natur und Landschaft herstellten; eine kubische leichte Form des Baukörpers, oft mit flachen Dächern; Vermeidung der Symmetrie und weiße bzw. in Pastellfarben gehaltene Fensterrahmen - dies waren die Hauptgestaltungsmerkmale.
Lichtdurchflutete Räume betreten Sie beim Besuch der Villa Plange, wie im populären Lied vom Herbert Grönemeyer. Eine Folge sich verändernder Perspektiven prägt diese in den zwanzigen Jahren neu definierte Raumgestaltung, schlicht und sachlich, wie in der „Neuen Sachlichkeit“, einer Strömung der Bildenden Künste damaliger Zeit.
Die von Bruno Paul 1927 entworfenen Möbel sind Teil des Denkmals. Sie wurden von den Deutschen Werkstätten in Dresden/Hellerau gefertigt und vom Richmondishaus in Köln ausgeliefert.
Während des zweiten Weltkriegs wurde die Villa Plange bei einem Bombenangriff stark beschädigt und, abgesehen von der Nordfassade, nach den alten Plänen wiederhergestellt.
Als „Denkmal des Monats März 2010“ wurde die Villa Plange ausgewählt, weil sie zusammen mit den beiden anderen Bruno-Paul-Villen in Soest, der Villa Sternberg und der Villa Jahn, den Repräsentationswillen mittelständischer Unternehmer dieser Zeit dokumentiert. Ein weiterer Grund für diese Auswahl war es, dass es in den 1920er Jahren in der westfälischen Kleinstadt Soest, also fernab von den damaligen großen kulturellen und wirtschaftlichen Zentren, alteingesessene mittelständische Unternehmer gab, deren Geschmack in keiner Weise dem Klischeebild von provinziellen Honoratioren mit dem beschränkten Horizont fortschrittfeindlicher „Bodenständigkeit“ entsprochen hat. Die genannten Soester Bauwerke aus dieser Zeit zählen zu den avantgardistischsten und fortschrittlichsten in Europa wie jene Bauwerke aus dem Mittelalter zu ihrer Zeit."
Quelle:
Arbeitsgemeinschaft Historischer Stadt- und Ortkerne NRW, Regionalgruppe südliches Westfalen,
http://www.hist-stadt.nrw.de/
Wolf Thomas - am Donnerstag, 18. März 2010, 21:59 - Rubrik: Kommunalarchive
"Im Rahmen eines Drittmittelprojekts sind diese Merkmale systematisch geordnet, mit 126 Abbildungen veranschaulicht und jüngst in Qucosa, dem sächsischen Dokumenten- und Publikationsserver, veröffentlicht worden."
Das SLUB-Blog
http://blog.slub-dresden.de/beitrag/2010/03/17/buecher-und-ihre-geschichte-arbeit-zu-slub-provenienzmerkmalen-erschienen/
verstößt damit klar gegen die Richtlinie von Qucosa:
Bitte nutzen Sie beim Zitieren immer folgende Url:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-27458
Hervorhebung von mir.
Quod licet Jovi non licet bovi?
Das SLUB-Blog
http://blog.slub-dresden.de/beitrag/2010/03/17/buecher-und-ihre-geschichte-arbeit-zu-slub-provenienzmerkmalen-erschienen/
verstößt damit klar gegen die Richtlinie von Qucosa:
Bitte nutzen Sie beim Zitieren immer folgende Url:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-27458
Hervorhebung von mir.
Quod licet Jovi non licet bovi?

"Es soll ein feuchtfröhliches Wiedersehen in Amsterdam werden und endet mit einem Mord: Der Mönchengladbacher Kunstrestaurator Robert Patati muss mit ansehen, wie sein guter Freund und Kollege Wolfgang in dem von seinem Chef geliehenen Jaguar in die Luft gejagt wird.
Zuletzt hat Wolfgang im Archiv des Lebensmittelkonzerns Duneko Fotos aus der Firmengeschichte für eine Ausstellung restauriert. Galt der Anschlag ihm oder seinem Auftraggeber? Verdächtigt werden die Aktivisten der Gruppe ›Best for Africa‹. Schon lange protestieren sie gegen die Geschäftspraktiken der Firma in Kamerun und anderen Entwicklungsländern. Haben die ›Weltverbesserer‹ die Grenze zum Terrorismus überschritten?
Obwohl sie sich gerade erst getrennt haben, kann Patati jetzt nur noch die gewiefte niederländische Profilerin Micky Spijker weiterhelfen... "
318 Seiten, kt.
ISBN 978-3-89425-360-8
1. Auflage 2009
Quelle: Verlagshomepage
Wolf Thomas - am Donnerstag, 18. März 2010, 21:24 - Rubrik: Wahrnehmung
KlausGraf - am Donnerstag, 18. März 2010, 20:55 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Internationale Musikinstitut Darmstadt (IMD), Ausrichter der Internationalen Ferienkurse für Neue Musik, beherbergt eines der zentralen Archive für eine quellenorientierte, differenzierte Geschichtsschreibung der Musik nach 1945. Die gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main wird in den nächsten vier Jahren die Erfassung, Digitalisierung und Erarbeitung einer internetbasierten Darstellung dieses einzigartigen Archivbestandes substantiell fördern.
Die Zuwendung an das IMD erfolgt im Rahmen der programmatischen Zielsetzung des Kulturfonds, die Auseinandersetzung mit Moderner Kunst u. a. in der Sparte Neue Musik zu intensivieren. Primäre Kooperationspartner des IMD sind die Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und das Deutsche Rundfunkarchiv Frankfurt am Main. Projektbeginn ist der 1. April 2010, nach zwei Jahren wird eine Evaluierung des Projekts vorgenommen. Projektziele sind die vollständige Erfassung, Beschreibung, elektronische Sicherung und Auswertung des umfangreichen IMD-Archivbestands, die Entwicklung eines Datenbank-Konzepts, das eine Integration sämtlicher Datenbestände des IMD erlaubt, die Erarbeitung einer internetbasierten Archivdarstellung. Auf diese Weise wird der Gesamtarchivbestand für die aktive Forschungsarbeit online verfügbar.
Das Internationale Musikinstitut Darmstadt als Kulturinstitut der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist Veranstalter und Netzwerk, Dokumentations- und Informationszentrum, Schaltstelle und Impulsgeber für die zeitgenössische Musik seit 1946. Mit seinen Internationalen Ferienkursen für Neue Musik, seinem Archiv und seiner Bibliothek schreibt das IMD auf einzigartige Weise Musik- und Kulturgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts fort und macht sie greifbar.
Zu den national und international einzigartigen IMD-Archivbeständen, die nun vollständig erschlossen werden sollen, gehören etwa Korrespondenz-, Presse- und Fotoarchive, teils bisher unveröffentlichte Manuskripte von Vor- und Beiträgen, Daten zu Komponisten und Ferienkursjahrgängen ab 1946 sowie umfangreiche Karteibestände von Partituren und Noten, teilweise mit handschriftlichen Eintragungen von Dirigenten, Interpreten und/oder Komponisten. "
Quelle: Link
Die Zuwendung an das IMD erfolgt im Rahmen der programmatischen Zielsetzung des Kulturfonds, die Auseinandersetzung mit Moderner Kunst u. a. in der Sparte Neue Musik zu intensivieren. Primäre Kooperationspartner des IMD sind die Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und das Deutsche Rundfunkarchiv Frankfurt am Main. Projektbeginn ist der 1. April 2010, nach zwei Jahren wird eine Evaluierung des Projekts vorgenommen. Projektziele sind die vollständige Erfassung, Beschreibung, elektronische Sicherung und Auswertung des umfangreichen IMD-Archivbestands, die Entwicklung eines Datenbank-Konzepts, das eine Integration sämtlicher Datenbestände des IMD erlaubt, die Erarbeitung einer internetbasierten Archivdarstellung. Auf diese Weise wird der Gesamtarchivbestand für die aktive Forschungsarbeit online verfügbar.
Das Internationale Musikinstitut Darmstadt als Kulturinstitut der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist Veranstalter und Netzwerk, Dokumentations- und Informationszentrum, Schaltstelle und Impulsgeber für die zeitgenössische Musik seit 1946. Mit seinen Internationalen Ferienkursen für Neue Musik, seinem Archiv und seiner Bibliothek schreibt das IMD auf einzigartige Weise Musik- und Kulturgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts fort und macht sie greifbar.
Zu den national und international einzigartigen IMD-Archivbeständen, die nun vollständig erschlossen werden sollen, gehören etwa Korrespondenz-, Presse- und Fotoarchive, teils bisher unveröffentlichte Manuskripte von Vor- und Beiträgen, Daten zu Komponisten und Ferienkursjahrgängen ab 1946 sowie umfangreiche Karteibestände von Partituren und Noten, teilweise mit handschriftlichen Eintragungen von Dirigenten, Interpreten und/oder Komponisten. "
Quelle: Link
Wolf Thomas - am Donnerstag, 18. März 2010, 20:54 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Donnerstag, 18. März 2010, 20:38 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Und die Archive?
Wolf Thomas - am Donnerstag, 18. März 2010, 20:34 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus einem alten Schreibkalender:
http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/120418
Weitere Beiträge zu Schreibkalendern in Archivalia:
http://archiv.twoday.net/search?q=schreibkalender
http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/120418
Weitere Beiträge zu Schreibkalendern in Archivalia:
http://archiv.twoday.net/search?q=schreibkalender
KlausGraf - am Donnerstag, 18. März 2010, 18:06 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Via E-Mail:
I am sorry you had difficulty locating this on our website!
Actually, Digital Library of the Week is not an award; it's a feature
that appears in our electronic weekly newsletter, American Libraries
Direct. Connecticut History Online was featured in our February 24
issue, which you can find at
http://www.americanlibrariesmagazine.org/al_direct/02242010 (scroll down
the right-hand sidebar until you get to a picture of a sailing vessel).
AL Direct has been featuring an editor-selected Digital Library each
week since 2007. You can find a cumulated list of them on the "I Love
Libraries" website at http://www.ilovelibraries.ala.org/diglibweekly/ .
It appears there because until January 2010, we did not have the
capability of putting our e-newsletters on our own website. We do now,
but we are still developing the capability for searching the AL Direct
section.
If you would like to subscribe to the e-newsletter, you can sign up for
free at http://www.americanlibrariesmagazine.org/aldirect .
Thanks for your interest!
I am sorry you had difficulty locating this on our website!
Actually, Digital Library of the Week is not an award; it's a feature
that appears in our electronic weekly newsletter, American Libraries
Direct. Connecticut History Online was featured in our February 24
issue, which you can find at
http://www.americanlibrariesmagazine.org/al_direct/02242010 (scroll down
the right-hand sidebar until you get to a picture of a sailing vessel).
AL Direct has been featuring an editor-selected Digital Library each
week since 2007. You can find a cumulated list of them on the "I Love
Libraries" website at http://www.ilovelibraries.ala.org/diglibweekly/ .
It appears there because until January 2010, we did not have the
capability of putting our e-newsletters on our own website. We do now,
but we are still developing the capability for searching the AL Direct
section.
If you would like to subscribe to the e-newsletter, you can sign up for
free at http://www.americanlibrariesmagazine.org/aldirect .
Thanks for your interest!
KlausGraf - am Donnerstag, 18. März 2010, 17:27 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://carta.info/24544/urheberrecht-als-kuenstlerischer-bankrott/
Lesenswert!
Siehe schon:
http://archiv.twoday.net/stories/6243155/
Lesenswert!
Siehe schon:
http://archiv.twoday.net/stories/6243155/
KlausGraf - am Donnerstag, 18. März 2010, 17:22 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 18. März 2010, 16:39 - Rubrik: Unterhaltung
Die Präsentation von Eric Retzlaff unter
http://www.opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2010/867/
lässt erkennen, dass der Besuch des Vortrags, wenn man von ihm irgendetwas Konkretes für die Arbeit erwartete und nicht nur bekannte allgemeine Aussagen über Open Access, nutzlos war.
Eine Bemerkung der Folien möchte ich aufgreifen:
"Im öffentlichen Bibliotheksbereich derzeit (noch) kein Thema (?)"
Wie könnten öffentliche Bibliotheken Open Access unterstützen?
* Sie könnten in Zusammenarbeit mit freien Projekten wie Wikisource dafür sorgen, dass die digitale Public Domain durch Scans und E-Texte gemeinfreier Bücher angereichert wird.
* Viele öffentlichen Bibliotheken (Stadtbibliotheken) betreuen kostbare Altbestände. Ähnliche wie in Frankreich sollten sie diese Schätze digitalisieren und als Public Domain im Internet zur Verfügung stellen. (Bislang praktizieren derlei nur die Stadtbibliotheken in Mainz - Kooperation mit Dilibri - und - in extrem bescheidenem Ausmaß - Nürnberg)
* Sie könnten durch lokale Kontakte gratis- oder libre-Open-Access-Veröffentlichungen von Büchern (einschließlich belletristischen Büchern) auf geeigneten Repositorien ermöglichen.
* Sie müssten eine allgemeinverständliche Anleitung zum Auffinden- und Nutzen von Open-Access-Veröffentlichungen erarbeiten und entsprechende Informationsveranstaltungen zur Informationskompetenz anbieten.
* Für publizierende Bibliothekare an öffentlichen Bibliotheken sollte es selbstverständlich sein, dass ihre Fachpublikationen auf Repositorien kostenfrei einsehbar sind.
http://www.opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2010/867/
lässt erkennen, dass der Besuch des Vortrags, wenn man von ihm irgendetwas Konkretes für die Arbeit erwartete und nicht nur bekannte allgemeine Aussagen über Open Access, nutzlos war.
Eine Bemerkung der Folien möchte ich aufgreifen:
"Im öffentlichen Bibliotheksbereich derzeit (noch) kein Thema (?)"
Wie könnten öffentliche Bibliotheken Open Access unterstützen?
* Sie könnten in Zusammenarbeit mit freien Projekten wie Wikisource dafür sorgen, dass die digitale Public Domain durch Scans und E-Texte gemeinfreier Bücher angereichert wird.
* Viele öffentlichen Bibliotheken (Stadtbibliotheken) betreuen kostbare Altbestände. Ähnliche wie in Frankreich sollten sie diese Schätze digitalisieren und als Public Domain im Internet zur Verfügung stellen. (Bislang praktizieren derlei nur die Stadtbibliotheken in Mainz - Kooperation mit Dilibri - und - in extrem bescheidenem Ausmaß - Nürnberg)
* Sie könnten durch lokale Kontakte gratis- oder libre-Open-Access-Veröffentlichungen von Büchern (einschließlich belletristischen Büchern) auf geeigneten Repositorien ermöglichen.
* Sie müssten eine allgemeinverständliche Anleitung zum Auffinden- und Nutzen von Open-Access-Veröffentlichungen erarbeiten und entsprechende Informationsveranstaltungen zur Informationskompetenz anbieten.
* Für publizierende Bibliothekare an öffentlichen Bibliotheken sollte es selbstverständlich sein, dass ihre Fachpublikationen auf Repositorien kostenfrei einsehbar sind.
KlausGraf - am Donnerstag, 18. März 2010, 16:14 - Rubrik: Open Access
Eine DSpace-Anwendung, anscheinend nur Einzelbilder, keine ganzen Bücher, keine brauchbaren Metadaten:
http://collections.ex.ac.uk/repository/

http://collections.ex.ac.uk/repository/

KlausGraf - am Donnerstag, 18. März 2010, 16:04 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Kaitlin Thaney führt hier im Abschnitt "Implications of FLOSS toggles and directives on data sharing" die Probleme auf, die Non-Commercial, Attribution- oder Share-Alike-Lizenzen auf Daten mit sich bringen:
Probleme mit Non-Commercial-Lizenzen
Welche Nutzung von Daten wird als kommerzielle Nutzung ausgeschlossen? Die Übernahme einiger Daten, eine Anfrage über die Daten oder gar schon der Link auf die Daten?
Ein weiterer erwähnenswerter Punkt: Share-Alike-Lizenzen, die eine kommerzielle Nutzung erlauben und Non-Commercial-Lizenzen sind inkompatibel miteinander. Das heißt, dass etwa die Wikipedia, deren Inhalte unter einer Share-Alike-Lizenz publiziert sind, mit NC lizenzierte Katalogdaten nicht nachnutzen könnte.
Probleme mit Attribution-Lizenzen
Macht jemand eine Abfrage über 30000 Linked-Data-Datenquellen, so wäre er theoretisch verpflichtet, alle Quellen zu attribuieren. Der Aufwand dafür wäre ungeheuer.
Probleme mit Share-Alike-Lizenzen
Share-Alike bedeutet, dass jedes aus den Daten abgeleitete Produkt dieselben Nutzungsbedingungen erhalten muss. Eine Anfrage über viele verteilte Datenbanken, von denen eine Share-Alike lizenziert ist, würde bedeuten, dass das gesamte abgeleitete Werk unter derselben Lizenz veröffentlicht werden müsste. Daraus können Kompatibilitätsprobleme entstehen.
http://opendata.hbz-nrw.de/projects/data-publishing/wiki/OpenData-de
Probleme mit Non-Commercial-Lizenzen
Welche Nutzung von Daten wird als kommerzielle Nutzung ausgeschlossen? Die Übernahme einiger Daten, eine Anfrage über die Daten oder gar schon der Link auf die Daten?
Ein weiterer erwähnenswerter Punkt: Share-Alike-Lizenzen, die eine kommerzielle Nutzung erlauben und Non-Commercial-Lizenzen sind inkompatibel miteinander. Das heißt, dass etwa die Wikipedia, deren Inhalte unter einer Share-Alike-Lizenz publiziert sind, mit NC lizenzierte Katalogdaten nicht nachnutzen könnte.
Probleme mit Attribution-Lizenzen
Macht jemand eine Abfrage über 30000 Linked-Data-Datenquellen, so wäre er theoretisch verpflichtet, alle Quellen zu attribuieren. Der Aufwand dafür wäre ungeheuer.
Probleme mit Share-Alike-Lizenzen
Share-Alike bedeutet, dass jedes aus den Daten abgeleitete Produkt dieselben Nutzungsbedingungen erhalten muss. Eine Anfrage über viele verteilte Datenbanken, von denen eine Share-Alike lizenziert ist, würde bedeuten, dass das gesamte abgeleitete Werk unter derselben Lizenz veröffentlicht werden müsste. Daraus können Kompatibilitätsprobleme entstehen.
http://opendata.hbz-nrw.de/projects/data-publishing/wiki/OpenData-de
KlausGraf - am Donnerstag, 18. März 2010, 15:54 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.gruene-bundestag.de/cms/presse/dok/332/332741.oeffentliches_wissen_sinnvoll_verknuepfe.html
Zur Resonanz siehe auch:
http://blog.openbib.org/2010/03/18/offene-katalogdaten-reaktionen/
Nun muss man aber auch das Copyfraud der Bibliotheken angehen:
http://archiv.twoday.net/search?q=copyfraud
Zur Resonanz siehe auch:
http://blog.openbib.org/2010/03/18/offene-katalogdaten-reaktionen/
Nun muss man aber auch das Copyfraud der Bibliotheken angehen:
http://archiv.twoday.net/search?q=copyfraud
KlausGraf - am Donnerstag, 18. März 2010, 15:13 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Italian Music of the 17th Century by Altri Stromenti
Cf. http://creativecommons.org/weblog/entry/21274
KlausGraf - am Donnerstag, 18. März 2010, 15:02 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Rainer Dresen, Justiziar bei Random House, ist Angeklagter eines Strafverfahrens vor dem Amtsgericht München, bei dem es darum geht, dass Dresen die Verantwortung dafür trägt, dass sein Verlag 2007 einen Titel mit dem Begriff Elfenmond veröffentlichte, obwohl ihm bekannt war, dass Guido Krain einen Titel »Elfenmond« im Selbstverlag herausgebracht hatte.
Berichterstattung im Börsenblatt:
http://www.boersenblatt.net/374155/
http://www.boersenblatt.net/372709/
http://www.boersenblatt.net/323085/
"Anwendung sollte § 143 MarkenG wie bisher im Bereich der Produktpiraterie finden und sonstige kennzeichenrechtliche Angelegenheiten sollten unter konsequenter Anwendung von § 154 d StPO auf den Zivilrechtsweg verwiesen werden", schreibt RA Dr. Patrick Baronikians in seinem Aufsatz "Mondfinsternis im Elfenland – Wider die Kriminalisierung des Kennzeichenrechts", der in K&R 2009 erschien und online kostenfrei einsehbar ist unter:
http://www.kommunikationundrecht.de/nachrichten/pages/ablagecontent/dok168.pdf
Zur Strafvorschrift:
http://www.markengesetz.de/paragraphen/143.htm
Mein Kommentar: Es gelten die gleichen Argumente gegen Strafvorschriften im Urheberrecht, die ich in meiner "Urheberrechtsfibel" http://www.contumax.de vorgetragen habe. Die verfassungsrechtlichen Zweifel von Baronikians an § 143 Markengesetz sind nur zu berechtigt.

Berichterstattung im Börsenblatt:
http://www.boersenblatt.net/374155/
http://www.boersenblatt.net/372709/
http://www.boersenblatt.net/323085/
"Anwendung sollte § 143 MarkenG wie bisher im Bereich der Produktpiraterie finden und sonstige kennzeichenrechtliche Angelegenheiten sollten unter konsequenter Anwendung von § 154 d StPO auf den Zivilrechtsweg verwiesen werden", schreibt RA Dr. Patrick Baronikians in seinem Aufsatz "Mondfinsternis im Elfenland – Wider die Kriminalisierung des Kennzeichenrechts", der in K&R 2009 erschien und online kostenfrei einsehbar ist unter:
http://www.kommunikationundrecht.de/nachrichten/pages/ablagecontent/dok168.pdf
Zur Strafvorschrift:
http://www.markengesetz.de/paragraphen/143.htm
Mein Kommentar: Es gelten die gleichen Argumente gegen Strafvorschriften im Urheberrecht, die ich in meiner "Urheberrechtsfibel" http://www.contumax.de vorgetragen habe. Die verfassungsrechtlichen Zweifel von Baronikians an § 143 Markengesetz sind nur zu berechtigt.

KlausGraf - am Donnerstag, 18. März 2010, 14:36 - Rubrik: Archivrecht
"Um die Aufarbeitung der Tätigkeit des Ministeriums für Staatssicherheit zu ermöglichen, verabschiedet die Volkskammer am 24. August 1990 das „Gesetz über die Sicherung und Nutzung der personenbezogenen Daten des ehemaligen Ministerium für Staatssicherheit/Amtes für Nationale Sicherheit“. Es sieht die dezentrale Lagerung und die Aufarbeitung der Akten des Ministeriums für Staatssicherheit in Sonderarchiven der Länder vor.
Die Nutzung der personenbezogenen Daten soll nicht nur zum Zweck der Strafverfolgung, Rehabilitierung oder Überprüfung von Personen auf eine eventuelle Kooperation mit dem MfS erfolgen, sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch zu wissenschaftlichen Forschungszwecken möglich sein. Eine direkte Einsichtnahme oder Herausgabe der Akten an Betroffene ist im Volkskammergesetz noch nicht vorgesehen. Am 28. September wird die Volkskammer Joachim Gauck als Sonderbeauftragen für die Stasi-Unterlagen vorschlagen.
Nach den Statistiken des MfS standen am 31. Oktober 1989 über 91.000 hauptamtliche Kräfte und rund 174.000 „Inoffizielle Mitarbeiter“ in seinem Dienst. Im Lauf der friedlichen Revolution werden unter dem Druck der Demonstrationen das Ministerium für Staatssicherheit und dann auch sein Nachfolger, das „Amt für Nationale Sicherheit“ (AfNS) aufgelöst. In vielen Bezirkshauptstädten besetzen Bürger die Kreisleitungen des ehemaligen MfS, um die Vernichtung der Akten zu verhindern. Am 15. Januar 1990 besetzten 2000 Demonstranten die Berliner Stasi-Zentrale.
Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) war eines der wichtigsten Instrumente der SED-Führung, um ihre Diktatur abzusichern. Es verstand sich selbst als "Schild und Schwert der Partei". Das MfS verfolgte die Menschen, die Widerstand gegen das politische System leisteten, und überwachte mit einem kontinuierlich ausgebauten Spitzelsystem die Bevölkerung. Gewaltanwendung, Freiheitsberaubung, Unterdrückung und Einschüchterung waren gängige Praktiken des MfS."
Quelle: Bundestag
s.a. Protokoll der Volkskammersitzung (PDF)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 18. März 2010, 12:11 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Deutsche Bundestag stellt auf seiner Homepage seit heute Videoaufzeichnungen von Sitzungen der am 18. März 1990 frei gewählten Volkskammer bereit.
http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/parlamentarismus/10_volkskammer/index.html
http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/parlamentarismus/10_volkskammer/index.html
ingobobingo - am Donnerstag, 18. März 2010, 12:01 - Rubrik: Parlamentsarchive
Das Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck hat sämtliche, auf verschiedene Standorte verteilte Briefe des Komponisten im "Brahms-Briefwechsel-Verzeichnis" erfasst und schaltet ab heute die Online-Präsentation des Briefbestandes frei:
http://www.brahms-institut.de/web/bihl_digital/briefe.html
http://www.brahms-institut.de/web/bihl_digital/briefe.html
ingobobingo - am Donnerstag, 18. März 2010, 10:34 - Rubrik: Musikarchive
" .... Unfassbar: Nur wenige Tage vor dem tragischen Unglück wurden dort noch Szenen eines Tatorts gedreht. "Kaltes Herz" heißt der Krimi, der am Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird. .....
Das Historische Stadtarchiv ist in diesem Zusammenhang als Aktenkeller des Jugendamts zu sehen.
Die Dreharbeiten gingen am 25. Februar 2009 zu Ende. In der "Welt" erinnert sich der Schauspieler Dietmar Bär: "Nur wenige Tage nach dem dreh stürzte das komplette Gebäude ein. Unfassbar. Jetzt bekommen wir noch einmal einen kleinen Einblick in das Innenleben dieser kulturellen Schatzkammer."
Quelle: Express
Informationen zu diesem Tatort auf daserste.de
Das Historische Stadtarchiv ist in diesem Zusammenhang als Aktenkeller des Jugendamts zu sehen.
Die Dreharbeiten gingen am 25. Februar 2009 zu Ende. In der "Welt" erinnert sich der Schauspieler Dietmar Bär: "Nur wenige Tage nach dem dreh stürzte das komplette Gebäude ein. Unfassbar. Jetzt bekommen wir noch einmal einen kleinen Einblick in das Innenleben dieser kulturellen Schatzkammer."
Quelle: Express
Informationen zu diesem Tatort auf daserste.de
Wolf Thomas - am Donnerstag, 18. März 2010, 10:28 - Rubrik: Kommunalarchive
KlausGraf - am Donnerstag, 18. März 2010, 02:03 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1566148
See here
http://archiv.twoday.net/stories/4346892/
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Skriptorium/Archiv/2009/Juni#Wikisource_als_Open-Access-Repositorium.3F
See here
http://archiv.twoday.net/stories/4346892/
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Skriptorium/Archiv/2009/Juni#Wikisource_als_Open-Access-Repositorium.3F
KlausGraf - am Donnerstag, 18. März 2010, 01:54 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Kommentiert:
http://www.dirkvongehlen.de/index.php/netz/leipziger-erklarung-zum-schutz-geistigen-eigentums/
http://www.dirkvongehlen.de/index.php/netz/leipziger-erklarung-zum-schutz-geistigen-eigentums/
KlausGraf - am Donnerstag, 18. März 2010, 01:40 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 18. März 2010, 01:33 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 18. März 2010, 01:22 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 18. März 2010, 01:17 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.badische-zeitung.de/wie-man-sich-meriten-erwirbt
in Wien ist man äußerst schlecht auf Fürstenberg zu sprechen. Wolfgang Mayer-König (63), Großmeister des Ordens "Mérito navali – Pour le mérite", sagt fassungslos, einen solchen "Mangel an Courtoisie" habe er noch nicht erlebt. Den traditionsreichen Orden – aus purem Gold im Wert von 20 000 Euro – dürfen laut Statut nur zwölf Personen gleichzeitig haben, zu Lebzeiten. Sie verpflichten sich, dass er nach ihrem Tod zurückgegeben wird, damit neue Kandidaten ausgezeichnet werden können. "Auch mein Freund Joki hat das zugesagt", seufzt Mayer-König. Nun ist der alte Fürstenberg schon seit siebeneinhalb Jahren tot, aber die Wiener haben ihren Orden noch immer nicht zurück. Und Kandidaten wie ein orthodoxer Patriarch oder ein schwedischer Anatom, die Mayer-König auf seiner Liste hat, können nicht ausgezeichnet werden. Denn daheim auf der Baar hat Junior Heinrich Gefallen an dem Goldzierrat gefunden. Erst ließ das Adelshaus verlauten, der Orden sei nicht auffindbar, dann fand ihn der Archivar, durfte ihn aber nicht hergeben. Der Fürst habe entschieden, ihn seiner Sammlung einzuverleiben, erfuhren die Wiener. Man hätte ihn gerne gefragt, ob er glaubt, dass er auf diese Weise neben dem Orden auch die Meriten des Vaters erwirbt, doch eine Bürodame lässt uns wissen: "Dazu geben wir keine Stellungnahme ab."
in Wien ist man äußerst schlecht auf Fürstenberg zu sprechen. Wolfgang Mayer-König (63), Großmeister des Ordens "Mérito navali – Pour le mérite", sagt fassungslos, einen solchen "Mangel an Courtoisie" habe er noch nicht erlebt. Den traditionsreichen Orden – aus purem Gold im Wert von 20 000 Euro – dürfen laut Statut nur zwölf Personen gleichzeitig haben, zu Lebzeiten. Sie verpflichten sich, dass er nach ihrem Tod zurückgegeben wird, damit neue Kandidaten ausgezeichnet werden können. "Auch mein Freund Joki hat das zugesagt", seufzt Mayer-König. Nun ist der alte Fürstenberg schon seit siebeneinhalb Jahren tot, aber die Wiener haben ihren Orden noch immer nicht zurück. Und Kandidaten wie ein orthodoxer Patriarch oder ein schwedischer Anatom, die Mayer-König auf seiner Liste hat, können nicht ausgezeichnet werden. Denn daheim auf der Baar hat Junior Heinrich Gefallen an dem Goldzierrat gefunden. Erst ließ das Adelshaus verlauten, der Orden sei nicht auffindbar, dann fand ihn der Archivar, durfte ihn aber nicht hergeben. Der Fürst habe entschieden, ihn seiner Sammlung einzuverleiben, erfuhren die Wiener. Man hätte ihn gerne gefragt, ob er glaubt, dass er auf diese Weise neben dem Orden auch die Meriten des Vaters erwirbt, doch eine Bürodame lässt uns wissen: "Dazu geben wir keine Stellungnahme ab."
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen


Impressionen vom Einführungsvortag Prof. Scheydt (zum Vergrößern bzw. Drehen auf die Bilder klicken).
"Archive haben nicht immer einen einfachen Stand in der
Kulturlandschaft, lautet die Situationsbeschreibung von Dr.
Marcus Stumpf, dem Leiter des LWL-Archivamtes, auf dem 62.
Westfälischen Archivtag. "In der öffentlichen Wahrnehmung und
selbst bei Politik und Verwaltung haben es Archive vor Ort
manchmal schwer, allein schon, weil ihre Arbeit in den meisten
Fällen nicht so publikumswirksam ist wie die der Museen und
Bibliotheken", sagte der Chefarchivar des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe (LWL) am Dienstag (16.3.) in Kamen vor rund 200
Teilnehmern.
Prof. Dr. Oliver Scheytt, Geschäftsführer der Ruhr.2010 GmbH
und ehemaliger Kulturdezernent der Stadt Essen, appellierte
darum in seinem Eröffnungsvortrag an die Archive, durch
"Polit-Marketing" mehr Überzeugungsarbeit zu leisten.
LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale legte ein
Bekenntnis zur Archivarbeit ab: "Archive sind für unsere
Gesellschaft unverzichtbar. Sie sichern wichtige Quellen aus
der Vergangenheit für die Zukunft. Der breit angelegten
Vermittlungsarbeit vor allem auch an Schülerinnen und Schülern
kommt dabei eine wichtige Rolle zu."
Ein Beispiel, wie es Archiven gelingen kann, ihr Profil zu
schärfen, lieferte Kamens Bürgermeister Hermann Hupe: "Unser
Stadtarchiv und unser Museum bilden bereits seit Jahren
organisatorisch eine Einheit. Besonders der Vermittlungsarbeit
kommt diese Konstellation sehr zugute."
"Organisatorische Zusammenschlüsse von Archiven mit anderen
Kultureinrichtungen sind nicht immer nur als "Liebesheirat" zu
werten, sondern können auch den Charakter von 'Zwangsehen'
haben". Ihr Nutzen sei dann fraglich, warnte LWL-Archivar
Stumpf. Die Auswirkungen der Finanzkrise auf die kommunalen
Haushalte und insbesondere auf die Kulturetats machten sich
bemerkbar. Die Gründung von Kulturbetrieben, u.a. als Anstalt
des öffentlichen Rechts, verfolge auch das Ziel, die
städtischen Ausgaben für die Kultur kontinuierlich
zurückzufahren.
Das Thema Migration war der zweite Schwerpunkt der Tagung.
"Schon heute sind die Archive gefordert, sich des
tagesaktuellen Themas Migration anzunehmen, Konzepte zu
entwickeln, welche Quellen aus der Verwaltung, aber auch von
Vereinen und Privatpersonen auf Dauer gesichert werden sollen,
um auch noch Jahrhunderte später Migrationsbewegungen zu Beginn
des 21. Jahrhundert in der städtischen Gesellschaft erforschen
zu können", so Hans-Jürgen Kistner, Stadtarchivar von Kamen.
Denn Quellen, die heute nicht durch die Archive gesichert
würden, stünden morgen der Forschung nicht zur Verfügung. Ein
gelungenes Beispiel der Sicherung von Quellen dokumentierte der
Werkstattbericht über die Zusammenarbeit von Kommunalarchiven
des Ruhrgebietes über ihr Ausstellungsprojekt "Fremd(e) im
Revier".
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Presseecho:
" ..... „Es reicht nicht, alle 20 Jahre eine dickbändige Stadtchronik herauszubringen”, betonte Michael Pavlicic vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). Archive müssten sich noch mehr öffnen. Sie sollten alle Bürger ansprechen: „Archive dürfen nicht Institutionen einer Elite-Kultur sein.” Konkurrenz und Kooperation mit anderen Kulturinstitutionen sollten gefördert werden. ....Die Öffentlichkeit – darin sieht Oliver Scheytt eine Möglichkeit, die Situation der Archive in Zeiten der Krise zu verbessern. Er referierte zum Thema „Polit-Marketing für Kommunalarchive”. Erstes Problem der Einrichtungen sei ihr Image: „Staub, Keller, Wände voller Akten – das sind die Vorstellungen, die viele Leute haben.” Einerseits sei Kultur zwar positiv behaftet. „Wenn zwischen Geld für einen Kindergarten oder für ein Archiv gewählt werden muss, ist die Entscheidung klar.”
Um Politiker zur Förderung der Archive zu bewegen, müsste der richtige Ansatzpunkt wählen.Generell gebe es drei Möglichkeiten der Einflussnahme: Überzeugung der politischen Kräfte, ein Tausch („Fördermittel gegen Rasenplatz”) und Druck. „Doch der lässt sich nur kurz aufbauen.” Langfristig sei Überzeugen die beste Alternative. „Die Währung der Politiker ist Aufmerksamkeit und Anerkennung”, führt Scheytt aus. Deshalb müsste das Polit-Marketing auf Image-Transfer ausgerichtet werden. Dabei müsse für den Politikern ein Gewinn erkennbar sein: „Politiker wollen steuern und wirken.”
Gemeinsam mit einem Politiker sollte ein Konzept erarbeitet werden. „Dabei ist es wichtig, im entscheidenen Moment dem Politiker den Vortritt zu lassen”. Das gebe diesem die gewollte Aufmerksamkeit und eine bessere Argumentationsposition innerhalb seiner Fraktion.
Westfälische Rundschau, Lokalteil Kamen
"Das Treffen der „Jäger des verlorenen Satzes“
Die meisten der rund 200 Menschen, die gestern und heute in der Stadthalle tagen, sehen eigentlich nicht aus wie Bewohner verstaubter Kellerräume und Hüter langweiliger Aktenstapel. Aber das sind nun mal die Klischees, mit denen sich Archivare herumplagen müssen. ...."
Hellweger Anzeiger
Wolf Thomas - am Mittwoch, 17. März 2010, 19:14 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
FAZ.net vom 17.3.10 berichtet, dass "der Bundesnachrichtendienst erstmals geheime Akten freigegeben hat, die belegen sollen, in welchem Umfang sich der Auslandsgeheimdienst bis in die siebziger Jahre ehemaliger Handlanger des nationalsozialistischen Terrorapparats bedient hat. Zugleich wurden einzelne Akten und Berichte über eine dienstinterne Säuberung zugänglich gemacht, mit der dieses Treiben beschränkt wurde.
Einen ausführlichen Bericht über die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit durch den Bundesnachrichtendienst soll in der F.A.Z. vom Donnerstag, dem 18. März erscheinen."
Hier findet sich der angekündigte Artikel:
http://www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~EE10E30E33EE74A63AE71676C68A03D14~ATpl~Ecommon~Scontent.html
Vierprinzen
Einen ausführlichen Bericht über die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit durch den Bundesnachrichtendienst soll in der F.A.Z. vom Donnerstag, dem 18. März erscheinen."
Hier findet sich der angekündigte Artikel:
http://www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~EE10E30E33EE74A63AE71676C68A03D14~ATpl~Ecommon~Scontent.html
Vierprinzen
vom hofe - am Mittwoch, 17. März 2010, 19:13
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Über das Ergebnis des ersten Zivilprozesses um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs berichtet die Welt-online vom 17.03.2010:
http://www.welt.de/die-welt/vermischtes/article6811631/Archiv-Einsturz-Leihgeber-scheitern-mit-Klage.html
http://www.welt.de/die-welt/vermischtes/article6811631/Archiv-Einsturz-Leihgeber-scheitern-mit-Klage.html
ingobobingo - am Mittwoch, 17. März 2010, 16:12 - Rubrik: Kommunalarchive
Emory University Saves Salman Rushdie's Digital Archive
New York Times, 15. Maerz 2010
http://www.nytimes.com/2010/03/16/books/16archive.html?scp=1&sq=Emory&st=cse
New York Times, 15. Maerz 2010
http://www.nytimes.com/2010/03/16/books/16archive.html?scp=1&sq=Emory&st=cse
astridme - am Mittwoch, 17. März 2010, 00:50 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen