RABOBANK | Utrechts Archief from Jisk Film on Vimeo.
"Commissioned by the Rabobank who is supporting the Utrechts Archief, we produced a short promotional film. It was quite a challenge, since the the building wasnt yet ready and we had to solve things with CGI. "Wolf Thomas - am Freitag, 2. Dezember 2011, 23:13 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Extrait Film pour les Archives Départementales... von laligue10
Un film d'Entreprise réalisé par La Ligue de l'Enseignement de l'Aube,
pour le Conseil général de l'Aube et sa direction des Archives Départementales.
Acteurs : Arthur Vignes et Charlotte Michel
Matériel vidéo : Panasonic AG-AF101 + Canon 24-105 f4 USM
Wolf Thomas - am Freitag, 2. Dezember 2011, 22:54 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
und hier verfügbar: Digital Preservation Summit
schwalm.potsdam - am Freitag, 2. Dezember 2011, 17:35 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
fragt Andreas Kilb in seinem Beitrag "Unsichtbare Vasen für die Menschheit" in der FAZ-Onlineausgabe v.01.12.2011:
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/digitales-kulturerbe-unsichtbare-vasen-fuer-die-menschheit-11539800.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/digitales-kulturerbe-unsichtbare-vasen-fuer-die-menschheit-11539800.html
ingobobingo - am Freitag, 2. Dezember 2011, 16:13 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Archivdirektor Dr. Karl-Peter Ellerbrock (links) und Joachim Punge (rechts), Vorsitzender der GWWG, begrüßen Hans-Jörg Hübner als 500. GWWG-Mitglied (Homepage WWA, Foto: Michael Printz)
"Von den Dortmunder Brauereien bis zur Textilindustrie im Münsterland: Die Geschichte der regionalen Wirtschaft nimmt rund zehn Regalkilometer im Westfälischen Wirtschaftsarchiv (WWA) ein. Nun feiert die Einrichtung in Dortmund ihren 70. Geburtstag. Gegründet wurde das Archiv 1941, um historische Unterlagen vor Bombeneinschlägen zu schützen. Seit 1969 besteht es als Stiftung, die unter anderem von den westfälischen Kammern der Wirtschaft, dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) sowie dem Sparkassenverband Westfalen-Lippe getragen wird. Heute wirkt das WWA als Archiv der Kammern, aber auch als Auffangstelle für Überlieferungen von Unternehmen, wenn diese in Konkurs gehen oder etwa durch eine Konzernübernahme ihre Eigenständigkeit verlieren. Zudem vertritt es die 300 deutschen Wirtschaftsarchive auf internationaler Ebene. "Das WWA leistet einen wichtigen Beitrag zur Pflege des Kulturguts Wirtschaft und damit auch für die
Identitätsfindung Westfalens", betonte LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale im Rahmen einer Feierstunde."via Mailingliste "Westfäölische Geschichte"
Weitere Informationen:
http://www.archive.nrw.de/Wirtschaftsarchive/WWADortmund/index.html
Wolf Thomas - am Freitag, 2. Dezember 2011, 12:12 - Rubrik: Wirtschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Stadtarchiv Linz am Rhein ist dort vertreten:
https://plus.google.com/u/0/106703708061960160966/posts
Meines Wissens war das erste deutschsprachige Archiv auf G+ das Hochschularchiv der RWTH Aachen:
https://plus.google.com/u/0/109080670989349548459/posts
https://plus.google.com/u/0/106703708061960160966/posts
Meines Wissens war das erste deutschsprachige Archiv auf G+ das Hochschularchiv der RWTH Aachen:
https://plus.google.com/u/0/109080670989349548459/posts
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Text ist vorerst nur in der Printausgabe vom 1. Dezember zugänglich.
Auszug: Der Biologe hat
mehr als 65 000 Mal in Artikel eingegriffen. Er
war 2004 nach eigenen Angaben dabei, als Wikimedia
gegründet wurde, ein Verein, der die deutsche
Wikipedia betreibt und pflegt. Raschka war
dort mal auf diesem, mal auf jenem Posten tätig,
zuletzt war er im Ressort Qualität und saß als
Beisitzer im Vorstand.
Achim Raschka war auch aktiv dabei, als vor
vier Jahren das Projekt »Nachwachsende Rohstoffe
«, kurz Nawaro, startete. Es war eines der
größten Schreibprojekte der deutschen Wikipedia.
Innerhalb von drei Jahren sollten über hundert
neue Einträge entstehen, von Bioenergie
über Kunststoffe bis hin zu Rohstoffpflanzen.
Das Projekt zog von Anfang an keine klare
Grenze zwischen Privatwirtschaft und Gemeininteresse.
Nawaro war eine Zusammenarbeit
zwischen Wikimedia und dem Unternehmen
Nova-Institut, das in der privaten Forschung für
unterschiedliche Auftraggeber tätig ist. Das Verbindungsglied
war der Mann, der bei beiden
arbeitete: Achim Raschka. Ihm wurde die Leitung
des Projekts übertragen.
Das ist, als würde ein Autor Thema und
Schreibstil bestimmten, redigieren und sich dabei
selbst kritisch beobachten. Obendrein erhielt
das Projekt eine staatliche Förderung. 234 820
Euro flossen aus den Mitteln des Verbraucherministeriums
– in der Zeit der CSU-Bundesminister
Horst Seehofer und Ilse Aigner – über den
Verein Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe
(FNR) direkt an das Nova-Institut. Das Gemenge
von staatlicher Finanzierung und privatwirtschaftlicher
Beteiligung ging auch einzelnen
Nutzern der Wikipedia-Community zu weit. Sie
fürchteten, andere Unternehmen könnten sich
an Nawaro ein Beispiel nehmen und sich ebenfalls
über Projekte in die Wikipedia einklinken.
Die üblichen Verdächtigen kritisieren den Artikel harsch. Mit dabei Heises Kleinz:
https://plus.google.com/107223467325602754395/posts/DHZ4aKy4eag
Update: der Verein reagiert und weist alle Vorwürfe zurück
http://blog.wikimedia.de/2011/12/02/ein-bisschen-aufklarung-wurde-schon-reichen/
Auszug: Der Biologe hat
mehr als 65 000 Mal in Artikel eingegriffen. Er
war 2004 nach eigenen Angaben dabei, als Wikimedia
gegründet wurde, ein Verein, der die deutsche
Wikipedia betreibt und pflegt. Raschka war
dort mal auf diesem, mal auf jenem Posten tätig,
zuletzt war er im Ressort Qualität und saß als
Beisitzer im Vorstand.
Achim Raschka war auch aktiv dabei, als vor
vier Jahren das Projekt »Nachwachsende Rohstoffe
«, kurz Nawaro, startete. Es war eines der
größten Schreibprojekte der deutschen Wikipedia.
Innerhalb von drei Jahren sollten über hundert
neue Einträge entstehen, von Bioenergie
über Kunststoffe bis hin zu Rohstoffpflanzen.
Das Projekt zog von Anfang an keine klare
Grenze zwischen Privatwirtschaft und Gemeininteresse.
Nawaro war eine Zusammenarbeit
zwischen Wikimedia und dem Unternehmen
Nova-Institut, das in der privaten Forschung für
unterschiedliche Auftraggeber tätig ist. Das Verbindungsglied
war der Mann, der bei beiden
arbeitete: Achim Raschka. Ihm wurde die Leitung
des Projekts übertragen.
Das ist, als würde ein Autor Thema und
Schreibstil bestimmten, redigieren und sich dabei
selbst kritisch beobachten. Obendrein erhielt
das Projekt eine staatliche Förderung. 234 820
Euro flossen aus den Mitteln des Verbraucherministeriums
– in der Zeit der CSU-Bundesminister
Horst Seehofer und Ilse Aigner – über den
Verein Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe
(FNR) direkt an das Nova-Institut. Das Gemenge
von staatlicher Finanzierung und privatwirtschaftlicher
Beteiligung ging auch einzelnen
Nutzern der Wikipedia-Community zu weit. Sie
fürchteten, andere Unternehmen könnten sich
an Nawaro ein Beispiel nehmen und sich ebenfalls
über Projekte in die Wikipedia einklinken.
Die üblichen Verdächtigen kritisieren den Artikel harsch. Mit dabei Heises Kleinz:
https://plus.google.com/107223467325602754395/posts/DHZ4aKy4eag
Update: der Verein reagiert und weist alle Vorwürfe zurück
http://blog.wikimedia.de/2011/12/02/ein-bisschen-aufklarung-wurde-schon-reichen/
http://dhdhi.hypotheses.org/610
Mareike König schreibt dort: Wissenschaftliches Bloggen bietet ein großes Potential für die schnelle Publikation, Verbreitung und Diskussion aktueller Forschungsinhalte. Im deutschsprachigen Raum und speziell bei den Geisteswissenschaften wird das noch viel zu wenig erkannt und genutzt. Mit dem Aufbau eines deutschsprachigen Blogportals für die Geisteswissenschaften - http://de.hypotheses.org - soll diese Form der wissenschaftlichen Kommunikation nun stärker verbreitet werden. In Anlehnung an das französische Vorbild hypotheses.org wird ein Service eingerichtet, der das Eröffnen von Wissenschaftsblogs aus allen Disziplinen der Humanities erleichtert, diese unter einem Dach versammelt und für eine größere Sichtbarkeit wie auch für die Archivierung der Inhalte sorgt.
Entstanden ist die Idee vor dem Hintergrund des großen Erfolgs des französischsprachigen Blogportals hypotheses.org. Über 60 der derzeit 269 dort versammelten Blogs haben in diesem Sommer von der französischen Nationalbibliothek eine ISSN bekommen und können damit wie Zeitschriften in die Bibliothekskataloge aufgenommen werden[1]. Das Team von hypotheses.org um Marin Dacos und Pierre Mounier stellen die Infrastruktur für das deutschsprachige Portal kostenlos zur Verfügung, ganz im Sinne des Manifests der Digital Humanities, entstanden auf dem Pariser ThatCamp 2010, das Kollaboration in einer solidarischen, offenen, einladenden und frei zugänglichen Praxisgemeinschaft in den Mittelpunkt stellt.
Folgt man dem französischen Beispiel, so sind Wissenschaftsblogs denkbar für Forschergruppen, begleitend zu Seminaren, über Projekte, Ausgrabungen, Zeitschriften oder um die Arbeit von Instituten und Einrichtungen zu präsentieren. Anmelden können sich Forschergruppen und Einzelforscher/innen der Geisteswissenschaften, die über eine universitäre oder institutionelle Anbindung verfügen und die regelmäßig über ihre aktuelle Forschungen schreiben möchten.
Die Blogs laufen auf WordPress. Das Portal ist derzeit in einer Betaversion. Anmeldungen zur Eröffnung eines Blogs oder zur Migration eines bereits bestehenden Blogs sind ab sofort möglich auf der Seite “Blog eröffnen“.
Ein wissenschaftlicher Beirat, bestehend aus Gudrun Gersmann, Peter Haber, Gregor Horstkemper, Martin Huber, Hubertus Kohle, Gerhard Lauer, Claudine Moulin und Eva Pfanzelter, begleitet das Projekt. Über die Auswahl der Beiträge für die Startseite des Blogportals entscheidet die wissenschaftliche Redaktion des Portals, zu der Klaus Graf, Jan Hodel, Eliane Kurmann, Lilian Landes, Enrico Natale, Cornelius Puschmann, Christof Schöch, Anton Tantner, Sacha Zala und ich gehören. Die Redaktion plant den Aufbau eines eigenen „Redaktionsblog“ rund um das Thema geisteswissenschaftliches Bloggen. Die Redaktion twittert ab sofort unter @dehypotheses.
Redaktion und Beirat sei an dieser Stelle für die große Hilfe gedankt, allen voran Peter Haber und Eva Pfanzelter, die bei der Ausarbeitung und Umsetzung des Projekts federführend waren, sowie Klaus Graf für seine wertvollen Hinweise u.a. rund um das Thema Impressum und Urheberrecht. Die technische Umsetzung liegt bei Frédérique Muscinési von hypotheses.org, der an dieser Stelle für ihren großen Einsatz ebenfalls ausdrücklich gedankt sei. Ein Dank geht auch an Miriam Kreis für die Übersetzungsarbeiten und an Gordon Blennemann für seine Hilfe in diesem Zusammenhang.
Am 9. März 2012 wird das Blogportal in München mit einer Tagung über das wissenschaftliche Bloggen, unterstützt durch L.I.S.A., das Wissenschaftsportal der Gerda Henkel Stiftung und das DHI Paris, offiziell an den Start gehen. Am Portal oder der Tagung Interessierte können sich an das DHI Paris wenden unter der Mailadresse blog [at] dhi-paris.fr.
Weitere Literatur
Peter Haber, Eine neue Plattform de.hypotheses.org, in: weblog.histnet, 30.11.2011
Pierre Mounier, Die Werkstatt des Historikers öffnen: Soziale Medien und Wissenschaftsblogs, in: dhdhi.hypotheses.org, 4.11.2011
[1] Siehe dazu Mareike König, Blogging Tricolore. Geisteswissenschaftliche Blogs in Frankreich, in: Archivalia, 11.08.2011
Mareike König schreibt dort: Wissenschaftliches Bloggen bietet ein großes Potential für die schnelle Publikation, Verbreitung und Diskussion aktueller Forschungsinhalte. Im deutschsprachigen Raum und speziell bei den Geisteswissenschaften wird das noch viel zu wenig erkannt und genutzt. Mit dem Aufbau eines deutschsprachigen Blogportals für die Geisteswissenschaften - http://de.hypotheses.org - soll diese Form der wissenschaftlichen Kommunikation nun stärker verbreitet werden. In Anlehnung an das französische Vorbild hypotheses.org wird ein Service eingerichtet, der das Eröffnen von Wissenschaftsblogs aus allen Disziplinen der Humanities erleichtert, diese unter einem Dach versammelt und für eine größere Sichtbarkeit wie auch für die Archivierung der Inhalte sorgt.
Entstanden ist die Idee vor dem Hintergrund des großen Erfolgs des französischsprachigen Blogportals hypotheses.org. Über 60 der derzeit 269 dort versammelten Blogs haben in diesem Sommer von der französischen Nationalbibliothek eine ISSN bekommen und können damit wie Zeitschriften in die Bibliothekskataloge aufgenommen werden[1]. Das Team von hypotheses.org um Marin Dacos und Pierre Mounier stellen die Infrastruktur für das deutschsprachige Portal kostenlos zur Verfügung, ganz im Sinne des Manifests der Digital Humanities, entstanden auf dem Pariser ThatCamp 2010, das Kollaboration in einer solidarischen, offenen, einladenden und frei zugänglichen Praxisgemeinschaft in den Mittelpunkt stellt.
Folgt man dem französischen Beispiel, so sind Wissenschaftsblogs denkbar für Forschergruppen, begleitend zu Seminaren, über Projekte, Ausgrabungen, Zeitschriften oder um die Arbeit von Instituten und Einrichtungen zu präsentieren. Anmelden können sich Forschergruppen und Einzelforscher/innen der Geisteswissenschaften, die über eine universitäre oder institutionelle Anbindung verfügen und die regelmäßig über ihre aktuelle Forschungen schreiben möchten.
Die Blogs laufen auf WordPress. Das Portal ist derzeit in einer Betaversion. Anmeldungen zur Eröffnung eines Blogs oder zur Migration eines bereits bestehenden Blogs sind ab sofort möglich auf der Seite “Blog eröffnen“.
Ein wissenschaftlicher Beirat, bestehend aus Gudrun Gersmann, Peter Haber, Gregor Horstkemper, Martin Huber, Hubertus Kohle, Gerhard Lauer, Claudine Moulin und Eva Pfanzelter, begleitet das Projekt. Über die Auswahl der Beiträge für die Startseite des Blogportals entscheidet die wissenschaftliche Redaktion des Portals, zu der Klaus Graf, Jan Hodel, Eliane Kurmann, Lilian Landes, Enrico Natale, Cornelius Puschmann, Christof Schöch, Anton Tantner, Sacha Zala und ich gehören. Die Redaktion plant den Aufbau eines eigenen „Redaktionsblog“ rund um das Thema geisteswissenschaftliches Bloggen. Die Redaktion twittert ab sofort unter @dehypotheses.
Redaktion und Beirat sei an dieser Stelle für die große Hilfe gedankt, allen voran Peter Haber und Eva Pfanzelter, die bei der Ausarbeitung und Umsetzung des Projekts federführend waren, sowie Klaus Graf für seine wertvollen Hinweise u.a. rund um das Thema Impressum und Urheberrecht. Die technische Umsetzung liegt bei Frédérique Muscinési von hypotheses.org, der an dieser Stelle für ihren großen Einsatz ebenfalls ausdrücklich gedankt sei. Ein Dank geht auch an Miriam Kreis für die Übersetzungsarbeiten und an Gordon Blennemann für seine Hilfe in diesem Zusammenhang.
Am 9. März 2012 wird das Blogportal in München mit einer Tagung über das wissenschaftliche Bloggen, unterstützt durch L.I.S.A., das Wissenschaftsportal der Gerda Henkel Stiftung und das DHI Paris, offiziell an den Start gehen. Am Portal oder der Tagung Interessierte können sich an das DHI Paris wenden unter der Mailadresse blog [at] dhi-paris.fr.
Weitere Literatur
Peter Haber, Eine neue Plattform de.hypotheses.org, in: weblog.histnet, 30.11.2011
Pierre Mounier, Die Werkstatt des Historikers öffnen: Soziale Medien und Wissenschaftsblogs, in: dhdhi.hypotheses.org, 4.11.2011
[1] Siehe dazu Mareike König, Blogging Tricolore. Geisteswissenschaftliche Blogs in Frankreich, in: Archivalia, 11.08.2011
Aus meiner Sicht ist der von Harnad und seinen Anhänger propagierte Eprints-Button, mit dem interessierte Wissenschaftler in IRs automatisiert Eprints nicht Open Access zur Verfügung stehender Beiträge anfordern können, Unsinn und hat mit Open Access nichts zu tun. Ich verweise auf meine früheren zahlreichen Stellungnahmen dazu
http://archiv.twoday.net/search?q=eprints+button
Voronin Y , Myrzahmetov A , Bernstein A , 2011 Access to Scientific Publications: The Scientist's Perspective. PLoS ONE 6(11): e27868. http://dx.doi.org/doi:10.1371/journal.pone.0027868 gibt jetzt zwar nicht über den IR-Button Aufschluss, aber über die Erfolgschancen der Anforderung von Eprints, die nicht Open Access zugänglich sind:
"Finally, we examined the response rates for reprint requests sent to corresponding authors, a method commonly used before internet access became widespread. Contacting corresponding authors with requests for electronic copies of articles by email resulted in a 55-60% success rate, although in some cases it took up to 1.5 months to get a response."
Im Klartext: In über 40 % aller Fälle war ein Kontaktversuch ERFOLGLOS, und es dauert teilweise sehr lang. Nichts spricht dafür, dass es bei den IR-Buttons besser aussehen könnte.
For “recent” papers, we sent out 40 requests and received 24 positive responses (60% success rate) (Fig. 3). For “cited” papers, we intended to send out 65 requests, but could not locate the email addresses of eight of the corresponding authors. For the remaining 57, requests were sent out and 31 authors responded by sending a copy of the paper (54% success rate). Among the 26 emails that were unsuccessful, 8 email addresses were outdated, one author declined to provide the paper citing copyright issues with the journal and the rest did not respond. The two thirds of those who replied to the request did so on the same day or the next. However, the other third of respondents took on average 11 days to reply (median 3 days, maximum 54 days).
Fig. 3:
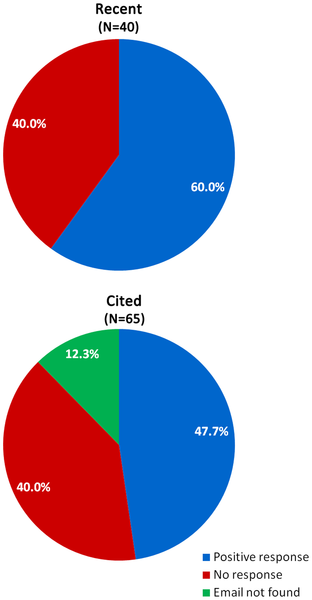
Kontakte zu Kollegen mit Zugang oder z.B. mehr oder minder legale Logins scheinen die frühere Praxis, eine Kopie vom Autor anzufordern zurückgedrängt zu haben.
Interestingly, contacting authors directly no longer appears to be a common approach to obtain reprints of publications. Our experience may provide some clues as to why this is the case. The response rate to reprint requests of only 50–60% and the not uncommon long delay in response make contacting authors a very unreliable and time-consuming way to access articles. Moreover, even though contact information of the corresponding author is usually available for recently published articles on the journal's website, it is frequently missing for older literature, creating a “catch 22” situation in which only those individuals with access to the paper online or in hard copy know the contact information of the corresponding author. Even when this information is available, it can be outdated.
Angesichts dieser Ergebnisse erscheint es absurd, Harnad lemminghaft bei seinem Irrweg zu folgen. Die Anforderung vom Autor ist einfach zu unsicher als dass man eine Open-Access-Strategie darauf bauen könnte. Mandate mit "dark deposits", bei denen zum jetzigen Zeitpunkt klar ist, dass die hinterlegte Version (oft das Verlags-PDF) in absehbarer Zeit nicht zugänglich gemacht werden kann, nützen niemand. Der Eprints-Button stellt keine wirkliche Option dar, zumal es denkbar ist, dass Verlage rechtlich gegen ihn vorgehen.
Je mehr Open Access sich durchsetzt, um so weniger darf man an den Goodwill der Verlage glauben, denen die Felle wegschwimmen. Einträge in die SHERPA-Romeo-Liste sind nicht sakrosankt, sondern können von einem Tag auf den andern zurückgenommen werden.
http://archiv.twoday.net/search?q=eprints+button
Voronin Y , Myrzahmetov A , Bernstein A , 2011 Access to Scientific Publications: The Scientist's Perspective. PLoS ONE 6(11): e27868. http://dx.doi.org/doi:10.1371/journal.pone.0027868 gibt jetzt zwar nicht über den IR-Button Aufschluss, aber über die Erfolgschancen der Anforderung von Eprints, die nicht Open Access zugänglich sind:
"Finally, we examined the response rates for reprint requests sent to corresponding authors, a method commonly used before internet access became widespread. Contacting corresponding authors with requests for electronic copies of articles by email resulted in a 55-60% success rate, although in some cases it took up to 1.5 months to get a response."
Im Klartext: In über 40 % aller Fälle war ein Kontaktversuch ERFOLGLOS, und es dauert teilweise sehr lang. Nichts spricht dafür, dass es bei den IR-Buttons besser aussehen könnte.
For “recent” papers, we sent out 40 requests and received 24 positive responses (60% success rate) (Fig. 3). For “cited” papers, we intended to send out 65 requests, but could not locate the email addresses of eight of the corresponding authors. For the remaining 57, requests were sent out and 31 authors responded by sending a copy of the paper (54% success rate). Among the 26 emails that were unsuccessful, 8 email addresses were outdated, one author declined to provide the paper citing copyright issues with the journal and the rest did not respond. The two thirds of those who replied to the request did so on the same day or the next. However, the other third of respondents took on average 11 days to reply (median 3 days, maximum 54 days).
Fig. 3:
Kontakte zu Kollegen mit Zugang oder z.B. mehr oder minder legale Logins scheinen die frühere Praxis, eine Kopie vom Autor anzufordern zurückgedrängt zu haben.
Interestingly, contacting authors directly no longer appears to be a common approach to obtain reprints of publications. Our experience may provide some clues as to why this is the case. The response rate to reprint requests of only 50–60% and the not uncommon long delay in response make contacting authors a very unreliable and time-consuming way to access articles. Moreover, even though contact information of the corresponding author is usually available for recently published articles on the journal's website, it is frequently missing for older literature, creating a “catch 22” situation in which only those individuals with access to the paper online or in hard copy know the contact information of the corresponding author. Even when this information is available, it can be outdated.
Angesichts dieser Ergebnisse erscheint es absurd, Harnad lemminghaft bei seinem Irrweg zu folgen. Die Anforderung vom Autor ist einfach zu unsicher als dass man eine Open-Access-Strategie darauf bauen könnte. Mandate mit "dark deposits", bei denen zum jetzigen Zeitpunkt klar ist, dass die hinterlegte Version (oft das Verlags-PDF) in absehbarer Zeit nicht zugänglich gemacht werden kann, nützen niemand. Der Eprints-Button stellt keine wirkliche Option dar, zumal es denkbar ist, dass Verlage rechtlich gegen ihn vorgehen.
Je mehr Open Access sich durchsetzt, um so weniger darf man an den Goodwill der Verlage glauben, denen die Felle wegschwimmen. Einträge in die SHERPA-Romeo-Liste sind nicht sakrosankt, sondern können von einem Tag auf den andern zurückgenommen werden.
KlausGraf - am Freitag, 2. Dezember 2011, 02:16 - Rubrik: Open Access
 Zu den wenigen deutschen Archiven, die Digitalisate in größerem Umfang in guter Qualität online und kostenlos zugänglich machen, zählt das Landesarchiv Baden-Württemberg. Mit 38 Urkunden (überwiegend Ablassurkunden) und sieben Transfixen ist das 1940 von Max Miller gebildete Urkundenselekt der "bemalten Urkunden" H 52 des Hauptstaatsarchivs Stuttgart ein sehr kleiner digitalisierter Bestand, aber sicher einer der schönsten.
Zu den wenigen deutschen Archiven, die Digitalisate in größerem Umfang in guter Qualität online und kostenlos zugänglich machen, zählt das Landesarchiv Baden-Württemberg. Mit 38 Urkunden (überwiegend Ablassurkunden) und sieben Transfixen ist das 1940 von Max Miller gebildete Urkundenselekt der "bemalten Urkunden" H 52 des Hauptstaatsarchivs Stuttgart ein sehr kleiner digitalisierter Bestand, aber sicher einer der schönsten. https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/startbild.php?bestand=5147
Unsere Abbildung - Aegidius abbas mit Hirschkuh - ist ein Ausschnitt aus einer in Avignon ausgestellten Ablassurkunde (1335 Januar 15) von 15 Erzbischöfen und Bischöfen für die St. Aegidiuskapelle der Deutschordensbrüder in Aachen. Als Provenienz wird Deutscher Orden angegeben, das Stück stammt also aus einem der Deutschordensbestände (hat man die Provenienz denn nicht genau dokumentiert?).

Illuminierte Urkunden waren hier bereits mehrfach Thema. Im letztjährigen Adventskalender erschienen sie im Beitrag zu illuminierten Archivalien:
http://archiv.twoday.net/stories/11466449/
Einige wenige Bildbeispiele gibt es auf Commons:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Illuminated_archival_materials
Im Sammelband "Visualisierte Kommunikation" des Staatsarchivs Marburg 2010 beschäftigen sich drei Beiträge mit illuminierten Urkunden (Besprechung in Archivalia).
2011 wies Archivalia hin auf:
http://www.hist-hh.uni-bamberg.de/ringvorlesung/illuminiert.html (leider ohne Abbildungen)
Der vielleicht jüngste deutschsprachige Beitrag ist Krafft, Otfried: Illustrationen in Papsturkunden des ausgehenden Mittelalters. In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 67 (2011), S. 51-98. Hinweis auf die Arbeit von Brunel 2005 zu den illuminierten Urkunden des französischen Nationalarchivs und zu illuminierten Rechtstexten im Band "AusBILDung des Rechts" (2009), S. 9
An Studien zum Thema finde ich online:
Andreas H. Zajic und Martin Roland: Eine spätmittelalterliche Urkundenfälschung aus dem Augustiner-Chorherrenstift Dürnstein in Niederösterreich. Zugleich ein Beitrag zu illuminierten Urkunden des Mittelalters. In: Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 51 (2005), S. 331-432
http://www.monasterium.net/Zajic_Roland.pdf
Radocsay, Denes: Über einige illuminierte Urkunden. In: Acta historiae artium Academiae scientiarum Hungaricae, Bd. 17 (1971), S. 31-61
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a147644.pdf
Nachtrag: Leo Santifaller: Illuminierte Urkunden (SD aus dem Schlern 1935)
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/z/zsn2b025578.pdf
***
Alle Türchen 2011
KlausGraf - am Freitag, 2. Dezember 2011, 01:11 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Es wird empfohlen, den Rechnungshofbericht (siehe http://archiv.twoday.net/stories/55769365/ ) wenigstens in seinem ersten Teil ganz durchzulesen und sich nicht auf die hier gegebenen Auszüge aus der Zusammenfassung zu beschränken.
Zum Thema "Vollständigkeit der Aktenführung" heißt es S. 10:
Die wichtige Entscheidung, an welchem Standort der Neubau für das LAV errichtet werden sollte, stellt nach § 36 Abs. 1 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Ministerien
des Landes NRW (GGO)
12
einen schriftlich zu bearbeitenden Vorgang dar, welcher die
sachliche Erledigung erkennen und deren Nachprüfung ermöglichen lassen muss.
Mündliche und fernmündliche Rücksprachen, Anordnungen, Auskünfte und sonstige
wichtige Hinweise sind, soweit sie für die weitere Bearbeitung einer Angelegenheit von
Bedeutung sind, in einem Aktenvermerk festzuhalten (§ 38 Abs. 1 GGO).
Soweit die GGO auf den BLB NRW als Landesbetrieb nicht anwendbar ist und der BLB
NRW dazu keine entsprechende hausinterne Anweisung erlassen hat, ergibt sich für ihn
dieser allgemeine Verwaltungsgrundsatz aus dem Prinzip der Gesetzmäßigkeit der
Verwaltung gemäß Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz. Danach sind Stellen, die öffentliche
Aufgaben wahrnehmen, verpflichtet, einzelne Vorgänge wahrheitsgetreu und vollständig
in den Akten zu dokumentieren.
Die Notwendigkeit einer lückenlosen Dokumentation ist auch vor dem Hintergrund des
Prüfungsrechts der externen Finanzkontrolle zu sehen. Fehlende oder mangelhafte Dokumentationen lassen dieses Recht ins Leere laufen.
Siehe hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=vollst%C3%A4ndigkeit+aktenf%C3%BChrung
Man gewinnt den Eindruck, dass bei der Standortentscheidung archivfachliche Belange keinerlei Rolle gespielt haben. Man suchte ein denkmalgeschütztes Objekt und die Staatskanzlei fand das dann im Duisburger Binnenhafen.
S. 12 heißt es: "Der BLB NRW hat seinerzeit noch nicht einmal die Wiederverwendung der Altbausubstanz näher geprüft. Die Bausubstanz des Speichers wurde erst 2010 untersucht. Da die
Lagerung von Archivakten selbst in einem ca. 40 Meter hohen Getreidespeicher neben
besonderen Klima- und Brandschutzanforderungen vornehmlich eine besondere Statik
erfordert, war bereits zum damaligen Zeitpunkt bautechnisch zumindest fraglich, ob die
Gebäudesubstanz des Speichers im Duisburger Innenhafen den statischen Anforderungen gewachsen war. Daher hätte der BLB NRW dieser Frage zwingend vor Ansatz eines Abschlages bei der Berechnung der Baukosten nachgehen müssen. Bei der späteren Verwirklichung des Bauprojekts hat sich sehr schnell gezeigt, dass die Altbausubstanz aus statischen Gründen umfassend ertüchtigt werden musste, sodass sich ein
entsprechender Abschlag bei der Standortentscheidung als nicht gerechtfertigt erwiesen
hat."
Unberücksichtigt bleibt der Mehraufwand für die archivfachliche Klimatisierung, die in einem Altbau womöglich aufwändiger zu realisieren ist als in einem neuen Archivzweckbau.
2009 stürzte das Kölner Stadtarchiv ein. Die Standortentscheidung war bereits vorher gefallen. Irgendwelche Erwägungen zum Katastropenschutz wurden bezeichnenderweise mit Ausnahme eines Grundwasserkonflikts nicht angestellt. Dabei sollte man schon in der archivischen Baumschule lernen, dass ein Standort in Nähe eines großen Fließgewässers archivfachlichen Anforderungen NICHT genügt.
Dazu: "außerdem schlägt zusätzlicher Hochwasserschutz mit weiteren 653.000 Euro zu Buche. Weil der Rhein im Januar des laufenden Jahres im Duisburger Hafen für einen - offenbar unerwarteten - Pegelstand von 27 Meter gesorgt hat, fallen in einer weiteren Kategorie noch einmal 500.000 Euro an. Die Baugrube musste sogar geflutet werden, weil sich die Bodenplatte ansonsten gelöst hätte und dem Bau ein ähnliches Schicksal wie dem Gebäude der Deutschen Welle in Bonn drohte, das im Anschluss an ein Hochwasser jahrelang still lag."
http://archiv.twoday.net/stories/31622454/
Es ist absolut unverständlich, dass die Leitung des Landesarchivs sich einen völlig ungeeigneten Standort, der zudem noch den Nachteil einer erheblichen Entfernung von den abliefernden Zentralbehörden aufweist und sich auch aus Benutzersicht als wenig günstig erweist (Düsseldorf ist leichter erreichbar als Duisburg), hat aufs Auge drücken lassen. Gegen die dem Korruptionsverdacht unterliegende Entscheidung, den Neubau als teures Renommierprojekt in klarer Gefahrenlage zu errichten, wäre mit Nachdruck zu remonstrieren und mit allen Mitteln vorzugehen gewesen. Wer sich bei einer solchen eklatanten Fehlentscheidung feige zurückhält, sollte keine Leitungsposition innehaben.
Es wäre meines Erachtens an der Zeit, dass auch im Landesarchiv Köpfe rollen.
Zum Thema "Vollständigkeit der Aktenführung" heißt es S. 10:
Die wichtige Entscheidung, an welchem Standort der Neubau für das LAV errichtet werden sollte, stellt nach § 36 Abs. 1 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Ministerien
des Landes NRW (GGO)
12
einen schriftlich zu bearbeitenden Vorgang dar, welcher die
sachliche Erledigung erkennen und deren Nachprüfung ermöglichen lassen muss.
Mündliche und fernmündliche Rücksprachen, Anordnungen, Auskünfte und sonstige
wichtige Hinweise sind, soweit sie für die weitere Bearbeitung einer Angelegenheit von
Bedeutung sind, in einem Aktenvermerk festzuhalten (§ 38 Abs. 1 GGO).
Soweit die GGO auf den BLB NRW als Landesbetrieb nicht anwendbar ist und der BLB
NRW dazu keine entsprechende hausinterne Anweisung erlassen hat, ergibt sich für ihn
dieser allgemeine Verwaltungsgrundsatz aus dem Prinzip der Gesetzmäßigkeit der
Verwaltung gemäß Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz. Danach sind Stellen, die öffentliche
Aufgaben wahrnehmen, verpflichtet, einzelne Vorgänge wahrheitsgetreu und vollständig
in den Akten zu dokumentieren.
Die Notwendigkeit einer lückenlosen Dokumentation ist auch vor dem Hintergrund des
Prüfungsrechts der externen Finanzkontrolle zu sehen. Fehlende oder mangelhafte Dokumentationen lassen dieses Recht ins Leere laufen.
Siehe hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=vollst%C3%A4ndigkeit+aktenf%C3%BChrung
Man gewinnt den Eindruck, dass bei der Standortentscheidung archivfachliche Belange keinerlei Rolle gespielt haben. Man suchte ein denkmalgeschütztes Objekt und die Staatskanzlei fand das dann im Duisburger Binnenhafen.
S. 12 heißt es: "Der BLB NRW hat seinerzeit noch nicht einmal die Wiederverwendung der Altbausubstanz näher geprüft. Die Bausubstanz des Speichers wurde erst 2010 untersucht. Da die
Lagerung von Archivakten selbst in einem ca. 40 Meter hohen Getreidespeicher neben
besonderen Klima- und Brandschutzanforderungen vornehmlich eine besondere Statik
erfordert, war bereits zum damaligen Zeitpunkt bautechnisch zumindest fraglich, ob die
Gebäudesubstanz des Speichers im Duisburger Innenhafen den statischen Anforderungen gewachsen war. Daher hätte der BLB NRW dieser Frage zwingend vor Ansatz eines Abschlages bei der Berechnung der Baukosten nachgehen müssen. Bei der späteren Verwirklichung des Bauprojekts hat sich sehr schnell gezeigt, dass die Altbausubstanz aus statischen Gründen umfassend ertüchtigt werden musste, sodass sich ein
entsprechender Abschlag bei der Standortentscheidung als nicht gerechtfertigt erwiesen
hat."
Unberücksichtigt bleibt der Mehraufwand für die archivfachliche Klimatisierung, die in einem Altbau womöglich aufwändiger zu realisieren ist als in einem neuen Archivzweckbau.
2009 stürzte das Kölner Stadtarchiv ein. Die Standortentscheidung war bereits vorher gefallen. Irgendwelche Erwägungen zum Katastropenschutz wurden bezeichnenderweise mit Ausnahme eines Grundwasserkonflikts nicht angestellt. Dabei sollte man schon in der archivischen Baumschule lernen, dass ein Standort in Nähe eines großen Fließgewässers archivfachlichen Anforderungen NICHT genügt.
Dazu: "außerdem schlägt zusätzlicher Hochwasserschutz mit weiteren 653.000 Euro zu Buche. Weil der Rhein im Januar des laufenden Jahres im Duisburger Hafen für einen - offenbar unerwarteten - Pegelstand von 27 Meter gesorgt hat, fallen in einer weiteren Kategorie noch einmal 500.000 Euro an. Die Baugrube musste sogar geflutet werden, weil sich die Bodenplatte ansonsten gelöst hätte und dem Bau ein ähnliches Schicksal wie dem Gebäude der Deutschen Welle in Bonn drohte, das im Anschluss an ein Hochwasser jahrelang still lag."
http://archiv.twoday.net/stories/31622454/
Es ist absolut unverständlich, dass die Leitung des Landesarchivs sich einen völlig ungeeigneten Standort, der zudem noch den Nachteil einer erheblichen Entfernung von den abliefernden Zentralbehörden aufweist und sich auch aus Benutzersicht als wenig günstig erweist (Düsseldorf ist leichter erreichbar als Duisburg), hat aufs Auge drücken lassen. Gegen die dem Korruptionsverdacht unterliegende Entscheidung, den Neubau als teures Renommierprojekt in klarer Gefahrenlage zu errichten, wäre mit Nachdruck zu remonstrieren und mit allen Mitteln vorzugehen gewesen. Wer sich bei einer solchen eklatanten Fehlentscheidung feige zurückhält, sollte keine Leitungsposition innehaben.
Es wäre meines Erachtens an der Zeit, dass auch im Landesarchiv Köpfe rollen.
"Inhaltsverzeichnis
1 Zusammenstellung der wesentlichen Prüfungsergebnisse S. 3
2 Ausgangslage S. 5
2.1 Errichtung des Landesarchivs S. 5
2.2 Festlegung des Raumbedarfs für den Neubau des Landesarchivs S. 6
2.3 Mietvertrag zwischen BLB NRW und Nutzer S. 6
3 Prüfungsfeststellungen S. 7
3.1 Standortentscheidung S. 7
3.2 Beabsichtigter Grundstückserwerb S. 13
3.3 Anmietung der Liegenschaften von der Investorin S. 20
3.3.1 Angebotene Miet- und Kauflösungen S. 20
3.3.2 Machbarkeitsstudie zum Standort Innenhafen S. 23
3.3.3 Durchführung von Architektenwettbewerben S. 24
3.3.4 Mietvertrag zwischen BLB NRW und Investorin S. 26
3.3.5 Kostensteigerungen nach Abschluss des Mietvertrages S. 29
3.4 Grunderwerb und Realisierung der Maßnahme durch den BLB
NRW S. 34
3.4.1 Situation vor dem Erwerb der Grundstücke S. 34
3.4.2 Kaufvertrag zwischen BLB NRW und der Investorin S. 37
3.4.3 Gutachten zur Wertermittlung S. 38
3.4.4 Erwerb weiterer Flächen durch den BLB NRW S. 40
3.5 Beteiligung des Verwaltungsrates des BLB NRW S. 46
3.6 Dokumentationspflichten der Betriebsleitung des BLB NRW S. 50
4 Schlussbemerkungen S. 52
1 Zusammenstellung der wesentlichen Prüfungsergebnisse
• Die Gesamtkosten für die Neuunterbringung des Landesarchivs werden voraussichtlich von rd. 51,7 Mio. € (47,8 Mio. € Baukosten + 3,9 Mio. € Grundstückskosten) auf mindestens rd. 190,4 Mio. € (171,9 Mio. € Baukosten + 18,5 Mio. € Grundstückskosten) steigen (Stand: Mai 2011). Dies entspricht einer Steigerung von 368%.
• Die für die Unterbringung des Landesarchivs im Duisburger Innenhafen maßgeblichen Gründe und weitreichenden strategischen Entscheidungsprozesse wurden sowohl vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) als auch - soweit betroffen - von der seinerzeit zuständigen Staatskanzlei in wesentlichen Teilen nicht oder nur unzureichend dokumentiert. Das gilt insbesondere für die Standortentscheidung, den gescheiterten direkten Erwerb der für den Bau benötigten Grundstücksflächen im Frühjahr 2007, den Mietvertrag vom 12.10.2007 und den Mietvertragsaufhebungs bzw. Kaufvertrag mit der Investorin vom 08.08.2008. Die einzelnen Vorgänge und Entscheidungen können deshalb aus der Warte eines objektiven Dritten nicht nachvollzogen werden. Dadurch war das gesamte Verfahren intransparent und in hohem Maße manipulationsanfällig.
• Der BLB NRW nahm die notwendigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur Auswahl des Standorts, zum direkten Ankauf der Grundstücke und zu den Abschlüssen des Mietvertrages sowie des Mietvertragsaufhebungs- bzw. Kaufvertrages nicht vor.
• Der BLB NRW unterließ es im Frühjahr 2007, die für den Bau des Landesarchivs benötigten Grundstücksflächen über eine stadteigene Duisburger Gesellschaft, die über entsprechende Vorkaufsrechte verfügte, zu einem Preis von 3,85 Mio. € zu erwerben. Nachvollziehbare Gründe für dieses Vorgehen sind nicht ersichtlich.
• Stattdessen schloss er mit einer Investorin, die diese Flächen angekauft hatte, im Oktober 2007 einen Mietvertrag über ein noch zu errichtendes Gebäude für das Landesarchiv ab. Der Mietvertrag sah eine Jahresmiete von 3,8 Mio. € bei Baukosten von maximal 30 Mio. € netto sowie eine proportionale Erhöhung der Miete bei Steigenden Baukosten vor. Weil zu diesem Zeitpunkt ein konkreter Entwurf des Bauvorhabens fehlte, war eine seriöse Schätzung der Baukosten nicht möglich, sodass der BLB NRW mit dem Vertragsabschluss ein nicht kalkulierbares Kostenrisiko einging.
• Bei kritischer Beurteilung der später ausgewählten Entwurfsplanung waren die in dem Mietvertrag angenommenen Baukosten von rd. 30 Mio. € vollkommen unrealistisch. Dennoch wurde seitens der Geschäftsführung des BLB NRW die Ausübung des vertraglich eingeräumten Rücktrittsrechts vom Mietvertrag
nicht geprüft.
• Bereits im Mai 2008 waren die prognostizierten Baukosten von rd. 30 Mio. € auf 71,3 Mio. € netto angestiegen. Dies hatte zur Folge, dass sich die Miete von 3,8 Mio. € auf 9,1 Mio. € (= 240%) erhöhte.
• Auch nach offizieller Kenntnis der gravierenden, maßgeblich durch den ausgewählten Projektentwurf bedingten Mehrkosten von damals 240% sah die Geschäftsführung des BLB NRW entgegen der substantiierten rechtlichen Hinweise des hauseigenen Justiziariats keine Veranlassung, einen Rücktritt vom Mietvertrag gemäß § 313 BGB (Störung der Geschäftsgrundlage) ernsthaft in Erwägung zu ziehen.
• Stattdessen entschied die Geschäftsführung des BLB NRW, die betreffenden Flächen von der Investorin für 29,9 Mio. € zu erwerben und die Baumaßnahme in Eigenregie zu realisieren. Die Angemessenheit des insgesamt an die Investorin gezahlten Betrags von 29,9 Mio. €, aufgeteilt in 17,6 Mio. € Grundstückskaufpreis, 4 Mio. € für Vorleistungen der Projektplanung und –realisierung und 8,3 Mio. € für die Aufgabe der Vermieterstellung, ist nicht nachvollziehbar und entbehrt jeglicher soliden wirtschaftlichen Grundlage. Allein der als reiner Grundstückskaufpreis bezeichnete Teilbetrag von 17,6 Mio. € stand in keinem Verhältnis zu einem gutachterlich festgestellten Verkehrswert von rd. 6,1 Mio. €. Damit hat der BLB NRW in massiver Weise gegen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 7 LHO) verstoßen.
• Ob die Fortführung des Projektes an dem von der Staatskanzlei gewünschten Standort unabhängig von wirtschaftlichen Erwägungen vor allem auf dem Motiv beruhte, das Prestigeprojekt im Duisburger Innenhafen nicht gänzlich verwerfen zu müssen oder ob hier noch andere sachfremde Interessen eine Rolle gespielt haben, konnte der LRH anhand der wenigen vorhandenen Unterlagen und Aufzeichnungen nicht aufklären.
• Der Verwaltungsrat des BLB NRW wurde von der Geschäftsleitung weder zutreffend noch umfassend und zeitgerecht über das von ihm zu genehmigende Investitionsvorhaben informiert. Hierdurch war das Vorhaben einer differenzierten Beurteilung durch den Verwaltungsrat entzogen. ...."
Quelle: Prüfungsbericht des Landesrechnungshofes Nordrhein-Westfalen v. 28.11.11
Medienreaktionen:
"BLB-Skandal: Prüfbericht setzt Rütgers’ Staatskanzlei unter Druck", WAZRechercheblog, 01.12.11
bild.de, Regional Düsseldorf, 01.12.11
WDR.de, nrwkompakt Kurznachrichten, 01.12.11
"Landesrechnungshof bestätigt Schlamperei", WDR 5 Westblick, Beitrag von Leo Flamm (3min 24)
".... Es ist nicht vorstellbar, dass ein derartiges Mismanagement ausschließlich die Folge von Schlampigkeit, Gleichgültigkeit und Unfähigkeit ist. Der Verdacht drängt sich auf, dass es hier um kriminelle Machenschaften geht, dass Schmiergelder geflossen sind. ....", Peter Jansen, Kommentar in der Neuen Westfälischen, 1.12.11
Politische Reaktion:
Michael Aggelidis, Schallende Ohrfeige für BLB vom Landesrechnungshof, Die Linke, Landtagsfraktion, 01.12.11
s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg
1 Zusammenstellung der wesentlichen Prüfungsergebnisse S. 3
2 Ausgangslage S. 5
2.1 Errichtung des Landesarchivs S. 5
2.2 Festlegung des Raumbedarfs für den Neubau des Landesarchivs S. 6
2.3 Mietvertrag zwischen BLB NRW und Nutzer S. 6
3 Prüfungsfeststellungen S. 7
3.1 Standortentscheidung S. 7
3.2 Beabsichtigter Grundstückserwerb S. 13
3.3 Anmietung der Liegenschaften von der Investorin S. 20
3.3.1 Angebotene Miet- und Kauflösungen S. 20
3.3.2 Machbarkeitsstudie zum Standort Innenhafen S. 23
3.3.3 Durchführung von Architektenwettbewerben S. 24
3.3.4 Mietvertrag zwischen BLB NRW und Investorin S. 26
3.3.5 Kostensteigerungen nach Abschluss des Mietvertrages S. 29
3.4 Grunderwerb und Realisierung der Maßnahme durch den BLB
NRW S. 34
3.4.1 Situation vor dem Erwerb der Grundstücke S. 34
3.4.2 Kaufvertrag zwischen BLB NRW und der Investorin S. 37
3.4.3 Gutachten zur Wertermittlung S. 38
3.4.4 Erwerb weiterer Flächen durch den BLB NRW S. 40
3.5 Beteiligung des Verwaltungsrates des BLB NRW S. 46
3.6 Dokumentationspflichten der Betriebsleitung des BLB NRW S. 50
4 Schlussbemerkungen S. 52
1 Zusammenstellung der wesentlichen Prüfungsergebnisse
• Die Gesamtkosten für die Neuunterbringung des Landesarchivs werden voraussichtlich von rd. 51,7 Mio. € (47,8 Mio. € Baukosten + 3,9 Mio. € Grundstückskosten) auf mindestens rd. 190,4 Mio. € (171,9 Mio. € Baukosten + 18,5 Mio. € Grundstückskosten) steigen (Stand: Mai 2011). Dies entspricht einer Steigerung von 368%.
• Die für die Unterbringung des Landesarchivs im Duisburger Innenhafen maßgeblichen Gründe und weitreichenden strategischen Entscheidungsprozesse wurden sowohl vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) als auch - soweit betroffen - von der seinerzeit zuständigen Staatskanzlei in wesentlichen Teilen nicht oder nur unzureichend dokumentiert. Das gilt insbesondere für die Standortentscheidung, den gescheiterten direkten Erwerb der für den Bau benötigten Grundstücksflächen im Frühjahr 2007, den Mietvertrag vom 12.10.2007 und den Mietvertragsaufhebungs bzw. Kaufvertrag mit der Investorin vom 08.08.2008. Die einzelnen Vorgänge und Entscheidungen können deshalb aus der Warte eines objektiven Dritten nicht nachvollzogen werden. Dadurch war das gesamte Verfahren intransparent und in hohem Maße manipulationsanfällig.
• Der BLB NRW nahm die notwendigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur Auswahl des Standorts, zum direkten Ankauf der Grundstücke und zu den Abschlüssen des Mietvertrages sowie des Mietvertragsaufhebungs- bzw. Kaufvertrages nicht vor.
• Der BLB NRW unterließ es im Frühjahr 2007, die für den Bau des Landesarchivs benötigten Grundstücksflächen über eine stadteigene Duisburger Gesellschaft, die über entsprechende Vorkaufsrechte verfügte, zu einem Preis von 3,85 Mio. € zu erwerben. Nachvollziehbare Gründe für dieses Vorgehen sind nicht ersichtlich.
• Stattdessen schloss er mit einer Investorin, die diese Flächen angekauft hatte, im Oktober 2007 einen Mietvertrag über ein noch zu errichtendes Gebäude für das Landesarchiv ab. Der Mietvertrag sah eine Jahresmiete von 3,8 Mio. € bei Baukosten von maximal 30 Mio. € netto sowie eine proportionale Erhöhung der Miete bei Steigenden Baukosten vor. Weil zu diesem Zeitpunkt ein konkreter Entwurf des Bauvorhabens fehlte, war eine seriöse Schätzung der Baukosten nicht möglich, sodass der BLB NRW mit dem Vertragsabschluss ein nicht kalkulierbares Kostenrisiko einging.
• Bei kritischer Beurteilung der später ausgewählten Entwurfsplanung waren die in dem Mietvertrag angenommenen Baukosten von rd. 30 Mio. € vollkommen unrealistisch. Dennoch wurde seitens der Geschäftsführung des BLB NRW die Ausübung des vertraglich eingeräumten Rücktrittsrechts vom Mietvertrag
nicht geprüft.
• Bereits im Mai 2008 waren die prognostizierten Baukosten von rd. 30 Mio. € auf 71,3 Mio. € netto angestiegen. Dies hatte zur Folge, dass sich die Miete von 3,8 Mio. € auf 9,1 Mio. € (= 240%) erhöhte.
• Auch nach offizieller Kenntnis der gravierenden, maßgeblich durch den ausgewählten Projektentwurf bedingten Mehrkosten von damals 240% sah die Geschäftsführung des BLB NRW entgegen der substantiierten rechtlichen Hinweise des hauseigenen Justiziariats keine Veranlassung, einen Rücktritt vom Mietvertrag gemäß § 313 BGB (Störung der Geschäftsgrundlage) ernsthaft in Erwägung zu ziehen.
• Stattdessen entschied die Geschäftsführung des BLB NRW, die betreffenden Flächen von der Investorin für 29,9 Mio. € zu erwerben und die Baumaßnahme in Eigenregie zu realisieren. Die Angemessenheit des insgesamt an die Investorin gezahlten Betrags von 29,9 Mio. €, aufgeteilt in 17,6 Mio. € Grundstückskaufpreis, 4 Mio. € für Vorleistungen der Projektplanung und –realisierung und 8,3 Mio. € für die Aufgabe der Vermieterstellung, ist nicht nachvollziehbar und entbehrt jeglicher soliden wirtschaftlichen Grundlage. Allein der als reiner Grundstückskaufpreis bezeichnete Teilbetrag von 17,6 Mio. € stand in keinem Verhältnis zu einem gutachterlich festgestellten Verkehrswert von rd. 6,1 Mio. €. Damit hat der BLB NRW in massiver Weise gegen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 7 LHO) verstoßen.
• Ob die Fortführung des Projektes an dem von der Staatskanzlei gewünschten Standort unabhängig von wirtschaftlichen Erwägungen vor allem auf dem Motiv beruhte, das Prestigeprojekt im Duisburger Innenhafen nicht gänzlich verwerfen zu müssen oder ob hier noch andere sachfremde Interessen eine Rolle gespielt haben, konnte der LRH anhand der wenigen vorhandenen Unterlagen und Aufzeichnungen nicht aufklären.
• Der Verwaltungsrat des BLB NRW wurde von der Geschäftsleitung weder zutreffend noch umfassend und zeitgerecht über das von ihm zu genehmigende Investitionsvorhaben informiert. Hierdurch war das Vorhaben einer differenzierten Beurteilung durch den Verwaltungsrat entzogen. ...."
Quelle: Prüfungsbericht des Landesrechnungshofes Nordrhein-Westfalen v. 28.11.11
Medienreaktionen:
"BLB-Skandal: Prüfbericht setzt Rütgers’ Staatskanzlei unter Druck", WAZRechercheblog, 01.12.11
bild.de, Regional Düsseldorf, 01.12.11
WDR.de, nrwkompakt Kurznachrichten, 01.12.11
"Landesrechnungshof bestätigt Schlamperei", WDR 5 Westblick, Beitrag von Leo Flamm (3min 24)
".... Es ist nicht vorstellbar, dass ein derartiges Mismanagement ausschließlich die Folge von Schlampigkeit, Gleichgültigkeit und Unfähigkeit ist. Der Verdacht drängt sich auf, dass es hier um kriminelle Machenschaften geht, dass Schmiergelder geflossen sind. ....", Peter Jansen, Kommentar in der Neuen Westfälischen, 1.12.11
Politische Reaktion:
Michael Aggelidis, Schallende Ohrfeige für BLB vom Landesrechnungshof, Die Linke, Landtagsfraktion, 01.12.11
s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg
Wolf Thomas - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 18:18 - Rubrik: Staatsarchive
Zusammengestellt von Jeffrey Beal, dem führenden Forscher auf diesem Gebiet:
http://metadata.posterous.com/83235355
Siehe hier
http://archiv.twoday.net/search?q=predatory
http://metadata.posterous.com/83235355
Siehe hier
http://archiv.twoday.net/search?q=predatory
KlausGraf - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 17:18 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.archiv.sachsen.de/download/Archivblatt_2_2011.pdf
U.a. mit einem Bericht über die Dresdner Tagung der Medienarchivare im Mai dieses Jahres.
U.a. mit einem Bericht über die Dresdner Tagung der Medienarchivare im Mai dieses Jahres.
ingobobingo - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 16:21 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"An die Bundesregierung
BMBF
Forschungsausschuss des Bundestags
8. Forschungsrahmenprogramm HORIZON 2020 - ohne Kulturerbeforschung?
Wir können auf mittlerweile über 25 Jahre erfolgreicher Kulturerbeforschung zurückblicken. Das ist ein großer Erfolg für Europa. Dieses Programm ist weltweit einzigartig und ohnegleichen.
Für diese Leistungen, die Europa auf diesem Gebiet erbringt, beneiden uns alle anderen Kontinente. Das unterstreicht die Bedeutung unseres reichen kulturellen Erbes. Aus diesem Grund ist Europa das Touristenziel Nummer Eins. Um dies auch aufrecht zu erhalten, ist Forschung zur nachhaltigen Bewahrung dieses unwiederbringlichen Kulturgutes eine zwingend erforderliche Grundlage.
Im Vorschlag der Europäischen Kommission zum 8. Forschungsrahmenprogramm – HORIZON 2020 - ist Kulturerbe komplett gestrichen. Damit wird dem Kulturguterhalt die notwendige Grundlage entzogen. Kann sich Europa das tatsächlich leisten? Können wir auf den Wirtschaftsfaktor Kulturtourismus einfach verzichten? Ist uns unser kulturelles Erbe nichts mehr wert?
Im letzten Rahmenprogramm war Deutschland die zweiterfolgreichste Nation in der Einwerbung der Forschungsgelder. Als Beispiele der herausragenden Projekte möchten wir nennen:
SMOOHS, Laufzeit: 2008-2011, Projekt Nr. 212939
Climate for Culture, Laufzeit: 2009-2014, Projekt Nr. 226973
Die Streichung der Kulturerbeforschung ist ein verheerendes Signal für das Ansehen Europas als der Kulturkontinent schlechthin. Deshalb sprechen sich die Unterzeichner dafür aus, unser kulturelles Gedächtnis nicht aufs Spiel zu setzen. Wir bitten Sie, uns dabei zu unterstützen, Kulturerbeforschung im 8. Forschungsrahmenprogramm weiterhin zu fördern.
Begründung: Die Europäische Kommission möchte den Bereich der Kulturerbeforschung im kommenden 8. Forschungsrahmenprogramm "HORIZON 2020" komplett streichen!
Das ist verheerend, denn damit wird dem Kulturguterhalt in Europa für lange Zeit die notwendige Grundlage entzogen!
In diesem Jahr können wir bereits auf 25 Jahre erfolgreiche Forschung im Sektor der Kulturguterhaltung zurückblicken. Dabei wurden in den Europäischen Rahmenprogrammen bislang 41 internationale Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 40 Millionen Euro unterstützt. Darunter groß angelegte Forschungs- und Anwendungsprojekte, in denen die Forschungspartner gemeinsam Strategien für den langfristigen Erhalt von historischen Stätten entworfen haben und in denen konkrete Lösungen für Museen, wie beispielsweise Vermeidung von Gefährdungsfaktoren in der musealen Präsentation, Massenentsäuerungen von Papieren und andere prinzipielle konservatorische Fragestellungen entwickelt wurden und werden.
Die bisherigen Forschungsrahmenprogramme ermöglichten eine einzigartige Vernetzung der europäischen Fachkompetenzen und die Beantwortung gemeinsamer, dringlicher Fragestellungen. Die wirtschaftliche Bedeutung des europäischen Kulturerbes konnte vermittelt und Erhaltungsstrategien für umweltgeschädigte Kulturgüter mit Hilfe neuester Forschungsergebnisse in den Mittelpunkt gerückt werden. Zudem es war möglich, das Anliegen einer profunden Restauratoren-Ausbildung in einmaliger Weise länderübergreifend zu transportieren.
Das darf mit Ablauf des 7. Forschungsrahmenprogramms (2007-2013) nicht vorbei sein!
Europa ist weiterhin auf diese Forschungsgelder angewiesen. Denn nur so sind wir finanziell in der Lage, Methoden und Produkte zu entwickeln, die Restauratoren in ganz Europa dringend für die Bewahrung der ihnen anvertrauten, unwiederbringlichen Kulturgüter benötigen. Ohne Forschung geben wir Kulturgüter dem Verfall preis. Kulturgüter sind aber wesentliche Identitätsstifter und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, vor allem in Europa, dem Kulturkontinent schlechthin und dem Touristenziel Nummer Eins.
Bereits jetzt gehen jährlich kulturelle Ressourcen im Wert von 14 Milliarden Euro verloren. Das kulturelle Erbe ist auch durch den Einfluß des Klimawandels gefährdet. Dem weiteren Verfall muss durch die Entwicklung gemeinsamer Erhaltungsstrategien für die Zukunft entgegengewirkt werden. Dafür benötigen wir dringend die Unterstützung des 8. Forschungsrahmenprogramms HORIZON 2020, das von 2014 bis 2020 laufen wird.
Bitte unterstützen Sie die Petition mit Ihrer Stimme!
Die Unterschriftenliste soll gemeinsam mit dem oben stehenden Brief an Vertreter aus der Regional-, Landes- und Bundespolitik sowie aus der Europäischen Kommission weitergeleitet werden.
Im Namen aller Unterzeichner.
Bonn, 23.11.2011 (aktiv bis 03.01.2012) "
Wir sollten unser Kolleginnen und Kollegen bei ihrem Anliegen unterstützen. Der Link zur Petition:
http://openpetition.de/petition/online/horizon-2020-streichung-der-kulturerbeforschung
BMBF
Forschungsausschuss des Bundestags
8. Forschungsrahmenprogramm HORIZON 2020 - ohne Kulturerbeforschung?
Wir können auf mittlerweile über 25 Jahre erfolgreicher Kulturerbeforschung zurückblicken. Das ist ein großer Erfolg für Europa. Dieses Programm ist weltweit einzigartig und ohnegleichen.
Für diese Leistungen, die Europa auf diesem Gebiet erbringt, beneiden uns alle anderen Kontinente. Das unterstreicht die Bedeutung unseres reichen kulturellen Erbes. Aus diesem Grund ist Europa das Touristenziel Nummer Eins. Um dies auch aufrecht zu erhalten, ist Forschung zur nachhaltigen Bewahrung dieses unwiederbringlichen Kulturgutes eine zwingend erforderliche Grundlage.
Im Vorschlag der Europäischen Kommission zum 8. Forschungsrahmenprogramm – HORIZON 2020 - ist Kulturerbe komplett gestrichen. Damit wird dem Kulturguterhalt die notwendige Grundlage entzogen. Kann sich Europa das tatsächlich leisten? Können wir auf den Wirtschaftsfaktor Kulturtourismus einfach verzichten? Ist uns unser kulturelles Erbe nichts mehr wert?
Im letzten Rahmenprogramm war Deutschland die zweiterfolgreichste Nation in der Einwerbung der Forschungsgelder. Als Beispiele der herausragenden Projekte möchten wir nennen:
SMOOHS, Laufzeit: 2008-2011, Projekt Nr. 212939
Climate for Culture, Laufzeit: 2009-2014, Projekt Nr. 226973
Die Streichung der Kulturerbeforschung ist ein verheerendes Signal für das Ansehen Europas als der Kulturkontinent schlechthin. Deshalb sprechen sich die Unterzeichner dafür aus, unser kulturelles Gedächtnis nicht aufs Spiel zu setzen. Wir bitten Sie, uns dabei zu unterstützen, Kulturerbeforschung im 8. Forschungsrahmenprogramm weiterhin zu fördern.
Begründung: Die Europäische Kommission möchte den Bereich der Kulturerbeforschung im kommenden 8. Forschungsrahmenprogramm "HORIZON 2020" komplett streichen!
Das ist verheerend, denn damit wird dem Kulturguterhalt in Europa für lange Zeit die notwendige Grundlage entzogen!
In diesem Jahr können wir bereits auf 25 Jahre erfolgreiche Forschung im Sektor der Kulturguterhaltung zurückblicken. Dabei wurden in den Europäischen Rahmenprogrammen bislang 41 internationale Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 40 Millionen Euro unterstützt. Darunter groß angelegte Forschungs- und Anwendungsprojekte, in denen die Forschungspartner gemeinsam Strategien für den langfristigen Erhalt von historischen Stätten entworfen haben und in denen konkrete Lösungen für Museen, wie beispielsweise Vermeidung von Gefährdungsfaktoren in der musealen Präsentation, Massenentsäuerungen von Papieren und andere prinzipielle konservatorische Fragestellungen entwickelt wurden und werden.
Die bisherigen Forschungsrahmenprogramme ermöglichten eine einzigartige Vernetzung der europäischen Fachkompetenzen und die Beantwortung gemeinsamer, dringlicher Fragestellungen. Die wirtschaftliche Bedeutung des europäischen Kulturerbes konnte vermittelt und Erhaltungsstrategien für umweltgeschädigte Kulturgüter mit Hilfe neuester Forschungsergebnisse in den Mittelpunkt gerückt werden. Zudem es war möglich, das Anliegen einer profunden Restauratoren-Ausbildung in einmaliger Weise länderübergreifend zu transportieren.
Das darf mit Ablauf des 7. Forschungsrahmenprogramms (2007-2013) nicht vorbei sein!
Europa ist weiterhin auf diese Forschungsgelder angewiesen. Denn nur so sind wir finanziell in der Lage, Methoden und Produkte zu entwickeln, die Restauratoren in ganz Europa dringend für die Bewahrung der ihnen anvertrauten, unwiederbringlichen Kulturgüter benötigen. Ohne Forschung geben wir Kulturgüter dem Verfall preis. Kulturgüter sind aber wesentliche Identitätsstifter und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, vor allem in Europa, dem Kulturkontinent schlechthin und dem Touristenziel Nummer Eins.
Bereits jetzt gehen jährlich kulturelle Ressourcen im Wert von 14 Milliarden Euro verloren. Das kulturelle Erbe ist auch durch den Einfluß des Klimawandels gefährdet. Dem weiteren Verfall muss durch die Entwicklung gemeinsamer Erhaltungsstrategien für die Zukunft entgegengewirkt werden. Dafür benötigen wir dringend die Unterstützung des 8. Forschungsrahmenprogramms HORIZON 2020, das von 2014 bis 2020 laufen wird.
Bitte unterstützen Sie die Petition mit Ihrer Stimme!
Die Unterschriftenliste soll gemeinsam mit dem oben stehenden Brief an Vertreter aus der Regional-, Landes- und Bundespolitik sowie aus der Europäischen Kommission weitergeleitet werden.
Im Namen aller Unterzeichner.
Bonn, 23.11.2011 (aktiv bis 03.01.2012) "
Wir sollten unser Kolleginnen und Kollegen bei ihrem Anliegen unterstützen. Der Link zur Petition:
http://openpetition.de/petition/online/horizon-2020-streichung-der-kulturerbeforschung
Wolf Thomas - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 12:17 - Rubrik: Bestandserhaltung
Die Proceedings des Infotags zur elektronischen Signatur des Fachverbands TeleTrust sind online: Infos elektronische Signatur
schwalm.potsdam - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 11:48 - Rubrik: E-Government
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sicherheit und Vertrauen im E-Government gewinnt im Kontext Datenaustausch, Datenverfügbarkeit, digitale Identitäten etc. immer mehr an Bedeutung. Nachstehend ein Link zu einer Studie in diesem Kontext: Vertrauen im E-Government
schwalm.potsdam - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 11:35 - Rubrik: E-Government
"13. Januar 09.00 Uhr, ganztägig
06. Februar 09.00 Uhr, ganztägig
10. Februar 09.00 Uhr, ganztägig
29. Februar 09.00 Uhr, ganztägig
08. März 08.00 - 12.30 Uhr
20. März 13.00 Uhr, ganztägig
26. März 09.00 Uhr, ganztägig
17. April 13.00 Uhr, ganztägig
24. April 13.00 Uhr, ganztägig
09. Mai 09.00 Uhr, ganztägig
14. Mai 09.00 Uhr, ganztägig
05. Juni 13.00 Uhr, ganztägig
14. Juni 08.00 - 12.30 Uhr
22. Juni 09.00 Uhr, ganztägig
25. Juni 09.00 Uhr, ganztägig
29. Juni 09.00 Uhr, ganztägig
03. Juli 13.00 Uhr, ganztägig"
Hoffentlich ergiebig zum Thema ....
s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg
Quelle: Terminplan PUA I
06. Februar 09.00 Uhr, ganztägig
10. Februar 09.00 Uhr, ganztägig
29. Februar 09.00 Uhr, ganztägig
08. März 08.00 - 12.30 Uhr
20. März 13.00 Uhr, ganztägig
26. März 09.00 Uhr, ganztägig
17. April 13.00 Uhr, ganztägig
24. April 13.00 Uhr, ganztägig
09. Mai 09.00 Uhr, ganztägig
14. Mai 09.00 Uhr, ganztägig
05. Juni 13.00 Uhr, ganztägig
14. Juni 08.00 - 12.30 Uhr
22. Juni 09.00 Uhr, ganztägig
25. Juni 09.00 Uhr, ganztägig
29. Juni 09.00 Uhr, ganztägig
03. Juli 13.00 Uhr, ganztägig"
Hoffentlich ergiebig zum Thema ....
s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg
Quelle: Terminplan PUA I
Wolf Thomas - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 11:32 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Oberbürgermeister Jürgen Roters gibt am 1. Dezember 2011 einen Empfang für den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Stadtgedächtnis, Dr. Stefan Lafaire. Dieser hat seine Arbeit am 1. Oktober 2011 aufgenommen. Roters möchte seinen Gästen aus Politik, Kultur, Medien und Wirtschaft die Gelegenheit geben, Dr. Lafaire auf dem Empfang persönlich kennen zu lernen. ......"
Quelle: Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadt Köln, 30.11.11
Quelle: Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadt Köln, 30.11.11
Wolf Thomas - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 10:27 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Zum mittlerweile sechsten Mal veröffentlichen das Historische Archiv und sein Förderverein "Freunde des Historischen Archivs der Stadt Köln" das "Kölner Kalendarium".
Der Kalender für das Jahr 2012 ist den Bewahrerinnen und Bewahrern des Kölner Gedächtnisses gewidmet:
Kulturinstitutionen in ganz Deutschland, die mit ihrer vielfältigen und umfangreichen Hilfe während der Bergung, bei der Gewährung von Asyl für das beschädigte Archivgut sowie der Restaurierung und Digitalisierung der Dokumente den kollektiven Gedächtnisverlust Kölns nach dem Einsturz verhinderten und verhindern. Das Kalendarium 2012 gibt einen faszinierenden Einblick in die bunten und vielfältigen Bestände und Sammlungen der beteiligten Archive, Bibliotheken und Museen.
Das Kalendarium mit dem Titel "Von Helfern und Schätzen" ist zum Preis von 9,95 Euro in einzelnen Kölner Buchhandlungen, über KölnTourismus und hier erhältlich:
Historisches Archiv
Lesesaal
Heumarkt 14
50667 Köln
(montags geschlossen)Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
Katasterservice
Zimmer 06D01
Willy-Brandt-Platz 2
50679 Köln
Sie können es zudem per E-Mail bestellen"
Quelle: Mitteilung des Historischen Archivs der Stadt Köln
Wolf Thomas - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 10:22 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 05:37 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das 1967 erschienene Buch von Hermann Nehlsen ist online:
http://epub.ub.uni-muenchen.de/9423/
Ebenso wie einige seiner rechtshistorischen Aufsätze (aaO).
http://epub.ub.uni-muenchen.de/9423/
Ebenso wie einige seiner rechtshistorischen Aufsätze (aaO).
KlausGraf - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 03:37 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Universitätsarchiv Würzburg stellt Angebote der einzelnen Fakultäten/Institute zu ihrer Geschichte zusammen:
http://www.uniarchiv.uni-wuerzburg.de/portal_universitaetsgeschichte/
http://www.uniarchiv.uni-wuerzburg.de/portal_universitaetsgeschichte/
KlausGraf - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 03:22 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Mein Beitrag http://archiv.twoday.net/stories/5878332/ stützte sich auf das Regest einer Georgianums-Urkunde. Inzwischen ist das aufschlussreiche Stück online:
http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/DE-AHGM/Urkunden/AHG_I_8%2860%7C148%29/charter
http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/DE-AHGM/Urkunden/AHG_I_8%2860%7C148%29/charter
KlausGraf - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 03:09 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wie Elsevier sich fremde Arbeitsergebnisse aneignet, Data-mining verbietet und Versprechen bricht, schildert Peter Murray Rust:
http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2011/11/27/textmining-my-years-negotiating-with-elsevier/
http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2011/11/27/textmining-my-years-negotiating-with-elsevier/
KlausGraf - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 02:42 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Falk Eisermann wies mich auf dieses neue Blog hin, das den Versuch unternimmt, Forschungsnotizen aus dem Feld der Buchgeschichte zu publizieren:
http://researchfragments.blogspot.com/
Ein Beitrag widmet sich Dietrich von Zengg, zu dem ich unter
http://de.wikisource.org/wiki/Dietrich_von_Zengg
die Überlieferung zusammengestellt habe.
http://researchfragments.blogspot.com/
Ein Beitrag widmet sich Dietrich von Zengg, zu dem ich unter
http://de.wikisource.org/wiki/Dietrich_von_Zengg
die Überlieferung zusammengestellt habe.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Otto ist einer der besten Kenner digitaler Bibliotheken weltweit, was Archivalia-LeserInnen sicher schon wissen.
https://twitter.com/#!/Rechtshistorie
Via
http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2011/11/30/news-on-legal-history/
https://twitter.com/#!/Rechtshistorie
Via
http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2011/11/30/news-on-legal-history/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 Während sich andere deutsche Stadtbibliotheken mit wertvollem Altbestand noch sehr zurückhalten, was die Digitalisierung ihrer Bestände angeht (um es adventsmäßig zurückhaltend auszudrücken), beteiligt sich die Stadtbibliothek Mainz - sie macht derzeit ja Schlagzeilen - am (auch sonst sehr reichhaltigen) rheinland-pfälzischen Digitalisierungsportal Dilibri mit einer kleinen, aber feinen Sammlung (derzeit 54 Titel):
Während sich andere deutsche Stadtbibliotheken mit wertvollem Altbestand noch sehr zurückhalten, was die Digitalisierung ihrer Bestände angeht (um es adventsmäßig zurückhaltend auszudrücken), beteiligt sich die Stadtbibliothek Mainz - sie macht derzeit ja Schlagzeilen - am (auch sonst sehr reichhaltigen) rheinland-pfälzischen Digitalisierungsportal Dilibri mit einer kleinen, aber feinen Sammlung (derzeit 54 Titel):http://www.dilibri.de/stbmz/nav/history
Der Schwerpunkt liegt auf seltenen Werken. Neben einigen frühneuzeitlichen Drucken gibt es beispielsweise etliche rare Mainzer Karnevalszeitungen.
Unser Bild stammt aus: Juwelenkästchen für Kinder, die gut und brav werden wollen von Kathinka Zitz (1862). Es ist mit über 70 weiteren Bildern auch in der sehenswerten Bildersammlung zur Stadtbibliothek Mainz auf Wikimedia Commons verfügbar. Digitalisate zur Geschichte der Stadtbibliothek listet Wikisource auf.
Alle Türchen 2011

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 00:00 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 Auch dieses Jahr soll es wieder einen Archivalia-Adventskalender geben, wenngleich nicht ganz so aufwändig wie derjenige des Jahres 2010. Es gibt jeweils ein Bild aus einer digitalen Sammlung (Bibliotheken und Archive), verbunden mit einem Kurzporträt derselben. Wer es bunter gemischt liebt, findet täglich auf
Auch dieses Jahr soll es wieder einen Archivalia-Adventskalender geben, wenngleich nicht ganz so aufwändig wie derjenige des Jahres 2010. Es gibt jeweils ein Bild aus einer digitalen Sammlung (Bibliotheken und Archive), verbunden mit einem Kurzporträt derselben. Wer es bunter gemischt liebt, findet täglich aufhttp://archivalia.tumblr.com/
Sehens- oder Hörenswertes.
Wie letztes Jahr und schon 2008 darf geneigte(r) Leser(in) nicht erwarten, dass Punkt Null Uhr der Beitrag bereits bereitgestellt ist.
(Dies ist nicht das erste Türchen, erst in einigen Stunden ist es so weit ...)
Wer den Kalender verlinken möchte, wählt bitte folgenden Link:
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+2011+t%C3%BCrchen
Das diesjährige Logo, eine Art Stern, stammt aus der Anjou-Bibel:
http://bibliodyssey.blogspot.com/2011/11/royal-anjou-bible.html
 Seite aus einem Psalterium. 15. Jahrhundert. Provenienz: Mainzer Kartäuserkloster. Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz. Signatur: Hs II 141 (folio 10 recto)
Seite aus einem Psalterium. 15. Jahrhundert. Provenienz: Mainzer Kartäuserkloster. Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz. Signatur: Hs II 141 (folio 10 recto)KlausGraf - am Mittwoch, 30. November 2011, 21:40 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Still und ohne Kommentar verschwindet dieses auch archivische Weblog.
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/38764387/
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/38764387/
Wolf Thomas - am Mittwoch, 30. November 2011, 21:40 - Rubrik: Weblogs
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Immer wieder reißen im Gebiet spontan Krater auf und verschlingen die Oberfläche. An den Rändern vermischen sich Untergrund-Geräusche mit dem urbanen Geschehen oberhalb. Anhand der Tonaufnahmen lässt sich nicht immer genau unterscheiden, was „untertage“ und was „übertage“ aufgezeichnet wurde.
Frank Niehusmann hat zum „Kulturhauptstadtjahr“ 2010 im Ruhrgebiet zahlreiche Tonaufnahmen gemacht. Seine Bearbeitungen dieses Klangmaterials sind akustische „Übermalungen“ und tontechnische „Frottagen“. Für „Das Gebiet“ bringt er dazu „Untertage“-Originaltöne ins Spiel – und Kurztexte, die das Gebiet „übertage“ und seine „Bergschäden“ protokollieren.
Frank Niehusmann; Rechte: Stephan von Knobloch
Bild vergrößern
Frank Niehusmann, geboren 1960 in Essen, Studium der Philosophie und Geschichte an der Ruhr-Universität in Bochum. Seit 1978 elektronische Komposition, Performances, Theatermusiken, Hörspiel und Mixed-Media Aktivitäten. Lebt in Velbert.
von Frank Niehusmann
Realisation: der Autor
Produktion: WDR 2011/52’
Redaktion: Markus Heuger
Das Hörstück steht nach der Ausstrahlung befristet zum kostenlosen DOWNLOAD im Internet.
Die nächsten Sendungen
09.12.2011
Bielefeld. Jahnplatz
Von Andreas und Matthias Hornschuh
16.12.2011
Bonnhören I und II
Von Sam Auinger und Erwin Stache
23.12.2011
Cäcilia: Ausgeplündert. Ein Besuch bei der Heiligen
Von Mauricio Kagel
"
Frank Niehusmann hat zum „Kulturhauptstadtjahr“ 2010 im Ruhrgebiet zahlreiche Tonaufnahmen gemacht. Seine Bearbeitungen dieses Klangmaterials sind akustische „Übermalungen“ und tontechnische „Frottagen“. Für „Das Gebiet“ bringt er dazu „Untertage“-Originaltöne ins Spiel – und Kurztexte, die das Gebiet „übertage“ und seine „Bergschäden“ protokollieren.
Frank Niehusmann; Rechte: Stephan von Knobloch
Bild vergrößern
Frank Niehusmann, geboren 1960 in Essen, Studium der Philosophie und Geschichte an der Ruhr-Universität in Bochum. Seit 1978 elektronische Komposition, Performances, Theatermusiken, Hörspiel und Mixed-Media Aktivitäten. Lebt in Velbert.
von Frank Niehusmann
Realisation: der Autor
Produktion: WDR 2011/52’
Redaktion: Markus Heuger
Das Hörstück steht nach der Ausstrahlung befristet zum kostenlosen DOWNLOAD im Internet.
Die nächsten Sendungen
09.12.2011
Bielefeld. Jahnplatz
Von Andreas und Matthias Hornschuh
16.12.2011
Bonnhören I und II
Von Sam Auinger und Erwin Stache
23.12.2011
Cäcilia: Ausgeplündert. Ein Besuch bei der Heiligen
Von Mauricio Kagel
"
Wolf Thomas - am Mittwoch, 30. November 2011, 21:28 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ich fand Karl Bosl als Historiker immer extrem überschätzt. Aber da er gut vernetzt war, galt er lange Zeit als "der" lebende bayerische Historiker.
Richard Hölzl berichtet nun:
Wie die Süddeutsche Zeitung (sueddeutsche.de, 29.11.2011, 12:20) gestern berichtete und der Nachrichtendienst für Historiker verlinkte, hat der Stadtrat von Cham vergangene Woche beschlossen Karl Bosl (1908-1993) die Ehrungen durch seine Geburtsstadt abzuerkennen. Ummittelbar danach wurde das Straßenschild des nun ehemaligen Prof.-Karl-Bosl-Platzes abmontiert. Gleiches soll mit einer 50.000 Euro teueren Bronzebüste Bosls geschehen, die die Stadt 2003 aufgestellt hatte. Zuvor hatte der Stadtrat den Stadtarchivar Timo Bullemer beauftragt, Vorwürfe zu prüfen, Bosl habe seine Rolle als Widerstandskämpfer während der NS-Zeit erfunden.
Bosl – Erneuerer der Bayerischen Landesgeschichte im Sinne einer Struktur- und Sozialgeschichte in den 1950er und 60er Jahren - war seit 1930 Mitglied des Stahlhelm gewesen, im Mai 1933 in die NSDAP, in den NS-Lehrerbund und danach auch in die SA eingetreten. Der Historiker Matthias Berg verweist in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft darauf, dass Bosl zunächst keine aktive Rolle in den NS-Organisationen eingenommen habe, die Mitgliedschaft sogar nach Wohnungswechseln einschlafen ließ. Nach seiner Promotion 1938 allerdings erwies sich Bosl als linientreuer Nachwuchsforscher und übernahm ein Forschungsprojekt des SS-Ahnenerbes zur Lehensgeschichte. Dass dem jungen Bosl keine Dozentur zuerkannt wurde, lag viel eher daran, dass das Kriegsende nahte, als an einer vermeintlich Widerstandstätigkeit, wie Bosl nach 1945 vorgab. Um eine Einstufung als ‘Mitläufer’ zu verhindern, gab Bosl unter Eidesstatt an, er sei Mitglied des Ansbacher Widerstands gewesen. Zeugen oder Quellenbelege gibt es dafür keine. Im Gegenteil deuten die von Berg untersuchten Akten auf eine ‘mustergültige’ Wissenschaftlerkarriere und Vernetzung im NS-Wissenschaftsapparat hin, die vor allem über die Beziehung zu seinem Lehrer Karl-Alexander v. Müller ging.
Vgl. Matthias Berg, Lehrjahre eines Historikers. Karl Bosl im Nationalsozialismus, in: ZfG 59 (2011) 1, S. 45-63.
http://kritischegeschichte.wordpress.com/2011/11/30/karl-bosl-in-cham-abmontiert/
Siehe auch
http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/ein_nazi_und_sein_schueler_karl_bosl_und_wolfgang_benz/
Zur Rolle des Stadtarchivars, der 2003 eine Eloge auf Bosl verfasste:
http://www.sueddeutsche.de/n5I387/344095/Erst-die-Eloge-jetzt-die-Abrechnung.html
Das Gutachten des Stadtarchivars
http://www.cham.de/deCham/kulturbildung/stadtarchiv/geschichte/Bosl-Recherche-Bericht-2.pdf
 Buch, erschienen in Jerusalem 2011
Buch, erschienen in Jerusalem 2011
Richard Hölzl berichtet nun:
Wie die Süddeutsche Zeitung (sueddeutsche.de, 29.11.2011, 12:20) gestern berichtete und der Nachrichtendienst für Historiker verlinkte, hat der Stadtrat von Cham vergangene Woche beschlossen Karl Bosl (1908-1993) die Ehrungen durch seine Geburtsstadt abzuerkennen. Ummittelbar danach wurde das Straßenschild des nun ehemaligen Prof.-Karl-Bosl-Platzes abmontiert. Gleiches soll mit einer 50.000 Euro teueren Bronzebüste Bosls geschehen, die die Stadt 2003 aufgestellt hatte. Zuvor hatte der Stadtrat den Stadtarchivar Timo Bullemer beauftragt, Vorwürfe zu prüfen, Bosl habe seine Rolle als Widerstandskämpfer während der NS-Zeit erfunden.
Bosl – Erneuerer der Bayerischen Landesgeschichte im Sinne einer Struktur- und Sozialgeschichte in den 1950er und 60er Jahren - war seit 1930 Mitglied des Stahlhelm gewesen, im Mai 1933 in die NSDAP, in den NS-Lehrerbund und danach auch in die SA eingetreten. Der Historiker Matthias Berg verweist in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft darauf, dass Bosl zunächst keine aktive Rolle in den NS-Organisationen eingenommen habe, die Mitgliedschaft sogar nach Wohnungswechseln einschlafen ließ. Nach seiner Promotion 1938 allerdings erwies sich Bosl als linientreuer Nachwuchsforscher und übernahm ein Forschungsprojekt des SS-Ahnenerbes zur Lehensgeschichte. Dass dem jungen Bosl keine Dozentur zuerkannt wurde, lag viel eher daran, dass das Kriegsende nahte, als an einer vermeintlich Widerstandstätigkeit, wie Bosl nach 1945 vorgab. Um eine Einstufung als ‘Mitläufer’ zu verhindern, gab Bosl unter Eidesstatt an, er sei Mitglied des Ansbacher Widerstands gewesen. Zeugen oder Quellenbelege gibt es dafür keine. Im Gegenteil deuten die von Berg untersuchten Akten auf eine ‘mustergültige’ Wissenschaftlerkarriere und Vernetzung im NS-Wissenschaftsapparat hin, die vor allem über die Beziehung zu seinem Lehrer Karl-Alexander v. Müller ging.
Vgl. Matthias Berg, Lehrjahre eines Historikers. Karl Bosl im Nationalsozialismus, in: ZfG 59 (2011) 1, S. 45-63.
http://kritischegeschichte.wordpress.com/2011/11/30/karl-bosl-in-cham-abmontiert/
Siehe auch
http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/ein_nazi_und_sein_schueler_karl_bosl_und_wolfgang_benz/
Zur Rolle des Stadtarchivars, der 2003 eine Eloge auf Bosl verfasste:
http://www.sueddeutsche.de/n5I387/344095/Erst-die-Eloge-jetzt-die-Abrechnung.html
Das Gutachten des Stadtarchivars
http://www.cham.de/deCham/kulturbildung/stadtarchiv/geschichte/Bosl-Recherche-Bericht-2.pdf
 Buch, erschienen in Jerusalem 2011
Buch, erschienen in Jerusalem 2011KlausGraf - am Mittwoch, 30. November 2011, 19:34 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist urheberrechtlich geschützt, so dass ein Teilabriss einen Eingriff in die Urheberpersönlichkeitsrechte darstellen kann. Allerdings sind im Rahmen der gebotenen Abwägung der betroffenen Interessen des Urhebers einerseits und des Eigentümers andererseits den urheberpersönlichkeitsrechtlichen Interessen des Urhebers nach seinem Tode ein geringeres Gewicht als zu seinen Lebzeiten beizumessen."
http://www.kanzlei.biz/nc/urteile/09-11-2011-bgh-az-i-zr-216-10.html
Siehe schon
http://archiv.twoday.net/stories/8382202/
http://www.kanzlei.biz/nc/urteile/09-11-2011-bgh-az-i-zr-216-10.html
Siehe schon
http://archiv.twoday.net/stories/8382202/
KlausGraf - am Mittwoch, 30. November 2011, 19:31 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
".... Eine Bürgerversammlung zum Neubau des Historischen Archivs am Eifelwall und einen fraktions-übergreifenden Antrag für eine bessere Anbindung der geplanten Grünanlage an den bestehenden Grüngürtel - diese Zusagen nahmen Vertreter der Bürgerinitiative Eifelwall von einem Treffen in der Bezirksverwaltung Innenstadt mit. Die Bürgerinitiative befürchtet, durch den geplanten, 140 Meter langen Neubau entlang der Straße werde den Anwohnern das Licht genommen, Lärm und Abgase nähmen zu, und Parkmöglichkeiten fielen weg. Alternativ schlägt die Initiative vor, den Neubau an gleicher Stelle, aber parallel zur Luxemburger Straße zu errichten.
Das aber lehnten Bezirksbürgermeister Andreas Hupke und Vertreter der Verwaltung vehement ab. Dies sei "völlig undenkbar", so Hupke, und werde nur dazu führen, dass auf der Restfläche Gebäude statt Grünflächen entstünden. Der quer zum Grüngürtel liegende Riegel widerspräche zudem dem Masterplan für Köln und den ursprünglichen Plänen zur Anlage der Kölner Neustadt, hieß es. Felix Waechter, Gewinner des Architektenwettbewerbs um den Neubau, versprach, dass sein Gebäude mit 13,50 Meter sehr viel niedriger ausfallen werde als die Bürgerinitiative angenommen hatte, die von 18 Metern ausgegangen war. Sein Anliegen sei es gewesen, so niedrig wie möglich zu bauen, eine von ihm erstellte Schattensimulation sollte zeigen, dass der vorhandenen Wohnbebauung kaum Sonne genommen werde. Auch der fensterlose "Schrein" im Inneren des Gebäudekomplexes, in dem die Archivalien aufbewahrt werden sollen, werde von der Straße aus nicht zu sehen sein.
Schwierigkeiten sahen alle Beteiligten bei der Anbindung der neuen Grünfläche an den bestehenden Grüngürtel, da die Luxemburger Straße hier wie eine gewaltige Schneise wirke. Anwesende Politiker der Grünen und der CDU wollen deswegen in einem gemeinsamen Antrag die Verwaltung mit der Suche nach Lösungen beauftragen. Rolf Tepel, ein Künstler, der auf dem Gelände am Eifelwall an einem Gesamtkunstwerk arbeitet, warf der Stadt vor, ihren Versprechungen zur Öffnung gegenüber den Anliegen der Bürger, wie sie nach dem Einsturz des Archivs häufig abgegeben wurden, nicht gerecht geworden zu sein. Die richtige Antwort auf den Einsturz hätte eine offene und demokratische Diskussion über den Neubau sein müssen.
"Sie haben uns nicht restlos überzeugt", fasste auch Erhard Puhl von der Initiative das Ergebnis zusammen. Er vermisse eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Alternativvorschlag der Initiative und beklagte die Vertröstung auf zukünftige Lösungen. Am Dienstag soll eine Petition an Oberbürgermeister Jürgen Roters übergeben werden. "
Quelle: Rainer Rudolph, Kölner Stadt-Anzeiger, 28.11.11 - wie immer interessant der Kommentar!
Das aber lehnten Bezirksbürgermeister Andreas Hupke und Vertreter der Verwaltung vehement ab. Dies sei "völlig undenkbar", so Hupke, und werde nur dazu führen, dass auf der Restfläche Gebäude statt Grünflächen entstünden. Der quer zum Grüngürtel liegende Riegel widerspräche zudem dem Masterplan für Köln und den ursprünglichen Plänen zur Anlage der Kölner Neustadt, hieß es. Felix Waechter, Gewinner des Architektenwettbewerbs um den Neubau, versprach, dass sein Gebäude mit 13,50 Meter sehr viel niedriger ausfallen werde als die Bürgerinitiative angenommen hatte, die von 18 Metern ausgegangen war. Sein Anliegen sei es gewesen, so niedrig wie möglich zu bauen, eine von ihm erstellte Schattensimulation sollte zeigen, dass der vorhandenen Wohnbebauung kaum Sonne genommen werde. Auch der fensterlose "Schrein" im Inneren des Gebäudekomplexes, in dem die Archivalien aufbewahrt werden sollen, werde von der Straße aus nicht zu sehen sein.
Schwierigkeiten sahen alle Beteiligten bei der Anbindung der neuen Grünfläche an den bestehenden Grüngürtel, da die Luxemburger Straße hier wie eine gewaltige Schneise wirke. Anwesende Politiker der Grünen und der CDU wollen deswegen in einem gemeinsamen Antrag die Verwaltung mit der Suche nach Lösungen beauftragen. Rolf Tepel, ein Künstler, der auf dem Gelände am Eifelwall an einem Gesamtkunstwerk arbeitet, warf der Stadt vor, ihren Versprechungen zur Öffnung gegenüber den Anliegen der Bürger, wie sie nach dem Einsturz des Archivs häufig abgegeben wurden, nicht gerecht geworden zu sein. Die richtige Antwort auf den Einsturz hätte eine offene und demokratische Diskussion über den Neubau sein müssen.
"Sie haben uns nicht restlos überzeugt", fasste auch Erhard Puhl von der Initiative das Ergebnis zusammen. Er vermisse eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Alternativvorschlag der Initiative und beklagte die Vertröstung auf zukünftige Lösungen. Am Dienstag soll eine Petition an Oberbürgermeister Jürgen Roters übergeben werden. "
Quelle: Rainer Rudolph, Kölner Stadt-Anzeiger, 28.11.11 - wie immer interessant der Kommentar!
Wolf Thomas - am Mittwoch, 30. November 2011, 19:16 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Gründung des Vereins im Salon des Hotel Bogota, Berlin. Von links nach rechts, stehend: Denis Brudna, Frank Frischmuth, Alexander Koch, Norbert Waning, Jens Bove, Lutz Fischmann. Vordere Reihe: Enno Kaufhold, Anna Gripp, Christiane Stahl, Stefan Rohde-Enslin. Foto: Joachim Rissmann
"Die Zukunft vieler fotografischer Archivbestände ist offen. In den kommenden Jahren werden immer mehr Fotografen oder deren Erben nach einem Ort für die Sicherung ihrer Bilder suchen. Bisher ist es nicht gelungen, eine nationale Einrichtung für Archive und Nachlässe zu schaffen, was unter anderem in der föderalen Struktur Deutschlands begründet ist. Gleichwohl gibt es zahlreiche öffentliche und private Institutionen und Initiativen, die bereits heute wesentliche Archive und Nachlässe bewahren und vermitteln.
Um die verschiedenen Initiativen zu vernetzen und engagierte Kräfte zu bündeln wurde im Sommer 2011 auf Initiative von Photonews der gemeinnützige Verein Netzwerk Fotoarchive e.V. gegründet. Bedeutende Fotografenverbände und Fotografie-Vereine in Deutschland gehören zu den Gründungsmitgliedern. Geplant ist, Schritt für Schritt Informationen über bestehende Archive und Institutionen zu sammeln und diese der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Fotografen oder deren Erben soll bei der Suche nach einem Ort für ihre Bilder geholfen sowie Institutionen bei der Sicherung und Aufarbeitung einzelner Archive unterstützt werden.
Auch das Netzwerk Fotoarchive wird nicht für alle Archive eine Lösung finden können. Aber es kann dazu beitragen, dass die vielfältigen Initiativen hierzulande besser kooperieren, die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisiert und Außenstehenden bei Recherchen geholfen wird.
Gründungsmitglieder Netzwerk Fotoarchive e.V.:
Bund Freischaffender Foto-Designer e.V.,
vertreten durch den Geschäftsführer Norbert Waning
Bundesverband der Pressebild-Agenturen und Bildarchive e.V.,
vertreten durch den Geschäftsführer Alexander Koch
FREELENS e.V., vertreten durch den Geschäftsführer Lutz Fischmann
Deutsche Gesellschaft für Photographie e.V.,
vertreten durch die Stellvertretende Vorsitzende Dr. Christiane Stahl
Denis Brudna, Photonews-Verlag
Dr. Jens Bove, Deutsche Fotothek
Frank Frischmuth, ullstein bild
Anna Gripp, Photonews-Verlag
Dr. Enno Kaufhold, Fotohistoriker und Autor
Dr. Stephan Rohde-Enslin, Institut für Museumskunde (SMB-PK)"
Quelle: Homepage Netzwerk Fotoarchive e.V.
Wolf Thomas - am Mittwoch, 30. November 2011, 19:09 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Üblicherweise sind großangelegte Zeitungsdigitalisierungsunternehmen Open Access, nicht so im Vereinigten Königreich. (Wir erinnern uns: Auch das dortige Nationalarchiv zockt bei seinen Online-Angeboten in der Regel ab.) Die British Library verantwortet die Kostenpflichtigkeit des von einem kommerziellen Unternehmen betriebenen Zeitungsarchivs aus ihren Beständen.
"Halte ich übrigens für unerfreulich, dass das British Newspaper Archive kostenpflichtig ist!" Meint Tantner sehr zu Recht.
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/51315586/
Einen Zugang für 2 Tage gibts für gut 8 Euro. Hoffen wir, dass sich genügend Leute finden, die Scans gemeinfreier Zeitungen aus ihrem Gefängnis "befreien".
http://www.britishnewspaperarchive.co.uk/
Update:
http://www.reklamekasper.de/technologie/von-hirschau-in-die-british-library/
"Halte ich übrigens für unerfreulich, dass das British Newspaper Archive kostenpflichtig ist!" Meint Tantner sehr zu Recht.
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/51315586/
Einen Zugang für 2 Tage gibts für gut 8 Euro. Hoffen wir, dass sich genügend Leute finden, die Scans gemeinfreier Zeitungen aus ihrem Gefängnis "befreien".
http://www.britishnewspaperarchive.co.uk/
Update:
http://www.reklamekasper.de/technologie/von-hirschau-in-die-british-library/
KlausGraf - am Mittwoch, 30. November 2011, 18:32 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Eine bundesweit einmalige Sammlung von Dokumenten und medizinischen Instrumenten zur Behandlung von Tuberkulose bekommt eine neue Heimat.
Das Deutsche Tuberkulose-Archiv, das der pensionierte Lungenfacharzt Robert Kropp (80) seit 1996 aufgebaut hatte, zieht nach Heidelberg. Das neue Museum an der dortigen Universität wird an diesem Donnerstag eröffnet.
In Osthessen hatte Kropp nach eigenen Angaben keine Stelle gefunden, die die Stücke übernimmt. Diese bleiben im Besitz des Fuldaer Fördervereins und werden nur als Dauerleihgabe abgegeben.".
Quelle: hr-text, S. 151, 30.11.11
".... Zu der Sammlung gehören Fotografien und Filme, Grafiken und Poster, Mikroskope, pathologisch-anatomische Lungenpräparate und andere medizinische Instrumente. Auch präparierte Lungen, die mit Tuberkulose infiziert waren, werden gezeigt. ..."
Quelle: Pharmazeutische Zeitung, 30.11.11
"..... Ein neues Museum über Tuberkulose wird am 1.12.2011 um 17 Uhr in der Thoraxklinik Heidelberg eingeweiht. „Ziel des neuen Tuberkulose-Museums ist es, das Wissen um die großen wissenschaftlichen und ärztlichen Leistungen zu erhalten, die bisher im Kampf gegen diese Erkrankung erbracht worden sind“, erläutert Prof. Dr. Herth, Chefarzt der Pneumologie und Beatmungsmedizin „Wir wollen außerdem bewusst machen, dass die bei uns fast vergessene Krankheit global betrachtet nach wie vor unbesiegt ist und jährlich Millionen Menschen in Afrika und Asien daran versterben. Die WHO ordnet ihrer Bekämpfung deswegen die höchste Priorität zu.“
Bereits im Jahr 1996 wurde von Dr. Robert Kropp ein Deutsches Tuberkulose-Archiv in Fulda gegründet. „Das Archiv umfasst mittlerweile über 6000 Monographien und Periodika, die sich mit der Erkrankung Tuberkulose beschäftigen“, berichtet Kropp. „Diese stammen vorwiegend aus dem 19. Jahrhundert und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als der Tuberkulose eine große medizinisch-ärztliche, wissenschaftliche und gesundheitspolitische Bedeutung zukam. Das Archiv ist insofern eine echte Fundgrube für die medizinhistorische Forschung und kann zu diesem Zweck auch genutzt werden.“ Neben der Akquisition von Büchern, die sämtliche Aspekte der Tuberkulose behandeln, begann Kropp damals auch weitere Materialien zu sammeln, die diese – früher alle Lebensbereiche durchdringende, jetzt aber in den Industrieländern immer seltenere – Erkrankung quasi wieder aufleben lassen.
Im Jahr 2010 beschloss Kropp dann, das Deutsche Tuberkulose-Archiv zusammen mit den zusätzlich gesammelten Materialien der Thoraxklinik Heidelberg als neuer Heimstätte zu überstellen. Daraufhin haben zwei ehemalige Chefärzte der Thoraxklinik – Prof. Dr. Werner Ebert und Prof. Dr. Volker Schulz – sowie der jetzige Chefarzt der Abteilung Pneumologie und Beatmungsmedizin der Thoraxklinik, Prof. Dr. Felix Herth, das Archiv neu aufgestellt. „Viele der Memorabilia, die uns von ehemaligen Tuberkulose-Heilstätten, Tuberkulose-Fürsorgestellen, Lungenärzten, aber auch von der Pharmaindustrie überlassen wurden, vermitteln einen recht guten Einblick in eine Krankheitswelt, die bei uns längst der Vergangenheit angehört“, erläutert Schulz. Dazu wurden mehrere Räume des Rohrbacher Schlösschens, einem frühklassizistischen Bau im Park der Thoraxklinik, als Museum eingerichtet, um zahlreiche alte und neue Aspekte der Tuberkulose zu dokumentieren.
Im Einzelnen werden die folgenden Aspekte im Museum dargestellt:
• Epidemiologie gestern und heute
• Soziale Aspekte gestern und heute
• Robert Koch, der Entdecker des Tuberkulose-Erregers
• Wilhelm Conrad Röntgen und die Entdeckung der Röntgenstrahlen als Diagnostikum für die Tuberkulose
• Ansteckungsmöglichkeiten und Erscheinungsformen der Lungentuberkulose
• Erscheinungsformen der Tuberkulose weiterer Organe
• Heilstätten in verschiedenen Facetten
• Verschiedene Therapieformen, insbesondere die Heliotherapie und die chirurgische Therapie (Pneumothorax, weitere Kollapsverfahren)
• Tuberkulose-Fürsorgestellen
• Volksaufklärung
• Schutzimpfung
• Antibiotische Therapie
• Resistenzentwicklung der Erreger
• Tuberkulose und Kunst.
„Diese Themen werden veranschaulicht durch zahlreiche, teilweise historische Fotografien und Grafiken sowie neu gestaltete Poster. Sie zeigen unter anderem Mikroskope zur Betrachtung des Tuberkulose-Erregers, pathologisch-anatomische Lungenpräparate, chirurgische Instrumente, verschiedene Pneumothoraxgeräte, originäre Liegen der Freiluft-Kur, Schirmbilduntersuchungsgeräte sowie Materialien der Tuberkulose-Fürsorgestellen“, schildert Ebert. „Zudem können über dreißig alte und neuere Filme, die als DVD vorliegen und die Tuberkulose in vielfältiger Weise behandeln, in einem eigens dafür vorgesehenen Saal abgespielt werden. Darüber hinaus werden künftig auch noch eine große Zahl radiologischer Aufnahmen und Diapositive hinzukommen, die uns von Kliniken und Heilstätten überlassen wurden und derzeit neu geordnet werden müssen.“
Zielgruppen des Museums sind zum einen Ärzte, zum anderen aber auch interessierte Laien. „Schließlich ist heutzutage selbst manchen Lungenfachärzten, die sich früher entsprechend ihrer speziellen Kenntnisse oft auch Tuberkuloseärzte nannten, das Krankheitsbild Tuberkulose nicht mehr in allen Einzelheiten bekannt“, erklärt Herth. „Der Besuch des Museums soll sie an ihre Wurzeln erinnern. Auch Dermatologen, Orthopäden, Thoraxchirurgen und Radiologen sind besonders angesprochen. Andererseits kann natürlich auch die allgemeine Öffentlichkeit Gewinn aus einem Museumsbesuch ziehen, zumal die Darstellung in vielerlei Hinsicht keine speziellen medizinischen Kenntnisse voraussetzt, sondern vielmehr zum Beispiel auch lokale Aspekte des Heilstättenwesens im südwestdeutschen Raum herausstellt. Deshalb bietet sich der Besuch des Museums sicherlich auch für Schulklassen, Mitarbeiter von Krankenversicherungen, Krankenhäusern, Pflegeinstitutionen sowie Sozialstellen an.“ Ebenso sieht der Geschäftsführer der Thoraxklinik Roland Fank eine medizinhistorische Kontinuität gewährleistet: „Die Thoraxklinik ist ursprünglich aus einer Tuberkuloseklinik entstanden. Daher ist es schön, dass wir nun ein Museum, welches diese Erkrankung intensiv thematisiert, bei uns beherbergen können.“
An der festlichen Eröffnungsveranstaltung am 1. Dezember 2011 nehmen neben Herrn Dr. Kropp weitere Persönlichkeiten teil, die für ihre Forschungsarbeiten bzw. klinische Expertise auf dem Gebiet der Epidemiologie, Diagnostik und Therapie der Tuberkulose wohl bekannt sind – wie z.B. Prof. Dr. Robert Loddenkemper (Generalsekretär des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose DZK in Berlin), Prof. Dr. med. Volker Schulz (wie Dr. Kropp Vorstandsmitglied des Deutschen Tuberkulose-Archiv), Prof. Dr. med. Felix Herth (Chefarzt der Abteilung Innere Medizin, Thoraxklinik Heidelberg, Experte für Klinik und Therapie der Tuberkulose), Prof. Dr. Christoph Lange (Leiter des Zentrums für Infektiologie in Borstel, Experte für Epidemiologie und Labordiagnostik der Tuberkulose und Lehrstuhlinhaber an der Uni Bremen), Prof. Dr. Ebert (ehemaliger Chefarzt der Thoraxklinik). „Forschungsarbeiten im Archiv sind aber auch jetzt schon möglich und Anfragen werden beantwortet“, betont Herth. „Offiziell wird das Museum ab Anfang Januar 2012 geöffnet sein, wobei wir noch keine regulären Öffnungszeiten festgelegt haben. Wir beabsichtigenaber, an zwei Wochentagen eine einstündige Besichtigung unter Führung anzubieten.“
...."
Quelle: Heidelberger Thoraxklinik, Pressemitteilung, 30.11.11
s. a.
Osthessen-News, 30.11.11 mit Bildern!
Fuldaer Zeitung, 30.11.11
Weinheimer Zeitung, 30.11.11
Das Deutsche Tuberkulose-Archiv, das der pensionierte Lungenfacharzt Robert Kropp (80) seit 1996 aufgebaut hatte, zieht nach Heidelberg. Das neue Museum an der dortigen Universität wird an diesem Donnerstag eröffnet.
In Osthessen hatte Kropp nach eigenen Angaben keine Stelle gefunden, die die Stücke übernimmt. Diese bleiben im Besitz des Fuldaer Fördervereins und werden nur als Dauerleihgabe abgegeben.".
Quelle: hr-text, S. 151, 30.11.11
".... Zu der Sammlung gehören Fotografien und Filme, Grafiken und Poster, Mikroskope, pathologisch-anatomische Lungenpräparate und andere medizinische Instrumente. Auch präparierte Lungen, die mit Tuberkulose infiziert waren, werden gezeigt. ..."
Quelle: Pharmazeutische Zeitung, 30.11.11
"..... Ein neues Museum über Tuberkulose wird am 1.12.2011 um 17 Uhr in der Thoraxklinik Heidelberg eingeweiht. „Ziel des neuen Tuberkulose-Museums ist es, das Wissen um die großen wissenschaftlichen und ärztlichen Leistungen zu erhalten, die bisher im Kampf gegen diese Erkrankung erbracht worden sind“, erläutert Prof. Dr. Herth, Chefarzt der Pneumologie und Beatmungsmedizin „Wir wollen außerdem bewusst machen, dass die bei uns fast vergessene Krankheit global betrachtet nach wie vor unbesiegt ist und jährlich Millionen Menschen in Afrika und Asien daran versterben. Die WHO ordnet ihrer Bekämpfung deswegen die höchste Priorität zu.“
Bereits im Jahr 1996 wurde von Dr. Robert Kropp ein Deutsches Tuberkulose-Archiv in Fulda gegründet. „Das Archiv umfasst mittlerweile über 6000 Monographien und Periodika, die sich mit der Erkrankung Tuberkulose beschäftigen“, berichtet Kropp. „Diese stammen vorwiegend aus dem 19. Jahrhundert und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als der Tuberkulose eine große medizinisch-ärztliche, wissenschaftliche und gesundheitspolitische Bedeutung zukam. Das Archiv ist insofern eine echte Fundgrube für die medizinhistorische Forschung und kann zu diesem Zweck auch genutzt werden.“ Neben der Akquisition von Büchern, die sämtliche Aspekte der Tuberkulose behandeln, begann Kropp damals auch weitere Materialien zu sammeln, die diese – früher alle Lebensbereiche durchdringende, jetzt aber in den Industrieländern immer seltenere – Erkrankung quasi wieder aufleben lassen.
Im Jahr 2010 beschloss Kropp dann, das Deutsche Tuberkulose-Archiv zusammen mit den zusätzlich gesammelten Materialien der Thoraxklinik Heidelberg als neuer Heimstätte zu überstellen. Daraufhin haben zwei ehemalige Chefärzte der Thoraxklinik – Prof. Dr. Werner Ebert und Prof. Dr. Volker Schulz – sowie der jetzige Chefarzt der Abteilung Pneumologie und Beatmungsmedizin der Thoraxklinik, Prof. Dr. Felix Herth, das Archiv neu aufgestellt. „Viele der Memorabilia, die uns von ehemaligen Tuberkulose-Heilstätten, Tuberkulose-Fürsorgestellen, Lungenärzten, aber auch von der Pharmaindustrie überlassen wurden, vermitteln einen recht guten Einblick in eine Krankheitswelt, die bei uns längst der Vergangenheit angehört“, erläutert Schulz. Dazu wurden mehrere Räume des Rohrbacher Schlösschens, einem frühklassizistischen Bau im Park der Thoraxklinik, als Museum eingerichtet, um zahlreiche alte und neue Aspekte der Tuberkulose zu dokumentieren.
Im Einzelnen werden die folgenden Aspekte im Museum dargestellt:
• Epidemiologie gestern und heute
• Soziale Aspekte gestern und heute
• Robert Koch, der Entdecker des Tuberkulose-Erregers
• Wilhelm Conrad Röntgen und die Entdeckung der Röntgenstrahlen als Diagnostikum für die Tuberkulose
• Ansteckungsmöglichkeiten und Erscheinungsformen der Lungentuberkulose
• Erscheinungsformen der Tuberkulose weiterer Organe
• Heilstätten in verschiedenen Facetten
• Verschiedene Therapieformen, insbesondere die Heliotherapie und die chirurgische Therapie (Pneumothorax, weitere Kollapsverfahren)
• Tuberkulose-Fürsorgestellen
• Volksaufklärung
• Schutzimpfung
• Antibiotische Therapie
• Resistenzentwicklung der Erreger
• Tuberkulose und Kunst.
„Diese Themen werden veranschaulicht durch zahlreiche, teilweise historische Fotografien und Grafiken sowie neu gestaltete Poster. Sie zeigen unter anderem Mikroskope zur Betrachtung des Tuberkulose-Erregers, pathologisch-anatomische Lungenpräparate, chirurgische Instrumente, verschiedene Pneumothoraxgeräte, originäre Liegen der Freiluft-Kur, Schirmbilduntersuchungsgeräte sowie Materialien der Tuberkulose-Fürsorgestellen“, schildert Ebert. „Zudem können über dreißig alte und neuere Filme, die als DVD vorliegen und die Tuberkulose in vielfältiger Weise behandeln, in einem eigens dafür vorgesehenen Saal abgespielt werden. Darüber hinaus werden künftig auch noch eine große Zahl radiologischer Aufnahmen und Diapositive hinzukommen, die uns von Kliniken und Heilstätten überlassen wurden und derzeit neu geordnet werden müssen.“
Zielgruppen des Museums sind zum einen Ärzte, zum anderen aber auch interessierte Laien. „Schließlich ist heutzutage selbst manchen Lungenfachärzten, die sich früher entsprechend ihrer speziellen Kenntnisse oft auch Tuberkuloseärzte nannten, das Krankheitsbild Tuberkulose nicht mehr in allen Einzelheiten bekannt“, erklärt Herth. „Der Besuch des Museums soll sie an ihre Wurzeln erinnern. Auch Dermatologen, Orthopäden, Thoraxchirurgen und Radiologen sind besonders angesprochen. Andererseits kann natürlich auch die allgemeine Öffentlichkeit Gewinn aus einem Museumsbesuch ziehen, zumal die Darstellung in vielerlei Hinsicht keine speziellen medizinischen Kenntnisse voraussetzt, sondern vielmehr zum Beispiel auch lokale Aspekte des Heilstättenwesens im südwestdeutschen Raum herausstellt. Deshalb bietet sich der Besuch des Museums sicherlich auch für Schulklassen, Mitarbeiter von Krankenversicherungen, Krankenhäusern, Pflegeinstitutionen sowie Sozialstellen an.“ Ebenso sieht der Geschäftsführer der Thoraxklinik Roland Fank eine medizinhistorische Kontinuität gewährleistet: „Die Thoraxklinik ist ursprünglich aus einer Tuberkuloseklinik entstanden. Daher ist es schön, dass wir nun ein Museum, welches diese Erkrankung intensiv thematisiert, bei uns beherbergen können.“
An der festlichen Eröffnungsveranstaltung am 1. Dezember 2011 nehmen neben Herrn Dr. Kropp weitere Persönlichkeiten teil, die für ihre Forschungsarbeiten bzw. klinische Expertise auf dem Gebiet der Epidemiologie, Diagnostik und Therapie der Tuberkulose wohl bekannt sind – wie z.B. Prof. Dr. Robert Loddenkemper (Generalsekretär des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose DZK in Berlin), Prof. Dr. med. Volker Schulz (wie Dr. Kropp Vorstandsmitglied des Deutschen Tuberkulose-Archiv), Prof. Dr. med. Felix Herth (Chefarzt der Abteilung Innere Medizin, Thoraxklinik Heidelberg, Experte für Klinik und Therapie der Tuberkulose), Prof. Dr. Christoph Lange (Leiter des Zentrums für Infektiologie in Borstel, Experte für Epidemiologie und Labordiagnostik der Tuberkulose und Lehrstuhlinhaber an der Uni Bremen), Prof. Dr. Ebert (ehemaliger Chefarzt der Thoraxklinik). „Forschungsarbeiten im Archiv sind aber auch jetzt schon möglich und Anfragen werden beantwortet“, betont Herth. „Offiziell wird das Museum ab Anfang Januar 2012 geöffnet sein, wobei wir noch keine regulären Öffnungszeiten festgelegt haben. Wir beabsichtigenaber, an zwei Wochentagen eine einstündige Besichtigung unter Führung anzubieten.“
...."
Quelle: Heidelberger Thoraxklinik, Pressemitteilung, 30.11.11
s. a.
Osthessen-News, 30.11.11 mit Bildern!
Fuldaer Zeitung, 30.11.11
Weinheimer Zeitung, 30.11.11
Wolf Thomas - am Mittwoch, 30. November 2011, 18:11 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Stadt Köln kann mit der Planung für den Neubau des Historischen Archivs beginnen. Wie Baudezernent Bernd Streitberger mitgeteilt hat, sind Beschwerden wegen des Vergabeverfahrens an ein Architekturbüro erledigt. Eine Beschwerde hat die Vergabekammer zurückgewiesen, die andere wurde zurück gezogen. Das rchitekturbüro "Waechter und Waechter" hatte im April den Wettbewerb zum Neubau des Stadtarchivs gewonnen. Jetzt kann der Auftrag offiziell an das Büro vergeben werden."
Quelle: WDR-Text, S. 768, 30.11.11
Quelle: WDR-Text, S. 768, 30.11.11
Wolf Thomas - am Mittwoch, 30. November 2011, 18:07 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Auch dieses Jahr hat das Archiv wieder einen Kalender erstellt, der unter
http://www.archiv.rwth-aachen.de/kalender/Kalender2012.pdf
auch zum Download bereitsteht.
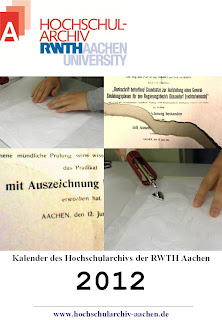
http://www.archiv.rwth-aachen.de/kalender/Kalender2012.pdf
auch zum Download bereitsteht.
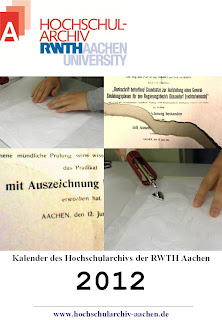
KlausGraf - am Mittwoch, 30. November 2011, 17:49 - Rubrik: Universitaetsarchive
Hatten wir schon http://archiv.twoday.net/stories/51315259/, ist aber wichtig genug, dass man den Fall nicht mit einem Einzeiler und einigen Links in den Kommentaren abtut.
die Wissenschaftler Jost Dülffer (Köln), Klaus-Dietmar Henke (Dresden), Wolfgang Krieger (Marburg) und Rolf-Dieter Müller (Potsdam) haben herausgefunden, dass der BND 2007 die Personalakten von etwa 250 hauptamtlichen Mitarbeitern vernichtet hat. Der Dienst bestätigt das.
Unter den entsorgten Unterlagen befinden sich nach Angaben der Kommission auch die Papiere von Personen, die während der NS-Zeit "in signifikanten geheimdienstlichen Positionen, in der SS, dem SD oder der Gestapo tätig gewesen sind"; gegen einige sei sogar nach 1945 wegen NS-Verbrechen ermittelt worden. Er sei über den Vorgang "einigermaßen fassungslos", erklärte Kommissionssprecher Henke gegenüber SPIEGEL ONLINE.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,800655,00.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article13742169/BND-vernichtete-Personalakten-frueherer-SS-Leute.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/nazi-vergangenheit-des-bnd-bnd-vernichtete-historische-akten-1.1222126
http://tagesschau.de/inland/bnd150.html
Die Rechtslage ist eindeutig: Nach dem Bundesarchivgesetz entscheidet das Bundesarchiv und nicht die Behörde, was archivwürdig ist. Auch wenn das Politische Archivs des Auswärtigen Amts das anders sieht: Behördenarchive sieht das Bundesarchivgesetz nicht vor.
Daher geht Schmalenstrtöers Vorwurf an die Archivare fehl:
Der Vorfall wirft aber auch Schatten auf die Rolle der Archivare. Es gibt keinen, der sich im eigenen Archiv so gut auskennt wie der zuständige Archivar. Und es liegt in der Natur eines Archives, dass nicht alle eingehenden Akten aufbewahrt werden können. Die Sortierung und Bewertung dieser Kassation liegt in den Händen der Archivare. Diese kontrollieren so das, was die spätere Forschung in die Hände bekommt und womit diese überhaupt arbeiten kann. Der Beruf des Archivares ist somit extrem verantwortungsvoll – denn was einmal vernichtet wurde, ist unwiederbringlich verloren. Die Archivare des BNDs haben entweder bei der Kassation gezeigt, dass sie diese Verantwortung nicht tragen können oder haben absichtlich vernichtet – und dann sollten sie die Verantwortung erst recht nicht tragen.
http://schmalenstroer.net/blog/2011/11/der-bnd-vernichtete-historisch-wertvolle-akten-ber-nazis-in-den-eigenen-reihen/
Ebensowenig wie es ein BND-Archiv geben kann, kann es BND-Archivare geben. Es wäre ein dicker Hund, wenn das Bundesarchiv der Vernichtung zugestimmt hätte.
Der Bundesnachrichtendienstbestand im Bundesarchiv trägt die Bestandskennzeichnung B 206:
http://www.bundesarchiv.de/oeffentlichkeitsarbeit/bilder_dokumente/00691/index.html.de
Wer in ARGUS etwas finden möchte, sollte vorher allerdings erst einen Kurs machen.
Findbuch mit Einleitung (2006)
http://startext.net-build.de:8080/barch/MidosaSEARCH/B206-28950/index.htm
Dass es unter den BND-Archivalien einen Punkt "Archiv" mit Archivberichten gibt, heißt nicht, dass diese Registratur tatsächlich ein Archiv im Sinne des Bundesarchivgesetzes darstellt.
Im Findbuch heißt es in der Einleitung: Die weitgehende Bevorzugung der Bearbeiterablage führte in der Organisation Gehlen und nachfolgend auch im Bundesnachrichtendienst zu überwiegend ungeordneten Unterlagen. Auch die Einführung des Aktenplans im Jahr 1969 konnte keine wesentliche Verbesserung erreichen. Eine sachgerechte Aktenführung findet nicht statt. Die Zuordnung gemäß Aktenplan erfolgt in zahlreichen Fällen erst im "Archivwesen" des BND.
Wenn es in der WELT heißt: "Die Kommission habe den BND nun aufgefordert, keine Unterlagen mehr ohne Rücksprache mit dem Historikergremium zu vernichten.", dann stellt das die Sachlage auf den Kopf. Der BND darf auch mit Zustimmung der Kommission nichts vernichten. Allein das Bundesarchiv entscheidet über die Archivwürdigkeit.
Wie schon bei den Bundeslöschtagen zeigt sich auch hier die Ohnmacht der gesetzlich vorgesehenen Archivare gegenüber mächtigen Behörden, die nach Gutdünken wild kassieren.
Und es bewahrheitet sich einmal mehr, dass weder die Historikerkommission noch die Presse in der Lage ist, die archivrechtlichen Gegebenheiten korrekt wiederzugeben. Ich wäre dankbar, wenn die LeserInnen von Archivalia den Medien ebenfalls entsprechende Hinweise geben könnten. Eine Anfrage beim Bundesarchiv wäre sinnvoll.
Nachtrag:
Zu den Bundeslöschtagen
http://archiv.twoday.net/search?q=bundesl%C3%B6schtage
Zum Thema Verwahrungsbruch
http://archiv.twoday.net/search?q=verwahrungsbruch
die Wissenschaftler Jost Dülffer (Köln), Klaus-Dietmar Henke (Dresden), Wolfgang Krieger (Marburg) und Rolf-Dieter Müller (Potsdam) haben herausgefunden, dass der BND 2007 die Personalakten von etwa 250 hauptamtlichen Mitarbeitern vernichtet hat. Der Dienst bestätigt das.
Unter den entsorgten Unterlagen befinden sich nach Angaben der Kommission auch die Papiere von Personen, die während der NS-Zeit "in signifikanten geheimdienstlichen Positionen, in der SS, dem SD oder der Gestapo tätig gewesen sind"; gegen einige sei sogar nach 1945 wegen NS-Verbrechen ermittelt worden. Er sei über den Vorgang "einigermaßen fassungslos", erklärte Kommissionssprecher Henke gegenüber SPIEGEL ONLINE.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,800655,00.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article13742169/BND-vernichtete-Personalakten-frueherer-SS-Leute.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/nazi-vergangenheit-des-bnd-bnd-vernichtete-historische-akten-1.1222126
http://tagesschau.de/inland/bnd150.html
Die Rechtslage ist eindeutig: Nach dem Bundesarchivgesetz entscheidet das Bundesarchiv und nicht die Behörde, was archivwürdig ist. Auch wenn das Politische Archivs des Auswärtigen Amts das anders sieht: Behördenarchive sieht das Bundesarchivgesetz nicht vor.
Daher geht Schmalenstrtöers Vorwurf an die Archivare fehl:
Der Vorfall wirft aber auch Schatten auf die Rolle der Archivare. Es gibt keinen, der sich im eigenen Archiv so gut auskennt wie der zuständige Archivar. Und es liegt in der Natur eines Archives, dass nicht alle eingehenden Akten aufbewahrt werden können. Die Sortierung und Bewertung dieser Kassation liegt in den Händen der Archivare. Diese kontrollieren so das, was die spätere Forschung in die Hände bekommt und womit diese überhaupt arbeiten kann. Der Beruf des Archivares ist somit extrem verantwortungsvoll – denn was einmal vernichtet wurde, ist unwiederbringlich verloren. Die Archivare des BNDs haben entweder bei der Kassation gezeigt, dass sie diese Verantwortung nicht tragen können oder haben absichtlich vernichtet – und dann sollten sie die Verantwortung erst recht nicht tragen.
http://schmalenstroer.net/blog/2011/11/der-bnd-vernichtete-historisch-wertvolle-akten-ber-nazis-in-den-eigenen-reihen/
Ebensowenig wie es ein BND-Archiv geben kann, kann es BND-Archivare geben. Es wäre ein dicker Hund, wenn das Bundesarchiv der Vernichtung zugestimmt hätte.
Der Bundesnachrichtendienstbestand im Bundesarchiv trägt die Bestandskennzeichnung B 206:
http://www.bundesarchiv.de/oeffentlichkeitsarbeit/bilder_dokumente/00691/index.html.de
Wer in ARGUS etwas finden möchte, sollte vorher allerdings erst einen Kurs machen.
Findbuch mit Einleitung (2006)
http://startext.net-build.de:8080/barch/MidosaSEARCH/B206-28950/index.htm
Dass es unter den BND-Archivalien einen Punkt "Archiv" mit Archivberichten gibt, heißt nicht, dass diese Registratur tatsächlich ein Archiv im Sinne des Bundesarchivgesetzes darstellt.
Im Findbuch heißt es in der Einleitung: Die weitgehende Bevorzugung der Bearbeiterablage führte in der Organisation Gehlen und nachfolgend auch im Bundesnachrichtendienst zu überwiegend ungeordneten Unterlagen. Auch die Einführung des Aktenplans im Jahr 1969 konnte keine wesentliche Verbesserung erreichen. Eine sachgerechte Aktenführung findet nicht statt. Die Zuordnung gemäß Aktenplan erfolgt in zahlreichen Fällen erst im "Archivwesen" des BND.
Wenn es in der WELT heißt: "Die Kommission habe den BND nun aufgefordert, keine Unterlagen mehr ohne Rücksprache mit dem Historikergremium zu vernichten.", dann stellt das die Sachlage auf den Kopf. Der BND darf auch mit Zustimmung der Kommission nichts vernichten. Allein das Bundesarchiv entscheidet über die Archivwürdigkeit.
Wie schon bei den Bundeslöschtagen zeigt sich auch hier die Ohnmacht der gesetzlich vorgesehenen Archivare gegenüber mächtigen Behörden, die nach Gutdünken wild kassieren.
Und es bewahrheitet sich einmal mehr, dass weder die Historikerkommission noch die Presse in der Lage ist, die archivrechtlichen Gegebenheiten korrekt wiederzugeben. Ich wäre dankbar, wenn die LeserInnen von Archivalia den Medien ebenfalls entsprechende Hinweise geben könnten. Eine Anfrage beim Bundesarchiv wäre sinnvoll.
Nachtrag:
Zu den Bundeslöschtagen
http://archiv.twoday.net/search?q=bundesl%C3%B6schtage
Zum Thema Verwahrungsbruch
http://archiv.twoday.net/search?q=verwahrungsbruch
Das Stadtarchiv Frankfurt/Oder wird nun doch nicht, wie seit 2009 geplant, in eine ehemalige Bürgerschule umziehen können, da das Land Brandenburg keine Finanzmittel für den Umbau zur Verfügung stellen wird. Archiv und Stadt müssen nun nach einem alternativen Standort suchen.
Bericht der Märkischen Oderzeitung in ihrer Online-Ausgabe v.30.11.2011:
http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/998488/
Bericht der Märkischen Oderzeitung in ihrer Online-Ausgabe v.30.11.2011:
http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/998488/
ingobobingo - am Mittwoch, 30. November 2011, 16:00 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Archives participatives
View more presentations from archivesmasala
Mit Erwähnung des Bundesarchiv-Wikimedia-Projekts
Wolf Thomas - am Mittwoch, 30. November 2011, 15:17 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Westfälische Literaturarchiv beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) blickt in diesem Jahr auf sein zehnjähriges Bestehen zurück. Aus Anlass seines zehnjährigen Bestehens veranstaltet das Westfälische Literaturarchiv am kommenden Donnerstag und Freitag (1. und 2.12.) eine Fachtagung.
Um zukunftsweisende Fachkonzepte für regionale Literaturarchive zu erarbeiten, müssen die Archive im intensiven Austausch zwischen Literaturschaffenden (den "Produzenten") und der Wissenschaft (den "Nutzern") stehen. Die Diskussion vor allem im Hinblick auf die Erwartungen an die Arbeit regionaler Literaturarchive zu fördern, ist das Hauptanliegen der Tagung, zu der das Literaturarchiv ca. 50 Experten erwartet.
2001 wurde das Literaturarchiv mit der Übernahme des Nachlasses des Lyrikers und Büchner-Preisträgers Ernst Meister als Kooperationseinrichtung der LWL-Literaturkommission für Westfalen und des LWL-Archivamtes für Westfalen eingerichtet.
Seine Hauptaufgaben sind die Förderung und Verbesserung der literarischen Nachlasspflege in der Region.
Das Tagungsprogramm
"Brauchen Literaturwissenschaftler regionale Literaturarchive?", so der Titel des Eröffnungsvortrages von Prof. Hartmut Steinecke (Paderborn), Vorstandsmitglied der LWL-Literaturkommission der ersten Stunde, der selbst zahlreiche Projekte zur Kulturlandschaft auf den Weg gebracht hat, so das Portal "Jüdische Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Westfalen".
Im ersten Teil der Tagung zum Thema "Profile, Bestände, Netzwerke" formuliert Eva Maaser (Verband deutscher Schriftsteller NRW) stellvertretend für Autoren ihre Erwartungen an regionale Literaturarchive und benennt auch Anforderungen, die aus einer zunehmend digitalisierten (Schreib-)Welt erwachsen. Wie stellen sich dazu die regionalen Literaturarchive auf? Welche Unterlagen gelangen in die Literaturarchive? Welche Herausforderungen kommen insbesondere bei der Übernahme von audio-visuellen Quellen und digitalen Unterlagen auf die Archive zu? Dr. Jochen Grywatsch (LWL-Literaturkommission für Westfalen, Münster), Dr. Sabine Brenner-Wilczek (Heinrich-Heine-Institut, Düsseldorf) und Dr. Peter Hehl (Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg) berichten
hierzu jeweils aus ihren Literaturarchiven.
Der zweite Teil der Tagung am Freitag nimmt schwerpunktmäßig Fragen der Präsentation, Vermittlung und Nutzung in den Blick.
Literaturwissenschaftler, die als Herausgeber zu den nspruchsvollsten Nutzern von Archiven gehören, diskutieren den Stellenwert von Literaturarchiven für die regionale Literaturforschung und stellen eigene Erschließungs- und Editionsprojekte vor (Dr. Stefanie Jordans, Aachen; Dr. Sikander Singh, Saarbrücken). Prof. Dr. Walter Gödden (LWL-Literaturkommission für Westfalen, Münster) und Dr. Ute Pott (Gleimhaus Halberstadt) befassen sich in ihren Beiträgen mit Fragen der zeitgemäßen Präsentation und Vermittlung von
Archivbeständen sowie von Forschungsergebnissen im Spannungsfeld "zwischen Grundlagenforschung und populärer Vermittlung".
"Schreibraum 2.0 -Neue Anforderungen an Literaturarchive?", so lautet das Thema der Abschlussdiskussion, in der eine jüngere Autorengeneration vertreten durch Oliver Uschmann (Ascheberg ) und Christoph Wenzel (Aachen) einen Blick in die Zukunft wagt. Das Internet als Publikationsplattform, Kommunikation über Social Networks - Entwicklungen, die die Arbeit regionaler Literaturarchive grundlegend verändern wird.
INFO
Es sind noch einige Plätze frei, so dass Interessenten sich
auch noch kurzfristig anmelden können beim LWL-Archivamt für
Westfalen, Tel.: 0251 591-3890 oder per Mail unter
LWL-Archivamt@lwl.org."
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Um zukunftsweisende Fachkonzepte für regionale Literaturarchive zu erarbeiten, müssen die Archive im intensiven Austausch zwischen Literaturschaffenden (den "Produzenten") und der Wissenschaft (den "Nutzern") stehen. Die Diskussion vor allem im Hinblick auf die Erwartungen an die Arbeit regionaler Literaturarchive zu fördern, ist das Hauptanliegen der Tagung, zu der das Literaturarchiv ca. 50 Experten erwartet.
2001 wurde das Literaturarchiv mit der Übernahme des Nachlasses des Lyrikers und Büchner-Preisträgers Ernst Meister als Kooperationseinrichtung der LWL-Literaturkommission für Westfalen und des LWL-Archivamtes für Westfalen eingerichtet.
Seine Hauptaufgaben sind die Förderung und Verbesserung der literarischen Nachlasspflege in der Region.
Das Tagungsprogramm
"Brauchen Literaturwissenschaftler regionale Literaturarchive?", so der Titel des Eröffnungsvortrages von Prof. Hartmut Steinecke (Paderborn), Vorstandsmitglied der LWL-Literaturkommission der ersten Stunde, der selbst zahlreiche Projekte zur Kulturlandschaft auf den Weg gebracht hat, so das Portal "Jüdische Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Westfalen".
Im ersten Teil der Tagung zum Thema "Profile, Bestände, Netzwerke" formuliert Eva Maaser (Verband deutscher Schriftsteller NRW) stellvertretend für Autoren ihre Erwartungen an regionale Literaturarchive und benennt auch Anforderungen, die aus einer zunehmend digitalisierten (Schreib-)Welt erwachsen. Wie stellen sich dazu die regionalen Literaturarchive auf? Welche Unterlagen gelangen in die Literaturarchive? Welche Herausforderungen kommen insbesondere bei der Übernahme von audio-visuellen Quellen und digitalen Unterlagen auf die Archive zu? Dr. Jochen Grywatsch (LWL-Literaturkommission für Westfalen, Münster), Dr. Sabine Brenner-Wilczek (Heinrich-Heine-Institut, Düsseldorf) und Dr. Peter Hehl (Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg) berichten
hierzu jeweils aus ihren Literaturarchiven.
Der zweite Teil der Tagung am Freitag nimmt schwerpunktmäßig Fragen der Präsentation, Vermittlung und Nutzung in den Blick.
Literaturwissenschaftler, die als Herausgeber zu den nspruchsvollsten Nutzern von Archiven gehören, diskutieren den Stellenwert von Literaturarchiven für die regionale Literaturforschung und stellen eigene Erschließungs- und Editionsprojekte vor (Dr. Stefanie Jordans, Aachen; Dr. Sikander Singh, Saarbrücken). Prof. Dr. Walter Gödden (LWL-Literaturkommission für Westfalen, Münster) und Dr. Ute Pott (Gleimhaus Halberstadt) befassen sich in ihren Beiträgen mit Fragen der zeitgemäßen Präsentation und Vermittlung von
Archivbeständen sowie von Forschungsergebnissen im Spannungsfeld "zwischen Grundlagenforschung und populärer Vermittlung".
"Schreibraum 2.0 -Neue Anforderungen an Literaturarchive?", so lautet das Thema der Abschlussdiskussion, in der eine jüngere Autorengeneration vertreten durch Oliver Uschmann (Ascheberg ) und Christoph Wenzel (Aachen) einen Blick in die Zukunft wagt. Das Internet als Publikationsplattform, Kommunikation über Social Networks - Entwicklungen, die die Arbeit regionaler Literaturarchive grundlegend verändern wird.
INFO
Es sind noch einige Plätze frei, so dass Interessenten sich
auch noch kurzfristig anmelden können beim LWL-Archivamt für
Westfalen, Tel.: 0251 591-3890 oder per Mail unter
LWL-Archivamt@lwl.org."
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Wolf Thomas - am Mittwoch, 30. November 2011, 12:30 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Der Bergbau ist untrennbar mit der Geschichte Hertens verbunden. Da ist es besonders ärgerlich, wenn dem Stadtarchiv wichtige Akten der Zechen fehlen. Solch ?fehlende? Bauakten der Zeche Schlägel und Eisen sind jetzt aufgetaucht und wurden dem Archiv zur Verfügung gestellt.
Der Kooperation des Fördervereins Schacht V mit den Arbeitskreisen "Schlägel & Eisen" sowie Scherlebecker
Geschichte(n) ist es zu verdanken, dass einige "Meter" alten Aktenbestandes jetzt für die Archivare und die Öffentlichkeit
zugänglich sind. "Nun ist sichergestellt, dass Recherchen vollständig an einer Stelle möglich sind", freuen sich Kirsten Notzel und Maik Leppak vom Stadtarchiv Herten.
Frank Laszok vom Förderverein Schacht V hatte die fehlenden Akten von Schlägel und Eisen im Bestand entdeckt. Um die über hundert Jahre alten Dokumente zu schonen, wurden die Daten vom Arbeitskreis elektronisch erfasst. Denn das Papier ist mit der Zeit sehr brüchig geworden.
Als besonders interessant bewertet Peter Kitzol-Kohn vom Arbeitskreis Scherlebecker Geschichte(n). die kleinen Bearbeitungsvermerke über den Umgang zwischen Zechenverwaltung, Amtsvertretung und königlichem Bergamt. Auch der Schriftverkehr und detaillierte Zeichnungen aus der Gründerzeit seien "eine wahre Fundgrube für alle Heimatforscher". Foto gebe es aus diesem Zeitraum nämlich leider nur sehr wenige."
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Der Kooperation des Fördervereins Schacht V mit den Arbeitskreisen "Schlägel & Eisen" sowie Scherlebecker
Geschichte(n) ist es zu verdanken, dass einige "Meter" alten Aktenbestandes jetzt für die Archivare und die Öffentlichkeit
zugänglich sind. "Nun ist sichergestellt, dass Recherchen vollständig an einer Stelle möglich sind", freuen sich Kirsten Notzel und Maik Leppak vom Stadtarchiv Herten.
Frank Laszok vom Förderverein Schacht V hatte die fehlenden Akten von Schlägel und Eisen im Bestand entdeckt. Um die über hundert Jahre alten Dokumente zu schonen, wurden die Daten vom Arbeitskreis elektronisch erfasst. Denn das Papier ist mit der Zeit sehr brüchig geworden.
Als besonders interessant bewertet Peter Kitzol-Kohn vom Arbeitskreis Scherlebecker Geschichte(n). die kleinen Bearbeitungsvermerke über den Umgang zwischen Zechenverwaltung, Amtsvertretung und königlichem Bergamt. Auch der Schriftverkehr und detaillierte Zeichnungen aus der Gründerzeit seien "eine wahre Fundgrube für alle Heimatforscher". Foto gebe es aus diesem Zeitraum nämlich leider nur sehr wenige."
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Wolf Thomas - am Mittwoch, 30. November 2011, 12:28 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Digitization Coordinator at the Maryland Historical Society (MdHS), Jennifer Ferretti about the costs of digitization on Bmore historic.
http://bmorehistoric.baltimoreheritage.org/2011/11/the-costs-of-digitization/
http://bmorehistoric.baltimoreheritage.org/2011/11/the-costs-of-digitization/
dustbin - am Mittwoch, 30. November 2011, 08:42 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
vierprinzen - am Dienstag, 29. November 2011, 22:03
Heute ging die Aufforderung ein, den Titel zu ändern. Ein Name dürfe nicht erscheinen.
Es scheint nicht zu genügen, dass Informationssperren verhängt werden, nun sollen auch Publikationsverbote ergehen.
Der Titel bleibt.
Madrid, den 29.11.2011
Vierprinzen
Avenida America 8
28002 Madrid
fax 003491 235 41 50
Alexander@vierprinzen.com
update:
wir vernichten keine Akten !
http://goo.gl/AO2zY
update 3.12.2011
An wen es angeht
Es freut mich, dass die Auseinandersetzung ein erfreuliches Ende gefunden hat. Danke.
Es scheint nicht zu genügen, dass Informationssperren verhängt werden, nun sollen auch Publikationsverbote ergehen.
Der Titel bleibt.
Madrid, den 29.11.2011
Vierprinzen
Avenida America 8
28002 Madrid
fax 003491 235 41 50
Alexander@vierprinzen.com
update:
wir vernichten keine Akten !
http://goo.gl/AO2zY
update 3.12.2011
An wen es angeht
Es freut mich, dass die Auseinandersetzung ein erfreuliches Ende gefunden hat. Danke.
vierprinzen - am Dienstag, 29. November 2011, 15:02 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Autographenauktion im Wiener Dorotheum am 9.12.2011 unter http://www.dorotheum.com/auktionen/auktion-9168-autographen.html ist der Katalog online. Das erste Lot sicher für ein deutsches Archiv interessant.
ThomasJust - am Dienstag, 29. November 2011, 12:43 - Rubrik: Kulturgut
"Der Arbeitskreis der Kommunalarchive im Kreis Steinfurt traf sich zu seiner Herbstsitzung auf Einladung von Kreisarchivarin Ute Langkamp im Rathaus der Gemeinde Nordwalde. Bürgermeisterin Sonja Schemmann betonte in ihrer Begrüßung, wie lebendig Geschichte sein kann. Dabei liegen ihr vor allem biographische Geschichten, die von der Lokal- und Regionalgeschichtsforschung thematisiert werden, am Herzen.
Die Archivarinnen und Archivare diskutierten, wie der Archivalltag besonders in Zeiten knapper Kassen der Kommunen noch zu meistern ist.
Hans-Jürgen Höötmann vom LWL-Archivamt für Westfalen und zuständiger Referent für die Kommunalarchive im Kreis Steinfurt, stellte die ganz Bandbreite möglicher Leistungen seiner Behörde vor. Das Spektrum der Beratungs- und Hilfsangebote reiche vom Bau eines Archivs über Aus- und Fortbildungen, Hilfe bei Wasserschäden bis zur Restaurierung von Archivalien. Zudem präsentierte er praktische Arbeitshilfen und Empfehlungen weiterer in der Archivfachwelt anerkannter Institutionen."
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Die Archivarinnen und Archivare diskutierten, wie der Archivalltag besonders in Zeiten knapper Kassen der Kommunen noch zu meistern ist.
Hans-Jürgen Höötmann vom LWL-Archivamt für Westfalen und zuständiger Referent für die Kommunalarchive im Kreis Steinfurt, stellte die ganz Bandbreite möglicher Leistungen seiner Behörde vor. Das Spektrum der Beratungs- und Hilfsangebote reiche vom Bau eines Archivs über Aus- und Fortbildungen, Hilfe bei Wasserschäden bis zur Restaurierung von Archivalien. Zudem präsentierte er praktische Arbeitshilfen und Empfehlungen weiterer in der Archivfachwelt anerkannter Institutionen."
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Wolf Thomas - am Dienstag, 29. November 2011, 12:03 - Rubrik: Kooperationsmodelle
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ich schreib es hier ja immer wieder - http://archiv.twoday.net/stories/38723599/ gibt Links auf einige Archivalia-Beiträge -, was man beachten muss, wenn man ein Bild nutzt, das unter freier Lizenz steht, aber anscheinend ist es für Medienschaffende zu schwer, sich zwei simple Grundregeln zu merken:
1. Nenne den Autor!
2. Verlinke die Lizenz!
Das gilt für die meisten Fälle (Wikipedia, Wikimedia Commons Flickr), wenn das Foto nicht verändert wird und für das Medium zugelassen ist (auch wenn man Autor und Lizenz angibt, darf ein kommerzielles Blog kein CC-BY-NC-Bild nutzen!).
Netzbürger Knüwer illustriert seinen Beitrag
http://www.indiskretionehrensache.de/2011/11/merck-vs-facebook/
mit einem Bild des Bundesarchivs auf Wikimedia Commons.
(Merck im Jahr 1936; Quelle: Bundesarchiv Creative Commons)
Das ist natürlich ganz falsch. Der Link geht kurioserweise auf eine Hilfeseite von Wikimedia Commons, auf der steht, wie man es richtig macht.
Und es gibt natürlich nicht nur eine Creative Commons-Lizenz, sondern viele verschiedene Versionen, wobei sich diese nach dem Land unterscheiden können. Auf Commons sind zulässig:
CC-BY
CC-BY-SA
Die Lizenz ist genau zu bezeichnen, was man hinreichend genau nur durch einen Link auf den spezifischen Lizenztext bewirken kann. Auch wenn CC-BY-SA 3.0 generic und CC-BY-SA 2.0 Deutschland sich im Kern nicht unterscheiden, gibt es doch rechtsverbindliche Differenzen. Der Hinweis CC-BY-SA genügt also nicht.
In den Metadaten auf Commons ist klar angegeben, wie man das Bundesarchiv-Bild lizenzkonform nutzt:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_111-098-069,_Darmstadt,_Verpackungsraum_f%C3%BCr_Pharmazeutika.jpg
Im Lizenztext steht:
Namensnennung: Bundesarchiv, Bild 111-098-069 / unbekannt / CC-BY-SA
Leider fehlt unter den Bedingungen im Erläuterungstext von Commons die von der Lizenz strikt geforderte Verlinkung des Lizenztextes (man darf davon ausgehen, dass niemand den Lizenztext in toto wiedergeben möchte).
Das Bundesarchiv hat also von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, dem Nutzer vorzugeben, wie er die Namensnennung vorzunehmen hat. (Es ist dem Bundesarchiv natürlich nicht möglich, den Benutzer von der Pflicht zu entbinden, einen Link zur Lizenz zu setzen, da dies nicht zur Disposition des Lizenzgebers steht.)

Bundesarchiv, Bild 111-098-069 / unbekannt / CC-BY-SA
So - mit vorgegebenem Text und Link zur spezifischen CC-Version, die auf der Bildseite von Commons verlinkt ist - nutzt man das Bild korrekt. Und nicht anders, Herr Knüwer.
Wer möchte kann noch einen zweiten Link zur Quelle auf Wikimedia Commons spendieren. Aber dieser Link darf den Link zur Lizenz nicht ersetzen!
1. Nenne den Autor!
2. Verlinke die Lizenz!
Das gilt für die meisten Fälle (Wikipedia, Wikimedia Commons Flickr), wenn das Foto nicht verändert wird und für das Medium zugelassen ist (auch wenn man Autor und Lizenz angibt, darf ein kommerzielles Blog kein CC-BY-NC-Bild nutzen!).
Netzbürger Knüwer illustriert seinen Beitrag
http://www.indiskretionehrensache.de/2011/11/merck-vs-facebook/
mit einem Bild des Bundesarchivs auf Wikimedia Commons.
(Merck im Jahr 1936; Quelle: Bundesarchiv Creative Commons)
Das ist natürlich ganz falsch. Der Link geht kurioserweise auf eine Hilfeseite von Wikimedia Commons, auf der steht, wie man es richtig macht.
Und es gibt natürlich nicht nur eine Creative Commons-Lizenz, sondern viele verschiedene Versionen, wobei sich diese nach dem Land unterscheiden können. Auf Commons sind zulässig:
CC-BY
CC-BY-SA
Die Lizenz ist genau zu bezeichnen, was man hinreichend genau nur durch einen Link auf den spezifischen Lizenztext bewirken kann. Auch wenn CC-BY-SA 3.0 generic und CC-BY-SA 2.0 Deutschland sich im Kern nicht unterscheiden, gibt es doch rechtsverbindliche Differenzen. Der Hinweis CC-BY-SA genügt also nicht.
In den Metadaten auf Commons ist klar angegeben, wie man das Bundesarchiv-Bild lizenzkonform nutzt:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_111-098-069,_Darmstadt,_Verpackungsraum_f%C3%BCr_Pharmazeutika.jpg
Im Lizenztext steht:
Namensnennung: Bundesarchiv, Bild 111-098-069 / unbekannt / CC-BY-SA
Leider fehlt unter den Bedingungen im Erläuterungstext von Commons die von der Lizenz strikt geforderte Verlinkung des Lizenztextes (man darf davon ausgehen, dass niemand den Lizenztext in toto wiedergeben möchte).
Das Bundesarchiv hat also von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, dem Nutzer vorzugeben, wie er die Namensnennung vorzunehmen hat. (Es ist dem Bundesarchiv natürlich nicht möglich, den Benutzer von der Pflicht zu entbinden, einen Link zur Lizenz zu setzen, da dies nicht zur Disposition des Lizenzgebers steht.)

Bundesarchiv, Bild 111-098-069 / unbekannt / CC-BY-SA
So - mit vorgegebenem Text und Link zur spezifischen CC-Version, die auf der Bildseite von Commons verlinkt ist - nutzt man das Bild korrekt. Und nicht anders, Herr Knüwer.
Wer möchte kann noch einen zweiten Link zur Quelle auf Wikimedia Commons spendieren. Aber dieser Link darf den Link zur Lizenz nicht ersetzen!
KlausGraf - am Montag, 28. November 2011, 17:52 - Rubrik: Archivrecht
http://www.tomshardware.com/news/ibm-file-degradation-aging-patent,14060.html
I thought it was a hoax but here is the link to the patent application:
http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PG01&s1=20110282838.PGNR.&OS=DN/20110282838RS=DN/20110282838
United States Patent Application 20110282838
Kind Code A1
Accapadi; Jos M. ; et al. November 17, 2011
AGING FILE SYSTEM
Abstract
A method, programmed medium and system are provided for a file system that provides for the aging of information and files stored thereon. Digital data stored on the aging file systems ages appropriately as would normal paper or photographs without the need for an external application. The aging file system uses a number of parameters depending on what type of digital data are stored. For example, parameters like ambient temperature, rate of aging, simulated type of paper or photo paper are selected and may be input to a filing system at configuration time. The aging file system also creates and stores digital authentication certificates to provide a unique certificate number based on the aged digital information.
Inventors: Accapadi; Jos M.; (Corvallis, OR) ; Weber; Lynne M.; (Austin, TX)
Assignee: International Business Machines Corporation
I thought it was a hoax but here is the link to the patent application:
http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PG01&s1=20110282838.PGNR.&OS=DN/20110282838RS=DN/20110282838
United States Patent Application 20110282838
Kind Code A1
Accapadi; Jos M. ; et al. November 17, 2011
AGING FILE SYSTEM
Abstract
A method, programmed medium and system are provided for a file system that provides for the aging of information and files stored thereon. Digital data stored on the aging file systems ages appropriately as would normal paper or photographs without the need for an external application. The aging file system uses a number of parameters depending on what type of digital data are stored. For example, parameters like ambient temperature, rate of aging, simulated type of paper or photo paper are selected and may be input to a filing system at configuration time. The aging file system also creates and stores digital authentication certificates to provide a unique certificate number based on the aged digital information.
Inventors: Accapadi; Jos M.; (Corvallis, OR) ; Weber; Lynne M.; (Austin, TX)
Assignee: International Business Machines Corporation
KlausGraf - am Montag, 28. November 2011, 17:37 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bitte hier oder auf youtube diskutieren!
Wolf Thomas - am Montag, 28. November 2011, 14:08 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.welt.de/politik/deutschland/article13737090/Professoren-wussten-frueh-von-Guttenbergs-Plagiaten.html
Nach Informationen der „Welt am Sonntag“ waren die Fehler in Guttenbergs Arbeit mehreren Wissenschaftlern schon seit Längerem bekannt. Zwei von ihnen sprechen nun erstmals. Mehr als ein halbes Jahr vor Fischer-Lescano war diesen klar, dass Guttenberg mehrere Passagen unsauber übernommen hat. Warum die Professoren dies für sich behielten, ist nur schwer zu verstehen. [...]
Man muss zurück in den Sommer 2010 gehen, um diese Spur aufzunehmen. Der Doktorand Michael S. – er promoviert in Berlin, arbeitet damals in Münster – holt für seine Doktorarbeit Guttenbergs Buch aus dem Regal, liest, besorgt sich die zitierte Literatur. S. erkennt schnell, dass Stellen eins zu eins übernommen wurden und oft nicht als Zitat gekennzeichnet waren. [...]
S. schreibt einen Aufsatz darüber und legt ihn ein paar Leuten in seinem Umfeld vor. „Mir wurde gesagt, dass der Aufsatz Sprengstoff in sich birgt und dass ich mit einer Veröffentlichung Gefahr laufe, von der Öffentlichkeit vereinnahmt zu werden“, erinnert sich S.. Er packt seinen Text in die Schublade.
Weder der Münsteraner Rechtsprofessor Bodo Pieroth noch der Doktorvater von S., Ingolf Pernice (ein Häberle-Schüler) ermuntern S., an die Öffentlichkeit zu gehen oder informieren den Bayreuther Promotionsausschuss.
Nach Informationen der „Welt am Sonntag“ waren die Fehler in Guttenbergs Arbeit mehreren Wissenschaftlern schon seit Längerem bekannt. Zwei von ihnen sprechen nun erstmals. Mehr als ein halbes Jahr vor Fischer-Lescano war diesen klar, dass Guttenberg mehrere Passagen unsauber übernommen hat. Warum die Professoren dies für sich behielten, ist nur schwer zu verstehen. [...]
Man muss zurück in den Sommer 2010 gehen, um diese Spur aufzunehmen. Der Doktorand Michael S. – er promoviert in Berlin, arbeitet damals in Münster – holt für seine Doktorarbeit Guttenbergs Buch aus dem Regal, liest, besorgt sich die zitierte Literatur. S. erkennt schnell, dass Stellen eins zu eins übernommen wurden und oft nicht als Zitat gekennzeichnet waren. [...]
S. schreibt einen Aufsatz darüber und legt ihn ein paar Leuten in seinem Umfeld vor. „Mir wurde gesagt, dass der Aufsatz Sprengstoff in sich birgt und dass ich mit einer Veröffentlichung Gefahr laufe, von der Öffentlichkeit vereinnahmt zu werden“, erinnert sich S.. Er packt seinen Text in die Schublade.
Weder der Münsteraner Rechtsprofessor Bodo Pieroth noch der Doktorvater von S., Ingolf Pernice (ein Häberle-Schüler) ermuntern S., an die Öffentlichkeit zu gehen oder informieren den Bayreuther Promotionsausschuss.
KlausGraf - am Montag, 28. November 2011, 00:59 - Rubrik: Archivrecht
Cynthia J. Cyrus: The Scribes for Women's Convents in Late Medieval Germany, Toronto: University of Toronto Press 2009
Von der Arbeit von Cyrus gibt es bei http://books.google.de/books?id=kKE97gvmWQcC genügend Auszüge um zu erkennen, dass die bereits 2007 von mir thematisierte germanistische Verwechslung der Dominikanerinnenkonvente von Medingen und Medlingen perpetuiert wird.
http://archiv.twoday.net/stories/4230116/
Weitere Belege für diese Verwechslung unter Zitierung von Archivalia finden sich bei Balázs J. Nemes, Dis buch ist iohannes schedelin. Die Handschriften eines Colmarer Bürgers aus der Mitte des 15. Jahrhunderts und ihre Verflechtungen mit dem Literaturangebot der Dominikanerobservanz, in: Kulturtopographie des deutschsprachigen Südwestens im späteren Mittelalter. Studien und Texte, hg. von Barbara Fleith und René Wetzel (Kulturtopographie des alemannischen Raums 1), Berlin/New York 2009, S. 157-214 (leider nicht mehr bei PaperC online, daher muss ich aus dem Gedächtnis zitieren).
[ http://books.google.de/books?id=MrV19BCa6-UC&pg=PA178 S. 178 Anm. 88]
[ http://archiv.twoday.net/stories/418666248/ ]
"All diese Informationen sind minutiös gesammelt, geordnet und diskutiert" schreibt A. Ambrosio
http://www.sehepunkte.de/2010/09/17866.html über Cyrus, was ich bei einem kurzen Blick in die Fußnoten des Buchs überhaupt nicht unterschreiben würde. Sie schlurft unkritisch Krämers meist unzuverlässigen Angaben hinterher.
Wenn man gründlich arbeitet, darf man nicht mehr Johannes Kursi wie die ältere Forschung schreiben, vor allem wenn in den zitierten Arbeiten von Fechter und Fasbender die richtige Namensform begründet wird.
Von der Arbeit von Cyrus gibt es bei http://books.google.de/books?id=kKE97gvmWQcC genügend Auszüge um zu erkennen, dass die bereits 2007 von mir thematisierte germanistische Verwechslung der Dominikanerinnenkonvente von Medingen und Medlingen perpetuiert wird.
http://archiv.twoday.net/stories/4230116/
Weitere Belege für diese Verwechslung unter Zitierung von Archivalia finden sich bei Balázs J. Nemes, Dis buch ist iohannes schedelin. Die Handschriften eines Colmarer Bürgers aus der Mitte des 15. Jahrhunderts und ihre Verflechtungen mit dem Literaturangebot der Dominikanerobservanz, in: Kulturtopographie des deutschsprachigen Südwestens im späteren Mittelalter. Studien und Texte, hg. von Barbara Fleith und René Wetzel (Kulturtopographie des alemannischen Raums 1), Berlin/New York 2009, S. 157-214 (leider nicht mehr bei PaperC online, daher muss ich aus dem Gedächtnis zitieren).
[ http://books.google.de/books?id=MrV19BCa6-UC&pg=PA178 S. 178 Anm. 88]
[ http://archiv.twoday.net/stories/418666248/ ]
"All diese Informationen sind minutiös gesammelt, geordnet und diskutiert" schreibt A. Ambrosio
http://www.sehepunkte.de/2010/09/17866.html über Cyrus, was ich bei einem kurzen Blick in die Fußnoten des Buchs überhaupt nicht unterschreiben würde. Sie schlurft unkritisch Krämers meist unzuverlässigen Angaben hinterher.
Wenn man gründlich arbeitet, darf man nicht mehr Johannes Kursi wie die ältere Forschung schreiben, vor allem wenn in den zitierten Arbeiten von Fechter und Fasbender die richtige Namensform begründet wird.
KlausGraf - am Sonntag, 27. November 2011, 23:52 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Gerade erst hat er seinen vierzigsten Geburtstag mit einer HipHop-Festwoche ausgiebig gefeiert, schon beweist Torch, dass ihm auch im gesetzteren Alter die Ideen nicht ausgehen.
Der Rap-Altvater aus Heidelberg plant, ein HipHop-Archiv in seiner Heimatstadt einzurichten. Laut einem Bericht der Rhein-Neckar-Zeitung sollen dort Dokumente wie Fotos, Texte, Musik oder Videos aufbewahrt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden - von allen Pionieren der beschaulichen Universitätsstadt wie Toni L, den Stieber Twins oder Cora E. Ob der Wahlheidelberger King of Rap Savas auch Erwähnung finden soll, ist unbekannt.
Das HipHop-Archiv soll jedoch nicht nur die altehrwürdige Historie dokumentieren, sondern auch im Hier und Jetzt für Kinder- und Jugendprojekte genutzt werden. Die Texte von Torch finden sich ja ohnehin schon im ein oder anderen Schulbuch. Allzu hoch wären die Kosten für das Archiv wohl nicht: Mehr als einen geeigneten Raum sowie technische Gerätschaften, um die Dokumente zu archivieren und vorzuführen, braucht es eigentlich nicht.
In einem Brief an die Stadt Heidelberg schreibt Torch: "Ich würde mich freuen, wenn eine solche geschichtsträchtige Stadt wie Heidelberg auch diesen Teil ihrer Geschichte erkennt und dieses Geschenk annimmt". Der Jugendgemeinderat ist bereits überzeugt und hat ohne Gegenstimme für das Archiv votiert. Der richtige Gemeinderat muss hingegen erst noch entscheiden, am morgigen Donnerstag soll sich der Kulturausschuss mit dem Thema befassen."
Am 15.12.2011 wird darüber wohl abschließend im Heidelberger Gemeinderat beraten. Ob sich Kollege Blum freut - über die neuen Kollegen in der Stadt.
Quelle: rap.de, 23.11.2011
Der Rap-Altvater aus Heidelberg plant, ein HipHop-Archiv in seiner Heimatstadt einzurichten. Laut einem Bericht der Rhein-Neckar-Zeitung sollen dort Dokumente wie Fotos, Texte, Musik oder Videos aufbewahrt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden - von allen Pionieren der beschaulichen Universitätsstadt wie Toni L, den Stieber Twins oder Cora E. Ob der Wahlheidelberger King of Rap Savas auch Erwähnung finden soll, ist unbekannt.
Das HipHop-Archiv soll jedoch nicht nur die altehrwürdige Historie dokumentieren, sondern auch im Hier und Jetzt für Kinder- und Jugendprojekte genutzt werden. Die Texte von Torch finden sich ja ohnehin schon im ein oder anderen Schulbuch. Allzu hoch wären die Kosten für das Archiv wohl nicht: Mehr als einen geeigneten Raum sowie technische Gerätschaften, um die Dokumente zu archivieren und vorzuführen, braucht es eigentlich nicht.
In einem Brief an die Stadt Heidelberg schreibt Torch: "Ich würde mich freuen, wenn eine solche geschichtsträchtige Stadt wie Heidelberg auch diesen Teil ihrer Geschichte erkennt und dieses Geschenk annimmt". Der Jugendgemeinderat ist bereits überzeugt und hat ohne Gegenstimme für das Archiv votiert. Der richtige Gemeinderat muss hingegen erst noch entscheiden, am morgigen Donnerstag soll sich der Kulturausschuss mit dem Thema befassen."
Am 15.12.2011 wird darüber wohl abschließend im Heidelberger Gemeinderat beraten. Ob sich Kollege Blum freut - über die neuen Kollegen in der Stadt.
Quelle: rap.de, 23.11.2011
Wolf Thomas - am Sonntag, 27. November 2011, 22:15 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://mashable.com/2011/11/24/google-search-infographic/
A recent study at Illinois Wesleyan University found that fewer than 25% of students could perform a “reasonably well-executed search.” Wrote researchers, “The majority of students — of all levels — exhibited significant difficulties that ranged across nearly every aspect of the search process.”
A recent study at Illinois Wesleyan University found that fewer than 25% of students could perform a “reasonably well-executed search.” Wrote researchers, “The majority of students — of all levels — exhibited significant difficulties that ranged across nearly every aspect of the search process.”
KlausGraf - am Sonntag, 27. November 2011, 16:35 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Christian Bracht (Marburg), Robert Giel (Berlin), Carolin Schreiber (München), Ralf Stegmann (Rodgau)
Manuscripta Mediaevalia: neuer Webauftritt und Perspektiven (C. Schreiber, ppt)
Rechtliche Aspekte der Veröffentlichungen in Manuscripta Mediaevalia (C. Bracht, ppt)
http://www.hab.de/bibliothek/sammlungen/hzdfg/handschriftenbearbeitertagung-2011-abstracts.htm
Natürlich beschränkt sich die Inkompetenz der Macher von ManuMed nicht auf den Internetauftritt des Portals, sie haben offenkundig auch vom Urheberrecht nicht die geringste Ahnung. Selbstverständlich gibt es nach deutschem Recht kein 50jähriges Leistungsschutzrecht an ihren Katalogen nach Erstveröffentlichung (so Folie 2 von Bracht, Rechtliche Aspekte).
Steinhauer sagt klar (und seit 2009 hat sich die Rechtslage nicht geändert):
"Der deutschen Urheberrechtsgesetzgeber hat [...] den Verlagen kein Leistungsschutzrecht am Layout ihrer Publikation zugesprochen."
http://www.bibliotheksrecht.de/2009/02/17/scannen-originale-5594501/
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/5525695/
Die Inkompetenz von ManuMed hat leider dazu geführt, dass unzählige gescannte Kataloge 2005 entfernt werden mussten, obwohl dazu nach der damaligen Rechtslage überhaupt kein Anlass bestand:
"Dass man sich “aus Gründen des Urheberrechts” 2005 gezwungen sah, zahlreiche Kataloge wieder zu entfernen, beweist ein hohes Maß an Unprofessionalität, denn bei den vor 1995 erschienenen Katalogen galt damals noch die Regelung, dass unbekannte Nutzungsarten (hier: Online-Nutzung) nicht vertraglich wirksam übertragen werden konnten. "
http://archiv.twoday.net/stories/11899641/
Manuscripta Mediaevalia: neuer Webauftritt und Perspektiven (C. Schreiber, ppt)
Rechtliche Aspekte der Veröffentlichungen in Manuscripta Mediaevalia (C. Bracht, ppt)
http://www.hab.de/bibliothek/sammlungen/hzdfg/handschriftenbearbeitertagung-2011-abstracts.htm
Natürlich beschränkt sich die Inkompetenz der Macher von ManuMed nicht auf den Internetauftritt des Portals, sie haben offenkundig auch vom Urheberrecht nicht die geringste Ahnung. Selbstverständlich gibt es nach deutschem Recht kein 50jähriges Leistungsschutzrecht an ihren Katalogen nach Erstveröffentlichung (so Folie 2 von Bracht, Rechtliche Aspekte).
Steinhauer sagt klar (und seit 2009 hat sich die Rechtslage nicht geändert):
"Der deutschen Urheberrechtsgesetzgeber hat [...] den Verlagen kein Leistungsschutzrecht am Layout ihrer Publikation zugesprochen."
http://www.bibliotheksrecht.de/2009/02/17/scannen-originale-5594501/
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/5525695/
Die Inkompetenz von ManuMed hat leider dazu geführt, dass unzählige gescannte Kataloge 2005 entfernt werden mussten, obwohl dazu nach der damaligen Rechtslage überhaupt kein Anlass bestand:
"Dass man sich “aus Gründen des Urheberrechts” 2005 gezwungen sah, zahlreiche Kataloge wieder zu entfernen, beweist ein hohes Maß an Unprofessionalität, denn bei den vor 1995 erschienenen Katalogen galt damals noch die Regelung, dass unbekannte Nutzungsarten (hier: Online-Nutzung) nicht vertraglich wirksam übertragen werden konnten. "
http://archiv.twoday.net/stories/11899641/
KlausGraf - am Sonntag, 27. November 2011, 16:17 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Fast alle Präsentationen der Wolfenbütteler Handschriftenbearbeitertagung sind online:
http://www.hab.de/bibliothek/sammlungen/hzdfg/handschriftenbearbeitertagung-2011-abstracts.htm
Zu "Handschriften" in Archiven:
Anne-Beate Riecke (Berlin)
Handschriften in Archiven und Bibliotheken – Texte zwischen zwei Welten? (ppt)
http://www.hab.de/bibliothek/sammlungen/hzdfg/handschriftenbearbeitertagung-2011-abstracts.htm
Zu "Handschriften" in Archiven:
Anne-Beate Riecke (Berlin)
Handschriften in Archiven und Bibliotheken – Texte zwischen zwei Welten? (ppt)
KlausGraf - am Sonntag, 27. November 2011, 16:05 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"alle Referentinnen und Referenten des Workshop „Usability of the Archives of the International Tracing Service“, der am 10. und 11. Oktober 2011 in den Räumen des Internationalen Suchdienstes in Bad Arolsen stattfand, haben – soweit es ihnen möglich war – ihre Abstracts, Redebeiträge und Präsentationen für die Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Sie stehen nun auf den Websites des ITS zusammen mit einem knappen Tagungsbericht zur Ansicht und zum Download zur Verfügung."
http://www.its-arolsen.org/de/startseite/aktuelles/index.html?expand=5591&cHash=5eb21bff1f
Kühnel in der Archivliste
http://www.its-arolsen.org/de/startseite/aktuelles/index.html?expand=5591&cHash=5eb21bff1f
Kühnel in der Archivliste
KlausGraf - am Sonntag, 27. November 2011, 16:02 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
lautet der schöne Titel eines Artikels über die Geschichte des Reggae, in dem es über die ökonomischen Grundlagen dieser Musik heißt:
"Beschleunigt wird diese Produktionsweise durch das eigentümliche Copyright in Jamaika – das als Gewohnheitsrecht auch im Rest der Reggae-Welt gilt: Die instrumentalen Kompositionen (in der Fachsprache: „Riddims“), zu denen Gesangseinlagen aller Art entstehen können, gelten als öffentliches Gut, sind also frei kopierbar. So kommt es, dass von jedem halbwegs erfolgreichen Reggae-Song innerhalb weniger Wochen unzählige „Versionen“ entstehen, eine origineller, durchgeknallter oder einfach nur schöner als die andere."
http://www.zeit.de/musik/genreuebersichten/reggae
Leider wird auf das "eigentümliche Copyright" nicht näher eingegangen und Wikipedia kann hier ebenfalls nur eine "laxe[] Handhabung des Urheberrechts" erkennen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Riddim
Wer sich gezielt verschiedene Varianten und Adaptionen eines Riddim anhört, findet Beispiele dafür, dass diese Produktionsweise kein kunstloses Klauen darstellen muss, sondern das respektvolle Aufnehmen und kreative Fortführen einer Tradition.
"Beschleunigt wird diese Produktionsweise durch das eigentümliche Copyright in Jamaika – das als Gewohnheitsrecht auch im Rest der Reggae-Welt gilt: Die instrumentalen Kompositionen (in der Fachsprache: „Riddims“), zu denen Gesangseinlagen aller Art entstehen können, gelten als öffentliches Gut, sind also frei kopierbar. So kommt es, dass von jedem halbwegs erfolgreichen Reggae-Song innerhalb weniger Wochen unzählige „Versionen“ entstehen, eine origineller, durchgeknallter oder einfach nur schöner als die andere."
http://www.zeit.de/musik/genreuebersichten/reggae
Leider wird auf das "eigentümliche Copyright" nicht näher eingegangen und Wikipedia kann hier ebenfalls nur eine "laxe[] Handhabung des Urheberrechts" erkennen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Riddim
Wer sich gezielt verschiedene Varianten und Adaptionen eines Riddim anhört, findet Beispiele dafür, dass diese Produktionsweise kein kunstloses Klauen darstellen muss, sondern das respektvolle Aufnehmen und kreative Fortführen einer Tradition.
SW - am Sonntag, 27. November 2011, 15:10 - Rubrik: Kulturgut
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Er legt nun nach, nachdem er zuvor kurz beteuert hat, er habe nicht zum Klauen von Musik aufgerufen:
https://plus.google.com/115216050683969364926/posts/N9NpqzvgKVa
anwälte, die ihr komplettes geschäft darauf basieren lassen kids, studenten oder sonst wen mit abstrusen summen abzuzocken, sind miese schweine! punkt! denn da geht es nicht um recht oder unrecht und das gesetz. sie haben einfach ein super funktionierendes geschäftsmodell gefunden wie sie sich mit wenig aufwand die taschen voll machen. die darbende musikbranche und die studios, videoproduktionsfirmen, labels, etc die alle pleite gehen haben davon nix! es kann auch nicht als abschreckungsmaßnahme dienen, weil es nur den hass gegen die konzerne schürt. man prügelt nicht die hand die einen füttern könnte.
Zuvor hieß es von ihm:
saugt bitte alle ruhig weiter, und lasst euch nicht erwischen!
Update:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Alles-miese-Schweine-Jan-Delay-schiesst-scharf-gegen-Abmahnanwaelte-1385880.html
https://plus.google.com/115216050683969364926/posts/N9NpqzvgKVa
anwälte, die ihr komplettes geschäft darauf basieren lassen kids, studenten oder sonst wen mit abstrusen summen abzuzocken, sind miese schweine! punkt! denn da geht es nicht um recht oder unrecht und das gesetz. sie haben einfach ein super funktionierendes geschäftsmodell gefunden wie sie sich mit wenig aufwand die taschen voll machen. die darbende musikbranche und die studios, videoproduktionsfirmen, labels, etc die alle pleite gehen haben davon nix! es kann auch nicht als abschreckungsmaßnahme dienen, weil es nur den hass gegen die konzerne schürt. man prügelt nicht die hand die einen füttern könnte.
Zuvor hieß es von ihm:
saugt bitte alle ruhig weiter, und lasst euch nicht erwischen!
Update:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Alles-miese-Schweine-Jan-Delay-schiesst-scharf-gegen-Abmahnanwaelte-1385880.html
KlausGraf - am Samstag, 26. November 2011, 22:01 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In der ZEIT spricht Guttenberg sehr ausführlich über seine Doktorarbeit und beteuert, es sei kein Betrug gewesen:
http://www.zeit.de/2011/48/DOS-Guttenberg/seite-1
Von den 179 Treffern zum Suchwort Guttenberg in Archivalia betreffen über 160 den Plagiatsfall:
http://archiv.twoday.net/search?q=guttenberg&start=160
Zum Thema lesenswert:
http://de.wikipedia.org/wiki/Plagiatsaff%C3%A4re_Guttenberg

http://www.zeit.de/2011/48/DOS-Guttenberg/seite-1
Von den 179 Treffern zum Suchwort Guttenberg in Archivalia betreffen über 160 den Plagiatsfall:
http://archiv.twoday.net/search?q=guttenberg&start=160
Zum Thema lesenswert:
http://de.wikipedia.org/wiki/Plagiatsaff%C3%A4re_Guttenberg

KlausGraf - am Samstag, 26. November 2011, 21:35 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
Grünen-Ströbele hat das Heddesheim-Blog abmahnen lassen, weil dort berichtet wurde, er habe einen 13jährigen angezeigt. Obwohl die Staatsanwaltschaft das zunächst bestätigte, erhielt der Blogger eine Abmahnung, denn in Wirklichkeit hat die Anzeige Frau Ströbele getätigt.
http://www.heddesheimblog.de/2011/11/22/ehefrau-von-bundestagsmitglied-christian-strobele-grune-zeigte-13-jahrigen-heddesheimer-an/
Interessant ist der Kommentar des Bloggers im Lawblog:
Guten Tag!
Besten Dank, Herr Vetter, für Ihren Beitrag und danke an die Kommentatoren für die Einschätzungen.
Was einzelne Kommentare angeht…
Journalistisch: Die Informationen für diesen Artikel wurden umfangreicher gegengecheckt – wie immer und ganz selbstverständlich. Alle, inklusive Staatsanwalt, haben den Eindruck weitergegeben, dass Herr Ströbele der Anzeiger war. Hätte es daran einen Zweifel gegeben, wären wir dem nachgegangen – was wir dann ja auch gemacht haben. Herr Ströbele war zudem aufgefordert, Stellung zu nehmen.
Tatsächlich wars wohl seine Frau – davon haben die Angler durch die sofortige Korrektur auf unseren Seiten erfahren.
Spende:
Ich bin seit 20 Jahren im Job und habe 18 Jahre ohne jede juristische Auseinandersetzung oder Gegendarstellung hinter mich gebracht. Seit zwei Jahren blogge ich und das ist nunmehr Abmahnung Nummer 11, von vier weiteren, die nicht zugesandt wurden, habe ich Kenntnis.
Bilanz: 11 juristische Beratungen, acht Abmahnungen wurden nicht weiter verfolgt, eine Einstweilige Verfügung aus Kostengründen und ein Vergleich. Dies ist der erste Spendenaufruf, weil es langsam zu teuer wird, um sich gegen diesen Abmahnschwachsinn mit fliegenden Gerichtsständen auf Dauer aus eigener Tasche zu wehren.
Ich selbst habe noch niemanden abgemahnt, obwohl es dazu Gelegenheit gegeben hat. Es ist eine Frage des Charakters, wie man sich verhält.
Juristisch:
Wenn die Recherchepraxis so aussehen muss, dass man sich für jede Aussage eine Eidesstaatliche Erklärung besorgen muss, vorher drei Anwälte lesen lässt, nur schriftlich belegte und besiegelte Informationen verbreitet und im Zweifel lieber nichts berichtet, ist der Journalismus genau eins, nämlich tot. Wer sich das wünscht, soll weiterlästern.
Beste Grüße
Hardy Prothmann
http://www.lawblog.de/index.php/archives/2011/11/25/strbele-mahnt-ab-was-ist-eine-anzeige/
Und noch was Schönes von den Ruhrbaronen:
Tja, als Politiker kommt Ströbele immer als der Urtyp der Froschfarbenen rüber. Fahrrad, Kreuzberg, keine Ahnung vom Internet und so. Jemand, mit dem man auf keine Fall ein Bier trinken will, weil er einen den ganzen Abend vollsülzen würde, aber der ganz ok ist. Menschlich und so. Ist er aber scheinbar nicht. Denn was er da mit Hardy macht ist eine miese Nummer. Aber das schöne ist: Das wissen jetzt alle. Und Ströbele kann ja mal die Kinderreporter fragen, was der Streisand-Effekt ist...
http://www.ruhrbarone.de/barbara-stroebele-und-das-fuschfutterattentat/
http://www.heddesheimblog.de/2011/11/22/ehefrau-von-bundestagsmitglied-christian-strobele-grune-zeigte-13-jahrigen-heddesheimer-an/
Interessant ist der Kommentar des Bloggers im Lawblog:
Guten Tag!
Besten Dank, Herr Vetter, für Ihren Beitrag und danke an die Kommentatoren für die Einschätzungen.
Was einzelne Kommentare angeht…
Journalistisch: Die Informationen für diesen Artikel wurden umfangreicher gegengecheckt – wie immer und ganz selbstverständlich. Alle, inklusive Staatsanwalt, haben den Eindruck weitergegeben, dass Herr Ströbele der Anzeiger war. Hätte es daran einen Zweifel gegeben, wären wir dem nachgegangen – was wir dann ja auch gemacht haben. Herr Ströbele war zudem aufgefordert, Stellung zu nehmen.
Tatsächlich wars wohl seine Frau – davon haben die Angler durch die sofortige Korrektur auf unseren Seiten erfahren.
Spende:
Ich bin seit 20 Jahren im Job und habe 18 Jahre ohne jede juristische Auseinandersetzung oder Gegendarstellung hinter mich gebracht. Seit zwei Jahren blogge ich und das ist nunmehr Abmahnung Nummer 11, von vier weiteren, die nicht zugesandt wurden, habe ich Kenntnis.
Bilanz: 11 juristische Beratungen, acht Abmahnungen wurden nicht weiter verfolgt, eine Einstweilige Verfügung aus Kostengründen und ein Vergleich. Dies ist der erste Spendenaufruf, weil es langsam zu teuer wird, um sich gegen diesen Abmahnschwachsinn mit fliegenden Gerichtsständen auf Dauer aus eigener Tasche zu wehren.
Ich selbst habe noch niemanden abgemahnt, obwohl es dazu Gelegenheit gegeben hat. Es ist eine Frage des Charakters, wie man sich verhält.
Juristisch:
Wenn die Recherchepraxis so aussehen muss, dass man sich für jede Aussage eine Eidesstaatliche Erklärung besorgen muss, vorher drei Anwälte lesen lässt, nur schriftlich belegte und besiegelte Informationen verbreitet und im Zweifel lieber nichts berichtet, ist der Journalismus genau eins, nämlich tot. Wer sich das wünscht, soll weiterlästern.
Beste Grüße
Hardy Prothmann
http://www.lawblog.de/index.php/archives/2011/11/25/strbele-mahnt-ab-was-ist-eine-anzeige/
Und noch was Schönes von den Ruhrbaronen:
Tja, als Politiker kommt Ströbele immer als der Urtyp der Froschfarbenen rüber. Fahrrad, Kreuzberg, keine Ahnung vom Internet und so. Jemand, mit dem man auf keine Fall ein Bier trinken will, weil er einen den ganzen Abend vollsülzen würde, aber der ganz ok ist. Menschlich und so. Ist er aber scheinbar nicht. Denn was er da mit Hardy macht ist eine miese Nummer. Aber das schöne ist: Das wissen jetzt alle. Und Ströbele kann ja mal die Kinderreporter fragen, was der Streisand-Effekt ist...
http://www.ruhrbarone.de/barbara-stroebele-und-das-fuschfutterattentat/
KlausGraf - am Samstag, 26. November 2011, 18:03 - Rubrik: Archivrecht
Der Pirat Dirk Hillbrecht kommentiert das Vorgehen der Loriot-Erben.
http://blog.hillbrecht.de/wp-content/uploads/2011/11/gesperrt.png
Dieser Tage stirbt Loriot einen zweiten Tod. Abzusehen war dies bereits vor einigen Tagen, als Heise Online vermeldete, die Loriot-Erben hätten die Wikipedia wegen der Abbildung von Briefmarken mit typischen Loriot-Motiven verklagt. [...]
Es mag vielen von uns nicht bewusst sein, aber die „westliche Welt” hat in den vergangenen 50 Jahren eines der repressivsten, öffentlichkeitsfeindlichsten und insgesamt kulturschädlichsten Urheberrechts– und Verwertungsregime der Menschheitsgeschichte installiert. Nur so sind Mechanismen wie die oben geschilderten durchsetzbar — zum Schaden aller Beteiligten. Kulturelle Werke können auf Zuruf der Öffentlichkeit entzogen werden, ein Interessensausgleich für eben diese Öffentlichkeit — die durch ihr Interesse ja überhaupt erst eine Grundlage für die Relevanz des Kulturguts geschaffen hat — findet nicht statt. Erstaunlich, dass derlei Treiben so unwidersprochen in Öffentlichkeit und Politik bleibt.
Siehe dazu auch
http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q="privatrechtlicher+verfügbarkeit"
http://archiv.twoday.net/search?q=loriot

http://blog.hillbrecht.de/wp-content/uploads/2011/11/gesperrt.png
Dieser Tage stirbt Loriot einen zweiten Tod. Abzusehen war dies bereits vor einigen Tagen, als Heise Online vermeldete, die Loriot-Erben hätten die Wikipedia wegen der Abbildung von Briefmarken mit typischen Loriot-Motiven verklagt. [...]
Es mag vielen von uns nicht bewusst sein, aber die „westliche Welt” hat in den vergangenen 50 Jahren eines der repressivsten, öffentlichkeitsfeindlichsten und insgesamt kulturschädlichsten Urheberrechts– und Verwertungsregime der Menschheitsgeschichte installiert. Nur so sind Mechanismen wie die oben geschilderten durchsetzbar — zum Schaden aller Beteiligten. Kulturelle Werke können auf Zuruf der Öffentlichkeit entzogen werden, ein Interessensausgleich für eben diese Öffentlichkeit — die durch ihr Interesse ja überhaupt erst eine Grundlage für die Relevanz des Kulturguts geschaffen hat — findet nicht statt. Erstaunlich, dass derlei Treiben so unwidersprochen in Öffentlichkeit und Politik bleibt.
Siehe dazu auch
http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q="privatrechtlicher+verfügbarkeit"
http://archiv.twoday.net/search?q=loriot

KlausGraf - am Samstag, 26. November 2011, 17:47 - Rubrik: Archivrecht
"Bei dem in Deutschland entwickelten Online-Spiel „TwinKomplex" werden die handelnden Personen nicht von Avataren verkörpert, sondern von realen Schauspielern. Das neue Social Game ist eine Art Agententhriller. Es besteht aus einem Mix von Spielfilmausschnitten im YouTube-Stil, Webseiten und Audio-Dateien."Ludic Philosophy", die Firma des Berliner Unternehmers Martin Burckhardt, hat das neuartige Online-Spiel entwickelt. Das Unternehmen setzt auf die steigende Beliebtheit von so genannten Social Games, bei denen die Nutzer über einen Internetbrowser miteinander oder gegeneinander spielen. Alleine über das soziale Netzwerk „Facebook" spielen schätzungsweise rund 200 Millionen Menschen weltweit Social Games. Bei TwinKomplex heuert der Spieler als Agent bei der Organisation namens „DIA" an. Die Aufgabe: Ein verschwundener Agent soll wiedergefunden werden. Der Spieler löst den Fall vom Schreibtisch aus, zusammen mit anderen Mitspielern. Informationen liefern ihm unter anderem die Schauspieler, die sich über kurze Clips immer wieder zu Wort melden. TwinKomplex ist kostenlos. Finanzieren wollen sich die Macher über freiwillige Zahlungen, durch die sich der Spieler Vorteile erkaufen an."
Wäre ein solches social game mit archivischer Story denkbar? Ich jedenfalls würde es gerne sehen!
Wolf Thomas - am Samstag, 26. November 2011, 16:26 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
... "mit der sehr gelungenen Website "Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui". Die Navigation erfolgt über die "Carte de Cassini" oder über den Namen eines Ortes. Das Dossier über einen Ort enthält u.a die Entwicklung der Einwohnerzahlen und ist downloadbar:" http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/index.htm
Via Mareike König, G+

Via Mareike König, G+

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.allgemeine-zeitung.de/region/kultur/literatur/11395018.htm
Auch wenn die Stadtbibliothek nun wohl doch nicht auf verschiedene Standorte aufgeteilt wird - der von der Ampelkoalition verordnete Sparkurs mit der Streichung von 20 Stellen und der Kürzung des Anschaffungsbudgets um die Hälfte stößt weiter auf Kritik. Die Stadtbibliothek werde „de facto kaputt gespart“, so der ehemalige Inhaber des (bis zu seinem Umzug nach Darmstadt) 200 Jahre in Mainz ansässigen Philipp von Zabern Verlages, Franz Philipp Rutzen, der in einem Schreiben die Ampelkoalitionäre auffordert, die Sparpläne neu zu prüfen und „wo immer es vertretbar ist, fallen zu lassen“. Eine Bibliothek könne man nicht kaltstellen, indem man so beträchtlich an Personal und Anschaffungen spare, dass sie sehr bald ihren Aufgaben nicht mehr gerecht werden könne. Wenn bald nur noch ein Notbetrieb möglich sei, werde man nicht einmal mehr recherchieren können, was die Bibliothek überhaupt besitze, so Rutzen. Die Besucher blieben aus, das Haus sieche dahin, der Druck zu weiteren Reduzierungen wachse und die Bibliothek könne schnell ganz zur Disposition stehen, sobald ihre Bestände anderweitig unterkommen könnten. „Es darf nicht soweit kommen, dass mit dem Einstieg der Mainzer Stadtverwaltung in den Entschuldungsfond gleichzeitig das Totenglöcklein für die wissenschaftliche Stadtbibliothek geläutet wird“, appelliert Rutzen.
Der ganze Text des Briefs von Rutzen:
http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/bibliothek-in-not/meinungsbeitraege.html
Die Petition hat inzwischen 5050 Unterschriften erreicht - es dürfen gern noch mehr werden!
http://openpetition.de/petition/online/der-bestand-der-wissenschaftlichen-stadtbibliothek-mainz-darf-nicht-zerschlagen-werden
Siehe auch hier
http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbibliothek+mainz
und dort
http://archivalia.tumblr.com/tagged/stadtbibliothek_mainz
 Vorderdeckel des Buches: "Dissertations Historiques Et Critiques Sur La Chevalerie Ancienne Et Moderne, Seculiere Et Reguliere. Avec des Notes. Par le R. P. Honoré De Sainte Marie, Carme Déchaussé. Paris : Giffart, 1718." Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz. Signatur: IV f 4 133
Vorderdeckel des Buches: "Dissertations Historiques Et Critiques Sur La Chevalerie Ancienne Et Moderne, Seculiere Et Reguliere. Avec des Notes. Par le R. P. Honoré De Sainte Marie, Carme Déchaussé. Paris : Giffart, 1718." Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz. Signatur: IV f 4 133
Auch wenn die Stadtbibliothek nun wohl doch nicht auf verschiedene Standorte aufgeteilt wird - der von der Ampelkoalition verordnete Sparkurs mit der Streichung von 20 Stellen und der Kürzung des Anschaffungsbudgets um die Hälfte stößt weiter auf Kritik. Die Stadtbibliothek werde „de facto kaputt gespart“, so der ehemalige Inhaber des (bis zu seinem Umzug nach Darmstadt) 200 Jahre in Mainz ansässigen Philipp von Zabern Verlages, Franz Philipp Rutzen, der in einem Schreiben die Ampelkoalitionäre auffordert, die Sparpläne neu zu prüfen und „wo immer es vertretbar ist, fallen zu lassen“. Eine Bibliothek könne man nicht kaltstellen, indem man so beträchtlich an Personal und Anschaffungen spare, dass sie sehr bald ihren Aufgaben nicht mehr gerecht werden könne. Wenn bald nur noch ein Notbetrieb möglich sei, werde man nicht einmal mehr recherchieren können, was die Bibliothek überhaupt besitze, so Rutzen. Die Besucher blieben aus, das Haus sieche dahin, der Druck zu weiteren Reduzierungen wachse und die Bibliothek könne schnell ganz zur Disposition stehen, sobald ihre Bestände anderweitig unterkommen könnten. „Es darf nicht soweit kommen, dass mit dem Einstieg der Mainzer Stadtverwaltung in den Entschuldungsfond gleichzeitig das Totenglöcklein für die wissenschaftliche Stadtbibliothek geläutet wird“, appelliert Rutzen.
Der ganze Text des Briefs von Rutzen:
http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/bibliothek-in-not/meinungsbeitraege.html
Die Petition hat inzwischen 5050 Unterschriften erreicht - es dürfen gern noch mehr werden!
http://openpetition.de/petition/online/der-bestand-der-wissenschaftlichen-stadtbibliothek-mainz-darf-nicht-zerschlagen-werden
Siehe auch hier
http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbibliothek+mainz
und dort
http://archivalia.tumblr.com/tagged/stadtbibliothek_mainz
 Vorderdeckel des Buches: "Dissertations Historiques Et Critiques Sur La Chevalerie Ancienne Et Moderne, Seculiere Et Reguliere. Avec des Notes. Par le R. P. Honoré De Sainte Marie, Carme Déchaussé. Paris : Giffart, 1718." Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz. Signatur: IV f 4 133
Vorderdeckel des Buches: "Dissertations Historiques Et Critiques Sur La Chevalerie Ancienne Et Moderne, Seculiere Et Reguliere. Avec des Notes. Par le R. P. Honoré De Sainte Marie, Carme Déchaussé. Paris : Giffart, 1718." Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz. Signatur: IV f 4 133KlausGraf - am Samstag, 26. November 2011, 15:18 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen