Eine Inkunabel der Marciana (Gesamtpdf ist übrigens fehlerfrei)
http://iccu01e.caspur.it/ms/internetCulturale.php?id=oai%3A193.206.197.121%3A18%3AVE0049%3AARM0000004&teca=marciana
Update:
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/SANSROB.htm
verlinkt wenig originell:
http://iccu01e.caspur.it/ms/internetCulturale.php?id=oai%3A193.206.197.121%3A18%3AVE0049%3AARM0000004&teca=marciana
Der GW hatte also Besseres zu tun, als sich nach einem persistenten Link zu erkundigen.

http://iccu01e.caspur.it/ms/internetCulturale.php?id=oai%3A193.206.197.121%3A18%3AVE0049%3AARM0000004&teca=marciana
Update:
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/SANSROB.htm
verlinkt wenig originell:
http://iccu01e.caspur.it/ms/internetCulturale.php?id=oai%3A193.206.197.121%3A18%3AVE0049%3AARM0000004&teca=marciana
Der GW hatte also Besseres zu tun, als sich nach einem persistenten Link zu erkundigen.

KlausGraf - am Samstag, 9. Juni 2012, 23:36 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Es ist erbärmlich, wie wenig sich seit 2004 zum Guten gewendet hat ...
Klaus Graf: Was erwartet die Forschung vom digitalen Angebot der Bibliotheken?
Vortrag am 4. März 2004 im Rahmen des Workshops "Neue Wege zu alten Quellen"
http://www.ceec.uni-koeln.de/projekte/CEEC/project/workshopkoeln04.pdf
Der Untertitel meines Beitrags lautet: eine Philippika.
Daher beginne ich mit einer bewußt provozierenden These:
Digitalisierungsprojekte Alter Drucke sind zum derzeitigen
Zeitpunkt für die Wissenschaft weitgehend wertlos, da die
Digitalisierung an den Bedürfnissen der Forschung vorbei
erfolgt, da sie chaotisch-unkoordiniert, ohne hinreichende
Sacherschließung, in benutzerunfreundlicher Weise und
hinter dem Rücken der Wissenschaft, also ohne die gebotene
Information über die Resultate, betrieben wird.
Es versteht sich von selbst, dass diese Beurteilung
ungerecht, unbescheiden, undankbar und ungeduldig ist.
Ungeduldig deshalb, weil das Internet seit noch nicht
einmal zehn Jahren populär ist. Wir befinden uns also,
zumal vor dem Hintergrund jahrhundertealter Buchkultur,
immer noch in einer Experimentierphase.
Undankbar deshalb, weil ich bei meiner eigenen
wissenschaftlichen Arbeit als Historiker schon des öfteren
konkret von Digitalisierungsprojekten profitiert habe.
Um nur ein Beispiel herauszugreifen: Die Bielefelder
Bereitstellung der Aufklärungszeitschriften macht einen
grandiosen Bestand an historischen Primärquellen verfügbar.
http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung/
Die Titel der einzelnen Aufsätze sind bequem suchbar und
durch eine Verschlagwortung angemessen erschlossen. In
einer dieser Zeitschriften traf ich auf ein anonymisiertes
Dokument zum Thema Hexenprozesse, das ich mit eigenem
Vorwissen als das bisher nicht bekannte Todesurteil der
1751 im Breisgauer Endingen als Hexe hingerichteten Anna
Trutt identifizieren konnte - eine echte Entdeckung für die
Hexenforschung.
Aber ich denke für die Projektjubelprosa sind hier andere
zuständig. Auch ich begrüße es, daß so viel digitalisiert
wird, aber ich finde dieses Geschäft sollte
verantwortungsbewußter und mit mehr Gespür für die
Bedürfnisse der potentiellen Nutzer betrieben werden. Es
sind oft Selbstverständlichkeiten, die vernachlässigt
werden und die man mit vergleichsweise geringem Aufwand
(und ohne jahrelangen Vorlauf bis zur Projektbewilligung)
realisieren könnte.
Natürlich kann ich hier nicht für DIE Wissenschaft
sprechen, noch nicht einmal für meine eigene Disziplin.
Meine subjektive Sicht auf Digitalisierungsprojekte ist die
eines eingefleischten Fans, der um so mehr an ihren
offenkundigen Mängeln, die aber kaum einmal öffentlich zur
Sprache kommen, leidet.
Ich wende mich im folgenden pauschal an die Bibliotheken,
obwohl ich weiß, daß es auch Museen und Archive gibt, die
Alte Drucke digitalisiert haben. Handschriften,
Archivalien, Bilder und Karten werfen eigene Probleme auf,
aber ich denke, vieles von dem, was ich im folgenden
ausführen will, läßt sich auch auf diese Dokumenttypen
übertragen.
Viele Akademiker nutzen das Internet dilettantisch und
unprofessionell, wenn sie es denn überhaupt nutzen. Bereits
jetzt liegt ein riesiger Quellenfundus an Alten Drucken
weltweit vor, der auch in der Lehre nutzbringend eingesetzt
werden könnte, aber selbst Nutzer, die das Stadium des
digitalen Analphabeten und Google-Einwortsuchers hinter
sich gelassen haben, sind mit dem Aufspüren dieser
verborgenen digitalen Schätze überfordert. Aus der Sicht
des Nutzers ist dies das Hauptproblem: Es gibt keine
einfache Suchstrategie, um die für ihn wissenschaftlich
einschlägigen digitalen Inhalte aufzufinden. Bevor man
weiter wild vor sich hin digitalisiert, sollte man erst
einmal dafür sorgen, daß das bereits Digitalisierte
überhaupt zur Kenntnis genommen wird.
Daher betrifft mein erster Punkt die mangelhafte
Information der Wissenschaft.
Das dringendste Desiderat ist eine einfach benutzbare
Datenbank der weltweit bereits frei verfügbaren
Digitalisate und eine ergänzende Dokumentation auf
suchmaschinenfreundlichen HTML-Seiten.
Die Datenbank sollte als reine Datenbank von
Online-Ressourcen wie die GBV-Online-Ressourcen organisiert
und via KVK abfragbar sein, also nicht nur wie die
GBV-Online-Ressourcen über den Karlsruher Virtuellen
Volltextkatalog, der nun OASE heißt.
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvvk.html
Eine solche Datenbank könnte in vielen Fällen die
Fremddaten des Digitalisierungsprojekts, die etwa in MARC
vorliegen, nach Absprache mit dem Projektträger nutzen.
Wenn man in ein kooperatives Projekt allein die Zeit, die
für das Erstellen dämlicher und überflüssiger allgemeiner
Linkkataloge durch Fachreferenten vertan wird, einbringt
und sich international geschickt vernetzt, könnte eine
solche Datenbank kostengünstig und ziemlich schnell
realisiert werden.
Es ist aber noch nicht einmal selbstverständlich, daß
Bibliotheken ihre Digitalisate in den eigenen
Bibliothekskatalog aufnehmen und vom digitalisierten Werk
auf das Digitalisat verweisen (MIAMI Münster). Natürlich
sollten alle Digitalisate auch im Verbundkatalog
recherchierbar sein.
Zugleich sollten auch Repositorien Alter Drucke die
Standards der Open Access Initiative erfüllen, also über
entsprechende Harvester - am wichtigsten ist der OAIster -
genauso wie moderne Publikationen abfragbar sein.
http://oaister.umdl.umich.edu/
Es ist ein klassisches Eigentor, daß die Verantwortlichen
von Münsters MIAMI nur die Dissertationen OAI-compliant
verfügbar gemacht haben, nicht aber die derzeit an die 500
Alten Drucke aus der Barockbibliothek Nünning, von deren
Existenz die wenigsten Fachwissenschaftler Kenntnis haben
dürften.
http://miami.uni-muenster.de/
Warum daneben die suchmaschinenfreundlichen HTML-Seiten?
Weil die meisten, auch akademischen Internetnutzer nun
einmal Suchmaschinen und vor allem Google anwerfen, wenn
sie etwas im Internet finden wollen.
Suchmaschinenfreundlich heißt: Seiten unter 101 KB mit
einfachen Adressen, die hierarchisch direkt unter der
Startseite angeordnet sind, auf denen die Titel samt
Sacherschließung aufgelistet sind.
Es ist einigermaßen kurios, daß die Suchmaschine von
Forschungsportal.net in öffentlicher Trägerschaft es nicht
geschafft hat, die digitalen Angebote der
Universitätsbibliotheken komplett aufzunehmen. Anders als
bei der kommerziellen Firma Google kann man dort ganz
einfach hinmailen und sicher sein, ein offenes Ohr für die
Berücksichtigung des eigenen Projekts zu finden.
http://forschungsportal.net/
Es schadet nichts, wenn man solche HTML-Listen auch den
offenbar unausrottbaren fachspezifischen Linksammlungen
beigibt, die jede einzelne Bibliothek bastelt.
Wichtiger ist freilich, daß man mit zentralen externen
Linksammlungen aktiv kooperiert. Hier ist für die
wichtigste Wissenschaftssprache der frühen Neuzeit, das
Lateinische, die vortreffliche Online-Bibliographie
"Neolatin Texts" von Dana Sutton zu nennen, die mit derzeit
an die 9000 Texten - nicht nur Bücher, sondern auch
unselbständige Texte - so ziemlich vollständig sein dürfte.
http://eee.uci.edu/~papyri/bibliography/
Was hier ein Einzelner neben seinen akademischen
Verpflichtungen als Professor leistet, ist unbeschreiblich.
Freilich gilt es zu berücksichtigen, daß antike und
mittelalterliche Texte vor der Renaissance (ca. 1350) von
ihm ausgeklammert werden. Obwohl Digitalisierungsprojekte
das Rad schon sehr oft neu erfunden haben, könnte man bei
Suttons Liste anknüpfen und versuchen, gezielt die anderen
Sprachen abzudecken. Ich selbst habe als Privatmann im
Rahmen meines Weblogs ARCHIVALIA im Dezember letzten Jahres
ein Verzeichnis der deutschsprachigen als Faksimile
digitalisierten Drucke des 16. Jahrhunderts außerhalb der
großen Sammlungen von Wolfenbüttel, Wittenberg und
Augsburg, also des Streuguts, angelegt.
http://archiv.twoday.net/stories/113113/
Ich finde es fürchterlich, wie wenig Werbung Bibliotheken
für ihre Digitalisate machen. So versteht es die UB
Freiburg, ihre beachtlichen digitalen Sammlungen auf ihrer
Website geschickt zu verstecken.
http://www.ub.uni-freiburg.de/dipro/index.html
Allzu oft möchte man ausrufen: Stellt doch um Himmels
willen Eure beachtlichen Leistungen nicht so unter den
Scheffel!
Öffentlichkeitsarbeit ist also angesagt und auch
Pressearbeit und zwar nicht nur einmal, wenn das Projekt
eröffnet wird. Warum nicht ein "featured item of the month"
herausstellen, das ausführlich erläutert wird?
Warum liest man unter den Bibliotheks-News fast nur von den
neuesten lizenzierten Datenbanken kommerzieller Anbieter,
aber so gut wie nie von den digitalen Schmuckstücken, die
man neu anzubieten hat?
Überfällig ist ein kooperativer Neuigkeitendienst, der neu
digitalisierte Stücke etwa in Weblogform präsentiert und
natürlich einen RSS-Feed aufweisen sollte. Ich kenne nur
ein polnisches Unternehmen in Posen, das einen RSS-Feed für
seine News anbietet. Wem das zu fortschrittlich ist, darf
gern an einen Mail-Newsletter denken.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra
Werbung sollte aber nicht nur in digitalen Medien, sondern
auch in gedruckten Fachpublikationen gemacht werden. So hat
die ZfdA eine eigene Rubrik "Mittelalalter-Philologie im
Internet" eingerichtet.
http://www.uni-marburg.de/hosting/zfda/beitr.html
Ich komme nun zu meinem zweiten Punkt, die unzulängliche
Sacherschließung betreffend.
Das beginnt schon mit fehlenden Referenzen. Wer als
Bibliothekar einen deutschen Druck des 16. Jahrhunderts
digitalisiert, ohne in den Metadaten die VD 16-Nummer
anzugeben, hat nach meinem bescheidenen Dafürhalten
wesentliche Inhalte seines Berufs vergessen. Daß in der
neuen Verteilten Inkunabelbibliothek im OPAC die
Inkunabelbibliographien nicht genannt werden, ist für mich
unfaßbar.
Bei der Barockbibliothek Nünning in MIAMI ist die
Sacherschließung absolut unbrauchbar, es wird ein viel zu
weites, nichtssagendes Schlagwort gewählt. In Wolfenbüttel
sind viele Digitalisate überhaupt nicht verschlagwortet
worden.
Es fehlt an fachspezifischen, feingegliederten Übersichten,
die man hochtrabend auch Thesauri nennen mag, mit denen
sich der Forscher einen Überblick über vertretenen
Sachbereiche verschaffen könnte, wenn es sich nicht um ein
fachlich ohnehin eng begrenztes Projekt handelt.
Es sollte selbstverständlich sein, ist es aber leider
nicht, daß das Inhaltsverzeichnis des alten Drucks komplett
als E-Text digitalisiert vorliegt und dort die einzelnen
Kapitel mit den entsprechenden Links versehen sind. Wenn
man das als Pflicht bezeichnet, wird man als Kür die
Erfassung des jeweiligen Registers (ebenfalls mit
Verlinkung) oder sogar die Beigabe eines schmutzigen, also
unkorrigierten OCR-Textes bei Antiquaschriften bezeichnen
dürfen.
In der Digital Library of India, die auch einige
englischsprachige Veröffentlichungen des 19. Jahrhunderts
enthält, kann man jedenfalls in diesem OCR-Text suchen.
http://www.dli.gov.in/home.htm
Sacherschließung heißt auch, daß man so weit wie möglich
versucht, Angaben zum einzelnen Werk verfügbar zu machen,
wie sie etwa in Ausstellungs- oder Antiquariatskatalogen
erscheinen, also eine mehr oder minder ausführliche
Würdigung. Inhalte von Digitalisierungsprojekten sind ja
auch so etwas wie eine virtuelle Ausstellung. Bei solchen
Ausstellungen wünsche ich mir übrigens, daß man häufiger
ganze Werke - insbesondere geringeren Umfangs - komplett
ins Netz stellt und nicht immer nur die Titelseiten.
Wichtig wären auch Literaturangaben zum Werk oder seinem
Autor, wobei zum jeweiligen Autor auf andere seriöse
Internetinhalte - etwa die Digitalisierung der ADB -
verlinkt werden sollte. Jeder Autor sollte mit seinen
Lebensdaten, besser mit einem Biogramm vertreten sein.
Ein Wort zu den Illustrationen: Hier sollte dringend die
Zusammenarbeiten mit Projekten wie PROMETHEUS gesucht
werden, die Bilder kooperativ verfügbar machen.
Druckillustrationen sind wichtige Quellen der
Kunstgeschichte, die man spezifisch - etwa mit ICONCLASS -
erschließen sollte.
http://www.prometheus-bildarchiv.de/
Der dritte Punkt betrifft die fehlende
Benutzerfreundlichkeit.
Von der Beachtung so fundamentaler Grundsätze wie
barrierefreier Benutzung oder Usability sind nicht wenige
Digitalisierungsunternehmen weit entfernt. Ich sehe nicht
ein, wieso es nicht möglich ist, für ein so simples Produkt
wie die Digitalisierung eines Buchs, in dem einfach die
Bildseiten aufeinanderfolgen, eine spartanische Textversion
zu realisieren, die mit allen Browsern, auch den älteren,
betrachtet werden kann. Bei Kenntnis der
Benennungskonvention der Dateinamen oder einer
entsprechenden Liste sollte jeder Benutzer die Möglichkeit
haben, die Imagedateien mit einem eigenen Viewer zu sehen,
der als Freeware verfügbar sein sollte. Jedes Projekt hat
seine eigenen Navigationskonventionen und intuitiv
eingängig sind die allerwenigsten.
Ich habe neulich ziemlich viel Zeit bei der Benutzung eines
brasilianischen Digitalisierungsprojekts in Sao Paulo, das
unter anderem Schedels Weltchronik von 1493 anbietet,
vertan, bis mir aufging, daß dieses vermutlich für Netscape
7 optimiert ist und mit dem Internet Explorer nicht
ordnungsgemäß funktioniert.
http://www.obrasraras.usp.br/
Wer lästige Plugins wie DjVu einsetzt, sollte auch
alternative Formen der Ansicht realisieren.
Ein trivialer Punkt: Die Scans sollten gut lesbar sein. So
ärgert man sich bei Gallica meist über die miserable
Qualität. Man sollte sie bequem vergrößern können.
Wer nicht über eine schnelle universitäre Internetanbindung
verfügt, ist darauf angewiesen, daß er die Werke offline in
Ruhe betrachten kann. Neben dem Einsatz eines
Offlinereaders ist da die Erstellung eines PDF, wie es von
Gallica angeboten wird, höchst willkommen. Daß diese
Möglichkeit bewußt nicht angeboten wird, da man Mißbrauch
befürchtet, ist schlicht und einfach ärgerlich - mehr dazu
unten beim Punkt "Open Access".
http://gallica.bnf.fr/
Alle Digitalisate sollten eine kurze Internetadresse, die
man auch in gedruckten Publikationen zitieren kann, haben,
am besten als Persistant Identifier (PURL oder URN).
Vorbildlich die Portugiesische Nationalbibliothek, die
einen alten Druck mit dem folgenden URL zugänglich macht:
http://purl.pt/360/
Auch sollte für Zitatzwecke die einzelne Seite des Werks
bequem verlinkbar sein.
Hinsichtlich der Suchmöglichkeiten habe ich oben schon
einiges gesagt. Auf jeden Fall sollte eine Möglichkeit des
Browsings gegeben sein, wie es ärgerlicherweise von der
Lutherhalle Wittenberg nicht angeboten wird. Dort kann noch
nicht einmal in der Suche nach digitalisierten Inhalten
gefiltert werden, was es beispielsweise Mr. Sutton
außerordentlich erschwert hat, die lateinischen Drucke
dieses riesigen Angebots einer Institution, die sich als
Museum versteht, in seine Bibliographie aufzunehmen.
http://luther.hki.uni-koeln.de/luther/pages/sucheDrucke.html
Neben simplen sollten auch ausgefeilte Suchmöglichkeiten
angeboten werden, also etwa die Suche nach Werken, die
innerhalb eines zeitlichen Intervalls erschienen sind.
Standardmäßig sollten alle Digitalisierungsprojekte
alternativ mit englischer Benutzungsoberfläche angeboten
werden. Dies betrifft nicht nur unsere eigenen deutschen
Unternehmungen, sondern auch solche in Japan, wobei hier
sicher freundliche kollegiale Kommunikation Wunder bewirken
könnte.
Mein nächstes Monitum - Punkt 4 - ist überschrieben mit "An
den Bedürfnissen der Nutzer vorbei" und thematisiert die
Auswahl der Werke.
Für den Nutzer ist es prima facie irrelevant, wenn Alciatos
Emblembuch oder Vesalius mehrfach im Web vertreten ist,
oder wenn das Innsbrucker Projekt ALO und die Wittenberger
Lutherhalle das gleiche seltene Werk von Abt Trithemius
anbieten. Den Malleus maleficarum gibt es in Ausgaben des
16. Jahrhunderts dreifach, zweimal in Spanien, einmal in
Cornell, aber die maßgebliche Inkunabelausgabe, die als
Faksimile in den Bibliotheken steht, ist meines Wissens
nirgends einsehbar.
Das meine ich mit "chaotisch-unkoordiniert": Man
digitalisiert Alte Drucke, wobei die Überschneidungen bei
der frühneuzeitlichen Wissenschaftssprache Latein am
größten sein dürften, ohne Kenntnis anderer
Digitalisierungen und ohne internationale Koordination -
und ohne hinreichende Mitwirkung der potentiellen
wissenschaftlichen Nutzer. Statt Lücken zu schließen,
handelt man nach der Devise "Mehr desselben", einem, wie
wir von Paul Watzlawick wissen, verhängnisvollen Motto.
Es gibt eine Reihe größerer Unternehmungen, die hierzulande
völlig unbekannt zu sein scheinen, aber mehrere hundert, ja
sogar über tausend digitalisierte Alte Drucke, darunter
auch Inkunabeln, umfassen. Im Bereich der Medizingeschichte
sind ein Pariser Projekt und das Madrider Angebot
Dioscurides zu nennen. Andere Fachbereiche werden von der
UB Sevilla, dem Gemeinschaftsprojekt der andalusischen
Bibliotheken (mit knapp hundert Inkunabeln) und einer
baskischen Bibliothek abgedeckt.
Nachdem es nun mehrere hundert lateinische Inkunabeln,
verteilt auf verschiedene Server frei zugänglich online
gibt, habe ich nicht begriffen, wieso die deutsche
Verteilte Inkunabelbibliothek mit Beständen aus Köln und
Wolfenbüttel ausgerechnet mit 50 lateinischen
Allerweltsinkunabeln startete.
http://www.hab.de/forschung/projekte/incunabula.htm
Mir ist eigentlich auch rätselhaft, wer mit diesen Büchern
arbeiten soll. Es gibt ja nur ganz wenige
hardcore-Inkunabelforscher, also Druckhistoriker, und die
blättern natürlich am liebsten in den erlesenen Drucken
selbst, abgesehen davon, daß Provenienzforschungen zum
individuellen Exemplar, worauf ich noch zu sprechen komme,
von den bestehenden Digitalisierungsprojekten keineswegs
gefördert werden.
Hier rächt sich die unzureichende Sacherschließung bzw.
Erläuterung. Natürlich weiß der absolute Experte, welcher
Druck als Primärquelle wissenschaftlich zitierfähig ist und
wann er nach einer maßgeblichen gedruckten Edition zu
zitieren hat. Aber das ist doch nur eine vieler möglichen
Benutzungskonstellationen. Wenn ich aus dem
Verfasserlexikon weiß, daß die Traktate von Felix Hemmerli
in zwei etwa gleichwertigen Ausgaben um 1500 vorliegen,
brauche ich mich nicht auf die Auszüge in Hansens Quellen
zu den Hexenprozessen zu verlassen, sondern kann mit dem
Digitalisat der Johannes a Lasco Bibliothek zu Emden
arbeiten.
http://www.jalb.de/agora/html/7606BIBLIOGRAPHIC_DESCRIPTION.html
Warum sollte dann aber eine solche Information, die ja nun
wirklich vergleichsweise einfach zu beschaffen ist, auch
wenn die historische Ausbildung und Bildung heutiger
Bibliothekare nicht mehr das ist, was sie einmal war, nicht
auch den Weg in die Metadaten, also die Erläuterung des
Stücks finden. Es ist daher generell zu fordern: Bei
Digitalisaten alter Drucke ist anzugeben, welche anderen
Ausgaben existieren, sei es frühere Erstausgaben, sei es
moderne Editionen, damit eine inhaltliche Benutzung auch
für diejenigen Wissenschaftler erleichtert wird, die ohne
Vorwissen und auch ohne textkritische Absichten mit den
Werken arbeiten möchten.
Es ist vielleicht sogar sinnvoll, daß man im universitären
Intranet bei patristischen Texten einen Link auf den
entsprechenden Text der elektronischen Edition der
Patrologia Latina legt, die ja von größeren
Universitätsbibliotheken auf Lizenzbasis bereitgestellt
wird.
Es gilt also, neues Publikum für die alten Werke zu
erschließen - vielleicht sogar den interessierten
Internetnutzer ohne Vorbildung, der gern in einer
illustrierten deutschsprachigen Inkunabel virtuell
blättert. Vor allem aber natürlich die Akademiker, die
vielleicht noch nicht viel Erfahrung mit Alten Drucken
haben.
Die mangelnde Vernetzung der Projekte, der sich aus meiner
ungerechten Außenperspektive als unbegreifbarer Egoismus
darstellt, zeigt sich auch daran, daß ich in den
Präsentationen nie Hinweise auf anderweitig digitalisierte
Werke gefunden habe. Jedes Unternehmen tut so als sei es
das einzige, das auf die Idee kommt, Schedels Weltchronik
zu digitalisieren (ich kenne 3 Digitalisate). Warum nicht
die anderen Exemplare verlinken wie es bei der
Gutenberg-Bibel ja der Fall ist? Warum kommt eine
bildungsgeschichtliche Bibliothek nicht auf die Idee, die
von der Tsukuba-Universität in Japan zugänglich gemachten
Alten Drucke zur Bildungsgeschichte (Comenius, französische
Texte, Pestalozzi) den Benutzern der eigenen Digitalen
Bibliothek detailliert mit einer Werkliste und nicht nur
durch pauschalen Hinweis ergänzend zu empfehlen?
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/pub/tree/kichosho.eng.html
Vorbildlich ist hier das Deutsche Rechtswörterbuch, das
anderweitig digitalisierte Wörterbuchquellen in einer
eigenen Linkliste nachweist.
http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/s/digital.htm
Nun zum Punkt der Mitwirkung der potentiellen Nutzer.
Bibliotheken sind wohl immer noch hierarchisch denkende
Anstalten, denen es nicht um Partizipation und Offenheit
geht, sondern primär um das eigene Prestige. Daher werden
fast alle Projekte den Wissenschaftlern nach dem Motto
"Vogel friß oder stirb" verordnet. Vielleicht gibt es ja
wissenschaftliche Beiräte, aber dann haben sie eher hinter
den Kulissen und wohl auch nicht sehr erfolgreich agiert.
Es ist ohne weiteres möglich, sich in einem informellen
Zirkel von Forschern zu erkundigen, welche
Digitalisierungsprioritäten gewünscht werden. So wäre es
auch denkbar gewesen, im Vorfeld der Planung der
Inkunabelbibliothek in der von der UB Tübingen angebotenen
Mailingliste INCUNABULA-L Laut zu geben. Das ist nicht
geschehen. Es ist aber auch möglich, wenn man sich nur
bemühen würde, Kontakte zu Lehrenden an der eigenen
Universität aufzunehmen, damit ein Seminar mit den
digitalisierten Quellen angeboten wird. Dessen Resultate
könnten dann online für das Projekt und seine Nutzung
werben.
Als Administrator der Mailingliste HEXENFORSCHUNG denke ich
an eine Verteilte Digitale Bibliothek der Hexenforschung,
die nach gemeinsamer Erstellung eines Kanons der
wichtigsten Quellenwerke Alte Drucke, die noch nicht
irgendwo digitalisiert vorliegen, bereitstellt und zwar
nicht als dubioses Großprojekt, sondern auf möglichst viele
Schultern verteilt, so daß jeder nach seinen Möglichkeiten
- inbesondere Zugang zu den Vorlagen - nicht mehr als
vielleicht fünf Quellenwerke digitalisieren muß. Daran
könnten sich durchaus auch Hobbyfotografen mit eigener
Digitalkamera beteiligen. Ich bin gespannt, ob etwas daraus
wird.
Wenig erfolgversprechend finde ich den Weg, den die
Lutherhalle Wittenberg mit der Digitalisierung on Demand
beschreitet: hier muß der Benutzer, der ein Werk
digitalisiert haben möchte, happige Kosten bezahlen, obwohl
eine solche Digitalisierung im öffentlichen Interesse ist.
Aber das liegt auf einer Linie mit der traditionellen
Praxis von Altbestandsbibliotheken, die ihre
wissenschaftlichen Benutzer mit prohibitiven Gebühren für
Reproduktionen dafür bestrafen, daß diese sich erdreisten,
über alte Drucke zu forschen.
Ganz wichtig ist mir der vorletzte Punkt 5, die mangelnde
Förderung der Provenienzforschung. Diese ist ohnehin ein
Stiefkind des derzeitigen Bibliothekswesens.
Digitalisierungsunternehmen sollten für die Alten Drucke
und ihre Erhaltung werben, sie sollten deutlich machen, daß
man diese nach Digitalisierung nicht wegwerfen oder
meistbietend auf Auktionen verscherbeln kann, damit man
vielleicht die nächste Phase des Projekts finanzieren kann.
Man muß ja heutzutage mit allem rechnen. Ich erinnere nur
an die Aufsehen erregenden, von Dr. Stüben verantworteten
Altbestandsverkäufe der Nordelbischen Kirchenbibliothek,
und die meiner Meinung nach nicht weniger skandalösen
sogenannten Dublettenverkäufe der Kapuzinerbibliotheken in
der UB Eichstätt, betrieben von Dr. Littger - beide
Bibliothekare sind nach wie vor hochangesehen Vertreter
ihres Berufsstandes, obwohl sie für mich eher Aussätzige
sind.
Digitalisierungsunternehmen sollten bewußt individuelle
Stücke präsentieren, die mit Randbemerkungen und anderen
Benutzerspuren versehen sind. Mehr und mehr interessiert
sich auch die Forschung für solche Stücke. Es ist ein
Zeichen von Ignoranz, wenn Wolfenbüttel zwar einige
Schreibkalender aus der frühen Neuzeit digitalisiert hat,
man aber den Katalogisaten überhaupt nicht entnehmen kann,
ob die Kalender tatsächlich gebraucht, also mit
handschriftlichen Einträgen versehen wurden (was mindestens
in einem Fall so ist). Dabei hat die
Schriftlichkeitsforschung gerade diese Gattung der
Schreibkalender als spannendes Thema entdeckt.
http://archiv.twoday.net/stories/32777/
Digitalisierungsunternehmen sollten sich verstärkt der
virtuellen Rekonstruktion zerstörter Fonds annehmen. Ich
selbst sammle ja schon seit 1999 Material für ein Projekt
"Donaueschingen Digital", das die barbarisch zerschlagene
Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliothek Donaueschingen
virtuell wieder zusammenführen soll. Das bisherige
Interesse an diesem Projekt war auch von Bibliotheksseite
mehr als bescheiden.
http://www.uni-freiburg.de/histsem/mertens/graf/dondig.htm
Zuletzt und sechstens: Open Access für Kulturgut!
Mit der Berliner Erklärung zum Open Access ist der Gedanke
des Open Access Movements, das sich den freien - also
sowohl den kostenfreien als auch den barriere- bzw.
lizenzfreien - Zugang zu wissenschaftlicher Fachliteratur
auf die Fahnen geschrieben hat, auf die
kulturgutverwahrenden Institutionen (heritage collections)
ausgeweitet worden - zu Recht!
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/
Digitalisiertes Kulturgut in Form Alter Drucke ist ja aus
urheberrechtlicher Sicht gemeinfrei, denn seine Autoren
sind alle länger als 70 Jahre tot. Dieses kulturelle
Allgemeingut gehört als public domain der Öffentlichkeit
und nicht den Bibliotheken, obwohl diese sich als
Zwingherren des Kulturguts aufspielen, das sie eifersüchtig
bewachen und möglichst gewinnbringend via
Reproduktionsrechte kommerzialisieren möchten.
http://www.jurawiki.de/FotoRecht
Da besteht eine Schweizer Burgerbibliothek darauf, daß in
einem E-Journal Abbildungen aus einer altgermanistischen
Handschrift nur künstlich verzerrt erfolgen dürfen, und
eine der beiden berühmtesten englischen Universitäten
duldet keinerlei Abbildung der eigenen Handschriften
außerhalb des eigenen Servers.
Unerfreulicherweise hat sich das tschechische Projekt
Manuskriptorium, das schon viele Handschriften und Drucke
digitalisiert hat, entschieden, den Zugang nur auf
Lizenzbasis zu gewähren, was zur Folge hat, daß die meisten
westlichen Wissenschaftler, deren Institutionen es aus
begreifbaren Gründen ablehnen, die überteuerten Lizenzen zu
erwerben, keinen bequemen Zugang zu den nur mit
unleserlichen Thumbnails, die nur in verzerrter Form
vergrößert werden können, im Internet vertretenen Schätzen
haben. Hier wäre es sinnvoll, der Prager Nationalbibliothek
kollegiale Proteste zukommen zu lassen.
Digitalisierte Bestände sollten nach den Grundsätzen des
Open Access frei nutzbar sein, auch wenn dies zur
Konsequenz hat, daß ein aus dem Web kopiertes Bild auf
einer anderen Website oder in einer Verlagspublikation, sei
es wissenschaftlicher oder anderer Art landet. Digitalisate
sollten aus wissenschaftlichen Gründen immer mit
größtmöglicher Qualität angeboten werden - rechtliche
Vorbehalte verkennen den entscheidenden Punkt: daß es sich
um kulturelles Allgemeingut handelt. Digitalisierung ist
daher immer auch ein Stück dringend gebotener Bürgernähe.
Quelle:
http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind0403&L=hexenforschung&P=R1430&I=-3
Klaus Graf: Was erwartet die Forschung vom digitalen Angebot der Bibliotheken?
Vortrag am 4. März 2004 im Rahmen des Workshops "Neue Wege zu alten Quellen"
http://www.ceec.uni-koeln.de/projekte/CEEC/project/workshopkoeln04.pdf
Der Untertitel meines Beitrags lautet: eine Philippika.
Daher beginne ich mit einer bewußt provozierenden These:
Digitalisierungsprojekte Alter Drucke sind zum derzeitigen
Zeitpunkt für die Wissenschaft weitgehend wertlos, da die
Digitalisierung an den Bedürfnissen der Forschung vorbei
erfolgt, da sie chaotisch-unkoordiniert, ohne hinreichende
Sacherschließung, in benutzerunfreundlicher Weise und
hinter dem Rücken der Wissenschaft, also ohne die gebotene
Information über die Resultate, betrieben wird.
Es versteht sich von selbst, dass diese Beurteilung
ungerecht, unbescheiden, undankbar und ungeduldig ist.
Ungeduldig deshalb, weil das Internet seit noch nicht
einmal zehn Jahren populär ist. Wir befinden uns also,
zumal vor dem Hintergrund jahrhundertealter Buchkultur,
immer noch in einer Experimentierphase.
Undankbar deshalb, weil ich bei meiner eigenen
wissenschaftlichen Arbeit als Historiker schon des öfteren
konkret von Digitalisierungsprojekten profitiert habe.
Um nur ein Beispiel herauszugreifen: Die Bielefelder
Bereitstellung der Aufklärungszeitschriften macht einen
grandiosen Bestand an historischen Primärquellen verfügbar.
http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung/
Die Titel der einzelnen Aufsätze sind bequem suchbar und
durch eine Verschlagwortung angemessen erschlossen. In
einer dieser Zeitschriften traf ich auf ein anonymisiertes
Dokument zum Thema Hexenprozesse, das ich mit eigenem
Vorwissen als das bisher nicht bekannte Todesurteil der
1751 im Breisgauer Endingen als Hexe hingerichteten Anna
Trutt identifizieren konnte - eine echte Entdeckung für die
Hexenforschung.
Aber ich denke für die Projektjubelprosa sind hier andere
zuständig. Auch ich begrüße es, daß so viel digitalisiert
wird, aber ich finde dieses Geschäft sollte
verantwortungsbewußter und mit mehr Gespür für die
Bedürfnisse der potentiellen Nutzer betrieben werden. Es
sind oft Selbstverständlichkeiten, die vernachlässigt
werden und die man mit vergleichsweise geringem Aufwand
(und ohne jahrelangen Vorlauf bis zur Projektbewilligung)
realisieren könnte.
Natürlich kann ich hier nicht für DIE Wissenschaft
sprechen, noch nicht einmal für meine eigene Disziplin.
Meine subjektive Sicht auf Digitalisierungsprojekte ist die
eines eingefleischten Fans, der um so mehr an ihren
offenkundigen Mängeln, die aber kaum einmal öffentlich zur
Sprache kommen, leidet.
Ich wende mich im folgenden pauschal an die Bibliotheken,
obwohl ich weiß, daß es auch Museen und Archive gibt, die
Alte Drucke digitalisiert haben. Handschriften,
Archivalien, Bilder und Karten werfen eigene Probleme auf,
aber ich denke, vieles von dem, was ich im folgenden
ausführen will, läßt sich auch auf diese Dokumenttypen
übertragen.
Viele Akademiker nutzen das Internet dilettantisch und
unprofessionell, wenn sie es denn überhaupt nutzen. Bereits
jetzt liegt ein riesiger Quellenfundus an Alten Drucken
weltweit vor, der auch in der Lehre nutzbringend eingesetzt
werden könnte, aber selbst Nutzer, die das Stadium des
digitalen Analphabeten und Google-Einwortsuchers hinter
sich gelassen haben, sind mit dem Aufspüren dieser
verborgenen digitalen Schätze überfordert. Aus der Sicht
des Nutzers ist dies das Hauptproblem: Es gibt keine
einfache Suchstrategie, um die für ihn wissenschaftlich
einschlägigen digitalen Inhalte aufzufinden. Bevor man
weiter wild vor sich hin digitalisiert, sollte man erst
einmal dafür sorgen, daß das bereits Digitalisierte
überhaupt zur Kenntnis genommen wird.
Daher betrifft mein erster Punkt die mangelhafte
Information der Wissenschaft.
Das dringendste Desiderat ist eine einfach benutzbare
Datenbank der weltweit bereits frei verfügbaren
Digitalisate und eine ergänzende Dokumentation auf
suchmaschinenfreundlichen HTML-Seiten.
Die Datenbank sollte als reine Datenbank von
Online-Ressourcen wie die GBV-Online-Ressourcen organisiert
und via KVK abfragbar sein, also nicht nur wie die
GBV-Online-Ressourcen über den Karlsruher Virtuellen
Volltextkatalog, der nun OASE heißt.
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvvk.html
Eine solche Datenbank könnte in vielen Fällen die
Fremddaten des Digitalisierungsprojekts, die etwa in MARC
vorliegen, nach Absprache mit dem Projektträger nutzen.
Wenn man in ein kooperatives Projekt allein die Zeit, die
für das Erstellen dämlicher und überflüssiger allgemeiner
Linkkataloge durch Fachreferenten vertan wird, einbringt
und sich international geschickt vernetzt, könnte eine
solche Datenbank kostengünstig und ziemlich schnell
realisiert werden.
Es ist aber noch nicht einmal selbstverständlich, daß
Bibliotheken ihre Digitalisate in den eigenen
Bibliothekskatalog aufnehmen und vom digitalisierten Werk
auf das Digitalisat verweisen (MIAMI Münster). Natürlich
sollten alle Digitalisate auch im Verbundkatalog
recherchierbar sein.
Zugleich sollten auch Repositorien Alter Drucke die
Standards der Open Access Initiative erfüllen, also über
entsprechende Harvester - am wichtigsten ist der OAIster -
genauso wie moderne Publikationen abfragbar sein.
http://oaister.umdl.umich.edu/
Es ist ein klassisches Eigentor, daß die Verantwortlichen
von Münsters MIAMI nur die Dissertationen OAI-compliant
verfügbar gemacht haben, nicht aber die derzeit an die 500
Alten Drucke aus der Barockbibliothek Nünning, von deren
Existenz die wenigsten Fachwissenschaftler Kenntnis haben
dürften.
http://miami.uni-muenster.de/
Warum daneben die suchmaschinenfreundlichen HTML-Seiten?
Weil die meisten, auch akademischen Internetnutzer nun
einmal Suchmaschinen und vor allem Google anwerfen, wenn
sie etwas im Internet finden wollen.
Suchmaschinenfreundlich heißt: Seiten unter 101 KB mit
einfachen Adressen, die hierarchisch direkt unter der
Startseite angeordnet sind, auf denen die Titel samt
Sacherschließung aufgelistet sind.
Es ist einigermaßen kurios, daß die Suchmaschine von
Forschungsportal.net in öffentlicher Trägerschaft es nicht
geschafft hat, die digitalen Angebote der
Universitätsbibliotheken komplett aufzunehmen. Anders als
bei der kommerziellen Firma Google kann man dort ganz
einfach hinmailen und sicher sein, ein offenes Ohr für die
Berücksichtigung des eigenen Projekts zu finden.
http://forschungsportal.net/
Es schadet nichts, wenn man solche HTML-Listen auch den
offenbar unausrottbaren fachspezifischen Linksammlungen
beigibt, die jede einzelne Bibliothek bastelt.
Wichtiger ist freilich, daß man mit zentralen externen
Linksammlungen aktiv kooperiert. Hier ist für die
wichtigste Wissenschaftssprache der frühen Neuzeit, das
Lateinische, die vortreffliche Online-Bibliographie
"Neolatin Texts" von Dana Sutton zu nennen, die mit derzeit
an die 9000 Texten - nicht nur Bücher, sondern auch
unselbständige Texte - so ziemlich vollständig sein dürfte.
http://eee.uci.edu/~papyri/bibliography/
Was hier ein Einzelner neben seinen akademischen
Verpflichtungen als Professor leistet, ist unbeschreiblich.
Freilich gilt es zu berücksichtigen, daß antike und
mittelalterliche Texte vor der Renaissance (ca. 1350) von
ihm ausgeklammert werden. Obwohl Digitalisierungsprojekte
das Rad schon sehr oft neu erfunden haben, könnte man bei
Suttons Liste anknüpfen und versuchen, gezielt die anderen
Sprachen abzudecken. Ich selbst habe als Privatmann im
Rahmen meines Weblogs ARCHIVALIA im Dezember letzten Jahres
ein Verzeichnis der deutschsprachigen als Faksimile
digitalisierten Drucke des 16. Jahrhunderts außerhalb der
großen Sammlungen von Wolfenbüttel, Wittenberg und
Augsburg, also des Streuguts, angelegt.
http://archiv.twoday.net/stories/113113/
Ich finde es fürchterlich, wie wenig Werbung Bibliotheken
für ihre Digitalisate machen. So versteht es die UB
Freiburg, ihre beachtlichen digitalen Sammlungen auf ihrer
Website geschickt zu verstecken.
http://www.ub.uni-freiburg.de/dipro/index.html
Allzu oft möchte man ausrufen: Stellt doch um Himmels
willen Eure beachtlichen Leistungen nicht so unter den
Scheffel!
Öffentlichkeitsarbeit ist also angesagt und auch
Pressearbeit und zwar nicht nur einmal, wenn das Projekt
eröffnet wird. Warum nicht ein "featured item of the month"
herausstellen, das ausführlich erläutert wird?
Warum liest man unter den Bibliotheks-News fast nur von den
neuesten lizenzierten Datenbanken kommerzieller Anbieter,
aber so gut wie nie von den digitalen Schmuckstücken, die
man neu anzubieten hat?
Überfällig ist ein kooperativer Neuigkeitendienst, der neu
digitalisierte Stücke etwa in Weblogform präsentiert und
natürlich einen RSS-Feed aufweisen sollte. Ich kenne nur
ein polnisches Unternehmen in Posen, das einen RSS-Feed für
seine News anbietet. Wem das zu fortschrittlich ist, darf
gern an einen Mail-Newsletter denken.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra
Werbung sollte aber nicht nur in digitalen Medien, sondern
auch in gedruckten Fachpublikationen gemacht werden. So hat
die ZfdA eine eigene Rubrik "Mittelalalter-Philologie im
Internet" eingerichtet.
http://www.uni-marburg.de/hosting/zfda/beitr.html
Ich komme nun zu meinem zweiten Punkt, die unzulängliche
Sacherschließung betreffend.
Das beginnt schon mit fehlenden Referenzen. Wer als
Bibliothekar einen deutschen Druck des 16. Jahrhunderts
digitalisiert, ohne in den Metadaten die VD 16-Nummer
anzugeben, hat nach meinem bescheidenen Dafürhalten
wesentliche Inhalte seines Berufs vergessen. Daß in der
neuen Verteilten Inkunabelbibliothek im OPAC die
Inkunabelbibliographien nicht genannt werden, ist für mich
unfaßbar.
Bei der Barockbibliothek Nünning in MIAMI ist die
Sacherschließung absolut unbrauchbar, es wird ein viel zu
weites, nichtssagendes Schlagwort gewählt. In Wolfenbüttel
sind viele Digitalisate überhaupt nicht verschlagwortet
worden.
Es fehlt an fachspezifischen, feingegliederten Übersichten,
die man hochtrabend auch Thesauri nennen mag, mit denen
sich der Forscher einen Überblick über vertretenen
Sachbereiche verschaffen könnte, wenn es sich nicht um ein
fachlich ohnehin eng begrenztes Projekt handelt.
Es sollte selbstverständlich sein, ist es aber leider
nicht, daß das Inhaltsverzeichnis des alten Drucks komplett
als E-Text digitalisiert vorliegt und dort die einzelnen
Kapitel mit den entsprechenden Links versehen sind. Wenn
man das als Pflicht bezeichnet, wird man als Kür die
Erfassung des jeweiligen Registers (ebenfalls mit
Verlinkung) oder sogar die Beigabe eines schmutzigen, also
unkorrigierten OCR-Textes bei Antiquaschriften bezeichnen
dürfen.
In der Digital Library of India, die auch einige
englischsprachige Veröffentlichungen des 19. Jahrhunderts
enthält, kann man jedenfalls in diesem OCR-Text suchen.
http://www.dli.gov.in/home.htm
Sacherschließung heißt auch, daß man so weit wie möglich
versucht, Angaben zum einzelnen Werk verfügbar zu machen,
wie sie etwa in Ausstellungs- oder Antiquariatskatalogen
erscheinen, also eine mehr oder minder ausführliche
Würdigung. Inhalte von Digitalisierungsprojekten sind ja
auch so etwas wie eine virtuelle Ausstellung. Bei solchen
Ausstellungen wünsche ich mir übrigens, daß man häufiger
ganze Werke - insbesondere geringeren Umfangs - komplett
ins Netz stellt und nicht immer nur die Titelseiten.
Wichtig wären auch Literaturangaben zum Werk oder seinem
Autor, wobei zum jeweiligen Autor auf andere seriöse
Internetinhalte - etwa die Digitalisierung der ADB -
verlinkt werden sollte. Jeder Autor sollte mit seinen
Lebensdaten, besser mit einem Biogramm vertreten sein.
Ein Wort zu den Illustrationen: Hier sollte dringend die
Zusammenarbeiten mit Projekten wie PROMETHEUS gesucht
werden, die Bilder kooperativ verfügbar machen.
Druckillustrationen sind wichtige Quellen der
Kunstgeschichte, die man spezifisch - etwa mit ICONCLASS -
erschließen sollte.
http://www.prometheus-bildarchiv.de/
Der dritte Punkt betrifft die fehlende
Benutzerfreundlichkeit.
Von der Beachtung so fundamentaler Grundsätze wie
barrierefreier Benutzung oder Usability sind nicht wenige
Digitalisierungsunternehmen weit entfernt. Ich sehe nicht
ein, wieso es nicht möglich ist, für ein so simples Produkt
wie die Digitalisierung eines Buchs, in dem einfach die
Bildseiten aufeinanderfolgen, eine spartanische Textversion
zu realisieren, die mit allen Browsern, auch den älteren,
betrachtet werden kann. Bei Kenntnis der
Benennungskonvention der Dateinamen oder einer
entsprechenden Liste sollte jeder Benutzer die Möglichkeit
haben, die Imagedateien mit einem eigenen Viewer zu sehen,
der als Freeware verfügbar sein sollte. Jedes Projekt hat
seine eigenen Navigationskonventionen und intuitiv
eingängig sind die allerwenigsten.
Ich habe neulich ziemlich viel Zeit bei der Benutzung eines
brasilianischen Digitalisierungsprojekts in Sao Paulo, das
unter anderem Schedels Weltchronik von 1493 anbietet,
vertan, bis mir aufging, daß dieses vermutlich für Netscape
7 optimiert ist und mit dem Internet Explorer nicht
ordnungsgemäß funktioniert.
http://www.obrasraras.usp.br/
Wer lästige Plugins wie DjVu einsetzt, sollte auch
alternative Formen der Ansicht realisieren.
Ein trivialer Punkt: Die Scans sollten gut lesbar sein. So
ärgert man sich bei Gallica meist über die miserable
Qualität. Man sollte sie bequem vergrößern können.
Wer nicht über eine schnelle universitäre Internetanbindung
verfügt, ist darauf angewiesen, daß er die Werke offline in
Ruhe betrachten kann. Neben dem Einsatz eines
Offlinereaders ist da die Erstellung eines PDF, wie es von
Gallica angeboten wird, höchst willkommen. Daß diese
Möglichkeit bewußt nicht angeboten wird, da man Mißbrauch
befürchtet, ist schlicht und einfach ärgerlich - mehr dazu
unten beim Punkt "Open Access".
http://gallica.bnf.fr/
Alle Digitalisate sollten eine kurze Internetadresse, die
man auch in gedruckten Publikationen zitieren kann, haben,
am besten als Persistant Identifier (PURL oder URN).
Vorbildlich die Portugiesische Nationalbibliothek, die
einen alten Druck mit dem folgenden URL zugänglich macht:
http://purl.pt/360/
Auch sollte für Zitatzwecke die einzelne Seite des Werks
bequem verlinkbar sein.
Hinsichtlich der Suchmöglichkeiten habe ich oben schon
einiges gesagt. Auf jeden Fall sollte eine Möglichkeit des
Browsings gegeben sein, wie es ärgerlicherweise von der
Lutherhalle Wittenberg nicht angeboten wird. Dort kann noch
nicht einmal in der Suche nach digitalisierten Inhalten
gefiltert werden, was es beispielsweise Mr. Sutton
außerordentlich erschwert hat, die lateinischen Drucke
dieses riesigen Angebots einer Institution, die sich als
Museum versteht, in seine Bibliographie aufzunehmen.
http://luther.hki.uni-koeln.de/luther/pages/sucheDrucke.html
Neben simplen sollten auch ausgefeilte Suchmöglichkeiten
angeboten werden, also etwa die Suche nach Werken, die
innerhalb eines zeitlichen Intervalls erschienen sind.
Standardmäßig sollten alle Digitalisierungsprojekte
alternativ mit englischer Benutzungsoberfläche angeboten
werden. Dies betrifft nicht nur unsere eigenen deutschen
Unternehmungen, sondern auch solche in Japan, wobei hier
sicher freundliche kollegiale Kommunikation Wunder bewirken
könnte.
Mein nächstes Monitum - Punkt 4 - ist überschrieben mit "An
den Bedürfnissen der Nutzer vorbei" und thematisiert die
Auswahl der Werke.
Für den Nutzer ist es prima facie irrelevant, wenn Alciatos
Emblembuch oder Vesalius mehrfach im Web vertreten ist,
oder wenn das Innsbrucker Projekt ALO und die Wittenberger
Lutherhalle das gleiche seltene Werk von Abt Trithemius
anbieten. Den Malleus maleficarum gibt es in Ausgaben des
16. Jahrhunderts dreifach, zweimal in Spanien, einmal in
Cornell, aber die maßgebliche Inkunabelausgabe, die als
Faksimile in den Bibliotheken steht, ist meines Wissens
nirgends einsehbar.
Das meine ich mit "chaotisch-unkoordiniert": Man
digitalisiert Alte Drucke, wobei die Überschneidungen bei
der frühneuzeitlichen Wissenschaftssprache Latein am
größten sein dürften, ohne Kenntnis anderer
Digitalisierungen und ohne internationale Koordination -
und ohne hinreichende Mitwirkung der potentiellen
wissenschaftlichen Nutzer. Statt Lücken zu schließen,
handelt man nach der Devise "Mehr desselben", einem, wie
wir von Paul Watzlawick wissen, verhängnisvollen Motto.
Es gibt eine Reihe größerer Unternehmungen, die hierzulande
völlig unbekannt zu sein scheinen, aber mehrere hundert, ja
sogar über tausend digitalisierte Alte Drucke, darunter
auch Inkunabeln, umfassen. Im Bereich der Medizingeschichte
sind ein Pariser Projekt und das Madrider Angebot
Dioscurides zu nennen. Andere Fachbereiche werden von der
UB Sevilla, dem Gemeinschaftsprojekt der andalusischen
Bibliotheken (mit knapp hundert Inkunabeln) und einer
baskischen Bibliothek abgedeckt.
Nachdem es nun mehrere hundert lateinische Inkunabeln,
verteilt auf verschiedene Server frei zugänglich online
gibt, habe ich nicht begriffen, wieso die deutsche
Verteilte Inkunabelbibliothek mit Beständen aus Köln und
Wolfenbüttel ausgerechnet mit 50 lateinischen
Allerweltsinkunabeln startete.
http://www.hab.de/forschung/projekte/incunabula.htm
Mir ist eigentlich auch rätselhaft, wer mit diesen Büchern
arbeiten soll. Es gibt ja nur ganz wenige
hardcore-Inkunabelforscher, also Druckhistoriker, und die
blättern natürlich am liebsten in den erlesenen Drucken
selbst, abgesehen davon, daß Provenienzforschungen zum
individuellen Exemplar, worauf ich noch zu sprechen komme,
von den bestehenden Digitalisierungsprojekten keineswegs
gefördert werden.
Hier rächt sich die unzureichende Sacherschließung bzw.
Erläuterung. Natürlich weiß der absolute Experte, welcher
Druck als Primärquelle wissenschaftlich zitierfähig ist und
wann er nach einer maßgeblichen gedruckten Edition zu
zitieren hat. Aber das ist doch nur eine vieler möglichen
Benutzungskonstellationen. Wenn ich aus dem
Verfasserlexikon weiß, daß die Traktate von Felix Hemmerli
in zwei etwa gleichwertigen Ausgaben um 1500 vorliegen,
brauche ich mich nicht auf die Auszüge in Hansens Quellen
zu den Hexenprozessen zu verlassen, sondern kann mit dem
Digitalisat der Johannes a Lasco Bibliothek zu Emden
arbeiten.
http://www.jalb.de/agora/html/7606BIBLIOGRAPHIC_DESCRIPTION.html
Warum sollte dann aber eine solche Information, die ja nun
wirklich vergleichsweise einfach zu beschaffen ist, auch
wenn die historische Ausbildung und Bildung heutiger
Bibliothekare nicht mehr das ist, was sie einmal war, nicht
auch den Weg in die Metadaten, also die Erläuterung des
Stücks finden. Es ist daher generell zu fordern: Bei
Digitalisaten alter Drucke ist anzugeben, welche anderen
Ausgaben existieren, sei es frühere Erstausgaben, sei es
moderne Editionen, damit eine inhaltliche Benutzung auch
für diejenigen Wissenschaftler erleichtert wird, die ohne
Vorwissen und auch ohne textkritische Absichten mit den
Werken arbeiten möchten.
Es ist vielleicht sogar sinnvoll, daß man im universitären
Intranet bei patristischen Texten einen Link auf den
entsprechenden Text der elektronischen Edition der
Patrologia Latina legt, die ja von größeren
Universitätsbibliotheken auf Lizenzbasis bereitgestellt
wird.
Es gilt also, neues Publikum für die alten Werke zu
erschließen - vielleicht sogar den interessierten
Internetnutzer ohne Vorbildung, der gern in einer
illustrierten deutschsprachigen Inkunabel virtuell
blättert. Vor allem aber natürlich die Akademiker, die
vielleicht noch nicht viel Erfahrung mit Alten Drucken
haben.
Die mangelnde Vernetzung der Projekte, der sich aus meiner
ungerechten Außenperspektive als unbegreifbarer Egoismus
darstellt, zeigt sich auch daran, daß ich in den
Präsentationen nie Hinweise auf anderweitig digitalisierte
Werke gefunden habe. Jedes Unternehmen tut so als sei es
das einzige, das auf die Idee kommt, Schedels Weltchronik
zu digitalisieren (ich kenne 3 Digitalisate). Warum nicht
die anderen Exemplare verlinken wie es bei der
Gutenberg-Bibel ja der Fall ist? Warum kommt eine
bildungsgeschichtliche Bibliothek nicht auf die Idee, die
von der Tsukuba-Universität in Japan zugänglich gemachten
Alten Drucke zur Bildungsgeschichte (Comenius, französische
Texte, Pestalozzi) den Benutzern der eigenen Digitalen
Bibliothek detailliert mit einer Werkliste und nicht nur
durch pauschalen Hinweis ergänzend zu empfehlen?
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/pub/tree/kichosho.eng.html
Vorbildlich ist hier das Deutsche Rechtswörterbuch, das
anderweitig digitalisierte Wörterbuchquellen in einer
eigenen Linkliste nachweist.
http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/s/digital.htm
Nun zum Punkt der Mitwirkung der potentiellen Nutzer.
Bibliotheken sind wohl immer noch hierarchisch denkende
Anstalten, denen es nicht um Partizipation und Offenheit
geht, sondern primär um das eigene Prestige. Daher werden
fast alle Projekte den Wissenschaftlern nach dem Motto
"Vogel friß oder stirb" verordnet. Vielleicht gibt es ja
wissenschaftliche Beiräte, aber dann haben sie eher hinter
den Kulissen und wohl auch nicht sehr erfolgreich agiert.
Es ist ohne weiteres möglich, sich in einem informellen
Zirkel von Forschern zu erkundigen, welche
Digitalisierungsprioritäten gewünscht werden. So wäre es
auch denkbar gewesen, im Vorfeld der Planung der
Inkunabelbibliothek in der von der UB Tübingen angebotenen
Mailingliste INCUNABULA-L Laut zu geben. Das ist nicht
geschehen. Es ist aber auch möglich, wenn man sich nur
bemühen würde, Kontakte zu Lehrenden an der eigenen
Universität aufzunehmen, damit ein Seminar mit den
digitalisierten Quellen angeboten wird. Dessen Resultate
könnten dann online für das Projekt und seine Nutzung
werben.
Als Administrator der Mailingliste HEXENFORSCHUNG denke ich
an eine Verteilte Digitale Bibliothek der Hexenforschung,
die nach gemeinsamer Erstellung eines Kanons der
wichtigsten Quellenwerke Alte Drucke, die noch nicht
irgendwo digitalisiert vorliegen, bereitstellt und zwar
nicht als dubioses Großprojekt, sondern auf möglichst viele
Schultern verteilt, so daß jeder nach seinen Möglichkeiten
- inbesondere Zugang zu den Vorlagen - nicht mehr als
vielleicht fünf Quellenwerke digitalisieren muß. Daran
könnten sich durchaus auch Hobbyfotografen mit eigener
Digitalkamera beteiligen. Ich bin gespannt, ob etwas daraus
wird.
Wenig erfolgversprechend finde ich den Weg, den die
Lutherhalle Wittenberg mit der Digitalisierung on Demand
beschreitet: hier muß der Benutzer, der ein Werk
digitalisiert haben möchte, happige Kosten bezahlen, obwohl
eine solche Digitalisierung im öffentlichen Interesse ist.
Aber das liegt auf einer Linie mit der traditionellen
Praxis von Altbestandsbibliotheken, die ihre
wissenschaftlichen Benutzer mit prohibitiven Gebühren für
Reproduktionen dafür bestrafen, daß diese sich erdreisten,
über alte Drucke zu forschen.
Ganz wichtig ist mir der vorletzte Punkt 5, die mangelnde
Förderung der Provenienzforschung. Diese ist ohnehin ein
Stiefkind des derzeitigen Bibliothekswesens.
Digitalisierungsunternehmen sollten für die Alten Drucke
und ihre Erhaltung werben, sie sollten deutlich machen, daß
man diese nach Digitalisierung nicht wegwerfen oder
meistbietend auf Auktionen verscherbeln kann, damit man
vielleicht die nächste Phase des Projekts finanzieren kann.
Man muß ja heutzutage mit allem rechnen. Ich erinnere nur
an die Aufsehen erregenden, von Dr. Stüben verantworteten
Altbestandsverkäufe der Nordelbischen Kirchenbibliothek,
und die meiner Meinung nach nicht weniger skandalösen
sogenannten Dublettenverkäufe der Kapuzinerbibliotheken in
der UB Eichstätt, betrieben von Dr. Littger - beide
Bibliothekare sind nach wie vor hochangesehen Vertreter
ihres Berufsstandes, obwohl sie für mich eher Aussätzige
sind.
Digitalisierungsunternehmen sollten bewußt individuelle
Stücke präsentieren, die mit Randbemerkungen und anderen
Benutzerspuren versehen sind. Mehr und mehr interessiert
sich auch die Forschung für solche Stücke. Es ist ein
Zeichen von Ignoranz, wenn Wolfenbüttel zwar einige
Schreibkalender aus der frühen Neuzeit digitalisiert hat,
man aber den Katalogisaten überhaupt nicht entnehmen kann,
ob die Kalender tatsächlich gebraucht, also mit
handschriftlichen Einträgen versehen wurden (was mindestens
in einem Fall so ist). Dabei hat die
Schriftlichkeitsforschung gerade diese Gattung der
Schreibkalender als spannendes Thema entdeckt.
http://archiv.twoday.net/stories/32777/
Digitalisierungsunternehmen sollten sich verstärkt der
virtuellen Rekonstruktion zerstörter Fonds annehmen. Ich
selbst sammle ja schon seit 1999 Material für ein Projekt
"Donaueschingen Digital", das die barbarisch zerschlagene
Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliothek Donaueschingen
virtuell wieder zusammenführen soll. Das bisherige
Interesse an diesem Projekt war auch von Bibliotheksseite
mehr als bescheiden.
http://www.uni-freiburg.de/histsem/mertens/graf/dondig.htm
Zuletzt und sechstens: Open Access für Kulturgut!
Mit der Berliner Erklärung zum Open Access ist der Gedanke
des Open Access Movements, das sich den freien - also
sowohl den kostenfreien als auch den barriere- bzw.
lizenzfreien - Zugang zu wissenschaftlicher Fachliteratur
auf die Fahnen geschrieben hat, auf die
kulturgutverwahrenden Institutionen (heritage collections)
ausgeweitet worden - zu Recht!
http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/
Digitalisiertes Kulturgut in Form Alter Drucke ist ja aus
urheberrechtlicher Sicht gemeinfrei, denn seine Autoren
sind alle länger als 70 Jahre tot. Dieses kulturelle
Allgemeingut gehört als public domain der Öffentlichkeit
und nicht den Bibliotheken, obwohl diese sich als
Zwingherren des Kulturguts aufspielen, das sie eifersüchtig
bewachen und möglichst gewinnbringend via
Reproduktionsrechte kommerzialisieren möchten.
http://www.jurawiki.de/FotoRecht
Da besteht eine Schweizer Burgerbibliothek darauf, daß in
einem E-Journal Abbildungen aus einer altgermanistischen
Handschrift nur künstlich verzerrt erfolgen dürfen, und
eine der beiden berühmtesten englischen Universitäten
duldet keinerlei Abbildung der eigenen Handschriften
außerhalb des eigenen Servers.
Unerfreulicherweise hat sich das tschechische Projekt
Manuskriptorium, das schon viele Handschriften und Drucke
digitalisiert hat, entschieden, den Zugang nur auf
Lizenzbasis zu gewähren, was zur Folge hat, daß die meisten
westlichen Wissenschaftler, deren Institutionen es aus
begreifbaren Gründen ablehnen, die überteuerten Lizenzen zu
erwerben, keinen bequemen Zugang zu den nur mit
unleserlichen Thumbnails, die nur in verzerrter Form
vergrößert werden können, im Internet vertretenen Schätzen
haben. Hier wäre es sinnvoll, der Prager Nationalbibliothek
kollegiale Proteste zukommen zu lassen.
Digitalisierte Bestände sollten nach den Grundsätzen des
Open Access frei nutzbar sein, auch wenn dies zur
Konsequenz hat, daß ein aus dem Web kopiertes Bild auf
einer anderen Website oder in einer Verlagspublikation, sei
es wissenschaftlicher oder anderer Art landet. Digitalisate
sollten aus wissenschaftlichen Gründen immer mit
größtmöglicher Qualität angeboten werden - rechtliche
Vorbehalte verkennen den entscheidenden Punkt: daß es sich
um kulturelles Allgemeingut handelt. Digitalisierung ist
daher immer auch ein Stück dringend gebotener Bürgernähe.
Quelle:
http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind0403&L=hexenforschung&P=R1430&I=-3
KlausGraf - am Samstag, 9. Juni 2012, 23:28 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Am 19. Mai 2013, am Pfingstsonntag des nächsten Jahres, wird in Wesel Geschichte geschrieben. Da sind sich die Kirchenvorstände der rechtsrheinischen katholischen Kirchengemeinden einig. Denn an diesem Tag fusionieren die vier Pfarrgemeinden St. Martini, St. Mariä Himmelfahrt, St. Antonius und St. Johannes zu einer Großpfarrei. "Das Datum ist etwa gleichzustellen mit Ostern 1540. Damals führte der Rat der Stadt die Reformation ein. Mehr als 470 Jahre später führen wir den neuen Stadtpatron ein", sagt Stefan Sühling, leitender Pfarrer der künftigen Seelsorgeeinheit. Wie er heißen soll, das entscheiden nun die rund 23 000 Katholiken.
http://www.rp-online.de/niederrhein-nord/wesel/nachrichten/katholiken-suchen-stadtpatron-1.2863473
Zu liturgierechtlichen Normen für Ortspatrone:
http://books.google.de/books?id=dzlFAAAAcAAJ&pg=PA273
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2007/373/ (S. 135).
Echte neue Stadtpatrone sind von Klerus und Volk zu wählen und von der Gottesdienstkongregation der römischen Kurie zu konfirmieren (Instruktion der Gottesdienstkongregation von 1970).
http://www.rp-online.de/niederrhein-nord/wesel/nachrichten/katholiken-suchen-stadtpatron-1.2863473
Zu liturgierechtlichen Normen für Ortspatrone:
http://books.google.de/books?id=dzlFAAAAcAAJ&pg=PA273
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2007/373/ (S. 135).
Echte neue Stadtpatrone sind von Klerus und Volk zu wählen und von der Gottesdienstkongregation der römischen Kurie zu konfirmieren (Instruktion der Gottesdienstkongregation von 1970).
KlausGraf - am Samstag, 9. Juni 2012, 15:14 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der stattliche Handschriftenbestand des Historischen Vereins von Mittelfranken - fast ausnahmslos nachmittelalterliche Stücke - befindet sich [teilweise] als Depositum im Staatsarchiv Nürnberg. Das nach wie vor maßgebliche, noch nicht durch ein neueres Findmittel ersetzte Verzeichnis ist der gedruckte Katalog von Theodor Preger 1907, der online einsehbar ist:
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00009640/image_5
Die Preger'schen Nummern sind noch heute gültig, allerdings sind leider mehrere Handschriften inzwischen verschollen. In Einzelfällen wurden auch Handschriften abgegeben, so
[Nr. 612: 8 Folioblätter: Gerichtsakten des Stadtgerichts Ulm unter Stadtamann Eberhart Bloß von
1455 (Freitag vor Joh., Freitag nach Joh., Montag nach Peter u. Paul), 1456 (Aftermontag nach
Oculi) – abgegeben an das Stadtarchiv Ulm 1988.]
Dr. Daniel Burger vom Staatsarchiv Nürnberg verdanke ich auch die folgenden beiden Beschreibungen:
Nr. 609: Chronik der Stadt [Schwäbisch] Hall und des Stiftes Comburg, verfasst von Georg
Widmann (1486-1560), Syndicus des Stifts Comburg, 1553. Darin: Kupferstich einer Stadtansicht
von Schwäbisch Hall mit Darstellung der Feuersbrunst 1680 (zu Beginn eingeklebt).
Halbledereinband (18./19. Jh., 32,5 x 20,5cm, 0,03lfm), leicht bestoßen; 124 fol.
Nr. 610: Chronik der Stadt [Schwäbisch] Hall aus dem 17. Jh. von einem ungenannten Verfasser,
geschöpft aus den Chroniken des " Jerg Widmann, Syndicus zu Comberg, Johannes Gerold, Pfarrer
zu Rainsperg [wohl Johann Herolt (1490-1562)], Berler und andere von Adel, die zu Hall gewohnt"
Halbledereinband (18./19. Jh., 33,5 x 21,5cm, 0,05lfm); 228 fol. zzgl. ungezähltes Personen-, Orts-
und Sachregister am Ende des Bandes. Enthält u.a.: 12 Artikel der Schwäbischen Bauern. Darin: am
Anfang zahlreiche Federzeichnungen (Erbauung der sieben Burgen zu Hall; Adelswappen); Gedicht
aus dem Bauernkrieg ("Bawren Krieg Reimen Weiß von Hannß Francken von Hall gemacht", fol.
155v-160r).
Beide Handschriften werden von dem Editor der Chroniken Herolts und Widmanns, Kolb, nicht erwähnt, weder in den Ausgaben
http://de.wikisource.org/wiki/W%C3%BCrttembergische_Geschichtsquellen
noch in der Besprechung der Widmann-Handschriften Württ. Franken NF 6 (1897), S. 44ff.
http://archive.org/stream/WuerttFranken_NF5_9/Wrttembergisch_Franken#page/n143/mode/2up
http://books.google.com/books?id=sJMtAAAAYAAJ (US)
[Das folgende über Wertmann ist überholt durch meinen Aufsatz
http://archiv.twoday.net/stories/97060108/ ]
Das Gedicht von Franckhen alias Hans Wertmann - die Arbeit von Gerd Wunder. Bauernkrieg reimenweis von Hantz Franckhen von Hall gemacht. Ein Gedicht aus dem Jahre 1525 und sein Verfasser Hans Wertmann, in: Haalquell 27 (1975), S.9-12 liegt mir nicht vor - wird üblicherweise zusammen mit Widmanns Haller Chronik überliefert. Es wurde von Steiff-Mehring ediert:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_133.jpg
1509 verfasste Wertmann als Pritschenmeister eine Beschreibung der beiden Augsburger Schießen (mit Widmung an Konrad Peutinger), überliefert im Erlanger Cod. B 213:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0016_a138_jpg.htm
Er heißt dort Glaser von Schwäbisch Hall. Aufgrund nicht genannter Quelle sagt Joseph August Adam 1824, Wertmann habe als ausgemachter Witzbold gegolten:
http://books.google.de/books?id=7aRDAAAAcAAJ&pg=PA15
Bei Wunder-Lenckner 1956, S. 670 Nr. 9347: Hans (Wortmann) Fräncklin, Glaser 1507/27, lebt am Kornhaus.
Handschriften Schwäbisch Haller Chroniken im Handel:
http://archiv.twoday.net/stories/1847380/
Digitalisierte Handschrift aus einer Zipser Bibliothek:
http://archiv.twoday.net/stories/292980/
Nachtrag 10.1.2013: Eigenartigerweise lese ich auf
http://www.schlossbibliothek-ansbach.de/
"Die Sammlung der Historischen Handschriften (Ms. hist.) des Historischen Vereins Mittelfrankens stellt einen für die landesgeschichtliche Forschung höchst wertvollen Bestand dar, beinhaltet sie doch zum einen zahlreiche Chroniken, Urkunden und Akten, die dem Verein geschenkt, von staatlichen Stellen übergeben oder auch käuflich erworben worden sind. Des weiteren finden sich in dem Fonds Forschungsarbeiten früherer Mitglieder. Die Sammlung umfasste im Jahr 1907, zum Zeitpunkt ihrer Verzeichnung in einem gedruckten Katalog durch Theodor Preger 658 Einheiten, die in der damaligen K. Regierungsbibliothek als Dauerleihgabe verwahrt wurden. Im Jahr 1977 erfolgte die Abgabe umfassender Bestandsteile an staatliche und kirchliche Archive, so dass nunmehr 96 Handschriften [noch in Arbeit] an der Staatlichen Bibliothek Ansbach eingesehen werden können. Besonders herausragende Stücke dieser Sammlung sind u.a. eine Abschrift des Fundationsbriefes der hochfürstlichen Bibliothek und des Münzkontors vom 6. Februar 1738 (Ms. hist. 54), eine Chronik zu den Jahren 714-1557 (Ms. hist. 223) sowie ein Bericht zum Landshuter Erbfolgekrieg des Jahres 1504/1505 (Ms. hist. 580)."
Am 16.1.2013 teilte die Bibliotheksleiterin Ute Kissling mit:
"Die Handschriften des Historischen Vereins Mittelfranken wurden in den 70er Jahren vom Verein selbst - als entscheidungsbefugtem Eigentümer - an neue Standorte gegeben; davon sind etwa 100 an die Staatliche Bibliothek als Depositum gegangen. Die Empfänger der anderen sind zahlreiche staatliche Einrichtungen, kirchliche Archive usw. außerhalb Ansbachs, die auf der homepage nicht alle genannt werden können, im übrigen auch nicht alle bekannt sind. – Die weiteren Modalitäten der Abgabe durch den Verein vor 35 Jahren sind der Bibliothek nicht bekannt.
Für die auf Ansbach überkommenen Bestände ist eine Verzeichnung geplant, da der gedruckte Katalog (Preger) kaum noch aussagefähig ist. Hierzu müssen Fördermittel eingeworben werden."
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/714908893/
#forschung
#fnzhss
 Barfüßer aus einer bei Kiefer angebotenen Herolt-Handschrift
Barfüßer aus einer bei Kiefer angebotenen Herolt-Handschrift
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00009640/image_5
Die Preger'schen Nummern sind noch heute gültig, allerdings sind leider mehrere Handschriften inzwischen verschollen. In Einzelfällen wurden auch Handschriften abgegeben, so
[Nr. 612: 8 Folioblätter: Gerichtsakten des Stadtgerichts Ulm unter Stadtamann Eberhart Bloß von
1455 (Freitag vor Joh., Freitag nach Joh., Montag nach Peter u. Paul), 1456 (Aftermontag nach
Oculi) – abgegeben an das Stadtarchiv Ulm 1988.]
Dr. Daniel Burger vom Staatsarchiv Nürnberg verdanke ich auch die folgenden beiden Beschreibungen:
Nr. 609: Chronik der Stadt [Schwäbisch] Hall und des Stiftes Comburg, verfasst von Georg
Widmann (1486-1560), Syndicus des Stifts Comburg, 1553. Darin: Kupferstich einer Stadtansicht
von Schwäbisch Hall mit Darstellung der Feuersbrunst 1680 (zu Beginn eingeklebt).
Halbledereinband (18./19. Jh., 32,5 x 20,5cm, 0,03lfm), leicht bestoßen; 124 fol.
Nr. 610: Chronik der Stadt [Schwäbisch] Hall aus dem 17. Jh. von einem ungenannten Verfasser,
geschöpft aus den Chroniken des " Jerg Widmann, Syndicus zu Comberg, Johannes Gerold, Pfarrer
zu Rainsperg [wohl Johann Herolt (1490-1562)], Berler und andere von Adel, die zu Hall gewohnt"
Halbledereinband (18./19. Jh., 33,5 x 21,5cm, 0,05lfm); 228 fol. zzgl. ungezähltes Personen-, Orts-
und Sachregister am Ende des Bandes. Enthält u.a.: 12 Artikel der Schwäbischen Bauern. Darin: am
Anfang zahlreiche Federzeichnungen (Erbauung der sieben Burgen zu Hall; Adelswappen); Gedicht
aus dem Bauernkrieg ("Bawren Krieg Reimen Weiß von Hannß Francken von Hall gemacht", fol.
155v-160r).
Beide Handschriften werden von dem Editor der Chroniken Herolts und Widmanns, Kolb, nicht erwähnt, weder in den Ausgaben
http://de.wikisource.org/wiki/W%C3%BCrttembergische_Geschichtsquellen
noch in der Besprechung der Widmann-Handschriften Württ. Franken NF 6 (1897), S. 44ff.
http://archive.org/stream/WuerttFranken_NF5_9/Wrttembergisch_Franken#page/n143/mode/2up
http://books.google.com/books?id=sJMtAAAAYAAJ (US)
[Das folgende über Wertmann ist überholt durch meinen Aufsatz
http://archiv.twoday.net/stories/97060108/ ]
Das Gedicht von Franckhen alias Hans Wertmann - die Arbeit von Gerd Wunder. Bauernkrieg reimenweis von Hantz Franckhen von Hall gemacht. Ein Gedicht aus dem Jahre 1525 und sein Verfasser Hans Wertmann, in: Haalquell 27 (1975), S.9-12 liegt mir nicht vor - wird üblicherweise zusammen mit Widmanns Haller Chronik überliefert. Es wurde von Steiff-Mehring ediert:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_133.jpg
1509 verfasste Wertmann als Pritschenmeister eine Beschreibung der beiden Augsburger Schießen (mit Widmung an Konrad Peutinger), überliefert im Erlanger Cod. B 213:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0016_a138_jpg.htm
Er heißt dort Glaser von Schwäbisch Hall. Aufgrund nicht genannter Quelle sagt Joseph August Adam 1824, Wertmann habe als ausgemachter Witzbold gegolten:
http://books.google.de/books?id=7aRDAAAAcAAJ&pg=PA15
Bei Wunder-Lenckner 1956, S. 670 Nr. 9347: Hans (Wortmann) Fräncklin, Glaser 1507/27, lebt am Kornhaus.
Handschriften Schwäbisch Haller Chroniken im Handel:
http://archiv.twoday.net/stories/1847380/
Digitalisierte Handschrift aus einer Zipser Bibliothek:
http://archiv.twoday.net/stories/292980/
Nachtrag 10.1.2013: Eigenartigerweise lese ich auf
http://www.schlossbibliothek-ansbach.de/
"Die Sammlung der Historischen Handschriften (Ms. hist.) des Historischen Vereins Mittelfrankens stellt einen für die landesgeschichtliche Forschung höchst wertvollen Bestand dar, beinhaltet sie doch zum einen zahlreiche Chroniken, Urkunden und Akten, die dem Verein geschenkt, von staatlichen Stellen übergeben oder auch käuflich erworben worden sind. Des weiteren finden sich in dem Fonds Forschungsarbeiten früherer Mitglieder. Die Sammlung umfasste im Jahr 1907, zum Zeitpunkt ihrer Verzeichnung in einem gedruckten Katalog durch Theodor Preger 658 Einheiten, die in der damaligen K. Regierungsbibliothek als Dauerleihgabe verwahrt wurden. Im Jahr 1977 erfolgte die Abgabe umfassender Bestandsteile an staatliche und kirchliche Archive, so dass nunmehr 96 Handschriften [noch in Arbeit] an der Staatlichen Bibliothek Ansbach eingesehen werden können. Besonders herausragende Stücke dieser Sammlung sind u.a. eine Abschrift des Fundationsbriefes der hochfürstlichen Bibliothek und des Münzkontors vom 6. Februar 1738 (Ms. hist. 54), eine Chronik zu den Jahren 714-1557 (Ms. hist. 223) sowie ein Bericht zum Landshuter Erbfolgekrieg des Jahres 1504/1505 (Ms. hist. 580)."
Am 16.1.2013 teilte die Bibliotheksleiterin Ute Kissling mit:
"Die Handschriften des Historischen Vereins Mittelfranken wurden in den 70er Jahren vom Verein selbst - als entscheidungsbefugtem Eigentümer - an neue Standorte gegeben; davon sind etwa 100 an die Staatliche Bibliothek als Depositum gegangen. Die Empfänger der anderen sind zahlreiche staatliche Einrichtungen, kirchliche Archive usw. außerhalb Ansbachs, die auf der homepage nicht alle genannt werden können, im übrigen auch nicht alle bekannt sind. – Die weiteren Modalitäten der Abgabe durch den Verein vor 35 Jahren sind der Bibliothek nicht bekannt.
Für die auf Ansbach überkommenen Bestände ist eine Verzeichnung geplant, da der gedruckte Katalog (Preger) kaum noch aussagefähig ist. Hierzu müssen Fördermittel eingeworben werden."
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/714908893/
#forschung
#fnzhss
 Barfüßer aus einer bei Kiefer angebotenen Herolt-Handschrift
Barfüßer aus einer bei Kiefer angebotenen Herolt-HandschriftKlausGraf - am Freitag, 8. Juni 2012, 23:25 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Am Sonntag, den 17. Juni 2012, lädt das Hessische Hauptstaatsarchiv zu einem Tag der offenen Tür ein. Anlässlich des 200. Jubiläums des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung präsentiert es an diesem Tag seine Schätze. Erstmals werden in einer Ausstellung mit dem Titel „Schatzkammer Nassaus“ künstlerisch und historisch hochwertige Objekte der Sammlung Nassauischer Altertümer aus dem Stadtmuseum Wiesbaden und dem Archiv des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung aus dem Hessischen Hauptstaatsarchiv kombiniert. Diese Glanzstücke waren seit Langem nicht mehr ausgestellt oder wurden noch nie in der Öffentlichkeit präsentiert.
Außerdem bietet das Hessische Hauptstaatsarchiv ein abwechslungsreiches Programm: Führungen durch das Haus, seine Magazine und die Restaurierungswerkstatt, Sonderverkauf von Publikationen, Filmvorführungen über das Hauptstaatsarchiv, Lese- und Schreibübungen für Groß und Klein in der deutschen Schrift des 19. Jahrhunderts sowie Informationsveranstaltungen für Orts- und Familienforscher.
Als besonderer Abschluss der Veranstaltung wird ab 16 Uhr der Krimi-Autor Jan Seghers aus seinem Roman „Die Akte Rosenherz“ lesen. Zu diesem Roman recherchierte der Autor im Hessischen Hauptstaatsarchiv über den Mord an der Prostituierten Helga Matura im Frankfurt der 60er Jahre.
Der Eintritt für den Tag der offenen Tür und die Lesung ist frei.
Wann: Sonntag, den 17. Juni 2012
Was: Tag der offenen Tür • 11–16 Uhr
Lesung von Jan Seghers • ab 16 Uhr
Wo: Hessisches Hauptstaatsarchiv
Kontakt: Hessisches Hauptstaatsarchiv, Mosbacher Str. 55, 65187 Wiesbaden, Tel.: 0611/881-0, Fax -145,
E-Mail: poststelle@hhstaw.hessen.de
Homepage: http://www.hauptstaatsarchiv.hessen.de
Außerdem bietet das Hessische Hauptstaatsarchiv ein abwechslungsreiches Programm: Führungen durch das Haus, seine Magazine und die Restaurierungswerkstatt, Sonderverkauf von Publikationen, Filmvorführungen über das Hauptstaatsarchiv, Lese- und Schreibübungen für Groß und Klein in der deutschen Schrift des 19. Jahrhunderts sowie Informationsveranstaltungen für Orts- und Familienforscher.
Als besonderer Abschluss der Veranstaltung wird ab 16 Uhr der Krimi-Autor Jan Seghers aus seinem Roman „Die Akte Rosenherz“ lesen. Zu diesem Roman recherchierte der Autor im Hessischen Hauptstaatsarchiv über den Mord an der Prostituierten Helga Matura im Frankfurt der 60er Jahre.
Der Eintritt für den Tag der offenen Tür und die Lesung ist frei.
Wann: Sonntag, den 17. Juni 2012
Was: Tag der offenen Tür • 11–16 Uhr
Lesung von Jan Seghers • ab 16 Uhr
Wo: Hessisches Hauptstaatsarchiv
Kontakt: Hessisches Hauptstaatsarchiv, Mosbacher Str. 55, 65187 Wiesbaden, Tel.: 0611/881-0, Fax -145,
E-Mail: poststelle@hhstaw.hessen.de
Homepage: http://www.hauptstaatsarchiv.hessen.de
Maria Kobold - am Freitag, 8. Juni 2012, 10:43 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.allgemeine-zeitung.de/region/kultur/literatur/12060085.htm
Eingerichtet wurde die Bibliothek von Abteilungsleiterin Annelen Ottermann und Fachreferent Christian Richter. „Wir wollten sichtbarer werden, mit dem, was wir gut können“, sagt Ottermann.
Dabei war nach den Sparbeschlüssen im Herbst 2011 nicht klar, ob die Bibliothek erhalten bleibt, erzählt Kulturdezernentin Marianne Grosse. Seitdem habe sich das Profil der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek verändert: „Sie wird künftig mit zwei Leuchttürmen erkennbar bleiben und am Medienstandort Mainz Präsenz zeigen“. Diese zwei Leuchttürme sind zum einen die Regionalbibliothek aus und über Mainz und Rheinhessen und zum anderen die Altbestandsbibliothek mit Sondersammlungen, Handschriften und historischen Beständen. „Die Bibliothek wird eine unverzichtbare Anlaufstelle bleiben, die jeder nutzen kann“, sagt Grosse.
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbibliothek+mainz
Eingerichtet wurde die Bibliothek von Abteilungsleiterin Annelen Ottermann und Fachreferent Christian Richter. „Wir wollten sichtbarer werden, mit dem, was wir gut können“, sagt Ottermann.
Dabei war nach den Sparbeschlüssen im Herbst 2011 nicht klar, ob die Bibliothek erhalten bleibt, erzählt Kulturdezernentin Marianne Grosse. Seitdem habe sich das Profil der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek verändert: „Sie wird künftig mit zwei Leuchttürmen erkennbar bleiben und am Medienstandort Mainz Präsenz zeigen“. Diese zwei Leuchttürme sind zum einen die Regionalbibliothek aus und über Mainz und Rheinhessen und zum anderen die Altbestandsbibliothek mit Sondersammlungen, Handschriften und historischen Beständen. „Die Bibliothek wird eine unverzichtbare Anlaufstelle bleiben, die jeder nutzen kann“, sagt Grosse.
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbibliothek+mainz
KlausGraf - am Freitag, 8. Juni 2012, 09:16 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Reinhard Markner schreibt mir: "Es geht um die unbefristete Schließung der Universitätsbibliothek Pisa aus Gründen der Gebäudestatik. In Italien kann so etwas leicht dazu führen, daß die betroffene Institution für Jahrzehnte außer Gefecht ist."
"All’attenzione del Sindaco di Pisa, dott. Marco Filippeschi
All’attenzione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pisa
All’attenzione della Provincia di Pisa
All’attenzione del Servizio Cultura della Provincia di Pisa
All’attenzione della Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della
Regione Toscana
All’attenzione della Direzione generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il diritto d’autore
All’attenzione degli studiosi e degli utenti della Biblioteca Universitaria di Pisa
All’attenzione della comunità tutta di Pisa
Come è noto, con provvedimento dello scorso 29 maggio, il palazzo della Sapienza, sito in via Curtatone e Montanara 15 a Pisa è stato chiuso al pubblico; con esso sono state chiuse anche la Facoltà di Giurisprudenza, ospitata in tale sede, e la Biblioteca Universitaria, sita al primo piano dell’edificio. Le ragioni della chiusura sono senz’altro serie (gravi rischi alla statica dell’edificio), e non c’è ragione per mettere in discussione un tale provvedimento. Tenendo conto che il problema era noto da tempo e che la Direzione della Biblioteca ha più volte sollecitato
l’attenzione della comunità cittadina e degli uffici competenti su questo fronte, occorrerebbe forse discutere della scarsa lungimiranza che ha portato a un evento come questo: ciò va detto anche alla luce di alcune notizie contrastanti che si apprendono dai giornali
e dagli altri mezzi di comunicazione, notizie che non gettano buona luce sulla condotta di altri ospiti del palazzo della Sapienza.
Quel che importa è che la chiusura coatta del palazzo della Sapienza comporterà disagi assai rilevanti per l’intera comunità di persone che afferivano a questo edificio. Se la chiusura del polo di Giurisprudenza ha in qualche modo trovato una serie di soluzioni
alternative, non pare che lo stesso possa dirsi per la Biblioteca Universitaria. L’ingente quantità di documenti conservati presso la Biblioteca richiede di considerare il problema con cautela e insieme con accortezza, in ragione della straordinaria qualità dei materiali
che essa conserva, tale da renderla uno dei poli bibliografici più importanti e più rinomati dell’intera Toscana.
La città di Pisa si trova infatti nella felice condizione di poter disporre di rilevanti raccolte librarie in poche centinaia di metri quadrati: la Biblioteca Universitaria, la Biblioteca della Scuola Normale Superiore, la Biblioteca della Scuola Sant’Anna e quelle
dei Dipartimenti universitari. Ognuna di queste biblioteche è specializzata in determinati ambiti della ricerca, e questo insieme armonioso è senza dubbio uno degli elementi qualificanti per gli studi universitari a Pisa. In particolare, con il suo rilevante patrimonio, la Biblioteca Universitaria garantisce un nucleo storico che non è sostituibile con alcuna delle altre raccolte pisane, e che si distingue anzi con estrema chiarezza nel panorama delle biblioteche universitarie italiane.
La Biblioteca conserva materiali di enorme pregio: molti conoscono i pregevolissimi manoscritti del fondo Rossellini e quelli provenienti dall’Hortus pisanus. Numerosi sono gli incunaboli e numerosissime sono le edizioni cinquecentesche, alcune delle quali in esemplare unico o con note di possesso illustri (Benedetto Varchi, Scipione Ammirato, Anton Maria Salvini, etc.). Molti di questi volumi provengono dalla raccolta Palatina di Firenze, trasferiti a Pisa nel 1771, e alcuni di essi erano già parte delle collezioni Medicea Palatina e Lotaringia Palatina di Firenze. Di enorme interesse sono i libri provenienti dalle raccolte di Anton Francesco Gori, di Angelo Fabroni, di Alessandro D’Ancona, della famiglia Orsini Baroni. La straordinaria preziosità di tutti questi documenti è dimostrata dall’interesse che studiosi di tutto il mondo hanno sempre rivolto al patrimonio della Biblioteca Universitaria. Enorme è la raccolta di pubblicazioni periodiche, sette- otto- e novecentesche, molte delle quali di difficile reperibilità. Ed è quasi inutile ricordare come la Biblioteca, in ragione dell’obbligo del deposito librario delle
opere stampate a Pisa e nella sua provincia, raccolga anche numerosissimi periodici correnti, a loro volta difficilmente reperibili in altra sede: il dettaglio non è irrilevante, dal momento che, in ragione del costo di alcune riviste, le altre biblioteche pisane ne hanno in molti casi dismesso gli abbonamenti.
In attesa di una soluzione, con la chiusura della Biblioteca tutti questi materiali resteranno inaccessibili al pubblico, con l’effetto concreto di bloccare sine die le ricerche di
molti studiosi attivi a Pisa, in Toscana e fuori. A questo si aggiunge poi un altro rischio,
tutt’altro che remoto: che cioè l’inestimabile patrimonio della Biblioteca Universitaria
venga non solo reso momentaneamente inutilizzabile, ma anche lasciato nei prossimi
mesi in condizioni non adeguate, almeno fino a quando non si troverà una qualche soluzione. Per limitarsi a ricordare solo alcuni dei grossi problemi che minacciano i volumi
antichi e moderni, è chiaro che, in mancanza delle opportune e anzi necessarie misure di
tutela del materiali cartacei, una eccessiva umidità o l’esposizione ai tarli o alle muffe
danneggerebbero volumi e documenti in modo irreversibile, con enorme perdita non solo per gli utenti, ma anche per la città tutta e per il mondo della ricerca, italiana e straniera.
Con la presente petizione, che si unisce alle richieste già formulate dai dipendenti
della Biblioteca negli scorsi giorni, si chiede una ponderata presa di posizione da parte
degli enti competenti. In particolar modo, sembra lecito auspicare:
- che, pur nei limiti imposti da una soluzione d’urgenza, si possa garantire a questo straordinario patrimonio una sede che – per quanto temporanea – possa essere adeguata, capace di accogliere nel migliore dei modi possibili i documenti che
la Biblioteca conserva;
- che i fondi della Biblioteca possano rimanere vicini alla realtà alla quale per lungo tempo essa è stata e rimane legata;
- che la Direzione e il personale della Biblioteca possano essere fattivamente partecipi delle scelte che riguarderanno la destinazione futura dei materiali librari e
la relativa conservazione di essi;
- che, se non in maniera integrale, almeno una parte significativa dei volumi e dei
manoscritti conservati dalla Biblioteca possa essere reso fruibile alla comunità
degli studiosi e alla comunità tutta di Pisa entro tempi il più possibile brevi e in
forma adeguata al valore testimoniale di essi;
- che una maggiore sensibilità su questo fronte possa venire da parte dell’intera
comunità cittadina, oltre che da parte delle realtà amministrative e dalla comunità universitaria tutta;
- che, nel fronteggiare questa emergenza, possa essere meno scontato pensare a un
maggiore interesse da parte delle realtà istituzionali alle quali ci si rivolge verso
il prezioso materiale conservato dalla Biblioteca Universitaria.
Nella speranza che queste parole possano trovare un pubblico sensibile, è gradito inviare i più cordiali saluti. "
Siehe auch
http://molly.pisa.sbn.it:3000/it/news/notizie/chiusura/
http://www.firmiamo.it/per-biblioteca-universitaria-pisa
"All’attenzione del Sindaco di Pisa, dott. Marco Filippeschi
All’attenzione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pisa
All’attenzione della Provincia di Pisa
All’attenzione del Servizio Cultura della Provincia di Pisa
All’attenzione della Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della
Regione Toscana
All’attenzione della Direzione generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il diritto d’autore
All’attenzione degli studiosi e degli utenti della Biblioteca Universitaria di Pisa
All’attenzione della comunità tutta di Pisa
Come è noto, con provvedimento dello scorso 29 maggio, il palazzo della Sapienza, sito in via Curtatone e Montanara 15 a Pisa è stato chiuso al pubblico; con esso sono state chiuse anche la Facoltà di Giurisprudenza, ospitata in tale sede, e la Biblioteca Universitaria, sita al primo piano dell’edificio. Le ragioni della chiusura sono senz’altro serie (gravi rischi alla statica dell’edificio), e non c’è ragione per mettere in discussione un tale provvedimento. Tenendo conto che il problema era noto da tempo e che la Direzione della Biblioteca ha più volte sollecitato
l’attenzione della comunità cittadina e degli uffici competenti su questo fronte, occorrerebbe forse discutere della scarsa lungimiranza che ha portato a un evento come questo: ciò va detto anche alla luce di alcune notizie contrastanti che si apprendono dai giornali
e dagli altri mezzi di comunicazione, notizie che non gettano buona luce sulla condotta di altri ospiti del palazzo della Sapienza.
Quel che importa è che la chiusura coatta del palazzo della Sapienza comporterà disagi assai rilevanti per l’intera comunità di persone che afferivano a questo edificio. Se la chiusura del polo di Giurisprudenza ha in qualche modo trovato una serie di soluzioni
alternative, non pare che lo stesso possa dirsi per la Biblioteca Universitaria. L’ingente quantità di documenti conservati presso la Biblioteca richiede di considerare il problema con cautela e insieme con accortezza, in ragione della straordinaria qualità dei materiali
che essa conserva, tale da renderla uno dei poli bibliografici più importanti e più rinomati dell’intera Toscana.
La città di Pisa si trova infatti nella felice condizione di poter disporre di rilevanti raccolte librarie in poche centinaia di metri quadrati: la Biblioteca Universitaria, la Biblioteca della Scuola Normale Superiore, la Biblioteca della Scuola Sant’Anna e quelle
dei Dipartimenti universitari. Ognuna di queste biblioteche è specializzata in determinati ambiti della ricerca, e questo insieme armonioso è senza dubbio uno degli elementi qualificanti per gli studi universitari a Pisa. In particolare, con il suo rilevante patrimonio, la Biblioteca Universitaria garantisce un nucleo storico che non è sostituibile con alcuna delle altre raccolte pisane, e che si distingue anzi con estrema chiarezza nel panorama delle biblioteche universitarie italiane.
La Biblioteca conserva materiali di enorme pregio: molti conoscono i pregevolissimi manoscritti del fondo Rossellini e quelli provenienti dall’Hortus pisanus. Numerosi sono gli incunaboli e numerosissime sono le edizioni cinquecentesche, alcune delle quali in esemplare unico o con note di possesso illustri (Benedetto Varchi, Scipione Ammirato, Anton Maria Salvini, etc.). Molti di questi volumi provengono dalla raccolta Palatina di Firenze, trasferiti a Pisa nel 1771, e alcuni di essi erano già parte delle collezioni Medicea Palatina e Lotaringia Palatina di Firenze. Di enorme interesse sono i libri provenienti dalle raccolte di Anton Francesco Gori, di Angelo Fabroni, di Alessandro D’Ancona, della famiglia Orsini Baroni. La straordinaria preziosità di tutti questi documenti è dimostrata dall’interesse che studiosi di tutto il mondo hanno sempre rivolto al patrimonio della Biblioteca Universitaria. Enorme è la raccolta di pubblicazioni periodiche, sette- otto- e novecentesche, molte delle quali di difficile reperibilità. Ed è quasi inutile ricordare come la Biblioteca, in ragione dell’obbligo del deposito librario delle
opere stampate a Pisa e nella sua provincia, raccolga anche numerosissimi periodici correnti, a loro volta difficilmente reperibili in altra sede: il dettaglio non è irrilevante, dal momento che, in ragione del costo di alcune riviste, le altre biblioteche pisane ne hanno in molti casi dismesso gli abbonamenti.
In attesa di una soluzione, con la chiusura della Biblioteca tutti questi materiali resteranno inaccessibili al pubblico, con l’effetto concreto di bloccare sine die le ricerche di
molti studiosi attivi a Pisa, in Toscana e fuori. A questo si aggiunge poi un altro rischio,
tutt’altro che remoto: che cioè l’inestimabile patrimonio della Biblioteca Universitaria
venga non solo reso momentaneamente inutilizzabile, ma anche lasciato nei prossimi
mesi in condizioni non adeguate, almeno fino a quando non si troverà una qualche soluzione. Per limitarsi a ricordare solo alcuni dei grossi problemi che minacciano i volumi
antichi e moderni, è chiaro che, in mancanza delle opportune e anzi necessarie misure di
tutela del materiali cartacei, una eccessiva umidità o l’esposizione ai tarli o alle muffe
danneggerebbero volumi e documenti in modo irreversibile, con enorme perdita non solo per gli utenti, ma anche per la città tutta e per il mondo della ricerca, italiana e straniera.
Con la presente petizione, che si unisce alle richieste già formulate dai dipendenti
della Biblioteca negli scorsi giorni, si chiede una ponderata presa di posizione da parte
degli enti competenti. In particolar modo, sembra lecito auspicare:
- che, pur nei limiti imposti da una soluzione d’urgenza, si possa garantire a questo straordinario patrimonio una sede che – per quanto temporanea – possa essere adeguata, capace di accogliere nel migliore dei modi possibili i documenti che
la Biblioteca conserva;
- che i fondi della Biblioteca possano rimanere vicini alla realtà alla quale per lungo tempo essa è stata e rimane legata;
- che la Direzione e il personale della Biblioteca possano essere fattivamente partecipi delle scelte che riguarderanno la destinazione futura dei materiali librari e
la relativa conservazione di essi;
- che, se non in maniera integrale, almeno una parte significativa dei volumi e dei
manoscritti conservati dalla Biblioteca possa essere reso fruibile alla comunità
degli studiosi e alla comunità tutta di Pisa entro tempi il più possibile brevi e in
forma adeguata al valore testimoniale di essi;
- che una maggiore sensibilità su questo fronte possa venire da parte dell’intera
comunità cittadina, oltre che da parte delle realtà amministrative e dalla comunità universitaria tutta;
- che, nel fronteggiare questa emergenza, possa essere meno scontato pensare a un
maggiore interesse da parte delle realtà istituzionali alle quali ci si rivolge verso
il prezioso materiale conservato dalla Biblioteca Universitaria.
Nella speranza che queste parole possano trovare un pubblico sensibile, è gradito inviare i più cordiali saluti. "
Siehe auch
http://molly.pisa.sbn.it:3000/it/news/notizie/chiusura/
http://www.firmiamo.it/per-biblioteca-universitaria-pisa
KlausGraf - am Freitag, 8. Juni 2012, 01:34 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://baekur.is/en/search/$N/TITLE
Auch lateinisches, während Deutsches so gut wie nicht vertreten ist.
Via
http://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen

Auch lateinisches, während Deutsches so gut wie nicht vertreten ist.
Via
http://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen

KlausGraf - am Freitag, 8. Juni 2012, 00:55 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Historische Gymnasialbibliotheken präsentieren sich auf den Homepages der altehrwürdigen Anstalten unterdessen gelegentlich im Internet, manchmal schüchtern, manchmal erhaben (oft aber gar nicht, weil's sie nicht mehr gibt) - doch wer kennt sie und wer findet sie? Im virtuellen Universum bloggen unterdessen zwei (in Zahlen: 2):
diese https://bismarckbibliothek.wordpress.com/
und jene: http://anonymea.tumblr.com/
Über das Blog "bismarckbibliothek" habe ich herausgefunden (auf der Homepage des altehrwürdigen Bismarck-Gymnasiums zu Karlsruhe http://www.bismarck-gymnasium.de/ nur ein kaum zu findender Hinweis), wie sich Partien der jüngeren Geschichte alter gymnasialer Buchsammlungen gleichen können:
via:
https://bismarckbibliothek.wordpress.com/2012/04/16/mit-alten-buchern-neues-lernen/
hierher:
https://bismarckbibliothek.files.wordpress.com/2012/04/mit-alten-bc3bcchern-neues-lernen.pdf
http://www.christianeum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=380&Itemid=166&limitstart=1
Nach dem Zweiten Weltkrieg gerupfte Bestände versuchen zu zaubern, um ihre Identitäten wieder vorhanden zu machen?
Siehe auch in "Archivalia":
http://archiv.twoday.net/search?q=historische%20schulbibliothek&start=10
http://archiv.twoday.net/search?q=historische+gymnasialbibliothek
diese https://bismarckbibliothek.wordpress.com/
und jene: http://anonymea.tumblr.com/
Über das Blog "bismarckbibliothek" habe ich herausgefunden (auf der Homepage des altehrwürdigen Bismarck-Gymnasiums zu Karlsruhe http://www.bismarck-gymnasium.de/ nur ein kaum zu findender Hinweis), wie sich Partien der jüngeren Geschichte alter gymnasialer Buchsammlungen gleichen können:
via:
https://bismarckbibliothek.wordpress.com/2012/04/16/mit-alten-buchern-neues-lernen/
hierher:
https://bismarckbibliothek.files.wordpress.com/2012/04/mit-alten-bc3bcchern-neues-lernen.pdf
http://www.christianeum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=380&Itemid=166&limitstart=1
Nach dem Zweiten Weltkrieg gerupfte Bestände versuchen zu zaubern, um ihre Identitäten wieder vorhanden zu machen?
Siehe auch in "Archivalia":
http://archiv.twoday.net/search?q=historische%20schulbibliothek&start=10
http://archiv.twoday.net/search?q=historische+gymnasialbibliothek
FeliNo - am Donnerstag, 7. Juni 2012, 22:47 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Erfahrungsaustausch zur Arbeit mit Nachlässen und verbotenem Material, zur Archivierung audiovisueller Dokumente, zum Umgang mit Archivnutzer/innen und zu Digitalisierungswerkzeugen.
Do, 14.6.12 13 Uhr bis Fr, 15.6.12 18 Uhr
Anmeldeschluss: 08.06.2012
Information und Anmeldung:
Anne Vechtel, vechtel@boell.de, +49 30 28534-262
http://www.boell.de/calendar/VA-viewevt-de.aspx?evtid=11293&crtpage=1
Programm:
http://boellblog.org/wp-content/uploads/2012/04/Programm_Workshops_der_Archive_6.pdf
Do, 14.6.12 13 Uhr bis Fr, 15.6.12 18 Uhr
Anmeldeschluss: 08.06.2012
Information und Anmeldung:
Anne Vechtel, vechtel@boell.de, +49 30 28534-262
http://www.boell.de/calendar/VA-viewevt-de.aspx?evtid=11293&crtpage=1
Programm:
http://boellblog.org/wp-content/uploads/2012/04/Programm_Workshops_der_Archive_6.pdf
SW - am Donnerstag, 7. Juni 2012, 22:04 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
So muss m. E. archivisches Bewegtbild aussehen. Gute Bilder, die neugierig machen, und das Ganze kurz und knackig!
#Bestandserhaltung
Wolf Thomas - am Donnerstag, 7. Juni 2012, 20:59 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
"In den fünfziger und sechziger Jahren hörte man Adorno fast jede Woche: im Rundfunk! In Berlin verwaltet Michael Schwarz die Stimme des Soziologen."
http://www.zeit.de/kultur/literatur/2010-04/adorno-archivar/komplettansicht
(Artikel vom April 2010!)
Über Adornos Rundfunktätigkeit:
Michael Schwarz : „Er redet leicht, schreibt schwer“ Theodor W. Adorno am Mikrophon
http://www.zeithistorische-forschungen.de/site/40209146/default.aspx
Informationen zur Benutzung des Theodor W. Adorno Archivs
http://www.adk.de/de/archiv/archivbestand/literatur/kuenstler/adorno_info.html
http://www.zeit.de/kultur/literatur/2010-04/adorno-archivar/komplettansicht
(Artikel vom April 2010!)
Über Adornos Rundfunktätigkeit:
Michael Schwarz : „Er redet leicht, schreibt schwer“ Theodor W. Adorno am Mikrophon
http://www.zeithistorische-forschungen.de/site/40209146/default.aspx
Informationen zur Benutzung des Theodor W. Adorno Archivs
http://www.adk.de/de/archiv/archivbestand/literatur/kuenstler/adorno_info.html
SW - am Donnerstag, 7. Juni 2012, 20:53 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Mehr dazu:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Kurier&oldid=103524310
Hat die Staatsanwaltschaft nichts anderes zu tun?
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Kurier&oldid=103524310
Hat die Staatsanwaltschaft nichts anderes zu tun?
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sliderule.PickettN902T.agr.jpg
Photo Arnold Reinhold
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Springer Images's policy seems to be: If it's in a Springer Journal, take it, make money with it and don't make a diligent copyright check. "We have enough money for sporadic complaints if an author doesn't accepts our thefts".
According to the first illustration of the Wikipedia article on Copyfraud this can be labelled as Copyfraud although Jason Mazzone may prefer a stricter definition (only falsely claiming copyright for the public domain).
See also the deletion discussion for the mentioned first illustration
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Deletion_requests/File:WP_on_Getty_images_with_watermark.jpg
See also
http://archiv.twoday.net/stories/97051246/
http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2012/06/07/springergate-i-try-to-explain-springerimages-and-my-continuing-concern/ (and more entries there)
Update:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2012-06-11/Special_report
http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2012/06/13/springergate-springer-replies/

Photo Arnold Reinhold
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Springer Images's policy seems to be: If it's in a Springer Journal, take it, make money with it and don't make a diligent copyright check. "We have enough money for sporadic complaints if an author doesn't accepts our thefts".
According to the first illustration of the Wikipedia article on Copyfraud this can be labelled as Copyfraud although Jason Mazzone may prefer a stricter definition (only falsely claiming copyright for the public domain).
See also the deletion discussion for the mentioned first illustration
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Deletion_requests/File:WP_on_Getty_images_with_watermark.jpg
See also
http://archiv.twoday.net/stories/97051246/
http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2012/06/07/springergate-i-try-to-explain-springerimages-and-my-continuing-concern/ (and more entries there)
Update:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2012-06-11/Special_report
http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2012/06/13/springergate-springer-replies/

KlausGraf - am Donnerstag, 7. Juni 2012, 17:29 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Verhandlungsführer des Rats und des Parlaments der EU haben sich am Mittwoch auf eine gemeinsame Linie zu den sogenannten verwaisten Werken verständigt. Demnach sollen Bücher, Filme, Fotos oder andere geistige Schöpfungen, für die kein Rechteinhaber mehr auffindbar ist, in nicht-kommerziellen Projekten verfügbar gemacht werden dürfen. Sollten im Nachhinein doch noch Ansprüche auf die Werke erhoben werden, sieht der Vorstoß eine angemessene Vergütung vor. So sollen Projekte zur Digitalisierung des kulturellen Erbes beflügelt und aufwendige Gerichtsverfahren wie im US-Streit um Google Books vermieden werden.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Neuer-Richtlinien-Entwurf-fuer-verwaiste-Werke-1612687.html
Die geforderte "sorgfältige Suche" ist nicht praktikabel.
http://archiv.twoday.net/search?q=verwaist
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Neuer-Richtlinien-Entwurf-fuer-verwaiste-Werke-1612687.html
Die geforderte "sorgfältige Suche" ist nicht praktikabel.
http://archiv.twoday.net/search?q=verwaist
KlausGraf - am Donnerstag, 7. Juni 2012, 16:48 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das versteht man unter FUD:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fear,_Uncertainty_and_Doubt
Nicht so die Uni Trier:
http://fud.uni-trier.de/?site_id=101

http://de.wikipedia.org/wiki/Fear,_Uncertainty_and_Doubt
Nicht so die Uni Trier:
http://fud.uni-trier.de/?site_id=101

KlausGraf - am Donnerstag, 7. Juni 2012, 16:36 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Peter Murray Rust setzt seine Kritik fort:
http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2012/06/07/springergate-i-try-to-explain-springerimages-and-my-continuing-concern/
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/97048913/
http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2012/06/07/springergate-i-try-to-explain-springerimages-and-my-continuing-concern/
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/97048913/
KlausGraf - am Donnerstag, 7. Juni 2012, 16:18 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sehr lesenswert:
http://libreas.wordpress.com/2012/06/06/peer-review-eine-entscheidungsfrage-fur-kleine-zeitschriften/
http://libreas.wordpress.com/2012/06/06/peer-review-eine-entscheidungsfrage-fur-kleine-zeitschriften/
KlausGraf - am Donnerstag, 7. Juni 2012, 15:06 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
Ergänzungen sind willkommen:
http://de.wikiversity.org/wiki/Aufsatzrecherche
Die Seite wurde heute etwas ergänzt bzw. überarbeitet.
http://de.wikiversity.org/wiki/Aufsatzrecherche
Die Seite wurde heute etwas ergänzt bzw. überarbeitet.
Sommerloch-Vorboten des lokalen Qualitätsjournalismus
Am 4. Juni 2012 meldete die WDR-Lokalzeit Südwestfalen in ihren Nachrichten : "Der Siegener Stadtverwaltung bereiten feuchte und verschimmelte Unterlagen Sorgen. Im Aktenlager im Gewölbekeller unter dem Rathaus hat sich der Schimmelpilz so weit ausgebreitet, dass Mitarbeiter den Keller nur noch mit Atemschutz betreten dürfen. Ursache sind die feuchten Grundmauern, die aus dem Mittelalter stammen. Historisch wertvolle Unterlagen sind deshalb schon ins Stadtarchiv ausgelagert worden. Es ist geplant, die übrigen Akten im Laufe dieses Jahres zu reinigen und dann anderswo unterzubringen."
Eine neugierig-besorgte Rückfrage beim Kollegen ergab, dass es sich um ein seit 2004 bekanntes Problem handelt. Bereits in diesem Jahr hatte das Stadtarchiv die genannten Unterlagen, entsprechend behandelt, übernommen.
Immerhin wurde in den 18:00-Nachrichten der Lokalzeit Südwestfalen ein ausführlicher Bericht für den kommenden Tag angekündigt.
Am 5. Juni 2012 meldete Radio Siegen: "Gewölbekeller lässt Feuchtigkeit durch Siegen hat mit schimmelnden Akten zu kämpfen
Die Stadt Siegen hat mit schimmelnden Akten in einem alten Keller unter dem Rathaus zu kämpfen. Dort dringt Feuchtigkeit ein. Der Gewölbekeller ist ein Überbleibsel aus dem Mittelalter. Das Problem ist der Stadt seit acht Jahren bekannt. In der Zwischenzeit hat das Stadtarchiv wichtige Unterlagen aussortiert. Die verbliebenen Akten müssen nun im Laufe des Jahres gereinigt und anderswo untergebracht werden. Wie viel die Reinigung durch eine Fachfirma kostet, ist unklar."
Gegen 10:00 Uhr vormittags fand sich auf der WDR-Videotextseite 788 der am Vortag angekündigte Bericht mit der Schlagzeile :"Schimmel im Stadtarchiv Siegen." Um 14:00 meldete der Kollege, dass nach dem Besuch des WDR-Teams der Titel des Beitrags geändert wurde: "Schimmel im Aktenlager des Rathauses Siegen." Dieser WDR-Bericht ist ab heute in der 7-Tage Rückschau zu sehen. Heute berichtet nun die Siegener Zeitung: "Die Stadt Siegen hat ein Problem: In einem unter dem Rathaus der Krönchenstadt gelegenen Gewölbekeller eingelagerte Akten schimmeln vor sich hin. Feuchtigkeit ist in den Keller, dessen Gemäuer aus dem Mittelalter stammen eingedrungen, bestätigte Pressesprecherin Astrid Schneider gestern der Siegener Zeitung. Deshalb müssen die Akten - Verwaltungsunterlagen des Standesamtes und des früheren Sozialamtes - nun aussortiert werden und zum Teil von einer Fachfirma gereinigt werden. Wichtige Unterlagen seien vom Schimmelpilz nicht betroffen - weder historische Dokumente noch Akten, die aus rechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. Solche Unterlagen seien bereits vor Jahren ins Statdarchiv ausgelagert worden, betonte Schneider, "wir haben nichts verloren."
Der rund 130 Quadratmeter große Keller befindet sich unter dem heutigen Ratssaalgebäude und war einst Teil des mittelalterlichen Rathauses. Die Sanierung ist seit Jahren immer mal wieder ein Thema in der Kommunalpolitik. Im Herbst soll sie über die Trockenlegung entscheiden, ein entsprechender Verwaltungsvorschlag ist in Arbeit."
Fragen:
1) Ist einem der konkrete Anlass klar geworden?
2) Ist Schimmelbildung in feuchten Kellern das Problem - oder das seit acht Jahren keine Lösung gefunden wurde?
3) Was hat der Aktenkeller eigentlich mit dem Stadtarchiv zu tun? [Das Siegener Stadtarchiv befindet auf der anderen Straßenseite gegenüber dem Rathausgebäude.]
4) Wem fällt bei dem verlinkten Fernsehbericht was auf (bitte als Kommentar)?
Am 4. Juni 2012 meldete die WDR-Lokalzeit Südwestfalen in ihren Nachrichten : "Der Siegener Stadtverwaltung bereiten feuchte und verschimmelte Unterlagen Sorgen. Im Aktenlager im Gewölbekeller unter dem Rathaus hat sich der Schimmelpilz so weit ausgebreitet, dass Mitarbeiter den Keller nur noch mit Atemschutz betreten dürfen. Ursache sind die feuchten Grundmauern, die aus dem Mittelalter stammen. Historisch wertvolle Unterlagen sind deshalb schon ins Stadtarchiv ausgelagert worden. Es ist geplant, die übrigen Akten im Laufe dieses Jahres zu reinigen und dann anderswo unterzubringen."
Eine neugierig-besorgte Rückfrage beim Kollegen ergab, dass es sich um ein seit 2004 bekanntes Problem handelt. Bereits in diesem Jahr hatte das Stadtarchiv die genannten Unterlagen, entsprechend behandelt, übernommen.
Immerhin wurde in den 18:00-Nachrichten der Lokalzeit Südwestfalen ein ausführlicher Bericht für den kommenden Tag angekündigt.
Am 5. Juni 2012 meldete Radio Siegen: "Gewölbekeller lässt Feuchtigkeit durch Siegen hat mit schimmelnden Akten zu kämpfen
Die Stadt Siegen hat mit schimmelnden Akten in einem alten Keller unter dem Rathaus zu kämpfen. Dort dringt Feuchtigkeit ein. Der Gewölbekeller ist ein Überbleibsel aus dem Mittelalter. Das Problem ist der Stadt seit acht Jahren bekannt. In der Zwischenzeit hat das Stadtarchiv wichtige Unterlagen aussortiert. Die verbliebenen Akten müssen nun im Laufe des Jahres gereinigt und anderswo untergebracht werden. Wie viel die Reinigung durch eine Fachfirma kostet, ist unklar."
Gegen 10:00 Uhr vormittags fand sich auf der WDR-Videotextseite 788 der am Vortag angekündigte Bericht mit der Schlagzeile :"Schimmel im Stadtarchiv Siegen." Um 14:00 meldete der Kollege, dass nach dem Besuch des WDR-Teams der Titel des Beitrags geändert wurde: "Schimmel im Aktenlager des Rathauses Siegen." Dieser WDR-Bericht ist ab heute in der 7-Tage Rückschau zu sehen. Heute berichtet nun die Siegener Zeitung: "Die Stadt Siegen hat ein Problem: In einem unter dem Rathaus der Krönchenstadt gelegenen Gewölbekeller eingelagerte Akten schimmeln vor sich hin. Feuchtigkeit ist in den Keller, dessen Gemäuer aus dem Mittelalter stammen eingedrungen, bestätigte Pressesprecherin Astrid Schneider gestern der Siegener Zeitung. Deshalb müssen die Akten - Verwaltungsunterlagen des Standesamtes und des früheren Sozialamtes - nun aussortiert werden und zum Teil von einer Fachfirma gereinigt werden. Wichtige Unterlagen seien vom Schimmelpilz nicht betroffen - weder historische Dokumente noch Akten, die aus rechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. Solche Unterlagen seien bereits vor Jahren ins Statdarchiv ausgelagert worden, betonte Schneider, "wir haben nichts verloren."
Der rund 130 Quadratmeter große Keller befindet sich unter dem heutigen Ratssaalgebäude und war einst Teil des mittelalterlichen Rathauses. Die Sanierung ist seit Jahren immer mal wieder ein Thema in der Kommunalpolitik. Im Herbst soll sie über die Trockenlegung entscheiden, ein entsprechender Verwaltungsvorschlag ist in Arbeit."
Fragen:
1) Ist einem der konkrete Anlass klar geworden?
2) Ist Schimmelbildung in feuchten Kellern das Problem - oder das seit acht Jahren keine Lösung gefunden wurde?
3) Was hat der Aktenkeller eigentlich mit dem Stadtarchiv zu tun? [Das Siegener Stadtarchiv befindet auf der anderen Straßenseite gegenüber dem Rathausgebäude.]
4) Wem fällt bei dem verlinkten Fernsehbericht was auf (bitte als Kommentar)?
Wolf Thomas - am Mittwoch, 6. Juni 2012, 18:47 - Rubrik: Wahrnehmung
Ein einsichtsvoller Artikel:
http://www.technologyreview.com/featured-story/427628/the-library-of-utopia/
http://www.technologyreview.com/featured-story/427628/the-library-of-utopia/
KlausGraf - am Mittwoch, 6. Juni 2012, 14:20 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
http://www.dradio.de/dkultur/kulturpresseschau/fazit/1775783/
Ins Spekulative weist auch ein langer Artikel in der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG über eine sehr alte Frage, nämlich die nach dem vor 200 Jahren geborenen Findelkind Kaspar Hauser und seiner wahren Identität. War Kaspar Hauser in Wahrheit der Erbprinz von Baden? Das Rätsel könnte womöglich gelöst werden, schreibt der Karlsruher Rechtshistoriker und Rechtsanwalt Winfried Klein, "anhand des DNS-Materials von Angehörigen des Hauses Baden" aus "Särgen in der Fürstengruft in Pforzheim", deren Entnahme aber das Veto des Oberhaupts der Familie Markgraf Max entgegensteht.
Dabei gehört die Gruft dem Fürstenhaus gar nicht, weist der Anwalt nach. "Die geforderte Mitwirkung des Markgrafen dürfte damit der bloßen Rücksichtnahme auf das Recht der Totenfürsorge entspringen. Mehr als hundertfünfzig Jahre nach der letzten Bestattung kommt diesem jedoch keine rechtliche Bedeutung mehr zu."
Der Fall gibt noch zu vielerlei weiteren juristisch und rechtshistorisch faszinierenden Betrachtungen Anlass, etwa diese: "Selbst wenn die Kosten für die Särge aus der großherzoglichen Handkasse beglichen worden wären, so spräche dies nicht unbedingt für privates Eigentum des Hauses Baden; denn es könnte auch eine Zahlung auf fremde Schuld angenommen werden."
Die Schlussfolgerung: "Damit kann festgehalten werden, dass die Schlosskirche mitsamt der Gruft und den Särgen Staatseigentum ist." Das Land Baden-Württemberg könnte somit Kaspar Hauser nach 200 Jahren endlich zu einer Identität verhelfen. Unter Feuilletonisten sei die Frage gestattet: Wäre das nicht eigentlich schade?
Update: Der Beitrag ist online
http://www.faz.net/frankfurter-allgemeine-zeitung/die-frage-der-herkunft-kann-das-raetsel-um-kaspar-hauser-doch-geloest-werden-11775177.html
Fortsetzung:
http://archiv.twoday.net/stories/109333538/
Ins Spekulative weist auch ein langer Artikel in der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG über eine sehr alte Frage, nämlich die nach dem vor 200 Jahren geborenen Findelkind Kaspar Hauser und seiner wahren Identität. War Kaspar Hauser in Wahrheit der Erbprinz von Baden? Das Rätsel könnte womöglich gelöst werden, schreibt der Karlsruher Rechtshistoriker und Rechtsanwalt Winfried Klein, "anhand des DNS-Materials von Angehörigen des Hauses Baden" aus "Särgen in der Fürstengruft in Pforzheim", deren Entnahme aber das Veto des Oberhaupts der Familie Markgraf Max entgegensteht.
Dabei gehört die Gruft dem Fürstenhaus gar nicht, weist der Anwalt nach. "Die geforderte Mitwirkung des Markgrafen dürfte damit der bloßen Rücksichtnahme auf das Recht der Totenfürsorge entspringen. Mehr als hundertfünfzig Jahre nach der letzten Bestattung kommt diesem jedoch keine rechtliche Bedeutung mehr zu."
Der Fall gibt noch zu vielerlei weiteren juristisch und rechtshistorisch faszinierenden Betrachtungen Anlass, etwa diese: "Selbst wenn die Kosten für die Särge aus der großherzoglichen Handkasse beglichen worden wären, so spräche dies nicht unbedingt für privates Eigentum des Hauses Baden; denn es könnte auch eine Zahlung auf fremde Schuld angenommen werden."
Die Schlussfolgerung: "Damit kann festgehalten werden, dass die Schlosskirche mitsamt der Gruft und den Särgen Staatseigentum ist." Das Land Baden-Württemberg könnte somit Kaspar Hauser nach 200 Jahren endlich zu einer Identität verhelfen. Unter Feuilletonisten sei die Frage gestattet: Wäre das nicht eigentlich schade?
Update: Der Beitrag ist online
http://www.faz.net/frankfurter-allgemeine-zeitung/die-frage-der-herkunft-kann-das-raetsel-um-kaspar-hauser-doch-geloest-werden-11775177.html
Fortsetzung:
http://archiv.twoday.net/stories/109333538/
KlausGraf - am Mittwoch, 6. Juni 2012, 13:14 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die italienische Region Emilia-Romagna, die in den letzten Wochen so stark unter wiederholten Erdbeben zu leiden hatte, sucht freiwillige Archivkräfte, die bei der Bergung von betroffenen Archiveinrichtungen zur Hand gehen könnten. Alle Details, Kontaktadressen und ein entsprechendes Formular sind auf der Homepage der regionalen Archiv-Soprintendenza von Bologna zu finden:
http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it/index.php?id=59&tx_ttnews[tt_news]=81&tx_ttnews[backPid]=46&cHash=4e146590234657b30f53740992e67c37
http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it/index.php?id=59&tx_ttnews[tt_news]=81&tx_ttnews[backPid]=46&cHash=4e146590234657b30f53740992e67c37
ho - am Mittwoch, 6. Juni 2012, 10:59 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Präsident des Deutschen Hochschulverbands plädiert für eine Verjährungsfrist von zehn Jahren.
http://www.heise.de/tp/blogs/6/152132
Klar, vertuschen und unter den Teppich kehren, vor allem wenn die Wissenschaftsministerin involviert ist.
http://www.heise.de/tp/blogs/6/152132
Klar, vertuschen und unter den Teppich kehren, vor allem wenn die Wissenschaftsministerin involviert ist.
KlausGraf - am Dienstag, 5. Juni 2012, 20:39 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
http://www.urheberrecht.org/news/4637/
"Mit seiner heute veröffentlichten Entscheidung vom 30. November 2011 (Az.: I ZR 212/10 - Blühende Landschaften [...]) befand der I. Zivilsenat des BGH, dass die Aufnahme fremder Zeitungsartikel und Lichtbilder in einer literarischen Collage bei der durch Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG geforderten kunstspezifischen Auslegung des Urheberrechts nicht ohne Weiteres durch das Zitatrecht § 51 Satz 2 Nr. 2 UrhG gedeckt ist. Die kunstspezifische Betrachtung verlange, bei Auslegung und Anwendung des § 51 Satz 2 Nr.2 UrhG die innere Verbindung der zitierten Stellen mit den Gedanken und Überlegungen des Zitierenden über die bloße Belegfunktion hinaus auch als Mittel künstlerischen Ausdrucks und künstlerischer Gestaltung anzuerkennen. Kunstcharakter habe ein Werk jedoch nicht bereits aufgrund des Umstands, dass eine Kombination aus eigenen Texten des Autors mit Artikeln aus Zeitungen, Urkunden und Lichtbildern auch als künstlerische Technik, namentlich als literarische Collage oder Montage, in Betracht komme. Erforderlich sei vielmehr, dass das Werk auch die der Kunst eigenen materiellen Strukturmerkmale aufweise, insbesondere Ergebnis freier schöpferischer Gestaltung sei."
Es ist einfach nur ärgerlich, dass diese unfähigen alten Männer vom Bundesgerichtshof nicht kapieren, dass auch das Urheberrecht im Licht der Grundrechte ausgelegt werden muss und dass es ganz und gar verfehlt ist, die Maßstäbe des richtungsweisenden Germania-Urteils des Bundesverfassungsgerichts eng auf die Kunst zu beziehen statt der überzeugenden Auffassung des insofern erheblich klügeren OLG Brandenburg als Vorinstanz zu folgen.
Volltext:
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=I%20ZR%20212/10&nr=60496
"Mit seiner heute veröffentlichten Entscheidung vom 30. November 2011 (Az.: I ZR 212/10 - Blühende Landschaften [...]) befand der I. Zivilsenat des BGH, dass die Aufnahme fremder Zeitungsartikel und Lichtbilder in einer literarischen Collage bei der durch Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG geforderten kunstspezifischen Auslegung des Urheberrechts nicht ohne Weiteres durch das Zitatrecht § 51 Satz 2 Nr. 2 UrhG gedeckt ist. Die kunstspezifische Betrachtung verlange, bei Auslegung und Anwendung des § 51 Satz 2 Nr.2 UrhG die innere Verbindung der zitierten Stellen mit den Gedanken und Überlegungen des Zitierenden über die bloße Belegfunktion hinaus auch als Mittel künstlerischen Ausdrucks und künstlerischer Gestaltung anzuerkennen. Kunstcharakter habe ein Werk jedoch nicht bereits aufgrund des Umstands, dass eine Kombination aus eigenen Texten des Autors mit Artikeln aus Zeitungen, Urkunden und Lichtbildern auch als künstlerische Technik, namentlich als literarische Collage oder Montage, in Betracht komme. Erforderlich sei vielmehr, dass das Werk auch die der Kunst eigenen materiellen Strukturmerkmale aufweise, insbesondere Ergebnis freier schöpferischer Gestaltung sei."
Es ist einfach nur ärgerlich, dass diese unfähigen alten Männer vom Bundesgerichtshof nicht kapieren, dass auch das Urheberrecht im Licht der Grundrechte ausgelegt werden muss und dass es ganz und gar verfehlt ist, die Maßstäbe des richtungsweisenden Germania-Urteils des Bundesverfassungsgerichts eng auf die Kunst zu beziehen statt der überzeugenden Auffassung des insofern erheblich klügeren OLG Brandenburg als Vorinstanz zu folgen.
Volltext:
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=I%20ZR%20212/10&nr=60496
KlausGraf - am Dienstag, 5. Juni 2012, 20:12 - Rubrik: Archivrecht
Springer wehrt sich gegen die Anschuldigungen des Wissenschaftlers Peter Murray Rust, der als "Blogger" abqualifiziert wird:
https://plus.google.com/u/0/116956861224568841998/posts/U1NzRKXCByC
Murray Rusts Eintrag:
http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2012/06/05/springergate-update-from-bettina-goerner-and-some-explanations-i-urge-that-scientific-images-should-be-free-as-in-speech-for-everyone/
Siehe zuvor
http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2012/06/05/springergate-systematic-copyglitch-appropriation-of-wikimedia-content/
Ich habe 2009 den gleichen Sachverhalt wie Murray-Rust hier thematisiert, nämlich dass Springer Images unter freier Lizenz stehende Bilder vermarktet:
http://archiv.twoday.net/stories/5814210/
https://plus.google.com/u/0/116956861224568841998/posts/U1NzRKXCByC
Murray Rusts Eintrag:
http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2012/06/05/springergate-update-from-bettina-goerner-and-some-explanations-i-urge-that-scientific-images-should-be-free-as-in-speech-for-everyone/
Siehe zuvor
http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2012/06/05/springergate-systematic-copyglitch-appropriation-of-wikimedia-content/
Ich habe 2009 den gleichen Sachverhalt wie Murray-Rust hier thematisiert, nämlich dass Springer Images unter freier Lizenz stehende Bilder vermarktet:
http://archiv.twoday.net/stories/5814210/
KlausGraf - am Dienstag, 5. Juni 2012, 18:39 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/uebersicht/leser-oder-surfer_1.17177492.html
Bis zum Jahr 2016 soll das denkmalgeschützte Beaux-Arts-Gebäude vom britischen Stararchitekten Norman Foster in einen ultramodernen Hightech-Büchertempel verwandelt werden, um die von finanziellen Sorgen bedrohte Institution für die Zukunft zu rüsten.
Dazu müssen dem prächtigen Bau die Eingeweide – manche sagen: das Herz – herausgerissen werden. Das alte Bibliotheksmagazin aus Eisen, wo derzeit 3 Millionen Bücher lagern, soll einem computergenerierten Rotationssystem weichen und die vornehmlich von der Forschung genutzte Sammlung teilweise nach New Jersey ausgelagert werden; an deren Stelle wird u. a. ein Multimedia-Zentrum mit Internetcafé entstehen. Ein «glorifiziertes Starbucks», wo lärmende Kids ihre E-Mails checken, schimpfen die Gegner. Architekturhistoriker, die in dem Büchermagazin einen integralen Teil der Architektur des Gebäudes sehen, sprechen von «kulturellem Vandalismus».
Siehe auch
http://www.nybooks.com/articles/archives/2012/jun/07/defense-new-york-public-library/?pagination=false
Bis zum Jahr 2016 soll das denkmalgeschützte Beaux-Arts-Gebäude vom britischen Stararchitekten Norman Foster in einen ultramodernen Hightech-Büchertempel verwandelt werden, um die von finanziellen Sorgen bedrohte Institution für die Zukunft zu rüsten.
Dazu müssen dem prächtigen Bau die Eingeweide – manche sagen: das Herz – herausgerissen werden. Das alte Bibliotheksmagazin aus Eisen, wo derzeit 3 Millionen Bücher lagern, soll einem computergenerierten Rotationssystem weichen und die vornehmlich von der Forschung genutzte Sammlung teilweise nach New Jersey ausgelagert werden; an deren Stelle wird u. a. ein Multimedia-Zentrum mit Internetcafé entstehen. Ein «glorifiziertes Starbucks», wo lärmende Kids ihre E-Mails checken, schimpfen die Gegner. Architekturhistoriker, die in dem Büchermagazin einen integralen Teil der Architektur des Gebäudes sehen, sprechen von «kulturellem Vandalismus».
Siehe auch
http://www.nybooks.com/articles/archives/2012/jun/07/defense-new-york-public-library/?pagination=false
KlausGraf - am Dienstag, 5. Juni 2012, 18:07 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.augias.net/index.php?ref=inc_7683.html
Die 1521 datierte Handschrift "mit Kommentaren zur antiken Perspektiven- und Spiegellehre sowie zur Hydrostatik von Euklid bzw. Archimedes stammt aus der Privatsammlung des ehemaligen schwedischen Generalgouverneurs Axel Graf von Löwen, der diese 1761 testamentarisch der Stadt Stralsund übereignete. Der Verfasser des auf Pergament geschriebenen außergewöhnlichen Buches ist der Portugiese Francisco de Mello."
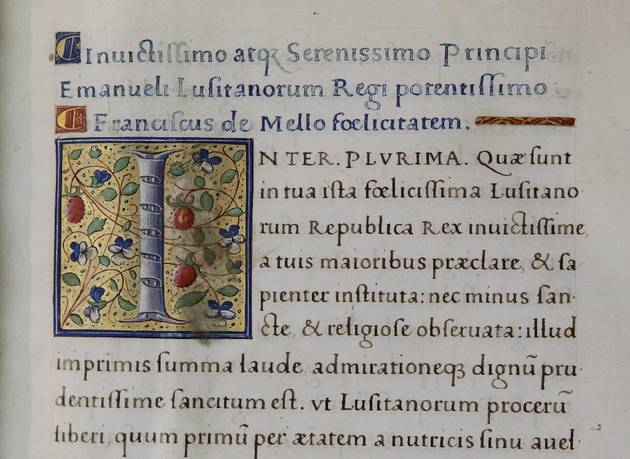
Die 1521 datierte Handschrift "mit Kommentaren zur antiken Perspektiven- und Spiegellehre sowie zur Hydrostatik von Euklid bzw. Archimedes stammt aus der Privatsammlung des ehemaligen schwedischen Generalgouverneurs Axel Graf von Löwen, der diese 1761 testamentarisch der Stadt Stralsund übereignete. Der Verfasser des auf Pergament geschriebenen außergewöhnlichen Buches ist der Portugiese Francisco de Mello."
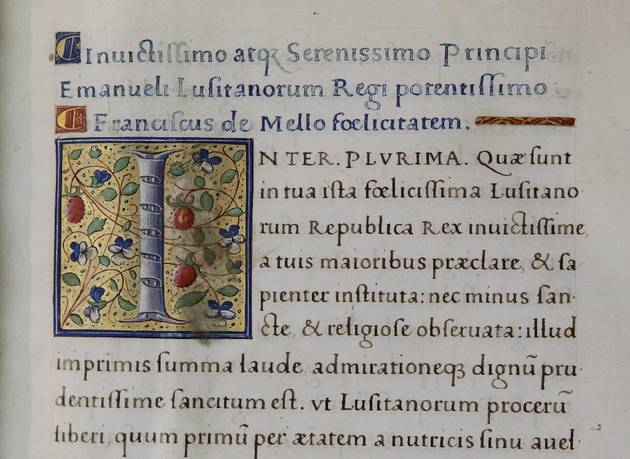
KlausGraf - am Dienstag, 5. Juni 2012, 18:03 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In der geschlossenen Facebook-Gruppe "Archivfragen" entstand heute die Idee zum Internationalen Tag der Archive am 9.6.2012 dem deutschen Bundesarchiv ein - wenn auch verspätetes -Geburtstaggeschenk zu machen. Gedacht ist an Beiträge in den Blogs, auf den Facebook-Seiten, auf Twitter oder auf sonstigen Kanälen. Die Idee geht primär in folgende Richtung "Aus den Beständen des Bundesarchivs (für unseren Kreis, Stadt etc.)". Allerdings sind auch Anekdoten,Benutzungsberichte, etc. denkbar. Falls Sie teilnehmen, schreiben Sie bitte den entsprechenden Link hier als Kommentar zu diesem Artikel. Falls Sie sich nicht auf eigenen Wegen im Web 2.0 bewegen, schreiben Sie ihren Beitrag hier als Kommentar.
Ich würde mich über eine rege Beteiligung sehr freuen.
Twitter_Nutzende verwenden bitte folgenden Hashtag: #archday12 .
Ich würde mich über eine rege Beteiligung sehr freuen.
Twitter_Nutzende verwenden bitte folgenden Hashtag: #archday12 .
Wolf Thomas - am Montag, 4. Juni 2012, 20:23 - Rubrik: Web 2.0
Sagt Anton Tantner bei der Vorstellung des Buchs von Klaus Gantert:
Für H-SOZ-U-KULT rezensiert Thomas Wozniak eine Publikation über Elektronische Informationsressourcen für Historiker, deren Verbreitung der Verlag de Gruyter mit einer vollkommen absurden Preisgestaltung wohl möglichst verhindern möchte: Das Papier-Buch kostet nicht weniger als 60 Euro, inklusive eBook sogar 90 Euro, letzteres scheint nicht für E-Reader konzipiert zu sein. Es ist möglich, einen Online-Zugang zu dem Buch zu erwerben, wer aber z.B. nur das 30 Seiten lange Kapitel E-Books einsehen möchte, darf dafür 30 Euro bezahlen!
Jenseits dieser Absurditäten, die dem Verlag anzulasten sind, hat das Buch auch zumindest einen schweren inhaltlichen Mangel, den der Rezensent vollkommen übersehen hat: Weblogs kommen bis auf eine kurze Erwähnung überhaupt nicht vor, d.h. zum Beispiel, dass eine der wichtigsten elektronischen Ressourcen für Historiker (und Historikerinnen), nämlich Archivalia, mit keinem einzigen Wort genannt wird!
Gantert, Klaus: Elektronische Informationsressourcen für Historiker. (=Bibliotheks- und Informationspraxis; 43). Berlin: de Gruyter, 2011.
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/97047042/
Für H-SOZ-U-KULT rezensiert Thomas Wozniak eine Publikation über Elektronische Informationsressourcen für Historiker, deren Verbreitung der Verlag de Gruyter mit einer vollkommen absurden Preisgestaltung wohl möglichst verhindern möchte: Das Papier-Buch kostet nicht weniger als 60 Euro, inklusive eBook sogar 90 Euro, letzteres scheint nicht für E-Reader konzipiert zu sein. Es ist möglich, einen Online-Zugang zu dem Buch zu erwerben, wer aber z.B. nur das 30 Seiten lange Kapitel E-Books einsehen möchte, darf dafür 30 Euro bezahlen!
Jenseits dieser Absurditäten, die dem Verlag anzulasten sind, hat das Buch auch zumindest einen schweren inhaltlichen Mangel, den der Rezensent vollkommen übersehen hat: Weblogs kommen bis auf eine kurze Erwähnung überhaupt nicht vor, d.h. zum Beispiel, dass eine der wichtigsten elektronischen Ressourcen für Historiker (und Historikerinnen), nämlich Archivalia, mit keinem einzigen Wort genannt wird!
Gantert, Klaus: Elektronische Informationsressourcen für Historiker. (=Bibliotheks- und Informationspraxis; 43). Berlin: de Gruyter, 2011.
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/97047042/
KlausGraf - am Montag, 4. Juni 2012, 17:24 - Rubrik: Allgemeines
Fotoimpressionen der Eröffnungsveranstaltung, 1. Juni 2012
J. Kemper - am Montag, 4. Juni 2012, 08:58 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Es ist das Gedächtnis der Bundesrepublik Deutschland. Alles, was für das Land wichtig ist, wird im Bundesarchiv in Koblenz systematisch gesammelt und aufgehoben. Den Beschluss zur Gründung der Institution fasst die Bundesregierung unter Konrad Adenauer (CDU) am 24. März 1950. Dem Archiv wird unter anderem die Aufgabe gestellt, das "bei der Bundesregierung und ihren Dienststellen anfallende Archivgut" zu ordnen und wissenschaftlich zu verwerten. Auch Materialien aus der Vergangenheit, "der Tätigkeit der ehemaligen deutschen Reichsbehörden und der deutschen Wehrmacht", sollen archiviert werden.
Doch es geht nicht nur um Amtliches: Ergänzend sollen "ferner planmäßig schriftliche Nachlässe, Ausarbeitungen, Denkschriften, Erlebnisberichte usw." von Politikern, Wirtschaftsvertretern sowie Menschen aus dem Sozial- und Kulturleben gesammelt werden - wie es im Bulletin der Bundesregierung heißt. Später werden deshalb nicht nur Gesetzestexte, Akten aus dem Bundeskanzleramt oder Oskar Schindlers Liste aufgehoben. Auch Dinge wie ein Dankesschreiben der Fußballnationalmannschaft von 1958 an Adenauer, ein Bausparkassenvertrag von Bundespräsident Theodor Heuss für sein privates Eigenheim oder die Speisekarten von internationalen Empfängen werden verwahrt. Ebenso sind bedeutende deutsche Spielfilme konservierungswürdig - weil deren Handlungen Spiegelbilder der jeweiligen gesellschaftlichen Situation darstellen.
Neubau wird 1986 eingeweiht
Seine Arbeit nimmt das Bundesarchiv am 3. Juni 1952 in Koblenz auf. Ein leer stehendes Gebäude der ehemaligen preußischen Provinzialregierung hat den Ausschlag für den Dienstort an der Mündung von Mosel und Rhein gegeben. Koblenz wird zunächst als Provisorium gesehen, die Entfernung zur Bundeshauptstadt Bonn scheint nur als Übergang hinnehmbar. Doch das ändert sich im Verlauf der Zeit.
Weil durch die Aktenrückgaben der Alliierten der Umfang der Bestände wächst, zieht das Bundesarchiv 1961 innerhalb von Koblenz in ein gemietetes Bürogebäude um. Schließlich wird 1986 in einem Neubaugebiet der Stadt ein neues und speziell eingerichtetes Dienstgebäude eingeweiht. Neben dieser Hauptstelle in Koblenz verfügt das Bundesarchiv mittlerweile über acht Nebenstellen - zum Beispiel in Berlin, Freiburg und Sankt Augustin.
Nutzung bei "berechtigtem Interesse"
Das Bundesarchiv sammelt nicht nur Material, sondern begutachtet es auch: Als 1983 das Magazin "Der Stern" behauptet, Hitlers Tagebücher gefunden zu haben, können die Experten aus Koblenz nachweisen, dass es sich bei den angeblichen Aufzeichnungen um eine Fälschung handelt. Auch bei der juristischen Aufarbeitung des Nationalsozialismus haben Archivare des Bundesarchivs mehrfach Belege vorgelegt, die zur Verurteilung von Tätern geführt haben.
Über 7.000 Professoren, Doktoranden oder Studenten haben 2011 das mit Lesesälen ausgestattete Bundesarchiv genutzt. Und nicht nur sie: Jeder, der ein weit gefasstes "berechtigtes Interesse" vorbringt, kann sich über Vergangenes informieren. Das Bundesarchiv hilft auch in ganz privaten Dingen, wenn Arbeitsbescheinigungen oder Rentennachweise fehlen. Oder wenn nach dem Namen des verschollenen Vaters gesucht werden soll."
Quelle: http://www1.wdr.de/themen/archiv/stichtag/stichtag6660.html
Doch es geht nicht nur um Amtliches: Ergänzend sollen "ferner planmäßig schriftliche Nachlässe, Ausarbeitungen, Denkschriften, Erlebnisberichte usw." von Politikern, Wirtschaftsvertretern sowie Menschen aus dem Sozial- und Kulturleben gesammelt werden - wie es im Bulletin der Bundesregierung heißt. Später werden deshalb nicht nur Gesetzestexte, Akten aus dem Bundeskanzleramt oder Oskar Schindlers Liste aufgehoben. Auch Dinge wie ein Dankesschreiben der Fußballnationalmannschaft von 1958 an Adenauer, ein Bausparkassenvertrag von Bundespräsident Theodor Heuss für sein privates Eigenheim oder die Speisekarten von internationalen Empfängen werden verwahrt. Ebenso sind bedeutende deutsche Spielfilme konservierungswürdig - weil deren Handlungen Spiegelbilder der jeweiligen gesellschaftlichen Situation darstellen.
Neubau wird 1986 eingeweiht
Seine Arbeit nimmt das Bundesarchiv am 3. Juni 1952 in Koblenz auf. Ein leer stehendes Gebäude der ehemaligen preußischen Provinzialregierung hat den Ausschlag für den Dienstort an der Mündung von Mosel und Rhein gegeben. Koblenz wird zunächst als Provisorium gesehen, die Entfernung zur Bundeshauptstadt Bonn scheint nur als Übergang hinnehmbar. Doch das ändert sich im Verlauf der Zeit.
Weil durch die Aktenrückgaben der Alliierten der Umfang der Bestände wächst, zieht das Bundesarchiv 1961 innerhalb von Koblenz in ein gemietetes Bürogebäude um. Schließlich wird 1986 in einem Neubaugebiet der Stadt ein neues und speziell eingerichtetes Dienstgebäude eingeweiht. Neben dieser Hauptstelle in Koblenz verfügt das Bundesarchiv mittlerweile über acht Nebenstellen - zum Beispiel in Berlin, Freiburg und Sankt Augustin.
Nutzung bei "berechtigtem Interesse"
Das Bundesarchiv sammelt nicht nur Material, sondern begutachtet es auch: Als 1983 das Magazin "Der Stern" behauptet, Hitlers Tagebücher gefunden zu haben, können die Experten aus Koblenz nachweisen, dass es sich bei den angeblichen Aufzeichnungen um eine Fälschung handelt. Auch bei der juristischen Aufarbeitung des Nationalsozialismus haben Archivare des Bundesarchivs mehrfach Belege vorgelegt, die zur Verurteilung von Tätern geführt haben.
Über 7.000 Professoren, Doktoranden oder Studenten haben 2011 das mit Lesesälen ausgestattete Bundesarchiv genutzt. Und nicht nur sie: Jeder, der ein weit gefasstes "berechtigtes Interesse" vorbringt, kann sich über Vergangenes informieren. Das Bundesarchiv hilft auch in ganz privaten Dingen, wenn Arbeitsbescheinigungen oder Rentennachweise fehlen. Oder wenn nach dem Namen des verschollenen Vaters gesucht werden soll."
Quelle: http://www1.wdr.de/themen/archiv/stichtag/stichtag6660.html
Wolf Thomas - am Montag, 4. Juni 2012, 08:49 - Rubrik: Archivgeschichte
Die 1482 von einem Frater Johannes Dillinger geschriebene Handschrift (heute München, SB, Cgm 359) wird in Häberlins Handschriftenkatalog der Bibliothek des Ulmer Bürgermeisters Raymund Krafft S. 95 Nr. 66 beschrieben [wie schon Krämer wusste, s. Nachtrag]. Ob die Hs. vor München in Mannheim war, wie Schneider vermutet, wäre zu prüfen.
http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0115
Katalog Schneider:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0044_b053_JPG.htm
http://www.handschriftencensus.de/8464
Siehe auch:
http://archiv.twoday.net/search?q=krafft+ulm
Nachtrag: Johannes Dillinger war wie Felix Fabri Konventuale des Ulmer Predigerklosters. Er schrieb noch mindestens drei andere erhaltene Handschriften (heute in Donauwörth, Budapest und Wettenhausen) und ist bei Krämer, Scriptores in 2 Personen gesplittet:
Nr.1 Dillinger, Johannes
Frater ordinis predicatorum conventus Ulmensis (Ulm). Schreibt für die Priorin des Dominikanerinnenklosters Mödingen bei Dillingen, Dorothea Rüchingin (Reihing) (a. 1497) und für Usula {sic!] Robolti (a. 1499).
Handschriften
Budapest, SzNB, CLMAE, 162, fol. 55v (partim) (a. 1499).
Donauwörth, B des Cassianeums, s.n. ("Liber processionalis") (a. 1497).
München, SB, Cgm 359, fol. 27r (a. 1482/88) (poss. Raym. Krafft, 1739).
(München, SB, Cgm 367 (a. 1459)). [Was die beiden von Johannes Schedel geschriebenen Hss. Cgm 367 und 409 hier zu suchen haben, ist rätselhaft.]
(München, SB, Cgm 409 (a. 1457/61)).
Literatur
cf. ZfB 48 (1931), S. 223f. [Federhofer, Die Bibliothek des Cassianeums: Bruder Johannes Dillinger widmet 1497 Dorothea Rüchingin (Reihing), Priorin von Medingen, einen Liber processionalis. Zur Priorin Reihingerin http://books.google.de/books?id=IVdEAAAAcAAJ&pg=PA7]
Bartoniek, Katal. Budapest, S. 137.
K. Schneider, Katal. München SB Cgm V/3, S. 53f. [zum Cgm 359]
Col. 2, Nr. 4642; 3, nach Nr. 9475, Vw auf Nr. 4642.
cf. Germania 9 (1864), S. 372. [http://books.google.de/books?id=QlFKAAAAcAAJ&pg=PA372 Zweifel an der Datierung des Cgm 359, daher Krämer oben: 1482/88]
Nr.2 Dillinger, Johannes
Handschriften
(0) "Felix Fabri, Evagatorium (gereimt)".
Literatur
Radò, Hss., S. 375f Nr. 56. [Libri liturgici, 1973, dürfte sich nach einem Google-Snippet nur auf die Budapester Hs. beziehen]
Verf. Lex. 2, 2. Aufl., 1980, S. 686. [zum Cgm 359!]
Zur Budapester Hs. siehe die Online-Version von Bartoniek:
Membr., saec. XV. (an. 1499, cf. ff. 30, 55’.) ff. 56, 17×12.7 cm. – Lit. init. – G. – Notae musicae quadratae quattuor linearum, clavibus c et f signatarum. – Teg. saec. XV.–XVI.
Antiphonae. (notis musicis instructae.)
f. 1. „Dominica In ramis palmarum.” – f. 9. „In cena domini.” – f. 27. „In paraschaue.” (!) – f. 29. „In die s. pasche.” – f. 31. „In ascensione domini.” – f. 34. „In festo corporis christi.” – f. 37. „In dedicacione Eclesie.” – f. 40. „In purificacione b. marie. u.” – f. 43. „In assumpcione b. marie.” – f. 47. „In solempni recepcione conuentus.” – f. 48. „In recepcione legatorum vel prelatorum.” – f. 49’. „In recepcione secularium principum.” – f. 50. „In primo ingressu sororum.” – f. 51. „Per totam ebdomadam penthecostes.” – f. 52… „In cena domini.” – f. 54. „In paraschause.” (!) – f. 55. „Sabatho sancto. pasche.”
NB. f. 30. Adnotationes germanica lingua conscriptae, inter notas musicas: „orgell”, „cor”. – f. 30.: „1449” – f. 55’. „Geschriben Im 1499. Jar. G. v. K.” – f. 55’. „anno domini M-o CCCC-o nonagesimo nono Ego frater iohannes dillinger ordinis predicatorum conuentus vlmensis. Compleui hunc libellulum” (!) „In uigilia sancti Dominici patris nostri. Laus deo.” – Manus alia saec. XV. „Vrsula Robolti.”
f. 56–56’. vacuum.
Prov.: Germania. (Ulm.) – Poss.: cf. f. 55’: „Vrsula Robolti.” cf. adnotationem in interiore parte tegumenti anterioris: „Johannes scripsit Vrsula possidet, 1499.” – „Das buch gehert gen medingen” (Borussia) „in das Claster.” (Man. saec. XV.) – Nic. de Jankovich, 1830.
http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/?f=templates&fn=main-h.htm&2.0 (Medingen ist natürlich Medingen bei Dillingen, nicht das Heidekloster!)
Das Prozessionale des Cassianeums ist nicht identisch mit dem von ihm im gleichen Jahr 1497 geschriebenen Prozessionale, das sich in der Bibliothek des Dominikanerklosters Wettenhausen befindet und das von Karlheinz Schlager/Theodor Wohnhaas, "Item 1 Processional ...", in: Jb. des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte e. V. 34 (2000), S. 195-211 besprochen wurde. Isnard W. Frank, Reform und Reformation bei den Ulmer Franziskanern, in: Rottenburger Jb. für Kirchengeschichte 12 (2002), S. 261-289, hier S. 272 Anm. 35 sagt in Unkenntnis der von Krämer zusammengetragenen Handschriften, über ihn sei nichts weiter bekannt. Zur Produktion religiöser Texte im Ulmer Konvent (Frank ebd.) und ihrer Rezeption am Ende des 15. Jahrhunderts siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/97045606/ (Bonaventura-Übersetzung des Johannes Kornwachs, Handschrift des Fraters "Codal")
#forschung

Schreibervermerk Wettenhausen (Schlager/Wohnhaas, nach S. 200 Abb. 36)
http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0115
Katalog Schneider:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0044_b053_JPG.htm
http://www.handschriftencensus.de/8464
Siehe auch:
http://archiv.twoday.net/search?q=krafft+ulm
Nachtrag: Johannes Dillinger war wie Felix Fabri Konventuale des Ulmer Predigerklosters. Er schrieb noch mindestens drei andere erhaltene Handschriften (heute in Donauwörth, Budapest und Wettenhausen) und ist bei Krämer, Scriptores in 2 Personen gesplittet:
Nr.1 Dillinger, Johannes
Frater ordinis predicatorum conventus Ulmensis (Ulm). Schreibt für die Priorin des Dominikanerinnenklosters Mödingen bei Dillingen, Dorothea Rüchingin (Reihing) (a. 1497) und für Usula {sic!] Robolti (a. 1499).
Handschriften
Budapest, SzNB, CLMAE, 162, fol. 55v (partim) (a. 1499).
Donauwörth, B des Cassianeums, s.n. ("Liber processionalis") (a. 1497).
München, SB, Cgm 359, fol. 27r (a. 1482/88) (poss. Raym. Krafft, 1739).
(München, SB, Cgm 367 (a. 1459)). [Was die beiden von Johannes Schedel geschriebenen Hss. Cgm 367 und 409 hier zu suchen haben, ist rätselhaft.]
(München, SB, Cgm 409 (a. 1457/61)).
Literatur
cf. ZfB 48 (1931), S. 223f. [Federhofer, Die Bibliothek des Cassianeums: Bruder Johannes Dillinger widmet 1497 Dorothea Rüchingin (Reihing), Priorin von Medingen, einen Liber processionalis. Zur Priorin Reihingerin http://books.google.de/books?id=IVdEAAAAcAAJ&pg=PA7]
Bartoniek, Katal. Budapest, S. 137.
K. Schneider, Katal. München SB Cgm V/3, S. 53f. [zum Cgm 359]
Col. 2, Nr. 4642; 3, nach Nr. 9475, Vw auf Nr. 4642.
cf. Germania 9 (1864), S. 372. [http://books.google.de/books?id=QlFKAAAAcAAJ&pg=PA372 Zweifel an der Datierung des Cgm 359, daher Krämer oben: 1482/88]
Nr.2 Dillinger, Johannes
Handschriften
(0) "Felix Fabri, Evagatorium (gereimt)".
Literatur
Radò, Hss., S. 375f Nr. 56. [Libri liturgici, 1973, dürfte sich nach einem Google-Snippet nur auf die Budapester Hs. beziehen]
Verf. Lex. 2, 2. Aufl., 1980, S. 686. [zum Cgm 359!]
Zur Budapester Hs. siehe die Online-Version von Bartoniek:
Membr., saec. XV. (an. 1499, cf. ff. 30, 55’.) ff. 56, 17×12.7 cm. – Lit. init. – G. – Notae musicae quadratae quattuor linearum, clavibus c et f signatarum. – Teg. saec. XV.–XVI.
Antiphonae. (notis musicis instructae.)
f. 1. „Dominica In ramis palmarum.” – f. 9. „In cena domini.” – f. 27. „In paraschaue.” (!) – f. 29. „In die s. pasche.” – f. 31. „In ascensione domini.” – f. 34. „In festo corporis christi.” – f. 37. „In dedicacione Eclesie.” – f. 40. „In purificacione b. marie. u.” – f. 43. „In assumpcione b. marie.” – f. 47. „In solempni recepcione conuentus.” – f. 48. „In recepcione legatorum vel prelatorum.” – f. 49’. „In recepcione secularium principum.” – f. 50. „In primo ingressu sororum.” – f. 51. „Per totam ebdomadam penthecostes.” – f. 52… „In cena domini.” – f. 54. „In paraschause.” (!) – f. 55. „Sabatho sancto. pasche.”
NB. f. 30. Adnotationes germanica lingua conscriptae, inter notas musicas: „orgell”, „cor”. – f. 30.: „1449” – f. 55’. „Geschriben Im 1499. Jar. G. v. K.” – f. 55’. „anno domini M-o CCCC-o nonagesimo nono Ego frater iohannes dillinger ordinis predicatorum conuentus vlmensis. Compleui hunc libellulum” (!) „In uigilia sancti Dominici patris nostri. Laus deo.” – Manus alia saec. XV. „Vrsula Robolti.”
f. 56–56’. vacuum.
Prov.: Germania. (Ulm.) – Poss.: cf. f. 55’: „Vrsula Robolti.” cf. adnotationem in interiore parte tegumenti anterioris: „Johannes scripsit Vrsula possidet, 1499.” – „Das buch gehert gen medingen” (Borussia) „in das Claster.” (Man. saec. XV.) – Nic. de Jankovich, 1830.
http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/?f=templates&fn=main-h.htm&2.0 (Medingen ist natürlich Medingen bei Dillingen, nicht das Heidekloster!)
Das Prozessionale des Cassianeums ist nicht identisch mit dem von ihm im gleichen Jahr 1497 geschriebenen Prozessionale, das sich in der Bibliothek des Dominikanerklosters Wettenhausen befindet und das von Karlheinz Schlager/Theodor Wohnhaas, "Item 1 Processional ...", in: Jb. des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte e. V. 34 (2000), S. 195-211 besprochen wurde. Isnard W. Frank, Reform und Reformation bei den Ulmer Franziskanern, in: Rottenburger Jb. für Kirchengeschichte 12 (2002), S. 261-289, hier S. 272 Anm. 35 sagt in Unkenntnis der von Krämer zusammengetragenen Handschriften, über ihn sei nichts weiter bekannt. Zur Produktion religiöser Texte im Ulmer Konvent (Frank ebd.) und ihrer Rezeption am Ende des 15. Jahrhunderts siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/97045606/ (Bonaventura-Übersetzung des Johannes Kornwachs, Handschrift des Fraters "Codal")
#forschung

Schreibervermerk Wettenhausen (Schlager/Wohnhaas, nach S. 200 Abb. 36)
KlausGraf - am Montag, 4. Juni 2012, 00:24 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Während Schelhorn unbrauchbar ist (auch weil er die wohl aus dem 12./13. Jahrhundert stammende Handschrift fehlerhaft ans Ende des 15. Jahrhunderts setzt)
http://books.google.de/books?id=UrkTAAAAQAAJ&hl=de&pg=PA110
gibt Häberlin 1737 Besseres (einschließlich 26 abgedruckten Versen):
http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0045
Als Ausgabe von Priester Wernhers Marienleben benutzte ich
http://books.google.de/books?id=_FoGAQAAIAAJ
Nach den Provenienzangaben kann die Krafft'sche Handschrift, die - wenn ich mich nicht täusche - bislang unbemerkt blieb, mit den zwei einzigen bekannten vollständigen Handschriften in Krakau (ehemals Berlin mgo 109, illuminiert) und Wien Cod. 2742* (nicht illuminiert) nicht identisch sein. Ein flüchtiger Blick in die Lesarten zeigt, dass die Krafftsche Handschrift der Berliner nahestand, aber die Provenienzenfolge der Berliner Handschrift verhindert eine Gleichsetzung.
Eine sorgfältigere Untersuchung der Häberlin'schen Angaben zu dem verlorenen Textzeugen wäre wünschenswert.
Bilder aus der ehemals Berliner Hs.:
http://bn.org.pl/download/document/1245746242.pdf S. 84
http://www.archive.org/stream/despriesterswern00wernuoft#page/n5/mode/2up
Zur Provenienz Krafft siehe die Hinweise bei Seelbach:
http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2007/4872/pdf/045.pdf
http://www.onlinekatalog-stadtarchiv.ulm.de/EKrafftakten.pdf
Bernd Breitenbruch in: Schwabenspiegel [...] 1000-1800, S. 397 ("364 Codices") unter Hinweis auf Breitenbruch, Ulmer Privatbibliotheken, 1991, S. 20-27
http://archiv.twoday.net/search?q=krafft+ulm
Zur Person
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=122371054
Nachtrag: Kurt Gärtner mailte mir freundlicherweise:
"Es handelt sich ganz sicher um die Berliner
Hs., jetzt Krakau, Bibl. Jagiello´nska, Berol. mgo 109 (s. den
Marburger Handschriftencensus). Die Hs. stammt wohl aus dem Besitz
von Raimund Krafft (+1729), beim Verkauf seiner Hss. (1739) ist sie
wohl an Heinrich Christian von Senckenberg (1704-1768) gegangen.
Die von Häberlin zitierten Verse auf der "pag. ultima" stimmen genau
mit den Versen auf dem letzten Bl. des Berol. mgo 91v, den ich
verglichen habe, überein, s. auch den Abdruck der Hs. in der Ausgabe
von Carl Wesle (Hg.), Priester Wernher, Maria. Bruchstücke und
Umarbeitungen. Zweite Auflage besorgt durch Hans Fromm (Altdeutsche
Textbibliothek 26), Tübingen 1969.
Wie im Abdruck der Verse von Häberlin bricht auch die Berliner Hs.
mitten im Vers ab.
Jetzt wissen wir etwas mehr über die Provenienz, aber um eine neue Handschrift handelt es sich ganz sicher nicht."
Dann ist aber gängige Ansicht zur Provenienz der Berliner Handschrift nicht zutreffend:
"Nach diesen Aufzeichnungen war der Codex im 17. Jahrhundert Bestandteil der
Handschriftensammlung des Straßburger Juristen Johannes Schilter (1632-1705).
Diese Sammlung wurde von dem Juristen Reichshofrat Heinrich Christian von
Senkenberg (1704-1768) erworben, der in Verbindung mit dem Pfarrer und
Historiker Samuel Wilhelm Oetter (1720-1792) stand. Nach dem Tode Senkenbergs
gelangte die Handschrift in den Besitz Oetters, von dem sie dessen Sohn Friedrich
Wilhelm (1754-1824) übernahm. Im Anschluß daran tauchte der Codex in der
Bibliothek des Geheimen Staatsrats und Generalpostmeisters Karl Ferdinand
Friedrich von Nagler (1770-1846) auf, die im Jahre 1835 von der Preußischen
Staatsbibliothek in Berlin übernommen wurde"
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/CIMA/CIMA%2062.pdf
Wenn man an Schilter als Vorbesitzer festhält (wieso?), muss man Krafft vor Senckenberg einschieben.
Nachtrag 23. November 2014: Henkel, Nikolaus: Lesen in Bild und Text. Die ehem. Berliner Bilderhandschrift von Priester Wernhers ‚Maria‘ (2014), S. 24f.
"Auf ein bislang unbekanntes, aber bemerkenswertes Zeugnis zu einer Bilderhandschrift einer deutschsprachigen gereimten Mariendichtung hat kürzlich Klaus Graf aufmerksam gemacht.40"
Statt diesen Beitrag zu zitieren, der schon wenige Tage später obigen Nachtrag enthielt, verweist Henkel lediglich auf das Digitalisat des Krafft-Katalogs.
40 Verfügbar unter: http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/
?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0005 (29. 6. 2013).
Das Zeugnis sei entgegen meiner Annahme identisch mit der Berliner Handschrift D. Das hatte ich nach Empfang der Mail von Herrn Gärtner aber auch gar nicht mehr bestritten. Immerhin liest man: "Grafs Entdeckung macht es aber notwendig,
die Provenienzgeschichte von Handschrift D neu zu schreiben."
#forschung
http://books.google.de/books?id=UrkTAAAAQAAJ&hl=de&pg=PA110
gibt Häberlin 1737 Besseres (einschließlich 26 abgedruckten Versen):
http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0045
Als Ausgabe von Priester Wernhers Marienleben benutzte ich
http://books.google.de/books?id=_FoGAQAAIAAJ
Nach den Provenienzangaben kann die Krafft'sche Handschrift, die - wenn ich mich nicht täusche - bislang unbemerkt blieb, mit den zwei einzigen bekannten vollständigen Handschriften in Krakau (ehemals Berlin mgo 109, illuminiert) und Wien Cod. 2742* (nicht illuminiert) nicht identisch sein. Ein flüchtiger Blick in die Lesarten zeigt, dass die Krafftsche Handschrift der Berliner nahestand, aber die Provenienzenfolge der Berliner Handschrift verhindert eine Gleichsetzung.
Eine sorgfältigere Untersuchung der Häberlin'schen Angaben zu dem verlorenen Textzeugen wäre wünschenswert.
Bilder aus der ehemals Berliner Hs.:
http://bn.org.pl/download/document/1245746242.pdf S. 84
http://www.archive.org/stream/despriesterswern00wernuoft#page/n5/mode/2up
Zur Provenienz Krafft siehe die Hinweise bei Seelbach:
http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2007/4872/pdf/045.pdf
http://www.onlinekatalog-stadtarchiv.ulm.de/EKrafftakten.pdf
Bernd Breitenbruch in: Schwabenspiegel [...] 1000-1800, S. 397 ("364 Codices") unter Hinweis auf Breitenbruch, Ulmer Privatbibliotheken, 1991, S. 20-27
http://archiv.twoday.net/search?q=krafft+ulm
Zur Person
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=122371054
Nachtrag: Kurt Gärtner mailte mir freundlicherweise:
"Es handelt sich ganz sicher um die Berliner
Hs., jetzt Krakau, Bibl. Jagiello´nska, Berol. mgo 109 (s. den
Marburger Handschriftencensus). Die Hs. stammt wohl aus dem Besitz
von Raimund Krafft (+1729), beim Verkauf seiner Hss. (1739) ist sie
wohl an Heinrich Christian von Senckenberg (1704-1768) gegangen.
Die von Häberlin zitierten Verse auf der "pag. ultima" stimmen genau
mit den Versen auf dem letzten Bl. des Berol. mgo 91v, den ich
verglichen habe, überein, s. auch den Abdruck der Hs. in der Ausgabe
von Carl Wesle (Hg.), Priester Wernher, Maria. Bruchstücke und
Umarbeitungen. Zweite Auflage besorgt durch Hans Fromm (Altdeutsche
Textbibliothek 26), Tübingen 1969.
Wie im Abdruck der Verse von Häberlin bricht auch die Berliner Hs.
mitten im Vers ab.
Jetzt wissen wir etwas mehr über die Provenienz, aber um eine neue Handschrift handelt es sich ganz sicher nicht."
Dann ist aber gängige Ansicht zur Provenienz der Berliner Handschrift nicht zutreffend:
"Nach diesen Aufzeichnungen war der Codex im 17. Jahrhundert Bestandteil der
Handschriftensammlung des Straßburger Juristen Johannes Schilter (1632-1705).
Diese Sammlung wurde von dem Juristen Reichshofrat Heinrich Christian von
Senkenberg (1704-1768) erworben, der in Verbindung mit dem Pfarrer und
Historiker Samuel Wilhelm Oetter (1720-1792) stand. Nach dem Tode Senkenbergs
gelangte die Handschrift in den Besitz Oetters, von dem sie dessen Sohn Friedrich
Wilhelm (1754-1824) übernahm. Im Anschluß daran tauchte der Codex in der
Bibliothek des Geheimen Staatsrats und Generalpostmeisters Karl Ferdinand
Friedrich von Nagler (1770-1846) auf, die im Jahre 1835 von der Preußischen
Staatsbibliothek in Berlin übernommen wurde"
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/CIMA/CIMA%2062.pdf
Wenn man an Schilter als Vorbesitzer festhält (wieso?), muss man Krafft vor Senckenberg einschieben.
Nachtrag 23. November 2014: Henkel, Nikolaus: Lesen in Bild und Text. Die ehem. Berliner Bilderhandschrift von Priester Wernhers ‚Maria‘ (2014), S. 24f.
"Auf ein bislang unbekanntes, aber bemerkenswertes Zeugnis zu einer Bilderhandschrift einer deutschsprachigen gereimten Mariendichtung hat kürzlich Klaus Graf aufmerksam gemacht.40"
Statt diesen Beitrag zu zitieren, der schon wenige Tage später obigen Nachtrag enthielt, verweist Henkel lediglich auf das Digitalisat des Krafft-Katalogs.
40 Verfügbar unter: http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/
?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0005 (29. 6. 2013).
Das Zeugnis sei entgegen meiner Annahme identisch mit der Berliner Handschrift D. Das hatte ich nach Empfang der Mail von Herrn Gärtner aber auch gar nicht mehr bestritten. Immerhin liest man: "Grafs Entdeckung macht es aber notwendig,
die Provenienzgeschichte von Handschrift D neu zu schreiben."
#forschung
KlausGraf - am Sonntag, 3. Juni 2012, 22:42 - Rubrik: Kodikologie
Notizen über Bücherdiebstähle (einschließlich der Girolamini-Bibliothek):
http://www.rbms.info/committees/security/theft_reports/theft_reports_2012.shtml
Ohne RSS-Feed.
http://www.rbms.info/committees/security/theft_reports/theft_reports_2012.shtml
Ohne RSS-Feed.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://archaeologik.blogspot.de/2012/06/feuer-auf-apameia.html
Rainer Schreg weist auf einen umfangreichen Report hin:
http://globalheritagenetwork.ning.com/profiles/blogs/new-report-on-damage-to-syria-s-cultural-heritage
Rainer Schreg weist auf einen umfangreichen Report hin:
http://globalheritagenetwork.ning.com/profiles/blogs/new-report-on-damage-to-syria-s-cultural-heritage
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Klaus Schreiners maßgeblicher Aufsatz "Möchtum im Geist der Benediktregel" von 1986 ist online:
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/b/b016737.pdf
Nachtrag: Ebenso wie eine ganze Reihe anderer Aufsätze Schreiners (s. OPAC der MGH-Bibliothek), darunter der bisher nur über DigiZeitschriften (lizenzpflichtig) zugängliche Aufsatz über Hildegardis Regina und Kloster Kempten:
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a149295.pdf
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/b/b016737.pdf
Nachtrag: Ebenso wie eine ganze Reihe anderer Aufsätze Schreiners (s. OPAC der MGH-Bibliothek), darunter der bisher nur über DigiZeitschriften (lizenzpflichtig) zugängliche Aufsatz über Hildegardis Regina und Kloster Kempten:
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a149295.pdf
KlausGraf - am Sonntag, 3. Juni 2012, 01:42 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Raymund Krafft in Ulm besaß nach Häberlins Katalog von 1739 (S. 110f. Nr. 8) auch eine deutsche Übersetzung der seit dem 15. Jahrhundert Albertus Magnus zugeschriebenen Schrift "De adhaerendo deo", die nunmehr als gesichertes Werk des Benediktiners Johannes von Kastl gilt und nach Sudbrack "De fine religiosae perfectionis" heißen soll.
http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00005BF300000000
Die nicht vor 1493 entstandene Handschrift enthielt an erster Stelle einen deutschen Bonaventura-Text, eine Anleitung für einen Franziskanerbruder zum geistlichen Leben. Ohne die Arbeiten von Ruh (²VL hilft nicht weiter) kann nur vage an die Regula novitiorum gedacht werden und selbst mit ihnen wäre eine eindeutige Identifizierung in Ermangelung eines Incipit womöglich unmöglich.
Der zweite Text war offenbar Thomas Fincks Übersetzung von Jakob von Paradies: De praeparatione ad sacramentum eucharistiae, die aus zwei Augsburger Handschriften bekannt ist:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4798/pdf/graf_thomas_finck.pdf
Fasbender hat (Studien und Mitteilungen OSB 1999, S. 161-166) die Übersetzung für Finck gesichert.
Zum Vergleich der Textanfang der Handschrift aus Kirchheim:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0148_a444_JPG.htm
http://www.handschriftencensus.de/6147
Den Schluss der Handschrift bildete der Pseudo-Albertus Magnus mit abschließendem Schreibervermerk "per fratrem Codal, Conventus Vlmensis Praedicatorem 1491". Weyermann registrierte den Schreiber
http://books.google.de/books?id=SvJQAAAAcAAJ&pg=PA56
ebenso wie Krämer (Scriptores, ohne weitere Angaben).
Der eigenartige Name lässt an eine Fehllesung oder an eine Namensabkürzung - Co(nrad?) Dal- - denken, man müsste aber die Literatur zum Ulmer Dominikanerkloster sichten.
Zur Überlieferung der deutschen Übersetzungen von "De adhaerendo Deo" lassen einen sowohl das Verfasserlexikon als auch der Handschriftencensus im Stich. Es existiert(e?) eine unter Ruh angefertigte Zulassungsarbeit von Dieter Picker: Der Traktat „De fine religiosae perfectionis" („De adhaerendo Deo"). Verfasser, Überlieferung, Text. (Masch.) Würzburg 1965, und Picker wollte wohl auch eine Dissertation zu den Übersetzungen vorlegen:
https://www.google.de/search?f&tbm=bks&q=%22dieter+picker%22
[Zur Zulassungsarbeit teilte Dorothea Klein mit: "leider ist die Arbeit im Institut, wenn es sie dort jemals gegeben haben sollte, nicht auffindbar."]
Welche beiden Handschriften Grabmann, Geistesleben I, 501 nannte, weiß ich nicht (auch die Erstauflage des VL II, 488 habe ich nicht greifbar). Im folgenden stelle ich zusammen, worauf ich (im Internet) stieß.
[Grabmann nennt Cgm 806, 5140 und Don. 356; diese 3 auch im Artikel zu Joh. von Kastl im VL 1. Aufl. II, 603; der Artikel Ulrich Horn VL 1. Aufl. II, 488 nennt neben der GNM-Hs. auch Don. 356 und den Hochfederdruck.]
Vermutlich steht die Krafftsche Übersetzung der in der ehemals Donaueschinger Handschrift der BLB Karlsruhe Cod. Donaueschingen 356, Bl. 51r-104r überlieferten nahe. Die Donaueschinger Handschrift enthält auch eine Bonaventura-Übersetzung des Ulmer Dominikaners Johannes Kornwachs 1493 (siehe Ruh im ²VL).
http://wiesel.wlb-stuttgart.de/referate/hschriften/barack/barack3.php3?browse=1&nummer=356
http://www.handschriftencensus.de/10585
Nach Ruh überliefert UB Augsburg III.2 oct. 35, Bl. 2r-43v aus Medingen (keine gedruckte Beschreibung [doch! Schromm, wie unten, S. 252], nicht im Hsc) die gleiche Übersetzung wie die Donaueschinger Handschrift, während er Thomas Fincks Übersetzung im Cgm 6940 als davon verschieden ansah (Bonaventura dt. 1956, S. 102):
http://books.google.de/books?id=EPtWAAAAIAAJ&q=%22verst%C3%A4nntnu%C3%9F+vnnd+begird++**%22
Zum Cgm 6940
http://www.handschriftencensus.de/5858
http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/700405460008.html
Karl Heinz Keller fand in Eichstätt, UB, st 760, Bl. 250v-259v (von 1507) eine zweite Überlieferung der Übersetzung Fincks:
http://www.handschriftencensus.de/19357
http://archiv.twoday.net/stories/14660552/
Der zweite namentliche Übersetzer des Textes ist Ulrich Horn. Seine Übersetzung ist nur in GNM Nürnberg Hs. 18526, Bl. 2r-52v überliefert:
http://www.handschriftencensus.de/21112
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0058_b076_JPG.htm
Ruhs Hinweis im ²VL 4, 141 (s.v. Horn, Ulrich) auf Cod. 482 der Langer'schen Bibliothek in Braunau geht wohl in die Irre. Möglicherweise handelt es sich bei der 1480/1510 datierten Handschrift (heute Prag, Nationalmuseum, Cod. XVII D 33, Bl. 259rb-275ra) um eine Druckabschrift, da der Text mit dem Nürnberger Hochfeder-Druck (1492) einer deutschen Übersetzung GW 584 übereinstimmt:
http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/ALBEMAG.htm#DeAdhaerendoDeo
Zur Prager Hs.:
http://www.handschriftencensus.de/5558
http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/700289480011.html (ausführliche Angaben zu Textbeginn und Textschluss)
Schließlich sind noch zwei Münchner Handschriften zu nennen, die jeweils verschiedene Übersetzungen tradieren:
Cgm 806, Bl. 68r-74v unvollständig
http://www.handschriftencensus.de/10240
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0046_a386_JPG.htm
Digitalisat:
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00035391/image_137
Cgm 5140, Bl. 234r-266r
http://www.handschriftencensus.de/10187
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0492_a488_JPG.htm
[Arnold Schromm, Die Bibliothek des ehemaligen Zisterzienserinnenkloster Kirchheim am Ries, 1998, S. 253 bietet zu der aus Kirchheim stammenden Hs. Cod. III.2.oct.36 (16. Jh.), Bl. 2r-69v ein Incipit, das darauf schließen lässt, dass hier die gleiche Übersetzung vorliegt wie in Cgm 5140: "Hie hebt sich an das puchlein dez grossen albertus vnd sagt von der ploßerung ganzen abgeschiedenheit aller zeitlicher dinger vnd vereynung mit got dem herrn. Ich gedenck mir entlich etwas zu schreiben als vil es muglichen ist in der Einwonung diß ellends vnd pilgramschaft von der ganczen abscheidung aller dinger".]
#forschung
http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00005BF300000000
Die nicht vor 1493 entstandene Handschrift enthielt an erster Stelle einen deutschen Bonaventura-Text, eine Anleitung für einen Franziskanerbruder zum geistlichen Leben. Ohne die Arbeiten von Ruh (²VL hilft nicht weiter) kann nur vage an die Regula novitiorum gedacht werden und selbst mit ihnen wäre eine eindeutige Identifizierung in Ermangelung eines Incipit womöglich unmöglich.
Der zweite Text war offenbar Thomas Fincks Übersetzung von Jakob von Paradies: De praeparatione ad sacramentum eucharistiae, die aus zwei Augsburger Handschriften bekannt ist:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4798/pdf/graf_thomas_finck.pdf
Fasbender hat (Studien und Mitteilungen OSB 1999, S. 161-166) die Übersetzung für Finck gesichert.
Zum Vergleich der Textanfang der Handschrift aus Kirchheim:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0148_a444_JPG.htm
http://www.handschriftencensus.de/6147
Den Schluss der Handschrift bildete der Pseudo-Albertus Magnus mit abschließendem Schreibervermerk "per fratrem Codal, Conventus Vlmensis Praedicatorem 1491". Weyermann registrierte den Schreiber
http://books.google.de/books?id=SvJQAAAAcAAJ&pg=PA56
ebenso wie Krämer (Scriptores, ohne weitere Angaben).
Der eigenartige Name lässt an eine Fehllesung oder an eine Namensabkürzung - Co(nrad?) Dal- - denken, man müsste aber die Literatur zum Ulmer Dominikanerkloster sichten.
Zur Überlieferung der deutschen Übersetzungen von "De adhaerendo Deo" lassen einen sowohl das Verfasserlexikon als auch der Handschriftencensus im Stich. Es existiert(e?) eine unter Ruh angefertigte Zulassungsarbeit von Dieter Picker: Der Traktat „De fine religiosae perfectionis" („De adhaerendo Deo"). Verfasser, Überlieferung, Text. (Masch.) Würzburg 1965, und Picker wollte wohl auch eine Dissertation zu den Übersetzungen vorlegen:
https://www.google.de/search?f&tbm=bks&q=%22dieter+picker%22
[Zur Zulassungsarbeit teilte Dorothea Klein mit: "leider ist die Arbeit im Institut, wenn es sie dort jemals gegeben haben sollte, nicht auffindbar."]
Welche beiden Handschriften Grabmann, Geistesleben I, 501 nannte, weiß ich nicht (auch die Erstauflage des VL II, 488 habe ich nicht greifbar). Im folgenden stelle ich zusammen, worauf ich (im Internet) stieß.
[Grabmann nennt Cgm 806, 5140 und Don. 356; diese 3 auch im Artikel zu Joh. von Kastl im VL 1. Aufl. II, 603; der Artikel Ulrich Horn VL 1. Aufl. II, 488 nennt neben der GNM-Hs. auch Don. 356 und den Hochfederdruck.]
Vermutlich steht die Krafftsche Übersetzung der in der ehemals Donaueschinger Handschrift der BLB Karlsruhe Cod. Donaueschingen 356, Bl. 51r-104r überlieferten nahe. Die Donaueschinger Handschrift enthält auch eine Bonaventura-Übersetzung des Ulmer Dominikaners Johannes Kornwachs 1493 (siehe Ruh im ²VL).
http://wiesel.wlb-stuttgart.de/referate/hschriften/barack/barack3.php3?browse=1&nummer=356
http://www.handschriftencensus.de/10585
Nach Ruh überliefert UB Augsburg III.2 oct. 35, Bl. 2r-43v aus Medingen (keine gedruckte Beschreibung [doch! Schromm, wie unten, S. 252], nicht im Hsc) die gleiche Übersetzung wie die Donaueschinger Handschrift, während er Thomas Fincks Übersetzung im Cgm 6940 als davon verschieden ansah (Bonaventura dt. 1956, S. 102):
http://books.google.de/books?id=EPtWAAAAIAAJ&q=%22verst%C3%A4nntnu%C3%9F+vnnd+begird++**%22
Zum Cgm 6940
http://www.handschriftencensus.de/5858
http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/700405460008.html
Karl Heinz Keller fand in Eichstätt, UB, st 760, Bl. 250v-259v (von 1507) eine zweite Überlieferung der Übersetzung Fincks:
http://www.handschriftencensus.de/19357
http://archiv.twoday.net/stories/14660552/
Der zweite namentliche Übersetzer des Textes ist Ulrich Horn. Seine Übersetzung ist nur in GNM Nürnberg Hs. 18526, Bl. 2r-52v überliefert:
http://www.handschriftencensus.de/21112
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0058_b076_JPG.htm
Ruhs Hinweis im ²VL 4, 141 (s.v. Horn, Ulrich) auf Cod. 482 der Langer'schen Bibliothek in Braunau geht wohl in die Irre. Möglicherweise handelt es sich bei der 1480/1510 datierten Handschrift (heute Prag, Nationalmuseum, Cod. XVII D 33, Bl. 259rb-275ra) um eine Druckabschrift, da der Text mit dem Nürnberger Hochfeder-Druck (1492) einer deutschen Übersetzung GW 584 übereinstimmt:
http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/ALBEMAG.htm#DeAdhaerendoDeo
Zur Prager Hs.:
http://www.handschriftencensus.de/5558
http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/700289480011.html (ausführliche Angaben zu Textbeginn und Textschluss)
Schließlich sind noch zwei Münchner Handschriften zu nennen, die jeweils verschiedene Übersetzungen tradieren:
Cgm 806, Bl. 68r-74v unvollständig
http://www.handschriftencensus.de/10240
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0046_a386_JPG.htm
Digitalisat:
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00035391/image_137
Cgm 5140, Bl. 234r-266r
http://www.handschriftencensus.de/10187
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0492_a488_JPG.htm
[Arnold Schromm, Die Bibliothek des ehemaligen Zisterzienserinnenkloster Kirchheim am Ries, 1998, S. 253 bietet zu der aus Kirchheim stammenden Hs. Cod. III.2.oct.36 (16. Jh.), Bl. 2r-69v ein Incipit, das darauf schließen lässt, dass hier die gleiche Übersetzung vorliegt wie in Cgm 5140: "Hie hebt sich an das puchlein dez grossen albertus vnd sagt von der ploßerung ganzen abgeschiedenheit aller zeitlicher dinger vnd vereynung mit got dem herrn. Ich gedenck mir entlich etwas zu schreiben als vil es muglichen ist in der Einwonung diß ellends vnd pilgramschaft von der ganczen abscheidung aller dinger".]
#forschung
KlausGraf - am Sonntag, 3. Juni 2012, 00:44 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen