http://www.forschung-und-lehre.de/wordpress/?p=11341
Interview mit Deborah Weber-Wulff.
F&L: Welche konkreten präventiven Maßnahmen sind im Kampf gegen das Plagiieren nach ihrer Beobachtung erfolgversprechend?
Debora Weber-Wulff: Sorgfältiges Lesen und Schreiben! Die eingereichten Arbeiten müssen gründlich gelesen werden – und die Studierenden müssen wissenschaftlich recherchieren und schreiben lernen. Die Universitäten sollten sich nicht darauf verlassen, dass dieses schon in der Schule vermittelt wurde, sondern vielmehr selbst Kurse für wissenschaftliches Schreiben anbieten. Es muss auch offen über Plagiat gesprochen werden – was ein Plagiat ist, wie man es vermeidet und warum es nicht zu tolerieren ist. Die Professorenschaft muss natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen. Sie dürfen nicht die Texte ihrer Studierenden als eigene Texte ausgeben oder Foliensätze aus dem Netz auf den eigenen Namen umbiegen. Wir brauchen eine Kultur des Zitierens, nicht weitere Regeln und Vorschriften.
Interview mit Deborah Weber-Wulff.
F&L: Welche konkreten präventiven Maßnahmen sind im Kampf gegen das Plagiieren nach ihrer Beobachtung erfolgversprechend?
Debora Weber-Wulff: Sorgfältiges Lesen und Schreiben! Die eingereichten Arbeiten müssen gründlich gelesen werden – und die Studierenden müssen wissenschaftlich recherchieren und schreiben lernen. Die Universitäten sollten sich nicht darauf verlassen, dass dieses schon in der Schule vermittelt wurde, sondern vielmehr selbst Kurse für wissenschaftliches Schreiben anbieten. Es muss auch offen über Plagiat gesprochen werden – was ein Plagiat ist, wie man es vermeidet und warum es nicht zu tolerieren ist. Die Professorenschaft muss natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen. Sie dürfen nicht die Texte ihrer Studierenden als eigene Texte ausgeben oder Foliensätze aus dem Netz auf den eigenen Namen umbiegen. Wir brauchen eine Kultur des Zitierens, nicht weitere Regeln und Vorschriften.
KlausGraf - am Dienstag, 7. August 2012, 18:01 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
[Kiel], 1800-1839
Bibliogr. Nachweis: Ratjen Cod. ms. SH 179 AAA 2 (UB Kiel)
Die Eintragungen reichen von 1800 bis 1839. Die älteren Karzerbücher seit etwa 1770 (eine Gesamtübersicht befindet sich in Bd. 2) scheinen verloren zu sein.
Online:
http://dibiki.ub.uni-kiel.de/viewer/resolver?urn=urn%3Anbn%3Ade%3Agbv%3A8%3A2-979965
Bibliogr. Nachweis: Ratjen Cod. ms. SH 179 AAA 2 (UB Kiel)
Die Eintragungen reichen von 1800 bis 1839. Die älteren Karzerbücher seit etwa 1770 (eine Gesamtübersicht befindet sich in Bd. 2) scheinen verloren zu sein.
Online:
http://dibiki.ub.uni-kiel.de/viewer/resolver?urn=urn%3Anbn%3Ade%3Agbv%3A8%3A2-979965
KlausGraf - am Dienstag, 7. August 2012, 17:55 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen


Links: Es war wohl ein britischer Halifax-Bomber, der im Januar 1945 bei Halle abgeschossen wurde und abstürzte. Das Wrack geriet in Vergessenheit, bis jetzt neue diese neuen Wrackteile in der Nähe der Absturzstelle entdeckt wurden.
Foto: LWL
Rechts: Auch ein Teil der Steuerinstrumente aus dem Cockpit des Wracks gehört zu den Funden, die oberflächlich gemacht werden konnten.
Foto: LWL
"Die Geschütze der deutschen Luftabwehr trafen ihn tödlich. Der britische Bomber stürzte vom Himmel und schlug unweit der Vorberge des Teutoburger Waldes in den Boden ein. Fast 70 Jahre lang schien diese Szene bei Halle im Kreis Gütersloh vergessen. Jetzt sind Zeugnisse eines der letzten unentdeckten Abstürze des Zweiten Weltkriegs in dieser Region wieder zum Vorschein gekommen. Archäologen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) sicherten die archäologischen Spuren um das Wrack, das jetzt lokalisiert werden konnte. Im Hauptquartier der britischen Streitkräfte in Möchengladbach beginnen derweil die Recherchen zur Historie der Kriegsepisode. Erst die Ergebnisse werden entscheiden, ob der Kriegsbomber Bodendenkmal und Grabstätte bleibt - oder ob mögliche menschliche und maschinelle Überreste geborgen werden.
Ganz vergessen haben die Zeitzeugen das Ereignis nie. Einzelteile des beim Absturz zerschmetterten Bombers hatten manche Hallenser in Wald, Feld und Flur schon vor Jahrzehnten entdeckt und zum Teil höchst unkonventionell in den eigenen Hausrat integriert. Andere entsinnen sich an das Bild des abstürzenden Fliegers am Himmel, das im Januar 1945 kein seltenes war. Für die alliierten Luftkräfte war das Mittelgebirge des Teutoburger Waldes eine Art Landmarke zur Orientierung bei ihren Angriffsflügen.
Dokumentiert und geborgen wurde das Wrack allerdings nie - auch die Hinterbliebenen wissen bis heute nichts vom Schicksal der Piloten und der weiteren Besatzung. Den Hinweisen auf den Absturz ging ein örtlicher Journalist mit eigenen Augen an Ort und Stelle nach und machte jetzt das Wrack ausfindig. Seine Funde gab er sofort an die LWL-Archäologie für Westfalen als zuständige Bodendenkmalbehörde weiter.
LWL-Archäologe Dr. Werner Best konnte vor Ort mehr sichern als Wrackteile des Bombers. "Vermutlich handelte es sich um eine britische Halifax", schildert Best, der schon einige Flugzeugwracks aus dem Zweiten Weltkrieg zu Gesicht bekommen hat. In Aktenvermerken im Stadtarchiv in Halle finden sich nur wenige nüchterne Worte über den Abschuss des "feindlichen Flugzeugs" und über die Bestattung von Leichenteilen einer nicht näher identifizierten Person aus dem Flugzeug.
Ob es noch mehr Besatzungsmitglieder gab ist ebenso unbekannt wie deren Verbleib. Anhand der Bekleidungsreste ließ sich bei einem Besuch eines amerikanischen Inspektors zweieinhalb Jahre nach dem Absturz die vermutlich britische Herkunft des viermotorigen Bombers festhalten. Informiert wurden die Briten darüber allerdings nie. LWL-Archäologe Best holte das jetzt - 67 Jahre nach dem Absturz - nach und übergab alle Informationen an das britische Hauptquartier in Mönchengladbach.
Auch jetzt, fast 70 Jahre nach dem Absturz, bleibt das Flugzeugwrack britisches Eigentum. "Die Briten entscheiden nun, wie weiter vorgegangen wird - dafür werden zunächst weitere Recherchen im entsprechenden Archiv in London unternommen, um mehr über das Flugzeug und seine Besatzung herauszubekommen", schildert Best. Bis dahin bleibt das Wrack ein geschütztes Bodendenkmal - zumal bislang nicht geklärt ist, ob es sich gleichzeitig um das Grab von Menschen handelt, deren Angehörige sie für vermisst halten. "Die Recherchen werden einige Zeit dauern und man wird nicht vor Herbst entscheiden, wie weiter verfahren wird", so Best.
Geborgen wird das Wrack voraussichtlich nur dann, wenn außergewöhnliche Umstände eintreten - etwa einer Kontaminierung des Bodens oder eine Plünderung der Absturzstelle zu befürchten ist. "
Quelle: LWL-Pressemitteilung, 6.8.2012
Wolf Thomas - am Montag, 6. August 2012, 20:37 - Rubrik: Kooperationsmodelle
Am 12. Juli war Richtfest beim Neubau des Landeskirchlichen Archivs in Nürnberg. Archivdirektorin Dr. Andrea Schwarz führt durch den Rohbau, für den 6000 Kubikmeter Beton und 1200 Tonnen Stahl verbaut wurden.
Wolf Thomas - am Montag, 6. August 2012, 20:15 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Historische Archiv der Stadt Köln kann die Restaurierung eines wahren Schmuckstücks seiner Bestände vermelden: das Evangeliar aus St. Gereon. Es wird ab Ende August 2012 ein bedeutender Teil einer Landesausstellung in Sachsen-Anhalt werden. Die Kosten für die Restaurierung hat das Kulturhistorische Museum Magdeburg getragen. ....Weitere Informationen zur Ausstellung: http://www.Otto2012.de "
Quelle: Blogeintrag Digitales Historisches Archiv Köln, 6.8.12"
Quelle: Blogeintrag Digitales Historisches Archiv Köln, 6.8.12"
Wolf Thomas - am Montag, 6. August 2012, 17:44 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Quellenbezogene Geschichtsschreibung ist unter anderem auf gut funktionierende Archive angewiesen, in denen wichtige Unterlagen dauerhaft aufgehoben, gesichert und zugänglich gemacht werden. Hierfür gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten: Entweder liefern Institutionen ihre „Alt-Akten“ regelmäßig an öffentliche Archive ab
– oder aber sie richten eigene Archive ein, wie dies beispielsweise bei Hochschularchiven oder Wirtschaftsarchiven der Fall ist.
Diese Aussagen gelten grundsätzlich auch für das Fachgebiet der Sportgeschichte, das ebenfalls dringend auf Archivunterlagen angewiesen ist. Eine vorläufige Bestandsaufnahme zeigt allerdings, dass gerade im Sportbereich noch erhebliche Defizite bei der dauerhaften Aufbewahrung von wichtigen Unterlagen festzustellen sind. So kann zurzeit nur bei 6 von insgesamt 16 Landessportbünden mit Sicherheit gesagt werden, wie sie mit ihren Alt-Akten umgehen. In Hessen wird allerdings seit mehreren Jahren am Aufbau eines Archivs des Landessportbunds gearbeitet.
Bei den hessischen Sportvereinen sieht es zumindest auf den ersten Blick ebenfalls recht positiv aus. Denn eine Bestandserhebung des Arbeitskreises „Sport und Geschichte” beim Landessportbund Hessen hat im Frühjahr 2008 zu dem Ergebnis geführt, dass etwa 700 der antwortenden Vereine über ein Archiv verfügen. Dies entspricht immerhin einem Anteil von knapp 10 % aller hessischen Sportvereine.
Dieses Ergebnis erscheint auch deshalb plausibel, weil vermutlich nur die größeren Sportvereine in der Lage sind, ein Archiv einzurichten und zu betreuen. Die genannte Zahl sagt allerdings nichts über den Umfang der gesammelten Materialien, über deren Unterbringung und über den Umfang von Maßnahmen der Bestandserhaltung aus. Dazu kommt noch, dass Vereinsarchive in der Regel nicht von ausgebildeten Archivaren betreut werden.
Darauf deutet unter anderem die Tatsache hin, dass sich bei der oben genannten Umfrage immerhin knapp 600 der antwortenden Sportvereine Fortbildungsangebote für die ehrenamtlichen Archivare gewünscht haben. Bei unsachgemäßer Behandlung der aufzubewahrenden Unterlagen besteht nämlich die Gefahr des Verlusts wichtiger Dokumente, wenn anerkannte Grundsätze der professionellen Archivarbeit nicht berücksichtigt werden.
Der Landessportbund Hessen konzentriert sich daher bei Überlegungen zur Unterstützung der Archivarbeit in den Sportvereinen zunächst auf Fortbildungsangebote sowie auf die Förderung der Zusammenarbeit mit öffentlichen Archiven und hauptberuflichen Archivaren. Deshalb wird vom Arbeitskreis „Sport und Geschichte“ auch den Abstimmungsgesprächen mit dem Landesverband Hessen im Verband deutscher Archivarinnen und Archivare große Bedeutung beigemessen.
Außerdem wurde Kontakt mit der Archivberatungsstelle Hessen sowie mit der Archivschule Marburg aufgenommen. Auf regionaler Ebene sollen die notwendigen Maßnahmen durch „Archivbeauftragte“ der Sportkreise unterstützt und koordiniert werden. Mittlerweile sind bereits von den meisten Sportkreisen Archivbeauftragte benannt worden.
Zusätzliche Informationen finden sich im Internetauftritt des Arbeitskreises „Sport und Geschichte“ beim Landessportbund Hessen (www.landessportbund-hessen.de/bereiche).
Peter Schermer
– oder aber sie richten eigene Archive ein, wie dies beispielsweise bei Hochschularchiven oder Wirtschaftsarchiven der Fall ist.
Diese Aussagen gelten grundsätzlich auch für das Fachgebiet der Sportgeschichte, das ebenfalls dringend auf Archivunterlagen angewiesen ist. Eine vorläufige Bestandsaufnahme zeigt allerdings, dass gerade im Sportbereich noch erhebliche Defizite bei der dauerhaften Aufbewahrung von wichtigen Unterlagen festzustellen sind. So kann zurzeit nur bei 6 von insgesamt 16 Landessportbünden mit Sicherheit gesagt werden, wie sie mit ihren Alt-Akten umgehen. In Hessen wird allerdings seit mehreren Jahren am Aufbau eines Archivs des Landessportbunds gearbeitet.
Bei den hessischen Sportvereinen sieht es zumindest auf den ersten Blick ebenfalls recht positiv aus. Denn eine Bestandserhebung des Arbeitskreises „Sport und Geschichte” beim Landessportbund Hessen hat im Frühjahr 2008 zu dem Ergebnis geführt, dass etwa 700 der antwortenden Vereine über ein Archiv verfügen. Dies entspricht immerhin einem Anteil von knapp 10 % aller hessischen Sportvereine.
Dieses Ergebnis erscheint auch deshalb plausibel, weil vermutlich nur die größeren Sportvereine in der Lage sind, ein Archiv einzurichten und zu betreuen. Die genannte Zahl sagt allerdings nichts über den Umfang der gesammelten Materialien, über deren Unterbringung und über den Umfang von Maßnahmen der Bestandserhaltung aus. Dazu kommt noch, dass Vereinsarchive in der Regel nicht von ausgebildeten Archivaren betreut werden.
Darauf deutet unter anderem die Tatsache hin, dass sich bei der oben genannten Umfrage immerhin knapp 600 der antwortenden Sportvereine Fortbildungsangebote für die ehrenamtlichen Archivare gewünscht haben. Bei unsachgemäßer Behandlung der aufzubewahrenden Unterlagen besteht nämlich die Gefahr des Verlusts wichtiger Dokumente, wenn anerkannte Grundsätze der professionellen Archivarbeit nicht berücksichtigt werden.
Der Landessportbund Hessen konzentriert sich daher bei Überlegungen zur Unterstützung der Archivarbeit in den Sportvereinen zunächst auf Fortbildungsangebote sowie auf die Förderung der Zusammenarbeit mit öffentlichen Archiven und hauptberuflichen Archivaren. Deshalb wird vom Arbeitskreis „Sport und Geschichte“ auch den Abstimmungsgesprächen mit dem Landesverband Hessen im Verband deutscher Archivarinnen und Archivare große Bedeutung beigemessen.
Außerdem wurde Kontakt mit der Archivberatungsstelle Hessen sowie mit der Archivschule Marburg aufgenommen. Auf regionaler Ebene sollen die notwendigen Maßnahmen durch „Archivbeauftragte“ der Sportkreise unterstützt und koordiniert werden. Mittlerweile sind bereits von den meisten Sportkreisen Archivbeauftragte benannt worden.
Zusätzliche Informationen finden sich im Internetauftritt des Arbeitskreises „Sport und Geschichte“ beim Landessportbund Hessen (www.landessportbund-hessen.de/bereiche).
Peter Schermer
Peter Schermer - am Montag, 6. August 2012, 17:33 - Rubrik: Sportarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Read more by Peter Murray Rust
http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2012/08/05/elsevier-replies-about-hybrid-openacess-i-am-appalled-about-their-practices-breaking-licences-and-having-to-pay-to-read-open-access
http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2012/08/05/elsevier-replies-about-hybrid-openacess-i-am-appalled-about-their-practices-breaking-licences-and-having-to-pay-to-read-open-access
KlausGraf - am Montag, 6. August 2012, 01:02 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sicher ist er kein Stück meisterhafter Weltliteratur und wird auch nicht von Martin Walser besprochen, aber Timo Baders historischer Roman Im Bann der Staufer ist eine charmante Geschichtsklitterung mit viel Schwäbisch Gmünder Lokalkolorit. Der 29jährige Lehrer am Gmünder Scheffold-Gymnasium, der sich in der Fantasy-Roman-Szene bereits einen Namen gemacht hat, ist mit seinem ersten historischen Roman recht erfolgreich. Anfang Juli waren bereits 2000 Exemplare von der im Einhorn-Verlag erschienenen Historien-Schwarte abgesetzt. Kein Wunder, grassiert doch anlässlich des Gmünder Stadtjubiläums 2012 (1162 wurden erstmals Gmünder Bürger erwähnt) die Stauferitis. Das Freilicht-Schauspiel Staufersaga fasziniert in diesem Sommer die Bürgerinnen und Bürger meiner Heimatstadt.
Wenige Textproben gibt es unter:
http://im-bann-der-staufer.blogspot.de/
Bader verknüpft die spannende Geschichte des Stauferkaisers Friedrich II. mit dem nicht weniger spannenden Schicksal einer erfundenen Figur, des aus Gmünd gebürtigen Kaspar, der zunächst unter die Räuber gerät und Lehrling des Johanniskirchen-Baumeisters Johannes wird. Dass Kaspar und seine Frau Agnes (S. 406) als Parler vorgestellt werden, also als Ahnen des Baumeistergeschlechts (Heinrich Parler kam im 14. Jahrhundert aus Köln nach Gmünd!), mag den den Geschichtskenner irritieren. Auch sonst gibt es sicher öfter einen Anachronismus-Alarm als mir aufgefallen ist. Ich las das Buch am Baggersee und konnte keinen Faktencheck mit Internet und Stauferstammtafel vornehmen. Natürlich war Konradin der Enkel und nicht der Sohn von Friedrich II. (S. 408), den "Pulverturm" (S. 262 u.ö.) konnte es vor der Erfindung des Schiesspulvers natürlich nicht geben (wir wissen nicht, wie der Turm in der Stauferzeit hieß) und auch nicht die "Untere Apotheke" (S. 308). Die Dominikaner waren damals noch nicht in Gmünd ansässig, gemeint ist das Dominikanerinnenkloster Gotteszell außerhalb der Mauern (S. 403). Aber wer nicht sehr historisch firm ist, wird sich davon nicht stören lassen. Manchmal knirscht es etwas, wenn historisches Wissen allzu lehrerhaft eingespeist wird: In der Stauferzeit wusste man nichts mehr vom Limes und hätte auch nicht vom "Kastellbad" gesprochen (S. 398). Bader lässt Otto IV. weiterleben, was legitime dichterische Freiheit ist, aber dass er Kaspar die Worte "In der Schrift Narratio de morte Ottonis IV. imperatoris beschrieb ein Augenzeuge sein Ableben" in den Mund legt (S. 422), ist schwerlich sehr geschickt.
Das sind aber vereinzelte Schnitzer. Dass ich, fast immer dem Genre des modernen historischen Romans abgeneigt, Baders Buch milder beurteile, liegt an den vielen Gmünder lokalgeschichtlichen Details. Dass zwei Arbeiten von mir (Der Ring der Herzogin, 1987 und Kleine Beiträge zum historischen Erzählen in Schwäbisch Gmünd, 1991) im Literaturverzeichnis eines historischen Romans auftauchen, ist eine neue Erfahrung für mich. Verwertet wurde zudem die von Caesarius von Heisterbach berichtete Himmelserscheinung bei der Johanniskirche 1225, auf die ich 1979 hingewiesen hatte. Bader baut sie als vorgetäuscht in die Handlung ein (S. 221, 232, 236).
Mehrfach wird die Gmünder Ringsage erwähnt (auch der Schwindelstein und die Klosterneuburger Schleiersage, doch ohne Nennung von Klosterneuburg S. 377), einmal auch die Baumeistersage der Johanniskirche (S. 290, siehe Graf, Kleine Beiträge), die "Etzelburg" (S. 397, siehe Graf, Kleine Beiträge), und natürlich darf auch "Gaudia mundi" nicht fehlen (S. 171). Gmünd erscheint - anachronistisch (siehe unten) - als Gold- und Silberstadt (S. 48). Sogar Briegel gibt es (S. 228). An Bauten notierte ich mir: mehrfach die Grät (deren Name aber von gradus, Stufen, kommt, und nicht von Geräte, S. 202), den (von der jüngeren Forschung vermuteten) Herrenhof an der Johanniskirche (S. 138), die jüdische Mikweh (S. 355), der Nepperstein = St. Salvator (S. 367). Man stößt auch auf eine prophetische Anspielung auf den "Gmünder Einhorn-Tunnel" (S. 434). Nach Bader gab es aber schon der Stauferzeit ein "verstecktes Netz aus Tunneln und Stollen" im Gmünder Untergrund (S. 205).
Insgesamt: Timo Bader liefert leicht konsumierbares neues Futter für den "Mythos Staufer", wobei er beileibe nicht der erste ist, der Schwäbisch Gmünd zum Schauplatz eines in der Stauferzeit spielenden historischen Romans macht. Den bisherigen Forschungsstand - niedergelegt in meinem Aufsatz zur Goldschmiedtradition 1984 - kann ich heute nicht unwesentlich erweitern. Ich erwähnte dort außer der Ringsage-Bearbeitung durch Luise Pichler (Der Ring der Herzogin, 1861)
[4. Auflage 1889 online:
http://www.ub.uni-koeln.de/cdm/ref/collection/mono19/id/28529 ]
auch den Roman "Hohenstaufen. Ein Spiegeldbild deutscher Kaisertreue aus Schwabens Geschichte" (1925) von Hugo Waldeyer-Hartz, "in dem der preußisch-national gesinnte Autor, Spezialist für breit angelegte Historiengemälde, den Endkampf der Staufer in Schwaben mit der römischen Kurie behandelt. Einer der Schauplätze des Romans, dessen Kulturkampf-Hintergrund man unschwer ausmacht, ist Schwäbisch Gmünd, Stätte adliger Turniere (S. 56 ff.)"
Eine Probeseite aus "Hohenstaufen":
http://www.flickr.com/photos/34028941@N00/7719696746/in/photostream
Ab 1. Januar 2013 kann dieser Text in der EU problemlos online gestellt werden, da der Autor dann 70 Jahre tot ist.
[Digitalisat:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hohenstaufen_(Waldeyer-Hartz).pdf ]
Gmünder Lokalkolorit weist auch der 1948 erschienene Roman über Walther von der Vogelweide "Singen und Sagen. Roman des Minnesangs" von Luise George Bachmann auf. Herr Walther logiert - wieder anachronistisch - in einem der "Stadthäuser des Rechbergs in Schwäbisch-Gmünd" (S. 335). Es kommen auch die Johanniskirche (S. 341) und bis zum Kapitelsende (S. 346) weitere Gmünder Örtlichkeiten und Familiennamen vor.
Interessanter freilich erscheint mir meine neueste Trouvaille, "Ludwig und Edeltrudis" (1858, die angekündigten Fortsetzungen erschienen nicht) von dem aus Gmünd gebürtigen katholischen Geistlichen und Schriftsteller Franz Joseph Holzwarth. Das Buch ist online beim Münchner Digitalisierungszentrum oder bei Google:
http://books.google.de/books?id=T5k6AAAAcAAJ
Schwäbisch Gmünd ist sehr lange Schauplatz in dem fromm gesinnten Werk (S. 169-256). Auch hier begegnet man der Ringsage (S. 170) und der Baumeistersage (S. 204) der Johanniskirche. Erwähnt wird auch die Christental-Überlieferung. Es kommen die Gmünder Goldschmiede vor (S. 184ff.), der Turniergraben (S. 207) und der St. Salvator (S. 218). Die Johanniskirche wird liebevoll beschrieben (S. 203).
"Mit fleißiger Treue und mit Verständniß des Zeitalters sind die Beschreibungen ausgeführt, und Sittenzüge, wie die der Verlobung, der Ritterseste fanden unverkümmerten Raum in der Darstellung; als das lebensvollste Bild in dieser Hinsicht und gleichsam der erste Sammelpunkt der bewegenden Kräfte erscheint die festliche Kirchenweihe und das Waffenspiel der schwäbischen Ritterschaft in der Goldschmiedestadt zu Gmünd", lobte der Rezensent der katholischen Historisch-politischen Blätter. Aus meiner Sicht liest sich Timo Bader 2012 aber wesentlich flotter als der recht hölzerne Holzwarth 1858, aber das mag der geneigte Leser und die geneigte Leserin selbst entscheiden!
Update Juni 2015: Louise Pichler, Autorin der Erzählung "Der Ring der Herzogin", baute Gmünd am Rande in die Handlung ihres umfangreichen Romans "Friedrich von Hohenstaufen der Einäugige" (Bd. 1, 1853) ein. Wasser aus der Salvatorquelle soll die Herzogin heilen (S. 201ff.). Erwähnt werden auch die "kunstreichen Meister[] zu Gmünd" (S. 162).
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/context/bsb10116303_00001.html?context=gm%C3%BCnd&action=Finden!&contextSort=score%2Cdescending&contextRows=10&contextType=scan
#forschung
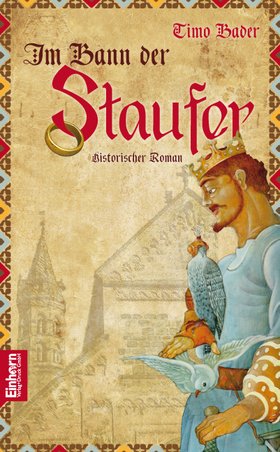
Wenige Textproben gibt es unter:
http://im-bann-der-staufer.blogspot.de/
Bader verknüpft die spannende Geschichte des Stauferkaisers Friedrich II. mit dem nicht weniger spannenden Schicksal einer erfundenen Figur, des aus Gmünd gebürtigen Kaspar, der zunächst unter die Räuber gerät und Lehrling des Johanniskirchen-Baumeisters Johannes wird. Dass Kaspar und seine Frau Agnes (S. 406) als Parler vorgestellt werden, also als Ahnen des Baumeistergeschlechts (Heinrich Parler kam im 14. Jahrhundert aus Köln nach Gmünd!), mag den den Geschichtskenner irritieren. Auch sonst gibt es sicher öfter einen Anachronismus-Alarm als mir aufgefallen ist. Ich las das Buch am Baggersee und konnte keinen Faktencheck mit Internet und Stauferstammtafel vornehmen. Natürlich war Konradin der Enkel und nicht der Sohn von Friedrich II. (S. 408), den "Pulverturm" (S. 262 u.ö.) konnte es vor der Erfindung des Schiesspulvers natürlich nicht geben (wir wissen nicht, wie der Turm in der Stauferzeit hieß) und auch nicht die "Untere Apotheke" (S. 308). Die Dominikaner waren damals noch nicht in Gmünd ansässig, gemeint ist das Dominikanerinnenkloster Gotteszell außerhalb der Mauern (S. 403). Aber wer nicht sehr historisch firm ist, wird sich davon nicht stören lassen. Manchmal knirscht es etwas, wenn historisches Wissen allzu lehrerhaft eingespeist wird: In der Stauferzeit wusste man nichts mehr vom Limes und hätte auch nicht vom "Kastellbad" gesprochen (S. 398). Bader lässt Otto IV. weiterleben, was legitime dichterische Freiheit ist, aber dass er Kaspar die Worte "In der Schrift Narratio de morte Ottonis IV. imperatoris beschrieb ein Augenzeuge sein Ableben" in den Mund legt (S. 422), ist schwerlich sehr geschickt.
Das sind aber vereinzelte Schnitzer. Dass ich, fast immer dem Genre des modernen historischen Romans abgeneigt, Baders Buch milder beurteile, liegt an den vielen Gmünder lokalgeschichtlichen Details. Dass zwei Arbeiten von mir (Der Ring der Herzogin, 1987 und Kleine Beiträge zum historischen Erzählen in Schwäbisch Gmünd, 1991) im Literaturverzeichnis eines historischen Romans auftauchen, ist eine neue Erfahrung für mich. Verwertet wurde zudem die von Caesarius von Heisterbach berichtete Himmelserscheinung bei der Johanniskirche 1225, auf die ich 1979 hingewiesen hatte. Bader baut sie als vorgetäuscht in die Handlung ein (S. 221, 232, 236).
Mehrfach wird die Gmünder Ringsage erwähnt (auch der Schwindelstein und die Klosterneuburger Schleiersage, doch ohne Nennung von Klosterneuburg S. 377), einmal auch die Baumeistersage der Johanniskirche (S. 290, siehe Graf, Kleine Beiträge), die "Etzelburg" (S. 397, siehe Graf, Kleine Beiträge), und natürlich darf auch "Gaudia mundi" nicht fehlen (S. 171). Gmünd erscheint - anachronistisch (siehe unten) - als Gold- und Silberstadt (S. 48). Sogar Briegel gibt es (S. 228). An Bauten notierte ich mir: mehrfach die Grät (deren Name aber von gradus, Stufen, kommt, und nicht von Geräte, S. 202), den (von der jüngeren Forschung vermuteten) Herrenhof an der Johanniskirche (S. 138), die jüdische Mikweh (S. 355), der Nepperstein = St. Salvator (S. 367). Man stößt auch auf eine prophetische Anspielung auf den "Gmünder Einhorn-Tunnel" (S. 434). Nach Bader gab es aber schon der Stauferzeit ein "verstecktes Netz aus Tunneln und Stollen" im Gmünder Untergrund (S. 205).
Insgesamt: Timo Bader liefert leicht konsumierbares neues Futter für den "Mythos Staufer", wobei er beileibe nicht der erste ist, der Schwäbisch Gmünd zum Schauplatz eines in der Stauferzeit spielenden historischen Romans macht. Den bisherigen Forschungsstand - niedergelegt in meinem Aufsatz zur Goldschmiedtradition 1984 - kann ich heute nicht unwesentlich erweitern. Ich erwähnte dort außer der Ringsage-Bearbeitung durch Luise Pichler (Der Ring der Herzogin, 1861)
[4. Auflage 1889 online:
http://www.ub.uni-koeln.de/cdm/ref/collection/mono19/id/28529 ]
auch den Roman "Hohenstaufen. Ein Spiegeldbild deutscher Kaisertreue aus Schwabens Geschichte" (1925) von Hugo Waldeyer-Hartz, "in dem der preußisch-national gesinnte Autor, Spezialist für breit angelegte Historiengemälde, den Endkampf der Staufer in Schwaben mit der römischen Kurie behandelt. Einer der Schauplätze des Romans, dessen Kulturkampf-Hintergrund man unschwer ausmacht, ist Schwäbisch Gmünd, Stätte adliger Turniere (S. 56 ff.)"
Eine Probeseite aus "Hohenstaufen":
http://www.flickr.com/photos/34028941@N00/7719696746/in/photostream
Ab 1. Januar 2013 kann dieser Text in der EU problemlos online gestellt werden, da der Autor dann 70 Jahre tot ist.
[Digitalisat:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hohenstaufen_(Waldeyer-Hartz).pdf ]
Gmünder Lokalkolorit weist auch der 1948 erschienene Roman über Walther von der Vogelweide "Singen und Sagen. Roman des Minnesangs" von Luise George Bachmann auf. Herr Walther logiert - wieder anachronistisch - in einem der "Stadthäuser des Rechbergs in Schwäbisch-Gmünd" (S. 335). Es kommen auch die Johanniskirche (S. 341) und bis zum Kapitelsende (S. 346) weitere Gmünder Örtlichkeiten und Familiennamen vor.
Interessanter freilich erscheint mir meine neueste Trouvaille, "Ludwig und Edeltrudis" (1858, die angekündigten Fortsetzungen erschienen nicht) von dem aus Gmünd gebürtigen katholischen Geistlichen und Schriftsteller Franz Joseph Holzwarth. Das Buch ist online beim Münchner Digitalisierungszentrum oder bei Google:
http://books.google.de/books?id=T5k6AAAAcAAJ
Schwäbisch Gmünd ist sehr lange Schauplatz in dem fromm gesinnten Werk (S. 169-256). Auch hier begegnet man der Ringsage (S. 170) und der Baumeistersage (S. 204) der Johanniskirche. Erwähnt wird auch die Christental-Überlieferung. Es kommen die Gmünder Goldschmiede vor (S. 184ff.), der Turniergraben (S. 207) und der St. Salvator (S. 218). Die Johanniskirche wird liebevoll beschrieben (S. 203).
"Mit fleißiger Treue und mit Verständniß des Zeitalters sind die Beschreibungen ausgeführt, und Sittenzüge, wie die der Verlobung, der Ritterseste fanden unverkümmerten Raum in der Darstellung; als das lebensvollste Bild in dieser Hinsicht und gleichsam der erste Sammelpunkt der bewegenden Kräfte erscheint die festliche Kirchenweihe und das Waffenspiel der schwäbischen Ritterschaft in der Goldschmiedestadt zu Gmünd", lobte der Rezensent der katholischen Historisch-politischen Blätter. Aus meiner Sicht liest sich Timo Bader 2012 aber wesentlich flotter als der recht hölzerne Holzwarth 1858, aber das mag der geneigte Leser und die geneigte Leserin selbst entscheiden!
Update Juni 2015: Louise Pichler, Autorin der Erzählung "Der Ring der Herzogin", baute Gmünd am Rande in die Handlung ihres umfangreichen Romans "Friedrich von Hohenstaufen der Einäugige" (Bd. 1, 1853) ein. Wasser aus der Salvatorquelle soll die Herzogin heilen (S. 201ff.). Erwähnt werden auch die "kunstreichen Meister[] zu Gmünd" (S. 162).
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/context/bsb10116303_00001.html?context=gm%C3%BCnd&action=Finden!&contextSort=score%2Cdescending&contextRows=10&contextType=scan
#forschung
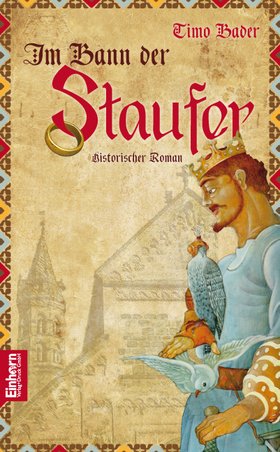
KlausGraf - am Sonntag, 5. August 2012, 22:22 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In letzter Zeit nervt mich Google in Chrome immer wieder mit unvollständigen Suchergebnissen in Google Books. Es werden keine oder nur sehr wenige Suchergenisse angezeigt, wenn ich von der Websuche mittels des Reiters "Mehr" zur Buchsuche wechsle. Indem ich in der URL das https wegkürze, komme ich dann in der Regel zu den korrekten Ergebnissen, aber das ist außerordentlich lästig, wenn man schnelles Arbeiten gewohnt ist. Irgendwelche Erklärungen?


KlausGraf - am Sonntag, 5. August 2012, 18:01 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Ausschnitte aus der achtteiligen, in vier Sprachen vorliegenden Serie „Tips für den Alltag" (1967-1971) und aus dem Dokumentarfilm „Jannis Stephanidis" (1970), hergestellt im Auftrag der Landeszentrale für politische Bildung NRW -- Die hier gezeigten Filme sind im Landesarchiv zugänglich unter den Signaturen RWF 0427, 0429, 0431 sowie RWF 0465. Für die Zusammenstellung wurden Digitalisate herangezogen, die von Ansichtskopien in Form von Betacam-SP-Bändern hergestellt wurden; eine weitere Digitalisierung auf Grundlage höherwertiger Kopien ist geplant.
Die Ausschnitte wurden für einen Vortrag auf dem Internationalen Archivsymposion in Luxemburg (Mai 2012) mit dem Titel „Arbeitsmigration in Nordrhein-Westfalen. Vom „Gastarbeiter" zum „Bürger mit Migrationshintergrund" zusammengestellt. Den Schnitt fertigte Michael Klabes, LAV NRW.
Kontakt: Landesarchiv NRW, Dr. Kathrin Pilger, kathrin.pilger@lav.nrw.de
Wolf Thomas - am Sonntag, 5. August 2012, 17:10 - Rubrik: Filmarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Archivists hope historical records of internal conflicts over borders, cattle, grazing land will help resolve modern-day violence of same type."
Link to full text
Link to full text
Wolf Thomas - am Sonntag, 5. August 2012, 17:06 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Sonntag, 5. August 2012, 17:03 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Idee einer „Ratinger Geschichtszeitung“ wurde vom Kulturdezernenten Dirk Tratzig entwickelt. Ausgang der Überlegungen war, dass es zwar von Seiten des Stadtarchivs zahlreiche Publikationen zu einzelnen Themen der Ratinger Stadtgeschichte gibt, diese jedoch differenziert und vertiefend behandelt werden. Die, kostenfrei erhältliche, Geschichtszeitung dagegen soll ein Medium für Interessierte sein, die einfach Spaß an der Beschäftigung mit geschichtlichen Themen haben, aber keine langen Abhandlungen lesen wollen. Eine Geschichtszeitung in knapper, ansprechender Form und mit einem gewissen „Spaßfaktor“ im Sinne des Infotainments versehen, soll Bürger jeden Alters auf die reichhaltige Stadtgeschichte Ratingens neugierig machen. Das Themenspektrum erstreckt sich vom Mittelalter bis zur kommunalen Neugliederung. "
Quelle: Homepage Stadtarchiv Ratingen
Link zur ersten Ausgabe (PDF)
Quelle: Homepage Stadtarchiv Ratingen
Link zur ersten Ausgabe (PDF)
Wolf Thomas - am Sonntag, 5. August 2012, 16:54 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
"The 2012 election is still months away, and President Barack Obama could have another four years in the White House. But competition for which state can properly lay claim to Obama’s post-presidential legacy is already underway.
While Chicago, where the 44th president launched his political career, seems like a natural spot for an eventual presidential library, Hawaii is waging an underdog campaign to ultimately bring the president’s records to the Aloha State. ....
Read more: http://www.politico.com/news/stories/0712/78608
I think, Hawaii would be the better place to work and research. ;-)
While Chicago, where the 44th president launched his political career, seems like a natural spot for an eventual presidential library, Hawaii is waging an underdog campaign to ultimately bring the president’s records to the Aloha State. ....
Read more: http://www.politico.com/news/stories/0712/78608
I think, Hawaii would be the better place to work and research. ;-)
Wolf Thomas - am Sonntag, 5. August 2012, 16:48 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"The Roy Rosenzweig Center for History and New Media (RRCHNM) at George Mason University is pleased to announce the release of its newest open source tool, Scripto, which opens up the possibilities of community transcription for digital humanities projects in universities, libraries, archives, and museums. "
http://chnm.gmu.edu/news/introducing-scripto-a-tool-for-community-transcription/
http://chnm.gmu.edu/news/introducing-scripto-a-tool-for-community-transcription/
KlausGraf - am Sonntag, 5. August 2012, 16:48 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Dieser Beitrag (frz.) beschäftigt sich mit der Archivierung der Ton Überlieferung des nationalen Radios der Komoren.
Wolf Thomas - am Sonntag, 5. August 2012, 16:39 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Virtuelle Geschichte" als Computerspiel.
Wolf Thomas - am Sonntag, 5. August 2012, 16:31 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Beachtliche Ausführungen des OVG Münster zum Verhältnis bereichsspezifischer Akteneinsichtsregelungen und Informationsfreiheitsgesetz:
http://www.telemedicus.info/urteile/Datenschutzrecht/Informationsfreiheit/502-OVG-Muenster-Az-21-E-148704-Einsicht-in-Jugendamtsakte.html
Während das Informationsfreiheitsgesetz allen natürlichen Personen unterschiedslos und ohne das Anknüpfen an bestimmte Bedingungen vom Grundsatz her einen allgemeinen Zugangsanspruch einräumt, regelt § 25 SGB X - im Übrigen ebenso wie die für Verwaltungsverfahren im Allgemeinen geltenden Vorschriften der § 29 VwVfG Bund und § 29 VwVfG NRW - ein Akteneinsichtsrecht nur für bestimmte Personen und nur für bestimmte Situationen. § 25 SGB X (§ 29 VwVfG Bund/NRW) räumt nämlich ein Akteneinsichtsrecht nur den an einem Verwaltungsverfahren im Sinne § 8 SGB X (§ 9 VwVfG Bund/NRW) Beteiligten und dies auch nur für die das jeweilige Verwaltungsverfahren betreffenden Akten und nur für die Zeit des Laufs des Verwaltungsverfahrens ein. Nur für diesen Anwendungsbereich, nämlich für das Akteneinsichtsgesuch eines Beteiligten in die das jeweilige Verwaltungsverfahren betreffenden Akten während des laufenden Verfahrens, stellt § 25 SGB X (§ 29 VwVfG Bund/NRW) eine abschließende und damit die Anwendbarkeit des Informationsfreiheitsgesetzes ausschließende Regelung dar.
Dies bedeutet, dass einem am Verwaltungsverfahren Beteiligten für das auf § 25 SGB X (§ 29 VwVfG Bund/NRW) gestützte Akteneinsichtsgesuch einerseits ein besonderes Interesse zur Seite stehen muss, denn § 25 SGB X (§ 29 VwVfG Bund/NRW) räumt ein Einsichtsrecht nur dann ein, wenn die Kenntnis der Akten zur Geltendmachung oder Verteidigung der rechtlichen Interessen erforderlich ist. Andererseits unterliegt der Beteiligte aber nicht den Einschränkungen, wie sie für einen Anspruch auf der Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes in §§ 6 f. IFG NRW statuiert sind, was darauf zurückzuführen ist, dass § 25 SGB X (§ 29 VwVfG Bund/NRW) Ausfluss der rechtsstaatlichen Grundsätze der Gewährung rechtlichen Gehörs und des fairen Verfahrens ist.
Über den zuvor dargestellten Anwendungsbereich hinaus kommt § 25 SGB X (§ 29 VwVfG Bund/NRW) aber keine abschließende Wirkung zu. Es lässt sich nicht feststellen, dass ein über diesen Bereich hinausgehender umfassender Informationsanspruch dem Schutzzweck des § 25 SGB X (§ 29 VwVfG Bund/NRW) zuwider laufen würde. Denn die Einschränkungen, denen der Zugangsanspruch nach dem Informationsfreiheitsgesetz durch die in §§ 6 f. IFG NRW getroffenen Regelungen unterliegt, stellen hinreichend sicher, dass private Belange der am Verwaltungsverfahren Beteiligten oder unbeteiligter Dritter, die einer Offenbarung des Akteninhalts oder Teilen von diesem entgegenstehen, in vergleichbarer Weise geschützt werden.
Vgl. in diesem Zusammenhang auch Nordmann, RDV 2001, 71 (82).
Ausgehend von diesen Überlegungen kann etwa ein am Verwaltungsverfahren Beteiligter bei Fehlen des in § 25 SGB X (§ 29 VwVfG Bund/NRW) geforderten besonderen Interesses auf der Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes Akteneinsicht begehren. Darin liegt kein systemwidriges Ergebnis.
So aber Wolf-Hegerbekermeier/Pelizäus, DVBl. 2002, 955 (957); vgl. in diesem Zusammenhang auch Stollmann, NWVBl. 2002, 216 (217).
Denn die Akteneinsicht wird nicht "nahezu schrankenlos" gewährt, sondern unterliegt den sich aus §§ 6 f. IFG NRW ergebenden Einschränkungen.
Ebenso kann ein Einsichtsgesuch auf § 4 Abs. 1 IFG NRW gestützt werden, wenn das Verwaltungsverfahren bereits abgeschlossen ist oder das Begehren von einem nicht am Verwaltungsverfahren Beteiligten ausgeht.
http://www.telemedicus.info/urteile/Datenschutzrecht/Informationsfreiheit/502-OVG-Muenster-Az-21-E-148704-Einsicht-in-Jugendamtsakte.html
Während das Informationsfreiheitsgesetz allen natürlichen Personen unterschiedslos und ohne das Anknüpfen an bestimmte Bedingungen vom Grundsatz her einen allgemeinen Zugangsanspruch einräumt, regelt § 25 SGB X - im Übrigen ebenso wie die für Verwaltungsverfahren im Allgemeinen geltenden Vorschriften der § 29 VwVfG Bund und § 29 VwVfG NRW - ein Akteneinsichtsrecht nur für bestimmte Personen und nur für bestimmte Situationen. § 25 SGB X (§ 29 VwVfG Bund/NRW) räumt nämlich ein Akteneinsichtsrecht nur den an einem Verwaltungsverfahren im Sinne § 8 SGB X (§ 9 VwVfG Bund/NRW) Beteiligten und dies auch nur für die das jeweilige Verwaltungsverfahren betreffenden Akten und nur für die Zeit des Laufs des Verwaltungsverfahrens ein. Nur für diesen Anwendungsbereich, nämlich für das Akteneinsichtsgesuch eines Beteiligten in die das jeweilige Verwaltungsverfahren betreffenden Akten während des laufenden Verfahrens, stellt § 25 SGB X (§ 29 VwVfG Bund/NRW) eine abschließende und damit die Anwendbarkeit des Informationsfreiheitsgesetzes ausschließende Regelung dar.
Dies bedeutet, dass einem am Verwaltungsverfahren Beteiligten für das auf § 25 SGB X (§ 29 VwVfG Bund/NRW) gestützte Akteneinsichtsgesuch einerseits ein besonderes Interesse zur Seite stehen muss, denn § 25 SGB X (§ 29 VwVfG Bund/NRW) räumt ein Einsichtsrecht nur dann ein, wenn die Kenntnis der Akten zur Geltendmachung oder Verteidigung der rechtlichen Interessen erforderlich ist. Andererseits unterliegt der Beteiligte aber nicht den Einschränkungen, wie sie für einen Anspruch auf der Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes in §§ 6 f. IFG NRW statuiert sind, was darauf zurückzuführen ist, dass § 25 SGB X (§ 29 VwVfG Bund/NRW) Ausfluss der rechtsstaatlichen Grundsätze der Gewährung rechtlichen Gehörs und des fairen Verfahrens ist.
Über den zuvor dargestellten Anwendungsbereich hinaus kommt § 25 SGB X (§ 29 VwVfG Bund/NRW) aber keine abschließende Wirkung zu. Es lässt sich nicht feststellen, dass ein über diesen Bereich hinausgehender umfassender Informationsanspruch dem Schutzzweck des § 25 SGB X (§ 29 VwVfG Bund/NRW) zuwider laufen würde. Denn die Einschränkungen, denen der Zugangsanspruch nach dem Informationsfreiheitsgesetz durch die in §§ 6 f. IFG NRW getroffenen Regelungen unterliegt, stellen hinreichend sicher, dass private Belange der am Verwaltungsverfahren Beteiligten oder unbeteiligter Dritter, die einer Offenbarung des Akteninhalts oder Teilen von diesem entgegenstehen, in vergleichbarer Weise geschützt werden.
Vgl. in diesem Zusammenhang auch Nordmann, RDV 2001, 71 (82).
Ausgehend von diesen Überlegungen kann etwa ein am Verwaltungsverfahren Beteiligter bei Fehlen des in § 25 SGB X (§ 29 VwVfG Bund/NRW) geforderten besonderen Interesses auf der Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes Akteneinsicht begehren. Darin liegt kein systemwidriges Ergebnis.
So aber Wolf-Hegerbekermeier/Pelizäus, DVBl. 2002, 955 (957); vgl. in diesem Zusammenhang auch Stollmann, NWVBl. 2002, 216 (217).
Denn die Akteneinsicht wird nicht "nahezu schrankenlos" gewährt, sondern unterliegt den sich aus §§ 6 f. IFG NRW ergebenden Einschränkungen.
Ebenso kann ein Einsichtsgesuch auf § 4 Abs. 1 IFG NRW gestützt werden, wenn das Verwaltungsverfahren bereits abgeschlossen ist oder das Begehren von einem nicht am Verwaltungsverfahren Beteiligten ausgeht.
KlausGraf - am Sonntag, 5. August 2012, 16:29 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Vorbereitungen auf die Beweissicherung gehen voran. Die mit den Arbeiten an der Einsturzstelle des Stadtarchivs befassten Gutachter haben sich auf ein Verfahren zur Sicherung des U-Bahn-Bauwerks geeinigt - ein weiterer Stützbalken soll errichtet werden. ...."
Hendrik Varnholt, in: Kölnische Rundschau v. 31.7.2012
Hendrik Varnholt, in: Kölnische Rundschau v. 31.7.2012
Wolf Thomas - am Sonntag, 5. August 2012, 16:25 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=61142&pos=0&anz=1
Der BGH stellt fest: "dass die im gewerblichen Rechtsschutz entwickelten Grundsätze zur Leerübertragung grundsätzlich im Urheberrecht entsprechend anwendbar sind (ebenso LG Oldenburg, GRUR 1996, 481,
484; LG Hamburg, GRUR Int., 2010, 67, 72; Loewenheim/J. B. Nordemann in
Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, 2. Aufl., § 62 Rn. 7; J. B. Nordemann in Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 10. Aufl., vor §§ 31 ff. UrhG Rn. 174;
Schulze in Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl., § 31 Rn. 14; Wandtke/Grunert in
Wandtke/Bullinger, Urheberrecht, 3. Aufl., vor §§ 31 ff. UrhG Rn. 124 f.; Schricker/Loewenheim in Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl., § 31 UrhG
Rn. 29; Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 5. Aufl., Rn. 1154; Burkhardt in Wenzel/Burkhardt, Urheberrecht für die Praxis, 5. Aufl., Rn. 30; Manz/
Ventroni/Schneider, ZUM 2002, 409, 412 f.; zum Verlagsrecht Schricker, Verlagsrecht, 3. Aufl., § 40 VerlG Rn. 2; vgl. auch OLG Hamburg, ZUM 2000, 870,
874). Danach ist ein urheberrechtlicher Lizenzvertrag über die Einräumung oder
Übertragung von Nutzungsrechten an einem vermeintlichen Werk nicht deshalb
unwirksam, weil das vermeintliche Werk tatsächlich keinen Urheberrechtsschutz
genießt. Der Lizenzgeber eines solchen Lizenzvertrages kann grundsätzlich die
vereinbarte Vergütung beanspruchen, solange der Lizenzvertrag besteht und
dem Lizenznehmer eine wirtschaftliche Vorzugsstellung verschafft."
Wenn Verträge über Scheinrechte wirksam sind, sind Schutzrechtsberühmungen (Copyfraud) leichter möglich:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzrechtsber%C3%BChmung
Der BGH stellt fest: "dass die im gewerblichen Rechtsschutz entwickelten Grundsätze zur Leerübertragung grundsätzlich im Urheberrecht entsprechend anwendbar sind (ebenso LG Oldenburg, GRUR 1996, 481,
484; LG Hamburg, GRUR Int., 2010, 67, 72; Loewenheim/J. B. Nordemann in
Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, 2. Aufl., § 62 Rn. 7; J. B. Nordemann in Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 10. Aufl., vor §§ 31 ff. UrhG Rn. 174;
Schulze in Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl., § 31 Rn. 14; Wandtke/Grunert in
Wandtke/Bullinger, Urheberrecht, 3. Aufl., vor §§ 31 ff. UrhG Rn. 124 f.; Schricker/Loewenheim in Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl., § 31 UrhG
Rn. 29; Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 5. Aufl., Rn. 1154; Burkhardt in Wenzel/Burkhardt, Urheberrecht für die Praxis, 5. Aufl., Rn. 30; Manz/
Ventroni/Schneider, ZUM 2002, 409, 412 f.; zum Verlagsrecht Schricker, Verlagsrecht, 3. Aufl., § 40 VerlG Rn. 2; vgl. auch OLG Hamburg, ZUM 2000, 870,
874). Danach ist ein urheberrechtlicher Lizenzvertrag über die Einräumung oder
Übertragung von Nutzungsrechten an einem vermeintlichen Werk nicht deshalb
unwirksam, weil das vermeintliche Werk tatsächlich keinen Urheberrechtsschutz
genießt. Der Lizenzgeber eines solchen Lizenzvertrages kann grundsätzlich die
vereinbarte Vergütung beanspruchen, solange der Lizenzvertrag besteht und
dem Lizenznehmer eine wirtschaftliche Vorzugsstellung verschafft."
Wenn Verträge über Scheinrechte wirksam sind, sind Schutzrechtsberühmungen (Copyfraud) leichter möglich:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzrechtsber%C3%BChmung
KlausGraf - am Sonntag, 5. August 2012, 16:13 - Rubrik: Archivrecht
http://www.heise.de/newsticker/meldung/US-Gericht-Verlinken-auf-fremde-Videostreams-keine-Copyright-Verletzung-1660207.html
Zur deutschen Rechtslage siehe etwa das Interview mit RA Solmecke:
http://experten-interviews.de/2012/07/06/umgehen-von-geo-sperren-ist-nicht-strafbar/
Zur Nutzung eines US-Proxys, wenn er den Zugang zu von HathiTrust oder Google gesperrten, in den EU noch nicht gemeinfreien Werken eröffnen soll, lässt sich Solmeckes Argumentation ("Die Umgehung einer “Geo-Sperre” verstößt auch nicht gegen das Verbot der Umgehung technischer Schutzmaßnahmen nach § 95a UrhG. Durch die Verwendung der „Geo-Sperre“ als technische Schutzmaßnahme verhindert der Anbieter, dass Nutzer mit bestimmten IP-Adressen auf die Videos zugreifen können. § 95a UrhG setzt jedoch voraus, dass die technische Schutzmaßnahme gerade durch denjenigen eingesetzt wird, der die Rechte an dem betroffenen Werk, hier also dem Video, hat. Youtube hat jedoch gerade nicht das Recht, die Videos in Deutschland öffentlich zugänglich zu machen. Aus diesem Grund liegt auch kein Verstoß gegen § 95a UrhG vor. ") übertragen. Auch das Herunterladen von Buchseiten für den privaten Gebrauch ist nach meiner Ansicht von § 53 UrhG gedeckt, wenn das Angebot im Ursprungsland legal ist.
Zur deutschen Rechtslage siehe etwa das Interview mit RA Solmecke:
http://experten-interviews.de/2012/07/06/umgehen-von-geo-sperren-ist-nicht-strafbar/
Zur Nutzung eines US-Proxys, wenn er den Zugang zu von HathiTrust oder Google gesperrten, in den EU noch nicht gemeinfreien Werken eröffnen soll, lässt sich Solmeckes Argumentation ("Die Umgehung einer “Geo-Sperre” verstößt auch nicht gegen das Verbot der Umgehung technischer Schutzmaßnahmen nach § 95a UrhG. Durch die Verwendung der „Geo-Sperre“ als technische Schutzmaßnahme verhindert der Anbieter, dass Nutzer mit bestimmten IP-Adressen auf die Videos zugreifen können. § 95a UrhG setzt jedoch voraus, dass die technische Schutzmaßnahme gerade durch denjenigen eingesetzt wird, der die Rechte an dem betroffenen Werk, hier also dem Video, hat. Youtube hat jedoch gerade nicht das Recht, die Videos in Deutschland öffentlich zugänglich zu machen. Aus diesem Grund liegt auch kein Verstoß gegen § 95a UrhG vor. ") übertragen. Auch das Herunterladen von Buchseiten für den privaten Gebrauch ist nach meiner Ansicht von § 53 UrhG gedeckt, wenn das Angebot im Ursprungsland legal ist.
KlausGraf - am Sonntag, 5. August 2012, 15:53 - Rubrik: Archivrecht
Aus Anlass des 100. Geburtstages von Prof. Hellwig präsentiert das Landesarchiv vom 30. Juli bis 31. August 2012 in seinen Räumen eine kleine Auswahl aus seiner Kartensammlung.
Prof. Dr. Fritz Hellwig ist am 3. August 1912 in Saarbrücken geboren. Er hat sich 1936 mit einer Biografie des Hüttenbarons aus Neunkirchen Karl Ferdinand Freiherrn von Stumm-Halberg habilitiert. Vor dem Zweiten Weltkrieg war er Mitarbeiter der Handelskammer Saarbrücken. Nach dem Weltkrieg war er 1953 bis 1959 Mitglied des Deutschen Bundestages und 1967 bis 1970 einer von fünf Vizepräsidenten der Europäischen Gemeinschaften in Brüssel. Bereits während seiner europaweiten Tätigkeiten sammelte er alte Landkarten, Stiche von Personen und Orten, sonstige Archivalien und alte Bücher, die seine weitere Heimat links des Rheins betrafen. Aufgrund seiner späteren Lehrtätigkeit ernannte ihn die Universität Trier 1990 zum Honorarprofessor für regionale Wirtschaftsgeographie und Kartographie.
Seit den 1990er Jahren erweist sich Prof. Hellwig als Mäzen des Saarlandes, indem er dem Landesarchiv und der Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek Teile seiner Sammlungen schenkt. Unter anderem hat das Landesarchiv Saarbrücken 2002 eine Porträtsammlung mit ca. 320 Stichen und Drucken aus der Zeit von 1550 bis 1816 erhalten. Die Sammlung enthält Porträts von Landesherren (Trier, Pfalz, Lothringen), Staatsmännern und Beamten, Feldherrn und Militärs des Kaisers, aus Preußen, den Niederlanden und Schweden, von Geistlichen und Theologen, Wissenschaftlern und Künstlern. 2010 hat er dem Landesarchiv 1.175 Ortsansichten des Saartales, Lothringens – darunter zahlreiche Ansichten von Nancy – des Elsass, der Region Trier und des Moseltales, vom Mittelrhein und vom Nahetal, von Mainz und von der Pfalz geschenkt, auch Bilddrucke aus dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71. Die größte Schenkung vom Juli 2008 enthielt eine bedeutende Kartensammlung zum Saarland und den es umgebenden Regionen. Die übergebenen 846 Karten und Pläne stammen aus der Zeit von den Anfängen der Kartographie im 16. Jahrhundert bis zum 20. Jahrhundert. Sie stellen einen Raum dar, der sich vom Oberlauf des Rheins bis in die Niederlande, von Württemberg bis nach Lothringen erstreckt. Besonders berücksichtigt sind auch hier Lothringen, Luxemburg, der Raum Trier und das Moseltal, außerdem das Elsass, die Pfalz und der Raum Mainz. Außerdem gehören dazu Karten der französischen Departements unseres Raumes von 1790 bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Aus der Schenkung historischer Karten hat das Landesarchiv eine Wanderausstellung erarbeitet, die bisher in Dillingen, Zweibrücken, Metz und Luxemburg gezeigt wurde.
Aus Anlass seines 100. Geburtstags präsentiert nun das Landesarchiv vom 30. Juli bis 31. August 2012 eine kleine Auswahl von ca. 30 Karten aus seiner Sammlung. Während der Öffnungszeiten (Montag - Freitag 8.30 - 16.00 Uhr) können die Karten im 3. Obergeschoss des Landesarchivs besichtigt werden.
Pressemitteilung v. 3.8.2012
Literatur zur Kartensammlung:

Ludwig Linsmayer (Hg.)
500 Jahre Saar-Lor-Lux
Die Kartensammlung Fritz Hellwig im Saarländischen Landesarchiv
(ECHOLOT. Historische Beiträge des Landesarchivs Saarbrücken. Quellen und Inventare 2. Herausgegeben im Auftrag der Vereinigung zur Förderung des Landesarchivs Saarbrücken)
Saarbrücken 2010
478 Seiten, Farbe
ISBN 978-3-9811672-4-5
Preis: 29,80 €
Link
#Veranstaltungen
Prof. Dr. Fritz Hellwig ist am 3. August 1912 in Saarbrücken geboren. Er hat sich 1936 mit einer Biografie des Hüttenbarons aus Neunkirchen Karl Ferdinand Freiherrn von Stumm-Halberg habilitiert. Vor dem Zweiten Weltkrieg war er Mitarbeiter der Handelskammer Saarbrücken. Nach dem Weltkrieg war er 1953 bis 1959 Mitglied des Deutschen Bundestages und 1967 bis 1970 einer von fünf Vizepräsidenten der Europäischen Gemeinschaften in Brüssel. Bereits während seiner europaweiten Tätigkeiten sammelte er alte Landkarten, Stiche von Personen und Orten, sonstige Archivalien und alte Bücher, die seine weitere Heimat links des Rheins betrafen. Aufgrund seiner späteren Lehrtätigkeit ernannte ihn die Universität Trier 1990 zum Honorarprofessor für regionale Wirtschaftsgeographie und Kartographie.
Seit den 1990er Jahren erweist sich Prof. Hellwig als Mäzen des Saarlandes, indem er dem Landesarchiv und der Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek Teile seiner Sammlungen schenkt. Unter anderem hat das Landesarchiv Saarbrücken 2002 eine Porträtsammlung mit ca. 320 Stichen und Drucken aus der Zeit von 1550 bis 1816 erhalten. Die Sammlung enthält Porträts von Landesherren (Trier, Pfalz, Lothringen), Staatsmännern und Beamten, Feldherrn und Militärs des Kaisers, aus Preußen, den Niederlanden und Schweden, von Geistlichen und Theologen, Wissenschaftlern und Künstlern. 2010 hat er dem Landesarchiv 1.175 Ortsansichten des Saartales, Lothringens – darunter zahlreiche Ansichten von Nancy – des Elsass, der Region Trier und des Moseltales, vom Mittelrhein und vom Nahetal, von Mainz und von der Pfalz geschenkt, auch Bilddrucke aus dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71. Die größte Schenkung vom Juli 2008 enthielt eine bedeutende Kartensammlung zum Saarland und den es umgebenden Regionen. Die übergebenen 846 Karten und Pläne stammen aus der Zeit von den Anfängen der Kartographie im 16. Jahrhundert bis zum 20. Jahrhundert. Sie stellen einen Raum dar, der sich vom Oberlauf des Rheins bis in die Niederlande, von Württemberg bis nach Lothringen erstreckt. Besonders berücksichtigt sind auch hier Lothringen, Luxemburg, der Raum Trier und das Moseltal, außerdem das Elsass, die Pfalz und der Raum Mainz. Außerdem gehören dazu Karten der französischen Departements unseres Raumes von 1790 bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Aus der Schenkung historischer Karten hat das Landesarchiv eine Wanderausstellung erarbeitet, die bisher in Dillingen, Zweibrücken, Metz und Luxemburg gezeigt wurde.
Aus Anlass seines 100. Geburtstags präsentiert nun das Landesarchiv vom 30. Juli bis 31. August 2012 eine kleine Auswahl von ca. 30 Karten aus seiner Sammlung. Während der Öffnungszeiten (Montag - Freitag 8.30 - 16.00 Uhr) können die Karten im 3. Obergeschoss des Landesarchivs besichtigt werden.
Pressemitteilung v. 3.8.2012
Literatur zur Kartensammlung:

Ludwig Linsmayer (Hg.)
500 Jahre Saar-Lor-Lux
Die Kartensammlung Fritz Hellwig im Saarländischen Landesarchiv
(ECHOLOT. Historische Beiträge des Landesarchivs Saarbrücken. Quellen und Inventare 2. Herausgegeben im Auftrag der Vereinigung zur Förderung des Landesarchivs Saarbrücken)
Saarbrücken 2010
478 Seiten, Farbe
ISBN 978-3-9811672-4-5
Preis: 29,80 €
Link
#Veranstaltungen
Wolf Thomas - am Sonntag, 5. August 2012, 14:07 - Rubrik: Karten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

AUFSÄTZE
Ulrich S. Soénius, Ein Erfinder und sein Nachlass. Theorie und Praxis der Nachlassbildung am Beispiel des Unternehmers Nicolaus August Otto (1832–1891) (60-68) PDF
Yuko Matsuzaki, Bijinesu Akaibuzu: Recent Events and Professional Conditions in Japanese Business Archives (69-75) PDF
Bernhard Ebneth, Die Neue Deutsche Biographie (NDB): Vom Lexikon zum Online-Informationssystem (76-84)
BERICHTE
Kai Bosecker, „Wind of Change“ – Wirtschaftsarchive in Transformationsprozessen. Arbeitstagung der Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e. V. vom 6.–8. Mai 2012 in Leipzig (84-88) PDF
Timo Gruber, 45. Jahrestagung des Arbeitskreises der Chemiearchivare innerhalb der VdW vom 13. bis 14. November 2011 in Hanau (88-89)
Andreas Knura und Kai Franke, Archivrecht für Wirtschaftsarchivare: Sensibilisierung – Orientierung – Professionalisierung. 73. VdW Lehrgang vom 6. bis 9. November 2011 in Heidelberg (90-91)
Evelyne Mosset, OS-Tool: Instrument zur Erstellung eines Ordnungssystems (92-95)
REZENSIONEN
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung (Hrsg.), Krupp – Fotografien aus zwei Jahrhunderten (Michael Klein) (95-96)
Johannes Bähr und Bernd Rudolph, 1931 Finanzkrisen 2008, hrsg. v. d. Eugen-Gutmann-Gesellschaft e. V. (Volker Beckmann) (96-98)
Alexandra Lutz (Hrsg.), Zwischen analog und digital – Schriftgutverwaltung als Herausforderung für Archive. Beiträge zum 13. Archivwissenschaftlichen Kolloquium der Archivschule Marburg (Manfred Witt) (98-99)
Clemens Rehm und Nicole Bickhoff (Hrsg.), Rechtsfragen der Nutzung von Archivgut. Vorträge der Frühjahrstagung der Fachgruppe 1 – Staatliche Archive – im VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V. am 29. April 2010 in Stuttgart (Frank Becker) (100-101)
Hans-Christoph Seidel, Der Ruhrbergbau im Zweiten Weltkrieg. Zechen – Bergarbeiter – Zwangsarbeiter (Stefan Przigoda) (101-104)
NACHRICHTEN
Dr. Carl Anton Reichling 90 Jahre alt (Klara van Eyll) (108-109)
NACHRUF
Nachruf Dr. Evelyn Kroker (Michael Farrenkopf und Renate Köhne-Lindenlaub) (105-108) PDF
Rezensionsliste (109-110)
Impressum (112)
Wolf Thomas - am Sonntag, 5. August 2012, 13:59 - Rubrik: Wirtschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Dies lässt das Welt-Artikelchen "BStU" - das Stasi-Archiv für die Bürger" vermuten, das mehr oder weniger nur folgendes Zitat des aktuellen Behördenleiters enthält:
"Es darf nicht sein, dass diejenigen, die mehr als 20 Jahre ihre Mitarbeit für das Ministerium für Staatssicherheit verschwiegen haben, weiter Karriere machen und so für ihr Lügen belohnt werden. Ich stehe für eine differenzierte Bewertung von DDR-Biographien, doch dazu müssen die Karten auf den Tisch. Noch immer bekennen sich die Täter der Diktatur unzureichend zu ihrer Verantwortung. Noch immer leugnen sie ihr menschenrechtswidriges Handeln. Noch immer verklären sie die Verhältnisse in der DDR.
Umso wichtiger ist es, dass wir die Akten der Staatssicherheit, die aufzeigen, wie die Machtinstrumente der Diktatur wirkten, in einem gut funktionierenden Archiv für immer zur Verfügung haben."
Ein sehr wichtiges Archiv - ohne Zweifel. Ein Archiv von Bürger gesichert - sicherlich. Aber: ein Archiv für die Bürger? Wohl noch nicht! Denn was ein Bürgerarchiv sein könnte, hat Klaus Graf hier beschrieben.
"Es darf nicht sein, dass diejenigen, die mehr als 20 Jahre ihre Mitarbeit für das Ministerium für Staatssicherheit verschwiegen haben, weiter Karriere machen und so für ihr Lügen belohnt werden. Ich stehe für eine differenzierte Bewertung von DDR-Biographien, doch dazu müssen die Karten auf den Tisch. Noch immer bekennen sich die Täter der Diktatur unzureichend zu ihrer Verantwortung. Noch immer leugnen sie ihr menschenrechtswidriges Handeln. Noch immer verklären sie die Verhältnisse in der DDR.
Umso wichtiger ist es, dass wir die Akten der Staatssicherheit, die aufzeigen, wie die Machtinstrumente der Diktatur wirkten, in einem gut funktionierenden Archiv für immer zur Verfügung haben."
Ein sehr wichtiges Archiv - ohne Zweifel. Ein Archiv von Bürger gesichert - sicherlich. Aber: ein Archiv für die Bürger? Wohl noch nicht! Denn was ein Bürgerarchiv sein könnte, hat Klaus Graf hier beschrieben.
Wolf Thomas - am Sonntag, 5. August 2012, 13:45 - Rubrik: Staatsarchive
Link zum PDF-Download
INHALT
Editorial 237
Aufsätze 238
Köln – Stadt der Archive 238
Angelika Menne-Haritz: Archivgut in digitalen Bibliotheken 248
Wolfgang Ernst: Bruchstellen. Die Eigenart von Archiven im Verbund von Gedächtnisagenturen und Speichertechnologien 258
Henning Steinführer: Kompetenter Ansprechpartner für Stadtgeschichte und Archivberatung. Das Stadtarchiv Braunschweig im Kontext historischer Informationsdienstleister 264
Interviews 270
Die Bedeutung der Archive als historische Informationsdienstleister
– Gespräch mit Annika Wellmann-Stühring 270
– Gespräch mit Thomas Mergel 275
Archivtheorie und praxis 281
Lange Zeit ein geheimer Ort: Das russische staatliche Militärarchiv in Moskau . Die Beratung der Behörden bei der Verwaltung
und Sicherung ihrer Unterlagen . Die Evaluierung des Politischen Archivs im Auswärtigen Amt durch die FH Potsdam . In den
Niederlanden fusionieren Königliche Bibliothek und Nationalarchiv
Tagungsberichte 293
Webarchivierung . Nachlässe in Archiven . 74. Fachtagung rheinland-pfälzischer und saarländischer Archivarinnen und
Archivare . Grenzüberschreitende Migration und Archive. Internationales Archivsymposion in Luxemburg . Zweites mitteleuropäisches Archivarstreffen
Literaturberichte 306
Mitteilungen und Beiträge des VdA 328
Novellierung des Bundesarchivgesetzes 328
Call for Papers. 83. Deutscher Archivtag Saarbrücken 2013 333
Personalnachrichten 335
Nachrufe 339
Kurzinformationen und Verschiedenes 341
Vorschau/Impressum 342
INHALT
Editorial 237
Aufsätze 238
Köln – Stadt der Archive 238
Angelika Menne-Haritz: Archivgut in digitalen Bibliotheken 248
Wolfgang Ernst: Bruchstellen. Die Eigenart von Archiven im Verbund von Gedächtnisagenturen und Speichertechnologien 258
Henning Steinführer: Kompetenter Ansprechpartner für Stadtgeschichte und Archivberatung. Das Stadtarchiv Braunschweig im Kontext historischer Informationsdienstleister 264
Interviews 270
Die Bedeutung der Archive als historische Informationsdienstleister
– Gespräch mit Annika Wellmann-Stühring 270
– Gespräch mit Thomas Mergel 275
Archivtheorie und praxis 281
Lange Zeit ein geheimer Ort: Das russische staatliche Militärarchiv in Moskau . Die Beratung der Behörden bei der Verwaltung
und Sicherung ihrer Unterlagen . Die Evaluierung des Politischen Archivs im Auswärtigen Amt durch die FH Potsdam . In den
Niederlanden fusionieren Königliche Bibliothek und Nationalarchiv
Tagungsberichte 293
Webarchivierung . Nachlässe in Archiven . 74. Fachtagung rheinland-pfälzischer und saarländischer Archivarinnen und
Archivare . Grenzüberschreitende Migration und Archive. Internationales Archivsymposion in Luxemburg . Zweites mitteleuropäisches Archivarstreffen
Literaturberichte 306
Mitteilungen und Beiträge des VdA 328
Novellierung des Bundesarchivgesetzes 328
Call for Papers. 83. Deutscher Archivtag Saarbrücken 2013 333
Personalnachrichten 335
Nachrufe 339
Kurzinformationen und Verschiedenes 341
Vorschau/Impressum 342
Wolf Thomas - am Sonntag, 5. August 2012, 13:38 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Mir liegt eine Fotokopie des Exemplars der WLB Stuttgart von den außerordentlich raren "Poetischen Versuchen" vor, die der spätere Publizist Johannes Scherr (geboren 1817 in Rechberg-Hinterweiler) 1835 bei den Gebrüdern Raach in Schwäbisch Gmünd drucken ließ.
Scherrs Jugendleben hat Anton Nägele in einer Artikelserie in den Gmünder Heimatblättern 1929/30 beleuchtet, ist aber auf den Gedichtband nur kurz eingegangen (Jg. 2, 1929, S. 80f., 92f.). Scherr schrieb bzw. veröffentlichte die Gedichte, als er während eines Fuß- und Augenleidens den Besuch des Ehinger Konvikts im Frühjahr 1835 unterbrechen musste (ebd., S. 80).
Scherr hat nicht nur in dem von Nägele erwähnten Gedicht "Fremdlings Heimkehr und Rückfahrt" (S. 58-60) auf seine Heimat mit Erwähnungen von Hohenstaufen und Rechberg Bezug genommen. Er schrieb auch ein Gedicht "Auf dem Hohenstauffen" (S. 71f.), das die Geschichte der Staufer zeittypisch in Verse fasst (zum Staufer-Mythos im 19. Jahrhundert: http://archiv.twoday.net/stories/6412734/ )
Drei weitere Gedichte aus dem Bändchen mit Heimatbezügen liegen online vor, da sie Bernhard Gaugele in sein Heimatbuch von 1910 aufgenommen hat, das digitalisiert auf Wikimedia Commons einzusehen ist:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Gaugele_Meiner_Heimat_T%C3%A4ler_und_H%C3%B6hen.djvu
Gaugele schließt sein Buch mit Scherrs Gedicht "Schwäbische Sage", das den Kyffhäuser-Barbarossa-Mythos am Hohenstaufen lokalisiert (Gaugele S. 144f.; Scherr S. 69-71).
Die "Sage vom Schloss Rechberg" (Scherr S. 51-54) ist bei Gaugele in zwei Teile zerschlagen (S. 40-42, 123f.). Erst in der Zeit um 1800 begegnet die Lokalisierung der angeblichen großen frühmittelalterlichen Christenschlacht ins Christental - eine Erfindung der "Schwäbischen Chronik" des Thomas Lirer - bei Nenningen.
Grundlegend zu dieser Überlieferung: Florian Henning Setzen, Geheimnisvolles Christental. Geschichtliches und Sagenhaftes um Burgruine Granegg und Reiterles-Kapelle, Donzdorf 1994, S. 12-26. Siehe auch Graf, Sagen der Schwäbischen Alb (2008), Nr. 212; Stütz, Sagen der Heimat (2011), Nr. 11 http://archiv.twoday.net/stories/16578482/
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/kirch.htm#t62
[ http://archiv.twoday.net/stories/120171638/ ]
Scherr konnte die Überlieferung aus den Werken des Pfarres Joseph Alois Rink kennen, aus der Gmünder Stadtgeschichte von 1802:
Wikisource
oder dem Aufsatz im Schwäbischen Taschenbuch auf das Jahr 1820:
Wikisource
2011 widmete sich eine Ausstellung der Schlacht von Waldstetten im Städtekrieg 1449 http://archiv.twoday.net/stories/31626557/. Gaugele bezieht sicher zu Recht Scherrs Gedicht "Die Jagd" (S. 55-58; mit anderer Versaufteilung bei Gaugele S. 22f.) auf diesen Konflikt. Ulrich von Rechberg, den Scherr anachronistisch als Graf bezeichnet, schlägt die Städter (der Name der Stadt Gmünd wird nicht genannt!), die in sein Gebiet eingefallen sind und auf einer Rast ihren Sieg feiern. Während der bürgerliche Zeitgeist damals die adeligen "Raubritter" schmähte, ergreift Scherr die Partei des Rechbergers und denunziert die Städter als Räuber.
Von der Schlacht bei Waldstetten konnte Scherr wieder durch Rinks Stadtgeschichte wissen, der auch Ulrich von Rechberg als Beteiligten nennt
Wikisource
"Deßwegen zogen die Gmünder durch die Haller verstärkt den 1. Sept. aus, und verbrannten zwey Rechbergische Schlösser, worunter das zu Waldstett war, und zündeten den Wald bey Rechberg an, nachdem sie zuvor die Bäume umgehauen hatten. Da sie sich aber sehr unordentlich zurückzogen, fiel ihnen Ulrich von Rechberg aus seiner Burg Rechberg in den Rücken, und unterstützt durch Graf Ulrich von Wirtemberg schlug er sie gänzlich zurück. Dabey wurden 54 getödtet, und 65 gefangen, die mit der wieder abgenommenen Beute nach Göppingen geführt wurden. Nach Steinhofer wurden über 100 erlegt, und über 150 gefangen."
Steinhofers Chronik (der sich auf Oswald Gabelkover stützt):
http://books.google.de/books?id=tn4AAAAAcAAJ&pg=PA913
Zur Schlacht von Waldstetten siehe
Wikisource mit weiteren Hinweisen
Weitere Heimat-Reminiszenzen Scherrs sind über
http://de.wikisource.org/wiki/Johannes_Scherr
zu erschließen: In den "Sagen aus Schwabenland" (1836) schuf Scherr eine einflussreiche eigene Fassung der Gmünder Ringsage, und 1883 erinnerte sich Scherr an das Gmünder Passionsspiel.
"Ein Priester" (1843) spielt in Rechberg, und das Buch beginnt mit einer Schilderung der Landschaft um den Hohenstaufen:
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10119086_00013.html
Nach Nägele (S. 69) bieten die Erzählungen "Der Wildschütz" (1838) und "Letzter Frühling eines Frühverwelkten" "ansprechende Bilder vom Hauptschauplatz Straßdorf und von der Burg Rechberg".
Nachtrag: Die Poetischen Versuche von 1835 sind jetzt online
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poetische_Versuche_(Scherr).pdf
#forschung

Scherrs Jugendleben hat Anton Nägele in einer Artikelserie in den Gmünder Heimatblättern 1929/30 beleuchtet, ist aber auf den Gedichtband nur kurz eingegangen (Jg. 2, 1929, S. 80f., 92f.). Scherr schrieb bzw. veröffentlichte die Gedichte, als er während eines Fuß- und Augenleidens den Besuch des Ehinger Konvikts im Frühjahr 1835 unterbrechen musste (ebd., S. 80).
Scherr hat nicht nur in dem von Nägele erwähnten Gedicht "Fremdlings Heimkehr und Rückfahrt" (S. 58-60) auf seine Heimat mit Erwähnungen von Hohenstaufen und Rechberg Bezug genommen. Er schrieb auch ein Gedicht "Auf dem Hohenstauffen" (S. 71f.), das die Geschichte der Staufer zeittypisch in Verse fasst (zum Staufer-Mythos im 19. Jahrhundert: http://archiv.twoday.net/stories/6412734/ )
Drei weitere Gedichte aus dem Bändchen mit Heimatbezügen liegen online vor, da sie Bernhard Gaugele in sein Heimatbuch von 1910 aufgenommen hat, das digitalisiert auf Wikimedia Commons einzusehen ist:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Gaugele_Meiner_Heimat_T%C3%A4ler_und_H%C3%B6hen.djvu
Gaugele schließt sein Buch mit Scherrs Gedicht "Schwäbische Sage", das den Kyffhäuser-Barbarossa-Mythos am Hohenstaufen lokalisiert (Gaugele S. 144f.; Scherr S. 69-71).
Die "Sage vom Schloss Rechberg" (Scherr S. 51-54) ist bei Gaugele in zwei Teile zerschlagen (S. 40-42, 123f.). Erst in der Zeit um 1800 begegnet die Lokalisierung der angeblichen großen frühmittelalterlichen Christenschlacht ins Christental - eine Erfindung der "Schwäbischen Chronik" des Thomas Lirer - bei Nenningen.
Grundlegend zu dieser Überlieferung: Florian Henning Setzen, Geheimnisvolles Christental. Geschichtliches und Sagenhaftes um Burgruine Granegg und Reiterles-Kapelle, Donzdorf 1994, S. 12-26. Siehe auch Graf, Sagen der Schwäbischen Alb (2008), Nr. 212; Stütz, Sagen der Heimat (2011), Nr. 11 http://archiv.twoday.net/stories/16578482/
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/kirch.htm#t62
[ http://archiv.twoday.net/stories/120171638/ ]
Scherr konnte die Überlieferung aus den Werken des Pfarres Joseph Alois Rink kennen, aus der Gmünder Stadtgeschichte von 1802:
Wikisource
oder dem Aufsatz im Schwäbischen Taschenbuch auf das Jahr 1820:
Wikisource
2011 widmete sich eine Ausstellung der Schlacht von Waldstetten im Städtekrieg 1449 http://archiv.twoday.net/stories/31626557/. Gaugele bezieht sicher zu Recht Scherrs Gedicht "Die Jagd" (S. 55-58; mit anderer Versaufteilung bei Gaugele S. 22f.) auf diesen Konflikt. Ulrich von Rechberg, den Scherr anachronistisch als Graf bezeichnet, schlägt die Städter (der Name der Stadt Gmünd wird nicht genannt!), die in sein Gebiet eingefallen sind und auf einer Rast ihren Sieg feiern. Während der bürgerliche Zeitgeist damals die adeligen "Raubritter" schmähte, ergreift Scherr die Partei des Rechbergers und denunziert die Städter als Räuber.
Von der Schlacht bei Waldstetten konnte Scherr wieder durch Rinks Stadtgeschichte wissen, der auch Ulrich von Rechberg als Beteiligten nennt
Wikisource
"Deßwegen zogen die Gmünder durch die Haller verstärkt den 1. Sept. aus, und verbrannten zwey Rechbergische Schlösser, worunter das zu Waldstett war, und zündeten den Wald bey Rechberg an, nachdem sie zuvor die Bäume umgehauen hatten. Da sie sich aber sehr unordentlich zurückzogen, fiel ihnen Ulrich von Rechberg aus seiner Burg Rechberg in den Rücken, und unterstützt durch Graf Ulrich von Wirtemberg schlug er sie gänzlich zurück. Dabey wurden 54 getödtet, und 65 gefangen, die mit der wieder abgenommenen Beute nach Göppingen geführt wurden. Nach Steinhofer wurden über 100 erlegt, und über 150 gefangen."
Steinhofers Chronik (der sich auf Oswald Gabelkover stützt):
http://books.google.de/books?id=tn4AAAAAcAAJ&pg=PA913
Zur Schlacht von Waldstetten siehe
Wikisource mit weiteren Hinweisen
Weitere Heimat-Reminiszenzen Scherrs sind über
http://de.wikisource.org/wiki/Johannes_Scherr
zu erschließen: In den "Sagen aus Schwabenland" (1836) schuf Scherr eine einflussreiche eigene Fassung der Gmünder Ringsage, und 1883 erinnerte sich Scherr an das Gmünder Passionsspiel.
"Ein Priester" (1843) spielt in Rechberg, und das Buch beginnt mit einer Schilderung der Landschaft um den Hohenstaufen:
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10119086_00013.html
Nach Nägele (S. 69) bieten die Erzählungen "Der Wildschütz" (1838) und "Letzter Frühling eines Frühverwelkten" "ansprechende Bilder vom Hauptschauplatz Straßdorf und von der Burg Rechberg".
Nachtrag: Die Poetischen Versuche von 1835 sind jetzt online
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poetische_Versuche_(Scherr).pdf
#forschung

KlausGraf - am Samstag, 4. August 2012, 22:52 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Falls jemand 45.000 Euro übrig hat, erhält er im Nachverkauf eine Schedel-Chronik von 1496:
http://194.25.171.19/bassenge/de/lose.asp?c=C&f=624&lot=656&DET=1
Provenienz: "Aus den Bibliotheken von Jacob Stoltenberg ("ex donatione Jacobi Stoltenbergius") und dem Mailänder Museo Cavaleri (Stempel) sowie mit dem gestochenen Exlibris der Elisabeth Sophie Maria Herzogin von Braunschweig-Lüneburg (1683-1767)
Der hübsche zeitgenössische Einband aus einer Leipziger Werkstatt eines Meisters mit dem Kennzeichen "Laubstab frei IV", der zwischen 1483 und 1506 tätig war (vgl. Kyriss 106). Die Einbanddecken sind mit dreifachen Fileten und breiten Akanthubordüren ("Steigbügelornament") in rechteckige Spiegelfelder geteilt, die mit geschwungenen Rauten und Blütenstempeln gefüllt sind. In den Bordüreecken erscheinen große, über die Fileten geprägte Rosetten. Auf dem Vorderdeckel über der Bordüre ist in großen gotischen Lettern der Titel geprägt, von dem man noch gut das Wort "Chronica" lesen kann (teils Buchstabenverlust). "
***
http://194.25.171.19/bassenge/de/lose.asp?c=C&f=624&lot=650&DET=1
"Blatt 1 recto mit hs. Titel und Wappenstempel der "Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae" und überstempelt "Duplum venditum" sowie weiterer Stempelrasur sowie hinterlegten Löchlein, zweites Blatt oben mit Bibliotheksvermerk eines Benediktinerordens "Bibliothecae Lepoglavensis O. S. B." des 19. Jahrhunderts. "
Googeln kann man im noblen Auktionshaus offenbar nicht. In Lepoglava gab es kein Benediktiner, sondern ein Paulinerkloster:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lepoglava
***
http://194.25.171.19/bassenge/de/lose.asp?c=C&f=624&lot=657&DET=1
"Aristotelische Naturwissenschaft und Metaphysik. Sammelband mit 2 Inkunabeln und 3 Postinkunabeln aus dem Besitz des Wiener Humanisten Ambrosius Saltzer. Format: 31 x 20,8 cm. Mit zahlreichen Holzschnittinitialen. Holzdeckelband d. Z. (etwas beschabt, leicht bestoßen und gering fleckig) mit breitem blindgeprägtem Schweinslederrücken und 2 erneuerten Messingschließen. 1497-1507.
Vom Herausgeber eines Wiener Aristoteles-Kommentars Ambrosius Saltzer (1476-1568) zusammengesetzter und eigenhändig durchgearbeiteter Sammelband als Handexemplar. Im vorderen Innendeckel der zeitgenössische Besitzvermerk "Liber magistri Ambrosii Saltzer" sowie das Monogramm Saltzers. Er gehörte gemeinsam mit Tannstetter, Gundel, Spiegel und Celtis zu den Mitgliedern des Wiener Humanistenkreises um Kaiser Maximilian I. In Wiens Buchdruckergeschichte zählt Mayer "den Domherrn Ambros Saltzer" zu den wenigen angesehenen Mitgliedern desselben, die noch weit in die Zeit Kaiser Ferdinands hineinwirkten. Ausführlich über Saltzers Biographie informiert ein in dessen Todesjahr bei Kaspar Stainhofer erschienener Nachruf auf den angesehenen Gelehrten (Johannes Katz, Oratio recitata idibus Junii in funere Ambrosii Salzeri qui mortem obiit Viennae Austriae 1568 3 Idus Junias. Wien 1568).
"Die Mehrzahl dieser Männer, welche den Maximilian'schen Humanistenkreis bildeten … haben die Wiener Buchdruckerpressen wenn nicht ausschließlich, doch vielfach beschäftigt und standen mit Winterburger, Vietor und Singriener auf vertrautem Fuße. Bildung und Wissen, die im klassischen Alterthume wurzeln, kennzeichnen die von ihnen commentierten Classiker oder selbstverfassten Schriften…" (Mayer I, 162).
Bei dem vorliegenden Sammelband handelt es sich um das von Saltzer selbst zuammen gestellte und annotierte Arbeitsexemplar zu ebendieser Edition. Bemerkenswert ist, dass bereits die Vereinigung dieser fünf Drucke zu einem Band auf Saltzer zurückgeht, wurden die fünf venezianischen Drucke doch nicht - wie es der bei allen identische Druckort nahe legen würde - in Oberitalien gebunden. Das für den schönen Einband verwendete Vorsatzpapier (WZ: Krone mit zweikonturigem Bügel und Herstellermarke "3b") fand laut Picard (I, XIII, 16) ausschließlich in der Kanzlei Kaiser Maximilians I. in den Jahren 1512 bis 1516 Verwendung.
Die in der Vietor-Ausgabe von 1514 behandelten "libri Metheorum" des Aristoteles finden sich im vorliegenden Sammelband in einer Ausgabe von 1507 (IV), weiters die editio princeps des bedeutenden Metaphysik-Kommentars des Scholastikers Duns Scotus und drei Werke des Antonio Trombetta zur Naturwissenschaft und Metaphysik (davon eine Ausgabe bibliographisch nicht nachweisbar). Enthalten sind die Drucke:
I. Johannes Duns Scotus. Quaestiones in Aristotelis Metaphysica etc. 132 nn. Bl. (le. w.), 2 Spalten.66-67 Zeilen. Got. Typ. Mit zahlreichen, teils figürlichen Initialen und Holzschnitt-Druckermarke. Venedig, Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 20. XI. 1497. - Hain-Copinger 6450. GW 9065. Goff D-372. BMC V, 448. BSB-Ink D-298. ISTC id00372000. Erste Ausgabe. Das Druckprivileg für diese Ausgabe erhielt Locatellus am 19. April des Jahres. Dieser Kommentar zur aristotelische Metaphysik ist eines der Hauptwerke des franziskanischen Scholastikers, der aufgrund seiner scharfsinnigen wissenschaftstheoretischen Argumentation den Beinamen "doctor subtilis" erhielt.
II. Antonio Trombetta. Opus in Metaphysicam Aristotelis. 112 nn. Bl. mit zahlreichen Holzschnitt-Initialen und Holzschnitt-Druckermarke. Ebenda 5. Februar 1502. - Nicht bei Adams, Panzer, im STC und NUC. Vgl. nur STC, der eine 1504 gedruckte Ausgabe bei J. Pentius verzeichnet. Umfangreiches Werk des 1518 gestorbenen Erzbischofs von Athen und Bischofs von Urbino, der an der Universität in Padua 42 Jahre lang Metaphysik lehrte. Trombetta gilt als einer der herausragendsten Vertreter des Scotismus im 16. Jahrhundert. - Außergewöhnlich seltener Druck.
III. Derselbe. Tractatus singularis contra Averoystas de humanarum animarum plurificatione. 32 nn. Bl. (le. w.). Mit 39 Holzschnitt-Initialen und Holzschnitt-Druckermarke. Ebenda 25. X. 1498. - Hain-Copinger 15646. GW 47624. Goff T-461. BMC V 451. BSB-Ink T-469. ISTC it00461000. Philosophisches Werk über die Vielgestaltigkeit des menschlichen Geistes und Seelenlebens. Die Angriffe gegen die Averroisten richteten sich gegen verschiedene aristotelische Schulen, die die Unsterblichkeit der Seele infrage stellten. Ähnlich wie Trombetta und die Scotisten schieden sie die ratio scharf von der fides. In den Naturwissenschaften verteidigten sie das aristotelische System.
IV. Aristoteles. Libri meteororum. Tractatum de reactione. Et tractatu de intensione et remissione eiusdem Gaietani. 2 Teile. 70; 61 (recte 55) num., 1 w. Bl. Mit 15 schematischen Textholzschnitten, zahlreichen figürlichen und ornamentalen Initialen und Holzschnitt-Druckermarke. Ebenda, 1. Dezember 1507. - STC 47. Isaac 12.477. Hoffmann I, 320. Erste Einzelausgabe des 16. Jahrhundets. Der vorliegenden Ausgabe beigegeben sind die erstmals 1491 gedruckten Kommentare des heiligen Gaetano di Tiene (gest. 1547), des Gründers des Theatinerordens (vgl. Stillwell V, 756-57).
V. Antonio Trombetta. In tractatu formalitatum Scoti sententia. Formalitates Antonii syreti de mente eiusdem Scoti. 32 num. Bl. Mit zahlreichen, teils figürlichen Initialen in Holzschnitt. Venedig, o. Dr. (d. i. J. Pentius), 22. April 1505. - STC 683. Adams T-997. Issac 12.930. Die Druckerzuschreibung laut STC, editorisch betreut wurde die vorliegende Ausgabe von M. O'Fihely.
Alle Titel mit eigenhändigen Marginalien Saltzers (passim), stellenweise im weißen Rand etwas fleckig, einige Blätter in Teil V mit Wasserrand, kaum Papierläsuren oder sonstige Gebrauchsspuren, insgesamt ein nahezu tadellos erhaltener Sammelband mit den originalen Blattweisern aus Pergament. Prachtvoll gebunden.
Trillenium 87078"
***
http://194.25.171.19/bassenge/de/lose.asp?c=C&f=624&lot=647&DET=1
Speculum exemplorum. Strassburg 1487. ISTC is00653000
"Insgesamt sehr schönes Exemplar aus dem Besitz des Dominikanerkonvents St. Wenzeslaus in Eger mit deren hs. Besitzvermerk auf dem Titel in Sepia (17. Jahrhundert). Weiterhin ein Besitzvermerk von Graf Konrad Reuttner von Weyl (vgl. Bloomsbury Auktion am 31. Oktober 1985, Los 136). Interessant ist ein 8zeiliger Tischspruch in deutscher Sprache auf Blatt O6recto: "Eyn gesetz alh[ier] geschrieben steytt / Keyn paine, da hier in die herberg geyt / Es offent sich wider [= weder] pforte noch thor / Es stehe den[n] achilles, plato add [= oder] dyamedes vor / Das gesetz nu ist von andert / Her yn aller der in got[t]e kompt gewandert / Der nackend martin lazarus und jacoff pilgereyn /Allhie zum züge und zu tische wilkommen seyn" (ungefähre Transkription mit Fehlern)."
Wenn man schon fehlerhaft transkribiert, sollte man ein Bild des Eintrags spendieren!
Zur Familie Reuttner:
www.reuttner.de/
***
http://194.25.171.19/bassenge/de/lose.asp?c=C&f=624&lot=625&DET=1
"Jodocus Erfordensis. Vocabularius utriusque iuris. 310 nn. Bl. (das erste weiß). 34 Zeilen. Got. Typ. Schriftraum: 20,6 x 12,1 cm. Format: 29 x 20,5 cm. Mit Initialspatien. Blindgeprägter Kalbslederband d. Z. (geschwärzt, mit kleinen Fehlstellen, winzigem Ausbruch im Rücken, unsichtbar restauriert) über schweren Holzdeckeln mit 4 Schließbeschlägen (ohne die Bügel) sowie mit 4 alten und älteren Titel- bzw. Bibliothekschildern. Basel, Michael Wenssler, um 1473.
Copinger 6354. GW 12628. Goff V-335. Proctor 7477. Pellechet 11758. Borm 1501. Collijn 1501. Deckert 691. Günther 424. Hubay 2128. Kaufmann-Nabholz 160. Madsen 4202. Nentwig 397. Ohly-Sack 3004. Rhodes 1836. Sack 3710. Scheidegger-Tammaro 789. Walsh 1113. BMC III, 722. BSB-Ink I-256. CIBN V-277. IBP 5695. IDL 4691. IGI 10354. ISTC iv00335000. Zweite Ausgabe eines der beliebtesten juristischen Werke des 15. Jahrhunderts über das kanonische wie das zivile Recht, die Wensslers undatiertem Druck aus der Zeit vor 1473 (GW 12628. Reichling 1920. Goff V-334) folgt und daher wohl in das Jahr 1473 datiert werden kann (ISTC hält auch 1474 für möglich). Ein Exemplar der Bayerischen Staatsbibliothek enthält einen Kaufvermerk des Jahre 1474 als terminus ante quem. Der BMC erwähnt Satzvarianten, hier etwa "dictorum" in der ersten Zeile auf 16/4r und "siue" auf 28/3r.
Die ersten und letzten Blätter mit kleinen Wurmgängen im weißen Rand, minimaler Textabklatsch, im Block leicht wellig, aber nur ganz vereinzelt fleckig sowie ein unbedeutender Wasserrand von unten, insgesamt in prachtvoller, bester Erhaltung. Der auffällig wohlerhaltene, sehr schöne und feste zeitgenössische Einband zeigt dreifache Blindfileten-Verzierung mit großen Rosen- und kleinen Lilien- und Blütenstempeln sowie dem gestempelten Schriftband "laus deo" auf beiden Deckeln. Aus der Bibliothek eines "Ulricus Wenger" mit dessen zeitgenössischem hs. Besitzvermerk oben am Textanfang und einem weiteren, etwas späteren Eintrag des 17. Jahrhunderts des Augustiner-Eremitenklosters zu Memmingen. Das Exemplar stammt aus der Hofbibliothek der Prinzen von Fürstenberg, Donaueschingen (vgl. Sotheby's London, 1. Juli 1994, Los 321). "
***
http://194.25.171.19/bassenge/de/lose.asp?c=C&f=624&lot=641&DET=1
Nicht jeder Inkunabelsammler hat Geschmack:
"Vorsatz mit Einträgen, Innenspiegel mit Pergamentbezug (teils lädiert), erste Textseite mit unschönem Exlibris-Blindstempel von Detlev Mauss, wenige Initialen etwas abgeklatscht, leicht fleckig und nur mit wenigen winzigen Papierläsuren, Gebrauchsspuren. "
Vgl. dazu:
http://web.archive.org/web/20070610094419/http://members.aol.com/Fust16843/Homepage/
Danach kommt der Akt der Eigentums- und Besitzergreifung. Ich habe mir einen Trocken-Prägestempel schneiden lassen in runder Form, dessen Unterschrift lautet: "Ex bibliotheca Dr. Mauss", in der Mitte des Kreises habe ich das Allianz-Wappen von Fust & Schöffer schneiden lassen. Ich habe Dr. Staub, Hessische LHB Darmstadt, um Rat gefragt, ob ich das denn dürfe, und seine wohlwollende Zustimmung erhalten. Wenn man bedenkt, daß die Bibliotheque Nationale de Paris ungehemmt ihren fetten roten Stempel in die Evangelistenhäupter einer Handschrift aus dem 12. Jahrhundert hineindonnern, dann darf wohl auch ich meinen unauffälligen Prägestempel in ein leeres Blatt meiner Inkunabel pressen.
http://194.25.171.19/bassenge/de/lose.asp?c=C&f=624&lot=656&DET=1
Provenienz: "Aus den Bibliotheken von Jacob Stoltenberg ("ex donatione Jacobi Stoltenbergius") und dem Mailänder Museo Cavaleri (Stempel) sowie mit dem gestochenen Exlibris der Elisabeth Sophie Maria Herzogin von Braunschweig-Lüneburg (1683-1767)
Der hübsche zeitgenössische Einband aus einer Leipziger Werkstatt eines Meisters mit dem Kennzeichen "Laubstab frei IV", der zwischen 1483 und 1506 tätig war (vgl. Kyriss 106). Die Einbanddecken sind mit dreifachen Fileten und breiten Akanthubordüren ("Steigbügelornament") in rechteckige Spiegelfelder geteilt, die mit geschwungenen Rauten und Blütenstempeln gefüllt sind. In den Bordüreecken erscheinen große, über die Fileten geprägte Rosetten. Auf dem Vorderdeckel über der Bordüre ist in großen gotischen Lettern der Titel geprägt, von dem man noch gut das Wort "Chronica" lesen kann (teils Buchstabenverlust). "
***
http://194.25.171.19/bassenge/de/lose.asp?c=C&f=624&lot=650&DET=1
"Blatt 1 recto mit hs. Titel und Wappenstempel der "Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae" und überstempelt "Duplum venditum" sowie weiterer Stempelrasur sowie hinterlegten Löchlein, zweites Blatt oben mit Bibliotheksvermerk eines Benediktinerordens "Bibliothecae Lepoglavensis O. S. B." des 19. Jahrhunderts. "
Googeln kann man im noblen Auktionshaus offenbar nicht. In Lepoglava gab es kein Benediktiner, sondern ein Paulinerkloster:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lepoglava
***
http://194.25.171.19/bassenge/de/lose.asp?c=C&f=624&lot=657&DET=1
"Aristotelische Naturwissenschaft und Metaphysik. Sammelband mit 2 Inkunabeln und 3 Postinkunabeln aus dem Besitz des Wiener Humanisten Ambrosius Saltzer. Format: 31 x 20,8 cm. Mit zahlreichen Holzschnittinitialen. Holzdeckelband d. Z. (etwas beschabt, leicht bestoßen und gering fleckig) mit breitem blindgeprägtem Schweinslederrücken und 2 erneuerten Messingschließen. 1497-1507.
Vom Herausgeber eines Wiener Aristoteles-Kommentars Ambrosius Saltzer (1476-1568) zusammengesetzter und eigenhändig durchgearbeiteter Sammelband als Handexemplar. Im vorderen Innendeckel der zeitgenössische Besitzvermerk "Liber magistri Ambrosii Saltzer" sowie das Monogramm Saltzers. Er gehörte gemeinsam mit Tannstetter, Gundel, Spiegel und Celtis zu den Mitgliedern des Wiener Humanistenkreises um Kaiser Maximilian I. In Wiens Buchdruckergeschichte zählt Mayer "den Domherrn Ambros Saltzer" zu den wenigen angesehenen Mitgliedern desselben, die noch weit in die Zeit Kaiser Ferdinands hineinwirkten. Ausführlich über Saltzers Biographie informiert ein in dessen Todesjahr bei Kaspar Stainhofer erschienener Nachruf auf den angesehenen Gelehrten (Johannes Katz, Oratio recitata idibus Junii in funere Ambrosii Salzeri qui mortem obiit Viennae Austriae 1568 3 Idus Junias. Wien 1568).
"Die Mehrzahl dieser Männer, welche den Maximilian'schen Humanistenkreis bildeten … haben die Wiener Buchdruckerpressen wenn nicht ausschließlich, doch vielfach beschäftigt und standen mit Winterburger, Vietor und Singriener auf vertrautem Fuße. Bildung und Wissen, die im klassischen Alterthume wurzeln, kennzeichnen die von ihnen commentierten Classiker oder selbstverfassten Schriften…" (Mayer I, 162).
Bei dem vorliegenden Sammelband handelt es sich um das von Saltzer selbst zuammen gestellte und annotierte Arbeitsexemplar zu ebendieser Edition. Bemerkenswert ist, dass bereits die Vereinigung dieser fünf Drucke zu einem Band auf Saltzer zurückgeht, wurden die fünf venezianischen Drucke doch nicht - wie es der bei allen identische Druckort nahe legen würde - in Oberitalien gebunden. Das für den schönen Einband verwendete Vorsatzpapier (WZ: Krone mit zweikonturigem Bügel und Herstellermarke "3b") fand laut Picard (I, XIII, 16) ausschließlich in der Kanzlei Kaiser Maximilians I. in den Jahren 1512 bis 1516 Verwendung.
Die in der Vietor-Ausgabe von 1514 behandelten "libri Metheorum" des Aristoteles finden sich im vorliegenden Sammelband in einer Ausgabe von 1507 (IV), weiters die editio princeps des bedeutenden Metaphysik-Kommentars des Scholastikers Duns Scotus und drei Werke des Antonio Trombetta zur Naturwissenschaft und Metaphysik (davon eine Ausgabe bibliographisch nicht nachweisbar). Enthalten sind die Drucke:
I. Johannes Duns Scotus. Quaestiones in Aristotelis Metaphysica etc. 132 nn. Bl. (le. w.), 2 Spalten.66-67 Zeilen. Got. Typ. Mit zahlreichen, teils figürlichen Initialen und Holzschnitt-Druckermarke. Venedig, Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 20. XI. 1497. - Hain-Copinger 6450. GW 9065. Goff D-372. BMC V, 448. BSB-Ink D-298. ISTC id00372000. Erste Ausgabe. Das Druckprivileg für diese Ausgabe erhielt Locatellus am 19. April des Jahres. Dieser Kommentar zur aristotelische Metaphysik ist eines der Hauptwerke des franziskanischen Scholastikers, der aufgrund seiner scharfsinnigen wissenschaftstheoretischen Argumentation den Beinamen "doctor subtilis" erhielt.
II. Antonio Trombetta. Opus in Metaphysicam Aristotelis. 112 nn. Bl. mit zahlreichen Holzschnitt-Initialen und Holzschnitt-Druckermarke. Ebenda 5. Februar 1502. - Nicht bei Adams, Panzer, im STC und NUC. Vgl. nur STC, der eine 1504 gedruckte Ausgabe bei J. Pentius verzeichnet. Umfangreiches Werk des 1518 gestorbenen Erzbischofs von Athen und Bischofs von Urbino, der an der Universität in Padua 42 Jahre lang Metaphysik lehrte. Trombetta gilt als einer der herausragendsten Vertreter des Scotismus im 16. Jahrhundert. - Außergewöhnlich seltener Druck.
III. Derselbe. Tractatus singularis contra Averoystas de humanarum animarum plurificatione. 32 nn. Bl. (le. w.). Mit 39 Holzschnitt-Initialen und Holzschnitt-Druckermarke. Ebenda 25. X. 1498. - Hain-Copinger 15646. GW 47624. Goff T-461. BMC V 451. BSB-Ink T-469. ISTC it00461000. Philosophisches Werk über die Vielgestaltigkeit des menschlichen Geistes und Seelenlebens. Die Angriffe gegen die Averroisten richteten sich gegen verschiedene aristotelische Schulen, die die Unsterblichkeit der Seele infrage stellten. Ähnlich wie Trombetta und die Scotisten schieden sie die ratio scharf von der fides. In den Naturwissenschaften verteidigten sie das aristotelische System.
IV. Aristoteles. Libri meteororum. Tractatum de reactione. Et tractatu de intensione et remissione eiusdem Gaietani. 2 Teile. 70; 61 (recte 55) num., 1 w. Bl. Mit 15 schematischen Textholzschnitten, zahlreichen figürlichen und ornamentalen Initialen und Holzschnitt-Druckermarke. Ebenda, 1. Dezember 1507. - STC 47. Isaac 12.477. Hoffmann I, 320. Erste Einzelausgabe des 16. Jahrhundets. Der vorliegenden Ausgabe beigegeben sind die erstmals 1491 gedruckten Kommentare des heiligen Gaetano di Tiene (gest. 1547), des Gründers des Theatinerordens (vgl. Stillwell V, 756-57).
V. Antonio Trombetta. In tractatu formalitatum Scoti sententia. Formalitates Antonii syreti de mente eiusdem Scoti. 32 num. Bl. Mit zahlreichen, teils figürlichen Initialen in Holzschnitt. Venedig, o. Dr. (d. i. J. Pentius), 22. April 1505. - STC 683. Adams T-997. Issac 12.930. Die Druckerzuschreibung laut STC, editorisch betreut wurde die vorliegende Ausgabe von M. O'Fihely.
Alle Titel mit eigenhändigen Marginalien Saltzers (passim), stellenweise im weißen Rand etwas fleckig, einige Blätter in Teil V mit Wasserrand, kaum Papierläsuren oder sonstige Gebrauchsspuren, insgesamt ein nahezu tadellos erhaltener Sammelband mit den originalen Blattweisern aus Pergament. Prachtvoll gebunden.
Trillenium 87078"
***
http://194.25.171.19/bassenge/de/lose.asp?c=C&f=624&lot=647&DET=1
Speculum exemplorum. Strassburg 1487. ISTC is00653000
"Insgesamt sehr schönes Exemplar aus dem Besitz des Dominikanerkonvents St. Wenzeslaus in Eger mit deren hs. Besitzvermerk auf dem Titel in Sepia (17. Jahrhundert). Weiterhin ein Besitzvermerk von Graf Konrad Reuttner von Weyl (vgl. Bloomsbury Auktion am 31. Oktober 1985, Los 136). Interessant ist ein 8zeiliger Tischspruch in deutscher Sprache auf Blatt O6recto: "Eyn gesetz alh[ier] geschrieben steytt / Keyn paine, da hier in die herberg geyt / Es offent sich wider [= weder] pforte noch thor / Es stehe den[n] achilles, plato add [= oder] dyamedes vor / Das gesetz nu ist von andert / Her yn aller der in got[t]e kompt gewandert / Der nackend martin lazarus und jacoff pilgereyn /Allhie zum züge und zu tische wilkommen seyn" (ungefähre Transkription mit Fehlern)."
Wenn man schon fehlerhaft transkribiert, sollte man ein Bild des Eintrags spendieren!
Zur Familie Reuttner:
www.reuttner.de/
***
http://194.25.171.19/bassenge/de/lose.asp?c=C&f=624&lot=625&DET=1
"Jodocus Erfordensis. Vocabularius utriusque iuris. 310 nn. Bl. (das erste weiß). 34 Zeilen. Got. Typ. Schriftraum: 20,6 x 12,1 cm. Format: 29 x 20,5 cm. Mit Initialspatien. Blindgeprägter Kalbslederband d. Z. (geschwärzt, mit kleinen Fehlstellen, winzigem Ausbruch im Rücken, unsichtbar restauriert) über schweren Holzdeckeln mit 4 Schließbeschlägen (ohne die Bügel) sowie mit 4 alten und älteren Titel- bzw. Bibliothekschildern. Basel, Michael Wenssler, um 1473.
Copinger 6354. GW 12628. Goff V-335. Proctor 7477. Pellechet 11758. Borm 1501. Collijn 1501. Deckert 691. Günther 424. Hubay 2128. Kaufmann-Nabholz 160. Madsen 4202. Nentwig 397. Ohly-Sack 3004. Rhodes 1836. Sack 3710. Scheidegger-Tammaro 789. Walsh 1113. BMC III, 722. BSB-Ink I-256. CIBN V-277. IBP 5695. IDL 4691. IGI 10354. ISTC iv00335000. Zweite Ausgabe eines der beliebtesten juristischen Werke des 15. Jahrhunderts über das kanonische wie das zivile Recht, die Wensslers undatiertem Druck aus der Zeit vor 1473 (GW 12628. Reichling 1920. Goff V-334) folgt und daher wohl in das Jahr 1473 datiert werden kann (ISTC hält auch 1474 für möglich). Ein Exemplar der Bayerischen Staatsbibliothek enthält einen Kaufvermerk des Jahre 1474 als terminus ante quem. Der BMC erwähnt Satzvarianten, hier etwa "dictorum" in der ersten Zeile auf 16/4r und "siue" auf 28/3r.
Die ersten und letzten Blätter mit kleinen Wurmgängen im weißen Rand, minimaler Textabklatsch, im Block leicht wellig, aber nur ganz vereinzelt fleckig sowie ein unbedeutender Wasserrand von unten, insgesamt in prachtvoller, bester Erhaltung. Der auffällig wohlerhaltene, sehr schöne und feste zeitgenössische Einband zeigt dreifache Blindfileten-Verzierung mit großen Rosen- und kleinen Lilien- und Blütenstempeln sowie dem gestempelten Schriftband "laus deo" auf beiden Deckeln. Aus der Bibliothek eines "Ulricus Wenger" mit dessen zeitgenössischem hs. Besitzvermerk oben am Textanfang und einem weiteren, etwas späteren Eintrag des 17. Jahrhunderts des Augustiner-Eremitenklosters zu Memmingen. Das Exemplar stammt aus der Hofbibliothek der Prinzen von Fürstenberg, Donaueschingen (vgl. Sotheby's London, 1. Juli 1994, Los 321). "
***
http://194.25.171.19/bassenge/de/lose.asp?c=C&f=624&lot=641&DET=1
Nicht jeder Inkunabelsammler hat Geschmack:
"Vorsatz mit Einträgen, Innenspiegel mit Pergamentbezug (teils lädiert), erste Textseite mit unschönem Exlibris-Blindstempel von Detlev Mauss, wenige Initialen etwas abgeklatscht, leicht fleckig und nur mit wenigen winzigen Papierläsuren, Gebrauchsspuren. "
Vgl. dazu:
http://web.archive.org/web/20070610094419/http://members.aol.com/Fust16843/Homepage/
Danach kommt der Akt der Eigentums- und Besitzergreifung. Ich habe mir einen Trocken-Prägestempel schneiden lassen in runder Form, dessen Unterschrift lautet: "Ex bibliotheca Dr. Mauss", in der Mitte des Kreises habe ich das Allianz-Wappen von Fust & Schöffer schneiden lassen. Ich habe Dr. Staub, Hessische LHB Darmstadt, um Rat gefragt, ob ich das denn dürfe, und seine wohlwollende Zustimmung erhalten. Wenn man bedenkt, daß die Bibliotheque Nationale de Paris ungehemmt ihren fetten roten Stempel in die Evangelistenhäupter einer Handschrift aus dem 12. Jahrhundert hineindonnern, dann darf wohl auch ich meinen unauffälligen Prägestempel in ein leeres Blatt meiner Inkunabel pressen.
Diverse Tondokumente aus den verschiedensten Bereichen stellt das Portal "Medienpädagogik und Medienkultur" des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg zur Verfügung:
http://www.mediaculture-online.de/Tonarchiv.804.0.html
http://www.mediaculture-online.de/Tonarchiv.804.0.html
KlausGraf - am Samstag, 4. August 2012, 16:49 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ausstellung in Wuppertal:
http://www.bella-italia-ausstellung.de/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bella_Italia_-_Fotografien_und_Gem%C3%A4lde_1815-1900

http://www.bella-italia-ausstellung.de/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bella_Italia_-_Fotografien_und_Gem%C3%A4lde_1815-1900

KlausGraf - am Samstag, 4. August 2012, 16:43 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Verband der italienischen Bibliotheken (Associazione Italiana Biblioteche [AIB]) spricht sich in entschiedener Weise gegen die in der Rechtsverordnung 95 (die sogenannte „spending review“ [Decreto legge 95]) vorgesehene Auflösung des Istituto centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi aus und möchte seiner großen Besorgnis hinsichtlich der Konsequenzen dieser Maßnahme selbst sowie der gewählten Vorgehensweise Ausdruck verleihen.
Das Institut, die ehemalige "Discoteca di stato”, sammelt und garantiert seit 1928 die Erhaltung von Tonträgern und audiovisuellen Quellen auf nationaler Ebene, die das nicht schriftliche historische Erbe unseres Landes darstellen. Diese völlig unerwartete und unvorbereitete Maßnahme, deren Motive wenig einsichtig sind, gefährdet die Erhaltung und den Schutz des nationalen kulturellen Erbes auf schwerwiegende Weise.
Der AIB weist seit vielen Jahren auf die Notwendigkeit einer Rationalisierung der Organisation der staatlichen Bibliotheken hin.
Die Auflösung einer Einrichtung wie des Istituto centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi – erklärt der Präsident des ABI, Stefano Parise – verbessert weder die Effizienz der staatlichen Institutionen noch trägt sie zur Sanierung des Staatshaushaltes bei. Es ist vielmehr eine wirkliche Rationalisierung und Umstrukturierung des Einsatzes von staatlichen Mitteln vonnöten, die den Notwendigkeiten der Gesamtstruktur des Bibliothekssystems auf nationaler Ebene Rechung trägt.
Der AIB bittet den Minister Ornaghi dringend um einen Gesprächstermin, um das Projekt für eine Biblioteca Nazionale d’Italia [Nationalbibliothek Italiens] vorzustellen, das die derzeitigen nationalen Zentralbibliotheken in Rom und Florenz, das Istituto Centrale per il Catalogo Unico [Zentralinstitut für den Einheitskatalog], das Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi und das Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario [Zentralinstitut für die Restaurierung und Erhaltung von Archiv- und Bücherbeständen] zusammenfassen würde. Dieser Biblioteca Nazionale d’Italia müsste wissenschaftliche, finanzielle und verwaltungstechnische Autonomie gewährt werden.
Ein Land ohne leistungsfähige Bibliotheken ist ein Land ohne Kenntnis und Bewusstsein seiner Vergangenheit und ohne Zukunft.
Rom, den 12. Juli 2012
(Translation: Christine Streubuehr, Deutsches Historisches Institut, Musikgeschichtliche Abteilung, Musickbibiothek, Rom)
Siehe auch
http://ilteatrodellamemoria.wordpress.com/2012/07/29/a-positive-result-of-the-mobilization-for-italian-sound-archives/
Das Institut, die ehemalige "Discoteca di stato”, sammelt und garantiert seit 1928 die Erhaltung von Tonträgern und audiovisuellen Quellen auf nationaler Ebene, die das nicht schriftliche historische Erbe unseres Landes darstellen. Diese völlig unerwartete und unvorbereitete Maßnahme, deren Motive wenig einsichtig sind, gefährdet die Erhaltung und den Schutz des nationalen kulturellen Erbes auf schwerwiegende Weise.
Der AIB weist seit vielen Jahren auf die Notwendigkeit einer Rationalisierung der Organisation der staatlichen Bibliotheken hin.
Die Auflösung einer Einrichtung wie des Istituto centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi – erklärt der Präsident des ABI, Stefano Parise – verbessert weder die Effizienz der staatlichen Institutionen noch trägt sie zur Sanierung des Staatshaushaltes bei. Es ist vielmehr eine wirkliche Rationalisierung und Umstrukturierung des Einsatzes von staatlichen Mitteln vonnöten, die den Notwendigkeiten der Gesamtstruktur des Bibliothekssystems auf nationaler Ebene Rechung trägt.
Der AIB bittet den Minister Ornaghi dringend um einen Gesprächstermin, um das Projekt für eine Biblioteca Nazionale d’Italia [Nationalbibliothek Italiens] vorzustellen, das die derzeitigen nationalen Zentralbibliotheken in Rom und Florenz, das Istituto Centrale per il Catalogo Unico [Zentralinstitut für den Einheitskatalog], das Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi und das Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario [Zentralinstitut für die Restaurierung und Erhaltung von Archiv- und Bücherbeständen] zusammenfassen würde. Dieser Biblioteca Nazionale d’Italia müsste wissenschaftliche, finanzielle und verwaltungstechnische Autonomie gewährt werden.
Ein Land ohne leistungsfähige Bibliotheken ist ein Land ohne Kenntnis und Bewusstsein seiner Vergangenheit und ohne Zukunft.
Rom, den 12. Juli 2012
(Translation: Christine Streubuehr, Deutsches Historisches Institut, Musikgeschichtliche Abteilung, Musickbibiothek, Rom)
Siehe auch
http://ilteatrodellamemoria.wordpress.com/2012/07/29/a-positive-result-of-the-mobilization-for-italian-sound-archives/
KlausGraf - am Samstag, 4. August 2012, 16:00 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
I suggest that it is unlikely that publishers will continue to produce printed encyclopaedias even given the possibility of digital-related funding opportunities. Not only because they become out of date and are (in print-on-paper versions) difficult and expensive to update but because of the difficulties of providing reasonable remuneration for contributors to 'locked-down' copyrighted tomes. Open Educational Resources could be much enhanced by a Creative Commons/Wikipedia approach.
Brian Whalley: Wikipedia: Reflections on Use and Acceptance in Academic Environments
http://www.ariadne.ac.uk/issue69/whalley

Brian Whalley: Wikipedia: Reflections on Use and Acceptance in Academic Environments
http://www.ariadne.ac.uk/issue69/whalley

KlausGraf - am Samstag, 4. August 2012, 15:03 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Tilmann Krause sichtet die Zugangsmöglichkeiten zu den Nachlässen der Familie Richard Wagners:
http://www.welt.de/kultur/history/article108427556/Liegen-Hitlers-Liebesbriefe-noch-im-Stahlschrank.html
Der gesamte Nachlass Richard Wagners, der die sommerlichen Opernaufführungen von Bayreuth 1876 begründet hatte, einschließlich der Hinterlassenschaften seiner Frau Cosima, die nach dem Tod des Meisters die Geschicke auf dem Grünen Hügel bestimmte, sowie auch noch der Kinder Cosimas und Richards, liegen im Richard-Wagner-Nationalarchiv in Bayreuth. Dabei handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Einrichtung. Jeder, der ein begründetes Forschungsinteresse vorweisen kann, wird dort eingelassen. [...]
Wenn wir der Gegenwart näher kommen, wäre an erster Stelle der Nachlass Wieland Wagners zu nennen, der die Festspiele (zusammen mit seinem Bruder Wolfgang, der sie später allein weiterführte) von 1951 bis zu seinem Tod 1966 leitete, aber auch schon im "Dritten Reich" von Hitler persönlich als zukünftiger Festivalleiter aufgebaut wurde.
Auch dieser Nachlass, der in Salzburg liegt, ist frei zugänglich. [...]
Der Nachlass Wolfgang Wagners wiederum, der erst vor zwei Jahren verstarb, ist allerdings einstweilen noch gesperrt. Er dürfte sich bei seiner Tochter und Erbin Katharina, der jetzigen Festspielleiterin, befinden. Der Organisator der im Moment in Bayreuth gezeigten Ausstellung zur Ausgrenzung jüdischer Sänger in Bayreuth, Hannes Heer, hat nun mehrfach beklagt, man habe ihm für seine Schau keinen Einblick in diese Bestände gewährt, ja noch nicht einmal auf sein Gesuch geantwortet.
Wenn das stimmt, dann ist das schlechter Stil, der übrigens gut zur bisherigen Haltung Katharinas passt. Sie hat bei ihrer Amtseinführung vollmundig angekündigt, sie wolle nunmehr alle Familienarchive zugänglich machen. Sie hat dann auch eine Historikerkommission, bestehend aus dem Hindenburg-Biografen Wolfram Pyta und dem Journalisten Peter Siebenmorgen, eingesetzt. Doch das war’s dann auch. [...]
Kommen wir zum Nachlass Winifreds, von dem man sich die größten, skandalösesten Trouvaillen verspricht. Er ging an Winifreds Lieblingsenkelin Amélie Hohmann. Herzstück dieses Bestands ist ein sagenumwobener, viel beraunter "Stahlschrank" in München. In ihm, so geht die Legende, soll die Korrespondenz Winifreds mit dem "Führer" liegen. Das mag ja sein.
http://www.welt.de/kultur/history/article108427556/Liegen-Hitlers-Liebesbriefe-noch-im-Stahlschrank.html
Der gesamte Nachlass Richard Wagners, der die sommerlichen Opernaufführungen von Bayreuth 1876 begründet hatte, einschließlich der Hinterlassenschaften seiner Frau Cosima, die nach dem Tod des Meisters die Geschicke auf dem Grünen Hügel bestimmte, sowie auch noch der Kinder Cosimas und Richards, liegen im Richard-Wagner-Nationalarchiv in Bayreuth. Dabei handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Einrichtung. Jeder, der ein begründetes Forschungsinteresse vorweisen kann, wird dort eingelassen. [...]
Wenn wir der Gegenwart näher kommen, wäre an erster Stelle der Nachlass Wieland Wagners zu nennen, der die Festspiele (zusammen mit seinem Bruder Wolfgang, der sie später allein weiterführte) von 1951 bis zu seinem Tod 1966 leitete, aber auch schon im "Dritten Reich" von Hitler persönlich als zukünftiger Festivalleiter aufgebaut wurde.
Auch dieser Nachlass, der in Salzburg liegt, ist frei zugänglich. [...]
Der Nachlass Wolfgang Wagners wiederum, der erst vor zwei Jahren verstarb, ist allerdings einstweilen noch gesperrt. Er dürfte sich bei seiner Tochter und Erbin Katharina, der jetzigen Festspielleiterin, befinden. Der Organisator der im Moment in Bayreuth gezeigten Ausstellung zur Ausgrenzung jüdischer Sänger in Bayreuth, Hannes Heer, hat nun mehrfach beklagt, man habe ihm für seine Schau keinen Einblick in diese Bestände gewährt, ja noch nicht einmal auf sein Gesuch geantwortet.
Wenn das stimmt, dann ist das schlechter Stil, der übrigens gut zur bisherigen Haltung Katharinas passt. Sie hat bei ihrer Amtseinführung vollmundig angekündigt, sie wolle nunmehr alle Familienarchive zugänglich machen. Sie hat dann auch eine Historikerkommission, bestehend aus dem Hindenburg-Biografen Wolfram Pyta und dem Journalisten Peter Siebenmorgen, eingesetzt. Doch das war’s dann auch. [...]
Kommen wir zum Nachlass Winifreds, von dem man sich die größten, skandalösesten Trouvaillen verspricht. Er ging an Winifreds Lieblingsenkelin Amélie Hohmann. Herzstück dieses Bestands ist ein sagenumwobener, viel beraunter "Stahlschrank" in München. In ihm, so geht die Legende, soll die Korrespondenz Winifreds mit dem "Führer" liegen. Das mag ja sein.
KlausGraf - am Samstag, 4. August 2012, 14:52 - Rubrik: Musikarchive
1977-2002
ausgewählte Artikel im Volltext:
http://medienarchive.at/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=51
siehe auch:
http://www.phonogrammarchiv.at/wwwnew/publ_d.htm#Downloads
ausgewählte Artikel im Volltext:
http://medienarchive.at/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=51
siehe auch:
http://www.phonogrammarchiv.at/wwwnew/publ_d.htm#Downloads
SW - am Samstag, 4. August 2012, 07:46 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Erinnert sich noch jemand an den spektakulären Diebstahl in der altehrwürdigen Biblioteca dei Girolamini in Neapel, die am 19. April 2012 von der Polizei geschlossen wurde? Im Mai wurde heftig spekuliert, inwieweit der Antiquariatshandel darin verwickelt sei, so zum Beispiel hier am 9. Mai:
http://archiv.twoday.net/stories/97016670/
Noch am 30. Mai, als allenfalls anderwärts im Konjunktiv gerätselt wurde, sprach man hier recht vorwitzig von "Gerücht":
http://archiv.twoday.net/stories/97040317/
Dabei war doch am 21. Mai bereits alles klar:
http://en.zisska.de/news
http://de.zisska.de/aktuelles
(Die "Übersetzung" dauerte etwas länger...)
Womit eindeutig bewiesen ist: Blogger können nicht googeln.
http://archiv.twoday.net/stories/97016670/
Noch am 30. Mai, als allenfalls anderwärts im Konjunktiv gerätselt wurde, sprach man hier recht vorwitzig von "Gerücht":
http://archiv.twoday.net/stories/97040317/
Dabei war doch am 21. Mai bereits alles klar:
http://en.zisska.de/news
http://de.zisska.de/aktuelles
(Die "Übersetzung" dauerte etwas länger...)
Womit eindeutig bewiesen ist: Blogger können nicht googeln.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/erfurt-will-neonazis-den-besuch-von-museen-verbieten-a-848159.html
Thüringens Landeshauptstadt will einschlägig bekannten Rechtsextremen am Besuch von städtischen Museen, Kultureinrichtungen und Kulturveranstaltungen hindern. Die Hausordnung der kommunalen Kultureinrichtungen sei um eine entsprechende Klausel ergänzt worden, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.
Demnach dürfen die Leiter der städtischen Einrichtungen, der Veranstaltungen oder deren Beauftragte von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, "die neonazistischen Organisationen angehören oder der extremen rechten Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch antisemitische, rassistische, menschenverachtende oder nationalistische Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Ausstellung oder Veranstaltung verwehren".
Halte ich persönlich nicht mit Art. 3 GG in Verbindung mit Art. 5 GG (Informationsfreiheit) vereinbar. Soweit Neonazis sich danebenbenehmen oder hinreichende Anhaltspunkte für eine Gefahr durch einen Besuch bestehen, kann ohne weiteres mit dem bisherigen Instrumentarium dagegen vorgegangen werden. Es geht nicht an, Bürgerrechte auszuhöhlen, auch wenn Neonazis betroffen sind.
Kommunales Hausrecht hat kein Gesinnungs-Hausrecht zu sein, das an geäußerte Meinungen anknüpft. Neonazis sind rechtlich keine Bürger zweiter Klasse. Jedes einschüchternde oder gar gewaltsame Auftreten muss nicht geduldet werden und kann mit Hausverboten geahndet werden, aber der Zutritt zu kommunalen Veranstaltungen hat für jeden Bürger und jede Bürgerin grundsätzlich offenzustehen.
Thüringens Landeshauptstadt will einschlägig bekannten Rechtsextremen am Besuch von städtischen Museen, Kultureinrichtungen und Kulturveranstaltungen hindern. Die Hausordnung der kommunalen Kultureinrichtungen sei um eine entsprechende Klausel ergänzt worden, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.
Demnach dürfen die Leiter der städtischen Einrichtungen, der Veranstaltungen oder deren Beauftragte von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, "die neonazistischen Organisationen angehören oder der extremen rechten Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch antisemitische, rassistische, menschenverachtende oder nationalistische Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Ausstellung oder Veranstaltung verwehren".
Halte ich persönlich nicht mit Art. 3 GG in Verbindung mit Art. 5 GG (Informationsfreiheit) vereinbar. Soweit Neonazis sich danebenbenehmen oder hinreichende Anhaltspunkte für eine Gefahr durch einen Besuch bestehen, kann ohne weiteres mit dem bisherigen Instrumentarium dagegen vorgegangen werden. Es geht nicht an, Bürgerrechte auszuhöhlen, auch wenn Neonazis betroffen sind.
Kommunales Hausrecht hat kein Gesinnungs-Hausrecht zu sein, das an geäußerte Meinungen anknüpft. Neonazis sind rechtlich keine Bürger zweiter Klasse. Jedes einschüchternde oder gar gewaltsame Auftreten muss nicht geduldet werden und kann mit Hausverboten geahndet werden, aber der Zutritt zu kommunalen Veranstaltungen hat für jeden Bürger und jede Bürgerin grundsätzlich offenzustehen.
KlausGraf - am Freitag, 3. August 2012, 19:42 - Rubrik: Archivrecht
Dokumente des Österreichischen Staatsarchivs präsentiert:
http://www.oesta.gv.at/site/cob__48446/5164/default.aspx

http://www.oesta.gv.at/site/cob__48446/5164/default.aspx

KlausGraf - am Freitag, 3. August 2012, 19:22 - Rubrik: Sportarchive
KlausGraf - am Freitag, 3. August 2012, 15:52 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"In der vom Bundesinnenministerium veröffentlichten Studie "Open Government Data Deutschland" werden rechtliche, technische und organisatorische Fragen rund um die Offenlegung von Datenbeständen der öffentlichen Verwaltung ("Open Government Data") untersucht.
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass viele Verwaltungsdaten bereits auf der Basis des geltenden Rechts offengelegt werden können - und zwar ohne oder nur mit geringfügigen Änderungen."
http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=5481
Studie (PDF)
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass viele Verwaltungsdaten bereits auf der Basis des geltenden Rechts offengelegt werden können - und zwar ohne oder nur mit geringfügigen Änderungen."
http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=5481
Studie (PDF)
KlausGraf - am Donnerstag, 2. August 2012, 16:15 - Rubrik: E-Government
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Beispiel (man erfährt die Quelle, wenn man mit der Maus über den jeweiligen Link fährt):
http://www.bundeskunsthalle.de/?cgi-bin/bib/kah?t_idn=b002005
http://www.bundeskunsthalle.de/?cgi-bin/bib/kah?t_idn=b002005
KlausGraf - am Donnerstag, 2. August 2012, 16:11 - Rubrik: Bibliothekswesen
Leider nur Schwarzweiss digitalisiert liegt der Cgm 213, der Konrad Bollstatters Bearbeitung der deutschen Version von Sigismund Meisterlins Augsburger Chronik (um 1480) überliefert, nun online vor:
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00074543/image_1
[Sept. 2015: nun farbig]
Zur Handschrift
http://www.handschriftencensus.de/5122
und Karin Schneiders Katalog
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0043_a048_JPG.htm
Die Bearbeitung Bollstatters behandelte Paul Joachimsen in seinem Meisterlin-Buch 1895, S. 84-90
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00022969/image_92
sowie in seinem Aufsatz in der Alemannia 1894, S. 12f.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Alemannia_XXII_020.jpg
wo er auch S. 139-155 Auszüge aus dem Cgm 213 publizierte:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Alemannia_XXII_147.jpg
Für meine Burgunderkriege-Seite
http://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege
war nun zu prüfen - da der Aufsatz von Dieter Weber: Karl der Kühne in der Meisterlin-Fortsetzung des Konrad Bollstatter (aus Cgm 213). In: Porta Ottoniana. Beiträge zur fränkischen und bayerischen Landesgeschichte. Otto Meyer zum achtzigsten Geburtstag gewidmet. Hrsg. von Harald Parigger. Bayreuth 1986, S. 138-159 diesbezüglich wenig brauchbar ist - wie sich Bollstatters Beschreibung des Trierer Treffens 1473 zum "Libellus de magnificentia ducis Burgundiae in Treveris visa conscriptus" verhält. Zugleich bot sich an, den bislang nicht beachteten Bericht im St. Galler Cod. 806 zu sichten.
Ausgabe des Libellus in den Basler Chroniken
http://www.archive.org/stream/baslerchroniken02basegoog#page/n348/mode/2up
Anders als ich anzunehmen geneigt war, ist Bollstatters Bericht (Bl. 263r-267v) vom Libellus unabhängig:
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00074543/image_529
Bollstatter bringt etliche Details, die dem Libellus (und wohl auch den anderen Quellen) fehlen, z.B. zu den Turnieren, zum Auftritt von Persevanten und Herolden beim Festmahl (Bl. 265v).
Zum Vergleich: die deutschsprachigen Berichte bei Chmel
http://books.google.de/books?id=ZqwAAAAAcAAJ&pg=PA51
in der Speyrer Chronik
http://books.google.de/books?id=k2VHAAAAYAAJ&pg=PA508
im Frankfurter Reisebericht
http://www.archive.org/stream/archivfrfrankfu14maingoog#page/n199/mode/2up
Brief des Hertnit vom Stein und Ludwigs von Eyb (online nur schlecht bei Baader, maßgeblich ed. Thumser, Ludwig von Eyb der Ältere, 2002, S. 202-209).
Knebel (lateinisch)
http://archive.org/stream/baslerchroniken01basegoog#page/n41/mode/2up
Näherer Erhellung bedarf das Verhältnis des Sangallensis zum Libellus. Hier können nur einige erste Hinweise gegeben werden.
Der Bericht Cod. 806, S. 297-302 (noch 15. Jh.?) liegt online vor:
http://www.e-codices.unifr.ch/de/csg/0806/297
Am Schluss werden S. 302 Haug und Ulrich von Montfort als Teilnehmer am Trierer Mahl namentlich herausgegriffen, was eine Entstehung des Textes im Bodenseeraum nicht unwahrscheinlich erscheinen lässt.
Bis auf wenige kurze Schlussabschnitte und die Einleitung überliefert die Handschrift den Libellus (Mahlteil) in der Fassung D (Diebold Schilling), wobei sie D1 (Speckers Handschrift) am nächsten steht. Das ergibt sich aus S. 299, wo von bloßen Armen die Rede ist (vgl. Basler Chroniken III, S. 347 Varianten von D1).
Bemerkenswert ist die Überlieferung deshalb, weil sie sich anders als die Versionen B, C, D nicht auf das Mahl am 7. Oktober 1473 beschränkt, zugleich aber nicht den in A (Königshofen-Fortsetzungen) gegebenen einleitenden Bericht enthält, sondern eine eigene Beschreibung, in der - allerdings sehr knapp - sonst meist vermisste inhaltliche Positionen des Kaisers und des Herzogs von Burgund herausstechen. Natürlich steht auch hier die Prachtentfaltung im Vordergrund, aber das Ansprechen der Türkenfrage im Dialog der Herrscher (S. 298f.) verdient Beachtung.
Nachtrag: Eine teilweise Übereinstimmung mit dem St. Galler Bericht weist auf die Chronik des Überlingers Leonhard Wintersulger, ed. Philipp Ruppert:
http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/kn_beitraege-1/0123
#forschung
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00074543/image_1
[Sept. 2015: nun farbig]
Zur Handschrift
http://www.handschriftencensus.de/5122
und Karin Schneiders Katalog
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0043_a048_JPG.htm
Die Bearbeitung Bollstatters behandelte Paul Joachimsen in seinem Meisterlin-Buch 1895, S. 84-90
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00022969/image_92
sowie in seinem Aufsatz in der Alemannia 1894, S. 12f.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Alemannia_XXII_020.jpg
wo er auch S. 139-155 Auszüge aus dem Cgm 213 publizierte:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Alemannia_XXII_147.jpg
Für meine Burgunderkriege-Seite
http://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege
war nun zu prüfen - da der Aufsatz von Dieter Weber: Karl der Kühne in der Meisterlin-Fortsetzung des Konrad Bollstatter (aus Cgm 213). In: Porta Ottoniana. Beiträge zur fränkischen und bayerischen Landesgeschichte. Otto Meyer zum achtzigsten Geburtstag gewidmet. Hrsg. von Harald Parigger. Bayreuth 1986, S. 138-159 diesbezüglich wenig brauchbar ist - wie sich Bollstatters Beschreibung des Trierer Treffens 1473 zum "Libellus de magnificentia ducis Burgundiae in Treveris visa conscriptus" verhält. Zugleich bot sich an, den bislang nicht beachteten Bericht im St. Galler Cod. 806 zu sichten.
Ausgabe des Libellus in den Basler Chroniken
http://www.archive.org/stream/baslerchroniken02basegoog#page/n348/mode/2up
Anders als ich anzunehmen geneigt war, ist Bollstatters Bericht (Bl. 263r-267v) vom Libellus unabhängig:
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00074543/image_529
Bollstatter bringt etliche Details, die dem Libellus (und wohl auch den anderen Quellen) fehlen, z.B. zu den Turnieren, zum Auftritt von Persevanten und Herolden beim Festmahl (Bl. 265v).
Zum Vergleich: die deutschsprachigen Berichte bei Chmel
http://books.google.de/books?id=ZqwAAAAAcAAJ&pg=PA51
in der Speyrer Chronik
http://books.google.de/books?id=k2VHAAAAYAAJ&pg=PA508
im Frankfurter Reisebericht
http://www.archive.org/stream/archivfrfrankfu14maingoog#page/n199/mode/2up
Brief des Hertnit vom Stein und Ludwigs von Eyb (online nur schlecht bei Baader, maßgeblich ed. Thumser, Ludwig von Eyb der Ältere, 2002, S. 202-209).
Knebel (lateinisch)
http://archive.org/stream/baslerchroniken01basegoog#page/n41/mode/2up
Näherer Erhellung bedarf das Verhältnis des Sangallensis zum Libellus. Hier können nur einige erste Hinweise gegeben werden.
Der Bericht Cod. 806, S. 297-302 (noch 15. Jh.?) liegt online vor:
http://www.e-codices.unifr.ch/de/csg/0806/297
Am Schluss werden S. 302 Haug und Ulrich von Montfort als Teilnehmer am Trierer Mahl namentlich herausgegriffen, was eine Entstehung des Textes im Bodenseeraum nicht unwahrscheinlich erscheinen lässt.
Bis auf wenige kurze Schlussabschnitte und die Einleitung überliefert die Handschrift den Libellus (Mahlteil) in der Fassung D (Diebold Schilling), wobei sie D1 (Speckers Handschrift) am nächsten steht. Das ergibt sich aus S. 299, wo von bloßen Armen die Rede ist (vgl. Basler Chroniken III, S. 347 Varianten von D1).
Bemerkenswert ist die Überlieferung deshalb, weil sie sich anders als die Versionen B, C, D nicht auf das Mahl am 7. Oktober 1473 beschränkt, zugleich aber nicht den in A (Königshofen-Fortsetzungen) gegebenen einleitenden Bericht enthält, sondern eine eigene Beschreibung, in der - allerdings sehr knapp - sonst meist vermisste inhaltliche Positionen des Kaisers und des Herzogs von Burgund herausstechen. Natürlich steht auch hier die Prachtentfaltung im Vordergrund, aber das Ansprechen der Türkenfrage im Dialog der Herrscher (S. 298f.) verdient Beachtung.
Nachtrag: Eine teilweise Übereinstimmung mit dem St. Galler Bericht weist auf die Chronik des Überlingers Leonhard Wintersulger, ed. Philipp Ruppert:
http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/kn_beitraege-1/0123
#forschung
KlausGraf - am Donnerstag, 2. August 2012, 03:02 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.leitmedium.de/2012/07/29/ich-wuensche-mir-eine-deutsche-nationalmediathek-oder-das-kurze-gedaechtnis-von-rtl/
Aus welchen Gründen bei Privatsendern kein Pflichtexemplarrecht besteht, kann ich nicht nachvollziehen. Jeder Rundfunkveranstalter sollte verpflichtet sein, seine Sendungen einem zentralen Medienarchiv abzuliefern.
Aus welchen Gründen bei Privatsendern kein Pflichtexemplarrecht besteht, kann ich nicht nachvollziehen. Jeder Rundfunkveranstalter sollte verpflichtet sein, seine Sendungen einem zentralen Medienarchiv abzuliefern.
KlausGraf - am Mittwoch, 1. August 2012, 23:38 - Rubrik: Medienarchive
Bislang an die 30 Titel.
http://digital.lb-oldenburg.de/ol/nav/classification/137688
Bemerkenswert: Digitalisate anderer Bibliotheken zu Oldenburg werden von der Bibliothek in einer Linksammlung auf Delicious nachgewiesen:
http://www.delicious.com/olregbib
Es wäre aber auch sinnvoll, diese im GBV zu katalogisieren.
http://digital.lb-oldenburg.de/ol/nav/classification/137688
Bemerkenswert: Digitalisate anderer Bibliotheken zu Oldenburg werden von der Bibliothek in einer Linksammlung auf Delicious nachgewiesen:
http://www.delicious.com/olregbib
Es wäre aber auch sinnvoll, diese im GBV zu katalogisieren.
KlausGraf - am Mittwoch, 1. August 2012, 16:48 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.landesarchiv-bw.de/web/54025
Zu den großen Zimelien des Hohenlohe–Zentralarchivs in Neuenstein zählt das mit Wappen reich geschmückte Lehnbuch Graf Albrechts II. von Hohenlohe. Lehnbücher sind eine bereits im hohen Mittelalter entwickelte Gattung von Amtsbüchern, die im Lauf des späten Mittelalters eine immer weitere Verbreitung fand. Neben administrativen Zwecken – der Kontrolle des Herrn über seine Vasallen und deren Lehnsbesitz – dienten derartige, mit großer Sorgfalt angelegte Kompilationen nicht selten auch als Medium der höfischen Repräsentation und folgerichtig kam ihnen im regelmäßig inszenierten Belehnungsritual eine zentrale Funktion zu.
Der großformatige, zwischen lederbezogene und rollstempelverzierte Holzdeckel gebundene Foliant umfasst insgesamt 150 Pergamentblätter; zusammengehalten wird er von schlichten Messingbeschlägen. Öffnet man den prächtigen Band, sieht man zuerst eine ganzseitige Darstellung des Grafen Albrecht in schimmernder Wehr; in der rechten Hand hält er einen Streitkolben, in der linken eine Lanze, deren Wimpel die Wappen von Hohenlohe, Ziegenhain und Nidda zeigt.
Die folgenden acht Seiten veranschaulichen die höchst illustre Ahnenreihe des Grafen, und schließlich folgen, jeweils illustriert mit dem Wappen der betreffenden Familie, Eintragungen über die Belehnung der gräflichen Vasallen – ein veritables Wappenbuch des fränkischen Adels in einem weiten Raum vom Kraichgau im Westen über den Odenwald und das Bauland, das Ochsenfurter und das Windsheimer Gäu sowie den Steigerwald bis auf die Frankenhöhe im Osten, nicht zu vergessen die hohenlohischen Kerngebiete um Kocher, Jagst und Tauber.
Siehe auch
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Illuminated_archival_materials

Zu den großen Zimelien des Hohenlohe–Zentralarchivs in Neuenstein zählt das mit Wappen reich geschmückte Lehnbuch Graf Albrechts II. von Hohenlohe. Lehnbücher sind eine bereits im hohen Mittelalter entwickelte Gattung von Amtsbüchern, die im Lauf des späten Mittelalters eine immer weitere Verbreitung fand. Neben administrativen Zwecken – der Kontrolle des Herrn über seine Vasallen und deren Lehnsbesitz – dienten derartige, mit großer Sorgfalt angelegte Kompilationen nicht selten auch als Medium der höfischen Repräsentation und folgerichtig kam ihnen im regelmäßig inszenierten Belehnungsritual eine zentrale Funktion zu.
Der großformatige, zwischen lederbezogene und rollstempelverzierte Holzdeckel gebundene Foliant umfasst insgesamt 150 Pergamentblätter; zusammengehalten wird er von schlichten Messingbeschlägen. Öffnet man den prächtigen Band, sieht man zuerst eine ganzseitige Darstellung des Grafen Albrecht in schimmernder Wehr; in der rechten Hand hält er einen Streitkolben, in der linken eine Lanze, deren Wimpel die Wappen von Hohenlohe, Ziegenhain und Nidda zeigt.
Die folgenden acht Seiten veranschaulichen die höchst illustre Ahnenreihe des Grafen, und schließlich folgen, jeweils illustriert mit dem Wappen der betreffenden Familie, Eintragungen über die Belehnung der gräflichen Vasallen – ein veritables Wappenbuch des fränkischen Adels in einem weiten Raum vom Kraichgau im Westen über den Odenwald und das Bauland, das Ochsenfurter und das Windsheimer Gäu sowie den Steigerwald bis auf die Frankenhöhe im Osten, nicht zu vergessen die hohenlohischen Kerngebiete um Kocher, Jagst und Tauber.
Siehe auch
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Illuminated_archival_materials

KlausGraf - am Mittwoch, 1. August 2012, 16:20 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Martin Walser ist geradezu euphorisch:
http://www.zeit.de/2012/30/L-B-Haller-Seelenfeuer/komplettansicht
Update: Auf Klischees verweist dagegen zurecht:
http://historikerkraus.de/blog/2012/08/05/seelenfeuer-von-cornelia-haller-die-zweite/

http://www.zeit.de/2012/30/L-B-Haller-Seelenfeuer/komplettansicht
Update: Auf Klischees verweist dagegen zurecht:
http://historikerkraus.de/blog/2012/08/05/seelenfeuer-von-cornelia-haller-die-zweite/

KlausGraf - am Mittwoch, 1. August 2012, 15:57 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.piggin.net/stemmahist/petercatalog.htm
Eine nützliche Übersicht, aber leider wertlos für die deutschsprachigen Versionen, da der Handschriftencensus und die neuere deutschsprachige Forschung ignoriert wird.
1987 habe ich in meiner Dissertation "Exemplarische Geschichten" auf die Handschrift Schätze 121 des Augsburger Stadtarchivs (mit doppelter Überlieferung des Textes, einmal geschrieben von Konrad Bollstatter = Schreiber A, und einmal vom sogenannten "Aalener Stadtschreiber" = Schreiber B) und S. 198f. auf die weitere deutschsprachige Überlieferung aufmerksam gemacht.
Zur Augsburger Handschrift :
http://www.handschriftencensus.de/4311
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/406843 (Beschreibung Roth)
Graf, Exemplarische Geschichten
http://books.google.de/books?id=pcvWAAAAMAAJ&pg=PA198
Auf S. 198 ist Zeile 8 von unten nach "Fragment -" Cgm 252 entfallen.
Auch die Klagenfurter Handschrift, die Ott beibrachte und auf die ich 1987 hinwies, fehlt in "Peter's Stemma". Sie findet sich im Handschriftencensus ohne Hinweis auf Petrus Pictaviensis:
http://www.handschriftencensus.de/5152
Dagegen war mir 1987 die in Peter's Stemma angegebene Handschrift von Gall Kemli in Zürich nicht bekannt (sie liegt digitalisiert vor:
http://www.e-codices.unifr.ch/de/description/zbz/A0135 )
Auch für Göttingen Theol. 293, Cgm 252 und Cgm 564 müsste der Handschriftencensus zitiert werden.
Zur Übersetzung 'Die kurze Bibel' existiert sogar ein Artikel im Verfasserlexikon (2. Aufl. Bd. 11, Sp. 898-903) von Gisela Kornrumpf, die mich namentlich erwähnt ("Bekannt sind seit Graf", Sp. 899), aber nicht die Zürcher Kemli-Handschrift.
Teil I des Artikels von Kornrumpf betrifft eine Kompilation im Nürnberger Löffelholz-Archiv ohne Bezug zu Petrus Pictaviensis.
Compendium historiae in genealogia Christi dt. = 'Die kurze Bibel' II. Teil III behandelt das sogenannte Heidelberger Mischgedicht im Cpg 110 bzw. 110a, das auf dem Petrus Picatviensis basiert (in Peter's Stemma).
Es wäre an der Zeit, dass die internationale Forschung zu Petrus Pictaviensis die Ermittlungen der deutschsprachigen Mediävistik zu den deutschen Versionen endlich einmal zur Kenntnis nimmt.
Eine nützliche Übersicht, aber leider wertlos für die deutschsprachigen Versionen, da der Handschriftencensus und die neuere deutschsprachige Forschung ignoriert wird.
1987 habe ich in meiner Dissertation "Exemplarische Geschichten" auf die Handschrift Schätze 121 des Augsburger Stadtarchivs (mit doppelter Überlieferung des Textes, einmal geschrieben von Konrad Bollstatter = Schreiber A, und einmal vom sogenannten "Aalener Stadtschreiber" = Schreiber B) und S. 198f. auf die weitere deutschsprachige Überlieferung aufmerksam gemacht.
Zur Augsburger Handschrift :
http://www.handschriftencensus.de/4311
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/406843 (Beschreibung Roth)
Graf, Exemplarische Geschichten
http://books.google.de/books?id=pcvWAAAAMAAJ&pg=PA198
Auf S. 198 ist Zeile 8 von unten nach "Fragment -" Cgm 252 entfallen.
Auch die Klagenfurter Handschrift, die Ott beibrachte und auf die ich 1987 hinwies, fehlt in "Peter's Stemma". Sie findet sich im Handschriftencensus ohne Hinweis auf Petrus Pictaviensis:
http://www.handschriftencensus.de/5152
Dagegen war mir 1987 die in Peter's Stemma angegebene Handschrift von Gall Kemli in Zürich nicht bekannt (sie liegt digitalisiert vor:
http://www.e-codices.unifr.ch/de/description/zbz/A0135 )
Auch für Göttingen Theol. 293, Cgm 252 und Cgm 564 müsste der Handschriftencensus zitiert werden.
Zur Übersetzung 'Die kurze Bibel' existiert sogar ein Artikel im Verfasserlexikon (2. Aufl. Bd. 11, Sp. 898-903) von Gisela Kornrumpf, die mich namentlich erwähnt ("Bekannt sind seit Graf", Sp. 899), aber nicht die Zürcher Kemli-Handschrift.
Teil I des Artikels von Kornrumpf betrifft eine Kompilation im Nürnberger Löffelholz-Archiv ohne Bezug zu Petrus Pictaviensis.
Compendium historiae in genealogia Christi dt. = 'Die kurze Bibel' II. Teil III behandelt das sogenannte Heidelberger Mischgedicht im Cpg 110 bzw. 110a, das auf dem Petrus Picatviensis basiert (in Peter's Stemma).
Es wäre an der Zeit, dass die internationale Forschung zu Petrus Pictaviensis die Ermittlungen der deutschsprachigen Mediävistik zu den deutschen Versionen endlich einmal zur Kenntnis nimmt.
KlausGraf - am Mittwoch, 1. August 2012, 14:37 - Rubrik: Kodikologie
Die zweite Ausgabe des Newsletters "Archivjournal - Neuigkeiten aus dem Staatsarchiv Hamburg" ist heute erschienen und kann unter der Adresse
http://www.hamburg.de/contentblob/3528944/data/archivjournal-12-02.pdf
abgerufen werden.
http://www.hamburg.de/contentblob/3528944/data/archivjournal-12-02.pdf
abgerufen werden.
Newsletter StaHH - am Mittwoch, 1. August 2012, 10:34 - Rubrik: Staatsarchive