In Kürze: Der Versuch Tiroler Institutionen, den bei Zisska aufgetauchten wertvollen Restbestand der denkmalgeschützten Haller Waldauf-Bibliothek en bloc zu erwerben, ist an der Gier von Auktionshaus und Einlieferer gescheitert. Einzelerwerbungen wurden nicht vorgenommen. Damit gingen die kostbaren Bücher an sogenannte Bibliophile, die sich nicht schämten, Dinge anzukaufen, die aus moralischer Sicht niemand anderem gehören als der frommen Stiftung des Florian Waldauf aus der Zeit Maximilians I. (Es ist nicht damit zu rechnen, dass öffentliche Institutionen in nennenswertem Umfang mitsteigern konnten.)
Die Presseaussendung der Diözese Innsbruck spricht Klartext:
Die von Florian Waldauf, einem Berater Maximilians I., Anfang des 16. Jahrhunderts gestiftete
und über 3000 Bände umfassende Predigerbibliothek gehört zu den ältesten Büchersammlungen
Tirols und enthielt eine Vielzahl an sehr beachtenswerten Handschriften, Inkunabeln und Drucken
des 16.–18. Jahrhunderts. Die Stiftungsbibliothek wird heute von der Stadtpfarre St. Nikolaus in
Hall verwaltet und wurde 2003 von der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol in Innsbruck als
Dauerleihgabe übernommen.
Bedauerlicherweise sind der Bibliothek in ihrer wechselvollen jüngeren Geschichte gerade an
wertvollstem Buchgut erhebliche Verluste erwachsen:
Nachdem bereits im Zuge des Ersten Weltkrieges das gesamte Stiftungsvermögen untergegangen
war, kam der Bibliothek in weiterer Folge eine Vielzahl ihrer wertvollsten Objekte, darunter vor allem
Handschriften und Inkunabeln auf eine bis heute nie geklärte, wohl nicht legale Weise abhanden.
Diese Verluste gehen auf eine um bzw. nach 1938 vorsorglich durchgeführte Sicherstellung vor
den Nationalsozialisten sowie möglicherweise auch auf Bergungsmaßnahmen während des 2.
Weltkrieges zurück.
Die noch verbliebenen Buchbestände dieser Bibliothek wurden in den 1950er Jahren wieder
in das Kaplaneihaus rückgeführt und auf Veranlassung des Landesdenkmalamtes durch das
Pastoraltheologische Institut in Innsbruck neu geordnet. Im Zuge dessen soll 1964 angeblich ein
Verkauf von weniger wertvollen Druckwerken des 18. Jahrhunderts sowie von Dubletten an ein nicht
näher definiertes „Antiquariat in Ostösterreich“ erfolgt sein. Über die Rechtmäßigkeit eines solchen
Verkaufs kann bislang kein schriftlicher Nachweis erbracht werden. Dass es sich dabei um die von
Zisska & Schauer nunmehr angebotenen wertvollen Objekte handelt, kann nahezu ausgeschlossen
werden.
Aufgrund des Bücherkataloges von 1859 sowie aufgrund intensiver Recherchen in den letzten
Jahrzehnten kann heute von einem Gesamtverlust von ca. 700 Bänden ausgegangen werden.
Im Zuge der zwischen 9. und 11. November 2011 bei Zisska & Schauer in München stattfindenden
Bücherauktion wurden insgesamt 2 Handschriften, 19 Inkunabeln, also Druckerzeugnisse vor
1500, sowie über 200 Drucke des 16.-18. Jahrhunderts aus der Waldauf-Sammlung angeboten.
Aus verkaufstaktischen Gründen wurden nicht alle Bücher als der Waldauf-Bibliothek zugehörig
ausgewiesen, viele konnten im Zuge einer Einsichtnahme aufgrund eindeutiger Besitzhinweise
identifiziert werden.
Die herausragende kulturelle Bedeutung der denkmalgeschützten Waldauf-Bibliothek hat
weitreichende nationale und internationale Reaktionen auf kulturpolitischer, wissenschaftlicher,
kirchlicher und medialer Ebene ausgelöst. Dabei steht neben dem beträchtlichen Wert zahlreicher
Einzelobjekte vor allem die Option, diese für die Kulturgeschichte des Landes Tirol einzigartige
Sammlung in ihrer Geschlossenheit nach Möglichkeit zu bewahren, im Mittelpunkt.
Hierfür wurde zum einen die Rechtslage durch das Bundesdenkmalamt geprüft. Zum anderen
bemühten sich die Stadtpfarre St. Nikolaus in Hall, das Diözesanarchiv Innsbruck, die Kulturabteilung
des Landes Tirol sowie die Universitäts- und Landesbibliothek Tirol in Innsbruck, sämtliche vom
besagten Auktionshaus angebotenen Objekte der Waldauf-Bibliothek für Tirol zu sichern. Die dafür erforderlichen Mittel wurden durch finanzielle Zusicherungen seitens des Landes Tirol, der Pfarre Hall
und weiterer Sponsoren garantiert.
Seitens der Geldgeber kam grundsätzlich nur der Erwerb des Gesamtensembles in Betracht, wobei die Bücher im Gesamtpaket aus der Auktion herausgekauft werden sollten. Dagegen bestand
das Auktionshaus unter Berufung auf den Einbringer aus geschäftspolitischen Gründen letztlich darauf, die wertvollsten Objekte, nämlich die Handschriften und Inkunabeln, einzeln zu versteigern. Für die restlichen, weniger wertvollen Werke wurden unmittelbar vor Auktionsbeginn über den Schätzpreis hinausgehende sowie dem Wert und konservatorischen Zustand der Objekte keineswegs angemessene Forderungen gestellt.
Der angestrebte geschlossene Erwerb wäre im Hinblick auf die Einzelversteigerung nicht mehr gewährleistet gewesen. Insgesamt schien die Verwendung öffentlicher Gelder aufgrund des äußerst
risikoreichen Ausgangs der Auktion nicht mehr vertretbar.
Trotz intensivster Bemühungen bis unmittelbar vor Auktionsbeginn am Mittwoch war es nicht möglich, dieses einmalige kulturelle Erbe für das Land Tirol zu retten.
Für die Übermittlung dieses Textes und weitere Auskünfte danke ich Kollegen Diözesanarchivar Dr. Kapferer, Innsbruck.
Frühere Beiträge in Archivalia zur Waldauf-Bibliothek:
http://archiv.twoday.net/search?q=waldauf
KOMMENTAR:
Positiv zu vermerken ist, dass alle Beteiligten an einem Strang gezogen haben, um den Restbestand für Tirol zu retten. Dabei wurden erhebliche Geldsummen von Sponsoren eingeworben. Die Entscheidung, den Gesamtbestand aufzukaufen, also das archivische Provenienzprinzip gegen das verhängnisvolle bibliothekarische "Dublettendenken" zu setzen, verdient ebenfalls Respekt.
Die Juristen des Denkmalamts sahen keine Möglichkeit, gegen das Auktionshaus vorzugehen, da sowohl die Verbringung ins Ausland vor 1993 erfolgte (Voraussetzung der Rückforderung) als auch Straftatbestände verjährt waren.
Ein Team der Sondersammlungen der UB innsbruck hat den gesamten Bestand der Auktion gesichtet und erfasst (ob Fotos gemacht wurden oder gemacht werden durften, weiss ich nicht), insbesondere Vorprovenienzen notiert. Dabei hat sich herausgestellt, dass in erheblichem Umfang Waldauf-Bibliotheksgut im Katalog nicht als solches gekennzeichnet war. Aus meiner Sicht spricht einiges dafür, diese für mich durchaus "betrügerische" Fehlinformation potentieller Käufer als wettbewerbswidrige Irreführung nach dem UWG zu werten.
Es wäre schön gewesen, wenn Bibliotheken in der Causa Donaueschingen oder bei späteren Kulturgutverlusten, die ich seit 1994 dokumentiere, eine solche Bestandsdokumentation, die ja leider nur rudimentär sein konnte, durchgeführt hätten. Denn an den Katalogen der Händler hat man, wie hier schlagend erwiesen, wenig Freude. Diese verschweigen und verschleiern Provenienzen oder geben sie in irreführender Weise an.
Die verfügbaren Quellen insbesondere im Kirchenarchiv Hall wurden intensiv gesichtet, was aber hinsichtlich der entscheidenden Fragen ergebnislos blieb. Die FAZ schrieb vor der Auktion:
Schon vor der Auktion bei Zisska & Schauer sorgen Bücher der „Waldauf Bibliothek“ für Aufsehen: Florian Waldauf Ritter von Waldenstein und seine Frau Barbara stifteten 1501 der Pfarrkirche in Hall in Tirol eine Kapelle samt Predigtamt und Bibliothek. Während des Zweiten Weltkriegs wurde eine unbekannte Zahl wertvoller Schriften zum Schutz an Privatpersonen gegeben, jedoch nie rückerstattet. Bereits in der Vergangenheit tauchten immer wieder Waldauf-Bände im Handel auf. Ein 1983 angelegter Katalog zählt noch etwas mehr als 2000 Titel; heute bewahrt die Universitätsbibliothek Innsbruck diese unter Denkmalschutz stehende gotische Bibliothek als Leihgabe.
Nach Auskunft des Auktionshauses stammt die Einlieferung aus deutschem Privatbesitz, in den sie über ein „ostösterreichisches Antiquariat“ gelangt sei. Sie umfasst eine Handschrift - Briefe des Hieronymus, 1435 zu Papier gebracht (6000) - und elf Inkunabeln, darunter eine Prediktlehre mit Exlibris von Wolfgang Crener, dem ersten Prediger der Haller Stiftung (6000), und eine lateinische Koberger-Bibel von 1493 (10.000). Dazu kommen rund 170 Losnummern an Drucken aus den Jahren 1501 bis 1785, darunter zwei große Konvolute. Pfarrer Jakob Patsch von der zuständigen Gemeinde in Hall sagt, man wolle alles tun, um die Bücher zurückzubekommen, und sei auf der dringenden Suche nach Sponsoren; denn die Stiftung sei längst vollkommen mittellos.
Dieses ostösterreichische Antiquariat ist allem nach eine "Legende". Irgendwelche belastbaren Fakten zu diesem angeblichen Verkauf durch Jesuiten konnten nicht aufgefunden werden. Insbesondere gab es keine Einnahmen für die Pfarre Hall in Tirol, was ja wohl Voraussetzung einer legalen Veräußerung gewesen wäre.
Auch hinsichtlich der Entfremdung der Bestände konnte nur mündliche Überlieferung ermittelt werden, die dann auch zu der Aussage Brunners geführt hat, dass die Bücher aus Furcht vor der Beschlagnahmung durch die Nazis an Privatleute gegeben wurden. Die in einem Kommentar in diesem Weblog geäußerte Ansicht, die Entfremdung habe womöglich schon vor 1938 stattgefunden, ist abwegig:
http://archiv.twoday.net/stories/42999544/#49594897
1. Ganz offenkundig war die Bibliothek zum Zeitpunkt, als sie Prof. Mayrhofer in den Tiroler Heimatblättern 1938 beschrieb, noch intakt. Von früheren Verlusten weiß er nichts, er nennt ca. 80 Inkunabeln. Heutiger Bestand: 16 (Brunner VÖB-Mitt. 2003) bzw. 14 (UB Innsbruck, Website) bzw. 13 Titel laut GW. 1914 erfasste der GW laut Brunner 2003 61 Titel (Goldschmidt ZfB 1916: 70 Titel), Brunner in den Tiroler Heimatblätter nennt im Titel 64 verschollene Inkunabeln. Mayrhofer nennt die Titel einiger inzwischen verschwundener Inkunabeln, die sich nicht im GW-Verzeichnis finden.
2. Die Festschrift der von Florian Waldauf gegründeten Haller Stubengesellschaft 1958 aus der Feder von Ernst Verdroß-Droßberg, gewidmet Florian Waldauf, bestätigt eindeutig die Angabe Brunners, dass die Verluste in der NS-Zeit eingetreten seien: "Leider gingen während des letzten Krieges wertvolle Handschriften und Drucke verloren" (S. 41).
Es kann so gut wie ausgeschlossen werden, dass so wertvolle Bestände wie Handschriften und Inkunabeln 1964 an ein "ostösterreichisches Antiquariat" veräußert worden. Die diesbezügliche Angabe sehe ich persönlich als dicke fette Lüge, um einen illegalen Bestand mit einer "Legende" zu versehen, die im Einklang mit den Ausführungen Brunners im Handbuch der historischen Buchbestände steht. Über den Einlieferer war natürlich nichts zu erfahren, es soll sich um einen deutschen Staatsbürger handeln, der den Bestand schon seit längerer Zeit besitzt.
Da man auf Verhandlungen gesetzt hat, die sich zunächst auch gut anließen, ist es verständlich, dass man eine einstweilige Verfügung durch ein deutsches Gericht, die den Verkauf hätte stoppen können, nicht in Betracht gezogen hat.
Wenn es einen Preis für Skrupellosigkeit im Umgang mit Kulturgut in Deutschland 2011 gäbe, so hätten ihn der Einlieferer und das Auktionshaus sich verdient. Hätte es sich um jüdische Alteigentümer gehandelt, wäre die ganze Sache völlig anders abgelaufen. Tatsache ist, dass die unbefriedigende Rechtslage schamlos von einem gewissenlosen Auktionshaus und einem Besitzer ausgenutzt wurden, um eine fromme Stiftung um einen Teil ihres Stiftungsvermögens und das Land Tirol um einen Teil seines historischen Kulturguts zu prellen.
Dass Antiquariate in dieser Weise agieren können, ohne dass ihnen jemand einen Strich durch die Rechnung macht, und dass sie Kumpane als Käufer haben, die solche Ware schamlos erwerben, ist der eigentliche Skandal.
Der ILAB-Code sagt: Die "affiliates" sind dafür verantwortlich, dem Käufer den Rechtsanspruch auf die verkauften Artikel zu übergeben und werden nicht wissentlich gestohlenes Material kaufen, besitzen oder verkaufen. Die "affiliates" unternehmen alle zumutbaren Bemühungen, um sich davon zu versichern, dass alle von ihnen angebotenen Artikel Eigentum des Verkäufers waren. Weiterhin unternehmen sie alle zumutbaren Bemühungen, den Diebstahl von antiquarischen Büchern und damit zusammenhängendem Material zu verhindern. Sie arbeiten mit den Behörden zusammen, um zur Ergreifung der Täter beizutragen.
Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wahr, dass die von Zisska verkauften Stücke gestohlen waren. Dann ist mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Zisska als Hehler zu betrachten, denn hier wurde bewusst in Kauf genommen, das die Stücke gestohlen waren. Irgendwelche konkreten Gegenbeweise zur Herkunft - z.B. Angaben, was das für ein ostösterreichisches Antiquariat war - hat Zisska nicht vorgelegt. Der Hinweis auf dieses mysteriöse Antiquariat hat den gleichen Status wie der ominöse "Dachbodenfund". Die Stücke können im übrigen Österreich unter keinen Umständen legal verlassen haben, denn Ausfuhrbeschränkungen gab es schon in den 1920er Jahren.
Zisska ist auch nicht an den aus meiner Sicht einzig rechtmäßigen Eigentümer, die Waldauf-Stiftung, vertreten durch die Pfarrei Hall, herangetreten, als im Mai 2011 bereits Inkunabeln aus der Stiftung versteigert wurden. Und da ich Pfarrer Patsch die Nachricht von der jetzigen Auktion telefonisch überbracht habe, erfolgte auch jetzt keine Information.
Man kann sich wirklich nur für den Antiquariatshandel schämen und hoffen, dass irgendwann der Handel mit Kulturgut in ähnlicher Weise reglementiert wird wie der Handel mit Antiken oder mit Elfenbein. Es muss also der Gesetzgeber tätig werden. Und die Öffentlichkeit bzw. die Fachleute sollten Antiquariate wie Zisska konsequent ächten und deren Kunden, die solche Stücke kaufen, ebenso.
Zum Thema halbseidene Antiquare:
http://archiv.twoday.net/search?q=halbseiden
Nachtrag:
Josef Pauser geht ebenfalls auf das traurige Ergebnis ein:
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=18580
Enttäuscht über die gescheiterten Verhandlungen zeigte sich am Mittwoch auch Kulturlandesrätin Beate Palfrader, auf deren Initiative hin das Land sich in der Sache engagiert hatte, denn: „Leider war der angestrebte Ankauf der Waldauf-Bibliothek letztlich trotz intensiver Bemühungen des Landes nicht durchführbar, weil die Forderungen des Auktionshauses in München und des Einbringers der Buchbestände immer unvertretbarer wurden. Seitens des Landes stellt es sich so dar, dass das Auktionshaus in München nie wirklich ernsthaft an einem Verkauf interessiert war“, so Palfrader.
Das sei, erklärte die Landesrätin, „sehr bedauerlich“, weil sich das Land, die Pfarre Hall und die Universitäts- und Landesbibliothek sehr engagiert hätten und auch bereit waren, „einen hohen finanziellen Einsatz zu leisten“. Zudem habe man eine private Stiftung dafür gewinnen können, „sich ebenfalls mit einem namhaften Betrag am Ankauf zu beteiligen“. Die konkreten Beträge, die zur Rettung der Waldauf-Bestände hätten bereitgestellt werden sollen, blieben am Mittwoch freilich ebenso ungenannt wie die Höhe der Forderungen, die in München gestellt wurden.
So die Tiroler Tageszeitung
http://www.tt.com/csp/cms/sites/tt/Nachrichten/3745962-6/tiroler-kulturschatz-wird-zerschlagen.csp
In einem weiteren Artikel heißt es: Das Bundesdenkmalamt hatte zuvor rechtliche Schritte geprüft, allerdings sei man auf diesem Wege nicht weitergekommen, erklärt Reinhard Rampold vom Landeskonservatoriat Tirol: Der Münchner Auktionator habe den Einbringer bestätigen lassen, dass er die Waldauf-Bestände schon vor Inkrafttreten jenes Gesetzes besessen habe, das die Ausfuhr von Antiquitäten aus Österreich verbietet.
Das ist nach meiner Einschätzung eine Fehldarstellung, denn es gab meines Wissens schon vor dem Zweiten Weltkrieg ein Ausfuhrverbot. Zu den heutigen Rechtsgrundlagen:
http://www.bda.at/organisation/801/Ausfuhr
Zahlreiche Kunstwerke und Handschriften tragen Stempel des Bundesdenkmalamts vor 1993:
http://www.google.de/search?hl=de&q=%22stempel%20bundesdenkmalamt%22
Pauser kommentiert:
Für mich stellt sich weiterhin die zivilrechtliche Frage, ob denn der unbekannte Einbringer tatsächlich Eigentümer der Bücher war und damit überhaupt befugt war, einen Verkauf via dem Antiquariatshandel tätigen zu lassen? Ich kann aus den mir vorliegenden Medungen nicht erkennen, dass das Auktionshaus einen lückenlosen Nachweis der Eigentümerkette (von der Waldauf-Stiftung weg bis hin zum Einbringer) erbracht hätte …
Weiteres Update:
Die öst. Rechtslage stellt dar Josef Pauser:
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=18580&cpage=1#comment-3438

 Florian Waldauf
Florian Waldauf
Die Presseaussendung der Diözese Innsbruck spricht Klartext:
Die von Florian Waldauf, einem Berater Maximilians I., Anfang des 16. Jahrhunderts gestiftete
und über 3000 Bände umfassende Predigerbibliothek gehört zu den ältesten Büchersammlungen
Tirols und enthielt eine Vielzahl an sehr beachtenswerten Handschriften, Inkunabeln und Drucken
des 16.–18. Jahrhunderts. Die Stiftungsbibliothek wird heute von der Stadtpfarre St. Nikolaus in
Hall verwaltet und wurde 2003 von der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol in Innsbruck als
Dauerleihgabe übernommen.
Bedauerlicherweise sind der Bibliothek in ihrer wechselvollen jüngeren Geschichte gerade an
wertvollstem Buchgut erhebliche Verluste erwachsen:
Nachdem bereits im Zuge des Ersten Weltkrieges das gesamte Stiftungsvermögen untergegangen
war, kam der Bibliothek in weiterer Folge eine Vielzahl ihrer wertvollsten Objekte, darunter vor allem
Handschriften und Inkunabeln auf eine bis heute nie geklärte, wohl nicht legale Weise abhanden.
Diese Verluste gehen auf eine um bzw. nach 1938 vorsorglich durchgeführte Sicherstellung vor
den Nationalsozialisten sowie möglicherweise auch auf Bergungsmaßnahmen während des 2.
Weltkrieges zurück.
Die noch verbliebenen Buchbestände dieser Bibliothek wurden in den 1950er Jahren wieder
in das Kaplaneihaus rückgeführt und auf Veranlassung des Landesdenkmalamtes durch das
Pastoraltheologische Institut in Innsbruck neu geordnet. Im Zuge dessen soll 1964 angeblich ein
Verkauf von weniger wertvollen Druckwerken des 18. Jahrhunderts sowie von Dubletten an ein nicht
näher definiertes „Antiquariat in Ostösterreich“ erfolgt sein. Über die Rechtmäßigkeit eines solchen
Verkaufs kann bislang kein schriftlicher Nachweis erbracht werden. Dass es sich dabei um die von
Zisska & Schauer nunmehr angebotenen wertvollen Objekte handelt, kann nahezu ausgeschlossen
werden.
Aufgrund des Bücherkataloges von 1859 sowie aufgrund intensiver Recherchen in den letzten
Jahrzehnten kann heute von einem Gesamtverlust von ca. 700 Bänden ausgegangen werden.
Im Zuge der zwischen 9. und 11. November 2011 bei Zisska & Schauer in München stattfindenden
Bücherauktion wurden insgesamt 2 Handschriften, 19 Inkunabeln, also Druckerzeugnisse vor
1500, sowie über 200 Drucke des 16.-18. Jahrhunderts aus der Waldauf-Sammlung angeboten.
Aus verkaufstaktischen Gründen wurden nicht alle Bücher als der Waldauf-Bibliothek zugehörig
ausgewiesen, viele konnten im Zuge einer Einsichtnahme aufgrund eindeutiger Besitzhinweise
identifiziert werden.
Die herausragende kulturelle Bedeutung der denkmalgeschützten Waldauf-Bibliothek hat
weitreichende nationale und internationale Reaktionen auf kulturpolitischer, wissenschaftlicher,
kirchlicher und medialer Ebene ausgelöst. Dabei steht neben dem beträchtlichen Wert zahlreicher
Einzelobjekte vor allem die Option, diese für die Kulturgeschichte des Landes Tirol einzigartige
Sammlung in ihrer Geschlossenheit nach Möglichkeit zu bewahren, im Mittelpunkt.
Hierfür wurde zum einen die Rechtslage durch das Bundesdenkmalamt geprüft. Zum anderen
bemühten sich die Stadtpfarre St. Nikolaus in Hall, das Diözesanarchiv Innsbruck, die Kulturabteilung
des Landes Tirol sowie die Universitäts- und Landesbibliothek Tirol in Innsbruck, sämtliche vom
besagten Auktionshaus angebotenen Objekte der Waldauf-Bibliothek für Tirol zu sichern. Die dafür erforderlichen Mittel wurden durch finanzielle Zusicherungen seitens des Landes Tirol, der Pfarre Hall
und weiterer Sponsoren garantiert.
Seitens der Geldgeber kam grundsätzlich nur der Erwerb des Gesamtensembles in Betracht, wobei die Bücher im Gesamtpaket aus der Auktion herausgekauft werden sollten. Dagegen bestand
das Auktionshaus unter Berufung auf den Einbringer aus geschäftspolitischen Gründen letztlich darauf, die wertvollsten Objekte, nämlich die Handschriften und Inkunabeln, einzeln zu versteigern. Für die restlichen, weniger wertvollen Werke wurden unmittelbar vor Auktionsbeginn über den Schätzpreis hinausgehende sowie dem Wert und konservatorischen Zustand der Objekte keineswegs angemessene Forderungen gestellt.
Der angestrebte geschlossene Erwerb wäre im Hinblick auf die Einzelversteigerung nicht mehr gewährleistet gewesen. Insgesamt schien die Verwendung öffentlicher Gelder aufgrund des äußerst
risikoreichen Ausgangs der Auktion nicht mehr vertretbar.
Trotz intensivster Bemühungen bis unmittelbar vor Auktionsbeginn am Mittwoch war es nicht möglich, dieses einmalige kulturelle Erbe für das Land Tirol zu retten.
Für die Übermittlung dieses Textes und weitere Auskünfte danke ich Kollegen Diözesanarchivar Dr. Kapferer, Innsbruck.
Frühere Beiträge in Archivalia zur Waldauf-Bibliothek:
http://archiv.twoday.net/search?q=waldauf
KOMMENTAR:
Positiv zu vermerken ist, dass alle Beteiligten an einem Strang gezogen haben, um den Restbestand für Tirol zu retten. Dabei wurden erhebliche Geldsummen von Sponsoren eingeworben. Die Entscheidung, den Gesamtbestand aufzukaufen, also das archivische Provenienzprinzip gegen das verhängnisvolle bibliothekarische "Dublettendenken" zu setzen, verdient ebenfalls Respekt.
Die Juristen des Denkmalamts sahen keine Möglichkeit, gegen das Auktionshaus vorzugehen, da sowohl die Verbringung ins Ausland vor 1993 erfolgte (Voraussetzung der Rückforderung) als auch Straftatbestände verjährt waren.
Ein Team der Sondersammlungen der UB innsbruck hat den gesamten Bestand der Auktion gesichtet und erfasst (ob Fotos gemacht wurden oder gemacht werden durften, weiss ich nicht), insbesondere Vorprovenienzen notiert. Dabei hat sich herausgestellt, dass in erheblichem Umfang Waldauf-Bibliotheksgut im Katalog nicht als solches gekennzeichnet war. Aus meiner Sicht spricht einiges dafür, diese für mich durchaus "betrügerische" Fehlinformation potentieller Käufer als wettbewerbswidrige Irreführung nach dem UWG zu werten.
Es wäre schön gewesen, wenn Bibliotheken in der Causa Donaueschingen oder bei späteren Kulturgutverlusten, die ich seit 1994 dokumentiere, eine solche Bestandsdokumentation, die ja leider nur rudimentär sein konnte, durchgeführt hätten. Denn an den Katalogen der Händler hat man, wie hier schlagend erwiesen, wenig Freude. Diese verschweigen und verschleiern Provenienzen oder geben sie in irreführender Weise an.
Die verfügbaren Quellen insbesondere im Kirchenarchiv Hall wurden intensiv gesichtet, was aber hinsichtlich der entscheidenden Fragen ergebnislos blieb. Die FAZ schrieb vor der Auktion:
Schon vor der Auktion bei Zisska & Schauer sorgen Bücher der „Waldauf Bibliothek“ für Aufsehen: Florian Waldauf Ritter von Waldenstein und seine Frau Barbara stifteten 1501 der Pfarrkirche in Hall in Tirol eine Kapelle samt Predigtamt und Bibliothek. Während des Zweiten Weltkriegs wurde eine unbekannte Zahl wertvoller Schriften zum Schutz an Privatpersonen gegeben, jedoch nie rückerstattet. Bereits in der Vergangenheit tauchten immer wieder Waldauf-Bände im Handel auf. Ein 1983 angelegter Katalog zählt noch etwas mehr als 2000 Titel; heute bewahrt die Universitätsbibliothek Innsbruck diese unter Denkmalschutz stehende gotische Bibliothek als Leihgabe.
Nach Auskunft des Auktionshauses stammt die Einlieferung aus deutschem Privatbesitz, in den sie über ein „ostösterreichisches Antiquariat“ gelangt sei. Sie umfasst eine Handschrift - Briefe des Hieronymus, 1435 zu Papier gebracht (6000) - und elf Inkunabeln, darunter eine Prediktlehre mit Exlibris von Wolfgang Crener, dem ersten Prediger der Haller Stiftung (6000), und eine lateinische Koberger-Bibel von 1493 (10.000). Dazu kommen rund 170 Losnummern an Drucken aus den Jahren 1501 bis 1785, darunter zwei große Konvolute. Pfarrer Jakob Patsch von der zuständigen Gemeinde in Hall sagt, man wolle alles tun, um die Bücher zurückzubekommen, und sei auf der dringenden Suche nach Sponsoren; denn die Stiftung sei längst vollkommen mittellos.
Dieses ostösterreichische Antiquariat ist allem nach eine "Legende". Irgendwelche belastbaren Fakten zu diesem angeblichen Verkauf durch Jesuiten konnten nicht aufgefunden werden. Insbesondere gab es keine Einnahmen für die Pfarre Hall in Tirol, was ja wohl Voraussetzung einer legalen Veräußerung gewesen wäre.
Auch hinsichtlich der Entfremdung der Bestände konnte nur mündliche Überlieferung ermittelt werden, die dann auch zu der Aussage Brunners geführt hat, dass die Bücher aus Furcht vor der Beschlagnahmung durch die Nazis an Privatleute gegeben wurden. Die in einem Kommentar in diesem Weblog geäußerte Ansicht, die Entfremdung habe womöglich schon vor 1938 stattgefunden, ist abwegig:
http://archiv.twoday.net/stories/42999544/#49594897
1. Ganz offenkundig war die Bibliothek zum Zeitpunkt, als sie Prof. Mayrhofer in den Tiroler Heimatblättern 1938 beschrieb, noch intakt. Von früheren Verlusten weiß er nichts, er nennt ca. 80 Inkunabeln. Heutiger Bestand: 16 (Brunner VÖB-Mitt. 2003) bzw. 14 (UB Innsbruck, Website) bzw. 13 Titel laut GW. 1914 erfasste der GW laut Brunner 2003 61 Titel (Goldschmidt ZfB 1916: 70 Titel), Brunner in den Tiroler Heimatblätter nennt im Titel 64 verschollene Inkunabeln. Mayrhofer nennt die Titel einiger inzwischen verschwundener Inkunabeln, die sich nicht im GW-Verzeichnis finden.
2. Die Festschrift der von Florian Waldauf gegründeten Haller Stubengesellschaft 1958 aus der Feder von Ernst Verdroß-Droßberg, gewidmet Florian Waldauf, bestätigt eindeutig die Angabe Brunners, dass die Verluste in der NS-Zeit eingetreten seien: "Leider gingen während des letzten Krieges wertvolle Handschriften und Drucke verloren" (S. 41).
Es kann so gut wie ausgeschlossen werden, dass so wertvolle Bestände wie Handschriften und Inkunabeln 1964 an ein "ostösterreichisches Antiquariat" veräußert worden. Die diesbezügliche Angabe sehe ich persönlich als dicke fette Lüge, um einen illegalen Bestand mit einer "Legende" zu versehen, die im Einklang mit den Ausführungen Brunners im Handbuch der historischen Buchbestände steht. Über den Einlieferer war natürlich nichts zu erfahren, es soll sich um einen deutschen Staatsbürger handeln, der den Bestand schon seit längerer Zeit besitzt.
Da man auf Verhandlungen gesetzt hat, die sich zunächst auch gut anließen, ist es verständlich, dass man eine einstweilige Verfügung durch ein deutsches Gericht, die den Verkauf hätte stoppen können, nicht in Betracht gezogen hat.
Wenn es einen Preis für Skrupellosigkeit im Umgang mit Kulturgut in Deutschland 2011 gäbe, so hätten ihn der Einlieferer und das Auktionshaus sich verdient. Hätte es sich um jüdische Alteigentümer gehandelt, wäre die ganze Sache völlig anders abgelaufen. Tatsache ist, dass die unbefriedigende Rechtslage schamlos von einem gewissenlosen Auktionshaus und einem Besitzer ausgenutzt wurden, um eine fromme Stiftung um einen Teil ihres Stiftungsvermögens und das Land Tirol um einen Teil seines historischen Kulturguts zu prellen.
Dass Antiquariate in dieser Weise agieren können, ohne dass ihnen jemand einen Strich durch die Rechnung macht, und dass sie Kumpane als Käufer haben, die solche Ware schamlos erwerben, ist der eigentliche Skandal.
Der ILAB-Code sagt: Die "affiliates" sind dafür verantwortlich, dem Käufer den Rechtsanspruch auf die verkauften Artikel zu übergeben und werden nicht wissentlich gestohlenes Material kaufen, besitzen oder verkaufen. Die "affiliates" unternehmen alle zumutbaren Bemühungen, um sich davon zu versichern, dass alle von ihnen angebotenen Artikel Eigentum des Verkäufers waren. Weiterhin unternehmen sie alle zumutbaren Bemühungen, den Diebstahl von antiquarischen Büchern und damit zusammenhängendem Material zu verhindern. Sie arbeiten mit den Behörden zusammen, um zur Ergreifung der Täter beizutragen.
Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wahr, dass die von Zisska verkauften Stücke gestohlen waren. Dann ist mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Zisska als Hehler zu betrachten, denn hier wurde bewusst in Kauf genommen, das die Stücke gestohlen waren. Irgendwelche konkreten Gegenbeweise zur Herkunft - z.B. Angaben, was das für ein ostösterreichisches Antiquariat war - hat Zisska nicht vorgelegt. Der Hinweis auf dieses mysteriöse Antiquariat hat den gleichen Status wie der ominöse "Dachbodenfund". Die Stücke können im übrigen Österreich unter keinen Umständen legal verlassen haben, denn Ausfuhrbeschränkungen gab es schon in den 1920er Jahren.
Zisska ist auch nicht an den aus meiner Sicht einzig rechtmäßigen Eigentümer, die Waldauf-Stiftung, vertreten durch die Pfarrei Hall, herangetreten, als im Mai 2011 bereits Inkunabeln aus der Stiftung versteigert wurden. Und da ich Pfarrer Patsch die Nachricht von der jetzigen Auktion telefonisch überbracht habe, erfolgte auch jetzt keine Information.
Man kann sich wirklich nur für den Antiquariatshandel schämen und hoffen, dass irgendwann der Handel mit Kulturgut in ähnlicher Weise reglementiert wird wie der Handel mit Antiken oder mit Elfenbein. Es muss also der Gesetzgeber tätig werden. Und die Öffentlichkeit bzw. die Fachleute sollten Antiquariate wie Zisska konsequent ächten und deren Kunden, die solche Stücke kaufen, ebenso.
Zum Thema halbseidene Antiquare:
http://archiv.twoday.net/search?q=halbseiden
Nachtrag:
Josef Pauser geht ebenfalls auf das traurige Ergebnis ein:
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=18580
Enttäuscht über die gescheiterten Verhandlungen zeigte sich am Mittwoch auch Kulturlandesrätin Beate Palfrader, auf deren Initiative hin das Land sich in der Sache engagiert hatte, denn: „Leider war der angestrebte Ankauf der Waldauf-Bibliothek letztlich trotz intensiver Bemühungen des Landes nicht durchführbar, weil die Forderungen des Auktionshauses in München und des Einbringers der Buchbestände immer unvertretbarer wurden. Seitens des Landes stellt es sich so dar, dass das Auktionshaus in München nie wirklich ernsthaft an einem Verkauf interessiert war“, so Palfrader.
Das sei, erklärte die Landesrätin, „sehr bedauerlich“, weil sich das Land, die Pfarre Hall und die Universitäts- und Landesbibliothek sehr engagiert hätten und auch bereit waren, „einen hohen finanziellen Einsatz zu leisten“. Zudem habe man eine private Stiftung dafür gewinnen können, „sich ebenfalls mit einem namhaften Betrag am Ankauf zu beteiligen“. Die konkreten Beträge, die zur Rettung der Waldauf-Bestände hätten bereitgestellt werden sollen, blieben am Mittwoch freilich ebenso ungenannt wie die Höhe der Forderungen, die in München gestellt wurden.
So die Tiroler Tageszeitung
http://www.tt.com/csp/cms/sites/tt/Nachrichten/3745962-6/tiroler-kulturschatz-wird-zerschlagen.csp
In einem weiteren Artikel heißt es: Das Bundesdenkmalamt hatte zuvor rechtliche Schritte geprüft, allerdings sei man auf diesem Wege nicht weitergekommen, erklärt Reinhard Rampold vom Landeskonservatoriat Tirol: Der Münchner Auktionator habe den Einbringer bestätigen lassen, dass er die Waldauf-Bestände schon vor Inkrafttreten jenes Gesetzes besessen habe, das die Ausfuhr von Antiquitäten aus Österreich verbietet.
Das ist nach meiner Einschätzung eine Fehldarstellung, denn es gab meines Wissens schon vor dem Zweiten Weltkrieg ein Ausfuhrverbot. Zu den heutigen Rechtsgrundlagen:
http://www.bda.at/organisation/801/Ausfuhr
Zahlreiche Kunstwerke und Handschriften tragen Stempel des Bundesdenkmalamts vor 1993:
http://www.google.de/search?hl=de&q=%22stempel%20bundesdenkmalamt%22
Pauser kommentiert:
Für mich stellt sich weiterhin die zivilrechtliche Frage, ob denn der unbekannte Einbringer tatsächlich Eigentümer der Bücher war und damit überhaupt befugt war, einen Verkauf via dem Antiquariatshandel tätigen zu lassen? Ich kann aus den mir vorliegenden Medungen nicht erkennen, dass das Auktionshaus einen lückenlosen Nachweis der Eigentümerkette (von der Waldauf-Stiftung weg bis hin zum Einbringer) erbracht hätte …
Weiteres Update:
Die öst. Rechtslage stellt dar Josef Pauser:
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=18580&cpage=1#comment-3438

 Florian Waldauf
Florian WaldaufAnnelen Ottermann schrieb gerade in der Provenienz-Liste:
bitte beachten Sie die aktuelle Stellungnahme der Mainzer Bibliotheksgesellschaft, die den Stand nach der Presseerklärung vom 10.11. zum Kommunalen Sparpaket wiedergibt.
http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/bibliothek-in-not/stellungnahmen-der-mbg.html
Der zentrale Punkt der Petition, die Erhaltung der historischen Sammlung als Ganzes, ist damit in Sicht, erfreulicherweise zunächst auch im 100 Jahre alten Bibliotheksgebäude.
Soweit die gute Nachricht.
Ganz und gar nicht gut dagegen ist die Perspektive, dass das Personal der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek in den nächsten 11-12 Jahren auf die Hälfte reduziert werden wird, Dienstleistungen entsprechend wegfallen müssen und dass der Erwerbungsetat halbiert, ja perspektivisch sogar noch weiter bis auf einen kaum mehr nennenswerten Sockelbetrag heruntergefahren werden wird. Im günstigsten Fall werden wir längerfristig ausgewählte Forschungsliteratur zu den historischen Beständen und Regionalliteratur auf niedrigem finanziellen Niveau erwerben können. Darüber hinaus wird der Bestand nicht wachsen können, soll also offensichtlich auf dem jetzigen Stand eingefroren werden. Auch wenn wir unter diesen Bedingungen künftig vor allem die weitere Erschließung von Handschriften, Rara und Alten Drucken betreiben werdem, steht zu befürchten, dass die Bürger mit den Füßen abstimmen werden!
Wenn der Stadtrat in seiner Sitzung vom 14.12. dem Sparpaket zustimmen wird, hören wir auf, eine normale, i.e. lebendige, Bibliothek zu sein!
Ich grüße Sie alle herzlich und danke Ihnen, wenn Sie die Petition durch Ihre Meinungsbeiträge weiterhin unterstützen. Das bleibt wichtig, gerade nach dieser erschreckenden Perspektive!
http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/bibliothek-in-not/meinungsbeitraege.html
Dies als Nachricht am 11.11. aus der Stadt der Narren zum Beginn der Fastnachts-Kampagne 2011. Uns bleibt das Lachen im Halse stecken.
Aus der Stellungnahme der Bibliotheksgesellschaft:
Die Ampelkoalition hat sich dahingehend geeinigt, dass auf einen Umzug der Stadtbibliothek aus dem bisherigen Gebäude in der Rheinallee 3 B vorerst verzichtet werden soll. Die für einen Umzug vorgesehenen Gelder sollen in den Gebäudeerhalt fließen. Ziel der Petition, die wertvollen, zum Teil mehrere hundert Jahre alten Bestände zusammenzuhalten und sie zugleich den Nutzerinnen und Nutzer frei zugänglich zu machen, wurde erreicht. Teil des vorgesehenen veränderten Bibliothekskonzeptes ist allerdings auch, dass künftig einige Dienstleistungen entfallen werden und in den nächsten zehn Jahren der Stellenplan zu unserem großen Bedauern reduziert werden wird. Dies ist bei aller Erleichterung über die geschlossenen Beschlüsse schmerzlich festzustellen.
Das Sparpaket zur Beteiligung am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz bedarf noch der Zustimmung des Stadtrates, die in der Sitzung am 14.12.2011 erfolgen soll.
Daher bitten wir Sie nach wie vor: Zeichnen Sie weiterhin unsere Petition und bringen Sie mit Ihrer Unterschrift Ihre Unterstützung zum Erhalt der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Mainz und für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort zum Ausdruck, damit möglichst viele Stellen erhalten bleiben.

bitte beachten Sie die aktuelle Stellungnahme der Mainzer Bibliotheksgesellschaft, die den Stand nach der Presseerklärung vom 10.11. zum Kommunalen Sparpaket wiedergibt.
http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/bibliothek-in-not/stellungnahmen-der-mbg.html
Der zentrale Punkt der Petition, die Erhaltung der historischen Sammlung als Ganzes, ist damit in Sicht, erfreulicherweise zunächst auch im 100 Jahre alten Bibliotheksgebäude.
Soweit die gute Nachricht.
Ganz und gar nicht gut dagegen ist die Perspektive, dass das Personal der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek in den nächsten 11-12 Jahren auf die Hälfte reduziert werden wird, Dienstleistungen entsprechend wegfallen müssen und dass der Erwerbungsetat halbiert, ja perspektivisch sogar noch weiter bis auf einen kaum mehr nennenswerten Sockelbetrag heruntergefahren werden wird. Im günstigsten Fall werden wir längerfristig ausgewählte Forschungsliteratur zu den historischen Beständen und Regionalliteratur auf niedrigem finanziellen Niveau erwerben können. Darüber hinaus wird der Bestand nicht wachsen können, soll also offensichtlich auf dem jetzigen Stand eingefroren werden. Auch wenn wir unter diesen Bedingungen künftig vor allem die weitere Erschließung von Handschriften, Rara und Alten Drucken betreiben werdem, steht zu befürchten, dass die Bürger mit den Füßen abstimmen werden!
Wenn der Stadtrat in seiner Sitzung vom 14.12. dem Sparpaket zustimmen wird, hören wir auf, eine normale, i.e. lebendige, Bibliothek zu sein!
Ich grüße Sie alle herzlich und danke Ihnen, wenn Sie die Petition durch Ihre Meinungsbeiträge weiterhin unterstützen. Das bleibt wichtig, gerade nach dieser erschreckenden Perspektive!
http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/bibliothek-in-not/meinungsbeitraege.html
Dies als Nachricht am 11.11. aus der Stadt der Narren zum Beginn der Fastnachts-Kampagne 2011. Uns bleibt das Lachen im Halse stecken.
Aus der Stellungnahme der Bibliotheksgesellschaft:
Die Ampelkoalition hat sich dahingehend geeinigt, dass auf einen Umzug der Stadtbibliothek aus dem bisherigen Gebäude in der Rheinallee 3 B vorerst verzichtet werden soll. Die für einen Umzug vorgesehenen Gelder sollen in den Gebäudeerhalt fließen. Ziel der Petition, die wertvollen, zum Teil mehrere hundert Jahre alten Bestände zusammenzuhalten und sie zugleich den Nutzerinnen und Nutzer frei zugänglich zu machen, wurde erreicht. Teil des vorgesehenen veränderten Bibliothekskonzeptes ist allerdings auch, dass künftig einige Dienstleistungen entfallen werden und in den nächsten zehn Jahren der Stellenplan zu unserem großen Bedauern reduziert werden wird. Dies ist bei aller Erleichterung über die geschlossenen Beschlüsse schmerzlich festzustellen.
Das Sparpaket zur Beteiligung am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz bedarf noch der Zustimmung des Stadtrates, die in der Sitzung am 14.12.2011 erfolgen soll.
Daher bitten wir Sie nach wie vor: Zeichnen Sie weiterhin unsere Petition und bringen Sie mit Ihrer Unterschrift Ihre Unterstützung zum Erhalt der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Mainz und für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort zum Ausdruck, damit möglichst viele Stellen erhalten bleiben.

KlausGraf - am Freitag, 11. November 2011, 22:35 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://openpetition.de/petition/online/der-bestand-der-wissenschaftlichen-stadtbibliothek-mainz-darf-nicht-zerschlagen-werden
Meinungsbeiträge:
http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/bibliothek-in-not/meinungsbeitraege.html
Zum Thema
http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbib+mainz

Meinungsbeiträge:
http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/bibliothek-in-not/meinungsbeitraege.html
Zum Thema
http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbib+mainz

KlausGraf - am Freitag, 11. November 2011, 19:45 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.niemanlab.org/2011/11/wired-releases-images-via-creative-commons-but-reopens-a-debate-on-what-noncommercial-means/
Der Artikel stellt einmal wieder fest, dass es schwierig ist, kommerzielle und nicht-kommerzielle Nutzungen voneinander abzugrenzen.

Wired verlangt Namensnennung:
Photo: Jim Merithew/Wired.com
Sodann (das ist gemäß CC-Lizenz zulässig) Verlinkung des Originalbeitrags (wobei dieser bei obigem Bild aus der Top-50-Auswahl nur auf Flickr, nicht aber bei der Ankündigung der CC-Lizenz angegeben ist!):
http://www.wired.com/gadgetlab/2010/05/maker-faire-2010/all/1
Und es muss natürlich wie immer bei CC die Lizenz verlinkt werden:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.en
Der Artikel stellt einmal wieder fest, dass es schwierig ist, kommerzielle und nicht-kommerzielle Nutzungen voneinander abzugrenzen.

Wired verlangt Namensnennung:
Photo: Jim Merithew/Wired.com
Sodann (das ist gemäß CC-Lizenz zulässig) Verlinkung des Originalbeitrags (wobei dieser bei obigem Bild aus der Top-50-Auswahl nur auf Flickr, nicht aber bei der Ankündigung der CC-Lizenz angegeben ist!):
http://www.wired.com/gadgetlab/2010/05/maker-faire-2010/all/1
Und es muss natürlich wie immer bei CC die Lizenz verlinkt werden:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.en
KlausGraf - am Freitag, 11. November 2011, 12:57 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Wieviel Prestige und Ehrlichkeit verbirgt sich hinter der Montage vom neuen Landesarchiv im Duisburger Innenhafen? Ob dieser Bau fertig gestellt wird bleibt offen. Protz oder Schönheit? Verschwendung oder Notwendigkeit? Wenn Justitia schweigt, tanzt das Ruhrgespenst.
Macht euch auf und tanzt euch frei. Surft durchs Netz und recherchiert zum Landesarchiv.
Blogt eure Netzfunde als Kommentar. Wir wollen alles wissen!
Wir sind der Meinung Kunst braucht keine Genehmigung,
Verschwendung aber schon!
Das Ruhrgespenst und sein Affe!
PS: RUHR YORK IS WHERE YOUR HEART IS!"
Wolf Thomas - am Freitag, 11. November 2011, 11:43 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
UB Tübingen Mh 6/1:
http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/Mh6-1
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/38723979/

http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/Mh6-1
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/38723979/

KlausGraf - am Freitag, 11. November 2011, 05:42 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Gesichte und Offenbarungen der Schwester "Magdalene Butlerin" geb. 1407 wurden 1853 in Köln aus der Brentano-Bibliothek verkauft (S. 5 Nr. 46):
http://archiv.twoday.net/stories/49608585/
Der Handschriftencensus hat die Handschrift offenkundig nicht. Als Gesamtüberlieferung des Magdalenenbuchs, das sich dem Leben und den Visionen der Klarissin Magdalena Beutlerin von Freiburg widmet, werden dort 5 Handschriften aufgeführt, von denen nur die 1491 datierte der Mainzer Stadtbibliothek den ganzen Text in mittelalterlicher Fassung bietet (also eine Vollhandschrift ist).
http://www.handschriftencensus.de/werke/994
Ohne Google hätte ich sicher nicht herausgefunden, dass ein Kölner Franziskanerinnenkonvent den Brentano-Codex erworben hat. Er taucht im Verzeichnis der kleineren Archive der Rheinprovinz Bd. 1, S. 261 als Eigentum des Dreikönigenklosters der Franziskanerinnen in Mülheim am Rhein, heute Köln-Mülheim auf:
http://www.archive.org/stream/bersichtberdeni01tillgoog#page/n274/mode/2up
Die Handschrift wird ins Ende des 15. Jahrhundert datiert, die Datierung der Vorlage 1448 verweist deutlich aufs Magdalenenbuch - wie auch der bei der Versteigerung 1853 gewählte Titel. Der Textbeginn ist ungewöhnlich, die Mainzer Handschrift beginnt nicht mit dem Brief der Klausnerin Katharina von Beuggen, der schon im Cgm 5134 erscheint. Siehe dazu Schleußner im Katholik 1907:
http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/kath_1907_035/0032
Das Internet hilft zwar viel, aber die passenden Franziskanerinnen zu finden, die das 1975 aufgegebene Dreikönigen-Hospital betreuten,
http://de.wikipedia.org/wiki/Keupstra%C3%9Fe
erscheint mir aussichtslos. Vermutlich werden sie irgendwann die Handschrift wieder verkauft haben. Aber ich versuche der Sache nachzugehen.
Nachtrag: Kollege Helbach gab den Hinweis, dass es die Aachener Franziskanerinnen waren: "Ausweislich Handbuch des Erzbistums 1933, S. 404 (Pfarreienartikel Mülheim, Liebfrauen (Anstalten)) und entspr. S. 699 (S. 684 ff. Zusammenstellung weibliche Orden) waren es die Franzisanerinnen aus dem Mutterhaus in Aachen, Lindenplatz 2 (Arme Schwestern vom Hl. Franziskus); 32 Schwestern gab es damals in dem Krankenhaus in der Keupstr. 2-4 in Köln-Mülheim." Heute: http://www.schervier-orden.de . Hinsichtlich des HAEK und des Pfarrarchivs Mülheim (in Schachteln verpackt, daher derzeit nicht zugänglich) spricht nichts dafür, dass das Stück dort gelandet ist.
Wie bereits vermutet ist im Aachener Mutterhaus der Franziskanerinnen nicht das geringste über die Handschrift bekannt (freundliche telefonische Auskunft der Archivarin Sr. Amabilis). Nach den Ordensvorschriften hätte sie im Mutterhaus ankommen müssen, wäre sie bei der Auflösung des Konvents noch vorhanden gewesen.
Update: Exzerpte aus dem Magdalenenbuch in der Trierer Hs. 785/1365 8°, dem Handschriftencensus am 5.2.2012 unbekannt:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0508_b321_jpg.htm (Bushey 1996!!)
http://archiv.twoday.net/stories/1022439843/
#forschung
http://archiv.twoday.net/stories/49608585/
Der Handschriftencensus hat die Handschrift offenkundig nicht. Als Gesamtüberlieferung des Magdalenenbuchs, das sich dem Leben und den Visionen der Klarissin Magdalena Beutlerin von Freiburg widmet, werden dort 5 Handschriften aufgeführt, von denen nur die 1491 datierte der Mainzer Stadtbibliothek den ganzen Text in mittelalterlicher Fassung bietet (also eine Vollhandschrift ist).
http://www.handschriftencensus.de/werke/994
Ohne Google hätte ich sicher nicht herausgefunden, dass ein Kölner Franziskanerinnenkonvent den Brentano-Codex erworben hat. Er taucht im Verzeichnis der kleineren Archive der Rheinprovinz Bd. 1, S. 261 als Eigentum des Dreikönigenklosters der Franziskanerinnen in Mülheim am Rhein, heute Köln-Mülheim auf:
http://www.archive.org/stream/bersichtberdeni01tillgoog#page/n274/mode/2up
Die Handschrift wird ins Ende des 15. Jahrhundert datiert, die Datierung der Vorlage 1448 verweist deutlich aufs Magdalenenbuch - wie auch der bei der Versteigerung 1853 gewählte Titel. Der Textbeginn ist ungewöhnlich, die Mainzer Handschrift beginnt nicht mit dem Brief der Klausnerin Katharina von Beuggen, der schon im Cgm 5134 erscheint. Siehe dazu Schleußner im Katholik 1907:
http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/kath_1907_035/0032
Das Internet hilft zwar viel, aber die passenden Franziskanerinnen zu finden, die das 1975 aufgegebene Dreikönigen-Hospital betreuten,
http://de.wikipedia.org/wiki/Keupstra%C3%9Fe
erscheint mir aussichtslos. Vermutlich werden sie irgendwann die Handschrift wieder verkauft haben. Aber ich versuche der Sache nachzugehen.
Nachtrag: Kollege Helbach gab den Hinweis, dass es die Aachener Franziskanerinnen waren: "Ausweislich Handbuch des Erzbistums 1933, S. 404 (Pfarreienartikel Mülheim, Liebfrauen (Anstalten)) und entspr. S. 699 (S. 684 ff. Zusammenstellung weibliche Orden) waren es die Franzisanerinnen aus dem Mutterhaus in Aachen, Lindenplatz 2 (Arme Schwestern vom Hl. Franziskus); 32 Schwestern gab es damals in dem Krankenhaus in der Keupstr. 2-4 in Köln-Mülheim." Heute: http://www.schervier-orden.de . Hinsichtlich des HAEK und des Pfarrarchivs Mülheim (in Schachteln verpackt, daher derzeit nicht zugänglich) spricht nichts dafür, dass das Stück dort gelandet ist.
Wie bereits vermutet ist im Aachener Mutterhaus der Franziskanerinnen nicht das geringste über die Handschrift bekannt (freundliche telefonische Auskunft der Archivarin Sr. Amabilis). Nach den Ordensvorschriften hätte sie im Mutterhaus ankommen müssen, wäre sie bei der Auflösung des Konvents noch vorhanden gewesen.
Update: Exzerpte aus dem Magdalenenbuch in der Trierer Hs. 785/1365 8°, dem Handschriftencensus am 5.2.2012 unbekannt:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0508_b321_jpg.htm (Bushey 1996!!)
http://archiv.twoday.net/stories/1022439843/
#forschung
KlausGraf - am Freitag, 11. November 2011, 03:57 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die beiden Verkaufskataloge von 1819 und 1853 (siehe Gajek, Clemens und Christian Brentanos Bibliotheken, 1974) sind online:
http://picus.sns.it/biblioteche_dei_filosofi/index.php?page=Filosofo&id=9&lang=it
http://picus.sns.it/index.php?page=Filosofo&id=10&lang=it
Im Katalog von 1853 findet man etwa mgo 224, den Fechter in seinem Inzigkofen-Buch mit anderen Handschriften aus diesem Stift, die an die Brüder gelangten, S. 49 erwähnt (aber nicht im Katalog der Handschriften selbst) auf S. 2 Nr. 5:
http://www.handschriftencensus.de/9227
Brentano S. 2f. Nr. 7 ist mgq 730 mit der Vita Elisabeths von Kirchberg:
http://www.handschriftencensus.de/4500
http://kups.ub.uni-koeln.de/1596/
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0603c_b369_jpg.htm (Degerings Provenienzregister nennt Q 730 für Brentano)
S. 3 Nr. 8 ist mgf 741. Nemes 2009 zitierte meinen Beitrag zu Felicitas Lieberin (in Medlingen), während der Handschriftencensus das - in diesem Eintrag - natürlich nicht für nötig hält:
http://archiv.twoday.net/stories/4230116/
S. 4 Nr. 27 stammt ebenfalls von der Lieberin und wurde jüngst in St. Petersburg wiedergefunden:
http://www.handschriftencensus.de/21883
S. 3 Nr. 15 ist die Finck-Handschrift Wien 13671
http://www.handschriftencensus.de/15924
Siehe auch:
http://archiv.twoday.net/stories/49608610/
#forschung
http://picus.sns.it/index.php?page=Filosofo&id=10&lang=it
Im Katalog von 1853 findet man etwa mgo 224, den Fechter in seinem Inzigkofen-Buch mit anderen Handschriften aus diesem Stift, die an die Brüder gelangten, S. 49 erwähnt (aber nicht im Katalog der Handschriften selbst) auf S. 2 Nr. 5:
http://www.handschriftencensus.de/9227
Brentano S. 2f. Nr. 7 ist mgq 730 mit der Vita Elisabeths von Kirchberg:
http://www.handschriftencensus.de/4500
http://kups.ub.uni-koeln.de/1596/
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0603c_b369_jpg.htm (Degerings Provenienzregister nennt Q 730 für Brentano)
S. 3 Nr. 8 ist mgf 741. Nemes 2009 zitierte meinen Beitrag zu Felicitas Lieberin (in Medlingen), während der Handschriftencensus das - in diesem Eintrag - natürlich nicht für nötig hält:
http://archiv.twoday.net/stories/4230116/
S. 4 Nr. 27 stammt ebenfalls von der Lieberin und wurde jüngst in St. Petersburg wiedergefunden:
http://www.handschriftencensus.de/21883
S. 3 Nr. 15 ist die Finck-Handschrift Wien 13671
http://www.handschriftencensus.de/15924
Siehe auch:
http://archiv.twoday.net/stories/49608610/
#forschung
KlausGraf - am Freitag, 11. November 2011, 01:35 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blogs.princeton.edu/rarebooks/2011/11/_frances_wolfreston_the_web.html
University of Pennsylvania Libraries project cataloging the Culture Class Collection http://www.flickr.com/photos/58558794@N07/
Smith College • Mortimer Rare Book Room http://www.flickr.com/photos/bibliography/
David Pearson • English book owners in the seventeenth century http://www.flickr.com/photos/49849376@N06/
University of Glasgow Library http://www.flickr.com/photos/uofglibrary/sets/72157626041343415/
Heraldic Bookplates (Group pool) http://www.flickr.com/groups/1000356@N20/
Pratt Libraries Ex Libris Collection http://www.flickr.com/photos/34900073@N07/sets/72157613160345964/
University of Pennsylvania Libraries project cataloging the Culture Class Collection http://www.flickr.com/photos/58558794@N07/
Smith College • Mortimer Rare Book Room http://www.flickr.com/photos/bibliography/
David Pearson • English book owners in the seventeenth century http://www.flickr.com/photos/49849376@N06/
University of Glasgow Library http://www.flickr.com/photos/uofglibrary/sets/72157626041343415/
Heraldic Bookplates (Group pool) http://www.flickr.com/groups/1000356@N20/
Pratt Libraries Ex Libris Collection http://www.flickr.com/photos/34900073@N07/sets/72157613160345964/
KlausGraf - am Freitag, 11. November 2011, 01:21 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://picus.sns.it/biblioteche_dei_filosofi/index.php?page=Home&lang=de
Das italienische Portal enthält auch digitalisierte Materialien (Buchkataloge), auch auf Deutsch und aus der frühen Neuzeit.
Via
http://filosofiastoria.wordpress.com/2011/11/07/biblioteca-dei-filosofi-biblioteche-filosofiche-private-in-eta-moderna-e-contemporanea/
Das italienische Portal enthält auch digitalisierte Materialien (Buchkataloge), auch auf Deutsch und aus der frühen Neuzeit.
Via
http://filosofiastoria.wordpress.com/2011/11/07/biblioteca-dei-filosofi-biblioteche-filosofiche-private-in-eta-moderna-e-contemporanea/
KlausGraf - am Freitag, 11. November 2011, 01:04 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
KlausGraf - am Freitag, 11. November 2011, 00:58 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
falls Sie sich auch für den Beitrag von Dr. Harald Müller
Die Erschließung von Nachlässen und der Datenschutz
in /RBD 40/2010, 81-89/
interessieren. Das Heft mit dem Beitrag ist jetzt erschienen und falls
Ihnen eine Fernleihe nicht möglich oder zu lästig ist, ich habe den
Beitrag hier
http://www.ajbd.de/veroeff/rbd/einzelneBeitraege/rbd2010-23-01-Mueller-NachlaesseDatenschutz.pdf
online gestellt.
Gerade Archivare dürften dafür sehr dankbar sein. Zitat:
Die Erschließung eines Nachlasses kann zu Konflikten mit datenschutzrechtlichen Vorschriften führen. Soweit der Nachlass unveröffentlichte
Werke noch lebender Dritter enthält, kann deren Verzeichnung vorerst
nur kursorisch in Listen erfolgen. Dies betrifft hauptsächlich Briefe von
dritter Hand. Für eine detaillierte Katalogisierung ist die Zustimmung
der Briefschreiber einzuholen. Der Aufwand hierfür dürfte erheblich sein.
Deshalb kann man einem Nachlassbearbeiter nur den Rat geben, mit der
detaillierten Katalogisierung von Briefen Dritter in einem handschriftlichen Nachlass so viele Jahre zu warten, bis mutmaßlich kein Briefschreiber mehr am Leben ist. Als Richtwert könnte der Zeitraum von 30 Jahren
dienen, der sich in den meisten Archivgesetzen findet. Sollten allerdings,
aus welchen Gründen auch immer wichtige und deshalb zu verzeichnende, Briefe noch lebender Dritter in einem Nachlass gefunden werden, so
ist eine Katalogisierung nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Betroffenen zulässig
Müller übersieht, dass de lege ferenda ohne größere Probleme das Problem beseitigt werden könnte. Ich habe mich zwar bei meinem Vorschlag für das Thüringer Bibliotheksgesetz
http://archiv.twoday.net/stories/4834214/
primär auf die Übernahme bezogen, aber die Erschließung ausdrücklich einbezogen. Dank Herrn Steinhauer wurde mein Vorschlag Gesetz:
http://archiv.twoday.net/stories/5094326/
§ 4 Abs. 3 des Thüringer Bibliotheksgesetzes lautet:
3) Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten
lebender Personen bei der Übernahme, Erschließung und
Nutzbarmachung von Nachlässen durch Bibliotheken gelten
die Vorschriften des Thüringer Archivgesetzes entsprechend.
Für mich völlig unverständlich und nur durch mangelnde Unterstützung der beteiligten Bibliotheksverbände erklärlich ist der Umstand, dass die späteren Bibliotheksgesetze in Sachsen-Anhalt und Hessen dem Thüringer Vorbild nicht gefolgt sind:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bibliotheksgesetz#Aktuelle_Gesetze_und_Gesetzgebungsverfahren
In § 15 des Thüringer Archivgesetzes heißt es:
(3) Die öffentlichen Archive sind verpflichtet, die von ihnen archivierten Unterlagen als öffentliches Archivgut nach archivwissenschaftlichen Gesichtspunkten zu ordnen und durch Findmittel zu erschließen.
(4) Zur besseren Erschließung darf das Archivgut mittels elektronischer Datenträger erfaßt und gespeichert werden; die Auswertung der gespeicherten Informationen ist nur zur Erfüllung der in diesem Gesetz genannten Zwecke zulässig.
(5) Die Verknüpfung personenbezogener Daten durch das öffentliche Archiv ist innerhalb der in § 17 genannten Schutzfristen nur zulässig, wenn schutzwürdige Belange betroffener Personen oder Dritte nicht beeinträchtigt werden.
Die übliche archivische Erschließung des Nachlasses mit Namen der Korrespondenten erscheint mir damit abgesichert. Ich bezweifle also entschieden, dass Müllers Schlussfolgerungen für Thüringer Bibliotheken zutreffend sind. Für den DBV hat mir Arne Upmeier mitgeteilt, dass er von einer offiziellen Stellungnahme absehen möchte. Er hat aber - soviel denke ich, darf ich aus seiner Mail an mich vom 29.7.2010, die auch an die interne Mailingliste der DBV-Rechtskomission ging, durchaus mitteilen - deutlich Sympathie für "meine" Datenschutzklausel geäußert.
Weitere Beiträge Müllers zum Thema:
https://www.kinematheksverbund.de/Symp2009-09-11/PDF/Mueller_script.pdf
http://www.mpil.de/shared/data/pdf/nachlass1983.pdf (Buch von 1983)
Die Erschließung von Nachlässen und der Datenschutz
in /RBD 40/2010, 81-89/
interessieren. Das Heft mit dem Beitrag ist jetzt erschienen und falls
Ihnen eine Fernleihe nicht möglich oder zu lästig ist, ich habe den
Beitrag hier
http://www.ajbd.de/veroeff/rbd/einzelneBeitraege/rbd2010-23-01-Mueller-NachlaesseDatenschutz.pdf
online gestellt.
Gerade Archivare dürften dafür sehr dankbar sein. Zitat:
Die Erschließung eines Nachlasses kann zu Konflikten mit datenschutzrechtlichen Vorschriften führen. Soweit der Nachlass unveröffentlichte
Werke noch lebender Dritter enthält, kann deren Verzeichnung vorerst
nur kursorisch in Listen erfolgen. Dies betrifft hauptsächlich Briefe von
dritter Hand. Für eine detaillierte Katalogisierung ist die Zustimmung
der Briefschreiber einzuholen. Der Aufwand hierfür dürfte erheblich sein.
Deshalb kann man einem Nachlassbearbeiter nur den Rat geben, mit der
detaillierten Katalogisierung von Briefen Dritter in einem handschriftlichen Nachlass so viele Jahre zu warten, bis mutmaßlich kein Briefschreiber mehr am Leben ist. Als Richtwert könnte der Zeitraum von 30 Jahren
dienen, der sich in den meisten Archivgesetzen findet. Sollten allerdings,
aus welchen Gründen auch immer wichtige und deshalb zu verzeichnende, Briefe noch lebender Dritter in einem Nachlass gefunden werden, so
ist eine Katalogisierung nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Betroffenen zulässig
Müller übersieht, dass de lege ferenda ohne größere Probleme das Problem beseitigt werden könnte. Ich habe mich zwar bei meinem Vorschlag für das Thüringer Bibliotheksgesetz
http://archiv.twoday.net/stories/4834214/
primär auf die Übernahme bezogen, aber die Erschließung ausdrücklich einbezogen. Dank Herrn Steinhauer wurde mein Vorschlag Gesetz:
http://archiv.twoday.net/stories/5094326/
§ 4 Abs. 3 des Thüringer Bibliotheksgesetzes lautet:
3) Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten
lebender Personen bei der Übernahme, Erschließung und
Nutzbarmachung von Nachlässen durch Bibliotheken gelten
die Vorschriften des Thüringer Archivgesetzes entsprechend.
Für mich völlig unverständlich und nur durch mangelnde Unterstützung der beteiligten Bibliotheksverbände erklärlich ist der Umstand, dass die späteren Bibliotheksgesetze in Sachsen-Anhalt und Hessen dem Thüringer Vorbild nicht gefolgt sind:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bibliotheksgesetz#Aktuelle_Gesetze_und_Gesetzgebungsverfahren
In § 15 des Thüringer Archivgesetzes heißt es:
(3) Die öffentlichen Archive sind verpflichtet, die von ihnen archivierten Unterlagen als öffentliches Archivgut nach archivwissenschaftlichen Gesichtspunkten zu ordnen und durch Findmittel zu erschließen.
(4) Zur besseren Erschließung darf das Archivgut mittels elektronischer Datenträger erfaßt und gespeichert werden; die Auswertung der gespeicherten Informationen ist nur zur Erfüllung der in diesem Gesetz genannten Zwecke zulässig.
(5) Die Verknüpfung personenbezogener Daten durch das öffentliche Archiv ist innerhalb der in § 17 genannten Schutzfristen nur zulässig, wenn schutzwürdige Belange betroffener Personen oder Dritte nicht beeinträchtigt werden.
Die übliche archivische Erschließung des Nachlasses mit Namen der Korrespondenten erscheint mir damit abgesichert. Ich bezweifle also entschieden, dass Müllers Schlussfolgerungen für Thüringer Bibliotheken zutreffend sind. Für den DBV hat mir Arne Upmeier mitgeteilt, dass er von einer offiziellen Stellungnahme absehen möchte. Er hat aber - soviel denke ich, darf ich aus seiner Mail an mich vom 29.7.2010, die auch an die interne Mailingliste der DBV-Rechtskomission ging, durchaus mitteilen - deutlich Sympathie für "meine" Datenschutzklausel geäußert.
Weitere Beiträge Müllers zum Thema:
https://www.kinematheksverbund.de/Symp2009-09-11/PDF/Mueller_script.pdf
http://www.mpil.de/shared/data/pdf/nachlass1983.pdf (Buch von 1983)
KlausGraf - am Freitag, 11. November 2011, 00:07 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.romanicodigital.com/
ist ein Portal für die Kunst der Romanik in Spanien.
http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index.html
ist die digitale Fassung des spanischen Denkmalkatalogs mit vielen alten Bildern, wobei natürlich die Lizenz CC-BY-NC für diejenigen Fotografen, die 70 Jahre tot sind, eindeutig Copyfraud ist.
ist ein Portal für die Kunst der Romanik in Spanien.
http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index.html
ist die digitale Fassung des spanischen Denkmalkatalogs mit vielen alten Bildern, wobei natürlich die Lizenz CC-BY-NC für diejenigen Fotografen, die 70 Jahre tot sind, eindeutig Copyfraud ist.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.oorlogsbronnen.nl/
"Het Netwerk Oorlogsbronnen bouwt de digitale zoekingang tot tweede wereldoorlog-collecties in nederland."
 Inwoners van Aken trekken met de weinige bezittingen die zij uit hun verwoeste woningen konden redden weg uit de verwoeste stad.
Inwoners van Aken trekken met de weinige bezittingen die zij uit hun verwoeste woningen konden redden weg uit de verwoeste stad.
"Het Netwerk Oorlogsbronnen bouwt de digitale zoekingang tot tweede wereldoorlog-collecties in nederland."
 Inwoners van Aken trekken met de weinige bezittingen die zij uit hun verwoeste woningen konden redden weg uit de verwoeste stad.
Inwoners van Aken trekken met de weinige bezittingen die zij uit hun verwoeste woningen konden redden weg uit de verwoeste stad.KlausGraf - am Donnerstag, 10. November 2011, 23:50 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM
Verschwiegen wird, dass die Kooperation mit dem Bundesarchiv keineswegs so ein Erfolg für das Archiv war, dass es diese weiterführen wollte.
Verschwiegen wird, dass die Kooperation mit dem Bundesarchiv keineswegs so ein Erfolg für das Archiv war, dass es diese weiterführen wollte.
KlausGraf - am Donnerstag, 10. November 2011, 23:08 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.artfact.com/auction-lot/andreas-gundelfinger-d.1605-,-pattern-book-of-ca-1-c-91996ed112
Arcana Collection bei Christies Lot 17
ANDREAS GUNDELFINGER (d.1605), Pattern Book of Calligraphic Specimens for his Pupils, in German and Latin, ILLUMINATED MANUSCRIPT ON VELLUM
[Nuremberg] 1575-1576162 x 220mm. ii + 10 + ii leaves, written in black ink in a variety of Fraktur, Kurrent and Kanzlei scripts extensively decorated in liquid gold (some leaves cropped at top into decorative penwork, slight wear to margins). 19th-century crushed green morocco gilt, gilt turn ins (small splits to joints, extremities lightly scuffed)
PROVENANCE:
1. The manuscript is dedicated to his pupils by Andreas Gundelfinger 'Zu gueter gedechtnus unnd zu zondern gefallen seinen schulern und discipuli hat Andreas Gundelfinger Rechenmaister da selbs diese schrifften geschrieben' in 1576, above his AG monogram, motto NUL PENNA SED USUS (not the pen but its use, a popular tag) and the date of 1575 in gold, f.1; small later hands have noted in Latin on ff.9 and 10 that it was written by Andreas Gundelfinger, calligraphus to Albert V, Duke of Bavaria (ruled 1550-1579). A 'Schreib- und Rechenmeister', master of writing and mathematics, Gundelfinger became a burgess of Nuremberg in 1569, where he was apparently still living in 1580; a contemporary report of his death in 1605 refers to him as 'Schoolmaster in Munich'. It was an established tradition that writing masters would leave specimens of their work as a continuing inspiration for their pupils.
2. William Bragge (1823-1884): the sale of his outstanding collection of manucripts, Sotheby's, 7 June 1876, lot 123, as 'exquisite specimens of artistic calligraphy', purchased by Quaritch; cited by Bradley in his Dictionary of Miniaturists, Illuminators, Calligraphers and Copyists, 1888, II, p.74.
3. The brothers Max (1849-1911) and Maurice (1852-1922) Rosenheim: bookplate and library label inside upper cover. Their extensive collections of Renaissance and Baroque works of art, most famed for its medals and plaquettes but including a pioneering collection of Album amicorum, was dispersed in six sales; sale of their library, Sotheby's 9 May 1923, lot 103, purchased by Maggs; Maggs Catalogue 46, 1924, no 84.
4. Breslauer, Catalogue 109 published on the occasion of the ninetieth anniversary of the firm by Martin Breslauer, New York, 1988, no.14.
CONTENT AND ILLUMINATION:
Each page presents a sample of a different script, opening with the signed dedication to his pupils, f.1, and including a complete alphabet of Fraktur-Kurrent capitals, f.7v. The most elaborate, the Latin hymn 'Jesu nostra redemptio', has a large yet intricate opening J, only just contained within the height of the page, and a delicate band of gold filigree decoration between each line, f. 7. Even the least formal hands, ff.5-6v, have letters touched with gold and curving cadels that swirl around the margins. His sample texts are not all up to date: among those mentioned are Augustus of Saxony (d.1586) Ottheinrich of the Palatinate (d. 1559) and Joachim of Brandenburg (d.1571), f.2; Philip II of Spain (d.1598), f.8v; Albrecht of Brandenburg, Archbishop of Mainz (d.1545), f.9v. Some texts seem to have had personal associations: the Graf von Helferstein and Freiherr zu Gundelfingen, in Swabia, presumably where the family had originated, appears on f.10. The Gundelfinger had probably moved east via Ulm, source of the text on f.4v, since another Gundelfinger delivered letters in Ulm from Nuremberg in the first years of the 17th century and news of Andreas Gundelfinger's death in Munich reached the Ulm Rechenmeister, Johann Faulhaber, news which he then passed on to Nuremberg in January 1605 (K. Hawlitschek, Johann Faulhaber1580-1635, 1995, pp.259-268).
Andreas Gundelfinger lavished all his skill on the book which he intended as the testament of his calligraphic achievements.
Der Verkauf bei Karl und Faber 1943 fehlt:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1943_09_21/0014
Zu Gundelfinger:
http://www.naa.net/ain/personen/show.asp?ID=320
#fnzhss
Arcana Collection bei Christies Lot 17
ANDREAS GUNDELFINGER (d.1605), Pattern Book of Calligraphic Specimens for his Pupils, in German and Latin, ILLUMINATED MANUSCRIPT ON VELLUM
[Nuremberg] 1575-1576162 x 220mm. ii + 10 + ii leaves, written in black ink in a variety of Fraktur, Kurrent and Kanzlei scripts extensively decorated in liquid gold (some leaves cropped at top into decorative penwork, slight wear to margins). 19th-century crushed green morocco gilt, gilt turn ins (small splits to joints, extremities lightly scuffed)
PROVENANCE:
1. The manuscript is dedicated to his pupils by Andreas Gundelfinger 'Zu gueter gedechtnus unnd zu zondern gefallen seinen schulern und discipuli hat Andreas Gundelfinger Rechenmaister da selbs diese schrifften geschrieben' in 1576, above his AG monogram, motto NUL PENNA SED USUS (not the pen but its use, a popular tag) and the date of 1575 in gold, f.1; small later hands have noted in Latin on ff.9 and 10 that it was written by Andreas Gundelfinger, calligraphus to Albert V, Duke of Bavaria (ruled 1550-1579). A 'Schreib- und Rechenmeister', master of writing and mathematics, Gundelfinger became a burgess of Nuremberg in 1569, where he was apparently still living in 1580; a contemporary report of his death in 1605 refers to him as 'Schoolmaster in Munich'. It was an established tradition that writing masters would leave specimens of their work as a continuing inspiration for their pupils.
2. William Bragge (1823-1884): the sale of his outstanding collection of manucripts, Sotheby's, 7 June 1876, lot 123, as 'exquisite specimens of artistic calligraphy', purchased by Quaritch; cited by Bradley in his Dictionary of Miniaturists, Illuminators, Calligraphers and Copyists, 1888, II, p.74.
3. The brothers Max (1849-1911) and Maurice (1852-1922) Rosenheim: bookplate and library label inside upper cover. Their extensive collections of Renaissance and Baroque works of art, most famed for its medals and plaquettes but including a pioneering collection of Album amicorum, was dispersed in six sales; sale of their library, Sotheby's 9 May 1923, lot 103, purchased by Maggs; Maggs Catalogue 46, 1924, no 84.
4. Breslauer, Catalogue 109 published on the occasion of the ninetieth anniversary of the firm by Martin Breslauer, New York, 1988, no.14.
CONTENT AND ILLUMINATION:
Each page presents a sample of a different script, opening with the signed dedication to his pupils, f.1, and including a complete alphabet of Fraktur-Kurrent capitals, f.7v. The most elaborate, the Latin hymn 'Jesu nostra redemptio', has a large yet intricate opening J, only just contained within the height of the page, and a delicate band of gold filigree decoration between each line, f. 7. Even the least formal hands, ff.5-6v, have letters touched with gold and curving cadels that swirl around the margins. His sample texts are not all up to date: among those mentioned are Augustus of Saxony (d.1586) Ottheinrich of the Palatinate (d. 1559) and Joachim of Brandenburg (d.1571), f.2; Philip II of Spain (d.1598), f.8v; Albrecht of Brandenburg, Archbishop of Mainz (d.1545), f.9v. Some texts seem to have had personal associations: the Graf von Helferstein and Freiherr zu Gundelfingen, in Swabia, presumably where the family had originated, appears on f.10. The Gundelfinger had probably moved east via Ulm, source of the text on f.4v, since another Gundelfinger delivered letters in Ulm from Nuremberg in the first years of the 17th century and news of Andreas Gundelfinger's death in Munich reached the Ulm Rechenmeister, Johann Faulhaber, news which he then passed on to Nuremberg in January 1605 (K. Hawlitschek, Johann Faulhaber1580-1635, 1995, pp.259-268).
Andreas Gundelfinger lavished all his skill on the book which he intended as the testament of his calligraphic achievements.
Der Verkauf bei Karl und Faber 1943 fehlt:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1943_09_21/0014
Zu Gundelfinger:
http://www.naa.net/ain/personen/show.asp?ID=320
#fnzhss
KlausGraf - am Donnerstag, 10. November 2011, 22:55 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Am Anfang Übersicht über Handschriften und Inkunabeln des Archivs:
http://hdl.handle.net/10062/19083
Beispielsweise:
http://www.handschriftencensus.de/1499
http://hdl.handle.net/10062/19083
Beispielsweise:
http://www.handschriftencensus.de/1499
KlausGraf - am Donnerstag, 10. November 2011, 22:25 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Während der Suezkrise 1956 besetzte die israelische Armee den damals schon mehrheitlich von palästinensischen Flüchtlingen bewohnten Gazastreifen und tötete dort hunderte von Palästinensern. Diese Massaker waren der Weltpresse damals nur eine Fussnote wert und tauchten auch in den meisten Geschichtsbüchern nicht auf.
Knapp 50 Jahre später geht Sacco dieser «Fussnote» nach, Ereignissen, die bei den Betroffenen noch immer nachwirken und mit ein Grund für den ständig schwelenden Nahostkonflikt sind. Sacco sucht die noch lebenden Zeugen auf und setzt ihre Aussagen in gewohnt eindrücklicher Weise um.
Erschienen: Juli 2011.", ISBN 978-3-03731-080-9
432 Seiten, schwarzweiss, 17 x 24 cm, Klappenbroschur
Quelle: Verlagswerbung
Joe Sacco - Footnotes in Gaza, Jan. 12, 2010 from pdxjustice Media Productions on Vimeo.
Wolf Thomas - am Donnerstag, 10. November 2011, 22:03 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Zur Herstellung von Lebensmitteln dürfen in der EU Tausende
von Zusätzen wie Aroma- und Farbstoffe, Enzyme und Geschmacksverstärker
beigemischt werden. Viele von ihnen müssen nicht einmal deklariert werden. Selbst
bei Bioprodukten sind zahlreiche Zusatzstoffe erlaubt.
Das Deutsche Zusatzstoffmuseum, das gestern von der Hamburger Kultursenatorin
von Welck eröffnet wurde erklärt, warum das so ist: es zeigt wo nicht deklarierte
Zusätze enthalten sein können, wie sie manchmal verschleiert werden und welche
Möglichkeiten bestehen, auf derartige Zusätze zu verzichten.
An der wissenschaftlichen Entwicklung des Deutschen Zusatzstoffmuseums sind die
Lebensmittelchemiker Prof. Dr. Georg Schwedt und Udo Pollmer beteiligt.
Das Museum ist ein Projekt der Hamburger Lebensmittelstiftung und wird von der
Tiefkühlmarke FRoSTA und der Saftkelterei Walter unterstützt. Beide verzichten bei
der Herstellung ihrer Produkte konsequent auf die oben genannten Zusätze.
„Wir unterstützen das Deutsche Zusatzstoffmuseum, weil wir vor der Umstellung auf
unser Reinheitsgebot selber nicht glaubten, auf Zusatzstoffe komplett verzichten zu
können. Seit 2003 zeigen wir, dass es zwar teurer, aber möglich ist,“ sagt FRoSTA
Geschäftsführer Felix Ahlers. Partner des Museums sind außerdem die
Schweisfurth- Stiftung und das Europäische Institut für Lebensmittel- und
Ernährungswissenschaften (EU.L.E). Weitere Firmen und Organisationen sind
eingeladen, sich zu beteiligen.
Das Deutsche Zusatzstoffmusuem befindet sich auf dem Gelände des Hamburger
Großmarkt. Die Öffnungszeiten sind Mittwochs bis Freitags: 11 - 17 Uhr, Samstag
und Sonntag 10-17 Uhr. Nach Vereinbarung ist für Gruppen ein Besuch auch
außerhalb der regulären Öffnungszeiten möglich!
Eintrittspreise
Erwachsene: 3,50 EUR
Kinder unter 18: 1,50 EUR
Schulklassen: pro Person: 1,00 EUR
Deutsches Zusatzstoffmuseum
Banksstr. 28, Anfahrt über „Auf der Brandshofer Schleuse“
Großmarkt, Tor Ost
20097 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 32027757
Fax: +49 (0)40 32027758
info@zusatzstoffmuseum.de
Weitere Informationen:
Friederike Ahlers, Vorstand Hamburger Lebensmittelstiftung, Theodorstraße 42-90, 22761 Hamburg,
040/ 85 41 40 86, Tel: 01638446447"
Quelle: Pressemitteilung des Museum, 28.5.2008
Facebook-Seite des Msuems
Wolf Thomas - am Donnerstag, 10. November 2011, 21:52 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Bibliothek Sainte-Geneviève befindet sich an der Place du Panthéon in Paris, unweit der Sorbonne. Sie ist ein Meilenstein der Bibliotheksarchitektur. Dieses großartige Beispiel früher Eisenbaukunst wurde in den Jahren 1843 bis 1850 unter der Leitung von Henri Labrouste errichtet. Am selben Ort befand sich zuvor eine Klosterbibliothek, die bereits vor der Französischen Revolution ihre Pforten dem Publikum öffnete und damit überhaupt das Konzept der öffentlichen Bibliothek einführte.
1930 erhielt die Bibliothek Sainte-Geneviève den Status der Universitätsbibliothek. Labroustes Entwurf mit der Fassade im italienischen Renaissancestil brach bewusst mit dem im 19. Jahrhundert in Europa herrschenden neoklassischen Stil. Außerdem wurde die Eisenkonstruktion, bis dahin nur bei Brücken und Bahnhöfen angewandt, bei der Bibliothek Sainte-Geneviève im Innern des Gebäudes sowohl funktional als auch als sichtbares ästhetisches Gestaltungsmittel genutzt. Damit beeindruckte Labrouste, der auch den Umbau der Bibliothèque Nationale entwarf, seine Zeitgenossen. Le Corbusier, einer der bedeutenden und einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts, bezeichnete das Bauwerk als den ersten Schritt auf dem Weg zur "modernen Architektur".
======
Die Bibliothek Sainte-Geneviève
Regie: Juliette Garcias
Koproduktion: ARTE France, Les Films d’Ici, Musée d’Orsay (2009)
Dauer: 26 minutes"
Wolf Thomas - am Donnerstag, 10. November 2011, 21:47 - Rubrik: Bibliothekswesen
" .... FAZIT
Es wird deutlich, dass die Archive bei der Ausübung zahlreicher ihrer Funktionen in Verbindung mit ihrer institutionellen Einordnung in die Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland dem demokratischen Gebot der Funktionentrennung innerhalb der Funktionenordnung widersprechen. Um diesen Konflikt aufzulösen müsste den Archiven innerhalb des politischen Systems der Bundesrepublik eine besondere Position zugewiesen werden. Idealerweise wären die öffentlichen Archive vollkommen unabhängige Institutionen außerhalb der Exekutive mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Leitung von einer Volksvertretung gewählt würde. Diese Institutionen – und ihre Leiter – sollten ausschließlich dem Souverän, also dem Volk oder einer Vertretung des Volkes verantwortlich sein. So würde nicht nur den Bedürfnissen der Funktionentrennung in einem demokratischen
Staat, sondern auch der Tendenz zu „mehr direkter Demokratie“ in
der Bundesrepublik Deutschland genüge getan. Die Stellung des BStU ist tendenziell als Hinweis auf den richtigen Weg hin zu einer funktionsgerechten Einordnung der Archive in das politische System der Bundesrepublik anzusehen.
Da die Schaffung einer derart selbständigen Institution praktisch schwer umsetzbar ist, wäre für die Archive auch eine andere Lösung denkbar. Als Anstalten des öffentlichen Rechts und somit Teil der mittelbaren Staatsverwaltung – also als eigenständige Verwaltungsträger mit eigener Rechtspersönlichkeit – wären die Archive mit einer ausreichenden Unabhängigkeit ausgestattet, um ihre mannigfaltigen Funktionen demokratiegerecht zu erfüllen. Sie hätten damit eine ähnliche Stellung wie Universitäten. Eine derartige Lösung ist in der Vergangenheit zumindest bereits angedacht worden. Alternativ sei abschließend auf die Stellung von anderen Kontrollinstitutionen wie dem Bundesrechnungshof und der Landesrechnungshöfe oder der Bundesbank verwiesen. Auch Einrichtungen wie Ombudsmänner und Datenschutz-, Bürger- oder Wehrbeauftragte können Hinweise für eine Neuregelung im Bereich der öffentlichen Archive bieten."
Quelle: Mitteilungen der Fachgruppe 6 im VdA, Heft 35 (2011) , S. 25-26
Ein von Prantl auf dem Bremer Archivtag nicht (oder nur unzureichend) diskutierter Aspekt der Systemrelenvanz der Archive. M. E.ist dies ein anregender Ansatz zur weiteren Diskussion - anregender als Prantls Zitatenkarussell.
Es wird deutlich, dass die Archive bei der Ausübung zahlreicher ihrer Funktionen in Verbindung mit ihrer institutionellen Einordnung in die Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland dem demokratischen Gebot der Funktionentrennung innerhalb der Funktionenordnung widersprechen. Um diesen Konflikt aufzulösen müsste den Archiven innerhalb des politischen Systems der Bundesrepublik eine besondere Position zugewiesen werden. Idealerweise wären die öffentlichen Archive vollkommen unabhängige Institutionen außerhalb der Exekutive mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Leitung von einer Volksvertretung gewählt würde. Diese Institutionen – und ihre Leiter – sollten ausschließlich dem Souverän, also dem Volk oder einer Vertretung des Volkes verantwortlich sein. So würde nicht nur den Bedürfnissen der Funktionentrennung in einem demokratischen
Staat, sondern auch der Tendenz zu „mehr direkter Demokratie“ in
der Bundesrepublik Deutschland genüge getan. Die Stellung des BStU ist tendenziell als Hinweis auf den richtigen Weg hin zu einer funktionsgerechten Einordnung der Archive in das politische System der Bundesrepublik anzusehen.
Da die Schaffung einer derart selbständigen Institution praktisch schwer umsetzbar ist, wäre für die Archive auch eine andere Lösung denkbar. Als Anstalten des öffentlichen Rechts und somit Teil der mittelbaren Staatsverwaltung – also als eigenständige Verwaltungsträger mit eigener Rechtspersönlichkeit – wären die Archive mit einer ausreichenden Unabhängigkeit ausgestattet, um ihre mannigfaltigen Funktionen demokratiegerecht zu erfüllen. Sie hätten damit eine ähnliche Stellung wie Universitäten. Eine derartige Lösung ist in der Vergangenheit zumindest bereits angedacht worden. Alternativ sei abschließend auf die Stellung von anderen Kontrollinstitutionen wie dem Bundesrechnungshof und der Landesrechnungshöfe oder der Bundesbank verwiesen. Auch Einrichtungen wie Ombudsmänner und Datenschutz-, Bürger- oder Wehrbeauftragte können Hinweise für eine Neuregelung im Bereich der öffentlichen Archive bieten."
Quelle: Mitteilungen der Fachgruppe 6 im VdA, Heft 35 (2011) , S. 25-26
Ein von Prantl auf dem Bremer Archivtag nicht (oder nur unzureichend) diskutierter Aspekt der Systemrelenvanz der Archive. M. E.ist dies ein anregender Ansatz zur weiteren Diskussion - anregender als Prantls Zitatenkarussell.
Wolf Thomas - am Donnerstag, 10. November 2011, 21:33 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Dass der italienische und der deutsche Faschismus bei der Stigmatisierung, Entrechtung und Tötung von unschuldigen Menschen einander buchstäblich entgegen gearbeitet haben, ist zwar grundsätzlich bekannt (wenn auch von manchen Revisionisten bestritten), aber selten aktenkundig nachvollziehbar. Eine kürzlich erfolgte Abgabe "meldeamtlicher" Akten an das historische Archiv der Stadt Bozen, die von 1922-1943 von faschistischen Podestàs verwaltet wurde, dokumentiert eindrucksvoll diese totalitäre "Achse des Bösen". Seit November 1938, dem Erlass italienischer "Rassegesetze", wandten die italienischen Behörden diskriminatorische Maßnahmen aus "rassischen" Motiven an und erstellten Listen der jüdischen (bzw. von den Behörden zu solchen erklärten) MitbürgerInnen zum Zweck ihrer Ausgrenzung. Die Entrechtung betraf zunächst die Sphären von Schulbesuch, Beruf und öffentlicher Betätigung und wurde nach und nach bis zum Entzug der Staatsbürgerschaft und zur Inhaftierung in Lagern gesteigert. Nach der nationalsozialistischen Besetzung Bozens und Südtirols am 8. September 1943 dienten die von den Faschisten angelegten Listen der Deportation der Entrechteten in die Vernichtungslager.
Das Stadtarchiv Bozen hat seine Forschungen in den vergangenen Jahren verstärkt auf die Geschichte des Bozner NS-Lagers (1944-45) gerichtet. Es möchte nun die neue Aktenlage zur Vorgeschichte des Lagers und der Deportation unter der Leitung des Historikers Hannes Obermair so rasch als möglich aufarbeiten und hat anlässlich des heutigen Gedenkens an die "Reichspogromnacht" von 1938 eine entsprechende Pressemitteilung veröffentlicht:
http://www.gemeinde.bozen.it/stampa_context.jsp?ID_LINK=426&area=295&id_context=18836&COL0008=36
http://www.comune.bolzano.it/stampa_context.jsp?ID_LINK=426&area=295&id_context=18831&COL0008=36
(jeweils mit Dokumentenbeispielen)
Das Stadtarchiv Bozen hat seine Forschungen in den vergangenen Jahren verstärkt auf die Geschichte des Bozner NS-Lagers (1944-45) gerichtet. Es möchte nun die neue Aktenlage zur Vorgeschichte des Lagers und der Deportation unter der Leitung des Historikers Hannes Obermair so rasch als möglich aufarbeiten und hat anlässlich des heutigen Gedenkens an die "Reichspogromnacht" von 1938 eine entsprechende Pressemitteilung veröffentlicht:
http://www.gemeinde.bozen.it/stampa_context.jsp?ID_LINK=426&area=295&id_context=18836&COL0008=36
http://www.comune.bolzano.it/stampa_context.jsp?ID_LINK=426&area=295&id_context=18831&COL0008=36
(jeweils mit Dokumentenbeispielen)
ho - am Donnerstag, 10. November 2011, 21:30 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Los jetzt! Schluß nun! Du kannst nicht immer alles behalten
Mach die alten Würstchen aus dem Glas, verjag die Motten aus dem Schrank
und nimm die Gelegenheit, nimm doch endlich einmal wahr, und
Scheiß aufs Recycling!
Pack alles in einen Sack
Dann bauen wir uns ein Schiff und hauen einfach ab
Und deine scheiß Angst, die lassen wir an Land
Lass dem Himmel seine Gedanken
Und den Menschen ihre Scham, lass sie nölen
und quaken so viel sie wollen
Von mir aus den ganzen Tag, aber krieg’s endlich auf die Reihe
und pack alles weg! Nimm alles was du nicht brauchst
und schmeiß es endlich weg und
Scheiß aufs Recycling
Pack alles in einen Sack!
Herr Archivar, ich bezahl die ganze Reise,
aber bitte räum endlich auf!
Trag den Plunder aus meinem Leben
und gibt mir endlich wieder Platz"
Homepage Zwei Tage ohne Schnupftabak
Wolf Thomas - am Donnerstag, 10. November 2011, 21:26 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Blogbeitrag gibt zugleich einen Einblick in neuere OPAC-Technologien:
http://plan3t.info/2011/11/07/verfugbarkeitschecks-in-bibliothekskatalogen/
http://plan3t.info/2011/11/07/verfugbarkeitschecks-in-bibliothekskatalogen/
KlausGraf - am Donnerstag, 10. November 2011, 21:02 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blog.openbib.org/2011/11/09/sammlungen-revisited/
Die bibliographischen Daten einer jeden Sammlung sind zusätzlich – gesondert von den Gesamtdaten des USB Katalogs – als Open Data unter CC Zero durch die USB Köln bereitgestellt worden.
Die bibliographischen Daten einer jeden Sammlung sind zusätzlich – gesondert von den Gesamtdaten des USB Katalogs – als Open Data unter CC Zero durch die USB Köln bereitgestellt worden.
KlausGraf - am Donnerstag, 10. November 2011, 20:59 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://netzwertig.com/2011/11/04/neues-geschaftsmodell-paperc-arbeitet-an-einer-e-book-flatrate-fur-fachbucher/
Unerfreulich ist, dass PaperC sich auf prüfungsrelevante Ebooks konzentrieren will.
Zu dem von mir inzwischen nicht mehr empfohlenen Angebot:
http://archiv.twoday.net/search?q=paperc
Unerfreulich ist, dass PaperC sich auf prüfungsrelevante Ebooks konzentrieren will.
Zu dem von mir inzwischen nicht mehr empfohlenen Angebot:
http://archiv.twoday.net/search?q=paperc
KlausGraf - am Donnerstag, 10. November 2011, 20:48 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Interview mit Adrian Pohl zu Open Bibliographic Data:
http://blog.zeit.de/open-data/2011/11/08/open-bibliographic-data/
http://blog.zeit.de/open-data/2011/11/08/open-bibliographic-data/
KlausGraf - am Donnerstag, 10. November 2011, 20:40 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Auf der Nürnberger Wikicon habe ich mich mit einem Mitglied des Support-Teams unterhalten, da die Loriot-Erben die Briefmarken mit Loriot-Motiven aus der Wikipedia entfernt haben wollten.
Die deutschsprachige Wikipedia sieht amtliche Briefmarken in Übereinstimmung mit einem Urteil des LG München als gemeinfrei an (§ 5 Abs. 1 UrhG):
Ein einschlägiges rechtskräftiges Urteil zum Urheberrecht von Briefmarken des Landgerichts München (AZ 21 S 20861/86) befasst sich mit der Abbildung der Marke „Fünfhundert Jahre Rathaus Michelstadt“. Das Urteil verneint in zweiter Instanz die Ansprüche auf Lizenzgebühr gegen den Schwaneberger Verlag München (Michel-Katalog), der 1985 einen Briefmarken-Kalender herausgegeben hatte und auf dem Titelbild des Kalenders einen vergrößerten Abdruck der vom Kläger entworfenen Briefmarke abbildete.
In der Urteilsbegründung heißt es: „Die von dem Kläger entworfene Briefmarke hat den urheberrechtlichen Schutz, den sie zunächst als bloßer Entwurf besaß (§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 Urheberrechtsgesetz), durch die Aufnahme im Amtsblatt des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen gemäß § 5 Abs. 1 UrhG verloren.“ Entsprechend diesem Urteil sind deutsche Briefmarken als amtliche Werke gemeinfrei, also ohne urheberrechtlichen Schutz und können von jedermann beliebig genutzt werden, soweit dem nicht die einschlägigen Vorschriften des Strafrechts (§§ 148, 149 StGB) entgegenstehen (so auch von Ungern-Sternberg, GRUR 1977, 768). Die Kommentarliteratur sieht das freilich anders. Diese Ansicht hat das LG München zur Kenntnis genommen, aber verworfen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Amtliche_Briefmarke_(Deutschland)#Abbilden_von_Briefmarken
Eine umfangreiche Diskussion dazu wurde (noch ohne Kenntnis des Loriot-Falls) auf der Diskussionsseite zu Wikipedia:Bildrechte geführt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_Diskussion:Bildrechte#Text.C3.A4nderungen_Briefmarken
Nun ist sowohl die Wikimedia-Foundation als auch der deutsche Verein der deutschsprachigen Community in den Rücken gefallen und hat die Bilder löschen lassen:
http://commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:WMFOffice#File:DPAG_2011_55_Herren_im_Bad.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Urheberrechtsfragen#Briefmarken_und_WMF
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Forum#Wohlfahrtsmarken_mit_Loriot-Motiven_sind_dem_DMCA_zum_Opfer_gefallen
Update: Die Briefmarken wurden nun auch auf de-WP gelöscht. Die Erklärung des "Legal teams" sagt im Grunde nur, dass die Loriot-Briefmarken nach US-Recht nicht frei sind:
https://commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:Philippe_(WMF)#File:DPAG_2011_55_Herren_im_Bad.jpg
http://archiv.twoday.net/stories/49612262/

Die deutschsprachige Wikipedia sieht amtliche Briefmarken in Übereinstimmung mit einem Urteil des LG München als gemeinfrei an (§ 5 Abs. 1 UrhG):
Ein einschlägiges rechtskräftiges Urteil zum Urheberrecht von Briefmarken des Landgerichts München (AZ 21 S 20861/86) befasst sich mit der Abbildung der Marke „Fünfhundert Jahre Rathaus Michelstadt“. Das Urteil verneint in zweiter Instanz die Ansprüche auf Lizenzgebühr gegen den Schwaneberger Verlag München (Michel-Katalog), der 1985 einen Briefmarken-Kalender herausgegeben hatte und auf dem Titelbild des Kalenders einen vergrößerten Abdruck der vom Kläger entworfenen Briefmarke abbildete.
In der Urteilsbegründung heißt es: „Die von dem Kläger entworfene Briefmarke hat den urheberrechtlichen Schutz, den sie zunächst als bloßer Entwurf besaß (§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 Urheberrechtsgesetz), durch die Aufnahme im Amtsblatt des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen gemäß § 5 Abs. 1 UrhG verloren.“ Entsprechend diesem Urteil sind deutsche Briefmarken als amtliche Werke gemeinfrei, also ohne urheberrechtlichen Schutz und können von jedermann beliebig genutzt werden, soweit dem nicht die einschlägigen Vorschriften des Strafrechts (§§ 148, 149 StGB) entgegenstehen (so auch von Ungern-Sternberg, GRUR 1977, 768). Die Kommentarliteratur sieht das freilich anders. Diese Ansicht hat das LG München zur Kenntnis genommen, aber verworfen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Amtliche_Briefmarke_(Deutschland)#Abbilden_von_Briefmarken
Eine umfangreiche Diskussion dazu wurde (noch ohne Kenntnis des Loriot-Falls) auf der Diskussionsseite zu Wikipedia:Bildrechte geführt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_Diskussion:Bildrechte#Text.C3.A4nderungen_Briefmarken
Nun ist sowohl die Wikimedia-Foundation als auch der deutsche Verein der deutschsprachigen Community in den Rücken gefallen und hat die Bilder löschen lassen:
http://commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:WMFOffice#File:DPAG_2011_55_Herren_im_Bad.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Urheberrechtsfragen#Briefmarken_und_WMF
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Forum#Wohlfahrtsmarken_mit_Loriot-Motiven_sind_dem_DMCA_zum_Opfer_gefallen
Update: Die Briefmarken wurden nun auch auf de-WP gelöscht. Die Erklärung des "Legal teams" sagt im Grunde nur, dass die Loriot-Briefmarken nach US-Recht nicht frei sind:
https://commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:Philippe_(WMF)#File:DPAG_2011_55_Herren_im_Bad.jpg
http://archiv.twoday.net/stories/49612262/

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:L%C3%B6schkandidaten/31._Oktober_2011#Marina_Weisband_.28gel.C3.B6scht.29
http://schneeschmelze.wordpress.com/2011/11/08/marina-weisband-wurde-geloscht/
Der Admin Karsten11, der die Entscheidung traf, hat nicht die Argumente der Diskussion gewürdigt, die überwiegend für Behalten plädierte, sondern ist dogmatisch den Relevanzkriterien gefolgt, die aber keine notwendigen Bedingungen sind. Entscheidend ist das Interesse der Öffentlichkeit an im öffentlichen Blickfeld stehenden Personen, nicht das, was völlig inkompetente Admins in die ohnehin nicht sonderlich kompetenten Relevanzkriterien hineininterpretieren. Wer bitteschön ist denn von den Promis aus eigenem Recht ohne aktuelle Medienresonanz relevant? Mit der idiotischen Begründung von Karsten11 könnte man das Kriterium Medienrelevanz auch ganz kippen.
 Tobias M. Eckrich http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
Tobias M. Eckrich http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
http://schneeschmelze.wordpress.com/2011/11/08/marina-weisband-wurde-geloscht/
Der Admin Karsten11, der die Entscheidung traf, hat nicht die Argumente der Diskussion gewürdigt, die überwiegend für Behalten plädierte, sondern ist dogmatisch den Relevanzkriterien gefolgt, die aber keine notwendigen Bedingungen sind. Entscheidend ist das Interesse der Öffentlichkeit an im öffentlichen Blickfeld stehenden Personen, nicht das, was völlig inkompetente Admins in die ohnehin nicht sonderlich kompetenten Relevanzkriterien hineininterpretieren. Wer bitteschön ist denn von den Promis aus eigenem Recht ohne aktuelle Medienresonanz relevant? Mit der idiotischen Begründung von Karsten11 könnte man das Kriterium Medienrelevanz auch ganz kippen.
 Tobias M. Eckrich http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
Tobias M. Eckrich http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.envierprinzen - am Donnerstag, 10. November 2011, 14:30 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine Anregung in den Kollegenkreis ebenfalls alte Jahresberichte zu digitalisieren und so online zu stellen. Archivgeschichtlich wäre es m. E. nicht uninteressant.
Wolf Thomas - am Donnerstag, 10. November 2011, 09:01 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
1989/90: In der DDR setzte das Machtvakuum beachtliche Energien der Menschen frei. Eine virtuelle Ausstellung erzählt von der Dynamik des Aufbruchs in Leipzig: Runder Tisch, Polarisierung auf der Straße, neue Zeitung, Piratensender, „Montmartre“ von Leipzig, Subkultur und Politik, „Stoppt den Tagebau“ …
Link zum Artikel in Deutschland Archiv Online
Der Autor, Achim Beier, ist Historiker und Mitarbeiter des Archiv Bürgerbewegung e.V., Leipzig.
Link zum Artikel in Deutschland Archiv Online
Der Autor, Achim Beier, ist Historiker und Mitarbeiter des Archiv Bürgerbewegung e.V., Leipzig.
Bernd Hüttner - am Donnerstag, 10. November 2011, 07:18 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Museen sind gerade vornedran:
http://museumsreif.posterous.com/museen-ab-jetzt-einkreisbar-1-tag-google-page
Update: http://digiwis.de/blog/2011/11/10/buchhandlungen-bibliotheken-und-wissenschaftsinstitutionen-auf-google/
http://museumsreif.posterous.com/museen-ab-jetzt-einkreisbar-1-tag-google-page
Update: http://digiwis.de/blog/2011/11/10/buchhandlungen-bibliotheken-und-wissenschaftsinstitutionen-auf-google/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Kurzes Statement des Stadtarchivs Speyer (Elisabeth Steiger) online via:
http://www.ica.org/2964/activities-projects/the-city-archive-of-speyer-web-20.html
http://www.ica.org/2964/activities-projects/the-city-archive-of-speyer-web-20.html
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Anscheinend gibt es die letzte Schätzung für die durchschnittliche Lebensdauer einer Website (so problamtisch dieses Maß auch ist) aus dem Jahr 2003. Damals betrug sie 100 Tage:
http://blogs.loc.gov/digitalpreservation/2011/11/the-average-lifespan-of-a-webpage/
Soviel zum Thema "Das Internet vergiß nichts".
http://blogs.loc.gov/digitalpreservation/2011/11/the-average-lifespan-of-a-webpage/
Soviel zum Thema "Das Internet vergiß nichts".
KlausGraf - am Mittwoch, 9. November 2011, 14:26 - Rubrik: Webarchivierung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.linksjugend-solid.de/aktuelles/news/
Die Linksjugend hat eine Abbildung des Komikers Mario Barth ins Internet gestellt, mit dem sie gegen dessen sexistische Sprüche aufbegehrt. Barth sieht dies, ganz humorfrei, als Verletzung seines Rechts am eigenen Bild und setzt sich dabei über die herrschende Meinung hinsichtlich der Einschränkung dieses Rechts bei Personen der Zeitgeschichte hinweg. Es kann auch keine Rede davon sein, dass eine solche Kritik Werbung sei. Selbst zu Werbezwecken darf unter Umständen das Bild einer solchen Persönlichkeit verwendet werden:
http://lexetius.com/2006,2838
Das Neue Deutschland steht natürlich auf der Seite der Linksjugend:
http://www.neues-deutschland.de/artikel/210550.witze-mit-barth.html
Siehe auch
http://www.focus.de/politik/deutschland/rechtsstreit-um-ein-foto-linke-jugend-streitet-weiter-mit-mario-barth_aid_681833.html
KlausGraf - am Mittwoch, 9. November 2011, 14:15 - Rubrik: Archivrecht
"Im Korruptionsskandal um den Bau des Landesarchivs in Duisburg haben zwei betroffene Unternehmer offenbar Geld an die Duisburger CDU gespendet. Insgesamt sollen bis zum Jahr 2009 knapp 40.000 Euro an die Partei gegangen sein. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal ermittelt in Sachen Landesarchiv seit über einem Jahr wegen Korruptionsverdachts. Dem Land NRW waren Flächen für den Bau erst vor der Nase weggekauft, dann anschließend für einen höheren Preis angeboten und verkauft worden. Der Chef des Bau- und Liegenschaftsbetriebs (BLB), Tiggemann, musste wegen der Vorwürfe zurücktreten."
Quelle: WDR.de, Studio Duisburg, Nachrichten 9.11.11.
s. a. WAZRechercheBlog v. 8.11.11, gleichlautend Aachener Zeitung v. 9.11.11, RP, 10.11.11
Zum Themenkomplex "Landesarchiv NRW in Duisburg": s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg
Quelle: WDR.de, Studio Duisburg, Nachrichten 9.11.11.
s. a. WAZRechercheBlog v. 8.11.11, gleichlautend Aachener Zeitung v. 9.11.11, RP, 10.11.11
Zum Themenkomplex "Landesarchiv NRW in Duisburg": s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg
Wolf Thomas - am Mittwoch, 9. November 2011, 11:50 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
So gut wie keine Auswanderungsbroschüre kann open access eingesehen werden, nur, angeblich die ab 2011 verfassten.
Woran liegt es ?
Ist Auswanderung unerwünscht ?
Ist das Bundesverwaltungsamt nicht in der Lage die älteren Broschüren zu scannen ?
http://goo.gl/kbXt6
Woran liegt es ?
Ist Auswanderung unerwünscht ?
Ist das Bundesverwaltungsamt nicht in der Lage die älteren Broschüren zu scannen ?
http://goo.gl/kbXt6
vierprinzen - am Montag, 7. November 2011, 17:58 - Rubrik: Open Access
EROMM, das European Register of Microform and Digital Masters, hat mit
"EROMM Search" ein neues Suchinstrument veröffentlicht, das die Suche in
den Metdaten zu mehr als 9 Millionen Digitalisaten und Mikroverfilmungen
aus Bibliotheksbeständen ermöglicht. EROMM Search kombiniert die Suche
in der klassischen EROMM Sekundärformendatenbank mit einem neu
aufgebauten Suchindex über einschlägige OAI Repositorien und Webseiten
älterer Digitalisierungsprojekte.
Sie finden EROMM Search auf der neuen EROMM Webseite unter
http://www.eromm.org
Die entscheiden Frage ist, bringt EROMM gegenüber anderen Nachweisinstrumenten (KVK, Europeana, vor allem aber BASE) einen Mehrwert? Da die Bücher des Internet Archive in BASE fehlen, ist das der Fall. (Siehe z.B. Suche nach Sudhoff.)
EROMM hat zum Suchbegriff Maihingen drei Heidelberger Digitalisate und einen Treffer aus retro.seals.ch.
BASE hatte zu Maihingen nur einen Treffer aus HathiTrust, der aber nur mit US-Proxy benutzbar ist. Bei erneuter Suche dann 6 Treffer, darunter die vier Heidelberger Digitalisate (EROMM hat nur drei!). retro.seals.ch fehlt.
Europeana hat neben Bildern nur ein Buch aus Gallica (auch BASE hat es).
Der Online-Filter des KVK hat die Heidelberger Digitalisate (4), den Treffer aus der Schweiz (retro.seals.ch) und via ZVDD noch zwei DigiZeitschriften-Artikel. Von den 6 BASE-Treffern hat der KVK nur 3. BVB ist derzeit nicht erreichbar, enthält aber 5 Treffer (v.a. Digitalisate UB Augsburg).
BAM-Portal ist unbrauchbar, es hat nur einige Buchinhaltsverzeichnisse. Worldcat dito, er hat nur drei Google-Bücher in Schnipseldarstellung, der Aufruf geht aber gerade nicht. Ruft man OAIster, das ja eigentlich integriert sein soll, separat auf, kommt nur ein Treffer, eines der vier Heidelberger Digitalisate.
Um alle Digitalisate zu finden, genügt es in diesem Fall KVK und BASE zu benutzen. In anderen Fällen kann EROMM aufgrund der IA-Bestände eine gute Wahl sein.
"EROMM Search" ein neues Suchinstrument veröffentlicht, das die Suche in
den Metdaten zu mehr als 9 Millionen Digitalisaten und Mikroverfilmungen
aus Bibliotheksbeständen ermöglicht. EROMM Search kombiniert die Suche
in der klassischen EROMM Sekundärformendatenbank mit einem neu
aufgebauten Suchindex über einschlägige OAI Repositorien und Webseiten
älterer Digitalisierungsprojekte.
Sie finden EROMM Search auf der neuen EROMM Webseite unter
http://www.eromm.org
Die entscheiden Frage ist, bringt EROMM gegenüber anderen Nachweisinstrumenten (KVK, Europeana, vor allem aber BASE) einen Mehrwert? Da die Bücher des Internet Archive in BASE fehlen, ist das der Fall. (Siehe z.B. Suche nach Sudhoff.)
EROMM hat zum Suchbegriff Maihingen drei Heidelberger Digitalisate und einen Treffer aus retro.seals.ch.
BASE hatte zu Maihingen nur einen Treffer aus HathiTrust, der aber nur mit US-Proxy benutzbar ist. Bei erneuter Suche dann 6 Treffer, darunter die vier Heidelberger Digitalisate (EROMM hat nur drei!). retro.seals.ch fehlt.
Europeana hat neben Bildern nur ein Buch aus Gallica (auch BASE hat es).
Der Online-Filter des KVK hat die Heidelberger Digitalisate (4), den Treffer aus der Schweiz (retro.seals.ch) und via ZVDD noch zwei DigiZeitschriften-Artikel. Von den 6 BASE-Treffern hat der KVK nur 3. BVB ist derzeit nicht erreichbar, enthält aber 5 Treffer (v.a. Digitalisate UB Augsburg).
BAM-Portal ist unbrauchbar, es hat nur einige Buchinhaltsverzeichnisse. Worldcat dito, er hat nur drei Google-Bücher in Schnipseldarstellung, der Aufruf geht aber gerade nicht. Ruft man OAIster, das ja eigentlich integriert sein soll, separat auf, kommt nur ein Treffer, eines der vier Heidelberger Digitalisate.
Um alle Digitalisate zu finden, genügt es in diesem Fall KVK und BASE zu benutzen. In anderen Fällen kann EROMM aufgrund der IA-Bestände eine gute Wahl sein.
Landesarchiv NRW, Duisburg: Ein Eintrag ins Schwarzbuch oder: Ein Fall für den Bund der Steuerzahler
Das Land Nordrhein-Westfalen erhält ein neues Landesarchiv. Als Standort stand frühzeitig ein Grundstück im Duisburger Innenhafen fest. Dabei blieb es auch, als der Kaufpreis für dieses Grundstück von zwei Millionen Euro auf 30 Millionen Euro gestiegen war. Und damit nicht genug der schlechten Nachrichten für die Steuerzahler: Auch die Baukosten sind inzwischen von 80 Millionen Euro auf fast das Doppelte gestiegen.
s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg
Wolf Thomas - am Montag, 7. November 2011, 09:57 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Mitglieder der wissenschaftlichen Buchgesellschaft können vom Mitgliederbereich aus kostenlos auf Olms Online (Reprints und Messekataloge) zugreifen. Das ist durchaus erfreulich.
KlausGraf - am Montag, 7. November 2011, 02:38 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stadtbibliothek_Mainz
Siehe
http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbibliothek+mainz

Siehe
http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbibliothek+mainz

KlausGraf - am Sonntag, 6. November 2011, 22:48 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Mainzer Dissertation von Judith König 2011 liegt online vor. Zusammenfassung:
In der vorliegenden Arbeit sind erstmals die Karmeliterchorbücher des Mainzer Dommuseums - ein fünfbändiges Antiphonar und ein Graduale - kodikologisch und kunsthistorisch untersucht worden. Dabei stellte sich heraus, dass diese bislang in der Literatur nur bruchstückhaft bekannten Handschriften zwei eigenständige Werke sind, deren Bildinitialen nicht - wie bislang angenommen - von dem in einer Widmung genannten Frater Nycolaus angefertigt worden sind. Dieser konnte lediglich als Schreiber von drei Bänden des Antiphonars identifiziert werden. Die neun Bildinitialen des handwerklich solide angefertigten Graduales folgen altbekannten böhmischen Vorbildern und bestechen durch ihre Erzählfreude und Detailgenauigkeit. Kunsthistorisch bedeutsamer sind die fünf erhaltenen Bildinitialen des Antiphonars, das wahrscheinlich von dem Mainzer Juristen und Geschichtsforscher Franz Joseph Bodmann im 19. Jahrhundert um mindestens zehn weitere Bildinitialen beraubt wurde. Die Qualität der verbliebenen Bildinitialen, die teilweise weit entwickelte Landschaften, eine hochmoderne Verkündigungsszene und Mustergrundinitialen zeigen, die in enger Verbindung zum Göttinger Musterbuch stehen, sichern dem Antiphonar einen bedeutenden Rang in der Mittelrheinischen Kunst. Beide Liturgika überraschen durch die qualitative und quantitative Ausstattungsfülle beim einzeiligen Initialschmuck. Zwei in die Jahre 1430 und 1432 datierte Widmungen im Antiphonar nennen als Auftraggeber einen Johannes Fabri aus dem Mainzer Handwerk, der 17 Jahre später zum Prior des Mainzer Karmeliterklosters aufgestiegen ist. Ein dargestelltes Stifterpaar im Graduale lässt auch dort auf Auftraggeber aus dem Bürgertum schließen, die die Handschrift wahrscheinlich im zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts in Auftrag gaben. Die in der Literatur postulierte Karmeliterwerkstatt muss bezweifelt werden, da die ihr zugewiesenen Werke einer kritischen Überprüfung nicht standhalten.
http://ubm.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2011/2828/
In der vorliegenden Arbeit sind erstmals die Karmeliterchorbücher des Mainzer Dommuseums - ein fünfbändiges Antiphonar und ein Graduale - kodikologisch und kunsthistorisch untersucht worden. Dabei stellte sich heraus, dass diese bislang in der Literatur nur bruchstückhaft bekannten Handschriften zwei eigenständige Werke sind, deren Bildinitialen nicht - wie bislang angenommen - von dem in einer Widmung genannten Frater Nycolaus angefertigt worden sind. Dieser konnte lediglich als Schreiber von drei Bänden des Antiphonars identifiziert werden. Die neun Bildinitialen des handwerklich solide angefertigten Graduales folgen altbekannten böhmischen Vorbildern und bestechen durch ihre Erzählfreude und Detailgenauigkeit. Kunsthistorisch bedeutsamer sind die fünf erhaltenen Bildinitialen des Antiphonars, das wahrscheinlich von dem Mainzer Juristen und Geschichtsforscher Franz Joseph Bodmann im 19. Jahrhundert um mindestens zehn weitere Bildinitialen beraubt wurde. Die Qualität der verbliebenen Bildinitialen, die teilweise weit entwickelte Landschaften, eine hochmoderne Verkündigungsszene und Mustergrundinitialen zeigen, die in enger Verbindung zum Göttinger Musterbuch stehen, sichern dem Antiphonar einen bedeutenden Rang in der Mittelrheinischen Kunst. Beide Liturgika überraschen durch die qualitative und quantitative Ausstattungsfülle beim einzeiligen Initialschmuck. Zwei in die Jahre 1430 und 1432 datierte Widmungen im Antiphonar nennen als Auftraggeber einen Johannes Fabri aus dem Mainzer Handwerk, der 17 Jahre später zum Prior des Mainzer Karmeliterklosters aufgestiegen ist. Ein dargestelltes Stifterpaar im Graduale lässt auch dort auf Auftraggeber aus dem Bürgertum schließen, die die Handschrift wahrscheinlich im zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts in Auftrag gaben. Die in der Literatur postulierte Karmeliterwerkstatt muss bezweifelt werden, da die ihr zugewiesenen Werke einer kritischen Überprüfung nicht standhalten.
http://ubm.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2011/2828/
KlausGraf - am Sonntag, 6. November 2011, 20:55 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Petition zur Erhaltung der Mainzer Wissenschaftlichen Stadtbibliothek hat soeben die 2000er-Marke erreicht. Danke, wenn Sie schon Ihre Stimme schon gegeben haben. Verbreiten Sie unser Anliegen weiter. Es hat an Dinglichkeit nichts verloren. Die Seite steht auch noch für viele Meinungsbeiträge offen.
Herzlichen Gruß aus Mainz sendet Ihnen Annelen Ottermann.
http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/bibliothek-in-not/petition.html
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbibliothek+mainz

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stadtbibliothek_Mainz
Herzlichen Gruß aus Mainz sendet Ihnen Annelen Ottermann.
http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/bibliothek-in-not/petition.html
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbibliothek+mainz

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stadtbibliothek_Mainz
KlausGraf - am Sonntag, 6. November 2011, 17:00 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine Konferenz des Internet & Gesellschaft Collaboratory, der Deutschen Kinemathek, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Wikimedia Deutschland.
http://www.ins-netz-gegangen.org
KONZEPT
Die Konferenz befasst sich mit den Folgen und Auswirkungen des Informationszeitalters auf Bibliotheken, Archive und Museen. Nach einer theoretischen Reflexion der heutigen Bedingungen des Zugangs zu Wissen sollen Projekte und Strategien der Präsentation unseres kulturellen Erbes im Netz aus ganz unterschiedlichen Perspektiven vorgestellt werden: Bibliotheken, Archive und Museen vertreten dabei den Bereich der traditionellen Gedächtnisorganisationen, der jedoch durch die neuen Makler und Produzenten digitalen Wissens wie Google und Wikipedia mit hoher Innovationskraft ergänzt wird.
Die damit verbundenen Aufgaben und Schwierigkeiten, die spezifischen Vor- und Nachteile der jeweiligen Konzepte stehen im Mittelpunkt der Konferenz. Sie wird mit einem Ausblick darauf enden, wie an verschiedener Stelle, unabhängig voneinander und doch gemeinsam, ein Netz, das gerade für das kulturelle Erbe große Chancen bietet, geknüpft werden kann.
Am Beginn der Konferenz soll eine kurze Analyse der Prozesse der letzten 30 Jahre stehen: Zum einen waren die demokratischen Optionen und Ansprüche des Netzes von großer Euphorie begleitet, zum anderen entwickelte sich die Digitalisierung in den Gedächtnisorganisationen nur sehr zögerlich. Warum? Das Verstehen dieser Vorgeschichte scheint uns wichtig, um die heutige Situation mit ihren zahlreichen Initiativen wie der Europeana, aber auch das Auftauchen von neuen Akteuren zu begreifen.
Unstrittig ist, dass das Netz, ursprünglich ein Zwitter aus Wissenschaft und Militärstrategie, eine Dynamik entwickelte, welche inzwischen in die Bereiche der Ökonomie und der Kultur eindrang, sie infiltrierte. In dem Maße, in dem die Globalisierung im Netz weitestgehend ihren Ausdruck und zu ihrer Form fand, entstand, parallel dazu, das Konzept einer Wissensgesellschaft, die ihrerseits wiederum das Netz euphorisch begrüßte, schien doch der Schritt zur radikalen Öffnung und Vermittlung des kulturellen Erbes nun nur noch ein kleiner zu sein. Doch der praktische Weg über die Repräsentation durch Digitalisate geriet ob zahlreicher ungeklärter Rechtefragen, mangelnder finanzieller Ressourcen, fehlender technologischer Kompetenzen und schwer änderbarer Mentalitäten steiniger als erwartet.
In einer gewissen Konsolidierungsphase wurden die Karten neu gemischt und es entstand sehr schnell die Struktur, die zum Thema dieser Konferenz werden sollte: Die Gedächtnisorganisationen haben inzwischen eigene Strategien zur Präsentation und Vernetzung des kulturellen Erbes entwickelt. Sie sind auch eine Reaktion auf die Aktivitäten kommerzieller Firmen. Parallel entstanden kollaborative, zivil- gesellschaftliche Projekte, die eine - auch von kommerziellen Akteuren nicht erreichte - Dynamik entfalteten.
Nicht nur in seiner Bedeutung für das kulturelle Erbe wird das Internet mit seiner offenen Struktur heute zum ersten von der Zivilgesellschaft, zum zweiten von Firmen mit ihren kommerziellen Interessen und zum dritten von öffentlichen Institutionen geprägt: Beispielhaft für die Zivilgesellschaft stehen Wikipedia, für kommerzielle Interessen Google und für die öffentlichen Institutionen die Europeana (und kommend die Deutsche Digitale Bibliothek). Unser Ziel ist es, eine Vision zur digitalen Zukunft des Kulturerbes zu entwickeln und mit ihr neue Perspektiven aufzuzeigen.
PROGRAMM
Donnerstag, 17. November
GRUNDLAGEN
10.00
Eröffnung: Kulturerbe im Netz - Zwischen Tradition, Kommerz und neuer Partizipation
Dr. Paul Klimpel
Verwaltungsdirektor der Deutschen Kinemathek
10.30
Begrüßung und Einleitung
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Parzinger
Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
10.45
Das Erbe der Arche Noah: Archive, Wissen und Informationen
Jürgen Keiper
Leiter IT-Projekte, Deutsche Kinemathek
11.15
Kulturelle Fragmentierung und Asymmetrische Information
Konrad Becker
Forscher, Künstler und Produzent im Bereich elektronische Medien, World-Information Institute
11.45
Standardisierung und kulturelles Erbe – eine schwierige, aber fruchtbare Ehe
Prof. Dr. Felix Sasaki
Senior Researcher am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, Leiter W3C Deutsch-Österr. Büro
12.15
Mittagspause
ANFANG
13.30
Objekt, Prozess und Kontext: Gedächtnisorganisationen und Semantische Technologien
Prof. Dr. Stefan Gradmann
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis (DGI), Humboldt-Universität zu Berlin
14.00
Digitale Vielfalt im Netz – Kulturelles Erbe digital
Dr. Stefan Rohde-Enslin
Institut für Museumsforschung, Stiftung Preußischer Kulturbesitz
14.30
Die “Deutsche Digitale Bibliothek” – Zukunft des kulturellen Erbes
Prof. Dr. Günther Schauerte
Vizepräsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
15.00
Kaffeepause
15.30
Wikipedia – Wissen und Partizipation
Pavel Richter
Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland e.V.
16.00
Google Art Project und Google Books
Annabella Weisl
Strategic Partner Manager Google Book Search
16.30
Erlebte Geschichte
Zeitzeugen im Internet. Das “Gedächtnis der Nation” ist online!
Jörg von Bilavsky
Geschäftsführer von “Gedächtnis der Nation”
17.00
Ausklang
Freitag, 18. November
HERAUSFORDERUNGEN
10.00
Themenschwerpunkt TECHNOLOGIE
(Kinemathek: Veranstaltungsraum 4. OG)
Dr. Robert Hauser
Geschäftsführer des Kompetenzzentrums für kulturelle Überlieferung – digital Karlsruhe in Gründung (KÜdKa)
Jürgen Enge
Leiter des Forschungsbereichs “Digitale Archive” am Prorektorat Forschung der HfG Karlsruhe
10.00
Themenschwerpunkt RECHT
(Staatsbibliothek: Hörsaal 320)
Dr. Till Kreutzer
iRights.info
10.00 Themenschwerpunkt MENTALITÄTEN
*(Staatsbibliothek: Ausstellungsraum)
Moderation: Jürgen Keiper
Leiter IT-Projekte, Deutsche Kinemathek
Wenn Gutenberg heute leben würde…
Pascale Meyer
Juristin und Organisationberaterin
Bibliothek als physischer Raum
Dr. Jonas Fansa
Baureferent der Zentral- und Landesbibliothek Berlin
Veränderungsprozesse im Berufsfeld des Bibliothekars
Julia Fromm
Stellvertretende Leiterin der Bereichsbibliothek Erziehungswissenschaft, Fachdidaktik und Psychologie, Freie Universität Berlin
11.30
Kaffeepause (Kinemathek)
12.00
Ergebnisse der Themenschwerpunkte (s.o.)
12.30
Mittagspause
13.30
Erfolgreiches Scheitern – Scheitern als Erfolg
Mathias Schindler
Projektmanager Politik und Gesellschaft, Wikimedia Deutschland e.V.
14.00 Auch die Großen machen Fehler
Dr. Max Senges
Google Policy Team
14.30
Kaffeepause
15.00
600.000 Bücher im Netz. Zur Kooperation der Österreichischen Nationalbibliothek mit Google
Max Kaiser
Abteilungsleiter Forschung und Entwicklung, Österreichische Nationalbibliothek
15.30 “Irrwege im Netz?” – Die Kooperation des Bundesarchivs mit Wikimedia
Dr. Oliver Sander
Leiter des Referats B6 (“Bildarchiv”) im Bundesarchiv
16.00
Kaffeepause
16.30
Podiumsdiskussion: Wem “gehört” das kulturelle Erbe?
Moderation: Dr. Paul Klimpel
Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer
Universität der Künste
des. Direktor des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft, Berlin
Anja Horstmann
Historikerin, Universität Bielefeld
Dr. Oliver Sander
Leiter des Referats B6 (“Bildarchiv”) im Bundesarchiv
Dr. Max Senges
Google Policy Team
Prof. Monika Hagedorn-Saupe
Stellvertretende Leiterin des Instituts für Museumsforschung
Staatliche Museen zu Berlin
Konrad Becker
Forscher, Künstler und Produzent im Bereich elektronische Medien,
World-Information Institute
17.00
Digitalisierung: Von allen für alle (Projekt)
17.30
Ausklang
Leitung: Dr. Paul Klimpel
Koordination: Marc Thümmler
E-Mail: marc@collaboratory.org
Website: www.ins-netz-gegangen.org
http://www.ins-netz-gegangen.org
KONZEPT
Die Konferenz befasst sich mit den Folgen und Auswirkungen des Informationszeitalters auf Bibliotheken, Archive und Museen. Nach einer theoretischen Reflexion der heutigen Bedingungen des Zugangs zu Wissen sollen Projekte und Strategien der Präsentation unseres kulturellen Erbes im Netz aus ganz unterschiedlichen Perspektiven vorgestellt werden: Bibliotheken, Archive und Museen vertreten dabei den Bereich der traditionellen Gedächtnisorganisationen, der jedoch durch die neuen Makler und Produzenten digitalen Wissens wie Google und Wikipedia mit hoher Innovationskraft ergänzt wird.
Die damit verbundenen Aufgaben und Schwierigkeiten, die spezifischen Vor- und Nachteile der jeweiligen Konzepte stehen im Mittelpunkt der Konferenz. Sie wird mit einem Ausblick darauf enden, wie an verschiedener Stelle, unabhängig voneinander und doch gemeinsam, ein Netz, das gerade für das kulturelle Erbe große Chancen bietet, geknüpft werden kann.
Am Beginn der Konferenz soll eine kurze Analyse der Prozesse der letzten 30 Jahre stehen: Zum einen waren die demokratischen Optionen und Ansprüche des Netzes von großer Euphorie begleitet, zum anderen entwickelte sich die Digitalisierung in den Gedächtnisorganisationen nur sehr zögerlich. Warum? Das Verstehen dieser Vorgeschichte scheint uns wichtig, um die heutige Situation mit ihren zahlreichen Initiativen wie der Europeana, aber auch das Auftauchen von neuen Akteuren zu begreifen.
Unstrittig ist, dass das Netz, ursprünglich ein Zwitter aus Wissenschaft und Militärstrategie, eine Dynamik entwickelte, welche inzwischen in die Bereiche der Ökonomie und der Kultur eindrang, sie infiltrierte. In dem Maße, in dem die Globalisierung im Netz weitestgehend ihren Ausdruck und zu ihrer Form fand, entstand, parallel dazu, das Konzept einer Wissensgesellschaft, die ihrerseits wiederum das Netz euphorisch begrüßte, schien doch der Schritt zur radikalen Öffnung und Vermittlung des kulturellen Erbes nun nur noch ein kleiner zu sein. Doch der praktische Weg über die Repräsentation durch Digitalisate geriet ob zahlreicher ungeklärter Rechtefragen, mangelnder finanzieller Ressourcen, fehlender technologischer Kompetenzen und schwer änderbarer Mentalitäten steiniger als erwartet.
In einer gewissen Konsolidierungsphase wurden die Karten neu gemischt und es entstand sehr schnell die Struktur, die zum Thema dieser Konferenz werden sollte: Die Gedächtnisorganisationen haben inzwischen eigene Strategien zur Präsentation und Vernetzung des kulturellen Erbes entwickelt. Sie sind auch eine Reaktion auf die Aktivitäten kommerzieller Firmen. Parallel entstanden kollaborative, zivil- gesellschaftliche Projekte, die eine - auch von kommerziellen Akteuren nicht erreichte - Dynamik entfalteten.
Nicht nur in seiner Bedeutung für das kulturelle Erbe wird das Internet mit seiner offenen Struktur heute zum ersten von der Zivilgesellschaft, zum zweiten von Firmen mit ihren kommerziellen Interessen und zum dritten von öffentlichen Institutionen geprägt: Beispielhaft für die Zivilgesellschaft stehen Wikipedia, für kommerzielle Interessen Google und für die öffentlichen Institutionen die Europeana (und kommend die Deutsche Digitale Bibliothek). Unser Ziel ist es, eine Vision zur digitalen Zukunft des Kulturerbes zu entwickeln und mit ihr neue Perspektiven aufzuzeigen.
PROGRAMM
Donnerstag, 17. November
GRUNDLAGEN
10.00
Eröffnung: Kulturerbe im Netz - Zwischen Tradition, Kommerz und neuer Partizipation
Dr. Paul Klimpel
Verwaltungsdirektor der Deutschen Kinemathek
10.30
Begrüßung und Einleitung
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Parzinger
Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
10.45
Das Erbe der Arche Noah: Archive, Wissen und Informationen
Jürgen Keiper
Leiter IT-Projekte, Deutsche Kinemathek
11.15
Kulturelle Fragmentierung und Asymmetrische Information
Konrad Becker
Forscher, Künstler und Produzent im Bereich elektronische Medien, World-Information Institute
11.45
Standardisierung und kulturelles Erbe – eine schwierige, aber fruchtbare Ehe
Prof. Dr. Felix Sasaki
Senior Researcher am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, Leiter W3C Deutsch-Österr. Büro
12.15
Mittagspause
ANFANG
13.30
Objekt, Prozess und Kontext: Gedächtnisorganisationen und Semantische Technologien
Prof. Dr. Stefan Gradmann
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis (DGI), Humboldt-Universität zu Berlin
14.00
Digitale Vielfalt im Netz – Kulturelles Erbe digital
Dr. Stefan Rohde-Enslin
Institut für Museumsforschung, Stiftung Preußischer Kulturbesitz
14.30
Die “Deutsche Digitale Bibliothek” – Zukunft des kulturellen Erbes
Prof. Dr. Günther Schauerte
Vizepräsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
15.00
Kaffeepause
15.30
Wikipedia – Wissen und Partizipation
Pavel Richter
Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland e.V.
16.00
Google Art Project und Google Books
Annabella Weisl
Strategic Partner Manager Google Book Search
16.30
Erlebte Geschichte
Zeitzeugen im Internet. Das “Gedächtnis der Nation” ist online!
Jörg von Bilavsky
Geschäftsführer von “Gedächtnis der Nation”
17.00
Ausklang
Freitag, 18. November
HERAUSFORDERUNGEN
10.00
Themenschwerpunkt TECHNOLOGIE
(Kinemathek: Veranstaltungsraum 4. OG)
Dr. Robert Hauser
Geschäftsführer des Kompetenzzentrums für kulturelle Überlieferung – digital Karlsruhe in Gründung (KÜdKa)
Jürgen Enge
Leiter des Forschungsbereichs “Digitale Archive” am Prorektorat Forschung der HfG Karlsruhe
10.00
Themenschwerpunkt RECHT
(Staatsbibliothek: Hörsaal 320)
Dr. Till Kreutzer
iRights.info
10.00 Themenschwerpunkt MENTALITÄTEN
*(Staatsbibliothek: Ausstellungsraum)
Moderation: Jürgen Keiper
Leiter IT-Projekte, Deutsche Kinemathek
Wenn Gutenberg heute leben würde…
Pascale Meyer
Juristin und Organisationberaterin
Bibliothek als physischer Raum
Dr. Jonas Fansa
Baureferent der Zentral- und Landesbibliothek Berlin
Veränderungsprozesse im Berufsfeld des Bibliothekars
Julia Fromm
Stellvertretende Leiterin der Bereichsbibliothek Erziehungswissenschaft, Fachdidaktik und Psychologie, Freie Universität Berlin
11.30
Kaffeepause (Kinemathek)
12.00
Ergebnisse der Themenschwerpunkte (s.o.)
12.30
Mittagspause
13.30
Erfolgreiches Scheitern – Scheitern als Erfolg
Mathias Schindler
Projektmanager Politik und Gesellschaft, Wikimedia Deutschland e.V.
14.00 Auch die Großen machen Fehler
Dr. Max Senges
Google Policy Team
14.30
Kaffeepause
15.00
600.000 Bücher im Netz. Zur Kooperation der Österreichischen Nationalbibliothek mit Google
Max Kaiser
Abteilungsleiter Forschung und Entwicklung, Österreichische Nationalbibliothek
15.30 “Irrwege im Netz?” – Die Kooperation des Bundesarchivs mit Wikimedia
Dr. Oliver Sander
Leiter des Referats B6 (“Bildarchiv”) im Bundesarchiv
16.00
Kaffeepause
16.30
Podiumsdiskussion: Wem “gehört” das kulturelle Erbe?
Moderation: Dr. Paul Klimpel
Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer
Universität der Künste
des. Direktor des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft, Berlin
Anja Horstmann
Historikerin, Universität Bielefeld
Dr. Oliver Sander
Leiter des Referats B6 (“Bildarchiv”) im Bundesarchiv
Dr. Max Senges
Google Policy Team
Prof. Monika Hagedorn-Saupe
Stellvertretende Leiterin des Instituts für Museumsforschung
Staatliche Museen zu Berlin
Konrad Becker
Forscher, Künstler und Produzent im Bereich elektronische Medien,
World-Information Institute
17.00
Digitalisierung: Von allen für alle (Projekt)
17.30
Ausklang
Leitung: Dr. Paul Klimpel
Koordination: Marc Thümmler
E-Mail: marc@collaboratory.org
Website: www.ins-netz-gegangen.org
symposium_recht_sdk - am Sonntag, 6. November 2011, 12:50 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://plan3t.info/2011/11/04/aeh-ja-doch-noch-was-zur-onleihe/
Die technischen Schwierigkeiten des Angebots sind dabei wohl vor allem auf das sehr restriktiv gestaltete DRM zurückzuführen, das bereits häufig beispielsweise bei Infobib, Archivalia, Netbib und Bibliothekarisch.de kritisiert wurde.
Um so problematischer finde ich persönlich, dass der DBV im “Bericht zur Lage der Bibliotheken 2011” (PDF, S. 7) die Onleihe für Öffentliche Bibliotheken als das probate Mittel für die digitale Teilhabe der Bibliotheken anpreist. Die Kosten von 4600,- Euro für eine Erstausstattung mit der Onleihe pro Bibliothek in einem Verbund(!) sind nicht zu unterschätzen, denn viele, gerade kleine Bibliotheken können dieses Geld nicht aufbringen, da dies schon ihr Erwerbungseta für alle Medien ist. Dabei ist die Onleihe immer nur ein Zusatzangebot zum “realen” Bibliotheksangeboten. Warum fordert der DBV nicht alternative Angebote ein? Es gibt doch genug Aggregatoren, Buchhändler oder Verlage, die sicherlich eigene Angebote aufbauen und einbringen könnten. Offensichtlich sind die armen Öffentlichen Bibliotheken jedoch keine interessante Handelszielgruppe.
Die technischen Schwierigkeiten des Angebots sind dabei wohl vor allem auf das sehr restriktiv gestaltete DRM zurückzuführen, das bereits häufig beispielsweise bei Infobib, Archivalia, Netbib und Bibliothekarisch.de kritisiert wurde.
Um so problematischer finde ich persönlich, dass der DBV im “Bericht zur Lage der Bibliotheken 2011” (PDF, S. 7) die Onleihe für Öffentliche Bibliotheken als das probate Mittel für die digitale Teilhabe der Bibliotheken anpreist. Die Kosten von 4600,- Euro für eine Erstausstattung mit der Onleihe pro Bibliothek in einem Verbund(!) sind nicht zu unterschätzen, denn viele, gerade kleine Bibliotheken können dieses Geld nicht aufbringen, da dies schon ihr Erwerbungseta für alle Medien ist. Dabei ist die Onleihe immer nur ein Zusatzangebot zum “realen” Bibliotheksangeboten. Warum fordert der DBV nicht alternative Angebote ein? Es gibt doch genug Aggregatoren, Buchhändler oder Verlage, die sicherlich eigene Angebote aufbauen und einbringen könnten. Offensichtlich sind die armen Öffentlichen Bibliotheken jedoch keine interessante Handelszielgruppe.
KlausGraf - am Sonntag, 6. November 2011, 05:20 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 6. November 2011, 00:53 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ulrich Johannes Schneider, Rektor der UB Leipzig, im Gespräch mit Martin Krebbers am 28.10.2011 in D-Radio Wissen
http://www.ub.uni-leipzig.de/schneider/audio-video/drw_201110281002_geschichte_der_bibliotheken_-_ges_1e126698.mp3
http://www.ub.uni-leipzig.de/schneider/audio-video/drw_201110281002_geschichte_der_bibliotheken_-_ges_1e126698.mp3
SW - am Samstag, 5. November 2011, 21:04 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Erfasst wurden die selbständigen, also nicht Stadtarchiv oder Museum eingeliederten Bibliotheken in städtischer Trägerschaft mit über 10.000 Titeln sowie - als Ausnahme - die vom Landkreis getragene Christian-Weise-Bibliothek Zittau. Insgesamt 28 Bibliotheken mit zusammen über 1,31 Mio. Titeln.
Die Angaben zu den Titeln stammen aus dem Fabian-Handbuch. Die angegebenen Internetseiten enthalten fast immer keine nennenswerten Informationen zum Altbestand. Ausnahmen sind vermerkt.
Es fehlen vor allem Informationen, ob Teile des Altbestands im OPAC der Bibliothek vorhanden sind.
In den Stadtstaaten Hamburg und Bremen sind die Staatsbibliotheken aus den historischen Stadtbibliotheken hervorgegangen, in Berlin die Zentralbibliothek.
Von den Stadtarchiven verwaltete Bibliotheken wurden nicht aufgenommen, auch wenn sie einen eigenen Eintrag im Fabian-Handbuch haben (Ausnahme: Lindau). Die wichtige wissenschaftliche Stadtbibliothek Soest (ca. 19.500 Titel) erscheint gemäß städtischer Website als Teil des Stadtarchivs Soest.
Die Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt heißt seit 2005 nur noch Universitätsbibliothek Frankfurt.
Unterhaltsträger der Stadt- und Universitätsbibliothek Köln ist das Land NRW. Die UB Kassel - Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel wird vom Land und der Stadt getragen.
2001 erfolgte die Übergabe der historischen Handschriften- und Buchbestände der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt durch die Landeshauptstadt Erfurt an die Universität Erfurt als Depositum (90.097 Titel
http://134.76.163.162/fabian?Stadt-_Und_Regionalbibliothek_(Erfurt) )
Im gleichen Jahr wurde auch die städtische Wessenberg-Bibliothek in Konstanz an die UB Konstanz übergeben:
http://www.ub.uni-konstanz.de/region/wessenberg-bibliothek/kurze-geschichte-der-wessenberg-bibliothek.html
Reihenfolge nach Bestandsgröße.
Die Links zum Fabian-Handbuch habe ich nicht kodiert, die Klammer ) ist in der angeklickten URL stets zu ergänzen.
***
Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek
133.922
http://134.76.163.162/fabian?Staats-_Und_Stadtbibliothek_(Augsburg)
http://www.augsburg.de/index.php?id=168 (vergleichsweise ausführlich), einige Ausstellungskataloge als PDFs
http://de.wikisource.org/wiki/Staats-_und_Stadtbibliothek_Augsburg
Mainz, Stadtbibliothek
130.000
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Mainz)
http://www.mainz.de/WGAPublisher/online/html/default/MKUZ-5UZCHY.DE.0
Sekundärliteratur zu den handschriften, Teilnahme an Dilibri (Digitalisate)
München, Stadtbibliothek
120.000
http://134.76.163.162/fabian?Staedtische_Bibliotheken_(Muenchen)
http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/stadtbibliothek/stadtbib-chronik-und-sammlungen.html
"Die Zentralbibliothek Am Gasteig ist eine der wenigen deutschen Bibliotheken in kommunaler Trägerschaft, die über umfangreiche historische Sammlungen verfügen. Das Kombinationsmodell eines modernen, öffentlichen Medienzentrums und einer qualitativ hochwertigen Informationsbibliothek mit archivarischem Auftrag ist im anglo-amerikanischen Raum weit verbreitet. Diese Public Libraries sind daher heute Vorbild für die Münchner Bibliothek, die aus einer Wissenschaftlichen Stadtbibliothek entstand."
Nürnberg, Stadtbibliothek
93.100
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Nuernberg)
http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de/spezialbibliothek/allgemeine_info.html (vergleichsweise ausführlich, Digitalisate bei den Kooperationsprojekten Hausbücher und VD17)
Zwickau, Ratsschulbibliothek
89.350
http://134.76.163.162/fabian?Ratsschulbibliothek_(Zwickau)
Eigene Website mit ausführlichen Informationen
http://www.rsb-zwickau.de/
Lübeck, Stadtbibliothek
81.536
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek(Luebeck)
http://stadtbibliothek.luebeck.de/zentrale/bestaende.html
Aachen, Stadtbibliothek
72.000
http://134.76.163.162/fabian?Oeffentliche_Bibliothek_(Aachen)
http://www.aachen.de/de/stadt_buerger/bildung/oeffentliche_bibliothek/zentralbibliothek/index.html
Handschriftenkataloge als Downloads.
Rudolstadt, Historische Bibliothek der Stadt
71.140
http://134.76.163.162/fabian?Historische_Bibliothek_(Rudolstadt)
http://www.rudolstadt.de/cms/website.php?id=/de/stadt_buerger/einrichtungen/kultureinrichtungen_neu/07113225115.htm
Nachfolgerin der Thüringischen Landesbibliothek Rudolstadt
Trier, Stadtbibliothek
70.912
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Trier)
http://www.stadtbibliothek-weberbach.de/
Teilnahme an Dilibri (Digitalisate), eigener Online-Katalog
Braunschweig, Stadtbibliothek
62.582
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Braunschweig)
Kleiner virtueller Rundgang:
http://www.braunschweig.de/kultur_tourismus/bibliotheken_archive/stadtbibliothek/buecherlust.html
Ulm, Stadtbibliothek
55.600
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Ulm)
Highlights aus dem Altbestand
http://www.ulm.de/kultur_tourismus/bibliotheken_und_literatur/highlights_aus_dem_altbestand.31282.3076,3963,3669,30713,31282.htm
Hannover, Stadtbibliothek
50.461
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbuechereien_(Hannover)
http://www.hannover.de/stabi/Wir_ueber_uns/Auftrag_und_Organisation/index.html
Lüneburg, Ratsbücherei
29.700
http://134.76.163.162/fabian?Ratsbuecherei
http://www.lueneburg.de/desktopdefault.aspx/tabid-88/180_read-7276/
Kempten, Stadtbibliothek
28.588 plus Zeitschriftenbände
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Kempten/Allgaeu)
Auf der Website kein Hinweis auf Altbestand!
http://www.kempten.de/de/bibliotheken.php
Bautzen, Stadtbibliothek
28.000
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Bautzen)
http://www.bautzen.de/stadtbibliothek.asp?mid=103&iid=156
Dortmund, Stadt- und Landesbibliothek
26.200
http://134.76.163.162/fabian?Stadt-_Und_Landesbibliothek_(Dortmund)
http://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/bildungwissenschaft/bibliothek/bibliothekensammlungen/handschriften/index.html
http://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/bildungwissenschaft/bibliothek/bibliothekensammlungen/historischebuchbestaende/index.html
Magdeburg, Stadtbibliothek
23.252
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Magdeburg)
Kein Hinweis auf den Altbestand auf der Website!
http://www.magdeburg.de/index.phtml?sNavID=115.37&La=1
Mönchengladbach, Stadtbibliothek
22950, nämlich 18.900 sowie Franziskanerbibliothek, soweit vor 1800, laut
http://134.76.163.162/fabian?Wissenschaft_Und_Weisheit_Der_Franziskaner
vor 1800 4050 Bände
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Moenchengladbach)
Dort erwähnt die Verwaltung des Spezialbestandes " Bibliothek des ehemaligen Volksvereins für das katholische Deutschland"
Hinzu kam 2003 der Altbestand der Studienbibliothek "Wissenschaft und Weisheit" des örtlichen Franziskanerklosters:
"Die Übergabe des Altbestandes (vor Erscheinungsjahr 1800) an die Stadtbibliothek Mönchengladbach wurde in einem Schenkungsvertrag zwischen der Kölnischen Franziskaner-Ordensprovinz GmbH und der Stadt Mönchengladbach dokumentiert. Der Vertrag wurde am 10.01.2003 bei einem Festakt im Rathaus Abtei von Provizialminister P. Klaus-Josef Färber und Stadtdirektor Wolfgang Rombey unterzeichnet. Für die Stadt Mönchengladbach bedeutet der bundesweit beachtete Schenkungsvertrag die einmalige Gelegenheit, die Franziskanerbibliothek als Zeugnis der Stadt- und Regionalgeschichte zu erhalten. Für die Stadtbibliothek stärkt dieser Vertrag die Doppelfunktion, neben der Öffentlichen Bibliothek auch einen Bereich "Wissenschaftliche Stadtbibliothek" zu unterhalten ("Von Inkunabeln bis Internet")."
http://www.moenchengladbach.de/index.php?id=sammlungen
Wuppertal, Stadtbibliothek
22.450
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Wuppertal)
http://www.wuppertal.de/kultur-bildung/stadtbibliothek/zentral/102370100000153794.php
Inkunabelkatalog:
http://stadtbibliothek-wuppertal.de//stadtbibliothek/inkunabeln/start.html
Worms, Stadtbibliothek
17.221
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Worms)
http://www.worms.de/deutsch/kultur/stadtbibliothek_wissenschaftlich.php?navid=4
Bildergalerie, Teilnahme an Dilibri (Digitalisate)
Video "Schätze der Bibliothek"
http://www.worms.de/deutsch//kultur/Stadtbibliothek/stadtbibliothek_wegweiser.php
Ballenstedt, Fürstin-Pauline-Bibliothek, früher: Stadtbibliothek
17.354
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Ballenstedt_Am_Harz)
http://www.bibliothek-ballenstedt.de/?page_id=18
Lindau, Reichsstädtische Bibliothek/Stadtbibliothek
17.000
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Lindau)
http://www.lindau2.de/index.php?sid=1023&ses=xtlumjpv
"Die Ehemals Reichsstädtische Bibliothek Lindau ist ein besonderer Teil des vom Stadtarchiv verwalteten Dokumentenerbes der Stadt. Sie ist die größte historische Rats- und Bürgerbibliothek am nördlichen Bodenseeufer." Auf der Website eigener Unterpunkt, daher hier trotz Verwaltung durch das Stadtarchiv aufgenommen.
Koblenz, Stadtbibliothek
16.086
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Koblenz)
http://www.koblenz.de/stadtleben_kultur/k42_altbestand.html
Teilnahme an Dilibri (Digitalisate)
Zittau, Christian-Weise-Bibliothek
13.680
http://134.76.163.162/fabian?Christian-Weise-Bibliothek
http://www.cwbz.de/altbestand/index.html
Überlingen, Leopold-Sophien-Bibliothek
13.662
http://134.76.163.162/fabian?Leopold-Sophien-Bibliothek
http://www.ueberlingen.de/Bildung_Kultur/L_S_Bibliothek/Bestand/
Saarbrücken, Wissenschaftlich-landeskundliche Abteilung der Stadtbibliothek
11.000+ Bände (Angaben sind unklar)
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek,_Wissenschaftlich_Landeskundliche_Abteilung
Keine Silbe über den Buchbestand vor 1900 bzw. 1800:
http://www.saarbruecken.de/de/bildung/stadtbibliothek/abteilungen_standorte/landeskundliche_abteilung
Memmingen, Stadtbibliothek
Etwa ein Drittel von 38.257 Bänden
http://134.76.163.162/fabian?Wissenschaftliche_Stadtbibliothek_(Memmingen)
Kein Hinweis auf den Altbestand auf der Website!
http://www.memmingen.de/468.html
Ludwigsburg, Stadtbibliothek
10.000 (?)
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Ludwigsburg)
Kein Hinweis auf den Altbestand auf Website und im Wikipedia-Artikel
http://www.stabi-ludwigsburg.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Stadtbibliothek_Ludwigsburg
Die Angaben zu den Titeln stammen aus dem Fabian-Handbuch. Die angegebenen Internetseiten enthalten fast immer keine nennenswerten Informationen zum Altbestand. Ausnahmen sind vermerkt.
Es fehlen vor allem Informationen, ob Teile des Altbestands im OPAC der Bibliothek vorhanden sind.
In den Stadtstaaten Hamburg und Bremen sind die Staatsbibliotheken aus den historischen Stadtbibliotheken hervorgegangen, in Berlin die Zentralbibliothek.
Von den Stadtarchiven verwaltete Bibliotheken wurden nicht aufgenommen, auch wenn sie einen eigenen Eintrag im Fabian-Handbuch haben (Ausnahme: Lindau). Die wichtige wissenschaftliche Stadtbibliothek Soest (ca. 19.500 Titel) erscheint gemäß städtischer Website als Teil des Stadtarchivs Soest.
Die Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt heißt seit 2005 nur noch Universitätsbibliothek Frankfurt.
Unterhaltsträger der Stadt- und Universitätsbibliothek Köln ist das Land NRW. Die UB Kassel - Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel wird vom Land und der Stadt getragen.
2001 erfolgte die Übergabe der historischen Handschriften- und Buchbestände der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt durch die Landeshauptstadt Erfurt an die Universität Erfurt als Depositum (90.097 Titel
http://134.76.163.162/fabian?Stadt-_Und_Regionalbibliothek_(Erfurt) )
Im gleichen Jahr wurde auch die städtische Wessenberg-Bibliothek in Konstanz an die UB Konstanz übergeben:
http://www.ub.uni-konstanz.de/region/wessenberg-bibliothek/kurze-geschichte-der-wessenberg-bibliothek.html
Reihenfolge nach Bestandsgröße.
Die Links zum Fabian-Handbuch habe ich nicht kodiert, die Klammer ) ist in der angeklickten URL stets zu ergänzen.
***
Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek
133.922
http://134.76.163.162/fabian?Staats-_Und_Stadtbibliothek_(Augsburg)
http://www.augsburg.de/index.php?id=168 (vergleichsweise ausführlich), einige Ausstellungskataloge als PDFs
http://de.wikisource.org/wiki/Staats-_und_Stadtbibliothek_Augsburg
Mainz, Stadtbibliothek
130.000
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Mainz)
http://www.mainz.de/WGAPublisher/online/html/default/MKUZ-5UZCHY.DE.0
Sekundärliteratur zu den handschriften, Teilnahme an Dilibri (Digitalisate)
München, Stadtbibliothek
120.000
http://134.76.163.162/fabian?Staedtische_Bibliotheken_(Muenchen)
http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/stadtbibliothek/stadtbib-chronik-und-sammlungen.html
"Die Zentralbibliothek Am Gasteig ist eine der wenigen deutschen Bibliotheken in kommunaler Trägerschaft, die über umfangreiche historische Sammlungen verfügen. Das Kombinationsmodell eines modernen, öffentlichen Medienzentrums und einer qualitativ hochwertigen Informationsbibliothek mit archivarischem Auftrag ist im anglo-amerikanischen Raum weit verbreitet. Diese Public Libraries sind daher heute Vorbild für die Münchner Bibliothek, die aus einer Wissenschaftlichen Stadtbibliothek entstand."
Nürnberg, Stadtbibliothek
93.100
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Nuernberg)
http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de/spezialbibliothek/allgemeine_info.html (vergleichsweise ausführlich, Digitalisate bei den Kooperationsprojekten Hausbücher und VD17)
Zwickau, Ratsschulbibliothek
89.350
http://134.76.163.162/fabian?Ratsschulbibliothek_(Zwickau)
Eigene Website mit ausführlichen Informationen
http://www.rsb-zwickau.de/
Lübeck, Stadtbibliothek
81.536
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek(Luebeck)
http://stadtbibliothek.luebeck.de/zentrale/bestaende.html
Aachen, Stadtbibliothek
72.000
http://134.76.163.162/fabian?Oeffentliche_Bibliothek_(Aachen)
http://www.aachen.de/de/stadt_buerger/bildung/oeffentliche_bibliothek/zentralbibliothek/index.html
Handschriftenkataloge als Downloads.
Rudolstadt, Historische Bibliothek der Stadt
71.140
http://134.76.163.162/fabian?Historische_Bibliothek_(Rudolstadt)
http://www.rudolstadt.de/cms/website.php?id=/de/stadt_buerger/einrichtungen/kultureinrichtungen_neu/07113225115.htm
Nachfolgerin der Thüringischen Landesbibliothek Rudolstadt
Trier, Stadtbibliothek
70.912
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Trier)
http://www.stadtbibliothek-weberbach.de/
Teilnahme an Dilibri (Digitalisate), eigener Online-Katalog
Braunschweig, Stadtbibliothek
62.582
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Braunschweig)
Kleiner virtueller Rundgang:
http://www.braunschweig.de/kultur_tourismus/bibliotheken_archive/stadtbibliothek/buecherlust.html
Ulm, Stadtbibliothek
55.600
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Ulm)
Highlights aus dem Altbestand
http://www.ulm.de/kultur_tourismus/bibliotheken_und_literatur/highlights_aus_dem_altbestand.31282.3076,3963,3669,30713,31282.htm
Hannover, Stadtbibliothek
50.461
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbuechereien_(Hannover)
http://www.hannover.de/stabi/Wir_ueber_uns/Auftrag_und_Organisation/index.html
Lüneburg, Ratsbücherei
29.700
http://134.76.163.162/fabian?Ratsbuecherei
http://www.lueneburg.de/desktopdefault.aspx/tabid-88/180_read-7276/
Kempten, Stadtbibliothek
28.588 plus Zeitschriftenbände
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Kempten/Allgaeu)
Auf der Website kein Hinweis auf Altbestand!
http://www.kempten.de/de/bibliotheken.php
Bautzen, Stadtbibliothek
28.000
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Bautzen)
http://www.bautzen.de/stadtbibliothek.asp?mid=103&iid=156
Dortmund, Stadt- und Landesbibliothek
26.200
http://134.76.163.162/fabian?Stadt-_Und_Landesbibliothek_(Dortmund)
http://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/bildungwissenschaft/bibliothek/bibliothekensammlungen/handschriften/index.html
http://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/bildungwissenschaft/bibliothek/bibliothekensammlungen/historischebuchbestaende/index.html
Magdeburg, Stadtbibliothek
23.252
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Magdeburg)
Kein Hinweis auf den Altbestand auf der Website!
http://www.magdeburg.de/index.phtml?sNavID=115.37&La=1
Mönchengladbach, Stadtbibliothek
22950, nämlich 18.900 sowie Franziskanerbibliothek, soweit vor 1800, laut
http://134.76.163.162/fabian?Wissenschaft_Und_Weisheit_Der_Franziskaner
vor 1800 4050 Bände
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Moenchengladbach)
Dort erwähnt die Verwaltung des Spezialbestandes " Bibliothek des ehemaligen Volksvereins für das katholische Deutschland"
Hinzu kam 2003 der Altbestand der Studienbibliothek "Wissenschaft und Weisheit" des örtlichen Franziskanerklosters:
"Die Übergabe des Altbestandes (vor Erscheinungsjahr 1800) an die Stadtbibliothek Mönchengladbach wurde in einem Schenkungsvertrag zwischen der Kölnischen Franziskaner-Ordensprovinz GmbH und der Stadt Mönchengladbach dokumentiert. Der Vertrag wurde am 10.01.2003 bei einem Festakt im Rathaus Abtei von Provizialminister P. Klaus-Josef Färber und Stadtdirektor Wolfgang Rombey unterzeichnet. Für die Stadt Mönchengladbach bedeutet der bundesweit beachtete Schenkungsvertrag die einmalige Gelegenheit, die Franziskanerbibliothek als Zeugnis der Stadt- und Regionalgeschichte zu erhalten. Für die Stadtbibliothek stärkt dieser Vertrag die Doppelfunktion, neben der Öffentlichen Bibliothek auch einen Bereich "Wissenschaftliche Stadtbibliothek" zu unterhalten ("Von Inkunabeln bis Internet")."
http://www.moenchengladbach.de/index.php?id=sammlungen
Wuppertal, Stadtbibliothek
22.450
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Wuppertal)
http://www.wuppertal.de/kultur-bildung/stadtbibliothek/zentral/102370100000153794.php
Inkunabelkatalog:
http://stadtbibliothek-wuppertal.de//stadtbibliothek/inkunabeln/start.html
Worms, Stadtbibliothek
17.221
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Worms)
http://www.worms.de/deutsch/kultur/stadtbibliothek_wissenschaftlich.php?navid=4
Bildergalerie, Teilnahme an Dilibri (Digitalisate)
Video "Schätze der Bibliothek"
http://www.worms.de/deutsch//kultur/Stadtbibliothek/stadtbibliothek_wegweiser.php
Ballenstedt, Fürstin-Pauline-Bibliothek, früher: Stadtbibliothek
17.354
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Ballenstedt_Am_Harz)
http://www.bibliothek-ballenstedt.de/?page_id=18
Lindau, Reichsstädtische Bibliothek/Stadtbibliothek
17.000
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Lindau)
http://www.lindau2.de/index.php?sid=1023&ses=xtlumjpv
"Die Ehemals Reichsstädtische Bibliothek Lindau ist ein besonderer Teil des vom Stadtarchiv verwalteten Dokumentenerbes der Stadt. Sie ist die größte historische Rats- und Bürgerbibliothek am nördlichen Bodenseeufer." Auf der Website eigener Unterpunkt, daher hier trotz Verwaltung durch das Stadtarchiv aufgenommen.
Koblenz, Stadtbibliothek
16.086
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Koblenz)
http://www.koblenz.de/stadtleben_kultur/k42_altbestand.html
Teilnahme an Dilibri (Digitalisate)
Zittau, Christian-Weise-Bibliothek
13.680
http://134.76.163.162/fabian?Christian-Weise-Bibliothek
http://www.cwbz.de/altbestand/index.html
Überlingen, Leopold-Sophien-Bibliothek
13.662
http://134.76.163.162/fabian?Leopold-Sophien-Bibliothek
http://www.ueberlingen.de/Bildung_Kultur/L_S_Bibliothek/Bestand/
Saarbrücken, Wissenschaftlich-landeskundliche Abteilung der Stadtbibliothek
11.000+ Bände (Angaben sind unklar)
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek,_Wissenschaftlich_Landeskundliche_Abteilung
Keine Silbe über den Buchbestand vor 1900 bzw. 1800:
http://www.saarbruecken.de/de/bildung/stadtbibliothek/abteilungen_standorte/landeskundliche_abteilung
Memmingen, Stadtbibliothek
Etwa ein Drittel von 38.257 Bänden
http://134.76.163.162/fabian?Wissenschaftliche_Stadtbibliothek_(Memmingen)
Kein Hinweis auf den Altbestand auf der Website!
http://www.memmingen.de/468.html
Ludwigsburg, Stadtbibliothek
10.000 (?)
http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek_(Ludwigsburg)
Kein Hinweis auf den Altbestand auf Website und im Wikipedia-Artikel
http://www.stabi-ludwigsburg.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Stadtbibliothek_Ludwigsburg
KlausGraf - am Samstag, 5. November 2011, 20:16 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Ein originales Zeugnis vom Leben der Preetzer Benediktinerinnen ist hingegen das heute zum Archivbestand des Klosters gehörende " Buch im Chore", das die von 1484 bis 1508 amtierende Priörin Anna von Buchwald seit 1471 zusammenstellte und das Klosteragende und Wirtschaftsbuch zugleich ist. Aus den in ihm enthaltenen Chroniknotizen geht hervor, daß sich eine Priörin am Anfang des 15. Jhs " dorch vele Boken, de se skref und skriven leht" um das Kloster verdient machte und daß die unmittelbare Amtsvorgängerin der Anna von Buchwald den Klosterfrauen " 3 düdesche Böke van dem Levende unses Herrn un van dem Rosenkranze Marien" schenkte. Davon ist jedoch nichts in der Bibliothek erhalten."
http://134.76.163.162/fabian?Kloster_Preetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Preetz

Fotos aus dem Kloster Preetz (teils von mir):
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Preetz_Priory
Update:
http://hdl.handle.net/1794/11650
http://134.76.163.162/fabian?Kloster_Preetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Preetz

Fotos aus dem Kloster Preetz (teils von mir):
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Preetz_Priory
Update:
http://hdl.handle.net/1794/11650
KlausGraf - am Samstag, 5. November 2011, 20:03 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Deutsche Verse über die Nutzlosigkeit ungelesener Bücher stehen in der Handschrift Stadtbibliothek Mainz, Hs I 300, fol. 124 verso. Meine Lesung (die ersten Verse auch bei List):
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mainz_nutzen_der_buecher.jpg
Nota bene
Wassze sollen die bucher die nyemant liest
Die sint nach unnuszer dan miest
Miest machet mangen acker dragen
So die bucher die holczworme nagen
(5) Die bucher sint leider worden vnwert
Desz steit isze huwer obeler dan vernte
Sprechen die paffen also gerne latine
Als gerne sie drincken guden wine
So fonden wir mangen gelerten man
Der me Latinis kunde dan er kan
Der Anfang ist klar: Was sollen Bücher, die niemand liest? Sie sind unnützer als Mist, Mist macht wenigstens manchen Acker fruchtbar, während Bücher, an denen die Holzwürmer nagen, immer weniger geschätzt werden. (Sehr frei übersetzt.) Am Schluss geht es gegen betrunkene Kleriker: Würden die Pfaffen so gern Latein sprechen wie sie guten Wein trinken, so fänden wir manchen Gelehrten, der besser Latein kann als in Wirklichkeit.
Vers 6 ist für mich ein schwerer Brocken. Eventuell: Des steht es früher übeler als (was?)
Huwer im Sinn von hiebevor (Variante!) in der Limburger Chronik
http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_Dt._Chron._4,1_S._75
Für vernte = Welt finde ich eine Variante bei Konrad von Megenberg
http://books.google.de/books?id=6xZKAAAAcAAJ&pg=PA509
Update:
https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/1KnJaAvfrGu
Der Vorschlag von Obermeir (Kommentar) scheint das Rätsel zu lösen (ebenso unabhängig davon Maria Rotter auf Facebook: ...in diesem Jahr (heuer) schlechter als im letzten Jahr). Huwer in der Limburger Chronik habe ich mit der Variante falsch verstanden, ein Schnipsel der oben zitierten Ausgabe erklärt aber "heuer"
http://books.google.de/books?&id=DjMMAQAAMAAJ&&q=huwer
vernt ist das Vorjahr: http://goo.gl/VrtyQ = Grimmsches Wb. online
Ich würde ißze als es (Frankfurter Reichscorrespondenz hat z.B. iß für es) lesen (nicht als jetzt), der Sinn wäre damit:
Die Bücher sind leider wertlos geworden
Damit/darum steht es heuer übeler als letztes Jahr.
Das Ganze ist ersichtlich eine Zeitklage, die a) den Verfall der Lesekultur beklagt und b) den der Latinität der Kleriker, die lieber saufen.
Nachtrag 6.11.: Die Verse sind ein Cento aus dem "Renner" Hugos von Trimberg, fand Kurt Gärtner heraus (Mitteilung von Annelen Ottermann):
http://www.handschriftencensus.de/15821
5883 Waz süln diu buoch, diu nieman list? 1
Diu sint noch unnützer denne mist. 2
Mist manigen magern acker tünget, (3)
Daz er fruht bringet und sich jünget:
Alsô sölten die sęle getünget werden
Von hôher meister lęre űf erden :
Die fünde man in vil manigen buochen,
5890 Der si mit flîze wölte suochen.
Nu sint si leider worden unwert: 5
Des stęt ez hiur wirs denne vert, 6
Sît milwen, holzwürme und schimel (4)
Nagent der buoch, der sęle ze himel (4)
Vor gote vil hôhe sint erhaben.
16637 Retten alle pfaffen als gerne latîn 7
Als gerne si trunken guoten wîn, 8
Sô fünde wir manigen gelęrten man, 9
16640 Der męre latîns könde denne er kan, 10
http://www.staff.ncl.ac.uk/henrike.laehnemann/renner/Teil16.html
http://de.wikisource.org/wiki/Bibliothek_des_Litterarischen_Vereins_in_Stuttgart (Links zu den 2 Bden der Ehrismann-Ausgabe)
Danke für alle Hilfe! Gemeinsam und mit Social Media kommt man schneller voran.
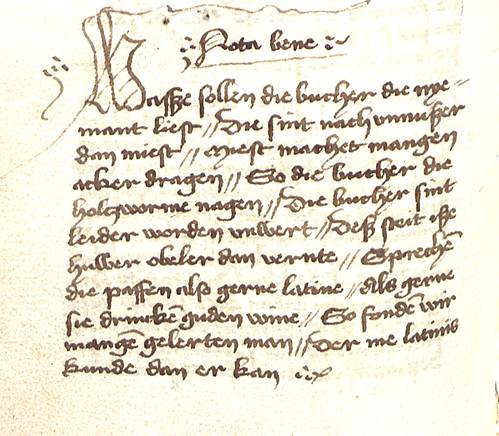
#forschung
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mainz_nutzen_der_buecher.jpg
Nota bene
Wassze sollen die bucher die nyemant liest
Die sint nach unnuszer dan miest
Miest machet mangen acker dragen
So die bucher die holczworme nagen
(5) Die bucher sint leider worden vnwert
Desz steit isze huwer obeler dan vernte
Sprechen die paffen also gerne latine
Als gerne sie drincken guden wine
So fonden wir mangen gelerten man
Der me Latinis kunde dan er kan
Der Anfang ist klar: Was sollen Bücher, die niemand liest? Sie sind unnützer als Mist, Mist macht wenigstens manchen Acker fruchtbar, während Bücher, an denen die Holzwürmer nagen, immer weniger geschätzt werden. (Sehr frei übersetzt.) Am Schluss geht es gegen betrunkene Kleriker: Würden die Pfaffen so gern Latein sprechen wie sie guten Wein trinken, so fänden wir manchen Gelehrten, der besser Latein kann als in Wirklichkeit.
Vers 6 ist für mich ein schwerer Brocken. Eventuell: Des steht es früher übeler als (was?)
Huwer im Sinn von hiebevor (Variante!) in der Limburger Chronik
http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_Dt._Chron._4,1_S._75
http://books.google.de/books?id=6xZKAAAAcAAJ&pg=PA509
Update:
https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/1KnJaAvfrGu
Der Vorschlag von Obermeir (Kommentar) scheint das Rätsel zu lösen (ebenso unabhängig davon Maria Rotter auf Facebook: ...in diesem Jahr (heuer) schlechter als im letzten Jahr). Huwer in der Limburger Chronik habe ich mit der Variante falsch verstanden, ein Schnipsel der oben zitierten Ausgabe erklärt aber "heuer"
http://books.google.de/books?&id=DjMMAQAAMAAJ&&q=huwer
vernt ist das Vorjahr: http://goo.gl/VrtyQ = Grimmsches Wb. online
Ich würde ißze als es (Frankfurter Reichscorrespondenz hat z.B. iß für es) lesen (nicht als jetzt), der Sinn wäre damit:
Die Bücher sind leider wertlos geworden
Damit/darum steht es heuer übeler als letztes Jahr.
Das Ganze ist ersichtlich eine Zeitklage, die a) den Verfall der Lesekultur beklagt und b) den der Latinität der Kleriker, die lieber saufen.
Nachtrag 6.11.: Die Verse sind ein Cento aus dem "Renner" Hugos von Trimberg, fand Kurt Gärtner heraus (Mitteilung von Annelen Ottermann):
http://www.handschriftencensus.de/15821
5883 Waz süln diu buoch, diu nieman list? 1
Diu sint noch unnützer denne mist. 2
Mist manigen magern acker tünget, (3)
Daz er fruht bringet und sich jünget:
Alsô sölten die sęle getünget werden
Von hôher meister lęre űf erden :
Die fünde man in vil manigen buochen,
5890 Der si mit flîze wölte suochen.
Nu sint si leider worden unwert: 5
Des stęt ez hiur wirs denne vert, 6
Sît milwen, holzwürme und schimel (4)
Nagent der buoch, der sęle ze himel (4)
Vor gote vil hôhe sint erhaben.
16637 Retten alle pfaffen als gerne latîn 7
Als gerne si trunken guoten wîn, 8
Sô fünde wir manigen gelęrten man, 9
16640 Der męre latîns könde denne er kan, 10
http://www.staff.ncl.ac.uk/henrike.laehnemann/renner/Teil16.html
http://de.wikisource.org/wiki/Bibliothek_des_Litterarischen_Vereins_in_Stuttgart (Links zu den 2 Bden der Ehrismann-Ausgabe)
Danke für alle Hilfe! Gemeinsam und mit Social Media kommt man schneller voran.
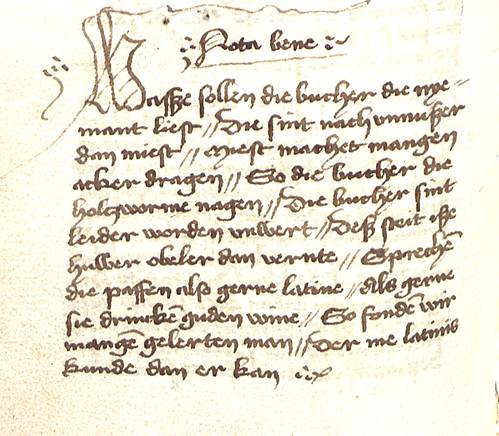
#forschung
KlausGraf - am Samstag, 5. November 2011, 18:53 - Rubrik: Kodikologie
Messe und Kongress sind zeitnah aber trotzdessen sehr empfehlenswert: Moderner Staat
schwalm.potsdam - am Samstag, 5. November 2011, 18:21 - Rubrik: E-Government
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Neues Buch:
Vier Prinzen zu Schaumburg-Lippe, Kammler und von Behr
circa 175 Seiten, 17 euro.
Vierprinzen
Avenida America 8
28002 Madrid
fax 003491 235 41 50
alexander@vierprinzen.com
http://vierprinzen.blogspot.com
Vier Prinzen zu Schaumburg-Lippe, Kammler und von Behr
circa 175 Seiten, 17 euro.
Vierprinzen
Avenida America 8
28002 Madrid
fax 003491 235 41 50
alexander@vierprinzen.com
http://vierprinzen.blogspot.com
vierprinzen - am Samstag, 5. November 2011, 18:02 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
http://openpetition.de/petition/online/der-bestand-der-wissenschaftlichen-stadtbibliothek-mainz-darf-nicht-zerschlagen-werden
In der Allgemeinen Zeitung erschien ein Interview mit dem Vorsitzenden der Mainzer Bibliotheksgesellschaft
http://www.allgemeine-zeitung.de/region/mainz/meldungen/11328154.htm
STADTBIBLIOTHEK Förderverein wehrt sich gegen Teilungspläne / Online-Petition gestartet
Zu den Plänen der Ampelkoalition, die Bestände der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek aufzuteilen, meldet sich der Förderverein, die Mainzer Bibliotheksgesellschaft zu Wort. Die AZ sprach mit dem Vorsitzenden Thomas Busch.
Warum ist es so wichtig, dass die Sammlung nicht zerteilt wird?
Im Falle einer Zersplitterung der Sammlung wären Teile des Bestandes nicht mehr frei zugänglich. Die seit 200 Jahren im städtischen Besitz befindliche Bibliothek birgt in ihren historischen und regionalen Sammlungen einzigartige Schätze vom 9. Jahrhundert bis heute. Die Sammlung ist auch international ein Aushängeschild der Gutenbergstadt und Stadt der Wissenschaft.
Wie groß ist der Bestand und wie ist er zustande gekommen?
Der Bestand umfasst 670 000 Bücher und Medien. Diese stammen zum Beispiel aus den alten Mainzer Klösterbibliotheken. Zudem haben Mainzer Bürger ihre Büchersammlungen gestiftet oder testamentarisch hinterlassen und sich damit mit der Bürgerbibliothek identifiziert. Auch heute engagieren sich Buchpaten aus allen Kreisen der Bevölkerung bei der Restaurierung von historischen Druckwerken und übernehmen hierbei erhebliche Kosten.
Welche organisatorischen Konsequenzen hätten die Sparpläne?
Eine wissenschaftliche Stadtbibliothek gäbe es dann nicht mehr. Es gäbe keine zentrale Anlaufstelle mehr für internationale Forscher und sonstige interessierte Nutzer.
Was zeichnet die Bibliothek aus?
Sie ist eine lebendige, regionale Forschungsbibliothek. Ihre Bestände müssen in vollem Umfang und in ihrem historisch gewachsenen Zusammenhang erhalten bleiben, um auch weiterhin eine uneingeschränkte Nutzung für wissenschaftliche und regionalkundliche Zwecke zu ermöglichen.
Wie kann man sich für den Erhalt der Bibliothek einsetzen?
Wir haben eine Online-Petition gestartet, die mit unserer Homepage http://www.MainzerBibliotheksgesellschaft.de verlinkt ist. Dort besteht auch die Möglichkeit, sich inhaltlich zu äußern.
Das Gespräch führte Michael Sowada
Stellungnahmen können hier hinterlassen werden:
http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/bibliothek-in-not/meinungsbeitraege.html
Siehe auch
http://archivalia.tumblr.com/tagged/stadtbibliothek_mainz
http://archiv.twoday.net/search?q=mainz+stadtbibliothek

In der Allgemeinen Zeitung erschien ein Interview mit dem Vorsitzenden der Mainzer Bibliotheksgesellschaft
http://www.allgemeine-zeitung.de/region/mainz/meldungen/11328154.htm
STADTBIBLIOTHEK Förderverein wehrt sich gegen Teilungspläne / Online-Petition gestartet
Zu den Plänen der Ampelkoalition, die Bestände der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek aufzuteilen, meldet sich der Förderverein, die Mainzer Bibliotheksgesellschaft zu Wort. Die AZ sprach mit dem Vorsitzenden Thomas Busch.
Warum ist es so wichtig, dass die Sammlung nicht zerteilt wird?
Im Falle einer Zersplitterung der Sammlung wären Teile des Bestandes nicht mehr frei zugänglich. Die seit 200 Jahren im städtischen Besitz befindliche Bibliothek birgt in ihren historischen und regionalen Sammlungen einzigartige Schätze vom 9. Jahrhundert bis heute. Die Sammlung ist auch international ein Aushängeschild der Gutenbergstadt und Stadt der Wissenschaft.
Wie groß ist der Bestand und wie ist er zustande gekommen?
Der Bestand umfasst 670 000 Bücher und Medien. Diese stammen zum Beispiel aus den alten Mainzer Klösterbibliotheken. Zudem haben Mainzer Bürger ihre Büchersammlungen gestiftet oder testamentarisch hinterlassen und sich damit mit der Bürgerbibliothek identifiziert. Auch heute engagieren sich Buchpaten aus allen Kreisen der Bevölkerung bei der Restaurierung von historischen Druckwerken und übernehmen hierbei erhebliche Kosten.
Welche organisatorischen Konsequenzen hätten die Sparpläne?
Eine wissenschaftliche Stadtbibliothek gäbe es dann nicht mehr. Es gäbe keine zentrale Anlaufstelle mehr für internationale Forscher und sonstige interessierte Nutzer.
Was zeichnet die Bibliothek aus?
Sie ist eine lebendige, regionale Forschungsbibliothek. Ihre Bestände müssen in vollem Umfang und in ihrem historisch gewachsenen Zusammenhang erhalten bleiben, um auch weiterhin eine uneingeschränkte Nutzung für wissenschaftliche und regionalkundliche Zwecke zu ermöglichen.
Wie kann man sich für den Erhalt der Bibliothek einsetzen?
Wir haben eine Online-Petition gestartet, die mit unserer Homepage http://www.MainzerBibliotheksgesellschaft.de verlinkt ist. Dort besteht auch die Möglichkeit, sich inhaltlich zu äußern.
Das Gespräch führte Michael Sowada
Stellungnahmen können hier hinterlassen werden:
http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/bibliothek-in-not/meinungsbeitraege.html
Siehe auch
http://archivalia.tumblr.com/tagged/stadtbibliothek_mainz
http://archiv.twoday.net/search?q=mainz+stadtbibliothek

KlausGraf - am Samstag, 5. November 2011, 17:47 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der IT-Planungsrat hat in seiner letzten Sitzung SAGA 5 beschlossen. Erstmals ist SAGA für den Bund verbindlich und unabhängig davon auch für Länder und Kommunen eine gute Quelle bzgl. IT-Standards. Nähere Information hier: SAGA 5
schwalm.potsdam - am Samstag, 5. November 2011, 17:17 - Rubrik: E-Government
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.digitalartconservation.org/
"Das Projekt digital art conservation widmet sich zum ersten der Dokumentation und Inventarisierung der Medienkunstsammlungen am Oberrhein, zum zweiten möchte es aufbauend auf der langjährigen Erfahrung der Partner mit der Erhaltung und Präsentation von digitaler Medienkunst einen Beitrag zur internationalen Diskussion um diesen neuen Bereich der Konservierung leisten. "
Mit dem Kurator der aktuellen Ausstellung "Digital Art Works" - eine ordentliche ausführliche Website gibt es nicht http://on1.zkm.de/zkm/stories/storyReader$7715 - sprach der SPIEGEL (43/2011, S. 134) über den rapiden Verfall digitaler Kunst. Bernhard Serexhe setzt auf ein Computermuseum, also auf die originale Hardware, da niemand die originale Software originalgetreu nachprogrammieren könne.
"Das Projekt digital art conservation widmet sich zum ersten der Dokumentation und Inventarisierung der Medienkunstsammlungen am Oberrhein, zum zweiten möchte es aufbauend auf der langjährigen Erfahrung der Partner mit der Erhaltung und Präsentation von digitaler Medienkunst einen Beitrag zur internationalen Diskussion um diesen neuen Bereich der Konservierung leisten. "
Mit dem Kurator der aktuellen Ausstellung "Digital Art Works" - eine ordentliche ausführliche Website gibt es nicht http://on1.zkm.de/zkm/stories/storyReader$7715 - sprach der SPIEGEL (43/2011, S. 134) über den rapiden Verfall digitaler Kunst. Bernhard Serexhe setzt auf ein Computermuseum, also auf die originale Hardware, da niemand die originale Software originalgetreu nachprogrammieren könne.
KlausGraf - am Samstag, 5. November 2011, 01:17 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Benutzer Concord schrieb mir in der Wikipedia:
Serendipity: Dein Hinweis bei Archivalia auf die Commons-Kategorie zur Stadtbibliothek Mainz brachte mich zu einem Bild eines Lipman-Regals, was mich veranlasste, eine wegen der Erwähnung ohne link in Stadtbibliothek (Lübeck) schon lange geplante Recherche zum Anbieter Wolf Netter & Jacobi zu unternehmen - eine erstaunliche Gechichte des Herstellers von Archiv- und Bibliotheksregalen und sonstigem Zubehör in Deustchland - bis zur "Arisierung" durch Mannesman 1938... Die verlinkten Sammlungsstücke auf Internet Archive (besser zugänglich als beim Leo Beack Institute selbst...) bieten reichlich Material, auch Fotos zur Geschichte des Bibliotheksbaus im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Carl Leopold Netter ist auch noch dabei abgefallen... Grüsse --Concord 23:25, 4. Nov. 2011 (CET)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolf_Netter_%26_Jacobi
http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Leopold_Netter

Serendipity: Dein Hinweis bei Archivalia auf die Commons-Kategorie zur Stadtbibliothek Mainz brachte mich zu einem Bild eines Lipman-Regals, was mich veranlasste, eine wegen der Erwähnung ohne link in Stadtbibliothek (Lübeck) schon lange geplante Recherche zum Anbieter Wolf Netter & Jacobi zu unternehmen - eine erstaunliche Gechichte des Herstellers von Archiv- und Bibliotheksregalen und sonstigem Zubehör in Deustchland - bis zur "Arisierung" durch Mannesman 1938... Die verlinkten Sammlungsstücke auf Internet Archive (besser zugänglich als beim Leo Beack Institute selbst...) bieten reichlich Material, auch Fotos zur Geschichte des Bibliotheksbaus im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Carl Leopold Netter ist auch noch dabei abgefallen... Grüsse --Concord 23:25, 4. Nov. 2011 (CET)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolf_Netter_%26_Jacobi
http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Leopold_Netter

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.welt.de/print/die_welt/hamburg/article13697640/Dolchstoss-fuer-den-Denkmalschutz.html
Das geplante neue Denkmalschutzgesetz für Schleswig-Holstein ist bei einer Anhörung des Landtags heftig kritisiert worden. Denkmalschutz-Institutionen, aber auch Städte, Kreise und Gemeinden lehnten am Donnerstag in Kiel vor dem Bildungsausschuss des Parlaments den Gesetzentwurf der CDU/FDP-Regierungskoalition vehement ab. Tenor der Kritik: Der bisherige Denkmalschutz werde geschwächt, ausgehöhlt zugunsten der wirtschaftlichen Interessen von Eigentümern denkmalgeschützter Bauten.
Von einem Paradigmenwechsel spricht der Landeskonservator:
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/fazit/1594979/
"Wir in Schleswig-Holstein müssen erkennen, dass wir uns doch weitgehend dann außerhalb vereinbarter kulturpolitischer und kultureller Strategien und Verabredungen stellen und dass Schleswig-Holstein auch im Denkmalschutz die aller-, allerletzte Rolle unter den Bundesländern einnimmt."
http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1225401
Das Nationalkomitee für Denkmalschutz sieht durch Pläne der schwarz-gelben Koalition in Kiel den Denkmalschutz bundesweit bedroht. «Es weht der Denkmalpflege ohnehin ein scharfer Wind entgegen», sagte die Geschäftsführerin Andrea Pufke in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. Da hätte ein Gesetz, wie Kiel es Ende des Jahres verabschieden will, verheerende Folgen für Deutschland, weil es ein negatives Beispiel wäre. Das Nationalkomitee ist beim Kulturstaatsminister des Bundes angesiedelt und sieht sich als Koordinierungsstelle für die meist föderal geprägte Denkmalpflege.
CDU und FDP an der Förde wollen mit einem neuen Denkmalschutzgesetz die Rechte der Eigentümer stärken und ihre wirtschaftlichen Belange mehr berücksichtigen. «Es ist völlig absurd, wenn ich in einem Gesetz, das die Denkmäler schützen soll, andere Rechtsgüter hervorhebe», kritisierte Pufke.
Außerdem will die Koalition die Verwaltung verschlanken und dazu wichtige Aufgaben des Landesamts für Denkmalpflege auf die unteren Denkmalschutzbehörden übertragen. Bauten ab 1950 sollen darüber hinaus schwerer unter Schutz zu stellen sein: Das Kulturministerium muss extra zustimmen. «Das ist wirklich einzigartig und entbehrt jeder Grundlage», sagte Pufke. «Da scheinen einige ein Problem mit moderner Architektur zu haben.»
Materialien, u.a. der Gesetzentwurf
http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl17/drucks/1600/drucksache-17-1617.pdf
finden sich im Landtagsinformationssystem SH.
Update: http://archiv.twoday.net/stories/64022849/
Das geplante neue Denkmalschutzgesetz für Schleswig-Holstein ist bei einer Anhörung des Landtags heftig kritisiert worden. Denkmalschutz-Institutionen, aber auch Städte, Kreise und Gemeinden lehnten am Donnerstag in Kiel vor dem Bildungsausschuss des Parlaments den Gesetzentwurf der CDU/FDP-Regierungskoalition vehement ab. Tenor der Kritik: Der bisherige Denkmalschutz werde geschwächt, ausgehöhlt zugunsten der wirtschaftlichen Interessen von Eigentümern denkmalgeschützter Bauten.
Von einem Paradigmenwechsel spricht der Landeskonservator:
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/fazit/1594979/
"Wir in Schleswig-Holstein müssen erkennen, dass wir uns doch weitgehend dann außerhalb vereinbarter kulturpolitischer und kultureller Strategien und Verabredungen stellen und dass Schleswig-Holstein auch im Denkmalschutz die aller-, allerletzte Rolle unter den Bundesländern einnimmt."
http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1225401
Das Nationalkomitee für Denkmalschutz sieht durch Pläne der schwarz-gelben Koalition in Kiel den Denkmalschutz bundesweit bedroht. «Es weht der Denkmalpflege ohnehin ein scharfer Wind entgegen», sagte die Geschäftsführerin Andrea Pufke in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. Da hätte ein Gesetz, wie Kiel es Ende des Jahres verabschieden will, verheerende Folgen für Deutschland, weil es ein negatives Beispiel wäre. Das Nationalkomitee ist beim Kulturstaatsminister des Bundes angesiedelt und sieht sich als Koordinierungsstelle für die meist föderal geprägte Denkmalpflege.
CDU und FDP an der Förde wollen mit einem neuen Denkmalschutzgesetz die Rechte der Eigentümer stärken und ihre wirtschaftlichen Belange mehr berücksichtigen. «Es ist völlig absurd, wenn ich in einem Gesetz, das die Denkmäler schützen soll, andere Rechtsgüter hervorhebe», kritisierte Pufke.
Außerdem will die Koalition die Verwaltung verschlanken und dazu wichtige Aufgaben des Landesamts für Denkmalpflege auf die unteren Denkmalschutzbehörden übertragen. Bauten ab 1950 sollen darüber hinaus schwerer unter Schutz zu stellen sein: Das Kulturministerium muss extra zustimmen. «Das ist wirklich einzigartig und entbehrt jeder Grundlage», sagte Pufke. «Da scheinen einige ein Problem mit moderner Architektur zu haben.»
Materialien, u.a. der Gesetzentwurf
http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl17/drucks/1600/drucksache-17-1617.pdf
finden sich im Landtagsinformationssystem SH.
Update: http://archiv.twoday.net/stories/64022849/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die lesenswerten Überlegungen von Pierre Mounier nun auch auf Deutsch:
http://dhdhi.hypotheses.org/591
Zum Thema siehe zuletzt in Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/43002425/
http://archiv.twoday.net/stories/43008401/
http://dhdhi.hypotheses.org/591
Zum Thema siehe zuletzt in Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/43002425/
http://archiv.twoday.net/stories/43008401/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.openpetition.de/petition/online/der-bestand-der-wissenschaftlichen-stadtbibliothek-mainz-darf-nicht-zerschlagen-werden
Frühere Berichterstattung:
http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbibliothek+mainz

Frühere Berichterstattung:
http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbibliothek+mainz

KlausGraf - am Freitag, 4. November 2011, 13:13
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
The Global Open Access Portal (GOAP), funded by the Governments of Colombia, Denmark, Norway, and the United States Department of State, presents a current snapshot of the status of Open Access (OA) to scientific information around the world. For countries that have been more successful implementing Open Access, the portal highlights critical success factors and aspects of the enabling environment. For countries and regions that are still in the early stages of Open Access development, the portal identifies key players, potential barriers and opportunities.
The Global Open Access Portal is designed to provide the necessary information for policy-makers to learn about the global OA environment and to view their country’s status, and understand where and why Open Access has been most successful.
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/
The Global Open Access Portal is designed to provide the necessary information for policy-makers to learn about the global OA environment and to view their country’s status, and understand where and why Open Access has been most successful.
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/
KlausGraf - am Freitag, 4. November 2011, 13:10 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Leiter des Detmolder Landesarchivs, Dr. Christian Reinicke, ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Reinicke leitete seit 2008 die Abteilung Ostwestfalen-Lippe des Landesarchivs und war zudem Vorsitzender des Naturwissenschaftlichen und Historischen Vereins für das Land Lippe (NHV). Er habe viele Akzente für das Archivwesen gesetzt, würdigt das Landesarchiv den Verstorbenen.
http://www.lz.de/aktuelles/aktuelle_meldungen_aus_der_region/5249651_Trauer_um_Leiter_des_Landesarchivs.html
Mit meinen KurskollegInnen trauere ich um Christian.
http://www.lz.de/aktuelles/aktuelle_meldungen_aus_der_region/5249651_Trauer_um_Leiter_des_Landesarchivs.html
Mit meinen KurskollegInnen trauere ich um Christian.
KlausGraf - am Freitag, 4. November 2011, 13:06 - Rubrik: Personalia
Ein Bundesministerium darf den Antrag auf Zugang zu amtlichen Informationen - hier hausinterne Unterlagen zu einem Gesetzgebungsverfahren sowie Stellungnahmen gegenüber dem Petitionsausschuss - nicht mit der Begründung ablehnen, dass die Unterlagen die Regierungstätigkeit betreffen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute entschieden.
Im ersten Fall begehrt der Kläger Einsicht in Unterlagen des Bundesjustizministeriums zur Frage der Reformbedürftigkeit des Kindschaftsrechts. Anlass für die Untersuchungen und Überlegungen war ein Prüfauftrag des Bundesverfassungsgerichts, der sich mittlerweile durch eine weitere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erledigt hat. Im Streit waren zuletzt noch interne Vorlagen für die Ministerin. Im zweiten Fall verlangt der Kläger Zugang zu Stellungnahmen des Bundesjustizministeriums, die dieses in zwei mittlerweile abgeschlossenen Petitionsverfahren gegenüber dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages abgegeben hat. Diese Petitionen betrafen über den Einzelfall hinausgehende Fragen zur Rehabilitierung der Opfer der so genannten Boden- und Industriereform in der damaligen SBZ. Die Kläger berufen sich auf das Informationsfreiheitsgesetz, das grundsätzlich jedermann gegenüber Behörden des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen gewährt.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die den Klagen stattgebenden Entscheidungen der Vorinstanzen bestätigt und die Revisionen der beklagten Bundesrepublik zurückgewiesen. Das Bundesjustizministerium gehöre zu den zur Auskunft verpflichteten Behörden. Eine Unterscheidung zwischen dem Verwaltungs- und dem Regierungshandeln eines Ministeriums sei im Gesetz nicht angelegt und auch nach dem Gesetzeszweck nicht gerechtfertigt. Es komme auch nicht darauf an, dass das Ministerium mit der Abgabe einer Stellungnahme gegenüber dem Petitionsausschuss eine verfassungsrechtliche Verpflichtung erfülle. Auch die im Gesetz geregelten Versagungsgründe stünden dem Anspruch der Kläger nicht entgegen. Insbesondere könne sich das Ministerium hier nicht auf den Schutz der Vertraulichkeit von Beratungen berufen.
BVerwG 7 C 3.11 und 4.11 - Urteile vom 3. November 2011
http://goo.gl/W4BGz = BVerwG-Pressemitteilung
Via
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Grundsatzurteile-zur-Informationsfreiheit-1371447.html
Im ersten Fall begehrt der Kläger Einsicht in Unterlagen des Bundesjustizministeriums zur Frage der Reformbedürftigkeit des Kindschaftsrechts. Anlass für die Untersuchungen und Überlegungen war ein Prüfauftrag des Bundesverfassungsgerichts, der sich mittlerweile durch eine weitere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erledigt hat. Im Streit waren zuletzt noch interne Vorlagen für die Ministerin. Im zweiten Fall verlangt der Kläger Zugang zu Stellungnahmen des Bundesjustizministeriums, die dieses in zwei mittlerweile abgeschlossenen Petitionsverfahren gegenüber dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages abgegeben hat. Diese Petitionen betrafen über den Einzelfall hinausgehende Fragen zur Rehabilitierung der Opfer der so genannten Boden- und Industriereform in der damaligen SBZ. Die Kläger berufen sich auf das Informationsfreiheitsgesetz, das grundsätzlich jedermann gegenüber Behörden des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen gewährt.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die den Klagen stattgebenden Entscheidungen der Vorinstanzen bestätigt und die Revisionen der beklagten Bundesrepublik zurückgewiesen. Das Bundesjustizministerium gehöre zu den zur Auskunft verpflichteten Behörden. Eine Unterscheidung zwischen dem Verwaltungs- und dem Regierungshandeln eines Ministeriums sei im Gesetz nicht angelegt und auch nach dem Gesetzeszweck nicht gerechtfertigt. Es komme auch nicht darauf an, dass das Ministerium mit der Abgabe einer Stellungnahme gegenüber dem Petitionsausschuss eine verfassungsrechtliche Verpflichtung erfülle. Auch die im Gesetz geregelten Versagungsgründe stünden dem Anspruch der Kläger nicht entgegen. Insbesondere könne sich das Ministerium hier nicht auf den Schutz der Vertraulichkeit von Beratungen berufen.
BVerwG 7 C 3.11 und 4.11 - Urteile vom 3. November 2011
http://goo.gl/W4BGz = BVerwG-Pressemitteilung
Via
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Grundsatzurteile-zur-Informationsfreiheit-1371447.html
KlausGraf - am Freitag, 4. November 2011, 12:56 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Laut FOCUS-Online v. 3.11.11 scheint dies so zu sein:
"..... Am 18. Oktober hatte die landeseigene Immobiliengesellschaft BLB dem Verwaltungsrat, einem parlamentarischen Kontrollgremium, auf 21 Seiten dargelegt, warum der umstrittene Weiterbau „im Duisburger Innenhafen“ einen Aufschlag in Höhe von knapp 38 Millionen Euro verschlingen werde. Die Abgeordneten des BLB-Verwaltungsrates reagierten äußerst gereizt auf die neuerliche Kostennote. Nach FOCUS-Online-Informationen stoppten die Politiker aller Parteien zunächst die weiteren Geldflüsse.
Demnach kletterten die Aufwendungen für die Errichtung des Archiv-Speichers auf fast 180 Millionen Euro. Dazu kommen die Ausgaben für den Ankauf der notwendigen Grundstücke in der Größenordnung von rund 19 Millionen Euro. .... Die rot-grünen Überlegungen zum Ausstieg aus dem Archiv-Projekt gehen nicht zuletzt auch auf parteitaktisches Kalkül zurück. Bisher galt das Landesarchiv als überteuerte Hinterlassenschaft der schwarz-gelben Vorgängerregierung. „Wenn wir das Ding aber jetzt trotz der immensen Mehrkosten fertig stellen, ist es ein rot-grünes Projekt. Das will bei uns niemand“, bekennt ein Parlamentarier aus der Koalitionsriege. .... Kalkulatoren machten Anfängerfehler: So hatten die Kalkulatoren vergessen, mehr als eine halbe Million Euro Umsatzsteuer für Rechnungen der zuständigen Architekten einzurechnen. Schlimmer noch: 825 000 Euro beträgt der Mehr-Posten „Eigenleistungen des BLB NRW für Planung und Projektsteuerung“. Auch die Gebühren für Bauanträge, Sondernutzungen und Abnahmen wurden schlichtweg nicht einkalkuliert – ein Anfängerfehler.
Am Ende des ersten Kapitels wartet ein ganz starkes Stück: Das Duisburger Rathaus verlangt für den Verkauf eines kleineren Areals, auf dem der Gesamt-Komplex gebaut wird, einen Nachschlag von 454 000 Euro. Anders gesagt: Die Stadt, die vor allem von dem neuen Landesarchiv profitiert, schröpft das Land nochmals um einen erheblichen Betrag. Damit nicht genug, reiht sich ein Bock an den nächsten: Knapp 700 000 für den Projektsteuerer hatte man genauso vergessen so wie 2,3 Millionen für „Altlasten, Schadstoff- und Baugrundrisiko“. Und das, obwohl der BLB auf einem alten Speditionsgelände und einigen umliegenden Brachen im Duisburger Binnenhafen baut, auf dem sicher kein biologischer Ackerbau betrieben wurde.
Allein der Umbau zweier denkmalgeschützter Hafenkrananlagen nimmt zusätzlich 100 000 Euro in Anspruch. Auch der Kampfmittelräumdienst auf der Suche nach Flieger-Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg schlägt mit mehr als 400 000 Euro zu Buche.
Zu guter Letzt langt auch der Konzern Hochtief ordentlich zu. Der Generalunternehmer hat dem BLB bereits mehr als zwei Millionen Euro wegen Baustillstands in Rechnung gestellt. Allein durch eine Flutung der Baustelle sind 42 Tage ins Land gegangen. Jeder Tag kostet 48 000 Euro.
Skurril und teuer zugleich wird der Rechtsstreit, den der BLB mit den ausgewählten Architekten Ortner und Ortner führen muss. Letztere wehren sich gegen die Landespläne, den Archiv-Speicher mit einer Wärme-dämmverbundfassade auszustatten. Kostenpunkt: 2,236 Millionen Euro. Weitere Risikorückstellungen durch mögliche Architektenklagen beziffert der BLB auf 2,6 Millionen Euro.
Auch die Berechnungen der Bauzeitzinsen waren wohl falsch. 4,5 Millionen Euro kommen oben drauf. Zudem rechnen die BLB-Kalkulatoren mit einer Bauzeitverlängerung von 13 Monaten: Macht knapp sechs Millionen Euro an Zusatzausgaben.
...."
Kommentar:
Dass das Projekt von der Standortwahl angefangen unter keinem guten Stern - dies ist noch gelinde formuliert - stand, dürfte allen klar sein. Die Alternative zwischen Weiter so und Abbruch des Projektes darf gerne durchdacht werden, aber man möge das eigentliche Ziel nicht aus den Augen verlieren: 3 Abteilungen des Landesarchivs benötigen dringend neuen Raum! Parteitaktische Gründe sollten hinten angestellt werden. Denn der Stopp des Projektes ist nicht nur schwarz-gelb anzulasten. Lediglich die Grünen vermittelten mit Kleinen Anfragen frühzeitig ein Interesse am Projekt. Von einer Kontrolle durch die Opposition kann nicht die Rede sein. Archivbelange sind eben nicht in Wählerstimmen umzurechnen - quasi ein Quotenkiller.
Zur Archivalia-Berichterstattung seit 2007 s. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg
"..... Am 18. Oktober hatte die landeseigene Immobiliengesellschaft BLB dem Verwaltungsrat, einem parlamentarischen Kontrollgremium, auf 21 Seiten dargelegt, warum der umstrittene Weiterbau „im Duisburger Innenhafen“ einen Aufschlag in Höhe von knapp 38 Millionen Euro verschlingen werde. Die Abgeordneten des BLB-Verwaltungsrates reagierten äußerst gereizt auf die neuerliche Kostennote. Nach FOCUS-Online-Informationen stoppten die Politiker aller Parteien zunächst die weiteren Geldflüsse.
Demnach kletterten die Aufwendungen für die Errichtung des Archiv-Speichers auf fast 180 Millionen Euro. Dazu kommen die Ausgaben für den Ankauf der notwendigen Grundstücke in der Größenordnung von rund 19 Millionen Euro. .... Die rot-grünen Überlegungen zum Ausstieg aus dem Archiv-Projekt gehen nicht zuletzt auch auf parteitaktisches Kalkül zurück. Bisher galt das Landesarchiv als überteuerte Hinterlassenschaft der schwarz-gelben Vorgängerregierung. „Wenn wir das Ding aber jetzt trotz der immensen Mehrkosten fertig stellen, ist es ein rot-grünes Projekt. Das will bei uns niemand“, bekennt ein Parlamentarier aus der Koalitionsriege. .... Kalkulatoren machten Anfängerfehler: So hatten die Kalkulatoren vergessen, mehr als eine halbe Million Euro Umsatzsteuer für Rechnungen der zuständigen Architekten einzurechnen. Schlimmer noch: 825 000 Euro beträgt der Mehr-Posten „Eigenleistungen des BLB NRW für Planung und Projektsteuerung“. Auch die Gebühren für Bauanträge, Sondernutzungen und Abnahmen wurden schlichtweg nicht einkalkuliert – ein Anfängerfehler.
Am Ende des ersten Kapitels wartet ein ganz starkes Stück: Das Duisburger Rathaus verlangt für den Verkauf eines kleineren Areals, auf dem der Gesamt-Komplex gebaut wird, einen Nachschlag von 454 000 Euro. Anders gesagt: Die Stadt, die vor allem von dem neuen Landesarchiv profitiert, schröpft das Land nochmals um einen erheblichen Betrag. Damit nicht genug, reiht sich ein Bock an den nächsten: Knapp 700 000 für den Projektsteuerer hatte man genauso vergessen so wie 2,3 Millionen für „Altlasten, Schadstoff- und Baugrundrisiko“. Und das, obwohl der BLB auf einem alten Speditionsgelände und einigen umliegenden Brachen im Duisburger Binnenhafen baut, auf dem sicher kein biologischer Ackerbau betrieben wurde.
Allein der Umbau zweier denkmalgeschützter Hafenkrananlagen nimmt zusätzlich 100 000 Euro in Anspruch. Auch der Kampfmittelräumdienst auf der Suche nach Flieger-Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg schlägt mit mehr als 400 000 Euro zu Buche.
Zu guter Letzt langt auch der Konzern Hochtief ordentlich zu. Der Generalunternehmer hat dem BLB bereits mehr als zwei Millionen Euro wegen Baustillstands in Rechnung gestellt. Allein durch eine Flutung der Baustelle sind 42 Tage ins Land gegangen. Jeder Tag kostet 48 000 Euro.
Skurril und teuer zugleich wird der Rechtsstreit, den der BLB mit den ausgewählten Architekten Ortner und Ortner führen muss. Letztere wehren sich gegen die Landespläne, den Archiv-Speicher mit einer Wärme-dämmverbundfassade auszustatten. Kostenpunkt: 2,236 Millionen Euro. Weitere Risikorückstellungen durch mögliche Architektenklagen beziffert der BLB auf 2,6 Millionen Euro.
Auch die Berechnungen der Bauzeitzinsen waren wohl falsch. 4,5 Millionen Euro kommen oben drauf. Zudem rechnen die BLB-Kalkulatoren mit einer Bauzeitverlängerung von 13 Monaten: Macht knapp sechs Millionen Euro an Zusatzausgaben.
...."
Kommentar:
Dass das Projekt von der Standortwahl angefangen unter keinem guten Stern - dies ist noch gelinde formuliert - stand, dürfte allen klar sein. Die Alternative zwischen Weiter so und Abbruch des Projektes darf gerne durchdacht werden, aber man möge das eigentliche Ziel nicht aus den Augen verlieren: 3 Abteilungen des Landesarchivs benötigen dringend neuen Raum! Parteitaktische Gründe sollten hinten angestellt werden. Denn der Stopp des Projektes ist nicht nur schwarz-gelb anzulasten. Lediglich die Grünen vermittelten mit Kleinen Anfragen frühzeitig ein Interesse am Projekt. Von einer Kontrolle durch die Opposition kann nicht die Rede sein. Archivbelange sind eben nicht in Wählerstimmen umzurechnen - quasi ein Quotenkiller.
Zur Archivalia-Berichterstattung seit 2007 s. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg
Wolf Thomas - am Freitag, 4. November 2011, 11:49 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das 16. Archivwissenschaftliches Kolloquium am am 29. und 30. November 2011 in der Archivschule Marburg steht unter dem Rahmentitel "Digitale Registraturen - digitale Archivierung Pragmatische Lösungen für kleinere und mittlere Archive?" und greift insofern aktuelle Fragestellungen auf, die gerade auf kommunaler Ebene zum einen komplex (Stichwort: Aufgabenvielfalt, zahlreiche Fachverfahren) zum anderen häufig auf begrenzte Ressourcen (was natürlich auch für Länder und Bund zutrifft) stoßen.
Das Programm ist vielfältig und sehr gut besetzt. Nähere Informationen finden sich hier: Archivwiss. Kolloqium 2011
Das Programm ist vielfältig und sehr gut besetzt. Nähere Informationen finden sich hier: Archivwiss. Kolloqium 2011
schwalm.potsdam - am Freitag, 4. November 2011, 09:54 - Rubrik: Records Management
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Da das Thema auch hier immer einmal wieder auftauchte und der nPA zukünftig eine große Rolle in Fragen der Authentifizierung bspw. an Verwaltungs-/Dienstleistungsportalen spielen wird, nachstehend das Link zum IT-Beauftragten der Bundesregierung. Von der Site bestehen Verlinkungen zu weiteren relevanten Seiten:
Neuer Personalausweis
Neuer Personalausweis
schwalm.potsdam - am Freitag, 4. November 2011, 09:20 - Rubrik: E-Government
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Technische Fragen zum Thema De-Mail finden sich, wie üblich beim BSI: IT-Sicherheit und De-Mail
schwalm.potsdam - am Freitag, 4. November 2011, 09:16 - Rubrik: Records Management
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine aktualisierte Broschüre zum Thema De-Mail ist hier De-Mail-Broschüre verfügbar.
schwalm.potsdam - am Freitag, 4. November 2011, 09:14 - Rubrik: Records Management
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
und hier: MoReq 2010 verfügbar.
schwalm.potsdam - am Freitag, 4. November 2011, 09:12 - Rubrik: Records Management
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
“Die Sicherung des audiovisuellen Erbes ist ein komplexer Prozess, der eine Reihe von rechtlichen, institutionellen, technischen und finanziellen Lösungen erfordert. Nichthandeln bedeutet den Verlust eines ganzen Kapitels dieses Erbes in weniger als zehn Jahren und führt zu einer bleibenden Verarmung von Gedächtnis, Kultur und Identität der Menschheit«
Koïchiro Matsuura, Generaldirektor der UNESCO, Tag des audiovisuellen Erbes, 27.10.2007 (1)
Um auf die von Matsuura geschilderte Gefahr eines Kulturgutverlustes zu reagieren, ist es notwendig zunächst die rechtliche und quantitative Ausgangslage in Westfalen zu eruieren. Alle westfälischen Kreise und kreisfreien Städte verfügen über ein Lokalradio - mit einer Ausnahme: der Kreis Olpe. Hinzu kommen die Campusradio-Stationen der Universitäten Bielefeld, Bochum, Dortmund, Münster und Siegen. Verlässliche Aussagen über die Anzahl von “Bürgerfunk/Radiowerkstätten” in Westfalen ließen sich nicht ermitteln. An dieser Stelle wird lediglich auf die beiden lokalen Fernsehsender in Westfalen verwiesen: CityVision RegionRuhr und wm.tv (West-münsterland TV mit Sitz in Bocholt). Die lokalen Radio- und Fernsehsender ín Westfalen-Lippe gewinnen ihre Bedeutung und ihren wirtschaftlichen Erfolg durch die Verbreitung in der Region. Eine Medienanalyse ergab im März 2011 (2) beispielsweise für den Sender Radio Siegen eine Reichweite von 39,5%; vierzig Prozent der Bevölkerung im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein hören täglich den lokalen Sender. Ein Vergleich: bei der Kreistagswahl am 30.08.2009 erreichte die CDU in Siegen-Wittgenstein als stärkste Partei 37,74%.
Lediglich das Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen vom 5. Juni 2007 (3) gibt Aufschluss über Aufbewahrungsfristen der lokalen Medienanstalten:
“ ….§ 43 Einsichtnahmerecht und Aufzeichnungspflicht
(1) Die Sendungen sind vom Veranstalter in Ton und Bild vollständig aufzuzeichnen und auf-zubewahren. Bei Sendungen, die unter Verwendung einer Aufzeichnung oder eines Films verbreitet werden, kann abweichend von Satz 1 die Aufzeichnung oder der Film aufbe-wahrt oder die Wiederbeschaffung sichergestellt werden.
(2) Die Pflichten nach Absatz 1 enden drei Monate nach dem Tag der Verbreitung. Wird in-nerhalb dieser Frist eine Sendung beanstandet, enden die Pflichten nach Absatz 1 erst, wenn die Beanstandung durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, durch gerichtli-chen Vergleich oder auf andere Weise erledigt ist. …..”
Weitergehende Regelungen zu Aufbewahrungs- bzw. Archivierungspflichten der Medienanstalten finden sich nicht. Die Konsequenz ist, dass die Pflege eines längerfristigen Archivs zurzeit allein den Senderanstalten überlassen ist. Im Gespräch mit dem Chefredakteur von Radio Siegen zeig-te sich eine weitere Gefahr: das Selbstverständnis der lokalen Sender. Lokale Radios verstehen sich eher als “Begleitmedien” und nicht so sehr als Inhaltsmedien. Dies führt dazu, dass die Sender den von ihnen ermittelten, unterhaltend verpackten Informationen einen geringen historischen Wert, auch im Sinne eines “Programmvermögens”, beimessen. Löschungen bei Ressourcenknappheit oder Systemwechseln sind somit Tür und Tor geöffnet.
Zur Klärung der Überlieferungssituation des audiovisuellen Dokumentationsgutes lokaler Medien wurden im Januar 2011 dem Arbeitskreis der nordrhein-westfälischen Kreisarchive beim Landkreistag Nordrhein Westfalen drei Fragen gestellt: Haben Sie bereits Dokumentationsgut der lokalen Sender (incl. Bürgerfunk) übernommen? Falls ja, ist es erschlossen und benutzbar? In welcher technischen Form liegt das Material bei Ihnen vor?
Das Ergebnis ist ernüchternd. In Westfalen verwahrt lediglich das Kreisarchiv Borken Mitschnitte von Sendungen mit Kreisthemen bzw. –mitarbeitern. Es liegen Tonbänder, Videobänder und digitales Dokumentationsgut vor, das mit einer EXCEL-Liste erschlossen ist. Es ist davon auszugehen, dass die Tendenz dieses Ergebnisses auch auf die Archive der kreisfreien Städte und auf die Universitätsarchive übertragen werden kann.
Angesichts der bisherigen, beiderseitigen Zurückhaltung bei der Überlieferungsbildung ist die Frage zu prüfen, ob der Quellenwert des zu erwartenden, audiovisuellen Dokumentationsgutes lokaler Medien so gering ist, dass ein kommunalarchivisches Engagement archivisch nicht begründbar ist. Wie ist es also um die Fähigkeit der Unterlagen bestellt, die Art und Weise der Tätigkeit lokaler Sender zu dokumentieren (Evidenzwert)? Zwei Beispiele aus dem digitalen Archiv des Senders Radio Siegen sollen verdeutlichen, was bei lokalen Medien erwartet werden kann.
Das Sounddesign ist quasi die akustische Visitenkarte des Senders. Das Jingle und die Anmoderation des “Radiojournals” auf Radio Siegen aus dem Jahr 1995 verdeutlichen gleich mehrere Sachverhalte: Das opulente Audio-Logo dieser Sendung wurde lt. mündlicher Auskunft des Chefredakteurs von Radio Siegen in den holländischen Endemol-Studios produziert und verweist auf amerikanische Vorbilder. Das Sendeformat „Radiojournal“ ist historisch. Es wird heute nicht mehr ausgestrahlt. Der Moderator ist zwischenzeitlich Pressesprecher des Kreises Siegen-Wittgenstein. Aus der Anmoderation hervor, dass sich das Sendestudio von Radio Siegen 1995 noch in der Siegener Bahnhofstr. (heute: am Obergraben) befand. Hier gibt ein einziges Archivale Auskunft zum Selbstverständnis des Senders, zur Programmplanung, zu Personal- und Standortfragen. Diese Punkte gehen sicher auch aus der schriftlichen Überlieferung des Senders hervor - aber in dieser Dichte?
Zur Entstehung eines Radio-Beitrages findet sich bei Radio Siegen keine schriftliche Überlieferung (mehr). Lediglich Sounddateien geben Aufschluss über die Entstehung eines Beitrages. Am Beispiel des Formats “Jahresrückblick” lässt sich dies im digitalen Archiv von Radio Siegen gut nachvollziehen. Von erhaltenen, ungeschnittenen Originalaufnahmen bis zu den gesendeten, durchaus unterschiedlichen Versionen des Jahresrückblicks ist erkennbar, wie ein Sendebeitrag entsteht.
Wie steht es nun um die Aussagekraft der medialen Überlieferung hinsichtlich “sonstiger Kontexte” (Informationswert)? Worüber gibt das audiovisuelle Archivgut besser Auskunft als herkömmliche Archivalien? Die wichtigste Information, die die lokalen Radio- und Fernsehbeiträge überliefern, ist die Emotion bei allen regionalgeschichtlich relevanten Themen. Begründet ist dies in der der unmittelbaren Entstehung der Sendebeiträge (z. B. Livereportagen, O-Töne etc.). Die Überlieferung der Bürgermeinung zu lokalen bzw. regionalen Ereignissen durch Umfragen darf hier ebenso wenig ungenannt bleiben wie die Interviews mit im weitesten Sinne regional bedeutenden Persönlichkeiten.
Wenden wir uns zuerst den Emotionen bei regionalgeschichtlich relevanten Themen zu. Im Juni 2005 gelang dem damaligen Fußballregionalligisten Sportfreunde Siegen der Aufstieg in die zweite Fußballbundesliga. Die Aufstiegskonferenz ist in der Endphase hochemotional.
Dieser Eindruck kann durch keine andere Quelle ersetzt werden. Eine Nachfrage beim Chefredakteur von Radio Siegen und beim fußballinteressierten Landrat des Kreis Siegen-Wittgenstein ergab bei der Vorbereitung zu diesem Vortrag, dass beide Personen ohne Zögern den Ort benennen konnten, an dem sie die Konferenz gehört hatten. Ein Effekt, der z. B. bei einer Präsentation zur Sportgeschichte des Kreises Siegen-Wittgenstein nicht unwillkommen sein dürfte. Grundsätzlich sind die Gefühle der Menschen einer Epoche die Quellen für eine in ihrer Bedeutung voraussichtlich zunehmende, regionale Mentalitätsgeschichte.(4) In den Beständen der kommunalen Archive in Westfalen dürften sie sich nur in Nachlässen oder Sammlungen (z. B. Oral-history-Projekte) finden lassen.
Im Gegensatz zu Leserbriefen bieten die Radioumfragen zu regionalen Themen einen ungeschönten Blick auf die Volksstimme. Der Abriss des Krupphochhauses in Siegen (2009) (5) nach langem Leerstand wurde 2007 öffentlich kontrovers diskutiert. Denkmalpfleger und Architekten votierten für den Erhalt dieser “Ikone der Nachkriegs-Moderne" (2007). Während einige Leserbriefe moderat den Abriss des Gebäudes befürworteten, findet sich in einer Radio-Siegen-Umfrage (2007) der drastische Vorschlag der Sprengung. Hier ergänzen die audiovisuellen Quellen die zu erwartende schriftliche Überlieferung.
Interviews mit regionalen Persönlichkeiten erweitern den Blick auf deren Einschätzungen zu tagesaktuellen und regionalen Themen. Einblicke in deren Privatleben sind gleichfalls zu erwarten, so gab Paul Breuer(6), Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein, anlässlich des 20. Geburtstages von Radio Siegen (2010) bereitwillig Auskunft über entspannende Momente als Pfeifenraucher auf dem regionalen Kulturfestvial KulturPur(7).
Archivterminologisch dürfte der Unterhaltungswert als Unterkategorie des Informationswertes angesprochen werden. Aber gerade die regionalen Comedysendungen von Radio Siegen kommentieren als “Hör-Karikatur” sowohl regionalhistorische Ereignisse als auch die regionale Mentalität. Denkbar wäre sogar der Einsatz von “Pannen” bei der Darstellung der lokalen Mediengeschichte.
Abschließend ist zum Quellenwert daher zu sagen: Als multimedial verwertbare (!) Quelle lokaler Zeit-, Mentalitäts-, Biographie- oder Mediengeschichte ist die Überlieferung der lokalen audiovisuellen Medien von den kommunalen Archiven (Kreis- und Stadtarchive) zu sichern. Die ältere und auch weiterhin ergänzende Überlieferung der öffentlich-rechtlichen Medien erreicht aufgrund deren regionalen Organisationsstruktur bei weitem nicht die Dichte der lokalen Rundfunk- und Fernsehsender.
Die Publikation "Empfehlungen Ton - Die Erhaltung von Tondokumenten" (November 2008) (8) des schweizerischen Vereins Memoriav bietet grundlegende Erklärungen zu Tondokumenten, die für das Verständnis der Erhaltungsprobleme unerlässlich sind. Die dort gemachten Hinweise zur Sicherung und Erschließung stellen immer noch den derzeitigen Stand der Technik dar.
So wird als Dateiformat der zwischenzeitlich wohl bei allen Sendern ausschließlich vorhandenen, digitalen Audiodateien das wav-Format (oder darauf basierende Formate BWF bzw. AIFF) als zur Langzeitsicherung geeignet angegeben. Ein archivischer Erschließungsstandard für Tondateien hat sich noch nicht ausgebildet. Bislang orientiert man sich daher an Vorgaben aus dem Bibliotheksbereich.
Am Beginn der hier vorzustellenden Kooperation zwischen dem Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein und Radio Siegen stand ein Gespräch zwischen dem Leiter des Kreisarchives und dem Chefredakteur des lokalen Senders, das durch die Vermittlung des Kreispressesprechers (s. o.) zustande kam. Ziel war zunächst das Sounddesign des Senders zu erhalten, das bei den Vorbereitungen zum 20-jährigen Bestehen im Jahr 2010 „gesichtet“ und vom Sender digital gesichert worden war. Ziel des Kreisarchivs war jedoch von Beginn an die Sicherung der archivrelevanten Audios seit 2000. Denn in diesem Jahr führte Radio Siegen eine digitale Programmverwaltung ein und analoge Medien waren nicht mehr vorhanden. Diese Erweiterung der Kooperation fiel auf äußerst fruchtbaren Boden. Den Mitarbeitern des Kreisarchivs wurde an mehreren Tagen ein Arbeitsplatz im Sender zur Verfügung gestellt, der es erlaubte, weitestgehend ungestört alle Dateien durchzu-sehen und gegebenenfalls anzuhören.
Empirisch entwickelte sich so ein „Dokumentationsprofil“, das dem oben ausgeführtem Quellenwert Rechnung trägt:
a) Alle erhaltenen Produktionsschritte zur Erstellung der Jahresrückblicke seit 2000 werden vollständig übernommen.
b) Regional bzw. lokal wichtige Ereignisse und Projekte (z. B. NRW-Tag in Siegen [2010] (9), Wiederansiedlung der Wisente in Bad Berleburg [seit 2005] (10)) werden berücksichtigt.
c) Kurioses wird, sofern vertretbar, berücksichtigt z. B. eine in den neunziger Jahren entstandene Bürogymnastikserie mit Silvia Neid(11).
Die ausgewählten Dateien stehen dem Kreisarchiv zur uneingeschränkten, nicht kommerziellen Nutzung mit Namensnennung zur Verfügung. Für die weitere Zusammenarbeit ist eine jährliche, gemeinsame „Aussonderung“ der archivwürdigen Audiodateien vereinbart worden. Um die Audio-Überlieferung des lokalen Senders abzurunden, gilt es die schriftliche Überlieferung der den Sen-der tragenden Veranstaltergemeinschaft und der Betriebsgemeinschaft zu sichten und zu bewerten.
Fußnoten:
(1) http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=154103
(2) http://www.radio-siegen.de/werben/reichweiten/index.html
(3) http://www.lfm-nrw.de/fileadmin/lfm-nrw/Medienrecht/lmg2007.pdf
(4) Für das Siegerland s: Armin Flender/ Dieter Pfau/ Sebastian Schmidt: Regionale Identität zwischen Kon-struktion und Wirklichkeit. Ein historisch-empirische Untersuchung am Beispiel des Siegerlandes, Baden-Baden 2001.
(5) http://de.wikipedia.org/wiki/Krupp-Hochhaus_Geisweid
(6) http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Breuer
(7) http://www.siwikultur.de/kulturpur/
(8) http://de.memoriav.ch/dokument/Empfehlungen/empfehlungen_ton_de.pdf
(9) http://www.nrw-tag-2010.de/
(10) http://www.wisente-rothaargebirge.de/
(11) http://de.wikipedia.org/wiki/Silvia_Neid
Quelle: Archivpflege in Westfalen und Lippe, Heft 75 (2011), S. 37 - 39
Koïchiro Matsuura, Generaldirektor der UNESCO, Tag des audiovisuellen Erbes, 27.10.2007 (1)
Um auf die von Matsuura geschilderte Gefahr eines Kulturgutverlustes zu reagieren, ist es notwendig zunächst die rechtliche und quantitative Ausgangslage in Westfalen zu eruieren. Alle westfälischen Kreise und kreisfreien Städte verfügen über ein Lokalradio - mit einer Ausnahme: der Kreis Olpe. Hinzu kommen die Campusradio-Stationen der Universitäten Bielefeld, Bochum, Dortmund, Münster und Siegen. Verlässliche Aussagen über die Anzahl von “Bürgerfunk/Radiowerkstätten” in Westfalen ließen sich nicht ermitteln. An dieser Stelle wird lediglich auf die beiden lokalen Fernsehsender in Westfalen verwiesen: CityVision RegionRuhr und wm.tv (West-münsterland TV mit Sitz in Bocholt). Die lokalen Radio- und Fernsehsender ín Westfalen-Lippe gewinnen ihre Bedeutung und ihren wirtschaftlichen Erfolg durch die Verbreitung in der Region. Eine Medienanalyse ergab im März 2011 (2) beispielsweise für den Sender Radio Siegen eine Reichweite von 39,5%; vierzig Prozent der Bevölkerung im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein hören täglich den lokalen Sender. Ein Vergleich: bei der Kreistagswahl am 30.08.2009 erreichte die CDU in Siegen-Wittgenstein als stärkste Partei 37,74%.
Lediglich das Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen vom 5. Juni 2007 (3) gibt Aufschluss über Aufbewahrungsfristen der lokalen Medienanstalten:
“ ….§ 43 Einsichtnahmerecht und Aufzeichnungspflicht
(1) Die Sendungen sind vom Veranstalter in Ton und Bild vollständig aufzuzeichnen und auf-zubewahren. Bei Sendungen, die unter Verwendung einer Aufzeichnung oder eines Films verbreitet werden, kann abweichend von Satz 1 die Aufzeichnung oder der Film aufbe-wahrt oder die Wiederbeschaffung sichergestellt werden.
(2) Die Pflichten nach Absatz 1 enden drei Monate nach dem Tag der Verbreitung. Wird in-nerhalb dieser Frist eine Sendung beanstandet, enden die Pflichten nach Absatz 1 erst, wenn die Beanstandung durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, durch gerichtli-chen Vergleich oder auf andere Weise erledigt ist. …..”
Weitergehende Regelungen zu Aufbewahrungs- bzw. Archivierungspflichten der Medienanstalten finden sich nicht. Die Konsequenz ist, dass die Pflege eines längerfristigen Archivs zurzeit allein den Senderanstalten überlassen ist. Im Gespräch mit dem Chefredakteur von Radio Siegen zeig-te sich eine weitere Gefahr: das Selbstverständnis der lokalen Sender. Lokale Radios verstehen sich eher als “Begleitmedien” und nicht so sehr als Inhaltsmedien. Dies führt dazu, dass die Sender den von ihnen ermittelten, unterhaltend verpackten Informationen einen geringen historischen Wert, auch im Sinne eines “Programmvermögens”, beimessen. Löschungen bei Ressourcenknappheit oder Systemwechseln sind somit Tür und Tor geöffnet.
Zur Klärung der Überlieferungssituation des audiovisuellen Dokumentationsgutes lokaler Medien wurden im Januar 2011 dem Arbeitskreis der nordrhein-westfälischen Kreisarchive beim Landkreistag Nordrhein Westfalen drei Fragen gestellt: Haben Sie bereits Dokumentationsgut der lokalen Sender (incl. Bürgerfunk) übernommen? Falls ja, ist es erschlossen und benutzbar? In welcher technischen Form liegt das Material bei Ihnen vor?
Das Ergebnis ist ernüchternd. In Westfalen verwahrt lediglich das Kreisarchiv Borken Mitschnitte von Sendungen mit Kreisthemen bzw. –mitarbeitern. Es liegen Tonbänder, Videobänder und digitales Dokumentationsgut vor, das mit einer EXCEL-Liste erschlossen ist. Es ist davon auszugehen, dass die Tendenz dieses Ergebnisses auch auf die Archive der kreisfreien Städte und auf die Universitätsarchive übertragen werden kann.
Angesichts der bisherigen, beiderseitigen Zurückhaltung bei der Überlieferungsbildung ist die Frage zu prüfen, ob der Quellenwert des zu erwartenden, audiovisuellen Dokumentationsgutes lokaler Medien so gering ist, dass ein kommunalarchivisches Engagement archivisch nicht begründbar ist. Wie ist es also um die Fähigkeit der Unterlagen bestellt, die Art und Weise der Tätigkeit lokaler Sender zu dokumentieren (Evidenzwert)? Zwei Beispiele aus dem digitalen Archiv des Senders Radio Siegen sollen verdeutlichen, was bei lokalen Medien erwartet werden kann.
Das Sounddesign ist quasi die akustische Visitenkarte des Senders. Das Jingle und die Anmoderation des “Radiojournals” auf Radio Siegen aus dem Jahr 1995 verdeutlichen gleich mehrere Sachverhalte: Das opulente Audio-Logo dieser Sendung wurde lt. mündlicher Auskunft des Chefredakteurs von Radio Siegen in den holländischen Endemol-Studios produziert und verweist auf amerikanische Vorbilder. Das Sendeformat „Radiojournal“ ist historisch. Es wird heute nicht mehr ausgestrahlt. Der Moderator ist zwischenzeitlich Pressesprecher des Kreises Siegen-Wittgenstein. Aus der Anmoderation hervor, dass sich das Sendestudio von Radio Siegen 1995 noch in der Siegener Bahnhofstr. (heute: am Obergraben) befand. Hier gibt ein einziges Archivale Auskunft zum Selbstverständnis des Senders, zur Programmplanung, zu Personal- und Standortfragen. Diese Punkte gehen sicher auch aus der schriftlichen Überlieferung des Senders hervor - aber in dieser Dichte?
Zur Entstehung eines Radio-Beitrages findet sich bei Radio Siegen keine schriftliche Überlieferung (mehr). Lediglich Sounddateien geben Aufschluss über die Entstehung eines Beitrages. Am Beispiel des Formats “Jahresrückblick” lässt sich dies im digitalen Archiv von Radio Siegen gut nachvollziehen. Von erhaltenen, ungeschnittenen Originalaufnahmen bis zu den gesendeten, durchaus unterschiedlichen Versionen des Jahresrückblicks ist erkennbar, wie ein Sendebeitrag entsteht.
Wie steht es nun um die Aussagekraft der medialen Überlieferung hinsichtlich “sonstiger Kontexte” (Informationswert)? Worüber gibt das audiovisuelle Archivgut besser Auskunft als herkömmliche Archivalien? Die wichtigste Information, die die lokalen Radio- und Fernsehbeiträge überliefern, ist die Emotion bei allen regionalgeschichtlich relevanten Themen. Begründet ist dies in der der unmittelbaren Entstehung der Sendebeiträge (z. B. Livereportagen, O-Töne etc.). Die Überlieferung der Bürgermeinung zu lokalen bzw. regionalen Ereignissen durch Umfragen darf hier ebenso wenig ungenannt bleiben wie die Interviews mit im weitesten Sinne regional bedeutenden Persönlichkeiten.
Wenden wir uns zuerst den Emotionen bei regionalgeschichtlich relevanten Themen zu. Im Juni 2005 gelang dem damaligen Fußballregionalligisten Sportfreunde Siegen der Aufstieg in die zweite Fußballbundesliga. Die Aufstiegskonferenz ist in der Endphase hochemotional.
Dieser Eindruck kann durch keine andere Quelle ersetzt werden. Eine Nachfrage beim Chefredakteur von Radio Siegen und beim fußballinteressierten Landrat des Kreis Siegen-Wittgenstein ergab bei der Vorbereitung zu diesem Vortrag, dass beide Personen ohne Zögern den Ort benennen konnten, an dem sie die Konferenz gehört hatten. Ein Effekt, der z. B. bei einer Präsentation zur Sportgeschichte des Kreises Siegen-Wittgenstein nicht unwillkommen sein dürfte. Grundsätzlich sind die Gefühle der Menschen einer Epoche die Quellen für eine in ihrer Bedeutung voraussichtlich zunehmende, regionale Mentalitätsgeschichte.(4) In den Beständen der kommunalen Archive in Westfalen dürften sie sich nur in Nachlässen oder Sammlungen (z. B. Oral-history-Projekte) finden lassen.
Im Gegensatz zu Leserbriefen bieten die Radioumfragen zu regionalen Themen einen ungeschönten Blick auf die Volksstimme. Der Abriss des Krupphochhauses in Siegen (2009) (5) nach langem Leerstand wurde 2007 öffentlich kontrovers diskutiert. Denkmalpfleger und Architekten votierten für den Erhalt dieser “Ikone der Nachkriegs-Moderne" (2007). Während einige Leserbriefe moderat den Abriss des Gebäudes befürworteten, findet sich in einer Radio-Siegen-Umfrage (2007) der drastische Vorschlag der Sprengung. Hier ergänzen die audiovisuellen Quellen die zu erwartende schriftliche Überlieferung.
Interviews mit regionalen Persönlichkeiten erweitern den Blick auf deren Einschätzungen zu tagesaktuellen und regionalen Themen. Einblicke in deren Privatleben sind gleichfalls zu erwarten, so gab Paul Breuer(6), Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein, anlässlich des 20. Geburtstages von Radio Siegen (2010) bereitwillig Auskunft über entspannende Momente als Pfeifenraucher auf dem regionalen Kulturfestvial KulturPur(7).
Archivterminologisch dürfte der Unterhaltungswert als Unterkategorie des Informationswertes angesprochen werden. Aber gerade die regionalen Comedysendungen von Radio Siegen kommentieren als “Hör-Karikatur” sowohl regionalhistorische Ereignisse als auch die regionale Mentalität. Denkbar wäre sogar der Einsatz von “Pannen” bei der Darstellung der lokalen Mediengeschichte.
Abschließend ist zum Quellenwert daher zu sagen: Als multimedial verwertbare (!) Quelle lokaler Zeit-, Mentalitäts-, Biographie- oder Mediengeschichte ist die Überlieferung der lokalen audiovisuellen Medien von den kommunalen Archiven (Kreis- und Stadtarchive) zu sichern. Die ältere und auch weiterhin ergänzende Überlieferung der öffentlich-rechtlichen Medien erreicht aufgrund deren regionalen Organisationsstruktur bei weitem nicht die Dichte der lokalen Rundfunk- und Fernsehsender.
Die Publikation "Empfehlungen Ton - Die Erhaltung von Tondokumenten" (November 2008) (8) des schweizerischen Vereins Memoriav bietet grundlegende Erklärungen zu Tondokumenten, die für das Verständnis der Erhaltungsprobleme unerlässlich sind. Die dort gemachten Hinweise zur Sicherung und Erschließung stellen immer noch den derzeitigen Stand der Technik dar.
So wird als Dateiformat der zwischenzeitlich wohl bei allen Sendern ausschließlich vorhandenen, digitalen Audiodateien das wav-Format (oder darauf basierende Formate BWF bzw. AIFF) als zur Langzeitsicherung geeignet angegeben. Ein archivischer Erschließungsstandard für Tondateien hat sich noch nicht ausgebildet. Bislang orientiert man sich daher an Vorgaben aus dem Bibliotheksbereich.
Am Beginn der hier vorzustellenden Kooperation zwischen dem Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein und Radio Siegen stand ein Gespräch zwischen dem Leiter des Kreisarchives und dem Chefredakteur des lokalen Senders, das durch die Vermittlung des Kreispressesprechers (s. o.) zustande kam. Ziel war zunächst das Sounddesign des Senders zu erhalten, das bei den Vorbereitungen zum 20-jährigen Bestehen im Jahr 2010 „gesichtet“ und vom Sender digital gesichert worden war. Ziel des Kreisarchivs war jedoch von Beginn an die Sicherung der archivrelevanten Audios seit 2000. Denn in diesem Jahr führte Radio Siegen eine digitale Programmverwaltung ein und analoge Medien waren nicht mehr vorhanden. Diese Erweiterung der Kooperation fiel auf äußerst fruchtbaren Boden. Den Mitarbeitern des Kreisarchivs wurde an mehreren Tagen ein Arbeitsplatz im Sender zur Verfügung gestellt, der es erlaubte, weitestgehend ungestört alle Dateien durchzu-sehen und gegebenenfalls anzuhören.
Empirisch entwickelte sich so ein „Dokumentationsprofil“, das dem oben ausgeführtem Quellenwert Rechnung trägt:
a) Alle erhaltenen Produktionsschritte zur Erstellung der Jahresrückblicke seit 2000 werden vollständig übernommen.
b) Regional bzw. lokal wichtige Ereignisse und Projekte (z. B. NRW-Tag in Siegen [2010] (9), Wiederansiedlung der Wisente in Bad Berleburg [seit 2005] (10)) werden berücksichtigt.
c) Kurioses wird, sofern vertretbar, berücksichtigt z. B. eine in den neunziger Jahren entstandene Bürogymnastikserie mit Silvia Neid(11).
Die ausgewählten Dateien stehen dem Kreisarchiv zur uneingeschränkten, nicht kommerziellen Nutzung mit Namensnennung zur Verfügung. Für die weitere Zusammenarbeit ist eine jährliche, gemeinsame „Aussonderung“ der archivwürdigen Audiodateien vereinbart worden. Um die Audio-Überlieferung des lokalen Senders abzurunden, gilt es die schriftliche Überlieferung der den Sen-der tragenden Veranstaltergemeinschaft und der Betriebsgemeinschaft zu sichten und zu bewerten.
Fußnoten:
(1) http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=154103
(2) http://www.radio-siegen.de/werben/reichweiten/index.html
(3) http://www.lfm-nrw.de/fileadmin/lfm-nrw/Medienrecht/lmg2007.pdf
(4) Für das Siegerland s: Armin Flender/ Dieter Pfau/ Sebastian Schmidt: Regionale Identität zwischen Kon-struktion und Wirklichkeit. Ein historisch-empirische Untersuchung am Beispiel des Siegerlandes, Baden-Baden 2001.
(5) http://de.wikipedia.org/wiki/Krupp-Hochhaus_Geisweid
(6) http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Breuer
(7) http://www.siwikultur.de/kulturpur/
(8) http://de.memoriav.ch/dokument/Empfehlungen/empfehlungen_ton_de.pdf
(9) http://www.nrw-tag-2010.de/
(10) http://www.wisente-rothaargebirge.de/
(11) http://de.wikipedia.org/wiki/Silvia_Neid
Quelle: Archivpflege in Westfalen und Lippe, Heft 75 (2011), S. 37 - 39
Wolf Thomas - am Freitag, 4. November 2011, 08:39 - Rubrik: Kommunalarchive
Die Petition gegen die Zerschlagung der Mainzer Wissenschaftlichen Stadtbibliothek zählt bereits über 800 Zeichner. Es gibt nun auch eine Seite mit Bildern zur Stadtbibliothek Mainz auf Wikimedia Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stadtbibliothek_Mainz
und eine Seite in Wikisource, die Digitalisate zur Bibliothek und zur Geschichte ihrer Bestände nachweist:
http://de.wikisource.org/wiki/Stadtbibliothek_Mainz
Erinnert sei auch an meine beiden Buchbesprechungen:
Woher unsere Bücher kommen. Provenienzen der Mainzer Stadtbibliothek im Spiegel von Exlibris. Konzeption und Text: Annelen Ottermann, Fotos: Martin Steinmetz (= Veröffentlichungen der Bibliotheken der Stadt Mainz 59). Mainz: Landeshauptstadt Mainz, 2011.
http://archiv.twoday.net/stories/29759083/
"Rara wachsen nach". Einblicke in die Rarasammlung der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Mainz. Konzeption und Text: Annelen Ottermann. Fotos Martin Steinmetz. Mainz: Bibliotheken der Stadt Mainz 2008 (= Veröffentlichungen der Bibliotheken der Stadt Mainz 55)
http://archiv.twoday.net/stories/5439463/
 Aus Hs II 50
Aus Hs II 50
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stadtbibliothek_Mainz
und eine Seite in Wikisource, die Digitalisate zur Bibliothek und zur Geschichte ihrer Bestände nachweist:
http://de.wikisource.org/wiki/Stadtbibliothek_Mainz
Erinnert sei auch an meine beiden Buchbesprechungen:
Woher unsere Bücher kommen. Provenienzen der Mainzer Stadtbibliothek im Spiegel von Exlibris. Konzeption und Text: Annelen Ottermann, Fotos: Martin Steinmetz (= Veröffentlichungen der Bibliotheken der Stadt Mainz 59). Mainz: Landeshauptstadt Mainz, 2011.
http://archiv.twoday.net/stories/29759083/
"Rara wachsen nach". Einblicke in die Rarasammlung der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Mainz. Konzeption und Text: Annelen Ottermann. Fotos Martin Steinmetz. Mainz: Bibliotheken der Stadt Mainz 2008 (= Veröffentlichungen der Bibliotheken der Stadt Mainz 55)
http://archiv.twoday.net/stories/5439463/
 Aus Hs II 50
Aus Hs II 50KlausGraf - am Freitag, 4. November 2011, 01:52 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen