Dank Edlef Stabenaus Ignoranz ist die Seite
http://wiki.netbib.de/coma/EnrichedContent
derzeit nur passwortgeschützt zugänglich. Die Versionsverwaltung dokumentiert nur Änderungen ab 2006, aber die Seite ist erheblich älter und enthält aus meiner Sicht schätzenswerte Informationen zur Frühgeschichte der Kataloganreicherung in Deutschland. Sie war auch in der Wikipedia verlinkt. Ich dokumentiere ihren letzten Inhalt (Links nicht überprüft). Siehe auch
http://wayback.archive.org/web/*/http://wiki.netbib.de/coma/EnrichedContent
:4: Enriched Content - Catalog Enrichment - Anreicherung von Bibliothekskatalogen :4:
//Catalogues, enrichissez-vous !// *
++Hier sollen Informationen zusammengetragen werden zum Thema Anreicherung von Bibliothekskatalogen (OPACs) mit Inhaltsverzeichnissen (TOCs), Links zu Besprechungen usw. sowie zu den Suchmöglichkeiten nach diesen zusätzlichen Inhalten.++
Jede(r) darf mitmachen und konstruktive Beiträge (auch zum Layout) zu dieser Seite leisten.
++English contributions are welcome!++ Thanks to the Catalogablog
http://catalogablog.blogspot.com/2004/06/catalog-enrichment_18.html
Quote: "If you are involved in such an effort post a link to your project. It is also useful to see what others are doing outside the US."
Hinweise auf Netbib:
http://log.netbib.de/index.php?s=enriched
http://log.netbib.de/archives/2004/03/02/toc-search/
* Nachweis des Mottos
http://membres.lycos.fr/vacher/profess/conf/brux99/texte.htm
{{toc}}
=== AKTUELLE INITIATIVEN (neueste oben) ===
** Kataloganreicherung in den Verbünden, Bericht auf dem Bibliothekartag Erfurt 2009 **
http://www.opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2009/719/
** Praxis bei OpenBib **
http://blog.openbib.org/2008/06/18/zentrale-kataloganreicherung/
** dandelon.com - International collaborative network for catalog enrichment -
http://www.dandelon.com - teilnehmende Bibliotheken: UBiT Trondheim (Norwegen), UB Kiel, ZBW Kiel und Hamburg, SUB Hamburg, UB Greifswald, TU Berlin, FHTW Berlin, UB Braunschweig, TIB Hannover, SUB Göttingen, UB Frankfurt, ULB Darmstadt, UB Mainz, FH Gelsenkirchen, VLB Bregenz, FH Dornbirn, LB Liechtenstein, UB St. Gallen - Betreiber AGI - Information Management Consultants. Bestand Mai 2009 über 600.000 TOCs. Alle Titel werden mit "intelligentCAPTURE mobile" von AGI - Information Management Consultants (http://www.agi-imc.de) produziert. Weitere 120.000 mit der gleichen Technik bei der Deutsche Nationalbibliothek, Leipzig und bei Casalini Libri (Italien) erstellt - über 1000 neue TOCs pro Tag ingesamt. Marktanteil in Europa ca. 60 %.
** Deutsche Nationalbibliothek **
http://www.d-nb.de - 2 Projekte: Leipzig: alle Werke ab Erwerbung 1913 (Titel ab ca. 1800 - Stand Ende Mai 2009 55.000, pro Monat ca. 9000 Zuwachs) und Frankfurt: Neue Titel in Reihe A (pro Jahr ca. 70.000).
**GBV**
http://www.gbv.de - Sammelt TOCs aus dandelon.com-Netzwerk, HBZ, Casalini Libri, LoC, DNB - die bislang größte, teilweise suchbare Kollektion.
** Praxis der ÖNB Wien **
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg33785.html
** Österreich: Übersicht**
http://verbundtag.obvsg.at/documents/2006/vbt06_edoc_vbjb.pdf
Hinweise auf andere Anwender im deutschsprachigen Raum
**Schweiz: ETH-Bibliothek **
http://www.ethbib.ethz.ch/abstract/abstract.html
Für etwa 70'000 Bücher sind im NEBIS-Katalog über die Link-Verknüpfung "Abstract / Index" zusätzliche Informationen (Zusammenfassungen, Inhaltsverzeichnisse oder Angaben über Autoren) eingebaut."
** Diplomarbeit, speziell zur Schweiz **
http://www.iudchur.net/fileadmin/uploads/pdf/csi/CSI_15_Loehrer.pdf
**Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-Westfalen (hbz)**
Das hbz beschäftigt sich seit August 2005 intensiv mit dem Thema Catalogue Enrichment. Im 180T-Projekt wurden in einem ersten Schritt insgesamt 180.000 Inhaltsverzeichnisse aus den Fachbereichen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften retrospektiv gescannt. Seit Januar 2006 wird die Digitalisierungsinitiative in einer zweiten Phase mit fünf Bibliotheken aus NRW fortgesetzt. Neben der retrospektiven Digitalisierung werden zudem Neuerwerbungen aus den einzelnen Bibliotheken gescannt.
Das Ziel ist, bis zum Spätsommer 2006 den Workflow des Scannings von Neuerwerbungen zu evaluieren sowie die Inhaltsverzeichnisse aller Neuzugänge des Verbundbereichs im hbz-Medienserver, im Dreiländerkatalog und in der hbz-Verbunddatenbank anzureichern und nachzuweisen. In einer weiteren Projektphase ist geplant, neben Inhaltsverzeichnissen auch weitere Zusatzinformationen wie Buchcover, Rezensionen und Klappentexte zu integrieren.
In Ergänzung zu seinen eigenen Scannaktivitäten evaluiert das hbz momentan das Angebot an Fremddaten und steht bereits in Verhandlungen mit Verlagen und Datenanbietern. Einen ersten Meilenstein stellt hierbei die Kooperation mit dem Springer Verlag dar.
//Links://
[[http://www.hbz-nrw.de/angebote/catalogue_enrichment/ Weitere Informationen zum Catalogue Enrichment im hbz]]
[[http://suchen.hbz-nrw.de/dreilaender/ Dreiländerkatalog]]
Anwenderbericht Catalogue Enrichment: Großgarten, Astrid. "[[http://www.hbz-nrw.de/dokumentencenter/produkte/catalogue_enrichment/Scanprojekt_Sonderdruck_IWP.pdf Das 180T-Projekt in Köln oder wie verarbeite ich 180.000 Bücher in vier Monaten]]". Information. Wissenschaft und Praxis. 56. 2005. S. 454-556
**Catalogue Enrichment mit ADAM im BVB**
Detaillierte Informationen zum Thema Catalogue Enrichment im Bibliotheksverbund Bayern auf der Wikiseite CatalogueEnrichmentBVB.
Beispiel im OPAC der UB Passau: Segler-Meßner: Archive der Erinnerung. Die im PDF des Inhaltsverzeichnisses vorhandene Zeichenfolge "Figur des Zeugen" wird mit Figur oder Zeugen nicht gefunden, eine Volltextsuche in den angereicherten Daten offenbar nicht möglich. Der Link auf TOC und Klappentext findet sich auch im BVB-OPAC. Hier gibt es eine Suchmöglichkeit Zusatzinformationen/Volltext, aber mit Figur werden zwar Inhaltsverzeichnisse gefunden, in denen Figur vorkommt, nicht aber der gesuchte Titel.
http://www.ib.hu-berlin.de/~libreas/libreas_neu/ausgabe4/003ebe.htm
Moralische Reflexion auf das Catalogue Enrichment (wertende Rezensionen)
http://www.anarchitect.org/log/2005/09/13/stadtbibliothek-hangt-ihren-katalog-ins-netz-und-wirbt-fur-amazon/
Kritik an Amazon-Bildern
OpenWorldCat is adding reader reviews and TOCs (not searchable)
http://log.netbib.de/archives/2005/10/13/open-worldcat-mit-leserrezensionen/
http://orweblog.oclc.org/archives/000825.html
http://log.netbib.de/archives/2005/05/02/polemik-gegen-kataloganreicherung/
Fortbildungsveranstaltung: OPAC der Zukunft mit einschlägigen Beiträgen
http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2004-fortbildung-stuttgart.php
Roy Tenant: Enriching the catalog, in: Library Journal
http://www.libraryjournal.com/article/CA423795?display=Digital+LibrariesNews&industry=Digital+Libraries&industryid=3760&verticalid=151
Catalog Enrichment Initiative
http://www.loc.gov/standards/catenrich/
Robert Kieft: Collaborative Project to Enhance Library Catalog Browsing
http://www.clir.org/pubs/issues/issues38.html#collab
==== Hinweis zur TOC-Search ====
Auffinden von englischsprachigen einschlägigen Beiträgen im Netz und bibliographischen Datenbanken mit:
bibliographic records enhancement
enrichment
tables of content usw.
Beiträge in INETBIB 2001 zum Thema TOCs in Katalogen:
http://www.hbz-nrw.de/produkte_dienstl/mlist/inetbib/200108/20010823.html
Weiterer Beitrag von Eversberg 2003:
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg11091.html
OPAC werde zur Zufallsmaschine.
Siehe auch den Abschnitt "Einspeisen von mehr Text" in Eversbergs Aufsatz zur Sachkatalogisierung:
http://www.allegro-c.de/regeln/cosarara.htm
2003 wurde in INETBIB über eine Recherche berichtet, von wievielen Festschriften des Jahres 2002 Inhaltsverzeichnisse in US-Katalogen vorhanden sind:
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg22153.html
Für das Jahr 2004 ergab die Suche nach Festschriften 2003 mit teilweise anderen Katalogen folgendes:
In MELVYL sind 18 Titel (vorwiegend theologische) vorhanden, in MNLink zusätzlich 4. Big Ten (U Minnesota Interface) erbrachte aus dem Bestand der Northwestern U 9 zusätzliche, Columbia U lieferte einen weiteren Titel, Tripod 2. Macht 34 Titel.
Unergiebig (wenige TOCs): LoC, Cornell, Yale, Illinet.
Ein anderer Test 2003 mit anderen Suchbegriffen:
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg10273.html
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg10296.html
Ergebnis: Auch OCLC und RLG bieten über die Keyword-Search nicht den Gesamtbestand frei zugänglicher TOCs in OPACs.
Ein weiterer Test zum Thema Rittertum 2003
http://www.uni-bayreuth.de/departments/aedph/2003/0098.html
Aus den USA bezogene Titeldaten der SB zu Berlin enthalten auch Inhaltsverzeichnisse, die suchbar sind (anders als im GBV, wo zwar solche TOCs vorhanden, aber nicht suchbar sind!)
OPAC der SB Berlin http://sbbweb1.sbb.spk-berlin.de:8080
Test Ende 2006
http://de.wikiversity.org/wiki/Benutzer:Histo/TOCsuche
**Literatur (online) und Internetquellen:**
Informationen des TOC-Lieferanten Blackwell mit ausführlicher TOC-Bibliographie im 35seitigen PDF, abrufbar auf
http://www.blackwell.com/level2/TOC.asp
Zitat:
"Studies undertaken to determine the effect on search retrieval of the addition of Table of Contents (TOC) to the catalog record have produced startling results. One study determined that the addition of tables of contents increased usage of new materials by 45% (see Appendix H for a TOC bibliography). Though methodologies vary, each study reports significant benefits. Specifically, Table of Contents and descriptive summary data enriches the record with key words for improved access, and adds to library users' understanding of the title retrieved. The latter benefit reduces trips to the stacks, and unnecessary interlibrary loan requests. Until now, the prohibitive costs of enriching catalog records with such data have kept the library community from realizing these benefits. Through a unique combination of book handling and MaRC record editing capabilities, Blackwell?s provides a service whereby libraries can send MaRC records to
Blackwell?s for enrichment with Tables of Contents, descriptive summaries, and authors'
affiliations which allow key word searching of institutions."
Marty Crowe: Table-of-Contents Enhancement for the Catalog (1997)
http://www.library.cornell.edu/cts/martyrep.htm
Update 2002 von David Banush
http://www.library.cornell.edu/staffweb/TOC.html
Madjid Ihadjadène: Les tables de matières dans les catalogues en ligne. Opportunités, méthodes et coûts (1998) - PDF
http://www.abf.asso.fr/IMG/pdf/n178_3.pdf
Yale Memorandum (2000) - PDF
http://www.library.yale.edu/CDC/public/documents/TOCreport.pdf
Ruth C. Morris: Online tables of contents for books: effect on usage (2001)
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=31701
"The study found that tables of contents do increase usage."
Aus einer Einladung zum DLF Spring Forum 2004
//Between the Sheets: Enriching the Catalog. Roy Tennant, California Digital Library
For almost three decades librarians have advocated the enhancement of online library catalog records with book tables of contents, sample text, indexes, reviews, cover images, etc. We believe that deployed technologies, user expectations, and emerging standards such as METS, OAI-PMH, and ONIX make this a propitious time for libraries to aggressively pursue bibliographic record enhancement strategies. This session will briefly report on an ad hoc collaborative effort begun at ALA Midwinter 2004 to build an infrastructure to enable distributed, non-duplicative input of record-enriching content using standards and practices currently available and proved effective. We will invite BOF attendees to share their concerns, ideas, and comments. As this effort is an informal collaborative, anyone is welcome to participate in advancing the future of the library catalog.//
http://www.diglib.org/forums/Spring2004/springforum04rev1.htm
Minutes des Treffens:
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg24332.html
==== Linking von Ressourcen allgemein ====
Wenn man etwas zu ergänzenden Informationen in Bibliothekskatalogen schreibt, darf auch eine Info zur Linking-Technologie nicht fehlen.
Auch wenn vielleicht keine TOCs durchsucht werden können, ist die Existenz eines solchen Angebots doch immerhin nützlich und ein Anfang.
Ein Beispiel ist der Einsatz von OpenURL/SFX zur Vernetzung verschiedener Informationsressourcen (Aufsatzdatenbanken, WeblogSuchmaschinen, etc.). Ob lizenziert oder Open Access spielt nur für die Zugriffsmöglichkeiten eine Rolle, nicht für die Technik.
SFX nutzt z.B. die Max-Planck-Gesellschaft (in Lizenz von Exlibris, http://www.exlibrisgroup.com/sfx.htm). Dies erleichtert in der Theorie den Zugriff auf einzelne Quellen durch einen SFX-Server. Oberfläche dazu etwa Vlib-Server der MPG (http://vlib.mpg.de/), mit reinem Gastzugang fallen dann natürlich die kommerziellen Informationsprovider weg...
Andersherum: eine Suche bei einem OpenURL-Provider (z.B. BiomedCentral, http://www.biomedcentral.com/) kann über eingeblendete SFX-Links dann auch zu Bibliotheksbeständen führen (z.B. ist eine Zeitschrift vorhanden in der Institution).
Bei einem Open-Access-Publisher (wie BMC einer ist) braucht man dann natürlich die Bibliotheksbestände nicht mehr ;-)
Die UB der Université Libre de Bruxelles (http://www.bib.ulb.ac.be/) nutzt in ihrem Katalog auch den OpenURL-Framework-Standard (http://www.niso.org/standards/standard_detail.cfm?std_id=783).
Beispielsuche nach "Huccorgne" in Verbindung mit dem Verfassernamen "Lawrence" bringt folgendes Ergebnis:
http://bib7.ulb.ac.be/uhtbin/cgisirsi/GmEVpRuyUC/14140014/88
Durch den Klick auf "VLink"-Button öffnet sich der Zugang zu anderen Ressourcen (wieder teilweise zugangsbeschränkt, da lizenzierte Inhalte).
Denkbar sind hier also auch Referenzen mit Review-Datenbanken u.ä.
==== Fallbeispiele - USA ====
:rot: Library of Congress (LoC) - Team BEAT :rot:
http://www.loc.gov/catdir/beat/
Anreicherung vor allem durch
- Inhaltsverzeichnisse (TOC)
- Buchauszüge (Sample-Texts)
- Umschlagabbildungen (Covers)
- Besprechungen, insbesondere des H-NET
- Links auf frei zugängliche Digitalisierungen (Journals, Public-Domain-Books)
Suchmöglichkeiten:
Die verlinkten Inhalte, auch die auf den Seiten der LoC gespeicherten Inhaltsverzeichnisse, können leider nicht durchsucht werden.
[Die auf den Seiten der LoC gespeicherten Inhaltsverzeichnisse können sehr wohl in http://catalog.gov, "Guided Search", "Search as: Contents Notes (KCON)" durchsucht werden. Die verlinkten Inhalte, soweit ich sehe, tatsächlich nicht. Dies ist der Nachteil verlinkter Inhalte. Werner Gerstenberger, Fachref. Sinologie UB Trier]
Es kann aber nach der Existenz solcher Verlinkungen gesucht werden.
http://catalog.loc.gov/
Im Katalog ist die "Guided Search" zu wählen. Eine Einschränkung auf Zeiträume, Sprachen, Erscheinungsländer ist durch "Set Limits" möglich. Mit http* findet man Katalogisate, die Links enthalten.
Mit dem zweiten Feld kann man durch NOT http loc gov ausschliessen: Links auf Webseiten der LoC.
Man kann - Achtung: "as a phrase" einstellen - nach http://www.h-net* suchen und so Katalogisate, die auf H-NET-Reviews verweisen, auffinden.
----
:rot:Rochester Institute of Technology (RIT) - Library :rot:
http://albert.rit.edu/
Im Katalog können mittels des Buttons more! zusätzliche Informationen, die vom kommerziellen Anbieter http://www.syndetics.com bereitgestellt werden, abgerufen werden (um Beispiele aufzufinden: Browse Recent Additions). Dabei handelt es sich insbesondere um Inhaltsverzeichnisse und Besprechungen, die frei zugänglich sind. Andere Verweise führen zu lizenzierten Angeboten.
Vortrag eines Syndetics-Vertreters (2000)
http://www.loc.gov/catdir/bibcontrol/calcagno_paper.html
Präsentation 2006
http://www.inforum.cz/inforum2006/pdf/Gerlach_Kai_Henning1.pdf
Website der Firma
http://www.syndetics.com/
Suchmöglichkeiten:
Die Inhalte von Syndetics.com können nicht durchsucht werden.
Exkurs: Im E-Content-Finder des RIT-Katalogs sind auch Public-Domain-Books der Online Books Page auffindbar!
Weiterer Syndetics-Kunde ist die UB Toronto
http://www.library.utoronto.ca/
Beispiel: Kallendorf, Exorcism, 2003 (Cover, Autor bio = akademische Zugehörigkeit, TOC, aber gegenüber dem ausführlichen TOC des Buchs leider sehr reduziert, TOC-Inhalt nicht suchbar)
Weiterer Kunde ist die UB Göteborg (Schweden)
http://sunda.ub.gu.se:8000/cgi-bin/chameleon?lng=en
Allerdings ist hier offenbar die Anzeige für Außenstehende blockiert. Es half allerdings, die in Göteborg gefundene ISBN in die RIT-URL einzutragen:
http://syndetics.com/rn12.pl?isbn=0300103352/index.html&client=rit
----
:rot: SAILS Library Network :rot:
Ein Beispiel aus dem Bereich der Public Libraries der USA: der Verbund umfaßt solche und Schulbüchereien. Andere Bibliotheken und Verbünde, die ebenfalls iBistro von SIRSI verwenden, könnten gleichermaßen genannt werden.
"iBistro content enriches library catalog records so that you may view, along with the records, book reviews, tables of contents, synopses and annotations, and other specific information about the items."
http://opac.sailsinc.org/
Eine Gastsuche ist möglich! Der Enriched Content ("Look inside") ist durch kleine Symbole in der Trefferliste angezeigt.
Suchmöglichkeiten:
Die Inhalte können nicht durchsucht werden.
Exkurs: Im Katalogeintrag lohnt links die Suche nach Webresourcen einen Klick, sie führt zu redaktionell erfaßten Internetquellen.
Nach dem gleichen Prinzip funktioniert auch WYLDCAT der Wyoming Libraries
http://wyld.state.wy.us/
Hier sind leider keine grossen akademischen Bibliotheken vertreten (aber die Internetquellen sind auch hier suchbar.)
==== Fallbeispiele - Deutschland ====
:rot: ekz.bibliotheksservice GmbH :rot:
http://vzg-sisis.gbv.de/
Metasuche über deutsche Verbundkataloge und Kataloge einzelner Bibliotheken (Portal für Öffentliche Bibliotheken).
Unter Profi-Recherche kann die Recherche auf die EKZ-Datenbank eingegrenzt werden.
Laut Selbstvorstellung ca. 125.000 Datensätze mit bibliographischen Nachweisen zu Schöner Literatur, Kinder- und Jugendliteratur, Sachliteratur, Gesellschaftsspielen und AV-Medien, Erscheinungsjahre 1969-2003. Tatsächlich sind bereits einige Titel aus 2004 verzeichnet.
Es werden (unter "TEXT") die Kurzbesprechungen mit angezeigt, die als Hilfsmittel für den Bestandsaufbau Öffentlicher Bibliotheken angefertigt werden. Durchsuchbar sind die Besprechungen offenbar nicht.
Es handelt sich nicht um einen Katalog (keine Besitznachweise von Bibliotheken), passt somit nur mit Einschränkung in den Kontext dieser Seite. Eine Verfügbarkeitsrecherche von EKZ-Treffern aus ist allerdings möglich.
Testweise waren früher EKZ-Besprechungen auch in SWBplus zugänglich (siehe unten).
----
:rot: SWBplus (Südwestverbund) :rot:
http://www.bsz-bw.de/SWBplus/
"Die Datenbank SWBplus enthält Abstracts, Aufsätze, Begleittexte, das Rezensionsorgan Informationsmittel für Bibliotheken, Inhaltsverzeichnisse, Klappentexte, den Linkservice, Literaturberichte, Rezensionen, Textproben und Verlagsinformationen. Durch die gegenseitige Verknüpfung der Datenbanken SWBplus und der Verbunddatenbank SWB, bilden digitale Dokumente, Bestandsnachweise und bibliographische Angaben eine Informationseinheit."
Im Februar 2004 wurde vereinbart, dass die IASL-Online-Besprechungen auf den SWB-Server übernommen werden.
Unselbständig erschienene Werke werden von den Juristischen Bibliotheken in Karlsruhe (BGH, BVerfG) und Tübingen (Jur. Seminar) eingebracht. Beispiel: "Enthaltene Werke" in der Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts.
Zur Tübinger Praxis vgl. den Bericht von Brintzinger:
http://www.uni-tuebingen.de/ub/elib/tbi/2002-1/tbi2002_1.htm#brintzinger
Suchmöglichkeiten:
In der Datenbank SWBplus ist eine Volltextsuche nach den Inhalten des angereicherten Inhalts möglich, nicht jedoch in der Verbunddatenbank selbst.
----
:rot: GBV (Gemeinsamer Bibliotheksverbund) :rot:
http://www.gbv.de/
Im GBV - genauer im GVK, dem Gemeinsamen Verbundkatalog - sind einzelne Sätze mit Rezensionen angereichert, Beispiel:
Die Suche nach der ISBN 3896024213 führt zum Titel Bild der Heimat, und unten an der Aufnahme sind Links zu Rezensionen. [[http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2003-1-099 Link 1]], [[http://www.h-net.org/reviews/showrev.cgi?path=108871047793229 Link 2]]
Es kann aber anscheinend nicht gezielt nach dem Inhalt (im Sinne des im Katalog enthaltenen Inhalts, also im wesentlichen der URL) dieser elektronischen Referenzen gesucht werden.
:rot: MPI für Europäische Rechtsgeschichte :rot:
OPAC: http://sunrise.mpier.uni-frankfurt.de/webOPAC/
Die Bibliotheksleiterin Frau Amedick teilte dazu mit:
"Das MPI fuer europaeische Rechtsgeschichte erschliesst seit Anfang 2004 alle neu erworbenen Sammelwerke mittels scannen und OCR-Bearbeitung der Inhaltsverzeichnisse. In den Inhaltsverzeichnissen kann sehr wohl gesucht werden: Sie sind einerseits in der "Suche in allen Feldern" mit indexiert und andererseits ueber die Kategorie "Inhalt" in der Standard- und in der Expertensuche gezielt ansprechbar. Der mittels OCR generierte Text wird im OPAC nicht angezeigt; das vom OPAC aus verlinkte PDF ist "searchable"".
http://log.netbib.de/archives/2004/04/08/enriched-content/#comment-5116
:rot: Elektronische Bibliothek der SuUB Bremen :rot:
OPAC: http://elib.suub.uni-bremen.de
Über den Index bzw. die Suchfunktion des Systems können neben allen gedruckten
Publikationen auch alle elektronischen Medien der Bibliothek gesucht werden.
Darüber hinaus sind auch die Table of Contents größerer Anbieter von E-Journals
verfügbar (Elsevier, Springer, Project Muse, JSTOR etc.)
Weiterhin werden zunehmend auch Metadaten interessanter Anbieter
von Open Access Publikationen in die Suche integriert, darunter
finden sich derzeit die Nachweise groesserer regionaler und überregionaler OAI-Datenanbieter wie PubMed- BioMedCentral, ArXiv.org, HU Berlin, LMU München,
OAI Dienst des Südwestverbundes, ViFaPhys TIB Hannover.
Insgesamt stehen dadurch mittlerweile mehrere Mio. Artikelnachweise
mit Link zum Volltext in der E-LIB zur Verfügung.
Weitere Projektinformationen unter:
http://elib.suub.uni-bremen.de/frs_elib2000.html
Hinweis: Kommentare zu http://log.netbib.de/archives/2006/02/26/kataloganreicherung-allenthalben/
bestreiten, dass der Hinweis auf die Bremer E-LIB hier berechtigt ist.
==== Fallbeispiele - Österreich ====
:rot: Vorarlberger Landesbibliothek :rot:
http://vlb-katalog.vorarlberg.at/
Die Vorarlberger Landesbibliothek und AGI - Information Management Consultants starten 2001 die Entwicklung und sind somit wohl der Pionier für Inhaltsverzeichnisse im OPAC. Die VLB erstellte für fast alle Sachbücher ein suchbares Inhaltsverzeichnis und setzt das Projekt mit Zeitschriftenaufsätzen fort. Die VLB lieferte den Anstoß zu dandelon.com.
:rot: Bibliotheken Online :rot:
http://www.bibliotheken.at
In der Detailanzeige eines Treffers
>- Verlinkung zu deutschsprachigen Autor/innen - http://www.ub.fu-berlin.de/internetquellen/fachinformation/germanistik/autoren/
>- über die ISBN Verlinkung zu http://www.rezensionen.at
:rot: eDOC-Suche :rot:
http://media.obvsg.at/suche
TOC-Suche des Österreichischen Verbundkatalogs
Übersicht zur Kataloganreicherung im deutschsprachigen Raum und insbesondere Österreichs
http://verbundtag.obvsg.at/documents/2006/vbt06_edoc_vbjb.pdf
==== Fallbeispiele: Polen UB Breslau ====
Im Neuerscheinungsdienst http://www.bu.uni.wroc.pl/oin/nowosci/main.html der UB Breslau sind meist die Cover und das Inhaltsverzeichnis gescannt. Da es mir nicht gelungen ist, einen Beispielband im OPAC wiederzufinden, ist unklar, ob diese Informationen auch beim Katalogisat verlinkt sind.
Hinweis bei: http://log.netbib.de/archives/2004/03/02/ub-breslau-reichert-an/
==== Fallbeispiele - Hong Kong WWW-OPACS ====
Die OPACS der großen Universitätsbibliotheken Hongkongs bieten in weit größerem
Umfang als die amerikanischen OPACs ToCs, die auch durchsucht werden können:
- Chinese University of Hong Kong (http://library.cuhk.edu.hk/screens/toc.html - differenziert nach Author, Title, Keyord/Phrase)
- Hong Kong University Libraries "Dragon" (http://library.hku.hk/search/X - hier im Suchfeld den Suchbegriffen "u:" voranstellen, z.B. u:david copperfield)
- Hong Kong University of Science and Technology (http://ustlib.ust.hk/search/X - hier im Suchfeld "Note" auswählen)
[Werner Gerstenberger, Fachref. Sinologie, UB Trier]
Kommentar von Klaus Graf zu dieser Ergänzung:
Bei den OPACs in Hongkong handelt es sich um die bekannten INNOPACs, wobei es davon auch in den USA eine Reihe sehr grosser Verbund-INNOPACs gibt, die die über Hongkong erschlossenen Bestände bei weitem übertreffen. Siehe dazu auch die Hinweise zur TOC-Search unter:
http://wiki.netbib.de/coma/USKataloge
Ausser den dort genannten Verbundkatalogen (MELVYL, OHIOLINK) ist immer auch der Tripod-Katalog TOC-reich:
http://tripod.brynmawr.edu/
Ausser Hongkong darf aus Singapore der INNOPAC genannt werden:
http://linc.nus.edu.sg/search/X
Siehe dazu insgesamt schon L. Kaczmarek 2001:
http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa.exe?A2=ind0109&L=hexenforschung&P=R3895&I=-3
==== Querverweis ====
http://wiki.netbib.de/coma/USKataloge
http://wiki.netbib.de/coma/EnrichedContent
derzeit nur passwortgeschützt zugänglich. Die Versionsverwaltung dokumentiert nur Änderungen ab 2006, aber die Seite ist erheblich älter und enthält aus meiner Sicht schätzenswerte Informationen zur Frühgeschichte der Kataloganreicherung in Deutschland. Sie war auch in der Wikipedia verlinkt. Ich dokumentiere ihren letzten Inhalt (Links nicht überprüft). Siehe auch
http://wayback.archive.org/web/*/http://wiki.netbib.de/coma/EnrichedContent
:4: Enriched Content - Catalog Enrichment - Anreicherung von Bibliothekskatalogen :4:
//Catalogues, enrichissez-vous !// *
++Hier sollen Informationen zusammengetragen werden zum Thema Anreicherung von Bibliothekskatalogen (OPACs) mit Inhaltsverzeichnissen (TOCs), Links zu Besprechungen usw. sowie zu den Suchmöglichkeiten nach diesen zusätzlichen Inhalten.++
Jede(r) darf mitmachen und konstruktive Beiträge (auch zum Layout) zu dieser Seite leisten.
++English contributions are welcome!++ Thanks to the Catalogablog
http://catalogablog.blogspot.com/2004/06/catalog-enrichment_18.html
Quote: "If you are involved in such an effort post a link to your project. It is also useful to see what others are doing outside the US."
Hinweise auf Netbib:
http://log.netbib.de/index.php?s=enriched
http://log.netbib.de/archives/2004/03/02/toc-search/
* Nachweis des Mottos
http://membres.lycos.fr/vacher/profess/conf/brux99/texte.htm
{{toc}}
=== AKTUELLE INITIATIVEN (neueste oben) ===
** Kataloganreicherung in den Verbünden, Bericht auf dem Bibliothekartag Erfurt 2009 **
http://www.opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2009/719/
** Praxis bei OpenBib **
http://blog.openbib.org/2008/06/18/zentrale-kataloganreicherung/
** dandelon.com - International collaborative network for catalog enrichment -
http://www.dandelon.com - teilnehmende Bibliotheken: UBiT Trondheim (Norwegen), UB Kiel, ZBW Kiel und Hamburg, SUB Hamburg, UB Greifswald, TU Berlin, FHTW Berlin, UB Braunschweig, TIB Hannover, SUB Göttingen, UB Frankfurt, ULB Darmstadt, UB Mainz, FH Gelsenkirchen, VLB Bregenz, FH Dornbirn, LB Liechtenstein, UB St. Gallen - Betreiber AGI - Information Management Consultants. Bestand Mai 2009 über 600.000 TOCs. Alle Titel werden mit "intelligentCAPTURE mobile" von AGI - Information Management Consultants (http://www.agi-imc.de) produziert. Weitere 120.000 mit der gleichen Technik bei der Deutsche Nationalbibliothek, Leipzig und bei Casalini Libri (Italien) erstellt - über 1000 neue TOCs pro Tag ingesamt. Marktanteil in Europa ca. 60 %.
** Deutsche Nationalbibliothek **
http://www.d-nb.de - 2 Projekte: Leipzig: alle Werke ab Erwerbung 1913 (Titel ab ca. 1800 - Stand Ende Mai 2009 55.000, pro Monat ca. 9000 Zuwachs) und Frankfurt: Neue Titel in Reihe A (pro Jahr ca. 70.000).
**GBV**
http://www.gbv.de - Sammelt TOCs aus dandelon.com-Netzwerk, HBZ, Casalini Libri, LoC, DNB - die bislang größte, teilweise suchbare Kollektion.
** Praxis der ÖNB Wien **
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg33785.html
** Österreich: Übersicht**
http://verbundtag.obvsg.at/documents/2006/vbt06_edoc_vbjb.pdf
Hinweise auf andere Anwender im deutschsprachigen Raum
**Schweiz: ETH-Bibliothek **
http://www.ethbib.ethz.ch/abstract/abstract.html
Für etwa 70'000 Bücher sind im NEBIS-Katalog über die Link-Verknüpfung "Abstract / Index" zusätzliche Informationen (Zusammenfassungen, Inhaltsverzeichnisse oder Angaben über Autoren) eingebaut."
** Diplomarbeit, speziell zur Schweiz **
http://www.iudchur.net/fileadmin/uploads/pdf/csi/CSI_15_Loehrer.pdf
**Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-Westfalen (hbz)**
Das hbz beschäftigt sich seit August 2005 intensiv mit dem Thema Catalogue Enrichment. Im 180T-Projekt wurden in einem ersten Schritt insgesamt 180.000 Inhaltsverzeichnisse aus den Fachbereichen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften retrospektiv gescannt. Seit Januar 2006 wird die Digitalisierungsinitiative in einer zweiten Phase mit fünf Bibliotheken aus NRW fortgesetzt. Neben der retrospektiven Digitalisierung werden zudem Neuerwerbungen aus den einzelnen Bibliotheken gescannt.
Das Ziel ist, bis zum Spätsommer 2006 den Workflow des Scannings von Neuerwerbungen zu evaluieren sowie die Inhaltsverzeichnisse aller Neuzugänge des Verbundbereichs im hbz-Medienserver, im Dreiländerkatalog und in der hbz-Verbunddatenbank anzureichern und nachzuweisen. In einer weiteren Projektphase ist geplant, neben Inhaltsverzeichnissen auch weitere Zusatzinformationen wie Buchcover, Rezensionen und Klappentexte zu integrieren.
In Ergänzung zu seinen eigenen Scannaktivitäten evaluiert das hbz momentan das Angebot an Fremddaten und steht bereits in Verhandlungen mit Verlagen und Datenanbietern. Einen ersten Meilenstein stellt hierbei die Kooperation mit dem Springer Verlag dar.
//Links://
[[http://www.hbz-nrw.de/angebote/catalogue_enrichment/ Weitere Informationen zum Catalogue Enrichment im hbz]]
[[http://suchen.hbz-nrw.de/dreilaender/ Dreiländerkatalog]]
Anwenderbericht Catalogue Enrichment: Großgarten, Astrid. "[[http://www.hbz-nrw.de/dokumentencenter/produkte/catalogue_enrichment/Scanprojekt_Sonderdruck_IWP.pdf Das 180T-Projekt in Köln oder wie verarbeite ich 180.000 Bücher in vier Monaten]]". Information. Wissenschaft und Praxis. 56. 2005. S. 454-556
**Catalogue Enrichment mit ADAM im BVB**
Detaillierte Informationen zum Thema Catalogue Enrichment im Bibliotheksverbund Bayern auf der Wikiseite CatalogueEnrichmentBVB.
Beispiel im OPAC der UB Passau: Segler-Meßner: Archive der Erinnerung. Die im PDF des Inhaltsverzeichnisses vorhandene Zeichenfolge "Figur des Zeugen" wird mit Figur oder Zeugen nicht gefunden, eine Volltextsuche in den angereicherten Daten offenbar nicht möglich. Der Link auf TOC und Klappentext findet sich auch im BVB-OPAC. Hier gibt es eine Suchmöglichkeit Zusatzinformationen/Volltext, aber mit Figur werden zwar Inhaltsverzeichnisse gefunden, in denen Figur vorkommt, nicht aber der gesuchte Titel.
http://www.ib.hu-berlin.de/~libreas/libreas_neu/ausgabe4/003ebe.htm
Moralische Reflexion auf das Catalogue Enrichment (wertende Rezensionen)
http://www.anarchitect.org/log/2005/09/13/stadtbibliothek-hangt-ihren-katalog-ins-netz-und-wirbt-fur-amazon/
Kritik an Amazon-Bildern
OpenWorldCat is adding reader reviews and TOCs (not searchable)
http://log.netbib.de/archives/2005/10/13/open-worldcat-mit-leserrezensionen/
http://orweblog.oclc.org/archives/000825.html
http://log.netbib.de/archives/2005/05/02/polemik-gegen-kataloganreicherung/
Fortbildungsveranstaltung: OPAC der Zukunft mit einschlägigen Beiträgen
http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2004-fortbildung-stuttgart.php
Roy Tenant: Enriching the catalog, in: Library Journal
http://www.libraryjournal.com/article/CA423795?display=Digital+LibrariesNews&industry=Digital+Libraries&industryid=3760&verticalid=151
Catalog Enrichment Initiative
http://www.loc.gov/standards/catenrich/
Robert Kieft: Collaborative Project to Enhance Library Catalog Browsing
http://www.clir.org/pubs/issues/issues38.html#collab
==== Hinweis zur TOC-Search ====
Auffinden von englischsprachigen einschlägigen Beiträgen im Netz und bibliographischen Datenbanken mit:
bibliographic records enhancement
enrichment
tables of content usw.
Beiträge in INETBIB 2001 zum Thema TOCs in Katalogen:
http://www.hbz-nrw.de/produkte_dienstl/mlist/inetbib/200108/20010823.html
Weiterer Beitrag von Eversberg 2003:
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg11091.html
OPAC werde zur Zufallsmaschine.
Siehe auch den Abschnitt "Einspeisen von mehr Text" in Eversbergs Aufsatz zur Sachkatalogisierung:
http://www.allegro-c.de/regeln/cosarara.htm
2003 wurde in INETBIB über eine Recherche berichtet, von wievielen Festschriften des Jahres 2002 Inhaltsverzeichnisse in US-Katalogen vorhanden sind:
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg22153.html
Für das Jahr 2004 ergab die Suche nach Festschriften 2003 mit teilweise anderen Katalogen folgendes:
In MELVYL sind 18 Titel (vorwiegend theologische) vorhanden, in MNLink zusätzlich 4. Big Ten (U Minnesota Interface) erbrachte aus dem Bestand der Northwestern U 9 zusätzliche, Columbia U lieferte einen weiteren Titel, Tripod 2. Macht 34 Titel.
Unergiebig (wenige TOCs): LoC, Cornell, Yale, Illinet.
Ein anderer Test 2003 mit anderen Suchbegriffen:
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg10273.html
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg10296.html
Ergebnis: Auch OCLC und RLG bieten über die Keyword-Search nicht den Gesamtbestand frei zugänglicher TOCs in OPACs.
Ein weiterer Test zum Thema Rittertum 2003
http://www.uni-bayreuth.de/departments/aedph/2003/0098.html
Aus den USA bezogene Titeldaten der SB zu Berlin enthalten auch Inhaltsverzeichnisse, die suchbar sind (anders als im GBV, wo zwar solche TOCs vorhanden, aber nicht suchbar sind!)
OPAC der SB Berlin http://sbbweb1.sbb.spk-berlin.de:8080
Test Ende 2006
http://de.wikiversity.org/wiki/Benutzer:Histo/TOCsuche
**Literatur (online) und Internetquellen:**
Informationen des TOC-Lieferanten Blackwell mit ausführlicher TOC-Bibliographie im 35seitigen PDF, abrufbar auf
http://www.blackwell.com/level2/TOC.asp
Zitat:
"Studies undertaken to determine the effect on search retrieval of the addition of Table of Contents (TOC) to the catalog record have produced startling results. One study determined that the addition of tables of contents increased usage of new materials by 45% (see Appendix H for a TOC bibliography). Though methodologies vary, each study reports significant benefits. Specifically, Table of Contents and descriptive summary data enriches the record with key words for improved access, and adds to library users' understanding of the title retrieved. The latter benefit reduces trips to the stacks, and unnecessary interlibrary loan requests. Until now, the prohibitive costs of enriching catalog records with such data have kept the library community from realizing these benefits. Through a unique combination of book handling and MaRC record editing capabilities, Blackwell?s provides a service whereby libraries can send MaRC records to
Blackwell?s for enrichment with Tables of Contents, descriptive summaries, and authors'
affiliations which allow key word searching of institutions."
Marty Crowe: Table-of-Contents Enhancement for the Catalog (1997)
http://www.library.cornell.edu/cts/martyrep.htm
Update 2002 von David Banush
http://www.library.cornell.edu/staffweb/TOC.html
Madjid Ihadjadène: Les tables de matières dans les catalogues en ligne. Opportunités, méthodes et coûts (1998) - PDF
http://www.abf.asso.fr/IMG/pdf/n178_3.pdf
Yale Memorandum (2000) - PDF
http://www.library.yale.edu/CDC/public/documents/TOCreport.pdf
Ruth C. Morris: Online tables of contents for books: effect on usage (2001)
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=31701
"The study found that tables of contents do increase usage."
Aus einer Einladung zum DLF Spring Forum 2004
//Between the Sheets: Enriching the Catalog. Roy Tennant, California Digital Library
For almost three decades librarians have advocated the enhancement of online library catalog records with book tables of contents, sample text, indexes, reviews, cover images, etc. We believe that deployed technologies, user expectations, and emerging standards such as METS, OAI-PMH, and ONIX make this a propitious time for libraries to aggressively pursue bibliographic record enhancement strategies. This session will briefly report on an ad hoc collaborative effort begun at ALA Midwinter 2004 to build an infrastructure to enable distributed, non-duplicative input of record-enriching content using standards and practices currently available and proved effective. We will invite BOF attendees to share their concerns, ideas, and comments. As this effort is an informal collaborative, anyone is welcome to participate in advancing the future of the library catalog.//
http://www.diglib.org/forums/Spring2004/springforum04rev1.htm
Minutes des Treffens:
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg24332.html
==== Linking von Ressourcen allgemein ====
Wenn man etwas zu ergänzenden Informationen in Bibliothekskatalogen schreibt, darf auch eine Info zur Linking-Technologie nicht fehlen.
Auch wenn vielleicht keine TOCs durchsucht werden können, ist die Existenz eines solchen Angebots doch immerhin nützlich und ein Anfang.
Ein Beispiel ist der Einsatz von OpenURL/SFX zur Vernetzung verschiedener Informationsressourcen (Aufsatzdatenbanken, WeblogSuchmaschinen, etc.). Ob lizenziert oder Open Access spielt nur für die Zugriffsmöglichkeiten eine Rolle, nicht für die Technik.
SFX nutzt z.B. die Max-Planck-Gesellschaft (in Lizenz von Exlibris, http://www.exlibrisgroup.com/sfx.htm). Dies erleichtert in der Theorie den Zugriff auf einzelne Quellen durch einen SFX-Server. Oberfläche dazu etwa Vlib-Server der MPG (http://vlib.mpg.de/), mit reinem Gastzugang fallen dann natürlich die kommerziellen Informationsprovider weg...
Andersherum: eine Suche bei einem OpenURL-Provider (z.B. BiomedCentral, http://www.biomedcentral.com/) kann über eingeblendete SFX-Links dann auch zu Bibliotheksbeständen führen (z.B. ist eine Zeitschrift vorhanden in der Institution).
Bei einem Open-Access-Publisher (wie BMC einer ist) braucht man dann natürlich die Bibliotheksbestände nicht mehr ;-)
Die UB der Université Libre de Bruxelles (http://www.bib.ulb.ac.be/) nutzt in ihrem Katalog auch den OpenURL-Framework-Standard (http://www.niso.org/standards/standard_detail.cfm?std_id=783).
Beispielsuche nach "Huccorgne" in Verbindung mit dem Verfassernamen "Lawrence" bringt folgendes Ergebnis:
http://bib7.ulb.ac.be/uhtbin/cgisirsi/GmEVpRuyUC/14140014/88
Durch den Klick auf "VLink"-Button öffnet sich der Zugang zu anderen Ressourcen (wieder teilweise zugangsbeschränkt, da lizenzierte Inhalte).
Denkbar sind hier also auch Referenzen mit Review-Datenbanken u.ä.
==== Fallbeispiele - USA ====
:rot: Library of Congress (LoC) - Team BEAT :rot:
http://www.loc.gov/catdir/beat/
Anreicherung vor allem durch
- Inhaltsverzeichnisse (TOC)
- Buchauszüge (Sample-Texts)
- Umschlagabbildungen (Covers)
- Besprechungen, insbesondere des H-NET
- Links auf frei zugängliche Digitalisierungen (Journals, Public-Domain-Books)
Suchmöglichkeiten:
Die verlinkten Inhalte, auch die auf den Seiten der LoC gespeicherten Inhaltsverzeichnisse, können leider nicht durchsucht werden.
[Die auf den Seiten der LoC gespeicherten Inhaltsverzeichnisse können sehr wohl in http://catalog.gov, "Guided Search", "Search as: Contents Notes (KCON)" durchsucht werden. Die verlinkten Inhalte, soweit ich sehe, tatsächlich nicht. Dies ist der Nachteil verlinkter Inhalte. Werner Gerstenberger, Fachref. Sinologie UB Trier]
Es kann aber nach der Existenz solcher Verlinkungen gesucht werden.
http://catalog.loc.gov/
Im Katalog ist die "Guided Search" zu wählen. Eine Einschränkung auf Zeiträume, Sprachen, Erscheinungsländer ist durch "Set Limits" möglich. Mit http* findet man Katalogisate, die Links enthalten.
Mit dem zweiten Feld kann man durch NOT http loc gov ausschliessen: Links auf Webseiten der LoC.
Man kann - Achtung: "as a phrase" einstellen - nach http://www.h-net* suchen und so Katalogisate, die auf H-NET-Reviews verweisen, auffinden.
----
:rot:Rochester Institute of Technology (RIT) - Library :rot:
http://albert.rit.edu/
Im Katalog können mittels des Buttons more! zusätzliche Informationen, die vom kommerziellen Anbieter http://www.syndetics.com bereitgestellt werden, abgerufen werden (um Beispiele aufzufinden: Browse Recent Additions). Dabei handelt es sich insbesondere um Inhaltsverzeichnisse und Besprechungen, die frei zugänglich sind. Andere Verweise führen zu lizenzierten Angeboten.
Vortrag eines Syndetics-Vertreters (2000)
http://www.loc.gov/catdir/bibcontrol/calcagno_paper.html
Präsentation 2006
http://www.inforum.cz/inforum2006/pdf/Gerlach_Kai_Henning1.pdf
Website der Firma
http://www.syndetics.com/
Suchmöglichkeiten:
Die Inhalte von Syndetics.com können nicht durchsucht werden.
Exkurs: Im E-Content-Finder des RIT-Katalogs sind auch Public-Domain-Books der Online Books Page auffindbar!
Weiterer Syndetics-Kunde ist die UB Toronto
http://www.library.utoronto.ca/
Beispiel: Kallendorf, Exorcism, 2003 (Cover, Autor bio = akademische Zugehörigkeit, TOC, aber gegenüber dem ausführlichen TOC des Buchs leider sehr reduziert, TOC-Inhalt nicht suchbar)
Weiterer Kunde ist die UB Göteborg (Schweden)
http://sunda.ub.gu.se:8000/cgi-bin/chameleon?lng=en
Allerdings ist hier offenbar die Anzeige für Außenstehende blockiert. Es half allerdings, die in Göteborg gefundene ISBN in die RIT-URL einzutragen:
http://syndetics.com/rn12.pl?isbn=0300103352/index.html&client=rit
----
:rot: SAILS Library Network :rot:
Ein Beispiel aus dem Bereich der Public Libraries der USA: der Verbund umfaßt solche und Schulbüchereien. Andere Bibliotheken und Verbünde, die ebenfalls iBistro von SIRSI verwenden, könnten gleichermaßen genannt werden.
"iBistro content enriches library catalog records so that you may view, along with the records, book reviews, tables of contents, synopses and annotations, and other specific information about the items."
http://opac.sailsinc.org/
Eine Gastsuche ist möglich! Der Enriched Content ("Look inside") ist durch kleine Symbole in der Trefferliste angezeigt.
Suchmöglichkeiten:
Die Inhalte können nicht durchsucht werden.
Exkurs: Im Katalogeintrag lohnt links die Suche nach Webresourcen einen Klick, sie führt zu redaktionell erfaßten Internetquellen.
Nach dem gleichen Prinzip funktioniert auch WYLDCAT der Wyoming Libraries
http://wyld.state.wy.us/
Hier sind leider keine grossen akademischen Bibliotheken vertreten (aber die Internetquellen sind auch hier suchbar.)
==== Fallbeispiele - Deutschland ====
:rot: ekz.bibliotheksservice GmbH :rot:
http://vzg-sisis.gbv.de/
Metasuche über deutsche Verbundkataloge und Kataloge einzelner Bibliotheken (Portal für Öffentliche Bibliotheken).
Unter Profi-Recherche kann die Recherche auf die EKZ-Datenbank eingegrenzt werden.
Laut Selbstvorstellung ca. 125.000 Datensätze mit bibliographischen Nachweisen zu Schöner Literatur, Kinder- und Jugendliteratur, Sachliteratur, Gesellschaftsspielen und AV-Medien, Erscheinungsjahre 1969-2003. Tatsächlich sind bereits einige Titel aus 2004 verzeichnet.
Es werden (unter "TEXT") die Kurzbesprechungen mit angezeigt, die als Hilfsmittel für den Bestandsaufbau Öffentlicher Bibliotheken angefertigt werden. Durchsuchbar sind die Besprechungen offenbar nicht.
Es handelt sich nicht um einen Katalog (keine Besitznachweise von Bibliotheken), passt somit nur mit Einschränkung in den Kontext dieser Seite. Eine Verfügbarkeitsrecherche von EKZ-Treffern aus ist allerdings möglich.
Testweise waren früher EKZ-Besprechungen auch in SWBplus zugänglich (siehe unten).
----
:rot: SWBplus (Südwestverbund) :rot:
http://www.bsz-bw.de/SWBplus/
"Die Datenbank SWBplus enthält Abstracts, Aufsätze, Begleittexte, das Rezensionsorgan Informationsmittel für Bibliotheken, Inhaltsverzeichnisse, Klappentexte, den Linkservice, Literaturberichte, Rezensionen, Textproben und Verlagsinformationen. Durch die gegenseitige Verknüpfung der Datenbanken SWBplus und der Verbunddatenbank SWB, bilden digitale Dokumente, Bestandsnachweise und bibliographische Angaben eine Informationseinheit."
Im Februar 2004 wurde vereinbart, dass die IASL-Online-Besprechungen auf den SWB-Server übernommen werden.
Unselbständig erschienene Werke werden von den Juristischen Bibliotheken in Karlsruhe (BGH, BVerfG) und Tübingen (Jur. Seminar) eingebracht. Beispiel: "Enthaltene Werke" in der Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts.
Zur Tübinger Praxis vgl. den Bericht von Brintzinger:
http://www.uni-tuebingen.de/ub/elib/tbi/2002-1/tbi2002_1.htm#brintzinger
Suchmöglichkeiten:
In der Datenbank SWBplus ist eine Volltextsuche nach den Inhalten des angereicherten Inhalts möglich, nicht jedoch in der Verbunddatenbank selbst.
----
:rot: GBV (Gemeinsamer Bibliotheksverbund) :rot:
http://www.gbv.de/
Im GBV - genauer im GVK, dem Gemeinsamen Verbundkatalog - sind einzelne Sätze mit Rezensionen angereichert, Beispiel:
Die Suche nach der ISBN 3896024213 führt zum Titel Bild der Heimat, und unten an der Aufnahme sind Links zu Rezensionen. [[http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2003-1-099 Link 1]], [[http://www.h-net.org/reviews/showrev.cgi?path=108871047793229 Link 2]]
Es kann aber anscheinend nicht gezielt nach dem Inhalt (im Sinne des im Katalog enthaltenen Inhalts, also im wesentlichen der URL) dieser elektronischen Referenzen gesucht werden.
:rot: MPI für Europäische Rechtsgeschichte :rot:
OPAC: http://sunrise.mpier.uni-frankfurt.de/webOPAC/
Die Bibliotheksleiterin Frau Amedick teilte dazu mit:
"Das MPI fuer europaeische Rechtsgeschichte erschliesst seit Anfang 2004 alle neu erworbenen Sammelwerke mittels scannen und OCR-Bearbeitung der Inhaltsverzeichnisse. In den Inhaltsverzeichnissen kann sehr wohl gesucht werden: Sie sind einerseits in der "Suche in allen Feldern" mit indexiert und andererseits ueber die Kategorie "Inhalt" in der Standard- und in der Expertensuche gezielt ansprechbar. Der mittels OCR generierte Text wird im OPAC nicht angezeigt; das vom OPAC aus verlinkte PDF ist "searchable"".
http://log.netbib.de/archives/2004/04/08/enriched-content/#comment-5116
:rot: Elektronische Bibliothek der SuUB Bremen :rot:
OPAC: http://elib.suub.uni-bremen.de
Über den Index bzw. die Suchfunktion des Systems können neben allen gedruckten
Publikationen auch alle elektronischen Medien der Bibliothek gesucht werden.
Darüber hinaus sind auch die Table of Contents größerer Anbieter von E-Journals
verfügbar (Elsevier, Springer, Project Muse, JSTOR etc.)
Weiterhin werden zunehmend auch Metadaten interessanter Anbieter
von Open Access Publikationen in die Suche integriert, darunter
finden sich derzeit die Nachweise groesserer regionaler und überregionaler OAI-Datenanbieter wie PubMed- BioMedCentral, ArXiv.org, HU Berlin, LMU München,
OAI Dienst des Südwestverbundes, ViFaPhys TIB Hannover.
Insgesamt stehen dadurch mittlerweile mehrere Mio. Artikelnachweise
mit Link zum Volltext in der E-LIB zur Verfügung.
Weitere Projektinformationen unter:
http://elib.suub.uni-bremen.de/frs_elib2000.html
Hinweis: Kommentare zu http://log.netbib.de/archives/2006/02/26/kataloganreicherung-allenthalben/
bestreiten, dass der Hinweis auf die Bremer E-LIB hier berechtigt ist.
==== Fallbeispiele - Österreich ====
:rot: Vorarlberger Landesbibliothek :rot:
http://vlb-katalog.vorarlberg.at/
Die Vorarlberger Landesbibliothek und AGI - Information Management Consultants starten 2001 die Entwicklung und sind somit wohl der Pionier für Inhaltsverzeichnisse im OPAC. Die VLB erstellte für fast alle Sachbücher ein suchbares Inhaltsverzeichnis und setzt das Projekt mit Zeitschriftenaufsätzen fort. Die VLB lieferte den Anstoß zu dandelon.com.
:rot: Bibliotheken Online :rot:
http://www.bibliotheken.at
In der Detailanzeige eines Treffers
>- Verlinkung zu deutschsprachigen Autor/innen - http://www.ub.fu-berlin.de/internetquellen/fachinformation/germanistik/autoren/
>- über die ISBN Verlinkung zu http://www.rezensionen.at
:rot: eDOC-Suche :rot:
http://media.obvsg.at/suche
TOC-Suche des Österreichischen Verbundkatalogs
Übersicht zur Kataloganreicherung im deutschsprachigen Raum und insbesondere Österreichs
http://verbundtag.obvsg.at/documents/2006/vbt06_edoc_vbjb.pdf
==== Fallbeispiele: Polen UB Breslau ====
Im Neuerscheinungsdienst http://www.bu.uni.wroc.pl/oin/nowosci/main.html der UB Breslau sind meist die Cover und das Inhaltsverzeichnis gescannt. Da es mir nicht gelungen ist, einen Beispielband im OPAC wiederzufinden, ist unklar, ob diese Informationen auch beim Katalogisat verlinkt sind.
Hinweis bei: http://log.netbib.de/archives/2004/03/02/ub-breslau-reichert-an/
==== Fallbeispiele - Hong Kong WWW-OPACS ====
Die OPACS der großen Universitätsbibliotheken Hongkongs bieten in weit größerem
Umfang als die amerikanischen OPACs ToCs, die auch durchsucht werden können:
- Chinese University of Hong Kong (http://library.cuhk.edu.hk/screens/toc.html - differenziert nach Author, Title, Keyord/Phrase)
- Hong Kong University Libraries "Dragon" (http://library.hku.hk/search/X - hier im Suchfeld den Suchbegriffen "u:" voranstellen, z.B. u:david copperfield)
- Hong Kong University of Science and Technology (http://ustlib.ust.hk/search/X - hier im Suchfeld "Note" auswählen)
[Werner Gerstenberger, Fachref. Sinologie, UB Trier]
Kommentar von Klaus Graf zu dieser Ergänzung:
Bei den OPACs in Hongkong handelt es sich um die bekannten INNOPACs, wobei es davon auch in den USA eine Reihe sehr grosser Verbund-INNOPACs gibt, die die über Hongkong erschlossenen Bestände bei weitem übertreffen. Siehe dazu auch die Hinweise zur TOC-Search unter:
http://wiki.netbib.de/coma/USKataloge
Ausser den dort genannten Verbundkatalogen (MELVYL, OHIOLINK) ist immer auch der Tripod-Katalog TOC-reich:
http://tripod.brynmawr.edu/
Ausser Hongkong darf aus Singapore der INNOPAC genannt werden:
http://linc.nus.edu.sg/search/X
Siehe dazu insgesamt schon L. Kaczmarek 2001:
http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa.exe?A2=ind0109&L=hexenforschung&P=R3895&I=-3
==== Querverweis ====
http://wiki.netbib.de/coma/USKataloge
KlausGraf - am Sonntag, 15. April 2012, 23:59 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Etablierte Parteien und Staatsoberhäupter fühlen sich bedroht. Piraten und Querköpfe werden zu "Wutbürger" deklariert. Die Bundeskanzlerin mimt die Göttin der Transparenz. Leicht zu durchschauen. Es sind keine "Wutbürger", es ist die Wut der Bürger. Das ist etwas anderes.
http://goo.gl/elg29
http://goo.gl/elg29
la bastille - am Sonntag, 15. April 2012, 23:29 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
PDF des Urteils:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Loriot_decision.pdf
Von § 5 Abs. 1 UrhG werden nach Ansicht des Gerichts nur Sprachwerke erfasst, nicht aber Werke der bildenden Kunst. Postwertzeichen fielen auch nicht unter § 5 Abs. 2 UrhG.
Damit stellt sich das Gericht gegen die Entscheidung des LG München, das für den Michel-Verlag Geltung besitzt.
Gewonnen hat die Wikipedia nur insofern, als sie die Wiedergabe der Unterschrift von Loriot nutzen darf. Dabei handle es sich nicht um ein urheberrechtlich geschütztes Werk.
Kommentare:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Urheberrechtsfragen&oldid=102087688#Loriot-Urteil_liegt_nun_vor
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Forum#Loriot-Entscheidung_des_LG_Berlin_nun_verf.C3.BCgbar
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Deletion_requests/Template:PD-German_stamps
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=loriot

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Loriot_decision.pdf
Von § 5 Abs. 1 UrhG werden nach Ansicht des Gerichts nur Sprachwerke erfasst, nicht aber Werke der bildenden Kunst. Postwertzeichen fielen auch nicht unter § 5 Abs. 2 UrhG.
Damit stellt sich das Gericht gegen die Entscheidung des LG München, das für den Michel-Verlag Geltung besitzt.
Gewonnen hat die Wikipedia nur insofern, als sie die Wiedergabe der Unterschrift von Loriot nutzen darf. Dabei handle es sich nicht um ein urheberrechtlich geschütztes Werk.
Kommentare:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Urheberrechtsfragen&oldid=102087688#Loriot-Urteil_liegt_nun_vor
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Forum#Loriot-Entscheidung_des_LG_Berlin_nun_verf.C3.BCgbar
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Deletion_requests/Template:PD-German_stamps
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=loriot

KlausGraf - am Sonntag, 15. April 2012, 23:26 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nichtskönner vom OLG Stuttgart, die sich leider Richter nennen dürfen, haben im Fall Kröner vs. Fernuni Hagen entschieden, dass nur drei (in Zahlen: 3) Seiten im Rahmen von § 52a UrhG Kursteilnehmern zugänglich gemacht werden dürfen.
http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/976/OLG%20Stuttgart%20040412.pdf
Zu § 52a UrhG
http://archiv.twoday.net/search?q=52a+urhg
RA Thomas Stadlers Stellungnahme:
http://www.internet-law.de/2012/04/das-urheberrecht-behindert-unterricht-und-bildung.html
Aus Rainer Kuhlens Stellungnahme:
a) Weltfremde Richter. In einem Rechtsstaat kann man Gerichtsurteile nicht einfach ignorieren. Also dem Rektor der Fernuniversität Hagen zu empfehlen, doch mal 6 Monate ins Gefängnis zu gehen, weil er sich dem Urteilen des Gerichts nicht anschließen mag, wäre wohl nicht angebracht. (warum eigentlich nicht – das wäre doch mal was; er wird deshalb wohl nicht gleich seinen Beamtenstatus verlieren) Aber man wird durchaus feststellen können, dass Richter wie die in Stuttgart in einer Welt des Umgangs mit Wissen und Information leben, die nichts mit der Realität des Forschens und des Lehrens und Lernens in elektronischen Umgebungen zu tun hat.
b) Selbstreferenzielle, sich verstrickende Juristen. Sind jemals in solche Verfahren Gutachten und Stellungnahmen eingegangen, die die Sicht von Bildung und Wissenschaft vertreten? Vermutlich nicht. Juristen sind i.d.R. selbstreferenziell und schließen Information aus der Welt außerhalb des juristischen Horizonts aus. Ist nicht Recht auch eine Sozial- und Politikwissenschaft? In solchen sich selbst verstrickenden Zirkeln entstehen zwar weiter rechtlich richtige Urteile, aber kaum gerechte.
c) Ziviler Ungehorsam. Also wird man Wege finden müssen, diese Urteile zu ignorieren. Wie weit dabei der individuelle zivile Ungehorsam gehen kann, muss jeder für sich entscheiden. Auf jeden Fall werden die findigen Studierenden Wege finden, wie Entscheidungen der Gerichte umgangen werden können, die auch technisch unsinnig sind. Elektronische Information lässt sich nicht einsperren.
d) Bisherige Publikationsmodelle auf den Müllhaufen. In Richtung Open Access. Ignoriert werden diese unsinnigen ungerechten Urteile am besten dadurch, dass man die bislang zugrundeliegenden verfahrensmäßigen Praktiken des Publizierens endlich auf den Müllhaufen der Geschichte wirft. Sollen die Gerichte und Verlage nur so weitermachen. Dann werden schließlich auch bald die Letzten davon überzeugt sein, dass in Bildung und Wissenschaft nur noch Open-Access-Publikationsmodelle Akzeptanz finden werden. Vae victoribus!
e) Eine letzte Warnung an die Verlage. Nicht wehe, den Besiegten, sondern wehe den Siegern! Sollen doch ruhig im Börsenverein die Sektkorken knallen ob ihres temporären Sieges. Die AutorInnen werden ihnen bald ausbleiben, wenn unter Federführung des Börsenvereins weiter wissenschaftsfeindliche Politik betrieben wird und selbst das mit öffentlichen Geldern finanzierte Wissen dem Primat der kommerziellen Verwertung unterworfen werden soll. Das Urteil sollte eher als letzte Warnung an die Verlage verstanden werden, sich auf den Weg zu offenen freien Nutzungsmodellen zu machen. Sonst brauchen wir Verlage nicht mehr.
f) Es muss jetzt von Seiten der Politik gehandelt werden. Nach diesem Urteil sollte auch die Letzten im Bundesjustizministerium – die Letzte ist in diesem Fall die Ministerin selber – überzeugt sein, dass Schluss mit den komplizierten, widersprüchlichen und gänzlich untauglichen Schrankenregelungen (52 ist ja nur ein Beispiel von vielen) sein muss. Es muss jetzt gehandelt werden. Wenn nicht, wird man dafür sorgen müssen und damit auch Erfolg haben, eine breitere Öffentlichkeit zum Aufstand gegen die träge Politik zu bringen, um endlich den elektronischen Räumen angemessene Regulierungen oder besser: Freiräume zu verschaffen. Es wird nicht schwer werden, neben Grünen und Linken vor allem auch die Piratenpartei dafür zu gewinnen.
g) Streichen von § 52a ja, aber nicht ersatzlos. In Richtung einer Wissenschaftsklausel. Natürlich kann selbst der nicht gute §52a nicht ersatzlos gestrichen werden, wie es der Börsenverein fordert. Streichen schon, aber nicht ersatzlos. Entweder macht sich der Gesetzgeber endlich daran, allgemein im deutschen Urheberrecht so etwas wie das angelsächsische „fair use“ einzuführen. Oder er setzt das um, was seit Jahren das Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft, die Allianz der Wissenschaftsorganisationen und die Kultusministerkonferenz fordern, nämlich die Einführung einer allgemeinen Bildungs- und Wissenschaftsklausel. Darin muss eigentlich nur geregelt werden, was auch im Vorschlag der European Copyright Codes der Wittem Gruppe vorgeschlagen wird, nämlich die genehmigungsfreie Nutzung publizierter Objekte für Zwecke von Bildung und Wissenschaft. Punkt! Unkonditioniert.
h) Müssen Bildungseinrichtungen sich auf kommerzielles Referenzmaterial verlassen? Müssen Einrichtungen wie die Fernuniversität Hagen (aber auch alle anderen Bildungseinrichtungen) solche Werke wie das Psychologiehandbuch, um das gestritten wurde, überhaupt als Referenzmaterial verwenden? Lehrbriefe sollten die Dozenten selber schreiben können, und in ihnen können sie freien Gebrauch nach dem in § 51 UrhG garantierten Zitatrecht machen. Fast unbegrenzt im Umfang, wenn es durch den Zweck der Briefe gerechtfertigt ist. Zusätzlich könnten Hintergrundinformationen zur „Veranschaulichung“ frei aus dem Netz heruntergeladen werden, z.B. zu Sokrates, Herbart, Dilthey, James oder Wygotski aus der deutschen oder englischen Wikipedia. Artikel zu diesen vier „Pionieren“ der Psychologie waren ja unter den im Verfahren monierten. Oder eine Referenz zum Wikibook: Geschichte von Psychologie und Psychiatrie – neben vielen anderen frei zugänglichen.
i) Nur Mut zur informationellen Autonomie der AutorInnen. Welches die Motive der AutorInnen waren, ihre Verwertungsrechte als Nutzungsrechte exklusiv an den Verlag abzugeben, so dass es überhaupt zu solchen Klagen hat kommen können, kann hier nicht geklärt werden. Zu fragen wäre zumindest bei dem Hauptautor, immerhin sehr gut bezahlter Professor an der Universität Bern, warum er nicht zumindest auf eine parallele, freie Zweitveröffentlichung bestanden hat. Auf das Geld kann es ihm sicher nicht angekommen sein. Nur Mut, Herr Kollege.
j) Steilvorlage für den Bundesgerichtshof. Das Urteil ist eine Steilvorlage für den Bundesgerichtshof – natürlich nur, wenn die Beklagte, die Fernuniversität Hagen den vom Oberlandeslandesgericht offen gelassenen Weg der Revision auch betreten will. Das müsste der Rektor der Fernuniversität alleine schon aus dem übergeordneten Interesse tun
http://www.inf.uni-konstanz.de/netethicsblog/?p=541
http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/976/OLG%20Stuttgart%20040412.pdf
Zu § 52a UrhG
http://archiv.twoday.net/search?q=52a+urhg
RA Thomas Stadlers Stellungnahme:
http://www.internet-law.de/2012/04/das-urheberrecht-behindert-unterricht-und-bildung.html
Aus Rainer Kuhlens Stellungnahme:
a) Weltfremde Richter. In einem Rechtsstaat kann man Gerichtsurteile nicht einfach ignorieren. Also dem Rektor der Fernuniversität Hagen zu empfehlen, doch mal 6 Monate ins Gefängnis zu gehen, weil er sich dem Urteilen des Gerichts nicht anschließen mag, wäre wohl nicht angebracht. (warum eigentlich nicht – das wäre doch mal was; er wird deshalb wohl nicht gleich seinen Beamtenstatus verlieren) Aber man wird durchaus feststellen können, dass Richter wie die in Stuttgart in einer Welt des Umgangs mit Wissen und Information leben, die nichts mit der Realität des Forschens und des Lehrens und Lernens in elektronischen Umgebungen zu tun hat.
b) Selbstreferenzielle, sich verstrickende Juristen. Sind jemals in solche Verfahren Gutachten und Stellungnahmen eingegangen, die die Sicht von Bildung und Wissenschaft vertreten? Vermutlich nicht. Juristen sind i.d.R. selbstreferenziell und schließen Information aus der Welt außerhalb des juristischen Horizonts aus. Ist nicht Recht auch eine Sozial- und Politikwissenschaft? In solchen sich selbst verstrickenden Zirkeln entstehen zwar weiter rechtlich richtige Urteile, aber kaum gerechte.
c) Ziviler Ungehorsam. Also wird man Wege finden müssen, diese Urteile zu ignorieren. Wie weit dabei der individuelle zivile Ungehorsam gehen kann, muss jeder für sich entscheiden. Auf jeden Fall werden die findigen Studierenden Wege finden, wie Entscheidungen der Gerichte umgangen werden können, die auch technisch unsinnig sind. Elektronische Information lässt sich nicht einsperren.
d) Bisherige Publikationsmodelle auf den Müllhaufen. In Richtung Open Access. Ignoriert werden diese unsinnigen ungerechten Urteile am besten dadurch, dass man die bislang zugrundeliegenden verfahrensmäßigen Praktiken des Publizierens endlich auf den Müllhaufen der Geschichte wirft. Sollen die Gerichte und Verlage nur so weitermachen. Dann werden schließlich auch bald die Letzten davon überzeugt sein, dass in Bildung und Wissenschaft nur noch Open-Access-Publikationsmodelle Akzeptanz finden werden. Vae victoribus!
e) Eine letzte Warnung an die Verlage. Nicht wehe, den Besiegten, sondern wehe den Siegern! Sollen doch ruhig im Börsenverein die Sektkorken knallen ob ihres temporären Sieges. Die AutorInnen werden ihnen bald ausbleiben, wenn unter Federführung des Börsenvereins weiter wissenschaftsfeindliche Politik betrieben wird und selbst das mit öffentlichen Geldern finanzierte Wissen dem Primat der kommerziellen Verwertung unterworfen werden soll. Das Urteil sollte eher als letzte Warnung an die Verlage verstanden werden, sich auf den Weg zu offenen freien Nutzungsmodellen zu machen. Sonst brauchen wir Verlage nicht mehr.
f) Es muss jetzt von Seiten der Politik gehandelt werden. Nach diesem Urteil sollte auch die Letzten im Bundesjustizministerium – die Letzte ist in diesem Fall die Ministerin selber – überzeugt sein, dass Schluss mit den komplizierten, widersprüchlichen und gänzlich untauglichen Schrankenregelungen (52 ist ja nur ein Beispiel von vielen) sein muss. Es muss jetzt gehandelt werden. Wenn nicht, wird man dafür sorgen müssen und damit auch Erfolg haben, eine breitere Öffentlichkeit zum Aufstand gegen die träge Politik zu bringen, um endlich den elektronischen Räumen angemessene Regulierungen oder besser: Freiräume zu verschaffen. Es wird nicht schwer werden, neben Grünen und Linken vor allem auch die Piratenpartei dafür zu gewinnen.
g) Streichen von § 52a ja, aber nicht ersatzlos. In Richtung einer Wissenschaftsklausel. Natürlich kann selbst der nicht gute §52a nicht ersatzlos gestrichen werden, wie es der Börsenverein fordert. Streichen schon, aber nicht ersatzlos. Entweder macht sich der Gesetzgeber endlich daran, allgemein im deutschen Urheberrecht so etwas wie das angelsächsische „fair use“ einzuführen. Oder er setzt das um, was seit Jahren das Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft, die Allianz der Wissenschaftsorganisationen und die Kultusministerkonferenz fordern, nämlich die Einführung einer allgemeinen Bildungs- und Wissenschaftsklausel. Darin muss eigentlich nur geregelt werden, was auch im Vorschlag der European Copyright Codes der Wittem Gruppe vorgeschlagen wird, nämlich die genehmigungsfreie Nutzung publizierter Objekte für Zwecke von Bildung und Wissenschaft. Punkt! Unkonditioniert.
h) Müssen Bildungseinrichtungen sich auf kommerzielles Referenzmaterial verlassen? Müssen Einrichtungen wie die Fernuniversität Hagen (aber auch alle anderen Bildungseinrichtungen) solche Werke wie das Psychologiehandbuch, um das gestritten wurde, überhaupt als Referenzmaterial verwenden? Lehrbriefe sollten die Dozenten selber schreiben können, und in ihnen können sie freien Gebrauch nach dem in § 51 UrhG garantierten Zitatrecht machen. Fast unbegrenzt im Umfang, wenn es durch den Zweck der Briefe gerechtfertigt ist. Zusätzlich könnten Hintergrundinformationen zur „Veranschaulichung“ frei aus dem Netz heruntergeladen werden, z.B. zu Sokrates, Herbart, Dilthey, James oder Wygotski aus der deutschen oder englischen Wikipedia. Artikel zu diesen vier „Pionieren“ der Psychologie waren ja unter den im Verfahren monierten. Oder eine Referenz zum Wikibook: Geschichte von Psychologie und Psychiatrie – neben vielen anderen frei zugänglichen.
i) Nur Mut zur informationellen Autonomie der AutorInnen. Welches die Motive der AutorInnen waren, ihre Verwertungsrechte als Nutzungsrechte exklusiv an den Verlag abzugeben, so dass es überhaupt zu solchen Klagen hat kommen können, kann hier nicht geklärt werden. Zu fragen wäre zumindest bei dem Hauptautor, immerhin sehr gut bezahlter Professor an der Universität Bern, warum er nicht zumindest auf eine parallele, freie Zweitveröffentlichung bestanden hat. Auf das Geld kann es ihm sicher nicht angekommen sein. Nur Mut, Herr Kollege.
j) Steilvorlage für den Bundesgerichtshof. Das Urteil ist eine Steilvorlage für den Bundesgerichtshof – natürlich nur, wenn die Beklagte, die Fernuniversität Hagen den vom Oberlandeslandesgericht offen gelassenen Weg der Revision auch betreten will. Das müsste der Rektor der Fernuniversität alleine schon aus dem übergeordneten Interesse tun
http://www.inf.uni-konstanz.de/netethicsblog/?p=541
KlausGraf - am Sonntag, 15. April 2012, 22:52 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein instruktiver Artikel dazu:
http://www.kreuz.net/article.3453.html [wenn es den Text auf Deutsch auch anderswo gibt, verzichte ich gern auf die Verlinkung von kreuz.net, laut Wikipedia ein "Blog mit religions- und kirchenbezogenen Texten sowie rechtsextremen, antisemitischen und homosexuellenfeindlichen Inhalten"]
englische Fassung:
http://www.draeconin.com/database/witchhunt.htm
Norman Cohn (Europe's Inner Demons, erstmals 1975) zeigte nicht nur, dass Lamothe-Langon gefälscht hat, er erwies auch ein Gutachten von Bartolo de Sassoferrata zu einem angeblichen Hexenprozess ca. 1340 in Novara als spätere Fälschung.
http://books.google.de/books?id=3mK_SJSZTooC (Auszüge aus Kieckhefers Buch, der unabhängig von Cohn Lamothe-Langon als Fälscher verdächtigte)
Fälschungen in Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/96987511/
http://www.kreuz.net/article.3453.html [wenn es den Text auf Deutsch auch anderswo gibt, verzichte ich gern auf die Verlinkung von kreuz.net, laut Wikipedia ein "Blog mit religions- und kirchenbezogenen Texten sowie rechtsextremen, antisemitischen und homosexuellenfeindlichen Inhalten"]
englische Fassung:
http://www.draeconin.com/database/witchhunt.htm
Norman Cohn (Europe's Inner Demons, erstmals 1975) zeigte nicht nur, dass Lamothe-Langon gefälscht hat, er erwies auch ein Gutachten von Bartolo de Sassoferrata zu einem angeblichen Hexenprozess ca. 1340 in Novara als spätere Fälschung.
http://books.google.de/books?id=3mK_SJSZTooC (Auszüge aus Kieckhefers Buch, der unabhängig von Cohn Lamothe-Langon als Fälscher verdächtigte)
Fälschungen in Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/96987511/
KlausGraf - am Sonntag, 15. April 2012, 22:26 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
"Die Stuttgarter Stadt-Glocke verbreitete Fortsetzungsgeschichten historischen und vaterländischen Inhalts, angekündigt als Sagen oder Erzählungen, die mündlich oder schriftlich von früheren Generationen überliefert worden seien. Tatsächlich waren die Texte jedoch frei erfunden, was der Leserschaft indes offenbar nicht immer klar war: Der fiktive Held der ersten Serie war Anton Webercus, ein angeblich mehr als hundertjähriger Mann, der in Tagebuchform die Sittengeschichte des 18. Jahrhunderts niedergeschrieben haben sollte. Webercus, der angeblich am 1. April beim Abzählen von 500 Wäscheklammern gestorben war, fand Eingang in die Allgemeine Deutsche Biographie"
http://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgarter_Stadt-Glocke
Zu Webercus siehe auch
http://de.wikisource.org/wiki/BLK%C3%96:Webercus,_Anton
Die derzeit maßgebliche Darstellung zu Munders angeblichen "Sagen" habe ich 1995 in "Sagen rund um Stuttgart" vorgelegt:
http://books.google.de/books?id=DCbaAAAAMAAJ&pg=PA56
Ich vermute dort, dass die Geschichten doch auf den Stuttgarter Buchdrucker Johann Gottfried Munder zurückgehen, nicht, wie zuvor angenommen, auf seinen Bruder, den Pfarrer.
Wie man Munders Phantasien in Schwäbisch Gmünd als authentische Überlieferungen auffasste (Georg Stütz, Alois Marquart, Hildegard Meschenmoser) zeigte ich im einhorn-Jahrbuch 1998:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/enzing.htm
Siehe auch
http://de.wikisource.org/wiki/Untergang_der_Enzinger
Württemberg wie es war und ist 1 (1854):
http://books.google.de/books?id=2ak7AAAAcAAJ
2 (1854)
http://books.google.de/books?id=Fqo7AAAAcAAJ
3 (1854)
http://books.google.de/books?id=G7G2jSxxPPwC
4 (1855)
http://books.google.de/books?id=ev-DtvGkLpUC
Siehe auch
http://catalog.hathitrust.org/Record/000300416
Zu Fälschungen in Archivalia
http://archiv.twoday.net/stories/96987511/
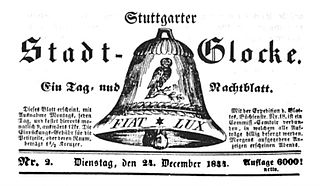
http://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgarter_Stadt-Glocke
Zu Webercus siehe auch
http://de.wikisource.org/wiki/BLK%C3%96:Webercus,_Anton
Die derzeit maßgebliche Darstellung zu Munders angeblichen "Sagen" habe ich 1995 in "Sagen rund um Stuttgart" vorgelegt:
http://books.google.de/books?id=DCbaAAAAMAAJ&pg=PA56
Ich vermute dort, dass die Geschichten doch auf den Stuttgarter Buchdrucker Johann Gottfried Munder zurückgehen, nicht, wie zuvor angenommen, auf seinen Bruder, den Pfarrer.
Wie man Munders Phantasien in Schwäbisch Gmünd als authentische Überlieferungen auffasste (Georg Stütz, Alois Marquart, Hildegard Meschenmoser) zeigte ich im einhorn-Jahrbuch 1998:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/enzing.htm
Siehe auch
http://de.wikisource.org/wiki/Untergang_der_Enzinger
Württemberg wie es war und ist 1 (1854):
http://books.google.de/books?id=2ak7AAAAcAAJ
2 (1854)
http://books.google.de/books?id=Fqo7AAAAcAAJ
3 (1854)
http://books.google.de/books?id=G7G2jSxxPPwC
4 (1855)
http://books.google.de/books?id=ev-DtvGkLpUC
Siehe auch
http://catalog.hathitrust.org/Record/000300416
Zu Fälschungen in Archivalia
http://archiv.twoday.net/stories/96987511/
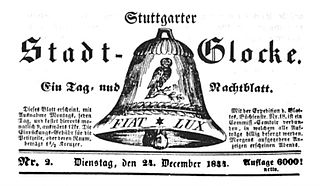
KlausGraf - am Sonntag, 15. April 2012, 20:53 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 15. April 2012, 19:08 - Rubrik: Allgemeines
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
The National Library of Ireland has made available for the first time James Joyce's manuscripts for free to the public via the Library's online catalogue. The online publication coincides with a book set publication of the same manuscripts that are being sold for hundreds of Euro. The Irish Times reports on the publication of Joyce's collection, and the factors that have played into the Library's early announcement of the project. The decision to announce the online version of the Joyce manuscripts was made after a Joycean scholar published the material in editions priced at up to €250. Joycean scholar Danis Rose has published Joyce's material ranging in prices from €75 and €250, or up to €800 for an entire set. Rose has claimed he is now the copyright holder in the EU of these manuscripts according to The Irish Times
http://xrefer.blogspot.de/2012/04/irelands-national-library-publish-james.html
http://www.irishcentral.com/ent/Irelands-National-Library-publish-James-Joyce-manuscripts-online-amid-copyright-dispute-147430065.html
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2012/0412/1224314641103.html
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2012/0412/1224314641130.html
http://houseofbreathings.com/
http://www.gaelnet.de/2012/04/12/joyce-manuskripte-offentlich-im-internet/
Digitalisate: http://catalogue.nli.ie/ (Joyce eingeben und digitised content wählen)
http://catalogue.nli.ie/Record/vtls000194606
Dieser schäbige Editor Rose, der sich gegen die Online-Veröffentlichung wendet, beruft sich auf ein Stück Murks-EU-Urheberrecht.
Den deutschen Murks bespreche ich in meiner "Urheberrechtsfibel", die jeder besitzen sollte, der sich für das deutsche Urheberrecht interessiert:
http://www.amazon.de/Urheberrechtsfibel-deutschen-Urheberrechtsgesetzes-kritisch-kommentiert/dp/3861990024/
http://archiv.twoday.net/search?q=urheberrechtsfibel
Auszug:
§ 71 Nachgelassene Werke
(1) Wer ein nicht erschienenes Werk nach Erlöschen des Urheberrechts
erlaubterweise erstmals erscheinen läßt oder erstmals öffentlich wiedergibt,
hat das ausschließliche Recht, das Werk zu verwerten. Das gleiche gilt für
nicht erschienene Werke, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes niemals
geschützt waren, deren Urheber aber schon länger als siebzig Jahre tot ist.
Die §§ 5 und 10 Abs. 1 sowie die §§ 15 bis 24, 26, 27, 44a bis 63 und 88
sind sinngemäß anzuwenden.
(2) Das Recht ist übertragbar.
(3) Das Recht erlischt fünfundzwanzig Jahre nach dem Erscheinen des
Werkes oder, wenn seine erste öffentliche Wiedergabe früher erfolgt ist,
nach dieser. Die Frist ist nach § 69 zu berechnen.
Nach Ansicht des Landgerichts Magdeburg (Urteil vom 16. Oktober 2003, Az.: 7 O 847/03) ist die berühmte vorgeschichtliche „Himmelsscheibe von Nebra“ ein nachgelassenes Werk im Sinn von § 71. Das Land Sachsen-Anhalt habe im Rahmen einer Pressekonferenz am 25. September 2002 ihr Erscheinen erwirkt und sei dadurch für 25 Jahre Inhaber des Schutzrechtes geworden.
Das seit 1995 auch europaweit geltende Recht der „Editio princeps“
entzieht ein Werk der Gemeinfreiheit, wenn es erstmals erscheint oder öffentlich wiedergegeben wird. Die Magdeburger Entscheidung ist in mehrfacher Hinsicht verfehlt. Sie muss die modernen Begriffe „Werk“ und „Erscheinen“ in vorgeschichtliche Zeit zurückprojizieren. Entgegen der Ansicht des Gerichts spricht vieles dafür, dass die Himmelsscheibe in vorgeschichtlicher Zeit erschienen ist, indem sie als Kultobjekt bei öffentlichen Zeremonien Verwendung fand. Obwohl die Vorschrift den Finder des erstmals veröffentlichten Kulturguts belohnen soll, sprachen die Richter das Schutzrecht dem Eigentümer zu.
Am 22. Januar 2009 entschieden die Richter des Bundesgerichtshofs
einen Rechtsstreit um die Vivaldi-Oper Motezuma (Az.: I ZR 19/07). Da Vivaldi aller Wahrscheinlichkeit einer venezianischen Praxis gefolgt ist, wonach Opernpartituren zum Kopieren für Interessenten bereitstanden, war die Oper nach Ansicht der Karlsruher Richter bereits im 18. Jahrhundert erschienen. Allgemein stellten sie zum Kriterium des Erscheinens fest: „Derjenige, der einen auf das ausschließliche Verwertungsrecht des Herausgebers der Erstausgabe eines Werkes nach § 71 UrhG gestützten Anspruch geltend macht, trägt grundsätzlich die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass das Werk im Sinne dieser Bestimmung ‚nicht erschienen‘ ist. Er kann sich allerdings zunächst auf die Behauptung beschränken, das Werk sei bislang nicht erschienen. Es ist dann Sache der Gegenseite, die Umstände darzulegen, die dafür sprechen, dass das Werk doch schon erschienen ist.“ Es ist fraglich, ob mit den vom BGH aufgestellten Grundsätzen das Magdeburger Urteil noch
vereinbar ist.
Wenn ich recht sehe, haben sich die Kommentatoren über eine praktisch durchaus bedeutsame Frage noch keine Gedanken gemacht. Was ist, wenn zunächst nur eine Teiledition eines Werks erscheint? Wenn ein Editor etwa die Hälfte von unveröffentlichten Lebenserinnerungen aus dem 19. Jahrhundert erscheinen lässt, blockiert er damit auch das Erscheinen des Restes? Oder kann ein anderer Herausgeber den Rest erscheinen lassen? Dieser Zweitherausgeber wäre aber daran gehindert, die in der Erstedition erschienene Hälfte ohne Zustimmung des Ersteditors erneut abzudrucken. Aus wissenschaftlicher Sicht und aus der Perspektive der am Werk Interessierten, wäre eine solche Aufteilung der
Rechte abwegig. Ein ähnliches Problem stellt sich bei verschiedenen
Fassungen eines Werkes: Kann, wer eine Fassung ediert, die Veröffentlichung einer anderen, ebenfalls bislang unveröffentlichten Fassung verhindern?
Das durch § 71 gewährte, sehr weitgehende Ausschließlichkeitsrecht
bedeutet, dass die Wissenschaft es für 25 Jahre akzeptieren muss, dass eine hundsmiserable Erstausgabe den Markt beherrscht. Wer eine verbesserte Neuausgabe erscheinen lassen will, braucht zwingend die Erlaubnis des Erstherausgebers, und dieser unterliegt in keinerlei Hinsicht einem Zwang zum Vertragsabschluss. Mit der Forschungsfreiheit des Artikels 5 Grundgesetz ist eine solche Konstellation meines Erachtens nicht zu vereinbaren!
Die Vorschrift ist erlassen worden, ohne sich Gedanken darüber zu
machen, ob Texteditoren sie überhaupt brauchen. Angesichts der Tatsache, dass viele Staaten keine vergleichbare Norm kennen, ohne dass man sagen könnte, dass sie editionswissenschaftlich unterentwickelt wären, kann das Anreiz-Argument zurückgewiesen werden. Wissenschaftler und Publizisten veröffentlichen nachgelassene Werke, weil sie sie interessant finden oder mit der Erstedition so etwas wie einen „Scoop“ landen wollen, aber nicht, weil es eine – ihnen meist ohnehin unbekannte – Vorschrift gibt, die andere für 25 Jahre von einer Zweitedition ausschließt.
Wenn § 71 im Musikbereich tatsächlich unverzichtbar sein sollte,
hätte man ihn ja darauf beschränken können. Und wie meine Beispiele zeigen, entgehen den Kommentatoren die praktischen Probleme, weil sie am Schreibtisch über editorische Sachverhalte schreiben, von denen sie nicht die geringste Ahnung haben.
Wenn § 70 schädlich ist, ist es § 71 erst recht. Die Bestimmung schädigt die Public Domain in massiver Weise, gängelt unzumutbar die Editionswissenschaft und wirft insbesondere erhebliche Beweisprobleme hinsichtlich des Nachweises des Nichterschienenseins auf. Grund genug, die ersatzlose Streichung zu fordern.
Zu § 71 UrhG in Archivalia
http://archiv.twoday.net/search?q=editio+princeps

http://xrefer.blogspot.de/2012/04/irelands-national-library-publish-james.html
http://www.irishcentral.com/ent/Irelands-National-Library-publish-James-Joyce-manuscripts-online-amid-copyright-dispute-147430065.html
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2012/0412/1224314641103.html
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2012/0412/1224314641130.html
http://houseofbreathings.com/
http://www.gaelnet.de/2012/04/12/joyce-manuskripte-offentlich-im-internet/
Digitalisate: http://catalogue.nli.ie/ (Joyce eingeben und digitised content wählen)
http://catalogue.nli.ie/Record/vtls000194606
Dieser schäbige Editor Rose, der sich gegen die Online-Veröffentlichung wendet, beruft sich auf ein Stück Murks-EU-Urheberrecht.
Den deutschen Murks bespreche ich in meiner "Urheberrechtsfibel", die jeder besitzen sollte, der sich für das deutsche Urheberrecht interessiert:
http://www.amazon.de/Urheberrechtsfibel-deutschen-Urheberrechtsgesetzes-kritisch-kommentiert/dp/3861990024/
http://archiv.twoday.net/search?q=urheberrechtsfibel
Auszug:
§ 71 Nachgelassene Werke
(1) Wer ein nicht erschienenes Werk nach Erlöschen des Urheberrechts
erlaubterweise erstmals erscheinen läßt oder erstmals öffentlich wiedergibt,
hat das ausschließliche Recht, das Werk zu verwerten. Das gleiche gilt für
nicht erschienene Werke, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes niemals
geschützt waren, deren Urheber aber schon länger als siebzig Jahre tot ist.
Die §§ 5 und 10 Abs. 1 sowie die §§ 15 bis 24, 26, 27, 44a bis 63 und 88
sind sinngemäß anzuwenden.
(2) Das Recht ist übertragbar.
(3) Das Recht erlischt fünfundzwanzig Jahre nach dem Erscheinen des
Werkes oder, wenn seine erste öffentliche Wiedergabe früher erfolgt ist,
nach dieser. Die Frist ist nach § 69 zu berechnen.
Nach Ansicht des Landgerichts Magdeburg (Urteil vom 16. Oktober 2003, Az.: 7 O 847/03) ist die berühmte vorgeschichtliche „Himmelsscheibe von Nebra“ ein nachgelassenes Werk im Sinn von § 71. Das Land Sachsen-Anhalt habe im Rahmen einer Pressekonferenz am 25. September 2002 ihr Erscheinen erwirkt und sei dadurch für 25 Jahre Inhaber des Schutzrechtes geworden.
Das seit 1995 auch europaweit geltende Recht der „Editio princeps“
entzieht ein Werk der Gemeinfreiheit, wenn es erstmals erscheint oder öffentlich wiedergegeben wird. Die Magdeburger Entscheidung ist in mehrfacher Hinsicht verfehlt. Sie muss die modernen Begriffe „Werk“ und „Erscheinen“ in vorgeschichtliche Zeit zurückprojizieren. Entgegen der Ansicht des Gerichts spricht vieles dafür, dass die Himmelsscheibe in vorgeschichtlicher Zeit erschienen ist, indem sie als Kultobjekt bei öffentlichen Zeremonien Verwendung fand. Obwohl die Vorschrift den Finder des erstmals veröffentlichten Kulturguts belohnen soll, sprachen die Richter das Schutzrecht dem Eigentümer zu.
Am 22. Januar 2009 entschieden die Richter des Bundesgerichtshofs
einen Rechtsstreit um die Vivaldi-Oper Motezuma (Az.: I ZR 19/07). Da Vivaldi aller Wahrscheinlichkeit einer venezianischen Praxis gefolgt ist, wonach Opernpartituren zum Kopieren für Interessenten bereitstanden, war die Oper nach Ansicht der Karlsruher Richter bereits im 18. Jahrhundert erschienen. Allgemein stellten sie zum Kriterium des Erscheinens fest: „Derjenige, der einen auf das ausschließliche Verwertungsrecht des Herausgebers der Erstausgabe eines Werkes nach § 71 UrhG gestützten Anspruch geltend macht, trägt grundsätzlich die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass das Werk im Sinne dieser Bestimmung ‚nicht erschienen‘ ist. Er kann sich allerdings zunächst auf die Behauptung beschränken, das Werk sei bislang nicht erschienen. Es ist dann Sache der Gegenseite, die Umstände darzulegen, die dafür sprechen, dass das Werk doch schon erschienen ist.“ Es ist fraglich, ob mit den vom BGH aufgestellten Grundsätzen das Magdeburger Urteil noch
vereinbar ist.
Wenn ich recht sehe, haben sich die Kommentatoren über eine praktisch durchaus bedeutsame Frage noch keine Gedanken gemacht. Was ist, wenn zunächst nur eine Teiledition eines Werks erscheint? Wenn ein Editor etwa die Hälfte von unveröffentlichten Lebenserinnerungen aus dem 19. Jahrhundert erscheinen lässt, blockiert er damit auch das Erscheinen des Restes? Oder kann ein anderer Herausgeber den Rest erscheinen lassen? Dieser Zweitherausgeber wäre aber daran gehindert, die in der Erstedition erschienene Hälfte ohne Zustimmung des Ersteditors erneut abzudrucken. Aus wissenschaftlicher Sicht und aus der Perspektive der am Werk Interessierten, wäre eine solche Aufteilung der
Rechte abwegig. Ein ähnliches Problem stellt sich bei verschiedenen
Fassungen eines Werkes: Kann, wer eine Fassung ediert, die Veröffentlichung einer anderen, ebenfalls bislang unveröffentlichten Fassung verhindern?
Das durch § 71 gewährte, sehr weitgehende Ausschließlichkeitsrecht
bedeutet, dass die Wissenschaft es für 25 Jahre akzeptieren muss, dass eine hundsmiserable Erstausgabe den Markt beherrscht. Wer eine verbesserte Neuausgabe erscheinen lassen will, braucht zwingend die Erlaubnis des Erstherausgebers, und dieser unterliegt in keinerlei Hinsicht einem Zwang zum Vertragsabschluss. Mit der Forschungsfreiheit des Artikels 5 Grundgesetz ist eine solche Konstellation meines Erachtens nicht zu vereinbaren!
Die Vorschrift ist erlassen worden, ohne sich Gedanken darüber zu
machen, ob Texteditoren sie überhaupt brauchen. Angesichts der Tatsache, dass viele Staaten keine vergleichbare Norm kennen, ohne dass man sagen könnte, dass sie editionswissenschaftlich unterentwickelt wären, kann das Anreiz-Argument zurückgewiesen werden. Wissenschaftler und Publizisten veröffentlichen nachgelassene Werke, weil sie sie interessant finden oder mit der Erstedition so etwas wie einen „Scoop“ landen wollen, aber nicht, weil es eine – ihnen meist ohnehin unbekannte – Vorschrift gibt, die andere für 25 Jahre von einer Zweitedition ausschließt.
Wenn § 71 im Musikbereich tatsächlich unverzichtbar sein sollte,
hätte man ihn ja darauf beschränken können. Und wie meine Beispiele zeigen, entgehen den Kommentatoren die praktischen Probleme, weil sie am Schreibtisch über editorische Sachverhalte schreiben, von denen sie nicht die geringste Ahnung haben.
Wenn § 70 schädlich ist, ist es § 71 erst recht. Die Bestimmung schädigt die Public Domain in massiver Weise, gängelt unzumutbar die Editionswissenschaft und wirft insbesondere erhebliche Beweisprobleme hinsichtlich des Nachweises des Nichterschienenseins auf. Grund genug, die ersatzlose Streichung zu fordern.
Zu § 71 UrhG in Archivalia
http://archiv.twoday.net/search?q=editio+princeps

KlausGraf - am Sonntag, 15. April 2012, 18:22 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Auch deutschsprachige, die einzelnen Jahrgänge sind (wie bei Wikisource) verlinkt:
http://www.arlima.net/periodiques_en_ligne.html
http://www.arlima.net/periodiques_en_ligne.html
KlausGraf - am Sonntag, 15. April 2012, 17:55 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heilig-rock-wallfahrt.de
Zum heiligen Rock
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Rock
Digitalisate:
http://de.wikisource.org/wiki/Heiliger_Rock
Video-Überwachung:
http://www.datenschutz.rlp.de/de/presseartikel.php?pm=pm2012041201
Heiliger Rock und "Orendel" in Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/6488352/


Zum heiligen Rock
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Rock
Digitalisate:
http://de.wikisource.org/wiki/Heiliger_Rock
Video-Überwachung:
http://www.datenschutz.rlp.de/de/presseartikel.php?pm=pm2012041201
Heiliger Rock und "Orendel" in Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/6488352/


KlausGraf - am Sonntag, 15. April 2012, 17:28 - Rubrik: Landesgeschichte
http://www.doabooks.org/
Bislang nur "756 Academic peer-reviewed books from 23 publishers", aber nicht alle explizit unter einer freien Lizenz. Eine Filtermöglichkeit nach Lizenz existiert nicht, aber anscheinend sind fast alle Bücher mit Lizenz nicht BBB-konform (CC-BY, CC-BY-SA), also Open Access gemäß der gültigen Definition.
Vor einiger Zeit habe ich mal eine Linksammlung zu Open-Access-Büchern begonnen, die aber seit längerem stagniert:
http://www.diigo.com/user/klausgraf/oa_monograph
Was DOAB erschließt, ist nur ein winziger Bruchteil des weltweit vorhandenen Bestandes.
Siehe auch
http://log.netbib.de/archives/2012/04/14/academic-open-access-books/
Bislang nur "756 Academic peer-reviewed books from 23 publishers", aber nicht alle explizit unter einer freien Lizenz. Eine Filtermöglichkeit nach Lizenz existiert nicht, aber anscheinend sind fast alle Bücher mit Lizenz nicht BBB-konform (CC-BY, CC-BY-SA), also Open Access gemäß der gültigen Definition.
Vor einiger Zeit habe ich mal eine Linksammlung zu Open-Access-Büchern begonnen, die aber seit längerem stagniert:
http://www.diigo.com/user/klausgraf/oa_monograph
Was DOAB erschließt, ist nur ein winziger Bruchteil des weltweit vorhandenen Bestandes.
Siehe auch
http://log.netbib.de/archives/2012/04/14/academic-open-access-books/
KlausGraf - am Sonntag, 15. April 2012, 16:26 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2012/04/the-taymouth-hours.html teilt mit, dass die kostbare Handschrift aus dem 14. Jahrhundert im Katalog der illuminierten Handschriften der British Library komplett digitalisiert einsehbar ist:
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=8148&CollID=58&NStart=13

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=8148&CollID=58&NStart=13

KlausGraf - am Sonntag, 15. April 2012, 16:20 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/kunst_architektur/grosse-bohrung--kleine-hoffnung_1.16391952.html
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/75231519/
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/75231519/
KlausGraf - am Sonntag, 15. April 2012, 15:53 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,824004,00.html
Gekürzt aus National Geographic übersetzt.
Gekürzt aus National Geographic übersetzt.
KlausGraf - am Sonntag, 15. April 2012, 15:47 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.hls-dhs-dss.ch/famn/?lg=d
Das "Familiennamenbuch der Schweiz" ist ein unentbehrliches Handbuch für Familienforscher und Historiker. Das Familiennamenbuch verzeichnet alphabetisch alle Familien, die 1962 in einer schweizerischen Gemeinde das Bürgerrecht besassen. Zu den einzelnen Familien werden folgende Informationen aufgelistet: der jeweilige Bürgerort und der Zeitpunkt des Bürgerrechtserwerbs sowie Herkunftsort oder Herkunftsstaat. Auf dieser Homepage werden die rund 48'500 Familiennamen der vergriffenen Buchausgabe über übersichtliche Suchfunktionen erschlossenen und im Internet frei zugänglich gemacht.
Die Online-Datenbank beinhaltet die unveränderte dritte Auflage des "Familiennamenbuchs der Schweiz" (Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1989). Die dabei geschaffene Datenbank wurde 1990 durch die Stiftung Historisches Lexikon der Schweiz (HLS) von der "Arbeitsgemeinschaft Schweizer Familiennamen" erworben.
Das "Familiennamenbuch der Schweiz" ist ein unentbehrliches Handbuch für Familienforscher und Historiker. Das Familiennamenbuch verzeichnet alphabetisch alle Familien, die 1962 in einer schweizerischen Gemeinde das Bürgerrecht besassen. Zu den einzelnen Familien werden folgende Informationen aufgelistet: der jeweilige Bürgerort und der Zeitpunkt des Bürgerrechtserwerbs sowie Herkunftsort oder Herkunftsstaat. Auf dieser Homepage werden die rund 48'500 Familiennamen der vergriffenen Buchausgabe über übersichtliche Suchfunktionen erschlossenen und im Internet frei zugänglich gemacht.
Die Online-Datenbank beinhaltet die unveränderte dritte Auflage des "Familiennamenbuchs der Schweiz" (Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1989). Die dabei geschaffene Datenbank wurde 1990 durch die Stiftung Historisches Lexikon der Schweiz (HLS) von der "Arbeitsgemeinschaft Schweizer Familiennamen" erworben.
KlausGraf - am Sonntag, 15. April 2012, 15:40 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"ÖNB und Austria Presse Agentur weiten seit 2008 bestehende Kooperation aus
Wien - Die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) und die APA - Austria Presse Agentur haben eine Kooperation zur systematischen Sammlung und Archivierung historischer und gegenwärtiger Pressefotografie in Österreich geschlossen. Dabei sollen auch aktuelle Pressefotos der APA über das Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Bereits seit 2008 kooperieren die beiden Institutionen, indem das Bildarchiv der ÖNB bei APA-PictureDesk abrufbar ist."
http://derstandard.at/1334132392366/Sammlung-Nationalbibliothek-archiviert-aktuelle-Pressefotos-der-APA
Wien - Die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) und die APA - Austria Presse Agentur haben eine Kooperation zur systematischen Sammlung und Archivierung historischer und gegenwärtiger Pressefotografie in Österreich geschlossen. Dabei sollen auch aktuelle Pressefotos der APA über das Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Bereits seit 2008 kooperieren die beiden Institutionen, indem das Bildarchiv der ÖNB bei APA-PictureDesk abrufbar ist."
http://derstandard.at/1334132392366/Sammlung-Nationalbibliothek-archiviert-aktuelle-Pressefotos-der-APA
Archivar123 - am Samstag, 14. April 2012, 16:00 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Fraunhofer IAO vergleicht unterschiedliche Ansätze zur Langzeitarchivierung digitaler Objekte
Im Rahmen des Projekts »LADO – Langzeitarchivierung Digitaler Objekte« hat das Fraunhofer IAO anhand einer Marktstudie unterschiedliche Ansätze der Langzeitarchivierung miteinander verglichen und auf Basis eines international akzeptierten Modells in Werkzeugklassen eingeordnet."
http://www.iao.fraunhofer.de/geschaeftsfelder/informations-und-kommunikationstechnik/925.html?lang=de
Die Studie wurde offensichtlich im April veröffentlicht, muss aber leider über ein Formular angefordert werden und kann nicht direkt heruntergeladen werden:
http://www.swm.iao.fraunhofer.de/Publikationen/lza2012.jsp
Im Rahmen des Projekts »LADO – Langzeitarchivierung Digitaler Objekte« hat das Fraunhofer IAO anhand einer Marktstudie unterschiedliche Ansätze der Langzeitarchivierung miteinander verglichen und auf Basis eines international akzeptierten Modells in Werkzeugklassen eingeordnet."
http://www.iao.fraunhofer.de/geschaeftsfelder/informations-und-kommunikationstechnik/925.html?lang=de
Die Studie wurde offensichtlich im April veröffentlicht, muss aber leider über ein Formular angefordert werden und kann nicht direkt heruntergeladen werden:
http://www.swm.iao.fraunhofer.de/Publikationen/lza2012.jsp
Archivar123 - am Samstag, 14. April 2012, 15:47 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wieder einmal ein Update. Diesmal mit Adressbüchern und "Auswanderungsakten" aus Fürth. Für mehr Infos siehe folgenden Blogeintrag.
Sebastian Post - am Freitag, 13. April 2012, 22:30 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aufgrund breiterer Quellen- und Literaturkenntnis und aufgrund strikterer Beachtung der Herolds-Hierarchie möchte ich meine Hypothese, Jörg Rüxner (alias Rugen, Jerusalem, Brandenburg) sei mit dem 1495 in Worms auftretenden königlichen Persevanten Jörg Elässer identisch, zurückziehen.
Ich knüpfe an meine Argumentation und die Belege in
http://archiv.twoday.net/stories/11475805/
an.
Die Belege zu Rüxner finden sich unter
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7140/
Das Hierarchie-Argument:
http://archiv.twoday.net/stories/96991398/
Rüxner nennt sich bis 1505 stets Persevant, als Herold ("ernhalt") erscheint er erstmals in der 1505 entstandenen Beschreibung des Kölner Reichstags. Im autographen Wiener Cod. 2799 nennt er sich 1515 erstmals König der Wappen (und gradierter Ernhalt auf Brandenburg, was immer das ist).
Da der ehemalige königliche Persevant Jörg Elsässer von Maximilian am 8. Oktober 1495 ausdrücklich als Herold bezeichnet wird, kann er - der Heroldshierarchie zufolge - nicht mit dem erst 1505 zum Herold promovierten Rüxner identisch sein.
Schon auf dem Regensburger Reichstag 1471 begegnet ein Herold Elsas des Erzherzogs Sigmund von Tirol (RTA ältere Reihe Bd. 22,2, 1999, S. 541) bzw. "Jorgen Elsess herzog Sigmunds zu Osterreich herolt" (ebd., S. 947). Wäre das Rüxner, müsste er - 1526 letztmals sicher zu belegen - recht alt geworden sein. Aber es gibt Gründe, in diesem Jörg Elässer nicht den späteren Persevanten zu sehen.
Der Herold ist mit dieser Bezeichnung in zwei Quellen 1471 bezeugt, ein Irrtum scheidet zwar nicht ganz aus, ist aber eher unwahrscheinlich. Denn noch ein zweites Argument kommt zu Hilfe, wenn es darum geht, einen älteren Herold von einem jüngeren Persevanten zu trennen. Am 16. September 1486 (RTA mittlere Reihe Bd. 1, 1989, S. 662f. Nr. 656) empfiehlt Kaiser Friedrich III. den zur Besprechung verschiedener Angelegenheiten zu Sigmund gesandten kaiserlichen Persevanten Jörg Elsässer: Dieser habe sich um die Belange des Hauses Österreich bereits sehr verdient gemacht. Es ist nicht anzunehmen, dass Friedrich seinem Verwandten eine Person in dieser Weise ans Herz legte, die dem Adressaten bereits 15 Jahre zuvor als Herold gedient hatte. Beide Argumente lassen es als plausibel erscheinen, einen älteren und einen jüngeren Herold Elässer zu unterscheiden.
Eine recht absurde Vorstellung von "bekannt" kultivierte Gerhard Pietzsch, Archivalische Forschungen zur Geschichte der Musik an den Höfen der Grafen und Herzöge von Kleve-Jülich-Berg (Ravensberg) bis zum Erlöschen der Linie Jülich-Kleve im Jahre 1609 (1971), S. 62f. als er vom "bekannten" Herold Jorg Elsass sprach, der Erzherzog Sigmund, Kaiser Friedrich III. und König Maximilian gedient habe. Dass ihm aufgrund seiner intensiven Quellenstudien (etwa in den Augsburger Baumeisterbüchern, aber auch in unzähligen anderen Quellen) diese Person gut vertraut war, mag sein. Aber von einem "Forschungsstand" kann man ganz und gar nicht sprechen (Elässer fehlt z.B. in Heinigs Herolde-Aufsatz). Pietzsch gibt leider nur einen einzigen Beleg zu dem "bekannten" Elsässer, nämlich Staatsarchiv Nürnberg Rep. 54, Nr. 18, Bl. 237v zu 1479: "Jorgen Elsasser herolt". Das wäre also noch der ältere Elsässer. Ob er später noch bezeugt ist, wusste vielleicht Pietzsch - ich kann die mir bekannten jüngeren Belege nur auf den Persevanten beziehen, der als Herold erstmals 1495 erscheint (zugleich sein letzter Beleg).
Pietzsch zitiert einen Geleitbrief Herzog Wilhelms von Jülich-Berg vom Juli 1494 für "Jorghe Elsaisser, bewyser des brieffs, mancherley koenygen ind fuirstenhoue erfaren ind sich dermaissen daselffs gehalden hait dat he sulcher gunst erfolgen mocht wirdig geschatzt zo werden mit edem tytell ind namen wapen genoiss mit dem he wyder ind mere heymsoechonge ind erfaronge verdienen mocht hyralt zo werden". Elässer wolle viele Reiche sehen, um erfahrener wiederzukehren (HStA Düsseldorf Jülich-Berg I Nr. 69/30 = Bl. 30-31 nach Nijsten, Shadow of Burgundy, 2003, S. 178f. mit ionghe statt Jorghe). Natürlich konnte Pietzsch diese Person nicht mit dem älteren Herold gleichsetzen, weil ja ausdrücklich in der Quelle stand, dass er erst Herold werden wollte. Er dachte daher an einen Verwandten (Sohn?).
In Augsburg erscheint 1511 ein Herold Jörg des Herzogs von Jülich (Pietzsch S. 63). Ich halte es für viel zu hypothetisch, diesen mit dem Elsässer von 1494 gleichzusetzen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich 1511 um Rüxner gehandelt hat, der ja bei vielen Herren ein und aus ging. Die fragmentarische Überlieferung zu Heroldsnamen verleitet dazu, bei gleichen Vornamen oder Amtsnamen an eine Kontinuität im Sinne einer "Festanstellung" zu denken.
Könnte der Jülicher Jörg Elsässer von 1494 der königliche Persevant sein? Ein Jahr später wollte dieser als Herold in die weite Welt: "KM gibt seinem Herold Georgio Elsas Heraldo einen Empfehlungsbrief an alle Kge, Fsten, Hge, Gfen etc.: Georg Elsaß hat die Absicht, das Hl. Grab in Jerusalem zu besuchen und verschiedene Teile der Welt zu bereisen, um die Sitten der Höfe, deren tapfere Taten (fortia gesta), ihre Wappen und alles, was zu seinen Pflichten gehört, zu erkunden. Wormatie 8. Octobris 1495." Von einem Dienstverhältnis spricht die Jülicher Quelle anscheinend nicht, obwohl es für Pietzsch plausibel war, ihn als Jülicher Herold aufzufassen. Dass die sich ähnlichen Empfehlungsbriefe von 1494/95 sich auf zwei verschiedene Personen, die beide Jörg Elsässer hießen, beziehen, halte ich für eher unwahrscheinlich. Wenn man das trotzdem annehmen möchte und zugleich meiner Argumentation, dass es einen Herold Sigmunds Jörg Elsässer und einen davon verschiedenen Persevanten Jörg Elsässer gab, folgen, hätte man mit drei Personen des Namens zu rechnen!
Ich hatte ja argumentiert, dass der Persevant Jörg Rugen = Rüxner, der ja anscheinend Graf Eberhard im Bart auf dem Wormser Reichstag über die Reichsverfassung unterrichtete, mit dem Persevanten Elsässer identisch sein muss, wenn er in der Teilnehmerliste aufgeführt sein sollte (ausschließen wollte ich den Wind-Gesellschaftsknecht Jörg von Giengen, der wohl mit dem 1487 RTA mR Bd. 2, 2001, S. 661 auftretenden Jorg Aman, Wind-Gesellschaftsknecht identisch ist). Wenn Rüxner und Elsässer aber verschiedene Personen sind, was ich jetzt annehmen möchte, wird man zu folgern haben, dass entweder Rugen in der Teilnehmerliste vergessen wurde (etwa weil er nur zeitweilig anwesend war) oder dass er gar nicht anwesend war. Rüxner könnte ja beispielsweise aus Heidelberg eine schriftliche Äußerung an Eberhard gesandt haben.
Aber bei solchen Bastelarbeiten sollte man immer im Auge behalten, dass angesichts der schlechten Quellenlage bzw. der schlechten Erschließung der allzu verstreuten Quellen jede neue Quelle die bisherigen Konstruktionen wie ein Kartenhaus zusammenstürzen lassen kann.
Nachtrag: Zu den Belegen für den Persevanten Elsässer kommt der bislang älteste hinzu:
Jörig Elsasser persinant (sic!) 1480 August 2
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jbksak1900/0312
Ein Herold Elsosser auf der Landshuter Hochzeit 1475:
http://archiv.twoday.net/stories/1022403203/
#forschung
Ich knüpfe an meine Argumentation und die Belege in
http://archiv.twoday.net/stories/11475805/
an.
Die Belege zu Rüxner finden sich unter
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7140/
Das Hierarchie-Argument:
http://archiv.twoday.net/stories/96991398/
Rüxner nennt sich bis 1505 stets Persevant, als Herold ("ernhalt") erscheint er erstmals in der 1505 entstandenen Beschreibung des Kölner Reichstags. Im autographen Wiener Cod. 2799 nennt er sich 1515 erstmals König der Wappen (und gradierter Ernhalt auf Brandenburg, was immer das ist).
Da der ehemalige königliche Persevant Jörg Elsässer von Maximilian am 8. Oktober 1495 ausdrücklich als Herold bezeichnet wird, kann er - der Heroldshierarchie zufolge - nicht mit dem erst 1505 zum Herold promovierten Rüxner identisch sein.
Schon auf dem Regensburger Reichstag 1471 begegnet ein Herold Elsas des Erzherzogs Sigmund von Tirol (RTA ältere Reihe Bd. 22,2, 1999, S. 541) bzw. "Jorgen Elsess herzog Sigmunds zu Osterreich herolt" (ebd., S. 947). Wäre das Rüxner, müsste er - 1526 letztmals sicher zu belegen - recht alt geworden sein. Aber es gibt Gründe, in diesem Jörg Elässer nicht den späteren Persevanten zu sehen.
Der Herold ist mit dieser Bezeichnung in zwei Quellen 1471 bezeugt, ein Irrtum scheidet zwar nicht ganz aus, ist aber eher unwahrscheinlich. Denn noch ein zweites Argument kommt zu Hilfe, wenn es darum geht, einen älteren Herold von einem jüngeren Persevanten zu trennen. Am 16. September 1486 (RTA mittlere Reihe Bd. 1, 1989, S. 662f. Nr. 656) empfiehlt Kaiser Friedrich III. den zur Besprechung verschiedener Angelegenheiten zu Sigmund gesandten kaiserlichen Persevanten Jörg Elsässer: Dieser habe sich um die Belange des Hauses Österreich bereits sehr verdient gemacht. Es ist nicht anzunehmen, dass Friedrich seinem Verwandten eine Person in dieser Weise ans Herz legte, die dem Adressaten bereits 15 Jahre zuvor als Herold gedient hatte. Beide Argumente lassen es als plausibel erscheinen, einen älteren und einen jüngeren Herold Elässer zu unterscheiden.
Eine recht absurde Vorstellung von "bekannt" kultivierte Gerhard Pietzsch, Archivalische Forschungen zur Geschichte der Musik an den Höfen der Grafen und Herzöge von Kleve-Jülich-Berg (Ravensberg) bis zum Erlöschen der Linie Jülich-Kleve im Jahre 1609 (1971), S. 62f. als er vom "bekannten" Herold Jorg Elsass sprach, der Erzherzog Sigmund, Kaiser Friedrich III. und König Maximilian gedient habe. Dass ihm aufgrund seiner intensiven Quellenstudien (etwa in den Augsburger Baumeisterbüchern, aber auch in unzähligen anderen Quellen) diese Person gut vertraut war, mag sein. Aber von einem "Forschungsstand" kann man ganz und gar nicht sprechen (Elässer fehlt z.B. in Heinigs Herolde-Aufsatz). Pietzsch gibt leider nur einen einzigen Beleg zu dem "bekannten" Elsässer, nämlich Staatsarchiv Nürnberg Rep. 54, Nr. 18, Bl. 237v zu 1479: "Jorgen Elsasser herolt". Das wäre also noch der ältere Elsässer. Ob er später noch bezeugt ist, wusste vielleicht Pietzsch - ich kann die mir bekannten jüngeren Belege nur auf den Persevanten beziehen, der als Herold erstmals 1495 erscheint (zugleich sein letzter Beleg).
Pietzsch zitiert einen Geleitbrief Herzog Wilhelms von Jülich-Berg vom Juli 1494 für "Jorghe Elsaisser, bewyser des brieffs, mancherley koenygen ind fuirstenhoue erfaren ind sich dermaissen daselffs gehalden hait dat he sulcher gunst erfolgen mocht wirdig geschatzt zo werden mit edem tytell ind namen wapen genoiss mit dem he wyder ind mere heymsoechonge ind erfaronge verdienen mocht hyralt zo werden". Elässer wolle viele Reiche sehen, um erfahrener wiederzukehren (HStA Düsseldorf Jülich-Berg I Nr. 69/30 = Bl. 30-31 nach Nijsten, Shadow of Burgundy, 2003, S. 178f. mit ionghe statt Jorghe). Natürlich konnte Pietzsch diese Person nicht mit dem älteren Herold gleichsetzen, weil ja ausdrücklich in der Quelle stand, dass er erst Herold werden wollte. Er dachte daher an einen Verwandten (Sohn?).
In Augsburg erscheint 1511 ein Herold Jörg des Herzogs von Jülich (Pietzsch S. 63). Ich halte es für viel zu hypothetisch, diesen mit dem Elsässer von 1494 gleichzusetzen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich 1511 um Rüxner gehandelt hat, der ja bei vielen Herren ein und aus ging. Die fragmentarische Überlieferung zu Heroldsnamen verleitet dazu, bei gleichen Vornamen oder Amtsnamen an eine Kontinuität im Sinne einer "Festanstellung" zu denken.
Könnte der Jülicher Jörg Elsässer von 1494 der königliche Persevant sein? Ein Jahr später wollte dieser als Herold in die weite Welt: "KM gibt seinem Herold Georgio Elsas Heraldo einen Empfehlungsbrief an alle Kge, Fsten, Hge, Gfen etc.: Georg Elsaß hat die Absicht, das Hl. Grab in Jerusalem zu besuchen und verschiedene Teile der Welt zu bereisen, um die Sitten der Höfe, deren tapfere Taten (fortia gesta), ihre Wappen und alles, was zu seinen Pflichten gehört, zu erkunden. Wormatie 8. Octobris 1495." Von einem Dienstverhältnis spricht die Jülicher Quelle anscheinend nicht, obwohl es für Pietzsch plausibel war, ihn als Jülicher Herold aufzufassen. Dass die sich ähnlichen Empfehlungsbriefe von 1494/95 sich auf zwei verschiedene Personen, die beide Jörg Elsässer hießen, beziehen, halte ich für eher unwahrscheinlich. Wenn man das trotzdem annehmen möchte und zugleich meiner Argumentation, dass es einen Herold Sigmunds Jörg Elsässer und einen davon verschiedenen Persevanten Jörg Elsässer gab, folgen, hätte man mit drei Personen des Namens zu rechnen!
Ich hatte ja argumentiert, dass der Persevant Jörg Rugen = Rüxner, der ja anscheinend Graf Eberhard im Bart auf dem Wormser Reichstag über die Reichsverfassung unterrichtete, mit dem Persevanten Elsässer identisch sein muss, wenn er in der Teilnehmerliste aufgeführt sein sollte (ausschließen wollte ich den Wind-Gesellschaftsknecht Jörg von Giengen, der wohl mit dem 1487 RTA mR Bd. 2, 2001, S. 661 auftretenden Jorg Aman, Wind-Gesellschaftsknecht identisch ist). Wenn Rüxner und Elsässer aber verschiedene Personen sind, was ich jetzt annehmen möchte, wird man zu folgern haben, dass entweder Rugen in der Teilnehmerliste vergessen wurde (etwa weil er nur zeitweilig anwesend war) oder dass er gar nicht anwesend war. Rüxner könnte ja beispielsweise aus Heidelberg eine schriftliche Äußerung an Eberhard gesandt haben.
Aber bei solchen Bastelarbeiten sollte man immer im Auge behalten, dass angesichts der schlechten Quellenlage bzw. der schlechten Erschließung der allzu verstreuten Quellen jede neue Quelle die bisherigen Konstruktionen wie ein Kartenhaus zusammenstürzen lassen kann.
Nachtrag: Zu den Belegen für den Persevanten Elsässer kommt der bislang älteste hinzu:
Jörig Elsasser persinant (sic!) 1480 August 2
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jbksak1900/0312
Ein Herold Elsosser auf der Landshuter Hochzeit 1475:
http://archiv.twoday.net/stories/1022403203/
#forschung
KlausGraf - am Freitag, 13. April 2012, 00:13 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der UB Heidelberg danke ich für die Bereitstellung von Heid. Hs. 171:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/heidhs171
Als Cod. Heid. 359,83 war die Handschrift von Kolb (Die Kraichgauer Ritterschaft 1909 bzw. WürttVjhLdG 1910, S. 18) erwähnt worden:
Über das Turnier ist ein gleichzeitiger Bericht im Stadtarchiv Straßburg vorhanden (A. A. 1921 f. 47—55 Papier, zwei Lagen zu
4 und 2 Blättern). Im wesentlichen stimmt derselbe mit dem bei Rüxner, Fol. 173 ff., überein. Abweichungen Rs. liegen in der Anordnung, in kleinen Auslassungen und Einschiebseln ohne Bedeutung. Die Turnierordnung ist außer bei Rüxner, wo einiges
fehlt, abgedruckt bei Lünig, P. Sp. Cont. III. 2 und bei Burgermeister, Cod dipl. equestr. S. 54. Roth v. Schreckenstein, Reichsritterschaft, Band II S. 109 Anm. 4 leitet ein Zitat der beiden Drucke mit den Worten ein: „Eine im Wesentlichen gleichartige Turnierordnung (mit der Heilbronner), angeblich der Gesellschaft des Esels in Schwaben de anno 1481 und 1485 bei Lünig" etc. — Eine späte Abschrift des Berichtes enthält die Handschr. 359; 83 der Heidelberger Universitätsbibliothek. (Danach zitiert bei Stamm, Turnierbuch ... 1986, S. 303).
http://hdl.handle.net/2027/uc1.b2614934?urlappend=%3Bseq=28 (Kolb mit US-Proxy)
Andreas Ranft, Adelsgesellschaften, 1994, S. 166 Anm. 295 spricht irreführend von einer frühneuzeitlichen Abschrift der Heidelberger Turnierordnung.
Mir gelang es, die nicht genannte Quelle der Abschrift zu ermitteln und zwar bei Studien zu den (echten) Quellen des Heidelberger Turniers. Von der neueren Forschung nicht beachtet wurden Hinweise in der älteren Literatur, beginnend bei einem Buch von Ildefons von Arx 1810,auf eine Beschreibung des Heidelberger Turniers in einer St. Galler Quelle.
Ildefons von Arx 1810
http://books.google.de/books?id=Dz4PAAAAQAAJ&pg=PA497
Später dann
http://books.google.de/books?id=pboAAAAAcAAJ&pg=PA161
Beide nach "Kopialbuch H". Als Tom. 110 des Stiftsarchivs St. Gallen zitiert von:
http://books.google.de/books?id=dUY8AQAAIAAJ&q="beschreibung+des+turniers"
Das Stiftsarchiv St. Gallen teilte freundlicherweise mit: Beim gesuchten Band handelt es sich um ein St.Galler Kopialbuch mit der Signatur "StiASG, Bd. 110" (Stiftsarchiv St.Gallen, Band 110). Der Band stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist überwiegend von der gleichen zeitnahen Hand geschrieben. Anbei der Link zur Verzeichnungseinheit in unserer Datenbank (die noch im Aufbau begriffen ist): http://scope.stiftsarchiv.sg.ch/detail.aspx?id=22096
Die Turnierordnung findet sich auf fol. 87r-102r von StiASG, Bd. 110 (andere, jedoch nicht mehr gültige Blatt- bzw. Lagenzählungen wären CXIIII-CXXX; 111r-127r bzw. i4-k7). Beim Band handelt es sich um ein "typisches" Kopialbuch; früher wurde es als "Copirbuch H" bzw. "Kopialbuch H" bezeichnet. Der Eintrag vor der Turnierordnung bringt einen "frunntlich vnt güttlich vertrag" zwischen Stadt und Kloster St.Gallen, der Eintrag danach einen "gütlichen Spruch" zwischen Kloster und Spital St.Gallen.
Vermutlich nicht vor 1810, dem Erscheinen der Geschichte von Arx, wurde also aus Heidelberg eine Abschrift aus dem St. Galler Band angefordert, die von Arx kollationiert wurde (Kopist war wohl "Loew") und ohne hinreichende Quellenangabe in den Bestand der UB Heidelberg geriet.
Da ich die 100 SFr für ein Gebrauchsdigitalisat der Seiten noch nicht aufbringen wollte, kann ich nichts darüber sagen, inwieweit bei der Abschrift in größerem Maß Lesefehler unterliefen.
Weder die Straßburger Überlieferung noch die im Staatsarchiv Nürnberg
Ordnung des Turniers zu Heidelberg in 50 Artikeln.
Laufzeit: 1481 August 26
Signatur: StArchiv-N, Rep. 2 b Rst. Nürnberg, Losungsamt, 7-farbiges Alphabet, Urkunden Nr. 3555
Altsignatur: Blau H Nr. 6
Jetzt in Rep. 2 c Rst. Nürnberg, 7-farbiges Alphabet, Akten, Nr. 245.
lagen mir bislang vor. Die Heidelberger Handschrift enthält ja die ganze Beschreibung des Turniers, nicht nur die Turnierordnung. Als gedruckte bzw. online verfügbare Parallelüberlieferung ist zu nennen
Rüxners Turnierbuch, hier zitiert nach der Ausgabe 1532 statt der Erstausgabe
http://www.dilibri.de/rlbdfg/content/pageview/324625
(Wirth 1868 hatte auch nur die Ausgabe von 1532 bei seinem Abdruck vorliegen:
http://books.google.de/books?id=v85DAAAAYAAJ&pg=PA214 )
[Erstausgabe 1530:
http://books.google.at/books?id=j8RUAAAAcAAJ&pg=PT687 ]
Eybs Turnierbuch 1519, hrsg. von Heide Stamm 1986 [Näheres]. Der Cgm 961 ist online
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00038996/image_127
Ein genauer Vergleich der Heidelberger Handschrift mit diesen beiden Quellen wäre wenig sinnvoll (man sollte die St. Galler Vorlage heranziehen und auch die weiteren Überlieferungen), aber bei flüchtiger Durchsicht zeigt sich, dass alle drei Überlieferungen im wesentlichen auf einen einzigen zeitgenössischen Bericht zurückgehen. In Einzelfällen liefert die Heidelberger Handschrift sicher bessere Angaben.
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/heidhs171/0019 Zeile 4 bringt z.B. den Vornamen Blicker des Manns der weiteren Frau aus dem Geschlecht der Landschad von Steinach.
Nachtrag: Bildquellen zum Turnier
http://archiv.twoday.net/stories/120175110/
#forschung
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/heidhs171
Als Cod. Heid. 359,83 war die Handschrift von Kolb (Die Kraichgauer Ritterschaft 1909 bzw. WürttVjhLdG 1910, S. 18) erwähnt worden:
Über das Turnier ist ein gleichzeitiger Bericht im Stadtarchiv Straßburg vorhanden (A. A. 1921 f. 47—55 Papier, zwei Lagen zu
4 und 2 Blättern). Im wesentlichen stimmt derselbe mit dem bei Rüxner, Fol. 173 ff., überein. Abweichungen Rs. liegen in der Anordnung, in kleinen Auslassungen und Einschiebseln ohne Bedeutung. Die Turnierordnung ist außer bei Rüxner, wo einiges
fehlt, abgedruckt bei Lünig, P. Sp. Cont. III. 2 und bei Burgermeister, Cod dipl. equestr. S. 54. Roth v. Schreckenstein, Reichsritterschaft, Band II S. 109 Anm. 4 leitet ein Zitat der beiden Drucke mit den Worten ein: „Eine im Wesentlichen gleichartige Turnierordnung (mit der Heilbronner), angeblich der Gesellschaft des Esels in Schwaben de anno 1481 und 1485 bei Lünig" etc. — Eine späte Abschrift des Berichtes enthält die Handschr. 359; 83 der Heidelberger Universitätsbibliothek. (Danach zitiert bei Stamm, Turnierbuch ... 1986, S. 303).
http://hdl.handle.net/2027/uc1.b2614934?urlappend=%3Bseq=28 (Kolb mit US-Proxy)
Andreas Ranft, Adelsgesellschaften, 1994, S. 166 Anm. 295 spricht irreführend von einer frühneuzeitlichen Abschrift der Heidelberger Turnierordnung.
Mir gelang es, die nicht genannte Quelle der Abschrift zu ermitteln und zwar bei Studien zu den (echten) Quellen des Heidelberger Turniers. Von der neueren Forschung nicht beachtet wurden Hinweise in der älteren Literatur, beginnend bei einem Buch von Ildefons von Arx 1810,auf eine Beschreibung des Heidelberger Turniers in einer St. Galler Quelle.
Ildefons von Arx 1810
http://books.google.de/books?id=Dz4PAAAAQAAJ&pg=PA497
Später dann
http://books.google.de/books?id=pboAAAAAcAAJ&pg=PA161
Beide nach "Kopialbuch H". Als Tom. 110 des Stiftsarchivs St. Gallen zitiert von:
http://books.google.de/books?id=dUY8AQAAIAAJ&q="beschreibung+des+turniers"
Das Stiftsarchiv St. Gallen teilte freundlicherweise mit: Beim gesuchten Band handelt es sich um ein St.Galler Kopialbuch mit der Signatur "StiASG, Bd. 110" (Stiftsarchiv St.Gallen, Band 110). Der Band stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist überwiegend von der gleichen zeitnahen Hand geschrieben. Anbei der Link zur Verzeichnungseinheit in unserer Datenbank (die noch im Aufbau begriffen ist): http://scope.stiftsarchiv.sg.ch/detail.aspx?id=22096
Die Turnierordnung findet sich auf fol. 87r-102r von StiASG, Bd. 110 (andere, jedoch nicht mehr gültige Blatt- bzw. Lagenzählungen wären CXIIII-CXXX; 111r-127r bzw. i4-k7). Beim Band handelt es sich um ein "typisches" Kopialbuch; früher wurde es als "Copirbuch H" bzw. "Kopialbuch H" bezeichnet. Der Eintrag vor der Turnierordnung bringt einen "frunntlich vnt güttlich vertrag" zwischen Stadt und Kloster St.Gallen, der Eintrag danach einen "gütlichen Spruch" zwischen Kloster und Spital St.Gallen.
Vermutlich nicht vor 1810, dem Erscheinen der Geschichte von Arx, wurde also aus Heidelberg eine Abschrift aus dem St. Galler Band angefordert, die von Arx kollationiert wurde (Kopist war wohl "Loew") und ohne hinreichende Quellenangabe in den Bestand der UB Heidelberg geriet.
Da ich die 100 SFr für ein Gebrauchsdigitalisat der Seiten noch nicht aufbringen wollte, kann ich nichts darüber sagen, inwieweit bei der Abschrift in größerem Maß Lesefehler unterliefen.
Weder die Straßburger Überlieferung noch die im Staatsarchiv Nürnberg
Ordnung des Turniers zu Heidelberg in 50 Artikeln.
Laufzeit: 1481 August 26
Signatur: StArchiv-N, Rep. 2 b Rst. Nürnberg, Losungsamt, 7-farbiges Alphabet, Urkunden Nr. 3555
Altsignatur: Blau H Nr. 6
Jetzt in Rep. 2 c Rst. Nürnberg, 7-farbiges Alphabet, Akten, Nr. 245.
lagen mir bislang vor. Die Heidelberger Handschrift enthält ja die ganze Beschreibung des Turniers, nicht nur die Turnierordnung. Als gedruckte bzw. online verfügbare Parallelüberlieferung ist zu nennen
Rüxners Turnierbuch, hier zitiert nach der Ausgabe 1532 statt der Erstausgabe
http://www.dilibri.de/rlbdfg/content/pageview/324625
(Wirth 1868 hatte auch nur die Ausgabe von 1532 bei seinem Abdruck vorliegen:
http://books.google.de/books?id=v85DAAAAYAAJ&pg=PA214 )
[Erstausgabe 1530:
http://books.google.at/books?id=j8RUAAAAcAAJ&pg=PT687 ]
Eybs Turnierbuch 1519, hrsg. von Heide Stamm 1986 [Näheres]. Der Cgm 961 ist online
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00038996/image_127
Ein genauer Vergleich der Heidelberger Handschrift mit diesen beiden Quellen wäre wenig sinnvoll (man sollte die St. Galler Vorlage heranziehen und auch die weiteren Überlieferungen), aber bei flüchtiger Durchsicht zeigt sich, dass alle drei Überlieferungen im wesentlichen auf einen einzigen zeitgenössischen Bericht zurückgehen. In Einzelfällen liefert die Heidelberger Handschrift sicher bessere Angaben.
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/heidhs171/0019 Zeile 4 bringt z.B. den Vornamen Blicker des Manns der weiteren Frau aus dem Geschlecht der Landschad von Steinach.
Nachtrag: Bildquellen zum Turnier
http://archiv.twoday.net/stories/120175110/
#forschung
KlausGraf - am Donnerstag, 12. April 2012, 19:02 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ausgezeichneter Beitrag von Heidrun Wiesenmüller:
http://www.vdb-online.org/publikationen/vdb-mitteilungen/vdb-mitteilungen-2012-1.pdf#page=20
Was fehlt aus meiner Sicht?
- Die immense Bedeutung der Kataloganreicherung für die Sacherschließung
Sie führt zu einer Aufweichung der online ohnehin obsoleten Grenze zwischen unselbständiger und selbständiger Literatur. Auch auf Artikelebene muss hinsichtlich der Metadaten auf Open Access gesetzt werden. Jede Uni bastelt da für die "happy few" ihr eigenes System.
Bei Sammelbänden sind die einzelnen Beiträge und eventuelle Open-Access-Versionen suchbar vorzuhalten. Und natürlich müssen auch die einzelnen Autoren dieser Beiträge mit PND verknüpft werden.
http://www.vdb-online.org/publikationen/vdb-mitteilungen/vdb-mitteilungen-2012-1.pdf#page=20
Was fehlt aus meiner Sicht?
- Die immense Bedeutung der Kataloganreicherung für die Sacherschließung
Sie führt zu einer Aufweichung der online ohnehin obsoleten Grenze zwischen unselbständiger und selbständiger Literatur. Auch auf Artikelebene muss hinsichtlich der Metadaten auf Open Access gesetzt werden. Jede Uni bastelt da für die "happy few" ihr eigenes System.
Bei Sammelbänden sind die einzelnen Beiträge und eventuelle Open-Access-Versionen suchbar vorzuhalten. Und natürlich müssen auch die einzelnen Autoren dieser Beiträge mit PND verknüpft werden.
KlausGraf - am Donnerstag, 12. April 2012, 16:30 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
By Ben Brumfield
http://manuscripttranscription.blogspot.fr/2012/04/crowdsourced-transcription-tool-list.html
http://manuscripttranscription.blogspot.fr/2012/04/crowdsourced-transcription-tool-list.html
KlausGraf - am Donnerstag, 12. April 2012, 16:16 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Bildersuchmaschinen dürfen Fotos als Vorschaubilder in den Ergebnislisten abbilden, wenn sie ein Dritter mit Zustimmung des Urhebers ins Internet eingestellt hat, ohne "technische Vorkehrungen gegen ein Auffinden und Anzeigen dieser Abbildung durch Suchmaschinen zu treffen". Diese Einwilligung erstrecke sich auch darauf, Bilder wiederzugeben, die nicht vom Fotografen oder mit Zustimmung von einem Dritten ins Internet eingestellt worden sind. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) am 19. Oktober 2011 entschieden (Az. I ZR 140/10). Nun liegt die schriftliche Urteilsbegründung vor."
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-darf-auch-widerrechtlich-veroeffentlichte-Bilder-zeigen-1519865.html
Der Volltext lohnt, liebe männliche Leser, allein schon aufgrund des gezeigten Fotos :-)
http://openjur.de/u/270380.html
"Räumt ein Berechtigter einem Dritten ohne Einschränkungen das Recht ein, die Abbildung eines Werkes oder Lichtbildes im Internet öffentlich zugänglich zu machen, erteilt er damit in der Regel zugleich seine Zustimmung, dass der Dritte in eine Nutzung dieser Abbildung durch eine Bildersuchmaschine einwilligt. [...]
Es ist allgemein bekannt, dass Suchmaschinen, die das Internet in einem automatisierten Verfahren unter Einsatz von Computerprogrammen nach Bildern durchsuchen, nicht danach unterscheiden können, ob ein aufgefundenes Bild von einem Berechtigten oder einem Nichtberechtigten ins Internet eingestellt worden ist. Deshalb kann der Betreiber einer Suchmaschine die Einwilligung in die Wiedergabe von Abbildungen eines Werkes oder Lichtbildes als Vorschaubild nach ihrem objektiven Erklärungsinhalt nur dahin verstehen, dass sie sich auch auf die Wiedergabe von Abbildungen des Werkes oder der Fotografie erstreckt, die nicht vom Berechtigten oder mit seiner Zustimmung von einem Dritten ins Internet eingestellt worden sind. Hat der Berechtigte oder mit seiner Zustimmung ein Dritter die Einwilligung zum Aufsuchen und Anzeigen von Abbildungen eines vom Berechtigten geschaffenen Werkes oder Lichtbildes durch Bildersuchmaschinen erteilt, verhält der Berechtigte sich daher widersprüchlich, wenn er von dem Betreiber einer Suchmaschine verlangt, nur Vorschaubilder solcher Abbildungen des Werkes oder Lichtbildes anzuzeigen, die vom Berechtigten oder mit seiner Zustimmung von Dritten ins Internet eingestellt worden sind."
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-darf-auch-widerrechtlich-veroeffentlichte-Bilder-zeigen-1519865.html
Der Volltext lohnt, liebe männliche Leser, allein schon aufgrund des gezeigten Fotos :-)
http://openjur.de/u/270380.html
"Räumt ein Berechtigter einem Dritten ohne Einschränkungen das Recht ein, die Abbildung eines Werkes oder Lichtbildes im Internet öffentlich zugänglich zu machen, erteilt er damit in der Regel zugleich seine Zustimmung, dass der Dritte in eine Nutzung dieser Abbildung durch eine Bildersuchmaschine einwilligt. [...]
Es ist allgemein bekannt, dass Suchmaschinen, die das Internet in einem automatisierten Verfahren unter Einsatz von Computerprogrammen nach Bildern durchsuchen, nicht danach unterscheiden können, ob ein aufgefundenes Bild von einem Berechtigten oder einem Nichtberechtigten ins Internet eingestellt worden ist. Deshalb kann der Betreiber einer Suchmaschine die Einwilligung in die Wiedergabe von Abbildungen eines Werkes oder Lichtbildes als Vorschaubild nach ihrem objektiven Erklärungsinhalt nur dahin verstehen, dass sie sich auch auf die Wiedergabe von Abbildungen des Werkes oder der Fotografie erstreckt, die nicht vom Berechtigten oder mit seiner Zustimmung von einem Dritten ins Internet eingestellt worden sind. Hat der Berechtigte oder mit seiner Zustimmung ein Dritter die Einwilligung zum Aufsuchen und Anzeigen von Abbildungen eines vom Berechtigten geschaffenen Werkes oder Lichtbildes durch Bildersuchmaschinen erteilt, verhält der Berechtigte sich daher widersprüchlich, wenn er von dem Betreiber einer Suchmaschine verlangt, nur Vorschaubilder solcher Abbildungen des Werkes oder Lichtbildes anzuzeigen, die vom Berechtigten oder mit seiner Zustimmung von Dritten ins Internet eingestellt worden sind."
KlausGraf - am Donnerstag, 12. April 2012, 15:50 - Rubrik: Archivrecht
In diesen Updates sind u.a. Bestände aus Meißen, Coswig, Cottbus, Bautzen und Schwäbisch Hall enthalten. Siehe hier und hier.
Sebastian Post - am Sonntag, 1. April 2012, 22:30 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Harm von Seggern hat 2002 dem Wappenkönig der Ruwieren Hermann von Brüninghausen eine kleine Studie gewidmet, in der er die zerstreute ältere Forschung zu dem niederrheinischen Herold zusammenfasste und neue Belege vor allem aus burgundischen Quellen beibrachte (Hermann von Brüninghausen. Wappenkönig der Ruwieren, in: Menschenbilder - Menschenbildner, 2002, S. 109-117. Ohne diesen Beitrag zur Kenntnis zu nehmen hat die Kunsthistorikerin Leonie Gräfin Nesselrode in ihrem Buch "Die Chorfenster von Ehrenstein" (2008) [Auszüge] die Urheberschaft Brüninghausens am Heroldsbuch des Jülicher Hubertusordens bestritten. Außer einem Aufsatz in einer Krakauer Zeitschrift (in: Prace Historyczne Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellonskiego (History Notebooks) 137, 2010, S. 43-78, non vidi) hat sie ihre Beobachtungen auch im Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 36 (2010) publiziert (Neue Erkenntnisse zum Heroldsbuch und Bruderschaftsbuch des jülich-bergischen Hubertusordens, S. 131-162). Ihr Aufsatz in den Rheinischen Vierteljahresblättern 75 (2011) geht auf diese Frage nicht ein.
Das Heroldsbuch des unmittelbar nach der siegreichen Schlacht bei Linnich (1444) durch Herzog Gerhard II. von Jülich-Berg gegründeten gegründeten Hubertusordens war lange verschollen. Die Berliner Handschrift mgq 1479 befindet sich heute unter der alten Signatur in der Biblioteka Jagiellonska in Krakau.
http://www.handschriftencensus.de/5306 (mit weiteren Nachweisen)
Bilder:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Heroldsbuch_des_j%C3%BClich-bergischen_Hubertusordens [vor allem Schwarzweissfotos aus dem Aufsatz von Nesselrode, polnischer Publikationsort]
Nesselrode zeigt schlüssig, dass die bisherige Datierung um 1480 und die Zuschreibung an Hermann von Brüninghausen (sie nennt ihn Brunshofen) unzutreffend sind. Bl. 13v sagt "herman eyn tornyrkunde heralt", dass er das Heroldsbuch gemacht und geordnet habe. Seine Hand unterscheidet sich von dem Vermerk Bl. 127v des Wappenkönigs Hermann von "brumhoyften" (so die Lesung Nesselrodes, auf meinem Gebrauchsscan der Abbildung 6 kann ich kaum etwas erkennen).
Da Nesselrode keine Angabe zu den einzelnen Händen der Handschrift macht - Degering meinte, sie sei im "wesentlichen von der Hand des Verfassers geschrieben - können ihre Angaben nicht nachvollzogen werden. Entgegen dem ausdrücklichen Wortlaut des Eingangsvermerks des Herolds Hermann sieht sie in ihm nur den Bearbeiter eines bereits vor 1463 bestehenden Buchs. Sie findet seine markante Hand in Eintragungen aus der Zeit um 1463, seine einzige datierte Eintragung stamme von 1463 (S. 140). Für die Anlage des Bandes erscheint der Zeitraum 1452/63 wahrscheinlich (S. 141). Hoffentlich wird der Codex in absehbarer Zeit digitalisiert, dann können Nesselrodes Beobachtungen besser überprüft werden. Nesselrode rechnet offensichtlich nicht mit der Möglichkeit, dass Hermann der geistige Urheber des Codex war, die Schreib- und Malarbeit aber anderen überlassen hat. Angaben über die Wasserzeichen liegen noch nicht vor.
Wenn die Frühdatierung (um oder vor 1463) zutrifft - daran möchte ich nicht zweifeln - kann gemäß der strengen Hierarchie des Heroldswesens (Persevant, Herold, Wappenkönig) Brüninghausen nicht mit dem 1463 wirkenden Herold Hermann (des Herzogs von Jülich bzw. des Hubertusordens) identisch sein (Nesselrode S. 142).
Zum Persevanten, Herold und schließlich Wappenkönig Hermann von Brüninghausen hat sich Wim van Anrooij 2009 geäußert (King of Arms of the Ruwieren: A Special Function in the German Empire, in: The Herald in Late Medieval Europe, 2009, S. 111-132, wobei er auf die unveröffentlichte Datenbank heraudica.org von Torsten Hiltmann und Franck Viltart zurückgreifen durfte.
Nach ebd., S. 128 wurde Hermann von Brüninghausen im Jahr 1470 Herold, er kann daher nicht mit dem um 1463 wirkenden Herold Hermann identisch sein.
Außer dem Aufsatz von Seggern bieten Belege zu Brüninghausen Gerhard Pietzsch, Archivalische Forschungen zur Geschichte der Motiv an den Höfen der Grafen und Herzöge von Kleve-Jülich-Berg (Ravensberg) bis zum Erlöschen der Linie Jülich-Kleve im Jahre 1609 (1971), S. 41f.; Gerard Nijsten, In the Shadow of Burgundy ... (2003), S. 78 [Auszug] (Persevant Hermann zu 1470, auch bei Nesselrode S. 142).
Die bekannten Belege reichen von 1461 (Persevant Hermann) bis 1501/02 (Stadtrechnung Neuss, Herold Hermann). Zwischen 1471 und 1477 wurde er Wappenkönig der Ruwieren.
[Auch Heinrich von Heessel - http://archiv.twoday.net/stories/59206605/ - war Wappenkönig der Ruwieren. Die Bezeichnung geht auf den Raumnamen Ripuarien zurück.]
Außerdem ist auf eine Urkunde aus Brauweiler hinzuweisen: "Hermann von Brüninghausen, Herold, und seine Frau Barbara haben dem Abt und Konvent 6 1/4 Morgen Wiesen in der Herrlichkeit Kernen verkauft. - 1489 Jan. 21. Orig.: HStAD, B, Urk. 96."
(FS Odilo Engels 1993, S. 216 [Schnipsel]
Leider nicht auf den Herold bezieht sich eine Nennung eines "Hen(n)man von Brünykofen hofmeister", die ich in der Eheabrede zwischen Graf Heinrich von Württemberg und Graf Simon Wecker von Zweibrücken-Bitsch (1485) im Hauptstaatsarchiv Stuttgart fand:
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-24954-1 (Digitalisat)
Die Adelsfamilie nannte sich nach Brünighofen bei Altkirch im Elsass:
http://gov.genealogy.net/item/show/BRUFENJN37OQ
Diverse Belege zur Familie und Sekundärliteratur gibt:
http://www.monuments-alsace.com/alsatia/alsatia.pdf
Ein Hamman von Brünighofen war zeitweilig in Mulhouse ansässig:
http://books.google.de/books?id=KFlMAAAAMAAJ&q="von+brunighofen"
Henemann de Brinighoffen heiratete 1488 Marie de Vaudrey nach
http://books.google.de/books?id=IYD4_xhf2MAC&pg=PA184
Die Herkunft des Herolds bleibt im Dunkeln. Aufgrund einiger in Betracht kommender Orte hat Seggern ganz darauf verzichtet, auf den Ortsnamen Brüninghausen einzugehen. Im Rheinland gibt es anscheinend keinen Ort, der in Betracht kommt, von den westfälischen Orten kommen am ehesten die nächstgelegenen Siedlungen bei Dortmund (Brüninghausen, Brünninghausen) und Brüninghausen bei Lüdenscheid in Betracht. Brüninghausen bei Lüdenscheid war ein wichtiger Ort der Grafschaft Mark und Sitz eines Freigerichts. Kleve-Jülich-Berg gab es um 1440 - damals dürfte Hermann geboren worden sein - noch nicht, aber Kleve-Mark. Über Kleve am Niederrhein könnte die Beziehung zu Jülich-Berg gelaufen sein, doch könnte man sich natürlich auch einen direkten Kontakt zum Herzogtum Berg vorstellen. Mehr als eine vage Hypothese ist die Herkunft aus Brüninghausen bei Lüdenscheid aber nicht, andere Möglichkeiten können keineswegs ausgeschlossen werden.
Außer dem Heroldsbuch soll Brüninghausen nach Seggern und Anrooij auch das Bruderschaftsbuch des Hubertusordens, laut Nesselrode eine "Bestandsaufnahme unter Herzog Wilhelm 1481/82" (S. 143), geschrieben haben, aber die Beschreibung von Marianne Reuter sagt davon nichts:
http://codicon.digitale-sammlungen.de/inventiconCod.icon.%20318.pdf
BSB Cod, icon. 318 ist im Netz:
http://codicon.digitale-sammlungen.de/Band_bsb00006309.html
Ich möchte seine Schrift eigentlich nicht mit der Schriftprobe Brüninghausens aus dem Heroldsbuch gleichsetzen, will mich aber nicht auf paläographisches Glatteis begeben.
Seit kurzem im Netz ist der 1481 von Brüninghausen nachweislich geschriebene Wiener Cod. 2899
http://manuscripta.at/?ID=4735 (mit weiteren Nachweisen)
Digitalisat über
http://data.onb.ac.at/rec/AL00167269
Wunderschöne Bilder! Aus dieser Handschrift stammt das Umschlagsbild von Barbara Hammes, Ritterlicher Fürst ... 2011.
"Herman von Bruninckusen", wie Menhardt liest, nennt sich als Autor dieser pfälzischen Genealogie, die nun bequem näher untersucht werden könnte.
Zwischen dem u und dem c befinden sich drei Striche mit einem waagerechten Strich darüber. Bruinnkusen, Brunnikusen, Brummkusen usw. wären also paläographisch ebenso möglich. Aber auf Bruninckusen kann man sich wohl einigen.
In ihrer Beschreibung des von Hartmann Schedel wohl um 1480 angelegten Clm 338 weist Birgit Studt, Fürstenhof und Geschichte, 1992, S. 86f. auf hochinteressante "pfälzische Heroldsdichtung" Bl. 194v-198v hin. Die Wiener Handschrift gibt eine Ahnenprobe Philipps von der Pfalz und seiner Frau Margarethe von Bayern (die Hochzeit war 1474), die Münchner Handschrift bietet eine gereimte Ahnenprobe für das gleiche Fürstenpaar, gefolgt Bl. 195r-198v von einem gereimten Gedicht auf die Lehensträger der Pfalz wohl von einem Herold (Textbeginn: "Ich heralt in myn wapencleid"), das von der landesgeschichtlichen Forschung anscheinend nicht weiter beachtet wurde, obwohl es hinsichtlich des "Repräsentationsaspekts" doch ein interessantes Seitenstück zum mit Wappen geschmückten pfälzischen Lehenbuch darstellt. Ob auch diese Gedichte von Bruninghusen stammen, schreibt Studt, bleibe zu prüfen. Sie sagt leider nicht, wie eine solche Prüfung erfolgen könne. Die Schreibsprache des Stücks spricht jedenfalls nicht für die Verfasseridentität.
Nachtrag August 2014:
Krakau Mgq 1479 ist online:
http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:jbc.bj.uj.edu.pl:194948

Mögliche Darstellung Hermanns von Brüninghausen (Juliers Herold) in einer Handschrift des 17. Jahrhunderts, Brüssel, Königl. Bibliothek IV 164, vor Bl. 1r. Anrooij S. 128 Anm. 59 verweist auf C. van den Bergen-Pantens, De heraldiek ... Brüssel 1985, S. 57.
#forschung
Das Heroldsbuch des unmittelbar nach der siegreichen Schlacht bei Linnich (1444) durch Herzog Gerhard II. von Jülich-Berg gegründeten gegründeten Hubertusordens war lange verschollen. Die Berliner Handschrift mgq 1479 befindet sich heute unter der alten Signatur in der Biblioteka Jagiellonska in Krakau.
http://www.handschriftencensus.de/5306 (mit weiteren Nachweisen)
Bilder:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Heroldsbuch_des_j%C3%BClich-bergischen_Hubertusordens [vor allem Schwarzweissfotos aus dem Aufsatz von Nesselrode, polnischer Publikationsort]
Nesselrode zeigt schlüssig, dass die bisherige Datierung um 1480 und die Zuschreibung an Hermann von Brüninghausen (sie nennt ihn Brunshofen) unzutreffend sind. Bl. 13v sagt "herman eyn tornyrkunde heralt", dass er das Heroldsbuch gemacht und geordnet habe. Seine Hand unterscheidet sich von dem Vermerk Bl. 127v des Wappenkönigs Hermann von "brumhoyften" (so die Lesung Nesselrodes, auf meinem Gebrauchsscan der Abbildung 6 kann ich kaum etwas erkennen).
Da Nesselrode keine Angabe zu den einzelnen Händen der Handschrift macht - Degering meinte, sie sei im "wesentlichen von der Hand des Verfassers geschrieben - können ihre Angaben nicht nachvollzogen werden. Entgegen dem ausdrücklichen Wortlaut des Eingangsvermerks des Herolds Hermann sieht sie in ihm nur den Bearbeiter eines bereits vor 1463 bestehenden Buchs. Sie findet seine markante Hand in Eintragungen aus der Zeit um 1463, seine einzige datierte Eintragung stamme von 1463 (S. 140). Für die Anlage des Bandes erscheint der Zeitraum 1452/63 wahrscheinlich (S. 141). Hoffentlich wird der Codex in absehbarer Zeit digitalisiert, dann können Nesselrodes Beobachtungen besser überprüft werden. Nesselrode rechnet offensichtlich nicht mit der Möglichkeit, dass Hermann der geistige Urheber des Codex war, die Schreib- und Malarbeit aber anderen überlassen hat. Angaben über die Wasserzeichen liegen noch nicht vor.
Wenn die Frühdatierung (um oder vor 1463) zutrifft - daran möchte ich nicht zweifeln - kann gemäß der strengen Hierarchie des Heroldswesens (Persevant, Herold, Wappenkönig) Brüninghausen nicht mit dem 1463 wirkenden Herold Hermann (des Herzogs von Jülich bzw. des Hubertusordens) identisch sein (Nesselrode S. 142).
Zum Persevanten, Herold und schließlich Wappenkönig Hermann von Brüninghausen hat sich Wim van Anrooij 2009 geäußert (King of Arms of the Ruwieren: A Special Function in the German Empire, in: The Herald in Late Medieval Europe, 2009, S. 111-132, wobei er auf die unveröffentlichte Datenbank heraudica.org von Torsten Hiltmann und Franck Viltart zurückgreifen durfte.
Nach ebd., S. 128 wurde Hermann von Brüninghausen im Jahr 1470 Herold, er kann daher nicht mit dem um 1463 wirkenden Herold Hermann identisch sein.
Außer dem Aufsatz von Seggern bieten Belege zu Brüninghausen Gerhard Pietzsch, Archivalische Forschungen zur Geschichte der Motiv an den Höfen der Grafen und Herzöge von Kleve-Jülich-Berg (Ravensberg) bis zum Erlöschen der Linie Jülich-Kleve im Jahre 1609 (1971), S. 41f.; Gerard Nijsten, In the Shadow of Burgundy ... (2003), S. 78 [Auszug] (Persevant Hermann zu 1470, auch bei Nesselrode S. 142).
Die bekannten Belege reichen von 1461 (Persevant Hermann) bis 1501/02 (Stadtrechnung Neuss, Herold Hermann). Zwischen 1471 und 1477 wurde er Wappenkönig der Ruwieren.
[Auch Heinrich von Heessel - http://archiv.twoday.net/stories/59206605/ - war Wappenkönig der Ruwieren. Die Bezeichnung geht auf den Raumnamen Ripuarien zurück.]
Außerdem ist auf eine Urkunde aus Brauweiler hinzuweisen: "Hermann von Brüninghausen, Herold, und seine Frau Barbara haben dem Abt und Konvent 6 1/4 Morgen Wiesen in der Herrlichkeit Kernen verkauft. - 1489 Jan. 21. Orig.: HStAD, B, Urk. 96."
(FS Odilo Engels 1993, S. 216 [Schnipsel]
Leider nicht auf den Herold bezieht sich eine Nennung eines "Hen(n)man von Brünykofen hofmeister", die ich in der Eheabrede zwischen Graf Heinrich von Württemberg und Graf Simon Wecker von Zweibrücken-Bitsch (1485) im Hauptstaatsarchiv Stuttgart fand:
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-24954-1 (Digitalisat)
Die Adelsfamilie nannte sich nach Brünighofen bei Altkirch im Elsass:
http://gov.genealogy.net/item/show/BRUFENJN37OQ
Diverse Belege zur Familie und Sekundärliteratur gibt:
http://www.monuments-alsace.com/alsatia/alsatia.pdf
Ein Hamman von Brünighofen war zeitweilig in Mulhouse ansässig:
http://books.google.de/books?id=KFlMAAAAMAAJ&q="von+brunighofen"
Henemann de Brinighoffen heiratete 1488 Marie de Vaudrey nach
http://books.google.de/books?id=IYD4_xhf2MAC&pg=PA184
Die Herkunft des Herolds bleibt im Dunkeln. Aufgrund einiger in Betracht kommender Orte hat Seggern ganz darauf verzichtet, auf den Ortsnamen Brüninghausen einzugehen. Im Rheinland gibt es anscheinend keinen Ort, der in Betracht kommt, von den westfälischen Orten kommen am ehesten die nächstgelegenen Siedlungen bei Dortmund (Brüninghausen, Brünninghausen) und Brüninghausen bei Lüdenscheid in Betracht. Brüninghausen bei Lüdenscheid war ein wichtiger Ort der Grafschaft Mark und Sitz eines Freigerichts. Kleve-Jülich-Berg gab es um 1440 - damals dürfte Hermann geboren worden sein - noch nicht, aber Kleve-Mark. Über Kleve am Niederrhein könnte die Beziehung zu Jülich-Berg gelaufen sein, doch könnte man sich natürlich auch einen direkten Kontakt zum Herzogtum Berg vorstellen. Mehr als eine vage Hypothese ist die Herkunft aus Brüninghausen bei Lüdenscheid aber nicht, andere Möglichkeiten können keineswegs ausgeschlossen werden.
Außer dem Heroldsbuch soll Brüninghausen nach Seggern und Anrooij auch das Bruderschaftsbuch des Hubertusordens, laut Nesselrode eine "Bestandsaufnahme unter Herzog Wilhelm 1481/82" (S. 143), geschrieben haben, aber die Beschreibung von Marianne Reuter sagt davon nichts:
http://codicon.digitale-sammlungen.de/inventiconCod.icon.%20318.pdf
BSB Cod, icon. 318 ist im Netz:
http://codicon.digitale-sammlungen.de/Band_bsb00006309.html
Ich möchte seine Schrift eigentlich nicht mit der Schriftprobe Brüninghausens aus dem Heroldsbuch gleichsetzen, will mich aber nicht auf paläographisches Glatteis begeben.
Seit kurzem im Netz ist der 1481 von Brüninghausen nachweislich geschriebene Wiener Cod. 2899
http://manuscripta.at/?ID=4735 (mit weiteren Nachweisen)
Digitalisat über
http://data.onb.ac.at/rec/AL00167269
Wunderschöne Bilder! Aus dieser Handschrift stammt das Umschlagsbild von Barbara Hammes, Ritterlicher Fürst ... 2011.
"Herman von Bruninckusen", wie Menhardt liest, nennt sich als Autor dieser pfälzischen Genealogie, die nun bequem näher untersucht werden könnte.
Zwischen dem u und dem c befinden sich drei Striche mit einem waagerechten Strich darüber. Bruinnkusen, Brunnikusen, Brummkusen usw. wären also paläographisch ebenso möglich. Aber auf Bruninckusen kann man sich wohl einigen.
In ihrer Beschreibung des von Hartmann Schedel wohl um 1480 angelegten Clm 338 weist Birgit Studt, Fürstenhof und Geschichte, 1992, S. 86f. auf hochinteressante "pfälzische Heroldsdichtung" Bl. 194v-198v hin. Die Wiener Handschrift gibt eine Ahnenprobe Philipps von der Pfalz und seiner Frau Margarethe von Bayern (die Hochzeit war 1474), die Münchner Handschrift bietet eine gereimte Ahnenprobe für das gleiche Fürstenpaar, gefolgt Bl. 195r-198v von einem gereimten Gedicht auf die Lehensträger der Pfalz wohl von einem Herold (Textbeginn: "Ich heralt in myn wapencleid"), das von der landesgeschichtlichen Forschung anscheinend nicht weiter beachtet wurde, obwohl es hinsichtlich des "Repräsentationsaspekts" doch ein interessantes Seitenstück zum mit Wappen geschmückten pfälzischen Lehenbuch darstellt. Ob auch diese Gedichte von Bruninghusen stammen, schreibt Studt, bleibe zu prüfen. Sie sagt leider nicht, wie eine solche Prüfung erfolgen könne. Die Schreibsprache des Stücks spricht jedenfalls nicht für die Verfasseridentität.
Nachtrag August 2014:
Krakau Mgq 1479 ist online:
http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:jbc.bj.uj.edu.pl:194948

Mögliche Darstellung Hermanns von Brüninghausen (Juliers Herold) in einer Handschrift des 17. Jahrhunderts, Brüssel, Königl. Bibliothek IV 164, vor Bl. 1r. Anrooij S. 128 Anm. 59 verweist auf C. van den Bergen-Pantens, De heraldiek ... Brüssel 1985, S. 57.
#forschung
KlausGraf - am Mittwoch, 11. April 2012, 22:51 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sehr geehrter Herr Graf,
es tut mir leid, aber eine solch anonyme Anfrage kann ich nicht bearbeiten. Bitte benennen Sie den Verwendungszweck präzise (Publikation, Arbeitstitel, Fach, Institut) und stellen Sie sich kurz vor (Name, Anschrift, Funktion).
Mit freundlichen Grüßen,
i. A.
Dr. [...]
AL Übergreifende Fachdienste
-------------------------------------------------------------------------------------------
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt
-Landesmuseum für Vorgeschichte-
Richard-Wagner-Straße 9
D-06114 Halle (Saale)
Tel. +49-345-5247320
Fax. +49-345-5247351
[...]
URL: www.lda-lsa.de
-------------------------------------------------------------------------------------------
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Klaus Graf [mailto:klausgraf@googlemail.com]
Gesendet: Freitag, 6. April 2012 18:54
An: bibliothek
Betreff: Schieferdecker
Hallo,
mit Blick auf http://archiv.twoday.net/stories/96986355/ wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir die beiden Seiten zum Weißenfelser Küchenzettel (ca. S. 9) scannen könnten aus der sehr seltenen Schrift
PPN:
137714319
Titel:
Erneuertes Gedächtniss des Weissenfelsischen Zions, oder eigentliche Beschreibung der Pfarrkirche zu unser Lieben-Frauen in Weissenfels, ... / entworffen von Joh. Dav. Schieferdecker
Verfasser:
Schieferdecker, Johann David *1672-1721*
Ort/Jahr:
Weissenfels : Wohlfahrt, [1703]
Umfang:
40 S.
Halle, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt Bibliothek
Nachgewiesen in:
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt Abteilung
Bau- und Kunstdenkmalpflege, Bibliothek
Signatur:
N 1 b : Wei 17
Standort:
BD
Besten Dank im voraus
Klaus Graf
es tut mir leid, aber eine solch anonyme Anfrage kann ich nicht bearbeiten. Bitte benennen Sie den Verwendungszweck präzise (Publikation, Arbeitstitel, Fach, Institut) und stellen Sie sich kurz vor (Name, Anschrift, Funktion).
Mit freundlichen Grüßen,
i. A.
Dr. [...]
AL Übergreifende Fachdienste
-------------------------------------------------------------------------------------------
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt
-Landesmuseum für Vorgeschichte-
Richard-Wagner-Straße 9
D-06114 Halle (Saale)
Tel. +49-345-5247320
Fax. +49-345-5247351
[...]
URL: www.lda-lsa.de
-------------------------------------------------------------------------------------------
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Klaus Graf [mailto:klausgraf@googlemail.com]
Gesendet: Freitag, 6. April 2012 18:54
An: bibliothek
Betreff: Schieferdecker
Hallo,
mit Blick auf http://archiv.twoday.net/stories/96986355/ wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir die beiden Seiten zum Weißenfelser Küchenzettel (ca. S. 9) scannen könnten aus der sehr seltenen Schrift
PPN:
137714319
Titel:
Erneuertes Gedächtniss des Weissenfelsischen Zions, oder eigentliche Beschreibung der Pfarrkirche zu unser Lieben-Frauen in Weissenfels, ... / entworffen von Joh. Dav. Schieferdecker
Verfasser:
Schieferdecker, Johann David *1672-1721*
Ort/Jahr:
Weissenfels : Wohlfahrt, [1703]
Umfang:
40 S.
Halle, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt Bibliothek
Nachgewiesen in:
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt Abteilung
Bau- und Kunstdenkmalpflege, Bibliothek
Signatur:
N 1 b : Wei 17
Standort:
BD
Besten Dank im voraus
Klaus Graf
KlausGraf - am Mittwoch, 11. April 2012, 18:32 - Rubrik: Unterhaltung
Die LINKE hat dazu eine Anfrage gestellt:
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/092/1709245.pdf
Via M. Schindler.
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/092/1709245.pdf
Via M. Schindler.
KlausGraf - am Mittwoch, 11. April 2012, 15:38 - Rubrik: E-Government
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Man kann eigentlich jeweils nur raten, ob die ganze Handschrift digitalisiert ist. Anscheinend sind etliche dort ganz einsehbar. Aber besonders dumm ist es, einen Permalink zur jeweiligen Seite zu veröffentlichen, der manuell abgetippt werden muss, weil er sich entscheidend vom Permalink für den Handschrifteneintrag unterscheidet:
Eintrag
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31570247
Seite
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/bilder/ds/hs_l_ub_ms_1429_0003r
ManuMurks eben, wie gehabt.
Eintrag
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31570247
Seite
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/bilder/ds/hs_l_ub_ms_1429_0003r
ManuMurks eben, wie gehabt.
KlausGraf - am Dienstag, 10. April 2012, 22:23 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In Manuscripta Mediaevalia sind von zahlreichen Moskaner Handschriften Schlüsselseiten eingestellt (derzeit findet die Suche nach Moskau mit Eingrenzung digitalisiert 173 Treffer). Beispiel:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31301304
zu
http://www.handschriftencensus.de/23325 (aus dem Stadtarchiv Lübeck)
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31301304
zu
http://www.handschriftencensus.de/23325 (aus dem Stadtarchiv Lübeck)
KlausGraf - am Dienstag, 10. April 2012, 22:09 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In ihrem Buch „Web 2.0 in Archiven. Hinweise für die Praxis“ versucht Susann Gutsch erstmals einen Überblick über die Möglichkeiten und Perspektiven zu geben, die das Web 2.0 für Archive bietet, diskutiert aber auch die Probleme, die damit zwangsläufig einhergehen. Da nach Aussage von Dr. Mario Glauert vom Brandenburgischen Landeshauptarchiv „viele deutsche Archive kaum im Web 1.0 angekommen sind“ hat die Arbeit durchaus Pioniercharakter.
Zu Beginn versucht sich Gutsch an einer Begriffsklärung, wobei sich eine Definition im eigentlichen Sinne als schwierig erweist, da über den spezifischen Charakter des Web 2.0 auch in der Fachwelt unterschiedliche Ansichten vorherrschen (S.11-12). Eine Annäherung gelingt schließlich über die Aufzählung wesenstypischer Merkmale, die Tim O’Reilly, der Erfinder des Begriffes, als kennzeichnend ansieht (S. 12-14). Vor allem der Aspekt der Partizipation (Einbeziehung der kollektiven Intelligenz der Nutzer) scheint hier bedeutsam zu sein. Auch die Entwicklung des Phänomens wird nachgezeichnet, ebenso die Kritik daran (S. 15-18). Schließlich wird noch die Nutzung des Web 2.0 durch Bibliotheken, die bereits in relativ hohem Maße mit Anwendungen aus diesem Bereich arbeiten, und Museen, bei denen dies, ähnlich wie bei Archiven, auf vergleichsweise geringer Basis stattfindet, untersucht (S. 18-20) und ein Überblick über den Forschungsstand zum Thema Web 2.0 und Archive gegeben (S. 20-22). Das Fazit: Im Gegensatz zum englischsprachigen Raum gibt es in Deutschland bisher so gut wie keine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Web 2.0 in der Archivliteratur.
In den folgenden Kapiteln versucht Gutsch darzulegen, wie die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten des Web 2.0 auch im Archivwesen gewinnbringend eingesetzt werden könnten, wobei der Mehrwert für die Archive vor allem in den deutlich schnelleren und vielfältigeren Möglichkeiten der Kommunikation mit den Nutzern besteht. Mehrere Studien belegen offensichtlich, dass die Nutzung von Web 2.0 Applikationen durch Archive nicht nur zu einem Anstieg der Nutzerzahlen führt, sondern auch zur Erschließung gänzlich neuer Nutzerpotentiale, die mit der Materie Archiv sonst kaum in Kontakt kämen.
Zunächst erklärt Gutsch die Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten einiger Web 2.0 Elemente, die sich keiner einzelnen Anwendung zuordnen lassen, wie Tagging, Social Bookmarking oder RSS (S. 26-31). Dann folgen die detaillierten Erörterungen zu besagten selbstständigen Anwendungen, die zunächst beschrieben und anschließend auf ihren möglichen Nutzen für Archive hin untersucht werden. Ans Ende setzt Gutsch dann noch jeweils ein konkretes Anwendungsbeispiel aus der Praxis, das dem Leser Funktion und Wirkweise der Applikationen im Zusammenhang mit ihrer archivalischen Nutzung noch einmal verdeutlicht.
Für Weblogs (S. 31-44) betont die Autorin vor allem ihre Möglichkeiten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing und stellt eine typologische Unterteilung nach Kate Theimer vor: Institutional Blogs dienen vor allem zur Verbreitung und Bekanntmachung von Neuigkeiten und können sowohl intern als auch extern verwendet werden. Processing Blogs dokumentieren für die Öffentlichkeit die Erschließung eines bestimmten Bestandes, während Archival Content Blogs die direkte Publikation ausgewählter Archivalien beinhalten (z.B. Archivale des Monats). Blogs Supporting Traditional Archival Systems schließlich dienen der Unterstützung archivalischer Arbeit, wie etwa der Dokumentation von Anfrage-Recherchen, die dann später auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können.
Für das Betreiben eines Wikis (S. 45-59) ist vor allem ein adäquat großer Nutzerkreis ratsam, weshalb diese Anwendung hauptsächlich für größere Archive und/oder in Form einer Kooperation mit anderen Einrichtungen relevant ist. Es eignet sich besonders als Instrument zur Planung, Vorbereitung und Zusammenarbeit, kann aber auch im Benutzerservice Anwendung finden. Von einer Verwendung als Homepage-Ersatz oder als Ort für das Verzeichnen von Beständen rät Gutsch dagegen eher ab.
Für die Nutzung von Crowdsourcing (S. 60-73) gibt es im Archivwesen zwei unterschiedliche Ansätze: Das Archiv betätigt sich mit seiner Arbeitskraft und Fachkompetenz als Crowdsourcer an der Problemlösung anderer, oder es lagert selbst bestimmte Tätigkeiten aus und beteiligt die Internetgemeinde somit an der Lösung eigener Fragestellungen. Grundsätzlich wird die Beteiligung an Crowdsourcing durch die Autorin sehr positiv bewertet. Der Bereich Bewertung sollte dabei allerdings ausgespart werden, da er von externen Nutzern nicht geleistet werden kann.
Auch das Photo Sharing (S. 74-86) dient vor allem dazu, der Öffentlichkeit regelmäßig Inhalte aus den eigenen Beständen (im Idealfall natürlich Fotografie) zu präsentieren (z. B. Bilderfreitag). Auch hier kann versucht werden, die Nutzer zur aktiven Beteiligung zu animieren, etwa eigenes Material beizusteuern. In jedem Fall kann auf diesem Wege der Kontakt zwischen Archiv und Benutzern intensiviert und das Image der Archive verbessert werden.
Ähnliches gilt auch für das Social Networking (S. 86-100), das primär ein Instrument der Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Nutzerakquise- und Kommunikation ist. Aufgrund seiner großen Verbreitung und vielen Applikationen empfiehlt Gutsch vor allem eine Präsenz bei Facebook, aber auch der Aufbau eines eigenen Netzwerkes kann sinnvoll sein.
Im Folgenden werden dem Leser Funktion und Bedeutung weiterer Elemente des Web 2.0 in kurzer Form erläutert. Dazu gehören das Podcasting (S. 100-103), das Video Sharing (S. 103-106), das Microblogging (S. 106-108) und Mashups (S. 108-110). Sie alle sind mehr oder weniger Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit und dienen insbesondere der Verbesserung des Dialogs mit den Benutzern: Der Bereich des Archivwesens, welcher sich durch eine Annäherung an das Web 2.0 am meisten verändern könnte.
Die letzte Teilrubrik in Gutschs Aufzählung ist den Online-Findbüchern vorbehalten (S. 110-112), also Findbüchern, die im Internet einsehbar sind. Eine solche Präsentation der eigenen Bestände, insbesondere wenn sie mit Web 2.0 Techniken verknüpft ist (hier ist z. B. das Tagging zu nennen), vergrößert nicht nur den potentiellen Nutzerkreis, sondern könnte auch zu einer deutlichen Verbesserung der Recherchemöglichkeiten führen.
Zum Schluss wendet sich die Autorin schließlich den Grenzen zu, die naturgemäß auch dem Web 2.0 gesetzt sind, und der sich insbesondere diejenigen, die mit seinen Elementen arbeiten, bewusst sein sollten (S. 113-120). Diese Grenzen werden gerade beim Stichwort „Mitmach-Archiv“, und der damit verbundenen Frage deutlich, inwieweit man die Kontrolle über die eigenen archivalischen Inhalte abgeben kann und darf. In manchen Bereichen, wie etwa der Bewertung, muss die letzte Entscheidungskompetenz immer in den Händen des Archivars verbleiben. Gutsch warnt vor zu hohen Erwartungen an das Web 2.0, verweist auf die Notwendigkeit, über die bloße Bereitstellung technischer Anwendungen hinaus auf die Nutzer zuzugehen und macht auf bestehende Risiken und einen gesteigerten Arbeitsaufwand aufmerksam.
Dennoch, so ihr Fazit (S. 121-125), kann man den Archiven nur zu mehr Offenheit im Umgang mit den Möglichkeiten raten, die das Web 2.0 bietet. Diese sollten als Chance, nicht als zusätzliche Belastung begriffen werden und böten vielfältige Möglichkeiten zur Verbesserung insbesondere von Nutzerservice und Imagepflege. Ihr Buch kann als eindeutiges Plädoyer für eine verstärkte Nutzung dieser Möglichkeiten verstanden wissen, denn gerade im deutschsprachigen Raum besteht hier im Archivwesen noch eindeutig Nachholbedarf. Das Web 2.0, so schließt die Autorin, „ist nicht die Zukunft, es ist die Gegenwart – auch für Archive.“
Entstanden im Rahmen eines Praktikums beim Hochschularchiv der RWTH Aachen.
Zu Beginn versucht sich Gutsch an einer Begriffsklärung, wobei sich eine Definition im eigentlichen Sinne als schwierig erweist, da über den spezifischen Charakter des Web 2.0 auch in der Fachwelt unterschiedliche Ansichten vorherrschen (S.11-12). Eine Annäherung gelingt schließlich über die Aufzählung wesenstypischer Merkmale, die Tim O’Reilly, der Erfinder des Begriffes, als kennzeichnend ansieht (S. 12-14). Vor allem der Aspekt der Partizipation (Einbeziehung der kollektiven Intelligenz der Nutzer) scheint hier bedeutsam zu sein. Auch die Entwicklung des Phänomens wird nachgezeichnet, ebenso die Kritik daran (S. 15-18). Schließlich wird noch die Nutzung des Web 2.0 durch Bibliotheken, die bereits in relativ hohem Maße mit Anwendungen aus diesem Bereich arbeiten, und Museen, bei denen dies, ähnlich wie bei Archiven, auf vergleichsweise geringer Basis stattfindet, untersucht (S. 18-20) und ein Überblick über den Forschungsstand zum Thema Web 2.0 und Archive gegeben (S. 20-22). Das Fazit: Im Gegensatz zum englischsprachigen Raum gibt es in Deutschland bisher so gut wie keine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Web 2.0 in der Archivliteratur.
In den folgenden Kapiteln versucht Gutsch darzulegen, wie die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten des Web 2.0 auch im Archivwesen gewinnbringend eingesetzt werden könnten, wobei der Mehrwert für die Archive vor allem in den deutlich schnelleren und vielfältigeren Möglichkeiten der Kommunikation mit den Nutzern besteht. Mehrere Studien belegen offensichtlich, dass die Nutzung von Web 2.0 Applikationen durch Archive nicht nur zu einem Anstieg der Nutzerzahlen führt, sondern auch zur Erschließung gänzlich neuer Nutzerpotentiale, die mit der Materie Archiv sonst kaum in Kontakt kämen.
Zunächst erklärt Gutsch die Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten einiger Web 2.0 Elemente, die sich keiner einzelnen Anwendung zuordnen lassen, wie Tagging, Social Bookmarking oder RSS (S. 26-31). Dann folgen die detaillierten Erörterungen zu besagten selbstständigen Anwendungen, die zunächst beschrieben und anschließend auf ihren möglichen Nutzen für Archive hin untersucht werden. Ans Ende setzt Gutsch dann noch jeweils ein konkretes Anwendungsbeispiel aus der Praxis, das dem Leser Funktion und Wirkweise der Applikationen im Zusammenhang mit ihrer archivalischen Nutzung noch einmal verdeutlicht.
Für Weblogs (S. 31-44) betont die Autorin vor allem ihre Möglichkeiten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing und stellt eine typologische Unterteilung nach Kate Theimer vor: Institutional Blogs dienen vor allem zur Verbreitung und Bekanntmachung von Neuigkeiten und können sowohl intern als auch extern verwendet werden. Processing Blogs dokumentieren für die Öffentlichkeit die Erschließung eines bestimmten Bestandes, während Archival Content Blogs die direkte Publikation ausgewählter Archivalien beinhalten (z.B. Archivale des Monats). Blogs Supporting Traditional Archival Systems schließlich dienen der Unterstützung archivalischer Arbeit, wie etwa der Dokumentation von Anfrage-Recherchen, die dann später auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können.
Für das Betreiben eines Wikis (S. 45-59) ist vor allem ein adäquat großer Nutzerkreis ratsam, weshalb diese Anwendung hauptsächlich für größere Archive und/oder in Form einer Kooperation mit anderen Einrichtungen relevant ist. Es eignet sich besonders als Instrument zur Planung, Vorbereitung und Zusammenarbeit, kann aber auch im Benutzerservice Anwendung finden. Von einer Verwendung als Homepage-Ersatz oder als Ort für das Verzeichnen von Beständen rät Gutsch dagegen eher ab.
Für die Nutzung von Crowdsourcing (S. 60-73) gibt es im Archivwesen zwei unterschiedliche Ansätze: Das Archiv betätigt sich mit seiner Arbeitskraft und Fachkompetenz als Crowdsourcer an der Problemlösung anderer, oder es lagert selbst bestimmte Tätigkeiten aus und beteiligt die Internetgemeinde somit an der Lösung eigener Fragestellungen. Grundsätzlich wird die Beteiligung an Crowdsourcing durch die Autorin sehr positiv bewertet. Der Bereich Bewertung sollte dabei allerdings ausgespart werden, da er von externen Nutzern nicht geleistet werden kann.
Auch das Photo Sharing (S. 74-86) dient vor allem dazu, der Öffentlichkeit regelmäßig Inhalte aus den eigenen Beständen (im Idealfall natürlich Fotografie) zu präsentieren (z. B. Bilderfreitag). Auch hier kann versucht werden, die Nutzer zur aktiven Beteiligung zu animieren, etwa eigenes Material beizusteuern. In jedem Fall kann auf diesem Wege der Kontakt zwischen Archiv und Benutzern intensiviert und das Image der Archive verbessert werden.
Ähnliches gilt auch für das Social Networking (S. 86-100), das primär ein Instrument der Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Nutzerakquise- und Kommunikation ist. Aufgrund seiner großen Verbreitung und vielen Applikationen empfiehlt Gutsch vor allem eine Präsenz bei Facebook, aber auch der Aufbau eines eigenen Netzwerkes kann sinnvoll sein.
Im Folgenden werden dem Leser Funktion und Bedeutung weiterer Elemente des Web 2.0 in kurzer Form erläutert. Dazu gehören das Podcasting (S. 100-103), das Video Sharing (S. 103-106), das Microblogging (S. 106-108) und Mashups (S. 108-110). Sie alle sind mehr oder weniger Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit und dienen insbesondere der Verbesserung des Dialogs mit den Benutzern: Der Bereich des Archivwesens, welcher sich durch eine Annäherung an das Web 2.0 am meisten verändern könnte.
Die letzte Teilrubrik in Gutschs Aufzählung ist den Online-Findbüchern vorbehalten (S. 110-112), also Findbüchern, die im Internet einsehbar sind. Eine solche Präsentation der eigenen Bestände, insbesondere wenn sie mit Web 2.0 Techniken verknüpft ist (hier ist z. B. das Tagging zu nennen), vergrößert nicht nur den potentiellen Nutzerkreis, sondern könnte auch zu einer deutlichen Verbesserung der Recherchemöglichkeiten führen.
Zum Schluss wendet sich die Autorin schließlich den Grenzen zu, die naturgemäß auch dem Web 2.0 gesetzt sind, und der sich insbesondere diejenigen, die mit seinen Elementen arbeiten, bewusst sein sollten (S. 113-120). Diese Grenzen werden gerade beim Stichwort „Mitmach-Archiv“, und der damit verbundenen Frage deutlich, inwieweit man die Kontrolle über die eigenen archivalischen Inhalte abgeben kann und darf. In manchen Bereichen, wie etwa der Bewertung, muss die letzte Entscheidungskompetenz immer in den Händen des Archivars verbleiben. Gutsch warnt vor zu hohen Erwartungen an das Web 2.0, verweist auf die Notwendigkeit, über die bloße Bereitstellung technischer Anwendungen hinaus auf die Nutzer zuzugehen und macht auf bestehende Risiken und einen gesteigerten Arbeitsaufwand aufmerksam.
Dennoch, so ihr Fazit (S. 121-125), kann man den Archiven nur zu mehr Offenheit im Umgang mit den Möglichkeiten raten, die das Web 2.0 bietet. Diese sollten als Chance, nicht als zusätzliche Belastung begriffen werden und böten vielfältige Möglichkeiten zur Verbesserung insbesondere von Nutzerservice und Imagepflege. Ihr Buch kann als eindeutiges Plädoyer für eine verstärkte Nutzung dieser Möglichkeiten verstanden wissen, denn gerade im deutschsprachigen Raum besteht hier im Archivwesen noch eindeutig Nachholbedarf. Das Web 2.0, so schließt die Autorin, „ist nicht die Zukunft, es ist die Gegenwart – auch für Archive.“
Entstanden im Rahmen eines Praktikums beim Hochschularchiv der RWTH Aachen.
Leo Vössing - am Dienstag, 10. April 2012, 19:02
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zur Handesblattkapagne gegen eine Liberalisierung des Urheberrechts gibts nicht nur viel auf Twitter #wasimhandelsblattfehlt, sondern auch Linkhinweise auf
http://www.bildblog.de/37905/urheberrecht-warm-upper-kaninchenzuechter/
und eine ausführliche Stellungnahme von Rainer Kuhlen
http://www.inf.uni-konstanz.de/netethicsblog/?p=499
http://www.bildblog.de/37905/urheberrecht-warm-upper-kaninchenzuechter/
und eine ausführliche Stellungnahme von Rainer Kuhlen
http://www.inf.uni-konstanz.de/netethicsblog/?p=499
KlausGraf - am Dienstag, 10. April 2012, 16:26 - Rubrik: Archivrecht
'Zeit was zu ändern!': Die Herausforderungen der Globalisierung und die Rolle der Wirtschaftsarchiv(ar)e. Archivare aus China und deutschsprachigen Ländern: One step together (75. VdW-Lehrgang)
Veranstalter: Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e.V. VdW
Datum, Ort: 10.06.2012-13.06.2012, Frankfurt am Main, Museum für Kommunikation, Schaumainkai 53, 60596 Frankfurt am Main
Deadline: 05.06.2012
Für Wirtschaftsarchivare und -historiker ist der Blick über die Grenzen selbstverständlich geworden. Denn als Folge der Globalisierung finden längst nicht mehr alle Unterlagen (ob aus Papier oder elektronisch) zielsicheren Weg in das (heimische) Konzernarchiv. Überlieferungslücken drohen insbesondere, sobald nicht allein Produktions- und Vertriebseinheiten, sondern ebenso innovative Forschungs- und Entwicklungs- oder strategische Organisationseinheiten ins Ausland verlegt werden. Dann ist der Aufbau archivischer Strukturen im Ausland oder einer gemeinsamen unternehmensinternen Archivplattform gefordert ... Was aber tun, wenn das Fallbeispiel China heißt? Und nicht allein sprachliche, sondern zusätzliche interkulturelle Barrieren zu überwinden sind? – Um Überlieferungslücken zu vermeiden oder wenigstens zu begrenzen, um die Leistungsfähigkeit des Unternehmensarchivs auch in Zukunft zu gewährleisten, dabei kann ein auf kollegialer sowie freundschaftlicher Grundlage aufzubauendes Netzwerk der Archivare einen entscheidenden Beitrag leisten. Es geht somit um gegenseitiges Kennenlernen, gegenseitiges Verständnis, um kollegialen Respekt, um Vertrauen und um freundschaftliche Beziehungen. Ein solches Netzwerk persönlicher Beziehungen (chinesisch Guanxi) vermag dem Archivar/Historiker Unterstützung auf Gegenseitigkeit zu sichern. Woran die Unternehmen wie ihre Archive ebenso partizipieren wie die wirtschaftsgeschichtliche Forschung und die Völkerverständigung. Als Jubiläumslehrgang bietet die Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare die Teilnahme am 75. Kurs zu einer eher symbolischen Schutz- und Verwaltungsgebühr von 75€ an. Und sie bietet Zugriff auf ein ebenso kostengünstiges wie zentrales Hotelkontingent (pro Nacht inkl. Frühstück 57-74€). Der 75. Lehrgang im 55. Jahr des Bestehens der VdW erscheint eingebettet in das 40. Jahr seit Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der VR China und der BRD. Die Vortragenden kommen aus China und den deutschsprachigen Ländern. Konferenzsprachen sind Chinesisch und Deutsch! Dolmetscher übersetzen (passagenweise) in die jeweils andere Sprache. Der Kurs wird gefördert von zahlreichen Einzelpersonen (z.B. Robert CAO, Mitbegründer u. Geschäftsführer des China Center Düsseldorf), Einrichtungen (u.a. Chinesisches Generalkonsulat Frankfurt, Chinesische Handelszeitung) und Firmen (u.a. Deutsche Bank AG, Evonik Services GmbH). Weitere Informationen (Programm, Anmeldeformular) unter: www.wirtschaftsarchive.de/archivwesen/aus-und-weiterbildung/75.-vdw-lehrgang.
Die Fortbildungsveranstaltung richtet sich in erster Linie an Wirtschaftsarchivare und Wirtschaftshistoriker. Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist limitiert; über die Zulassung zum Kurs entscheidet die Kursleitung. Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme besteht nicht. Mit Zulassung zum Kurs und Überweisung der Teilnahmegebühr sind abgegolten: Tagesverpflegung (Mittagessen/Kaffeepausen, Abendessen von Sonntag bis Dienstagabend), Teilnahme an den organisierten Transfers vom Hotel zu bzw. zwischen den wechselnden Austragungsorten). Möglichkeit einer kostengünstigen und zentralen Unterbringung im Hotel Ramada Frankfurt City Center pro Nacht inkl. Frühstück ab 57€ besteht über ein von der VdW reserviertes Hotelkontingent. Für Rückfragen steht der genannte Ansprechpartner gern zur Verfügung!
Sonntag, 10. Juni 2012, Fraport, Frankfurt Airport Services Worldwide, 60547 Frankfurt am Main, (angefragt), Bustransfer Hotel-Fraport-Hotel wird eingerichtet, Abfahrtszeiten folgen
18:00 Uhr: Empfang – Begrüßung
Dr. Peter Blum, VdW Ressort Aus- u. Weiterbildung, Neidenstein
WEN Zhenshun, Generalkonsul der Volksrepublik China, Frankfurt/Main
Michael Jurk M.A., Vorsitzender der Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e.V./Commerzbank AG, Frankfurt/Main
Dr. Michael Hollmann, Präsident des Bundesarchivs, Koblenz
Eröffnungsvortrag
„Wir leisten nur einen kleinen Beitrag, aber jeder kleine Stein zählt und ist wichtig“
CAO Robert, Initiator u. Geschäftsführer des Düsseldorf China Center/General Manager Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd.
19:00 Uhr: Gemeinsames Abendessen auf Einladung der Fraport AG (angefragt)
20:15 Uhr: Kurzes „Who is who?“
(chinesische Gäste, Kursteilnehmer, anwesende Referenten und Mitwirkende)
Montag, 11. Juni 2012, Museum für Kommunikation Frankfurt, Schaumainkai 53, 60596 Frankfurt/Main, Filmsaal
8:30 Uhr: Sektion 1: Globale Herausforderungen meistern durch mehr Kooperation und Vernetzung – Stärkere Kooperation braucht über sprachliches Verstehen hinaus gegenseitiges Verständnis:
Interkulturelle Annäherungen an Deutschland
MAO Zuhui, SinaLingua e.K., Heidelberg/Shanghai
9:30 Uhr: Kaffee-/Teepause
9:45 Uhr: Interkulturelle Annäherungen an China
Dr. Manuel Vermeer, Dr. Vermeer-Consult, Gaiberg bei Heidelberg/Ostasieninstitut FH Ludwigshafen
10:45 Uhr: Kaffee-/Teepause
11:00 Uhr: Sektion 2: Quellen zur Wirtschaftsgeschichte und die Rolle der Archivare in China und Deutschland:
2.1 Einzelvorträge, Fragen, Diskussion
12:30 Uhr: Gemeinsames Mittagessen
13:45 Uhr: 2.2 Einzelvorträge, Fragen, Diskussion
15:30 Uhr: Kaffee-/Teepause
15:45 Uhr: 2.3 Einzelvorträge, Fragen, Diskussion
Abendveranstaltung: Deutsche Bank, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt/Main
19:00 Uhr: Begrüßung und kurze Einführung
Die Geschichte der Deutschen Bank in China
Dr. Martin L. Müller, Historisches Institut der Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
Vortrag
Mehr als ein Grußwort: Grenzen überwinden, Unterstützung sowie Kollegen und neue Freunde finden …
Andreas Kellerhals, Vice-President Finance u. Mitglied anderer Vorstandsgremien des Internationalen Archivrats ICA/Direktor Schweizerisches Bundesarchiv, Bern, CH
Rundgang durch den BrandSpace
20:30 Uhr: Gemeinsames Abendbuffet auf Einladung der Deutsche Bank AG
Dienstag, 12. Juni 2012, Museum für Kommunikation Frankfurt, Schaumainkai 53, 60596 Frankfurt/Main, Filmsaal
8:45 Uhr: Fortsetzung
Sektion 2: Quellen zur Wirtschaftsgeschichte und die Rolle der Archivare in China und Deutschland
2.4 Einzelvorträge, Fragen, Diskussion
10:15 Uhgr: Kaffee-/Teepause
10:30 Uhr: 2.5 Einzelvorträge, Fragen, Diskussion
12:15 Uhr: Gemeinsames Mittagessen
13:30 Uhr: Sektion 3: Andere Perspektive – veränderte Wahrnehmung – neue Chancen
Social media – Neue Formen der Kommunikation unter Archivaren und mit Archivbenutzern
Dr. Klaus Graf, WEBLOG Archivalia/Hochschularchiv Aachen
Trennendes und Verbindendes: Kenntnis und Verständnis als Schlüssel engerer facharchivischer Zusammenarbeit
Dr. Vivian Wagner, Sinologin
14:45 Uhr: Kaffee-/Teepause
15:00 Uhr: Bustransfer nach Hanau
Konzernarchiv Evonik Services GmbH, 711-108, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau-Wolfgang
15:45 Uhr: Sektion 4: Cake talk – how about a cup of tea?
spontaner Austausch in lockerer Runde über alles, was chinesische u. deutschsprachige Archivare bewegt – Option insbes. für Kursteilnehmer, sich mit konkreten Themen u. in eigener Sache einzubringen
17:45 Uhr: Archivführung: Temperaturregulierung und Dämmung mit Lehm
Dr. Andrea Hohmeyer, Konzernarchiv Evonik Services GmbH
ca. 18:00 Uhr: Sektion 5: Blick über den Tellerrand – Gemeinsam statt einsam: Lokal, regional … global
Der VdW-Arbeitskreis Globalisierung
Doris Eizenhöfer M.A., AK-Vorsitzende/Konzernarchiv Evonik Services GmbH, Hanau
Die ICA-Sektion „Business and Labour Archives“
Dr. Karl-Peter Ellerbrock, Vorstandsmitglied ICA-SBL/Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv, Dortmund
18:30 Uhr: Gemeinsames Abendessen auf Einladung der Evonik Services GmbH
21:00 Uhr: Abschlusscommuniqué – Ausgabe Zertifikate – Verabschiedung
Mittwoch, 13. Juni 2012
8:30 Uhr: Abfahrt Fachexkursion zum Krupp-Archiv/zur Villa Hügel nach Essen (chinesische Delegationsteilnehmer)
Allgemeine Informationen, auch zu den Örtlichkeiten (Info und Anreise):
Hotel Ramada Frankfurt City Center & Financial District, Weserstr. 17, 60329 Frankfurt/Main, www.ramada-frankfurt.com/index.html
Fraport (angefragt), Frankfurt Airport Services Worldwide, 60547 Frankfurt am Main, www.wirtschaftsarchivportal.de/archiv/details/id/17 – www.fraport.de/content/fraport-ag/de/misc/binaer/anfahrtsplan/jcr:content.file/file.pdf
Museum für Kommunikation, Schaumainkai, 53, 60596 Frankfurt/Main, Filmsaal, www.mfk-frankfurt.de/besuch/service-infos.html
Deutsche Bank, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt/Main, The BrandSpace, brandspace.de/brandspace/de/index_flash.html
Konzernarchiv Evonik Services GmbH, 711-108, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau-Wolfgang, geschichte.evonik.de/sites/geschichte/de/kontakt/pages/default.aspx
Für Sonntag (Hotel–Fraport–Hotel) und Dienstag (Museum für Kommunikation–Evonik–Hotel) werden rechtzeitig Transfermöglichkeiten bereitgestellt.
Sobald als möglich, werden in Sektion 2 die Abfolge der einzelnen Vorträge, als auch die Namen und die jeweiligen Vortragsthemen der Referenten ergänzt. Wir bitten um Verständnis, dass eine sinnvolle Zusammenstellung/Abfolge der verschiedenen chinesischen und deutschsprachigen Vorträge aufgrund der chinesischen Modalitäten für Dienst- und Ausreisegenehmigungen, denen unsere chinesischen Kollegen unterliegen, erst zeitnah abgestimmt werden kann.
Kontakt:
Peter Dr. Blum
Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare VdW/Stadtarchiv Heidelberg,
Heiliggeiststr. 12, 69117 Heidelberg
06221 - 5819800
06221 - 5849470
peter.blum@heidelberg.de
URL: Homepage der Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e.V. VdW mit allen Informationen zum 75. VdW-Lehrgang
URL zur Zitation dieses Beitrageshttp://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=18939
Veranstalter: Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e.V. VdW
Datum, Ort: 10.06.2012-13.06.2012, Frankfurt am Main, Museum für Kommunikation, Schaumainkai 53, 60596 Frankfurt am Main
Deadline: 05.06.2012
Für Wirtschaftsarchivare und -historiker ist der Blick über die Grenzen selbstverständlich geworden. Denn als Folge der Globalisierung finden längst nicht mehr alle Unterlagen (ob aus Papier oder elektronisch) zielsicheren Weg in das (heimische) Konzernarchiv. Überlieferungslücken drohen insbesondere, sobald nicht allein Produktions- und Vertriebseinheiten, sondern ebenso innovative Forschungs- und Entwicklungs- oder strategische Organisationseinheiten ins Ausland verlegt werden. Dann ist der Aufbau archivischer Strukturen im Ausland oder einer gemeinsamen unternehmensinternen Archivplattform gefordert ... Was aber tun, wenn das Fallbeispiel China heißt? Und nicht allein sprachliche, sondern zusätzliche interkulturelle Barrieren zu überwinden sind? – Um Überlieferungslücken zu vermeiden oder wenigstens zu begrenzen, um die Leistungsfähigkeit des Unternehmensarchivs auch in Zukunft zu gewährleisten, dabei kann ein auf kollegialer sowie freundschaftlicher Grundlage aufzubauendes Netzwerk der Archivare einen entscheidenden Beitrag leisten. Es geht somit um gegenseitiges Kennenlernen, gegenseitiges Verständnis, um kollegialen Respekt, um Vertrauen und um freundschaftliche Beziehungen. Ein solches Netzwerk persönlicher Beziehungen (chinesisch Guanxi) vermag dem Archivar/Historiker Unterstützung auf Gegenseitigkeit zu sichern. Woran die Unternehmen wie ihre Archive ebenso partizipieren wie die wirtschaftsgeschichtliche Forschung und die Völkerverständigung. Als Jubiläumslehrgang bietet die Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare die Teilnahme am 75. Kurs zu einer eher symbolischen Schutz- und Verwaltungsgebühr von 75€ an. Und sie bietet Zugriff auf ein ebenso kostengünstiges wie zentrales Hotelkontingent (pro Nacht inkl. Frühstück 57-74€). Der 75. Lehrgang im 55. Jahr des Bestehens der VdW erscheint eingebettet in das 40. Jahr seit Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der VR China und der BRD. Die Vortragenden kommen aus China und den deutschsprachigen Ländern. Konferenzsprachen sind Chinesisch und Deutsch! Dolmetscher übersetzen (passagenweise) in die jeweils andere Sprache. Der Kurs wird gefördert von zahlreichen Einzelpersonen (z.B. Robert CAO, Mitbegründer u. Geschäftsführer des China Center Düsseldorf), Einrichtungen (u.a. Chinesisches Generalkonsulat Frankfurt, Chinesische Handelszeitung) und Firmen (u.a. Deutsche Bank AG, Evonik Services GmbH). Weitere Informationen (Programm, Anmeldeformular) unter: www.wirtschaftsarchive.de/archivwesen/aus-und-weiterbildung/75.-vdw-lehrgang.
Die Fortbildungsveranstaltung richtet sich in erster Linie an Wirtschaftsarchivare und Wirtschaftshistoriker. Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist limitiert; über die Zulassung zum Kurs entscheidet die Kursleitung. Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme besteht nicht. Mit Zulassung zum Kurs und Überweisung der Teilnahmegebühr sind abgegolten: Tagesverpflegung (Mittagessen/Kaffeepausen, Abendessen von Sonntag bis Dienstagabend), Teilnahme an den organisierten Transfers vom Hotel zu bzw. zwischen den wechselnden Austragungsorten). Möglichkeit einer kostengünstigen und zentralen Unterbringung im Hotel Ramada Frankfurt City Center pro Nacht inkl. Frühstück ab 57€ besteht über ein von der VdW reserviertes Hotelkontingent. Für Rückfragen steht der genannte Ansprechpartner gern zur Verfügung!
Sonntag, 10. Juni 2012, Fraport, Frankfurt Airport Services Worldwide, 60547 Frankfurt am Main, (angefragt), Bustransfer Hotel-Fraport-Hotel wird eingerichtet, Abfahrtszeiten folgen
18:00 Uhr: Empfang – Begrüßung
Dr. Peter Blum, VdW Ressort Aus- u. Weiterbildung, Neidenstein
WEN Zhenshun, Generalkonsul der Volksrepublik China, Frankfurt/Main
Michael Jurk M.A., Vorsitzender der Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e.V./Commerzbank AG, Frankfurt/Main
Dr. Michael Hollmann, Präsident des Bundesarchivs, Koblenz
Eröffnungsvortrag
„Wir leisten nur einen kleinen Beitrag, aber jeder kleine Stein zählt und ist wichtig“
CAO Robert, Initiator u. Geschäftsführer des Düsseldorf China Center/General Manager Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd.
19:00 Uhr: Gemeinsames Abendessen auf Einladung der Fraport AG (angefragt)
20:15 Uhr: Kurzes „Who is who?“
(chinesische Gäste, Kursteilnehmer, anwesende Referenten und Mitwirkende)
Montag, 11. Juni 2012, Museum für Kommunikation Frankfurt, Schaumainkai 53, 60596 Frankfurt/Main, Filmsaal
8:30 Uhr: Sektion 1: Globale Herausforderungen meistern durch mehr Kooperation und Vernetzung – Stärkere Kooperation braucht über sprachliches Verstehen hinaus gegenseitiges Verständnis:
Interkulturelle Annäherungen an Deutschland
MAO Zuhui, SinaLingua e.K., Heidelberg/Shanghai
9:30 Uhr: Kaffee-/Teepause
9:45 Uhr: Interkulturelle Annäherungen an China
Dr. Manuel Vermeer, Dr. Vermeer-Consult, Gaiberg bei Heidelberg/Ostasieninstitut FH Ludwigshafen
10:45 Uhr: Kaffee-/Teepause
11:00 Uhr: Sektion 2: Quellen zur Wirtschaftsgeschichte und die Rolle der Archivare in China und Deutschland:
2.1 Einzelvorträge, Fragen, Diskussion
12:30 Uhr: Gemeinsames Mittagessen
13:45 Uhr: 2.2 Einzelvorträge, Fragen, Diskussion
15:30 Uhr: Kaffee-/Teepause
15:45 Uhr: 2.3 Einzelvorträge, Fragen, Diskussion
Abendveranstaltung: Deutsche Bank, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt/Main
19:00 Uhr: Begrüßung und kurze Einführung
Die Geschichte der Deutschen Bank in China
Dr. Martin L. Müller, Historisches Institut der Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
Vortrag
Mehr als ein Grußwort: Grenzen überwinden, Unterstützung sowie Kollegen und neue Freunde finden …
Andreas Kellerhals, Vice-President Finance u. Mitglied anderer Vorstandsgremien des Internationalen Archivrats ICA/Direktor Schweizerisches Bundesarchiv, Bern, CH
Rundgang durch den BrandSpace
20:30 Uhr: Gemeinsames Abendbuffet auf Einladung der Deutsche Bank AG
Dienstag, 12. Juni 2012, Museum für Kommunikation Frankfurt, Schaumainkai 53, 60596 Frankfurt/Main, Filmsaal
8:45 Uhr: Fortsetzung
Sektion 2: Quellen zur Wirtschaftsgeschichte und die Rolle der Archivare in China und Deutschland
2.4 Einzelvorträge, Fragen, Diskussion
10:15 Uhgr: Kaffee-/Teepause
10:30 Uhr: 2.5 Einzelvorträge, Fragen, Diskussion
12:15 Uhr: Gemeinsames Mittagessen
13:30 Uhr: Sektion 3: Andere Perspektive – veränderte Wahrnehmung – neue Chancen
Social media – Neue Formen der Kommunikation unter Archivaren und mit Archivbenutzern
Dr. Klaus Graf, WEBLOG Archivalia/Hochschularchiv Aachen
Trennendes und Verbindendes: Kenntnis und Verständnis als Schlüssel engerer facharchivischer Zusammenarbeit
Dr. Vivian Wagner, Sinologin
14:45 Uhr: Kaffee-/Teepause
15:00 Uhr: Bustransfer nach Hanau
Konzernarchiv Evonik Services GmbH, 711-108, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau-Wolfgang
15:45 Uhr: Sektion 4: Cake talk – how about a cup of tea?
spontaner Austausch in lockerer Runde über alles, was chinesische u. deutschsprachige Archivare bewegt – Option insbes. für Kursteilnehmer, sich mit konkreten Themen u. in eigener Sache einzubringen
17:45 Uhr: Archivführung: Temperaturregulierung und Dämmung mit Lehm
Dr. Andrea Hohmeyer, Konzernarchiv Evonik Services GmbH
ca. 18:00 Uhr: Sektion 5: Blick über den Tellerrand – Gemeinsam statt einsam: Lokal, regional … global
Der VdW-Arbeitskreis Globalisierung
Doris Eizenhöfer M.A., AK-Vorsitzende/Konzernarchiv Evonik Services GmbH, Hanau
Die ICA-Sektion „Business and Labour Archives“
Dr. Karl-Peter Ellerbrock, Vorstandsmitglied ICA-SBL/Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv, Dortmund
18:30 Uhr: Gemeinsames Abendessen auf Einladung der Evonik Services GmbH
21:00 Uhr: Abschlusscommuniqué – Ausgabe Zertifikate – Verabschiedung
Mittwoch, 13. Juni 2012
8:30 Uhr: Abfahrt Fachexkursion zum Krupp-Archiv/zur Villa Hügel nach Essen (chinesische Delegationsteilnehmer)
Allgemeine Informationen, auch zu den Örtlichkeiten (Info und Anreise):
Hotel Ramada Frankfurt City Center & Financial District, Weserstr. 17, 60329 Frankfurt/Main, www.ramada-frankfurt.com/index.html
Fraport (angefragt), Frankfurt Airport Services Worldwide, 60547 Frankfurt am Main, www.wirtschaftsarchivportal.de/archiv/details/id/17 – www.fraport.de/content/fraport-ag/de/misc/binaer/anfahrtsplan/jcr:content.file/file.pdf
Museum für Kommunikation, Schaumainkai, 53, 60596 Frankfurt/Main, Filmsaal, www.mfk-frankfurt.de/besuch/service-infos.html
Deutsche Bank, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt/Main, The BrandSpace, brandspace.de/brandspace/de/index_flash.html
Konzernarchiv Evonik Services GmbH, 711-108, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau-Wolfgang, geschichte.evonik.de/sites/geschichte/de/kontakt/pages/default.aspx
Für Sonntag (Hotel–Fraport–Hotel) und Dienstag (Museum für Kommunikation–Evonik–Hotel) werden rechtzeitig Transfermöglichkeiten bereitgestellt.
Sobald als möglich, werden in Sektion 2 die Abfolge der einzelnen Vorträge, als auch die Namen und die jeweiligen Vortragsthemen der Referenten ergänzt. Wir bitten um Verständnis, dass eine sinnvolle Zusammenstellung/Abfolge der verschiedenen chinesischen und deutschsprachigen Vorträge aufgrund der chinesischen Modalitäten für Dienst- und Ausreisegenehmigungen, denen unsere chinesischen Kollegen unterliegen, erst zeitnah abgestimmt werden kann.
Kontakt:
Peter Dr. Blum
Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare VdW/Stadtarchiv Heidelberg,
Heiliggeiststr. 12, 69117 Heidelberg
06221 - 5819800
06221 - 5849470
peter.blum@heidelberg.de
URL: Homepage der Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e.V. VdW mit allen Informationen zum 75. VdW-Lehrgang
URL zur Zitation dieses Beitrageshttp://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=18939
KlausGraf - am Dienstag, 10. April 2012, 16:15 - Rubrik: Veranstaltungen
http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2012/04/first-science-manuscripts-published.html
Darunter:
Harley MS 1720 Georg Joachim Rheticus, Magnus canon doctrinae triangulorum (Germany, 16th century)
Harley MS 2660 Isidore of Seville, Etymologiae and De natura rerum (Germany, 1136)
Harley MS 3035 Isidore of Seville, Etymologiae and De natura rerum (Germany, 1495)
Harley MS 3092 Hrabanus Maurus, De universo and De computo (Germany, 12th century)
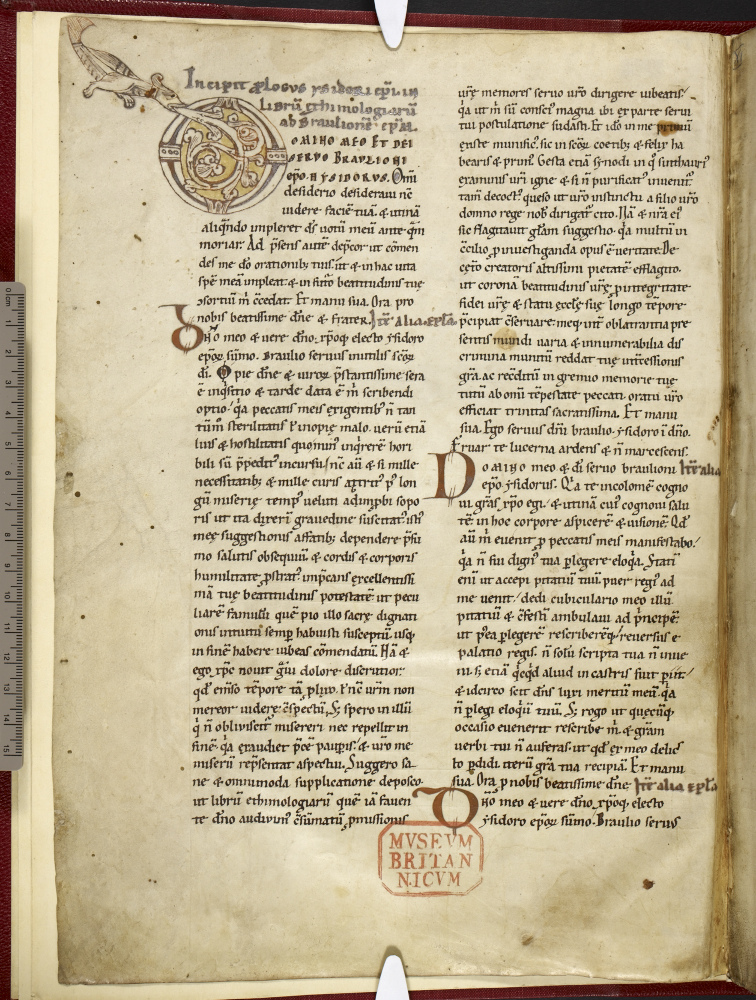
Darunter:
Harley MS 1720 Georg Joachim Rheticus, Magnus canon doctrinae triangulorum (Germany, 16th century)
Harley MS 2660 Isidore of Seville, Etymologiae and De natura rerum (Germany, 1136)
Harley MS 3035 Isidore of Seville, Etymologiae and De natura rerum (Germany, 1495)
Harley MS 3092 Hrabanus Maurus, De universo and De computo (Germany, 12th century)
KlausGraf - am Dienstag, 10. April 2012, 16:09 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.lhr-law.de/lbr-blog/urheberrecht/sie-ist-da-die-erste-facebook-abmahnung-wegen-eines-fremden-fotos-an-der-pinnwand
http://www.infodocc.info/panikmache-facebook-abmahnung-die-abmahnwelle-bleibt-aus-also-blaest-anwalt-etwas-nach/
http://www.kriegs-recht.de/facebook-abmahnung/
"Wer ohne zu fragen fremde Fotografien in seinen Social Media Streams wie beispielweise auf seiner Facebook-Pinnwand oder auf Pinterest einbindet, der kann leicht eine Urheberrechtsverletzung begehen." Oder in Tumblr.
Update:
http://www.internet-law.de/2012/04/haftungsrisiko-facebook.html
http://www.infodocc.info/panikmache-facebook-abmahnung-die-abmahnwelle-bleibt-aus-also-blaest-anwalt-etwas-nach/
http://www.kriegs-recht.de/facebook-abmahnung/
"Wer ohne zu fragen fremde Fotografien in seinen Social Media Streams wie beispielweise auf seiner Facebook-Pinnwand oder auf Pinterest einbindet, der kann leicht eine Urheberrechtsverletzung begehen." Oder in Tumblr.
Update:
http://www.internet-law.de/2012/04/haftungsrisiko-facebook.html
KlausGraf - am Dienstag, 10. April 2012, 15:08 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Name wurde geändert, das alte Listenarchiv bleibt bestehen. Zur neuen Liste:
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-l
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-l
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?seite=1&key=standard_document_44418959&jmpage=1&type=v&rubrik=36090&jm=1&mediakey=fs%2Fhessenschau%2F20120403_1930_ysenburg_stiftung
Wolfgang Ernst Fürst zu Ysenburg und Büdingen ist Chef der Stiftung "Präsenz Büdingen". Ihr Zweck ist es eigentlich, Kirchenbauten zu erhalten. Stattdessen soll der finanziell angeschlagene Fürst mit ihr windige Immobiliengeschäfte zu seinem Vorteil gemacht haben. Ein Kirchenvertreter erhebt schwere Vorwürfe.
hessenschau, 03.04.2012
***
http://www.kreis-anzeiger.de/lokales/wetteraukreis/buedingen/11840503_1.htm
Das Resultat dieser Untersuchungen lag Bürgermeister Erich Spamer am 12. September 2011 vor und erbrachte Erstaunliches. Als Ergebnis formulierte Professor Kannowski in Kurzform: „Die Präsenz zu Büdingen ist als rechtsfähige evangelische kirchliche Stiftung im Sinne des Kirchengesetzes über kirchliche Stiftungen in der evangelischen Kirche Hessen und Nassau anzusehen. Vertretungsbefugt ist ein sogenannter Präsentarius. Wie dieser nach Herkommen bestimmt und eingesetzt wurde, vermag ich nicht zu sagen. Eine Befugnis des Fürsten zu Ysenburg und Büdingen zur Besetzung dieses Amtes ist jedoch aus den mir vorliegenden Materialien nicht ersichtlich.“
Dass der Fürst an der Spitze der Büdinger Präsenz auftritt, ist demnach grundlegend zweifelhaft. Dieses Gutachten schickte Rathauschef Spamer am 26. September 2011 an die zuständige Kirchenaufsicht. Sie ist im Regierungspräsidium Darmstadt angesiedelt. Doch dort geschah kaum Nachvollziehbares. Mit dem Fürsten wurde eine neue Stiftungssatzung vereinbart, die am 1. Januar 2012 Gültigkeit erlangte und dem Hessischen Rundfunk vorliegt. So ermöglicht die neue Satzung eine Auflösung der 750 Jahre alten Stiftung. Kirchen, Pfarrhäuser und Friedhöfe fielen in einem solchen Fall der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau zu, „das sonstige Vermögen an den dann lebenden Chef des fürstlichen Hauses zu Ysenburg und Büdingen“. Dann bekäme der Fürst kostenlos sämtliche Grundstücke zurück, die er zuvor für gutes Geld an die Stiftung verkaufte. Für Regierungspräsidiumssprecher Gerhard Müller hat das kein Geschmäckle: „Wir haben die Angelegenheit so behandelt, wie wir das bei jeder Stiftung tun.“ Nach dem Zustandekommen der neuen Satzung habe das Regierungspräsidium vom Fürsten eine Vermögensaufstellung und Rechenschaftsberichte der vergangenen Jahre angefordert. Müller: „Dagegen hat der Fürst vorm Verwaltungsgericht Gießen geklagt. Das Verfahren ist noch anhängig.“
Zur Büdinger Präsenz siehe auch
http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?rubrik=36090&msg=36090&key=standard_document_44418959
http://www.jungborn-buedingen.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Itemid=41&limitstart=10
Zum Umgang des Hauses mit seinem Kulturgut:
http://archiv.twoday.net/stories/692500/
(Archivalia, meistgelesene Beiträge, derzeit Platz 15)
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/233328991/
 Mehr als 90 px ist diese Gestalt mir nicht wert, gleichwohl: Foto Sven Teschke, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de
Mehr als 90 px ist diese Gestalt mir nicht wert, gleichwohl: Foto Sven Teschke, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de
Wolfgang Ernst Fürst zu Ysenburg und Büdingen ist Chef der Stiftung "Präsenz Büdingen". Ihr Zweck ist es eigentlich, Kirchenbauten zu erhalten. Stattdessen soll der finanziell angeschlagene Fürst mit ihr windige Immobiliengeschäfte zu seinem Vorteil gemacht haben. Ein Kirchenvertreter erhebt schwere Vorwürfe.
hessenschau, 03.04.2012
***
http://www.kreis-anzeiger.de/lokales/wetteraukreis/buedingen/11840503_1.htm
Das Resultat dieser Untersuchungen lag Bürgermeister Erich Spamer am 12. September 2011 vor und erbrachte Erstaunliches. Als Ergebnis formulierte Professor Kannowski in Kurzform: „Die Präsenz zu Büdingen ist als rechtsfähige evangelische kirchliche Stiftung im Sinne des Kirchengesetzes über kirchliche Stiftungen in der evangelischen Kirche Hessen und Nassau anzusehen. Vertretungsbefugt ist ein sogenannter Präsentarius. Wie dieser nach Herkommen bestimmt und eingesetzt wurde, vermag ich nicht zu sagen. Eine Befugnis des Fürsten zu Ysenburg und Büdingen zur Besetzung dieses Amtes ist jedoch aus den mir vorliegenden Materialien nicht ersichtlich.“
Dass der Fürst an der Spitze der Büdinger Präsenz auftritt, ist demnach grundlegend zweifelhaft. Dieses Gutachten schickte Rathauschef Spamer am 26. September 2011 an die zuständige Kirchenaufsicht. Sie ist im Regierungspräsidium Darmstadt angesiedelt. Doch dort geschah kaum Nachvollziehbares. Mit dem Fürsten wurde eine neue Stiftungssatzung vereinbart, die am 1. Januar 2012 Gültigkeit erlangte und dem Hessischen Rundfunk vorliegt. So ermöglicht die neue Satzung eine Auflösung der 750 Jahre alten Stiftung. Kirchen, Pfarrhäuser und Friedhöfe fielen in einem solchen Fall der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau zu, „das sonstige Vermögen an den dann lebenden Chef des fürstlichen Hauses zu Ysenburg und Büdingen“. Dann bekäme der Fürst kostenlos sämtliche Grundstücke zurück, die er zuvor für gutes Geld an die Stiftung verkaufte. Für Regierungspräsidiumssprecher Gerhard Müller hat das kein Geschmäckle: „Wir haben die Angelegenheit so behandelt, wie wir das bei jeder Stiftung tun.“ Nach dem Zustandekommen der neuen Satzung habe das Regierungspräsidium vom Fürsten eine Vermögensaufstellung und Rechenschaftsberichte der vergangenen Jahre angefordert. Müller: „Dagegen hat der Fürst vorm Verwaltungsgericht Gießen geklagt. Das Verfahren ist noch anhängig.“
Zur Büdinger Präsenz siehe auch
http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?rubrik=36090&msg=36090&key=standard_document_44418959
http://www.jungborn-buedingen.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Itemid=41&limitstart=10
Zum Umgang des Hauses mit seinem Kulturgut:
http://archiv.twoday.net/stories/692500/
(Archivalia, meistgelesene Beiträge, derzeit Platz 15)
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/233328991/
 Mehr als 90 px ist diese Gestalt mir nicht wert, gleichwohl: Foto Sven Teschke, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de
Mehr als 90 px ist diese Gestalt mir nicht wert, gleichwohl: Foto Sven Teschke, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.deAngeboten in Auktion 80 Nr. 269 bei Kiefer:
http://www.kiefer.de/auktion_artikel_details.aspx?KatNr=269
Reformation und Ordnung der Stadt Ratzeburgk. Dt. Handschrift auf Papier. 4 Tle. in 1 Bd. Ratzeburg 1578-1609. 171 Bl. Folio. Prgt. d. Zt. (Rücken erneuert) mit etw. Blindpräg. und Deckelmonogr. "H. D. 1609". Schätzpreis: 2.700,00 €
Sehr interessantes stadthistorisches Dokument der Stadt Ratzeburg. - Enthält I: Christliche Polizei-Ordnung 1582. - II: Gerichts- und Prozessordnung der Stadt Ratzeburg 1598. - III: Hofgerichtsordnung Herzog Franz d. Älteren zu Sachsen-Engern und Westphalen 1578. - IV: Äcker-Register der Stadt Ratzeburg 1592. - Von zwei Schreibern verfaßt in sauberer Kanzleischrift mit breitem Rand. Unter den behandelten Kapiteln: Von Rotten und Secten. Vonn Zauberey und Wirken., Wahrsagen und Büessen. Von Unfleissigem Kirchgange, Vonn Feyr, Sontägigem geseüff und tantzen, von armen Leuthen und fremden Bettlern, Vonn Mordt und Todtschlage, Vonn Unzucht lediger Personen etc. - Stadthistorische Dokumente von Ratzeburg aus diesem Zeitraum dürften von großer Seltenheit sein, da die Stadt 1693 vom dänischen König Christian V. bis auf die Domhalbinsel vollständig zerstört wurde. - Gebräunt, die ersten 4 und letzten 8 Bll. im Rand verstärkt.

http://www.kiefer.de/auktion_artikel_details.aspx?KatNr=269
Reformation und Ordnung der Stadt Ratzeburgk. Dt. Handschrift auf Papier. 4 Tle. in 1 Bd. Ratzeburg 1578-1609. 171 Bl. Folio. Prgt. d. Zt. (Rücken erneuert) mit etw. Blindpräg. und Deckelmonogr. "H. D. 1609". Schätzpreis: 2.700,00 €
Sehr interessantes stadthistorisches Dokument der Stadt Ratzeburg. - Enthält I: Christliche Polizei-Ordnung 1582. - II: Gerichts- und Prozessordnung der Stadt Ratzeburg 1598. - III: Hofgerichtsordnung Herzog Franz d. Älteren zu Sachsen-Engern und Westphalen 1578. - IV: Äcker-Register der Stadt Ratzeburg 1592. - Von zwei Schreibern verfaßt in sauberer Kanzleischrift mit breitem Rand. Unter den behandelten Kapiteln: Von Rotten und Secten. Vonn Zauberey und Wirken., Wahrsagen und Büessen. Von Unfleissigem Kirchgange, Vonn Feyr, Sontägigem geseüff und tantzen, von armen Leuthen und fremden Bettlern, Vonn Mordt und Todtschlage, Vonn Unzucht lediger Personen etc. - Stadthistorische Dokumente von Ratzeburg aus diesem Zeitraum dürften von großer Seltenheit sein, da die Stadt 1693 vom dänischen König Christian V. bis auf die Domhalbinsel vollständig zerstört wurde. - Gebräunt, die ersten 4 und letzten 8 Bll. im Rand verstärkt.

KlausGraf - am Montag, 9. April 2012, 21:20 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
