Vergleichsweise selten sind digitalisierte Schreibkalender, die bestimmungsgemäß für Eintragungen benutzt wurden. Hier ein Beispiel aus der ZB Zürich:
http://www.e-rara.ch/zuz/content/thumbview/3568990
Besser lesbar:
http://www.e-rara.ch/zuz/content/thumbview/3568757
http://www.e-rara.ch/zuz/content/thumbview/3568258
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=schreibkalender
http://www.e-rara.ch/zuz/content/thumbview/3568990
Besser lesbar:
http://www.e-rara.ch/zuz/content/thumbview/3568757
http://www.e-rara.ch/zuz/content/thumbview/3568258
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=schreibkalender
KlausGraf - am Dienstag, 24. Juli 2012, 23:03 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.geschichtsort-hotel-silber.de/
"Der „virtuelle Geschichtsort“ soll Nutzer über das "Hotel Silber" und die Geschichte der Gestapo in Stuttgart informieren, zum Wissensaustausch anregen und zur Debatte um den realen Gedenkort beitragen."
Via
http://www.damals.de/de/4/news.html?aid=190842&action=showDetails
"Der „virtuelle Geschichtsort“ soll Nutzer über das "Hotel Silber" und die Geschichte der Gestapo in Stuttgart informieren, zum Wissensaustausch anregen und zur Debatte um den realen Gedenkort beitragen."
Via
http://www.damals.de/de/4/news.html?aid=190842&action=showDetails
KlausGraf - am Dienstag, 24. Juli 2012, 22:57 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Peter Suber: The OA Journal of Computational Geometry released its financial statements for 2010, 2011, and 2012 (YTD), "to help others understand...the real cost of running an open access journal."
JoCG pays $10/year, for its domain name, and nothing else for anything.
Not all OA journals run on a shoestring this thin, but here's one that does and that can prove it
For some others, see the March 2010 article in which Brian Edgar and John Willinsky report that 29% of 998 journals using Open Journal Systems claimed zero expenses, 20% claimed expenses between $1-$1,000, and 31% claimed expenses between $1,001-$10k. 44% operated on zero revenue, 16% on revenue between $1-$1,000, and 24% on revenue between $1,001-$10k. (See Table 15.)
https://plus.google.com/109377556796183035206/posts/fzhS9zDGMo9
JoCG pays $10/year, for its domain name, and nothing else for anything.
Not all OA journals run on a shoestring this thin, but here's one that does and that can prove it
For some others, see the March 2010 article in which Brian Edgar and John Willinsky report that 29% of 998 journals using Open Journal Systems claimed zero expenses, 20% claimed expenses between $1-$1,000, and 31% claimed expenses between $1,001-$10k. 44% operated on zero revenue, 16% on revenue between $1-$1,000, and 24% on revenue between $1,001-$10k. (See Table 15.)
https://plus.google.com/109377556796183035206/posts/fzhS9zDGMo9
KlausGraf - am Dienstag, 24. Juli 2012, 12:50 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine aktuelle Untersuchung des Instituts für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Universität Wien, zur Nutzung von Twitter.
http://www.univie.ac.at/publizistik/twitterstudie/
Twitter wird vorwiegend für Nachrichten genutzt; Twitter-Nutzer verweisen auf Medieninhalte aus redaktionellen Medien; Twitter-Nutzer kommentieren und werten Medieninhalte. Fazit der Studie: Wie wir dies aus den Theorien der Anschlußkommunikation
an Nachrichten in Face-to-Face Situationen kennen, verbinden Nutzer/innen auch bei der Kommunikation über Medieninhalte auf Twitter die Inhalte mit anderen Erfahrungen. Durch das Verknüpfen
eines Medieninhalts mit zusätzlichen Informationen, spezifischen Interpretationen oder gar mit dem eigenen persönlichen Leben und Erleben, beteiligen sich Twitter-Nutzer/innen an der Einordnung dieser Medieninhalte, an der sozialen Konstruktion von Vorstellungen
über die Welt. Sie stellen die Inhalte in einen Kontext und ermöglichen den anderen Nutzer/innen so, unterschiedliche Perspektiven auf die mit den Medieninhalten verbundenen Thematiken kennen zu lernen. So ist Twitter mehr als ein Diffusionskanal für Medieninhalte, es ist vielmehr ein - je nach
Zusammensetzung der Follower / Followees - individuell strukturierter Diskursraum für Themen öffentlicher und teilöffentlicher Relevanz.
http://www.univie.ac.at/publizistik/twitterstudie/
Twitter wird vorwiegend für Nachrichten genutzt; Twitter-Nutzer verweisen auf Medieninhalte aus redaktionellen Medien; Twitter-Nutzer kommentieren und werten Medieninhalte. Fazit der Studie: Wie wir dies aus den Theorien der Anschlußkommunikation
an Nachrichten in Face-to-Face Situationen kennen, verbinden Nutzer/innen auch bei der Kommunikation über Medieninhalte auf Twitter die Inhalte mit anderen Erfahrungen. Durch das Verknüpfen
eines Medieninhalts mit zusätzlichen Informationen, spezifischen Interpretationen oder gar mit dem eigenen persönlichen Leben und Erleben, beteiligen sich Twitter-Nutzer/innen an der Einordnung dieser Medieninhalte, an der sozialen Konstruktion von Vorstellungen
über die Welt. Sie stellen die Inhalte in einen Kontext und ermöglichen den anderen Nutzer/innen so, unterschiedliche Perspektiven auf die mit den Medieninhalten verbundenen Thematiken kennen zu lernen. So ist Twitter mehr als ein Diffusionskanal für Medieninhalte, es ist vielmehr ein - je nach
Zusammensetzung der Follower / Followees - individuell strukturierter Diskursraum für Themen öffentlicher und teilöffentlicher Relevanz.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Meint Thomas7 und illustriert das mit einem Screenshot meiner Wikipedia-Diskussionsseite:
http://thomas7.netau.net/

http://thomas7.netau.net/

Preprint aus der ZGO 2012
Tom Scott, Town, country and regions in Reformation Germany.
Leiden/Boston: Brill 2005. XXV, 447 S., EUR 112,-.
Eingeleitet von einer kundigen Einführung von Thomas A. Brady Jr.
präsentiert Tom Scott 15 zwischen 1978 und 2004 meist auf Deutsch
publizierte Aufsätze in einer durchgesehenen Fassung nun auch dem
englischsprachigen Leser. Seit dem 1986 erschienenen Buch “Freiburg and the Breisgau” hat sich der Sozial- und Wirtschaftshistoriker immer wieder quellennah und anregend mit der oberrheinischen Geschichte vor allem des 16. Jahrhunderts auseinandergesetzt.
Der erste der drei Hauptteile vereint Studien zu Bauernkrieg,
Reformation und regionalen Aufständen im Vorfeld des Bauernkriegs. Kapitel 1 bietet eine umfangreiche Strukturanalyse von reformatorischer Bewegung und Bauernkrieg 1525 in und um Waldshut, während sich Kapitel 3 dem Rufacher “Butzenkrieg” von 1513 und Kapitel 4 der Rolle von Freiburg im Breisgau bei den verschiedenen Bundschuh-Erhebungen widmet. Die übrigen Beiträge dieses Teils thematisieren allgemeine Aspekte des sozialen Hintergrunds der damaligen Unruhen und der Reformation.
Um “ökonomische Landschaften” (Economic Landscapes) geht es im zweiten Hauptteil, das an das bedeutende Buch Scotts von 1997 “Regional Identity and Economic Change: The Upper Rhine, 1450-1600" anknüpft (vgl. ZGO 153, 2005, S. 731f.). Im Mittelpunkt stehen die Stadt-Land-Beziehungen und das Städtenetz am Oberrhein. Kapitel 11 schildert die spätmittelalterliche Territorialpolitik von Freiburg im Breisgau.
Heterogener zusammengesetzt ist der letzte Teil “Regions and Local
Identities”. Kapitel 12 würdigt das Elsass als “Brückenlandschaft”,
Kapitel 14 thematisiert die Genese der Eidgenossenschaft in der
Innerschweiz. Die komparative Perspektive steht zwar nur im Titel des 15. Aufsatzes, in dem es um die südwestdeutsche
Leibherrschaft/Leibeigenschaft geht, zeichnet aber alle Studien des
Bandes aus.
Etwas näher möchte ich auf das 13. Kapitel eingehen, dessen Gegenstand das Verhältnis der Reformschrift des sogenannten “Oberrheinischen Revolutionärs” zu Vorderösterreich ist (Erstdruck 1997 in der Festschrift für Hans-Jürgen Goertz). Scott weist (S. 351) meine Einwände gegen die lange von Klaus Lauterbach vertretene Gleichsetzung des Oberrheins mit Mathias Wurm von Geudertheim zurück und behandelt die Identifikation als “wasserdicht”. Er trennt - methodisch unzulässig - nicht zwischen dem Verfasser des “Buchli der hundert capiteln mit xxxx statuten” und Mathias Wurm. Das war ziemlich
unvorsichtig, denn Lauterbach hat in seiner inzwischen erschienenen Edition des Werks in der Reihe der MGH-Staatsschriften 2009 erfreulicherweise darauf verzichtet, seine Vermutung über den Verfasser mit der früheren Vehemenz zu wiederholen. Er äußert sich ausgesprochen zurückhaltend zur Verfasserfrage (S. 18f.) und verweist auf die dann in der ZGO 2009 von Volkhard Huth vorlegte alternative Identifizierung. Für Huth ist der Verfasser der Straßburger Jurist Dr. Jakob Merswin. Huth meint dort, meine Zweifel seien bisher nicht entkräftet worden (S. 85). Huths eigener Vorschlag überzeugt mich, zumal Merswin anders als der Kanzleisekretär Wurm graduierter Jurist
war, was ja mein Hauptargument gegen Lauterbachs These war.
Selbstverständlich ist Scotts Aufsatz damit nicht wertlos, da er ja
interessante Beobachtungen zum Verhältnis des Oberrheiners zu
Vorderösterreich und zu den politischen Konzeptionen in
Vorderösterreich um 1500 enthält. Dabei spielt natürlich eine wichtige Rolle der Plan des Landvogts Kaspar von Mörsberg aus den frühen 1490er Jahren, die habsburgischen Lande am Oberrhein mit anderen Herrschaften zu einem mächtigen Territorium zusammenzuschließen. Der Oberrheiner (Jakob Merswin?) war also nicht der einzige, der damals die Reform des Reichs von einer blühenden Oberrhein-Region erhoffte (S. 359).
Aufgrund der präganten Argumentation, der meist schlüssigen Ergebnisse und ihrer Quellennähe sind Scotts gesammelte Beiträge auch für deutschsprachige Leser empfehlenswert. Ein Index der Personen- und Ortsnamen und - ausgesprochen löblich! - ein Sachindex beschließen den preislich leider nicht sehr günstigen Band, dessen innere Kohärenz die manch anderer Aufsatzsammlungen deutlich überragt.
***
Die oben erwähnte Besprechung (erschienen ZGO 2005), in meiner Manuskript-Fassung:
Tom Scott, Regional Identity and Economic Change. The Upper Rhine, 1450-1600. Oxford: Clarendon Press 1997. IX, 363 S. Geb.
Drei Ziele hat sich das Buch des durch seine Studien zu den Stadt-Land-Beziehungen von Freiburg im Breisgau bekannt gewordenen Historikers aus Liverpool gesetzt. Erstens will es regionale Wirtschaftsgeschichte schreiben unter Einbeziehung des Theorieangebots der historischen und Wirtschaftsgeographie. Zweitens insistiert es darauf, dass die ökonomische Identität und ihr Wandel nicht verstanden werden können, wenn man die sozialen, politischen und institutionellen Rahmenbedingungen nicht berücksichtigt. Und drittens will Scott die empirischen Resultate aus seinem Untersuchungsgebiet am Oberrhein in Beziehung setzen zu den internationalen Studien über die Entwicklung regionenbezogener Ökonomien im frühneuzeitlichen Europa (S. 13).
In vier Teilen organisiert Scott seine Darstellung, die auf intensiven Quellenstudien in zahlreichen oberrheinischen Archiven beruht. Nach einer einführenden Vorstellung des Raums – im wesentlichen das südliche Oberrheingebiet zwischen Straßburg und Basel beidseitig des Stroms - und seiner territorialen Fragmentierung wendet sich der zweite Teil dem zentralörtlichen System der Städte und ländlichen Märkte zu. Unter kritischem Rückgriff auf die Theorie des Geographen Walter Christaller stellt Scott das Konkurrenzverhältnis der städtischen Mittelpunkte, der sich in regionalen Zünften organisierenden Landhandwerkern, der ländlichen Salzkästen sowie der ländlichen Wochenmärkte dar. Ausführlich werden die Konflikte vorderösterreichischer und badischer Märkte gewürdigt.
Im dritten Teil geht es um die regionalen Kooperationen der Herrschaftsträger des Raums. Eine Schlüsselrolle kommt dem Rappenmünzbund zu, der vom Ende des 14. bis zum Ende des 16. Jahrhunderts bestand. Diese Zusammenarbeit bildete auch den Rahmen für die am „gemeinen Nutzen“ und an „guter Polizei“ orientierte Regelung der Fleisch- sowie der Getreideversorgung. Der letzte Teil zeigt, wie die interterritoriale Solidarität durch die territorialpolitischen und konfessionellen Veränderungen zerbrach, und versucht eine Einordnung der im 16. Jahrhundert zunehmenden krisenhaften Erscheinungen der im Spätmittelalter so prosperierenden oberrheinischen Ökononomie in den gesamteuropäischen Kontext.
Scotts innovative und prägnant geschriebene Studie wurde von den bisherigen Rezensenten zu Recht sehr positiv beurteilt. Sie sollte aber nicht nur von den Wirtschaftshistorikern rezipiert werden, bietet sie doch auch willkommenes Material zu interterritorialen politischen Kooperationen in einer Region. Die in den Blick genommenen Wirtschaftsbündnisse müssten mit den regionalen Landfriedensbündnissen verglichen werden, die in Schwaben an die Stelle des 1534 aufgelösten Schwäbischen Bundes traten.
Wichtig ist aber auch der Ertrag des Buchs für die Erforschung der regionalen Identität. Mit Sympathie liest man die resümierende Ablehnung eines essentialistischen Regionen-Konzepts: „economic co-operation on the southern Upper Rhine led not to the crystallization of a single regional identity, shaped by natural frontiers and political alliances (the Rappen league), but rather to the simultaneous coexistence of overlapping regional identities superimposed upon one another, predicated upon varying economic needs and opportunities and structured by principles of both centrality and arterial networks” (S. 272).
Scotts Buch bietet somit eine Fülle von Anregungen, die hoffentlich nicht nur von der oberrheinischen Landesgeschichtsforschung aufgenommen werden.
***
Zum Oberrheinischen Revolutionär
http://archiv.twoday.net/stories/4342526/
http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2002/0028.html
Zum Mörsberg-Konzept
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2514/ S. 224
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/219045545/ mit erneuter Wiedergabe der Rezension 2012
Tom Scott, Town, country and regions in Reformation Germany.
Leiden/Boston: Brill 2005. XXV, 447 S., EUR 112,-.
Eingeleitet von einer kundigen Einführung von Thomas A. Brady Jr.
präsentiert Tom Scott 15 zwischen 1978 und 2004 meist auf Deutsch
publizierte Aufsätze in einer durchgesehenen Fassung nun auch dem
englischsprachigen Leser. Seit dem 1986 erschienenen Buch “Freiburg and the Breisgau” hat sich der Sozial- und Wirtschaftshistoriker immer wieder quellennah und anregend mit der oberrheinischen Geschichte vor allem des 16. Jahrhunderts auseinandergesetzt.
Der erste der drei Hauptteile vereint Studien zu Bauernkrieg,
Reformation und regionalen Aufständen im Vorfeld des Bauernkriegs. Kapitel 1 bietet eine umfangreiche Strukturanalyse von reformatorischer Bewegung und Bauernkrieg 1525 in und um Waldshut, während sich Kapitel 3 dem Rufacher “Butzenkrieg” von 1513 und Kapitel 4 der Rolle von Freiburg im Breisgau bei den verschiedenen Bundschuh-Erhebungen widmet. Die übrigen Beiträge dieses Teils thematisieren allgemeine Aspekte des sozialen Hintergrunds der damaligen Unruhen und der Reformation.
Um “ökonomische Landschaften” (Economic Landscapes) geht es im zweiten Hauptteil, das an das bedeutende Buch Scotts von 1997 “Regional Identity and Economic Change: The Upper Rhine, 1450-1600" anknüpft (vgl. ZGO 153, 2005, S. 731f.). Im Mittelpunkt stehen die Stadt-Land-Beziehungen und das Städtenetz am Oberrhein. Kapitel 11 schildert die spätmittelalterliche Territorialpolitik von Freiburg im Breisgau.
Heterogener zusammengesetzt ist der letzte Teil “Regions and Local
Identities”. Kapitel 12 würdigt das Elsass als “Brückenlandschaft”,
Kapitel 14 thematisiert die Genese der Eidgenossenschaft in der
Innerschweiz. Die komparative Perspektive steht zwar nur im Titel des 15. Aufsatzes, in dem es um die südwestdeutsche
Leibherrschaft/Leibeigenschaft geht, zeichnet aber alle Studien des
Bandes aus.
Etwas näher möchte ich auf das 13. Kapitel eingehen, dessen Gegenstand das Verhältnis der Reformschrift des sogenannten “Oberrheinischen Revolutionärs” zu Vorderösterreich ist (Erstdruck 1997 in der Festschrift für Hans-Jürgen Goertz). Scott weist (S. 351) meine Einwände gegen die lange von Klaus Lauterbach vertretene Gleichsetzung des Oberrheins mit Mathias Wurm von Geudertheim zurück und behandelt die Identifikation als “wasserdicht”. Er trennt - methodisch unzulässig - nicht zwischen dem Verfasser des “Buchli der hundert capiteln mit xxxx statuten” und Mathias Wurm. Das war ziemlich
unvorsichtig, denn Lauterbach hat in seiner inzwischen erschienenen Edition des Werks in der Reihe der MGH-Staatsschriften 2009 erfreulicherweise darauf verzichtet, seine Vermutung über den Verfasser mit der früheren Vehemenz zu wiederholen. Er äußert sich ausgesprochen zurückhaltend zur Verfasserfrage (S. 18f.) und verweist auf die dann in der ZGO 2009 von Volkhard Huth vorlegte alternative Identifizierung. Für Huth ist der Verfasser der Straßburger Jurist Dr. Jakob Merswin. Huth meint dort, meine Zweifel seien bisher nicht entkräftet worden (S. 85). Huths eigener Vorschlag überzeugt mich, zumal Merswin anders als der Kanzleisekretär Wurm graduierter Jurist
war, was ja mein Hauptargument gegen Lauterbachs These war.
Selbstverständlich ist Scotts Aufsatz damit nicht wertlos, da er ja
interessante Beobachtungen zum Verhältnis des Oberrheiners zu
Vorderösterreich und zu den politischen Konzeptionen in
Vorderösterreich um 1500 enthält. Dabei spielt natürlich eine wichtige Rolle der Plan des Landvogts Kaspar von Mörsberg aus den frühen 1490er Jahren, die habsburgischen Lande am Oberrhein mit anderen Herrschaften zu einem mächtigen Territorium zusammenzuschließen. Der Oberrheiner (Jakob Merswin?) war also nicht der einzige, der damals die Reform des Reichs von einer blühenden Oberrhein-Region erhoffte (S. 359).
Aufgrund der präganten Argumentation, der meist schlüssigen Ergebnisse und ihrer Quellennähe sind Scotts gesammelte Beiträge auch für deutschsprachige Leser empfehlenswert. Ein Index der Personen- und Ortsnamen und - ausgesprochen löblich! - ein Sachindex beschließen den preislich leider nicht sehr günstigen Band, dessen innere Kohärenz die manch anderer Aufsatzsammlungen deutlich überragt.
***
Die oben erwähnte Besprechung (erschienen ZGO 2005), in meiner Manuskript-Fassung:
Tom Scott, Regional Identity and Economic Change. The Upper Rhine, 1450-1600. Oxford: Clarendon Press 1997. IX, 363 S. Geb.
Drei Ziele hat sich das Buch des durch seine Studien zu den Stadt-Land-Beziehungen von Freiburg im Breisgau bekannt gewordenen Historikers aus Liverpool gesetzt. Erstens will es regionale Wirtschaftsgeschichte schreiben unter Einbeziehung des Theorieangebots der historischen und Wirtschaftsgeographie. Zweitens insistiert es darauf, dass die ökonomische Identität und ihr Wandel nicht verstanden werden können, wenn man die sozialen, politischen und institutionellen Rahmenbedingungen nicht berücksichtigt. Und drittens will Scott die empirischen Resultate aus seinem Untersuchungsgebiet am Oberrhein in Beziehung setzen zu den internationalen Studien über die Entwicklung regionenbezogener Ökonomien im frühneuzeitlichen Europa (S. 13).
In vier Teilen organisiert Scott seine Darstellung, die auf intensiven Quellenstudien in zahlreichen oberrheinischen Archiven beruht. Nach einer einführenden Vorstellung des Raums – im wesentlichen das südliche Oberrheingebiet zwischen Straßburg und Basel beidseitig des Stroms - und seiner territorialen Fragmentierung wendet sich der zweite Teil dem zentralörtlichen System der Städte und ländlichen Märkte zu. Unter kritischem Rückgriff auf die Theorie des Geographen Walter Christaller stellt Scott das Konkurrenzverhältnis der städtischen Mittelpunkte, der sich in regionalen Zünften organisierenden Landhandwerkern, der ländlichen Salzkästen sowie der ländlichen Wochenmärkte dar. Ausführlich werden die Konflikte vorderösterreichischer und badischer Märkte gewürdigt.
Im dritten Teil geht es um die regionalen Kooperationen der Herrschaftsträger des Raums. Eine Schlüsselrolle kommt dem Rappenmünzbund zu, der vom Ende des 14. bis zum Ende des 16. Jahrhunderts bestand. Diese Zusammenarbeit bildete auch den Rahmen für die am „gemeinen Nutzen“ und an „guter Polizei“ orientierte Regelung der Fleisch- sowie der Getreideversorgung. Der letzte Teil zeigt, wie die interterritoriale Solidarität durch die territorialpolitischen und konfessionellen Veränderungen zerbrach, und versucht eine Einordnung der im 16. Jahrhundert zunehmenden krisenhaften Erscheinungen der im Spätmittelalter so prosperierenden oberrheinischen Ökononomie in den gesamteuropäischen Kontext.
Scotts innovative und prägnant geschriebene Studie wurde von den bisherigen Rezensenten zu Recht sehr positiv beurteilt. Sie sollte aber nicht nur von den Wirtschaftshistorikern rezipiert werden, bietet sie doch auch willkommenes Material zu interterritorialen politischen Kooperationen in einer Region. Die in den Blick genommenen Wirtschaftsbündnisse müssten mit den regionalen Landfriedensbündnissen verglichen werden, die in Schwaben an die Stelle des 1534 aufgelösten Schwäbischen Bundes traten.
Wichtig ist aber auch der Ertrag des Buchs für die Erforschung der regionalen Identität. Mit Sympathie liest man die resümierende Ablehnung eines essentialistischen Regionen-Konzepts: „economic co-operation on the southern Upper Rhine led not to the crystallization of a single regional identity, shaped by natural frontiers and political alliances (the Rappen league), but rather to the simultaneous coexistence of overlapping regional identities superimposed upon one another, predicated upon varying economic needs and opportunities and structured by principles of both centrality and arterial networks” (S. 272).
Scotts Buch bietet somit eine Fülle von Anregungen, die hoffentlich nicht nur von der oberrheinischen Landesgeschichtsforschung aufgenommen werden.
***
Zum Oberrheinischen Revolutionär
http://archiv.twoday.net/stories/4342526/
http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2002/0028.html
Zum Mörsberg-Konzept
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2514/ S. 224
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/219045545/ mit erneuter Wiedergabe der Rezension 2012
KlausGraf - am Montag, 23. Juli 2012, 22:06 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/109333462/ (Kommentare)
http://bibliothekarisch.de/blog/2012/07/23/urheberrecht-und-das-aus-fuer-digitale-bibliotheksangebote/
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/type=nachrichten&id=1845
http://wissen.dradio.de/gedaechtnisorganisationen-nationalbibliothek-vs-urheberrecht.36.de.html?dram:article_id=214984
Am interessantesten:
http://www.hagalil.com/archiv/2012/07/19/dnb/ (Jim G. Tobias)
Das klammheimliche Abschalten der beiden digitalisierten Zeitschriftenbestände „Exilpresse“ und „Jüdische Periodika in NS-Deutschland“ hat fassungsloses Kopfschütteln und heftigen Protest bei Historikern, Bibliothekaren und Journalisten ausgelöst. Wie berichtet, hat die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) kürzlich diese wichtigen und einzigartigen Quellen aus „rechtlichen Gründen“ vom Netz genommen. Der Bestand war in den 1990er Jahren mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) digitalisiert und innerhalb des DNB-Webportals der Forschung online zur Verfügung gestellt worden.
Etwaige urheberrechtliche Fragen hinsichtlich der Problematik „verwaister Werke“ wurden seinerzeit geklärt und wo es möglich war, Genehmigungen der Rechteinhaber eingeholt. Bis zum heutigen Tag gab es keine juristischen Probleme und die DNB war mit keinerlei Ansprüchen der Artikelverfasser bzw. deren Rechtsnachfolger konfrontiert. Für Yves Kugelmann, leitender Redakteur der „JM Jüdische Medien AG“ in Zürich, ist die Entscheidung der Deutschen Nationalbibliothek daher auch „völlig absurd, irreführend und unbegründet“. Die Jüdische Medien AG hatte 2004 die traditionsreiche deutsch-amerikanische Emigrantenzeitung AUFBAU übernommen und der DNB gestattet, die kompletten Jahrgänge 1934-1950 des AUFBAU ins Netz zu stellen. „Die Rechtslage im Fall von AUFBAU ist durch unseren Verlag abgedeckt“, sagt Kugelmann im Gespräch mit haGalil. „Die Bibliothek trägt kein Risiko und verhält sich wie ein wasserscheuer Schwimmer!“
Ebenso ist beim Bestand „Jüdische Periodika in NS-Deutschland“, bei dem es sich weitgehend um Mitteilungsblätter der Gemeinden und Selbsthilfeeinrichtungen handelt, die juristische Lage eigentlich klar. Die nach 1945 neugegründeten Israelitischen Kultusgemeinden sind nicht Rechtsnachfolger dieser jüdischen Körperschaften. Auch diese Fragen wurden freilich schon vor über zehn Jahren im Rahmen der DFG-Projektförderung diskutiert und geprüft. Weder bei der DNB noch bei der DFG, die das Projekt als legal und förderungswürdig einstufte, tauchten Bedenken auf.
Deshalb ist man auch bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft etwas irritiert, da offensichtlich von Seiten der DNB gegen die Richtlinien verstoßen wird. In einem Telefongespräch erklärte Dr. Anne Lipp von der DFG-Abteilung Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme unmissverständlich: „DFG geförderte Projekte müssen öffentlich zugänglich gemacht werden.“ Gleichwohl will man der Deutschen Nationalbibliothek „die Zeit geben, etwaige rechtliche Probleme zu klären“, so Dr. Lipp. „Wir gehen davon aus, dass eine zeitnahe Lösung erreicht wird.“
Update: Nichts Neues bringt die Stellungnahme von Asmus:
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/type=nachrichten&id=1849
Halten wir fest: Die DNB hat ohne Not, also ohne dass irgendwelche Beschwerden von Rechteinhabern bekannt wurden, die von der DFG für die Öffentlichkeit finanzierte Digitalisierung aus dem Netz genommen. Die Rechtslage hat sich überhaupt nicht geändert, und die Diskussionen über verwaiste Werke im Internet sprechen eher dafür, das Angebot im Netz zu belassen als es daraus zu entfernen. Der Schluss liegt nahe, dass die DNB, in meinen Augen eine der miesesten Nationalbibliotheken der Welt, die betroffenen Wissenschaftlern als Geiseln missbraucht, damit diese bei Politikern vorstellig werden, um eine Lösung des Problems der verwaisten Werke anzumahnen.
Update: http://archiv.twoday.net/stories/115269537/
http://archiv.twoday.net/stories/109333462/ (Kommentare)
http://bibliothekarisch.de/blog/2012/07/23/urheberrecht-und-das-aus-fuer-digitale-bibliotheksangebote/
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/type=nachrichten&id=1845
http://wissen.dradio.de/gedaechtnisorganisationen-nationalbibliothek-vs-urheberrecht.36.de.html?dram:article_id=214984
Am interessantesten:
http://www.hagalil.com/archiv/2012/07/19/dnb/ (Jim G. Tobias)
Das klammheimliche Abschalten der beiden digitalisierten Zeitschriftenbestände „Exilpresse“ und „Jüdische Periodika in NS-Deutschland“ hat fassungsloses Kopfschütteln und heftigen Protest bei Historikern, Bibliothekaren und Journalisten ausgelöst. Wie berichtet, hat die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) kürzlich diese wichtigen und einzigartigen Quellen aus „rechtlichen Gründen“ vom Netz genommen. Der Bestand war in den 1990er Jahren mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) digitalisiert und innerhalb des DNB-Webportals der Forschung online zur Verfügung gestellt worden.
Etwaige urheberrechtliche Fragen hinsichtlich der Problematik „verwaister Werke“ wurden seinerzeit geklärt und wo es möglich war, Genehmigungen der Rechteinhaber eingeholt. Bis zum heutigen Tag gab es keine juristischen Probleme und die DNB war mit keinerlei Ansprüchen der Artikelverfasser bzw. deren Rechtsnachfolger konfrontiert. Für Yves Kugelmann, leitender Redakteur der „JM Jüdische Medien AG“ in Zürich, ist die Entscheidung der Deutschen Nationalbibliothek daher auch „völlig absurd, irreführend und unbegründet“. Die Jüdische Medien AG hatte 2004 die traditionsreiche deutsch-amerikanische Emigrantenzeitung AUFBAU übernommen und der DNB gestattet, die kompletten Jahrgänge 1934-1950 des AUFBAU ins Netz zu stellen. „Die Rechtslage im Fall von AUFBAU ist durch unseren Verlag abgedeckt“, sagt Kugelmann im Gespräch mit haGalil. „Die Bibliothek trägt kein Risiko und verhält sich wie ein wasserscheuer Schwimmer!“
Ebenso ist beim Bestand „Jüdische Periodika in NS-Deutschland“, bei dem es sich weitgehend um Mitteilungsblätter der Gemeinden und Selbsthilfeeinrichtungen handelt, die juristische Lage eigentlich klar. Die nach 1945 neugegründeten Israelitischen Kultusgemeinden sind nicht Rechtsnachfolger dieser jüdischen Körperschaften. Auch diese Fragen wurden freilich schon vor über zehn Jahren im Rahmen der DFG-Projektförderung diskutiert und geprüft. Weder bei der DNB noch bei der DFG, die das Projekt als legal und förderungswürdig einstufte, tauchten Bedenken auf.
Deshalb ist man auch bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft etwas irritiert, da offensichtlich von Seiten der DNB gegen die Richtlinien verstoßen wird. In einem Telefongespräch erklärte Dr. Anne Lipp von der DFG-Abteilung Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme unmissverständlich: „DFG geförderte Projekte müssen öffentlich zugänglich gemacht werden.“ Gleichwohl will man der Deutschen Nationalbibliothek „die Zeit geben, etwaige rechtliche Probleme zu klären“, so Dr. Lipp. „Wir gehen davon aus, dass eine zeitnahe Lösung erreicht wird.“
Update: Nichts Neues bringt die Stellungnahme von Asmus:
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/type=nachrichten&id=1849
Halten wir fest: Die DNB hat ohne Not, also ohne dass irgendwelche Beschwerden von Rechteinhabern bekannt wurden, die von der DFG für die Öffentlichkeit finanzierte Digitalisierung aus dem Netz genommen. Die Rechtslage hat sich überhaupt nicht geändert, und die Diskussionen über verwaiste Werke im Internet sprechen eher dafür, das Angebot im Netz zu belassen als es daraus zu entfernen. Der Schluss liegt nahe, dass die DNB, in meinen Augen eine der miesesten Nationalbibliotheken der Welt, die betroffenen Wissenschaftlern als Geiseln missbraucht, damit diese bei Politikern vorstellig werden, um eine Lösung des Problems der verwaisten Werke anzumahnen.
Update: http://archiv.twoday.net/stories/115269537/
KlausGraf - am Montag, 23. Juli 2012, 20:48 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://speyererhausbuch1795.blogspot.de/
Das Bloggen des "Hausbuchs" ist im Zeitraum März bis Mitte Juli 2012 erfolgt (in 17 "Posts"). Die kleine Quelle zur Speyerer Geschichte, die den Zeitraum 1795 bis 1821 abdeckt, kann jetzt komplett, d.h. in transkribierter Form, über das Weblog abgerufen werden (eine Verlinkung des Blogs mit dem Eintrag in den Online-Findmitteln wird hergestellt; ebenso wird das Hausbuch auch in digitalisierter Form über die Online-Findmittel abrufbar sein).
Das Bloggen des "Hausbuchs" ist im Zeitraum März bis Mitte Juli 2012 erfolgt (in 17 "Posts"). Die kleine Quelle zur Speyerer Geschichte, die den Zeitraum 1795 bis 1821 abdeckt, kann jetzt komplett, d.h. in transkribierter Form, über das Weblog abgerufen werden (eine Verlinkung des Blogs mit dem Eintrag in den Online-Findmitteln wird hergestellt; ebenso wird das Hausbuch auch in digitalisierter Form über die Online-Findmittel abrufbar sein).
http://orka.bibliothek.uni-kassel.de/viewer/image/1342094207551/1/
Kassel, Universitätsbibl. / LMB, 4° Ms. poet. et roman. 8 (1. Viertel 15. Jh.) ist die einzige Überlieferung von Johannes Rothe: Ritterspiegel und Eisenacher Rechtsbuch (zu beiden: http://www.geschichtsquellen.de ).
http://www.handschriftencensus.de/5140
Kassel, Universitätsbibl. / LMB, 4° Ms. poet. et roman. 8 (1. Viertel 15. Jh.) ist die einzige Überlieferung von Johannes Rothe: Ritterspiegel und Eisenacher Rechtsbuch (zu beiden: http://www.geschichtsquellen.de ).
http://www.handschriftencensus.de/5140
KlausGraf - am Montag, 23. Juli 2012, 12:50 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/heidhs59
Über die Heilbronner Weinbüchlein handelte Karl Hans Weingärtner: Studien zur Geschichtsschreibung der Reichsstadt Heilbronn a. N., 1962, S. 44-61. 8 Handschriften gingen 1944 verloren. Erhalten sind nach Weingärtner München Cgm 5282, UB Tübingen Mh 830a, die zwei Heidelberger Handschriften 59 (jetzt online) und 95. Zwei Weinbüchlein waren damals in Privatbesitz.
Über die Heilbronner Weinbüchlein handelte Karl Hans Weingärtner: Studien zur Geschichtsschreibung der Reichsstadt Heilbronn a. N., 1962, S. 44-61. 8 Handschriften gingen 1944 verloren. Erhalten sind nach Weingärtner München Cgm 5282, UB Tübingen Mh 830a, die zwei Heidelberger Handschriften 59 (jetzt online) und 95. Zwei Weinbüchlein waren damals in Privatbesitz.
KlausGraf - am Montag, 23. Juli 2012, 12:39 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Jetzt wurde der Grundstein gelegt:
http://www.pnp.de/nachrichten/bayern/landkreis_landshut/474210_24-Millionen-Projekt-um-historisches-Erbe-bewahren.html
http://www.pnp.de/nachrichten/bayern/landkreis_landshut/474210_24-Millionen-Projekt-um-historisches-Erbe-bewahren.html
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://nordhausen.thueringer-allgemeine.de/web/lokal/kultur/detail/-/specific/Erstes-Digitalisierungsprojekt-abgeschlossen-1684617177
In diesem Jahr sei eine Bereitstellung im Internet vorgesehen.

Freundl. Hinweis Dr. Brigitte Pfeil
In diesem Jahr sei eine Bereitstellung im Internet vorgesehen.

Freundl. Hinweis Dr. Brigitte Pfeil
KlausGraf - am Montag, 23. Juli 2012, 11:44 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Frereysen, Antonius, of Gmünd, fl. 1559-61: Wimpf 88 (purch. Gmünd), 123, 271 (1561), 285 (1559), 417 (1561, iure … possessor); Copenh 3744 (1560) bietet Needhams IPI. Auch die Kopenhagener Inkunabel stammt aus dem Dominikanerkloster Wimpfen:
http://www.kb.dk/permalink/2006/manus/735/dan/198/?var=
"Anthonius Frereysen de Gammundia" heißt es in einem Besitzvermerk von 1561:
http://books.google.de/books?id=7lELAQAAIAAJ&q=frereysen+wimpfen
Die Familie Gfereis(en) war in Schwäbisch Gmünd ansässig noch im 19. Jahrhundert. Handwerker aus dem 17. Jahrhundert (vor allem Pflasterer) weist Hermann Kissling, Künstler und Handwerker ..., 1995, S. 118f. nach. Aus dem 16. Jahrhundert finde ich nur: Nitsch, Spitalarchiv, 1965 Nr. 965 1541 Jan. 20 Lenz Frereysen verkauft Zins aus einem Haus in der Eutighofer Gasse, den er 1552 ablöst. Die gleiche Person oder ein gleichnamiger Verwandter begegnet 1576 Mai 1 (Deibele, Katharinenspital, 1969, Nr. 206): Lorenz Gföreisen der Gentner verkauft Zins aus seinem Haus beim Türlensteg.
Trotz des seltenen Namens besteht wohl kein Zusammenhang mit dem Heilbronner Apotheker Anton Frereysen, der als VD-16-Beiträger die GND
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=119676206
hat. Das Stadtarchiv Heilbronn half auf Facebook weiter: "Bei unserem Heilbronner Anton Fröreisen lässt sich kein Bezug zu Gmünd nachweisen. Allerdings ist auch nicht allzu viel über ihn bekannt: Er wird erstmals im Betbuch von 1574 genannt, 1584 erscheint er anlässlich einer Taufe mit der Bezeichnung "Apotheker" – er war definitiv evangelisch. Er starb (vermutlich in Heilbronn) zwischen 1600 und 1606. Der gleichnamige Sohn wurde am 15. November 1578 in Heilbronn getauft, 1604 gründete er die Einhorn-Apotheke; er starb hier am 25. Juli 1639.
Die Heilbronner Namensträger schreiben sich stets mit "ö" Fröreisen oder Fröreysen."
http://www.facebook.com/stadtgeschichte.heilbronn/posts/440590245974444
Testimonium des Heilbronner Apothekers 1592:
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00023013/image_230
In den Beiträgen zur württembergischen Apothekengeschichte wurde er behandelt laut
http://books.google.de/books?id=mL7RAQ7bx3gC&pg=PA176&q=apotheke+heilbronn+anton
[Ich hatte zwar hier darauf hingewiesen, dass Wankmüllers Beiträge online sind, es aber offenkundig wieder vergessen:
Langer Link 1
Langer Link 2 ]
Dass ein evangelischer Heilbronner dem Wimpfener katholischen Dominikanerkonvent Bücher geschenkt hat, ist höchst unwahrscheinlich. Ob es irgendwo weitere Belege über den aus Gmünd stammenden Buchbesitzer, den ich als Verwandter des oben genannten Lorenz Gfrereisen ansehe, geben mag?
#forschung
http://www.kb.dk/permalink/2006/manus/735/dan/198/?var=
"Anthonius Frereysen de Gammundia" heißt es in einem Besitzvermerk von 1561:
http://books.google.de/books?id=7lELAQAAIAAJ&q=frereysen+wimpfen
Die Familie Gfereis(en) war in Schwäbisch Gmünd ansässig noch im 19. Jahrhundert. Handwerker aus dem 17. Jahrhundert (vor allem Pflasterer) weist Hermann Kissling, Künstler und Handwerker ..., 1995, S. 118f. nach. Aus dem 16. Jahrhundert finde ich nur: Nitsch, Spitalarchiv, 1965 Nr. 965 1541 Jan. 20 Lenz Frereysen verkauft Zins aus einem Haus in der Eutighofer Gasse, den er 1552 ablöst. Die gleiche Person oder ein gleichnamiger Verwandter begegnet 1576 Mai 1 (Deibele, Katharinenspital, 1969, Nr. 206): Lorenz Gföreisen der Gentner verkauft Zins aus seinem Haus beim Türlensteg.
Trotz des seltenen Namens besteht wohl kein Zusammenhang mit dem Heilbronner Apotheker Anton Frereysen, der als VD-16-Beiträger die GND
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=119676206
hat. Das Stadtarchiv Heilbronn half auf Facebook weiter: "Bei unserem Heilbronner Anton Fröreisen lässt sich kein Bezug zu Gmünd nachweisen. Allerdings ist auch nicht allzu viel über ihn bekannt: Er wird erstmals im Betbuch von 1574 genannt, 1584 erscheint er anlässlich einer Taufe mit der Bezeichnung "Apotheker" – er war definitiv evangelisch. Er starb (vermutlich in Heilbronn) zwischen 1600 und 1606. Der gleichnamige Sohn wurde am 15. November 1578 in Heilbronn getauft, 1604 gründete er die Einhorn-Apotheke; er starb hier am 25. Juli 1639.
Die Heilbronner Namensträger schreiben sich stets mit "ö" Fröreisen oder Fröreysen."
http://www.facebook.com/stadtgeschichte.heilbronn/posts/440590245974444
Testimonium des Heilbronner Apothekers 1592:
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00023013/image_230
In den Beiträgen zur württembergischen Apothekengeschichte wurde er behandelt laut
http://books.google.de/books?id=mL7RAQ7bx3gC&pg=PA176&q=apotheke+heilbronn+anton
[Ich hatte zwar hier darauf hingewiesen, dass Wankmüllers Beiträge online sind, es aber offenkundig wieder vergessen:
Langer Link 1
Langer Link 2 ]
Dass ein evangelischer Heilbronner dem Wimpfener katholischen Dominikanerkonvent Bücher geschenkt hat, ist höchst unwahrscheinlich. Ob es irgendwo weitere Belege über den aus Gmünd stammenden Buchbesitzer, den ich als Verwandter des oben genannten Lorenz Gfrereisen ansehe, geben mag?
#forschung
KlausGraf - am Sonntag, 22. Juli 2012, 19:51 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Staatsarchiv Ludwigsburg B 177 S U 309
1572 April 23 (Georgii)
Anna Gaisbergin, Witwe Wilhelms von Bellestraß, kaiserlicher Ehrenhold, stellt Bürgermeister und Rat der Stadt Gmünd über Wohnung und Beisitz in der Stadt einen Revers aus.
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=2-2443999
Zunächst hatte ich nichts weiter über diese Person gefunden, kam dann aber auf die Idee nach "wilhelm von" und ehrenhold zu suchen. In Google Books fand ich dann, dass der kaiserliche Ehrenhold Wilhelm von Pellestraß (OCR: "Wilhelm von Pellesnch") im Dezember 1566 die Achtankündigung an Herzog Johann Friedrich von Sachsen überbringen sollte:
http://books.google.de/books?id=MUAOAAAAQAAJ&pg=PA352
Auf diese Ankündigung bezieht sich die Druckschrift (ohne dass der Name des Herolds genannt wird):
http://books.google.de/books?id=taRRAAAAcAAJ
Aus einer Anfrage nach dem Wappen von Wilhelm v. "Bellestras", der 1572 nicht mehr lebte, im Monatsblatt des Adlers (Bd. 5, S. 295) erfährt man leider nichts Neues.
http://books.google.de/books?id=PhAWAAAAYAAJ&pg=PA295 (US)
Suche mit Soundex in der Wiener Archivdatenbank erbrachte:
Signatur: AT-OeStA/HHStA RHR Passbriefe 2-3-29
Titel: Bellenstrass Wilhelm von, kaiserlicher Herold, Passbrief zum kaiserlicher Botschafter am französischen Hof
Entstehungszeitraum: 1569
http://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=2125327
[1563 Wilhalm von Pellenstras als Hausbesitzer in Wien belegt, ebenso 1566: Pellenstrass
http://books.google.de/books?id=BuM-AAAAYAAJ&pg=PA120
= Am Hof 8 (Huth, wie unten)]
Nach Georgii von Georgenau war Anna, Tochter von Johann Heinrich Gaisberg und Agathe Eysengrein, verheiratet mit Wilhelm von Bellenstrass in Gmünd.
http://archive.org/stream/Biographisch-genealogischeBlaetterAusUndUeberSchwaben#page/n217/mode/2up
Ebenso Faber, Familienstiftungen
http://books.google.de/books?id=LGoKAAAAIAAJ&pg=RA2-PA125
In Bernhardts Zentralbehörden kommt die Ehefrau Anna ebenfalls vor "Gaisberger, Agathe, geb. Eisengrein 3o8 - Anna, 00 v. Bellestras 3o8". Hans Heinrich Gaisberger floh 1534 nach Gmünd:
http://books.google.de/books?id=BCVoAAAAMAAJ&q=agathe+eisengrein+gm%C3%BCnd
Dort auch erwähnt "Gaisberger , Klaus [...] aus Schorndorf , + 1541 Aug. 26 zu Schw. Gmünd " Sein Totenschild im Gmünder Münster!
In den Gmünder Regestenwerken finde ich nur die Witwe. Am 14. Sept. 1599 stiftete die Witwe Anna von Bellerstraß geborene von Geißberg zu Gmünd 40 Gulden an das Katharinenspital (Deibele, Katharinenspital, 1969, Regest 253a). Anna Bellsträssin erscheint auch als Wohltäterin des Gmünder Spitals (Nitsch, Spitalarchiv, 1965, S. 281).
Nachtrag: Volkhard Huth vom Bensheimer Institut für Personengeschichte teilte mir auf Anfrage am 26.7.2012 freundlicherweise mit: "Für den gesuchten Herold werden Sie im Netz ein paar Referenzen mehr finden, wenn Sie ihn in der graphematischen Variante "Püllenstraß" (o.ä.) suchen. Dann gelangen Sie auch an die Digitalversion des Turnierbuchs Hans Francolins (zu diesem vgl. den komplett herunterzuladenden Artikel von Gerhard Winkler, unter:
http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/WM_1_0105-0120.pdf ), das mir hier mit unserem Institutsexemplar in der deutschen Fassung (Frankfurt am Main 1578) vorliegt und in den Schilderungen jenes üppigen Festes schwelgt, das Maximilian II. 1560 in Wien veranstaltet hat. Bei diesem fiel auch "Wilhelm Püllenstraß" als "Böhemische[m] Ernhold" eine repräsentative Aufgabe zu, neben dem Herold "Steffan Demoures/sonst Heimnault genannt" (a.a.O., fol. IIv). Über dieses Werk dürfte auch Berchem (bzw. Otto Hupp) Ihren P[u]ellenstras[s] gekannt haben; vgl. Beiträge zur
Heraldik, Berlin 1939/ND Neustadt an der Aisch 1972, Verzeichnis S. 223."
Die Stelle im Turnierbuch Francolins (Ausgabe 1561)
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00029446/image_24
Seyler erwähnte den Herold danach:
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/1077703
Wie man sich den böhmischen Herold bei einem Maskenfest in Utrecht vorstellte (Foto):
http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1890-1900/129559
Nachtrag 2015:
Kaiserlicher Hofstaat Augsburg 1566 - Heroldsliste: Pellenstraß
https://books.google.de/books?id=m8xcAAAAcAAJ&pg=PT29
#forschung
1572 April 23 (Georgii)
Anna Gaisbergin, Witwe Wilhelms von Bellestraß, kaiserlicher Ehrenhold, stellt Bürgermeister und Rat der Stadt Gmünd über Wohnung und Beisitz in der Stadt einen Revers aus.
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=2-2443999
Zunächst hatte ich nichts weiter über diese Person gefunden, kam dann aber auf die Idee nach "wilhelm von" und ehrenhold zu suchen. In Google Books fand ich dann, dass der kaiserliche Ehrenhold Wilhelm von Pellestraß (OCR: "Wilhelm von Pellesnch") im Dezember 1566 die Achtankündigung an Herzog Johann Friedrich von Sachsen überbringen sollte:
http://books.google.de/books?id=MUAOAAAAQAAJ&pg=PA352
Auf diese Ankündigung bezieht sich die Druckschrift (ohne dass der Name des Herolds genannt wird):
http://books.google.de/books?id=taRRAAAAcAAJ
Aus einer Anfrage nach dem Wappen von Wilhelm v. "Bellestras", der 1572 nicht mehr lebte, im Monatsblatt des Adlers (Bd. 5, S. 295) erfährt man leider nichts Neues.
http://books.google.de/books?id=PhAWAAAAYAAJ&pg=PA295 (US)
Suche mit Soundex in der Wiener Archivdatenbank erbrachte:
Signatur: AT-OeStA/HHStA RHR Passbriefe 2-3-29
Titel: Bellenstrass Wilhelm von, kaiserlicher Herold, Passbrief zum kaiserlicher Botschafter am französischen Hof
Entstehungszeitraum: 1569
http://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=2125327
[1563 Wilhalm von Pellenstras als Hausbesitzer in Wien belegt, ebenso 1566: Pellenstrass
http://books.google.de/books?id=BuM-AAAAYAAJ&pg=PA120
= Am Hof 8 (Huth, wie unten)]
Nach Georgii von Georgenau war Anna, Tochter von Johann Heinrich Gaisberg und Agathe Eysengrein, verheiratet mit Wilhelm von Bellenstrass in Gmünd.
http://archive.org/stream/Biographisch-genealogischeBlaetterAusUndUeberSchwaben#page/n217/mode/2up
Ebenso Faber, Familienstiftungen
http://books.google.de/books?id=LGoKAAAAIAAJ&pg=RA2-PA125
In Bernhardts Zentralbehörden kommt die Ehefrau Anna ebenfalls vor "Gaisberger, Agathe, geb. Eisengrein 3o8 - Anna, 00 v. Bellestras 3o8". Hans Heinrich Gaisberger floh 1534 nach Gmünd:
http://books.google.de/books?id=BCVoAAAAMAAJ&q=agathe+eisengrein+gm%C3%BCnd
Dort auch erwähnt "Gaisberger , Klaus [...] aus Schorndorf , + 1541 Aug. 26 zu Schw. Gmünd " Sein Totenschild im Gmünder Münster!
In den Gmünder Regestenwerken finde ich nur die Witwe. Am 14. Sept. 1599 stiftete die Witwe Anna von Bellerstraß geborene von Geißberg zu Gmünd 40 Gulden an das Katharinenspital (Deibele, Katharinenspital, 1969, Regest 253a). Anna Bellsträssin erscheint auch als Wohltäterin des Gmünder Spitals (Nitsch, Spitalarchiv, 1965, S. 281).
Nachtrag: Volkhard Huth vom Bensheimer Institut für Personengeschichte teilte mir auf Anfrage am 26.7.2012 freundlicherweise mit: "Für den gesuchten Herold werden Sie im Netz ein paar Referenzen mehr finden, wenn Sie ihn in der graphematischen Variante "Püllenstraß" (o.ä.) suchen. Dann gelangen Sie auch an die Digitalversion des Turnierbuchs Hans Francolins (zu diesem vgl. den komplett herunterzuladenden Artikel von Gerhard Winkler, unter:
http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/WM_1_0105-0120.pdf ), das mir hier mit unserem Institutsexemplar in der deutschen Fassung (Frankfurt am Main 1578) vorliegt und in den Schilderungen jenes üppigen Festes schwelgt, das Maximilian II. 1560 in Wien veranstaltet hat. Bei diesem fiel auch "Wilhelm Püllenstraß" als "Böhemische[m] Ernhold" eine repräsentative Aufgabe zu, neben dem Herold "Steffan Demoures/sonst Heimnault genannt" (a.a.O., fol. IIv). Über dieses Werk dürfte auch Berchem (bzw. Otto Hupp) Ihren P[u]ellenstras[s] gekannt haben; vgl. Beiträge zur
Heraldik, Berlin 1939/ND Neustadt an der Aisch 1972, Verzeichnis S. 223."
Die Stelle im Turnierbuch Francolins (Ausgabe 1561)
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00029446/image_24
Seyler erwähnte den Herold danach:
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/1077703
Wie man sich den böhmischen Herold bei einem Maskenfest in Utrecht vorstellte (Foto):
http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1890-1900/129559
Nachtrag 2015:
Kaiserlicher Hofstaat Augsburg 1566 - Heroldsliste: Pellenstraß
https://books.google.de/books?id=m8xcAAAAcAAJ&pg=PT29
#forschung
KlausGraf - am Sonntag, 22. Juli 2012, 16:33 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=2-1183
Der Bestand enthält sowohl Archivalien, die noch unter Eigentumsvorbehalt der 1802 an Württemberg gekommenen ehemaligen Reichsstadt (Schwäbisch) Gmünd stehen, wie auch Schriftgut, welches in das Eigentum des Staates bzw. der staatlichen Archivverwaltung übergegangen ist. Letzteres umfasst Archivalien, die teils von Lotter im Jahre 1827 im Stadtarchiv, im Spitalarchiv und in den Archiven des Augustiner-, Dominikaner-, Franziskaner- und Kapuzinerklosters sowie des Franziskanerinnenklosters St. Ludwig und des Dominikanerinnenklosters Gotteszell ausgehoben wurden, teils auch durch Ankauf (1862) und Ausscheidungen des Kameralamts Gmünd (1844, 1851 und 1894) sowie der Staatssammlung vaterländischer Kunst- und Altertumsdenkmale (1889) zu einem späteren Zeitpunkt in das Stuttgarter Archiv gelangten. Nach einer Inspektion der bislang noch im Stadtarchiv Gmünd verbliebenen Archivalien durch P. Stälin im Jahre 1880 wurde ein großer Teil (mit Ausnahme etwa der Archivalien der Spitalverwaltung sowie der Kirchen- und Schulpflege) nach Stuttgart verbracht und aufgrund Gemeinderatsbeschlusses im Jahre 1900 dem Staate zur dauernden Aufbewahrung unter Eigentumsvorbehalt überlassen. Der gesamte Bestand wurde im Zuge der Beständebereinigung zwischen den Archiven in Stuttgart und Ludwigsburg im Jahr 1969 in das Staatsarchiv Ludwigsburg überführt.
Bei der Neuordnung und Verzeichnung sämtlicher (in Stuttgart befindlicher) Beständeteile wurden ein Großbestand gebildet, die Archivalien unter Kennzeichnung des jeweiligen Eigentümers vereinigt und - aus praktischen Erwägungen unter gelegentlicher Aufgabe des Provenienzprinzips (auf lokaler Ebene) - sach- und lokalpertinent geordnet, und zwar: I. Beziehungen zu Kaiser und Reich; - II. Beziehungen zum Schwäbischen Kreis; - III. Beziehungen zum Schwäbischen Bund; - IV. Beziehungen zu anderen Städten; - V. Beziehungen zu Württemberg; - VI. Beziehungen zu adeligen Nachbarn; - VII. Beziehungen zu geistlichen Nachbarn; - VIII. Freie Pirsch; - IX. Kriegsangelegenheiten; - X. Magistrat, Beamtenschaft, Gesetzgebung; XI. Zünfte, Professionen, Stände; - XII. Unterrichtswesen; - XIII. Verkehrs- und Straßenbauwesen; - XIV. Finanzwesen; - XV. Gerichtswesen; - XVI. Privatrechtliches; - XVII. Güterbesitz zu Gmünd (mit Gotteszell); - XVIII. Bestand- und Lagerbücher über das Gmünder Gebiet; - XIX. Einzelne Orte (in alphabetischer Folge); - XX. Kirchliches (mit Wohltätigkeitsanstalten und Stiftungen); - XXI. Klöster.
Die in der letzten Rubrik ursprünglich enthaltenen Archivalien über das Dominikanerinnenkloster Gotteszell wurden vor 1969 herausgelöst und zu einem selbstständigen Bestand (B 185) formiert. Ebenso extrahiert wurden im Hauptstaatsarchiv Stuttgart die Königs- und Kaiserurkunden bis 1437 und die Mehrzahl der Lager- und Kopialbücher, die in die entsprechenden Selektbestände überführt wurden. Der Hauptteil des weitgehend erhaltenen Spitalarchivs befindet sich (s.o.) im Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd, wo hingegen nurmehr wenige Archivalien eigentlich reichsstädtischer Provenienz vorhanden sind.
Das vorliegende Findbuch wurde im Rahmen eines von der DFG geförderten Projektes 2010/11 retrokonvertiert. Ein Abgleich der Titelaufnahmen mit den in verschiedenen Bänden der Reihe der Inventare der nichtstaatlichen Archive in Baden-Württemberg (Hefte 9, 11,12, 14 und 15) gedruckten Regesten der Urkunden und Akten der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd und einzelner dortiger geistlicher Institutionen konnte im Rahmen des Retrokonversionsprojektes nicht durchgeführt werden, ist aber zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.
Findmittel
AR (Midosa21) von Marionela Wolf, 2012, nach VA (hschr.) von Rudolf Krauß, 1907
Umfang
2087 Urkunden, 3032 Büschel (34,7 lfd. m)
Ein wichtiger Fortschritt für die Stadtgeschichtsforschung von Schwäbisch Gmünd. Leider ist das Findbuch von Gotteszell (B 185) nicht online.
Der Bestand enthält sowohl Archivalien, die noch unter Eigentumsvorbehalt der 1802 an Württemberg gekommenen ehemaligen Reichsstadt (Schwäbisch) Gmünd stehen, wie auch Schriftgut, welches in das Eigentum des Staates bzw. der staatlichen Archivverwaltung übergegangen ist. Letzteres umfasst Archivalien, die teils von Lotter im Jahre 1827 im Stadtarchiv, im Spitalarchiv und in den Archiven des Augustiner-, Dominikaner-, Franziskaner- und Kapuzinerklosters sowie des Franziskanerinnenklosters St. Ludwig und des Dominikanerinnenklosters Gotteszell ausgehoben wurden, teils auch durch Ankauf (1862) und Ausscheidungen des Kameralamts Gmünd (1844, 1851 und 1894) sowie der Staatssammlung vaterländischer Kunst- und Altertumsdenkmale (1889) zu einem späteren Zeitpunkt in das Stuttgarter Archiv gelangten. Nach einer Inspektion der bislang noch im Stadtarchiv Gmünd verbliebenen Archivalien durch P. Stälin im Jahre 1880 wurde ein großer Teil (mit Ausnahme etwa der Archivalien der Spitalverwaltung sowie der Kirchen- und Schulpflege) nach Stuttgart verbracht und aufgrund Gemeinderatsbeschlusses im Jahre 1900 dem Staate zur dauernden Aufbewahrung unter Eigentumsvorbehalt überlassen. Der gesamte Bestand wurde im Zuge der Beständebereinigung zwischen den Archiven in Stuttgart und Ludwigsburg im Jahr 1969 in das Staatsarchiv Ludwigsburg überführt.
Bei der Neuordnung und Verzeichnung sämtlicher (in Stuttgart befindlicher) Beständeteile wurden ein Großbestand gebildet, die Archivalien unter Kennzeichnung des jeweiligen Eigentümers vereinigt und - aus praktischen Erwägungen unter gelegentlicher Aufgabe des Provenienzprinzips (auf lokaler Ebene) - sach- und lokalpertinent geordnet, und zwar: I. Beziehungen zu Kaiser und Reich; - II. Beziehungen zum Schwäbischen Kreis; - III. Beziehungen zum Schwäbischen Bund; - IV. Beziehungen zu anderen Städten; - V. Beziehungen zu Württemberg; - VI. Beziehungen zu adeligen Nachbarn; - VII. Beziehungen zu geistlichen Nachbarn; - VIII. Freie Pirsch; - IX. Kriegsangelegenheiten; - X. Magistrat, Beamtenschaft, Gesetzgebung; XI. Zünfte, Professionen, Stände; - XII. Unterrichtswesen; - XIII. Verkehrs- und Straßenbauwesen; - XIV. Finanzwesen; - XV. Gerichtswesen; - XVI. Privatrechtliches; - XVII. Güterbesitz zu Gmünd (mit Gotteszell); - XVIII. Bestand- und Lagerbücher über das Gmünder Gebiet; - XIX. Einzelne Orte (in alphabetischer Folge); - XX. Kirchliches (mit Wohltätigkeitsanstalten und Stiftungen); - XXI. Klöster.
Die in der letzten Rubrik ursprünglich enthaltenen Archivalien über das Dominikanerinnenkloster Gotteszell wurden vor 1969 herausgelöst und zu einem selbstständigen Bestand (B 185) formiert. Ebenso extrahiert wurden im Hauptstaatsarchiv Stuttgart die Königs- und Kaiserurkunden bis 1437 und die Mehrzahl der Lager- und Kopialbücher, die in die entsprechenden Selektbestände überführt wurden. Der Hauptteil des weitgehend erhaltenen Spitalarchivs befindet sich (s.o.) im Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd, wo hingegen nurmehr wenige Archivalien eigentlich reichsstädtischer Provenienz vorhanden sind.
Das vorliegende Findbuch wurde im Rahmen eines von der DFG geförderten Projektes 2010/11 retrokonvertiert. Ein Abgleich der Titelaufnahmen mit den in verschiedenen Bänden der Reihe der Inventare der nichtstaatlichen Archive in Baden-Württemberg (Hefte 9, 11,12, 14 und 15) gedruckten Regesten der Urkunden und Akten der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd und einzelner dortiger geistlicher Institutionen konnte im Rahmen des Retrokonversionsprojektes nicht durchgeführt werden, ist aber zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.
Findmittel
AR (Midosa21) von Marionela Wolf, 2012, nach VA (hschr.) von Rudolf Krauß, 1907
Umfang
2087 Urkunden, 3032 Büschel (34,7 lfd. m)
Ein wichtiger Fortschritt für die Stadtgeschichtsforschung von Schwäbisch Gmünd. Leider ist das Findbuch von Gotteszell (B 185) nicht online.
KlausGraf - am Sonntag, 22. Juli 2012, 16:11 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wenn ein Beamter behördliche Akten vernichtet, macht er sich strafbar. Geregelt ist dies im Paragrafen 133 des Strafgesetzbuches unter dem Begriff Verwahrungsbruch. Vorgesehen sind eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. Nach Ansicht des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare (VdA) haben mehrere Verfassungsschutzbehörden eindeutig gegen dieses Gesetz verstoßen.
Von staatsanwaltlichen Ermittlungen ist bislang jedoch nichts bekannt. Auf die Frage, ob sein Verband bei der Justiz auf Strafverfolgung insistieren werde, sagte Clemens Rehm, der stellvertretende Vorsitzende des VdA: 'Ich denke, dass wir noch mal nachhaken.' Es dränge sich angesichts der bekannt gewordenen Details der Eindruck auf, dass es sich bei den Aktenvernichtungen nicht um individuelles Fehlverhalten von Mitarbeitern handelte, sondern um ein systematisches Unterlaufen der geltenden Bestimmungen; sowie auch der Absprachen zwischen Bundesbehörden und Bundesarchiv.
Der VdA betonte am Freitag erneut, das Bundesamt für Verfassungsschutz sei nicht befugt über das Vernichten von Unterlagen zu entscheiden. Solche Vorgänge seien alarmierend. 'Damit wird der Rechtsstaat ausgehöhlt.' Zugleich forderten die Archivare konkrete Sofortmaßnahmen für 'rechtsstaatliches Handeln in den Ämtern'. Unter anderem sollen die zuständigen Archive unverzüglich Einsicht erhalten in die Akten der Verfassungsschutzämter, dazu seien neue Stellen zu schaffen.
Auch durch die Berufung auf den Datenschutz lasse sich das Archivgesetz nicht aushebeln, sagte Rehm. Denn Archivgesetze seien als spezielle Regelungen zum Schutz von Daten zu verstehen. Lange Sperrfristen würden garantieren, dass keine Persönlichkeitsrechte verletzt würden. Deshalb seien sämtliche Akten vor der Löschung dem zuständigen Archiv anzubieten. Allein das G10-Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses kennt solche Regelungen jedoch nicht. Darauf beruft sich das Bundesinnenministerium.
Verurteilungen wegen Verwahrungsbruchs sind selten. In Rheinland-Pfalz musste in den 90er Jahren ein Bürgermeister 500 Mark Geldbuße bezahlen, weil er ortsgeschichtliche Dokumente aus dem 19. und 20. Jahrhundert verbrennen ließ. Auch sechs Nürnberger Bestatter wurden wegen Verwahrungsbruchs verurteilt. Sie hatten aber keine Akten vernichtet, sondern das Zahngold von Toten zu Geld gemacht. RN
http://www.sueddeutsche.de/35w38C/734994/Archivare-entsetzt-ueber-Umgang-mit-Dokumenten.html
Von staatsanwaltlichen Ermittlungen ist bislang jedoch nichts bekannt. Auf die Frage, ob sein Verband bei der Justiz auf Strafverfolgung insistieren werde, sagte Clemens Rehm, der stellvertretende Vorsitzende des VdA: 'Ich denke, dass wir noch mal nachhaken.' Es dränge sich angesichts der bekannt gewordenen Details der Eindruck auf, dass es sich bei den Aktenvernichtungen nicht um individuelles Fehlverhalten von Mitarbeitern handelte, sondern um ein systematisches Unterlaufen der geltenden Bestimmungen; sowie auch der Absprachen zwischen Bundesbehörden und Bundesarchiv.
Der VdA betonte am Freitag erneut, das Bundesamt für Verfassungsschutz sei nicht befugt über das Vernichten von Unterlagen zu entscheiden. Solche Vorgänge seien alarmierend. 'Damit wird der Rechtsstaat ausgehöhlt.' Zugleich forderten die Archivare konkrete Sofortmaßnahmen für 'rechtsstaatliches Handeln in den Ämtern'. Unter anderem sollen die zuständigen Archive unverzüglich Einsicht erhalten in die Akten der Verfassungsschutzämter, dazu seien neue Stellen zu schaffen.
Auch durch die Berufung auf den Datenschutz lasse sich das Archivgesetz nicht aushebeln, sagte Rehm. Denn Archivgesetze seien als spezielle Regelungen zum Schutz von Daten zu verstehen. Lange Sperrfristen würden garantieren, dass keine Persönlichkeitsrechte verletzt würden. Deshalb seien sämtliche Akten vor der Löschung dem zuständigen Archiv anzubieten. Allein das G10-Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses kennt solche Regelungen jedoch nicht. Darauf beruft sich das Bundesinnenministerium.
Verurteilungen wegen Verwahrungsbruchs sind selten. In Rheinland-Pfalz musste in den 90er Jahren ein Bürgermeister 500 Mark Geldbuße bezahlen, weil er ortsgeschichtliche Dokumente aus dem 19. und 20. Jahrhundert verbrennen ließ. Auch sechs Nürnberger Bestatter wurden wegen Verwahrungsbruchs verurteilt. Sie hatten aber keine Akten vernichtet, sondern das Zahngold von Toten zu Geld gemacht. RN
http://www.sueddeutsche.de/35w38C/734994/Archivare-entsetzt-ueber-Umgang-mit-Dokumenten.html

KlausGraf - am Samstag, 21. Juli 2012, 22:49 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
ist seit einiger Zeit in Düsseldorf online, nun gibt es einen Wikipedia-Artikel zu dem gelehrten Chorherrn und Propst des Ulmer Wengen-Stifts
http://goo.gl/64iHO =
http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Kuen_(Geistlicher)
Johann Birks (Schulmeisters der Abtei Kempten) Tractatus ed. Kuen Collectio II:
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/2711468

http://goo.gl/64iHO =
http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Kuen_(Geistlicher)
Johann Birks (Schulmeisters der Abtei Kempten) Tractatus ed. Kuen Collectio II:
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/2711468

KlausGraf - am Samstag, 21. Juli 2012, 20:47 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Preprint aus der ZGO 2012 [erschienen Jg. 160, S. 622f.]
Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache WMU auf der
Grundlage des Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300. Unter Leitung von Bettina Kirschstein und Ursula Schulze (ab Lieferung 25: Unter Leitung von Ursula Schulze) erarbeitet von Sibylle Ohly und Daniela Schmidt. Berlin: Erich Schmidt Verlag. 23. Lieferung:
verswigen - vorder S. 2113-2208 (2007); 24. Lieferung: vorder - wagen
S. 2209-2304 (2008); 25. Lieferung. wâgen - widersage S. 2305-2400
(2009); 26. Lieferung: widersagen - zesamenetragen S. 2401-2496
(2009); 27. Lieferung: zesamenevüegen - zwîvelrede. Nachträge abebenen
- zilboum. Bemerkungen zum Abschluss des WMU S. 2497-2619 (2010).
Brosch.
“Nach einer Publikationszeit von 24 Jahren liegt das ‘Wörterbuch der
mittelhochdeutschen Urkundensprache’ 2010 abgeschlossen vor. (Die
Planung hatte Ende der 50er Jahre begonnen. Es umfasst in 27
Lieferungen 8986 Lemmata von abbet bis zwîvelrede, dazu kommen 439
Nachtragsstichwörter” (S. 2613). Stolz resümiert die Projektleiterin
Ursula Schulze -
1960 von Helmut de Boor als Hilfskraft eingestellt - in den
abschließenden Bemerkungen ihr Langzeitprojekt. Am Schluss steht eine
Danksagung, die leider eine Gruppe ausspart: die Rezensenten des
voluminösen Werks. Seit dem Jahrgang 1988 dieser Zeitschrift quäle ich
mich mit diesem zunehmend ungeliebten gedruckten Nachschlagewerk
(weitere Rezensionen, die mehrere Lieferungen zusammenfassen,
erschienen 1991, 1996, 2002 und 2007). Dass ich als junger Referendar
im Generallandesarchiv 1987 beim ersten Heft zugriff, war rückblickend
betrachtet eine Fehlentscheidung. Weder beruflich noch privat habe ich
von diesem Spezialwörterbuch in nennenswertem Umfang profitiert, und
ob meine Rezensionen irgendeinen Nutzen gestiftet haben, möchte ich
bezweifeln. Obwohl von Anfang an ausgemacht war, dass nicht jede
Lieferung einzeln besprochen werden kann, drängte der Verlag und
setzte die Schriftleitung unter Druck. Da ich mich - anders als der
Rezensent der Nassauischen Annalen - dagegen entschieden hatte,
einzelne Lemmata kommentierend aufzulisten, musste ich mir jedesmal
einigermaßen neue Aspekte einfallen lassen. Was ich in der Sache
zusammenfassend zum WMU zu sagen habe, habe ich bereits in der letzten
Besprechung formuliert (der Text ist abrufbar unter:
http://archiv.twoday.net/stories/75224744/ ).
Je weiter das Unternehmen fortschritt, um so unzufriedener wurde ich
mit seiner teuren gedruckten Präsentationsform. Der offizielle Preis
des Gesamtwerks beträgt 1194 Euro in Deutschland. Unter anderem
“verlagsrechtliche Gründe” hätten eine Umstellung des Werks auf
elektronische Bearbeitung nicht zugelassen, erfährt man (S. 2613).
Dass es in absehbarer Zeit die dringend wünschenswerte
Open-Access-Version, die an die Seite der höchst verdienstvollen
Corpus-Digitalisierung (www.corpus.uni-trier.de) treten könnte, geben
wird, halte ich für unwahrscheinlich. Die öffentliche Hand hat mit
viel Steuergeldern das Projekt finanziert, während der Verlag fette
Profite einstreichen durfte. So wird es sich womöglich auch bei der
angekündigten Online-Fassung verhalten. Ein freies nachnutzbares WMU
(unter der Lizenz CC-BY - Creative Commons Attribution) könnte der
Forschung unschätzbaren Nutzen bescheren. Aber darum kümmern sich die
Verkrustungen des traditionellen Verlagswesens nicht. Freilich wäre es einseitig, nur die Verlage verantwortlich zu machen. Die konservativen Open-Access-Verhinderer an den Akademien tragen eine erhebliche Mitschuld.
Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache WMU auf der
Grundlage des Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300. Unter Leitung von Bettina Kirschstein und Ursula Schulze (ab Lieferung 25: Unter Leitung von Ursula Schulze) erarbeitet von Sibylle Ohly und Daniela Schmidt. Berlin: Erich Schmidt Verlag. 23. Lieferung:
verswigen - vorder S. 2113-2208 (2007); 24. Lieferung: vorder - wagen
S. 2209-2304 (2008); 25. Lieferung. wâgen - widersage S. 2305-2400
(2009); 26. Lieferung: widersagen - zesamenetragen S. 2401-2496
(2009); 27. Lieferung: zesamenevüegen - zwîvelrede. Nachträge abebenen
- zilboum. Bemerkungen zum Abschluss des WMU S. 2497-2619 (2010).
Brosch.
“Nach einer Publikationszeit von 24 Jahren liegt das ‘Wörterbuch der
mittelhochdeutschen Urkundensprache’ 2010 abgeschlossen vor. (Die
Planung hatte Ende der 50er Jahre begonnen. Es umfasst in 27
Lieferungen 8986 Lemmata von abbet bis zwîvelrede, dazu kommen 439
Nachtragsstichwörter” (S. 2613). Stolz resümiert die Projektleiterin
Ursula Schulze -
1960 von Helmut de Boor als Hilfskraft eingestellt - in den
abschließenden Bemerkungen ihr Langzeitprojekt. Am Schluss steht eine
Danksagung, die leider eine Gruppe ausspart: die Rezensenten des
voluminösen Werks. Seit dem Jahrgang 1988 dieser Zeitschrift quäle ich
mich mit diesem zunehmend ungeliebten gedruckten Nachschlagewerk
(weitere Rezensionen, die mehrere Lieferungen zusammenfassen,
erschienen 1991, 1996, 2002 und 2007). Dass ich als junger Referendar
im Generallandesarchiv 1987 beim ersten Heft zugriff, war rückblickend
betrachtet eine Fehlentscheidung. Weder beruflich noch privat habe ich
von diesem Spezialwörterbuch in nennenswertem Umfang profitiert, und
ob meine Rezensionen irgendeinen Nutzen gestiftet haben, möchte ich
bezweifeln. Obwohl von Anfang an ausgemacht war, dass nicht jede
Lieferung einzeln besprochen werden kann, drängte der Verlag und
setzte die Schriftleitung unter Druck. Da ich mich - anders als der
Rezensent der Nassauischen Annalen - dagegen entschieden hatte,
einzelne Lemmata kommentierend aufzulisten, musste ich mir jedesmal
einigermaßen neue Aspekte einfallen lassen. Was ich in der Sache
zusammenfassend zum WMU zu sagen habe, habe ich bereits in der letzten
Besprechung formuliert (der Text ist abrufbar unter:
http://archiv.twoday.net/stories/75224744/ ).
Je weiter das Unternehmen fortschritt, um so unzufriedener wurde ich
mit seiner teuren gedruckten Präsentationsform. Der offizielle Preis
des Gesamtwerks beträgt 1194 Euro in Deutschland. Unter anderem
“verlagsrechtliche Gründe” hätten eine Umstellung des Werks auf
elektronische Bearbeitung nicht zugelassen, erfährt man (S. 2613).
Dass es in absehbarer Zeit die dringend wünschenswerte
Open-Access-Version, die an die Seite der höchst verdienstvollen
Corpus-Digitalisierung (www.corpus.uni-trier.de) treten könnte, geben
wird, halte ich für unwahrscheinlich. Die öffentliche Hand hat mit
viel Steuergeldern das Projekt finanziert, während der Verlag fette
Profite einstreichen durfte. So wird es sich womöglich auch bei der
angekündigten Online-Fassung verhalten. Ein freies nachnutzbares WMU
(unter der Lizenz CC-BY - Creative Commons Attribution) könnte der
Forschung unschätzbaren Nutzen bescheren. Aber darum kümmern sich die
Verkrustungen des traditionellen Verlagswesens nicht. Freilich wäre es einseitig, nur die Verlage verantwortlich zu machen. Die konservativen Open-Access-Verhinderer an den Akademien tragen eine erhebliche Mitschuld.
KlausGraf - am Samstag, 21. Juli 2012, 15:33 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=22666
Die Ausstellung "Buch & Macht" in Strechau würdigt den Bibliophilen Ferdinand Hoffmann, dessen Sammlung bei der Zerstreuung der Nikolsburger Bibliothek 1933/34 - siehe http://archiv.twoday.net/stories/14663042/ - ebenfalls in alle Winde verweht wurde.
Zur Person
Buch über steirische Exlibris, austria-lexikon.at
http://ipi.cerl.org/
Update: http://archiv.twoday.net/stories/138660800/

Die Ausstellung "Buch & Macht" in Strechau würdigt den Bibliophilen Ferdinand Hoffmann, dessen Sammlung bei der Zerstreuung der Nikolsburger Bibliothek 1933/34 - siehe http://archiv.twoday.net/stories/14663042/ - ebenfalls in alle Winde verweht wurde.
Zur Person
Buch über steirische Exlibris, austria-lexikon.at
http://ipi.cerl.org/
Update: http://archiv.twoday.net/stories/138660800/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Links zur wichtigen habsburgischen Gesetzessammlung gibt es unter
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/110776898/
Insbesondere Josef Pauser, Leiter einer hochangesehenen Behördenbibliothek, hätte es in der Hand gehabt, Digitalisate für http://alex.onb.ac.at/ zu veranlassen. Wenn ANNO, das Schwesterprojekt von ALEX, aktuell "Friesierkunst der Mode" digitalisierte, so bestätigt das einmal mehr den Befund, dass Digitalisierungsprojekte wissenschaftliche Prioritäten verkennen bzw. dass diese ihnen schnurzpiepegal sind.
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/110776898/
Insbesondere Josef Pauser, Leiter einer hochangesehenen Behördenbibliothek, hätte es in der Hand gehabt, Digitalisate für http://alex.onb.ac.at/ zu veranlassen. Wenn ANNO, das Schwesterprojekt von ALEX, aktuell "Friesierkunst der Mode" digitalisierte, so bestätigt das einmal mehr den Befund, dass Digitalisierungsprojekte wissenschaftliche Prioritäten verkennen bzw. dass diese ihnen schnurzpiepegal sind.
KlausGraf - am Samstag, 21. Juli 2012, 13:52 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.brennpunkt-geschichte.de/2012/07/01/was-ist-digitale-geschichtsdidaktik/
http://historischdenken.hypotheses.org/202
Das Digitale ist aus meiner Sicht sowohl Werkzeug als auch Quelle. Es gilt, Geschichtsvermittlung mit digitalen Mitteln zu verbessern, wobei Web 2.0 die Vermittelnden und ihre Adressaten auf Augenhöhe bringen kann, und empirisch - durch "teilnehmende Beobachtung" - die Rolle des Digitalen in der Geschichts- und Erinnerungskultur zu untersuchen. In beiden Fällen ist noch viel zu tun.
http://historischdenken.hypotheses.org/202
Das Digitale ist aus meiner Sicht sowohl Werkzeug als auch Quelle. Es gilt, Geschichtsvermittlung mit digitalen Mitteln zu verbessern, wobei Web 2.0 die Vermittelnden und ihre Adressaten auf Augenhöhe bringen kann, und empirisch - durch "teilnehmende Beobachtung" - die Rolle des Digitalen in der Geschichts- und Erinnerungskultur zu untersuchen. In beiden Fällen ist noch viel zu tun.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://bib-blog.de/?page_id=773 bietet eine Liste von Links zu Hochschulbibliotheken und (leicht veraltete) Angaben über die Studierendenzahl. Überprüft wurden nur die Universitäten mit mehr als 10.000 Studierenden auf das Vorhandensein von digitalen Sammlungen. Die Reihenfolge folgt der Quelle und orientiert sich am vollen Namen der jeweiligen Einrichtung.
Da viele Bibliotheken ihre digitalen Sammlungen verstecken, kann es sein, dass mir solche entgangen sind.
Freiburg i. Br.
http://www.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=dipro
Oldenburg
Die digitalisierten historischen Kinderbücher wurden offenbar in jüngster Zeit vom Netz genommen. Eine Erklärung dafür findet sich nicht online. Eine Rezension des Angebots von 2005:
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/id=90&type=rezwww
Kiel
http://dibiki.ub.uni-kiel.de/viewer/
Tübingen
http://www.ub.uni-tuebingen.de/literatur-suchen-ausleihen/digitalisierte-bestaende.html
Greifswald
http://ub-goobi-pr2.ub.uni-greifswald.de/viewer/
FH Frankfurt
Die Institution ist nicht in der Lage, einen korrekten Link zur kleinen digitalen Sammlung von 48 Werken zu setzen:
http://frankfurt.intranda.com/viewer/searchList.xhtml
Von http://frankfurt.intranda.com kommt man nicht weiter.
Erlangen-Nürnberg
http://bvbm1.bib-bvb.de/R/?local_base=UBE
Jena
http://www.urmel-dl.de/
Göttingen
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/
Düsseldorf
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/
Hochschule RheinMain
Die Angebote der integrierten Landesbibliothek Wiesbaden (außer den verlinkten Tageszeitungen noch 1 Hildegardis-Handschrift) sind sehr gut versteckt
http://www.hs-rm.de/landesbibliothek/hessen-und-nassau/tageszeitungen-der-region-digital/index.html
HU Berlin
http://edoc.hu-berlin.de/?lesen=6
Frankfurt
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/
Würzburg
Unsinnigerweise auf zwei Portale verteilt. Neben dem verlinkten auch die Franconica
http://vb.uni-wuerzburg.de/ub/index.html
Gießen
http://digisam.ub.uni-giessen.de/index.html
Karlsruhe
http://www.bibliothek.kit.edu/cms/digitalisierte-altbestaende.php
München
http://epub.ub.uni-muenchen.de/
Halle
http://bibliothek.uni-halle.de/dbib/digital/
Bamberg
So gut wie nicht auffindbar (einiges Gemeinfreie frei zugänglich):
https://katalog.ub.uni-bamberg.de/ubg-www/Digitalisate/
Marburg
Keine Übersicht über den Gesamtbestand. Neben DigiWunschbuch auch Nachlassdigitalisierung.
http://www.uni-marburg.de/bis/service/digiwunschbuch/index_html
Bonn
http://s2w.hbz-nrw.de/ulbbn/
Heidelberg
http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/digilit.html
RWTH Aachen
Digitalisate in OPUS versteckt
http://darwin.bth.rwth-aachen.de/opus3/abfrage_collections.php?la=de
TU Berlin
Die paar Digitalisate in OPUS zählen eigentlich nicht:
http://opus.kobv.de/tuberlin/
Schlecht auffindbar:
http://gartentexte-digital.ub.tu-berlin.de/
http://pomologie.ub.tu-berlin.de/
TU Braunschweig
http://rzbl04.biblio.etc.tu-bs.de:8080/docportal/content/main/sammlungen.xml
Darmstadt
http://www.ulb.tu-darmstadt.de/angebot/medien/digitale_sammlungen_1/digitale_sammlungen.de.jsp
Dresden
http://digital.slub-dresden.de/kollektionen/
TU München
http://mediatum.ub.tum.de/
Augsburg
http://www.bibliothek.uni-augsburg.de/dda/
Bielefeld
http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/
Bremen
http://brema.suub.uni-bremen.de/
(sowie Karten)
Hamburg
Sehr gut versteckt:
http://www.sub.uni-hamburg.de/bibliotheken/projekte/digitalisierte-bestaende.html
Kassel
http://orka.bibliothek.uni-kassel.de/viewer/
Köln
http://www.ub.uni-koeln.de/digital/digitsam/index_ger.html
Trier
http://www.uni-trier.de/index.php?id=2943
Münster
http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/
http://www.ulb.uni-muenster.de/sammlungen/digital/
Fazit: Nur 35 der 61 dort verlinkten Universitätsbibliotheken größerer deutscher Hochschulen bieten digitalisierte eigene Bestände an! Die Auffindbarkeit der digitalen Sammlungen ist oft unbefriedigend.
Die Datengrundlage meiner Quelle ist freilich zweifelhaft. Das Fehlen der UB Leipzig ist unverzeihlich. Die Leipziger Digitalisate muss man sich via
http://www.ub.uni-leipzig.de/projekte.html
zusammensuchen. Dort fehlen die in Manuscripta Mediaevalia versteckten Handschriftendigitalisate.
Da viele Bibliotheken ihre digitalen Sammlungen verstecken, kann es sein, dass mir solche entgangen sind.
Freiburg i. Br.
http://www.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=dipro
Oldenburg
Die digitalisierten historischen Kinderbücher wurden offenbar in jüngster Zeit vom Netz genommen. Eine Erklärung dafür findet sich nicht online. Eine Rezension des Angebots von 2005:
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/id=90&type=rezwww
Kiel
http://dibiki.ub.uni-kiel.de/viewer/
Tübingen
http://www.ub.uni-tuebingen.de/literatur-suchen-ausleihen/digitalisierte-bestaende.html
Greifswald
http://ub-goobi-pr2.ub.uni-greifswald.de/viewer/
FH Frankfurt
Die Institution ist nicht in der Lage, einen korrekten Link zur kleinen digitalen Sammlung von 48 Werken zu setzen:
http://frankfurt.intranda.com/viewer/searchList.xhtml
Von http://frankfurt.intranda.com kommt man nicht weiter.
Erlangen-Nürnberg
http://bvbm1.bib-bvb.de/R/?local_base=UBE
Jena
http://www.urmel-dl.de/
Göttingen
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/
Düsseldorf
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/
Hochschule RheinMain
Die Angebote der integrierten Landesbibliothek Wiesbaden (außer den verlinkten Tageszeitungen noch 1 Hildegardis-Handschrift) sind sehr gut versteckt
http://www.hs-rm.de/landesbibliothek/hessen-und-nassau/tageszeitungen-der-region-digital/index.html
HU Berlin
http://edoc.hu-berlin.de/?lesen=6
Frankfurt
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/
Würzburg
Unsinnigerweise auf zwei Portale verteilt. Neben dem verlinkten auch die Franconica
http://vb.uni-wuerzburg.de/ub/index.html
Gießen
http://digisam.ub.uni-giessen.de/index.html
Karlsruhe
http://www.bibliothek.kit.edu/cms/digitalisierte-altbestaende.php
München
http://epub.ub.uni-muenchen.de/
Halle
http://bibliothek.uni-halle.de/dbib/digital/
Bamberg
So gut wie nicht auffindbar (einiges Gemeinfreie frei zugänglich):
https://katalog.ub.uni-bamberg.de/ubg-www/Digitalisate/
Marburg
Keine Übersicht über den Gesamtbestand. Neben DigiWunschbuch auch Nachlassdigitalisierung.
http://www.uni-marburg.de/bis/service/digiwunschbuch/index_html
Bonn
http://s2w.hbz-nrw.de/ulbbn/
Heidelberg
http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/digilit.html
RWTH Aachen
Digitalisate in OPUS versteckt
http://darwin.bth.rwth-aachen.de/opus3/abfrage_collections.php?la=de
TU Berlin
Die paar Digitalisate in OPUS zählen eigentlich nicht:
http://opus.kobv.de/tuberlin/
Schlecht auffindbar:
http://gartentexte-digital.ub.tu-berlin.de/
http://pomologie.ub.tu-berlin.de/
TU Braunschweig
http://rzbl04.biblio.etc.tu-bs.de:8080/docportal/content/main/sammlungen.xml
Darmstadt
http://www.ulb.tu-darmstadt.de/angebot/medien/digitale_sammlungen_1/digitale_sammlungen.de.jsp
Dresden
http://digital.slub-dresden.de/kollektionen/
TU München
http://mediatum.ub.tum.de/
Augsburg
http://www.bibliothek.uni-augsburg.de/dda/
Bielefeld
http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/
Bremen
http://brema.suub.uni-bremen.de/
(sowie Karten)
Hamburg
Sehr gut versteckt:
http://www.sub.uni-hamburg.de/bibliotheken/projekte/digitalisierte-bestaende.html
Kassel
http://orka.bibliothek.uni-kassel.de/viewer/
Köln
http://www.ub.uni-koeln.de/digital/digitsam/index_ger.html
Trier
http://www.uni-trier.de/index.php?id=2943
Münster
http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/
http://www.ulb.uni-muenster.de/sammlungen/digital/
Fazit: Nur 35 der 61 dort verlinkten Universitätsbibliotheken größerer deutscher Hochschulen bieten digitalisierte eigene Bestände an! Die Auffindbarkeit der digitalen Sammlungen ist oft unbefriedigend.
Die Datengrundlage meiner Quelle ist freilich zweifelhaft. Das Fehlen der UB Leipzig ist unverzeihlich. Die Leipziger Digitalisate muss man sich via
http://www.ub.uni-leipzig.de/projekte.html
zusammensuchen. Dort fehlen die in Manuscripta Mediaevalia versteckten Handschriftendigitalisate.
KlausGraf - am Freitag, 20. Juli 2012, 18:50 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt Bd. 110. 2001, nunmehr auch online
http://periodika.digitale-sammlungen.de/ingolstadt/Blatt_bsb00069307,00005.html
http://periodika.digitale-sammlungen.de/ingolstadt/Blatt_bsb00069307,00005.html
KlausGraf - am Freitag, 20. Juli 2012, 18:23 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 20. Juli 2012, 18:08 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
This week alerts appeared about the proposed sale of parts of the Mendham Collection, since thirty years on deposit at Canterbury Cathedral. The owner, the Law Society of England and Wales, describes the collection at its own website as “a unique collection of Catholic and anti-Catholic literature including manuscripts and printed books ranging from the 15th to the 19th centuries”. Despite protests of Canterbury Cathedral the Law Society has started removing books from Canterbury on July 18, 2012 in preparation for an auction at Sotheby’s, apparently to raise funds. Canterbury Cathedral and the University of Kent have jointly decided to involve the general public in their protest against the possible dispersal of a collection with more than 5,000 items including medieval manuscripts and early printed books. An online petition to support both institutions has been launched.
Read more by Otto Vervaart at
http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2012/07/19/selling-the-mendham-collection-a-poor-move/
Update:
http://www.kentonline.co.uk/kentonline/news/2012/july/24/mendham_collection.aspx
Read more by Otto Vervaart at
http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2012/07/19/selling-the-mendham-collection-a-poor-move/
Update:
http://www.kentonline.co.uk/kentonline/news/2012/july/24/mendham_collection.aspx
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://kups.ub.uni-koeln.de/4727/
Wann merken die Schriftenserver, dass bei einem solchen Werk das Inhaltsverzeichnis in die Metadaten gehört?
Ein Aufsatz behandelt auch die aktuellen urheberrechtlichen Probleme im Bibliotheksbereich.
Wann merken die Schriftenserver, dass bei einem solchen Werk das Inhaltsverzeichnis in die Metadaten gehört?
Ein Aufsatz behandelt auch die aktuellen urheberrechtlichen Probleme im Bibliotheksbereich.
KlausGraf - am Freitag, 20. Juli 2012, 16:33 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Freitag, 20. Juli 2012, 14:45 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die im Bundesarchivgesetz festgelegte Anbietungspflicht scheint selbst im Bundesinnenministerium unbekannt zu sein, das nach einem Bericht der Stuttgarter Zeitung vom 19.07.2012 selbst die Anweisung zur Vernichtung von Verfassungsschutzakten gab:
Das Bundesinnenministerium (BMI) hat zehn Tage nach dem Auffliegen der Thüringer Neonazi-Zelle NSU angeordnet, dass die Protokolle von sechs Abhörmaßnahmen des Bundesamts für Verfassungsschutz vernichtet werden, obwohl es sich dabei um Spitzelaktionen gegen Rechtsextremisten gehandelt hatte...Das BMI bestätigte den Vorgang am Abend und rechtfertigt ihn mit einer „fristgerechten Sammelanordnung für Löschungsfälle nach Ablauf der Speicherfrist“, so ein Ministeriumssprecher. Der Vorgang sei in der Sache gerechtfertigt und die zeitliche Nähe zum Aufdecken des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ NSU um Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe ein Zufall.
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.verfassungsschutzbericht-schredder-befehl-von-ganz-oben.67f9752e-8f11-4ecc-9590-2c46e6974d92.html
S.a.
http://archiv.twoday.net/stories/97068889/
http://archiv.twoday.net/stories/97072455/
http://archiv.twoday.net/stories/109324340/
http://archiv.twoday.net/stories/109329711/
Das Bundesinnenministerium (BMI) hat zehn Tage nach dem Auffliegen der Thüringer Neonazi-Zelle NSU angeordnet, dass die Protokolle von sechs Abhörmaßnahmen des Bundesamts für Verfassungsschutz vernichtet werden, obwohl es sich dabei um Spitzelaktionen gegen Rechtsextremisten gehandelt hatte...Das BMI bestätigte den Vorgang am Abend und rechtfertigt ihn mit einer „fristgerechten Sammelanordnung für Löschungsfälle nach Ablauf der Speicherfrist“, so ein Ministeriumssprecher. Der Vorgang sei in der Sache gerechtfertigt und die zeitliche Nähe zum Aufdecken des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ NSU um Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe ein Zufall.
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.verfassungsschutzbericht-schredder-befehl-von-ganz-oben.67f9752e-8f11-4ecc-9590-2c46e6974d92.html
S.a.
http://archiv.twoday.net/stories/97068889/
http://archiv.twoday.net/stories/97072455/
http://archiv.twoday.net/stories/109324340/
http://archiv.twoday.net/stories/109329711/
ingobobingo - am Freitag, 20. Juli 2012, 10:35 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 18. Juli 2012, 15:13 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ich kann Dilibri gar nicht genug danken, dass sie diese vermutlich von Fälschungen Roths durchzogene Quellensammlung, die auch in Bibliotheken sehr rar ist, online bereitgestellt hat:
http://www.dilibri.de/id/867776
http://www.dilibri.de/id/867776
KlausGraf - am Dienstag, 17. Juli 2012, 17:48 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Meint Gerhard Dannemann, Professor für Recht, Wirtschaft und Politik am Großbritannien-Zentrum der Humboldt-Universität zu Berlin.
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/verjaehrungsfrist-fuer-plagiatsvergehen-dannemann-gegen-verjaehrung-a-841795.html
"Ausgerechnet jetzt, wo wir das volle Ausmaß unentdeckter oder unzulänglich aufgearbeiteter Altfälle zu erahnen beginnen, darf man nicht über eine Verjährungsregel deren überfällige Aufarbeitung im Keim ersticken."
Stimmt! Der Umgang universitärer Gremien mit dem Problem ist vielfach skandalös.

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/verjaehrungsfrist-fuer-plagiatsvergehen-dannemann-gegen-verjaehrung-a-841795.html
"Ausgerechnet jetzt, wo wir das volle Ausmaß unentdeckter oder unzulänglich aufgearbeiteter Altfälle zu erahnen beginnen, darf man nicht über eine Verjährungsregel deren überfällige Aufarbeitung im Keim ersticken."
Stimmt! Der Umgang universitärer Gremien mit dem Problem ist vielfach skandalös.

KlausGraf - am Dienstag, 17. Juli 2012, 17:29 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
Unter den Neuzugängen sind etliche deutsche Handschriften:
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msinc/nav/history
Twingers Straßburger Chronik
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/titleinfo/3663121
Wie kann man nur einen belanglosen Zettel über das wunderbare Jungen-Exlibris kleben?
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/pageview/3663126
Oder wenn der Zettel nur an einer Seite befestigt ist, wie kann man nur die Seite digitalisieren, ohne beide Ansichten wiederzugeben?
Ein Aktenband zur Grafschaft Hohenberg aus der Sammlung des Ulmer Prälaten Schmid, die sonst im Stadtarchiv Ulm und Hauptstaatsarchiv Stuttgart aufbewahrt wird:
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/titleinfo/3655901
Mit Ms. germ. qu. 7 liegt die zweite Handschrift des Minne- und Aventiure-Romans Friedrich von Schwaben online vor (die Frankfurter Handschrift war der Forschung zum "FvS" lange entgangen, bevor sie in der ZfdA 1976 vorgestellt wurde.)
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/titleinfo/3649901
Der Spruch auf den schwäbischen Städtekrieg
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/pageview/3656695
nach der Edition von Steiff/Mehring:
http://de.wikisource.org/wiki/Die_K%C3%A4mpfe_bei_Gm%C3%BCnd,_Staufen_und_E%C3%9Flingen_%281449%29
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msinc/nav/history
Twingers Straßburger Chronik
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/titleinfo/3663121
Wie kann man nur einen belanglosen Zettel über das wunderbare Jungen-Exlibris kleben?
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/pageview/3663126
Oder wenn der Zettel nur an einer Seite befestigt ist, wie kann man nur die Seite digitalisieren, ohne beide Ansichten wiederzugeben?
Ein Aktenband zur Grafschaft Hohenberg aus der Sammlung des Ulmer Prälaten Schmid, die sonst im Stadtarchiv Ulm und Hauptstaatsarchiv Stuttgart aufbewahrt wird:
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/titleinfo/3655901
Mit Ms. germ. qu. 7 liegt die zweite Handschrift des Minne- und Aventiure-Romans Friedrich von Schwaben online vor (die Frankfurter Handschrift war der Forschung zum "FvS" lange entgangen, bevor sie in der ZfdA 1976 vorgestellt wurde.)
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/titleinfo/3649901
Der Spruch auf den schwäbischen Städtekrieg
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/pageview/3656695
nach der Edition von Steiff/Mehring:
http://de.wikisource.org/wiki/Die_K%C3%A4mpfe_bei_Gm%C3%BCnd,_Staufen_und_E%C3%9Flingen_%281449%29
KlausGraf - am Dienstag, 17. Juli 2012, 17:00 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 17. Juli 2012, 16:29 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Fragt RA Winfried Klein in der heutigen FAZ
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kaspar-hausers-raetsel-zweiter-teil-sargverlust-in-der-fuerstengruft-11822206.html
damit seine Studien zur Pforzheimer Fürstengruft fortsetzend, siehe
http://archiv.twoday.net/stories/97050074/
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kaspar-hausers-raetsel-zweiter-teil-sargverlust-in-der-fuerstengruft-11822206.html
damit seine Studien zur Pforzheimer Fürstengruft fortsetzend, siehe
http://archiv.twoday.net/stories/97050074/
KlausGraf - am Dienstag, 17. Juli 2012, 15:53 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Direktorium/Stadtarchiv/Juedisches-Muenchen/Gedenkbuch.html
Ohne Einzelnachweise.
Ohne Einzelnachweise.
KlausGraf - am Dienstag, 17. Juli 2012, 15:46 - Rubrik: Kommunalarchive
KlausGraf - am Dienstag, 17. Juli 2012, 15:43 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Leise ging das Weblog des Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchivs am 22. Juni 2012 an den Start.
Link: http://www.bb-wa.de/de/neuigkeiten.html
Wolf Thomas - am Dienstag, 17. Juli 2012, 13:30 - Rubrik: Weblogs
Eine Schreckensnachricht aus INETBIB:
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
heute erfuhr ich, dass die DNB die digitalisierten Zeitschriften der
Exilsammlung abgeschaltet hat. Auf der Hinweisseite heißt es dazu nur,
dass es aus "rechtlichen Gründen" geschehen sei.
Für Rückfragen zu diesem Vorgang stünde Frau Dr. Asmus zur Verfügung.
http://www.dnb.de/DE/DEA/Kataloge/Periodika/periodika_node.html
Welche rechtlichen Gründe kann es wohl für die Abschaltung geben?
Ich bitte sie alle, sich danach bei der DNB zu erkundigen, denn ohne
diese wichtigen Quellen ist eine gute Arbeit in unserem Haus kaum
möglich.
Mit freundlichen Grüßen,
Florian Schulze
***********************************
Florian Schulze
Dipl.-Bibl. (FH)
Bibliothek
Jüdisches Museum Franken
Fürth, Schnaittach & Schwabach
Nürnberger Straße 3
D-90762 Fürth
http://www.dnb.de/DE/DEA/Kataloge/Exilpresse/exilpresse_node.html
http://www.dnb.de/DE/Wir/Projekte/Abgeschlossen/exilpresseDigital.html
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/110778661/
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
heute erfuhr ich, dass die DNB die digitalisierten Zeitschriften der
Exilsammlung abgeschaltet hat. Auf der Hinweisseite heißt es dazu nur,
dass es aus "rechtlichen Gründen" geschehen sei.
Für Rückfragen zu diesem Vorgang stünde Frau Dr. Asmus zur Verfügung.
http://www.dnb.de/DE/DEA/Kataloge/Periodika/periodika_node.html
Welche rechtlichen Gründe kann es wohl für die Abschaltung geben?
Ich bitte sie alle, sich danach bei der DNB zu erkundigen, denn ohne
diese wichtigen Quellen ist eine gute Arbeit in unserem Haus kaum
möglich.
Mit freundlichen Grüßen,
Florian Schulze
***********************************
Florian Schulze
Dipl.-Bibl. (FH)
Bibliothek
Jüdisches Museum Franken
Fürth, Schnaittach & Schwabach
Nürnberger Straße 3
D-90762 Fürth
http://www.dnb.de/DE/DEA/Kataloge/Exilpresse/exilpresse_node.html
http://www.dnb.de/DE/Wir/Projekte/Abgeschlossen/exilpresseDigital.html
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/110778661/
KlausGraf - am Dienstag, 17. Juli 2012, 13:05 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Im Rahmen der vielen Beiträge zu Geschichtsfälschungen in Archivalia - siehe http://archiv.twoday.net/stories/96987511/ - hatte ich mir unlängst vorgenommen, endlich einmal auch jene Fiktion vorzustellen, die mich schon seit den frühen 1990er Jahren beschäftigt hat: die 1918 erschienene "Goldschmiede-Chronik". Meine Fernleih-Bestellung der Rezension in der Deutschen Rundschau 1919 trägt den Datumsstempel 16. April 1993. Ich hatte mir - mit tatkräftiger Unterstützung von Frau Effinger in Heidelberg - den entlegen publizierten Aufsatz von Johann Michael Fritz (2008) und auch die unkritische Würdigung von Irmscher in der "Weltkunst" 1995 (S. 140f.) besorgt, ein einigermaßen günstiges Exemplar des Buchs erworben (es soll von der UB Heidelberg mit Genehmigung des Rechteinhabers digitalisiert werden) und Kontakt mit dem Enkel des "Herausgebers" Curt Rudolf Vincentz, Dr. Lothar Vincentz aufgenommen. Er bestätigte mir im April 2012 am Telefon, was ich schon bei der ersten Lektüre des Buchs wusste: Dass es sich nicht um eine authentische Quelle des 16. Jahrhunderts handelte. Merkwürdigerweise hätte das Interesse an dem Werk, erzählte er mir, in letzer Zeit zugenommen, während in den Jahrzehnten zuvor keine Anfragen dazu gekommen seien. Der Leiter von "Vincentz Network", Nachfolger der von seinem Großvater begründeten Fachverlage, übersandte mir liebenswürdigerweise sogar ein Exemplar des von mir bibliographisch ermittelten Buchs von Eberhard Meckel "Curt Rudolf Vincentz" (1954) als Leihgabe. Aus den bislang nicht beachteten Passagen dieser seltenen Schrift ergab sich eindeutig der fiktionale Charakter der sich als Werk des 16. Jahrhunderts ausgebenden "Chronik".
So standen die Dinge, als mir Karen Lambrecht, mit der ich vor allem in Sachen Hexenforschung früher freundschaftlichen Kontakt pflog, am 5. Juli ihren Aufsatz zur Goldschmiedechronik zusandte. Ich hatte am Rand von Hohenheimer Tagungen und auch im Gespräch mit ihr vor längerer Zeit die Authentizität der oft benutzten Quelle bestritten und auch von der Absicht der Veröffentlichung meiner Einsichten gesprochen. Ich war "not amused", dass mir Lambrechts Publikation in die Quere kam und dass die Autorin auch vor Abgabe ihres Beitrags keinen Kontakt mehr mit mir aufgenommen hatte. Lambrecht erweckt den Eindruck, als hätte sie allein die Fiktion aufgedeckt, obwohl ich sie doch im damaligen Gespräch (nach meiner Erinnerung ) auf den Casus und die Fiktion deutlich aufmerksam gemacht hatte. Ich kenne sie seit mindestens 1993 und bin mir ziemlich sicher, dass unsere Gespräche schon in den 1990er Jahren stattgefunden haben, während Lambrecht noch in ihrem Beitrag "Communicating Europe" in: German History 20 (2002), S. 18 Anm. 78 die Goldschmiede-Chronik ohne jegliche kritische Distanz als authentische Quelle zitiert!
Ich habe es satt, die kleinen Unredlichkeiten des Wissenschaftsbetriebs zu schlucken, auch wenn Lambrecht nun vorgibt, sich nicht an eine Publikationsabsicht meinerseits erinnern zu können. Ich weiß nur, dass ich an ihrer Stelle im Zweifel nicht den Eindruck erweckt hätte, allein die Quelle entlarvt zu haben, wenn Jahre zuvor in Gesprächen dieses Ergebnis bereits auch von anderer Seite kommuniziert worden war. Sie hätte mit mir nochmals Kontakt aufnehmen müssen, um die Sachlage abzuklären und ggf. Einsichten auszutauschen. Alles andere erscheint mir höchst unfair.
Karen Lambrecht: Dichtung und Wahrheit. Zum Verfasser der Goldschmiede-Chronik Curt Rudolf Vincentz (1867-1945). In: Schlesische Gelehrtenrepublik (2012), S. 269-280 ist ein klarer Fortschritt in der Beschäftigung mit der Goldschmiedechronik, wenngleich ihr die mir auch erst seit kurzem bekannte etwas frühere Stellungnahme des ehemals Heidelberger Kunsthistorikers Fritz entgangen ist. Sie schildert den skandalösen unkritischen Gebrauch der Quelle durch die moderne Selbstzeugnis-Forschung und kann erstmals das Meckel-Buch als Schlüsseltext für die Entstehung des Buchs heranziehen. Sie zollt am Schluss dem Autor Vincentz als Geschichtenerzähler Respekt, schreibt aber (und dem ist ohne Wenn und Aber beizupflichten), dass sein Werk nicht länger als geschichtswissenschaftliche Quelle der Selbstzeugnisforschung genutzt werden kann.
Der kurze Aufsatz von Johann Michael Fritzl: Eine historische Quelle zu den Breslauer Goldschmieden des 16. Jahrhunderts? In: Biuletyn historii sztuki 70 (2008), S. 303-305 bringt von seinem Publikationsort alle Voraussetzungen mit, hierzulande übersehen zu werden. Fritz kennt das Buch von Meckel nicht und erzählt aus Anlass der Verwendung der Goldschmiede-Chronik durch eine polnische Kunsthistorikerin von seiner eigenen Begegnung mit dem Text, die ihn zu dem Schluss führte, auf diese - wenn sie echt wäre - "sensationelle" Quelle in eigenen Publikationen zu verzichten. Er stellt fest, dass die maßgebliche Studie zu den Breslauer Goldschmieden von Hintze 1906 in der Chronik verwertet ist und diese daher "eine lokalpatriotische historisierende Erfindung" ist, die sich durch die altertümelnde Sprache als Original ausgibt (S. 304f.).
Fritz sagt, dass in dem Buch eine Verlagsangabe fehle und auch kein Herausgeber genannt sei. Das kann durchaus sein, auch wenn die mir zugänglichen Exemplare beides nennen. Es hat offensichtlich mehrere Druckvarianten gegeben. Ich habe mir nicht notiert, in welcher Bibliothek bzw. aus welchem Fernleihexemplar ich mir seinerzeit einige Kopien aus dem Buch gemacht habe, aber das Titelblatt des kopierten Buchs weist eine andere Gestaltung (nämlich ein Holzschnitt-Ornament unterhalb des Titels) auf als das in meinem Eigentum befindliche Exemplar mit Verlagsangabe und Datum auf dem Titelblatt:
Die Goldschmiede-Chronik.
Die Erlebnisse
der ehrbaren Goldschmiede-Ältesten
Martin und Wolfgang, auch Mag.
Peters Vincentz.
Verlag der Deutschen Bauhütte
Hannover
1918
Lambrecht stellt zurecht heraus, dass die Aufnahme von Textauszügen in Wolfram Fischers einflussreiche Quellensammlung zur Geschichte des deutschen Handwerks (1957, S. 30-55) die Rezeption der Chronik als historische Quelle erheblich befördert hat. Sie sei in der Entstehung undurchsichtig, schrieb Fischer (S. 11) und konzedierte, dass sie ohne Zweifel von ihrem Herausgeber Curt Rudolf Vincentz bearbeitet worden sei. Doch spräche "eine starke innere Wahrscheinlichkeit für die grundsätzliche Echtheit der Quelle" (S. 23). In der Fußnote dankt Fischer nicht weniger als 13 namentlich genannten Gewährsleuten (überwiegend mit Doktortitel), die ihm geholfen hätten, der Herkunft der Quelle auf die Spur zu kommen. Nun gab es damals noch nicht das Internet und die Wikipedia, mit der man blitzschnell zur heutigen Firma Vincentz gelangt, aber auch in den 1950er Jahren wäre es doch ohne weiteres möglich gewesen, den weiterbestehenden Verlag zu ermitteln und dort nachzufragen.
Dass es Vincentz, auf dessen universale Bildung und vielseitige Interessen ich nicht eingehen kann (und der auch bei Lambrecht etwas zu kurz kommt), von Anfang an gelungen ist, seine Autorschaft zu verschleiern, zeigt bereits die kurze Anzeige in der Deutschen Rundschau vom Dezember 1919, S. 473, die ich komplett wiedergebe: "In unruhige Zeit, wenn auch eine entlegene, führt die 'Goldschmiede-Chronik', die von den Erlebnissen der ehrbaren Goldschmiedeältesten Martin und Wolfgang, auch Mag. Peters Vinzent kündet (Deutsche Bauhütte, Hannover). Sie umfaßt die Jahre 1480 bis 1586 und handelt von den Freuden und Leiden, dem Stolz und der Not deutschen Handwerks im Kampf gegen Polen und Pest. Hier ist ein Dokument, das kulturhistorisch und auch national von besonderem Wert ist".
Auf ideologische Aspekte des Buchs geht Lambrecht nicht ein. Mir fielen Passagen über die Juden (vor allem S. 301-305) auf, die auf antisemitische Diskurse der Entstehungszeit zurückgehen könnten. Immerhin ist die berüchtigte "Laichinger Hungerchronik" (publiziert 1913/17) etwa zur gleichen Zeit aus antisemitischem Affekt gefälscht worden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Laichinger_Hungerchronik (mit weiteren Nachweisen)
Zu den literarischen Vorlagen von Vincentz könnte die durch ihre farbigen Schilderungen und die eingemischten Schwänke heute noch faszinierende Zimmerische Chronik gehört haben. Auch die Goldschmiede-Chronik mischt gern schwankhafte Erzählungen ein. Auf jeden Fall hat sich das heute noch durchaus lesbare Buch von Vincentz - schon allein wegen seiner Rezeption, siehe unten - weitere interpretatorische Bemühungen verdient.
Lambrecht meint, das Buch vermittle durchaus den Eindruck einer authentischen Quelle und es erfordere schon genaues Hinsehen, um die Fiktion zu erkennen (S. 279). Der Ansicht bin ich nicht. Wer auch nur ein wenig quellenkritisches Gespür und kritischen Geist hat, sollte eigentlich schon sehr rasch merken (wie ich das bei der ersten Lektüre getan habe), dass einfach alles zu gut passt, dass die Protagonisten bei zu vielen wichtigen Ereignissen dabei waren. Aber Lambrecht ist ja früher selbst auf die Quelle hereingefallen und mit ihr ganz viele andere, auch renommierte Historiker.
Lambrechts Nachweise der Benutzung in der modernen Geschichtswissenschaft als authentische Quelle (Kaspar von Greyerz, Axel Gotthard u.a.m.) lassen sich mit Google Book Search ohne Mühe vermehren:
Katharina Simon-Murscheid: Die Dinge im Schnittpunkt sozialer Beziehungsnetze (2004), im Literaturverzeichnis
Knut Schulz, in: Jahrbuch des Historischen Kollegs 1996, S. 74 Anm. 24: ein im Kern echter Wanderbericht
Jürgen Kuczynski (1980) usw. usf.
https://www.google.de/search?q=goldschmiedechronik&tbm=bks
https://www.google.de/search?q="goldschmiede-chronik"&tbm=bks
Sehr selten sind distanzierende Hinweise:
Rudolf Holbach, in: Kredit im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa (1991), S. 136 Anm. 15: "in der freilich reichlich dubiosen Goldschmiede-Chronik"
Walther Karl Zülch: Frankfurter Künstler (1935), S. 342: "vermutlich unechte, aber viele historische Tatsachen enthaltende"
Sehr viele Historikerinnen und Historiker (auch solche aus der ersten Reihe) sind Vincentz auf den Leim gegangen und haben eine fiktive Schrift unkritisch als authentische Quelle verwertet, da sie einfach zu schönen und einzigartigen Stoff bot. Zweifel, die sich schon aufgrund der Präsentationsform des Ganzen aufdrängen mussten, wurden kaum artikuliert. Niemand hat offenbar beim Verlag recherchiert, wo man ihm wohl freimütig das mitgeteilt hätte, was ich am Telefon erfuhr und was in Meckels Buch von 1954 (das auch in einigen wissenschaftlichen Bibliotheken steht) gedruckt zu lesen war, dass es sich bei der Goldschmiedechronik um ein Resultat der überbordenden historischen Phantasie des Curt Rudolf Vincentz handelt. Das alles wirft kein gutes Licht auf die Praxis der Geschichtswissenschaft.
Nachtrag August 2012: Das Buch von Vincentz ist online
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vincentz1918
#forschung
 Ölgemälde von Curt R. Vincentz (aus dem Buch von Meckel)
Ölgemälde von Curt R. Vincentz (aus dem Buch von Meckel)
 Titelblatt (von mir vor längerem kopiert)
Titelblatt (von mir vor längerem kopiert)
So standen die Dinge, als mir Karen Lambrecht, mit der ich vor allem in Sachen Hexenforschung früher freundschaftlichen Kontakt pflog, am 5. Juli ihren Aufsatz zur Goldschmiedechronik zusandte. Ich hatte am Rand von Hohenheimer Tagungen und auch im Gespräch mit ihr vor längerer Zeit die Authentizität der oft benutzten Quelle bestritten und auch von der Absicht der Veröffentlichung meiner Einsichten gesprochen. Ich war "not amused", dass mir Lambrechts Publikation in die Quere kam und dass die Autorin auch vor Abgabe ihres Beitrags keinen Kontakt mehr mit mir aufgenommen hatte. Lambrecht erweckt den Eindruck, als hätte sie allein die Fiktion aufgedeckt, obwohl ich sie doch im damaligen Gespräch (nach meiner Erinnerung ) auf den Casus und die Fiktion deutlich aufmerksam gemacht hatte. Ich kenne sie seit mindestens 1993 und bin mir ziemlich sicher, dass unsere Gespräche schon in den 1990er Jahren stattgefunden haben, während Lambrecht noch in ihrem Beitrag "Communicating Europe" in: German History 20 (2002), S. 18 Anm. 78 die Goldschmiede-Chronik ohne jegliche kritische Distanz als authentische Quelle zitiert!
Ich habe es satt, die kleinen Unredlichkeiten des Wissenschaftsbetriebs zu schlucken, auch wenn Lambrecht nun vorgibt, sich nicht an eine Publikationsabsicht meinerseits erinnern zu können. Ich weiß nur, dass ich an ihrer Stelle im Zweifel nicht den Eindruck erweckt hätte, allein die Quelle entlarvt zu haben, wenn Jahre zuvor in Gesprächen dieses Ergebnis bereits auch von anderer Seite kommuniziert worden war. Sie hätte mit mir nochmals Kontakt aufnehmen müssen, um die Sachlage abzuklären und ggf. Einsichten auszutauschen. Alles andere erscheint mir höchst unfair.
Karen Lambrecht: Dichtung und Wahrheit. Zum Verfasser der Goldschmiede-Chronik Curt Rudolf Vincentz (1867-1945). In: Schlesische Gelehrtenrepublik (2012), S. 269-280 ist ein klarer Fortschritt in der Beschäftigung mit der Goldschmiedechronik, wenngleich ihr die mir auch erst seit kurzem bekannte etwas frühere Stellungnahme des ehemals Heidelberger Kunsthistorikers Fritz entgangen ist. Sie schildert den skandalösen unkritischen Gebrauch der Quelle durch die moderne Selbstzeugnis-Forschung und kann erstmals das Meckel-Buch als Schlüsseltext für die Entstehung des Buchs heranziehen. Sie zollt am Schluss dem Autor Vincentz als Geschichtenerzähler Respekt, schreibt aber (und dem ist ohne Wenn und Aber beizupflichten), dass sein Werk nicht länger als geschichtswissenschaftliche Quelle der Selbstzeugnisforschung genutzt werden kann.
Der kurze Aufsatz von Johann Michael Fritzl: Eine historische Quelle zu den Breslauer Goldschmieden des 16. Jahrhunderts? In: Biuletyn historii sztuki 70 (2008), S. 303-305 bringt von seinem Publikationsort alle Voraussetzungen mit, hierzulande übersehen zu werden. Fritz kennt das Buch von Meckel nicht und erzählt aus Anlass der Verwendung der Goldschmiede-Chronik durch eine polnische Kunsthistorikerin von seiner eigenen Begegnung mit dem Text, die ihn zu dem Schluss führte, auf diese - wenn sie echt wäre - "sensationelle" Quelle in eigenen Publikationen zu verzichten. Er stellt fest, dass die maßgebliche Studie zu den Breslauer Goldschmieden von Hintze 1906 in der Chronik verwertet ist und diese daher "eine lokalpatriotische historisierende Erfindung" ist, die sich durch die altertümelnde Sprache als Original ausgibt (S. 304f.).
Fritz sagt, dass in dem Buch eine Verlagsangabe fehle und auch kein Herausgeber genannt sei. Das kann durchaus sein, auch wenn die mir zugänglichen Exemplare beides nennen. Es hat offensichtlich mehrere Druckvarianten gegeben. Ich habe mir nicht notiert, in welcher Bibliothek bzw. aus welchem Fernleihexemplar ich mir seinerzeit einige Kopien aus dem Buch gemacht habe, aber das Titelblatt des kopierten Buchs weist eine andere Gestaltung (nämlich ein Holzschnitt-Ornament unterhalb des Titels) auf als das in meinem Eigentum befindliche Exemplar mit Verlagsangabe und Datum auf dem Titelblatt:
Die Goldschmiede-Chronik.
Die Erlebnisse
der ehrbaren Goldschmiede-Ältesten
Martin und Wolfgang, auch Mag.
Peters Vincentz.
Verlag der Deutschen Bauhütte
Hannover
1918
Lambrecht stellt zurecht heraus, dass die Aufnahme von Textauszügen in Wolfram Fischers einflussreiche Quellensammlung zur Geschichte des deutschen Handwerks (1957, S. 30-55) die Rezeption der Chronik als historische Quelle erheblich befördert hat. Sie sei in der Entstehung undurchsichtig, schrieb Fischer (S. 11) und konzedierte, dass sie ohne Zweifel von ihrem Herausgeber Curt Rudolf Vincentz bearbeitet worden sei. Doch spräche "eine starke innere Wahrscheinlichkeit für die grundsätzliche Echtheit der Quelle" (S. 23). In der Fußnote dankt Fischer nicht weniger als 13 namentlich genannten Gewährsleuten (überwiegend mit Doktortitel), die ihm geholfen hätten, der Herkunft der Quelle auf die Spur zu kommen. Nun gab es damals noch nicht das Internet und die Wikipedia, mit der man blitzschnell zur heutigen Firma Vincentz gelangt, aber auch in den 1950er Jahren wäre es doch ohne weiteres möglich gewesen, den weiterbestehenden Verlag zu ermitteln und dort nachzufragen.
Dass es Vincentz, auf dessen universale Bildung und vielseitige Interessen ich nicht eingehen kann (und der auch bei Lambrecht etwas zu kurz kommt), von Anfang an gelungen ist, seine Autorschaft zu verschleiern, zeigt bereits die kurze Anzeige in der Deutschen Rundschau vom Dezember 1919, S. 473, die ich komplett wiedergebe: "In unruhige Zeit, wenn auch eine entlegene, führt die 'Goldschmiede-Chronik', die von den Erlebnissen der ehrbaren Goldschmiedeältesten Martin und Wolfgang, auch Mag. Peters Vinzent kündet (Deutsche Bauhütte, Hannover). Sie umfaßt die Jahre 1480 bis 1586 und handelt von den Freuden und Leiden, dem Stolz und der Not deutschen Handwerks im Kampf gegen Polen und Pest. Hier ist ein Dokument, das kulturhistorisch und auch national von besonderem Wert ist".
Auf ideologische Aspekte des Buchs geht Lambrecht nicht ein. Mir fielen Passagen über die Juden (vor allem S. 301-305) auf, die auf antisemitische Diskurse der Entstehungszeit zurückgehen könnten. Immerhin ist die berüchtigte "Laichinger Hungerchronik" (publiziert 1913/17) etwa zur gleichen Zeit aus antisemitischem Affekt gefälscht worden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Laichinger_Hungerchronik (mit weiteren Nachweisen)
Zu den literarischen Vorlagen von Vincentz könnte die durch ihre farbigen Schilderungen und die eingemischten Schwänke heute noch faszinierende Zimmerische Chronik gehört haben. Auch die Goldschmiede-Chronik mischt gern schwankhafte Erzählungen ein. Auf jeden Fall hat sich das heute noch durchaus lesbare Buch von Vincentz - schon allein wegen seiner Rezeption, siehe unten - weitere interpretatorische Bemühungen verdient.
Lambrecht meint, das Buch vermittle durchaus den Eindruck einer authentischen Quelle und es erfordere schon genaues Hinsehen, um die Fiktion zu erkennen (S. 279). Der Ansicht bin ich nicht. Wer auch nur ein wenig quellenkritisches Gespür und kritischen Geist hat, sollte eigentlich schon sehr rasch merken (wie ich das bei der ersten Lektüre getan habe), dass einfach alles zu gut passt, dass die Protagonisten bei zu vielen wichtigen Ereignissen dabei waren. Aber Lambrecht ist ja früher selbst auf die Quelle hereingefallen und mit ihr ganz viele andere, auch renommierte Historiker.
Lambrechts Nachweise der Benutzung in der modernen Geschichtswissenschaft als authentische Quelle (Kaspar von Greyerz, Axel Gotthard u.a.m.) lassen sich mit Google Book Search ohne Mühe vermehren:
Katharina Simon-Murscheid: Die Dinge im Schnittpunkt sozialer Beziehungsnetze (2004), im Literaturverzeichnis
Knut Schulz, in: Jahrbuch des Historischen Kollegs 1996, S. 74 Anm. 24: ein im Kern echter Wanderbericht
Jürgen Kuczynski (1980) usw. usf.
https://www.google.de/search?q=goldschmiedechronik&tbm=bks
https://www.google.de/search?q="goldschmiede-chronik"&tbm=bks
Sehr selten sind distanzierende Hinweise:
Rudolf Holbach, in: Kredit im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa (1991), S. 136 Anm. 15: "in der freilich reichlich dubiosen Goldschmiede-Chronik"
Walther Karl Zülch: Frankfurter Künstler (1935), S. 342: "vermutlich unechte, aber viele historische Tatsachen enthaltende"
Sehr viele Historikerinnen und Historiker (auch solche aus der ersten Reihe) sind Vincentz auf den Leim gegangen und haben eine fiktive Schrift unkritisch als authentische Quelle verwertet, da sie einfach zu schönen und einzigartigen Stoff bot. Zweifel, die sich schon aufgrund der Präsentationsform des Ganzen aufdrängen mussten, wurden kaum artikuliert. Niemand hat offenbar beim Verlag recherchiert, wo man ihm wohl freimütig das mitgeteilt hätte, was ich am Telefon erfuhr und was in Meckels Buch von 1954 (das auch in einigen wissenschaftlichen Bibliotheken steht) gedruckt zu lesen war, dass es sich bei der Goldschmiedechronik um ein Resultat der überbordenden historischen Phantasie des Curt Rudolf Vincentz handelt. Das alles wirft kein gutes Licht auf die Praxis der Geschichtswissenschaft.
Nachtrag August 2012: Das Buch von Vincentz ist online
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vincentz1918
#forschung
 Ölgemälde von Curt R. Vincentz (aus dem Buch von Meckel)
Ölgemälde von Curt R. Vincentz (aus dem Buch von Meckel) Titelblatt (von mir vor längerem kopiert)
Titelblatt (von mir vor längerem kopiert)KlausGraf - am Dienstag, 17. Juli 2012, 00:34 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://researchfragments.blogspot.de/2012/06/price-of-pamphlet.html
Bis zu 31,50 Euro je Scan!
Siehe auch
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Digitalisierungstarife
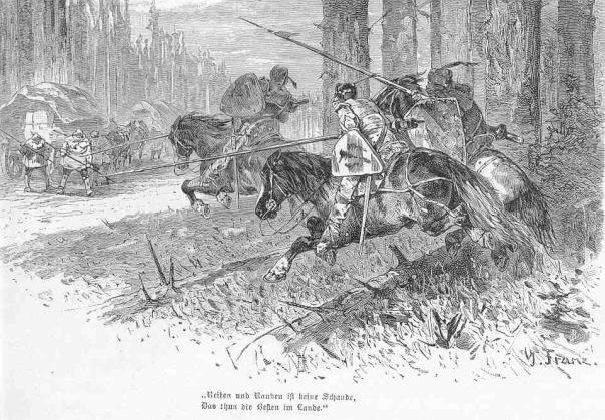
Bis zu 31,50 Euro je Scan!
Siehe auch
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Digitalisierungstarife
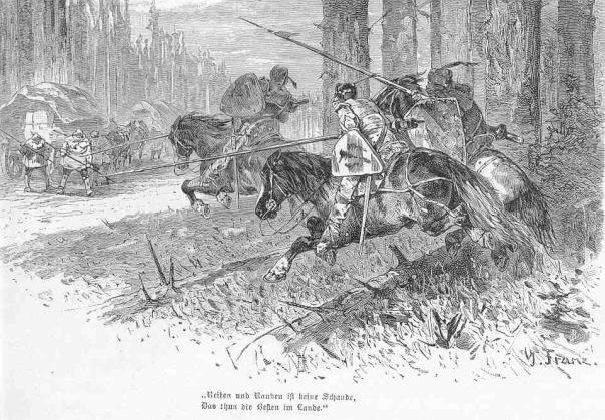
KlausGraf - am Dienstag, 17. Juli 2012, 00:14 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
