Auf der Prager Frühjahrstagung der VdA-Fachgruppe 8, der ich ja seit 1989 angehöre, hatte ich die GND (ehemals PND) mehrfach erwähnt und versprochen, hier über sie zu informieren.
Frühere Beiträge in Archivalia
http://archiv.twoday.net/search?q=gnd
http://archiv.twoday.net/search?q=pnd
Als Grundlagentexte empfehle ich die Lektüre von
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:GND
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:PND/BEACON
Die GND-Nummer ist eine derzeit mehrstellige Nummer, die als Personen-Normnummer bei individualisierten Personen eindeutig auf eine einigermaßen prominente historische Person verweist.
Die GND wird bei der Deutschen Nationalbibliothek gepflegt, die zu jeder GND (ich gehe hier nur auf Personen ein) Basisangaben (Namensformen, Lebensdaten, Kurzcharakteristik) anbietet. Untypisch ist hinsichtlich des Umfangs der Kurzcharakteristik der Eintrag zu Theophil Wurm:
http://d-nb.info/gnd/118635646
Hier kommt man auf der rechten Seite nur zum Beitrag in der Wikipedia, nicht aber zu weiteren Informationsangeboten, die Wurm mit seiner GND 118635646 verknüpft haben.
Wenig bekannt ist, welche Bewandtnis es mit den Links Normdaten (Person) hat, die man am Fuß des Wikipedia-Artikels gern übersieht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Theophil_Wurm
Der erste Link führt zur Nationalbibliothek, der zweite zur Library of Congress, der dritte zum VIAF-Eintrag (Zusammenführung verschiedener nationaler Normdateneinträge) und der vierte zu Appers Personen-Tool, das leider nur für Personen mit Wikipedia-Eintrag funktioniert:
http://toolserver.org/~apper/pd/person/Theophil_Wurm
Empfehlenswert ist stattdessen die Nutzung des in Wikisource bei SeeAlso verlinkten BEACON-Findbuchs. Da Wurm bei Wikisource keinen Eintrag hat, wähle ich eine andere Persönlichkeit:
http://de.wikisource.org/wiki/Friedrich_von_Bezold
Unter der GND steht rechts neben der Wikipedia-Personensuche SeeAlso:
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118662880
Wir können den GND-Teil dieser URL nun durch unsere Wurm-Nummer 118635646 ersetzen und sehen, dass sich das Apper-Tool und das BEACON-Findbuch leicht unterscheiden. Für das Findbuch gibt es eine API, die die Einbindung in eigene Angebote ermöglicht, wenn man nicht
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118635646
verlinken möchte. Davon hat das Landeskirchliche Archiv in Stuttgart bei seinen Nachlässen Gebrauch gemacht, auf deren Seite man mit dem Apper-Tool über Supplement und via BEACON-Findbuch direkt kommt:
http://www.zentralbibliothek.elk-wue.de/cms/startseite/literatursuche-kataloge/nachlaesse/t-z/wurm-theophil/
Bislang hat das Landesarchiv Baden-Württemberg nicht bekannt gegeben, wie die praktische Gewinnung der GND-Nummern bei Findbüchern funktioniert. Aus
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:PND/BEACON#Bibliotheken.2C_Verb.C3.BCnde.2C_Archive
geht hervor, dass bisher über 7200 Einträge zur Verfügung stehen. Im Fall Wurm derzeit 29 Einträge aus verschiedenen Beständen:
https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/suche/ergebnis1.php?gnd=118635646
Wer die Beispiele nachvollzogen hat, dem sollte das Potential dieser Personen-Metasuche deutlich geworden sein.
Man braucht eine dauerhafte Internetadresse für den lokalen Personeneintrag (z.B. Professorenkatalog oder Professorenpersonalakten bei einem Universitätsarchiv), eine absolut simpel herzustellende BEACON-Datei im Netz, die man beim Betreiber des BEACON-Findbuchs anmeldet, und kann dann seine eigenen personenbezogenen Bestände über die GND-Suche sichtbar machen. Zugleich kann man ohne weiteren Rechercheaufwand biographische Informationen zu den Personen via GND-Verlinkung den Benutzern in den eigenen Findmitteln/Personendatenbanken usw. zur Verfügung stellen.
Alles klar?
Frühere Beiträge in Archivalia
http://archiv.twoday.net/search?q=gnd
http://archiv.twoday.net/search?q=pnd
Als Grundlagentexte empfehle ich die Lektüre von
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:GND
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:PND/BEACON
Die GND-Nummer ist eine derzeit mehrstellige Nummer, die als Personen-Normnummer bei individualisierten Personen eindeutig auf eine einigermaßen prominente historische Person verweist.
Die GND wird bei der Deutschen Nationalbibliothek gepflegt, die zu jeder GND (ich gehe hier nur auf Personen ein) Basisangaben (Namensformen, Lebensdaten, Kurzcharakteristik) anbietet. Untypisch ist hinsichtlich des Umfangs der Kurzcharakteristik der Eintrag zu Theophil Wurm:
http://d-nb.info/gnd/118635646
Hier kommt man auf der rechten Seite nur zum Beitrag in der Wikipedia, nicht aber zu weiteren Informationsangeboten, die Wurm mit seiner GND 118635646 verknüpft haben.
Wenig bekannt ist, welche Bewandtnis es mit den Links Normdaten (Person) hat, die man am Fuß des Wikipedia-Artikels gern übersieht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Theophil_Wurm
Der erste Link führt zur Nationalbibliothek, der zweite zur Library of Congress, der dritte zum VIAF-Eintrag (Zusammenführung verschiedener nationaler Normdateneinträge) und der vierte zu Appers Personen-Tool, das leider nur für Personen mit Wikipedia-Eintrag funktioniert:
http://toolserver.org/~apper/pd/person/Theophil_Wurm
Empfehlenswert ist stattdessen die Nutzung des in Wikisource bei SeeAlso verlinkten BEACON-Findbuchs. Da Wurm bei Wikisource keinen Eintrag hat, wähle ich eine andere Persönlichkeit:
http://de.wikisource.org/wiki/Friedrich_von_Bezold
Unter der GND steht rechts neben der Wikipedia-Personensuche SeeAlso:
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118662880
Wir können den GND-Teil dieser URL nun durch unsere Wurm-Nummer 118635646 ersetzen und sehen, dass sich das Apper-Tool und das BEACON-Findbuch leicht unterscheiden. Für das Findbuch gibt es eine API, die die Einbindung in eigene Angebote ermöglicht, wenn man nicht
http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118635646
verlinken möchte. Davon hat das Landeskirchliche Archiv in Stuttgart bei seinen Nachlässen Gebrauch gemacht, auf deren Seite man mit dem Apper-Tool über Supplement und via BEACON-Findbuch direkt kommt:
http://www.zentralbibliothek.elk-wue.de/cms/startseite/literatursuche-kataloge/nachlaesse/t-z/wurm-theophil/
Bislang hat das Landesarchiv Baden-Württemberg nicht bekannt gegeben, wie die praktische Gewinnung der GND-Nummern bei Findbüchern funktioniert. Aus
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:PND/BEACON#Bibliotheken.2C_Verb.C3.BCnde.2C_Archive
geht hervor, dass bisher über 7200 Einträge zur Verfügung stehen. Im Fall Wurm derzeit 29 Einträge aus verschiedenen Beständen:
https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/suche/ergebnis1.php?gnd=118635646
Wer die Beispiele nachvollzogen hat, dem sollte das Potential dieser Personen-Metasuche deutlich geworden sein.
Man braucht eine dauerhafte Internetadresse für den lokalen Personeneintrag (z.B. Professorenkatalog oder Professorenpersonalakten bei einem Universitätsarchiv), eine absolut simpel herzustellende BEACON-Datei im Netz, die man beim Betreiber des BEACON-Findbuchs anmeldet, und kann dann seine eigenen personenbezogenen Bestände über die GND-Suche sichtbar machen. Zugleich kann man ohne weiteren Rechercheaufwand biographische Informationen zu den Personen via GND-Verlinkung den Benutzern in den eigenen Findmitteln/Personendatenbanken usw. zur Verfügung stellen.
Alles klar?
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-babs-0000013992
Jahrgänge 2011 und 2012 als PDFs. In Heft 51 wird der Fotograf Georg Loesti (1859-1943) GND: http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=117157333 gewürdigt, dessen Werke am 1. Januar des nächsten Jahres gemeinfrei werden.
Jahrgänge 2011 und 2012 als PDFs. In Heft 51 wird der Fotograf Georg Loesti (1859-1943) GND: http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=117157333 gewürdigt, dessen Werke am 1. Januar des nächsten Jahres gemeinfrei werden.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.llb-detmold.de/aktuelles/aktuelles-detail/article/volltextsuche-in-den-digitalen-sammlungen.html
"Ab sofort können Sie in den Digitalen Sammlungen bei neueren Schrifttypen (Antiqua) nicht nur in den Titel- und Strukturdaten, sondern auch im Volltext suchen.
Die ersten 8000 Seiten haben die Texterkennung bereits durchlaufen."
Was fehlt, ist eine Metasuche der diversen Volltextsuchen in Digitalen Sammlungen (insbesondere nach dem semantics-Modell).
"Ab sofort können Sie in den Digitalen Sammlungen bei neueren Schrifttypen (Antiqua) nicht nur in den Titel- und Strukturdaten, sondern auch im Volltext suchen.
Die ersten 8000 Seiten haben die Texterkennung bereits durchlaufen."
Was fehlt, ist eine Metasuche der diversen Volltextsuchen in Digitalen Sammlungen (insbesondere nach dem semantics-Modell).
KlausGraf - am Montag, 25. März 2013, 18:20 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
J. Kemper - am Montag, 25. März 2013, 14:58 - Rubrik: Kooperationsmodelle
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Winand von Steeg (gestorben 1453 als Kanoniker von St. Kastor in Koblenz, GND http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118633562) war eine der faszinierendsten Persönlichkeiten des 15. Jahrhunderts. Aloys Schmidt hat zu ihm mehrere wichtige Publikationen vorgelegt, am wichtigsten ist die mit Hermann Heimpel 1977 in den Münchner Akademie-Abhandlungen publizierte Studie zum einzigartig mit Juristenporträts illustrierten Zollgutachten im Geheimen Hausarchiv Hs. 12. Enno Bünz schrieb den Artikel im ²VL und gab einen biographischen Abriss in seinem Buch über das Würzburger Stift Haug:
http://books.google.de/books?id=CLPTDL8HNRUC&pg=PA635&lpg=PA635
BAV Pal. lat. 411 ist online:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_411
Die eherechtliche Schrift wurde auf dem Konstanzer Konzil 1417 abgeschlossen. http://www.handschriftencensus.de/10484 erwähnt nicht, dass Bl. 36r ein der Gattin Pfalzgraf Ludwigs III. gewidmetes deutsches Stundenlied, deutsche Fassung einer ihrem Gatten gewidmeten lateinischen Version, überliefert (²VL 10, 1186):
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_411/0077
[Abdruck Analecta Hymnica 30, 1898, S. 110-112
http://archive.org/stream/piadictaminarei02blumgoog#page/n357/mode/2up ]
BAV Pal. lat. 412 ist ebenfalls online:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_412
Mit den Illustrationen von "Adamas colluctancium aquilarum" (1418/19) befasste sich aus kunsthistorischer Sicht 1983 Barbara Obrist:
http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=zak-003:1983:40::350
Die hagiographische Sammelhandschrift zu Werner von Oberwesel Pal. lat. 858 ist noch nicht online.
[teilweiser Abdruck in den Acta Sanctorum:
http://books.google.de/books?id=n6jQNmguGbYC&pg=PA697 ]
Die wichtige Handschrift Würzburg, UB, M. ch. f. 62 ist dagegen online:
http://vb.uni-wuerzburg.de/ub/permalink/mchf62
Da die Hand Winands in ihr wiederholt begegnet, darf man ihn getrost als zeitweiligen Besitzer ansprechen. Zu den Winand-Texten (eine Predigt aus dem lapis angularis, zwei akademische Reden zur Würzburger Universität, wohl die ältesten dieser Art) siehe die Beschreibung:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0086_b042_JPG.htm
Lectura sexti decretalium ebenda M.ch.f. 90: Aloys Schmidt hatte 1977 (Schmidt/Heimpel: Winand, S. 32f.) schlüssig Winand zugewiesen (mittelrheinische Ortsnamen, Verfasser war wie Steeg Schüler Nikolaus Burgmanns) und der 1981 erschienene Handschriftenkatalog ist dieser Zuschreibung gefolgt:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0086_b054_jpg.htm
[Die Hs. nannte Schmidt bereits in der FS Thomas 1967, S. 367 Anm. 18]
Die Handschrift ist online:
http://vb.uni-wuerzburg.de/ub/permalink/mchf62
Erwähnen sollte man auch die Konfirmation Winands für den Abt von Banz in M.ch.f.84, Bl. 120v (Formularbuch des Johannes Ambundii), online:
http://vb.uni-wuerzburg.de/ub/mchf84/pages/mchf84/240.html
Kurze Auszüge aus einem Wormser Gutachten Winands bietet die Gießener Hs. 687:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0026_c083_jpg.htm
In Kassel ist leider noch nichts von 2° Ms. theol. 18, 19 und 20 online:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0372_b023_jpg.htm
Auf die Steeg-Autographen im Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 701, Nr. 178, 179, 187, 221 ist online nicht zu hoffen.
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0517_b395_jpg.htm (in diesem Katalog nur die ersten drei Nummern)
Nachträge: Das Phantasie-Porträt
http://www.portraitindex.de/bilder/zoom/ubl0050-0053
bezeichnet Winand fälschlich als Ulmer Patrizier.
Die Literaturliste von Ansgar Frenken im BBKL 1993:
G. Toepke (Hrsg.), Die Matrikel der Universität Heidelberg, Heidelberg 1884/1886, I 57; II 501; - Repertorium Germanicum I, ed. E. Göller, Berlin 1916, Nr. 2239; II, ed. G. Tellenbach, Berlin 1933-1961, 1164 f., 1325 u.ö.; IV, ed. K.A. Fink, Berlin 1943-1958, 3791 f. u.ö.; - Germania sacra NF 14: Kirchenprovinz Trier 2, Berlin-New York 1980, 223, 250; - Aloys Schmidt, Zur Geschichte der älteren Universität Würzburg, in: Würzburger Diözesangeschichtsblätter 11/12, 1949-50, 85-102; - Ders., Leichenpredigt auf König Ruprecht von der Pfalz, gehalten im Dome zu Würzburg am 9. Juni 1410 von Winand von Steeg, in: Würzburger Diözesangeschichtsblätter 14/15, 1952-53, 337-342; - Ders., Zur Baugeschichte der Wernerkapelle in Bacharach, in: Rhein. Viertelsjahresblätter 19, 1954, 69-89; - Ders., Nikolaus v. Kues, Sekretär des Kardinals Giordano Orsini, in: Aus Mittelalter und Neuzeit. FS Gerhard Kallen, Bonn 1957, 137- 143; - Ders., Winand von Steeg, ein unbekannter mittelrheinischer Künstler, in: FS Alois Thomas, Trier 1967, 363-372; - Ders., Die Wandmalereien in den Kirchen zu Steeg und Oberdiebach, in: Jb. zur Geschichte von Stadt und Landkreis Kaiserslauten 12/13, 1974-75, 305-327; - Ders./Hermann Heimpel, Winand von Steeg (1371-1453), ein mittelrheinischer Gelehrter und Künstler, in: Abhandlungen der Bayer. Akademie derWissenschaften. Phil.-hist. Klasse NF 81, München 1977; - Hermann Heimpel, Die Vener von Gmünd und Straßburg I-III, Göttingen 1982, 406-419 u.ö.; - Joseph Szövérffy, Die Annalen der lateinischen Hymnendichtung 2, Berlin 1965, 395; - Barbara Obrist, Das illustrierte »Adames colluctancium aquilarum« von Winand von Steeg als Zeitdokument, in: Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 40, 1983, 136-143; - Otto Meyer, Die Universität von Würzburg von 1402 und ihr Professor Winand von Steeg, in: Ders., Varia Franconiae Historica III, Würzburg 1986, 1115-1127; - LThK2 10, 1965, 1175
Bei Frenken fehlt:
Graf, Agnes: Winand von Steeg: Adamas colluctancium aquilarum. Ein Aufruf zum Kreuzzug gegen die Hussiten. Umění 40 (1992) 344-351
Die Literatur vor den grundlegenden Studien vor Schmidt ist nicht ganz bedeutungslos, zu nennen wären die Aufsätze von Joseph Weiß im Bericht der Görres-Gesellschaft 1904 (erschienen 1905):
http://archive.org/stream/vereinsschriftg11grgoog#page/n387/mode/2up
und im Historischen Jahrbuch 27 (1906) S. 470-471
[ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weiss_Winand_von_Steeg.pdf ]
Bünz im ²VL hat noch nicht:
Schouwink, Wilfried: Die Offiziendichtungen Winands von Steeg in Vat. Pal. lat. 411, 412, 858 und Trier, Stadtbibliothek 1139/65
In: Palatina-Studien / hrsg. von Walter Berschin. - Città del Vaticano, 1997 [erschienen 1998]. - (Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae ; 5)(Studi e testi / Biblioteca Apostolica Vaticana ; 365). - ISBN 88-210-0685-9. - S. 237-286
Auf Winand bezieht sich:
Dušan Buran: König Sigismund als Advocatus Ecclesiae : ein Bildkommentar . In: Bonum ut pulchrum : essays in art history in honour of Ernő Marosi on his seventieth birthday, ed. by Livia Varga .... – Budapest, 2010. – ISBN 978-963-7381-97-3, S. 251-258
Zu den im ²VL aufgezählten Werken ist zu ergänzen das kurze Gutachten (1430) des Dr. decretorum und Kaplan des Pfalzgrafen Ludwig, das Heimpel: Vener III, S. 1371 aus Eichstätt, UB, st 726, Bl. 183r edierte. Die Identifizierung mit Winand ist durchaus plausibel.
Heilsbronner Belege 1416/17 kannte Schmidt noch nicht:
http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Georg_Muck_-_Geschichte_von_Kloster_Heilsbronn_(Band_2).pdf/561 (canonicus pataviensis zu 1416, vgl. Schmidt 1977, S. 17f.)
http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Georg_Muck_-_Geschichte_von_Kloster_Heilsbronn_(Band_2).pdf/562
Siehe auch die Datenbanken
http://personendatenbank.germania-sacra.de/books/search/book:/term:steeg+winand
Repertorium Germanicum (suche Winandus, Stega)
http://194.242.233.132/denqRG/index.htm
RAG
http://www.rag-online.org/pnd/118633562
Im Dominikanerinnen-Kloster Liebenau bei Worms sah Ladislaus Sunthaim um 1500 ein Exemplar des verlorenen "Paries septenariorum", das ihn ausgesprochen beeindruckt haben muss:
http://books.google.de/books?id=J5fF1rCkbEIC&pg=PA941
(besprochen bei Schmidt/Heimpel 1977, S. 39f.)
Trithemius (Ann. Hirsaugienses) über Winand:
http://books.google.de/books?id=3whCAAAAcAAJ&pg=PA719
#forschung

http://books.google.de/books?id=CLPTDL8HNRUC&pg=PA635&lpg=PA635
BAV Pal. lat. 411 ist online:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_411
Die eherechtliche Schrift wurde auf dem Konstanzer Konzil 1417 abgeschlossen. http://www.handschriftencensus.de/10484 erwähnt nicht, dass Bl. 36r ein der Gattin Pfalzgraf Ludwigs III. gewidmetes deutsches Stundenlied, deutsche Fassung einer ihrem Gatten gewidmeten lateinischen Version, überliefert (²VL 10, 1186):
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_411/0077
[Abdruck Analecta Hymnica 30, 1898, S. 110-112
http://archive.org/stream/piadictaminarei02blumgoog#page/n357/mode/2up ]
BAV Pal. lat. 412 ist ebenfalls online:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_412
Mit den Illustrationen von "Adamas colluctancium aquilarum" (1418/19) befasste sich aus kunsthistorischer Sicht 1983 Barbara Obrist:
http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=zak-003:1983:40::350
Die hagiographische Sammelhandschrift zu Werner von Oberwesel Pal. lat. 858 ist noch nicht online.
[teilweiser Abdruck in den Acta Sanctorum:
http://books.google.de/books?id=n6jQNmguGbYC&pg=PA697 ]
Die wichtige Handschrift Würzburg, UB, M. ch. f. 62 ist dagegen online:
http://vb.uni-wuerzburg.de/ub/permalink/mchf62
Da die Hand Winands in ihr wiederholt begegnet, darf man ihn getrost als zeitweiligen Besitzer ansprechen. Zu den Winand-Texten (eine Predigt aus dem lapis angularis, zwei akademische Reden zur Würzburger Universität, wohl die ältesten dieser Art) siehe die Beschreibung:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0086_b042_JPG.htm
Lectura sexti decretalium ebenda M.ch.f. 90: Aloys Schmidt hatte 1977 (Schmidt/Heimpel: Winand, S. 32f.) schlüssig Winand zugewiesen (mittelrheinische Ortsnamen, Verfasser war wie Steeg Schüler Nikolaus Burgmanns) und der 1981 erschienene Handschriftenkatalog ist dieser Zuschreibung gefolgt:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0086_b054_jpg.htm
[Die Hs. nannte Schmidt bereits in der FS Thomas 1967, S. 367 Anm. 18]
Die Handschrift ist online:
http://vb.uni-wuerzburg.de/ub/permalink/mchf62
Erwähnen sollte man auch die Konfirmation Winands für den Abt von Banz in M.ch.f.84, Bl. 120v (Formularbuch des Johannes Ambundii), online:
http://vb.uni-wuerzburg.de/ub/mchf84/pages/mchf84/240.html
Kurze Auszüge aus einem Wormser Gutachten Winands bietet die Gießener Hs. 687:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0026_c083_jpg.htm
In Kassel ist leider noch nichts von 2° Ms. theol. 18, 19 und 20 online:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0372_b023_jpg.htm
Auf die Steeg-Autographen im Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 701, Nr. 178, 179, 187, 221 ist online nicht zu hoffen.
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0517_b395_jpg.htm (in diesem Katalog nur die ersten drei Nummern)
Nachträge: Das Phantasie-Porträt
http://www.portraitindex.de/bilder/zoom/ubl0050-0053
bezeichnet Winand fälschlich als Ulmer Patrizier.
Die Literaturliste von Ansgar Frenken im BBKL 1993:
G. Toepke (Hrsg.), Die Matrikel der Universität Heidelberg, Heidelberg 1884/1886, I 57; II 501; - Repertorium Germanicum I, ed. E. Göller, Berlin 1916, Nr. 2239; II, ed. G. Tellenbach, Berlin 1933-1961, 1164 f., 1325 u.ö.; IV, ed. K.A. Fink, Berlin 1943-1958, 3791 f. u.ö.; - Germania sacra NF 14: Kirchenprovinz Trier 2, Berlin-New York 1980, 223, 250; - Aloys Schmidt, Zur Geschichte der älteren Universität Würzburg, in: Würzburger Diözesangeschichtsblätter 11/12, 1949-50, 85-102; - Ders., Leichenpredigt auf König Ruprecht von der Pfalz, gehalten im Dome zu Würzburg am 9. Juni 1410 von Winand von Steeg, in: Würzburger Diözesangeschichtsblätter 14/15, 1952-53, 337-342; - Ders., Zur Baugeschichte der Wernerkapelle in Bacharach, in: Rhein. Viertelsjahresblätter 19, 1954, 69-89; - Ders., Nikolaus v. Kues, Sekretär des Kardinals Giordano Orsini, in: Aus Mittelalter und Neuzeit. FS Gerhard Kallen, Bonn 1957, 137- 143; - Ders., Winand von Steeg, ein unbekannter mittelrheinischer Künstler, in: FS Alois Thomas, Trier 1967, 363-372; - Ders., Die Wandmalereien in den Kirchen zu Steeg und Oberdiebach, in: Jb. zur Geschichte von Stadt und Landkreis Kaiserslauten 12/13, 1974-75, 305-327; - Ders./Hermann Heimpel, Winand von Steeg (1371-1453), ein mittelrheinischer Gelehrter und Künstler, in: Abhandlungen der Bayer. Akademie derWissenschaften. Phil.-hist. Klasse NF 81, München 1977; - Hermann Heimpel, Die Vener von Gmünd und Straßburg I-III, Göttingen 1982, 406-419 u.ö.; - Joseph Szövérffy, Die Annalen der lateinischen Hymnendichtung 2, Berlin 1965, 395; - Barbara Obrist, Das illustrierte »Adames colluctancium aquilarum« von Winand von Steeg als Zeitdokument, in: Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 40, 1983, 136-143; - Otto Meyer, Die Universität von Würzburg von 1402 und ihr Professor Winand von Steeg, in: Ders., Varia Franconiae Historica III, Würzburg 1986, 1115-1127; - LThK2 10, 1965, 1175
Bei Frenken fehlt:
Graf, Agnes: Winand von Steeg: Adamas colluctancium aquilarum. Ein Aufruf zum Kreuzzug gegen die Hussiten. Umění 40 (1992) 344-351
Die Literatur vor den grundlegenden Studien vor Schmidt ist nicht ganz bedeutungslos, zu nennen wären die Aufsätze von Joseph Weiß im Bericht der Görres-Gesellschaft 1904 (erschienen 1905):
http://archive.org/stream/vereinsschriftg11grgoog#page/n387/mode/2up
und im Historischen Jahrbuch 27 (1906) S. 470-471
[ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weiss_Winand_von_Steeg.pdf ]
Bünz im ²VL hat noch nicht:
Schouwink, Wilfried: Die Offiziendichtungen Winands von Steeg in Vat. Pal. lat. 411, 412, 858 und Trier, Stadtbibliothek 1139/65
In: Palatina-Studien / hrsg. von Walter Berschin. - Città del Vaticano, 1997 [erschienen 1998]. - (Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae ; 5)(Studi e testi / Biblioteca Apostolica Vaticana ; 365). - ISBN 88-210-0685-9. - S. 237-286
Auf Winand bezieht sich:
Dušan Buran: König Sigismund als Advocatus Ecclesiae : ein Bildkommentar . In: Bonum ut pulchrum : essays in art history in honour of Ernő Marosi on his seventieth birthday, ed. by Livia Varga .... – Budapest, 2010. – ISBN 978-963-7381-97-3, S. 251-258
Zu den im ²VL aufgezählten Werken ist zu ergänzen das kurze Gutachten (1430) des Dr. decretorum und Kaplan des Pfalzgrafen Ludwig, das Heimpel: Vener III, S. 1371 aus Eichstätt, UB, st 726, Bl. 183r edierte. Die Identifizierung mit Winand ist durchaus plausibel.
Heilsbronner Belege 1416/17 kannte Schmidt noch nicht:
http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Georg_Muck_-_Geschichte_von_Kloster_Heilsbronn_(Band_2).pdf/561 (canonicus pataviensis zu 1416, vgl. Schmidt 1977, S. 17f.)
http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Georg_Muck_-_Geschichte_von_Kloster_Heilsbronn_(Band_2).pdf/562
Siehe auch die Datenbanken
http://personendatenbank.germania-sacra.de/books/search/book:/term:steeg+winand
Repertorium Germanicum (suche Winandus, Stega)
http://194.242.233.132/denqRG/index.htm
RAG
http://www.rag-online.org/pnd/118633562
Im Dominikanerinnen-Kloster Liebenau bei Worms sah Ladislaus Sunthaim um 1500 ein Exemplar des verlorenen "Paries septenariorum", das ihn ausgesprochen beeindruckt haben muss:
http://books.google.de/books?id=J5fF1rCkbEIC&pg=PA941
(besprochen bei Schmidt/Heimpel 1977, S. 39f.)
Trithemius (Ann. Hirsaugienses) über Winand:
http://books.google.de/books?id=3whCAAAAcAAJ&pg=PA719
#forschung

KlausGraf - am Sonntag, 24. März 2013, 21:49 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Als ich neulich auf eine Straßburger Abschrift Schorbachs von einer untergegangenen Sutro-Handschrift aufmerksam machte
http://archiv.twoday.net/stories/233328051/
war mir überhaupt nicht klar, dass dieser 1830 in Aachen geborene US-Unternehmer und Politiker (er war der 24. Bürgermeister von San Francisco) eine der größten Privatbibliotheken der USA mit europäischen Bücherschätzen sein eigen nannte. Jeder Hinweis auf die Bibliothek fehlt noch in:
http://de.wikipedia.org/wiki/Adolph_Sutro
Seit 2012 haben die Reste der Bibliothek, die das Feuer von 1906 überstanden haben, eine noble Residenz in der J. Paul Leonard Library der State University in San Francisco gefunden. Sie sind Bestandteil der San Francisco State Library. Das "Bulletin" dieser Bibliothek widmet vier Beiträge der Sutro-Library:
http://www.cslfdn.org/pdf/Bulletin104.pdf
Wieder abgedruckt wurden die Recherchen von Russ Davidson (Bulletin von 2003), illustriert mit Bildern der noch vorhandenen kostbaren Bücher.
Das Feuer, das dem verheerenden Erdbeben 1906 folgte, vernichtete etwa die Hälfte des Bestands, aber leider die kostbarere Hälfte und führte zu einem riesigen Verlust unersetzlichen deutschen Kulturguts. Nach S. 29f. wurden etwa 90 Prozent der Inkunabeln, tausende Manuskripte und zehntausende Bücher des Altbestands vernichtet.
Von 1883 bis 1887 diente Sutro der Münchner Buchhändler Carl Friedrich Mayer als Agent und Bibliothekar. Im September 1883 kaufte Sutro einen großen Teil ("major part") der Bücher der Kartause Buxheim, einige tausend Stück (S. 20).
http://archive.cls.yale.edu/buxheim/libraries/librariess.html#8 (nur 2 Handschriften noch in San Fracisco!)
Einen Monat später erwarb er 8000 Bände aus der Dalberg-Bibliothek, die in Augsburg versteigert wurde. "The Dalberg collection was formed by two noblemen of fine culture and magnificent tastes-Baron Wolfgang Heribert von Dalberg, who has quite a reputation in Germany for having, while intendant of the Mannheim theatre, brought out Schiller's famous tragedy of "The Robbers "; and his son, Emmerich Joseph, created a duke by Napoleon, and a prominent diplomatic and administrative functionary in Napoleon's government of the Rhine countries. The Dalberg library was especially strong in history, geography, travels, and fine arts." So in einer Notiz zur Sutro-Bibliothek 1885
http://quod.lib.umich.edu/m/moajrnl/ahj1472.2-05.029/626?node=ahj1472.2-05.029%3A10&view=image
(siehe auch den Katalog von Fidelis Butsch: Catalog der werthvollen und reichhaltigen Bibliothek des Schlosses Herrnsheim bei Worms a. Rh.)
Zum Ankauf von Dubletten der Bayerischen Staatsbibliothek schreibt Davidson (S. 20, 22): "As remarkable as the Buxheim and Dalberg acquisitions were, they were nevertheless exceeded, in both quantity and quality, by Sutro’s third German bookbuying success — his purchase of duplicate imprints from the Royal State Library in Munich. The Kingdom of Bavaria, to which this library then belonged, was in dire need of money, and Sutro had secured permission from a high-level government official to purchase such duplicates as he wanted. Moreover, his opportunity to do so coincided with his blossoming relationship with Charles Mayer. Anxious to continue his travels and reach the Near East, Sutro engaged Mayer to work through the duplicates. Mayer took to the task energetically, and when he had finished, had increased the size of Sutro’s library by some 13,000 volumes. When finally packed for shipment to San Francisco, it took 86 cases to hold all of the Munich State Library books acquired by Sutro. Still more impressive, however, was that 33 of these cases held incunabula. Thirty-three cases of “cradle books”! It is a staggering statistic. It is not clear precisely how many incunables were once found in the Sutro Library, and exact number is now of historical interest only. Sutro himself estimated that he owned over 4,000. There were certainly at least 3,000, or approximately oneseventh of all such books known to be in
existence at the time. The range and excellence of the Sutro incunabula were attested to by a Cornell University scholar, Professor George Lincoln Burr, who spent several days inspecting them during a visit to San Francisco in 1892. After returning to
Cornell, Burr wrote to Sutro: “It is, I think, beyond all comparison the best collection in America, both as to numbers and as to
quality of the books of the 15th century; and I gravely doubt if it has any rival this side of the Atlantic for its literature of the 16th
century.” In addition to his purchases from these three major libraries, Sutro also acquired books of a similar nature, perhaps
several thousand volumes in all, from dealers and bookshops in Munich, Heidelberg, Ellwangen, and other cities. His acquisitions in Germany thus consolidated the second pillar of his library—the incunabula and early printed books, focused in particular on the sixteenth-century struggles for religious and civil liberties in the German states, the study and development of cartography and the natural sciences, and European travel and discovery in the Age of
Reconnaissance.
33 von 86 Kisten (38 Prozent) würden bei 13.000 Münchner Bänden ungefähr 4940 Bände Inkunabeln bedeuten. Zu beachten ist aber der Widerspruch mit der Angabe, Sutros Inkunabelbestand habe 3000/4000 Stück betragen.
Es ist einigermaßen bezeichnend, wie die BSB mit den schändlichen Dublettenverkäufen des 19. Jahrhunderts im Handbuch der historischen Buchbestände umgeht - keine Silbe zu Sutro!
"Die verbliebenen Dubletten, auf den Dachböden des Akademiegebäudes und der Michaelskirche gelagert und um 1830 auf etwa 200.000 Bde geschätzt, wurden erst damals geordnet und katalogisiert. Die Verkäufe wurden fortgesetzt; aus dem Erlös finanzierte man Ankäufe von Neuerscheinungen und fehlenden Antiquaria. Im Jahre 1859 waren noch mindestens 100.000 Titel vorhanden, für die damals angeblich kaum Nachfrage bestand, auch wegen des teilweise schlechten Erhaltungszustands. Neben diesen alten Dubletten gab es aber viele Doppelstöcke, die man zunächst als erhaltenswürdige Fachdubletten in den Bestand der Bibliothek eingereiht hatte. Hiervon ließ der Bibliotheksdirektor Karl Halm (1809-1882) 1858 zahlreiche seltene Drucke versteigern, darunter ein Exemplar der 42zeiligen Gutenberg-Bibel (sein Vorgänger Lichtenthaler hatte bereits 1832 das zweite der drei vorhandenen Exemplare verkauft) sowie viele weitere Inkunabeln, Blockbücher, Pergamentdrucke und Werke aus dem Gründungsbestand der Hofbibliothek. Die Einnahmen verwendete Halm zur teilweisen Finanzierung der Quatremère-Bibliothek (s. u. 1.43-1.44), der Drucklegung des Handschriftenkatalogs sowie für Neuanschaffungen. Proteste in der Öffentlichkeit bewirkten, daß die Verkäufe von besonders wertvollen Dubletten fortan eingestellt wurden. Der Inkunabelbestand, 1811 auf 24.000 Bde geschätzt, verringerte sich durch die Dublettenverkäufe bis Ende des 19. Jhs um 5000 bis 6000 Exemplare."
http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Bayerische_Staatsbibliothek
Zu den Protesten des Würzburger Bibliothekars Ruland gegen die Inkunabelverkäufe Halms siehe etwa
http://books.google.de/books?id=j-N6QoSiWbMC&pg=PA111
Zu zwei vermissten Richenbach-Einbänden aus den Beständen der BSB schrieb mir Bettina Wagner: "im Butsch-Auktionskatalog von 1858, S. 2, erscheinen zwei Exemplare der Eggestein-Bibel:
http://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=162931955
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10536490-1
Eines davon könnte durchaus das Thierhauptener Exemplar gewesen sein (vielleicht Nr. 21 mit dem Lederbd., das bei der Auktion von Quaritch gekauft wurde; Nr. 20 ging an Dr. Petzholdt in Dresden). Die Hieronymus-Briefe finde ich bei Butsch nicht. Allerdings geht aus den Butsch-Beschreibungen nicht hervor, ob es sich um Richenbach-Einbände handelt.
Grundsätzlich wäre es auch möglich, dass Inkunabeldubletten (wenn auch in erheblich geringerer Zahl) im 19. Jh. individuell an Privatleute oder in einer der früheren Auktionen verkauft wurden, vgl. dazu
Auktionskatalog 1815
http://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=165988813
Auktionskatalog 1820
http://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=165929622
Zu Privatverkäufen gibt es zwar einige Archivalien in der BSB, sie enthalten aber leider nur sehr rudimentäre Titelangaben; man würde wirklich nach der Nadel im Heuhaufen suchen müssen. Wenn einzelne Titel überhaupt angeführt werden, sind sie meist noch knapper als in den Auktionskatalogen, so dass es kaum möglich sein dürfte, die Ausgaben oder gar Exemplare zu identifizieren - und auch wenn der Name des Käufers zu ermitteln sein sollte, weiß man damit ja noch nicht, wohin das Buch heute gelangt ist."
Archivalien zum Sutro-Verkauf erwähnt Wagner nicht (ich hatte aber auch nicht danach gefragt).
Im Bulletin S. 17 ist eine illuminierte Inkunabelseite aus einer 1883 angekauften Münchner Inkunabel der Summa Theologiae 1478 abgebildet, was auf
http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M46472.htm
führt. San Francisco SL ist im GW offenbar die Sutro-Sammlung mit insgesamt 56 erfassten Ausgaben. Needhams IPI nennt zu Sutro 48 Inkunabeln in San Francisco und vier in Berkeley. Das sind erheblich weniger als 10 % des auf 3000 oder 4000 Bände geschätzten Inkunabelbestands Sutros. (Zum Vergleich: Die Huntingon-Library zählt gut 5000 im GW erfasste Ausgaben.)
Auf jeden Fall kann man den Brand der Sutro-Library als einen der schlimmsten Kulturgutverluste im Bereich der Erforschung historischer oberdeutscher Klosterbibliotheken nach der Säkularisation bezeichnen. Das betrifft nicht nur die Buxheimer Bestände, sondern auch die Münchner sogenannten "Dubletten", die ja überwiegend aus Klosterbibliotheken gestammt haben dürften.
***
Aus Seymour de Ricci: Census of medieval and renaissance manuscripts in the United States and Canada, Bd. 1, New York 1935 teile ich die OCR (ACLM Humanities E-Books) der Seiten 26-28 mit
THE ADOLPH SUTRO LIBRARY,
CIVIC CENTER,
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
The great collection of books and manuscripts formed from
1885 to 1898 by Adolph Sutro suffered irreparable losses during
the Fire of 1906. What remains of it (still over 80,000 volumes)
has been recently transferred to the building of the California
State Library at Civic Center, San Francisco, where it is now
being systematically overhauled. The following notes taken in
1918 and in 1931, and for the compilation of which I received
every assistance from the Library authorities, probably indicate
all the early manuscripts of any real interest.
1. Orationes et antiphonae. Vel. and pap. (xvuthi c.), 103 if.
(35 x 23 cm.). Written in Germany. Orig. wooden boards
and stamped pigskin.
From the Carthusians of Buxheim; sale of Graf von Waldbott-Bassenheim
(Muinich, 20 Sept. I883, n. 2640).
2. Aldobrandino da Siena, La fisicha della santa del chorpo
del uomo, translated into Italian prose by Zucchero Bencivenni. Pap. (1392), 68 if. (30 x 22 cm.). Orig. Italian
wooden boards.
Coll. Fabrizio Orsini Rilli, at Poppi. - N. 263 in a Sotheby sale (ca. 1890).
3. Graduale. Vel. (xvth C.), 143 if. (37 27 cm.). Written in
Germany. XVIth c. wooden boards and stamped vellum.
From the Carthusians of Buxheim; sale of Graf von Waldbott-Bassenheim
(Munich, 20 Sept. 1883, n. 2533).
4. Medical recipes, in Italian. Pap. (1523), 126 if. (20 x 8 cm.).
Orig. cardboard wrapper.
N. 692 in an old library. Was last in Germany.
5. Decreta Concilii provincialis Toletani, anni 1582. Pap.
(ca. i6oo), 52 if. (22 x 15 cm.). Orig. vellum wrapper.
6. Horae. Vel. (ca. 1450), 3 if. only (i7 X 12 cm.), with miniatures. Half-calf.
Obtained from Rosenthal.
7. Elizabethan deeds, including: A deed relating to John
Ade of Lewes. Vel. (io May a. 44 Eliz. [1602]). - An indenture signed by Thomas Lucy of Charlcott. Vel. - An indenture signed by E. Bardolff. Vel. (30 Apr. 1584). - A docum.
on paper (1754), signed by George Hathaway, of Ward
(Hertfordshire). - A Latin deed relating to George Weldon
of Cookeham (?), Berkshire. Vel. (4 Sept. 199). - Maximilian II, Letter signed. Pap. (12 July 1542). - Copy by
J. Bindley of a letter written to him by C. M. Cracherode,
26 Aug. 1775, on a book in the Bodleian. - Bill of Thomas
Huntington (20 Dec. i656) for 2 mss., one being " The
Defense of the lawfull regiment of women ". Pap. - Deed
relating to Richard Nelson of Fayrehurst, Lancashire. Vel.
(15 Oct. a. 44 Eliz. [1602]). - Indenture in Latin relating
to Brian Hollywell, of Stainland, Yorkshire. Vel. (8 Feb. a.
45 Eliz. [1603]). - Half-calf, ca. i880.
J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, I July I889, n. I227) to Sutro.
8. English deeds. Pap. (early XVIth c.) I. Signatures of
John Berners and others. - 2. Richard Palmer, A bill to
Thomas Stokes (25 July, a. 13 H. VII [1498]). -3. Thomas
Stokes, doc. s.- 4. Lewys Caerlyon, Royal physician, 1. s.,
to Stokes (6 May, a. io. H. VII [1495]). - 5. Sir Edward
Wyngfeld, Recognizance to Stokes (12 July, a. 13 H. VII.
[1498]). - 6. Indenture, referring to Henry Earl of Northumberland, Greenwich (Dec. a. 25 H. VIII [1533]), cut into
eight strips. - 7. Thomas Stoke, Bill dated 4 Dec. a. io H.
VII [1494.] - English half-calf, ca. i88o.
J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, i July 1889, n. 1269) to Sutro.
9. Report of the Commissioners of sewers for Southwark.
Vel. (1642), a roll cut into 4 if. Green half-mor., ca. 1880.
J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, i July 1889, n. 1262) to Sutro.
10. Rent-book of Shottery Meadow, Stratford-on-Avon. Vel.
(1620-1621), 16 if. (19 X 15 cm.). English dark-green mor.,
ca. i88o.
J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, i July I889, n. I270) to Sutro.
11. Sir Lewis Lewkenor, Accounts from I Jan. to 16 Feb.
1613. Pap., 5 if. (31 X 20 cm.). Followed by a letter-carrier's
bill, Oct. I618, 2 if. Half-mor.
J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, i July 1889, n. 1245) to Sutro.
12. Accounts of a steward in a Norfolk family. Pap. (1589 -15 91), 24 if. (31 X 20 cm.). Half-calf, ca. 1885.
J. Payne Collier sale (London, 1884, not catalogued); J. O. Halliwell-Phillipps
sale (London, I July 1889, n. 1251) to Sutro.
13. Visitation of York, 1559. Pap. (xlxth c.).
W. J. Thomrns sale (London, 9 Feb. I887, n. 1486); J. O. Halliwell-Phillipps
sale (London, i July 1889, part of n. 1263) to Sutro.
14. Norfolk mss. Copies fromthe Record Office. Pap. (xlxth c.).
J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, i July 1889, part of n. 1263) to Sutro.
15. The Interpreter in three characters of the Puritane, Protestant, Papist (i 622), and other mss. in prose and verse. Pap.
(1618-1628),2o6 f.and18 if.,dated 1628(2I X 17 cm.). Green
half-mor., ca. i88o.
Owned (?), xvIith c., by My Lady Carlisle.- J. O. Halliwell-Phillipps sale
(London, I July I889, n. 1249) to Sutro.
16. Fanshawe papers. Pap. (1667-1673), 55 documents.
From the J. O. Halliwell-Phillipps coll. (not identified in the 1889 sale).
- In addition to the above-mentioned documents Adolph Sutro had secured
in the Halliwell-Phillipps sale lots 1228, 1234-1237, 1240-1241, 1243, 1244,
1250, 1252, 1254, 1255, 1259-1261, 1264-1266, 1281 and 1283-1288.

http://archiv.twoday.net/stories/233328051/
war mir überhaupt nicht klar, dass dieser 1830 in Aachen geborene US-Unternehmer und Politiker (er war der 24. Bürgermeister von San Francisco) eine der größten Privatbibliotheken der USA mit europäischen Bücherschätzen sein eigen nannte. Jeder Hinweis auf die Bibliothek fehlt noch in:
http://de.wikipedia.org/wiki/Adolph_Sutro
Seit 2012 haben die Reste der Bibliothek, die das Feuer von 1906 überstanden haben, eine noble Residenz in der J. Paul Leonard Library der State University in San Francisco gefunden. Sie sind Bestandteil der San Francisco State Library. Das "Bulletin" dieser Bibliothek widmet vier Beiträge der Sutro-Library:
http://www.cslfdn.org/pdf/Bulletin104.pdf
Wieder abgedruckt wurden die Recherchen von Russ Davidson (Bulletin von 2003), illustriert mit Bildern der noch vorhandenen kostbaren Bücher.
Das Feuer, das dem verheerenden Erdbeben 1906 folgte, vernichtete etwa die Hälfte des Bestands, aber leider die kostbarere Hälfte und führte zu einem riesigen Verlust unersetzlichen deutschen Kulturguts. Nach S. 29f. wurden etwa 90 Prozent der Inkunabeln, tausende Manuskripte und zehntausende Bücher des Altbestands vernichtet.
Von 1883 bis 1887 diente Sutro der Münchner Buchhändler Carl Friedrich Mayer als Agent und Bibliothekar. Im September 1883 kaufte Sutro einen großen Teil ("major part") der Bücher der Kartause Buxheim, einige tausend Stück (S. 20).
http://archive.cls.yale.edu/buxheim/libraries/librariess.html#8 (nur 2 Handschriften noch in San Fracisco!)
Einen Monat später erwarb er 8000 Bände aus der Dalberg-Bibliothek, die in Augsburg versteigert wurde. "The Dalberg collection was formed by two noblemen of fine culture and magnificent tastes-Baron Wolfgang Heribert von Dalberg, who has quite a reputation in Germany for having, while intendant of the Mannheim theatre, brought out Schiller's famous tragedy of "The Robbers "; and his son, Emmerich Joseph, created a duke by Napoleon, and a prominent diplomatic and administrative functionary in Napoleon's government of the Rhine countries. The Dalberg library was especially strong in history, geography, travels, and fine arts." So in einer Notiz zur Sutro-Bibliothek 1885
http://quod.lib.umich.edu/m/moajrnl/ahj1472.2-05.029/626?node=ahj1472.2-05.029%3A10&view=image
(siehe auch den Katalog von Fidelis Butsch: Catalog der werthvollen und reichhaltigen Bibliothek des Schlosses Herrnsheim bei Worms a. Rh.)
Zum Ankauf von Dubletten der Bayerischen Staatsbibliothek schreibt Davidson (S. 20, 22): "As remarkable as the Buxheim and Dalberg acquisitions were, they were nevertheless exceeded, in both quantity and quality, by Sutro’s third German bookbuying success — his purchase of duplicate imprints from the Royal State Library in Munich. The Kingdom of Bavaria, to which this library then belonged, was in dire need of money, and Sutro had secured permission from a high-level government official to purchase such duplicates as he wanted. Moreover, his opportunity to do so coincided with his blossoming relationship with Charles Mayer. Anxious to continue his travels and reach the Near East, Sutro engaged Mayer to work through the duplicates. Mayer took to the task energetically, and when he had finished, had increased the size of Sutro’s library by some 13,000 volumes. When finally packed for shipment to San Francisco, it took 86 cases to hold all of the Munich State Library books acquired by Sutro. Still more impressive, however, was that 33 of these cases held incunabula. Thirty-three cases of “cradle books”! It is a staggering statistic. It is not clear precisely how many incunables were once found in the Sutro Library, and exact number is now of historical interest only. Sutro himself estimated that he owned over 4,000. There were certainly at least 3,000, or approximately oneseventh of all such books known to be in
existence at the time. The range and excellence of the Sutro incunabula were attested to by a Cornell University scholar, Professor George Lincoln Burr, who spent several days inspecting them during a visit to San Francisco in 1892. After returning to
Cornell, Burr wrote to Sutro: “It is, I think, beyond all comparison the best collection in America, both as to numbers and as to
quality of the books of the 15th century; and I gravely doubt if it has any rival this side of the Atlantic for its literature of the 16th
century.” In addition to his purchases from these three major libraries, Sutro also acquired books of a similar nature, perhaps
several thousand volumes in all, from dealers and bookshops in Munich, Heidelberg, Ellwangen, and other cities. His acquisitions in Germany thus consolidated the second pillar of his library—the incunabula and early printed books, focused in particular on the sixteenth-century struggles for religious and civil liberties in the German states, the study and development of cartography and the natural sciences, and European travel and discovery in the Age of
Reconnaissance.
33 von 86 Kisten (38 Prozent) würden bei 13.000 Münchner Bänden ungefähr 4940 Bände Inkunabeln bedeuten. Zu beachten ist aber der Widerspruch mit der Angabe, Sutros Inkunabelbestand habe 3000/4000 Stück betragen.
Es ist einigermaßen bezeichnend, wie die BSB mit den schändlichen Dublettenverkäufen des 19. Jahrhunderts im Handbuch der historischen Buchbestände umgeht - keine Silbe zu Sutro!
"Die verbliebenen Dubletten, auf den Dachböden des Akademiegebäudes und der Michaelskirche gelagert und um 1830 auf etwa 200.000 Bde geschätzt, wurden erst damals geordnet und katalogisiert. Die Verkäufe wurden fortgesetzt; aus dem Erlös finanzierte man Ankäufe von Neuerscheinungen und fehlenden Antiquaria. Im Jahre 1859 waren noch mindestens 100.000 Titel vorhanden, für die damals angeblich kaum Nachfrage bestand, auch wegen des teilweise schlechten Erhaltungszustands. Neben diesen alten Dubletten gab es aber viele Doppelstöcke, die man zunächst als erhaltenswürdige Fachdubletten in den Bestand der Bibliothek eingereiht hatte. Hiervon ließ der Bibliotheksdirektor Karl Halm (1809-1882) 1858 zahlreiche seltene Drucke versteigern, darunter ein Exemplar der 42zeiligen Gutenberg-Bibel (sein Vorgänger Lichtenthaler hatte bereits 1832 das zweite der drei vorhandenen Exemplare verkauft) sowie viele weitere Inkunabeln, Blockbücher, Pergamentdrucke und Werke aus dem Gründungsbestand der Hofbibliothek. Die Einnahmen verwendete Halm zur teilweisen Finanzierung der Quatremère-Bibliothek (s. u. 1.43-1.44), der Drucklegung des Handschriftenkatalogs sowie für Neuanschaffungen. Proteste in der Öffentlichkeit bewirkten, daß die Verkäufe von besonders wertvollen Dubletten fortan eingestellt wurden. Der Inkunabelbestand, 1811 auf 24.000 Bde geschätzt, verringerte sich durch die Dublettenverkäufe bis Ende des 19. Jhs um 5000 bis 6000 Exemplare."
http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Bayerische_Staatsbibliothek
Zu den Protesten des Würzburger Bibliothekars Ruland gegen die Inkunabelverkäufe Halms siehe etwa
http://books.google.de/books?id=j-N6QoSiWbMC&pg=PA111
Zu zwei vermissten Richenbach-Einbänden aus den Beständen der BSB schrieb mir Bettina Wagner: "im Butsch-Auktionskatalog von 1858, S. 2, erscheinen zwei Exemplare der Eggestein-Bibel:
http://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=162931955
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10536490-1
Eines davon könnte durchaus das Thierhauptener Exemplar gewesen sein (vielleicht Nr. 21 mit dem Lederbd., das bei der Auktion von Quaritch gekauft wurde; Nr. 20 ging an Dr. Petzholdt in Dresden). Die Hieronymus-Briefe finde ich bei Butsch nicht. Allerdings geht aus den Butsch-Beschreibungen nicht hervor, ob es sich um Richenbach-Einbände handelt.
Grundsätzlich wäre es auch möglich, dass Inkunabeldubletten (wenn auch in erheblich geringerer Zahl) im 19. Jh. individuell an Privatleute oder in einer der früheren Auktionen verkauft wurden, vgl. dazu
Auktionskatalog 1815
http://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=165988813
Auktionskatalog 1820
http://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=165929622
Zu Privatverkäufen gibt es zwar einige Archivalien in der BSB, sie enthalten aber leider nur sehr rudimentäre Titelangaben; man würde wirklich nach der Nadel im Heuhaufen suchen müssen. Wenn einzelne Titel überhaupt angeführt werden, sind sie meist noch knapper als in den Auktionskatalogen, so dass es kaum möglich sein dürfte, die Ausgaben oder gar Exemplare zu identifizieren - und auch wenn der Name des Käufers zu ermitteln sein sollte, weiß man damit ja noch nicht, wohin das Buch heute gelangt ist."
Archivalien zum Sutro-Verkauf erwähnt Wagner nicht (ich hatte aber auch nicht danach gefragt).
Im Bulletin S. 17 ist eine illuminierte Inkunabelseite aus einer 1883 angekauften Münchner Inkunabel der Summa Theologiae 1478 abgebildet, was auf
http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M46472.htm
führt. San Francisco SL ist im GW offenbar die Sutro-Sammlung mit insgesamt 56 erfassten Ausgaben. Needhams IPI nennt zu Sutro 48 Inkunabeln in San Francisco und vier in Berkeley. Das sind erheblich weniger als 10 % des auf 3000 oder 4000 Bände geschätzten Inkunabelbestands Sutros. (Zum Vergleich: Die Huntingon-Library zählt gut 5000 im GW erfasste Ausgaben.)
Auf jeden Fall kann man den Brand der Sutro-Library als einen der schlimmsten Kulturgutverluste im Bereich der Erforschung historischer oberdeutscher Klosterbibliotheken nach der Säkularisation bezeichnen. Das betrifft nicht nur die Buxheimer Bestände, sondern auch die Münchner sogenannten "Dubletten", die ja überwiegend aus Klosterbibliotheken gestammt haben dürften.
***
Aus Seymour de Ricci: Census of medieval and renaissance manuscripts in the United States and Canada, Bd. 1, New York 1935 teile ich die OCR (ACLM Humanities E-Books) der Seiten 26-28 mit
THE ADOLPH SUTRO LIBRARY,
CIVIC CENTER,
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
The great collection of books and manuscripts formed from
1885 to 1898 by Adolph Sutro suffered irreparable losses during
the Fire of 1906. What remains of it (still over 80,000 volumes)
has been recently transferred to the building of the California
State Library at Civic Center, San Francisco, where it is now
being systematically overhauled. The following notes taken in
1918 and in 1931, and for the compilation of which I received
every assistance from the Library authorities, probably indicate
all the early manuscripts of any real interest.
1. Orationes et antiphonae. Vel. and pap. (xvuthi c.), 103 if.
(35 x 23 cm.). Written in Germany. Orig. wooden boards
and stamped pigskin.
From the Carthusians of Buxheim; sale of Graf von Waldbott-Bassenheim
(Muinich, 20 Sept. I883, n. 2640).
2. Aldobrandino da Siena, La fisicha della santa del chorpo
del uomo, translated into Italian prose by Zucchero Bencivenni. Pap. (1392), 68 if. (30 x 22 cm.). Orig. Italian
wooden boards.
Coll. Fabrizio Orsini Rilli, at Poppi. - N. 263 in a Sotheby sale (ca. 1890).
3. Graduale. Vel. (xvth C.), 143 if. (37 27 cm.). Written in
Germany. XVIth c. wooden boards and stamped vellum.
From the Carthusians of Buxheim; sale of Graf von Waldbott-Bassenheim
(Munich, 20 Sept. 1883, n. 2533).
4. Medical recipes, in Italian. Pap. (1523), 126 if. (20 x 8 cm.).
Orig. cardboard wrapper.
N. 692 in an old library. Was last in Germany.
5. Decreta Concilii provincialis Toletani, anni 1582. Pap.
(ca. i6oo), 52 if. (22 x 15 cm.). Orig. vellum wrapper.
6. Horae. Vel. (ca. 1450), 3 if. only (i7 X 12 cm.), with miniatures. Half-calf.
Obtained from Rosenthal.
7. Elizabethan deeds, including: A deed relating to John
Ade of Lewes. Vel. (io May a. 44 Eliz. [1602]). - An indenture signed by Thomas Lucy of Charlcott. Vel. - An indenture signed by E. Bardolff. Vel. (30 Apr. 1584). - A docum.
on paper (1754), signed by George Hathaway, of Ward
(Hertfordshire). - A Latin deed relating to George Weldon
of Cookeham (?), Berkshire. Vel. (4 Sept. 199). - Maximilian II, Letter signed. Pap. (12 July 1542). - Copy by
J. Bindley of a letter written to him by C. M. Cracherode,
26 Aug. 1775, on a book in the Bodleian. - Bill of Thomas
Huntington (20 Dec. i656) for 2 mss., one being " The
Defense of the lawfull regiment of women ". Pap. - Deed
relating to Richard Nelson of Fayrehurst, Lancashire. Vel.
(15 Oct. a. 44 Eliz. [1602]). - Indenture in Latin relating
to Brian Hollywell, of Stainland, Yorkshire. Vel. (8 Feb. a.
45 Eliz. [1603]). - Half-calf, ca. i880.
J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, I July I889, n. I227) to Sutro.
8. English deeds. Pap. (early XVIth c.) I. Signatures of
John Berners and others. - 2. Richard Palmer, A bill to
Thomas Stokes (25 July, a. 13 H. VII [1498]). -3. Thomas
Stokes, doc. s.- 4. Lewys Caerlyon, Royal physician, 1. s.,
to Stokes (6 May, a. io. H. VII [1495]). - 5. Sir Edward
Wyngfeld, Recognizance to Stokes (12 July, a. 13 H. VII.
[1498]). - 6. Indenture, referring to Henry Earl of Northumberland, Greenwich (Dec. a. 25 H. VIII [1533]), cut into
eight strips. - 7. Thomas Stoke, Bill dated 4 Dec. a. io H.
VII [1494.] - English half-calf, ca. i88o.
J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, i July 1889, n. 1269) to Sutro.
9. Report of the Commissioners of sewers for Southwark.
Vel. (1642), a roll cut into 4 if. Green half-mor., ca. 1880.
J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, i July 1889, n. 1262) to Sutro.
10. Rent-book of Shottery Meadow, Stratford-on-Avon. Vel.
(1620-1621), 16 if. (19 X 15 cm.). English dark-green mor.,
ca. i88o.
J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, i July I889, n. I270) to Sutro.
11. Sir Lewis Lewkenor, Accounts from I Jan. to 16 Feb.
1613. Pap., 5 if. (31 X 20 cm.). Followed by a letter-carrier's
bill, Oct. I618, 2 if. Half-mor.
J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, i July 1889, n. 1245) to Sutro.
12. Accounts of a steward in a Norfolk family. Pap. (1589 -15 91), 24 if. (31 X 20 cm.). Half-calf, ca. 1885.
J. Payne Collier sale (London, 1884, not catalogued); J. O. Halliwell-Phillipps
sale (London, I July 1889, n. 1251) to Sutro.
13. Visitation of York, 1559. Pap. (xlxth c.).
W. J. Thomrns sale (London, 9 Feb. I887, n. 1486); J. O. Halliwell-Phillipps
sale (London, i July 1889, part of n. 1263) to Sutro.
14. Norfolk mss. Copies fromthe Record Office. Pap. (xlxth c.).
J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, i July 1889, part of n. 1263) to Sutro.
15. The Interpreter in three characters of the Puritane, Protestant, Papist (i 622), and other mss. in prose and verse. Pap.
(1618-1628),2o6 f.and18 if.,dated 1628(2I X 17 cm.). Green
half-mor., ca. i88o.
Owned (?), xvIith c., by My Lady Carlisle.- J. O. Halliwell-Phillipps sale
(London, I July I889, n. 1249) to Sutro.
16. Fanshawe papers. Pap. (1667-1673), 55 documents.
From the J. O. Halliwell-Phillipps coll. (not identified in the 1889 sale).
- In addition to the above-mentioned documents Adolph Sutro had secured
in the Halliwell-Phillipps sale lots 1228, 1234-1237, 1240-1241, 1243, 1244,
1250, 1252, 1254, 1255, 1259-1261, 1264-1266, 1281 and 1283-1288.

KlausGraf - am Sonntag, 24. März 2013, 19:10 - Rubrik: Kodikologie
"Kann der Gebrauch fremder Werke auch dann untersagt werden, wenn das Copyright an diesen bereits abgelaufen ist, andere Werke des Autoren aber noch geschützt sind? Diese Frage soll nun ein Gericht im US-Bundesstaat Illinois klären. Anlass ist ein Copyright-Streit um die von Arthur Conan Doyle geschaffene Figur Sherlock Holmes."
http://heise.de/-1824246

http://heise.de/-1824246

KlausGraf - am Sonntag, 24. März 2013, 18:45 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die FAZ ignoriert alle Aufforderungen von dritter Seite, zu meiner Abmahnung Stellung zu nehmen. Auf Google+ werden kritische Wortmeldungen gelöscht, wie den Kommentaren zu
https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/LizwwQf27Z8
zu entnehmen ist:
Dirk Schmidt sagt dort: "Von der +FAZ.NET - Frankfurter Allgemeine gibt es keine Stellungnahmen. Kritiken werden zensiert, indem sie kommentarlos gelöscht werden. Kritische Google+-User werden von +FAZ.NET - Frankfurter Allgemeine gesperrt. "
Christa M.: "Ich sag nur dazu. Ich habe wegen "nur" Loeschen meiner harmlosen Kommentare. (Ich schrieb Dirk Schmidt als Antwort +10 fuer deinen Kommentar) u. Loeschen der Kommentare von +Dirk Schmidt u. noch weiteren die FAZ hier auf G+ blockiert. Die sind ja das Letzte."
Mein offener Brief in Archivalia an die Herausgeber der FAZ
http://archiv.twoday.net/stories/326207397/
wurde wiederholt ganz oder in Teilen in anderen Blogs wiedergegeben. Der Fall ist derzeit auch auf der Rivva-Startseite mit
8 BLOGS · 51 TWEETS · 3 LIKES · 10 SHARES · 76 PLUSONES
http://rivva.de/190511834
https://causaschavan.wordpress.com/2013/03/22/fortgesetzte-beziehungskiste-wie-sich-klaus-graf-zur-unterlassenen-unterlassungserklarung-erklart/
Erbloggtes mit vollständiger Wiedergabe, falls Archivalia offline ist
http://erbloggtes.wordpress.com/2013/03/22/klaus-graf-offener-brief-an-die-faz/
Netbib (Edlef Stabenau) mit vollständiger Wiedergabe
http://log.netbib.de/archives/2013/03/22/skandaloser-fehlgriff/
Redaktionsblog hypotheses.org
http://redaktionsblog.hypotheses.org/1120
http://www.schiebener.net/wordpress/?p=22977
mit vollständiger Wiedergabe
Stilstand
http://www.stilstand.de/die-kunst-den-ruf-zu-ladieren/
http://tamagothi.wordpress.com/2013/03/23/4335/
http://blah.tamagothi.de/2013/03/23/wenn-ich-bis-vor-einigen-jahren-zufriedener-abo/
The hobo and the gypsy
https://hogymag.wordpress.com/2013/03/22/causa-schavan-ein-offener-brief-von-klaus-graf-an-die-faz/
mit vollständiger Wiedergabe
Jürgen Fenn schreibt
"In einer anderen Liga
Posted on 24. März 2013 by jfenn
Ich glaube nicht, daß die FAZ sich mit der Abmahnung von Klaus Graf sozusagen fahrlässig (Vollzitat bei Erbloggtes) „Sympathien bei Bloggern und in den Social Media aktiven Menschen verscherzt“ hat. Sie macht genau das, was sie sonst auch das ganze Jahr über tut: Sie setzt ihre rechte Agenda, zumal gut 200 Tage vor der Bundestagswahl. Und sie kümmert sich um ihr Geschäft, indem sie ihrer Klientel suggerieren möchte, daß Blogs etwas Schlechtes seien. Daß Blogger vor gar nichts zurückschreckten. Daß sie unseriös seien und was weiß ich, was sonst noch alles.
Die Abmahnung gegen Klaus Graf zielt auf alle kritischen Blogger. Sie ist Teil einer Kampagne, die schon seit langem läuft. Blogs verlören Leser. Blogs seien in eine Krise geraten, hieß es da zur letzten Jahreswende. Blogs seien wieder weniger interessant für die Leser geworden als die Zeitungen. Woher wissen die das eigentlich, die Zeitungen? Über aktuelle Ereignisse informiere ich mich seit langem zu gut 90 Prozent aus Blogs. Und im übrigen lese ich ausländische Zeitungen wie den Guardian oder die Nachrichten des australischen Rundfunks, die bei dem, was sie schreiben, den nötigen Abstand zu den hiesigen Kampagnen haben. Kampagnen wie diese, zum Beispiel.
Es ist auch kein Zufall, daß hier ein Blogger angegangen wird, der sich vehement für wissenschaftliche Redlichkeit und gegen das Leistungsschutzrecht für Presseverleger verwendet hat, das gerade von rot-grün im Bundesrat durchgewunken worden ist. Der große Auftritt der Opposition blieb aus. War ja klar: Man möchte es sich ja schließlich nicht mit der Journaillie verderben, gut 200 Tage vor der Bundestagswahl.
Diese Kampagne ist aber auch eine der letzten ihrer Art. Hier erleben wir noch einmal den großen Aufstand der großen Rechtsabteilung eines ganz großen Pressekonzerns, der es nötig hat, gegen einen Wissenschaftsblogger aufzutreten, der in einer ganz anderen Liga spielt, in einer ernstzunehmenden nämlich. Und darauf darf die Blogosphäre doch auch stolz sein. Blogger, die Roß und Reiter nennen, verteidigen die Meinungs- und Pressefreiheit gegen die politisch vermachtete Konzernpresse. Soweit ist es gekommen.
Das sind letzte Gefechte und peinliche Stellvertreterkriege. Klaus hat unsere Geduld anderweitig durchaus in Anspruch genommen, aber hier bin ich mit ihm solidarisch, denn was er damals geschrieben hatte, war harmlos und durchweg der kritischen Aufklärung verpflichtet, verglichen mit dem, was die FAZ tagtäglich unter dem Deckmantel der bürgerlichen Ideologie so in die Welt setzt.
Und in gut 200 Tagen ist Bundestagswahl."
http://schneeschmelze.wordpress.com/2013/03/24/in-einer-anderen-liga/
Fenns Text unter http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/
Frühere Resonanz zur Sache:
http://archiv.twoday.net/stories/326204812/
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/342793744/

https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/LizwwQf27Z8
zu entnehmen ist:
Dirk Schmidt sagt dort: "Von der +FAZ.NET - Frankfurter Allgemeine gibt es keine Stellungnahmen. Kritiken werden zensiert, indem sie kommentarlos gelöscht werden. Kritische Google+-User werden von +FAZ.NET - Frankfurter Allgemeine gesperrt. "
Christa M.: "Ich sag nur dazu. Ich habe wegen "nur" Loeschen meiner harmlosen Kommentare. (Ich schrieb Dirk Schmidt als Antwort +10 fuer deinen Kommentar) u. Loeschen der Kommentare von +Dirk Schmidt u. noch weiteren die FAZ hier auf G+ blockiert. Die sind ja das Letzte."
Mein offener Brief in Archivalia an die Herausgeber der FAZ
http://archiv.twoday.net/stories/326207397/
wurde wiederholt ganz oder in Teilen in anderen Blogs wiedergegeben. Der Fall ist derzeit auch auf der Rivva-Startseite mit
8 BLOGS · 51 TWEETS · 3 LIKES · 10 SHARES · 76 PLUSONES
http://rivva.de/190511834
https://causaschavan.wordpress.com/2013/03/22/fortgesetzte-beziehungskiste-wie-sich-klaus-graf-zur-unterlassenen-unterlassungserklarung-erklart/
Erbloggtes mit vollständiger Wiedergabe, falls Archivalia offline ist
http://erbloggtes.wordpress.com/2013/03/22/klaus-graf-offener-brief-an-die-faz/
Netbib (Edlef Stabenau) mit vollständiger Wiedergabe
http://log.netbib.de/archives/2013/03/22/skandaloser-fehlgriff/
Redaktionsblog hypotheses.org
http://redaktionsblog.hypotheses.org/1120
http://www.schiebener.net/wordpress/?p=22977
mit vollständiger Wiedergabe
Stilstand
http://www.stilstand.de/die-kunst-den-ruf-zu-ladieren/
http://tamagothi.wordpress.com/2013/03/23/4335/
http://blah.tamagothi.de/2013/03/23/wenn-ich-bis-vor-einigen-jahren-zufriedener-abo/
The hobo and the gypsy
https://hogymag.wordpress.com/2013/03/22/causa-schavan-ein-offener-brief-von-klaus-graf-an-die-faz/
mit vollständiger Wiedergabe
Jürgen Fenn schreibt
"In einer anderen Liga
Posted on 24. März 2013 by jfenn
Ich glaube nicht, daß die FAZ sich mit der Abmahnung von Klaus Graf sozusagen fahrlässig (Vollzitat bei Erbloggtes) „Sympathien bei Bloggern und in den Social Media aktiven Menschen verscherzt“ hat. Sie macht genau das, was sie sonst auch das ganze Jahr über tut: Sie setzt ihre rechte Agenda, zumal gut 200 Tage vor der Bundestagswahl. Und sie kümmert sich um ihr Geschäft, indem sie ihrer Klientel suggerieren möchte, daß Blogs etwas Schlechtes seien. Daß Blogger vor gar nichts zurückschreckten. Daß sie unseriös seien und was weiß ich, was sonst noch alles.
Die Abmahnung gegen Klaus Graf zielt auf alle kritischen Blogger. Sie ist Teil einer Kampagne, die schon seit langem läuft. Blogs verlören Leser. Blogs seien in eine Krise geraten, hieß es da zur letzten Jahreswende. Blogs seien wieder weniger interessant für die Leser geworden als die Zeitungen. Woher wissen die das eigentlich, die Zeitungen? Über aktuelle Ereignisse informiere ich mich seit langem zu gut 90 Prozent aus Blogs. Und im übrigen lese ich ausländische Zeitungen wie den Guardian oder die Nachrichten des australischen Rundfunks, die bei dem, was sie schreiben, den nötigen Abstand zu den hiesigen Kampagnen haben. Kampagnen wie diese, zum Beispiel.
Es ist auch kein Zufall, daß hier ein Blogger angegangen wird, der sich vehement für wissenschaftliche Redlichkeit und gegen das Leistungsschutzrecht für Presseverleger verwendet hat, das gerade von rot-grün im Bundesrat durchgewunken worden ist. Der große Auftritt der Opposition blieb aus. War ja klar: Man möchte es sich ja schließlich nicht mit der Journaillie verderben, gut 200 Tage vor der Bundestagswahl.
Diese Kampagne ist aber auch eine der letzten ihrer Art. Hier erleben wir noch einmal den großen Aufstand der großen Rechtsabteilung eines ganz großen Pressekonzerns, der es nötig hat, gegen einen Wissenschaftsblogger aufzutreten, der in einer ganz anderen Liga spielt, in einer ernstzunehmenden nämlich. Und darauf darf die Blogosphäre doch auch stolz sein. Blogger, die Roß und Reiter nennen, verteidigen die Meinungs- und Pressefreiheit gegen die politisch vermachtete Konzernpresse. Soweit ist es gekommen.
Das sind letzte Gefechte und peinliche Stellvertreterkriege. Klaus hat unsere Geduld anderweitig durchaus in Anspruch genommen, aber hier bin ich mit ihm solidarisch, denn was er damals geschrieben hatte, war harmlos und durchweg der kritischen Aufklärung verpflichtet, verglichen mit dem, was die FAZ tagtäglich unter dem Deckmantel der bürgerlichen Ideologie so in die Welt setzt.
Und in gut 200 Tagen ist Bundestagswahl."
http://schneeschmelze.wordpress.com/2013/03/24/in-einer-anderen-liga/
Fenns Text unter http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/
Frühere Resonanz zur Sache:
http://archiv.twoday.net/stories/326204812/
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/342793744/

KlausGraf - am Sonntag, 24. März 2013, 17:46 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Kirchenbibliothek von St. Marien in Barth ist dank eines Fördervereins gerettet und wird feierlich wiedereröffnet.
http://www.blog.pommerscher-greif.de/bibliotheca-bardensis/
http://www.blog.pommerscher-greif.de/bibliotheca-bardensis/
MOtt - am Sonntag, 24. März 2013, 17:09 - Rubrik: Kulturgut
http://www.wilhelmsgymnasium.de/digitalisate/
Leider nur wenige Beispielseiten aus einer dreibändigen Handschrift:
Jakob Maier SJ, Commentaria una cum quaestionibus in Aristotelem, scriptis excepta a Virgilio Imbslander, 3 Bände, Dillingen 1603 – 1605
(Kommentare des Dillinger Jesuiten Jakob Maier zu Aristoteles’ De anima, Metaphysica, De caelo und De ortu et interitu sowie Untersuchungen zu verschiedenen Aspekten der aristotelischen Philosophie; Abschriften von der Hand seines Ordensbruders Virgilius Imbslander SJ)
Untergebracht bei Rapidshare! (Könnten ins Internet Archive oder auf Commons gespiegelt werden.)
Zur Bibliotheksgeschichte der wie so oft lange vernachlässigten Gymnasialbibliothek:
http://www.wilhelmsgymnasium.de/bibliothek/
Anm. 3: "Die vor dem Jahr 1850 erschienenen Bücher sind Eigentum des Freistaats Bayern und eigentlich der Bayerischen Staatsbibliothek zugeordnet, die mit Erscheinungsdatum 1850 und später gehören der Stadt München."
Handbuch der historischen Buchbestände
Hutters Bericht über die Bibliothek 1861 (in zwei Exemplaren online bei der BSB, siehe OPAC):
http://bavarica.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10341935.html
Der historische Bestand umfasste 1993 ca. 3600 Titel, den Gesamtbestand gibt die Wikipedia mit 11.000 Bänden an:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelmsgymnasium_M%C3%BCnchen#Die_Bibliothek_des_Wilhelmsgymnasiums
 Foto: http://www.wilhelmsgymnasium.de/
Foto: http://www.wilhelmsgymnasium.de/
Leider nur wenige Beispielseiten aus einer dreibändigen Handschrift:
Jakob Maier SJ, Commentaria una cum quaestionibus in Aristotelem, scriptis excepta a Virgilio Imbslander, 3 Bände, Dillingen 1603 – 1605
(Kommentare des Dillinger Jesuiten Jakob Maier zu Aristoteles’ De anima, Metaphysica, De caelo und De ortu et interitu sowie Untersuchungen zu verschiedenen Aspekten der aristotelischen Philosophie; Abschriften von der Hand seines Ordensbruders Virgilius Imbslander SJ)
Untergebracht bei Rapidshare! (Könnten ins Internet Archive oder auf Commons gespiegelt werden.)
Zur Bibliotheksgeschichte der wie so oft lange vernachlässigten Gymnasialbibliothek:
http://www.wilhelmsgymnasium.de/bibliothek/
Anm. 3: "Die vor dem Jahr 1850 erschienenen Bücher sind Eigentum des Freistaats Bayern und eigentlich der Bayerischen Staatsbibliothek zugeordnet, die mit Erscheinungsdatum 1850 und später gehören der Stadt München."
Handbuch der historischen Buchbestände
Hutters Bericht über die Bibliothek 1861 (in zwei Exemplaren online bei der BSB, siehe OPAC):
http://bavarica.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10341935.html
Der historische Bestand umfasste 1993 ca. 3600 Titel, den Gesamtbestand gibt die Wikipedia mit 11.000 Bänden an:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelmsgymnasium_M%C3%BCnchen#Die_Bibliothek_des_Wilhelmsgymnasiums
 Foto: http://www.wilhelmsgymnasium.de/
Foto: http://www.wilhelmsgymnasium.de/http://archaeologik.blogspot.de/2013/03/ende-der-denkmalforderung-nrw-online.html
"Das Land Nordhein-Westfalen will sich bis 2015 ganz aus der Finanzierung der Archäologie und der Denkmalförderung zurückziehen und hat bereits für 2013 drastische Mittelkürzungen vorgenommen. Zwar sieht eine Gesetzesinitiative die Stärkung der Denkmalpflege unter anderem mit Einführung des Verursacherprinzips vor, doch ist die gleichzeitige Mittelkürzung von 12 Mio in den vergangenen Jahren auf 0 im Jahr 2015 ein fatales Zeichen."
Mit vielen weiteren Links, u.a.
http://kristinoswald.hypotheses.org/562

"Das Land Nordhein-Westfalen will sich bis 2015 ganz aus der Finanzierung der Archäologie und der Denkmalförderung zurückziehen und hat bereits für 2013 drastische Mittelkürzungen vorgenommen. Zwar sieht eine Gesetzesinitiative die Stärkung der Denkmalpflege unter anderem mit Einführung des Verursacherprinzips vor, doch ist die gleichzeitige Mittelkürzung von 12 Mio in den vergangenen Jahren auf 0 im Jahr 2015 ein fatales Zeichen."
Mit vielen weiteren Links, u.a.
http://kristinoswald.hypotheses.org/562

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Friday Flowers 3/15/13 by Sonny Carter is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Each week on friday Sonny Carter ist posting a flower picture in the Archives list. This is nice but it is exciting that a Creative Commons license allows me to re-post the pictures in my non-commercial Tumblr blog.More pictures tagged naturalia in Archivalia_EN:
http://archivalia.tumblr.com/tagged/naturalia
KlausGraf - am Samstag, 23. März 2013, 22:07 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zu welchem auch für die deutsche Archivgeschichte wichtigen Gebäude gehören diese Fenster und Türen?
Wolf Thomas - am Samstag, 23. März 2013, 18:13 - Rubrik: Unterhaltung
"The online Bassi-Veratti Collection is a multi-year collaboration of the Stanford University Libraries, the Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, Bologna, Italy, and the Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, to produce a digital version of the archive of the influential woman scientist, Laura Bassi. "
http://bv.stanford.edu/?locale=en
Mit Copyfraud, da man unsinnigen Nutzungsbeschränkungen zustimmen muss, bevor man irgendetwas sehen darf.
Laura Bassi war die erste Universitätsprofessorin Europas:
http://de.wikipedia.org/wiki/Laura_Bassi

http://bv.stanford.edu/?locale=en
Mit Copyfraud, da man unsinnigen Nutzungsbeschränkungen zustimmen muss, bevor man irgendetwas sehen darf.
Laura Bassi war die erste Universitätsprofessorin Europas:
http://de.wikipedia.org/wiki/Laura_Bassi

KlausGraf - am Freitag, 22. März 2013, 19:26 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wer hat uns verraten? NRW-Sozialdemokraten. Der Bundesrat hat das Leistungsschutzrecht der Presseverleger nicht verhindert bzw. auf die lange Bank bis zur Bundestagswahl geschoben.
Sascha Lobo listet unsere (der Netzgemeinde) Fehler beim Umgang mit dem LSR auf:
http://saschalobo.com/2013/03/22/unsere-muetter-unsere-fehler/
Sascha Lobo listet unsere (der Netzgemeinde) Fehler beim Umgang mit dem LSR auf:
http://saschalobo.com/2013/03/22/unsere-muetter-unsere-fehler/
KlausGraf - am Freitag, 22. März 2013, 19:07 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Von 9:00 bis max. (sic !) 10:00 will man laut Einladung zur Sitzung Zeit nehmen den Generalia zu regeln.
Wolf Thomas - am Freitag, 22. März 2013, 06:13 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Soeben per Fax übermittelt (der Text darf gern ganz oder in Auszügen mit Quellenangabe anderweitig veröffentlicht werden):
Sehr geehrte Herren,
die Frankfurter Allgemeine Zeitung fordert mich mit Schreiben vom 8. März 2013 auf, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben, in der ich mich gegenüber der FAZ GmbH und Frau Heike Schmoll verpflichte, die Veröffentlichung und Verbreitung der Behauptung zu unterlassen, dass Frau Schmoll “die Freundin und/oder die Lebensgefährtin von Frau Annette Schavan sei”.
Ich habe mich zur Sache in zwei Blogeinträgen geäußert, auf die ich ergänzend verweise:
http://archiv.twoday.net/stories/326202963/
http://archiv.twoday.net/stories/326204812/
Nach Rücksprache mit meinem Rechtsanwalt habe ich mich entschieden, keine Unterlassungserklärung abzugeben.
Weder durch die Formulierung “Schavan-Freundin Schmoll”, die aus meiner Sicht lediglich die auffällig freundliche Berichterstattung von Frau Schmoll über Frau Schavan charakterisieren sollte, noch durch die Linksetzung auf http://causaschavan.wordpress.com habe ich die von Ihnen als falsch und üble Nachrede bezeichnete Unterstellung einer Lebenspartnerschaft verbreitet. Mir war dieses Gerücht völlig unbekannt.
Bei der rechtlichen Würdigung empfiehlt es sich, von den Grundsätzen des Bundesverfassungsgerichts auszugehen: “Maßgeblich für die Deutung ist weder die subjektive Absicht des sich Äußernden noch das subjektive Verständnis der von der Äußerung Betroffenen, sondern der Sinn, den sie nach dem Verständnis eines unvoreingenommenen und verständigen Durchschnittspublikums hat (vgl. BVerfGE 93, 266 [295]; BGHZ 95, 212 [215]; 132, 13 [19]). Fern liegende Deutungen sind auszuscheiden (vgl. BVerfGE 93, 266 [296]).” So die Entscheidung 1 BvR 1696/98 aus dem Jahr 2005. Nach Ausweis der öffentlichen Resonanz auf die hier zur Rede stehende Abmahnung kann man nicht umhin, die Deutung des Begriffs Freundin als ausgesprochen “fern liegend” zu bezeichnen. Selbst für den Begriff Intima, der noch sehr viel mehr geeignet wäre, auf eine homosexuelle Beziehung anzuspielen, kann man dem Durchschnittspublikum eine solche Deutung nicht unterstellen, sonst würde sicher nicht Schavan als “Merkel-Intima” (so etwa die Südwest-Presse in einem Kommentar) bezeichnet werden.
Was meinen Link auf die Startseite von causaschavan.wordpress.com angeht, so hat dieses Blog dazu alles Nötige geschrieben: “Um es deutlich zu sagen: Wir haben mit Plagiatschavan nichts zu tun und wollen mit Plagiatschavan auch bitte nicht verwechselt werden. Wenn wir das richtig sehen, hat Klaus Graf jedoch nirgendwo einen Hyperlink auf Plagiatschavan gesetzt. Und auf Causa Schavan wurden von dem User “plagiatschavan” nur zwei Kommentare veröffentlicht, in denen Frau Schmoll lediglich in unverfänglicher Weise als “Freundin” der Frau Schavan angesprochen wird. Ein weiterer Kommentar dieses Users, der in dieser Hinsicht weniger unverfänglich erschien, wurde von uns nicht freigegeben und gelöscht.”
http://causaschavan.wordpress.com/2013/03/13/beziehungskiste-oder-was-der-blogger-klaus-graf-in-sachen-schavan-unterlassen-soll/
Dass ich aufgrund eines Hyperlinks haften soll, der zu einem Blog führt, in dessen Kommentaren irgendwo Frau Schmoll als Freundin von Frau Schavan bezeichnet wurde, überdehnt jedes vernünftige Konzept von Linkhaftung.
Sollte es außerhalb von Geschäftsführung und Justitiarat der FAZ tatsächlich Menschen geben, die meinen Blogbeitrag vom 3. Februar 2013 im Sinne der erwähnten Unterstellung auffassen, so finden diese nun in fetter Schrift einen Hinweis auf den Beitrag vom 17. März 2013, in dem ich klarstelle, dass ich nichts dergleichen unterstellen wollte und will. Ich darf versichern und wer meine bisherige Praxis in meinem seit 2003 bestehenden Blog Archivalia kennt, wird daran nicht zweifeln, dass ich diese Ergänzung nicht mehr zu entfernen gedenke. Dadurch ist eine hinreichende Klarstellung erfolgt, einer strafbewehrten Unterlassungserklärung bedarf es unter diesen Umständen nicht.
Ich sehe Ihre Abmahnung gegenüber mir als skandalösen Fehlgriff an. Sie haben eigentlich alles falsch gemacht und sich viele Sympathien bei Bloggern und in den Social Media aktiven Menschen verscherzt. Wenn es Ihnen tatsächlich darum ging, sich schützend vor Ihre Mitarbeiterin zu stellen und ein Gerücht über ihre sexuelle Orientierung an der Verbreitung zu hindern, haben Sie durch das von mir in meinem zweiten Beitrag am 16. März 2013 dokumentierte nicht ganz geringe Aufsehen, das Ihre Abmahnung im Netz erregte, genau das Gegenteil erreicht.
Sie haben es noch nicht einmal geschafft, sauber über mich zu recherchieren, da Sie mir einen nicht existierenden Professorentitel beilegen. Sie hätten wissen können, dass ich, gern mit dem Adjektiv “streitbar” versehen, bei einer offenkundig an den Haaren herbeigezogenen Abmahnung ganz gewiss nicht klein beigebe, sondern den Casus an die Öffentlichkeit trage. Wer im Netz aktiv ist, sollte nun wirklich inzwischen den “Streisand-Effekt” kennen.
Es ist zudem bei vielen der Eindruck entstanden, dass hinter der Abmahnung ein stock-konservatives Lebensmodell und Menschenbild steht, für das der Verdacht einer homosexuellen Beziehung eine “Schmähung des Ansehens” darstellt. Selbst wenn man Frau Schmoll womöglich wahrheitswidrig als lesbisch outen würde, wäre das vielleicht eine Persönlichkeitsrechtsverletzung, aber keine üble Nachrede.
Sie haben mit Ihrer Abmahnung ein Blog getroffen, das es sich nicht zuletzt seit der Affäre Guttenberg zur Aufgabe gemacht hat, wissenschaftliche Standards hochzuhalten und gegen Plagiate vorzugehen. Archivalia hat daher sehr intensiv über die Causa Schavan berichtet, wobei es sich meist auf die ausgezeichneten Recherchen der Blogs Erbloggtes und Causaschavan stützen konnte. Archivalia hat zwar keine eigenständigen Verdienste bei der Aufdeckung der Machenschaften, konnte aber durch seine fachliche Reichweite als führendes deutsches Geschichtsblog immer wieder unterstreichen, dass es nicht angeht, ein Plagiat deshalb milder zu sehen, weil die (damals noch amtierende) Wissenschaftsministerin betroffen ist. Das ist der Kontext des beanstandeten Blogbeitrags. Wie die meisten deutschen sogenannten “Qualitätsmedien” hat auch die FAZ - namentlich durch die wiederholt einseitig für Schavan Partei ergreifenden Artikel von Frau Schmoll - in dieser Angelegenheit völlig versagt. Gut recherchiert haben fast nur die Blogs. Nicht ohne Grund kommentiert Causaschavan meine Abmahnung: “Immerhin aber ist diese Konstruktion des Justitiariats der FAZ in etwa so schlecht recherchiert und so umstandslos daherbehauptet, dass man angesichts gewisser Qualitätspresseberichte und -kommentare der letzten Monate in Sachen Schavan zumindest keinen Stilbruch zu beklagen hat.”
Wenn ich, bis vor einigen Jahren zufriedener Abonnent der FAZ, die FAZ und die anderen sogenannten Qualitätsmedien inzwischen überwiegend nur noch als “Journaille” sehen kann, hängt das mit der Haltung der FAZ und dieser Medien zur digitalen Revolution zusammen. Sie sind nicht im 21. Jahrhundert angekommen, sondern klammern sich an veraltete Konzepte. Statt ein tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln, wollen Sie die neuen Medien in alte Schläuche füllen. (Und kundenfreundlich war Ihr Vorgehen gewiss nicht, den Abonnenten vor einiger Zeit die Möglichkeit zu nehmen, die FAZ am gleichen Tag ohne Mehrkosten auch digital einzusehen.)
Das Netz und seine Feinde: Die FAZ wirbt unverhohlen für das unsägliche Leistungsschutzgesetz der Presseverleger, das ich bekämpfe. Sie missbrauchen Ihre Medienmacht, indem Sie vor allem digitalen Reaktionären das Wort geben. Während Archivalia sich als Sturmgeschütz für “Open Access” sieht, dürfen Roland Reuß und Uwe Jochum und deren Kumpane in Ihrer Zeitung Unsinn gegen Open Access schreiben. In meinem Buch “Urheberrechtsfibel” habe ich 2009 dafür plädiert, das geltende Urheberrecht durch eine tiefgreifende Reform an das digitale Zeitalter anzupassen. Die FAZ macht aber Stimmung gegen jede Änderung, die die Macht der Verwerter antasten könnte.
Vor dem Hintergrund meiner Abmahnung erweist sich die Tatsache, dass Sie einige Blogger auf Ihrer Website schreiben lassen und auch den einen oder anderen netzfreundlichen Artikel veröffentlichen, als bloßes Feigenblatt. Zu einem fairen Umgang mit Bloggern gehört auch, dass man nach Möglichkeit auf eine Abmahnung, also das Fordern einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, zunächst verzichtet. Und man sollte immer bedenken, dass auch Blogger ebenso wie die traditionelle Presse an der Meinungsbildung der Öffentlichkeit mitwirken und ihnen ebenso wie der Presse das Grundrecht der Pressefreiheit, das immer wieder von den sogenannten Qualitätsmedien als hohes Gut gepriesen wird, zusteht. Damit verträgt es sich nicht, einen Blogger mit einer absurden Abmahnung zu überziehen, die ihn einschüchtern soll, die aber im Justitiariat von sagen wir SPIEGEL ONLINE allenfalls einen Lachkrampf auslösen würde.
Es ist genau dieser Einschüchterungseffekt, der mich so wütend macht. Ich wünsche mir natürlich nicht, für meine mitunter wirklich etwas harten Formulierungen in Archivalia und andernorts abgemahnt zu werden. Ich wünsche mir, dass man mit Augenmaß und Gelassenheit vorgeht, wenn ein Blogger (oder Internetautor) etwas schreibt, was einem nicht gefällt. Wer klug ist, bedenkt den Streisand-Effekt. Ich plädiere in Archivalia und als Mitarbeiter von Wissenschaftsblogs auf de.hypotheses.org und als Redaktionsmitglied dieses Blogportals dafür, dass Wissenschaftler bloggen sollen. Zugleich informiere ich - vor allem in einer Artikelreihe Blog & Recht in Archivalia - über rechtliche Rahmenbedingungen. Der Beitrag zu möglichen Persönlichkeitsrechtsverletzungen und erster Hilfe bei Abmahnungen steht noch aus. Wie kann ich glaubhaft für das Bloggen werben, wenn die FAZ wegen einer solchen Nichtigkeit abmahnt? Nicht jeder ist so robust wie ich. Soll man zu Wissenschaftsskandalen wie der Causa Schavan und dem merkwürdigen Treiben der sogenannten Qualitätsjournalisten einschließlich Ihrer Mitarbeiterin Schmoll den Mund halten, weil man Angst davor hat, abgemahnt zu werden?
Nach dem Vorstehenden wird es Sie nicht überraschen, wenn ich einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit großer Gelassenheit entgegensehe.
Mit freundlichen Grüßen
Sehr geehrte Herren,
die Frankfurter Allgemeine Zeitung fordert mich mit Schreiben vom 8. März 2013 auf, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben, in der ich mich gegenüber der FAZ GmbH und Frau Heike Schmoll verpflichte, die Veröffentlichung und Verbreitung der Behauptung zu unterlassen, dass Frau Schmoll “die Freundin und/oder die Lebensgefährtin von Frau Annette Schavan sei”.
Ich habe mich zur Sache in zwei Blogeinträgen geäußert, auf die ich ergänzend verweise:
http://archiv.twoday.net/stories/326202963/
http://archiv.twoday.net/stories/326204812/
Nach Rücksprache mit meinem Rechtsanwalt habe ich mich entschieden, keine Unterlassungserklärung abzugeben.
Weder durch die Formulierung “Schavan-Freundin Schmoll”, die aus meiner Sicht lediglich die auffällig freundliche Berichterstattung von Frau Schmoll über Frau Schavan charakterisieren sollte, noch durch die Linksetzung auf http://causaschavan.wordpress.com habe ich die von Ihnen als falsch und üble Nachrede bezeichnete Unterstellung einer Lebenspartnerschaft verbreitet. Mir war dieses Gerücht völlig unbekannt.
Bei der rechtlichen Würdigung empfiehlt es sich, von den Grundsätzen des Bundesverfassungsgerichts auszugehen: “Maßgeblich für die Deutung ist weder die subjektive Absicht des sich Äußernden noch das subjektive Verständnis der von der Äußerung Betroffenen, sondern der Sinn, den sie nach dem Verständnis eines unvoreingenommenen und verständigen Durchschnittspublikums hat (vgl. BVerfGE 93, 266 [295]; BGHZ 95, 212 [215]; 132, 13 [19]). Fern liegende Deutungen sind auszuscheiden (vgl. BVerfGE 93, 266 [296]).” So die Entscheidung 1 BvR 1696/98 aus dem Jahr 2005. Nach Ausweis der öffentlichen Resonanz auf die hier zur Rede stehende Abmahnung kann man nicht umhin, die Deutung des Begriffs Freundin als ausgesprochen “fern liegend” zu bezeichnen. Selbst für den Begriff Intima, der noch sehr viel mehr geeignet wäre, auf eine homosexuelle Beziehung anzuspielen, kann man dem Durchschnittspublikum eine solche Deutung nicht unterstellen, sonst würde sicher nicht Schavan als “Merkel-Intima” (so etwa die Südwest-Presse in einem Kommentar) bezeichnet werden.
Was meinen Link auf die Startseite von causaschavan.wordpress.com angeht, so hat dieses Blog dazu alles Nötige geschrieben: “Um es deutlich zu sagen: Wir haben mit Plagiatschavan nichts zu tun und wollen mit Plagiatschavan auch bitte nicht verwechselt werden. Wenn wir das richtig sehen, hat Klaus Graf jedoch nirgendwo einen Hyperlink auf Plagiatschavan gesetzt. Und auf Causa Schavan wurden von dem User “plagiatschavan” nur zwei Kommentare veröffentlicht, in denen Frau Schmoll lediglich in unverfänglicher Weise als “Freundin” der Frau Schavan angesprochen wird. Ein weiterer Kommentar dieses Users, der in dieser Hinsicht weniger unverfänglich erschien, wurde von uns nicht freigegeben und gelöscht.”
http://causaschavan.wordpress.com/2013/03/13/beziehungskiste-oder-was-der-blogger-klaus-graf-in-sachen-schavan-unterlassen-soll/
Dass ich aufgrund eines Hyperlinks haften soll, der zu einem Blog führt, in dessen Kommentaren irgendwo Frau Schmoll als Freundin von Frau Schavan bezeichnet wurde, überdehnt jedes vernünftige Konzept von Linkhaftung.
Sollte es außerhalb von Geschäftsführung und Justitiarat der FAZ tatsächlich Menschen geben, die meinen Blogbeitrag vom 3. Februar 2013 im Sinne der erwähnten Unterstellung auffassen, so finden diese nun in fetter Schrift einen Hinweis auf den Beitrag vom 17. März 2013, in dem ich klarstelle, dass ich nichts dergleichen unterstellen wollte und will. Ich darf versichern und wer meine bisherige Praxis in meinem seit 2003 bestehenden Blog Archivalia kennt, wird daran nicht zweifeln, dass ich diese Ergänzung nicht mehr zu entfernen gedenke. Dadurch ist eine hinreichende Klarstellung erfolgt, einer strafbewehrten Unterlassungserklärung bedarf es unter diesen Umständen nicht.
Ich sehe Ihre Abmahnung gegenüber mir als skandalösen Fehlgriff an. Sie haben eigentlich alles falsch gemacht und sich viele Sympathien bei Bloggern und in den Social Media aktiven Menschen verscherzt. Wenn es Ihnen tatsächlich darum ging, sich schützend vor Ihre Mitarbeiterin zu stellen und ein Gerücht über ihre sexuelle Orientierung an der Verbreitung zu hindern, haben Sie durch das von mir in meinem zweiten Beitrag am 16. März 2013 dokumentierte nicht ganz geringe Aufsehen, das Ihre Abmahnung im Netz erregte, genau das Gegenteil erreicht.
Sie haben es noch nicht einmal geschafft, sauber über mich zu recherchieren, da Sie mir einen nicht existierenden Professorentitel beilegen. Sie hätten wissen können, dass ich, gern mit dem Adjektiv “streitbar” versehen, bei einer offenkundig an den Haaren herbeigezogenen Abmahnung ganz gewiss nicht klein beigebe, sondern den Casus an die Öffentlichkeit trage. Wer im Netz aktiv ist, sollte nun wirklich inzwischen den “Streisand-Effekt” kennen.
Es ist zudem bei vielen der Eindruck entstanden, dass hinter der Abmahnung ein stock-konservatives Lebensmodell und Menschenbild steht, für das der Verdacht einer homosexuellen Beziehung eine “Schmähung des Ansehens” darstellt. Selbst wenn man Frau Schmoll womöglich wahrheitswidrig als lesbisch outen würde, wäre das vielleicht eine Persönlichkeitsrechtsverletzung, aber keine üble Nachrede.
Sie haben mit Ihrer Abmahnung ein Blog getroffen, das es sich nicht zuletzt seit der Affäre Guttenberg zur Aufgabe gemacht hat, wissenschaftliche Standards hochzuhalten und gegen Plagiate vorzugehen. Archivalia hat daher sehr intensiv über die Causa Schavan berichtet, wobei es sich meist auf die ausgezeichneten Recherchen der Blogs Erbloggtes und Causaschavan stützen konnte. Archivalia hat zwar keine eigenständigen Verdienste bei der Aufdeckung der Machenschaften, konnte aber durch seine fachliche Reichweite als führendes deutsches Geschichtsblog immer wieder unterstreichen, dass es nicht angeht, ein Plagiat deshalb milder zu sehen, weil die (damals noch amtierende) Wissenschaftsministerin betroffen ist. Das ist der Kontext des beanstandeten Blogbeitrags. Wie die meisten deutschen sogenannten “Qualitätsmedien” hat auch die FAZ - namentlich durch die wiederholt einseitig für Schavan Partei ergreifenden Artikel von Frau Schmoll - in dieser Angelegenheit völlig versagt. Gut recherchiert haben fast nur die Blogs. Nicht ohne Grund kommentiert Causaschavan meine Abmahnung: “Immerhin aber ist diese Konstruktion des Justitiariats der FAZ in etwa so schlecht recherchiert und so umstandslos daherbehauptet, dass man angesichts gewisser Qualitätspresseberichte und -kommentare der letzten Monate in Sachen Schavan zumindest keinen Stilbruch zu beklagen hat.”
Wenn ich, bis vor einigen Jahren zufriedener Abonnent der FAZ, die FAZ und die anderen sogenannten Qualitätsmedien inzwischen überwiegend nur noch als “Journaille” sehen kann, hängt das mit der Haltung der FAZ und dieser Medien zur digitalen Revolution zusammen. Sie sind nicht im 21. Jahrhundert angekommen, sondern klammern sich an veraltete Konzepte. Statt ein tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln, wollen Sie die neuen Medien in alte Schläuche füllen. (Und kundenfreundlich war Ihr Vorgehen gewiss nicht, den Abonnenten vor einiger Zeit die Möglichkeit zu nehmen, die FAZ am gleichen Tag ohne Mehrkosten auch digital einzusehen.)
Das Netz und seine Feinde: Die FAZ wirbt unverhohlen für das unsägliche Leistungsschutzgesetz der Presseverleger, das ich bekämpfe. Sie missbrauchen Ihre Medienmacht, indem Sie vor allem digitalen Reaktionären das Wort geben. Während Archivalia sich als Sturmgeschütz für “Open Access” sieht, dürfen Roland Reuß und Uwe Jochum und deren Kumpane in Ihrer Zeitung Unsinn gegen Open Access schreiben. In meinem Buch “Urheberrechtsfibel” habe ich 2009 dafür plädiert, das geltende Urheberrecht durch eine tiefgreifende Reform an das digitale Zeitalter anzupassen. Die FAZ macht aber Stimmung gegen jede Änderung, die die Macht der Verwerter antasten könnte.
Vor dem Hintergrund meiner Abmahnung erweist sich die Tatsache, dass Sie einige Blogger auf Ihrer Website schreiben lassen und auch den einen oder anderen netzfreundlichen Artikel veröffentlichen, als bloßes Feigenblatt. Zu einem fairen Umgang mit Bloggern gehört auch, dass man nach Möglichkeit auf eine Abmahnung, also das Fordern einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, zunächst verzichtet. Und man sollte immer bedenken, dass auch Blogger ebenso wie die traditionelle Presse an der Meinungsbildung der Öffentlichkeit mitwirken und ihnen ebenso wie der Presse das Grundrecht der Pressefreiheit, das immer wieder von den sogenannten Qualitätsmedien als hohes Gut gepriesen wird, zusteht. Damit verträgt es sich nicht, einen Blogger mit einer absurden Abmahnung zu überziehen, die ihn einschüchtern soll, die aber im Justitiariat von sagen wir SPIEGEL ONLINE allenfalls einen Lachkrampf auslösen würde.
Es ist genau dieser Einschüchterungseffekt, der mich so wütend macht. Ich wünsche mir natürlich nicht, für meine mitunter wirklich etwas harten Formulierungen in Archivalia und andernorts abgemahnt zu werden. Ich wünsche mir, dass man mit Augenmaß und Gelassenheit vorgeht, wenn ein Blogger (oder Internetautor) etwas schreibt, was einem nicht gefällt. Wer klug ist, bedenkt den Streisand-Effekt. Ich plädiere in Archivalia und als Mitarbeiter von Wissenschaftsblogs auf de.hypotheses.org und als Redaktionsmitglied dieses Blogportals dafür, dass Wissenschaftler bloggen sollen. Zugleich informiere ich - vor allem in einer Artikelreihe Blog & Recht in Archivalia - über rechtliche Rahmenbedingungen. Der Beitrag zu möglichen Persönlichkeitsrechtsverletzungen und erster Hilfe bei Abmahnungen steht noch aus. Wie kann ich glaubhaft für das Bloggen werben, wenn die FAZ wegen einer solchen Nichtigkeit abmahnt? Nicht jeder ist so robust wie ich. Soll man zu Wissenschaftsskandalen wie der Causa Schavan und dem merkwürdigen Treiben der sogenannten Qualitätsjournalisten einschließlich Ihrer Mitarbeiterin Schmoll den Mund halten, weil man Angst davor hat, abgemahnt zu werden?
Nach dem Vorstehenden wird es Sie nicht überraschen, wenn ich einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit großer Gelassenheit entgegensehe.
Mit freundlichen Grüßen
KlausGraf - am Freitag, 22. März 2013, 04:15 - Rubrik: Archivrecht
"Der Bundesgerichtshof hat den vom Oberlandesgericht festgesetzten Gesamtvertrag nicht in allen Punkten gebilligt und die Sache daher zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Oberlandesgericht zurückverwiesen. Es sei zwar nicht zu beanstanden, dass der Gesamtvertrag einen Vorrang angemessener Angebote der Rechteinhaber und eine Erfassung und Abrechnung einzelner Nutzungen vorsehe. Das Oberlandesgericht habe jedoch nicht überzeugend begründet, weshalb es bei der Festlegung des zulässigen Nutzungsumfangs teilweise von den Regelungen abgewichen sei, die die Parteien im gleichfalls Sprachwerke betreffenden "Gesamtvertrag zur Vergütung von Ansprüchen nach § 52a UrhG für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken für Zwecke des Unterrichts an Schulen" getroffen haben; danach sind unter "kleine Teile eines Werkes" maximal 12% eines Werkes, "Teile eines Werkes" maximal 25% eines Werkes (jedoch nicht mehr als 100 Seiten) und "Werke geringen Umfangs" Druckwerke mit maximal 25 Seiten zu verstehen.
Es erscheine auch nicht sachgerecht, die Vergütung für das öffentliche Zugänglichmachen von Sprachwerken an Hochschulen - entsprechend dem von der Beklagten mit anderen Verwertungsgesellschaften geschlossenen "Gesamtvertrag zur Vergütung von Ansprüchen nach § 52a UrhG für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken mit Ausnahme von Sprachwerken an Hochschulen" - nach dem Werk oder Werkteil und nicht nach der Zahl der Seiten des Druckwerks, nach Gruppengrößen und nicht nach der Zahl der Teilnehmer der Veranstaltung sowie degressiv und nicht linear zu bemessen. Nicht zu beanstanden sei allerdings, dass sich das Oberlandesgericht bei der Bemessung der Vergütung an der sogenannten Kopiervergütung orientiert habe, die aufgrund eines zwischen den Parteien geschlossenen Rahmenvertrages vom 8. März 2007 für Vervielfältigungen nach § 54a Abs. 2 UrhG aF (jetzt § 54c UrhG) zu zahlen sei und 0,008 € (0,8 ct) pro Seite betrage.
Urteil vom 20. März 2013 - I ZR 84/11 - Gesamtvertrag Hochschul-Intranet"
Kein Volltext bisher.
Es erscheine auch nicht sachgerecht, die Vergütung für das öffentliche Zugänglichmachen von Sprachwerken an Hochschulen - entsprechend dem von der Beklagten mit anderen Verwertungsgesellschaften geschlossenen "Gesamtvertrag zur Vergütung von Ansprüchen nach § 52a UrhG für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken mit Ausnahme von Sprachwerken an Hochschulen" - nach dem Werk oder Werkteil und nicht nach der Zahl der Seiten des Druckwerks, nach Gruppengrößen und nicht nach der Zahl der Teilnehmer der Veranstaltung sowie degressiv und nicht linear zu bemessen. Nicht zu beanstanden sei allerdings, dass sich das Oberlandesgericht bei der Bemessung der Vergütung an der sogenannten Kopiervergütung orientiert habe, die aufgrund eines zwischen den Parteien geschlossenen Rahmenvertrages vom 8. März 2007 für Vervielfältigungen nach § 54a Abs. 2 UrhG aF (jetzt § 54c UrhG) zu zahlen sei und 0,008 € (0,8 ct) pro Seite betrage.
Urteil vom 20. März 2013 - I ZR 84/11 - Gesamtvertrag Hochschul-Intranet"
Kein Volltext bisher.
KlausGraf - am Donnerstag, 21. März 2013, 18:51 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 21. März 2013, 18:36 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://archiv.twoday.net/stories/55779436/#326207119
Der Fund (Andergast sei gedankt!) ist eine eigene Meldung wert.
Der Fund (Andergast sei gedankt!) ist eine eigene Meldung wert.
KlausGraf - am Donnerstag, 21. März 2013, 17:07 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eigenartig, dass keinerlei Abgrenzung gegenüber e-codices (Mittelalter und frühere frühe Neuzeit?) erfolgt.
http://www.e-manuscripta.ch/
"Auf der Plattform www.e-manuscripta.ch können ab sofort Handschriften und Archivalien aus mehreren Jahrhunderten online eingesehen werden. Dokumente von Erasmus von Rotterdam, Richard Wagner und Albert Einstein sind dort ebenso zu entdecken wie der Nachlass des Geologen Arnold Escher von der Linth, Gelehrtenkorrespondenz um den Basler Arzt Felix Platter oder das Archiv der Allgemeinen Musik-Gesellschaft Zürich.
e-manuscripta.ch ist ein Kooperationsprojekt der Universitätsbibliothek Basel mit der ETH-Bibliothek und der Zentralbibliothek Zürich und schliesst eine Lücke im digitalen Angebot dieser Institutionen."
Es geht, wie es weiter heißt, um "handschriftliches Material der Neuzeit"
Gerold Edlibachs Chronik könnte man aber ebenso in e-codices.ch erwarten:
http://dx.doi.org/10.7891/e-manuscripta-1008
Und ... ich sage nur: Wickiana.
http://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/newsdetail/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=343&cHash=a03f6a2272be35b587f4e553c79056d4

http://www.e-manuscripta.ch/
"Auf der Plattform www.e-manuscripta.ch können ab sofort Handschriften und Archivalien aus mehreren Jahrhunderten online eingesehen werden. Dokumente von Erasmus von Rotterdam, Richard Wagner und Albert Einstein sind dort ebenso zu entdecken wie der Nachlass des Geologen Arnold Escher von der Linth, Gelehrtenkorrespondenz um den Basler Arzt Felix Platter oder das Archiv der Allgemeinen Musik-Gesellschaft Zürich.
e-manuscripta.ch ist ein Kooperationsprojekt der Universitätsbibliothek Basel mit der ETH-Bibliothek und der Zentralbibliothek Zürich und schliesst eine Lücke im digitalen Angebot dieser Institutionen."
Es geht, wie es weiter heißt, um "handschriftliches Material der Neuzeit"
Gerold Edlibachs Chronik könnte man aber ebenso in e-codices.ch erwarten:
http://dx.doi.org/10.7891/e-manuscripta-1008
Und ... ich sage nur: Wickiana.
http://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/newsdetail/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=343&cHash=a03f6a2272be35b587f4e553c79056d4

KlausGraf - am Donnerstag, 21. März 2013, 02:00 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.ebay.de/itm/EARLY-LAW-RELATED-INCUNABLE-VOCABULARIUS-JURIS-ERFORDENSIS-WENSSLER-BASLE-1474-/360510005051
Wer knapp 15.000 Euro locker hat, kann sofort zuschlagen.
"LITERATURE
GW 12628; ISTC iv00335000; Copinger 6354; Goff V-335; Proctor 7477; Pellechet 11758; Hubay 2128; Ohly-Sack 3004; Rhodes 1836, BMC III, 722; BSB-Ink I-256; IGI 10354th
PROVENANCE
Library of Ulricus Wenger with its contemporary manuscript ownership inscription at the top of the content.
Owner entry of Augustinian Hermits monastery in Memmingen from the 17th century.
Our copy come from the Royal Library of the Princes of Fürstenberg, Donaueschingen (see Christies NY, Rockefeller Plaza, 23.04.2001, Sale 9630, Lot 64, Realized price: U.S. $ 14,100.)"
Von den Fürsten von Fürstenberg verscherbelt bei Sotheby's 1994 Nr. 321 (Donaueschinger Signatur Inc. 488), siehe auch
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/don.htm
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/374/
Das Stück war 2012 bei Bassenge im Angebot:
http://archiv.twoday.net/stories/120170726/
Das gleiche Stück:
http://www.laboramedia.com/ebay/M945%20Vocabularius.pdf
Needham hat zu Wenger im IPI wie schon 1994 keine Nachweise, aber ein Blick in Manuscripta Mediaevalia hilft weiter: Hardo Hilg hat zu GNM Hs. 25470 (von ca. 1463, teilweise geschrieben von Wenger) aus dem Memminger Augustiner-Eremitenkloster gut recherchiert:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0061_c029_jpg.htm
Wenger, bezeugt 1450-1483, war Pleban in Oberwinterthur, Pfarrer in Altstädten und Kaplan in Seifriedsberg. Damit möchte ich, Needham 1994 ändernd und ergänzend, lesen:
"Hic liber est domini vlrici Wenger ecclesiarum alstetten rectoris et Sifridsperg capellanus"
Nachdem bei Sifridsperg nur eine er-Kürzung erkennbar ist, sehe ich keine Notwendigkeit alstettensis oder alstettensium zu lesen, zumal niemand weiß, wie Wengers Latein war.
Im Repertorium Germanicum findet man Wenger auch
http://www.romana-repertoria.net/
RG VII 02813 bezieht sich auf Seifriedsberg.

Wer knapp 15.000 Euro locker hat, kann sofort zuschlagen.
"LITERATURE
GW 12628; ISTC iv00335000; Copinger 6354; Goff V-335; Proctor 7477; Pellechet 11758; Hubay 2128; Ohly-Sack 3004; Rhodes 1836, BMC III, 722; BSB-Ink I-256; IGI 10354th
PROVENANCE
Library of Ulricus Wenger with its contemporary manuscript ownership inscription at the top of the content.
Owner entry of Augustinian Hermits monastery in Memmingen from the 17th century.
Our copy come from the Royal Library of the Princes of Fürstenberg, Donaueschingen (see Christies NY, Rockefeller Plaza, 23.04.2001, Sale 9630, Lot 64, Realized price: U.S. $ 14,100.)"
Von den Fürsten von Fürstenberg verscherbelt bei Sotheby's 1994 Nr. 321 (Donaueschinger Signatur Inc. 488), siehe auch
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/don.htm
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/374/
Das Stück war 2012 bei Bassenge im Angebot:
http://archiv.twoday.net/stories/120170726/
Das gleiche Stück:
http://www.laboramedia.com/ebay/M945%20Vocabularius.pdf
Needham hat zu Wenger im IPI wie schon 1994 keine Nachweise, aber ein Blick in Manuscripta Mediaevalia hilft weiter: Hardo Hilg hat zu GNM Hs. 25470 (von ca. 1463, teilweise geschrieben von Wenger) aus dem Memminger Augustiner-Eremitenkloster gut recherchiert:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0061_c029_jpg.htm
Wenger, bezeugt 1450-1483, war Pleban in Oberwinterthur, Pfarrer in Altstädten und Kaplan in Seifriedsberg. Damit möchte ich, Needham 1994 ändernd und ergänzend, lesen:
"Hic liber est domini vlrici Wenger ecclesiarum alstetten rectoris et Sifridsperg capellanus"
Nachdem bei Sifridsperg nur eine er-Kürzung erkennbar ist, sehe ich keine Notwendigkeit alstettensis oder alstettensium zu lesen, zumal niemand weiß, wie Wengers Latein war.
Im Repertorium Germanicum findet man Wenger auch
http://www.romana-repertoria.net/
RG VII 02813 bezieht sich auf Seifriedsberg.

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=26336 mit gewohnt sorgfältigen Nachweisen
Siehe auch
http://archivalia.tumblr.com/post/45865416398/supreme-court-rules-in-kirtsaeng-v-wiley-first-sale
Update zu: http://archiv.twoday.net/stories/165211023/ (mit ausführlicher Stellungnahme zum Problem der Erschöpfung des Verbreitungsrechts außerhalb der EU)
Siehe auch
http://archivalia.tumblr.com/post/45865416398/supreme-court-rules-in-kirtsaeng-v-wiley-first-sale
Update zu: http://archiv.twoday.net/stories/165211023/ (mit ausführlicher Stellungnahme zum Problem der Erschöpfung des Verbreitungsrechts außerhalb der EU)
KlausGraf - am Mittwoch, 20. März 2013, 23:28 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://log.netbib.de/archives/2013/03/20/vortrage-auf-dem-bibliothekskongress/ bemängelt zurecht, dass die bei den Präsentationen des Bibliothekskongresses hochgeladenen Folien oft nicht so recht hilfreich sind, weil die "Erzählspur" fehlt. Dass in anderen Bereichen Videoaufzeichnungen erfolgreich eingesetzt werden, scheint den Bibliothekaren unbekannt zu sein.
Ein Beispiel für ausgesprochen wenig aussagekräftige Folien ist Thomas Hilberers Vortrag:
http://www.opus-bayern.de/bib-info/volltexte//2013/1439/
Ohne das Abstract rätselt man allzu sehr herum.
"Ausgangspunkt war die Erstellung einer Art „Fakultätsbibliographie“ durch die Verzeichnung der Aufsätze der Dozenten im Bibliothekskatalog. Damit wurde 2005 begonnen, mittlerweile sind über 2500 Titel erfaßt. Seit 2009 werden auch Volltexte von Aufsätzen über den Katalog und eine Webseite angeboten.
Dieses Portal „Neuphilologie“ führt zu Zweitveröffentlichungen („Grüner Weg“) von derzeit fast 600 wissenschaftlichen Aufsätzen von Dozenten der Tübinger Philosophischen Fakultät. Dabei werden die Texte in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek auf deren Publikationsserver veröffentlicht, mit Schlagwörtern versehen und im Katalog des „Südwestdeutschen Bibliotheksverbunds“ verzeichnet. Die Titelaufnahme liefert also per Hyperlink unmittelbar den Volltext, und dies nicht nur im Tübinger Katalog, sondern auch in den Katalogen aller wissenschaftlichen Bibliotheken des Verbundraumes (der mehr als 1.200 Bibliotheken aus den Regionen Baden-Württemberg, Saarland und Sachsen sowie weitere Spezialbibliotheken wie die des „Goethe-Instituts“ umfaßt). Darüber hinaus erfolgt eine Indexierung durch Suchmaschinen.
Zur Vereinfachung des Veröffentlichungs-Verfahrens wird ein Herausgebervertrag zugrunde gelegt.
Äußerst zeitaufwendig gestaltete sich die Einwerbung der Aufsätze, sie erforderte sehr viel persönliche Ansprache.
Gezeigt werden soll, daß sich der Aufwand auch für eine kleinere Bibliothek lohnt, Forschung und Lehre gefördert und nicht zuletzt das Renommee aller beteiligten Einrichtung verbessert werden."
Grüner Open Access wird also auf Institutsbibliotheks-Ebene durch persönliche Ansprache der Wissenschaftler gefördert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/portal/neuphil/?la=de
Altgermanisten finden beispielsweise viele Aufsätze Ridders. Für mich besonders wertvoll zwei wichtige Forschungsbeiträge Paul Sapplers zum "Friedrich von Schwaben", die jetzt auch online verfügbar sind.
Ein Beispiel für ausgesprochen wenig aussagekräftige Folien ist Thomas Hilberers Vortrag:
http://www.opus-bayern.de/bib-info/volltexte//2013/1439/
Ohne das Abstract rätselt man allzu sehr herum.
"Ausgangspunkt war die Erstellung einer Art „Fakultätsbibliographie“ durch die Verzeichnung der Aufsätze der Dozenten im Bibliothekskatalog. Damit wurde 2005 begonnen, mittlerweile sind über 2500 Titel erfaßt. Seit 2009 werden auch Volltexte von Aufsätzen über den Katalog und eine Webseite angeboten.
Dieses Portal „Neuphilologie“ führt zu Zweitveröffentlichungen („Grüner Weg“) von derzeit fast 600 wissenschaftlichen Aufsätzen von Dozenten der Tübinger Philosophischen Fakultät. Dabei werden die Texte in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek auf deren Publikationsserver veröffentlicht, mit Schlagwörtern versehen und im Katalog des „Südwestdeutschen Bibliotheksverbunds“ verzeichnet. Die Titelaufnahme liefert also per Hyperlink unmittelbar den Volltext, und dies nicht nur im Tübinger Katalog, sondern auch in den Katalogen aller wissenschaftlichen Bibliotheken des Verbundraumes (der mehr als 1.200 Bibliotheken aus den Regionen Baden-Württemberg, Saarland und Sachsen sowie weitere Spezialbibliotheken wie die des „Goethe-Instituts“ umfaßt). Darüber hinaus erfolgt eine Indexierung durch Suchmaschinen.
Zur Vereinfachung des Veröffentlichungs-Verfahrens wird ein Herausgebervertrag zugrunde gelegt.
Äußerst zeitaufwendig gestaltete sich die Einwerbung der Aufsätze, sie erforderte sehr viel persönliche Ansprache.
Gezeigt werden soll, daß sich der Aufwand auch für eine kleinere Bibliothek lohnt, Forschung und Lehre gefördert und nicht zuletzt das Renommee aller beteiligten Einrichtung verbessert werden."
Grüner Open Access wird also auf Institutsbibliotheks-Ebene durch persönliche Ansprache der Wissenschaftler gefördert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/portal/neuphil/?la=de
Altgermanisten finden beispielsweise viele Aufsätze Ridders. Für mich besonders wertvoll zwei wichtige Forschungsbeiträge Paul Sapplers zum "Friedrich von Schwaben", die jetzt auch online verfügbar sind.
KlausGraf - am Mittwoch, 20. März 2013, 23:16 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Website wurde erneuert.
http://blog.cibera.de/2013/03/20/biblioteca-digital-hispanica-vereinfacht-den-zugang/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
http://blog.cibera.de/2013/03/20/biblioteca-digital-hispanica-vereinfacht-den-zugang/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
KlausGraf - am Mittwoch, 20. März 2013, 23:09 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sie wurde 1918 versteigert:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hirsch1918_05_27
Zu den deutschsprachigen Handschriften:
http://www.handschriftencensus.de/hss/Privat (unter Antiquariat Emil Hirsch, NICHT Piloty zu finden)
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hirsch1918_05_27
Zu den deutschsprachigen Handschriften:
http://www.handschriftencensus.de/hss/Privat (unter Antiquariat Emil Hirsch, NICHT Piloty zu finden)
KlausGraf - am Mittwoch, 20. März 2013, 23:04 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Am 18. Februar habe ich mit der Sammlung der Digitalisate begonnen:
http://archiv.twoday.net/stories/264164073/
Zuletzt digitalisierte mir die ULB Düsseldorf die Rektoratsrede von 1904:
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/id/5167349
Philip Rosin (Bonn) irrt sich, wenn er in seinem Artikel im Portal Rheinische Geschichte schreibt:
Beyerhaus, Gisbert, Friedrich von Bezolds innere Entwicklung, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 1 (1931), S. 321-338 [mit vollständigem Werkverzeichnis].
Rosin hat die doch recht ausführliche Würdigung Bezolds im JfL 1980 von Waltraud Riesinger und Heidrun Marquardt-Rabiger übersehen, die mit ihren Ergänzungen zur Bibliographie von Beyerhaus ihr Urteil belegen können, dass die Bibliographie von Beyerhaus "allzu unvollständig" blieb:
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00048829/image_235
Wer vergleicht, wird feststellen, dass man auch die Bibliographie der beiden Autorinnen anhand meiner Neufunde "allzu unvollständig" nennen könnte. Die Ergänzungen entstammen diversen Quellen: vor allem intensiven Suchen in Google Books, dem Regesta-Imperii-Opac und einem PDF der Berliner Akademiebibliothek.
Es ist natürlich möglich, dass etwa im Bereich der Rezensionen etliche Ergänzungen zu erwarten sind. Und auch bei den Aufsätzen ist das nicht ausgeschlossen. Sie können dann in Wikisource von jedem nachgetragen und mit Digitalisaten verlinkt werden. Insofern könnte man dann auch Wikisource als "allzu unvollständig" schmähen.
Nicht vollständig nachgewiesen sind die Erstdrucke zu den im Sammelband "Aus Mittelalter und Reformation" enthaltenen Aufsätzen, was mich aber nicht wirklich schlimm dünkt.
Freie Digitalisate konnten ohne weiteres verlinkt werden, bei mit US-Proxy zugänglichen Werken konnte ich auf bewährte Hilfe von dritter Seite zurückgreifen. Untergebracht wurden die Ergänzungen teils im Internet Archive, teils auf Wikimedia Commons. Einige Aufsätze wurden aus DigiZeitschriften befreit.
Während die UB Erlangen sich schmählich dem Unternehmen verweigerte
http://archiv.twoday.net/stories/285826807/
habe ich einigen Institutionen und deren Mitarbeitern zu danken, die Digitalisate kostenlos zur Verfügung stellten oder Hinweise gaben:
Bibliothek der BBAW (besonders großzügig bei den Scans)
UB Bonn (Hinweise)
ULB Düsseldorf
UB Köln
Zwei Wikipedianer organisierten Scans zu zwei Schriften.
Wer sich künftig mit der intellektuellen Produktion Friedrichs von Bezold auseinandersetzen möchte, hat mit der Liste in Wikisource nunmehr einen exzellenten Ausgangspunkt.
http://archiv.twoday.net/stories/264164073/
Zuletzt digitalisierte mir die ULB Düsseldorf die Rektoratsrede von 1904:
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/id/5167349
Philip Rosin (Bonn) irrt sich, wenn er in seinem Artikel im Portal Rheinische Geschichte schreibt:
Beyerhaus, Gisbert, Friedrich von Bezolds innere Entwicklung, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 1 (1931), S. 321-338 [mit vollständigem Werkverzeichnis].
Rosin hat die doch recht ausführliche Würdigung Bezolds im JfL 1980 von Waltraud Riesinger und Heidrun Marquardt-Rabiger übersehen, die mit ihren Ergänzungen zur Bibliographie von Beyerhaus ihr Urteil belegen können, dass die Bibliographie von Beyerhaus "allzu unvollständig" blieb:
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00048829/image_235
Wer vergleicht, wird feststellen, dass man auch die Bibliographie der beiden Autorinnen anhand meiner Neufunde "allzu unvollständig" nennen könnte. Die Ergänzungen entstammen diversen Quellen: vor allem intensiven Suchen in Google Books, dem Regesta-Imperii-Opac und einem PDF der Berliner Akademiebibliothek.
Es ist natürlich möglich, dass etwa im Bereich der Rezensionen etliche Ergänzungen zu erwarten sind. Und auch bei den Aufsätzen ist das nicht ausgeschlossen. Sie können dann in Wikisource von jedem nachgetragen und mit Digitalisaten verlinkt werden. Insofern könnte man dann auch Wikisource als "allzu unvollständig" schmähen.
Nicht vollständig nachgewiesen sind die Erstdrucke zu den im Sammelband "Aus Mittelalter und Reformation" enthaltenen Aufsätzen, was mich aber nicht wirklich schlimm dünkt.
Freie Digitalisate konnten ohne weiteres verlinkt werden, bei mit US-Proxy zugänglichen Werken konnte ich auf bewährte Hilfe von dritter Seite zurückgreifen. Untergebracht wurden die Ergänzungen teils im Internet Archive, teils auf Wikimedia Commons. Einige Aufsätze wurden aus DigiZeitschriften befreit.
Während die UB Erlangen sich schmählich dem Unternehmen verweigerte
http://archiv.twoday.net/stories/285826807/
habe ich einigen Institutionen und deren Mitarbeitern zu danken, die Digitalisate kostenlos zur Verfügung stellten oder Hinweise gaben:
Bibliothek der BBAW (besonders großzügig bei den Scans)
UB Bonn (Hinweise)
ULB Düsseldorf
UB Köln
Zwei Wikipedianer organisierten Scans zu zwei Schriften.
Wer sich künftig mit der intellektuellen Produktion Friedrichs von Bezold auseinandersetzen möchte, hat mit der Liste in Wikisource nunmehr einen exzellenten Ausgangspunkt.
KlausGraf - am Mittwoch, 20. März 2013, 22:11 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wir wollen es nicht hoffen:
http://schmalenstroer.net/blog/2013/03/ist-google-scholar-gefahrdet/
Besonders einflussreich war die Kritik von Jacsó 2005:
http://scholar.google.de/scholar?cites=15073117673858897728&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=de
http://schmalenstroer.net/blog/2013/03/ist-google-scholar-gefahrdet/
Besonders einflussreich war die Kritik von Jacsó 2005:
http://scholar.google.de/scholar?cites=15073117673858897728&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=de
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Johann Andreas Christian Löhr: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend, nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig [1–]2. Band 1, Leipzig [ca. 1819/20].
Erstdruck: Leipzig (Gerhard Fleischer d. Jüng.) ca. 1819/20.
Zu dieser Quelle bemerkte Hans-Jörg Uther in seiner Märchen-CD:
"1819/20
Das zweibändige »Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend« erscheint. Es umfaßt Erzählungen, darunter Märchen, Schwänke und moralische Geschichten. Löhr bietet eine Auswahl aus französischen Feenmärchen, Märchen von Perrault, Geschichten aus »Tausendundeiner Nacht,« Märchen von Wieland, Fouqué, den Brüdern Grimm und A.L. Grimm. Seine Bearbeitung zielt auf kindgerechte Fassungen ab. Wichtig ist ihm eine moralische Nutzanweisung."
Bei zeno.org liegen beide Bände, aber nur als E-Texte ohne Faksmiles vor:
http://www.zeno.org/Literatur/M/L%C3%B6hr,+Johann+Andreas+Christian/M%C3%A4rchen/Das+Buch+der+M%C3%A4hrchen
Die UB Braunschweig hat freundlicherweise den ersten Band für Wikisource digitalisiert:
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050423
Zum Autor:
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Andreas_Christian_L%C3%B6hr
S. 250-269 "Das Galgenmännlein, oder der böse Geist im Glase" ist eine Bearbeitung von Fouqués Erzählung "Das Galgenmännlein".
Diesen Titel trägt sie in den Neuen Erzählungen von 1814:
http://books.google.de/books?id=kgVLAAAAcAAJ&pg=PA101
Die Erstausgabe im Pantheon von 1810 trug den Titel "Eine Geschichte vom Galgenmännlein":
http://books.google.de/books?id=Jv4aAAAAYAAJ&pg=PA198
bzw.
http://books.google.de/books?id=JrQAAAAAYAAJ&pg=PA198
Nur auf die Erstausgabe von 1810 bezog sich der Nachdruck in der Iris 1826:
http://books.google.de/books?id=TWQsAQAAIAAJ&pg=PA905
E-Text nach der Ausgabe von 1996:
http://www.zeno.org/Literatur/M/Fouqu%C3%A9,+Friedrich+de+la+Motte/Erz%C3%A4hlungen/Eine+Geschichte+vom+Galgenm%C3%A4nnlein
Neuere Literatur zu Fouqués Galgenmännlein bei:
http://stephanreuthner.de/_friedrich_de_la_motte_fouque.html
Löhr war nicht der einzige, der Fouqués Werk als angebliche "Volkserzählung" wiedergab. Bei meinen Studien zu den Sagen des Raums Stuttgart stieß ich auf Wilhelm Binders angebliche "Volkssage", die sich an einen schwarzen Brunnen bei Schwaikheim in der Nähe von Winnenden knüpft.
Der schwarze Brunnen ist offenkundig der heutige "Teufelsbrunnen", zu dem es es mehrere dämonologische Erzählungen gibt:
http://www.heimatverein-schwaikheim.de/geschichte/sagen/frauengestalt/index.html
In meiner Sagenausgabe 1995 dokumentierte ich als Nr. 260 den Anfang von Binders Erzählung mit der lokalen Situierung, um dann auf eine ungedruckte Zusammenfassung von Binders Geschichte durch den Sagensammler Ernst Meier (um 1850) überzuwechseln:
http://books.google.de/books?id=DCbaAAAAMAAJ&pg=PA208
Ich stellte fest, dass Binder lediglich Fouqués Erzählung ausschrieb.
Die vorhergehende Nr. 259 meiner Sagenausgabe betrifft die Geistererscheinungen am Teufelsbrunnen (Text aus Justinus Kerners Magikon 1840, im Auszug):
http://books.google.de/books?id=PHEAAAAAMAAJ&pg=PA162
Binders vermeintliche Volkssagen wurden sowohl als "alemannische" als auch als "schwäbische" textidentisch publiziert.
Binder: Alemannische Volkssagen [...], Stuttgart 1842
http://books.google.de/books?id=6mIAAAAAcAAJ&pg=PA51
=
http://books.google.de/books?id=1jwKAQAAMAAJ&pg=PA51
Schwäbische Volkssagen [...], Stuttgart 1845
http://books.google.de/books?id=oWIAAAAAcAAJ&pg=PA51
Während bei Volkskundlern vor allem noch die unsägliche Innsbrucker Petzoldt-Schule ganz und gar veralteteten Auffassungen über "Volkserzählungen" huldigt, haben einige, auch renommierte Germanisten kaum etwas vom neuen Wind der Sagenforschung mitbekommen. Ich darf der Kürze halber nur auf meine eigenen Publikationen dazu verweisen:
http://archiv.twoday.net/stories/4990762/
Der hochgelobte Märchenforscher Heinz Rölleke durfte in der Enzyklopädie des Märchens (Bd. 5, 1987) den Artikel Fouqué schreiben, in dem man doch sage und schreibe liest, Fouqué hätten Grimmelshausen und eine alemannische Volkssage vorgelegen:
http://books.google.de/books?id=5Dia4uoaJZQC&pg=PR26
Als Beleg wird auf Schlossers unkritische Dissertation zum Galgenmännlein von 1912 und das Handwörterbuch des Aberglaubens (s.v. Alraun) verwiesen, wo aber nichts zu dieser Abhängigkeit steht. Schlosser ist bei HathiTrust mit US-Proxy einsehbar:
http://hdl.handle.net/2027/wu.89094595279
[= http://archive.org/stream/SchlosserDieSageVomGalgenmaennlein#page/n73/mode/2up ]
[Grimmelshausens Galgen-Männlein:
http://digital.blb-karlsruhe.de/id/18961 ]
S. 75 behauptet Schlosser, Fouqué "dürfte" den Stoff der von Schlosser früher erwähnten Geschichte des Ulmer Kaufmannssohnes Dichard entnommen haben (ein Fehler Schlossers, bei Binder heißt er Richard), da dort auch ein Halbheller als endgültige Ablösung vorkommt. S. 40 referiert Schlosser Binders Alemannische Volkssagen I, 51.
Das kehrt das historische Verhältnis genau um: Binder hat einfach aus Fouqués bekannter Erzählung eine bei dem sagenumwobenen Teufelsbrunnen (schwarzer Brunnen) lokalisierte "Volkssage" gemacht. Möglicherweise hat ihm den Stoff und/oder die Lokalisierung der bekannte Pfarrer Otmar Schönhuth vermittelt, der ihm laut Vorwort den Stoff überließ. Binder gestaltet einen als volkstümliche "Sage der Vorzeit" (miss)verstandenen Stoff literarisch und nennt das "Volkssage".
Obwohl Binders Sagen 1842 erschienen und die enge Abhängigkeit von Fouqué (Erstausgabe 1810) auf der Hand liegt (was Schlosser ja auch bemerkte, da er den Halbheller erwähnt), geht Schlosser Binders Sagen-Rhetorik im Vorwort auf den Leim und nimmt eine wirkliche Volkssage an - und Rölleke schreibt das unkritisch ab. Obwohl Rölleke es als exzellenter Quellenforscher insbesondere bei den Grimm'schen Märchen und dem Wunderhorn wirklich besser wissen sollte, bleibt er wiederholt in seinen Publikationen (unsäglich etwa als kommerzielles Produkt: "Das große deutsche Sagenbuch") dem veralteten Sagen-Klischee verhaftet, das den literarischen Einfluss auf sogenannte "Volkssagen" unterschätzt.
Gut denkbar, dass Rölleke einfach Max 1980 gefolgt ist, für den die konkrete Ausformung des Motivs "auf eine alemannische Volkssage" zurückging (mit vorsichtigem "dürfte"), wobei sich Max ganz auf Schlosser gestützt hat.
http://books.google.de/books?id=DqIqAAAAYAAJ&&q=alemannische
Rölleke könnte aus Platzgründen auf diese Literaturangabe verzichtet haben, hat aber durch die apodiktische Formulierung ("die ... zurückgeht") eindeutig der Forschung geschadet.
Fassen wir zusammen: Es ist pure Spekulation, dass Quelle von Fouqués Galgenmännlein neben Grimmelshausen eine "Volkssage" gewesen ist, denn die spätere Fassung bei Binder 1842 ist von Fouqué abhängig und keine "alemannische Volkssage". Wilhelm Binder hat ebenso wie Löhr Fouqués Erzählung als "Volkspoesie" verstanden, die - ohne Hinweis auf Fouqué - frei bearbeitet werden durfte.
Update: Das richtige Verhältnis Fouqué-Binder hat schon erkannt: Wieden, Brage bei der: Zu Fouqués "Galgenmännlein". In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 227 (=142) (1990), S. 323-327, hier S. 323f. "Schönhuth hat, Binder vermutlich täuschend, eine Kunstsage, nämlich die Erzählung Fouqués, zur Volkssage gemacht" (S. 324). Er verweist darauf, dass im Winnender Heimatbuch von Gotthold Börner 1923 nichts über die Sage vom Galgenmännlein steht, obwohl ausführlich vom schwarzen Brunnen (=Teufelsbrunnen) die Rede sei.
#forschung

Erstdruck: Leipzig (Gerhard Fleischer d. Jüng.) ca. 1819/20.
Zu dieser Quelle bemerkte Hans-Jörg Uther in seiner Märchen-CD:
"1819/20
Das zweibändige »Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend« erscheint. Es umfaßt Erzählungen, darunter Märchen, Schwänke und moralische Geschichten. Löhr bietet eine Auswahl aus französischen Feenmärchen, Märchen von Perrault, Geschichten aus »Tausendundeiner Nacht,« Märchen von Wieland, Fouqué, den Brüdern Grimm und A.L. Grimm. Seine Bearbeitung zielt auf kindgerechte Fassungen ab. Wichtig ist ihm eine moralische Nutzanweisung."
Bei zeno.org liegen beide Bände, aber nur als E-Texte ohne Faksmiles vor:
http://www.zeno.org/Literatur/M/L%C3%B6hr,+Johann+Andreas+Christian/M%C3%A4rchen/Das+Buch+der+M%C3%A4hrchen
Die UB Braunschweig hat freundlicherweise den ersten Band für Wikisource digitalisiert:
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050423
Zum Autor:
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Andreas_Christian_L%C3%B6hr
S. 250-269 "Das Galgenmännlein, oder der böse Geist im Glase" ist eine Bearbeitung von Fouqués Erzählung "Das Galgenmännlein".
Diesen Titel trägt sie in den Neuen Erzählungen von 1814:
http://books.google.de/books?id=kgVLAAAAcAAJ&pg=PA101
Die Erstausgabe im Pantheon von 1810 trug den Titel "Eine Geschichte vom Galgenmännlein":
http://books.google.de/books?id=Jv4aAAAAYAAJ&pg=PA198
bzw.
http://books.google.de/books?id=JrQAAAAAYAAJ&pg=PA198
Nur auf die Erstausgabe von 1810 bezog sich der Nachdruck in der Iris 1826:
http://books.google.de/books?id=TWQsAQAAIAAJ&pg=PA905
E-Text nach der Ausgabe von 1996:
http://www.zeno.org/Literatur/M/Fouqu%C3%A9,+Friedrich+de+la+Motte/Erz%C3%A4hlungen/Eine+Geschichte+vom+Galgenm%C3%A4nnlein
Neuere Literatur zu Fouqués Galgenmännlein bei:
http://stephanreuthner.de/_friedrich_de_la_motte_fouque.html
Löhr war nicht der einzige, der Fouqués Werk als angebliche "Volkserzählung" wiedergab. Bei meinen Studien zu den Sagen des Raums Stuttgart stieß ich auf Wilhelm Binders angebliche "Volkssage", die sich an einen schwarzen Brunnen bei Schwaikheim in der Nähe von Winnenden knüpft.
Der schwarze Brunnen ist offenkundig der heutige "Teufelsbrunnen", zu dem es es mehrere dämonologische Erzählungen gibt:
http://www.heimatverein-schwaikheim.de/geschichte/sagen/frauengestalt/index.html
In meiner Sagenausgabe 1995 dokumentierte ich als Nr. 260 den Anfang von Binders Erzählung mit der lokalen Situierung, um dann auf eine ungedruckte Zusammenfassung von Binders Geschichte durch den Sagensammler Ernst Meier (um 1850) überzuwechseln:
http://books.google.de/books?id=DCbaAAAAMAAJ&pg=PA208
Ich stellte fest, dass Binder lediglich Fouqués Erzählung ausschrieb.
Die vorhergehende Nr. 259 meiner Sagenausgabe betrifft die Geistererscheinungen am Teufelsbrunnen (Text aus Justinus Kerners Magikon 1840, im Auszug):
http://books.google.de/books?id=PHEAAAAAMAAJ&pg=PA162
Binders vermeintliche Volkssagen wurden sowohl als "alemannische" als auch als "schwäbische" textidentisch publiziert.
Binder: Alemannische Volkssagen [...], Stuttgart 1842
http://books.google.de/books?id=6mIAAAAAcAAJ&pg=PA51
=
http://books.google.de/books?id=1jwKAQAAMAAJ&pg=PA51
Schwäbische Volkssagen [...], Stuttgart 1845
http://books.google.de/books?id=oWIAAAAAcAAJ&pg=PA51
Während bei Volkskundlern vor allem noch die unsägliche Innsbrucker Petzoldt-Schule ganz und gar veralteteten Auffassungen über "Volkserzählungen" huldigt, haben einige, auch renommierte Germanisten kaum etwas vom neuen Wind der Sagenforschung mitbekommen. Ich darf der Kürze halber nur auf meine eigenen Publikationen dazu verweisen:
http://archiv.twoday.net/stories/4990762/
Der hochgelobte Märchenforscher Heinz Rölleke durfte in der Enzyklopädie des Märchens (Bd. 5, 1987) den Artikel Fouqué schreiben, in dem man doch sage und schreibe liest, Fouqué hätten Grimmelshausen und eine alemannische Volkssage vorgelegen:
http://books.google.de/books?id=5Dia4uoaJZQC&pg=PR26
Als Beleg wird auf Schlossers unkritische Dissertation zum Galgenmännlein von 1912 und das Handwörterbuch des Aberglaubens (s.v. Alraun) verwiesen, wo aber nichts zu dieser Abhängigkeit steht. Schlosser ist bei HathiTrust mit US-Proxy einsehbar:
http://hdl.handle.net/2027/wu.89094595279
[= http://archive.org/stream/SchlosserDieSageVomGalgenmaennlein#page/n73/mode/2up ]
[Grimmelshausens Galgen-Männlein:
http://digital.blb-karlsruhe.de/id/18961 ]
S. 75 behauptet Schlosser, Fouqué "dürfte" den Stoff der von Schlosser früher erwähnten Geschichte des Ulmer Kaufmannssohnes Dichard entnommen haben (ein Fehler Schlossers, bei Binder heißt er Richard), da dort auch ein Halbheller als endgültige Ablösung vorkommt. S. 40 referiert Schlosser Binders Alemannische Volkssagen I, 51.
Das kehrt das historische Verhältnis genau um: Binder hat einfach aus Fouqués bekannter Erzählung eine bei dem sagenumwobenen Teufelsbrunnen (schwarzer Brunnen) lokalisierte "Volkssage" gemacht. Möglicherweise hat ihm den Stoff und/oder die Lokalisierung der bekannte Pfarrer Otmar Schönhuth vermittelt, der ihm laut Vorwort den Stoff überließ. Binder gestaltet einen als volkstümliche "Sage der Vorzeit" (miss)verstandenen Stoff literarisch und nennt das "Volkssage".
Obwohl Binders Sagen 1842 erschienen und die enge Abhängigkeit von Fouqué (Erstausgabe 1810) auf der Hand liegt (was Schlosser ja auch bemerkte, da er den Halbheller erwähnt), geht Schlosser Binders Sagen-Rhetorik im Vorwort auf den Leim und nimmt eine wirkliche Volkssage an - und Rölleke schreibt das unkritisch ab. Obwohl Rölleke es als exzellenter Quellenforscher insbesondere bei den Grimm'schen Märchen und dem Wunderhorn wirklich besser wissen sollte, bleibt er wiederholt in seinen Publikationen (unsäglich etwa als kommerzielles Produkt: "Das große deutsche Sagenbuch") dem veralteten Sagen-Klischee verhaftet, das den literarischen Einfluss auf sogenannte "Volkssagen" unterschätzt.
Gut denkbar, dass Rölleke einfach Max 1980 gefolgt ist, für den die konkrete Ausformung des Motivs "auf eine alemannische Volkssage" zurückging (mit vorsichtigem "dürfte"), wobei sich Max ganz auf Schlosser gestützt hat.
http://books.google.de/books?id=DqIqAAAAYAAJ&&q=alemannische
Rölleke könnte aus Platzgründen auf diese Literaturangabe verzichtet haben, hat aber durch die apodiktische Formulierung ("die ... zurückgeht") eindeutig der Forschung geschadet.
Fassen wir zusammen: Es ist pure Spekulation, dass Quelle von Fouqués Galgenmännlein neben Grimmelshausen eine "Volkssage" gewesen ist, denn die spätere Fassung bei Binder 1842 ist von Fouqué abhängig und keine "alemannische Volkssage". Wilhelm Binder hat ebenso wie Löhr Fouqués Erzählung als "Volkspoesie" verstanden, die - ohne Hinweis auf Fouqué - frei bearbeitet werden durfte.
Update: Das richtige Verhältnis Fouqué-Binder hat schon erkannt: Wieden, Brage bei der: Zu Fouqués "Galgenmännlein". In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 227 (=142) (1990), S. 323-327, hier S. 323f. "Schönhuth hat, Binder vermutlich täuschend, eine Kunstsage, nämlich die Erzählung Fouqués, zur Volkssage gemacht" (S. 324). Er verweist darauf, dass im Winnender Heimatbuch von Gotthold Börner 1923 nichts über die Sage vom Galgenmännlein steht, obwohl ausführlich vom schwarzen Brunnen (=Teufelsbrunnen) die Rede sei.
#forschung

KlausGraf - am Mittwoch, 20. März 2013, 19:30 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Während einer internationalen Tagung vom 18. – 20. März 2013 in Göteborg
wurde offiziell die „Research Data Alliance“ (RDA) gegründet. Diese
globale Initiative, derzeit maßgeblich getragen von der National Science
Foundation (NSF), der Europäischen Kommission (Projekt iCordi) und des
Australian National Data Service (ANDS), hat es sich zur Aufgabe gemacht,
Innovation und Erkenntnisgewinn in der Wissenschaft durch international
abgestimmte Maßnahmen für einen besseren Umgang mit Forschungsdaten zu
unterstützen. Im Vordergrund steht das Ziel, Forschungsdaten in
koordinierter Weise zu sichern und für eine zukünftige Nachnutzung
bereitzustellen. Dies soll durch international abgestimmte Beiträge zur
technischen Entwicklung, zu Regelwerken und Normen und durch eine
Unterstützung in der praktischen Umsetzung erreicht werden."
(Forschungsdaten Mailingliste)
http://rd-alliance.org/
wurde offiziell die „Research Data Alliance“ (RDA) gegründet. Diese
globale Initiative, derzeit maßgeblich getragen von der National Science
Foundation (NSF), der Europäischen Kommission (Projekt iCordi) und des
Australian National Data Service (ANDS), hat es sich zur Aufgabe gemacht,
Innovation und Erkenntnisgewinn in der Wissenschaft durch international
abgestimmte Maßnahmen für einen besseren Umgang mit Forschungsdaten zu
unterstützen. Im Vordergrund steht das Ziel, Forschungsdaten in
koordinierter Weise zu sichern und für eine zukünftige Nachnutzung
bereitzustellen. Dies soll durch international abgestimmte Beiträge zur
technischen Entwicklung, zu Regelwerken und Normen und durch eine
Unterstützung in der praktischen Umsetzung erreicht werden."
(Forschungsdaten Mailingliste)
http://rd-alliance.org/
KlausGraf - am Mittwoch, 20. März 2013, 16:24 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Hier spricht der Administrator in seiner zu Testzwecken angelegten Narrenkappe. Zugleich begrüße ich mein unangemeldetes Doppel Spamritter.
Beiträge können alle registrierten Benutzer anlegen. Die Registrierung ist einfach, man muss (neben Überwindung eines Captchas) seine Mail angeben und mit dieser Mailadresse die Anmeldung bestätigen.
Kommentieren kann man auch ohne Anmeldung, man muss dann ein mitunter lästiges Captcha oder sogar mehrere überwinden, kann dann aber nicht auf den angelegten Beitrag erneut zugreifen, um ihn zu ändern, falls man sich vertippt hat.
Ist man dagegen angemeldet und eingeloggt, kann man frühere Beiträge ändern oder sogar löschen.
Löschen sollte nur bei einem absolut zwingenden Grund erfolgen, verhindern kann ich es nicht, nur missbilligen.
Ändern kann ich keine Kommentare (anders als Beiträge, die ich aber allenfalls minimal oder mit ausdrücklicher Kennzeichnung ändere). Änderungen durch den Kommentator sollten so erfolgen, dass der Diskussionsverlauf sinnvoll bleibt.
Wer uneingeloggt kommentiert und etwas ändern möchte, geht am besten wie folgt vor: Er schreibt den Beitrag neu und einen zweiten, in dem er um Löschung des fehlerhaften bittet. Eine sofortige Mailbenachrichtigung an mich (Kontaktdaten siehe IMPRESSUM, das im MENU versteckt ist) ist unschädlich, wird jedoch dann sinnvoll, wenn ich nach einigen Tagen noch nicht reagiert habe.
Soll ein Kommentar gelöscht werden, ist mir der zwingende Grund per Mail mitzuteilen.
Beiträge können alle registrierten Benutzer anlegen. Die Registrierung ist einfach, man muss (neben Überwindung eines Captchas) seine Mail angeben und mit dieser Mailadresse die Anmeldung bestätigen.
Kommentieren kann man auch ohne Anmeldung, man muss dann ein mitunter lästiges Captcha oder sogar mehrere überwinden, kann dann aber nicht auf den angelegten Beitrag erneut zugreifen, um ihn zu ändern, falls man sich vertippt hat.
Ist man dagegen angemeldet und eingeloggt, kann man frühere Beiträge ändern oder sogar löschen.
Löschen sollte nur bei einem absolut zwingenden Grund erfolgen, verhindern kann ich es nicht, nur missbilligen.
Ändern kann ich keine Kommentare (anders als Beiträge, die ich aber allenfalls minimal oder mit ausdrücklicher Kennzeichnung ändere). Änderungen durch den Kommentator sollten so erfolgen, dass der Diskussionsverlauf sinnvoll bleibt.
Wer uneingeloggt kommentiert und etwas ändern möchte, geht am besten wie folgt vor: Er schreibt den Beitrag neu und einen zweiten, in dem er um Löschung des fehlerhaften bittet. Eine sofortige Mailbenachrichtigung an mich (Kontaktdaten siehe IMPRESSUM, das im MENU versteckt ist) ist unschädlich, wird jedoch dann sinnvoll, wenn ich nach einigen Tagen noch nicht reagiert habe.
Soll ein Kommentar gelöscht werden, ist mir der zwingende Grund per Mail mitzuteilen.
Dummerjahn - am Mittwoch, 20. März 2013, 15:43 - Rubrik: Allgemeines
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
(vgl. http://archiv.twoday.net/stories/285826607/)
Mit dem Beginn des Archivtages begann sich der Blog (https://www.lwl.org/LWL/Kultur/Archivamt/westfaelischer-archivtag-blog/) schlagartig zu füllen. Allerdings hat er nun die Anmutung eines flickr/twitter-Accounts. Zu jedem Vortrag wird ein Foto zusammen mit 1-2 Sätzen vorgestellt.
Negativ: Als Ferngebliebener erfahre ich auch nicht mehr als ohne ich ohne das Weblog erfahren hätte. "Sternchen-Bewertungen" kann man nicht mehr zurücknehmen. Kommentieren ist nicht vorgesehen.
Positiv: Durch stetiges Posten wirkt die LWL-Seite etwas lebendiger. Und vor allem: Besser als gar nichts. Vielleicht erleben wir ja den Beginn einer sehr guten Tradition, die eines Tages die teuren und viel zu spät erscheinenden Tagungsbände ablöst?
Mit dem Beginn des Archivtages begann sich der Blog (https://www.lwl.org/LWL/Kultur/Archivamt/westfaelischer-archivtag-blog/) schlagartig zu füllen. Allerdings hat er nun die Anmutung eines flickr/twitter-Accounts. Zu jedem Vortrag wird ein Foto zusammen mit 1-2 Sätzen vorgestellt.
Negativ: Als Ferngebliebener erfahre ich auch nicht mehr als ohne ich ohne das Weblog erfahren hätte. "Sternchen-Bewertungen" kann man nicht mehr zurücknehmen. Kommentieren ist nicht vorgesehen.
Positiv: Durch stetiges Posten wirkt die LWL-Seite etwas lebendiger. Und vor allem: Besser als gar nichts. Vielleicht erleben wir ja den Beginn einer sehr guten Tradition, die eines Tages die teuren und viel zu spät erscheinenden Tagungsbände ablöst?
jaymz1980 - am Mittwoch, 20. März 2013, 00:22 - Rubrik: Weblogs
http://archive.org/details/ArchivinventareDerKatholischenPfarreienInDerDioezeseWuerzburg
Das voluminöse Werk von August Amrhein (1914) war bei HathiTrust nur mit Proxy einsehbar.
Besprechung in den GGA 1916:
http://archive.org/stream/GoettingischeGelehrteAnzeigen1916#page/n565/mode/2up
Das voluminöse Werk von August Amrhein (1914) war bei HathiTrust nur mit Proxy einsehbar.
Besprechung in den GGA 1916:
http://archive.org/stream/GoettingischeGelehrteAnzeigen1916#page/n565/mode/2up
KlausGraf - am Dienstag, 19. März 2013, 21:45 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/Stellungnahme-BMJ-UrhG_2013-3-15-def1.pdf
Via
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Max-Planck-Institut-kritisiert-geplante-Urheberrechtsreform-1826094.html
Kritisiert wird deutlich die "green road" of Open Access und der Glauben an Repositorien.
Via
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Max-Planck-Institut-kritisiert-geplante-Urheberrechtsreform-1826094.html
Kritisiert wird deutlich die "green road" of Open Access und der Glauben an Repositorien.
KlausGraf - am Dienstag, 19. März 2013, 21:01 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=4361465&custom_att_2=simple_viewer
Die nicht vor 1567 entstandene Handschrift enthält auch ein historisches Lied auf den Augsburger Bürgermeister Ulrich Schwarz und seinen Prozess 1478. Zu Schwarz:
http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_04229.html
Handschriftenbeschreibung von Karin Schneider:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0148_a084_JPG.htm
Die nicht vor 1567 entstandene Handschrift enthält auch ein historisches Lied auf den Augsburger Bürgermeister Ulrich Schwarz und seinen Prozess 1478. Zu Schwarz:
http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_04229.html
Handschriftenbeschreibung von Karin Schneider:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0148_a084_JPG.htm
KlausGraf - am Dienstag, 19. März 2013, 20:54 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-37876
Die Handschrift aus dem 14. Jahrhundert (Karlsruhe Cod. Donaueschingen 74) enthält:
Rudolf von Ems: 'Willehalm von Orlens' (D) [= S. 1-88]
Konrad von Fußesbrunnen: 'Kindheit Jesu' (C) [= S. 89-118]
Konrad von Heimesfurt: 'Unser vrouwen hinvart' (A) [= S. 118-129]
'Sigenot' (S1) [= S. 130-132]
'Eckenlied' (E2) [= S. 132-148]
http://www.handschriftencensus.de/1849
Lassbergs Sigenot-Ausgabe (aus dieser Handschrift) wurde nach dem Exemplar in meiner Bibliothek aus der aufgelösten Liebenstein'schen Bibliothek zu Jebenhausen für Wikimedia Commons gescannt:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Meister_Seppen_von_Eppishusen_Sigenot
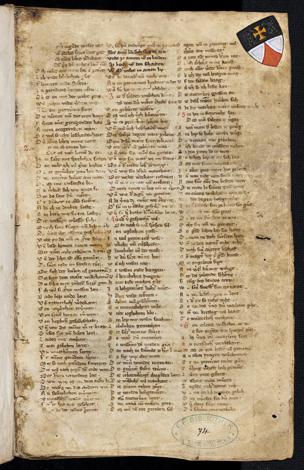
Die Handschrift aus dem 14. Jahrhundert (Karlsruhe Cod. Donaueschingen 74) enthält:
Rudolf von Ems: 'Willehalm von Orlens' (D) [= S. 1-88]
Konrad von Fußesbrunnen: 'Kindheit Jesu' (C) [= S. 89-118]
Konrad von Heimesfurt: 'Unser vrouwen hinvart' (A) [= S. 118-129]
'Sigenot' (S1) [= S. 130-132]
'Eckenlied' (E2) [= S. 132-148]
http://www.handschriftencensus.de/1849
Lassbergs Sigenot-Ausgabe (aus dieser Handschrift) wurde nach dem Exemplar in meiner Bibliothek aus der aufgelösten Liebenstein'schen Bibliothek zu Jebenhausen für Wikimedia Commons gescannt:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Meister_Seppen_von_Eppishusen_Sigenot
KlausGraf - am Dienstag, 19. März 2013, 20:43 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.librarian.net/stax/4058/lacma-launches-new-collection-site-with-20k-public-domain-images/
http://lacma.wordpress.com/2013/03/14/what-do-cats-have-to-do-with-it-welcome-to-our-new-collections-website/
"Why would a museum give away images of its art? As Michael Govan often says, it’s because our mission is to care for and share those works of art with the broadest possible public. The logical, radical extension of that is to open up our treasure trove of images. "
Die Terms of use https://www.lacma.org/about/contact-us/terms-use sind so unklar, dass ich sie erst beim zweiten Lesen verstanden habe. Wenn Content gekennzeichnet ist mit "Public Domain High Resolution Image Available", verzichtet das Museum offenkundig auch auf das ihm zustehende Urheberrecht (US: Copyright) an Reproduktionen von 3-D-Vorlagen. Für Nutzer gilt hier nur die Verpflichtung zur Quellenangabe: "Users should cite the author/artist and source of the Public Domain High Resolution images as they would material from any printed or other work, and citation should include the URL www.lacma.org in addition to all other proprietary notices, if any, provided with the Public Domain High Resolution images." Das "should" deutet an, dass das Museum wohl nicht gegen Verstöße vorgehen wird. Anderer Content, nämlich der Protected Content (wozu auch Public-Domain-Werke gehören können), darf nur für nichtkommerzielle persönliche Zwecke genutzt werden.

http://lacma.wordpress.com/2013/03/14/what-do-cats-have-to-do-with-it-welcome-to-our-new-collections-website/
"Why would a museum give away images of its art? As Michael Govan often says, it’s because our mission is to care for and share those works of art with the broadest possible public. The logical, radical extension of that is to open up our treasure trove of images. "
Die Terms of use https://www.lacma.org/about/contact-us/terms-use sind so unklar, dass ich sie erst beim zweiten Lesen verstanden habe. Wenn Content gekennzeichnet ist mit "Public Domain High Resolution Image Available", verzichtet das Museum offenkundig auch auf das ihm zustehende Urheberrecht (US: Copyright) an Reproduktionen von 3-D-Vorlagen. Für Nutzer gilt hier nur die Verpflichtung zur Quellenangabe: "Users should cite the author/artist and source of the Public Domain High Resolution images as they would material from any printed or other work, and citation should include the URL www.lacma.org in addition to all other proprietary notices, if any, provided with the Public Domain High Resolution images." Das "should" deutet an, dass das Museum wohl nicht gegen Verstöße vorgehen wird. Anderer Content, nämlich der Protected Content (wozu auch Public-Domain-Werke gehören können), darf nur für nichtkommerzielle persönliche Zwecke genutzt werden.
KlausGraf - am Dienstag, 19. März 2013, 20:12 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.derwesten.de/politik/polizei-nimmt-nrw-piraten-fest-weil-er-laden-logo-fotografierte-id7741605.html
http://www1.wdr.de/themen/panorama/fotografierenhauptbahnhof102.html
http://www.internet-law.de/2013/03/das-fotografieren-im-offentlichen-raum-ist-gefahrlich.html
http://www.pottblog.de/2013/03/19/bundespolizei-setzt-im-kolner-hauptbahnhof-landtagsabgeordneten-der-piratenpartei-fest-weil-er-einen-rewe-to-go-laden-fotografiert-hat/
Unglaublich!
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/156271221/
http://archiv.twoday.net/stories/5262563/

http://www1.wdr.de/themen/panorama/fotografierenhauptbahnhof102.html
http://www.internet-law.de/2013/03/das-fotografieren-im-offentlichen-raum-ist-gefahrlich.html
http://www.pottblog.de/2013/03/19/bundespolizei-setzt-im-kolner-hauptbahnhof-landtagsabgeordneten-der-piratenpartei-fest-weil-er-einen-rewe-to-go-laden-fotografiert-hat/
Unglaublich!
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/156271221/
http://archiv.twoday.net/stories/5262563/

KlausGraf - am Dienstag, 19. März 2013, 19:27 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen