http://www.alemannisches-institut.de/cms/website.php?id=publikationen/volltexte.htm
Gutmann, Andre (2011/2013): Unter dem Wappen der Fidel. Die Herren von Wieladingen und die Herren vom Stein zwischen Ministerialität und adliger Herrschaft, unter Mitarbeit von Christopher Schmidberger (Forschungen zur Oberrheinischen Landesgeschichte, Bd. LV), Freiburg/ München 2011 (inkl. Errata 2013). Volltext (PDF / 4 MB)
Bauschke-Hartung, Ricarda (2010): Alemannische Minnesänger des 13. Jahrhunderts, in: Alemannisches Jahrbuch 2007/2008, S. 101-110. Volltext (PDF)
Bircher,
Patrick (2008): Architektur, Kunst und Kunsthandwerk des 17. und 18. Jahrhunderts im vorderösterreichischen
Herrschaftsgebiet am Hochrhein, in: Alemannisches Jahrbuch 2005/2006, S. 163-224. Volltext (PDF)
Streck, Tobias (2008): Vom Scheßlong zum Boddschamber und retur ... Französische Entlehnungen in den badischen Mundarten, in: Alemannisches Jahrbuch 2005/2006, S. 261-315. Volltext (PDF)
Stadelbauer, Jörg (2007): Kämpfer für Struktur, Standort und Profil des Alemannischen Instituts - Friedrich Metz (1938-1945; 1952-1962), in: Das Alemannische Institut. 75 Jahre grenzüberschreitende Kommunikation und Forschung (1931-2006), hg. v. Alemannischen Institut Freiburg i.Br. e.V., Freiburg/München 2007, S. 143-154. Volltext (PDF)
Klöckler, Jürgen (2007): Vom Alemannischen Institut zum „Oberrheinischen Institut für geschichtliche Landeskunde". Theodor Mayer als Wissenschaftsorganisator im „Dritten Reich", in: Das Alemannische Institut. 75 Jahre grenzüberschreitende Kommunikation und Forschung (1931-2006), hg. v. Alemannischen Institut Freiburg i.Br. e.V. (Veröffentlichung des Alemannischen Instituts Freiburg i. Br., Nr. 75), Freiburg/München 2007, S. 135-142. Volltext (PDF)
Eggenberger, Christoph (2003): Der Goldene Psalter und die Buchmalerei des Klosters St. Gallen, in: Alemannisches Jahrbuch 2001/2002, S. 63-84. Volltext (PDF)
Geuenich, Dieter (2003): Mönche und Konvent von St. Gallen in der Karolingerzeit, in: Alemannisches Jahrbuch 2001/2002, S. 39-62. Volltext (PDF)
Zettler, Alfons (2003): St. Gallen als Bischofs- und Königskloster, in: Alemannisches Jahrbuch 2001/2002, S. 23-38. Volltext (PDF)
Langenbeck, Fritz (1958): Die tung- und -hurst-Namen im Oberrheingebiet, in: Alemannisches Jahrbuch 1958, S. 51-108. (PDF / 3,4 MB)
Gutmann, Andre (2011/2013): Unter dem Wappen der Fidel. Die Herren von Wieladingen und die Herren vom Stein zwischen Ministerialität und adliger Herrschaft, unter Mitarbeit von Christopher Schmidberger (Forschungen zur Oberrheinischen Landesgeschichte, Bd. LV), Freiburg/ München 2011 (inkl. Errata 2013). Volltext (PDF / 4 MB)
Bauschke-Hartung, Ricarda (2010): Alemannische Minnesänger des 13. Jahrhunderts, in: Alemannisches Jahrbuch 2007/2008, S. 101-110. Volltext (PDF)
Bircher,
Patrick (2008): Architektur, Kunst und Kunsthandwerk des 17. und 18. Jahrhunderts im vorderösterreichischen
Herrschaftsgebiet am Hochrhein, in: Alemannisches Jahrbuch 2005/2006, S. 163-224. Volltext (PDF)
Streck, Tobias (2008): Vom Scheßlong zum Boddschamber und retur ... Französische Entlehnungen in den badischen Mundarten, in: Alemannisches Jahrbuch 2005/2006, S. 261-315. Volltext (PDF)
Stadelbauer, Jörg (2007): Kämpfer für Struktur, Standort und Profil des Alemannischen Instituts - Friedrich Metz (1938-1945; 1952-1962), in: Das Alemannische Institut. 75 Jahre grenzüberschreitende Kommunikation und Forschung (1931-2006), hg. v. Alemannischen Institut Freiburg i.Br. e.V., Freiburg/München 2007, S. 143-154. Volltext (PDF)
Klöckler, Jürgen (2007): Vom Alemannischen Institut zum „Oberrheinischen Institut für geschichtliche Landeskunde". Theodor Mayer als Wissenschaftsorganisator im „Dritten Reich", in: Das Alemannische Institut. 75 Jahre grenzüberschreitende Kommunikation und Forschung (1931-2006), hg. v. Alemannischen Institut Freiburg i.Br. e.V. (Veröffentlichung des Alemannischen Instituts Freiburg i. Br., Nr. 75), Freiburg/München 2007, S. 135-142. Volltext (PDF)
Eggenberger, Christoph (2003): Der Goldene Psalter und die Buchmalerei des Klosters St. Gallen, in: Alemannisches Jahrbuch 2001/2002, S. 63-84. Volltext (PDF)
Geuenich, Dieter (2003): Mönche und Konvent von St. Gallen in der Karolingerzeit, in: Alemannisches Jahrbuch 2001/2002, S. 39-62. Volltext (PDF)
Zettler, Alfons (2003): St. Gallen als Bischofs- und Königskloster, in: Alemannisches Jahrbuch 2001/2002, S. 23-38. Volltext (PDF)
Langenbeck, Fritz (1958): Die tung- und -hurst-Namen im Oberrheingebiet, in: Alemannisches Jahrbuch 1958, S. 51-108. (PDF / 3,4 MB)
KlausGraf - am Mittwoch, 15. Mai 2013, 20:41 - Rubrik: Open Access
Andre Gutmann teilt mit:
"nachdem mein im Herbst 2011 erschienes Buch "Unter dem
Wappen der Fidel" schon nach einem Jahr vergriffen war, ist
es seit einigen Tagen komplett mit allen Abbildungen und
Karten über die Homepage des Alemannischen Instituts als
PDF online verfügbar (4 MB), dazu gibt es noch ein kurzes
Online-Vorwort und zwei Errata-Seiten (auch wenn die
Markierungen im Text keine aktiven Links zu den Errata
sind, aber wohl doch zu benutzen).
Der Text ist unter folgender URL einsehbar bzw.
herunterladbar:
http://www.alemannisches-institut.de/html/img/pool/Gutmann_Wieladingen.pdf "
Ausgezeichnet!
Zum Inhalt: "Die Herren von Wieladingen und die Herren vom Stein verwalteten im 13. und 14. Jahrhundert als Meier des Damenstifts Säckingen dessen Güterbesitz am Hochrhein, im Breisgau und Aargau. Das von beiden Familien verwendete Wappenmotiv einer bzw. dreier Fideln zeugt von einer gemeinsamen Herkunft."
#histverein

"nachdem mein im Herbst 2011 erschienes Buch "Unter dem
Wappen der Fidel" schon nach einem Jahr vergriffen war, ist
es seit einigen Tagen komplett mit allen Abbildungen und
Karten über die Homepage des Alemannischen Instituts als
PDF online verfügbar (4 MB), dazu gibt es noch ein kurzes
Online-Vorwort und zwei Errata-Seiten (auch wenn die
Markierungen im Text keine aktiven Links zu den Errata
sind, aber wohl doch zu benutzen).
Der Text ist unter folgender URL einsehbar bzw.
herunterladbar:
http://www.alemannisches-institut.de/html/img/pool/Gutmann_Wieladingen.pdf "
Ausgezeichnet!
Zum Inhalt: "Die Herren von Wieladingen und die Herren vom Stein verwalteten im 13. und 14. Jahrhundert als Meier des Damenstifts Säckingen dessen Güterbesitz am Hochrhein, im Breisgau und Aargau. Das von beiden Familien verwendete Wappenmotiv einer bzw. dreier Fideln zeugt von einer gemeinsamen Herkunft."
#histverein
KlausGraf - am Mittwoch, 15. Mai 2013, 20:34 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Digital wird das Handbuch Informationskompetenz – genau wie die Druckausgabe – für einen Komplettpreis von 128,95 € angeboten. Ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass die 48 Kapitel zum Einzelpreis von 30 € online zu haben sind. Wer Wert allein auf Titelblatt, Abkürzungs- oder Stichwortverzeichnis legt, kann diese ebenfalls für den Kapitelpreis von 30 € einzeln erwerben. Ein hoher Preis, angesichts dessen, dass insbesondere das Stichwortverzeichnis keineswegs überflüssiges Beiwerk eines Handbuches darstellt, sondern eine wichtige Informationsquelle ist, um sich einen Überblick zum Thema zu verschaffen und die relevanten Beiträge zu finden; eine Quelle, auf die man in der Regel beim kapitelweisen Online-Zugriff verzichten wird. Der Verlag bietet jedoch online eine kostenlose Volltextsuche. Die Voransicht der jeweils ersten Kapitelseite ist ebenfalls gratis. Die Paketversion (Online- und Druckausgabe) kostet 199,95 €. Inwieweit die Preisgestaltung durch den Herstellungsprozess (wurden bspw. die Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge entlohnt?) gerechtfertigt ist, vermag der Rezensent nicht zu beurteilen, empfiehlt aber doch für gelegentliche Nutzung eher auf Bibliotheksexemplare oder -lizenzen zuzugreifen, als es sich für den Hausgebrauch privat anzuschaffen."
Müller, Lars (2013): Rezension zu: Sühl-Strohmenger, Wilfried (Hrsg.) / Handbuch Informationkompetenz. In: LIBREAS.Library Ideas, Jg. 9, H. 1 (22).
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100208959
Müller, Lars (2013): Rezension zu: Sühl-Strohmenger, Wilfried (Hrsg.) / Handbuch Informationkompetenz. In: LIBREAS.Library Ideas, Jg. 9, H. 1 (22).
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100208959
KlausGraf - am Mittwoch, 15. Mai 2013, 20:31 - Rubrik: Bibliothekswesen
Patrick Deinzer ist vom Archiv der Konrad-Adenauer-Stiftung sehr angetan:
http://konservativ.hypotheses.org/41
http://konservativ.hypotheses.org/41
KlausGraf - am Mittwoch, 15. Mai 2013, 20:29 - Rubrik: Parteiarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der folgende Text erschien zuerst in LIBREAS: Klaus Graf: Lehren aus der Causa Stralsund: Mehr Schutz für historische Bestände. In: LIBREAS.Library Ideas, Jg. 9, Heft 1 /Heft 22 (2013)
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100208891 (PDF).
In der Stralsunder Archivsatzung aus dem Jahr 2002 heißt es: “Das Archiv- und Bibliotheksgut ist Kulturgut und unveräußerlich.” Auch das Archivgesetz von Mecklenburg-Vorpommern schreibt die Unveräußerlichkeit des öffentlichen Archivguts fest. Beide Normen haben den Hauptausschuss der Stralsunder Bürgerschaft nicht abgehalten, im Juni 2012 in nicht-öffentlicher Sitzung den um etliche regionale Titel verminderten Bestand der historischen Gymnasialbibliothek im Stadtarchiv Stralsund einem bayerischen Antiquar zu verkaufen. Falk Eisermann wurde auf eine entsprechende Pressemeldung zur Schließung des Stadtarchivs wegen Schimmelbefalls aufmerksam, ich hakte nach, erhielt die Bestätigung der Stadt und mobilisierte die Öffentlichkeit, nicht zuletzt in dem von mir betreuten Gemeinschaftsweblog “Archivalia”. [Fn 01] Nachdem zwei germanistische Fachgutachter, Nigel Palmer und Jürgen Wolf, die im “Handbuch der historischen Buchbestände” gewürdigte Büchersammlung des traditionsreichen Stralsunder Gymnasiums als erhaltenswerte wertvolle Gesamtheit einschätzten und auch das Innenministerium (als Kommunalaufsicht) und das Kultusministerium in dem Verkauf einen Verstoß gegen die Archivsatzung und das Archivgesetz sahen, revidierte die Stadtverwaltung ihre Position und holte die Bücher, soweit diese noch bei dem Antiquar greifbar waren, zurück. Die Leiterin des Stadtarchivs – sie soll die Gymnasialbibliothek als “totes Kapital” bezeichnet haben [Fn 02] – wurde fristlos entlassen. Vor allem durch eine Auktion bei dem Königsteiner Auktionshaus Reiss wurden wertvolle frühneuzeitliche Drucke unwiederbringlich in alle Welt zerstreut, darunter auch Bücher aus der Bibliothek des Stralsunder Poeten Zacharias Orth († 1579). [Fn 03] Nicht verwertbare Bücher, die zu stark beschädigt waren, hatte der Antiquar vernichtet.
“Lehren aus dem Karlsruher Kulturgutdebakel” habe ich 2007 in der “Kunstchronik” publiziert, [Fn 04] und was ich damals schrieb, ist unvermindert aktuell. Mein damaliger erster Punkt “Öffentlicher Druck ist wirkungsvoll!” wurde eindrucksvoll bestätigt. Hervorzuheben ist dabei die große Rolle der Social Media. [Fn 05] Eine Petition bei openpetition.de fand gut 3600 Unterstützer.
Man kann den Ausgang der Affäre, die viele Bibliothekare und Archivare schockiert hat, glimpflich nennen: Die Stadt Stralsund hat eingesehen, dass sie einen gravierenden Fehler begangen hat. Sie hat den Kauf rückabgewickelt und bemüht sich derzeit um die Wiederbeschaffung der bereits verkauften Titel. Doch sollte das nicht zu der Annahme verführen, mit dem Kulturgutschutz stehe es in deutschen Landen zum Besten. Nur Propheten können wissen, ob das Stralsunder Desaster als Abschreckung taugen wird oder ob angesichts klammer Stadt- oder Landeskassen vermehrt Kulturgutverkäufe zu erwarten sind. Ich möchte daher mit Nachdruck darauf hinweisen, dass es keine wirksame Lobby für historische Sammlungen gibt und die rechtlichen Rahmenbedingungen völlig unzureichend sind. Seit 1994 dokumentiere ich Kulturgutverluste, die das Versagen des Kulturgut- und Denkmalschutzes belegen. [Fn 06]
Es ist ein Unding, dass es so gut wie keine gesetzliche Sicherung gegen den Ausverkauf kommunalen Kulturguts gibt. Noch am ehesten kann bei Archivgut der Veräußerung Einhalt geboten werden, schutzlos sind Sammlungen in Bibliotheken und Museen. Die früheren kommunalrechtlichen Genehmigungsvorbehalte, die die Veräußerung von Kulturgütern der staatlichen Kontrolle unterstellte, wurden weitgehend beseitigt. In § 90 der schleswig-holsteinischen Gemeindeordnung erhielt sich eine solche Vorschrift. Absatz 3 lautet: “Die Gemeinde bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn sie über bewegliche Sachen, die einen besonderen wissenschaftlichen, geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben, verfügen oder solche Sachen wesentlich verändern will. Die Gemeinde bedarf abweichend von Satz 1 keiner Genehmigung, wenn diese Sachen an andere schleswig-holsteinische kommunale Körperschaften oder das Land Schleswig-Holstein veräußert werden.” Die wertvollen Altbestände der historischen Stadtbibliotheken oder kommunales Museumsgut dürfen ohne Weiteres in den Handel gegeben werden, da sie weder unter Denkmalschutz stehen, noch als nationales Kulturgut eingetragen sind.
2006 wurde durch das Städtische Museum Schwäbisch Gmünd der Verkauf einer als Schenkung in die Institution gelangten Zinnfigurensammlung angekündigt. Obwohl erhebliche Zweifel am Vorgehen des Museums bestanden, [Fn 07] wollte die Kommunalaufsicht das Vorgehen des Museums nicht beanstanden: “Für uns ergeben sich keine Hinweise auf eine besondere wissenschaftliche, künstlerische oder heimatgeschichtliche Bedeutung und auf eine besondere Beziehung zum Kulturbereich des Landes. Eine Eintragung in das Denkmalbuch als Kulturdenkmal kam also nicht in Frage. Nur in diesem Falle bedarf eine Entfernung von Einzelsachen aus der Sammlung einer Genehmigung. Beim ‚Code of Ethics for Museums’ des Internationalen Museumsrates (IOCM) handelt es sich um eine Selbstbindungsrichtlinie. Ein evtl. Verstoß gegen diese Empfehlungen zieht keine Konsequenzen nach sich.” [Fn 08] Aus meiner Sicht ist der Schutz beweglicher Kulturdenkmale in allen Bundesländern aufgrund viel zu hoher Hürden nur als ganz und gar inakzeptabel zu bezeichnen. Es stünde einem Kulturstaat gut an, anstelle des überflüssigen Schutzes der “kleinen Münze” im Urheberrecht endlich die kleine Münze bei beweglichen Denkmälern anzuerkennen. Während man an der untersten Grenze des Urheberrechtsschutzes (sogenannte “kleine Münze”) großzügig ist und selbst das bescheidene Wegekreuz als Kleindenkmal oder den Hufnagel im Waldboden als Zeugnis für eine einstige Römerstraße und archäologische Quelle schützt, bleiben hochrangige Bibliothek-Ensembles vom Denkmalschutz “verschont”. Der Schutz der kleinen Münze könnte bei Kulturgut beispielsweise bedeuten, dass man Eigentümern verbietet, mittelalterliche oder frühneuzeitliche illuminierte Handschriften aufzubrechen, damit die einzelnen Blätter gewinnbringend verkauft werden können.
In Nordrhein-Westfalen wären die Stralsunder Verkäufe ganz legal gewesen, da man hier bei der Novellierung des Archivgesetzes unsinnigerweise die Ausnahmeregelung für die Kommunen (und Universitäten) bei Sammlungsgut beibehalten hat. Unveräußerlich ist nur das umgewidmete amtliche Registraturgut. Sammlungen oder Nachlässe dürfen also in Nordrhein-Westfalen von den Archiven verkauft werden. [Fn 09] Auf Anfrage im Jahr 2009 wurde mir dazu mitgeteilt: “Aus Sicht der Landesregierung soll es der Wertung der kommunalen Selbstverwaltung uneingeschränkt obliegen, ausnahmsweise bestimmtes Archivgut, das nicht aus Verwaltungshandeln öffentlicher Stellen stammt, veräußern zu können.” [Fn 10]
Die Stralsunder Archivbibliothek zählt zu den vier ganz großen Altbestandsbibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern. Aber auch viele andere Archivbibliotheken bergen erhaltenswerte Sammlungen, die nicht selten vernachlässigt werden. Selbst wenn es im jeweiligen Archivgesetz eine Unveräußerlichkeits-Klausel für Archivgut gibt, können verkaufswillige Archivare und Archivträger zwei Ausflüchte anführen:
Bibliotheksgut ist als Sammlungsgut kein “eigentliches” Archivgut und fällt daher nicht unter die gesetzliche Regelung für Archivgut.
Selbstverständlich darf man “Dubletten” und für den Sammlungsauftrag des Archivs wertlose Bücher verkaufen, ohne gegen die Unveräußerlichkeit zu verstoßen.
Ich möchte die Hand nicht ins Feuer legen, dass es nicht nur vereinzelte Archivare gibt, die mit dem Argument “Sind doch nur gedruckte Bücher und keine Handschriften” Teile ihrer Dienstbibliotheken zu Antiquaren bringen und so den historischen Provenienzen in ihrer Sammlung Schaden zufügen. Schon der Vorgänger der geschassten Stralsunder Archivleiterin hatte ja mit dem Verscherbeln von Büchern begonnen. Er hat seine Nachfolgerin auch öffentlich in Schutz genommen.
Während Verkäufe im Museumsbereich in Deutschland noch weitgehend ein Tabu sind, herrscht in den USA eine Kultur der “deaccession”, die unbekümmert in den Markt gibt, was über Generationen bewahrt wurde. Kritiker meinen zwar, dass solche Bestände als Teil eines “Public Trust” zu verstehen seien, der treuhänderisch für die Öffentlichkeit erhalten werden müsse, [Fn 11] aber sie sind in der Minderheit. Es steht zu befürchten, dass eine solche Mentalität auch in Deutschland Boden gewinnen wird.
Warum sind Verkäufe von Beständen aus kulturgutverwahrenden Institutionen von Übel?
Erstens: Archive, Bibliotheken, Museen und andere Sammlungen (wie zum Beispiel die der Denkmalämter) haben eine Archivfunktion. Sie sind als Gedächtnisinstitutionen Teil des kulturellen Gedächtnisses und sollen ihre Kulturgüter dauerhaft bewahren. Gesetzlich festgeschrieben ist das aber leider nur für die Archive.
Zweitens: Die Gedächtnisinstitutionen sichern Geschichtsquellen und machen sie für Wissenschaft und Öffentlichkeit nutzbar. Um einen möglichst hohen Erlös zu erzielen, müssen sich verkaufswillige Institutionen an die Auktionshäuser wenden, die nicht derjenigen Institution den Zuschlag erteilen, in der das veräußerte Kulturgut am besten untergebracht ist, sondern demjenigen Bieter, der die höchste Summe zahlt. Unzählige für die Öffentlichkeit bedeutsame Kulturgüter verschwinden jährlich unzugänglich in Privatsammlungen. Wenn es bei solchen privaten Sammlungen die gleichen Möglichkeiten gäbe, die Stücke einzusehen, wie in öffentlichen Sammlungen, müsste man sich wenig Gedanken machen, aber das ist nun einmal nicht der Fall. Werden historische Sammlungen zerrissen, werden schützenswerte Geschichtsquellen zerstört, die nicht weniger Erkenntnisse über die Geschichte unserer Kultur vermitteln als archäologische Grabungen. Eine Dokumentation vor der Zerstörung, wie sie in der Boden- und Baudenkmalpflege üblich ist (mitunter auf Kosten des Bauherrn), kennt der Kulturgutschutz nicht. Man kann es Juristen überlassen zu überlegen, ob man die Pflicht des Staates, solche Geschichtsquellen für Wissenschaft und Öffentlichkeit zu bewahren, aus dem Kulturstaatsprinzip oder dem Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit ableitet. Entscheidend ist, dass sich an der Praxis des Wegschauens, wenn hochrangige Sammlungen zerstückelt werden, etwas ändert, und dass man den Denkmalschutz bei beweglichen Kulturdenkmalen radikal ausweitet.
Drittens: Großzügige Stifter haben die Gedächtnisinstitutionen in der Regel deshalb mit Schenkungen bedacht, damit ihre Stücke dauerhaft als eine Art Denkmal der Stifter erhalten bleiben. Es verstößt eklatant gegen den Vertrauensschutz, wenn man sich nun von den einstigen Schenkungen trennt und sie zu Geld macht. Potentielle Mäzene, die mit der erwähnten Mentalität in den USA Probleme haben, werden abgeschreckt. Sammler, Familien und private Vereine sollten es sich gut überlegen, ob sie ihre Kulturgüter ohne Auflagen öffentlichen Sammlungen als Schenkung überlassen. Möglicherweise ist es sinnvoller, sie in eine Stiftung einzubringen, die sie als Dauerleihgabe an ein Archiv, eine Bibliothek oder ein Museum gibt. Voraussetzung ist freilich, dass die staatliche Stiftungsaufsicht funktioniert. Bei dem Karlsruher Kulturgüterskandal konnte davon keine Rede sein. Bürgerinnen und Bürger müssen sowohl im Stiftungsrecht als auch im Denkmal- und Kulturschutzrecht die Möglichkeit haben, alle Entscheidungen der Behörden zu kontrollieren. Derzeit ist vor allem an eine gerichtliche Kontrolle zu denken. Es muss also analog zum Naturschutzrecht die Möglichkeit einer Verbandsklage gegeben sein.
Zur bürgerschaftlichen Kontrolle gehört auch eine stärkere Verwaltungstransparenz. Die Stadt Stralsund hat entscheidende Sachverhalte der Öffentlichkeit bewusst vorenthalten, insbesondere den Kaufpreis des im Sommer 2012 verkauften Buchbestandes (angeblich 95.000 Euro). Meine Versuche, dies durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit korrigieren zu lassen, wurden im Eilverfahren abgeschmettert. Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald befand letztinstanzlich, dass mein Weblog “Archivalia” kein redaktionell-journalistisches Angebot sei, da eine redaktionelle Prüfung der Beiträge nicht stattfinde. Dass dabei mein Grundrecht der Pressefreiheit als Rechercheur mit Füßen getreten wird, nimmt das Gericht in Kauf. Bleibt es bei dem jetzigen hohen Ansatz des Streitwerts, haben mich die beiden Verfahren zusammen etwa 800 Euro gekostet.
Wäre es sinnvoll, eine Unveräußerlichkeitsklausel in Bibliotheksgesetze einzubauen? Oder sollte man öffentliche Sammlungen verstärkt in das Verzeichnis nationaler Kulturgüter aufnehmen? Beides kann nicht schaden, bringt aber keine entscheidenden Verbesserungen.
Sinnvoll ist nur ein gesetzlicher Schutz, der alle erhaltenswerten Sammlungstypen umfasst. Ein Bibliotheksgesetz hat keine Auswirkungen auf den Museumsbereich. Dass die Liste des national wertvollen Kulturguts im Land Mecklenburg-Vorpommern leer ist, hat man zu Recht anlässlich der Causa Stralsund angemerkt. Diese Kulturgutliste ist nach wie vor eine virtuelle Kunst- und Wunderkammer der Bundesrepublik, über die man sich nur wundern kann. Entscheidend ist, dass dieser Kulturgutschutz keinerlei Sammlungsschutz bewirkt. Ein Einzelverkauf der Sammlungsgegenstände im Inland könnte nicht verhindert werden.
Es spricht also alles dafür, an der Systemstelle anzusetzen, bei der es um den Erhalt von Sachen und Sachgesamtheiten geht, an deren Bewahrung aus wissenschaftlichen, heimatgeschichtlichen oder künstlerischen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. Also bei dem in den Denkmalgesetzen geregelten Denkmalschutz, der im Prinzip ja auch bewegliche Kulturdenkmale für die Nachwelt sichern soll. Die Entscheidung über den Ausfuhrschutz national wertvollen Kulturguts sollte der Ministerialbürokratie weggenommen und den Denkmalämtern übertragen werden. Jedes national wertvolle Kulturgut muss zugleich auf der Denkmalliste des jeweiligen Landes stehen. Der auf Archäologie und Baudenkmalpflege beschränkte Denkmalschutz muss erweitert werden, wobei eine solche Aufgabenausweitung angesichts des rauen Winds, der der Denkmalpflege zunehmend ins Gesicht weht, derzeit eine reine Illusion darstellt. Die Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen kämpft 2013 mit massiven Mittelkürzungen.
Soweit Denkmalgesetze wie in Nordrhein-Westfalen oder Mecklenburg-Vorpommern Archivgut aus ihrem Geltungsbereich ausnehmen, sollte das rasch geändert werden. Auch bei Archivgut muss es die Möglichkeiten der denkmalschutzrechtlichen Eingriffsverwaltung, zum Beispiel eine vorläufige Unterschutzstellung bei Gefahr im Verzug geben. Es ist nicht hinnehmbar, dass private Archiveigentümer mit ihrem Archivgut Handlungsfreiheit haben, wenn es sich um Kulturgut, also kulturelles Allgemeingut handelt. Wenn sich ein westfälischer Landjunker entschließt, mit seinem Archiv ein Feuerchen auf dem Schlosshof zu machen, wird man ihn womöglich immissionsrechtlich belangen können, aber Denkmalschutz und Kulturgutschutz sind machtlos.
Es sei noch angefügt, dass die reine Existenz wertvoller Sammlungen für das öffentliche Interesse an ihrem Erhalt nicht ausreicht. Sie müssen auch gepflegt und angemessen nutzbar sein. Durch Kooperationen und Beratungsleistungen muss verhindert werden, dass wertvolle Bibliotheken – seien es öffentliche wie die Stralsunder Stadtarchivbibliothek, seien es private Adelsbibliotheken – verschimmeln und zugrunde gehen. Und die Kulturgüter müssen auch der Allgemeinheit (ebenso wie der Wissenschaft) zur Nutzung angeboten werden, wobei im digitalen Zeitalter vor allem an Digitalisierung und freie Nachnutzbarkeit als Open Data zu denken ist. “Kulturgut muss frei sein”. [Fn 12]
Als Fazit muss man leider konstatieren, dass die Rahmenbedingungen für den Kulturgutschutz eher schlecht sind, obwohl wir dringend mehr Schutz bräuchten. Der Staat zieht sich aus der Kultur zurück, man kann auch sagen: Er spart sie kaputt. Auf die Politik ist wenig Hoffnung zu setzen, denn Banausen wie in der Stralsunder Bürgerschaft kann es auch in einer Landesregierung geben. Unvergessen ist das Diktum des baden-württembergischen Justizministers, der 2006 im Karlsruher Kulturgutstreit angesichts der unersetzlichen Handschriften der Badischen Landesbibliothek von “altem Papier, das im Keller liegt”, sprach. [Fn 13] Also Resignation? Nicht unbedingt. Wenn der Kulturgutschutz nicht ganz ausgehöhlt werden soll, ist es erforderlich, dass in diesem Bereich die Bürgergesellschaft mehr Verantwortung übernimmt. Sie muss sich weit mehr als bisher einmischen und über Stiftungsgelder oder Crowdfunding alternative Finanzierungsmöglichkeiten anbieten. Den Social Media kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: Sie können die Öffentlichkeit bei Missständen mobilisieren, zugleich aber auch für den kulturellen Wert der in den Gedächtnisinstitutionen verwahrten Zeugnisse der Geschichte und Kunst werben. Die Bürgergesellschaft muss also weit mehr als bisher aktiv in die “Überlieferungsbildung”, also die Arbeit am kulturellen Gedächtnis und die damit zusammenhängenden Bewertungsprozesse, einbezogen werden.
Fußnoten
[01] Vgl. für einen Überblick zum Sachverhalt neben den vielen Beitragen auf „Archivalia“ (auffindbar via Stichwortsuche nach “Stralsund”: http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund) die zusammenfassenden Beiträge im “Weblog Kulturgut” (http://kulturgut.hypotheses.org/category/bibliotheken/stralsund) sowie explizit Graf, Klaus: Causa Stralsund, in: L.I.S.A. – Das Wissenschaftsportal der Gerda Henkel Stiftung, 13.11.2012, abgerufen am 24.04.2013, http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=4101. [zurück]
[02] Vgl. Müller-Ulrich, Burkhard; Marx, Peter: Stralsund will historischen Bibliotheksbestand zurückkaufen – 6210 Bücher waren abgegeben worden, in: Deutschlandfunk – Kultur heute, 21.11.2012, abgerufen am 24.04.2013, http://www.dradio.de/dlf/sendungen/kulturheute/1928683/. [zurück]
[03] Vgl. Graf, Klaus: Causa Stralsund: Kepler-Druck aus der Gymnasialbibliothek Stralsund am 30. Oktober für 44.000 Euro bei Reiss verauktioniert, in: “Archivalia”, 20.11.2012, abgerufen am 24.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/219022356/. [zurück]
[04] Vgl. Graf, Klaus: Lehren aus dem Karlsruher Kulturgutdebakel 2006, in: “Archivalia”, 06.02.2007, abgerufen am 24.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/3287721/. [zurück]
[05] Siehe auch den Kommentar von: Schmalenstroer, Michael: Die Stralsunder Gymnasialbibliothek ist gerettet, in: Schmalenstroer.net, 21.11.2012, abgerufen am 24.04.2013, http://schmalenstroer.net/blog/2012/11/die-stralsunder-gymnasialbibliothek-ist-gerettet/. [zurück]
[06] Vgl. die Links via https://docs.google.com/document/d/1j2fQxZxJir1mTytZ0EMpTFZGVW6aDbi96Db3cdC2a-U/, abgerufen am 24.04.2013. [zurück]
[07] Vgl.: Graf, Klaus: Museum Schwäbisch Gmünd verscherbelt Museumsgut, in: “Archivalia”, 09.12.2006, abgerufen am 24.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/3043380/. [zurück]
[08] Vgl.: Nachtrag zu: Graf, Klaus: Museum Schwäbisch Gmünd verscherbelt Museumsgut, in: “Archivalia”, 09.12.2006, abgerufen am 27.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/3043380/. Nachträglich wurde mir der Bericht über die Tagung des Museumsverbands Mecklenburg-Vorpommern am 28./29.4.2013 in Wismar bekannt, auf der darauf hingewiesen wurde, “dass Kulturgüter in öffentlichen Sammlungen in Mecklenburg-Vorpommern gesetzlich nicht ausreichend geschützt seien. So sei nicht geregelt, unter welchen Umständen Museen Kulturgüter überhaupt abgeben dürfen.” Besserer Schutz für Kulturgüter gefordert, in: ndr.de, 28.4.2013, abgerufen am 30.04.2013 http://www.ndr.de/regional/mecklenburg-vorpommern/kulturgueter101.html. [zurück]
[09] Siehe zur Diskussion die einschlägigen “Archivalia”-Beiträge durch eine Stichwortsuche nach “Sammlungsgut” und “NRW” http://archiv.twoday.net/search?q=sammlungsgut+nrw. [zurück]
[10] Vgl. Graf, Klaus: Archivgesetz NRW: Stadtarchive und Uniarchive sollen Archivgut verscherbeln dürfen, in: “Archivalia”, 30.11.2009, abgerufen am 24.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/6070626/. [zurück]
[11] The Art Law Blog, abgerufen am 24.04.2013, http://theartlawblog.blogspot.de/ passim. [zurück]
[12] Vgl. Graf, Klaus: Kulturgut muss frei sein!, in: “Archivalia”, 24.11.2007, abgerufen am 24.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/4477824/. [zurück]
[13] Vgl. Raffelt, Albert: Der “badische Kulturgüterstreit” – eine erste Zwischenbilanz. In: Sühl-Strohmenger, Wilfried [u.a.]: EUCOR-Bibliotheksinformationen – Informations des bibliothèques, 29(2007), pp. 26-29, abgerufen am 24.04.2013, http://www.ub.uni-freiburg.de/fileadmin/ub/eucor_infos/pdf/eucor-29.pdf. [zurück]
Dr. Klaus Graf ist Historiker und Archivar, als solcher unter anderem als Geschäftsführer am Hochschularchiv der RWTH Aachen sowie als Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte der Universität Freiburg im Breisgau und am Lehr- und Forschungsgebiet Frühe Neuzeit der RWTH Aachen, tätig. Über die historiographische und archivalische Arbeit hinaus beschäftigt sich Klaus Graf intensiv publizistisch mit Themen wie Urheberrecht und Open Access, insbesondere in Zusammenhang mit Kulturgütern. Das von ihm maßgeblich inhaltlich geprägte Weblog Archivalia ist weit über Fachgrenzen hinaus bekannt.
Der Beitrag als PDF: http://edoc.hu-berlin.de/libreas/22/graf-klaus-4/PDF/graf.pdf . Er steht unter CC-BY.
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100208891 (PDF).
In der Stralsunder Archivsatzung aus dem Jahr 2002 heißt es: “Das Archiv- und Bibliotheksgut ist Kulturgut und unveräußerlich.” Auch das Archivgesetz von Mecklenburg-Vorpommern schreibt die Unveräußerlichkeit des öffentlichen Archivguts fest. Beide Normen haben den Hauptausschuss der Stralsunder Bürgerschaft nicht abgehalten, im Juni 2012 in nicht-öffentlicher Sitzung den um etliche regionale Titel verminderten Bestand der historischen Gymnasialbibliothek im Stadtarchiv Stralsund einem bayerischen Antiquar zu verkaufen. Falk Eisermann wurde auf eine entsprechende Pressemeldung zur Schließung des Stadtarchivs wegen Schimmelbefalls aufmerksam, ich hakte nach, erhielt die Bestätigung der Stadt und mobilisierte die Öffentlichkeit, nicht zuletzt in dem von mir betreuten Gemeinschaftsweblog “Archivalia”. [Fn 01] Nachdem zwei germanistische Fachgutachter, Nigel Palmer und Jürgen Wolf, die im “Handbuch der historischen Buchbestände” gewürdigte Büchersammlung des traditionsreichen Stralsunder Gymnasiums als erhaltenswerte wertvolle Gesamtheit einschätzten und auch das Innenministerium (als Kommunalaufsicht) und das Kultusministerium in dem Verkauf einen Verstoß gegen die Archivsatzung und das Archivgesetz sahen, revidierte die Stadtverwaltung ihre Position und holte die Bücher, soweit diese noch bei dem Antiquar greifbar waren, zurück. Die Leiterin des Stadtarchivs – sie soll die Gymnasialbibliothek als “totes Kapital” bezeichnet haben [Fn 02] – wurde fristlos entlassen. Vor allem durch eine Auktion bei dem Königsteiner Auktionshaus Reiss wurden wertvolle frühneuzeitliche Drucke unwiederbringlich in alle Welt zerstreut, darunter auch Bücher aus der Bibliothek des Stralsunder Poeten Zacharias Orth († 1579). [Fn 03] Nicht verwertbare Bücher, die zu stark beschädigt waren, hatte der Antiquar vernichtet.
“Lehren aus dem Karlsruher Kulturgutdebakel” habe ich 2007 in der “Kunstchronik” publiziert, [Fn 04] und was ich damals schrieb, ist unvermindert aktuell. Mein damaliger erster Punkt “Öffentlicher Druck ist wirkungsvoll!” wurde eindrucksvoll bestätigt. Hervorzuheben ist dabei die große Rolle der Social Media. [Fn 05] Eine Petition bei openpetition.de fand gut 3600 Unterstützer.
Man kann den Ausgang der Affäre, die viele Bibliothekare und Archivare schockiert hat, glimpflich nennen: Die Stadt Stralsund hat eingesehen, dass sie einen gravierenden Fehler begangen hat. Sie hat den Kauf rückabgewickelt und bemüht sich derzeit um die Wiederbeschaffung der bereits verkauften Titel. Doch sollte das nicht zu der Annahme verführen, mit dem Kulturgutschutz stehe es in deutschen Landen zum Besten. Nur Propheten können wissen, ob das Stralsunder Desaster als Abschreckung taugen wird oder ob angesichts klammer Stadt- oder Landeskassen vermehrt Kulturgutverkäufe zu erwarten sind. Ich möchte daher mit Nachdruck darauf hinweisen, dass es keine wirksame Lobby für historische Sammlungen gibt und die rechtlichen Rahmenbedingungen völlig unzureichend sind. Seit 1994 dokumentiere ich Kulturgutverluste, die das Versagen des Kulturgut- und Denkmalschutzes belegen. [Fn 06]
Es ist ein Unding, dass es so gut wie keine gesetzliche Sicherung gegen den Ausverkauf kommunalen Kulturguts gibt. Noch am ehesten kann bei Archivgut der Veräußerung Einhalt geboten werden, schutzlos sind Sammlungen in Bibliotheken und Museen. Die früheren kommunalrechtlichen Genehmigungsvorbehalte, die die Veräußerung von Kulturgütern der staatlichen Kontrolle unterstellte, wurden weitgehend beseitigt. In § 90 der schleswig-holsteinischen Gemeindeordnung erhielt sich eine solche Vorschrift. Absatz 3 lautet: “Die Gemeinde bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn sie über bewegliche Sachen, die einen besonderen wissenschaftlichen, geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben, verfügen oder solche Sachen wesentlich verändern will. Die Gemeinde bedarf abweichend von Satz 1 keiner Genehmigung, wenn diese Sachen an andere schleswig-holsteinische kommunale Körperschaften oder das Land Schleswig-Holstein veräußert werden.” Die wertvollen Altbestände der historischen Stadtbibliotheken oder kommunales Museumsgut dürfen ohne Weiteres in den Handel gegeben werden, da sie weder unter Denkmalschutz stehen, noch als nationales Kulturgut eingetragen sind.
2006 wurde durch das Städtische Museum Schwäbisch Gmünd der Verkauf einer als Schenkung in die Institution gelangten Zinnfigurensammlung angekündigt. Obwohl erhebliche Zweifel am Vorgehen des Museums bestanden, [Fn 07] wollte die Kommunalaufsicht das Vorgehen des Museums nicht beanstanden: “Für uns ergeben sich keine Hinweise auf eine besondere wissenschaftliche, künstlerische oder heimatgeschichtliche Bedeutung und auf eine besondere Beziehung zum Kulturbereich des Landes. Eine Eintragung in das Denkmalbuch als Kulturdenkmal kam also nicht in Frage. Nur in diesem Falle bedarf eine Entfernung von Einzelsachen aus der Sammlung einer Genehmigung. Beim ‚Code of Ethics for Museums’ des Internationalen Museumsrates (IOCM) handelt es sich um eine Selbstbindungsrichtlinie. Ein evtl. Verstoß gegen diese Empfehlungen zieht keine Konsequenzen nach sich.” [Fn 08] Aus meiner Sicht ist der Schutz beweglicher Kulturdenkmale in allen Bundesländern aufgrund viel zu hoher Hürden nur als ganz und gar inakzeptabel zu bezeichnen. Es stünde einem Kulturstaat gut an, anstelle des überflüssigen Schutzes der “kleinen Münze” im Urheberrecht endlich die kleine Münze bei beweglichen Denkmälern anzuerkennen. Während man an der untersten Grenze des Urheberrechtsschutzes (sogenannte “kleine Münze”) großzügig ist und selbst das bescheidene Wegekreuz als Kleindenkmal oder den Hufnagel im Waldboden als Zeugnis für eine einstige Römerstraße und archäologische Quelle schützt, bleiben hochrangige Bibliothek-Ensembles vom Denkmalschutz “verschont”. Der Schutz der kleinen Münze könnte bei Kulturgut beispielsweise bedeuten, dass man Eigentümern verbietet, mittelalterliche oder frühneuzeitliche illuminierte Handschriften aufzubrechen, damit die einzelnen Blätter gewinnbringend verkauft werden können.
In Nordrhein-Westfalen wären die Stralsunder Verkäufe ganz legal gewesen, da man hier bei der Novellierung des Archivgesetzes unsinnigerweise die Ausnahmeregelung für die Kommunen (und Universitäten) bei Sammlungsgut beibehalten hat. Unveräußerlich ist nur das umgewidmete amtliche Registraturgut. Sammlungen oder Nachlässe dürfen also in Nordrhein-Westfalen von den Archiven verkauft werden. [Fn 09] Auf Anfrage im Jahr 2009 wurde mir dazu mitgeteilt: “Aus Sicht der Landesregierung soll es der Wertung der kommunalen Selbstverwaltung uneingeschränkt obliegen, ausnahmsweise bestimmtes Archivgut, das nicht aus Verwaltungshandeln öffentlicher Stellen stammt, veräußern zu können.” [Fn 10]
Die Stralsunder Archivbibliothek zählt zu den vier ganz großen Altbestandsbibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern. Aber auch viele andere Archivbibliotheken bergen erhaltenswerte Sammlungen, die nicht selten vernachlässigt werden. Selbst wenn es im jeweiligen Archivgesetz eine Unveräußerlichkeits-Klausel für Archivgut gibt, können verkaufswillige Archivare und Archivträger zwei Ausflüchte anführen:
Bibliotheksgut ist als Sammlungsgut kein “eigentliches” Archivgut und fällt daher nicht unter die gesetzliche Regelung für Archivgut.
Selbstverständlich darf man “Dubletten” und für den Sammlungsauftrag des Archivs wertlose Bücher verkaufen, ohne gegen die Unveräußerlichkeit zu verstoßen.
Ich möchte die Hand nicht ins Feuer legen, dass es nicht nur vereinzelte Archivare gibt, die mit dem Argument “Sind doch nur gedruckte Bücher und keine Handschriften” Teile ihrer Dienstbibliotheken zu Antiquaren bringen und so den historischen Provenienzen in ihrer Sammlung Schaden zufügen. Schon der Vorgänger der geschassten Stralsunder Archivleiterin hatte ja mit dem Verscherbeln von Büchern begonnen. Er hat seine Nachfolgerin auch öffentlich in Schutz genommen.
Während Verkäufe im Museumsbereich in Deutschland noch weitgehend ein Tabu sind, herrscht in den USA eine Kultur der “deaccession”, die unbekümmert in den Markt gibt, was über Generationen bewahrt wurde. Kritiker meinen zwar, dass solche Bestände als Teil eines “Public Trust” zu verstehen seien, der treuhänderisch für die Öffentlichkeit erhalten werden müsse, [Fn 11] aber sie sind in der Minderheit. Es steht zu befürchten, dass eine solche Mentalität auch in Deutschland Boden gewinnen wird.
Warum sind Verkäufe von Beständen aus kulturgutverwahrenden Institutionen von Übel?
Erstens: Archive, Bibliotheken, Museen und andere Sammlungen (wie zum Beispiel die der Denkmalämter) haben eine Archivfunktion. Sie sind als Gedächtnisinstitutionen Teil des kulturellen Gedächtnisses und sollen ihre Kulturgüter dauerhaft bewahren. Gesetzlich festgeschrieben ist das aber leider nur für die Archive.
Zweitens: Die Gedächtnisinstitutionen sichern Geschichtsquellen und machen sie für Wissenschaft und Öffentlichkeit nutzbar. Um einen möglichst hohen Erlös zu erzielen, müssen sich verkaufswillige Institutionen an die Auktionshäuser wenden, die nicht derjenigen Institution den Zuschlag erteilen, in der das veräußerte Kulturgut am besten untergebracht ist, sondern demjenigen Bieter, der die höchste Summe zahlt. Unzählige für die Öffentlichkeit bedeutsame Kulturgüter verschwinden jährlich unzugänglich in Privatsammlungen. Wenn es bei solchen privaten Sammlungen die gleichen Möglichkeiten gäbe, die Stücke einzusehen, wie in öffentlichen Sammlungen, müsste man sich wenig Gedanken machen, aber das ist nun einmal nicht der Fall. Werden historische Sammlungen zerrissen, werden schützenswerte Geschichtsquellen zerstört, die nicht weniger Erkenntnisse über die Geschichte unserer Kultur vermitteln als archäologische Grabungen. Eine Dokumentation vor der Zerstörung, wie sie in der Boden- und Baudenkmalpflege üblich ist (mitunter auf Kosten des Bauherrn), kennt der Kulturgutschutz nicht. Man kann es Juristen überlassen zu überlegen, ob man die Pflicht des Staates, solche Geschichtsquellen für Wissenschaft und Öffentlichkeit zu bewahren, aus dem Kulturstaatsprinzip oder dem Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit ableitet. Entscheidend ist, dass sich an der Praxis des Wegschauens, wenn hochrangige Sammlungen zerstückelt werden, etwas ändert, und dass man den Denkmalschutz bei beweglichen Kulturdenkmalen radikal ausweitet.
Drittens: Großzügige Stifter haben die Gedächtnisinstitutionen in der Regel deshalb mit Schenkungen bedacht, damit ihre Stücke dauerhaft als eine Art Denkmal der Stifter erhalten bleiben. Es verstößt eklatant gegen den Vertrauensschutz, wenn man sich nun von den einstigen Schenkungen trennt und sie zu Geld macht. Potentielle Mäzene, die mit der erwähnten Mentalität in den USA Probleme haben, werden abgeschreckt. Sammler, Familien und private Vereine sollten es sich gut überlegen, ob sie ihre Kulturgüter ohne Auflagen öffentlichen Sammlungen als Schenkung überlassen. Möglicherweise ist es sinnvoller, sie in eine Stiftung einzubringen, die sie als Dauerleihgabe an ein Archiv, eine Bibliothek oder ein Museum gibt. Voraussetzung ist freilich, dass die staatliche Stiftungsaufsicht funktioniert. Bei dem Karlsruher Kulturgüterskandal konnte davon keine Rede sein. Bürgerinnen und Bürger müssen sowohl im Stiftungsrecht als auch im Denkmal- und Kulturschutzrecht die Möglichkeit haben, alle Entscheidungen der Behörden zu kontrollieren. Derzeit ist vor allem an eine gerichtliche Kontrolle zu denken. Es muss also analog zum Naturschutzrecht die Möglichkeit einer Verbandsklage gegeben sein.
Zur bürgerschaftlichen Kontrolle gehört auch eine stärkere Verwaltungstransparenz. Die Stadt Stralsund hat entscheidende Sachverhalte der Öffentlichkeit bewusst vorenthalten, insbesondere den Kaufpreis des im Sommer 2012 verkauften Buchbestandes (angeblich 95.000 Euro). Meine Versuche, dies durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit korrigieren zu lassen, wurden im Eilverfahren abgeschmettert. Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald befand letztinstanzlich, dass mein Weblog “Archivalia” kein redaktionell-journalistisches Angebot sei, da eine redaktionelle Prüfung der Beiträge nicht stattfinde. Dass dabei mein Grundrecht der Pressefreiheit als Rechercheur mit Füßen getreten wird, nimmt das Gericht in Kauf. Bleibt es bei dem jetzigen hohen Ansatz des Streitwerts, haben mich die beiden Verfahren zusammen etwa 800 Euro gekostet.
Wäre es sinnvoll, eine Unveräußerlichkeitsklausel in Bibliotheksgesetze einzubauen? Oder sollte man öffentliche Sammlungen verstärkt in das Verzeichnis nationaler Kulturgüter aufnehmen? Beides kann nicht schaden, bringt aber keine entscheidenden Verbesserungen.
Sinnvoll ist nur ein gesetzlicher Schutz, der alle erhaltenswerten Sammlungstypen umfasst. Ein Bibliotheksgesetz hat keine Auswirkungen auf den Museumsbereich. Dass die Liste des national wertvollen Kulturguts im Land Mecklenburg-Vorpommern leer ist, hat man zu Recht anlässlich der Causa Stralsund angemerkt. Diese Kulturgutliste ist nach wie vor eine virtuelle Kunst- und Wunderkammer der Bundesrepublik, über die man sich nur wundern kann. Entscheidend ist, dass dieser Kulturgutschutz keinerlei Sammlungsschutz bewirkt. Ein Einzelverkauf der Sammlungsgegenstände im Inland könnte nicht verhindert werden.
Es spricht also alles dafür, an der Systemstelle anzusetzen, bei der es um den Erhalt von Sachen und Sachgesamtheiten geht, an deren Bewahrung aus wissenschaftlichen, heimatgeschichtlichen oder künstlerischen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. Also bei dem in den Denkmalgesetzen geregelten Denkmalschutz, der im Prinzip ja auch bewegliche Kulturdenkmale für die Nachwelt sichern soll. Die Entscheidung über den Ausfuhrschutz national wertvollen Kulturguts sollte der Ministerialbürokratie weggenommen und den Denkmalämtern übertragen werden. Jedes national wertvolle Kulturgut muss zugleich auf der Denkmalliste des jeweiligen Landes stehen. Der auf Archäologie und Baudenkmalpflege beschränkte Denkmalschutz muss erweitert werden, wobei eine solche Aufgabenausweitung angesichts des rauen Winds, der der Denkmalpflege zunehmend ins Gesicht weht, derzeit eine reine Illusion darstellt. Die Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen kämpft 2013 mit massiven Mittelkürzungen.
Soweit Denkmalgesetze wie in Nordrhein-Westfalen oder Mecklenburg-Vorpommern Archivgut aus ihrem Geltungsbereich ausnehmen, sollte das rasch geändert werden. Auch bei Archivgut muss es die Möglichkeiten der denkmalschutzrechtlichen Eingriffsverwaltung, zum Beispiel eine vorläufige Unterschutzstellung bei Gefahr im Verzug geben. Es ist nicht hinnehmbar, dass private Archiveigentümer mit ihrem Archivgut Handlungsfreiheit haben, wenn es sich um Kulturgut, also kulturelles Allgemeingut handelt. Wenn sich ein westfälischer Landjunker entschließt, mit seinem Archiv ein Feuerchen auf dem Schlosshof zu machen, wird man ihn womöglich immissionsrechtlich belangen können, aber Denkmalschutz und Kulturgutschutz sind machtlos.
Es sei noch angefügt, dass die reine Existenz wertvoller Sammlungen für das öffentliche Interesse an ihrem Erhalt nicht ausreicht. Sie müssen auch gepflegt und angemessen nutzbar sein. Durch Kooperationen und Beratungsleistungen muss verhindert werden, dass wertvolle Bibliotheken – seien es öffentliche wie die Stralsunder Stadtarchivbibliothek, seien es private Adelsbibliotheken – verschimmeln und zugrunde gehen. Und die Kulturgüter müssen auch der Allgemeinheit (ebenso wie der Wissenschaft) zur Nutzung angeboten werden, wobei im digitalen Zeitalter vor allem an Digitalisierung und freie Nachnutzbarkeit als Open Data zu denken ist. “Kulturgut muss frei sein”. [Fn 12]
Als Fazit muss man leider konstatieren, dass die Rahmenbedingungen für den Kulturgutschutz eher schlecht sind, obwohl wir dringend mehr Schutz bräuchten. Der Staat zieht sich aus der Kultur zurück, man kann auch sagen: Er spart sie kaputt. Auf die Politik ist wenig Hoffnung zu setzen, denn Banausen wie in der Stralsunder Bürgerschaft kann es auch in einer Landesregierung geben. Unvergessen ist das Diktum des baden-württembergischen Justizministers, der 2006 im Karlsruher Kulturgutstreit angesichts der unersetzlichen Handschriften der Badischen Landesbibliothek von “altem Papier, das im Keller liegt”, sprach. [Fn 13] Also Resignation? Nicht unbedingt. Wenn der Kulturgutschutz nicht ganz ausgehöhlt werden soll, ist es erforderlich, dass in diesem Bereich die Bürgergesellschaft mehr Verantwortung übernimmt. Sie muss sich weit mehr als bisher einmischen und über Stiftungsgelder oder Crowdfunding alternative Finanzierungsmöglichkeiten anbieten. Den Social Media kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: Sie können die Öffentlichkeit bei Missständen mobilisieren, zugleich aber auch für den kulturellen Wert der in den Gedächtnisinstitutionen verwahrten Zeugnisse der Geschichte und Kunst werben. Die Bürgergesellschaft muss also weit mehr als bisher aktiv in die “Überlieferungsbildung”, also die Arbeit am kulturellen Gedächtnis und die damit zusammenhängenden Bewertungsprozesse, einbezogen werden.
Fußnoten
[01] Vgl. für einen Überblick zum Sachverhalt neben den vielen Beitragen auf „Archivalia“ (auffindbar via Stichwortsuche nach “Stralsund”: http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund) die zusammenfassenden Beiträge im “Weblog Kulturgut” (http://kulturgut.hypotheses.org/category/bibliotheken/stralsund) sowie explizit Graf, Klaus: Causa Stralsund, in: L.I.S.A. – Das Wissenschaftsportal der Gerda Henkel Stiftung, 13.11.2012, abgerufen am 24.04.2013, http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=4101. [zurück]
[02] Vgl. Müller-Ulrich, Burkhard; Marx, Peter: Stralsund will historischen Bibliotheksbestand zurückkaufen – 6210 Bücher waren abgegeben worden, in: Deutschlandfunk – Kultur heute, 21.11.2012, abgerufen am 24.04.2013, http://www.dradio.de/dlf/sendungen/kulturheute/1928683/. [zurück]
[03] Vgl. Graf, Klaus: Causa Stralsund: Kepler-Druck aus der Gymnasialbibliothek Stralsund am 30. Oktober für 44.000 Euro bei Reiss verauktioniert, in: “Archivalia”, 20.11.2012, abgerufen am 24.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/219022356/. [zurück]
[04] Vgl. Graf, Klaus: Lehren aus dem Karlsruher Kulturgutdebakel 2006, in: “Archivalia”, 06.02.2007, abgerufen am 24.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/3287721/. [zurück]
[05] Siehe auch den Kommentar von: Schmalenstroer, Michael: Die Stralsunder Gymnasialbibliothek ist gerettet, in: Schmalenstroer.net, 21.11.2012, abgerufen am 24.04.2013, http://schmalenstroer.net/blog/2012/11/die-stralsunder-gymnasialbibliothek-ist-gerettet/. [zurück]
[06] Vgl. die Links via https://docs.google.com/document/d/1j2fQxZxJir1mTytZ0EMpTFZGVW6aDbi96Db3cdC2a-U/, abgerufen am 24.04.2013. [zurück]
[07] Vgl.: Graf, Klaus: Museum Schwäbisch Gmünd verscherbelt Museumsgut, in: “Archivalia”, 09.12.2006, abgerufen am 24.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/3043380/. [zurück]
[08] Vgl.: Nachtrag zu: Graf, Klaus: Museum Schwäbisch Gmünd verscherbelt Museumsgut, in: “Archivalia”, 09.12.2006, abgerufen am 27.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/3043380/. Nachträglich wurde mir der Bericht über die Tagung des Museumsverbands Mecklenburg-Vorpommern am 28./29.4.2013 in Wismar bekannt, auf der darauf hingewiesen wurde, “dass Kulturgüter in öffentlichen Sammlungen in Mecklenburg-Vorpommern gesetzlich nicht ausreichend geschützt seien. So sei nicht geregelt, unter welchen Umständen Museen Kulturgüter überhaupt abgeben dürfen.” Besserer Schutz für Kulturgüter gefordert, in: ndr.de, 28.4.2013, abgerufen am 30.04.2013 http://www.ndr.de/regional/mecklenburg-vorpommern/kulturgueter101.html. [zurück]
[09] Siehe zur Diskussion die einschlägigen “Archivalia”-Beiträge durch eine Stichwortsuche nach “Sammlungsgut” und “NRW” http://archiv.twoday.net/search?q=sammlungsgut+nrw. [zurück]
[10] Vgl. Graf, Klaus: Archivgesetz NRW: Stadtarchive und Uniarchive sollen Archivgut verscherbeln dürfen, in: “Archivalia”, 30.11.2009, abgerufen am 24.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/6070626/. [zurück]
[11] The Art Law Blog, abgerufen am 24.04.2013, http://theartlawblog.blogspot.de/ passim. [zurück]
[12] Vgl. Graf, Klaus: Kulturgut muss frei sein!, in: “Archivalia”, 24.11.2007, abgerufen am 24.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/4477824/. [zurück]
[13] Vgl. Raffelt, Albert: Der “badische Kulturgüterstreit” – eine erste Zwischenbilanz. In: Sühl-Strohmenger, Wilfried [u.a.]: EUCOR-Bibliotheksinformationen – Informations des bibliothèques, 29(2007), pp. 26-29, abgerufen am 24.04.2013, http://www.ub.uni-freiburg.de/fileadmin/ub/eucor_infos/pdf/eucor-29.pdf. [zurück]
Dr. Klaus Graf ist Historiker und Archivar, als solcher unter anderem als Geschäftsführer am Hochschularchiv der RWTH Aachen sowie als Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte der Universität Freiburg im Breisgau und am Lehr- und Forschungsgebiet Frühe Neuzeit der RWTH Aachen, tätig. Über die historiographische und archivalische Arbeit hinaus beschäftigt sich Klaus Graf intensiv publizistisch mit Themen wie Urheberrecht und Open Access, insbesondere in Zusammenhang mit Kulturgütern. Das von ihm maßgeblich inhaltlich geprägte Weblog Archivalia ist weit über Fachgrenzen hinaus bekannt.
Der Beitrag als PDF: http://edoc.hu-berlin.de/libreas/22/graf-klaus-4/PDF/graf.pdf . Er steht unter CC-BY.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://chronicle.com/article/Publisher-Threatens-to-Sue/139243/
Zu Beall
http://archiv.twoday.net/search?q=beall
Zu Beall
http://archiv.twoday.net/search?q=beall
KlausGraf - am Mittwoch, 15. Mai 2013, 17:07 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://log.netbib.de
Die Frage müsste natürlich lauten: Was ist mit JürgenPeinlicher Plieninger los? Da wird die gute Anna Amalia zur Namengeberin einer "Bilbiothek", die bücherflohmarktveranstaltenden Steyler Missionare werden "Steyrer" und die vermisste Digitalisierung des Speyrer Evangelistars wurde hier am 7. Mai angezeigt:
http://archiv.twoday.net/stories/379776186/
Die Frage müsste natürlich lauten: Was ist mit Jürgen
http://archiv.twoday.net/stories/379776186/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 15. Mai 2013, 16:56 - Rubrik: Archivrecht
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lehm135
"Heinrich Beschißer von Esslingen, ein Vagus, schwört der Stadt Speyer bei der Entlassung aus seiner wegen Tötung des Johannes Ostertag zu Hagenau über ihn verhängten, nun aber da sich an den angesetzten Gerichtstermin niemand gemeldet, er auch in Notwehr gehandel [!] zu haben angibt, aufgehobenen Haft, Urfehde."
Lesbar wäre: "Heinrich Beschißer von Esslingen, ein Vagant (vagus), schwört der Stadt Speyer Urfehde bei der Entlassung aus der Haft, die wegen Tötung des Johannes Ostertag zu Hagenau über ihn verhängt worden war, nun aber aufgehoben wurde, da sich an den angesetzten Gerichtsterminen niemand gemeldet hatte und er angibt, in Notwehr gehandelt zu haben."
"Heinrich Beschißer von Esslingen, ein Vagus, schwört der Stadt Speyer bei der Entlassung aus seiner wegen Tötung des Johannes Ostertag zu Hagenau über ihn verhängten, nun aber da sich an den angesetzten Gerichtstermin niemand gemeldet, er auch in Notwehr gehandel [!] zu haben angibt, aufgehobenen Haft, Urfehde."
Lesbar wäre: "Heinrich Beschißer von Esslingen, ein Vagant (vagus), schwört der Stadt Speyer Urfehde bei der Entlassung aus der Haft, die wegen Tötung des Johannes Ostertag zu Hagenau über ihn verhängt worden war, nun aber aufgehoben wurde, da sich an den angesetzten Gerichtsterminen niemand gemeldet hatte und er angibt, in Notwehr gehandelt zu haben."
KlausGraf - am Mittwoch, 15. Mai 2013, 16:43 - Rubrik: Erschließung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/404098698/
"Das ist wirklich eine gigantische Hilfe: Die bei ANNO bislang als Image-Dateien verfügbaren Zeitungen und Zeitschriften sind seit heute zu einem guten Teil (bis 1872, für das 18. Jahrhundert v.a. das Wiener Diarium/Wiener Zeitung) OCR-erfasst und damit durchsuchbar; selbstredend gibt es bei der Fraktur etliche Fehler, doch eine Suche nach Herrn Wersak spuckte mir postwendend u.a eine mir bislang nicht bekannte Ankündigung seiner Universal-Schreibstube in der Wiener Zeitung aus; und ich wollte auch immer schon wissen, dass man bei Wersak das Arkanum des Abwischwassers der Elisabeth Maßmayer erfragen konnte!
http://anno.onb.ac.at/anno-suche/ "
"Das ist wirklich eine gigantische Hilfe: Die bei ANNO bislang als Image-Dateien verfügbaren Zeitungen und Zeitschriften sind seit heute zu einem guten Teil (bis 1872, für das 18. Jahrhundert v.a. das Wiener Diarium/Wiener Zeitung) OCR-erfasst und damit durchsuchbar; selbstredend gibt es bei der Fraktur etliche Fehler, doch eine Suche nach Herrn Wersak spuckte mir postwendend u.a eine mir bislang nicht bekannte Ankündigung seiner Universal-Schreibstube in der Wiener Zeitung aus; und ich wollte auch immer schon wissen, dass man bei Wersak das Arkanum des Abwischwassers der Elisabeth Maßmayer erfragen konnte!
http://anno.onb.ac.at/anno-suche/ "
KlausGraf - am Dienstag, 14. Mai 2013, 23:32 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Klasse Bild auf Infobib
http://infobib.de/blog/2013/05/14/open-access-ein-aspekt-ethischer-grundsatze/

http://infobib.de/blog/2013/05/14/open-access-ein-aspekt-ethischer-grundsatze/

KlausGraf - am Dienstag, 14. Mai 2013, 23:26 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://sa-kuva.fi/
Siehe http://nordichistoryblog.hypotheses.org/1585
Hatte ich übrigens schon am 2. April gemeldet:
http://archivalia.tumblr.com/post/49226780261/the-finnish-defense-forces-have-put-up-an-online

Siehe http://nordichistoryblog.hypotheses.org/1585
Hatte ich übrigens schon am 2. April gemeldet:
http://archivalia.tumblr.com/post/49226780261/the-finnish-defense-forces-have-put-up-an-online

KlausGraf - am Dienstag, 14. Mai 2013, 20:26 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Merkt aus Anlass der Vorstellung der virtuellen Schwabenkinder-Ausstellung http://www.schwabenkinder.eu/de/ zu Recht an:
http://mannigfaltigkeiten.twoday.net/stories/404098641/
http://de.wikisource.org/wiki/Schwabenkinder

http://mannigfaltigkeiten.twoday.net/stories/404098641/
http://de.wikisource.org/wiki/Schwabenkinder

KlausGraf - am Dienstag, 14. Mai 2013, 20:22 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://moocfellowship.org/
Jeder kann abstimmen, welche 10 Online-Kurse den Wettbewerb gewinnen. Zur germanistischen Mediävistik bewirbt sich ein Kurs über den Erzähler:
https://moocfellowship.org/submissions/der-erzahler-materialitat-und-virtualitat-vom-mittelalter-bis-zur-gegenwart
Jeder kann abstimmen, welche 10 Online-Kurse den Wettbewerb gewinnen. Zur germanistischen Mediävistik bewirbt sich ein Kurs über den Erzähler:
https://moocfellowship.org/submissions/der-erzahler-materialitat-und-virtualitat-vom-mittelalter-bis-zur-gegenwart
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek / Klassik Stiftung Weimar präsentiert in ihrem Online-Angebot »Monographien digital« mittlerweile über 2000 Werke aus knapp 850 digitalisierten »Aschebüchern«. Diese Bücher wurden beim Brand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek am 2. September 2004 besonders stark geschädigt und sind zum Teil nur als Fragmente erhalten. Nach der Restaurierung werden sie in Auswahl digitalisiert und online gestellt. Suchmöglichkeiten bieten Personen- und Titelregister, die nicht identifizierten Stücke erschließt ein chronologisches Register nach vermuteten Erscheinungsjahren.
Für die Identifizierung dieser Werke bitten wir Sie erneut um Ihre Mithilfe. Sie finden die Digitalisate über den Link http://ora-web.klassik-stiftung.de/digimo_online/digimo.entry (linker Frame, unten Link »Aschebücher« anklicken).
Haben Sie Vorschläge, um welche Titel und Ausgaben es sich handelt? Bitte teilen Sie uns Ihre Hinweise über den Blog zum Werk oder per E-Mail an folgende Adresse mit:
haab.aschebuecher@klassik-stiftung.de
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und Anregungen.
---
HAAB - Projekt Aschebücher
Für die Identifizierung dieser Werke bitten wir Sie erneut um Ihre Mithilfe. Sie finden die Digitalisate über den Link http://ora-web.klassik-stiftung.de/digimo_online/digimo.entry (linker Frame, unten Link »Aschebücher« anklicken).
Haben Sie Vorschläge, um welche Titel und Ausgaben es sich handelt? Bitte teilen Sie uns Ihre Hinweise über den Blog zum Werk oder per E-Mail an folgende Adresse mit:
haab.aschebuecher@klassik-stiftung.de
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und Anregungen.
---
HAAB - Projekt Aschebücher
KlausGraf - am Dienstag, 14. Mai 2013, 19:32 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Um 1690 reiste der französische Diplomat Philippe de Coulanges auch durch Deutschland. Sein Bericht wurde 1820 nur auszugsweise gedruckt.
Digitalisate des Abdrucks von 1820 und der Pariser Handschrift weist eine Suche in der Europeana nach:
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=coulanges+philippe&rows=24
Heute war eine weitere Handschrift der UPenn, die jetzt online ist, in meinen RSS-Feeds:
http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/3773835
#fnzhss

Digitalisate des Abdrucks von 1820 und der Pariser Handschrift weist eine Suche in der Europeana nach:
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=coulanges+philippe&rows=24
Heute war eine weitere Handschrift der UPenn, die jetzt online ist, in meinen RSS-Feeds:
http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/3773835
#fnzhss

KlausGraf - am Dienstag, 14. Mai 2013, 19:19 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.historikerverband.de/mitteilungen/mitteilungs-details/article/petition-gegen-planungsstopp-fuer-koelner-stadtarchiv.html
Gestern hat die Petition einen großen Sprung nach vorne gemacht:
https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-die-aufhebung-des-planungsstopps-fuer-den-neubau-des-historischen-archivs-der-stadt-koeln
Danke allen, die weiterverbreitet haben.
Gestern hat die Petition einen großen Sprung nach vorne gemacht:
https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-die-aufhebung-des-planungsstopps-fuer-den-neubau-des-historischen-archivs-der-stadt-koeln
Danke allen, die weiterverbreitet haben.
KlausGraf - am Dienstag, 14. Mai 2013, 00:54 - Rubrik: Kommunalarchive
Monika Lehner stellt Links zusammen:
http://mindthegaps.hypotheses.org/633
 http://dsr.nii.ac.jp/toyobunko/La-161/V-1/
http://dsr.nii.ac.jp/toyobunko/La-161/V-1/
http://mindthegaps.hypotheses.org/633
KlausGraf - am Montag, 13. Mai 2013, 15:36 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Telemedicus deckt auf:
http://www.telemedicus.info/article/2550-Urteile-als-Nebenverdienst-beim-BGH.html
"Es ist offenbar gängige Praxis, dass sich einzelne Richter an der Erfüllung dieses Verfassungsauftrages privat bereichern. An einer Leistung, die gerade nicht über die Tätigkeit hinaus geht, für die sie bereits öffentliche Bezüge erhalten haben. Dieses Vorgehen hinter einer „wissenschaftlichen Tätigkeit” zu verstecken, ist nicht nur moralisch wie juristisch fragwürdig, sondern schadet auch allen Richterkollegen, die tatsächlich wissenschaftlich tätig sind.
Um die wirtschaftliche Hoheit über Gerichtsentscheidungen findet schon seit Jahren ein Machtkampf statt, der dem Rechtsstaat zunehmend schadet. Weder darf das öffentliche Informationsinteresse den wirtschaftlichen Interessen der Justiz weichen, noch darf es für die private Bereicherung missbraucht werden. Und doch findet beides statt. Für einen Rechtsstaat ist das unwürdig."
http://www.telemedicus.info/article/2550-Urteile-als-Nebenverdienst-beim-BGH.html
"Es ist offenbar gängige Praxis, dass sich einzelne Richter an der Erfüllung dieses Verfassungsauftrages privat bereichern. An einer Leistung, die gerade nicht über die Tätigkeit hinaus geht, für die sie bereits öffentliche Bezüge erhalten haben. Dieses Vorgehen hinter einer „wissenschaftlichen Tätigkeit” zu verstecken, ist nicht nur moralisch wie juristisch fragwürdig, sondern schadet auch allen Richterkollegen, die tatsächlich wissenschaftlich tätig sind.
Um die wirtschaftliche Hoheit über Gerichtsentscheidungen findet schon seit Jahren ein Machtkampf statt, der dem Rechtsstaat zunehmend schadet. Weder darf das öffentliche Informationsinteresse den wirtschaftlichen Interessen der Justiz weichen, noch darf es für die private Bereicherung missbraucht werden. Und doch findet beides statt. Für einen Rechtsstaat ist das unwürdig."
KlausGraf - am Montag, 13. Mai 2013, 15:07 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ulinka Rublack, aus Deutschland stammende Frühneuzeithistorikerin in Cambridge, hat 2010 eine preisgekrönte Studie '' Dressing Up: Cultural Identity in Renaissance Europe'' vorgelegt und arbeitet derzeit an einer kommentierten Ausgabe der Trachtenbücher des Fugger-Hauptbuchhalters Matthäus Schwarz. In diesem Zusammenhang ließ sie jetzt zusammen mit der Kostümhistorikerin Jenny Tiramani das Gewand rekonstruieren, das Schwarz zum Augsburger Reichstag 1530 trug und hielt dies in in einem YOUTUBE-Video fest
Die Gewand-Abbildung in einer Abschrift auf Wikimedia Commons
[Einbettungscode von mir ergänzt KG]
Die Gewand-Abbildung in einer Abschrift auf Wikimedia Commons
[Einbettungscode von mir ergänzt KG]
Hans Luneborch - am Montag, 13. Mai 2013, 15:01
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die ersten 15 Bände sind online, darunter:
Scholz, Leander/Pompe, Hedwig (Hg.): Archivprozesse. Die Kommunikation der Aufbewahrung. (=Mediologie; 5) Köln: DuMont 2002.
http://www.fk-427.de/Profil/Mediologie-5
http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/2372
Aus dem Inhalt:
Klaus Militzer: Entstehung und Bildung von Archiven in Köln
während des Mittelalters
Wolfgang Ernst
ROM 1881: Die Medialität des Vatikanischen Geheimarchivs
als Gesetz der Historie
Und ein Zitat aus der Einleitung, das verstehe, wer will: "Die Überschreitung von Ort und Gesetz des Archivs (die Topo-Nomologie, wie es bei Derrida heißt) stattet die Medien des Archivs wie die Medien im Archiv mit wechselseitiger Verweiskraft aus. Die Einschreibung in den Körper ist dabei eine der machtvollsten Archivinskriptionen, die Gedächtnisfunktionen als evidenten Bestandteil kultureller Praxen zeigt. Die Bannung des Unheimlichen mittels Archivierung macht das natürliche, das erste Medium, den menschlichen Körper, zum Ort der Erzeugung desselben: Erscheinungen aus dem Jenseits, von Geistern, von Untoten."
Via
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/404098052/
Scholz, Leander/Pompe, Hedwig (Hg.): Archivprozesse. Die Kommunikation der Aufbewahrung. (=Mediologie; 5) Köln: DuMont 2002.
http://www.fk-427.de/Profil/Mediologie-5
http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/2372
Aus dem Inhalt:
Klaus Militzer: Entstehung und Bildung von Archiven in Köln
während des Mittelalters
Wolfgang Ernst
ROM 1881: Die Medialität des Vatikanischen Geheimarchivs
als Gesetz der Historie
Und ein Zitat aus der Einleitung, das verstehe, wer will: "Die Überschreitung von Ort und Gesetz des Archivs (die Topo-Nomologie, wie es bei Derrida heißt) stattet die Medien des Archivs wie die Medien im Archiv mit wechselseitiger Verweiskraft aus. Die Einschreibung in den Körper ist dabei eine der machtvollsten Archivinskriptionen, die Gedächtnisfunktionen als evidenten Bestandteil kultureller Praxen zeigt. Die Bannung des Unheimlichen mittels Archivierung macht das natürliche, das erste Medium, den menschlichen Körper, zum Ort der Erzeugung desselben: Erscheinungen aus dem Jenseits, von Geistern, von Untoten."
Via
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/404098052/
KlausGraf - am Montag, 13. Mai 2013, 13:07 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ich habe dem Handschriftencensus eine Frist gesetzt, entweder die lang angemahnte Korrektur in
http://www.handschriftencensus.de/16013
vorzunehmen oder meinen Namen in dem Eintrag zu streichen. Seit vielen Monaten wird keine Ergänzung von mir in den Census eingearbeitet.
Rolf Götz, Die Herzöge von Teck. Herzöge ohne Herzogtum (Schriftenreihe des Stadtarchivs Kirchheim unter Teck 33), Kirchheim unter Teck 2009, S. 97-273, 889-904, hier S. 897 Anm. 508 ist natürlich völliger Unsinn. Es handelt sich um die Stadtgeschichte "Kirchheim unter Teck" 2006, was das unsägliche DLL, über das Volker Honemann in der ZfdA fast alles Nötige gesagt hat (PDF kann ich gern abgeben), nicht abgehalten hat, diese wohl seit 2009 im Census verewigte Falschangabe ohne Überprüfung einfach abzuschreiben:
http://books.google.de/books?id=nzqLp6td3z4C&pg=PA45
Aus der Endnote 508 ergibt sich, dass Götz die Kenntnis der Sönke Lorenz (²VL 2004) unbekannten Zweitüberlieferung des Kremerin-Berichts in der Handschrift des Wiener Schottenklosters mir verdankte. Er zitierte die Beschreibung Hübls, in der ich schon vor über 30 Jahren (nämlich laut meiner Kladde 1979) auf die Handschrift gestoßen war:
http://www.manuscripta.at/_scripts/php/digi_books.php?cat=huebl&page_fn=B253
In der Arbeit von Heike Uffmann 2008 liest man S. 260 Anm. 211: "Den Hinweis darauf verdanke ich Klaus Graf, der sie im Archiv des Wiener Schottenklosters ausfindig machte". Daraus ergibt sich wohl hinreichend, dass ich es war, der die Zweitüberlieferung der Kremerin in die Forschung eingeführt hat.
In wenigen Tagen findet eine Tagung zur Kremerin in Kirchheim statt, bei der die üblichen Verdächtigen sprechen:
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=21473
Es ist ein Jammer, dass Jeffrey Hamburger seinen Aufsatz über die Kremerin 2010 in DASH wegsperren lässt. Die unter "Kremer, Magdalena or Margareta Merin? (and workshop / und Werkstatt) Alsace / Elsass" laufenden illuminierten Handschriften sind aufgelistet unter
http://www.agfem-art.com/i-index-of-named-artists.html
Dort vermisst man aber einen Hinweis auf die Studie von Rolf Götz: Eine einmalige Gelegenheit. Handschriften aus dem Kirchheimer Kloster werden in St. Blasien ausgestellt, in: Beiträge zur Heimatkunde des Bezirks Kirchheim unter Teck 38 (Juli 1984), S. 3-8, der sich mit den beiden Kirchheimer Handschriften in St. Paul in Kärnten 71/1 und 62/1 befasste. Er stellt fest (S. 6), dass in der wohl um 1530 entstandenen Handschrift 71/1 zum 2. Oktober der Jahrtag der Magdalena Kremerin eingetragen ist und zwar von der Anlagehand, also nicht von dieser Nonne stammen kann. Das Chorbuch 62/1 sei wohl 1478 von den Reformschwestern aus dem Silokloster in Schlettstadt nach Kirchheim mitgebracht worden (S. 5).
Im Gegensatz zu den Ausführungen von Götz wird 71/1 von dem "Repertorium of Manuscripts" noch in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts gesetzt und der Kremerin-Gruppe zugewiesen. Ich denke, Götz hat Recht.
Wer den Reformbericht der Kremerin lesen will, muss noch immer die alte Ausgabe Sattlers zur Hand nehmen:
http://archive.org/stream/allgemeinegeschi05satt#page/172/mode/2up
Nachtrag: Zu einer Buchschenkung 1492 an Kirchheim siehe
http://archiv.twoday.net/stories/224317679/
Update: Hamburgers Aufsatz online - vielen Dank!
http://www.academia.edu/3717997/Magdalena_Kremer_Scribe_and_Painter_of_the_Choir_and_Chapter_Books_of_the_Dominican_Convent_of_St_Johannes-Baptista_in_Kirchheim_unter_Teck
Tagungsbericht:
http://www.teckbote.de/nachrichten/stadt-kreis_artikel,-Kremerin-macht-Kirchheim-beruehmt-_arid,78745.html
Zitat: "Auf eine weitere Kirchheimer Handschrift aus dem Umfeld der Klosterchronik ging Dr. Roland Deigendesch ein, früherer Kirchheimer und jetziger Reutlinger Stadtarchivar: auf den Nekrolog, der sich heute in Sankt Paul im österreichischen Lavanttal befindet. Die Datierung dieses Nekrologs ist nicht weniger einfach als die der Chronik. Während für die Chronik eine Entstehungszeit ab 1490 angenommen wird, geht Roland Deigendesch für den Nekrolog von einem Zeitraum zwischen 1500 und 1503 aus. Trotz einer erheblichen Distanz zur Reformzeit des Klosters hält er aber auch den Klosternekrolog für reformbezogen. Eine einzige Person ist übrigens im Nekrolog besonders hervorgehoben: Magdalena Kremerin. Diese Hervorhebung ist aber genauso rätselhaft wie alle anderen Nachrichten über diese Person. So tritt sie zu keinem Zeitpunkt deutlich als die Autorin der Chronik in Erscheinung, als die sie seit langem angesehen wird. Ebenfalls ungeklärt ist die Frage, ob eine Priorin namens Magdalena, die auf Barbara Bernheimerin folgte, identisch ist mit der Kremerin oder ob es sich um eine andere Magdalena handelt."
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=5040
Update:
chotten.hypotheses.org/512
 Stuttgarter Handschrift des Reformberichts (um 1490)
Stuttgarter Handschrift des Reformberichts (um 1490)
http://www.handschriftencensus.de/16013
vorzunehmen oder meinen Namen in dem Eintrag zu streichen. Seit vielen Monaten wird keine Ergänzung von mir in den Census eingearbeitet.
Rolf Götz, Die Herzöge von Teck. Herzöge ohne Herzogtum (Schriftenreihe des Stadtarchivs Kirchheim unter Teck 33), Kirchheim unter Teck 2009, S. 97-273, 889-904, hier S. 897 Anm. 508 ist natürlich völliger Unsinn. Es handelt sich um die Stadtgeschichte "Kirchheim unter Teck" 2006, was das unsägliche DLL, über das Volker Honemann in der ZfdA fast alles Nötige gesagt hat (PDF kann ich gern abgeben), nicht abgehalten hat, diese wohl seit 2009 im Census verewigte Falschangabe ohne Überprüfung einfach abzuschreiben:
http://books.google.de/books?id=nzqLp6td3z4C&pg=PA45
Aus der Endnote 508 ergibt sich, dass Götz die Kenntnis der Sönke Lorenz (²VL 2004) unbekannten Zweitüberlieferung des Kremerin-Berichts in der Handschrift des Wiener Schottenklosters mir verdankte. Er zitierte die Beschreibung Hübls, in der ich schon vor über 30 Jahren (nämlich laut meiner Kladde 1979) auf die Handschrift gestoßen war:
http://www.manuscripta.at/_scripts/php/digi_books.php?cat=huebl&page_fn=B253
In der Arbeit von Heike Uffmann 2008 liest man S. 260 Anm. 211: "Den Hinweis darauf verdanke ich Klaus Graf, der sie im Archiv des Wiener Schottenklosters ausfindig machte". Daraus ergibt sich wohl hinreichend, dass ich es war, der die Zweitüberlieferung der Kremerin in die Forschung eingeführt hat.
In wenigen Tagen findet eine Tagung zur Kremerin in Kirchheim statt, bei der die üblichen Verdächtigen sprechen:
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=21473
Es ist ein Jammer, dass Jeffrey Hamburger seinen Aufsatz über die Kremerin 2010 in DASH wegsperren lässt. Die unter "Kremer, Magdalena or Margareta Merin? (and workshop / und Werkstatt) Alsace / Elsass" laufenden illuminierten Handschriften sind aufgelistet unter
http://www.agfem-art.com/i-index-of-named-artists.html
Dort vermisst man aber einen Hinweis auf die Studie von Rolf Götz: Eine einmalige Gelegenheit. Handschriften aus dem Kirchheimer Kloster werden in St. Blasien ausgestellt, in: Beiträge zur Heimatkunde des Bezirks Kirchheim unter Teck 38 (Juli 1984), S. 3-8, der sich mit den beiden Kirchheimer Handschriften in St. Paul in Kärnten 71/1 und 62/1 befasste. Er stellt fest (S. 6), dass in der wohl um 1530 entstandenen Handschrift 71/1 zum 2. Oktober der Jahrtag der Magdalena Kremerin eingetragen ist und zwar von der Anlagehand, also nicht von dieser Nonne stammen kann. Das Chorbuch 62/1 sei wohl 1478 von den Reformschwestern aus dem Silokloster in Schlettstadt nach Kirchheim mitgebracht worden (S. 5).
Im Gegensatz zu den Ausführungen von Götz wird 71/1 von dem "Repertorium of Manuscripts" noch in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts gesetzt und der Kremerin-Gruppe zugewiesen. Ich denke, Götz hat Recht.
Wer den Reformbericht der Kremerin lesen will, muss noch immer die alte Ausgabe Sattlers zur Hand nehmen:
http://archive.org/stream/allgemeinegeschi05satt#page/172/mode/2up
Nachtrag: Zu einer Buchschenkung 1492 an Kirchheim siehe
http://archiv.twoday.net/stories/224317679/
Update: Hamburgers Aufsatz online - vielen Dank!
http://www.academia.edu/3717997/Magdalena_Kremer_Scribe_and_Painter_of_the_Choir_and_Chapter_Books_of_the_Dominican_Convent_of_St_Johannes-Baptista_in_Kirchheim_unter_Teck
Tagungsbericht:
http://www.teckbote.de/nachrichten/stadt-kreis_artikel,-Kremerin-macht-Kirchheim-beruehmt-_arid,78745.html
Zitat: "Auf eine weitere Kirchheimer Handschrift aus dem Umfeld der Klosterchronik ging Dr. Roland Deigendesch ein, früherer Kirchheimer und jetziger Reutlinger Stadtarchivar: auf den Nekrolog, der sich heute in Sankt Paul im österreichischen Lavanttal befindet. Die Datierung dieses Nekrologs ist nicht weniger einfach als die der Chronik. Während für die Chronik eine Entstehungszeit ab 1490 angenommen wird, geht Roland Deigendesch für den Nekrolog von einem Zeitraum zwischen 1500 und 1503 aus. Trotz einer erheblichen Distanz zur Reformzeit des Klosters hält er aber auch den Klosternekrolog für reformbezogen. Eine einzige Person ist übrigens im Nekrolog besonders hervorgehoben: Magdalena Kremerin. Diese Hervorhebung ist aber genauso rätselhaft wie alle anderen Nachrichten über diese Person. So tritt sie zu keinem Zeitpunkt deutlich als die Autorin der Chronik in Erscheinung, als die sie seit langem angesehen wird. Ebenfalls ungeklärt ist die Frage, ob eine Priorin namens Magdalena, die auf Barbara Bernheimerin folgte, identisch ist mit der Kremerin oder ob es sich um eine andere Magdalena handelt."
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=5040
Update:
chotten.hypotheses.org/512
 Stuttgarter Handschrift des Reformberichts (um 1490)
Stuttgarter Handschrift des Reformberichts (um 1490)KlausGraf - am Montag, 13. Mai 2013, 01:51 - Rubrik: Landesgeschichte
Umfasst derzeit Beschreibungen für 146 Handschriften:
http://www.agfem-art.com/index.html
Ärgerlich, dass man auf Links zum Handschriftencensus (und natürlich auf Links zu online verfügbaren Quellen) verzichtet hat.
Dieser bietet in Sachen Nonnenkunst nur Erbärmliches. Zu Sibylla von Bondorfs BL Cod. Add. 15710 hat er als einzige Literaturangabe nur Priebsch, während das vorliegende Repertorium (Stand 2010) eine ganze Reihe von Titeln anführt, wobei zu ergänzen wäre Winston-Allen in: Schreiben und Lesen in der Stadt (2012), s. Handschriftenregister.
 Londoner Handschrift Add. 15710 Sibyllas.
Londoner Handschrift Add. 15710 Sibyllas.
http://www.agfem-art.com/index.html
Ärgerlich, dass man auf Links zum Handschriftencensus (und natürlich auf Links zu online verfügbaren Quellen) verzichtet hat.
Dieser bietet in Sachen Nonnenkunst nur Erbärmliches. Zu Sibylla von Bondorfs BL Cod. Add. 15710 hat er als einzige Literaturangabe nur Priebsch, während das vorliegende Repertorium (Stand 2010) eine ganze Reihe von Titeln anführt, wobei zu ergänzen wäre Winston-Allen in: Schreiben und Lesen in der Stadt (2012), s. Handschriftenregister.
 Londoner Handschrift Add. 15710 Sibyllas.
Londoner Handschrift Add. 15710 Sibyllas.KlausGraf - am Montag, 13. Mai 2013, 01:15 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://zenodo.org/ ist ein neues Open-Access- und Forschungsdaten-Repositorium für alle Felder von "Science".
http://zenodo.org/
Ob Science auch Humanities meint und ob nur englische Beiträge erwünscht sind, darüber schweigt sich das Repositorium aus.
Die Suche ist jedenfalls Murks bzw. funktioniert nicht, da ich anscheinend immer die Fehlermeldung oben erhalte, auch wenn ich einen der vorgeschlagenen Begriffe anklicke und Begriffe wähle (wie catalog), die garantiert in den Metadaten von Uploads vorkommen.
http://zenodo.org/
Ob Science auch Humanities meint und ob nur englische Beiträge erwünscht sind, darüber schweigt sich das Repositorium aus.
Die Suche ist jedenfalls Murks bzw. funktioniert nicht, da ich anscheinend immer die Fehlermeldung oben erhalte, auch wenn ich einen der vorgeschlagenen Begriffe anklicke und Begriffe wähle (wie catalog), die garantiert in den Metadaten von Uploads vorkommen.
KlausGraf - am Montag, 13. Mai 2013, 00:11 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Kurzsichtigkeit der Kölner Stadtpolitiker, die jetzt einen Planungsstopp für das Kölner Stadtarchiv wollen und die Integration der gemeinsamen Museumsbibliothek in Frage stellen, ist schändlich. Es geht nicht um ein Luxusarchiv, sondern darum, dass das durch die größte Archivkatastrophe in Deutschland nach 1945 gebeutelte Stadtarchiv zuverlässige bauliche Grundlagen bekommt. Unsinnig ist es, an eine Zerschlagung der gemeinsamen Museumsbibliothek zu denken, die als weiterer Nutzer des geplanten Neubaus sinnvollerweise vorgesehen wurde.
Nach fulminantem Auftakt stagniert die von Thomas Wolf initiierte Petition, die nach Erreichen von 5000 Stimmen verlängert wurde und gerade mal bei gut 5400 Stimmen dümpelt.
https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-die-aufhebung-des-planungsstopps-fuer-den-neubau-des-historischen-archivs-der-stadt-koeln
Wir müssen alle mehr unsere Netzwerke aktivieren!. Es kann doch nicht sein, dass ich bei gut 1000 Followern auf Twitter und 2000 auf G+ durch unzähliges Teilen der Petition oder von Beiträgen zu ihr nur gefühlt jeweils eine Handvoll Leute motivieren konnte, die Nachricht weiterzuverbreiten.
So sehr mich das auch freut, dass Archivalia mit deutlichem Abstand die wichtigste Online-Quelle darstellt, über die Zeichner der Petition auf die Seite kommen, so fragwürdig ist dieser Befund. Wieso konnte die Online-Presse (einschließlich der Kölner) nicht für einen Link gewonnen werden? Wieso gibt es keine Links von Twitter, Facebook oder Google+ (oder wurden diese nicht berücksichtigt)?
Bitte unterstützen Sie unser Anliegen, indem Sie Ihre Kontakte um Zeichnung der Petition bitten. Auch wenn Sie meinen, schon genug getan zu haben.
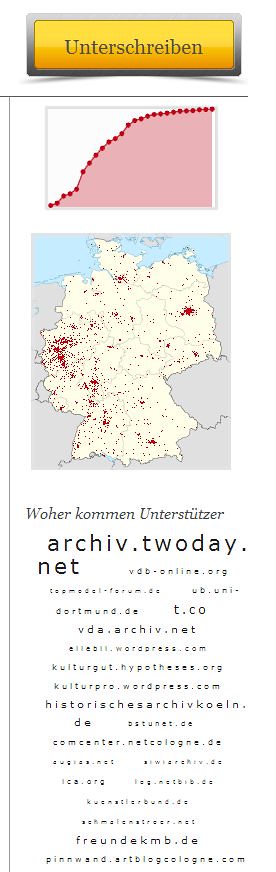
Nach fulminantem Auftakt stagniert die von Thomas Wolf initiierte Petition, die nach Erreichen von 5000 Stimmen verlängert wurde und gerade mal bei gut 5400 Stimmen dümpelt.
https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-die-aufhebung-des-planungsstopps-fuer-den-neubau-des-historischen-archivs-der-stadt-koeln
Wir müssen alle mehr unsere Netzwerke aktivieren!. Es kann doch nicht sein, dass ich bei gut 1000 Followern auf Twitter und 2000 auf G+ durch unzähliges Teilen der Petition oder von Beiträgen zu ihr nur gefühlt jeweils eine Handvoll Leute motivieren konnte, die Nachricht weiterzuverbreiten.
So sehr mich das auch freut, dass Archivalia mit deutlichem Abstand die wichtigste Online-Quelle darstellt, über die Zeichner der Petition auf die Seite kommen, so fragwürdig ist dieser Befund. Wieso konnte die Online-Presse (einschließlich der Kölner) nicht für einen Link gewonnen werden? Wieso gibt es keine Links von Twitter, Facebook oder Google+ (oder wurden diese nicht berücksichtigt)?
Bitte unterstützen Sie unser Anliegen, indem Sie Ihre Kontakte um Zeichnung der Petition bitten. Auch wenn Sie meinen, schon genug getan zu haben.
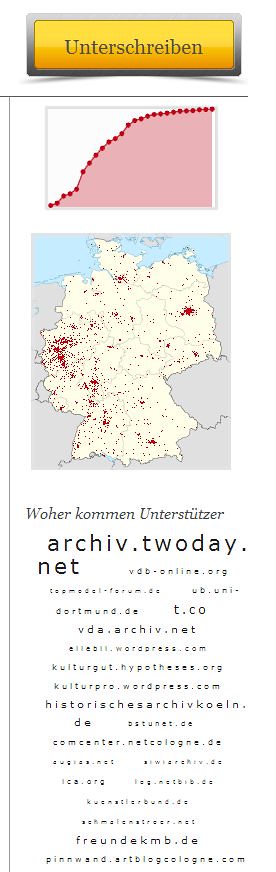
KlausGraf - am Sonntag, 12. Mai 2013, 23:32 - Rubrik: Kommunalarchive
Weder kann ich Türkisch noch sind meine extrem rudimentären Kenntnisse des Italienischen ausreichend, um eine ausgiebige Lektüre der offenkundig reichen Sekundärliteratur zur Eroberung von Otranto 1480 durch ein osmanisches Aufgebot aussichtsreich erscheinen zu lassen. Zudem sind nur wenige substantielle Informationen online verfügbar. Auf Anhieb ergoogelt man nur unkritische und unbelegte erbauliche Texte.
Angeblich sollen die Türken am 14. August 1480 800 Bürger, angeführt von Antonio Primaldo, hingerichtet haben, nachdem sie sich geweigert hatten, zum Islam überzutreten. Am heutigen 12. Mai hat Papst Franziskus die 800 Märtyrer von Otranto heiliggesprochen:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/05/12/%E2%80%9Eletztlich_haben_sie_europa_gerettet...%E2%80%9C/ted-691353
Auch wenn man zugestehen muss, dass die entscheidenden Weichen sein Vorgänger gestellt hatte, so ist doch mehr als nur ein Fragezeichen hinsichtlich der Kanonisation angebracht. Über die theologische Berechtigung, eine Lebensleistung auf eine einzige Entscheidung zu reduzieren, unabhängig davon, aus welchen Motiven diese erfolgt sein mag (außer dem von Primaldo ist kein anderer Name der Märtyrer bekannt), möchte ich mich nicht auslassen. Die Heiligsprechung ist jedoch ein verhängnisvolles Signal in Richtung Islam und Türkei, zumal erhebliche Zweifel an der hagiographischen Darstellung bestehen.
Zuverlässige Informationen sucht man in den Artikeln, die die einzelnen Sprachversionen der Wikipedia den Märtyrern gewidmet haben, vergebens. Typisch ist der deutschsprachige Artikel, der durch das Unterdrücken abweichender Meinungen eklatant gegen den Neutralitäts-Grundsatz der Wikipedia verstößt. Der fromme Glaube darf gern referiert werden, aber die Zweifel der Historiker müssen ebenfalls genannt werden. Alle Weblinks sind unbrauchbar, da sie nicht auf zuverlässig belegte Quellen verweisen.
Seite „Märtyrer von Otranto“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. Mai 2013, 14:18 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A4rtyrer_von_Otranto&oldid=118434444 (Abgerufen: 12. Mai 2013, 16:13 UTC)
Immerhin wird auf das Ökumenische Heiligenlexikon verlinkt, in dem es heißt:
"Viele Geschichtsforscher sehen die Toten heute als Opfer der Kämpfe, wofür entsprechende Verletzungen an manchen Schädeln sprechen. In der Regel haben die Osmanen ihre unterworfenen christlichen Gegner nicht um ihres anderen Glaubens willen getötet, sondern gemäß Sure 9, Vers 29 des Korans mit einer besonderen Steuer - der Dschizya - belegt. 2007 wurde in Otranto ein großer Kongress zu dieser Frage abgehalten, der die Zweifel an der traditionellen Auffassung deutlich verstärkte."
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienM/Maertyrer_von_Otranto.html
Die dort als "Quellen" angegebenen Internetlinks sind aber ebenfalls nicht zu verwenden. Eine deutliche Distanzierung von der Legende bietet der Wikipedia-Artikel über den Otranto-Feldzug. Dort liest man in einer Fußnote:
"Diese traditionelle Überlieferung wird durch neuere Forschungen massiv in Zweifel gezogen; vergleiche dazu etwa: * Hubert Houben (Hrsg.), La conquista turca di Otranto (1480) tra storia e mito. Atti del Convegno internazionale di studio Otranto - Muro Leccese, 28-31 marzo 2007", 2 Bände, Congedo, Galatina 2008, ISBN 9788880868309 und ISBN 9788880868293 "
Seite „Otranto-Feldzug“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 24. April 2013, 12:59 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Otranto-Feldzug&oldid=117857280 (Abgerufen: 12. Mai 2013, 16:20 UTC)
Trotzdem hat man eine unsäglich unkritische Darstellung von Sandro Magister als einzigen Weblink und in die Einzelnachweise aufgenommen. Interessant sind Hinweise auf der Diskussionsseite des Artikels:
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Otranto-Feldzug
Leider kann der Wikipedianer Ruggero1 nicht mehr zu seinen Forschungen befragt werden, da er 2011 verstorben ist.
Bedauerlicherweise bleiben die Online-Rezensionen der genannten Tagungsakten von 2008 oberflächlich und werten die Ergebnisse mit Bezug auf unsere Thematik (dem "Mythos" Otranto) nicht aus:
http://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/quellen-und-forschungen-aus-italienischen-archiven-und-bibliotheken/89-2009/89/ReviewMonograph549282880
http://www.sehepunkte.de/2010/04/15733.html
Nicht weniger oberflächlich ist meine folgende Linksammlung:
http://www.fondazioneterradotranto.it/2013/02/10/martiri-di-otranto-una-ferita-ancora-aperta-2/ Artikel von 2010, der auf die unterschiedlichen Interpretationen hinweist
http://books.google.de/books?id=DptVGd1bPkQC Quellenausgabe humanistischer Texte im Auszug
http://books.google.de/books?id=8tsPtfioqRIC&pg=PT104
http://books.google.de/books?id=8tsPtfioqRIC&pg=PT131 Englische Arbeit von 2005 im Auszug, Hinweise auf Quellen und Literatur (keine Seitenzahlen im Digitalisat!)
http://books.google.de/books?id=hAZXbneOJA4C&pg=PA33 Italienische Darstellung im Auszug u.a. mit Hinweis auf einen französischen Artikel in Turcica 2002
http://archive.org/stream/actasanctorum37unse#page/n215/mode/2up
Acta Sanctorum August III (Erstausgabe 1737) "De BB. martyribus Hydruntinis"
http://books.google.de/books?id=s8s-AAAAcAAJ&pg=PA179 (Erstausgabe)
http://www.unilu.ch/files/hauptseminararbeit_tuerkenbilder.pdf Seminararbeit zur Gräuelpropaganda im Fall Otranto
http://mjh.akdeniz.edu.tr/haldun-eroglu Artikel eines türkischen Historikers über den Feldzug 1480, aber im Internet unbrauchbar, da das PDF nicht alle Seiten enthält! Ohne Kennzeichnung sind alle diese PDFs der Zeitschrift nur Leseproben!
Nachträge:
https://archive.org/details/ArchivioStoricoPerLeProvinceNapolet1881 Edition von Foucard von Dokumenten aus dem Staatsarchiv Modena im Archivio storico per le province napoletane 6 (1881), S. 74-176, 609-628 (freundlicher Hinweis von Hubert Houben, mit dem ich ein Mailinterview führte, das hier bald erscheinen wird).
http://culturasalentina.files.wordpress.com/2010/09/aspettidistoriamilitarenellaguerradotranto.pdf Schrift von Scarpelle (it.) zu militärgeschichtlichen Aspekten
http://www.italiamedievale.org/sito_acim/contributi/RM-Corongiu-Maometto.pdf Aufsatz von Corongiu (ital.) über die letzten Jahre Mehmeds II.
http://emeroteca.provincia.brindisi.it/Brundisii%20Res/1978/articoli/Brindisi%20durante%20l'Invasione%20Turca%20di%20Otranto.pdf Aufsatz (ital.) über Brindisi während der Besetzung Otrantos
http://books.google.de/books?id=Cqzr0Phl9ZsC&pg=PA93 Auszug aus: Europas Grenzen (2006). Der Aufsatz von Peter Thorau über den osmanischen Einfall 1480/81 ist komplett einsehbar
http://books.google.de/books?id=QNQoCqPmZkIC&pg=PA158
http://books.google.de/books?id=QNQoCqPmZkIC&pg=PA260
Auszüge aus Bisaha 2004 (engl.) zur Quellenproblematik der 800 Märtyrer
http://books.google.de/books?id=zjFv_SkqOkcC&pg=PA302 Aufsatz über den Erzbischof Agricoli, Auszug
Eine dritte Darstellung der Märyrer in der dt. Wikipedia (neben den oben zitierten beiden anderen) ist bemerkenswert:
Seite „Otranto“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Mai 2013, 16:25 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Otranto&oldid=118538845 (Abgerufen: 15. Mai 2013, 18:23 UTC)
Update 16. Mai 2013: Das Interview mit Hubert Houben bestätigt die hier geäußerten Zweifel:
http://archiv.twoday.net/stories/404099608/
=
http://frueheneuzeit.hypotheses.org/1417
 Foto: Laurent Massoptier (see website: http://loloieg.free.fr ) http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.it
Foto: Laurent Massoptier (see website: http://loloieg.free.fr ) http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.it
Angeblich sollen die Türken am 14. August 1480 800 Bürger, angeführt von Antonio Primaldo, hingerichtet haben, nachdem sie sich geweigert hatten, zum Islam überzutreten. Am heutigen 12. Mai hat Papst Franziskus die 800 Märtyrer von Otranto heiliggesprochen:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/05/12/%E2%80%9Eletztlich_haben_sie_europa_gerettet...%E2%80%9C/ted-691353
Auch wenn man zugestehen muss, dass die entscheidenden Weichen sein Vorgänger gestellt hatte, so ist doch mehr als nur ein Fragezeichen hinsichtlich der Kanonisation angebracht. Über die theologische Berechtigung, eine Lebensleistung auf eine einzige Entscheidung zu reduzieren, unabhängig davon, aus welchen Motiven diese erfolgt sein mag (außer dem von Primaldo ist kein anderer Name der Märtyrer bekannt), möchte ich mich nicht auslassen. Die Heiligsprechung ist jedoch ein verhängnisvolles Signal in Richtung Islam und Türkei, zumal erhebliche Zweifel an der hagiographischen Darstellung bestehen.
Zuverlässige Informationen sucht man in den Artikeln, die die einzelnen Sprachversionen der Wikipedia den Märtyrern gewidmet haben, vergebens. Typisch ist der deutschsprachige Artikel, der durch das Unterdrücken abweichender Meinungen eklatant gegen den Neutralitäts-Grundsatz der Wikipedia verstößt. Der fromme Glaube darf gern referiert werden, aber die Zweifel der Historiker müssen ebenfalls genannt werden. Alle Weblinks sind unbrauchbar, da sie nicht auf zuverlässig belegte Quellen verweisen.
Seite „Märtyrer von Otranto“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. Mai 2013, 14:18 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A4rtyrer_von_Otranto&oldid=118434444 (Abgerufen: 12. Mai 2013, 16:13 UTC)
Immerhin wird auf das Ökumenische Heiligenlexikon verlinkt, in dem es heißt:
"Viele Geschichtsforscher sehen die Toten heute als Opfer der Kämpfe, wofür entsprechende Verletzungen an manchen Schädeln sprechen. In der Regel haben die Osmanen ihre unterworfenen christlichen Gegner nicht um ihres anderen Glaubens willen getötet, sondern gemäß Sure 9, Vers 29 des Korans mit einer besonderen Steuer - der Dschizya - belegt. 2007 wurde in Otranto ein großer Kongress zu dieser Frage abgehalten, der die Zweifel an der traditionellen Auffassung deutlich verstärkte."
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienM/Maertyrer_von_Otranto.html
Die dort als "Quellen" angegebenen Internetlinks sind aber ebenfalls nicht zu verwenden. Eine deutliche Distanzierung von der Legende bietet der Wikipedia-Artikel über den Otranto-Feldzug. Dort liest man in einer Fußnote:
"Diese traditionelle Überlieferung wird durch neuere Forschungen massiv in Zweifel gezogen; vergleiche dazu etwa: * Hubert Houben (Hrsg.), La conquista turca di Otranto (1480) tra storia e mito. Atti del Convegno internazionale di studio Otranto - Muro Leccese, 28-31 marzo 2007", 2 Bände, Congedo, Galatina 2008, ISBN 9788880868309 und ISBN 9788880868293 "
Seite „Otranto-Feldzug“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 24. April 2013, 12:59 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Otranto-Feldzug&oldid=117857280 (Abgerufen: 12. Mai 2013, 16:20 UTC)
Trotzdem hat man eine unsäglich unkritische Darstellung von Sandro Magister als einzigen Weblink und in die Einzelnachweise aufgenommen. Interessant sind Hinweise auf der Diskussionsseite des Artikels:
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Otranto-Feldzug
Leider kann der Wikipedianer Ruggero1 nicht mehr zu seinen Forschungen befragt werden, da er 2011 verstorben ist.
Bedauerlicherweise bleiben die Online-Rezensionen der genannten Tagungsakten von 2008 oberflächlich und werten die Ergebnisse mit Bezug auf unsere Thematik (dem "Mythos" Otranto) nicht aus:
http://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/quellen-und-forschungen-aus-italienischen-archiven-und-bibliotheken/89-2009/89/ReviewMonograph549282880
http://www.sehepunkte.de/2010/04/15733.html
Nicht weniger oberflächlich ist meine folgende Linksammlung:
http://www.fondazioneterradotranto.it/2013/02/10/martiri-di-otranto-una-ferita-ancora-aperta-2/ Artikel von 2010, der auf die unterschiedlichen Interpretationen hinweist
http://books.google.de/books?id=DptVGd1bPkQC Quellenausgabe humanistischer Texte im Auszug
http://books.google.de/books?id=8tsPtfioqRIC&pg=PT104
http://books.google.de/books?id=8tsPtfioqRIC&pg=PT131 Englische Arbeit von 2005 im Auszug, Hinweise auf Quellen und Literatur (keine Seitenzahlen im Digitalisat!)
http://books.google.de/books?id=hAZXbneOJA4C&pg=PA33 Italienische Darstellung im Auszug u.a. mit Hinweis auf einen französischen Artikel in Turcica 2002
http://archive.org/stream/actasanctorum37unse#page/n215/mode/2up
Acta Sanctorum August III (Erstausgabe 1737) "De BB. martyribus Hydruntinis"
http://books.google.de/books?id=s8s-AAAAcAAJ&pg=PA179 (Erstausgabe)
http://www.unilu.ch/files/hauptseminararbeit_tuerkenbilder.pdf Seminararbeit zur Gräuelpropaganda im Fall Otranto
http://mjh.akdeniz.edu.tr/haldun-eroglu Artikel eines türkischen Historikers über den Feldzug 1480, aber im Internet unbrauchbar, da das PDF nicht alle Seiten enthält! Ohne Kennzeichnung sind alle diese PDFs der Zeitschrift nur Leseproben!
Nachträge:
https://archive.org/details/ArchivioStoricoPerLeProvinceNapolet1881 Edition von Foucard von Dokumenten aus dem Staatsarchiv Modena im Archivio storico per le province napoletane 6 (1881), S. 74-176, 609-628 (freundlicher Hinweis von Hubert Houben, mit dem ich ein Mailinterview führte, das hier bald erscheinen wird).
http://culturasalentina.files.wordpress.com/2010/09/aspettidistoriamilitarenellaguerradotranto.pdf Schrift von Scarpelle (it.) zu militärgeschichtlichen Aspekten
http://www.italiamedievale.org/sito_acim/contributi/RM-Corongiu-Maometto.pdf Aufsatz von Corongiu (ital.) über die letzten Jahre Mehmeds II.
http://emeroteca.provincia.brindisi.it/Brundisii%20Res/1978/articoli/Brindisi%20durante%20l'Invasione%20Turca%20di%20Otranto.pdf Aufsatz (ital.) über Brindisi während der Besetzung Otrantos
http://books.google.de/books?id=Cqzr0Phl9ZsC&pg=PA93 Auszug aus: Europas Grenzen (2006). Der Aufsatz von Peter Thorau über den osmanischen Einfall 1480/81 ist komplett einsehbar
http://books.google.de/books?id=QNQoCqPmZkIC&pg=PA158
http://books.google.de/books?id=QNQoCqPmZkIC&pg=PA260
Auszüge aus Bisaha 2004 (engl.) zur Quellenproblematik der 800 Märtyrer
http://books.google.de/books?id=zjFv_SkqOkcC&pg=PA302 Aufsatz über den Erzbischof Agricoli, Auszug
Eine dritte Darstellung der Märyrer in der dt. Wikipedia (neben den oben zitierten beiden anderen) ist bemerkenswert:
Seite „Otranto“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Mai 2013, 16:25 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Otranto&oldid=118538845 (Abgerufen: 15. Mai 2013, 18:23 UTC)
Update 16. Mai 2013: Das Interview mit Hubert Houben bestätigt die hier geäußerten Zweifel:
http://archiv.twoday.net/stories/404099608/
=
http://frueheneuzeit.hypotheses.org/1417
 Foto: Laurent Massoptier (see website: http://loloieg.free.fr ) http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.it
Foto: Laurent Massoptier (see website: http://loloieg.free.fr ) http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.itKlausGraf - am Sonntag, 12. Mai 2013, 17:37 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
http://kulturgut.hypotheses.org/194
"Sotheby’s hat seinen Katalog für die Auktion am 5. Juni 2013 schon ins Netz gestellt, bei der 142 kostbare Stücke, darunter auch Handschriften, aus der Mendham-Collection unter den Hammer kommen werden. Nichts scheint die Law Society of England and Wales von ihrem barbarischen Vorhaben, die traditionsreiche Sammlung Joseph Mendhams (1769-1856), die sich seit 1984 als Leihgabe in der Canterbury Cathedral Library befindet, zu zerreißen, abbringen zu können. Eine Petition, die noch läuft, sammelte 4000 Unterschriften. Schon im letzten Jahr formierten sich die Proteste (siehe Otto Vervaart und Meldungen in Archivalia vom Sommer 2012: 1, 2).
Ein gerade veröffentlichter Leserbrief an die TIMES wurde auch von British-Library-CEO Roly Keating unterzeichnet. Darin heißt es: The collection, formed by Joseph Mendham (1769-1856), a Church of England clergyman at Sutton Coldfield, comprises 12 medieval and post-medieval manuscripts and 5,000 books published between 1450 and 1850, many not held in the British Library or other national collections. It constitutes a rich and coherent resource for both Protestant and Catholic history. The collection was gifted by Sophia Mendham to the society in 1869 on the understanding that it would be kept together indefinitely, and accepted by the society on that basis. Had the society not accepted this provision, the collection would have been gifted to King’s College London. More than a century later, in recognition of the collection’s national importance, the British Library awarded a grant to catalogue it with the expectation that it would not subsequently be dispersed.
Schon ein kurzer Blick in den Sotheby’s-Katalog genügt, um zu erkennen, welche Schätze mutmaßlich in Privatschatullen verschwinden werden. Da ist etwa die Nr. 76, eine in Deventer gedruckte Inkunabel, ein Unicum aus dem Besitz des Eichstätter Kanonikers Bernhard Adelmann von Adelmannsfelden. Seit 2005 weiß man, dass der Gmünder Franziskanerkonvent die Bücher Adelmanns angekauft hatte, die im frühen 19. Jahrhundert an den Frankfurter Sammler Georg Kloß gelangten, der auch als Vorbesitzer der jetzt verkauften Inkunabel erscheint. Außer den Büchern in der Bodleiana kennt Needhams IPI nur drei Stücke aus Bernhards Bibliothek."
http://archiv.twoday.net/search?q=mendham+collection
"Sotheby’s hat seinen Katalog für die Auktion am 5. Juni 2013 schon ins Netz gestellt, bei der 142 kostbare Stücke, darunter auch Handschriften, aus der Mendham-Collection unter den Hammer kommen werden. Nichts scheint die Law Society of England and Wales von ihrem barbarischen Vorhaben, die traditionsreiche Sammlung Joseph Mendhams (1769-1856), die sich seit 1984 als Leihgabe in der Canterbury Cathedral Library befindet, zu zerreißen, abbringen zu können. Eine Petition, die noch läuft, sammelte 4000 Unterschriften. Schon im letzten Jahr formierten sich die Proteste (siehe Otto Vervaart und Meldungen in Archivalia vom Sommer 2012: 1, 2).
Ein gerade veröffentlichter Leserbrief an die TIMES wurde auch von British-Library-CEO Roly Keating unterzeichnet. Darin heißt es: The collection, formed by Joseph Mendham (1769-1856), a Church of England clergyman at Sutton Coldfield, comprises 12 medieval and post-medieval manuscripts and 5,000 books published between 1450 and 1850, many not held in the British Library or other national collections. It constitutes a rich and coherent resource for both Protestant and Catholic history. The collection was gifted by Sophia Mendham to the society in 1869 on the understanding that it would be kept together indefinitely, and accepted by the society on that basis. Had the society not accepted this provision, the collection would have been gifted to King’s College London. More than a century later, in recognition of the collection’s national importance, the British Library awarded a grant to catalogue it with the expectation that it would not subsequently be dispersed.
Schon ein kurzer Blick in den Sotheby’s-Katalog genügt, um zu erkennen, welche Schätze mutmaßlich in Privatschatullen verschwinden werden. Da ist etwa die Nr. 76, eine in Deventer gedruckte Inkunabel, ein Unicum aus dem Besitz des Eichstätter Kanonikers Bernhard Adelmann von Adelmannsfelden. Seit 2005 weiß man, dass der Gmünder Franziskanerkonvent die Bücher Adelmanns angekauft hatte, die im frühen 19. Jahrhundert an den Frankfurter Sammler Georg Kloß gelangten, der auch als Vorbesitzer der jetzt verkauften Inkunabel erscheint. Außer den Büchern in der Bodleiana kennt Needhams IPI nur drei Stücke aus Bernhards Bibliothek."
http://archiv.twoday.net/search?q=mendham+collection
In meinem Umfeld häufen sich panische Schreckensmeldungen: Man könne in HathiTrust mit US-Proxy keine Seiten mehr einsehen. Ich tendiere zwar zu der Ansicht, wer nicht auf die Idee kommt, alle Buttons mal auszuprobieren, habe den Zugriff auf die Inhalte nicht verdient, möchte aber trotzdem erklären, wie man (neben der nach wie vor bestehenden Möglichkeit, Einzelseiten als PDF herunterzuladen und damit auch anzusehen) wieder zu den Scans kommt. Man muss in der Buttonleiste links neben den Scans nur den vierten Button von oben anklicken.


KlausGraf - am Sonntag, 12. Mai 2013, 01:37 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die nach der neuseeländischen Canterbury-Universität benannte Rolle mit der Genealogie der englischen Könige wurde im 15. Jahrhundert geschrieben.
http://www.canterbury.ac.nz/canterburyroll/
http://antipodeanfootnotes.blogspot.ca/2013/04/noah-to-edward-iv-canterbury-roll.html?goback=.gde_2608822_member_239953284

http://www.canterbury.ac.nz/canterburyroll/
http://antipodeanfootnotes.blogspot.ca/2013/04/noah-to-edward-iv-canterbury-roll.html?goback=.gde_2608822_member_239953284

KlausGraf - am Samstag, 11. Mai 2013, 23:32 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ich habe den Wikipedia-Artikel überarbeitet: http://de.wikipedia.org/wiki/Dominikus_Debler
Viele Bilder aus seiner Chronik:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dominikus_Debler

Viele Bilder aus seiner Chronik:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dominikus_Debler

KlausGraf - am Samstag, 11. Mai 2013, 23:01 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Maria Rottler, der ich ungezählte Hinweise auch für dieses Blog verdanke, macht mich auf den bebilderten Bericht über den Besuch der Kettenbibliothek Zutphen aufmerksam:
http://medievalfragments.wordpress.com/2013/05/10/the-last-of-the-great-chained-libraries/
Vor einer Woche hatte ich selbst die Gelegenheit (als Reiseleiter einer Gruppe der VHS Speyer) eine ehemalige Kettenbibliothek zu besichtigen. Der Betreuer der evangelischen Nicolaus-Matz-Kirchenbibliothek, die sich unter der Obhut der Stadt Michelstadt befindet, Erwin Müller informierte uns anschaulich und ausführlich über die Schätze dieses Kleinods. Leider ist nur die Anbringung der Ketten bei den von Matz gestifteten Büchern noch sichtbar, die zu Demonstrationszwecken verwahrte Kette ist ein moderner Nachbau.
Zum Stifter und der Bibliothek:
http://de.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Matz#Die_Nicolaus-Matz-Bibliothek_.28Kirchenbibliothek.29_Michelstadt.
Fotos aus der Bibliothek:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Matz-Bibliothek
Fabian-Handbuch:
http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Nicolaus-Matz-Bibliothek
Zur gleichfalls protestantischen Kirchenbibliothek von Isny siehe
http://archiv.twoday.net/stories/142783537/
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/1022385780/
 Brandzeichen des Nikolaus Matz
Brandzeichen des Nikolaus Matz

 Moderne Demo-Kette in Michelstadt
Moderne Demo-Kette in Michelstadt
http://medievalfragments.wordpress.com/2013/05/10/the-last-of-the-great-chained-libraries/
Vor einer Woche hatte ich selbst die Gelegenheit (als Reiseleiter einer Gruppe der VHS Speyer) eine ehemalige Kettenbibliothek zu besichtigen. Der Betreuer der evangelischen Nicolaus-Matz-Kirchenbibliothek, die sich unter der Obhut der Stadt Michelstadt befindet, Erwin Müller informierte uns anschaulich und ausführlich über die Schätze dieses Kleinods. Leider ist nur die Anbringung der Ketten bei den von Matz gestifteten Büchern noch sichtbar, die zu Demonstrationszwecken verwahrte Kette ist ein moderner Nachbau.
Zum Stifter und der Bibliothek:
http://de.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Matz#Die_Nicolaus-Matz-Bibliothek_.28Kirchenbibliothek.29_Michelstadt.
Fotos aus der Bibliothek:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Matz-Bibliothek
Fabian-Handbuch:
http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Nicolaus-Matz-Bibliothek
Zur gleichfalls protestantischen Kirchenbibliothek von Isny siehe
http://archiv.twoday.net/stories/142783537/
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/1022385780/
 Brandzeichen des Nikolaus Matz
Brandzeichen des Nikolaus Matz
 Moderne Demo-Kette in Michelstadt
Moderne Demo-Kette in Michelstadtnoch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://archivalia.tumblr.com/post/50173210219/blog-access-has-been-restricted-as-noted mit Link zur Mailingliste, wo man mehr Kontext findet.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.wn.de/Welt/Kultur/Kultur-Verbandschef-Rodekamp-fordert-Museen-muessen-sich-oeffnen
«Es herrscht eine Art Aufbruchstimmung», sagte Rodekamp. «Wir müssen uns öffnen, porös werden, die Menschen einladen und zugleich anregen, mit uns gemeinsam Kultur zu befragen.» Dafür biete die Auseinandersetzung mit neuen Medien und den Rezeptionsgewohnheiten einer jüngeren Erlebnisgesellschaft neue Chancen. «Digitale Medien können die Idee des Museums verstärken und das dort angehäufte Wissen viel breiter zur Verfügung stellen.»
Gilt genauso für Archive ...
«Es herrscht eine Art Aufbruchstimmung», sagte Rodekamp. «Wir müssen uns öffnen, porös werden, die Menschen einladen und zugleich anregen, mit uns gemeinsam Kultur zu befragen.» Dafür biete die Auseinandersetzung mit neuen Medien und den Rezeptionsgewohnheiten einer jüngeren Erlebnisgesellschaft neue Chancen. «Digitale Medien können die Idee des Museums verstärken und das dort angehäufte Wissen viel breiter zur Verfügung stellen.»
Gilt genauso für Archive ...
KlausGraf - am Samstag, 11. Mai 2013, 16:29 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Rubrik Archivrecht von Archivalia nimmt seit vielen Jahren am Aggregator-Angebot Jurablogs teil. Im RSS-Feed der TOP-Meldungen sehe ich, wenn es ein Archivalia-Beitrag in die Spitzengruppe geschafft hat, wozu häufig noch nicht einmal 100 Leser nötig sind. Zuverlässig klickt die Jurablogs-Klientel Überschriften an, die sagen wir mal etwas reißerisch formuliert sind. Ob die unfähigen alten Männer oder Juris-GmbH-Bashing: Das zieht juristisch interessierte Leser an wie Sch*** die Fliegen. Gerade liegt mein Juris-Jubelschrei mit 284 Lesern an der Spitze.
Bei einem Blick auf die 365-Tage-Statistik zeigt sich: Sachlich oder neutral formulierte Überschriften sind eher in der Minderzahl:
http://www.jurablogs.com/blogs/archivalia-archivrecht/popular/365d
Beim Jurablogs-Ranking steht Archivalia seit geraumer Zeit etwa bei Platz 90 (derzeit 88, bei 252 Blogs auf Jurablogs):
http://www.jurablogs.com/blogs/ranking
http://archiv.twoday.net/search?q=jurablogs+ranking
Zum Faktor A erfährt man: "1528 Artikel dieses Blogs wurden im Durchschnitt von 38 Lesern gelesen. Die um die besten und schlechtesten 5% dieser Artikel bereinigten Zahlen sind: 1376 Artikel mit durchschnittlich 30 Lesern. Dies ergibt den 174. Platz nach der Leserzahl pro Artikel (Faktor A - 35% des Gesamtranking)."
Meistgelesener Beitrag aller Zeiten: "Endlich klagt mal jemand gegen die Juris-Jauche" (612 Leser)
http://archiv.twoday.net/stories/41787757/
Eine besonders gute Position hat Archivalia beim Faktor D: "182 Links aus 1528 Artikeln dieses Blog verweisen auf 67 andere JuraBlogs. Dies ergibt den 16. Platz nach ausgehenden Links (Faktor D - 10% des Gesamtranking)."
Was die Bloghäufigkeit angeht (wohlgemerkt: nur Rubrik Archivrecht), steht Archivalia auf Platz 70 (Faktor B). "41 Links aus 25 anderen JuraBlogs verweisen auf dieses Blog. Dies ergibt den 84. Platz nach eingehenden Links (Faktor C - 15% des Gesamtranking)".
Abschließend die Gretchenfrage: Denke ich beim Formulieren der Überschriften der Rubrik Archivrecht an Jurablogs? Offene Antwort: Meistens ja.

Bei einem Blick auf die 365-Tage-Statistik zeigt sich: Sachlich oder neutral formulierte Überschriften sind eher in der Minderzahl:
http://www.jurablogs.com/blogs/archivalia-archivrecht/popular/365d
Beim Jurablogs-Ranking steht Archivalia seit geraumer Zeit etwa bei Platz 90 (derzeit 88, bei 252 Blogs auf Jurablogs):
http://www.jurablogs.com/blogs/ranking
http://archiv.twoday.net/search?q=jurablogs+ranking
Zum Faktor A erfährt man: "1528 Artikel dieses Blogs wurden im Durchschnitt von 38 Lesern gelesen. Die um die besten und schlechtesten 5% dieser Artikel bereinigten Zahlen sind: 1376 Artikel mit durchschnittlich 30 Lesern. Dies ergibt den 174. Platz nach der Leserzahl pro Artikel (Faktor A - 35% des Gesamtranking)."
Meistgelesener Beitrag aller Zeiten: "Endlich klagt mal jemand gegen die Juris-Jauche" (612 Leser)
http://archiv.twoday.net/stories/41787757/
Eine besonders gute Position hat Archivalia beim Faktor D: "182 Links aus 1528 Artikeln dieses Blog verweisen auf 67 andere JuraBlogs. Dies ergibt den 16. Platz nach ausgehenden Links (Faktor D - 10% des Gesamtranking)."
Was die Bloghäufigkeit angeht (wohlgemerkt: nur Rubrik Archivrecht), steht Archivalia auf Platz 70 (Faktor B). "41 Links aus 25 anderen JuraBlogs verweisen auf dieses Blog. Dies ergibt den 84. Platz nach eingehenden Links (Faktor C - 15% des Gesamtranking)".
Abschließend die Gretchenfrage: Denke ich beim Formulieren der Überschriften der Rubrik Archivrecht an Jurablogs? Offene Antwort: Meistens ja.

KlausGraf - am Samstag, 11. Mai 2013, 15:53 - Rubrik: Archivrecht
Das Orts- und Namensverzeichnis des neuen Buches kann hier vorübergehend eingesehen werden:
http://www.vierprinzen.com/2013/05/vier-prinzen-kammler-und-von-behr-orts_11.html
update 26 Mai 2013: USB Stick wurde an Druckerei übergeben. Auslieferung der ersten Exemplare findet im Juni statt. Herr Dr. Graf bekommt von mir ein Gratis-Exemplar.
Wirtschaftliches:
Lektorat Layout und Druckerei mindestens 2800euro.
Auftritt an der Frankfurter Messe einschl. Reisekosten und Übernachtung 2.000euro.
Salär für den Autor: 0
marketing 0
Summe plus Umsatzsteuer 5.000 euro.
Zuschüsse 0
Kommentare erwünscht
Alexander vom Hofe
http://www.vierprinzen.com/2013/05/vier-prinzen-kammler-und-von-behr-orts_11.html
update 26 Mai 2013: USB Stick wurde an Druckerei übergeben. Auslieferung der ersten Exemplare findet im Juni statt. Herr Dr. Graf bekommt von mir ein Gratis-Exemplar.
Wirtschaftliches:
Lektorat Layout und Druckerei mindestens 2800euro.
Auftritt an der Frankfurter Messe einschl. Reisekosten und Übernachtung 2.000euro.
Salär für den Autor: 0
marketing 0
Summe plus Umsatzsteuer 5.000 euro.
Zuschüsse 0
Kommentare erwünscht
Alexander vom Hofe
vom hofe - am Samstag, 11. Mai 2013, 10:35 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
http://www.hu-berlin.de/ueberblick/geschichte/juedische-studierende wird am Montag freigeschaltet
Via
http://idw-online.de/pages/de/news532851
Via
http://idw-online.de/pages/de/news532851
KlausGraf - am Samstag, 11. Mai 2013, 00:31 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Matrikel über die an der Hochfürstl. Friedrichs-Universität zu Bayreuth u. Erlangen aufgenommenen Studierenden adeliger und bürgerlicher Herkunft - UER MS.D 30 / 1. Studierende adeliger und bürgerlicher Herkunft
1742 - 1800
http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=4568229&custom_att_2=simple_viewer
1742 - 1800
http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=4568229&custom_att_2=simple_viewer
KlausGraf - am Samstag, 11. Mai 2013, 00:29 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Freies Recht für freie Bürgerinnen und Bürger? In Deutschland Pustekuchen. Zur Juris GmbH vergleiche man hier
http://archiv.twoday.net/search?q=juris+gmbh
Nun hat der VGH Baden-Württemberg das Juris-Monopol beendet:
"Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hob den ablehnenden Bescheid des Bundesverfassungsgerichts vom 21. Juli 2009 mit Urteil vom 7. Mai 2013 – 10 S 281/12 – auf und verurteilte die Bundesrepublik Deutschland dazu, der LexXpress GmbH sämtliche Entscheidungen, die sie der juris GmbH seit dem 1. Juni 2009 zum Zwecke der Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat, zu denselben Bedingungen und in derselben Form zu übermitteln. Die Revision wurde – wie bei der grundsätzlichen Bedeutung des Rechtsstreits zu erwarten – zugelassen. Die Entscheidungsgründe liegen allerdings noch nicht vor."
http://blog.delegibus.com/2013/05/07/gemeinfreiheit-grose-rechtsprechung-im-kellergericht/
Siehe auch
http://klawtext.blogspot.de/2013/05/juris-wackelt.html
http://www.juve.de/nachrichten/verfahren/2013/05/schlappe-fur-bverfg-rwp-mandantin-lexxpress-macht-vertrag-mit-juris-zunichte
Update: http://archiv.twoday.net/stories/418666673/

http://archiv.twoday.net/search?q=juris+gmbh
Nun hat der VGH Baden-Württemberg das Juris-Monopol beendet:
"Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hob den ablehnenden Bescheid des Bundesverfassungsgerichts vom 21. Juli 2009 mit Urteil vom 7. Mai 2013 – 10 S 281/12 – auf und verurteilte die Bundesrepublik Deutschland dazu, der LexXpress GmbH sämtliche Entscheidungen, die sie der juris GmbH seit dem 1. Juni 2009 zum Zwecke der Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat, zu denselben Bedingungen und in derselben Form zu übermitteln. Die Revision wurde – wie bei der grundsätzlichen Bedeutung des Rechtsstreits zu erwarten – zugelassen. Die Entscheidungsgründe liegen allerdings noch nicht vor."
http://blog.delegibus.com/2013/05/07/gemeinfreiheit-grose-rechtsprechung-im-kellergericht/
Siehe auch
http://klawtext.blogspot.de/2013/05/juris-wackelt.html
http://www.juve.de/nachrichten/verfahren/2013/05/schlappe-fur-bverfg-rwp-mandantin-lexxpress-macht-vertrag-mit-juris-zunichte
Update: http://archiv.twoday.net/stories/418666673/
KlausGraf - am Freitag, 10. Mai 2013, 21:13 - Rubrik: Archivrecht
http://www.faz.net/aktuell/wissen/atomium-culture/atomium-umfrage-wenn-open-access-zur-grossen-politik-gehoert-12166186.html
"In Irland hat die Bewegung allerdings schon vor einigen Jahren enorm an Fahrt aufgenommen. Nahim Brennan, die Leiterin des Informationsservice am Trinity College, hat vor kurzem auf einer Veranstaltung der Organisation „Atomium Culture“ in Dublin eine geradezu euphorische Bilanz gezogen. „Irlands Forschung insgesamt ist von Platz 36 im Jahr 2003 auf Platz 20 gesprungen“, sagte sie, die Zahl der zitierten Arbeiten irischer Wissenschaftler wurde seit den achtziger Jahren um 1800 Prozent gesteigert. Der messbare „Research Impact“ habe früher auf der Höhe Polens, Griechenlands oder Portugals gelegen und bewege sich jetzt schon deutlich über dem europäischen Durchschnitt.
Für alles entscheidend hält Brennan die Umsetzung einer nationalen Open-Access-Strategie: Erst mit ihr sind irische Forschungsgruppen weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und zitierfähig geworden. Im Oktober 2012 hat die irische Regierung im „National Open Access Statement“ deutlich gemacht, dass das Weiterentwicklung des nationenweiten zentralen Publikationsarchivs, des „National Open Access Portal RIAN“ im Interesse des gesamten Landes liege. Über das digitale Portal ist jeder irische Forscher mit seinen Arbeiten und biographischen Informationen erreichbar. "
http://rian.ie/
"In Irland hat die Bewegung allerdings schon vor einigen Jahren enorm an Fahrt aufgenommen. Nahim Brennan, die Leiterin des Informationsservice am Trinity College, hat vor kurzem auf einer Veranstaltung der Organisation „Atomium Culture“ in Dublin eine geradezu euphorische Bilanz gezogen. „Irlands Forschung insgesamt ist von Platz 36 im Jahr 2003 auf Platz 20 gesprungen“, sagte sie, die Zahl der zitierten Arbeiten irischer Wissenschaftler wurde seit den achtziger Jahren um 1800 Prozent gesteigert. Der messbare „Research Impact“ habe früher auf der Höhe Polens, Griechenlands oder Portugals gelegen und bewege sich jetzt schon deutlich über dem europäischen Durchschnitt.
Für alles entscheidend hält Brennan die Umsetzung einer nationalen Open-Access-Strategie: Erst mit ihr sind irische Forschungsgruppen weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und zitierfähig geworden. Im Oktober 2012 hat die irische Regierung im „National Open Access Statement“ deutlich gemacht, dass das Weiterentwicklung des nationenweiten zentralen Publikationsarchivs, des „National Open Access Portal RIAN“ im Interesse des gesamten Landes liege. Über das digitale Portal ist jeder irische Forscher mit seinen Arbeiten und biographischen Informationen erreichbar. "
http://rian.ie/
KlausGraf - am Freitag, 10. Mai 2013, 21:04 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Olaf Dilling untersucht das Thema in ZUM 2013, S. 380-389.
Fazit: "Zum Schutz vor Persönlichkeitsverletzungen in der deutschsprachigen Wikipedia sind Betroffene mangels einer effektiven internationalen Vollstreckung weitgehend auf den guten Willen und die selbstregulative Konfliktlösung der Wikipedia-Community angewiesen. Die internen Grundprinzipien und Regeln zum Persönlichkeitsschutz entsprechen dabei immerhin weitgehend dem deutschen Schutzniveau. Unstimmigkeiten gibt es vor allem im Zusammenhang mit dem Erfordernis veröffentlichter Belege, das andererseits aber auch dafür sorgt, dass unbewiesene Gerüchte oder persönliche Werturteile nicht regelkonform sind. Durchgesetzt werden die Regeln durch einen ausdifferenzierten »Stab« an ehrenamtlich tätigen Benutzern mit unterschiedlichen Rechten und Zuständigkeiten.
Die in der Blogspot-Entscheidung des Bundesgerichtshofs etablierten Prüfpflichten des Hostproviders verlangen ein Moderationsverfahren, das die Rolle der Selbstregulierung in Online-Gemeinschaften weiter stärken dürfte. Anders als bei privaten Blogs steht bei Wikipedia dem Persönlichkeitsschutz jedoch nicht so sehr die Meinungsfreiheit individueller Autoren, sondern eher das öffentliche Interesse an der Versorgung mit Information als Voraussetzung für den demokratischen Meinungsbildungsprozess gegenüber. Dem korrespondiert grundsätzlich der institutionelle Gehalt der Mediengrundrechte, wobei noch nicht abschließend geklärt ist, ob und zugunsten welchen Grundrechtsträgers hier Presse- oder Rundfunkfreiheit zum Tragen kommt."
Fazit: "Zum Schutz vor Persönlichkeitsverletzungen in der deutschsprachigen Wikipedia sind Betroffene mangels einer effektiven internationalen Vollstreckung weitgehend auf den guten Willen und die selbstregulative Konfliktlösung der Wikipedia-Community angewiesen. Die internen Grundprinzipien und Regeln zum Persönlichkeitsschutz entsprechen dabei immerhin weitgehend dem deutschen Schutzniveau. Unstimmigkeiten gibt es vor allem im Zusammenhang mit dem Erfordernis veröffentlichter Belege, das andererseits aber auch dafür sorgt, dass unbewiesene Gerüchte oder persönliche Werturteile nicht regelkonform sind. Durchgesetzt werden die Regeln durch einen ausdifferenzierten »Stab« an ehrenamtlich tätigen Benutzern mit unterschiedlichen Rechten und Zuständigkeiten.
Die in der Blogspot-Entscheidung des Bundesgerichtshofs etablierten Prüfpflichten des Hostproviders verlangen ein Moderationsverfahren, das die Rolle der Selbstregulierung in Online-Gemeinschaften weiter stärken dürfte. Anders als bei privaten Blogs steht bei Wikipedia dem Persönlichkeitsschutz jedoch nicht so sehr die Meinungsfreiheit individueller Autoren, sondern eher das öffentliche Interesse an der Versorgung mit Information als Voraussetzung für den demokratischen Meinungsbildungsprozess gegenüber. Dem korrespondiert grundsätzlich der institutionelle Gehalt der Mediengrundrechte, wobei noch nicht abschließend geklärt ist, ob und zugunsten welchen Grundrechtsträgers hier Presse- oder Rundfunkfreiheit zum Tragen kommt."
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blog.paperc.de/2013/04/in-eigener-sache-zum-start-der-neuen-plattform-paperc-com/
Während jetzt 100 % des Inhalts der Bücher befristet lesbar sind, gibt es künftig nur noch 10 % kostenlos. Die epubs sind nicht zitierfähig, da das Verlagslayout anders als jetzt nicht abgebildet wird. Die bisherigen Links werden nicht mehr funktionieren.
Schade. Aus einem verheißungsvollen Open-Access-ähnlichen Angebot (OHNE funktionierende übergreifende Volltextsuche) ist eine wertlose Verkaufsplattform geworden.
Während jetzt 100 % des Inhalts der Bücher befristet lesbar sind, gibt es künftig nur noch 10 % kostenlos. Die epubs sind nicht zitierfähig, da das Verlagslayout anders als jetzt nicht abgebildet wird. Die bisherigen Links werden nicht mehr funktionieren.
Schade. Aus einem verheißungsvollen Open-Access-ähnlichen Angebot (OHNE funktionierende übergreifende Volltextsuche) ist eine wertlose Verkaufsplattform geworden.
KlausGraf - am Freitag, 10. Mai 2013, 14:46 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Artikel von Eckart Schörle über Open Access, in dem Archivalia zitiert wird, erschien bereits 2009 in WerkstattGeschichte und ist frei einsehbar:
http://www.werkstattgeschichte.de/werkstatt_site/archiv/WG52_057-068_SCHOERLE_ZUGANG.pdf
http://www.werkstattgeschichte.de/werkstatt_site/archiv/WG52_057-068_SCHOERLE_ZUGANG.pdf
KlausGraf - am Freitag, 10. Mai 2013, 11:25 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.internet-law.de/2013/05/pressefreiheit-auch-fur-leserkommentare.html
RA Stadler kritisiert einen Beschluss des LG Augsburg, "dass sich die Augsburger Allgemeine im Hinblick auf die Nutzerkommentare nicht auf das Grundrecht der Pressefreiheit berufen kann und damit auch nicht auf ein Zeugnisverweigerungsrecht nach der Strafprozessordnung".
Siehe auch
http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=5890
RA Stadler kritisiert einen Beschluss des LG Augsburg, "dass sich die Augsburger Allgemeine im Hinblick auf die Nutzerkommentare nicht auf das Grundrecht der Pressefreiheit berufen kann und damit auch nicht auf ein Zeugnisverweigerungsrecht nach der Strafprozessordnung".
Siehe auch
http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=5890
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Mai 2013, 21:53 - Rubrik: Archivrecht
Christian Schwaderer kritisiert das bewährte Lateinwörterbuch:
http://www.recensio.net/Members/khyland/der-neue-georges
Ein Unding, dass weder in der URL noch in den Metadaten von Recensio.net der Name des Rezensenten erscheint.
Zitiert werden soll:
recensio.net: Präsentation von: Thomas Baier (Hg.): Karl Ernst Georges, Der neue Georges. Ausführliches Handwörterbuch Lateinisch – Deutsch, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2012
Autor ist nicht recensio.net, sondern Schwaderer. So möchte ich dringend abraten, dass jemand die Möglichkeit nutzt, aktuelle Fachliteratur auf Recensio.net zu rezensieren. Die Regeln guten wissenschaftlichen Arbeitens werden von Recensio.net mit dem Zitierhinweis mit Füßen getreten.
http://www.recensio.net/Members/khyland/der-neue-georges
Ein Unding, dass weder in der URL noch in den Metadaten von Recensio.net der Name des Rezensenten erscheint.
Zitiert werden soll:
recensio.net: Präsentation von: Thomas Baier (Hg.): Karl Ernst Georges, Der neue Georges. Ausführliches Handwörterbuch Lateinisch – Deutsch, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2012
Autor ist nicht recensio.net, sondern Schwaderer. So möchte ich dringend abraten, dass jemand die Möglichkeit nutzt, aktuelle Fachliteratur auf Recensio.net zu rezensieren. Die Regeln guten wissenschaftlichen Arbeitens werden von Recensio.net mit dem Zitierhinweis mit Füßen getreten.
Dass der Nachrichtendienst für Historiker wieder da ist, ist ja schön. Dass Berg seine Leser aber mit völlig übertriebener Kürzung der Titel und Schlagzeilen vera*** weniger ...
http://www.nfhdata.de/
Update:
https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/MpMNuKrSz5b
http://www.nfhdata.de/
Update:
https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/MpMNuKrSz5b
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Mai 2013, 21:16 - Rubrik: Archivrecht
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Mai 2013, 21:13 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die deutsche Regierung hat über Jahrzehnte die Rückgabe brisanter NS-Akten an das Bundesarchiv verzögert. Das geht aus vertraulichen Unterlagen hervor, die der Journalist Malte Herwig bei Recherchen für ein Buch über die sogenannte Flakhelfergeneration in Washington eingesehen hat.
Seit Kriegsende lagerten wichtige Akten der NSDAP, darunter auch die Mitgliederkartei, im Document Center, einem von den Amerikanern bewachten Gebäudekomplex in Berlin. Erst im Sommer 1994, nach mühsamen Verhandlungen, ging das Archiv in deutsche Obhut über. Bislang ging man davon aus, dass die USA die Überstellung der Akten verzögert hatten. So hatte es auch das Auswärtige Amt erklärt, das die Verhandlungen führte.
Tatsächlich wären die USA schon 1967 zur Rückgabe bereit gewesen, wie aus den von Herwig gesichteten Depeschen und vertraulichen Memos hervorgeht. Die Verhandlungen über die Modalitäten scheiterten aber an der Hinhaltetaktik der Deutschen. Als die Grünen 1989 einen Parlamentsbeschluss durchsetzten, um auf die Regierung Druck auszuüben, ging das Auswärtige Amt nach Aktenlage so weit, die Amerikaner um ein doppeltes Spiel zu bitten."
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesregierung-verzoegerte-jahrzehntelang-rueckgabe-von-ns-akten-a-898138.html
Seit Kriegsende lagerten wichtige Akten der NSDAP, darunter auch die Mitgliederkartei, im Document Center, einem von den Amerikanern bewachten Gebäudekomplex in Berlin. Erst im Sommer 1994, nach mühsamen Verhandlungen, ging das Archiv in deutsche Obhut über. Bislang ging man davon aus, dass die USA die Überstellung der Akten verzögert hatten. So hatte es auch das Auswärtige Amt erklärt, das die Verhandlungen führte.
Tatsächlich wären die USA schon 1967 zur Rückgabe bereit gewesen, wie aus den von Herwig gesichteten Depeschen und vertraulichen Memos hervorgeht. Die Verhandlungen über die Modalitäten scheiterten aber an der Hinhaltetaktik der Deutschen. Als die Grünen 1989 einen Parlamentsbeschluss durchsetzten, um auf die Regierung Druck auszuüben, ging das Auswärtige Amt nach Aktenlage so weit, die Amerikaner um ein doppeltes Spiel zu bitten."
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesregierung-verzoegerte-jahrzehntelang-rueckgabe-von-ns-akten-a-898138.html
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Mai 2013, 21:11 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Am 25. April hat auch RA Solmecke meinen Fall aufgegriffen:
http://www.wbs-law.de/internetrecht/faz-mahnt-blogger-ab-39248/
Klaus Graf ist bekannter Internet Blogger und betreibt seinen eigenen Blog „Archivaria“. Archivaria, so so.
"Letztlich muss man, wenn man sich den ganzen Sachverhalt vor Augen führt schon fragen, warum ein Blogger die Meinungsfreiheit gerade gegen eine der größten DeutschenTageszeitungen verteidigen muss und sicherlich auch, warum die FAZ hier vorliegend überhaupt die Rechte von Frau Schmoll vertritt. Wo hier eigentlich eine Rechtsverletzung zum Nachteil der FAZ gegeben sein soll, müsste auch erst einmal aufgezeigt werden."
Zu meiner Abmahnung:
http://archiv.twoday.net/stories/342793744/ mit weiteren Nachweisen
Die FAZ hat sich bei mir nicht wieder gemeldet. Hinsichtlich einer einstweiligen Verfügung dürfte die Eilbedürftigkeit inzwischen entfallen sein. Ein langwieriges Hauptsacheverfahren ist eher unwahrscheinlich.
http://www.wbs-law.de/internetrecht/faz-mahnt-blogger-ab-39248/
Klaus Graf ist bekannter Internet Blogger und betreibt seinen eigenen Blog „Archivaria“. Archivaria, so so.
"Letztlich muss man, wenn man sich den ganzen Sachverhalt vor Augen führt schon fragen, warum ein Blogger die Meinungsfreiheit gerade gegen eine der größten DeutschenTageszeitungen verteidigen muss und sicherlich auch, warum die FAZ hier vorliegend überhaupt die Rechte von Frau Schmoll vertritt. Wo hier eigentlich eine Rechtsverletzung zum Nachteil der FAZ gegeben sein soll, müsste auch erst einmal aufgezeigt werden."
Zu meiner Abmahnung:
http://archiv.twoday.net/stories/342793744/ mit weiteren Nachweisen
Die FAZ hat sich bei mir nicht wieder gemeldet. Hinsichtlich einer einstweiligen Verfügung dürfte die Eilbedürftigkeit inzwischen entfallen sein. Ein langwieriges Hauptsacheverfahren ist eher unwahrscheinlich.
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Mai 2013, 20:59 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"To celebrate World Intellectual Property Day ( 26 April) and to promote discussion of the role of intellectual property in encouraging innovation and creativity The National Library of Wales has announced a pioneering decision in relation to its digitised collections by declaring that it will no longer claim ownership of copyright in digital copies of items in its care."
Sollte eigentlich selbstverständlich sein, alles andere wäre Copyfraud.
http://www.llgc.org.uk/index.php?id=1514&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5306&cHash=ff862080bf62ecada84a42e3601e6fb8
Sollte eigentlich selbstverständlich sein, alles andere wäre Copyfraud.
http://www.llgc.org.uk/index.php?id=1514&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5306&cHash=ff862080bf62ecada84a42e3601e6fb8
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Mai 2013, 20:57 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://idw-online.de/pages/de/news532457
"Eine Handschrift der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel war einst im Besitz des französischen Universalgelehrten Michel de Montaigne. Dieser Überraschungsfund gelang Ingrid De Smet (University of Warwick) und Alain Legros (Université François-Rabelais), die im Rahmen ihrer Forschungsarbeit ein Digitalisat der Handschrift mit der Signatur Cod. Guelf. 7.1 Aug. 4° aus der Sammlung Herzog Augusts bestellt hatten."
Digitalisat:
http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/7-1-aug-4f

"Eine Handschrift der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel war einst im Besitz des französischen Universalgelehrten Michel de Montaigne. Dieser Überraschungsfund gelang Ingrid De Smet (University of Warwick) und Alain Legros (Université François-Rabelais), die im Rahmen ihrer Forschungsarbeit ein Digitalisat der Handschrift mit der Signatur Cod. Guelf. 7.1 Aug. 4° aus der Sammlung Herzog Augusts bestellt hatten."
Digitalisat:
http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/7-1-aug-4f
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Mai 2013, 20:51 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Im Einzelnen finden sich in dem Internetportal http://uni-helmstedt.hab.de sämtliche Vorlesungsverzeichnisse der Universität Helmstedt mit 27.000 Lehrveranstaltungen aus dem Zeitraum 1581–1810: Neben den Digitalisaten steht zudem eine umfangreiche Volltext-Suche in den lateinischsprachigen und deutschsprachigen (ab 1745) Vorlesungsankündigungen zur Verfügung. Weiterhin existieren Datenbanken zu den in allen vier Fakultäten (Theologie, Jura, Medizin, Philosophie) angefertigten Dissertationen mit knapp 7.000 Einträgen sowie zur Matrikel der Universität, in der ca. 46.000 Universitätsbesucher und Universitätsangehörige verzeichnet sind. Die ungefähr 1.600 transkribierten Rechenschaftsberichte in lateinischer Sprache aus drei Zeiträumen zwischen der Mitte des 17. und der Mitte des 18. Jahrhunderts werden ergänzt durch einen Professorenkatalog, in dem Basisinformationen zu den rund 250 Professoren zu finden sind, die an der Academia Julia in Helmstedt gelehrt haben."
http://idw-online.de/pages/de/news532235
http://idw-online.de/pages/de/news532235
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Mai 2013, 20:48 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ms. Codex 1178 - Ausführliche Nachricht oder Beschreibung von denen churfürstl[ich] sächs[ischen] Land- und Ausschuss-Tägen, von anno 1185 biss ad annum 1718, auch wie die Steüern und Anlagen nacheinander eingeführet und erhöhet worden, ingleichen wie die Bewilligung geschehen ist
http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4311797
#fnzhss
http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4311797
#fnzhss
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Mai 2013, 20:46 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Roter-Alarm-fuer-Porno-Trolle-1859349.html
"Das Urheberrecht, ursprünglich zum Ausgleich für darbende Künstler entworfen, erlaubt in diesem Zeitalter elektronischer Medien darbenden Anwälten, die Bürgerschaft auszuplündern." - Sagt der US-Richter Otis D. Wright II
Siehe auch
http://www.infodocc.info/copyright-trolle-berufsverbot/
"Das Urheberrecht, ursprünglich zum Ausgleich für darbende Künstler entworfen, erlaubt in diesem Zeitalter elektronischer Medien darbenden Anwälten, die Bürgerschaft auszuplündern." - Sagt der US-Richter Otis D. Wright II
Siehe auch
http://www.infodocc.info/copyright-trolle-berufsverbot/
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Mai 2013, 20:29 - Rubrik: Archivrecht
http://www.juristischer-gedankensalat.de/2013/05/07/angst-vor-dem-zitierfettnapfchen-muss-nicht-sein/
Via
http://www.juristischer-gedankensalat.de/2013/05/07/angst-vor-dem-zitierfettnapfchen-muss-nicht-sein/
Via
http://www.juristischer-gedankensalat.de/2013/05/07/angst-vor-dem-zitierfettnapfchen-muss-nicht-sein/
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Mai 2013, 20:26 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.sammlungen.uni-mainz.de/
Eine neue Internetplattform der Universität Mainz ermöglicht erstmals einen Überblick über alle universitären Sammlungen – von der Ägyptologie über den Botanischen Garten und die Kunstgeschichte bis hin zur Münzsammlung oder den Sammlungen des Instituts für Klassische Archäologie.
Via
http://www.damals.de/de/4/news.html?aid=191060&action=showDetails
Eine neue Internetplattform der Universität Mainz ermöglicht erstmals einen Überblick über alle universitären Sammlungen – von der Ägyptologie über den Botanischen Garten und die Kunstgeschichte bis hin zur Münzsammlung oder den Sammlungen des Instituts für Klassische Archäologie.
Via
http://www.damals.de/de/4/news.html?aid=191060&action=showDetails
KlausGraf - am Donnerstag, 9. Mai 2013, 20:22 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sehr geehrte Damen und Herren,
diese Mitteilung nimmt Bezug auf einen Mailwechsel über die Intetbib (ab 01.10.2012) zu einer Inkunabel aus dem Bestand des ehemaligen Eichstätter Kapuzinerklosters:
Die Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt konnte heute in der Bayerischen Staatsbibliothek die aus dem Bestand des Eichstätter Kapuzinerklosters verloren gegangene Inkunabel 'Thomas à Kempis: Meditationes de vita Jesu Christi. Köln: Johann Laden, c. 1498?' in Empfang nehmen.
Nach Gesprächen mit dem Eigentümer, der die Inkunabel im Oktober 2012 dankenswerter Weise aus einer Auktion der Galerie Bassenge zurückgezogen hatte, und unter Einbeziehung der Bayerischen Staatsbibliothek kamen alle Beteiligten zu dem Schluss, dass eine lückenlose Klärung der verschiedenen Eigentumsübergange nicht möglich ist. Vor diesem Hintergrund entschied sich der Eigentümer, die Inkunabel ohne finanzielle Gegenleistung der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt zu übergeben.
Wir danken dem Eigentümer und der Bayerischer Staatsbibliothek ausdrücklich für dieses erfreuliche Ergebnis.
Auf diesem Weg möchten wir darauf hinweisen, dass bei der Übernahme der Inkunabeln aus dem Kapuzinerkloster Eichstätt durch die Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt im Jahre 2003 neben dem nun zurückgekehrten Band vier weitere Titel als fehlend dokumentiert wurden (alte Signatur des Eichstätter Kapuzinerklosters: Kap Ink 1, 2, 3, 5 und 27), die ebenfalls auf dem Markt auftauchen könnten. Allerdings sind nur die nun übergebene Inkunabel sowie der Sammelband mit der Nr. 3 in der Bestandsbeschreibung durch Ilona Hubay erwähnt, sodass wir nur zu diesem fehlenden Band eine Inhaltsangabe geben können. Es handelt sich um einen Sammelband mit der Provenienz: „Casparus Erckh me Jure tenet", der folgende Titel enthält:
1. Reformatorium vitae morum et honestatis clericorum. Basel: Michael Furter, in Kathedra Petri, [22. Februar] 1494, Hubay Nr. 883, GW M33160
2. Pseudo-Bernardus: Modus bene vivendi. [Basel: Bernardinus Benalius, 30. Mai 1492]. Hubay Nr. 167, GW 4047.
Sollten Sie einen Hinweis zum Verblieb des Werkes haben, wären wir für diese Information dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Maria Löffler
--
Universitätsbibliothek Eichstaett-Ingolstadt
Kommissarische Bibliotheksleitung
Leitung Zweigbibliothek Ingolstadt & EDV-Referat
Dr. Maria Loeffler
Universitätsallee 1
85072 Eichstätt
Tel.: 08421/93-1330 oder -1806
E-Mail: maria.loeffler@ku-eichstaett.de
--
http://www.inetbib.de
Das ist ja ausgesprochen erfreulich. Ohne den Hinweis eines Kommentators hier am 1. Oktober 2012
http://archiv.twoday.net/stories/120170726/#156270199
und meinen Beitrag vom gleichen Tag in INETBIB
http://article.gmane.org/gmane.culture.libraries.inetbib/23066
wäre das Stück höchstwahrscheinlich in einer Privatsammlung verschwunden.
Zur Causa Eichstätt
http://archiv.twoday.net/search?q=kapuz+eichst%C3%A4tt
Zur Provenienz Eichstätt OCapuc. hat Needhams IPI:
"OCapuc, S. Crux, fd. 1627, on property of former OSB Scottorum: Munich SB; Eichst. (Σ84); Fkft/M; CatRég XI 7, 12, 14; Pirages 46 (Nov. 2001): 8 (B-553); Bod-inc.; Paris BNF"
diese Mitteilung nimmt Bezug auf einen Mailwechsel über die Intetbib (ab 01.10.2012) zu einer Inkunabel aus dem Bestand des ehemaligen Eichstätter Kapuzinerklosters:
Die Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt konnte heute in der Bayerischen Staatsbibliothek die aus dem Bestand des Eichstätter Kapuzinerklosters verloren gegangene Inkunabel 'Thomas à Kempis: Meditationes de vita Jesu Christi. Köln: Johann Laden, c. 1498?' in Empfang nehmen.
Nach Gesprächen mit dem Eigentümer, der die Inkunabel im Oktober 2012 dankenswerter Weise aus einer Auktion der Galerie Bassenge zurückgezogen hatte, und unter Einbeziehung der Bayerischen Staatsbibliothek kamen alle Beteiligten zu dem Schluss, dass eine lückenlose Klärung der verschiedenen Eigentumsübergange nicht möglich ist. Vor diesem Hintergrund entschied sich der Eigentümer, die Inkunabel ohne finanzielle Gegenleistung der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt zu übergeben.
Wir danken dem Eigentümer und der Bayerischer Staatsbibliothek ausdrücklich für dieses erfreuliche Ergebnis.
Auf diesem Weg möchten wir darauf hinweisen, dass bei der Übernahme der Inkunabeln aus dem Kapuzinerkloster Eichstätt durch die Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt im Jahre 2003 neben dem nun zurückgekehrten Band vier weitere Titel als fehlend dokumentiert wurden (alte Signatur des Eichstätter Kapuzinerklosters: Kap Ink 1, 2, 3, 5 und 27), die ebenfalls auf dem Markt auftauchen könnten. Allerdings sind nur die nun übergebene Inkunabel sowie der Sammelband mit der Nr. 3 in der Bestandsbeschreibung durch Ilona Hubay erwähnt, sodass wir nur zu diesem fehlenden Band eine Inhaltsangabe geben können. Es handelt sich um einen Sammelband mit der Provenienz: „Casparus Erckh me Jure tenet", der folgende Titel enthält:
1. Reformatorium vitae morum et honestatis clericorum. Basel: Michael Furter, in Kathedra Petri, [22. Februar] 1494, Hubay Nr. 883, GW M33160
2. Pseudo-Bernardus: Modus bene vivendi. [Basel: Bernardinus Benalius, 30. Mai 1492]. Hubay Nr. 167, GW 4047.
Sollten Sie einen Hinweis zum Verblieb des Werkes haben, wären wir für diese Information dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Maria Löffler
--
Universitätsbibliothek Eichstaett-Ingolstadt
Kommissarische Bibliotheksleitung
Leitung Zweigbibliothek Ingolstadt & EDV-Referat
Dr. Maria Loeffler
Universitätsallee 1
85072 Eichstätt
Tel.: 08421/93-1330 oder -1806
E-Mail: maria.loeffler@ku-eichstaett.de
--
http://www.inetbib.de
Das ist ja ausgesprochen erfreulich. Ohne den Hinweis eines Kommentators hier am 1. Oktober 2012
http://archiv.twoday.net/stories/120170726/#156270199
und meinen Beitrag vom gleichen Tag in INETBIB
http://article.gmane.org/gmane.culture.libraries.inetbib/23066
wäre das Stück höchstwahrscheinlich in einer Privatsammlung verschwunden.
Zur Causa Eichstätt
http://archiv.twoday.net/search?q=kapuz+eichst%C3%A4tt
Zur Provenienz Eichstätt OCapuc. hat Needhams IPI:
"OCapuc, S. Crux, fd. 1627, on property of former OSB Scottorum: Munich SB; Eichst. (Σ84); Fkft/M; CatRég XI 7, 12, 14; Pirages 46 (Nov. 2001): 8 (B-553); Bod-inc.; Paris BNF"
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Am 12. Mai 2013 zum Internationalen Museumstag rufe ich zu der kleinen Twitteraktion "Mein Lieblingsstück" auf. Ziel ist es die derzeitige Lage der 3, von einem Neubau-Plnungsstopp betroffenen Institutionen (Stadtarchiv, Kunst- und Museumbibliothek und Rheinisches Bildarchiv) bekannt zu machen und die seit fast einem Monat laufende Petition zu verbreiten.
Es müssen dabei nur 2 Tweets verschickt werden, die mit den hashtags #IMT13 und #IMD13 versehen sind.
1) Der erste Tweet enthält ein schönes Stück aus den Online-Bestände der 3 Einrichtungen. Man könnte z. B. ein Lieblingsstück aus der Kunst- und Museumsbibliothek posten. Hier findet man einiges: http://www.kulturelles-erbe-koeln.de/.
2) Der zweite Tweet verweist auf die Petition und ruft zum Mitzeichnen auf: https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-die-aufhebung-des-planungsstopps-fuer-den-neubau-des-historischen-archivs-der-stadt-koeln
Es müssen dabei nur 2 Tweets verschickt werden, die mit den hashtags #IMT13 und #IMD13 versehen sind.
1) Der erste Tweet enthält ein schönes Stück aus den Online-Bestände der 3 Einrichtungen. Man könnte z. B. ein Lieblingsstück aus der Kunst- und Museumsbibliothek posten. Hier findet man einiges: http://www.kulturelles-erbe-koeln.de/.
2) Der zweite Tweet verweist auf die Petition und ruft zum Mitzeichnen auf: https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-die-aufhebung-des-planungsstopps-fuer-den-neubau-des-historischen-archivs-der-stadt-koeln
Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Mai 2013, 09:59 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
