http://ra-melchior.blog.de/2009/02/18/brut-5603288/
Archivalia ist allein mit einer juristischen Rubrik Archivrecht in Jurablogs gelistet. Und wenn RA Melchior das Recht hat zu behauptet, ich hätte von der Juristerei keinerlei Ahnung, darf ichs von ihm ja auch. Niemand sagt, dass ein Organ der Rechtspflege zwangsläufig kompetent sein muss ...
http://archiv.twoday.net/topics/Archivrecht/
Ich wüsste übrigens gern, ob ein Blogbeitrag von RA Melchior bereits Eingang in die Landesgesetzgebung Eingang gefunden hat:
http://archiv.twoday.net/stories/5492544/
Archivalia ist allein mit einer juristischen Rubrik Archivrecht in Jurablogs gelistet. Und wenn RA Melchior das Recht hat zu behauptet, ich hätte von der Juristerei keinerlei Ahnung, darf ichs von ihm ja auch. Niemand sagt, dass ein Organ der Rechtspflege zwangsläufig kompetent sein muss ...
http://archiv.twoday.net/topics/Archivrecht/
Ich wüsste übrigens gern, ob ein Blogbeitrag von RA Melchior bereits Eingang in die Landesgesetzgebung Eingang gefunden hat:
http://archiv.twoday.net/stories/5492544/
KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 22:09 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Detlef Berentzen, in den 80er Jahren selbst lange bei der taz, spürt zum 30. Geburtstag der taz-Geschichte mit dem Mikrofon nach und interviewt Randy Kaufman, der sich gerne “Archivar der ersten Stunde” nennt.
Link zum Blog-Eintrag:
http://blogs.taz.de/spurensuche/2009/02/11/im_keller_des_archivars/
Link zur mp3-Datei:
http://blogs.taz.de/spurensuche/files/2009/02/audioblog4.mp3
Link zum Blog-Eintrag:
http://blogs.taz.de/spurensuche/2009/02/11/im_keller_des_archivars/
Link zur mp3-Datei:
http://blogs.taz.de/spurensuche/files/2009/02/audioblog4.mp3
Wolf Thomas - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 21:48 - Rubrik: Medienarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die NZZ (Link) berichtet: " ..... Von höchstem Wert war auch die (Vor-)Arbeit von Jura Brüschweiler, dem Doyen der Hodler-Forschung. Er entdeckte den Maler Ende der fünfziger Jahre, zu einer Zeit, da sein Ansehen auf dem Tiefpunkt angelangt war, und widmete sich fortan ganz der Erforschung und Vermittlung seines Lebens und Werks. Brüschweilers eigenes Archiv wird kaum das Schicksal des Archivs von Loosli teilen. Aus Wut über mangelnde offizielle Anerkennung hatte der 1959 verstorbene Schriftsteller nämlich verfügt, dass die von ihm zusammengetragenen Dokumente fünfzig Jahre unter Verschluss bleiben sollten. Glücklicherweise konnte dieses Archiv schon ein paar Jahre früher, für die Katalog-Bearbeiter gerade noch rechtzeitig, geöffnet werden. ....."
Wolf Thomas - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 21:35 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus einem Interview Johannes Waechters mit Rainer Lotz im SZ-Magazin:" ...... Von den vielen tausend Titeln in ihrer Sammlung sind nun einige Dutzend auf die CD-Edition gelangt. Was aber passiert mit dem Rest? Haben Sie die Befürchtung, dass Ihre Platten irgendwann in einem Archiv verschwinden, wo sie keiner mehr hört?
Sie sprechen da eine sehr traurige Geschichte an. Ich habe fast 60 Jahre lang diese Sachen zusammengetragen und habe vermutlich die weltgrößte Sammlung solcher Stücke, von denen viele Unikate sind. Es läge mir sehr daran, dass diese Sammlung als Ganzes erhalten bleibt, an einem Ort, der der Wissenschaft und dem interessierten Publikum zugänglich ist. Ich könnte alles verschenken, aber ich möchte wenigstens etwas Geld dafür haben, da meine Familie unter meiner Sammelwut gelitten hat und ich meinen Kindern etwas zurückgeben will. Aber den Wert meiner Sammlung kann niemand finanziell darstellen. Privatsammler haben das Geld nicht, die öffentlichen Archive auch nicht. Und die deutschen Institutionen haben vor allem auch nicht das Verständis dafür. Die Library of Congress in Washington hat jetzt meine ganz frühen Sachen aufgekauft, die Ragtime- und Cake-Walk-Platten, aber das Deutsche Muskarchiv in Berlin scheint kein Interesse an meiner Sammlung zu haben. ......"
Interessant wäre es zu erfahren, ob das Darmstädter Jazz-Institut beteiligt war.
Quelle:
http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/28224
Sie sprechen da eine sehr traurige Geschichte an. Ich habe fast 60 Jahre lang diese Sachen zusammengetragen und habe vermutlich die weltgrößte Sammlung solcher Stücke, von denen viele Unikate sind. Es läge mir sehr daran, dass diese Sammlung als Ganzes erhalten bleibt, an einem Ort, der der Wissenschaft und dem interessierten Publikum zugänglich ist. Ich könnte alles verschenken, aber ich möchte wenigstens etwas Geld dafür haben, da meine Familie unter meiner Sammelwut gelitten hat und ich meinen Kindern etwas zurückgeben will. Aber den Wert meiner Sammlung kann niemand finanziell darstellen. Privatsammler haben das Geld nicht, die öffentlichen Archive auch nicht. Und die deutschen Institutionen haben vor allem auch nicht das Verständis dafür. Die Library of Congress in Washington hat jetzt meine ganz frühen Sachen aufgekauft, die Ragtime- und Cake-Walk-Platten, aber das Deutsche Muskarchiv in Berlin scheint kein Interesse an meiner Sammlung zu haben. ......"
Interessant wäre es zu erfahren, ob das Darmstädter Jazz-Institut beteiligt war.
Quelle:
http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/28224
Wolf Thomas - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 21:21 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/aktuell/1677017_Akten-aus-der-NS-Zeit-entdeckt.html
Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Friesland in Jever haben rund 800 Akten zu Zwangssterilisationen in der NS-Zeit entdeckt. Die Kranken- und Gerichtsakten in sieben Umzugskisten wurden auf dem Dachboden der Behörde gefunden, wie der Sprecher des Landkreises Friesland, Rainer Graalfs, auf ddp-Anfrage sagte.
Ähnliches Material gebe es bislang nur aus der Wesermarsch. Nach Einschätzung des Niedersächsisches Staatsarchivs in Oldenburg handelt es sich dagegen nicht um einen einzigartigen Fund.
Die Akten des 1939 gegründeten Landkreises Friesland galten bislang als verschollen. Sie dokumentieren Zwangssterilisierungen der Nationalsozialisten in Friesland zwischen 1934 und 1945.
Neben Personendaten findet sich in den Unterlagen auch eine "erbbiologische Bestandsaufnahme" des Jeverlandes. Die Kisten sollen noch in dieser Woche dem Staatsarchiv übergeben werden.
Dessen Leiter Matthias Nistal hält die in Jever gefunden Akten für wenig aufsehenerregend. Im Landesarchiv lagerten bereits 3000 bis 4000 Akten über Zwangssterilisationen in der NS-Zeit. Neue Erkenntnisse bringe das in Jever gefundene Material vermutlich nicht, sagte Nistal auf ddp-Anfrage.
Die Dokumente sollen nach Eingang im Staatsarchiv zunächst ausgewertet, restauriert und dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Na wenigstens werden sie nicht einfach kassiert ... Wozu archiviert man eigentlich Akten, wenn diese vermutlich keine neuen Erkenntnisse bringen? Sind das Herausarbeiten regionaler Disparitäten - offensichtlich gibt es ja aus dem betroffenen Teil des Sprengels sonst keine Akten - etwa keine neuen Erkenntnisse? Dieser Staatsarchivleiter äußerte sich meines Erachtens unsensibel und zu geringschätzig über die Erforschung der NS-Vergangenheit.
Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Friesland in Jever haben rund 800 Akten zu Zwangssterilisationen in der NS-Zeit entdeckt. Die Kranken- und Gerichtsakten in sieben Umzugskisten wurden auf dem Dachboden der Behörde gefunden, wie der Sprecher des Landkreises Friesland, Rainer Graalfs, auf ddp-Anfrage sagte.
Ähnliches Material gebe es bislang nur aus der Wesermarsch. Nach Einschätzung des Niedersächsisches Staatsarchivs in Oldenburg handelt es sich dagegen nicht um einen einzigartigen Fund.
Die Akten des 1939 gegründeten Landkreises Friesland galten bislang als verschollen. Sie dokumentieren Zwangssterilisierungen der Nationalsozialisten in Friesland zwischen 1934 und 1945.
Neben Personendaten findet sich in den Unterlagen auch eine "erbbiologische Bestandsaufnahme" des Jeverlandes. Die Kisten sollen noch in dieser Woche dem Staatsarchiv übergeben werden.
Dessen Leiter Matthias Nistal hält die in Jever gefunden Akten für wenig aufsehenerregend. Im Landesarchiv lagerten bereits 3000 bis 4000 Akten über Zwangssterilisationen in der NS-Zeit. Neue Erkenntnisse bringe das in Jever gefundene Material vermutlich nicht, sagte Nistal auf ddp-Anfrage.
Die Dokumente sollen nach Eingang im Staatsarchiv zunächst ausgewertet, restauriert und dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Na wenigstens werden sie nicht einfach kassiert ... Wozu archiviert man eigentlich Akten, wenn diese vermutlich keine neuen Erkenntnisse bringen? Sind das Herausarbeiten regionaler Disparitäten - offensichtlich gibt es ja aus dem betroffenen Teil des Sprengels sonst keine Akten - etwa keine neuen Erkenntnisse? Dieser Staatsarchivleiter äußerte sich meines Erachtens unsensibel und zu geringschätzig über die Erforschung der NS-Vergangenheit.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
FAZ:
Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst des Open Access. Düstere Schreckensszenarien entwarf Roland Reuß gerade an dieser Stelle (Eingecremtes Publizieren: Open Access als Enteignung) im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen in der Wissenschaftskultur und -kommunikation: Hier die vornehmen Hüter der traditionellen Buchkultur, dort die ebenso fanatischen wie naiven Open-Access-Aktivisten, die nicht - oder, noch schlimmer, nur allzu genau - wissen, was sie tun.
Zu Reuß http://archiv.twoday.net/stories/5509895/
Statt auf Polemik mit Gegenpolemik zu antworten, sei hier zu einer kurzen und nüchternen Bestandsaufnahme eingeladen. Was bedeutet Open Access in der Praxis? Werfen wir einen Blick auf meine Forschungsinstitution, das im Jahre 1958 gegründete Deutsche Historische Institut in Paris. Auch in ihm beginnen neben den klassischen Buch- die neuen Open-Access-Publikationen eine immer wichtigere Rolle zu spielen. Einerseits gibt das Institut neben der Fachzeitschrift „Francia“ in Zusammenarbeit mit dem Thorbecke- und Oldenbourg-Verlag mehrere Buchreihen heraus, in denen unter anderem Quelleneditionen, Dissertationen und Habilitationsschriften sowie die Ergebnisse deutsch-französischer Tagungen veröffentlicht werden.
Sämtliche Jahrgänge zugänglich
Andererseits aber hat das Institut in den vergangenen anderthalb Jahren dank der Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mit dem systematischen Aufbau eines größeren Open-Access-online-Angebots begonnen, das sowohl die nachlaufenden Digitalisierungen bereits erschienener Werke als auch eigenständige online-Publikationen umfasst: Seit November 2008 sind sämtliche Jahrgänge der „Francia“ von 1973-2006 für jedermann zugänglich, mit einer zweijährigen „moving-wall“ werden auch die zukünftigen Ausgaben entsprechend online verfügbar sein. Der ehemals gedruckte Rezensionsteil der „Francia“ wurde gleichzeitig konsequent ins Netz ausgelagert.
All dies geschah nicht gegen den Willen, sondern mit vollem Einverständnis der „Francia“-Autoren, die - bis auf einige wenige Ausnahmen - geradezu enthusiastisch auf das ihnen vorgeschlagene neue Publikationsmodell reagierten. Bis 2010 wird nach ähnlichem Muster in Kooperation mit dem „Zentrum für Elektronisches Publizieren“ (ZEP) der Bayerischen Staatsbibliothek sukzessive auch die Digitalisierung zurückliegender Jahrgänge der Beihefte der „Francia“, der „Instrumenta“ und „Pariser historischen Studien“ sowie die Online-Publikation von Tagungssammelbänden auf www.perspectivia.net erfolgen, einer neuen Open-Access-Publikationsumgebung für die in der Stiftung „Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland“ zusammengefassten Institute und ihre Kooperationspartner.
Nachfrage groß und drängend
Warum lohnt es sich, open access zu publizieren? Warum geht das Pariser Institut diesen Weg? Unsere Erfahrungen, von denen vielleicht auch andere geisteswissenschaftliche Forschungsinstitute profitieren können, lassen sich in vier Beobachtungen resümieren: Erstens ist die Nachfrage der Wissenschaftler selbst nach Open Access inzwischen groß und drängend. Da die Außenwahrnehmung der eigenen Forschungsleistungen für jeden Schreibenden - und nicht nur für Nachwuchswissenschaftler - eine zentrale Rolle spielt, wird der Wunsch nach weltweiter „Sichtbarkeit“ zunehmend laut: Und hier können, wie Studien belegen und wie es auch die statistische Auswertung der Zugriffe auf www.perspectivia.net in wünschenswerter Klarheit zeigt, klassische Printpublikationen mit elektronischen Texten, die mit Meta- und Verschlagwortungsdaten ausgezeichnet sind und über Suchmaschinen erfasst werden, eben kaum mithalten.
An dieser Stelle wird auch gerne die Legende bemüht, dass Open Access zwangsläufig den Bankrott der Verlage nach sich zieht. Dem sei allerdings entgegengehalten, dass eine Erhöhung der Zahl frei zugänglicher Publikationen zu einem signifikanten „return on investment“ führte, wie eine von John Houghton und anderen jüngst publizierte, umfassende Analyse zum Publikationsaufkommen Englands eindrucksvoll belegt.
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/rpteconomicoapublishing.pdf
http://immateriblog.de/?p=262
Qualitätsbewusstes Publizieren
Open Access Publizieren ist zweitens qualitätsbewusstes Publizieren. Der Wert eines wissenschaftlichen Manuskripts hängt von der Stringenz der Argumentation und Sorgfalt der Darstellung ab, nicht vom Medium an sich. So, wie nicht jedes gedruckte Buch per se nobelpreisverdächtig ist, wird ein Manuskript durch die elektronische Verbreitung keineswegs automatisch schlecht, sondern oft sogar dann noch besser, wenn die Publikation mit einem Open-peer-review-Verfahren kombiniert wird. Zudem liefern gerade barrierefrei zugängliche Publikationen die Chance eines wirklich effizienten kollaborativ verteilten Arbeitens, indem sie die Verknüpfung von Texten, Quellen, Artikeln und Daten ermöglichen. Im Pariser Institut gibt es keinerlei Rangabstufung zwischen gedruckten und online verfügbaren Arbeiten. Alle Publikationen werden vor der Veröffentlichung bei uns demselben Prozess intensiver Begutachtung und Redaktion unterzogen, und zwar durch ein hauseigenes Lektorat.
Drittens: Als die von den Kritikern an die Wand gemalte Enteignung empfinden unsere Autoren den freien Zugang zu ihren Werken wahrlich nicht. Jegliche Publikation setzt schließlich voraus, dass deren Urheber Dritten bestimmte Verwertungsrechte einräumen. Andernfalls dürfte ein Verlag weder gedruckte noch elektronische Veröffentlichungen vorlegen. Im Open-Access-Modell definiert der Autor darüber hinaus durch die Vergabe von Lizenzen genau, welche Verwertungsrechte auch den Lesern eingeräumt werden. Somit bestehen klare Regeln für den Umgang mit den Manuskripten, deren Sichtbarkeit und Berücksichtigung im akademischen Diskurs im ureigenen Interesse der Autoren liegt. Der Vorwurf, Open Access missachte das geltende Urheberrecht, ist im besten Fall blanke Unkenntnis der Materie, im schlechtesten Fall eine gezielte Desinformation.
Zu guter Letzt begreifen wir die Open-Access-Politik unseres Instituts als einen wichtigen Beitrag zur Internationalisierung und Demokratisierung der Geisteswissenschaften: Nicht jeder Leser der „Pariser historischen Studien“ lebt in Paris und erfreut sich eines bequemen Zugangs zu einer der exzellenten Pariser Forschungsbibliotheken. Gerade frankophone Wissenschaftler aus armen Ländern mit chaotischer Bibliothekssituation und defizitärer Literaturversorgung wissen den freien Zugang zur Forschungsliteratur zu schätzen. Wird damit nicht ein Traum Wirklichkeit, den jüngst noch Robert Darnton, brillanter Historiker der Buchgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, in seiner Eigenschaft als Direktor der Universitätsbibliothek Harvard, umrissen hat - der Traum nämlich vom weltweiten freien Fluss der Ideen und Texte, den schon die Aufklärer träumten? Mir scheint, Open Access bedeutet keine Gefahr für das Abendland, im Gegenteil.
Gudrun Gersmann ist Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in Paris und Vorsitzende des Unterausschusses „Elektronische Publikationen“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Gut gebrüllt, Löwin!
Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst des Open Access. Düstere Schreckensszenarien entwarf Roland Reuß gerade an dieser Stelle (Eingecremtes Publizieren: Open Access als Enteignung) im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen in der Wissenschaftskultur und -kommunikation: Hier die vornehmen Hüter der traditionellen Buchkultur, dort die ebenso fanatischen wie naiven Open-Access-Aktivisten, die nicht - oder, noch schlimmer, nur allzu genau - wissen, was sie tun.
Zu Reuß http://archiv.twoday.net/stories/5509895/
Statt auf Polemik mit Gegenpolemik zu antworten, sei hier zu einer kurzen und nüchternen Bestandsaufnahme eingeladen. Was bedeutet Open Access in der Praxis? Werfen wir einen Blick auf meine Forschungsinstitution, das im Jahre 1958 gegründete Deutsche Historische Institut in Paris. Auch in ihm beginnen neben den klassischen Buch- die neuen Open-Access-Publikationen eine immer wichtigere Rolle zu spielen. Einerseits gibt das Institut neben der Fachzeitschrift „Francia“ in Zusammenarbeit mit dem Thorbecke- und Oldenbourg-Verlag mehrere Buchreihen heraus, in denen unter anderem Quelleneditionen, Dissertationen und Habilitationsschriften sowie die Ergebnisse deutsch-französischer Tagungen veröffentlicht werden.
Sämtliche Jahrgänge zugänglich
Andererseits aber hat das Institut in den vergangenen anderthalb Jahren dank der Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mit dem systematischen Aufbau eines größeren Open-Access-online-Angebots begonnen, das sowohl die nachlaufenden Digitalisierungen bereits erschienener Werke als auch eigenständige online-Publikationen umfasst: Seit November 2008 sind sämtliche Jahrgänge der „Francia“ von 1973-2006 für jedermann zugänglich, mit einer zweijährigen „moving-wall“ werden auch die zukünftigen Ausgaben entsprechend online verfügbar sein. Der ehemals gedruckte Rezensionsteil der „Francia“ wurde gleichzeitig konsequent ins Netz ausgelagert.
All dies geschah nicht gegen den Willen, sondern mit vollem Einverständnis der „Francia“-Autoren, die - bis auf einige wenige Ausnahmen - geradezu enthusiastisch auf das ihnen vorgeschlagene neue Publikationsmodell reagierten. Bis 2010 wird nach ähnlichem Muster in Kooperation mit dem „Zentrum für Elektronisches Publizieren“ (ZEP) der Bayerischen Staatsbibliothek sukzessive auch die Digitalisierung zurückliegender Jahrgänge der Beihefte der „Francia“, der „Instrumenta“ und „Pariser historischen Studien“ sowie die Online-Publikation von Tagungssammelbänden auf www.perspectivia.net erfolgen, einer neuen Open-Access-Publikationsumgebung für die in der Stiftung „Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland“ zusammengefassten Institute und ihre Kooperationspartner.
Nachfrage groß und drängend
Warum lohnt es sich, open access zu publizieren? Warum geht das Pariser Institut diesen Weg? Unsere Erfahrungen, von denen vielleicht auch andere geisteswissenschaftliche Forschungsinstitute profitieren können, lassen sich in vier Beobachtungen resümieren: Erstens ist die Nachfrage der Wissenschaftler selbst nach Open Access inzwischen groß und drängend. Da die Außenwahrnehmung der eigenen Forschungsleistungen für jeden Schreibenden - und nicht nur für Nachwuchswissenschaftler - eine zentrale Rolle spielt, wird der Wunsch nach weltweiter „Sichtbarkeit“ zunehmend laut: Und hier können, wie Studien belegen und wie es auch die statistische Auswertung der Zugriffe auf www.perspectivia.net in wünschenswerter Klarheit zeigt, klassische Printpublikationen mit elektronischen Texten, die mit Meta- und Verschlagwortungsdaten ausgezeichnet sind und über Suchmaschinen erfasst werden, eben kaum mithalten.
An dieser Stelle wird auch gerne die Legende bemüht, dass Open Access zwangsläufig den Bankrott der Verlage nach sich zieht. Dem sei allerdings entgegengehalten, dass eine Erhöhung der Zahl frei zugänglicher Publikationen zu einem signifikanten „return on investment“ führte, wie eine von John Houghton und anderen jüngst publizierte, umfassende Analyse zum Publikationsaufkommen Englands eindrucksvoll belegt.
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/rpteconomicoapublishing.pdf
http://immateriblog.de/?p=262
Qualitätsbewusstes Publizieren
Open Access Publizieren ist zweitens qualitätsbewusstes Publizieren. Der Wert eines wissenschaftlichen Manuskripts hängt von der Stringenz der Argumentation und Sorgfalt der Darstellung ab, nicht vom Medium an sich. So, wie nicht jedes gedruckte Buch per se nobelpreisverdächtig ist, wird ein Manuskript durch die elektronische Verbreitung keineswegs automatisch schlecht, sondern oft sogar dann noch besser, wenn die Publikation mit einem Open-peer-review-Verfahren kombiniert wird. Zudem liefern gerade barrierefrei zugängliche Publikationen die Chance eines wirklich effizienten kollaborativ verteilten Arbeitens, indem sie die Verknüpfung von Texten, Quellen, Artikeln und Daten ermöglichen. Im Pariser Institut gibt es keinerlei Rangabstufung zwischen gedruckten und online verfügbaren Arbeiten. Alle Publikationen werden vor der Veröffentlichung bei uns demselben Prozess intensiver Begutachtung und Redaktion unterzogen, und zwar durch ein hauseigenes Lektorat.
Drittens: Als die von den Kritikern an die Wand gemalte Enteignung empfinden unsere Autoren den freien Zugang zu ihren Werken wahrlich nicht. Jegliche Publikation setzt schließlich voraus, dass deren Urheber Dritten bestimmte Verwertungsrechte einräumen. Andernfalls dürfte ein Verlag weder gedruckte noch elektronische Veröffentlichungen vorlegen. Im Open-Access-Modell definiert der Autor darüber hinaus durch die Vergabe von Lizenzen genau, welche Verwertungsrechte auch den Lesern eingeräumt werden. Somit bestehen klare Regeln für den Umgang mit den Manuskripten, deren Sichtbarkeit und Berücksichtigung im akademischen Diskurs im ureigenen Interesse der Autoren liegt. Der Vorwurf, Open Access missachte das geltende Urheberrecht, ist im besten Fall blanke Unkenntnis der Materie, im schlechtesten Fall eine gezielte Desinformation.
Zu guter Letzt begreifen wir die Open-Access-Politik unseres Instituts als einen wichtigen Beitrag zur Internationalisierung und Demokratisierung der Geisteswissenschaften: Nicht jeder Leser der „Pariser historischen Studien“ lebt in Paris und erfreut sich eines bequemen Zugangs zu einer der exzellenten Pariser Forschungsbibliotheken. Gerade frankophone Wissenschaftler aus armen Ländern mit chaotischer Bibliothekssituation und defizitärer Literaturversorgung wissen den freien Zugang zur Forschungsliteratur zu schätzen. Wird damit nicht ein Traum Wirklichkeit, den jüngst noch Robert Darnton, brillanter Historiker der Buchgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, in seiner Eigenschaft als Direktor der Universitätsbibliothek Harvard, umrissen hat - der Traum nämlich vom weltweiten freien Fluss der Ideen und Texte, den schon die Aufklärer träumten? Mir scheint, Open Access bedeutet keine Gefahr für das Abendland, im Gegenteil.
Gudrun Gersmann ist Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in Paris und Vorsitzende des Unterausschusses „Elektronische Publikationen“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Gut gebrüllt, Löwin!
KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 20:37 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 20:33 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bereits mehrfach konnte ich feststellen, dass aktuell die Ansicht der VD-16-Digitalisate im DFG-Viewer nicht funktioniert, obwohl die BSB wahrscheinlich dazu verpflichtet ist, diese Digitalisate auch im DFG-Viewer anzubieten (bezeichnenderweise erfolgt das nicht bei den anderen Digitalisaten, die anders finanziert werden ...)
Beispiel:
http://dfg-viewer.de/v1/?set[mets]=http://mdz10.bib-bvb.de/~db/mets/bsb00025408_mets.xml
Hinweis auf dieses zur Finanzkrise passende Digitalisat bei
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=823
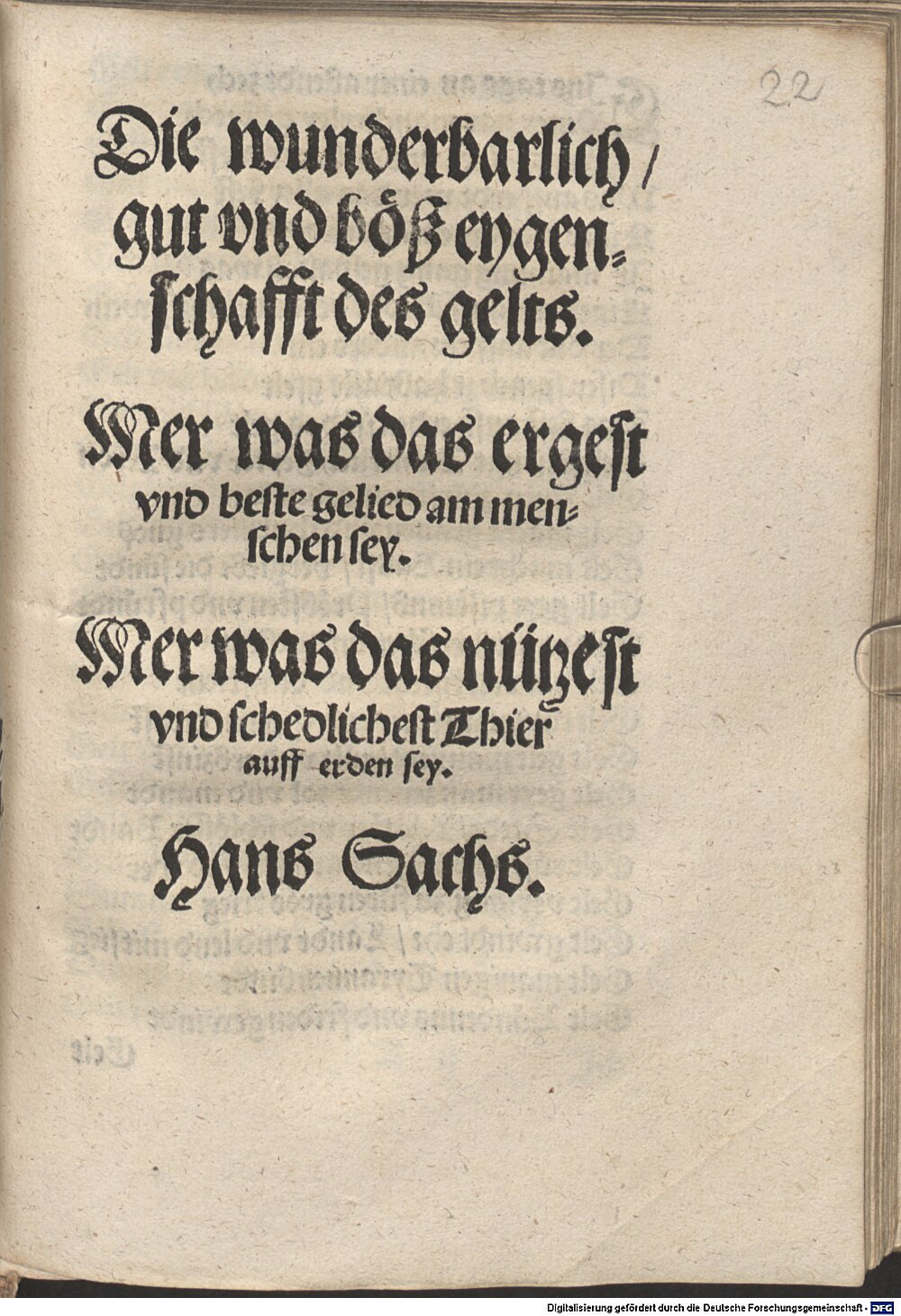
Beispiel:
http://dfg-viewer.de/v1/?set[mets]=http://mdz10.bib-bvb.de/~db/mets/bsb00025408_mets.xml
Hinweis auf dieses zur Finanzkrise passende Digitalisat bei
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=823
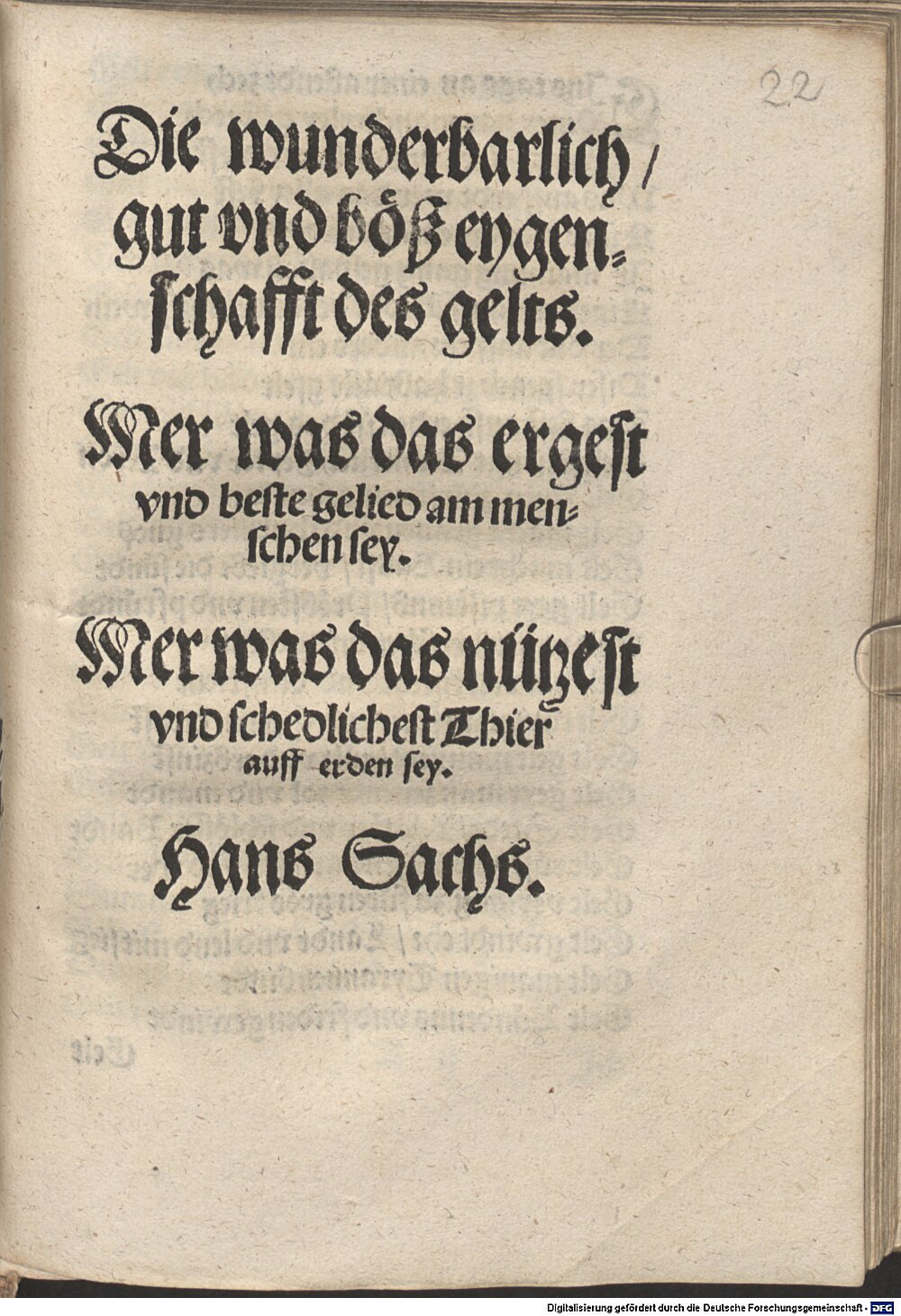
KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 20:18 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
http://library-mistress.blogspot.com/2009/02/google-game.html
http://www.google.com/search?num=100&hl=de&rlz=1C1CHMB_deDE291DE303&q="Klaus+likes+to"&btnG=Suche&lr=
Klaus likes to read
Klaus likes to manage intelligently, that is, teach others based on his past experiences.
Klaus likes to hang around in parties [not really]
Klaus likes to think of his life as a kind of constant dissidence against what he sees as the erroneous views of the majority

Klaus likes to present himself as a pro-American politician [?]
In the morning, Klaus likes to read the paper and drink coffee
Klaus likes to play the S.O.B. [??]
Havel said Klaus "likes to provoke"
Klaus likes to spend his leisure time waterfowl hunting, hiking, bicycling, skiing, and engaging in family activities [???]
Klaus likes to play with a partner, why not?
http://www.google.com/search?num=100&hl=de&rlz=1C1CHMB_deDE291DE303&q="Klaus+likes+to"&btnG=Suche&lr=
Klaus likes to read
Klaus likes to manage intelligently, that is, teach others based on his past experiences.
Klaus likes to hang around in parties [not really]
Klaus likes to think of his life as a kind of constant dissidence against what he sees as the erroneous views of the majority

Klaus likes to present himself as a pro-American politician [?]
In the morning, Klaus likes to read the paper and drink coffee
Klaus likes to play the S.O.B. [??]
Havel said Klaus "likes to provoke"
Klaus likes to spend his leisure time waterfowl hunting, hiking, bicycling, skiing, and engaging in family activities [???]
Klaus likes to play with a partner, why not?
KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 19:57 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Üblicherweise missachten die deutschen Staatsanwaltschaften das Recht des nicht anwaltlich vertretenen Beschuldigten, über die zu seiner Verteidigung notwendigen Informationen unterrichtet zu werden, obwohl dadurch von Chancengleichheit keine Rede sein kann. Üblicherweise wird dem Strafverteidiger umstandslos Akteneinsicht gewährt und üblicherweise macht dieser die Informationen seinem Mandanten zugänglich.
Seit längerem hat eine Berliner Kanzlei ein Billig-Angebot für die Akteneinsicht ins Netz gestellt: 30 Euro für ein PDF mit den Akten. Nun zerreissen sich Blawger das Maul darüber und beschwören den Untergang der Rechtspflege herauf:
http://www.lawblog.de/index.php/archives/2009/02/17/erst-mal-in-die-akte-gucker/
http://stattaller.blogspot.com/2009/02/blogger-kollege-hoenig-bietet.html
Is klar, ne? Dass diese Brut kein Interesse daran hat, einen für sie profitablen Rechts-Missstand zu beenden.
Seit längerem hat eine Berliner Kanzlei ein Billig-Angebot für die Akteneinsicht ins Netz gestellt: 30 Euro für ein PDF mit den Akten. Nun zerreissen sich Blawger das Maul darüber und beschwören den Untergang der Rechtspflege herauf:
http://www.lawblog.de/index.php/archives/2009/02/17/erst-mal-in-die-akte-gucker/
http://stattaller.blogspot.com/2009/02/blogger-kollege-hoenig-bietet.html
Is klar, ne? Dass diese Brut kein Interesse daran hat, einen für sie profitablen Rechts-Missstand zu beenden.
KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 19:41 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
14 Suchanfrage: büttenrede
13 Suchanfrage: archivalia
11 Suchanfrage: Archiv der deutschen Frauenbewegung
10 Suchanfrage: archivalia
8 Suchanfrage: Uwe Schwartz kunsttexte
7 http://de.wikipedia.org/wiki/Personenstandsgesetz
7 http://www.google.com/reader/view
7 http://www.twoday.net/members/login
5 http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-...
5 Suchanfrage: archivalia
5 Suchanfrage: lateinische texte
5 Suchanfrage: grafen von cilli
4 http://rss.netbib.de
4 Suchanfrage: Archivausbildung Potsdam
4 Suchanfrage: Patrimonium Brühl
3 http://132390.forum.onetwomax.de/topic=10026659729...
3 http://de.wikisource.org/wiki/Zeitschriften_(Lande...
3 http://historia-docet.de/html/diskussion.html
3 http://log.netbib.de
3 Suchanfrage: http://libser.media.osaka-cu.ac.jp/
3 Suchanfrage: beste bildersuchmaschine
3 Suchanfrage: ub eichstätt aussonderung
3 Suchanfrage: uschi götz
3 Suchanfrage: erlanger historikerseite
3 http://www.portill.nl/php/topic2.php?topic=1635&to...
13 Suchanfrage: archivalia
11 Suchanfrage: Archiv der deutschen Frauenbewegung
10 Suchanfrage: archivalia
8 Suchanfrage: Uwe Schwartz kunsttexte
7 http://de.wikipedia.org/wiki/Personenstandsgesetz
7 http://www.google.com/reader/view
7 http://www.twoday.net/members/login
5 http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-...
5 Suchanfrage: archivalia
5 Suchanfrage: lateinische texte
5 Suchanfrage: grafen von cilli
4 http://rss.netbib.de
4 Suchanfrage: Archivausbildung Potsdam
4 Suchanfrage: Patrimonium Brühl
3 http://132390.forum.onetwomax.de/topic=10026659729...
3 http://de.wikisource.org/wiki/Zeitschriften_(Lande...
3 http://historia-docet.de/html/diskussion.html
3 http://log.netbib.de
3 Suchanfrage: http://libser.media.osaka-cu.ac.jp/
3 Suchanfrage: beste bildersuchmaschine
3 Suchanfrage: ub eichstätt aussonderung
3 Suchanfrage: uschi götz
3 Suchanfrage: erlanger historikerseite
3 http://www.portill.nl/php/topic2.php?topic=1635&to...
KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 19:18 - Rubrik: Allgemeines
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://bibliotheksrecht.blog.de/2009/02/17/scannen-originale-5594501/
( Siehe schon: http://www.bibliotheksrecht.de/2008/01/16/verlegerrecht_und_layout_schutz~3584078/ )
Steinhauer begründet schlüssig, dass weder das Urheberrecht noch das UWG in aller Regel dem Scannen der Verlagspublikation, wenn der Autor dem Repositorium einfache Nutzungsrechte eingeräumt hat, entgegensteht.
Ergänzend möchte ich unterreichen, dass auch das Verlags-PDF bei aktuellen Publikationen verwendet werden darf, soweit die Publikation nach diesen Maßstäben retrodigitalisiert werden dürfte. Gibt der Verlag in seiner Policy bekannt, dass das Verlags-PDF nicht eingestellt werden darf, muss diese Policy in den Verlagsvertrag (als AGB) wirksam einbezogen worden sein.
Bei Abruf in Großbritannien (und einigen anderen Ländern) könnte allerdings ein britischer Verlag nach dem dortigen Layout-Schutz gegen das Scannen bzw. die Übernahme des PDFs vorgehen:
http://wiki.netbib.de/coma/ReproductionRights
( Siehe schon: http://www.bibliotheksrecht.de/2008/01/16/verlegerrecht_und_layout_schutz~3584078/ )
Steinhauer begründet schlüssig, dass weder das Urheberrecht noch das UWG in aller Regel dem Scannen der Verlagspublikation, wenn der Autor dem Repositorium einfache Nutzungsrechte eingeräumt hat, entgegensteht.
Ergänzend möchte ich unterreichen, dass auch das Verlags-PDF bei aktuellen Publikationen verwendet werden darf, soweit die Publikation nach diesen Maßstäben retrodigitalisiert werden dürfte. Gibt der Verlag in seiner Policy bekannt, dass das Verlags-PDF nicht eingestellt werden darf, muss diese Policy in den Verlagsvertrag (als AGB) wirksam einbezogen worden sein.
Bei Abruf in Großbritannien (und einigen anderen Ländern) könnte allerdings ein britischer Verlag nach dem dortigen Layout-Schutz gegen das Scannen bzw. die Übernahme des PDFs vorgehen:
http://wiki.netbib.de/coma/ReproductionRights
KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 19:02 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 18:59 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wenn ihnen ihr verantwortungsvoller Job des Kulturgutzerstörens durch Auseinanderschneiden von Stammbüchern http://archiv.twoday.net/stories/5384503/ und Zerlegen geschlossener Sammlungen genügend Zeit lässt:
http://www.boersenblatt.net/307860/
http://www.boersenblatt.net/307860/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 18:18 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
P. Birken, der sich in der Wikipedia selbst als den Maßgeblichen für das sogenannte Sichten von Versionen sieht, hat bei der Vornamens-Affäre Guttenberg
http://archiv.twoday.net/stories/5509548/
einen Schuldigen ausgemacht: denjenigen, der die Änderung gesichtet hat:
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer_Diskussion:Gamma9#Prominente_Sichtung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Fragen_zur_Wikipedia&oldid=56832613#Au_weia
Sichten soll offensichtlichen Vandalismus verhindern. Man kann sicher darüber streiten, ob die Hinzufügung eines weiteren Vornamens offensichtlicher Vandalismus ist, aber der herrische Ton, mit dem P. Birken auf dem armen Sichter herumtrampelt, sagt schon einiges über die Kommunikationskultur der Wikipedia und ihrer selbst ernannten Führungsclique.
http://archiv.twoday.net/stories/5509548/
einen Schuldigen ausgemacht: denjenigen, der die Änderung gesichtet hat:
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer_Diskussion:Gamma9#Prominente_Sichtung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Fragen_zur_Wikipedia&oldid=56832613#Au_weia
Sichten soll offensichtlichen Vandalismus verhindern. Man kann sicher darüber streiten, ob die Hinzufügung eines weiteren Vornamens offensichtlicher Vandalismus ist, aber der herrische Ton, mit dem P. Birken auf dem armen Sichter herumtrampelt, sagt schon einiges über die Kommunikationskultur der Wikipedia und ihrer selbst ernannten Führungsclique.
http://frag.wikia.com/wiki/Frag_Wikia!
Da grinst uns zwar Jimbeau entgegen, aber seriöse Fragen sind bei bibliothekarischen Auskunftsdiensten und der Wikipedia Auskunft besser aufgehoben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Auskunft

Da grinst uns zwar Jimbeau entgegen, aber seriöse Fragen sind bei bibliothekarischen Auskunftsdiensten und der Wikipedia Auskunft besser aufgehoben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Auskunft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/verkauf.php
Verzichtet aber darauf, wie bisher üblich, auch den Archivalia-Beitrag zu melden - Retourkutsche?
Verzichtet aber darauf, wie bisher üblich, auch den Archivalia-Beitrag zu melden - Retourkutsche?
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Unterschriftensammlung
Zur zweiten Rettung des Königlichen Münzkabinetts
für Hannover
Es ist das Schicksal vieler privater Sammlungen, dass sie nach einer Generation wieder zur Versteigerung kommen. Denken wir nur an die Sammlungen Erlanger, Virgil M. Brandt oder jetzt an die große Mittelalter-Sammlung Professor de Wit (Auktionen Künker 121, 130 137 von 2007 und 2008). Die über 300-jährige Geschichte des Niedersächsischen Münzkabinetts ist ein so einzigartiges Phänomen, dass die Zerschlagung eine Katastrophe für die deutsche Kultur an sich wäre. Gerade Sammlungen mit einer solch exzeptionellen Geschichte müssen in Museen gelangen und dort der Öffentlichkeit zugänglich bleiben und der Wissenschaft zur Verfügung stehen. Es ist zu befürchten, dass daraus ein gefährlicher Präzedenzfall wird. Weltweit gibt es eine Fülle von Münzsammlungen, aber auch sonstigen Kunstsammlungen in der Obhut von Banken. Die weltweite Banken- und Finanzkrise könnte einen Erdrutsch von Verkäufen auslösen, der das Preisgefüge des Handels völlig außer Kontrolle geraten lässt.
Im Niedersächsischen Münzkabinett der Deutschen Bank in Hannover liegt die einmalige königliche Welfen-Sammlung mit etwa 43.000 Münzen und Medaillen, darunter Stücke von allerhöchster wissenschaftlicher Bedeutung und Seltenheit. Als Prinz Ernst August Sr. von Hannover 1983 Geld brauchte, wollte er die Sammlung in London verkaufen. Hermann J. Abs, dem großen Bankier und Kunstmäzen, ist es zu verdanken, dass der Sammlung dieses Schicksal erspart blieb, dass sie gerettet wurde. Es entstand für ein Viertel Jahrhundert eine vorbildliche und beispielhafte Zusammenarbeit zwischen Deutscher Bank und Land Niedersachsen zum Wohle der Geldgeschichte als Feld der Alltags- und Landesgeschichte. In die Erschließung und Aufwertung der Sammlung wurden von beiden Seiten viele Ideen, viel Zeit, Kraft und Geld gesteckt. Es ist aus der Sicht des Steuerzahlers nicht nachvollziehbar, dass all dies umsonst gewesen sein soll. Sollte es wirklich zu einer Zerschlagung, einem Verkauf an einen Münzhändler oder zur (teilweisen) Abwanderung nach Braunschweig kommen, so wäre es ein Fall für kritische Fragen etwa des Steuerzahlerbundes. Über die eminente Bedeutung des Königlichen Münzkabinetts für die Wissenschaft und für das breite an Geld- und Wirtschaftsgeschichte interessierte Publikum berichtete Ulf Dräger im NNB 58, 2009, 7-9.
Keineswegs vorbildlich sind jedoch die jüngsten Ereignisse. Wie eine Bombe schlug Ende letzten Jahres die Nachricht ein, vom abermaligen Versuch, diese Sammlung zu verkaufen, die ein Kulturgut höchsten Ranges darstellt. Die Absicht, sich von der Sammlung aus Kostengründen zu trennen, besteht schon länger. Den entscheidenden letzten Anstoß für einen Verkauf gab sicherlich die Bankenkrise, auch wenn die Deutsche Bank versucht, dies abzustreiten. Zeitungen berichteten, Politiker, Wissenschaftler und verschiedene Verbände sprachen sich umgehend für den Erhalt der Sammlung aus. Rasch entstand eine bedrohliche Öffentlichkeit für die bisher im Verborgenen Handelnden. Eine insgeheim geplante Verkaufsaktion an einen Braunschweiger Münzenhändler wurde von der Presse aufgedeckt und die Beteiligten nahmen in letzter Minute Abstand von dieser Überraschungsaktion, die einfach Tatsachen schaffen sollte. ZUNÄCHST nahmen sie Abstand, so muss man vermuten. Die Zukunft und der Verbleib der Sammlung in Hannover sind weiterhin völlig unklar und die interessierte Öffentlichkeit wäre schlecht beraten, wenn sie sich jetzt bequem und zufrieden zurücklehnen würde. Es ist jedoch zu befürchten, dass die Ruhe, um die sich die Verantwortlichen krampfhaft bemühen, eher eine „Ruhe vor dem Sturm“ ist. Mit weiteren Gegenoffensiven aus Braunschweig ist aber zu rechnen.
Nach den jüngsten Ereignissen verdichtet sich der Verdacht, dass es sich um die Veräußerung von „Tafelsilber“ vor dem Hintergrund der Bankenkrise durch die Deutsche Bank handelt. Es fragt sich nur, ob der für eine der größten Banken der Welt vergleichsweise kleine Betrag, den sicheren großen Image-Schaden lohnt. Inzwischen gibt es auch eine Internetplattform, die weitere Hintergrundinformationen bietet: http://archiv.twoday.net/stories/5353032/
Eine Welle von Briefen von Numismatikern, Münzkabinetten und wissenschaftlichen Institutionen aus dem In- und Ausland wurden an die Deutsche Bank, an den Niedersächsischen Ministerpräsidenten, an den Oberbürgermeister von Hannover, an den Staatsminister für Kultur in Berlin und an verschiedene Kulturstiftungen geschrieben. Die Deutsche Numismatische Gesellschaft gehört zu den Ersten, die sich an die Bank und führende Politiker gewandt haben. Einige der Schreiben tragen den Charakter eines offenen Briefes und sind im Internet veröffentlicht, z. B. von Prof. Dr. Lucia Travaini, Mailand/Rom: http://www.luciatravaini.it/.
Die Deutsche Bank versuchte schnell, die Wogen zu glätten, und betonte, sich dem Interesse des Landes verpflichtet zu fühlen und in diesem Sinne handeln zu wollen. Das aber kann nur heißen, dass die Sammlung geschlossen erhalten bleibt und der Öffentlichkeit am Standort Hannover weiterhin zugänglich gemacht wird. Alles andere wäre Wortbruch und pure Unglaubwürdigkeit. Die Sammlung ist in den vergangenen drei Jahrhunderten in Hannover und für Hannover von rund 20 Wissenschaftlergenerationen aufgebaut worden. Sie gehört an diesen Ort und nirgendwo anders hin.
Alle Beteiligten sind außerdem daran zu erinnern, dass Artikel 72 der Niedersächsischen Verfassung festlegt, dass die kulturelle und historische Identität der alten Landesteile Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg gewahrt und gefördert werden müssen. Übertragen auf archäologische Funde oder Museumssammlungen bedeutet es, dass diese Kulturgüter aus guten Gründen dort bleiben müssen, wo sie entstanden sind, und dass sie nicht verlagert werden dürfen. So lautet jedenfalls die bisherige Rechtspraxis. Will man tatsächlich gegen Verfassungsrecht verstoßen? Dies ist zu beachten, sollte man tatsächlich an die Anbindung an ein Braunschweiger Museum denken. Eine Verlagerung dieses historischen Schatzes von Hannover nach Braunschweig ist nicht nur unsinnig, sondern zugleich überhaupt nicht verfassungskonform.
Das Numismatische Nachrichtenblatt fasste einige faszinierende Ideen zusammen, wie aus der bedrohlichen Krise etwas Positives Neues entstehen könnte. Eine Dauerausstellung an zentralem Ort mit großer „Laufkundschaft“ wurde vorgeschlagen. Gemeint ist das Schloss Herrenhausen, das bis 2012 von der Stiftung Volkswagenwerk wieder aufgebaut wird. Die Königliche Münzsammlung im Königlichen Schloss wäre eine würdige und angemessene Präsentation. Die räumlich-organisatorische Anbindung an das Niedersächsische Landesarchiv und die Zusammenführung aller hannoverschen Münzsammlungen wurden diskutiert. Im historischen Archivgebäude entstand das Königliche Münzkabinett und entwickelte im 18. und 19. Jahrhundert eine erste Blüte. Im Verbund mit der großen
· Universalsammlung des Museums August Kestner
(http://www.hannover.de/museen/museen/kestner/vorst/kes_numi.html)
· der Münzsammlung Berkowitz der Sparkasse Hannover
(https://archiv.twoday.net/stories/5353032/)
· der landes- und stadtgeschichtlichen Sammlung des Historischen Museums
· und der weltweit einzigartigen Sammlung von Bergbaugeprägen der Preussag (heute: Touristik Union International TUI,
http://www.hannover.de/museen/museen/mus_preu.html#)
entstünde ein Münzkabinett nicht nur von nationalem, sondern von internationalem Format. Natürlich entstehen damit auch Synergien, die Kosten senken können. Dies sollte nicht übersehen werden, da die Kostendiskussion ja offenbar das Desaster ausgelöst hat. Man scheint dabei auch völlig zu übersehen, dass die für Hannover geschehene Aufbauleistung der letzen Jahrzehnte mutwillig zerstört wird. Aus der Königlichen Sammlung ist durch das unermüdliche Engagement, die erfolgreiche wissenschaftliche und wissenschaftsorganisatorische Arbeit von Dr. Reiner Cunz ein modernes und vorbildliches geldgeschichtliches Institut entstanden, dessen Auflösung nun zu befürchten ist, was großen Schaden für die deutsche und internationale Geldgeschichte anrichten würde.
Hannover würde jedoch durch die Zusammenlegung aller Münzkabinette in der Champions League der Geldmuseen mitspielen und in einem Atemzug mit Berlin, München und Dresden genannt werden. Was jetzt gebraucht wird, ist Rückgrat bei der Abwendung der Bedrohung und der visionäre Mut zur Größe. In Hannover kann etwas geschaffen werden, was es in anderen vergleichbaren Städten nicht gibt. Es gilt, diese großartige Chance nicht zu verpassen.
Die Deutsche Numismatische Gesellschaft (DNG) begrüßt die vielseitigen Bemühungen zur Rettung der Welfen-Sammlung, muss aber feststellen, dass für den Erhalt noch kein wirklicher Durchbruch gelungen ist.
Deshalb hat sich die Deutsche Numismatische Gesellschaft entschlossen, eine Unterschriftenaktion zu initiieren, die deutlich machen soll, dass eine solche Sammlung nicht nur für wenige Spezialisten, sondern für die deutsche Kulturgeschichte von erheblicher Bedeutung ist. Eine Resolution wird den Mitgliedern der einzelnen Vereine zur Unterschrift vorgelegt. Die Unterschriftensammlung hat bereits im Januar auf der Jahreshauptversammlung der Frankfurter Numismatischen Gesellschaft und dem Kolloquium Mittelalternumismatik in Halle (Saale) begonnen.
Mit einer hohen Zahl von Unterschriften will die DNG beweisen, dass der dringende Wunsch, diese unvergleichliche Sammlung zu schützen und zu erhalten, von breiten Bevölkerungskreisen getragen wird. Die gesammelten Unterschriften werden der Geschäftsleitung der Deutschen Bank in Hannover übergeben, Kopien der Unterschriftenlisten werden dann an den Niedersächsischen Ministerpräsidenten geschickt. Die Presse wird rechtzeitig über diesen Schritt informiert.
Die DNG ruft deshalb ihre Mitglieder auf, diese Resolution bis Ende März zu unterschreiben. Die Listen mit den Unterschriften sollen an den Präsidenten der DNG, Dr. Helmut Schubert, Kurfürstenstraße 21, 60486 Frankfurt am Main geschickt werden. Die Vereinsvorsitzenden erhalten per Email bzw. Fax die Listen zur weiteren Verbreitung auf den Vereinssitzungen, Jahreshauptversammlungen, Münzbörsen und Tagungen. Außerdem kann man die Liste als PDF-Datei von der Website der Deutschen Numismatischen Gesellschaft herunterladen: http://www.numismatische-gesellschaft.de/
Lassen wir nichts unversucht, um die Verantwortlichen der Deutschen Bank an die Verpflichtung zu erinnern, die Hermann J. Abs einging, als er 1983 die Welfen-Sammlung zum ersten Mal retten konnte. Es ist unsere Aufgabe und Verantwortung, die zweite Rettung der Sammlung nach Kräften zu unterstützen und Denkanstöße für die Gestaltung der Zukunft zu geben. Unser Fach ist in großer Gefahr.
Dr. Helmut Schubert
Präsident der DNG
Update 4.3.2009(kg)
Die Aktion ist bis zum Mai verlängert. Bitte weiter unterschreiben, damit die Münzsammlung als Ganzes in Hannover bleibt und nicht nach dem Ankauf durch die Landesregierung ganz oder teilweise nach Braunschweig abwandert! http://archiv.twoday.net/stories/5559965/
Zur zweiten Rettung des Königlichen Münzkabinetts
für Hannover
Es ist das Schicksal vieler privater Sammlungen, dass sie nach einer Generation wieder zur Versteigerung kommen. Denken wir nur an die Sammlungen Erlanger, Virgil M. Brandt oder jetzt an die große Mittelalter-Sammlung Professor de Wit (Auktionen Künker 121, 130 137 von 2007 und 2008). Die über 300-jährige Geschichte des Niedersächsischen Münzkabinetts ist ein so einzigartiges Phänomen, dass die Zerschlagung eine Katastrophe für die deutsche Kultur an sich wäre. Gerade Sammlungen mit einer solch exzeptionellen Geschichte müssen in Museen gelangen und dort der Öffentlichkeit zugänglich bleiben und der Wissenschaft zur Verfügung stehen. Es ist zu befürchten, dass daraus ein gefährlicher Präzedenzfall wird. Weltweit gibt es eine Fülle von Münzsammlungen, aber auch sonstigen Kunstsammlungen in der Obhut von Banken. Die weltweite Banken- und Finanzkrise könnte einen Erdrutsch von Verkäufen auslösen, der das Preisgefüge des Handels völlig außer Kontrolle geraten lässt.
Im Niedersächsischen Münzkabinett der Deutschen Bank in Hannover liegt die einmalige königliche Welfen-Sammlung mit etwa 43.000 Münzen und Medaillen, darunter Stücke von allerhöchster wissenschaftlicher Bedeutung und Seltenheit. Als Prinz Ernst August Sr. von Hannover 1983 Geld brauchte, wollte er die Sammlung in London verkaufen. Hermann J. Abs, dem großen Bankier und Kunstmäzen, ist es zu verdanken, dass der Sammlung dieses Schicksal erspart blieb, dass sie gerettet wurde. Es entstand für ein Viertel Jahrhundert eine vorbildliche und beispielhafte Zusammenarbeit zwischen Deutscher Bank und Land Niedersachsen zum Wohle der Geldgeschichte als Feld der Alltags- und Landesgeschichte. In die Erschließung und Aufwertung der Sammlung wurden von beiden Seiten viele Ideen, viel Zeit, Kraft und Geld gesteckt. Es ist aus der Sicht des Steuerzahlers nicht nachvollziehbar, dass all dies umsonst gewesen sein soll. Sollte es wirklich zu einer Zerschlagung, einem Verkauf an einen Münzhändler oder zur (teilweisen) Abwanderung nach Braunschweig kommen, so wäre es ein Fall für kritische Fragen etwa des Steuerzahlerbundes. Über die eminente Bedeutung des Königlichen Münzkabinetts für die Wissenschaft und für das breite an Geld- und Wirtschaftsgeschichte interessierte Publikum berichtete Ulf Dräger im NNB 58, 2009, 7-9.
Keineswegs vorbildlich sind jedoch die jüngsten Ereignisse. Wie eine Bombe schlug Ende letzten Jahres die Nachricht ein, vom abermaligen Versuch, diese Sammlung zu verkaufen, die ein Kulturgut höchsten Ranges darstellt. Die Absicht, sich von der Sammlung aus Kostengründen zu trennen, besteht schon länger. Den entscheidenden letzten Anstoß für einen Verkauf gab sicherlich die Bankenkrise, auch wenn die Deutsche Bank versucht, dies abzustreiten. Zeitungen berichteten, Politiker, Wissenschaftler und verschiedene Verbände sprachen sich umgehend für den Erhalt der Sammlung aus. Rasch entstand eine bedrohliche Öffentlichkeit für die bisher im Verborgenen Handelnden. Eine insgeheim geplante Verkaufsaktion an einen Braunschweiger Münzenhändler wurde von der Presse aufgedeckt und die Beteiligten nahmen in letzter Minute Abstand von dieser Überraschungsaktion, die einfach Tatsachen schaffen sollte. ZUNÄCHST nahmen sie Abstand, so muss man vermuten. Die Zukunft und der Verbleib der Sammlung in Hannover sind weiterhin völlig unklar und die interessierte Öffentlichkeit wäre schlecht beraten, wenn sie sich jetzt bequem und zufrieden zurücklehnen würde. Es ist jedoch zu befürchten, dass die Ruhe, um die sich die Verantwortlichen krampfhaft bemühen, eher eine „Ruhe vor dem Sturm“ ist. Mit weiteren Gegenoffensiven aus Braunschweig ist aber zu rechnen.
Nach den jüngsten Ereignissen verdichtet sich der Verdacht, dass es sich um die Veräußerung von „Tafelsilber“ vor dem Hintergrund der Bankenkrise durch die Deutsche Bank handelt. Es fragt sich nur, ob der für eine der größten Banken der Welt vergleichsweise kleine Betrag, den sicheren großen Image-Schaden lohnt. Inzwischen gibt es auch eine Internetplattform, die weitere Hintergrundinformationen bietet: http://archiv.twoday.net/stories/5353032/
Eine Welle von Briefen von Numismatikern, Münzkabinetten und wissenschaftlichen Institutionen aus dem In- und Ausland wurden an die Deutsche Bank, an den Niedersächsischen Ministerpräsidenten, an den Oberbürgermeister von Hannover, an den Staatsminister für Kultur in Berlin und an verschiedene Kulturstiftungen geschrieben. Die Deutsche Numismatische Gesellschaft gehört zu den Ersten, die sich an die Bank und führende Politiker gewandt haben. Einige der Schreiben tragen den Charakter eines offenen Briefes und sind im Internet veröffentlicht, z. B. von Prof. Dr. Lucia Travaini, Mailand/Rom: http://www.luciatravaini.it/.
Die Deutsche Bank versuchte schnell, die Wogen zu glätten, und betonte, sich dem Interesse des Landes verpflichtet zu fühlen und in diesem Sinne handeln zu wollen. Das aber kann nur heißen, dass die Sammlung geschlossen erhalten bleibt und der Öffentlichkeit am Standort Hannover weiterhin zugänglich gemacht wird. Alles andere wäre Wortbruch und pure Unglaubwürdigkeit. Die Sammlung ist in den vergangenen drei Jahrhunderten in Hannover und für Hannover von rund 20 Wissenschaftlergenerationen aufgebaut worden. Sie gehört an diesen Ort und nirgendwo anders hin.
Alle Beteiligten sind außerdem daran zu erinnern, dass Artikel 72 der Niedersächsischen Verfassung festlegt, dass die kulturelle und historische Identität der alten Landesteile Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg gewahrt und gefördert werden müssen. Übertragen auf archäologische Funde oder Museumssammlungen bedeutet es, dass diese Kulturgüter aus guten Gründen dort bleiben müssen, wo sie entstanden sind, und dass sie nicht verlagert werden dürfen. So lautet jedenfalls die bisherige Rechtspraxis. Will man tatsächlich gegen Verfassungsrecht verstoßen? Dies ist zu beachten, sollte man tatsächlich an die Anbindung an ein Braunschweiger Museum denken. Eine Verlagerung dieses historischen Schatzes von Hannover nach Braunschweig ist nicht nur unsinnig, sondern zugleich überhaupt nicht verfassungskonform.
Das Numismatische Nachrichtenblatt fasste einige faszinierende Ideen zusammen, wie aus der bedrohlichen Krise etwas Positives Neues entstehen könnte. Eine Dauerausstellung an zentralem Ort mit großer „Laufkundschaft“ wurde vorgeschlagen. Gemeint ist das Schloss Herrenhausen, das bis 2012 von der Stiftung Volkswagenwerk wieder aufgebaut wird. Die Königliche Münzsammlung im Königlichen Schloss wäre eine würdige und angemessene Präsentation. Die räumlich-organisatorische Anbindung an das Niedersächsische Landesarchiv und die Zusammenführung aller hannoverschen Münzsammlungen wurden diskutiert. Im historischen Archivgebäude entstand das Königliche Münzkabinett und entwickelte im 18. und 19. Jahrhundert eine erste Blüte. Im Verbund mit der großen
· Universalsammlung des Museums August Kestner
(http://www.hannover.de/museen/museen/kestner/vorst/kes_numi.html)
· der Münzsammlung Berkowitz der Sparkasse Hannover
(https://archiv.twoday.net/stories/5353032/)
· der landes- und stadtgeschichtlichen Sammlung des Historischen Museums
· und der weltweit einzigartigen Sammlung von Bergbaugeprägen der Preussag (heute: Touristik Union International TUI,
http://www.hannover.de/museen/museen/mus_preu.html#)
entstünde ein Münzkabinett nicht nur von nationalem, sondern von internationalem Format. Natürlich entstehen damit auch Synergien, die Kosten senken können. Dies sollte nicht übersehen werden, da die Kostendiskussion ja offenbar das Desaster ausgelöst hat. Man scheint dabei auch völlig zu übersehen, dass die für Hannover geschehene Aufbauleistung der letzen Jahrzehnte mutwillig zerstört wird. Aus der Königlichen Sammlung ist durch das unermüdliche Engagement, die erfolgreiche wissenschaftliche und wissenschaftsorganisatorische Arbeit von Dr. Reiner Cunz ein modernes und vorbildliches geldgeschichtliches Institut entstanden, dessen Auflösung nun zu befürchten ist, was großen Schaden für die deutsche und internationale Geldgeschichte anrichten würde.
Hannover würde jedoch durch die Zusammenlegung aller Münzkabinette in der Champions League der Geldmuseen mitspielen und in einem Atemzug mit Berlin, München und Dresden genannt werden. Was jetzt gebraucht wird, ist Rückgrat bei der Abwendung der Bedrohung und der visionäre Mut zur Größe. In Hannover kann etwas geschaffen werden, was es in anderen vergleichbaren Städten nicht gibt. Es gilt, diese großartige Chance nicht zu verpassen.
Die Deutsche Numismatische Gesellschaft (DNG) begrüßt die vielseitigen Bemühungen zur Rettung der Welfen-Sammlung, muss aber feststellen, dass für den Erhalt noch kein wirklicher Durchbruch gelungen ist.
Deshalb hat sich die Deutsche Numismatische Gesellschaft entschlossen, eine Unterschriftenaktion zu initiieren, die deutlich machen soll, dass eine solche Sammlung nicht nur für wenige Spezialisten, sondern für die deutsche Kulturgeschichte von erheblicher Bedeutung ist. Eine Resolution wird den Mitgliedern der einzelnen Vereine zur Unterschrift vorgelegt. Die Unterschriftensammlung hat bereits im Januar auf der Jahreshauptversammlung der Frankfurter Numismatischen Gesellschaft und dem Kolloquium Mittelalternumismatik in Halle (Saale) begonnen.
Mit einer hohen Zahl von Unterschriften will die DNG beweisen, dass der dringende Wunsch, diese unvergleichliche Sammlung zu schützen und zu erhalten, von breiten Bevölkerungskreisen getragen wird. Die gesammelten Unterschriften werden der Geschäftsleitung der Deutschen Bank in Hannover übergeben, Kopien der Unterschriftenlisten werden dann an den Niedersächsischen Ministerpräsidenten geschickt. Die Presse wird rechtzeitig über diesen Schritt informiert.
Die DNG ruft deshalb ihre Mitglieder auf, diese Resolution bis Ende März zu unterschreiben. Die Listen mit den Unterschriften sollen an den Präsidenten der DNG, Dr. Helmut Schubert, Kurfürstenstraße 21, 60486 Frankfurt am Main geschickt werden. Die Vereinsvorsitzenden erhalten per Email bzw. Fax die Listen zur weiteren Verbreitung auf den Vereinssitzungen, Jahreshauptversammlungen, Münzbörsen und Tagungen. Außerdem kann man die Liste als PDF-Datei von der Website der Deutschen Numismatischen Gesellschaft herunterladen: http://www.numismatische-gesellschaft.de/
Lassen wir nichts unversucht, um die Verantwortlichen der Deutschen Bank an die Verpflichtung zu erinnern, die Hermann J. Abs einging, als er 1983 die Welfen-Sammlung zum ersten Mal retten konnte. Es ist unsere Aufgabe und Verantwortung, die zweite Rettung der Sammlung nach Kräften zu unterstützen und Denkanstöße für die Gestaltung der Zukunft zu geben. Unser Fach ist in großer Gefahr.
Dr. Helmut Schubert
Präsident der DNG
Update 4.3.2009(kg)
Die Aktion ist bis zum Mai verlängert. Bitte weiter unterschreiben, damit die Münzsammlung als Ganzes in Hannover bleibt und nicht nach dem Ankauf durch die Landesregierung ganz oder teilweise nach Braunschweig abwandert! http://archiv.twoday.net/stories/5559965/
Hermann Grote - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 09:15 - Rubrik: Kulturgut
KlausGraf - am Dienstag, 17. Februar 2009, 19:15 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Über die Wiederaufnahme von "Caligula", der vorletzten Oper des 1960 in Hamburg geborenen Komponisten Detlev Glanert, an der Oper Frankfurt konstatierte ein Beobachter : „Caligula, das steht fest, ist eine Oper, die es nicht verdient, nach ihrer Uraufführung in der Archiv-Schublade zu verschwinden. Sie hat das Zeug zum Repertoirestück.“
Quelle:
http://cms.frankfurt-live.com/front_content.php?idcatart=63837
Quelle:
http://cms.frankfurt-live.com/front_content.php?idcatart=63837
Wolf Thomas - am Dienstag, 17. Februar 2009, 19:09 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus Maxi Sickerts Besprechung in der Zeit (Link):" ..... Ein Schüler von Abrams ist 1974 der 19-jährige Posaunist und Philosophiestudent George Lewis. Er tritt der AACM bei. Ende der Neunziger, Lewis ist mittlerweile ein anerkannter Musiker und Professor an der Columbia University, macht ihm sein Mentor den Vorschlag, die Geschichte der AACM aufzuschreiben. Eine riesige Aufgabe, denn es gibt kein vorhandenes Archiv oder bereits existierende Arbeiten dazu.Lewis macht sich daran, die Mitglieder der AACM nach und nach aufzusuchen, Interviews zu führen, Artikel und Liner Notes, Flyer für Konzerte und private Fotos der Musiker zu sichten. Mehr als 70 Gespräche hat er geführt, Soli transkribiert, Kassettenmitschnitte restauriert und so eine Organisation umrissen, die fest verankert ist in der künstlerischen Entwicklung des Jazz und der Freien Improvisation, wie auch in der sozialen und politischen Entwicklung Chicagos. .....
Diesem Buch gelingt es erstmals, die Bedeutung der AACM kulturell einzuordnen und ihren Einfluss auf die Entwicklung der Improvisation darzustellen. Damit ist es ein wichtiger Baustein, der bisher in der amerikanischen Jazzgeschichtsschreibung gefehlt hat."
Diesem Buch gelingt es erstmals, die Bedeutung der AACM kulturell einzuordnen und ihren Einfluss auf die Entwicklung der Improvisation darzustellen. Damit ist es ein wichtiger Baustein, der bisher in der amerikanischen Jazzgeschichtsschreibung gefehlt hat."
Wolf Thomas - am Dienstag, 17. Februar 2009, 19:06 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Fazit des SZ-Artikels (Link): " ..... So wird dann hoffentlich bald zu erkennen sein, welche Wertschöpfungen aus Bibliothek, Theater, Volkshoch- oder Musikschule, Archiv oder Museum hervorgehen - zum Vorteil der Kultur. "
Darf ich mich beim Begriff "Wertschöpfung" im archivischen Kontext unwohl fühlen ?
Darf ich mich beim Begriff "Wertschöpfung" im archivischen Kontext unwohl fühlen ?
Wolf Thomas - am Dienstag, 17. Februar 2009, 19:04 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus dem Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom
14. April 2008 S. 48 hebe ich hervor:
Wo sehen Sie die Hauptschuld der Familie von Hessen in der Generation Ihres Vaters?
Die Hauptschuld liegt meiner Ansicht nach darin, dass sie sich dem Regime zur Verfügung gestellt und dadurch viele andere dazu animiert haben, da das Haus Hessen in den dreißiger Jahren immer noch über eine große öffentliche Wirkung verfügte. Das lässt sich später nicht mehr gutmachen. Das Einzige, was heute getan werden kann, ist, den Irrtum einzusehen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Das sollte allerdings nicht dazu verführen zu glauben, wir hätten es unter den damaligen Verhältnissen besser gemacht.
Würde mit dieser Einsicht nicht einhergehen, dass das Familienarchiv im Schloss Fasanerie komplett geöffnet würde?
Das Archiv ist ein privates, kein öffentliches Archiv. Alle Dokumente mit Bezug auf die öffentliche Tätigkeit meines Vaters und seiner Brüder sowie auf ihre NS-Karrieren befinden sich in den Staatsarchiven in Berlin und Wiesbaden sowie im Bundesarchiv Koblenz. Sie sind dort seit langem der Öffentlichkeit zugänglich. Die Nachlässe meiner Großmutter und ihrer Nachkommen, die im Familienarchiv aufbewahrt sind, bestehen zur Hauptsache aus Privatpapieren. Während der fünfjährigen Zusammenarbeit mit Professor Petropoulos habe ich diese Nachlässe auf alles überprüft, was einen gesellschaftlich relevanten oder politischen Bezug haben könnte, fotokopiert, exzerpiert und dem Autor zur Verfügung gestellt.
Wäre es denn möglich, die persönlichen von den eher öffentlichen Dokumenten zu trennen und Letztere der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen?
Das lässt sich nicht trennen, weil in den Briefen von persönlichen als auch öffentlichen Themen die Rede ist. Eines Tages, wenn die nächsten Angehörigen derer, von denen die Briefe handeln, nicht mehr am Leben sind, könnte ich mir vorstellen, dass auch die privaten Dokumente im Familienarchiv der Forschung zugänglich gemacht werden. So hat meine Familie es zum Beispiel mit den Briefen meiner Urgroßmutter, der Kaiserin Friedrich, getan, in denen auch sehr persönliche Dinge zur Entwicklung Kaiser Wilhelms II. zu lesen sind.
Siehe auch:
http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=12227
14. April 2008 S. 48 hebe ich hervor:
Wo sehen Sie die Hauptschuld der Familie von Hessen in der Generation Ihres Vaters?
Die Hauptschuld liegt meiner Ansicht nach darin, dass sie sich dem Regime zur Verfügung gestellt und dadurch viele andere dazu animiert haben, da das Haus Hessen in den dreißiger Jahren immer noch über eine große öffentliche Wirkung verfügte. Das lässt sich später nicht mehr gutmachen. Das Einzige, was heute getan werden kann, ist, den Irrtum einzusehen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Das sollte allerdings nicht dazu verführen zu glauben, wir hätten es unter den damaligen Verhältnissen besser gemacht.
Würde mit dieser Einsicht nicht einhergehen, dass das Familienarchiv im Schloss Fasanerie komplett geöffnet würde?
Das Archiv ist ein privates, kein öffentliches Archiv. Alle Dokumente mit Bezug auf die öffentliche Tätigkeit meines Vaters und seiner Brüder sowie auf ihre NS-Karrieren befinden sich in den Staatsarchiven in Berlin und Wiesbaden sowie im Bundesarchiv Koblenz. Sie sind dort seit langem der Öffentlichkeit zugänglich. Die Nachlässe meiner Großmutter und ihrer Nachkommen, die im Familienarchiv aufbewahrt sind, bestehen zur Hauptsache aus Privatpapieren. Während der fünfjährigen Zusammenarbeit mit Professor Petropoulos habe ich diese Nachlässe auf alles überprüft, was einen gesellschaftlich relevanten oder politischen Bezug haben könnte, fotokopiert, exzerpiert und dem Autor zur Verfügung gestellt.
Wäre es denn möglich, die persönlichen von den eher öffentlichen Dokumenten zu trennen und Letztere der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen?
Das lässt sich nicht trennen, weil in den Briefen von persönlichen als auch öffentlichen Themen die Rede ist. Eines Tages, wenn die nächsten Angehörigen derer, von denen die Briefe handeln, nicht mehr am Leben sind, könnte ich mir vorstellen, dass auch die privaten Dokumente im Familienarchiv der Forschung zugänglich gemacht werden. So hat meine Familie es zum Beispiel mit den Briefen meiner Urgroßmutter, der Kaiserin Friedrich, getan, in denen auch sehr persönliche Dinge zur Entwicklung Kaiser Wilhelms II. zu lesen sind.
Siehe auch:
http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=12227
KlausGraf - am Dienstag, 17. Februar 2009, 18:14 - Rubrik: Herrschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://medienlese.com/2009/02/12/zukunft-der-medien-journalismus-ohne-zeitung/
Hier ist eins:
“Wer auf Print-Online-Verzahnung setzt und Blogs einsetzt (Sie wissen schon, diese crazy Internettagebücher für junge Leute!), der sollte nicht der Blog sagen. Das dürfen nur Duden-Redakteure, die sich morgens erst einmal zu einer Tasse Filterkaffee das Internet ausdrucken.”
—Antville-Blogger Kutter (nicht nur) über den neuen Freitag, Februar 2009
Hier ist eins:
“Wer auf Print-Online-Verzahnung setzt und Blogs einsetzt (Sie wissen schon, diese crazy Internettagebücher für junge Leute!), der sollte nicht der Blog sagen. Das dürfen nur Duden-Redakteure, die sich morgens erst einmal zu einer Tasse Filterkaffee das Internet ausdrucken.”
—Antville-Blogger Kutter (nicht nur) über den neuen Freitag, Februar 2009
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Buch mit Anwendungsbeispielen:
http://creativecommons.org.au/materials/Building_an_Australasian_Commons_book.pdf
http://creativecommons.org.au/materials/Building_an_Australasian_Commons_book.pdf
KlausGraf - am Dienstag, 17. Februar 2009, 02:03 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Leider hat die Badische Landesbibliothek im neuen Jahr ihre so sorgfältige Dokumentation der Presseberichte zur badischen Kulturgüteraffäre offenbar aufgegeben, obwohl ein Ende des Würgens in greifbarer Nähe scheint. Aber noch ist nicht alles in trockenen Tüchern.
http://www.badische-zeitung.de/hartes-feilschen-um-kunst
[...] Seit Ministerpräsident Günther Oettinger Anfang November mit Erbprinz Bernhard von Baden den wohl größten Kulturhandel in der Landesgeschichte festgeklopft hat, wurde akribisch darum gerungen, welchen Gegenwert das Land für seine vielen Millionen (insgesamt 60,8 Millionen Euro) erhält.
Vieles scheint klar: So lässt es sich das Land 15 Millionen Euro kosten, dass das in tiefen Finanzproblemen steckende Adelshaus darauf verzichtet, vor Gericht um seine Besitzrechte an badischen Kunstschätzen zu kämpfen. Eine hochkarätige Expertenkommission hatte festgestellt, dass das meiste dieser Kunst – grob geschätzter Wert gut 300 Millionen Euro – ohnehin dem Land gehört. Dennoch geht die Regierung auf diesen Deal ein.
Für weitere 25,8 Millionen Euro will das Land Schloss und Kloster Salem samt Münster erwerben – inklusive der nicht beweglichen Kunstwerke in den Bauten. Ausgenommen ist die Prälatur, in der die Familie des Markgrafen weiter wohnen wird. Das Land erhält nur ein Vorkaufsrecht, gesteht dafür dem Adelshaus zu, andere Räume wie den Kaisersaal gelegentlich zu nutzen.
Den Haken in der Vereinbarung sahen Insider von Anfang an in der Zusicherung des Landes, für bis zu 17 Millionen Euro weitere Kunstgegenstände zu erwerben, die zweifelsfrei dem Adelshaus gehören. "Auf der Grundlage fachlicher Bewertungen" sollte die Auswahl der Kunstwerke erfolgen. Schon bei der Einigung auf die Gutachter zeigte sich, mit welch harten Bandagen gekämpft wurde: Das Haus Baden lehnte einen Experten ab, den es selbst vorgeschlagen hatte, nur weil dieser schon einmal im Auftrag des Landes tätig war. Der neue Gutachter, den das Land akzeptiert hatte, taxierte prompt ein Paket von 8000 Urkunden erheblich teurer und damit badenfreundlicher.
Einvernehmliche Verhandlungsergebnisse wurden vom Haus Baden immer wieder in Frage gestellt. Es versuchte auch wiederholt, Kunstwerke von den Immobilien zu trennen und sie in den 17-Millionen-Topf aufzunehmen – so bliebe für die Familie mehr übrig, was sich auf dem freien Markt verkaufen ließe. "Es wird gehandelt, bis die Zahlen stimmen", beschrieb ein Beobachter das Feilschen.
Inzwischen steht fest, dass die Kunstwerke im Schloss und außerhalb einen Wert von mehr als 23 Millionen Euro besitzen. Es ist nun zu entscheiden, welche Kunst für sechs Millionen Euro die Familie für sich behält.
Hartnäckig hält sich auf Landesseite aber der Verdacht, das Haus Baden verneble weiteren Kunstbesitz. Denn die vereinbarte Übersicht über den Gesamtbestand liegt bisher nicht vor. Und manches gehört plötzlich nicht mehr dazu wie ein wertvoller burgundischer Frauengürtel aus dem 13. Jahrhundert. Kunstminister Peter Frankenberg sieht dennoch "alles auf gutem Weg", wie er in dieser Woche der CDU-Fraktion sagte. Kommende Woche soll schon mal der Finanzausschuss des Landtags unterrichtet werden.
Die Stuttgarter Nachrichten melden:
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1949227
Das Haus Baden wird die Vermarktung von Schloss Salem nun doch komplett dem Land überlassen. Darauf haben sich beide Verhandlungspartner geeinigt. Derweil hat der Landtag den Weg für den Gesamtvertrag frei gemacht.
In der uralten Geschichte über den Streit um die badischen Kunstschätze wird jetzt das letzte Kapitel aufgeschlagen. Seit sich beide Parteien im November 2008 grundsätzlich darüber verständigt haben, was mit der Klosteranlage sowie hunderten Kunstwerken geschehen soll, geht es jetzt noch um Details. Mitte März soll dann der Kaufvertrag offiziell unterzeichnet werden.
Die Hauptarbeit hat seit Wochen ein dreiköpfiges Gutachtergremium, das den Preis einzelner Kunstwerke schätzt. Das Paket enthält nämlich nicht nur den Kauf der Schlossanlage durch das Land für 25,8 Millionen Euro sowie ein Wohnrecht für die markgräfliche Familie, sondern auch eine Regelung für wertvolle Bilder und Schmuckstücke, deren Eigentum seit Jahrzehnten umstritten ist. Vorgesehen ist, dass das Haus Baden auf alle Ansprüche verzichtet und im Gegenzug dafür 15 Millionen Euro erhält - eine Art Ablösesumme.
Mitte März wollen die Unterhändler mit dem Vertrag zum Notar, doch schon zum 1. März ist ein Teil des Kaufpreises fällig: Das Haus Baden erhält 25,8 Millionen für die Schlossanlage sowie die Hälfte der vereinbarten 17 Millionen. Weil dies im Haushalt für 2009 noch nicht verankert ist, hat der Finanzausschuss am Montag mit den Stimmen von CDU, FDP und Grünen den Weg für Gesamtvertrag frei gemacht. Volumen: insgesamt 57,8 Millionen Euro. Am morgigen Mittwoch soll auch das Plenum den Deal besiegeln.
Anders zum Zeitplan:
http://www.ad-hoc-news.de/verhandlungen-ueber-erwerb-von-schloss-salem-vor--/de/Politik/20051203
 F. Bucher http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de
F. Bucher http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de
http://www.badische-zeitung.de/hartes-feilschen-um-kunst
[...] Seit Ministerpräsident Günther Oettinger Anfang November mit Erbprinz Bernhard von Baden den wohl größten Kulturhandel in der Landesgeschichte festgeklopft hat, wurde akribisch darum gerungen, welchen Gegenwert das Land für seine vielen Millionen (insgesamt 60,8 Millionen Euro) erhält.
Vieles scheint klar: So lässt es sich das Land 15 Millionen Euro kosten, dass das in tiefen Finanzproblemen steckende Adelshaus darauf verzichtet, vor Gericht um seine Besitzrechte an badischen Kunstschätzen zu kämpfen. Eine hochkarätige Expertenkommission hatte festgestellt, dass das meiste dieser Kunst – grob geschätzter Wert gut 300 Millionen Euro – ohnehin dem Land gehört. Dennoch geht die Regierung auf diesen Deal ein.
Für weitere 25,8 Millionen Euro will das Land Schloss und Kloster Salem samt Münster erwerben – inklusive der nicht beweglichen Kunstwerke in den Bauten. Ausgenommen ist die Prälatur, in der die Familie des Markgrafen weiter wohnen wird. Das Land erhält nur ein Vorkaufsrecht, gesteht dafür dem Adelshaus zu, andere Räume wie den Kaisersaal gelegentlich zu nutzen.
Den Haken in der Vereinbarung sahen Insider von Anfang an in der Zusicherung des Landes, für bis zu 17 Millionen Euro weitere Kunstgegenstände zu erwerben, die zweifelsfrei dem Adelshaus gehören. "Auf der Grundlage fachlicher Bewertungen" sollte die Auswahl der Kunstwerke erfolgen. Schon bei der Einigung auf die Gutachter zeigte sich, mit welch harten Bandagen gekämpft wurde: Das Haus Baden lehnte einen Experten ab, den es selbst vorgeschlagen hatte, nur weil dieser schon einmal im Auftrag des Landes tätig war. Der neue Gutachter, den das Land akzeptiert hatte, taxierte prompt ein Paket von 8000 Urkunden erheblich teurer und damit badenfreundlicher.
Einvernehmliche Verhandlungsergebnisse wurden vom Haus Baden immer wieder in Frage gestellt. Es versuchte auch wiederholt, Kunstwerke von den Immobilien zu trennen und sie in den 17-Millionen-Topf aufzunehmen – so bliebe für die Familie mehr übrig, was sich auf dem freien Markt verkaufen ließe. "Es wird gehandelt, bis die Zahlen stimmen", beschrieb ein Beobachter das Feilschen.
Inzwischen steht fest, dass die Kunstwerke im Schloss und außerhalb einen Wert von mehr als 23 Millionen Euro besitzen. Es ist nun zu entscheiden, welche Kunst für sechs Millionen Euro die Familie für sich behält.
Hartnäckig hält sich auf Landesseite aber der Verdacht, das Haus Baden verneble weiteren Kunstbesitz. Denn die vereinbarte Übersicht über den Gesamtbestand liegt bisher nicht vor. Und manches gehört plötzlich nicht mehr dazu wie ein wertvoller burgundischer Frauengürtel aus dem 13. Jahrhundert. Kunstminister Peter Frankenberg sieht dennoch "alles auf gutem Weg", wie er in dieser Woche der CDU-Fraktion sagte. Kommende Woche soll schon mal der Finanzausschuss des Landtags unterrichtet werden.
Die Stuttgarter Nachrichten melden:
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1949227
Das Haus Baden wird die Vermarktung von Schloss Salem nun doch komplett dem Land überlassen. Darauf haben sich beide Verhandlungspartner geeinigt. Derweil hat der Landtag den Weg für den Gesamtvertrag frei gemacht.
In der uralten Geschichte über den Streit um die badischen Kunstschätze wird jetzt das letzte Kapitel aufgeschlagen. Seit sich beide Parteien im November 2008 grundsätzlich darüber verständigt haben, was mit der Klosteranlage sowie hunderten Kunstwerken geschehen soll, geht es jetzt noch um Details. Mitte März soll dann der Kaufvertrag offiziell unterzeichnet werden.
Die Hauptarbeit hat seit Wochen ein dreiköpfiges Gutachtergremium, das den Preis einzelner Kunstwerke schätzt. Das Paket enthält nämlich nicht nur den Kauf der Schlossanlage durch das Land für 25,8 Millionen Euro sowie ein Wohnrecht für die markgräfliche Familie, sondern auch eine Regelung für wertvolle Bilder und Schmuckstücke, deren Eigentum seit Jahrzehnten umstritten ist. Vorgesehen ist, dass das Haus Baden auf alle Ansprüche verzichtet und im Gegenzug dafür 15 Millionen Euro erhält - eine Art Ablösesumme.
Mitte März wollen die Unterhändler mit dem Vertrag zum Notar, doch schon zum 1. März ist ein Teil des Kaufpreises fällig: Das Haus Baden erhält 25,8 Millionen für die Schlossanlage sowie die Hälfte der vereinbarten 17 Millionen. Weil dies im Haushalt für 2009 noch nicht verankert ist, hat der Finanzausschuss am Montag mit den Stimmen von CDU, FDP und Grünen den Weg für Gesamtvertrag frei gemacht. Volumen: insgesamt 57,8 Millionen Euro. Am morgigen Mittwoch soll auch das Plenum den Deal besiegeln.
Anders zum Zeitplan:
http://www.ad-hoc-news.de/verhandlungen-ueber-erwerb-von-schloss-salem-vor--/de/Politik/20051203
 F. Bucher http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de
F. Bucher http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de http://www.bib-bvb.de/protokolle/kab_prot12.pdf
Aus dem Protokoll der Kommission Altes Buch im BVB vom 29.10.2008
Eine praxisorientierte Handreichung für den Umgang mit Dubletten, Geschenken etc. soll schriftlich fixiert werden, wobei auch der Umgang mit Mehrfachexemplaren von Drucken vor 1850, die – soweit schon im Bestand vorhanden - von einer Abgabe im Sinn der Abgaberichtlinien unberührt bleiben sollten, einer Festlegung bedarf. In diesem Zusammenhang sei auf den Beschluss der „Allianz zur Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes“ verwiesen, wonach grundsätzlich jedes Exemplar vor 1850 als erhaltenswert einzustufen ist. Dies stieß nicht bei allen Teilnehmern auf ungeteilte Zustimmung, da im Zuge der Auflösung von Gymnasial- und Klosterbibliotheken ein enormer Zustrom dubletten Altbestands zu erwarten ist, der in Zeiten begrenzter Magazine pragmatisch zu behandeln sein müsse.
Diese Altbestandsbibliothekare sind für nichts anderes als Kriminelle, die das ihnen anvertraute Kulturgut verraten.
http://archiv.twoday.net/search?q=dubletten
Aus dem Protokoll der Kommission Altes Buch im BVB vom 29.10.2008
Eine praxisorientierte Handreichung für den Umgang mit Dubletten, Geschenken etc. soll schriftlich fixiert werden, wobei auch der Umgang mit Mehrfachexemplaren von Drucken vor 1850, die – soweit schon im Bestand vorhanden - von einer Abgabe im Sinn der Abgaberichtlinien unberührt bleiben sollten, einer Festlegung bedarf. In diesem Zusammenhang sei auf den Beschluss der „Allianz zur Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes“ verwiesen, wonach grundsätzlich jedes Exemplar vor 1850 als erhaltenswert einzustufen ist. Dies stieß nicht bei allen Teilnehmern auf ungeteilte Zustimmung, da im Zuge der Auflösung von Gymnasial- und Klosterbibliotheken ein enormer Zustrom dubletten Altbestands zu erwarten ist, der in Zeiten begrenzter Magazine pragmatisch zu behandeln sein müsse.
Diese Altbestandsbibliothekare sind für nichts anderes als Kriminelle, die das ihnen anvertraute Kulturgut verraten.
http://archiv.twoday.net/search?q=dubletten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Premierminister Gordon Brown hatte sich mit dem Renaissancemaler Tizian verglichen, der im Alter immer besser geworden und mit 90 Jahren gestorben sei. Statt den anmaßenden Vergleich des drögen Schotten mit dem genialen Venezianer zu geißeln, besserwisserte Tory-Chef David Cameron bei der parlamentarischen Fragestunde am Mittwoch: "Tatsache ist, dass Tizian mit 86 gestorben ist." Das ist eben keine Tatsache. Niemand weiß, wann Tizian geboren ist, es war irgendwann zwischen 1486 und 1490. Fest steht lediglich sein Todestag: Tizian starb am 27. August 1576 an der Pest. Ausgerechnet dieses Datum fälschte einer von Camerons Mitarbeitern und machte bei Wikipedia das Jahr 1572 daraus. Dazu benutzte der Klotzkopf den Rechner in der Geschäftsstelle der Tories, die nach den Wahlen im nächsten Jahr wohl Großbritannien regieren werden.
Einer der Gründer von Wikipedia, Larry Sanger, der sich 2001 von den Lexikonbetreibern trennte, hat inzwischen ein angeblich fehlerbereinigtes Onlinenachschlagewerk mit dem albernen Namen Citizendium ins Netz gestellt. Dort können solche plumpen Fälschungen nicht passieren. Es gibt nämlich keinen Eintrag unter "Tizian".
taz
Einer der Gründer von Wikipedia, Larry Sanger, der sich 2001 von den Lexikonbetreibern trennte, hat inzwischen ein angeblich fehlerbereinigtes Onlinenachschlagewerk mit dem albernen Namen Citizendium ins Netz gestellt. Dort können solche plumpen Fälschungen nicht passieren. Es gibt nämlich keinen Eintrag unter "Tizian".
taz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein NS-Provenienzforschungsprojekt der StUB Köln:
http://richterbibliothek.ub.uni-koeln.de/
Update: http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=810
http://richterbibliothek.ub.uni-koeln.de/
Update: http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=810
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 16. Februar 2009, 20:08 - Rubrik: Digitale Unterlagen
" ...... Eine Büttenrede mit Lachgarantie zum Thema "Archivar" servierte Johnny Behnert allen Närrinnen und Narren ....."Wer kann diese Rede beschaffen ?
Quelle: Südwest-Zeitung (Link)
Quelle: Südwest-Zeitung (Link)
Wolf Thomas - am Montag, 16. Februar 2009, 18:57 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... In einem Unternehmen sammeln sich über die Jahre hinweg Unmengen an Informationen an, die sich über kurz oder lang im Archiv verstecken. ...."
Matthias Hintenaus, Managing Director Northern & Central Europe bei Atempo
Normalerweise halte ich mich bei der Auswertung der Berichterstattung über EDV-Systeme (DMS usw.) zurück, aber diese schlauen Infos sind nun doch zu schade .....
Quelle:
http://www.searchstorage.de/themenbereiche/archivierung/allgemein/articles/170836/
Matthias Hintenaus, Managing Director Northern & Central Europe bei Atempo
Normalerweise halte ich mich bei der Auswertung der Berichterstattung über EDV-Systeme (DMS usw.) zurück, aber diese schlauen Infos sind nun doch zu schade .....
Quelle:
http://www.searchstorage.de/themenbereiche/archivierung/allgemein/articles/170836/
Wolf Thomas - am Montag, 16. Februar 2009, 18:54 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 16. Februar 2009, 16:57 - Rubrik: Archivrecht
We are pleased to announce that on March 1, 2009, the Jewish Women's Archive will launch the free, online version of Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia. Previously available only on CD-ROM, the Encyclopedia is the first comprehensive source on the history of Jewish women and includes more than 1,700 biographies, 300 thematic essays, and 1,400 photographs and illustrations (minus a few for which we do not have web display permission). The Encyclopedia nearly doubles the content available on our website ( http://jwa.org ) and gives Internet users all over the world free and easy access to a wealth of information. Via archives-L
KlausGraf - am Montag, 16. Februar 2009, 15:15 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die UB Freiburg stellt kostenlos einige Auflichtscanner zum Kopieren auf USB-Stick zur Verfügung. Meine Erfahrungen kurz beschrieb ich in netbib:
http://log.netbib.de/archives/2008/11/13/live-aus-der-ub-freiburg-1-teil-3/
http://log.netbib.de/archives/2008/11/12/live-aus-der-ub-freiburg-1-teil-2/
Nun hat auch die ULB Düsseldorf nachgezogen, doch, typisch für die "Benutzerfreundlichkeit" dieser Bibliothek, ab April soll abkassiert werden (2,5 Cent pro Scan). Wofür eigentlich?
Dafür, dass man zum Ansehen Acrobat Reader 8.0 braucht, dieser aber auf den PCs der ULB gar nicht installiert ist, man also überhaupt nicht überprüfen kann, ob die Scans hingehauen haben? (Genau das gleiche Problem wie in Freiburg!)
Dafür, dass an einem Schwarzweissscanner die Vorschau deaktiviert ist und (anders als in Freiburg) keine ausgedruckte Anleitung verfügbar ist bzw. auch mit der Hilfetaste keine Antwort zu erhalten ist?
Dafür, dass man zuhause die zahlreichen Dateien (fortlaufend nummeriert) auf seinem USB-Stick nachbearbeiten muss? (Oder ausdrucken.)
Wenn man das Pech hat, nicht oder zu spät zu merken, dass man JPGs erzeugt, braucht man schon ein wenig Erfahrung, daraus ohne Acrobat ein PDF zu machen. (Zuerst hab ich mich eine halbe Stunde lang dämlich angestellt und ein völlig unbrauchbares PDF aus den mühsam einzeln konvertierten JPGs erstellt, bis ich mit der Bilder-Druckfunktion von Windows XP ein akzeptables Gesamt-PDF mir zusammenstellen konnte.)
Zahlen dafür, dass anders als bei einem normalen Kopierer ein erheblich größeres Maß an Gefummel nötig ist, eine ganz normale Buchvorlage korrekt zu scannen? Bei einer Seite musste ich das Buch schließlich umdrehen, da der Variantenapparat immer abgeschnitten wurde, egal, wie ich das Buch hinlegte.
In Düsseldorf kann man mehrseitige PDFs erstellen, aber die Bedienung kommt mir komplizierter vor als in Freiburg.
Für alle diese Kinderkrankheiten soll man die Hälfte des Preises einer normalen Kopie zahlen??
Kein Zufall, dass sowohl in Freiburg als auch in Düsseldorf nach meinen Beobachtungen die Scanner alles andere als überlaufen sind, mit anderen Worten nicht angenommen werden. Wenn man etwas digital weiterverarbeiten möchte, sind diese Scanner vielleicht cool aber bei ganz normalen Kopien lohnt sich die Heimarbeit des Nacharbeitens absolut nicht. Da zahlt man lieber die 5 Cent und hat etwas, was man schwarz auf weiß nach Hause tragen kann.

http://log.netbib.de/archives/2008/11/13/live-aus-der-ub-freiburg-1-teil-3/
http://log.netbib.de/archives/2008/11/12/live-aus-der-ub-freiburg-1-teil-2/
Nun hat auch die ULB Düsseldorf nachgezogen, doch, typisch für die "Benutzerfreundlichkeit" dieser Bibliothek, ab April soll abkassiert werden (2,5 Cent pro Scan). Wofür eigentlich?
Dafür, dass man zum Ansehen Acrobat Reader 8.0 braucht, dieser aber auf den PCs der ULB gar nicht installiert ist, man also überhaupt nicht überprüfen kann, ob die Scans hingehauen haben? (Genau das gleiche Problem wie in Freiburg!)
Dafür, dass an einem Schwarzweissscanner die Vorschau deaktiviert ist und (anders als in Freiburg) keine ausgedruckte Anleitung verfügbar ist bzw. auch mit der Hilfetaste keine Antwort zu erhalten ist?
Dafür, dass man zuhause die zahlreichen Dateien (fortlaufend nummeriert) auf seinem USB-Stick nachbearbeiten muss? (Oder ausdrucken.)
Wenn man das Pech hat, nicht oder zu spät zu merken, dass man JPGs erzeugt, braucht man schon ein wenig Erfahrung, daraus ohne Acrobat ein PDF zu machen. (Zuerst hab ich mich eine halbe Stunde lang dämlich angestellt und ein völlig unbrauchbares PDF aus den mühsam einzeln konvertierten JPGs erstellt, bis ich mit der Bilder-Druckfunktion von Windows XP ein akzeptables Gesamt-PDF mir zusammenstellen konnte.)
Zahlen dafür, dass anders als bei einem normalen Kopierer ein erheblich größeres Maß an Gefummel nötig ist, eine ganz normale Buchvorlage korrekt zu scannen? Bei einer Seite musste ich das Buch schließlich umdrehen, da der Variantenapparat immer abgeschnitten wurde, egal, wie ich das Buch hinlegte.
In Düsseldorf kann man mehrseitige PDFs erstellen, aber die Bedienung kommt mir komplizierter vor als in Freiburg.
Für alle diese Kinderkrankheiten soll man die Hälfte des Preises einer normalen Kopie zahlen??
Kein Zufall, dass sowohl in Freiburg als auch in Düsseldorf nach meinen Beobachtungen die Scanner alles andere als überlaufen sind, mit anderen Worten nicht angenommen werden. Wenn man etwas digital weiterverarbeiten möchte, sind diese Scanner vielleicht cool aber bei ganz normalen Kopien lohnt sich die Heimarbeit des Nacharbeitens absolut nicht. Da zahlt man lieber die 5 Cent und hat etwas, was man schwarz auf weiß nach Hause tragen kann.

KlausGraf - am Montag, 16. Februar 2009, 04:02 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://burgerbe.wordpress.com/2009/02/14/tiroler-kluengel-laengste-haengebrucke-der-alpen-soll-zwei-burgen-verbinden/
Ergänzend: Was ist mit dem Denkmalschutz? Ist das historische KulturLandschaftsEnsemble, das nie eine solche Brücke kannte, nicht schützenswert?

Ergänzend: Was ist mit dem Denkmalschutz? Ist das historische KulturLandschaftsEnsemble, das nie eine solche Brücke kannte, nicht schützenswert?

" ..... In der Vorliebe für das Archiv und analoge Dinge drückt sich der Wunsch aus nach Haltepunkten in einer unübersichtlichen, digitalisierten Produktwelt. ....."
Thorsten Firlus, Wirtschaftswoche
http://www.wiwo.de/lifestyle/retro-marken-szenarien-fuer-die-zeit-nach-der-insolvenz-387276/
Thorsten Firlus, Wirtschaftswoche
http://www.wiwo.de/lifestyle/retro-marken-szenarien-fuer-die-zeit-nach-der-insolvenz-387276/
Wolf Thomas - am Sonntag, 15. Februar 2009, 17:49 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Ebenfalls nördlich der Torstraße [Berlin] hat Kirsten Hermann, selbst lange in der Modebranche tätig, soeben aller Kriselei zum Trotz die „Galerie für Modefotografie“ eröffnet. Ein interessantes Projekt, denn Hermann will nicht nur veröffentlichte Modeaufnahmen als Kunstform ernst nehmen, sondern auch die Bilder zeigen, die bei Fotoproduktionen abgelehnt wurden, weil ein Model nicht genug lächelt, falsch sitzt, weil die Ästhetik sich zu sehr von dem entfernte, was als machbar galt - sozusagen den Giftschrank.
So könnte hier so etwas wie ein Archiv der Wunschbilder einer Epoche entstehen, die unbekannte Bildgeschichte des abgelehnten Geschmacks. ....."
Quelle: FAZ (Link)
So könnte hier so etwas wie ein Archiv der Wunschbilder einer Epoche entstehen, die unbekannte Bildgeschichte des abgelehnten Geschmacks. ....."
Quelle: FAZ (Link)
Wolf Thomas - am Sonntag, 15. Februar 2009, 17:47 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://readingarchives.blogspot.com/2009/02/inappropriate-behavior-at-nara.html
http://www.ischool.pitt.edu/colloquia/aaa/AnthonyClark-NARA.mp3
http://www.ischool.pitt.edu/colloquia/aaa/AnthonyClark-NARA.mp3
KlausGraf - am Sonntag, 15. Februar 2009, 17:47 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Ihre Arbeit wandert nicht ins Archiv, sondern soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden"
Kirchenvorsteherin Brigitte Wilke zur Kirchenbucherfassung in Harpstedt
Quelle: Link
Kirchenvorsteherin Brigitte Wilke zur Kirchenbucherfassung in Harpstedt
Quelle: Link
Wolf Thomas - am Sonntag, 15. Februar 2009, 17:45 - Rubrik: Wahrnehmung
" ..... Trotzdem klingt die Rede wie aus dem Archiv. ....."
Tagesspiegel (Link) über eine Rede der Bundeskanzlerin vor der Industrie- und Handelskammer in Berlin am 12.02.2009
Es hat den Anschein, dass die Berliner Zeitung ein Wort aus der Fäkalsprache mehr oder weniger elegant zu vermeiden versuchte
Tagesspiegel (Link) über eine Rede der Bundeskanzlerin vor der Industrie- und Handelskammer in Berlin am 12.02.2009
Es hat den Anschein, dass die Berliner Zeitung ein Wort aus der Fäkalsprache mehr oder weniger elegant zu vermeiden versuchte
Wolf Thomas - am Sonntag, 15. Februar 2009, 17:42 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
«Wir planen aber kein abgeschlossenes Museum mit einem Archiv. Nichts, wo man sich anmelden muss oder gar Eintritt zahlen muss»
Lutz van Hasselt Archivar Alemannia Aachen
Wow, was für moderne Gedanken hegt man da in Aachen ......
Quelle: Aachener Zeitung
Lutz van Hasselt Archivar Alemannia Aachen
Wow, was für moderne Gedanken hegt man da in Aachen ......
Quelle: Aachener Zeitung
Wolf Thomas - am Sonntag, 15. Februar 2009, 17:39 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Mitteldeutsche Zeitung (Link) berichtet: " ..... Das Bild vom Archivar ist landläufig geprägt mit dem Klischee des altersweisen, ergrauten Bücherwurms, der sich durch ganze Stapel vergilbten Papieres wühlt. "Sie sind zu jung für eine Archivarin", befand ein früherer Nutzer einmal über Ines Hildebrand mit seinem Urteil zwischen Kompliment und Kränkung. ......"
Ist hier mitlesenden Kolleginnen ähnliches widerfahren ?
Ist hier mitlesenden Kolleginnen ähnliches widerfahren ?
Wolf Thomas - am Sonntag, 15. Februar 2009, 17:37 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Erst ein Codex online:
http://mdz1.bib-bvb.de/~db/ausgaben/uni_ausgabe.html?projekt=1231487130&recherche=ja&ordnung=sig
http://mdz1.bib-bvb.de/~db/ausgaben/uni_ausgabe.html?projekt=1231487130&recherche=ja&ordnung=sig
KlausGraf - am Sonntag, 15. Februar 2009, 17:35 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Der Stadt Köln und dem Land Nordrhein-Westfalen ist nach sechs Jahren Verhandlungen mit der Erbengemeinschaft Heinrich Bölls ein großer Wurf gelungen. Für 800 000 Euro kauften sie mit Unterstützung der Kulturstiftung der Länder das Privatarchiv des Schriftstellers mit teils unveröffentlichten Arbeiten aus der Zeit vor 1945, Manuskripten, Übersetzungen, Dokumenten, Fotos und rund 2400 Briefen vor allem an seine Frau Annemarie, die 2004 gestorben war. ....."
Quelle:
http://www.rundschau-online.de/html/artikel/1234334883448.shtml
Quelle:
http://www.rundschau-online.de/html/artikel/1234334883448.shtml
Wolf Thomas - am Sonntag, 15. Februar 2009, 17:35 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://mdz1.bib-bvb.de/~db/ausgaben/uni_ausgabe.html?projekt=1228724548&recherche=ja&ordnung=sig
Zum Thema hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=ottheinrich
Zum Thema hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=ottheinrich
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00034655/images/
Mit hübschen Schlossansichten, aber natürlich, da kein DFG-Projekt, sondern hauseigene Digitalisierung, ohne Download-Möglichkeit und DFG-Viewer-Ansicht.
Mit hübschen Schlossansichten, aber natürlich, da kein DFG-Projekt, sondern hauseigene Digitalisierung, ohne Download-Möglichkeit und DFG-Viewer-Ansicht.
KlausGraf - am Sonntag, 15. Februar 2009, 17:19 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
KlausGraf - am Sonntag, 15. Februar 2009, 16:06 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://historia-docet.de/html/diskussion.html
Die erste Stellungnahme zu meiner Website stammt im Internetforum Archivalia von Klaus Graf, der das Urkundenbuch St. Blasien in der Zeitschrift für Hohenzollerische Geschichte 126 (2005) rezensierte. Graf hat seinen Beitrag am 8. Januar 2009 ins Netz gestellt: http://archiv.twoday.net/stories/5433755/ unter der Überschrift “Johann Wilhelm Braun teilt aus”. Anscheinend hält Graf Forschung und wissenschaftliche Auseinandersetzung eher für eine Art Kampfsport, in dem es zu seinem guten Ton gehört, den Kontrahenten mit verbalen Tiefschlägen wie “lächerlich”, “ausfällig” und “gehässig” einzudecken.
Wer mich als durchaus wohlwollenden Rezensenten in dieser Weise abwatscht, muss das Echo vertragen können.
Dies hier ist kein Internetforum, sondern ein Weblog.
Was ein Weblog ist, steht z.B. in der Wikipedia, Herr Braun.
Da ich annehme, dass Sie nicht wissen, was das ist:
http://de.wikipedia.org/wiki/Blog
Zutreffender wäre der Titel gewesen “Johann Wilhelm Braun teilt ein”, nämlich in zwei einigermaßen gegensätzliche Forschungsrichtungen, einer sozusagen traditionellen (der ich mich verpflichtet fühle), die den vielfältigen Fundus der seit drei Jahrhunderten entwickelten wissenschaftlichen Methoden zu bewahren, anzuwenden und gerade gegenwärtig um vielversprechende neue Methoden und Techniken zu erweitern sucht, und einer scheinbar modernen, die ich die “Reduktionfraktion” genannt habe und in der Gefahr sehe, eine “Forschung light” zu betreiben. Auf diese Problematik, die der Hauptanlass für meine “Recensio recensionum” war, ist Graf leider mit keinem Wort eingegangen.
Ich sehe mich nicht als Vertreter einer Forschung light. Worauf ich eingehe oder nicht, ist immer noch meine Sache.
Stattdessen verbreitet er sich über Rechtsfragen des Kopierens. Mir genügt, dass Kopieren für private und wissenschaftliche Zwecke erlaubt ist. Weiteres, was letzten Endes nur unter dem Verwertungsaspekt, sprich Geldverdienen mit Geistesprodukten, Sinn macht, war, wenigstens in meinem Bereich der historischen Forschung, gar noch des Mittelalters und hier der Quellenedition, leider immer so wenig einträglich, dass es die reine Zeitverschwendung wäre, sich damit eingehender zu befassen. Z. B. war die jahrzehntelange Arbeit am Urkundenbuch St. Blasien natürlich nur als Dienstaufgabe überhaupt möglich, also von vorneherein ohne Anspruch auf verwertungsrechtliche Vergütung. Und wenn die VG Wort für die zwei Bände von insgesamt fast 1400 Seiten weniger als 500 Euro ausschüttete und die CD-ROM-Ausgabe überhaupt nicht berücksichtigte – welchen Sinn hat es für unsereins angesichts solcher “Summen”, sich mit Verwertungsfragen aus dem Urheberrecht groß zu befassen? Ich wünsche es Herrn Graf, dass ihm für seine diesbezügliche eingehende Beschäftigung mehr herausspringt.
Es gehört für Herrn Braun wohl wie für die meisten Historiker zum guten Ton, eine möglichst große Unkenntnis in Urheberrechtsfragen an den Tag zu legen. Nein, wesentlich mehr springt bei meiner Beschäftigung mit dem Urheberrecht nicht heraus, aber wer sich wie ich für "Open Access" einsetzt, muss die urheberrechtlichen Begrenzungen und Pferdefüße kennen.
Nebenbei bedauert Graf, dass ich nur die ungedruckten Teile meiner seinerzeitigen Dissertation auf der Website veröffentlicht habe. Ich verstehe nicht, warum ich das mit den gedruckten, also in einer Vorfassung dazu, auch hätte tun sollen. Sie sind doch durch die überarbeitete Druckfassung überholt!
Die überarbeitete Druckfassung steht eben nicht online zur Verfügung. Und da wäre es durchaus willkommen, wenigstens die nicht überarbeitete Vorfassung kostenfrei am PC benützen zu können - abgesehen davon, dass ein Buch mehr als die Summe seiner Teile ist, nämlich eine beziehungsreiche Ganzheit. Wenn man das im Laufe eines langen Berufsleben nicht begriffen hat ...
Meine Begründung, die ungedruckten Teile der Dissertation nur als Bilddatei und des zu großen Aufwands halber nicht als OCR-eingelesene Textdatei ins Netz zu stellen, sei – so Graf – “einfach nur lächerlich”. Der angesprochene Aufwand bezieht sich natürlich nicht auf die bloße technische Umsetzung – das wäre tatsächlich lächerlich – sondern auf den riesigen Korrekturaufwand, den das Einlese-Ergebnis erfordert hätte. Ich habe es natürlich ausprobiert, das Programm konnte die leider nicht besonders gute Typoskriptvorlage (eine bessere habe ich aber nicht) in zureichender Qualität nicht umsetzen, wie auch jeder an der jetzt im Netz stehenden Fassung sehen, und wenn er Lust hat, damit die OCR-Umsetzung auch selber ausprobieren und für sich nutzen mag. Welcher Schrott mit solchen OCR-eingelesenen und unkorrigiert belassenen Texten zustandekommt, davon kann man sich an zahllosen Beispielen der Google’schen Buchdigitalisierungen überzeugen. (Man erhält diese Ergebnisse mit dem Link: Nur Text anzeigen). Google überläßt es dem Benutzer, diese Texte anhand der PDF-Bilddateien selber zu korrigieren. Mehr kann oder will selbst dieser Riesenkonzern nicht leisten.
Braun zeigt einmal mehr, dass er keine Ahnung hat, wovon er spricht.
Erstens: Die Google-OCR ist erheblich brauchbarer geworden, es gibt außerordentlich gut erkannte Bücher - sogar in Fraktur!
Zweitens: Da ich an die 50 eigene Aufsätze mit OCR erfasst und kursorisch korrekturgelesen habe (Freidok, ebenso ARTDok), was angesichts der sehr guten Qualität von des OCR-Programms, auch bei sehr langen Aufsätzen einschließlich Scannen nicht mehr als eine Dreiviertelstunde in Anspruch nahm, kann ich nur sagen, dass Herr Braun dann halt ein miserables Programm benutzt hat. Beispielsweise ist die eingebaute OCR von Acrobat eher schlecht.
Wozu braucht es die OCR in einem doppelschichtigen PDF? Einzig allein für die Suchmaschinen und Nutzer, die Zitate oder längere Textteile (z.B. Quellenstellen) entnehmen wollen. Letzteren ist zuzumuten, dass sie den Wortlaut mit dem ja zur Verfügung stehenden Faksimile kollationieren.
Und bei den Suchmaschinen ist eine hundertprozentige Übereinstimmung ebenfalls entbehrlich. Man sollte lediglich darauf achten, dass die Schlüsselbegriffe des Texts richtig erkannt werden.
Ist das OCR-Ergebnis zufriedenstellend (und ich sehe keinen Grund, wieso ein Typoskript nicht ordentlich bearbeitbar sein soll), genügt eine kursorische Durchsicht, die bei einer sehr umfangreichen Arbeit keineswegs viele Arbeitsstunden in Anspruch nimmt.
Wir haben hier in Archivalia Dutzende Beiträge, die den Nutzen von Volltextsuchen schlagend anhand von wissenschaftlichen Beispielen belegen. Das hat nichts mit Wissenschaft light zu tun, sondern mit Nutzung neuer Möglichkeiten, die nicht bei der Beigabe einer CD als Non-Plus-Ultra stehen bleibt.
Im übrigen hat sich an Grafs Replik schon eine kleine Diskussion angehängt. Man ist als Forscher “im Elfenbeinturm” überrascht, was es ‚da draußen’ so für Gesichtspunkte gibt, z. B. dass “jemand jahrzehntelang (?) [mein Kommentar: Fragezeichen können Sie streichen] für Steuer- oder Stiftungsgeld an einem einzelnen Buch arbeiten kann, ist das ja schön für ihn” – mein Kommentar: von wegen, diese Aufgabe habe ich mir seinerzeit keineswegs selber ausgesucht, sie war mir aufgrund gewisser Umstände dienstlich verordnet worden, und für wie “schön” für mich man sie hielt, lässt sich daran ablesen, dass ich nach 35 Dienstjahren auf derselben Gehaltsstufe pensioniert wurde, in der ich eingestellt worden war, – gewiß ein einmaliges Phänomen im baden-württembergischen Beamtenwesen – und ich hatte mich in der Dienstzeit auch noch gegen solche zu wehren, die derweil automatisch die Karrieretreppe hinauffielen, auch sie übrigens “für Steuer- oder Stiftungsgeld” und ohne dafür ein “Jahrhundertwerk” zu verlangen, ein “Luxus”, der offenbar “dem Fortkommen der Wissenschaft insgesamt” weitaus dienlicher ist – soviel zur “Ökonomie des Wissenschaftsbetriebs” aus der Sicht eines anonymen “ladislaus” auf der zitierten Website, dem immerhin meine “hemdärmelige Anleitung zum Urheberrechtsverstoss” “sehr willkommen” ist.
Karlsruhe, 12. Februar 2009 Johann Wilhelm Braun
Diese letzten Bemerkungen lasse ich unkommentiert.
Neuss, den 14. Februar 2008 Klaus Graf
Die erste Stellungnahme zu meiner Website stammt im Internetforum Archivalia von Klaus Graf, der das Urkundenbuch St. Blasien in der Zeitschrift für Hohenzollerische Geschichte 126 (2005) rezensierte. Graf hat seinen Beitrag am 8. Januar 2009 ins Netz gestellt: http://archiv.twoday.net/stories/5433755/ unter der Überschrift “Johann Wilhelm Braun teilt aus”. Anscheinend hält Graf Forschung und wissenschaftliche Auseinandersetzung eher für eine Art Kampfsport, in dem es zu seinem guten Ton gehört, den Kontrahenten mit verbalen Tiefschlägen wie “lächerlich”, “ausfällig” und “gehässig” einzudecken.
Wer mich als durchaus wohlwollenden Rezensenten in dieser Weise abwatscht, muss das Echo vertragen können.
Dies hier ist kein Internetforum, sondern ein Weblog.
Was ein Weblog ist, steht z.B. in der Wikipedia, Herr Braun.
Da ich annehme, dass Sie nicht wissen, was das ist:
http://de.wikipedia.org/wiki/Blog
Zutreffender wäre der Titel gewesen “Johann Wilhelm Braun teilt ein”, nämlich in zwei einigermaßen gegensätzliche Forschungsrichtungen, einer sozusagen traditionellen (der ich mich verpflichtet fühle), die den vielfältigen Fundus der seit drei Jahrhunderten entwickelten wissenschaftlichen Methoden zu bewahren, anzuwenden und gerade gegenwärtig um vielversprechende neue Methoden und Techniken zu erweitern sucht, und einer scheinbar modernen, die ich die “Reduktionfraktion” genannt habe und in der Gefahr sehe, eine “Forschung light” zu betreiben. Auf diese Problematik, die der Hauptanlass für meine “Recensio recensionum” war, ist Graf leider mit keinem Wort eingegangen.
Ich sehe mich nicht als Vertreter einer Forschung light. Worauf ich eingehe oder nicht, ist immer noch meine Sache.
Stattdessen verbreitet er sich über Rechtsfragen des Kopierens. Mir genügt, dass Kopieren für private und wissenschaftliche Zwecke erlaubt ist. Weiteres, was letzten Endes nur unter dem Verwertungsaspekt, sprich Geldverdienen mit Geistesprodukten, Sinn macht, war, wenigstens in meinem Bereich der historischen Forschung, gar noch des Mittelalters und hier der Quellenedition, leider immer so wenig einträglich, dass es die reine Zeitverschwendung wäre, sich damit eingehender zu befassen. Z. B. war die jahrzehntelange Arbeit am Urkundenbuch St. Blasien natürlich nur als Dienstaufgabe überhaupt möglich, also von vorneherein ohne Anspruch auf verwertungsrechtliche Vergütung. Und wenn die VG Wort für die zwei Bände von insgesamt fast 1400 Seiten weniger als 500 Euro ausschüttete und die CD-ROM-Ausgabe überhaupt nicht berücksichtigte – welchen Sinn hat es für unsereins angesichts solcher “Summen”, sich mit Verwertungsfragen aus dem Urheberrecht groß zu befassen? Ich wünsche es Herrn Graf, dass ihm für seine diesbezügliche eingehende Beschäftigung mehr herausspringt.
Es gehört für Herrn Braun wohl wie für die meisten Historiker zum guten Ton, eine möglichst große Unkenntnis in Urheberrechtsfragen an den Tag zu legen. Nein, wesentlich mehr springt bei meiner Beschäftigung mit dem Urheberrecht nicht heraus, aber wer sich wie ich für "Open Access" einsetzt, muss die urheberrechtlichen Begrenzungen und Pferdefüße kennen.
Nebenbei bedauert Graf, dass ich nur die ungedruckten Teile meiner seinerzeitigen Dissertation auf der Website veröffentlicht habe. Ich verstehe nicht, warum ich das mit den gedruckten, also in einer Vorfassung dazu, auch hätte tun sollen. Sie sind doch durch die überarbeitete Druckfassung überholt!
Die überarbeitete Druckfassung steht eben nicht online zur Verfügung. Und da wäre es durchaus willkommen, wenigstens die nicht überarbeitete Vorfassung kostenfrei am PC benützen zu können - abgesehen davon, dass ein Buch mehr als die Summe seiner Teile ist, nämlich eine beziehungsreiche Ganzheit. Wenn man das im Laufe eines langen Berufsleben nicht begriffen hat ...
Meine Begründung, die ungedruckten Teile der Dissertation nur als Bilddatei und des zu großen Aufwands halber nicht als OCR-eingelesene Textdatei ins Netz zu stellen, sei – so Graf – “einfach nur lächerlich”. Der angesprochene Aufwand bezieht sich natürlich nicht auf die bloße technische Umsetzung – das wäre tatsächlich lächerlich – sondern auf den riesigen Korrekturaufwand, den das Einlese-Ergebnis erfordert hätte. Ich habe es natürlich ausprobiert, das Programm konnte die leider nicht besonders gute Typoskriptvorlage (eine bessere habe ich aber nicht) in zureichender Qualität nicht umsetzen, wie auch jeder an der jetzt im Netz stehenden Fassung sehen, und wenn er Lust hat, damit die OCR-Umsetzung auch selber ausprobieren und für sich nutzen mag. Welcher Schrott mit solchen OCR-eingelesenen und unkorrigiert belassenen Texten zustandekommt, davon kann man sich an zahllosen Beispielen der Google’schen Buchdigitalisierungen überzeugen. (Man erhält diese Ergebnisse mit dem Link: Nur Text anzeigen). Google überläßt es dem Benutzer, diese Texte anhand der PDF-Bilddateien selber zu korrigieren. Mehr kann oder will selbst dieser Riesenkonzern nicht leisten.
Braun zeigt einmal mehr, dass er keine Ahnung hat, wovon er spricht.
Erstens: Die Google-OCR ist erheblich brauchbarer geworden, es gibt außerordentlich gut erkannte Bücher - sogar in Fraktur!
Zweitens: Da ich an die 50 eigene Aufsätze mit OCR erfasst und kursorisch korrekturgelesen habe (Freidok, ebenso ARTDok), was angesichts der sehr guten Qualität von des OCR-Programms, auch bei sehr langen Aufsätzen einschließlich Scannen nicht mehr als eine Dreiviertelstunde in Anspruch nahm, kann ich nur sagen, dass Herr Braun dann halt ein miserables Programm benutzt hat. Beispielsweise ist die eingebaute OCR von Acrobat eher schlecht.
Wozu braucht es die OCR in einem doppelschichtigen PDF? Einzig allein für die Suchmaschinen und Nutzer, die Zitate oder längere Textteile (z.B. Quellenstellen) entnehmen wollen. Letzteren ist zuzumuten, dass sie den Wortlaut mit dem ja zur Verfügung stehenden Faksimile kollationieren.
Und bei den Suchmaschinen ist eine hundertprozentige Übereinstimmung ebenfalls entbehrlich. Man sollte lediglich darauf achten, dass die Schlüsselbegriffe des Texts richtig erkannt werden.
Ist das OCR-Ergebnis zufriedenstellend (und ich sehe keinen Grund, wieso ein Typoskript nicht ordentlich bearbeitbar sein soll), genügt eine kursorische Durchsicht, die bei einer sehr umfangreichen Arbeit keineswegs viele Arbeitsstunden in Anspruch nimmt.
Wir haben hier in Archivalia Dutzende Beiträge, die den Nutzen von Volltextsuchen schlagend anhand von wissenschaftlichen Beispielen belegen. Das hat nichts mit Wissenschaft light zu tun, sondern mit Nutzung neuer Möglichkeiten, die nicht bei der Beigabe einer CD als Non-Plus-Ultra stehen bleibt.
Im übrigen hat sich an Grafs Replik schon eine kleine Diskussion angehängt. Man ist als Forscher “im Elfenbeinturm” überrascht, was es ‚da draußen’ so für Gesichtspunkte gibt, z. B. dass “jemand jahrzehntelang (?) [mein Kommentar: Fragezeichen können Sie streichen] für Steuer- oder Stiftungsgeld an einem einzelnen Buch arbeiten kann, ist das ja schön für ihn” – mein Kommentar: von wegen, diese Aufgabe habe ich mir seinerzeit keineswegs selber ausgesucht, sie war mir aufgrund gewisser Umstände dienstlich verordnet worden, und für wie “schön” für mich man sie hielt, lässt sich daran ablesen, dass ich nach 35 Dienstjahren auf derselben Gehaltsstufe pensioniert wurde, in der ich eingestellt worden war, – gewiß ein einmaliges Phänomen im baden-württembergischen Beamtenwesen – und ich hatte mich in der Dienstzeit auch noch gegen solche zu wehren, die derweil automatisch die Karrieretreppe hinauffielen, auch sie übrigens “für Steuer- oder Stiftungsgeld” und ohne dafür ein “Jahrhundertwerk” zu verlangen, ein “Luxus”, der offenbar “dem Fortkommen der Wissenschaft insgesamt” weitaus dienlicher ist – soviel zur “Ökonomie des Wissenschaftsbetriebs” aus der Sicht eines anonymen “ladislaus” auf der zitierten Website, dem immerhin meine “hemdärmelige Anleitung zum Urheberrechtsverstoss” “sehr willkommen” ist.
Karlsruhe, 12. Februar 2009 Johann Wilhelm Braun
Diese letzten Bemerkungen lasse ich unkommentiert.
Neuss, den 14. Februar 2008 Klaus Graf
KlausGraf - am Samstag, 14. Februar 2009, 22:06 - Rubrik: Landesgeschichte
http://blog.verweisungsform.de/2009-02-13/e-book-reader-ganz-subjektiv/
http://bibliothekarisch.de/blog/2009/02/13/der-e-book-reader-olymp-wird-heiss-umkaempft/
http://bibliothekarisch.de/blog/2009/02/13/der-e-book-reader-olymp-wird-heiss-umkaempft/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
I am pleased to announce that Private Libraries in Renaissance England (PLRE), in cooperation with the Folger Shakespeare Library, is now available online as the PLRE.Folger database. PLRE.Folger contains records of nearly 13,000 books drawn from book-lists compiled in England between 1507 and 1653, itemizing the collections of 196 owners. These records include the book-lists appearing in 162 probate inventories taken under the jurisdiction of the Chancellor of Oxford University.
The material in the database is searchable in a variety ways, and thanks to the generosity of the Folger, access is free to the scholarly community. The current database is the beta version. Accordingly, users are invited to make comments and suggestions for improvement. Email addresses are provided for that purpose on the website's Contacts page.
This announcement of the PLRE.Folger release would be incomplete without the following comments:
PLRE.Folger and the printed volumes of PLRE are complementary presentations of the material in Private Libraries in Renaissance England. They are not substitutes one for the other. The use of PLRE.Folger will, therefore, be enhanced with the printed volumes on hand.
[...]
PLRE.Folger can be accessed at: http://plre.folger.edu Given the unique character of the database, the documentation is unusually heavy and detailed; users would be well-served to print the documentation for reference.
The PLRE Project website, which provides detailed information about Private Libraries in Renaissance England as well as material drawn from the published volumes not available at PLRE.Folger, can be accessed at http://wmpeople.wm.edu/site/page/rjfehr or via a link from PLRE.Folger.
I would be grateful if the recipients of this announcement would distribute it to other interested scholars.
R.J. Fehrenbach, General Editor
Private Libraries in Renaissance England
The material in the database is searchable in a variety ways, and thanks to the generosity of the Folger, access is free to the scholarly community. The current database is the beta version. Accordingly, users are invited to make comments and suggestions for improvement. Email addresses are provided for that purpose on the website's Contacts page.
This announcement of the PLRE.Folger release would be incomplete without the following comments:
PLRE.Folger and the printed volumes of PLRE are complementary presentations of the material in Private Libraries in Renaissance England. They are not substitutes one for the other. The use of PLRE.Folger will, therefore, be enhanced with the printed volumes on hand.
[...]
PLRE.Folger can be accessed at: http://plre.folger.edu Given the unique character of the database, the documentation is unusually heavy and detailed; users would be well-served to print the documentation for reference.
The PLRE Project website, which provides detailed information about Private Libraries in Renaissance England as well as material drawn from the published volumes not available at PLRE.Folger, can be accessed at http://wmpeople.wm.edu/site/page/rjfehr or via a link from PLRE.Folger.
I would be grateful if the recipients of this announcement would distribute it to other interested scholars.
R.J. Fehrenbach, General Editor
Private Libraries in Renaissance England
KlausGraf - am Freitag, 13. Februar 2009, 22:35 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die kostbarsten Handschriften Berns gehören der Burgerbibliothek und sind Eigentum der Burgergemeinde, einer öffentlichrechtlichen Körperschaft von ehemaligen Patriziern.
http://de.wikipedia.org/wiki/Burgergemeinde_Bern
Katrin Rieders Dissertation (Netzwerke des Konservatismus. Berner Burgergemeinde und Patriziat im 19. und 20. Jahrhundert. Chronos, Zürich 2008) löste in dem Medien Diskussionen über dieses eigenartige schwerreiche Gebilde aus. Der Burgergemeindepräsident wies die Kritik 2008 zurück:
PDF
Im Internet ist nachzulesen:
http://www.reitschule.ch/reitschule/mediengruppe/Medienspiegel/08-08-14-MS.html
Als die Berner Historikerin Katrin Rieder begann, über die Berner Burgergemeinde zu forschen, stiess sie auf grossen Widerstand. Ihr wurden aktuelle Quellen vorenthalten, es wurde ihr subtil gedroht, und dann wurde selbst die Publikation von Artikeln schwierig. Denn die 17 000 BernburgerInnen sind mächtig, und sie üben diese Macht am liebsten diskret aus.
Die Burgergemeinde hat viel Erfahrung im Herrschen: In ihr versammeln sich die alten patrizischen Berner Familien und das städtische Grossbürgertum. Man kennt sich, man hilft sich: "Burger gegen Burger, das geht nicht", heisst es. Die BurgerInnen sitzen in wichtigen Positionen in der Verwaltung und in der Privatwirtschaft. Und ihre Macht ist institutionell gestützt, die Burgergemeinde hat die Funktion einer Heimatgemeinde. Deshalb übernimmt sie auch staatliche Aufgaben wie die Sozialfürsorge für ihre Angehörigen.
Heute verfügt die Burgergemeinde über ein Milliardenvermögen, sie ist die reichste Korporation der Schweiz. Allein in der Stadt Bern besitzt sie einen Drittel des Bodens - Kapital, das aus dem Vermögen des alten Stadtstaates Bern stammt. "Wenn es die Burgergemeinde nicht gäbe, wäre die Einwohnergemeinde der Stadt Bern viel reicher", sagt Rieder. "Sie hätte dann zwar mehr Aufgaben, aber auch die Mittel dafür."
Und zum Thema Informationssperren:
WOZ: Katrin Rieder, Sie forschen seit Jahren über die Berner Burgergemeinde. Haben sich die Burger Innen darüber gefreut?
Katrin Rieder: Nicht wirklich. Sie haben es mir nicht leichtgemacht, an die Quellen heranzukommen, nur solche aus dem 19. Jahrhundert sind frei zugänglich. Ich musste ein Gesuch stellen, um zumindest einige Akten aus dem 20. Jahrhundert einsehen zu können. Zu den Dokumenten aus den letzten dreissig Jahren wurde mir der Zutritt vollumfänglich verwehrt. Damit hatte ich nicht gerechnet.
Wie haben Sie das Problem gelöst?
Ich habe mehrmals nachgefragt, doch letztlich hätte ich es juristisch einfordern müssen, und das habe ich nicht getan. Eigentlich begründete das neue kantonale Informationsgesetz von 1993 das Öffentlichkeitsprinzip - auch die Burgergemeinde ist diesem Gesetz unterstellt. Die Gespräche mit der Burgerbibliothek waren nicht einfach. Man war über meine Forschungen - gelinde gesagt - "not amused".
Aus einem anderen Artikel:
· Zwei an der Universität Bern erarbeitete historische Lizenziatsarbeiten von Karoline Arn und Katrin Rieder (5) brachten Ende der 1990er-Jahre neue Fakten über die neue Geschichte der Burgergemeinde ans Licht. Mit der Folge, dass - laut Aussage des heutigen Burgerratspräsidenten Franz von Graffenried - der damalige Sekretär der Burgergemeinde drohte, ein Weiterzug der Forschungsarbeit mit Publikation hätte Klagen zur Folge.
· Im Hinblick auf eine vom Bundesarchiv, dem Stadt- und Staatsarchiv für 2001 geplante Ausstellung im Käfigturm über Bundesrat Markus Feldmanns Tagebücher hatte das Bundesarchiv Katrin Rieder den Auftrag erteilt, für ein Dossier einen Artikel zu schreiben zum Thema, wie Feldmann Bernburger wurde (6). Feldmann war im ersten Anlauf 1940 überraschend nicht zum Bundesrat gewählt worden. An seiner Stelle wählte das Parlament den deutschfreundlichen BGB-Parteikollegen und Bernburger Eduard von Steiger. Im Hinblick auf seine Wahl im zweiten Anlauf offerierte die Burgergemeinde Feldmann 1951 das Ehrenburgerrecht. Dem Vernehmen nach hatte der Berner Staatsarchivar - selbst ein Bernburger - versucht, den Auftrag an die Historikerin zu verhindern. Als ihm dies nicht gelang, machte das Berner Staatsarchiv bei der Ausstellung nicht mehr mit.
· Der Berner Historiker Daniel Schläppi publizierte zwei Texte in Bänden über die Geschichte von Berner Zünften (7). Dem Vernehmen nach musste er dabei Zensuren akzeptieren. Heute will er sich zu dieser Angelegenheit nicht mehr äussern. Kenner der Szene erklären, wer in Sachen Burgergemeinde kritisch recherchiere, müsse damit rechnen, auf dem Platz Bern keine Stelle als Historiker zu finden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Burgergemeinde_Bern
Katrin Rieders Dissertation (Netzwerke des Konservatismus. Berner Burgergemeinde und Patriziat im 19. und 20. Jahrhundert. Chronos, Zürich 2008) löste in dem Medien Diskussionen über dieses eigenartige schwerreiche Gebilde aus. Der Burgergemeindepräsident wies die Kritik 2008 zurück:
Im Internet ist nachzulesen:
http://www.reitschule.ch/reitschule/mediengruppe/Medienspiegel/08-08-14-MS.html
Als die Berner Historikerin Katrin Rieder begann, über die Berner Burgergemeinde zu forschen, stiess sie auf grossen Widerstand. Ihr wurden aktuelle Quellen vorenthalten, es wurde ihr subtil gedroht, und dann wurde selbst die Publikation von Artikeln schwierig. Denn die 17 000 BernburgerInnen sind mächtig, und sie üben diese Macht am liebsten diskret aus.
Die Burgergemeinde hat viel Erfahrung im Herrschen: In ihr versammeln sich die alten patrizischen Berner Familien und das städtische Grossbürgertum. Man kennt sich, man hilft sich: "Burger gegen Burger, das geht nicht", heisst es. Die BurgerInnen sitzen in wichtigen Positionen in der Verwaltung und in der Privatwirtschaft. Und ihre Macht ist institutionell gestützt, die Burgergemeinde hat die Funktion einer Heimatgemeinde. Deshalb übernimmt sie auch staatliche Aufgaben wie die Sozialfürsorge für ihre Angehörigen.
Heute verfügt die Burgergemeinde über ein Milliardenvermögen, sie ist die reichste Korporation der Schweiz. Allein in der Stadt Bern besitzt sie einen Drittel des Bodens - Kapital, das aus dem Vermögen des alten Stadtstaates Bern stammt. "Wenn es die Burgergemeinde nicht gäbe, wäre die Einwohnergemeinde der Stadt Bern viel reicher", sagt Rieder. "Sie hätte dann zwar mehr Aufgaben, aber auch die Mittel dafür."
Und zum Thema Informationssperren:
WOZ: Katrin Rieder, Sie forschen seit Jahren über die Berner Burgergemeinde. Haben sich die Burger Innen darüber gefreut?
Katrin Rieder: Nicht wirklich. Sie haben es mir nicht leichtgemacht, an die Quellen heranzukommen, nur solche aus dem 19. Jahrhundert sind frei zugänglich. Ich musste ein Gesuch stellen, um zumindest einige Akten aus dem 20. Jahrhundert einsehen zu können. Zu den Dokumenten aus den letzten dreissig Jahren wurde mir der Zutritt vollumfänglich verwehrt. Damit hatte ich nicht gerechnet.
Wie haben Sie das Problem gelöst?
Ich habe mehrmals nachgefragt, doch letztlich hätte ich es juristisch einfordern müssen, und das habe ich nicht getan. Eigentlich begründete das neue kantonale Informationsgesetz von 1993 das Öffentlichkeitsprinzip - auch die Burgergemeinde ist diesem Gesetz unterstellt. Die Gespräche mit der Burgerbibliothek waren nicht einfach. Man war über meine Forschungen - gelinde gesagt - "not amused".
Aus einem anderen Artikel:
· Zwei an der Universität Bern erarbeitete historische Lizenziatsarbeiten von Karoline Arn und Katrin Rieder (5) brachten Ende der 1990er-Jahre neue Fakten über die neue Geschichte der Burgergemeinde ans Licht. Mit der Folge, dass - laut Aussage des heutigen Burgerratspräsidenten Franz von Graffenried - der damalige Sekretär der Burgergemeinde drohte, ein Weiterzug der Forschungsarbeit mit Publikation hätte Klagen zur Folge.
· Im Hinblick auf eine vom Bundesarchiv, dem Stadt- und Staatsarchiv für 2001 geplante Ausstellung im Käfigturm über Bundesrat Markus Feldmanns Tagebücher hatte das Bundesarchiv Katrin Rieder den Auftrag erteilt, für ein Dossier einen Artikel zu schreiben zum Thema, wie Feldmann Bernburger wurde (6). Feldmann war im ersten Anlauf 1940 überraschend nicht zum Bundesrat gewählt worden. An seiner Stelle wählte das Parlament den deutschfreundlichen BGB-Parteikollegen und Bernburger Eduard von Steiger. Im Hinblick auf seine Wahl im zweiten Anlauf offerierte die Burgergemeinde Feldmann 1951 das Ehrenburgerrecht. Dem Vernehmen nach hatte der Berner Staatsarchivar - selbst ein Bernburger - versucht, den Auftrag an die Historikerin zu verhindern. Als ihm dies nicht gelang, machte das Berner Staatsarchiv bei der Ausstellung nicht mehr mit.
· Der Berner Historiker Daniel Schläppi publizierte zwei Texte in Bänden über die Geschichte von Berner Zünften (7). Dem Vernehmen nach musste er dabei Zensuren akzeptieren. Heute will er sich zu dieser Angelegenheit nicht mehr äussern. Kenner der Szene erklären, wer in Sachen Burgergemeinde kritisch recherchiere, müsse damit rechnen, auf dem Platz Bern keine Stelle als Historiker zu finden.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
'Chronik der Kaiser, Könige und Päpste, sowie der Grafen von Württemberg'
Gedruckte Weltchronik in dt. Sprache (um 1480) in der Nachfolge Jakob -> Twingers von Königshofen
Überlieferung. Druck Augsburg, [Johann Blaubirer], um 1480 (GW 6687), 98 Bl.
Ausgabe. Chr. Fr. Sattler, Geschichte des Herzogthums Würtenberg unter der Regierung der Graven, Bd. 1, ²1773, Beylagen, S. 1-4 (nur c. 7)
Das bislang kaum beachtete Werk stellt eine wohl in Augsburg
angefertigte Kompilation aus der Straßburger Chronik Twingers und
Heinrich Steinhöwels 1473 in Ulm gedruckter 'Tütschen Chronica'
(Auszug aus den 'Flores temporum') dar. In sechs Kapiteln wird ein Abriß der Geschichte der Päpste (c. 4) und Kaiser (c. 2-3) geboten, der durch Mitteilungen zur Regionalgeschichte des Oberrheins (c. 1 sowie c. 6 über die Armagnaken und Erdbeben) und zum Ursprung der französischen Könige (c. 5) ergänzt wird. Zusammenhänge mit den Augsburger Twinger-Drucken und -Handschriften, Johann Bämlers 'Kaiser- und Papstchronik' (1476) und dem historiographischen Oeuvre Konrad Bollstatters müßten noch näher untersucht werden.
Nachträglich erweitert wurde das Kompendium durch ein siebtes Kapitel zur württembergischen Geschichte: Hie wirdet etwas gesagt
von ettlichen alten geschichten der herren von Wirttemberg.
Bis zum Jahr 1344 wird der mit der Geburt Graf Eberhard des Erlauchten (1265) einsetzende Text der im 3. Viertel des 15. Jh.s entstandenen 'Stuttgarter Stiftschronik vom Hause Württemberg' wörtlich übernommen. Es folgen Nachrichten über Graf Eberhard den Greiner und seinen Bruder sowie über die Kämpfe zwischen Württemberg und den Reichsstädten (1368-1388). Offensichtlich hoffte der Augsburger Drucker auf Absatz seines Geschichtsbuchs im württembergisch-schwäbischen Raum.
Literatur. Chr. v. Stälin, Ueber das s.g. älteste gedruckte
Württembergische Geschichtsbuch, Württembergische Jbb. (1856) H. 1, S. 91-93;
K. Graf, Exemplarische Geschichten. Thomas Lirers "Schwäbische
Chronik" und die "Gmünder Kaiserchronik" (Forschg.n z. Gesch. d. älteren dt. Lit. 7), 1987, S. 218f.;
J. Wolf, Konrad Bollstatter und die Augsburger Geschichtsschreibung, ZfdA 125 (1996), S. 54, 62f., 84.
Quelle: Klaus Graf, ²VL 11 Lief. 2 (2001) 328f.
Die Inkunabel (ohne das siebte Kapitel zu Württemberg) nun online:
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00034204/image_1
Stälin 1856 online:
http://books.google.com/books?id=SQMAAAAAMAAJ&pg=PA91
Graf 1987 online
http://www.literature.at/webinterface/library/ALO_PDF_V01?objid=22215
Steinhöwel 1473 online
http://diglib.hab.de/inkunabeln/4-xylogr-1/start.htm
Bämlers Twinger-Bearbeitung Ausgabe 1480 online
http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0003/bsb00032289/images/
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00032289/image_1
Zu Abweichungen dieser Ausgabe von ihrer Vorlage siehe Boehms Reformatio Sigismundi-Ausgabe
http://books.google.com/books?id=C0MJAAAAQAAJ&pg=PA11 (US-Proxy)
[ http://archive.org/stream/friedrichreiser00reisgoog#page/n20/mode/2up ]
Stälins Ausgabe der Stuttgarter Stiftchronik vom Hause Württemberg 1864
http://books.google.de/books?id=r24AAAAAcAAJ&pg=PA256
Das in München nicht vorhandene siebte Kapitel über die Herren von Württemberg ist nach HStA Stuttgart J1 Hs. 35 Bl. 509r-513v online einsehbar unter
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inkunabel_GW_6687_1.jpg
Nachträge 2013:
Transkription des württembergischen Kapitels auf Wikisource:
http://de.wikisource.org/wiki/Von_ettlichen_alten_geschichten_der_herren_von_Wirttemberg
Digitalisat des Exemplars der WLB Stuttgart mit 7. Kapitel:
http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz347315496
#forschung
Gedruckte Weltchronik in dt. Sprache (um 1480) in der Nachfolge Jakob -> Twingers von Königshofen
Überlieferung. Druck Augsburg, [Johann Blaubirer], um 1480 (GW 6687), 98 Bl.
Ausgabe. Chr. Fr. Sattler, Geschichte des Herzogthums Würtenberg unter der Regierung der Graven, Bd. 1, ²1773, Beylagen, S. 1-4 (nur c. 7)
Das bislang kaum beachtete Werk stellt eine wohl in Augsburg
angefertigte Kompilation aus der Straßburger Chronik Twingers und
Heinrich Steinhöwels 1473 in Ulm gedruckter 'Tütschen Chronica'
(Auszug aus den 'Flores temporum') dar. In sechs Kapiteln wird ein Abriß der Geschichte der Päpste (c. 4) und Kaiser (c. 2-3) geboten, der durch Mitteilungen zur Regionalgeschichte des Oberrheins (c. 1 sowie c. 6 über die Armagnaken und Erdbeben) und zum Ursprung der französischen Könige (c. 5) ergänzt wird. Zusammenhänge mit den Augsburger Twinger-Drucken und -Handschriften, Johann Bämlers 'Kaiser- und Papstchronik' (1476) und dem historiographischen Oeuvre Konrad Bollstatters müßten noch näher untersucht werden.
Nachträglich erweitert wurde das Kompendium durch ein siebtes Kapitel zur württembergischen Geschichte: Hie wirdet etwas gesagt
von ettlichen alten geschichten der herren von Wirttemberg.
Bis zum Jahr 1344 wird der mit der Geburt Graf Eberhard des Erlauchten (1265) einsetzende Text der im 3. Viertel des 15. Jh.s entstandenen 'Stuttgarter Stiftschronik vom Hause Württemberg' wörtlich übernommen. Es folgen Nachrichten über Graf Eberhard den Greiner und seinen Bruder sowie über die Kämpfe zwischen Württemberg und den Reichsstädten (1368-1388). Offensichtlich hoffte der Augsburger Drucker auf Absatz seines Geschichtsbuchs im württembergisch-schwäbischen Raum.
Literatur. Chr. v. Stälin, Ueber das s.g. älteste gedruckte
Württembergische Geschichtsbuch, Württembergische Jbb. (1856) H. 1, S. 91-93;
K. Graf, Exemplarische Geschichten. Thomas Lirers "Schwäbische
Chronik" und die "Gmünder Kaiserchronik" (Forschg.n z. Gesch. d. älteren dt. Lit. 7), 1987, S. 218f.;
J. Wolf, Konrad Bollstatter und die Augsburger Geschichtsschreibung, ZfdA 125 (1996), S. 54, 62f., 84.
Quelle: Klaus Graf, ²VL 11 Lief. 2 (2001) 328f.
Die Inkunabel (ohne das siebte Kapitel zu Württemberg) nun online:
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00034204/image_1
Stälin 1856 online:
http://books.google.com/books?id=SQMAAAAAMAAJ&pg=PA91
Graf 1987 online
http://www.literature.at/webinterface/library/ALO_PDF_V01?objid=22215
Steinhöwel 1473 online
http://diglib.hab.de/inkunabeln/4-xylogr-1/start.htm
Bämlers Twinger-Bearbeitung Ausgabe 1480 online
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00032289/image_1
Zu Abweichungen dieser Ausgabe von ihrer Vorlage siehe Boehms Reformatio Sigismundi-Ausgabe
http://books.google.com/books?id=C0MJAAAAQAAJ&pg=PA11 (US-Proxy)
[ http://archive.org/stream/friedrichreiser00reisgoog#page/n20/mode/2up ]
Stälins Ausgabe der Stuttgarter Stiftchronik vom Hause Württemberg 1864
http://books.google.de/books?id=r24AAAAAcAAJ&pg=PA256
Das in München nicht vorhandene siebte Kapitel über die Herren von Württemberg ist nach HStA Stuttgart J1 Hs. 35 Bl. 509r-513v online einsehbar unter
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inkunabel_GW_6687_1.jpg
Nachträge 2013:
Transkription des württembergischen Kapitels auf Wikisource:
http://de.wikisource.org/wiki/Von_ettlichen_alten_geschichten_der_herren_von_Wirttemberg
Digitalisat des Exemplars der WLB Stuttgart mit 7. Kapitel:
http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz347315496
#forschung
KlausGraf - am Freitag, 13. Februar 2009, 21:46 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Im Anhang zu einem deutschsprachigen Druck der Goldenen Bulle
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00034383/images/index.html?id=00034383&&seite=68
Zu den Quaternionen sehe man
http://de.wikipedia.org/wiki/Quaternionen_der_Reichsverfassung
Update: weitere Inkunabel
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00034381/images/index.html?id=00034381&seite=165
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00034383/images/index.html?id=00034383&&seite=68
Zu den Quaternionen sehe man
http://de.wikipedia.org/wiki/Quaternionen_der_Reichsverfassung
Update: weitere Inkunabel
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00034381/images/index.html?id=00034381&seite=165
KlausGraf - am Freitag, 13. Februar 2009, 21:40 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
A list of Digital Collections. Unfortunately no meta-search.
http://library.mtsu.edu/digitalprojects/womenshistory.php

http://library.mtsu.edu/digitalprojects/womenshistory.php
KlausGraf - am Freitag, 13. Februar 2009, 21:02 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Immer wieder ärgere ich mich, wenn in Ausstellungskatalogen Objekte einseitig kunsthistorisch gewürdigt werden, der historische Kontext aber unter den Tisch fällt.
Jüngstes Beispiel: In dem Katalog der Berner Ausstellung "Karl der Kühne" (Stuttgart 2008) ist Nr. 161 ein "Bericht über die Hochzeit" von Maximilian und Maria und Burgund aus dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (Allg. Urkundenreihe 1479 III 17). Man erfährt, dass er aus dem Kloster Einsiedeln stammt, aber mit keiner Silbe, dass der Verfasser der dortige Konventuale Albrecht von Bonstetten war. Der Text ist besprochen bei Regine Schweers, Albrecht von Bonstetten ..., 2005, S. 93-95 http://books.google.com/books?id=7Ne2OKF_j6YC&pg=PA93. Susan Marti gibt im Ausstellungskatalog als Literatur nur den Berliner Katalog "Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation" 2006 S. 123f., der mir nicht vorliegt. Die historische Einordnung des Textes setzt voraus, dass man den Verfasser Bonstetten kennt, mit ihm lässt sich etwa auch der Abdruck des Textes bei Chmel ermitteln.
(Wie nicht selten, hat es auf den ersten Blick den Anschein, dass Chmels Urkunden und Aktenstücke bei Google Book Search gar nicht online sind. Nimmt man aber ein Textstück aus Schweers, findet man die Stelle sofort:
http://books.google.com/books?ei=PL-VSbGqFqOOyQT7lJmBDw&hl=de&as_brr=0&q=sit+igitur+iste+sigismondus )

UPDATE:
Michael Anders hat mir freundlicherweise den Wortlaut des Katalogbands 2 zur Ausstellung „Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation 962-1806“ zur Verfügung gestellt:
„Die bildliche Darstellung zeigt diesen Moment [die Hochzeit]: Die beiden Brautleute stehen einander vor einem Geistlichen gegenüber, Maria ist in geistlicher Begleitung, Maxi- [S. 124] milian wird von einem Schwertträger begleitet. Zu Füßen der handelnden Personen befinden sich die beiden Wappenschilde, der österreichische Bindenschild neben dem burgundischen Schild. Die beiden Wappen fallen durch ihre Farbigkeit auf und symbolisieren für den Betrachter der Szene sofort, dass die Verbindung zwischen Habsburg und Burgund trotz aller Irrungen nun zustande gekommen ist.
Der Bericht über die Hochzeit wurde anscheinend im Kloster Einsiedeln verfasst. Möglicherweise ist es eine Auftragsarbeit des Innsbrucker Hofes, da sich der Verfasser als Anhänger Erzherzog Siegmunds von Tirol zu erkennen gibt. Gedacht war der Bericht für den Dogen und die Senatoren von Venedig, allerdings wurde das Stück nie abgeschickt. Siegmund von Tirol hatte sich für die österreichisch-burgundische Heirat stark eingesetzt, er wurde dafür von Friedrich III. auch mit dem Titel eines Erzherzogs belohnt. Dieser Titel stand nach der Bestätigung des Privilegium Maius durch den Kaiser im Jahr 1453 nur der steirischen Linie der Habsburger zu.“
Autor: ThJ = Thomas Just
Verwiesen wird auf:
Wiesflecker 1971-1986, Bd.1, S. 96-133;
Ausst.-Kat. Neuhofen an der Ybbs/St. Pölten 1996, S. 666f;
Ausst.-Kat. Berlin 2003, S. 115.
Also auch da kein Hinweis auf den Autor. Liegts also nicht an den Kunsthistorikern, sondern an einem Wiener Archivar, dass das Stück seinen Autor verlor? Sollte Just tatsächlich übersehen haben, dass Bonstetten der Autor ist, was bei Chmel steht, aber womöglich nicht im Findmittel der Urkundenreihe? Es klingt fast danach (anscheinend in Einsiedeln, gibt sich als Anhänger Sigmunds zu erkennen). Aber was ist mit den zitierten Quellen? Da Just dieses Weblog liest, ist die Lösung des Rätsels womöglich nah ...
Update:
Siehe auch
http://wwwg.uni-klu.ac.at/kultdoku/kataloge/20/html/1823.htm
Jüngstes Beispiel: In dem Katalog der Berner Ausstellung "Karl der Kühne" (Stuttgart 2008) ist Nr. 161 ein "Bericht über die Hochzeit" von Maximilian und Maria und Burgund aus dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (Allg. Urkundenreihe 1479 III 17). Man erfährt, dass er aus dem Kloster Einsiedeln stammt, aber mit keiner Silbe, dass der Verfasser der dortige Konventuale Albrecht von Bonstetten war. Der Text ist besprochen bei Regine Schweers, Albrecht von Bonstetten ..., 2005, S. 93-95 http://books.google.com/books?id=7Ne2OKF_j6YC&pg=PA93. Susan Marti gibt im Ausstellungskatalog als Literatur nur den Berliner Katalog "Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation" 2006 S. 123f., der mir nicht vorliegt. Die historische Einordnung des Textes setzt voraus, dass man den Verfasser Bonstetten kennt, mit ihm lässt sich etwa auch der Abdruck des Textes bei Chmel ermitteln.
(Wie nicht selten, hat es auf den ersten Blick den Anschein, dass Chmels Urkunden und Aktenstücke bei Google Book Search gar nicht online sind. Nimmt man aber ein Textstück aus Schweers, findet man die Stelle sofort:
http://books.google.com/books?ei=PL-VSbGqFqOOyQT7lJmBDw&hl=de&as_brr=0&q=sit+igitur+iste+sigismondus )

UPDATE:
Michael Anders hat mir freundlicherweise den Wortlaut des Katalogbands 2 zur Ausstellung „Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation 962-1806“ zur Verfügung gestellt:
„Die bildliche Darstellung zeigt diesen Moment [die Hochzeit]: Die beiden Brautleute stehen einander vor einem Geistlichen gegenüber, Maria ist in geistlicher Begleitung, Maxi- [S. 124] milian wird von einem Schwertträger begleitet. Zu Füßen der handelnden Personen befinden sich die beiden Wappenschilde, der österreichische Bindenschild neben dem burgundischen Schild. Die beiden Wappen fallen durch ihre Farbigkeit auf und symbolisieren für den Betrachter der Szene sofort, dass die Verbindung zwischen Habsburg und Burgund trotz aller Irrungen nun zustande gekommen ist.
Der Bericht über die Hochzeit wurde anscheinend im Kloster Einsiedeln verfasst. Möglicherweise ist es eine Auftragsarbeit des Innsbrucker Hofes, da sich der Verfasser als Anhänger Erzherzog Siegmunds von Tirol zu erkennen gibt. Gedacht war der Bericht für den Dogen und die Senatoren von Venedig, allerdings wurde das Stück nie abgeschickt. Siegmund von Tirol hatte sich für die österreichisch-burgundische Heirat stark eingesetzt, er wurde dafür von Friedrich III. auch mit dem Titel eines Erzherzogs belohnt. Dieser Titel stand nach der Bestätigung des Privilegium Maius durch den Kaiser im Jahr 1453 nur der steirischen Linie der Habsburger zu.“
Autor: ThJ = Thomas Just
Verwiesen wird auf:
Wiesflecker 1971-1986, Bd.1, S. 96-133;
Ausst.-Kat. Neuhofen an der Ybbs/St. Pölten 1996, S. 666f;
Ausst.-Kat. Berlin 2003, S. 115.
Also auch da kein Hinweis auf den Autor. Liegts also nicht an den Kunsthistorikern, sondern an einem Wiener Archivar, dass das Stück seinen Autor verlor? Sollte Just tatsächlich übersehen haben, dass Bonstetten der Autor ist, was bei Chmel steht, aber womöglich nicht im Findmittel der Urkundenreihe? Es klingt fast danach (anscheinend in Einsiedeln, gibt sich als Anhänger Sigmunds zu erkennen). Aber was ist mit den zitierten Quellen? Da Just dieses Weblog liest, ist die Lösung des Rätsels womöglich nah ...
Update:
Siehe auch
http://wwwg.uni-klu.ac.at/kultdoku/kataloge/20/html/1823.htm
KlausGraf - am Freitag, 13. Februar 2009, 19:48 - Rubrik: Landesgeschichte
" ..... Die Sammlung von Fotos, Zeichnungen und erotischen Texten mit einem Bezug zu Leeuwarden sei möglicherweise von einem Angestellten oder einem Besucher mit nach Hause genommen worden, sagte Erik Krikke vom Historischen Zentrum. „Wir hoffen, dass jemand kommt und sagt: 'Hey, ich habe es auf meinem Dachboden' und es zurückbringt“, sagte Krikke. „Wir stellen auch keine Fragen.“ Die Sammlung sei klein genug gewesen, um in eine Umzugskiste zu passen. ...."
Quelle:
http://www.bild.de/BILD/news/telegramm/news-ticker,rendertext=7381774.html
Quelle:
http://www.bild.de/BILD/news/telegramm/news-ticker,rendertext=7381774.html
Wolf Thomas - am Donnerstag, 12. Februar 2009, 22:16 - Rubrik: Kommunalarchive
"Görlitz, 17. Juni 1953. Der arbeitslose Pflanzenschutztechniker Werner Herbig muss wegen eines Ausweises zur Polizei. Da laufen die Beamten umher wie die aufgescheuchten Hühner, denn es gibt beunruhigende Meldungen aus der Hauptstadt: Streik! Aufruhr! Putsch! Herbig soll nach Hause. Auf der Straße kommt ihm ein Demonstrationszug entgegen, hunderte Arbeiter vom Lokomotiv- und Waggonbau-Werk, die gegen die hohen Normen protestieren. Jemand ruft: „Herbig, du gehörst zu uns! Los, hier rein!“ Den Ruf, der sein Leben verändert, wird er später oft und in diversen Varianten zitieren.
Auf einmal steht er an der Spitze des Zuges, und weil er an der Spitze des Zuges steht, machen die Görlitzer Demonstranten den arbeitslosen Pflanzenschutztechniker zum Mitglied ihres „Streikkomitees“. Es geht schließlich um etwas mehr als Norm und Streik. Dies ist ein Volksaufstand gegen die SED-Herrschaft. Politische Gefangene sollen befreit werden, und weil das Frauengefängnis auf dem Weg der Demonstranten liegt, öffnen sie hier alle Türen. Dann kommt das Rathaus dran. Der Bürgermeister wird festgehalten, die Leute von der Stasi-Zentrale entwaffnet und hinausgeworfen. In Bautzen sind die Aufständischen gründlich. Finanzamt, Post und Bahnhof besetzen sie. Nur in die Kaserne der Russen trauen sie sich nicht.
Es gibt Absprachen und Fantasien, wer soll, wenn die alte Herrschaft fort ist, welche Verantwortung übernehmen, Werner Herbig würde sich um Land- und Forstwirtschaft kümmern. Es gibt Versammlungen, und am späten Nachmittag schickt die Streikleitung die Demonstranten heim. Morgen wird man weitersehen.
Doch schon am selben Abend ist alles vorbei. Russische Soldaten rücken ein, der Bürgermeister zeigt, wo die Anführer des Aufstands wohnen. Er zeigt auf Werner Herbig: Der da war dabei!
Ein Monat Untersuchungshaft mit Verhörmethoden, die Häftlinge Dinge gestehen lassen, die sie nie getan haben, dann die Verhandlung ohne Verteidigung, dafür mit einem Richter, der die Anträge der Staatsanwaltschaft überbietet, und das Urteil für Werner Herbig: fünf Jahre Zuchthaus. Fast vier Jahre davon sitzt er ab mit kahlem Schädel und gelben X-Zeichen auf der Kleidung. Das ist das Zeichen für die „Agenten und Provokateure“ vom 17. Juni.
Zwei Jahre nach seiner Freilassung flieht er mit Frau und Sohn nach West-Berlin, findet Arbeit im Botanischen Garten und später beim Landesarchiv. Das sind gute Stellen, denn nebenher hat er viel Zeit zur Fortsetzung seines Kampfes.
Werner Herbig ist von robuster Natur. Die grausamen Jahre der Haft hat er besser überstanden als andere. Er gründet den „Arbeitskreis 17. Juni“ und kümmert sich darum, dass man den anderen glaubt, woher ihre Verletzungen stammen. Er ist einer jener störenden Geister, die den 17. Juni als Gedenktag ernst nehmen....."
Quelle:
http://www.tagesspiegel.de/berlin/Nachrufe;art127,2729290
Auf einmal steht er an der Spitze des Zuges, und weil er an der Spitze des Zuges steht, machen die Görlitzer Demonstranten den arbeitslosen Pflanzenschutztechniker zum Mitglied ihres „Streikkomitees“. Es geht schließlich um etwas mehr als Norm und Streik. Dies ist ein Volksaufstand gegen die SED-Herrschaft. Politische Gefangene sollen befreit werden, und weil das Frauengefängnis auf dem Weg der Demonstranten liegt, öffnen sie hier alle Türen. Dann kommt das Rathaus dran. Der Bürgermeister wird festgehalten, die Leute von der Stasi-Zentrale entwaffnet und hinausgeworfen. In Bautzen sind die Aufständischen gründlich. Finanzamt, Post und Bahnhof besetzen sie. Nur in die Kaserne der Russen trauen sie sich nicht.
Es gibt Absprachen und Fantasien, wer soll, wenn die alte Herrschaft fort ist, welche Verantwortung übernehmen, Werner Herbig würde sich um Land- und Forstwirtschaft kümmern. Es gibt Versammlungen, und am späten Nachmittag schickt die Streikleitung die Demonstranten heim. Morgen wird man weitersehen.
Doch schon am selben Abend ist alles vorbei. Russische Soldaten rücken ein, der Bürgermeister zeigt, wo die Anführer des Aufstands wohnen. Er zeigt auf Werner Herbig: Der da war dabei!
Ein Monat Untersuchungshaft mit Verhörmethoden, die Häftlinge Dinge gestehen lassen, die sie nie getan haben, dann die Verhandlung ohne Verteidigung, dafür mit einem Richter, der die Anträge der Staatsanwaltschaft überbietet, und das Urteil für Werner Herbig: fünf Jahre Zuchthaus. Fast vier Jahre davon sitzt er ab mit kahlem Schädel und gelben X-Zeichen auf der Kleidung. Das ist das Zeichen für die „Agenten und Provokateure“ vom 17. Juni.
Zwei Jahre nach seiner Freilassung flieht er mit Frau und Sohn nach West-Berlin, findet Arbeit im Botanischen Garten und später beim Landesarchiv. Das sind gute Stellen, denn nebenher hat er viel Zeit zur Fortsetzung seines Kampfes.
Werner Herbig ist von robuster Natur. Die grausamen Jahre der Haft hat er besser überstanden als andere. Er gründet den „Arbeitskreis 17. Juni“ und kümmert sich darum, dass man den anderen glaubt, woher ihre Verletzungen stammen. Er ist einer jener störenden Geister, die den 17. Juni als Gedenktag ernst nehmen....."
Quelle:
http://www.tagesspiegel.de/berlin/Nachrufe;art127,2729290
Wolf Thomas - am Donnerstag, 12. Februar 2009, 22:15 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Wie lässt sich die Veränderung des Klimas überhaupt dingfest machen? Die Antwort liegt tief unter der Erdoberfläche in beinhartem Gestein und moosweichen Torfschichten; solche Ablagerungen haben Veränderungen des Klimas über Jahrtausende hinweg wie eine Computerfestplatte gespeichert. Dieses nahezu unberührte Sedimentgestein findet sich im Wehntal, das aufgrund der Beschaffenheit ein einzigartiges Klimaarchiv von nationaler Bedeutung darstellt. ....."
Quelle:
http://www.zuonline.ch/storys/storys.cfm?vID=13003
Mehr zum Thema auf Archivalia:
http://archiv.twoday.net/search?q=Sediment
Quelle:
http://www.zuonline.ch/storys/storys.cfm?vID=13003
Mehr zum Thema auf Archivalia:
http://archiv.twoday.net/search?q=Sediment
Wolf Thomas - am Donnerstag, 12. Februar 2009, 22:12 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Ausstellung "Tatsachen über Beijing – Dokumente der Erinnerung" ist seit Mittwoch im Beijinger Archiv kostenlos für Besucher zugängig. Über 400 Materialien und Dokumente, welche die Entwicklung und den Wandel der Stadt Beijing in den vergangenen hundert Jahren widerspiegeln, werden in neun Bereichen ausgestellt. Dazu gehören beispielsweise Darstellungen über das alte Beijing sowie über Handel und Industrie oder Bildung und Kultur. Unter den Exponaten befinden sich auch wertvolle Gemälde von Landschaften im Alten Sommerpalast, der Eisenbahn Beijing-Zhangkaikou, der Einkaufsstraße Dazhalan oder dem Trommelturm im alten Beijing und von einem Abschnitt des Kaiserkanals zwischen Beijing und Hangzhou. Auch der Bewerbungsbericht der Stadt Beijing um die Austragung der 29. Olympischen Spiele liegt aus. Interessierte können auch unter Vorlage des Ausweises kostenlos das Archiv nutzen. Die Ausstellung ist von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr von Montag bis Freitag geöffnet. Für Fragen und Anmeldungen wurde ein Servicetelefon eingerichtet: die Nummer lautet 8519 4106."
Quelle:
http://german.cri.cn/1669/2009/02/12/1s108667.htm
Quelle:
http://german.cri.cn/1669/2009/02/12/1s108667.htm
Wolf Thomas - am Donnerstag, 12. Februar 2009, 22:09 - Rubrik: Veranstaltungen
"Reihen von verstaubten Einmachgläsern führen in den Ausstellungsraum Klingental, der kontrastreiche Arbeiten zum Thema „Welt in Sicht II“ präsentiert. Doch welche Welten geraten hier in Sicht? Im zweiten Teil der Ausstellung, deren Auftakt im Kunstpanorama/Kunsthalle Luzern im Frühjahr letzten Jahres stattfand und das imaginäre Reisen als Kontext hatte, wird nun die meist übersehene, kleine Welt der nächsten Umgebung in den Blick genommen.
Gleich mehrere Arbeiten beschäftigen sich mit verborgenen Orten, zu denen zum Beispiel das Archiv zählt. Der Künstler Christian Ratti (*1974) hat zusammen mit dem Industrie-Designer Jean Franck Haspel die Installation „Rübli 29.X.41“ eingerichtet. Haspel arbeitet für die Firma Vetropack und hatte dadurch Zugang zu alten Einmachgläsern der Firma Bülach, die heute zu Vetropack gehört. Die Arbeit beinhaltet nicht nur eingewecktes Gemüse ab 1930, das im Labor der Firma nach verschiedenen Methoden haltbar gemacht wurde - wie man auf den handgeschriebenen Etiketten nachvollziehen kann - vielmehr setzen die Künstler die aus dem Dunkel des Vergessens hervorgeholten Archivgläser mit weiteren Dokumenten der Firma Bülach in Verbindung. Die vergangene Welt der Schweizer Glasbläserei wird aufbereitet und kritisch hinterfragt, ist der Aufschwung der Firma Bülach doch auch dem Zweiten Weltkrieg geschuldet und der damit einhergehenden propagierten Notwendigkeit von Vorratshaltung. In der Präsentation von Ratti und Haspel entsteht so eine unauflösbare Spannung in der Anschauung eines halb verschimmelten Relikts aus der Vergangenheit und der Vorsorge für die Zukunft. Der Zweite Weltkrieg scheint darin als etwas Zukünftiges konserviert.
„La pièce sacrée“ ist eine mehrteilige Arbeit von Petra Elena Köhle (*1977) und Nicolas Vermot Petit-Outhenin (*1977), die immer wieder den von Hans Dietz bis zu seinem Tod geheim gehaltenen Schreibtischinhalt konsultieren. In Schachteln verpackt bleibt der Inhalt im ersten Teil der Installation den Besuchern verborgen. Teilweise gelüftet wird er dann im abgeschotteten Nebenraum. Hier untersuchen die Künstler das Haushaltsbuch von Hans Dietz. Doch was dieses Heftchen über ihn erzählt, reicht den Künstlern nicht aus. Sie wollen tiefer in seine Welt eindringen und kaufen die vermerkten Lebensmittel nach, versuchen daraus Gerichte zu kochen und archivieren ihre Quittungen, die sie dem Besucher als geheftete Kopien präsentieren. Die Habseligkeiten des Verstorbenen werden immer wieder neu gesichtet und bewusst nachvollzogen, mit der heutigen Realität abgeglichen und vermengt. So reisten sie nach Capri, um dort Orte aufzuspüren, die als Urlaubsfotos in den Erinnerungen auftauchen. Im Diavortrag treten alte Aufnahmen von Hans Dietz neben die der Künstler. ......
Welt in Sicht II
Ausstellungsraum Klingental
Kasernenstr. 23, Basel (CH).
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 15.00 bis 18.00 Uhr, Samstag und Sonntag 11.00 bis 17.00 Uhr.
Bis 8. März 2009.
Am 8. März 2009 spricht Christian Ratti um 17.00 Uhr über seine Arbeit „Rübli 29.X.41“. "
Quelle:
http://www.regioartline.org/ral/index.php?&id=4&backPID=27&tt_news=2341
Link zum Ausstellungsraum: http://www.ausstellungsraum.ch/
Gleich mehrere Arbeiten beschäftigen sich mit verborgenen Orten, zu denen zum Beispiel das Archiv zählt. Der Künstler Christian Ratti (*1974) hat zusammen mit dem Industrie-Designer Jean Franck Haspel die Installation „Rübli 29.X.41“ eingerichtet. Haspel arbeitet für die Firma Vetropack und hatte dadurch Zugang zu alten Einmachgläsern der Firma Bülach, die heute zu Vetropack gehört. Die Arbeit beinhaltet nicht nur eingewecktes Gemüse ab 1930, das im Labor der Firma nach verschiedenen Methoden haltbar gemacht wurde - wie man auf den handgeschriebenen Etiketten nachvollziehen kann - vielmehr setzen die Künstler die aus dem Dunkel des Vergessens hervorgeholten Archivgläser mit weiteren Dokumenten der Firma Bülach in Verbindung. Die vergangene Welt der Schweizer Glasbläserei wird aufbereitet und kritisch hinterfragt, ist der Aufschwung der Firma Bülach doch auch dem Zweiten Weltkrieg geschuldet und der damit einhergehenden propagierten Notwendigkeit von Vorratshaltung. In der Präsentation von Ratti und Haspel entsteht so eine unauflösbare Spannung in der Anschauung eines halb verschimmelten Relikts aus der Vergangenheit und der Vorsorge für die Zukunft. Der Zweite Weltkrieg scheint darin als etwas Zukünftiges konserviert.
„La pièce sacrée“ ist eine mehrteilige Arbeit von Petra Elena Köhle (*1977) und Nicolas Vermot Petit-Outhenin (*1977), die immer wieder den von Hans Dietz bis zu seinem Tod geheim gehaltenen Schreibtischinhalt konsultieren. In Schachteln verpackt bleibt der Inhalt im ersten Teil der Installation den Besuchern verborgen. Teilweise gelüftet wird er dann im abgeschotteten Nebenraum. Hier untersuchen die Künstler das Haushaltsbuch von Hans Dietz. Doch was dieses Heftchen über ihn erzählt, reicht den Künstlern nicht aus. Sie wollen tiefer in seine Welt eindringen und kaufen die vermerkten Lebensmittel nach, versuchen daraus Gerichte zu kochen und archivieren ihre Quittungen, die sie dem Besucher als geheftete Kopien präsentieren. Die Habseligkeiten des Verstorbenen werden immer wieder neu gesichtet und bewusst nachvollzogen, mit der heutigen Realität abgeglichen und vermengt. So reisten sie nach Capri, um dort Orte aufzuspüren, die als Urlaubsfotos in den Erinnerungen auftauchen. Im Diavortrag treten alte Aufnahmen von Hans Dietz neben die der Künstler. ......
Welt in Sicht II
Ausstellungsraum Klingental
Kasernenstr. 23, Basel (CH).
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 15.00 bis 18.00 Uhr, Samstag und Sonntag 11.00 bis 17.00 Uhr.
Bis 8. März 2009.
Am 8. März 2009 spricht Christian Ratti um 17.00 Uhr über seine Arbeit „Rübli 29.X.41“. "
Quelle:
http://www.regioartline.org/ral/index.php?&id=4&backPID=27&tt_news=2341
Link zum Ausstellungsraum: http://www.ausstellungsraum.ch/
Wolf Thomas - am Donnerstag, 12. Februar 2009, 22:07 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Paul Sacher Stiftung wurde 1973 zunächst mit dem Ziel der Bewahrung der musikalischen Bibliothek von Paul Sacher gegründet. Mit der einige Zeit später einsetzenden systematischen Erweiterung der Bestände wandelte sich diese Aufgabe. Mit rund achtzig Nachlässen und Sammlungen von bedeutenden Komponisten und Interpreten bildet die Stiftung heute ein internationales Forschungszentrum für die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts.
Die Hauptaufgabe der Paul Sacher Stiftung besteht in der optimalen Konservierung und Erschliessung der Quellenbestände. Darüber hinaus ermöglicht und fördert sie die wissenschaftliche Erforschung des Archivguts durch Bereitstellung der Dokumente vor Ort. Hierfür wurden alle technischen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen.
So ist das Haus mit mehreren Lesesälen, Büros, Magazinen und einem für die Archivierung der Originaldokumente bestimmten klimatisierten Kulturgüterschutzraum ausgestattet.
Auch eine umfangreiche Fachbibliothek zur Musik des 20. und 21. Jahrhunderts wurde aufgebaut, die wie die zugehörige Phonothek und Videothek laufend ergänzt wird und so die einschlägige Fachliteratur im Haus verfügbar macht. Mit eigenen Forschungsprojekten und Publikationen beteiligt sich die Stiftung selbst an der wissenschaftlichen Erforschung und Aufarbeitung ihrer Bestände."
Quelle: Homepage der Stiftung: http://www.paul-sacher-stiftung.ch/
Link zur Sammlungsliste:
http://www.paul-sacher-stiftung.ch/pss/sammlungen.htm
Die Hauptaufgabe der Paul Sacher Stiftung besteht in der optimalen Konservierung und Erschliessung der Quellenbestände. Darüber hinaus ermöglicht und fördert sie die wissenschaftliche Erforschung des Archivguts durch Bereitstellung der Dokumente vor Ort. Hierfür wurden alle technischen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen.
So ist das Haus mit mehreren Lesesälen, Büros, Magazinen und einem für die Archivierung der Originaldokumente bestimmten klimatisierten Kulturgüterschutzraum ausgestattet.
Auch eine umfangreiche Fachbibliothek zur Musik des 20. und 21. Jahrhunderts wurde aufgebaut, die wie die zugehörige Phonothek und Videothek laufend ergänzt wird und so die einschlägige Fachliteratur im Haus verfügbar macht. Mit eigenen Forschungsprojekten und Publikationen beteiligt sich die Stiftung selbst an der wissenschaftlichen Erforschung und Aufarbeitung ihrer Bestände."
Quelle: Homepage der Stiftung: http://www.paul-sacher-stiftung.ch/
Link zur Sammlungsliste:
http://www.paul-sacher-stiftung.ch/pss/sammlungen.htm
Wolf Thomas - am Donnerstag, 12. Februar 2009, 22:05 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.badische-heimat.de/neu/projekte/reprint/index.htm
Zutreffend als Insellösung kritisiert:
http://mannigfaltigkeiten.twoday.net/stories/5510713/
Bühlers Blog (mit eigenartigem Foto ganz oben)
http://blog.kulturerbe.li/
Zutreffend als Insellösung kritisiert:
http://mannigfaltigkeiten.twoday.net/stories/5510713/
Bühlers Blog (mit eigenartigem Foto ganz oben)
http://blog.kulturerbe.li/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://kirtasbooks.com
Kirtas hat soeben eine weitere Partnerschaft mit der UPenn bekannt gegeben. Es soll eine Digization on demand-Funktion enthalten.
Das Bücher-Angebot auf der Website ist englischsprachig. Es gibt eine (sehr langsame) Search Inside-Möglichkeit, und man kann die Bücher in einem Viewer betrachten, der Download kostet etwas (üblicherweise knapp 2 Dollar). Hat man eine interessante Stelle mit der Suche inside gefunden, darf man aber das ganze Buch durchlesen, da die Suche im Buch selbst anscheinend nicht klappt. Ist alles noch sehr beta, aber besser als gar kein kostenloser Zugang zum Buchinhalt.
Nachtrag: Wenn man sichs genauer anschaut, dann gibt es die beschriebene kostenlose Ansicht nur für einen Teil der Bücher (Classics und Navy-Collection).
Kirtas hat soeben eine weitere Partnerschaft mit der UPenn bekannt gegeben. Es soll eine Digization on demand-Funktion enthalten.
Das Bücher-Angebot auf der Website ist englischsprachig. Es gibt eine (sehr langsame) Search Inside-Möglichkeit, und man kann die Bücher in einem Viewer betrachten, der Download kostet etwas (üblicherweise knapp 2 Dollar). Hat man eine interessante Stelle mit der Suche inside gefunden, darf man aber das ganze Buch durchlesen, da die Suche im Buch selbst anscheinend nicht klappt. Ist alles noch sehr beta, aber besser als gar kein kostenloser Zugang zum Buchinhalt.
Nachtrag: Wenn man sichs genauer anschaut, dann gibt es die beschriebene kostenlose Ansicht nur für einen Teil der Bücher (Classics und Navy-Collection).
KlausGraf - am Donnerstag, 12. Februar 2009, 04:21 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.uni-muenster.de/Staedtegeschichte/Publikationen/Bibliographien/Sammelbesprechung6.shtml
Die Neuen Veröffentlichungen zur vergleichenden historischen Städteforschung 2001-2008 werden erstmals nicht in den Blättern für deutsche Landesgeschichte veröffentlicht, sondern auf der Homepage des IStG. Mit diesem neuen Ort geht eine inhaltliche Neukonzeption einher: Aus organisatorischen Gründen soll von der bisher üblichen detaillierten Besprechung von Einzeltiteln Abstand genommen und stattdessen stärker eine Gesamtbewertung der Forschungsliteratur vorgenommen werden.
Die Neuen Veröffentlichungen zur vergleichenden historischen Städteforschung 2001-2008 werden erstmals nicht in den Blättern für deutsche Landesgeschichte veröffentlicht, sondern auf der Homepage des IStG. Mit diesem neuen Ort geht eine inhaltliche Neukonzeption einher: Aus organisatorischen Gründen soll von der bisher üblichen detaillierten Besprechung von Einzeltiteln Abstand genommen und stattdessen stärker eine Gesamtbewertung der Forschungsliteratur vorgenommen werden.
KlausGraf - am Donnerstag, 12. Februar 2009, 00:48 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 12. Februar 2009, 00:35 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://webilus.com/
Webilus est un blog qui vous propose une sélection des meilleures illustrations et images trouvées sur Internet et ayant pour thème le web en général. A ce jour, Webilus.com vous propose de découvrir 481 images...

Webilus est un blog qui vous propose une sélection des meilleures illustrations et images trouvées sur Internet et ayant pour thème le web en général. A ce jour, Webilus.com vous propose de découvrir 481 images...

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.mercurynews.com/breakingnews/ci_11671723
A rare trove of 11,000 Hebrew books and manuscripts went on display at Sotheby's this week as the auction house seeks to find a buyer for what is considered the greatest collection of Judaica in private hands.
The Valmadonna Trust Library includes documents of unparalleled significance including a copy of a 16th-century Hebrew Bible once owned by Westminster Abbey. Some have burn or water marks or other signs of religious persecution.
"I don't know any other collection quite like it in private hands. It even rivals some of the great institutional collections in the world," Arthur Kiron, curator of Judaica collections at the University of Pennsylvania, said. "There are very few cultural moments like this one where a collection of such great significance is made available for sale."
The complete library, valued at more than $40 million, is being shown in its entirety for the first time at Sotheby's Manhattan galleries until Feb. 19. The trust has asked the auction house to facilitate the sale of the complete collection to a public institution or private collector. It will not break up the collection or sell individuals works.
The Valmadonna Library is the lifelong pursuit of Jack Lunzer, an 88-year-old collector from London who was in New York on Monday for the opening of the exhibition.
Lunzer will not benefit from the proceeds of the sale, which is being handled by the trust, which will also decide whether to accept an offer from a collector or an institution.
But Lunzer has made his wishes known. "I would like our library to be acquired by the Library of Congress," he said. "That would be my great joy."
Sharon Mintz, curator of Jewish art at the Jewish Theological Seminary, which owns the largest public collection of Judaica in the United States, said any institution that acquired the library would immediately be catapulted "to one of the top-tier places of study of Hebrew culture."
See also PR (PDF)
http://www.sothebys.com/liveauctions/event/valmadonnaTrustLibraryBrochure.pdf

Update: See also
http://www.nytimes.com/2009/02/12/books/12hebr.html?pagewanted=1&_r=2
There is also an exquisitely preserved edition of the Babylonian Talmud (1519-23) made by the Christian printer Daniel Bomberg in Venice, an edition created with the advice of a panel of scholars that codified many aspects of how the Talmud is displayed and printed. This set made its way into the collection of Westminster Abbey, where Mr. Lunzer saw it, covered with dust, perhaps untouched for centuries. He ultimately acquired it in a trade, offering a 900-year-old copy of the Abbey’s original Charter.
Update:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601088&sid=a084B5FRM1PY&refer=home
A rare trove of 11,000 Hebrew books and manuscripts went on display at Sotheby's this week as the auction house seeks to find a buyer for what is considered the greatest collection of Judaica in private hands.
The Valmadonna Trust Library includes documents of unparalleled significance including a copy of a 16th-century Hebrew Bible once owned by Westminster Abbey. Some have burn or water marks or other signs of religious persecution.
"I don't know any other collection quite like it in private hands. It even rivals some of the great institutional collections in the world," Arthur Kiron, curator of Judaica collections at the University of Pennsylvania, said. "There are very few cultural moments like this one where a collection of such great significance is made available for sale."
The complete library, valued at more than $40 million, is being shown in its entirety for the first time at Sotheby's Manhattan galleries until Feb. 19. The trust has asked the auction house to facilitate the sale of the complete collection to a public institution or private collector. It will not break up the collection or sell individuals works.
The Valmadonna Library is the lifelong pursuit of Jack Lunzer, an 88-year-old collector from London who was in New York on Monday for the opening of the exhibition.
Lunzer will not benefit from the proceeds of the sale, which is being handled by the trust, which will also decide whether to accept an offer from a collector or an institution.
But Lunzer has made his wishes known. "I would like our library to be acquired by the Library of Congress," he said. "That would be my great joy."
Sharon Mintz, curator of Jewish art at the Jewish Theological Seminary, which owns the largest public collection of Judaica in the United States, said any institution that acquired the library would immediately be catapulted "to one of the top-tier places of study of Hebrew culture."
See also PR (PDF)
http://www.sothebys.com/liveauctions/event/valmadonnaTrustLibraryBrochure.pdf

Update: See also
http://www.nytimes.com/2009/02/12/books/12hebr.html?pagewanted=1&_r=2
There is also an exquisitely preserved edition of the Babylonian Talmud (1519-23) made by the Christian printer Daniel Bomberg in Venice, an edition created with the advice of a panel of scholars that codified many aspects of how the Talmud is displayed and printed. This set made its way into the collection of Westminster Abbey, where Mr. Lunzer saw it, covered with dust, perhaps untouched for centuries. He ultimately acquired it in a trade, offering a 900-year-old copy of the Abbey’s original Charter.
Update:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601088&sid=a084B5FRM1PY&refer=home
KlausGraf - am Donnerstag, 12. Februar 2009, 00:12 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen