http://paperc.de/
http://log.netbib.de/archives/2009/08/27/nochmal-paper-c/
http://article.gmane.org/gmane.culture.libraries.inetbib/14760
Bücher von vorn bis hinten nach einfacher Registrierung einsehen zu dürfen, ist natürlich großartig, vor allem wenn aus dem Bestand von de Gruyter/Niemeyer das Humanismus-Verfasserlexikon im Angebot ist. Texte kopieren und drucken kostet Geld, die ganzen Ebooks sind (noch?) unglaublich billig. Die 674 Seiten des VL kosten nur gut 33 Euro.
Was (noch) nicht klappt:
Die Suchfunktion ist unbrauchbar. Bei Eingabe mehrere Suchbegriffe kann es sein, dass ab dem dritten Treffer im Buch nichts gefunden wird. Es gibt keine erweiterte Suche.
Im Buch funktioniert bei mir die Suche nicht.
Lästig ist das Umblättern, das Laden einer neuen Seite geht wohl bewusst nicht so ganz schnell.
http://log.netbib.de/archives/2009/08/27/nochmal-paper-c/
http://article.gmane.org/gmane.culture.libraries.inetbib/14760
Bücher von vorn bis hinten nach einfacher Registrierung einsehen zu dürfen, ist natürlich großartig, vor allem wenn aus dem Bestand von de Gruyter/Niemeyer das Humanismus-Verfasserlexikon im Angebot ist. Texte kopieren und drucken kostet Geld, die ganzen Ebooks sind (noch?) unglaublich billig. Die 674 Seiten des VL kosten nur gut 33 Euro.
Was (noch) nicht klappt:
Die Suchfunktion ist unbrauchbar. Bei Eingabe mehrere Suchbegriffe kann es sein, dass ab dem dritten Treffer im Buch nichts gefunden wird. Es gibt keine erweiterte Suche.
Im Buch funktioniert bei mir die Suche nicht.
Lästig ist das Umblättern, das Laden einer neuen Seite geht wohl bewusst nicht so ganz schnell.
KlausGraf - am Donnerstag, 27. August 2009, 23:24 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://booksearch.blogspot.com/2009/08/download-over-million-public-domain.html
Zunächst fand ich kein Beispiel (Google nannte in meiner ursprünglichen Quelle typischerweise eine für Deutsche nicht zugängliche Hamlet-Ausgabe), aber hier ist eins:
http://books.google.de/books?id=9f4TAAAAQAAJ
Danke an
http://twitter.com/saschafricke/status/3587604203
Zum Format:
http://de.wikipedia.org/wiki/EPUB
Zunächst fand ich kein Beispiel (Google nannte in meiner ursprünglichen Quelle typischerweise eine für Deutsche nicht zugängliche Hamlet-Ausgabe), aber hier ist eins:
http://books.google.de/books?id=9f4TAAAAQAAJ
Danke an
http://twitter.com/saschafricke/status/3587604203
Zum Format:
http://de.wikipedia.org/wiki/EPUB
KlausGraf - am Donnerstag, 27. August 2009, 23:03
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Unabhängig wie man zu den Restitutionsansprüchen steht: Wenn Kunstgegenstände wieder in Privatschatullen verschwinden und nach kurzer Frist auf Auktionen verstreut werden, dann ist das ein kultureller Verlust, der einzig und allein auf die - rechtlich sanktionierte - Gier der Erben zurückgeht.
Streit mit Kunstammlungen Chemnitz
http://www.lvz-online.de/aktuell/content/109016.html
Kunstsammlungen Dresden müssen 7 Gemälde zurückgeben
http://www.premiumpresse.de/kunstsammlungen-muessen-lehndorff-erben-sieben-gemaelde-zurueckgeben-PR551747.html
Burg Kriebstein muss zurückgeben
http://www.kuvi.de/news/15198_rueckgabe-kunstgegenstaende-lehndorff-erben.html
Grassi-Museum
http://www.news-adhoc.com/grassi-museum-will-moebelstuecke-an-lehndorff-erben-zurueckgeben-idna2009072040822/
Zum Thema Restitution:
http://archiv.twoday.net/search?q=ealg
Streit mit Kunstammlungen Chemnitz
http://www.lvz-online.de/aktuell/content/109016.html
Kunstsammlungen Dresden müssen 7 Gemälde zurückgeben
http://www.premiumpresse.de/kunstsammlungen-muessen-lehndorff-erben-sieben-gemaelde-zurueckgeben-PR551747.html
Burg Kriebstein muss zurückgeben
http://www.kuvi.de/news/15198_rueckgabe-kunstgegenstaende-lehndorff-erben.html
Grassi-Museum
http://www.news-adhoc.com/grassi-museum-will-moebelstuecke-an-lehndorff-erben-zurueckgeben-idna2009072040822/
Zum Thema Restitution:
http://archiv.twoday.net/search?q=ealg
The Open Book Alliance, involving the Internet Archive, industry heavyweights (Yahoo, Amazon, Microsoft), and author, publisher, and library groups, has launched to criticize and oppose the Google Book Search settlement.
http://www.libraryjournal.com/article/CA6685992.html
http://www.openbookalliance.org/
http://twitter.com/oballiance
http://www.heise.de/newsticker/Open-Book-Alliance-gegen-Google-formiert-sich--/meldung/144371 (German)
http://www.libraryjournal.com/article/CA6685992.html
http://www.openbookalliance.org/
http://twitter.com/oballiance
http://www.heise.de/newsticker/Open-Book-Alliance-gegen-Google-formiert-sich--/meldung/144371 (German)
KlausGraf - am Donnerstag, 27. August 2009, 19:32 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://commons.wikimedia.org/wiki/Help:Gadget-ImageAnnotator
Beispiel:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VietnamkriegPersonen1966.jpg
Update: Ich hab es auch einmal ausprobiert:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Columella_stuttgart.jpg

Beispiel:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VietnamkriegPersonen1966.jpg
Update: Ich hab es auch einmal ausprobiert:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Columella_stuttgart.jpg

KlausGraf - am Donnerstag, 27. August 2009, 19:16 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.schloss-herdringen.de/afh.htm
Archiv der Freiherren von Fürstenberg zu Herdringen, hauptamtlich betreut.
 Foto: Michael Jolk, CC
Foto: Michael Jolk, CC
Zu Archiv und Bibliothek:
http://tinyurl.com/ll4v4q (A. Bömer)
http://dtm.bbaw.de/HSA/Herdringen_700359390000.html
http://www.mr1314.de/1059
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herdringen_ems.jpg
Archiv der Freiherren von Fürstenberg zu Herdringen, hauptamtlich betreut.
 Foto: Michael Jolk, CC
Foto: Michael Jolk, CCZu Archiv und Bibliothek:
http://tinyurl.com/ll4v4q (A. Bömer)
http://dtm.bbaw.de/HSA/Herdringen_700359390000.html
http://www.mr1314.de/1059
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herdringen_ems.jpg
KlausGraf - am Donnerstag, 27. August 2009, 18:05 - Rubrik: Herrschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die traditionalistische Piusbruderschaft in Frankreich protestiert gegen Ovids "Ars amandi" (Liebeskunst) als Pflichtlektüre für die Latein-Abschlussklassen. Das vom Erziehungsministerium vorgeschriebene Werk sei einzig darauf ausgerichtet, Ratschläge zu Verführungstechniken zu geben, erklärte der französische Distriktobere Regis de Cacqueray am Mittwoch auf der Webseite der Gemeinschaft. Ovids Text fördere die Vervielfachung der Partner und beschreibe die Nutzung niedrigster und zynischster Methoden, um zum Ziel zu gelangen. De Cacqueray rief dazu auf, mit Schreiben an das Erziehungsministerium gegen die "Anstachelung zu Unmoral und Unzucht" zu protestieren. KNA
http://www.sueddeutsche.de/M5538p/3022769/Piusbrueder-entsetzt-ueber-Ovids-Liebeskunst.html
Im Grunde genommen hat schon Heinrich Lindemann 1861 in seiner Vorrede zur Übersetzung der Liebeskunst alles gesagt:
http://books.google.com/books?id=olwCAAAAQAAJ
Weitere Bände:
http://de.wikisource.org/wiki/Ovid
Die Ausgabe gibt es auch als E-Text bei dem Projekt Gutenberg-DE:
http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=1983&kapitel=3&cHash=a1e5bc1d442#gb_found

Bild via http://bildungcontainern.blogsport.de/
http://www.sueddeutsche.de/M5538p/3022769/Piusbrueder-entsetzt-ueber-Ovids-Liebeskunst.html
Im Grunde genommen hat schon Heinrich Lindemann 1861 in seiner Vorrede zur Übersetzung der Liebeskunst alles gesagt:
http://books.google.com/books?id=olwCAAAAQAAJ
Weitere Bände:
http://de.wikisource.org/wiki/Ovid
Die Ausgabe gibt es auch als E-Text bei dem Projekt Gutenberg-DE:
http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=1983&kapitel=3&cHash=a1e5bc1d442#gb_found

Bild via http://bildungcontainern.blogsport.de/
KlausGraf - am Donnerstag, 27. August 2009, 16:40 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Manchmal ist die Realität komischer als alles, was sich ein Comedy-Autor ausdenken könnte. Im Juli hatte sich Verleger Hubert Burda mit Bezug auf die von zahlreichen Verlagen unterzeichnete Hamburger Erklärung in einem Interview mit dem „Manager Magazin“ sehr kritisch über das Geschäftsmodell von Google geäußert. Das Unternehmen sei derzeit der einzige Sieger im Web-Geschäft und verdiene ein Drittel der Werbeumsätze im Netz - und all das, ohne selbst in teuren Journalismus zu investieren.“
Genau den spart sich die Burda-Tochter Tomorrow Focus bei ihrem neuen Finanzportal Finanzen100 dann auch gleich. Denn statt teurem Journalismus bedient man sich genau der Technik, die Verleger Burda an Google kritisiert: Ein erstes Kernangebot des werbefinanzierten Portals Finanzen100, einem Joint Venture von Tomorrow Focus und OnVista-Gründer Stephan Schubert, ist ein News-Aggregator, der Informationen aus über 12.500 Quellen aufbereitet. Mit anderen Worten: Man will Geld verdienen mit den Inhalten anderer.
Weiterlesen:
http://www.dwdl.de/story/22344/finanzen100_was_google_kann_knnen_wir_schon_lange/
Genau den spart sich die Burda-Tochter Tomorrow Focus bei ihrem neuen Finanzportal Finanzen100 dann auch gleich. Denn statt teurem Journalismus bedient man sich genau der Technik, die Verleger Burda an Google kritisiert: Ein erstes Kernangebot des werbefinanzierten Portals Finanzen100, einem Joint Venture von Tomorrow Focus und OnVista-Gründer Stephan Schubert, ist ein News-Aggregator, der Informationen aus über 12.500 Quellen aufbereitet. Mit anderen Worten: Man will Geld verdienen mit den Inhalten anderer.
Weiterlesen:
http://www.dwdl.de/story/22344/finanzen100_was_google_kann_knnen_wir_schon_lange/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 27. August 2009, 14:56 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 27. August 2009, 14:45 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus der Liste diskus:
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in der Amploniana befindet sich eine Gruppe gleichartiger Einbände, die wohl im ersten Viertel des 15. Jhs. im Großraum Mainz (eventuell auch in Mainz selbst) gebunden wurden. Es handelt sich um Halbbände aus Schweinsleder, mit signifikanter roter Lederbordüre als Abschluss und (neben anderen) einem sehr auffälligen S-Stempel im Quadrat mit einer Art Perlbordüre.
In den einschlägigen Repertorien finde ich diese Werkstatt bisher nicht. Daher habe ich die signifikantesten Stempel dieser Einbandgruppe (S, Löwe oder Panther (2 Bilder der Deutlichkeit halber), Adler) nun auf unsere Homepage hochgeladen
http://www.uni-erfurt.de/amploniana/bilderschauen/bilderoffline/
und bitte Sie, vielleicht einmal einen Blick darauf zu werfen. - Möglicherweise sind gleichartige Einbände ja noch in anderen Sammlungen erhalten.
Der S-Stempel ist offenbar 'Leitstempel', da er nur auf dem Einband einer Oktavhandschrift fehlt. - Dieser Stempel bzw. ein sehr ähnlicher war wohl auch noch am Ende des 15. Jhs. im Gebrauch. Doch stimmen die begleitenden Stempel hier ebensowenig mit denen meiner Gruppe überein wie der Einband insgesamt, der in diesem Fall komplett mit dunkelbraunem Rindleder bezogen ist.
Danke und Grüße
Brigitte Pfeil
--
Dr. Brigitte Pfeil
___________________________________________________
Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha
Universitätsbibliothek
Sondersammlung
DFG-Projekt 'Erschließung der Codices Amploniani'
&
Forschungsprojekt 'Amploniana' der Katholisch-
Theologischen Fakultät
Nordhäuser Straße 63
D-99089 Erfurt
Tel: +49 (0)361 737-5884 /-5880: Lesesaal
Fax: +49 (0)361 737-5779
Mail: brigitte.pfeil@uni-erfurt.de
Web: http://www.uni-erfurt.de/amploniana

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in der Amploniana befindet sich eine Gruppe gleichartiger Einbände, die wohl im ersten Viertel des 15. Jhs. im Großraum Mainz (eventuell auch in Mainz selbst) gebunden wurden. Es handelt sich um Halbbände aus Schweinsleder, mit signifikanter roter Lederbordüre als Abschluss und (neben anderen) einem sehr auffälligen S-Stempel im Quadrat mit einer Art Perlbordüre.
In den einschlägigen Repertorien finde ich diese Werkstatt bisher nicht. Daher habe ich die signifikantesten Stempel dieser Einbandgruppe (S, Löwe oder Panther (2 Bilder der Deutlichkeit halber), Adler) nun auf unsere Homepage hochgeladen
http://www.uni-erfurt.de/amploniana/bilderschauen/bilderoffline/
und bitte Sie, vielleicht einmal einen Blick darauf zu werfen. - Möglicherweise sind gleichartige Einbände ja noch in anderen Sammlungen erhalten.
Der S-Stempel ist offenbar 'Leitstempel', da er nur auf dem Einband einer Oktavhandschrift fehlt. - Dieser Stempel bzw. ein sehr ähnlicher war wohl auch noch am Ende des 15. Jhs. im Gebrauch. Doch stimmen die begleitenden Stempel hier ebensowenig mit denen meiner Gruppe überein wie der Einband insgesamt, der in diesem Fall komplett mit dunkelbraunem Rindleder bezogen ist.
Danke und Grüße
Brigitte Pfeil
--
Dr. Brigitte Pfeil
___________________________________________________
Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha
Universitätsbibliothek
Sondersammlung
DFG-Projekt 'Erschließung der Codices Amploniani'
&
Forschungsprojekt 'Amploniana' der Katholisch-
Theologischen Fakultät
Nordhäuser Straße 63
D-99089 Erfurt
Tel: +49 (0)361 737-5884 /-5880: Lesesaal
Fax: +49 (0)361 737-5779
Mail: brigitte.pfeil@uni-erfurt.de
Web: http://www.uni-erfurt.de/amploniana

KlausGraf - am Donnerstag, 27. August 2009, 14:37 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.vzbv.de/mediapics/google_lg_hamburg_07_08_2009.pdf
http://www.vzbv.de/go/presse/1199/index.html?ref_presseinfo=true
Das Urteil des LG Hamburg ist noch nicht rechtskräftig.
http://www.vzbv.de/go/presse/1199/index.html?ref_presseinfo=true
Das Urteil des LG Hamburg ist noch nicht rechtskräftig.
KlausGraf - am Donnerstag, 27. August 2009, 14:32 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
The ARSC Journal is a semi-annual, peer-reviewed publication that serves to document the history of recorded sound and includes original articles on many aspects of research and preservation. Back issues of the Journal are available -- free of charge -- as full-text PDFs.
Over 5,000 scanned pages contained in the first 25 volumes (1967 through 1994) can be accessed at:
http://www.arsc-audio.org/journal.html
Over 5,000 scanned pages contained in the first 25 volumes (1967 through 1994) can be accessed at:
http://www.arsc-audio.org/journal.html
KlausGraf - am Donnerstag, 27. August 2009, 13:40 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Da es vielleicht nicht allgemein bekannt ist, wie man am besten auf Kurztitelaufnahmen (Ausgaben), Exemplarnachweise und Suchergebnisse in INKA, dem von der UB Tübingen betreuten Inkunabelkatalog deutscher Bibliotheken verlinken kann und die Tübinger Hilfsseiten dazu keine Hinweise enthalten, stelle ich ein paar Infos aus eigener Recherche hier zusammen.
Für Korrekturen oder Ergänzungen bin ich dankbar. Etwaige Irrtümer bitte ich mir nachzusehen, ich bin kein Spezialist für's Alte Buch ...
Beispiel:
Wir suchen Exemplare von Sebastian Brants Narrenschiff in Ausgabe(n) von 1494.
Verlinkung von Suchergebnissen:
Aufgrund der Frametechnik der Startseite wird die Anfrage in der URL nicht direkt sichtbar. Im Kopf bzw. Fuß der Antwortseite findet man aber neben einem Link "Neue Suche" einen Link "Zum Seitenende", am Fuß der Seite einen Link "Zum Seitenanfang":
Zum Seitenende | Neue Suche
...
Zum Seitenanfang | Neue Suche
Die zugehörige Linkadresse kann man über das Kontextmenu (rechte Maustaste) kopieren, den lokalen Anker #ende entfernt man, fertig ist der Link.
Alternativ kann man auch die Suche direkt über die URL
INKA Suchmaske ohne Frame
http://www.inka.uni-tuebingen.de/inkamaske.php
anstoßen und findet die URLs dann direkt in der Browserzeile.
In der URL sind die Felder der Suchmaske und die benutzten Suchtermini als Parameter kodiert (vgl. hierzu auch die ausführlichen Hinweise zur Benutzung auf der INKA Homepage):
Verlinkung von Ausgaben:
... über den Bibliographischen Nachweis, d.h. die Nummer in einer Inkunabelbibliographie (Feld snachweis mit snaw, Voreinstellung GW), z.B. für GW 5041
http://www.inka.uni-tuebingen.de/cgi-bin/inkunabel?status=Suchen&naw=GW&snachweis=5041
Mit der Ausgabe werden alle in INKA gefundenen Exemplare angezeigt.
Achtung: Bitte auf keinen Fall die interne Datensatznummer in INKA (zsnum bzw. zsnumalt) verwenden, die im Datensatz als hidden variable mitgeführt wird. Diese kann sich mit jeder Aktualisierung ändern. Beispiel:
http://www.google.de/search?q="INKA+Recherche-Ergebnis"+site%3Auni-tuebingen.de
Die für jeden Treffer über die Anzeige des Seitenquelltextes zu findenden Nummern zsnumalt sind aktuell z.B. für den zweiten Treffer Aesopus: Vita et Fabulae . Übers.: Heinrich Steinhöwel. ... gerade um 1 kleiner als noch im Google Cache.
Verwendet man diese Nummern, erzeugt man potentielle broken links oder falsche Treffer.
Verlinkung von Exemplaren einer bestimmten Bibliothek:
... nötigenfalls durch Einschränkung auf die Bibliothek, z.B. die SLUB Dresden:
(Alle Dresdner Exemplare von Sebastian Brants Narrenschiff, alle Ausgaben)
http://www.inka.uni-tuebingen.de/cgi-bin/inkunabel?status=Suchen&sbibliothek=DRE&form=voll&stitel=narrenschiff&sperson=brant
oder auf ein spezifisches Exemplar einer Bibliothek unter Hinzufügen der Katalognummer, z.B. für die BSB München : Nr. B-816
http://www.inka.uni-tuebingen.de/cgi-bin/inkunabel?status=Suchen&sbibliothek=MUN&snummer="B-816"&naw=GW&snachweis=5041
Anm.: Leider gibt es keine direkte Möglichkeit, von der Anzeige einzelner Exemplare zu einer Ausgabe (die immer mit angezeigt wird) wieder zur Anzeige der Ausgabe mit allen erfassten Exemplaren zu gelangen. Hilfreich wäre dazu eine automatische Auszeichnung der angezeigten Bibliographischen Nachweise (GW-Nummern etc.) als "Hotlinks".
In der Ergebnisanzeige von INKA erscheint i.d.R. der Name der Bibliothek und dahinter die laufende Nr. im Katalog der Bibliothek, angebundene Exemplare werden ebenfalls aufgeführt. Die Nummern sind in der Ergebnisanzeige anklickbar und führen zum entsprechenden Titel. Da sich die meisten Kataloge noch in Bearbeitung befinden, verändern sich diese Nummern häufig und sind deshalb i.d.R. nicht zitierfähig (handelt es sich um eine Interimsnummer, ist ein entsprechender Hinweis ( Interimsnr. - Stand: ... ) aufgeführt; falls nicht, sind sie als stabil und zitierfähig zu betrachten), siehe das erste Beispiel oben.
Daher ist eine Verlinkung alleine über Bibliothek und Katalognummer generell nicht zu empfehlen, eine Verlinkung über GW-Nummern etc. ist vorzuziehen, auch schon wg. des nützlichen Kontextes der gesamten in INKA erfassten Überlieferungslage (an anderen Bibliotheken nachgewiesene Ex.)
Trotzdem kann es gelegentlich praktisch sein, zu Demonstrationszwecken mehrere Katalognummern einer Bibliothek zusammen anzeigen zu lassen (und so auch zu verlinken), die normalerweise in einer Trefferliste nicht zusammen auftauchen, z.B.
http://www.inka.uni-tuebingen.de/cgi-bin/inkunabel?status=Suchen&sbibliothek=TUB&form=voll&snummer=80+135
Im ZKBW-Dialog 49 vom 12.06.2006 wurde über eine Kooperation zwischen der UB Tübingen und dem Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg berichtet:
Der Inkunabel-Katalog deutscher Bibliotheken (INKA) / Ulrike Mehringer; Armin Schlechter. In: BIT online. - Jg. 5. 2002, H. 1, S. 41-44.
http://www.b-i-t-online.de/archiv/2002-01/nach1.htm [backup: Google Cache]
Die Inkunabeln der UB Heidelberg im Inkunabelkatalog deutscher Bibliotheken (INKA) / Armin Schlechter, in: Theke. Informationsblatt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bibliothekssystem der Universität Heidelberg (2001), S. 37-40
http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/3109/
Die Erschließung der baden-württembergischen Inkunabeln / Armin Schlechter, in: Theke. Informationsblatt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bibliothekssystem der Universität Heidelberg (1999), S. 44-50.
http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/3111/
Instruktive Beispiele, auch aus INKA ...
Nachweis von Inkunabeln in der Badischen Landesbibliothek:
http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/handschriften/inkunabeln.html
Ebenso, erschienen zur Weimarer Inkunabelausstellung von 2007/08, "Welt der Wiegendrucke - die ersten gedruckten Bücher der Herzogin Anna Amalia Bibliothek":
Wie wird eine Inkunabel in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek katalogisiert? / Eva Raffel, darin S. 12-14: Inkunabelkatalog deutscher Bibliotheken (INKA).
http://www.klassik-stiftung.de/fileadmin/downloads/haab/Website_Inkunabelausstellung_7.pdf
(Technische Dokumentation, sehr speziell. Hinweise für die Bearbeiter von Inkunabelkatalogen, die mit der TUSTEP-Anwendung INKA arbeiten)
Das Tübinger Inkunabelprogramm (INKA) - Datenformat und Datenverarbeitung. / Friedrich Seck; Ewa Dubowik-Belka. Stand: 19.12.2007 (Aktuelle Version und Link siehe INKA homepage, http://www.inka.uni-tuebingen.de/)
Update 19.11.: INKA verlinkt jetzt auf diese Anleitung (unter Beschreibung und Benutzungshinweise).
Für Korrekturen oder Ergänzungen bin ich dankbar. Etwaige Irrtümer bitte ich mir nachzusehen, ich bin kein Spezialist für's Alte Buch ...
Beispiel:
Wir suchen Exemplare von Sebastian Brants Narrenschiff in Ausgabe(n) von 1494.
Verlinkung von Suchergebnissen:
Aufgrund der Frametechnik der Startseite wird die Anfrage in der URL nicht direkt sichtbar. Im Kopf bzw. Fuß der Antwortseite findet man aber neben einem Link "Neue Suche" einen Link "Zum Seitenende", am Fuß der Seite einen Link "Zum Seitenanfang":
Zum Seitenende | Neue Suche
...
Zum Seitenanfang | Neue Suche
Die zugehörige Linkadresse kann man über das Kontextmenu (rechte Maustaste) kopieren, den lokalen Anker #ende entfernt man, fertig ist der Link.
Alternativ kann man auch die Suche direkt über die URL
INKA Suchmaske ohne Frame
http://www.inka.uni-tuebingen.de/inkamaske.php
anstoßen und findet die URLs dann direkt in der Browserzeile.
In der URL sind die Felder der Suchmaske und die benutzten Suchtermini als Parameter kodiert (vgl. hierzu auch die ausführlichen Hinweise zur Benutzung auf der INKA Homepage):
/cgi-bin/inkunabel?(Die Reihenfolge der Parameter spielt keine Rolle. Bei der Übernahme der URL kann man nicht benötigte unbesetzte Parameter auch weglassen.)
status=Suchen
&sbibliothek=alle ... (Bibliotheken)
&form=voll ... (Ausgabeformat)
&stitel=narrenschiff ... (Titel)
&sperson=brant%2C+sebastian ... (Person)
&stkz=jede ... (Typenkennzeichen, Funktion einer Person)
&sort= ... (Druckort)
&sbubi= ... (Buchbinder)
&sdrucker= ... (Drucker, Verleger)
&sprovenienz= ... (Provenienz)
&sjahr=1494 ... (Jahr)
&ssignatur= ... (Signatur)
&snachweis= ... (Bibliographien): Nummer
&naw= ... und zugehörige Inkunabelbibliographie
&skyriss= ... Kyriss, Haebler (Einbände)
&snummer= ... (Katalognr.)
&searchs= ... (Freitextsuche)
&digi= ... (Einschränkung auf Ex. mit Digitalisaten)
Verlinkung von Ausgaben:
... über den Bibliographischen Nachweis, d.h. die Nummer in einer Inkunabelbibliographie (Feld snachweis mit snaw, Voreinstellung GW), z.B. für GW 5041
http://www.inka.uni-tuebingen.de/cgi-bin/inkunabel?status=Suchen&naw=GW&snachweis=5041
Mit der Ausgabe werden alle in INKA gefundenen Exemplare angezeigt.
Achtung: Bitte auf keinen Fall die interne Datensatznummer in INKA (zsnum bzw. zsnumalt) verwenden, die im Datensatz als hidden variable mitgeführt wird. Diese kann sich mit jeder Aktualisierung ändern. Beispiel:
http://www.google.de/search?q="INKA+Recherche-Ergebnis"+site%3Auni-tuebingen.de
Die für jeden Treffer über die Anzeige des Seitenquelltextes zu findenden Nummern zsnumalt sind aktuell z.B. für den zweiten Treffer Aesopus: Vita et Fabulae . Übers.: Heinrich Steinhöwel. ... gerade um 1 kleiner als noch im Google Cache.
Verwendet man diese Nummern, erzeugt man potentielle broken links oder falsche Treffer.
Verlinkung von Exemplaren einer bestimmten Bibliothek:
... nötigenfalls durch Einschränkung auf die Bibliothek, z.B. die SLUB Dresden:
(Alle Dresdner Exemplare von Sebastian Brants Narrenschiff, alle Ausgaben)
http://www.inka.uni-tuebingen.de/cgi-bin/inkunabel?status=Suchen&sbibliothek=DRE&form=voll&stitel=narrenschiff&sperson=brant
oder auf ein spezifisches Exemplar einer Bibliothek unter Hinzufügen der Katalognummer, z.B. für die BSB München : Nr. B-816
http://www.inka.uni-tuebingen.de/cgi-bin/inkunabel?status=Suchen&sbibliothek=MUN&snummer="B-816"&naw=GW&snachweis=5041
Anm.: Leider gibt es keine direkte Möglichkeit, von der Anzeige einzelner Exemplare zu einer Ausgabe (die immer mit angezeigt wird) wieder zur Anzeige der Ausgabe mit allen erfassten Exemplaren zu gelangen. Hilfreich wäre dazu eine automatische Auszeichnung der angezeigten Bibliographischen Nachweise (GW-Nummern etc.) als "Hotlinks".
In der Ergebnisanzeige von INKA erscheint i.d.R. der Name der Bibliothek und dahinter die laufende Nr. im Katalog der Bibliothek, angebundene Exemplare werden ebenfalls aufgeführt. Die Nummern sind in der Ergebnisanzeige anklickbar und führen zum entsprechenden Titel. Da sich die meisten Kataloge noch in Bearbeitung befinden, verändern sich diese Nummern häufig und sind deshalb i.d.R. nicht zitierfähig (handelt es sich um eine Interimsnummer, ist ein entsprechender Hinweis ( Interimsnr. - Stand: ... ) aufgeführt; falls nicht, sind sie als stabil und zitierfähig zu betrachten), siehe das erste Beispiel oben.
Daher ist eine Verlinkung alleine über Bibliothek und Katalognummer generell nicht zu empfehlen, eine Verlinkung über GW-Nummern etc. ist vorzuziehen, auch schon wg. des nützlichen Kontextes der gesamten in INKA erfassten Überlieferungslage (an anderen Bibliotheken nachgewiesene Ex.)
Trotzdem kann es gelegentlich praktisch sein, zu Demonstrationszwecken mehrere Katalognummern einer Bibliothek zusammen anzeigen zu lassen (und so auch zu verlinken), die normalerweise in einer Trefferliste nicht zusammen auftauchen, z.B.
http://www.inka.uni-tuebingen.de/cgi-bin/inkunabel?status=Suchen&sbibliothek=TUB&form=voll&snummer=80+135
Im ZKBW-Dialog 49 vom 12.06.2006 wurde über eine Kooperation zwischen der UB Tübingen und dem Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg berichtet:
Die in INKA nachgewiesenen Inkunabeln von Bibliotheken aus der SWB-Region sollen künftig auch in der Datenbank des SWB nachgewiesen werden. Dazu werden die INKA-Daten mit verkürzten Exemplarinformationen in die SWB-Datenbank eingespielt. In den Daten wird eine URL ergänzt, die zu der ausführlichen Exemplarbeschreibung in INKA führt.Beispiel: Inkunabeln aus der Historischen Bibliothek Rastatt (Ludwig-Wilhelm-Gymnasium) im SWB (mit Verlinkung über GW-Nummern, ohne Einschränkung auf eine bestimmte Bibliothek)
http://is.gd/2Bftw (ShortLink SWB-Suche nach Sigel Ras 1, EJ -1500)Literatur:
Der Inkunabel-Katalog deutscher Bibliotheken (INKA) / Ulrike Mehringer; Armin Schlechter. In: BIT online. - Jg. 5. 2002, H. 1, S. 41-44.
http://www.b-i-t-online.de/archiv/2002-01/nach1.htm [backup: Google Cache]
Die Inkunabeln der UB Heidelberg im Inkunabelkatalog deutscher Bibliotheken (INKA) / Armin Schlechter, in: Theke. Informationsblatt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bibliothekssystem der Universität Heidelberg (2001), S. 37-40
http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/3109/
Die Erschließung der baden-württembergischen Inkunabeln / Armin Schlechter, in: Theke. Informationsblatt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bibliothekssystem der Universität Heidelberg (1999), S. 44-50.
http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/3111/
Instruktive Beispiele, auch aus INKA ...
Nachweis von Inkunabeln in der Badischen Landesbibliothek:
http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/handschriften/inkunabeln.html
Ebenso, erschienen zur Weimarer Inkunabelausstellung von 2007/08, "Welt der Wiegendrucke - die ersten gedruckten Bücher der Herzogin Anna Amalia Bibliothek":
Wie wird eine Inkunabel in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek katalogisiert? / Eva Raffel, darin S. 12-14: Inkunabelkatalog deutscher Bibliotheken (INKA).
http://www.klassik-stiftung.de/fileadmin/downloads/haab/Website_Inkunabelausstellung_7.pdf
(Technische Dokumentation, sehr speziell. Hinweise für die Bearbeiter von Inkunabelkatalogen, die mit der TUSTEP-Anwendung INKA arbeiten)
Das Tübinger Inkunabelprogramm (INKA) - Datenformat und Datenverarbeitung. / Friedrich Seck; Ewa Dubowik-Belka. Stand: 19.12.2007 (Aktuelle Version und Link siehe INKA homepage, http://www.inka.uni-tuebingen.de/)
Update 19.11.: INKA verlinkt jetzt auf diese Anleitung (unter Beschreibung und Benutzungshinweise).
BCK - am Donnerstag, 27. August 2009, 11:40 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Die Kölner WDR-Lokalzeit berichtete gestern einminütig.
Link zur 7-Tage Rückschau
Link zur 7-Tage Rückschau
Wolf Thomas - am Donnerstag, 27. August 2009, 11:02 - Rubrik: Kommunalarchive
Das Adresscomptoir verweist auf das interessante Ö1-Radiokolleg:
"Einst sprach man vom Speichern nur im Zusammenhang mit Vorratskammern: Es gibt den Museumsspeicher und die Speicherkammer.
Heute hingegen lagert man bits und bytes ein. Aber nicht notgedrungen um sich zu erinnern oder karge Zeiten zu überwinden, sondern um beruhigt zu vergessen. Digitale Fotos werden zwar zuhauf geschossen, aber genauso schnell und gern wieder vergessen. Und als letzte Instanz gibt es noch immer den Festplatten-Crash und veraltete Datenträger.
Seitdem Rechner mit reichlich Speicherkapazitäten ausgestattet werden, sorgen sich manche um die menschliche Ressource Aufmerksamkeit. Sie sei, im Gegensatz zum digitalen Speicher, nicht endlos erweiterbar. Mit der Frage, wie viel das menschliche Gehirn an Informationen speichern kann, beschäftigten sich Computerwissenschafter schon in den 1950er Jahren. Ihre Antworten führten gleichermaßen zu Missverständnissen wie zu erstaunlichen Ergebnissen.
Weitere Informationen:
Buch-Tipps
Horst Völz: Wissen, "Erkennen, Information. Datensepicher von der Steinzeit bis in das 21. Jahrhundert", Digitale Bibliothek 159, Directmedia Publishing GmbH, Berlin 2007.
Michael Buckland, "Emanuel Goldberg and His Knowledge Machine. Information, Invention, and Political Forces", Libraries Unlimited, 2006.
Heinz von Foerster, "Memory and Inductive Inference", BCL 152, Bionic Symposium, 1966
Link: http://www.theatlantic.com/doc/194507/bush"
Quelle:
Link zur Ö!-Ankündigung
"Einst sprach man vom Speichern nur im Zusammenhang mit Vorratskammern: Es gibt den Museumsspeicher und die Speicherkammer.
Heute hingegen lagert man bits und bytes ein. Aber nicht notgedrungen um sich zu erinnern oder karge Zeiten zu überwinden, sondern um beruhigt zu vergessen. Digitale Fotos werden zwar zuhauf geschossen, aber genauso schnell und gern wieder vergessen. Und als letzte Instanz gibt es noch immer den Festplatten-Crash und veraltete Datenträger.
Seitdem Rechner mit reichlich Speicherkapazitäten ausgestattet werden, sorgen sich manche um die menschliche Ressource Aufmerksamkeit. Sie sei, im Gegensatz zum digitalen Speicher, nicht endlos erweiterbar. Mit der Frage, wie viel das menschliche Gehirn an Informationen speichern kann, beschäftigten sich Computerwissenschafter schon in den 1950er Jahren. Ihre Antworten führten gleichermaßen zu Missverständnissen wie zu erstaunlichen Ergebnissen.
Weitere Informationen:
Buch-Tipps
Horst Völz: Wissen, "Erkennen, Information. Datensepicher von der Steinzeit bis in das 21. Jahrhundert", Digitale Bibliothek 159, Directmedia Publishing GmbH, Berlin 2007.
Michael Buckland, "Emanuel Goldberg and His Knowledge Machine. Information, Invention, and Political Forces", Libraries Unlimited, 2006.
Heinz von Foerster, "Memory and Inductive Inference", BCL 152, Bionic Symposium, 1966
Link: http://www.theatlantic.com/doc/194507/bush"
Quelle:
Link zur Ö!-Ankündigung
Wolf Thomas - am Donnerstag, 27. August 2009, 10:11 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Internet, das Internet. Viele Zeitungsleute reden darüber wie von einem neuen Hunneneinfall. Die Hunnen kamen vor 1500 Jahren aus dem Nichts, schlugen alles kurz und klein (und verschwanden 100 Jahre später wieder). Das Internet schlägt gar nichts kurz und klein.
Heribert Prantl
http://www.blaetter.de/artikel.php?pr=3148
 Attila, Bild: Delacroix
Attila, Bild: Delacroix
Heribert Prantl
http://www.blaetter.de/artikel.php?pr=3148
 Attila, Bild: Delacroix
Attila, Bild: Delacroixnoch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/R/?func=collections-result&collection_id=1411
55 Ritterbücher, darunter ein deutscher Druck aus dem 16. Jahrhundert.

55 Ritterbücher, darunter ein deutscher Druck aus dem 16. Jahrhundert.

KlausGraf - am Mittwoch, 26. August 2009, 19:35 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
The New Opportunities Fund invested millions of pounds into a programme to Digitise the nation's Cultural Heritage. It created tens of thousands of interesting and useful digital images, learning resources and other material, which are now at risk of loss as the resources are not being promoted and the public have no idea they're there to use.
http://archives20.ning.com/profiles/blogs/petition-to-save-digitised
http://archives20.ning.com/profiles/blogs/petition-to-save-digitised
KlausGraf - am Mittwoch, 26. August 2009, 15:29 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.jur-blog.de/grundlagen/rechtsanwalt/2009-08/widerspruch-herr-verfassungsrichter-im-internet-wird-one-man-one-vote-verwirklicht/
http://www.internet-law.de/2009/08/verfassungsrichter-di-fabio-sieht-durch.html
http://www.sueddeutsche.de/kultur/960/485387/text/
Zitat aus der Rede (laut SZ):
"Wer schreibt für Wikipedia? Warum zeigt sich das Gesicht der Kommunikationsteilnehmer nicht offen im Netz - ist die mittelalterlich anmutende Burka im Straßenbild auch europäischer Städte denn wirklich so weit entfernt von den hypermodischen Twittern und Newsbotstern?"
Nun, meines Wissens steht unter Urteilen des Bundesverfassungsgerichts auch nicht der Name des Berichterstatters, der das Urteil geschrieben hat.
Und abgesehen davon, dass sehr viele Wikipedianer mit Klarnamen agieren, stehen auch anonyme Beiträge unter dem Schutz der Grundrechte.
Weiß jemand, was Newsbotstern sind?
Update:
Im Redetext Newsbotsern:
In den Potentialen des globalen Netzes könnte auf nicht allzu ferne Sicht der technische Überschlag weg vom modernen Zeitalter schlummern. War es nicht die große Leistung der frühen Neuzeit, aus der Anonymität der sozialreligiösen, der ständisch-familialen Netzwerke die Person, das Individuum erstehen zu lassen, als Heros, als Subjekt, als Genius, als Rechtsperson? Warum kennen wir Namen wie Dante, Michelangelo, Descartes oder Rubens, und warum kennen wir kaum je die Namen der Architekten gotischer Kathedralen des Mittelalters?
Aber wie ist es heute? Wer schreibt für Wikipedia, das jeder Schüler als digitales Lexikon ohne zu zögern konsultiert? Warum zeigt sich das Gesicht der Kommunikationsteilnehmer nicht offen im Netz - ist die mittelalterlich anmutende Burka im Straßenbild auch europäischer Städte denn wirklich so weit entfernt von den hypermodischen Twittern und „Newsbotsern“? Der freie Mensch der Neuzeit zeigt sein Gesicht, gibt seinen Namen preis, wenn er die Bühne des öffentlichen Raumes betritt.
Die Zeitung ist objektiv unentbehrlich, und die Bürger wissen das
Wer anonyme Netzwerke als Wissens- und Meinungsproduzenten vorbehaltlos akzeptiert, wird auch schnell den Sinn für Urheberrechte des Schriftstellers oder des Künstlers verlieren, genauso rasch wie deren Kunstfertigkeit ein Muster ohne Wert wird. Wo alles auf Klick verfügbar scheint, entsteht eine Kultur der solipsistischen Verfügbarkeit, die selbst den gefährlichen Anspruch der Demokratie, die Lebensverhältnisse der Bürger vollständig gestalten zu können, wenn nicht überbietet, so doch nachdrücklich stärkt. Nicht mehr die Bürger, die mit ihrer Arbeit, ihrem gebildeten Verstand das Publikum als eigentliches Subjekt der öffentlichen Meinung bilden, sondern der ununterbrochene Strom eines Konglomerats aus Kommerz und Emotion, aus Information und Unsinn, aus gesteuerter Ordnung und wildem Zufall wird zum Herrschaftssubjekt, tauscht die neuen Ideale der Direktheit, des unmittelbaren Effekts, auch der totalen Gleichheit des Zugangs gegen den Anspruch, die Welt nach Menschenmaß in einem diskursiven Prozess, mit Mehrheit in einem förmlichen Verfahren demokratisch zu gestalten.
http://www.solinger-tageblatt.de/Home/Solingen/Di-Fabio-Ansprache-Teil-2-Leuchtturm-im-offenen-Meer-der-Information--d5fa8ae7-d87c-4475-bb55-9a34d5eb34e9-ds
Update:
http://blog.handelsblatt.de/indiskretion/eintrag.php?id=2193
 Burka
Burka
http://www.internet-law.de/2009/08/verfassungsrichter-di-fabio-sieht-durch.html
http://www.sueddeutsche.de/kultur/960/485387/text/
Zitat aus der Rede (laut SZ):
"Wer schreibt für Wikipedia? Warum zeigt sich das Gesicht der Kommunikationsteilnehmer nicht offen im Netz - ist die mittelalterlich anmutende Burka im Straßenbild auch europäischer Städte denn wirklich so weit entfernt von den hypermodischen Twittern und Newsbotstern?"
Nun, meines Wissens steht unter Urteilen des Bundesverfassungsgerichts auch nicht der Name des Berichterstatters, der das Urteil geschrieben hat.
Und abgesehen davon, dass sehr viele Wikipedianer mit Klarnamen agieren, stehen auch anonyme Beiträge unter dem Schutz der Grundrechte.
Weiß jemand, was Newsbotstern sind?
Update:
Im Redetext Newsbotsern:
In den Potentialen des globalen Netzes könnte auf nicht allzu ferne Sicht der technische Überschlag weg vom modernen Zeitalter schlummern. War es nicht die große Leistung der frühen Neuzeit, aus der Anonymität der sozialreligiösen, der ständisch-familialen Netzwerke die Person, das Individuum erstehen zu lassen, als Heros, als Subjekt, als Genius, als Rechtsperson? Warum kennen wir Namen wie Dante, Michelangelo, Descartes oder Rubens, und warum kennen wir kaum je die Namen der Architekten gotischer Kathedralen des Mittelalters?
Aber wie ist es heute? Wer schreibt für Wikipedia, das jeder Schüler als digitales Lexikon ohne zu zögern konsultiert? Warum zeigt sich das Gesicht der Kommunikationsteilnehmer nicht offen im Netz - ist die mittelalterlich anmutende Burka im Straßenbild auch europäischer Städte denn wirklich so weit entfernt von den hypermodischen Twittern und „Newsbotsern“? Der freie Mensch der Neuzeit zeigt sein Gesicht, gibt seinen Namen preis, wenn er die Bühne des öffentlichen Raumes betritt.
Die Zeitung ist objektiv unentbehrlich, und die Bürger wissen das
Wer anonyme Netzwerke als Wissens- und Meinungsproduzenten vorbehaltlos akzeptiert, wird auch schnell den Sinn für Urheberrechte des Schriftstellers oder des Künstlers verlieren, genauso rasch wie deren Kunstfertigkeit ein Muster ohne Wert wird. Wo alles auf Klick verfügbar scheint, entsteht eine Kultur der solipsistischen Verfügbarkeit, die selbst den gefährlichen Anspruch der Demokratie, die Lebensverhältnisse der Bürger vollständig gestalten zu können, wenn nicht überbietet, so doch nachdrücklich stärkt. Nicht mehr die Bürger, die mit ihrer Arbeit, ihrem gebildeten Verstand das Publikum als eigentliches Subjekt der öffentlichen Meinung bilden, sondern der ununterbrochene Strom eines Konglomerats aus Kommerz und Emotion, aus Information und Unsinn, aus gesteuerter Ordnung und wildem Zufall wird zum Herrschaftssubjekt, tauscht die neuen Ideale der Direktheit, des unmittelbaren Effekts, auch der totalen Gleichheit des Zugangs gegen den Anspruch, die Welt nach Menschenmaß in einem diskursiven Prozess, mit Mehrheit in einem förmlichen Verfahren demokratisch zu gestalten.
http://www.solinger-tageblatt.de/Home/Solingen/Di-Fabio-Ansprache-Teil-2-Leuchtturm-im-offenen-Meer-der-Information--d5fa8ae7-d87c-4475-bb55-9a34d5eb34e9-ds
Update:
http://blog.handelsblatt.de/indiskretion/eintrag.php?id=2193
 Burka
Burkahttp://blog.bildungsserver.de/?p=269
"Nachdem vor rund 6 Monaten die ersten Verlagstexte auf peDOCS kostenfrei für die Allgemeinheit publiziert wurden, sind teilweise befürchtete negative Auswirkungen auf die Verkäufe der parallel im Print-Format kostenpflichtig angebotenen Texte nicht eingetreten."
Siehe dazu auch:
http://delicious.com/Klausgraf/monograph_open_access
"Nachdem vor rund 6 Monaten die ersten Verlagstexte auf peDOCS kostenfrei für die Allgemeinheit publiziert wurden, sind teilweise befürchtete negative Auswirkungen auf die Verkäufe der parallel im Print-Format kostenpflichtig angebotenen Texte nicht eingetreten."
Siehe dazu auch:
http://delicious.com/Klausgraf/monograph_open_access
KlausGraf - am Mittwoch, 26. August 2009, 14:34 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Pressemitteilung der Bürgerinitiative "Köln kann auch anders":
"Journalist und Buchautor Frank Möller wirft in einem aktuellen Beitrag für die Fachzeitschrift „Geschichte in Köln“ den Verantwortlichen des Stadtarchivs bewusste Desinformation und Bagatellisierung des Archivverlustes vor. Daher fordert KÖLN KANN AUCH ANDERS von den aktuellen OB-Kandidaten eine klare Distanzierung zur bisherigen Informationspolitik.Köln, 25.08.2009 – In der im Oktober erscheinende Sonderausgabe von „Geschichte in Köln“ zum Archiveinsturz erläutert der Kölner Autor und Unterstützer von KÖLN KANN AUCH ANDERS, Frank Möller, welche verheerende Wirkung der Einsturz des Stadtarchivs auf die Geschichtsforschung und das historische Erbe der Stadt Köln hat. Noch wenige Tage vor dem Einsturz arbeitete Möller im Stadtarchiv an einer Recherche für ein Buch über den Kölner Verleger Joseph Caspar Witsch. In dem knapp zwanzigseitigen Beitrag legt Möller u. a. dar, warum vollmundige Erfolgsmeldungen der Archivleitung zur Bergung des Archivgutes reine Augenwischerei für die Öffentlichkeit sind.
Der Beitrag macht auf äußerst anschauliche Weise am konkreten Beispiel deutlich, welch gravierender Verlust der Stadt Köln sowie der deutschen und internationalen Geschichtsforschung durch den Einsturz des Stadtarchivs entstanden ist. Ob die Rekonstruktion der geborgenen Unterlagen im notwendigen Umfang erfolgen kann, bleibt zweifelhaft, weil sie einen dreistelligen Millionenbetrag verschlingen wird. Bereits in der aktuellen Bergungsphase ist deutlich geworden ist, dass die Stadt an der personellen Ausstattung des Archivs offensichtlich weiter zu sparen gedenkt.
Die Entscheider in der Kölner Stadtverwaltung und im Historischen Archiv scheinen den dramatischen Schaden immer noch eher bagatellisieren als ihm angemessen begegnen zu wollen.
KÖLN KANN AUCH ANDERS fordert ein Umdenken in der Informationspolitik rund um das Stadtarchiv sowie im Krisenmanagement:
o Die aktuellen OB-Kandidaten sollten sich deutlich von der bisherigen irreführenden Informationspolitik der Stadt distanzieren.
o Die entstandenen Schäden und die Auflösung der archivischen Ordnungsstrukturen müssen durch unabhängige Restauratoren und Archivexperten des Bundesarchivs und des Vereins Deutscher Archivare (VDA) erhoben und begutachtet werden.
o Ein sachlich und personell schlüssiges Konzept zur Behebung der physischen Schäden wie auch die provenienzgerechte Rekonstruktion der Einzelbestände sowie ihre Wiedereingliederung in die ehemalige Gesamttektonik des Archivs ist zeitnah
und überzeugend öffentlich darzulegen und zur Diskussion zu stellen.
o Kurzfristig sind konkrete, bestandsbezogene Angaben über Umfang, Zustand und Lagerort in den "Asylarchiven" der geborgenen Archivalien zu machen.
o Die in den Presseverlautbarungen der Stadt immer wieder gebrauchte Formulierung "gerettete Bestände" ist irreführend und hinsichtlich Erhaltungs- und Ordnungszustand zu präzisieren.
Die Erfüllung der Forderungen wäre ein klarer Schritt für mehr Transparenz und Verantwortungsbewusstsein in Politik, Verwaltung und öffentlichen Betrieben der Stadt Köln.
Pressekontakt und weitere Informationen:
Dorothee Schneider/Frank Deja
Pionierstr. 5
50735 Köln
mobil: 0172 641 40 32
e-Mail: info@koelnkannauchanders.de
www.koelnkannauchanders.de"
Link zum PDF
"Journalist und Buchautor Frank Möller wirft in einem aktuellen Beitrag für die Fachzeitschrift „Geschichte in Köln“ den Verantwortlichen des Stadtarchivs bewusste Desinformation und Bagatellisierung des Archivverlustes vor. Daher fordert KÖLN KANN AUCH ANDERS von den aktuellen OB-Kandidaten eine klare Distanzierung zur bisherigen Informationspolitik.Köln, 25.08.2009 – In der im Oktober erscheinende Sonderausgabe von „Geschichte in Köln“ zum Archiveinsturz erläutert der Kölner Autor und Unterstützer von KÖLN KANN AUCH ANDERS, Frank Möller, welche verheerende Wirkung der Einsturz des Stadtarchivs auf die Geschichtsforschung und das historische Erbe der Stadt Köln hat. Noch wenige Tage vor dem Einsturz arbeitete Möller im Stadtarchiv an einer Recherche für ein Buch über den Kölner Verleger Joseph Caspar Witsch. In dem knapp zwanzigseitigen Beitrag legt Möller u. a. dar, warum vollmundige Erfolgsmeldungen der Archivleitung zur Bergung des Archivgutes reine Augenwischerei für die Öffentlichkeit sind.
Der Beitrag macht auf äußerst anschauliche Weise am konkreten Beispiel deutlich, welch gravierender Verlust der Stadt Köln sowie der deutschen und internationalen Geschichtsforschung durch den Einsturz des Stadtarchivs entstanden ist. Ob die Rekonstruktion der geborgenen Unterlagen im notwendigen Umfang erfolgen kann, bleibt zweifelhaft, weil sie einen dreistelligen Millionenbetrag verschlingen wird. Bereits in der aktuellen Bergungsphase ist deutlich geworden ist, dass die Stadt an der personellen Ausstattung des Archivs offensichtlich weiter zu sparen gedenkt.
Die Entscheider in der Kölner Stadtverwaltung und im Historischen Archiv scheinen den dramatischen Schaden immer noch eher bagatellisieren als ihm angemessen begegnen zu wollen.
KÖLN KANN AUCH ANDERS fordert ein Umdenken in der Informationspolitik rund um das Stadtarchiv sowie im Krisenmanagement:
o Die aktuellen OB-Kandidaten sollten sich deutlich von der bisherigen irreführenden Informationspolitik der Stadt distanzieren.
o Die entstandenen Schäden und die Auflösung der archivischen Ordnungsstrukturen müssen durch unabhängige Restauratoren und Archivexperten des Bundesarchivs und des Vereins Deutscher Archivare (VDA) erhoben und begutachtet werden.
o Ein sachlich und personell schlüssiges Konzept zur Behebung der physischen Schäden wie auch die provenienzgerechte Rekonstruktion der Einzelbestände sowie ihre Wiedereingliederung in die ehemalige Gesamttektonik des Archivs ist zeitnah
und überzeugend öffentlich darzulegen und zur Diskussion zu stellen.
o Kurzfristig sind konkrete, bestandsbezogene Angaben über Umfang, Zustand und Lagerort in den "Asylarchiven" der geborgenen Archivalien zu machen.
o Die in den Presseverlautbarungen der Stadt immer wieder gebrauchte Formulierung "gerettete Bestände" ist irreführend und hinsichtlich Erhaltungs- und Ordnungszustand zu präzisieren.
Die Erfüllung der Forderungen wäre ein klarer Schritt für mehr Transparenz und Verantwortungsbewusstsein in Politik, Verwaltung und öffentlichen Betrieben der Stadt Köln.
Pressekontakt und weitere Informationen:
Dorothee Schneider/Frank Deja
Pionierstr. 5
50735 Köln
mobil: 0172 641 40 32
e-Mail: info@koelnkannauchanders.de
www.koelnkannauchanders.de"
Link zum PDF
Wolf Thomas - am Mittwoch, 26. August 2009, 13:37 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aber die neue Musikurhebervereinigung mit dem albernen Akronym ADAM sieht das ganz anders:
Zur Wahrung einer »zukunftsfähigen, innovativen, identitätsstiftenden, vielfältigen und lebendigen Musikkultur« sei daher auch eine Stärkung des Urheberrechts gerade in Bezug auf digitale Nutzung ihrer Werke notwendig.
http://www.urheberrecht.org/news/3702/
Wie soll diese Stärkung aussehen? Lebenslange Haft für Raubkopierer? Oder gar die Todesstrafe für gewerbliche Produktpiraten? Wenn's um das Eingemachte der deutschen Musikautoren geht, darf es wirklich keine Tabus geben!
Zur Wahrung einer »zukunftsfähigen, innovativen, identitätsstiftenden, vielfältigen und lebendigen Musikkultur« sei daher auch eine Stärkung des Urheberrechts gerade in Bezug auf digitale Nutzung ihrer Werke notwendig.
http://www.urheberrecht.org/news/3702/
Wie soll diese Stärkung aussehen? Lebenslange Haft für Raubkopierer? Oder gar die Todesstrafe für gewerbliche Produktpiraten? Wenn's um das Eingemachte der deutschen Musikautoren geht, darf es wirklich keine Tabus geben!
KlausGraf - am Dienstag, 25. August 2009, 21:23 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Antje Thumser: Rezension zu: Dicker, Stefan: Landesbewusstsein und Zeitgeschehen. Studien zur bayerischen Chronistik des 15. Jahrhunderts. Köln 2009, in: H-Soz-u-Kult, 26.08.2009, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2009-3-158
Siehe dazu auch
http://archiv.twoday.net/stories/5869902/
Siehe dazu auch
http://archiv.twoday.net/stories/5869902/
KlausGraf - am Dienstag, 25. August 2009, 21:11 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 25. August 2009, 21:02 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://bibliothekarisch.de/blog/2009/08/25/europa-und-google-books/
Lesenswert!
Ich möchte aber folgendes herausgreifen:
Es nützt nichts, gegen Google und Google Books Allianzen zu schließen, wenn man nur meckert und im Gegenzug nicht selbst aktiv wird. Eine Allianz allein gegen das Google Settlement bringt die Sache nicht voran und schadet dem begrüßenswerten Zugang zu nicht mehr gedruckten Büchern.
Und mal so nebenbei – Achtung Ironie!:
90 Prozent aller weltweit archivierten Bücher würden nicht mehr gedruckt und seien daher öffentlich nicht mehr zugänglich
Schöne Zahl, aber zugänglich sind sie wohl nicht allein dadurch, dass sie bei Google findbar sind, oder? Sie sind doch in irgendeiner Bibliothek zu finden, wo sie in gedruckter Form stehen, damit Google sie schließlich digitalisieren kann. Bibliothek heißt, zugänglich gemacht für denjenigen, der ihrer bedarf. Letztendlich wird jedoch nur der Zugang vereinfacht und auch nur dann, wenn die Bücher nicht nur über Google sondern auch über die Bibliotheken auffindbar sind. Im Umkehrschluss, wenn 90% über Google zugänglich sind, kann man Bibliotheken in Archive umwandeln und nur die 10%, die aktuell verfügbar sind, über Bibliotheken noch aktiv zur Nutzung anbieten. Ach, ich vergaß, die 10% werden in Auszügen über Google sichtbar sein und jeder kann sich dann das Kapitel, dass er benötigt bestellen und kaufen (natürlich über Google, den großen Vertriebspartner der Verlage). Ein Hoch auf die Zukunft der Bibliothek als Archiv und den neuen Print-on-Demand-Vertragspartner Google der Verlage.
Zugang vereinfacht oder ermöglicht? Kulturgut muss so einfach wie möglich zugänglich sein. Hier eine kleine Liste von Hinderungsgründen, gerade mal aus dem Handgelenk geschüttelt:
* unfreundliche Bibliothekarinnen wie in der ULB Düsseldorf
* benutzerunfreundliche Öffnungszeiten wie in den meisten öffentlichen Büchereien und vielen wissenschaftlichen Bibliotheken
* Happige Jahresgebühren (WLB Stuttgart, BLB Karlsruhe)
* Kein remote access zu Datenbanken für zahlende Nutzer (Düsseldorf)
* überteuerte Kopierer (Stuttgart, Karlsruhe), überteuerte Scanner (Düsseldorf); kaputte Kopierer (häufig), Schlangen vor dem einzigen Münzkopierer, wenn Einmalbesucher keine Kopierkarte erwerben möchten/können
* Verbot der Nutzung eigener Digitalkameras bei Altbeständen (häufig)
* extrem lange Magazinbestellzeiten (halbe Woche: UB Freiburg)
* kein Freihandbestand außer den Lesesälen wie in der RWTH Aachen
* seltene Bücher, die schlicht und einfach nicht mehr in die Fernleihe gegeben werden
* Bücher die es nur im Ausland und daher gegen eine teure Auslandsfernleihe gibt (von der spärlichen Verbreitung älterer europäischen Literatur in den USA ganz zu schweigen)
* BibliothekarInnen, die sich anstellen bzw. sich weigern, wenn ein freies Projekt sie um 2-3 Gratiskopien bittet (SUB Göttingen u.a.)
usw.
Ich bekenne ganz offen: Die Forschungsbibliothek meiner Wahl ist inzwischen Google Book Search. Weil deutsche wissenschaftliche Bibliotheken heute alles andere als zufriedene Benutzer wollen.
Lesenswert!
Ich möchte aber folgendes herausgreifen:
Es nützt nichts, gegen Google und Google Books Allianzen zu schließen, wenn man nur meckert und im Gegenzug nicht selbst aktiv wird. Eine Allianz allein gegen das Google Settlement bringt die Sache nicht voran und schadet dem begrüßenswerten Zugang zu nicht mehr gedruckten Büchern.
Und mal so nebenbei – Achtung Ironie!:
90 Prozent aller weltweit archivierten Bücher würden nicht mehr gedruckt und seien daher öffentlich nicht mehr zugänglich
Schöne Zahl, aber zugänglich sind sie wohl nicht allein dadurch, dass sie bei Google findbar sind, oder? Sie sind doch in irgendeiner Bibliothek zu finden, wo sie in gedruckter Form stehen, damit Google sie schließlich digitalisieren kann. Bibliothek heißt, zugänglich gemacht für denjenigen, der ihrer bedarf. Letztendlich wird jedoch nur der Zugang vereinfacht und auch nur dann, wenn die Bücher nicht nur über Google sondern auch über die Bibliotheken auffindbar sind. Im Umkehrschluss, wenn 90% über Google zugänglich sind, kann man Bibliotheken in Archive umwandeln und nur die 10%, die aktuell verfügbar sind, über Bibliotheken noch aktiv zur Nutzung anbieten. Ach, ich vergaß, die 10% werden in Auszügen über Google sichtbar sein und jeder kann sich dann das Kapitel, dass er benötigt bestellen und kaufen (natürlich über Google, den großen Vertriebspartner der Verlage). Ein Hoch auf die Zukunft der Bibliothek als Archiv und den neuen Print-on-Demand-Vertragspartner Google der Verlage.
Zugang vereinfacht oder ermöglicht? Kulturgut muss so einfach wie möglich zugänglich sein. Hier eine kleine Liste von Hinderungsgründen, gerade mal aus dem Handgelenk geschüttelt:
* unfreundliche Bibliothekarinnen wie in der ULB Düsseldorf
* benutzerunfreundliche Öffnungszeiten wie in den meisten öffentlichen Büchereien und vielen wissenschaftlichen Bibliotheken
* Happige Jahresgebühren (WLB Stuttgart, BLB Karlsruhe)
* Kein remote access zu Datenbanken für zahlende Nutzer (Düsseldorf)
* überteuerte Kopierer (Stuttgart, Karlsruhe), überteuerte Scanner (Düsseldorf); kaputte Kopierer (häufig), Schlangen vor dem einzigen Münzkopierer, wenn Einmalbesucher keine Kopierkarte erwerben möchten/können
* Verbot der Nutzung eigener Digitalkameras bei Altbeständen (häufig)
* extrem lange Magazinbestellzeiten (halbe Woche: UB Freiburg)
* kein Freihandbestand außer den Lesesälen wie in der RWTH Aachen
* seltene Bücher, die schlicht und einfach nicht mehr in die Fernleihe gegeben werden
* Bücher die es nur im Ausland und daher gegen eine teure Auslandsfernleihe gibt (von der spärlichen Verbreitung älterer europäischen Literatur in den USA ganz zu schweigen)
* BibliothekarInnen, die sich anstellen bzw. sich weigern, wenn ein freies Projekt sie um 2-3 Gratiskopien bittet (SUB Göttingen u.a.)
usw.
Ich bekenne ganz offen: Die Forschungsbibliothek meiner Wahl ist inzwischen Google Book Search. Weil deutsche wissenschaftliche Bibliotheken heute alles andere als zufriedene Benutzer wollen.
KlausGraf - am Dienstag, 25. August 2009, 20:23 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Wissenschaftler und AutorInnen, die auf eine möglichst große Sichtbarkeit ihrer Werke Wert legen, werden dringend gebeten, der VG Wort als Bezugsberechtigte keine Rechte zu übertragen und als Wahrnehmungsberechtigte fristgerecht zu widersprechen.
Diese Empfehlung gibt das Urheberrechtsbündnis:
http://iuwis.de/blog/erinnerung-aktionsb%C3%BCndnis-empfiehlt-nicht-zustimmung-zur-%C3%A4nderung-des-vg-wort-vertrags
Warum darf die VG Wort die Rechte nicht bekommen?
Dies ist in den folgenden Beiträgen erläutert:
http://archiv.twoday.net/stories/5743335/
http://archiv.twoday.net/stories/5741709/
Wissenschaftler können die Rechte vergriffener Bücher nach § 41 UrhG zurückrufen:
http://archiv.twoday.net/stories/4069056/
Sie sind dann Rechteinhaber im Sinne des Google Books Settlement und können eine weltweite Gratis-Anzeige des gesamten Buchs gegenüber Google erklären bzw. eine CC-Lizenz vereinbaren:
http://archiv.twoday.net/stories/5878756/
Diese Empfehlung gibt das Urheberrechtsbündnis:
http://iuwis.de/blog/erinnerung-aktionsb%C3%BCndnis-empfiehlt-nicht-zustimmung-zur-%C3%A4nderung-des-vg-wort-vertrags
Warum darf die VG Wort die Rechte nicht bekommen?
Dies ist in den folgenden Beiträgen erläutert:
http://archiv.twoday.net/stories/5743335/
http://archiv.twoday.net/stories/5741709/
Wissenschaftler können die Rechte vergriffener Bücher nach § 41 UrhG zurückrufen:
http://archiv.twoday.net/stories/4069056/
Sie sind dann Rechteinhaber im Sinne des Google Books Settlement und können eine weltweite Gratis-Anzeige des gesamten Buchs gegenüber Google erklären bzw. eine CC-Lizenz vereinbaren:
http://archiv.twoday.net/stories/5878756/
KlausGraf - am Dienstag, 25. August 2009, 19:40 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Über
http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/621-guid.html
wurde ich auf PLoS Currents aufmerksam.
http://www.ploscurrents.org/influenza
Das sind aktuelle Beiträge (ohne Peer Review) zum Thema Grippe, die bei Google Knol eingestellt werden.
Die dauerhafte Archivierung erfolgt durch die NCBI in den USA im Rahmen von deren "Rapid Research Notes":
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/rrn/about/index.html
http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/621-guid.html
wurde ich auf PLoS Currents aufmerksam.
http://www.ploscurrents.org/influenza
Das sind aktuelle Beiträge (ohne Peer Review) zum Thema Grippe, die bei Google Knol eingestellt werden.
Die dauerhafte Archivierung erfolgt durch die NCBI in den USA im Rahmen von deren "Rapid Research Notes":
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/rrn/about/index.html
KlausGraf - am Dienstag, 25. August 2009, 19:31 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.webuser.co.uk/news/288184.html?aff=rss
Dagegen ein falsches Signal: KB Kopenhagen paktiert mit Proquest:
http://www.kb.dk/da/kb/nyheder/nyheder/Proquest.html
Dagegen ein falsches Signal: KB Kopenhagen paktiert mit Proquest:
http://www.kb.dk/da/kb/nyheder/nyheder/Proquest.html
KlausGraf - am Dienstag, 25. August 2009, 17:47 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Dass die Löschanträge in der Wikipedia gegen die einzelnen Mitglieder der Comedian Harmonists nicht durchkamen, ist ein schwacher Trost. Dass sie überhaupt gestellt wurden, ist unfassbar peinlich:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Löschkandidaten/24._August_2009#Mitglieder_der_Comedian_Harmonists_.28alle_LAE.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer_Diskussion:Tuxman#Hallo
Zitat des verantwortlichen Benutzers Tuxman:
Ach, ich habe kein Problem damit, den einzelnen Mitgliedern auch außerhalb der WP eine erfolgreiche Karriere als Solokünstler abzusprechen.
Ich zitiere mal aus dem Wikipedia-Artikel über den offenkundigen Looser Frommermann:
"Die drei jüdischen Mitglieder Harry Frommermann, Roman Cycowski und Erich Collin emigrierten nach Wien, von wo aus sie unter dem Namen "Comedy Harmonists" weiterhin erfolgreich Tourneen in aller Welt machten. Ende 1941 wurden sie in New York vom Eintritt der USA in den Krieg überrascht, und das Ensemble fiel auseinander. Frommermanns Versuch, in New York mit einem anderen Ensemble neu anzufangen, scheiterte an Geldmangel. Frommermann wurde von der US-Armee eingezogen und änderte seinen Namen in Frohman. Wegen eines Dienstunfalls musste er nicht an die Front, sondern unterhielt als Entertainer die Verwundeten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam er zurück nach Berlin und arbeitete als Übersetzer (unter anderem beim Nürnberger Prozess), später als Nachrichtenoffizier. Nach seiner Entlassung aus der Armee ging er nach Zürich und wurde Immobilienmakler. Ein Versuch, mit Collin ein neues Ensemble aufzubauen, missglückte. Daraufhin ging Frommermann 1949 nach Rom und arbeitete als künstlerischer Beirat beim Radio.
1951 kehrte er in die Schweiz zurück, um dort eine Im- und Exportfirma aufzubauen. Auch dieser Versuch schlug fehl. Danach versuchte er, in der USA beim Fernsehen zu landen, aber er wurde nicht eingestellt. Seine Frau verließ ihn, eine neue Ehe wurde 1956 geschieden. Frommermann versuchte, sich als Packer im Hafen von New York über Wasser zu halten, später stellte er in einer Firma Alarmanlagen her. Er jobbte als Hilfsbuchhalter, Taxifahrer und verkaufte Küchenmöbel. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich fortwährend.
Bereits während seiner Zeit als amerikanischer Soldat hatte Frommermann die Deutsche Erika von Späth kennengelernt und über Jahre mit ihr Briefkontakt gehalten. 1960 beantragte er auf ihren Rat Entschädigung für den Verlust seiner Existenz durch die Rassegesetze des Dritten Reichs. 1962 erhielt er eine lebenslange Rente zugesprochen, kehrte nach Deutschland zurück und zog mit Erika von Späth zusammen. Er war nun ständig krank und starb 1975 mit 69 Jahren in Bremen."
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Löschkandidaten/24._August_2009#Mitglieder_der_Comedian_Harmonists_.28alle_LAE.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer_Diskussion:Tuxman#Hallo
Zitat des verantwortlichen Benutzers Tuxman:
Ach, ich habe kein Problem damit, den einzelnen Mitgliedern auch außerhalb der WP eine erfolgreiche Karriere als Solokünstler abzusprechen.
Ich zitiere mal aus dem Wikipedia-Artikel über den offenkundigen Looser Frommermann:
"Die drei jüdischen Mitglieder Harry Frommermann, Roman Cycowski und Erich Collin emigrierten nach Wien, von wo aus sie unter dem Namen "Comedy Harmonists" weiterhin erfolgreich Tourneen in aller Welt machten. Ende 1941 wurden sie in New York vom Eintritt der USA in den Krieg überrascht, und das Ensemble fiel auseinander. Frommermanns Versuch, in New York mit einem anderen Ensemble neu anzufangen, scheiterte an Geldmangel. Frommermann wurde von der US-Armee eingezogen und änderte seinen Namen in Frohman. Wegen eines Dienstunfalls musste er nicht an die Front, sondern unterhielt als Entertainer die Verwundeten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam er zurück nach Berlin und arbeitete als Übersetzer (unter anderem beim Nürnberger Prozess), später als Nachrichtenoffizier. Nach seiner Entlassung aus der Armee ging er nach Zürich und wurde Immobilienmakler. Ein Versuch, mit Collin ein neues Ensemble aufzubauen, missglückte. Daraufhin ging Frommermann 1949 nach Rom und arbeitete als künstlerischer Beirat beim Radio.
1951 kehrte er in die Schweiz zurück, um dort eine Im- und Exportfirma aufzubauen. Auch dieser Versuch schlug fehl. Danach versuchte er, in der USA beim Fernsehen zu landen, aber er wurde nicht eingestellt. Seine Frau verließ ihn, eine neue Ehe wurde 1956 geschieden. Frommermann versuchte, sich als Packer im Hafen von New York über Wasser zu halten, später stellte er in einer Firma Alarmanlagen her. Er jobbte als Hilfsbuchhalter, Taxifahrer und verkaufte Küchenmöbel. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich fortwährend.
Bereits während seiner Zeit als amerikanischer Soldat hatte Frommermann die Deutsche Erika von Späth kennengelernt und über Jahre mit ihr Briefkontakt gehalten. 1960 beantragte er auf ihren Rat Entschädigung für den Verlust seiner Existenz durch die Rassegesetze des Dritten Reichs. 1962 erhielt er eine lebenslange Rente zugesprochen, kehrte nach Deutschland zurück und zog mit Erika von Späth zusammen. Er war nun ständig krank und starb 1975 mit 69 Jahren in Bremen."
Vom 19.-20. November findet in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin die Jahrestagung eAkte statt mit Fachvorträgen zu den verschiedenen Fragestellung im Kontext elektronische Akte, Langzeitspeicherung und Archivierung.
Die Fachvorträge sind organisiert in themenspezifischen Fachforen so u.a.:
Organisiert wird die Tagung durch die INFORA GmbH. Die fachliche Organisation, so Auswahl der Themen und ReferentInnen etc. und die entspr. Qualitätssicherung erfolgt durch einen Fachbeirat mit Experten im Kontext DMS/VBS, Langzeitspeicherung und eAkte sowie der öffentlichen Verwaltung selbst.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für VertreterInnen des öffentlichen Dienstes kostenfrei. Die Vorträge sind fachlich sehr empfehlenswert, zumal eine solch kompakte Darstellung der wichtigsten Themenstellung im Kontext DMS/VBS, Langzeitspeicherung und Archivierung äußerst selten ist.
Nähere Informationen zur Tagung finden sich unter nachstehendem Link:Jahrestagung eAkte
Die Fachvorträge sind organisiert in themenspezifischen Fachforen so u.a.:
- Digitalisierung von Papierunterlagen
- Normung und Standardisierung
- elektronische Signatur/Rechts- und Beweissicherheit elektronischer Akten
- Collaboration/Web 2.0 und elektronische Akten
- Langzeitspeicherung
- elektronische Archivierung
- Hr. Dr. Keitel/Landesarchiv Baden-Württemberg
- Fr. Dr. Jandt, PROVET-Projekt der Uni Kassel (Beweissicherheit digitaler Unterlagen)
- Fr. Dobratz/NESTOR
- Fr. Dr. Gutzmann/VW
Organisiert wird die Tagung durch die INFORA GmbH. Die fachliche Organisation, so Auswahl der Themen und ReferentInnen etc. und die entspr. Qualitätssicherung erfolgt durch einen Fachbeirat mit Experten im Kontext DMS/VBS, Langzeitspeicherung und eAkte sowie der öffentlichen Verwaltung selbst.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für VertreterInnen des öffentlichen Dienstes kostenfrei. Die Vorträge sind fachlich sehr empfehlenswert, zumal eine solch kompakte Darstellung der wichtigsten Themenstellung im Kontext DMS/VBS, Langzeitspeicherung und Archivierung äußerst selten ist.
Nähere Informationen zur Tagung finden sich unter nachstehendem Link:Jahrestagung eAkte
schwalm.potsdam - am Dienstag, 25. August 2009, 09:12 - Rubrik: Records Management
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://alteskrokodil.blogspot.com/
Harte Worte von Peter Muzler, aber wenn es um ein so heikles Thema geht, wäre mehr Sensibilität erforderlich gewesen!
Harte Worte von Peter Muzler, aber wenn es um ein so heikles Thema geht, wäre mehr Sensibilität erforderlich gewesen!
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.adk.de/de/aktuell/forum_dokumentationen/forum_Appell_Google_21.8.09.html
Muss man solchen Schwachsinn noch kommentieren?
"Die Akademie der Künste appelliert an den Deutschen Bundestag, die Bundesregierung, an die Europäische Kommission, an den Rechtsausschuss und den Binnenmarktausschuss des Europäischen Parlaments, das geistige Eigentum europäischer Autoren durch politische und rechtliche Maßnahmen nachhaltig zu schützen. Sollte dies vernachlässigt werden, droht die Gefahr wachsender rechtsfreier Zonen im digitalen Zeitalter und damit die Schwächung des Urheberrechts, der Grundlage der Entwicklung der Informations- und Mediengesellschaft."
Nein, das Urheberrecht ist nicht die Grundlage der Entwicklung der Mediengesellschaft. Johannes Gutenberg hat seine Erfindung gemacht, ohne dass es ein Urheberrecht gab, und die großartigsten Werke sind weltweit ohne Urheberrechtsgesetze entstanden.

Muss man solchen Schwachsinn noch kommentieren?
"Die Akademie der Künste appelliert an den Deutschen Bundestag, die Bundesregierung, an die Europäische Kommission, an den Rechtsausschuss und den Binnenmarktausschuss des Europäischen Parlaments, das geistige Eigentum europäischer Autoren durch politische und rechtliche Maßnahmen nachhaltig zu schützen. Sollte dies vernachlässigt werden, droht die Gefahr wachsender rechtsfreier Zonen im digitalen Zeitalter und damit die Schwächung des Urheberrechts, der Grundlage der Entwicklung der Informations- und Mediengesellschaft."
Nein, das Urheberrecht ist nicht die Grundlage der Entwicklung der Mediengesellschaft. Johannes Gutenberg hat seine Erfindung gemacht, ohne dass es ein Urheberrecht gab, und die großartigsten Werke sind weltweit ohne Urheberrechtsgesetze entstanden.

KlausGraf - am Montag, 24. August 2009, 21:05 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2009/08/when-is-it-in-the-public-domain.html (Peter Hirtle)
Quote:
We often want legal certainty when we think about digitization projects. What we should be asking instead is whether what we want to do useful, and how likely it is that anyone would object.

Quote:
We often want legal certainty when we think about digitization projects. What we should be asking instead is whether what we want to do useful, and how likely it is that anyone would object.

KlausGraf - am Montag, 24. August 2009, 14:47 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blog.jacomet.ch/?p=3474
Ganz meine Meinung! Zu Streetview siehe:
http://archiv.twoday.net/search?q=streetview
Wer auch immer eine vollständige Abbildung der vom öffentlichen Straßenraum sichtbaren Erdoberfläche realisieren möchte, sollte das Recht dazu haben. Es kann nicht sein, dass Hauseigentümern das Recht zugestanden wird, ihr Haus aus dem virtuellen Straßenbild entfernen zu lassen. Das ist Geodaten-Zensur, nichts anderes.
Siehe auch:
http://www.heise.de/newsticker/Schweizer-Datenschuetzer-fordert-Stopp-von-Google-Street-View--/meldung/144146
Ganz meine Meinung! Zu Streetview siehe:
http://archiv.twoday.net/search?q=streetview
Wer auch immer eine vollständige Abbildung der vom öffentlichen Straßenraum sichtbaren Erdoberfläche realisieren möchte, sollte das Recht dazu haben. Es kann nicht sein, dass Hauseigentümern das Recht zugestanden wird, ihr Haus aus dem virtuellen Straßenbild entfernen zu lassen. Das ist Geodaten-Zensur, nichts anderes.
Siehe auch:
http://www.heise.de/newsticker/Schweizer-Datenschuetzer-fordert-Stopp-von-Google-Street-View--/meldung/144146
KlausGraf - am Montag, 24. August 2009, 14:18 - Rubrik: Archivrecht
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30977/1.html
Gaby Weber recherchiert zum Thema: Haben mit Billigung des BND ausgerechnet Nazi-Techniker Israel nuklear aufgerüstet? Da sich der BND weigert, die Akten einsehen zu lassen, verklagt sie ihn vor dem Bundesverwaltungsgericht (§ 50 VwGO sieht das bei BND-Sachen vor).
Zum Thema Bundesarchivgesetz:
So machte der BND im Bezug auf Eichmann geltend, es handele sich um sogenanntes "Archivgut", für das eine 60 Jahres-Frist bestehe (§ 5 Abs. 3 BArchG). Dies sei der Fall, da die angeforderten Akten gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 2 BArchG der Geheimhaltung unterliegen. Doch nicht einmal die Akten, die älter als 60 Jahre sind möchte Pullach herausrücken. Diese seien in einer "Aufbewahrungseinheit" zusammengeheftet, sodass für den Fristbeginn auf die jüngsten Aktenteile abzustellen sei, die im Jahre 1956 lägen. - Anders ausgedrückt könnte man also eine Akte bis zum St. Nimmerleinstag weiterführen und auf ewig der Einsicht entziehen.
Widerspruchsbescheid:
http://www.gabyweber.com/dwnld/prozesse/bnd_9_08.pdf

Gaby Weber recherchiert zum Thema: Haben mit Billigung des BND ausgerechnet Nazi-Techniker Israel nuklear aufgerüstet? Da sich der BND weigert, die Akten einsehen zu lassen, verklagt sie ihn vor dem Bundesverwaltungsgericht (§ 50 VwGO sieht das bei BND-Sachen vor).
Zum Thema Bundesarchivgesetz:
So machte der BND im Bezug auf Eichmann geltend, es handele sich um sogenanntes "Archivgut", für das eine 60 Jahres-Frist bestehe (§ 5 Abs. 3 BArchG). Dies sei der Fall, da die angeforderten Akten gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 2 BArchG der Geheimhaltung unterliegen. Doch nicht einmal die Akten, die älter als 60 Jahre sind möchte Pullach herausrücken. Diese seien in einer "Aufbewahrungseinheit" zusammengeheftet, sodass für den Fristbeginn auf die jüngsten Aktenteile abzustellen sei, die im Jahre 1956 lägen. - Anders ausgedrückt könnte man also eine Akte bis zum St. Nimmerleinstag weiterführen und auf ewig der Einsicht entziehen.
Widerspruchsbescheid:
http://www.gabyweber.com/dwnld/prozesse/bnd_9_08.pdf

KlausGraf - am Montag, 24. August 2009, 13:56 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Archivalia mag ja ganz ordentliche Zugriffszahlen für ein Nischenblog haben, aber gut vernetzt ist es mit deutschsprachigen Geschichtsblogs nicht. Was sicher auch daran liegt, dass wir keine Blogroll haben.
Beispiele:
http://geschichtsunterricht.wordpress.com/
Blogroll ja, Archivalia drin: nein
http://geschichtsweb.blogspot.com/
dito
http://www.geschichtspassage.de/wordpress/index.php
dito
http://www.geschichte-und-neue-medien.de/
keine Blogroll
In meinem Feedreader sind:
http://adresscomptoir.twoday.net/
http://arcana.twoday.net/
http://digireg.twoday.net/
http://www.fotostoria.de/
http://geschichtsweberei.blogspot.com/
Archivalia jeweils in Blogroll
http://weblog.histnet.ch/
Als Blogroll wird verkauft:
http://www.hist.net/forschung-praxis/geschichtsblogs/
Archivalia war Geschichtsblog im Januar 2007, aber das sieht man obiger Liste nicht an:
http://weblog.histnet.ch/archives/267
http://geschichtspuls.de/
keine Blogroll
Beispiele:
http://geschichtsunterricht.wordpress.com/
Blogroll ja, Archivalia drin: nein
http://geschichtsweb.blogspot.com/
dito
http://www.geschichtspassage.de/wordpress/index.php
dito
http://www.geschichte-und-neue-medien.de/
keine Blogroll
In meinem Feedreader sind:
http://adresscomptoir.twoday.net/
http://arcana.twoday.net/
http://digireg.twoday.net/
http://www.fotostoria.de/
http://geschichtsweberei.blogspot.com/
Archivalia jeweils in Blogroll
http://weblog.histnet.ch/
Als Blogroll wird verkauft:
http://www.hist.net/forschung-praxis/geschichtsblogs/
Archivalia war Geschichtsblog im Januar 2007, aber das sieht man obiger Liste nicht an:
http://weblog.histnet.ch/archives/267
http://geschichtspuls.de/
keine Blogroll
KlausGraf - am Sonntag, 23. August 2009, 21:12 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://weblog.histnet.ch/ ist nun auch auf Twitter zu finden http://twitter.com/histnet
Mal sehen, wann die hochgeschätzten Kollegen merken, dass man auf Twitter auch anderen folgt.
Mal sehen, wann die hochgeschätzten Kollegen merken, dass man auf Twitter auch anderen folgt.
http://www.lwl.org/LWL/Kultur/Aufruhr/aktuell/ Mit Video.
http://geschichtspuls.de/art1348-das-ruhrgebiet-land-der-burgen-und-schloesser
http://geschichtspuls.de/art1348-das-ruhrgebiet-land-der-burgen-und-schloesser
KlausGraf - am Samstag, 22. August 2009, 22:02 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Heike Uffmann, Wie in einem Rosengarten. Monastische Reformen des späten Mittelalters in den Vorstellungen von Klosterfrauen (Religion in der Geschichte 14). Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 2008. 392 S., 29 Euro. Inhaltsverzeichnis (PDF)
Über zehn Jahre hat die Verfasserin der Bielefelder historischen Dissertation (bei Heinrich Rüthing) an ihrer Arbeit gesessen, in der sie die chronistischen Aufzeichnungen aus Frauenklöstern des deutschsprachigen Raumes 1470-1525, also aus der Zeit der Klosterreformen, würdigt. Sie hat ein gut lesbares und wichtiges Buch vorgelegt, das die Beachtung aller an spätmittelalterlicher Historiographie Interessierten verdient.
Constance Proksch hatte in ihrer aus der Sprandel-Schule hervorgegangenen, nicht sonderlich befriedigenden Studie über die Geschichtsschreibung der Klosterreform 1994 (siehe meine Rezension 1997, in der ich ohne Namensnennung bereits auf Uffmanns Dissertationsvorhaben verwies) die Sicht der Nonnen ignoriert. 2002 erschien dann von Charlotte Woodford ein Buch über die frühneuzeitliche Historiographie deutscher Klosterfrauen (Vorschau Google Books). Offenbar nicht mehr verwertet werden konnte von Uffmann die 2004 publizierte Monographie von Anne Winston-Allen: Convent Chronicles.
Women Writing About Women and Reform in the Late Middle Ages (Vorschau Google Books).
Bevor sich Uffmann an die Textinterpretation macht, behandelt sie in vier Kapiteln wichtige Rahmenbedingungen. Der Überblick über die spätmittelalterlichen Klosterreformen (S. 40-61) ist nicht zuletzt durch die kleine Fallstudie über die Bursfelder Benediktinerinnen wertvoll. Anschließend zeigt sie, wie zwei männliche Wortführer der Klosterreform, der Windesheimer Augustinerchorherr Johannes Busch (ca. 1400-1480) und der oberservante Dominikaner Johannes Meyer (1422-1485) reformierte Frauenklöster sahen (S. 62-76).
Einen beachtlichen und quellennahen Beitrag zum Bildungsstand in den Frauenklöstern leistet das Kapitel "Die Ausbildung der Chronistinnen in der Klosterschule" (S. 77-98).
Nach einem Abschnitt zur klösterlichen Historiographie (S. 99-122) interpretiert Uffmann im langen Hauptkapitel (S. 123-253) die schwerpunktmäßig behandelten Aufzeichnungen. Es sind dies Berichte, die "im heutigen Niedersachsen in den Benediktinerinnenklöstern Ebstorf und Lüne, in dem Wienhausener Zisterzienserinnenkloster und in dem Konvent der Augustinerchorfrauen in Heiningen entstanden. Am Mittelrhein schrieben die Franziskanerterziarinnen in Besselich. Im Süd-Westen des deutschsprachigen Raumes brachten Nonnen in den beiden Dominikanerinnenklöstern Kirchheim unter Teck und St. Katharina in St. Gallen ihre Konventsgeschichten zu Papier" (S. 123).
Besonders aufschlussreich sind die Interpretationen zu den bisher ungedruckten und/oder kaum bekannten Quellen. Da ist das von Uffmann erstmals umfangreich behandelte grandiose Konventbuch des Klosters Besselich bei Koblenz, das in der Außenstelle Rommersdorf des Landeshauptarchivs Koblenz verwahrt wird (Depositum Barton genannt Stedman), eine außerordentlich faszinierende Quelle, wie ich aus eigener Anschauung weiß. Die umfangreiche Schrift der Magdalena Kremer zur Reform des Dominikanerinnenklosters Kirchheim unter Teck liegt nur in einem unzulänglichen alten Druck von Sattler 1777 vor. 2009 wurden die Chronik und das sogenannte Schwesternbuch des Katharinenklosters St. Gallen aus dem Klosterarchiv von St. Katharina in Wil online zugänglich gemacht, was eine Überprüfung der Ausführungen von Uffmann erlaubt:
http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/kaw/signature/50/0
Es wäre zu wünschen, dass auch die anderen Nonnenchroniken digitalisiert und ins Internet gestellt würden.
Für die Alltagsgeschichte der Frauenklöster fällt viel Material ab, denn man wird von Uffmann ausführlich über Liturgiefragen und die Durchsetzung der Klausur sowie deren Implikationen für die Kommunikation mit Laien unterrichtet.
Als bemerkenswertes Detail möchte ich die Befunde zu den Buchvernichtungen im Verlauf der Reformen, die vor allem vorreformatorische Liturgica betrafen (S. 103f., 198), hervorheben.
Um zu zeigen, wie sich eine Chronistin in der Reformationszeit mit der Klosterreform auseinandersetzt, schließt Uffmann ein Kapitel über die zwischen 1533 und 1560 entstandenen Chroniken der Anna Roede, Benediktinerin im westfälischen Herzebrock, an (S. 254-284).
Überzeugend stellt Uffmann heraus, dass es nicht angeht, wie Proksch von "der" Reformchronistik als "antithetisch strukturierter" Gattung zu sprechen (S. 287): "Viel entschiedener als das bisher geschehen ist, muss der geschlechtsspezifischen Differenzierung in der künftigen Klosterreformforschung Rechnung getragen werden" (S. 313). Die Nonnen neigten sehr viel weniger zur "Schwarzweißmalerei" als die Mönche.
Den sehr knappen Ausblick auf die Reformationszeit (S. 320-322) ergänzt die heuristisch bedeutsame quellenkundliche Zusammenstellung des Anhangs (S. 325-343), die nicht nur die von Uffmann ermittelten Quellen der Klosterreformzeit 1400-1525 mit Angaben zu Überlieferung, Edition, Inhalt usw. kurz charakterisiert, sondern auch eine Fortführung bis 1555 enthält.
Unverzichtbar ist bei einer so materialreichen und gehaltvollen Arbeit ein Register. Es fehlt leider. Von kleineren Nachlässigkeiten ist kein Aufhebens zu machen.
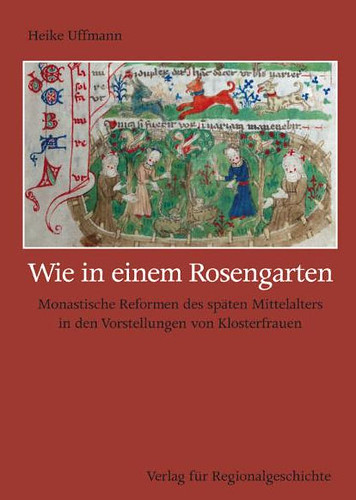
Graf, Klaus. Chronistik in Frauenklöstern. Archivalia. 2009-08-23. URL:https://archiv.twoday.net/stories/5892949/. Accessed: 2009-08-23. (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/5jFHExCEd)
Über zehn Jahre hat die Verfasserin der Bielefelder historischen Dissertation (bei Heinrich Rüthing) an ihrer Arbeit gesessen, in der sie die chronistischen Aufzeichnungen aus Frauenklöstern des deutschsprachigen Raumes 1470-1525, also aus der Zeit der Klosterreformen, würdigt. Sie hat ein gut lesbares und wichtiges Buch vorgelegt, das die Beachtung aller an spätmittelalterlicher Historiographie Interessierten verdient.
Constance Proksch hatte in ihrer aus der Sprandel-Schule hervorgegangenen, nicht sonderlich befriedigenden Studie über die Geschichtsschreibung der Klosterreform 1994 (siehe meine Rezension 1997, in der ich ohne Namensnennung bereits auf Uffmanns Dissertationsvorhaben verwies) die Sicht der Nonnen ignoriert. 2002 erschien dann von Charlotte Woodford ein Buch über die frühneuzeitliche Historiographie deutscher Klosterfrauen (Vorschau Google Books). Offenbar nicht mehr verwertet werden konnte von Uffmann die 2004 publizierte Monographie von Anne Winston-Allen: Convent Chronicles.
Women Writing About Women and Reform in the Late Middle Ages (Vorschau Google Books).
Bevor sich Uffmann an die Textinterpretation macht, behandelt sie in vier Kapiteln wichtige Rahmenbedingungen. Der Überblick über die spätmittelalterlichen Klosterreformen (S. 40-61) ist nicht zuletzt durch die kleine Fallstudie über die Bursfelder Benediktinerinnen wertvoll. Anschließend zeigt sie, wie zwei männliche Wortführer der Klosterreform, der Windesheimer Augustinerchorherr Johannes Busch (ca. 1400-1480) und der oberservante Dominikaner Johannes Meyer (1422-1485) reformierte Frauenklöster sahen (S. 62-76).
Einen beachtlichen und quellennahen Beitrag zum Bildungsstand in den Frauenklöstern leistet das Kapitel "Die Ausbildung der Chronistinnen in der Klosterschule" (S. 77-98).
Nach einem Abschnitt zur klösterlichen Historiographie (S. 99-122) interpretiert Uffmann im langen Hauptkapitel (S. 123-253) die schwerpunktmäßig behandelten Aufzeichnungen. Es sind dies Berichte, die "im heutigen Niedersachsen in den Benediktinerinnenklöstern Ebstorf und Lüne, in dem Wienhausener Zisterzienserinnenkloster und in dem Konvent der Augustinerchorfrauen in Heiningen entstanden. Am Mittelrhein schrieben die Franziskanerterziarinnen in Besselich. Im Süd-Westen des deutschsprachigen Raumes brachten Nonnen in den beiden Dominikanerinnenklöstern Kirchheim unter Teck und St. Katharina in St. Gallen ihre Konventsgeschichten zu Papier" (S. 123).
Besonders aufschlussreich sind die Interpretationen zu den bisher ungedruckten und/oder kaum bekannten Quellen. Da ist das von Uffmann erstmals umfangreich behandelte grandiose Konventbuch des Klosters Besselich bei Koblenz, das in der Außenstelle Rommersdorf des Landeshauptarchivs Koblenz verwahrt wird (Depositum Barton genannt Stedman), eine außerordentlich faszinierende Quelle, wie ich aus eigener Anschauung weiß. Die umfangreiche Schrift der Magdalena Kremer zur Reform des Dominikanerinnenklosters Kirchheim unter Teck liegt nur in einem unzulänglichen alten Druck von Sattler 1777 vor. 2009 wurden die Chronik und das sogenannte Schwesternbuch des Katharinenklosters St. Gallen aus dem Klosterarchiv von St. Katharina in Wil online zugänglich gemacht, was eine Überprüfung der Ausführungen von Uffmann erlaubt:
http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/kaw/signature/50/0
Es wäre zu wünschen, dass auch die anderen Nonnenchroniken digitalisiert und ins Internet gestellt würden.
Für die Alltagsgeschichte der Frauenklöster fällt viel Material ab, denn man wird von Uffmann ausführlich über Liturgiefragen und die Durchsetzung der Klausur sowie deren Implikationen für die Kommunikation mit Laien unterrichtet.
Als bemerkenswertes Detail möchte ich die Befunde zu den Buchvernichtungen im Verlauf der Reformen, die vor allem vorreformatorische Liturgica betrafen (S. 103f., 198), hervorheben.
Um zu zeigen, wie sich eine Chronistin in der Reformationszeit mit der Klosterreform auseinandersetzt, schließt Uffmann ein Kapitel über die zwischen 1533 und 1560 entstandenen Chroniken der Anna Roede, Benediktinerin im westfälischen Herzebrock, an (S. 254-284).
Überzeugend stellt Uffmann heraus, dass es nicht angeht, wie Proksch von "der" Reformchronistik als "antithetisch strukturierter" Gattung zu sprechen (S. 287): "Viel entschiedener als das bisher geschehen ist, muss der geschlechtsspezifischen Differenzierung in der künftigen Klosterreformforschung Rechnung getragen werden" (S. 313). Die Nonnen neigten sehr viel weniger zur "Schwarzweißmalerei" als die Mönche.
Den sehr knappen Ausblick auf die Reformationszeit (S. 320-322) ergänzt die heuristisch bedeutsame quellenkundliche Zusammenstellung des Anhangs (S. 325-343), die nicht nur die von Uffmann ermittelten Quellen der Klosterreformzeit 1400-1525 mit Angaben zu Überlieferung, Edition, Inhalt usw. kurz charakterisiert, sondern auch eine Fortführung bis 1555 enthält.
Unverzichtbar ist bei einer so materialreichen und gehaltvollen Arbeit ein Register. Es fehlt leider. Von kleineren Nachlässigkeiten ist kein Aufhebens zu machen.
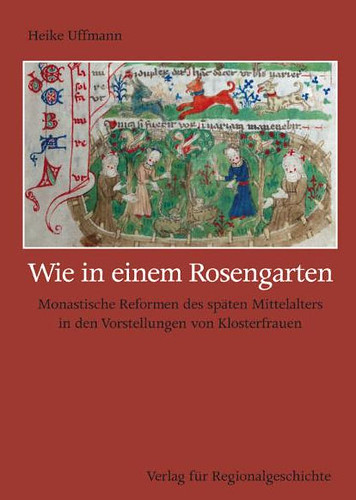
Graf, Klaus. Chronistik in Frauenklöstern. Archivalia. 2009-08-23. URL:https://archiv.twoday.net/stories/5892949/. Accessed: 2009-08-23. (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/5jFHExCEd)
KlausGraf - am Samstag, 22. August 2009, 15:34 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.millenniata.com/about/index.html
Millenniata is the sole provider of a permanent, backwards-compatible archiving solution for the digital age. Located in Springville, Utah, Millenniata is poised to become the world's leader in digital data preservation. Millenniata is the result of pioneering inventions from Brigham Young University.
Professors at BYU developed the technology now known as the M-ARC™ Disc. Data and images written to the M-ARC™ Disc using the M-Writer™ Drive can be preserved, making them virtually permanent by modern standards.
The products developed by Millenniata, Inc. will satisfy the archiving needs of government institutions, businesses and consumers.
The M-ARC™ Disc builds on the foundation of existing optical data storage technology such as CD, DVD, HD-DVD, and Blu-ray, while going beyond to provide a digital data storage solution that will preserve data for generations.
The M-ARC™ Disc looks like the familiar CD-ROM or DVD and can be read by current disc drives.
Millenniata is the sole provider of a permanent, backwards-compatible archiving solution for the digital age. Located in Springville, Utah, Millenniata is poised to become the world's leader in digital data preservation. Millenniata is the result of pioneering inventions from Brigham Young University.
Professors at BYU developed the technology now known as the M-ARC™ Disc. Data and images written to the M-ARC™ Disc using the M-Writer™ Drive can be preserved, making them virtually permanent by modern standards.
The products developed by Millenniata, Inc. will satisfy the archiving needs of government institutions, businesses and consumers.
The M-ARC™ Disc builds on the foundation of existing optical data storage technology such as CD, DVD, HD-DVD, and Blu-ray, while going beyond to provide a digital data storage solution that will preserve data for generations.
The M-ARC™ Disc looks like the familiar CD-ROM or DVD and can be read by current disc drives.
KlausGraf - am Samstag, 22. August 2009, 15:01 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.hst.mdh.se/digitbooks/
Die drei Digitalisate werden in Touch & Turn präsentiert, einem Viewer, der durch seine extreme Langsamkeit abturnt. Man wartet endlos, bis das Buch in Flash geladen geladen ist, und nicht jedem ist es gegeben, sofort die Vergrößerungsmöglichkeit (Förstoring) der Scans zu entdecken.
Der Boccaccio ist eine deutschsprachige Inkunabel (Augsburg: Sorg 1490). Angeboten wird auf Deutsch auch eine Lutherbibel (Wittenberg 1524, illuminiert).
Update:
Zu technischen Problemen siehe auch den Kommentar. Weitere Bilder und Hinweise zur Lutherbibel
http://bibliodyssey.blogspot.com/2009/09/september-testament.html

KlausGraf - am Samstag, 22. August 2009, 03:35 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
http://www.nrsr.sk/dk/Download.aspx?MasterID=97154&Type=DocVar&DocVarID=23149&DocID=285050
(Digitalisat)
http://www.nrsr.sk/dk/Download.aspx?MasterID=97154
(E-Text)
Zugänglich im Rahmen der Digitalen Bibliothek des slowakischen Nationalrates
http://www.nrsr.sk/nrdk/dk.aspx?Lang=de
Update:
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=2358
Wie ich an die obigen Links kam, konnte ich beim zweiten Versuch leider nicht mehr reproduzieren!
Wenn man die MasterID nach rückwärts verfolgt, erhält man z.B.
http://www.nrsr.sk/dk/Download.aspx?MasterID=97144
mit PDF
http://www.nrsr.sk/dk/Download.aspx?MasterID=97144&Type=DocVar&DocVarID=23139&DocID=285791
Auch
http://www.nrsr.sk/dk/Download.aspx?MasterID=97143
funktioniert.
Unter den Fraktur-PDFs liegt der E-Text!
(Digitalisat)
http://www.nrsr.sk/dk/Download.aspx?MasterID=97154
(E-Text)
Zugänglich im Rahmen der Digitalen Bibliothek des slowakischen Nationalrates
http://www.nrsr.sk/nrdk/dk.aspx?Lang=de
Update:
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=2358
Wie ich an die obigen Links kam, konnte ich beim zweiten Versuch leider nicht mehr reproduzieren!
Wenn man die MasterID nach rückwärts verfolgt, erhält man z.B.
http://www.nrsr.sk/dk/Download.aspx?MasterID=97144
mit PDF
http://www.nrsr.sk/dk/Download.aspx?MasterID=97144&Type=DocVar&DocVarID=23139&DocID=285791
Auch
http://www.nrsr.sk/dk/Download.aspx?MasterID=97143
funktioniert.
Unter den Fraktur-PDFs liegt der E-Text!
KlausGraf - am Samstag, 22. August 2009, 00:35 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.libraryjournal.com/article/CA6678948.html
They wrote:
We have three main concerns about the proposed settlement agreement. First, to maximize access to knowledge, prices should be reasonable. Unfortunately, the proposed settlement agreement contains inadequate checks and balances to prevent price gouging and unduly restrictive terms for purchasers of books and institutional subscribers.
Second, the agreement does not contemplate or make provision for open access choices that have in recent years become common among academic authorial communities, especially with regard to out of print books. The settlement agreement only contemplates that authors would monetize their books and related metadata through the Book Rights Registry (BRR). This is especially worrisome as to the millions of out of print, and likely orphan, books.
Third, the agreement contemplates some monitoring of user queries and uses of books in the Book Search corpus that negatively impinge on significant privacy interests of authors and readers and undermine fundamental academic freedom principles.”
They wrote:
We have three main concerns about the proposed settlement agreement. First, to maximize access to knowledge, prices should be reasonable. Unfortunately, the proposed settlement agreement contains inadequate checks and balances to prevent price gouging and unduly restrictive terms for purchasers of books and institutional subscribers.
Second, the agreement does not contemplate or make provision for open access choices that have in recent years become common among academic authorial communities, especially with regard to out of print books. The settlement agreement only contemplates that authors would monetize their books and related metadata through the Book Rights Registry (BRR). This is especially worrisome as to the millions of out of print, and likely orphan, books.
Third, the agreement contemplates some monitoring of user queries and uses of books in the Book Search corpus that negatively impinge on significant privacy interests of authors and readers and undermine fundamental academic freedom principles.”
KlausGraf - am Freitag, 21. August 2009, 23:43 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.gda.bayern.de/findmittel/pdf/hsta_rkg_009_2009.pdf
Ein einziger Band der gedruckten Inventare ist somit online. Sonst steht eine moderne Verzeichnung in größerem Umfang meines Wissens nur in der Archivdatenbank des Landes Rheinland-Pfalz für Speyer online zur Verfügung, was in Anbetracht der Wichtigkeit dieser Erschließung ziemlich armselig ist.
Ein einziger Band der gedruckten Inventare ist somit online. Sonst steht eine moderne Verzeichnung in größerem Umfang meines Wissens nur in der Archivdatenbank des Landes Rheinland-Pfalz für Speyer online zur Verfügung, was in Anbetracht der Wichtigkeit dieser Erschließung ziemlich armselig ist.
KlausGraf - am Freitag, 21. August 2009, 21:57 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 21. August 2009, 17:56 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

