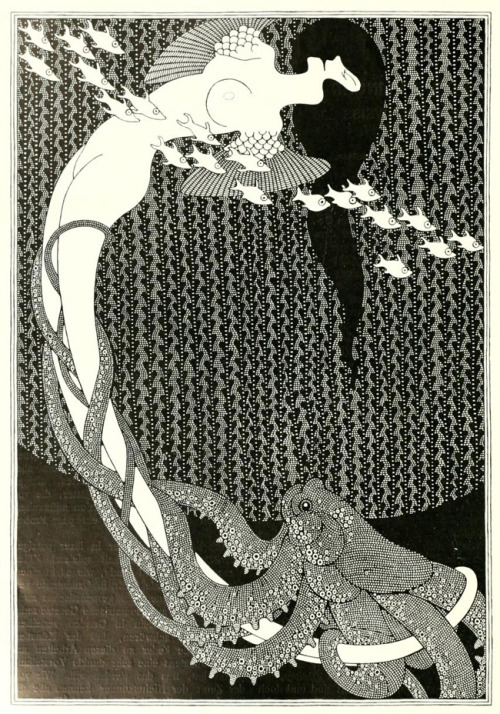KlausGraf - am Freitag, 30. Dezember 2011, 23:58 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Blue Shield hat am 20.Dezember ein Statement zum Brand der Bibliothek veröffentlicht: http://ancbs.org/images/pressreleases/20-12-2011_blueshield_statement_egypt_en.pdf
Auf der deutschen Blue Shield Seite habe ich meinen sehr detaillierten Überblick (auf English) online verfügbar gemacht. Er enthält Informationen, Presseauszüge, Bilder etc. und wird regelmäßig aktualisiert:
http://blueshield.de/institut.html
Derzeit sind keine zusätzlichen Freiwilligen vonnöten. In Kairo haben sich mehr Fremdsprachenkundige gemeldet, als die Nationalbibliothek bei den Sortierarbeiten eintakten kann.
Am 26. Dezember wurde eine neue Institutsleitung gewählt, da der bisherigen Direktor eine Woche nach dem Brand gestorben ist. Der neue Vizedirektor ist Prof. Ismail Serageldin, der Chef der Bibliotheca Alexandrina. Dadurch wird nun auch die andere große (und innovative) ägyptische Bibliothek eingebunden - aus meiner Sicht ist dies eine sehr kluge Entscheidung. Und dass er früher Vizedirektor der Weltbank war, könnte auch hilfreich sein ...
Rund 120 Bände aus der zerstörten Bibliothek sind digitalisiert worden und online abrufbar; dies war ein Projekt der Bibliotheca Alexandrina. Überhaupt ist Serageldin ein Befürworter der Digitalisierung. Er hat ein umfassendes Konzept für Ägypten entwickelt, es wurde jedoch in diesem Jahr von beiden Ministerpräsidenten abgelehnt.
[Zusatz KG: Siehe auch hier http://archiv.twoday.net/search?q=egypt ]
Auf der deutschen Blue Shield Seite habe ich meinen sehr detaillierten Überblick (auf English) online verfügbar gemacht. Er enthält Informationen, Presseauszüge, Bilder etc. und wird regelmäßig aktualisiert:
http://blueshield.de/institut.html
Derzeit sind keine zusätzlichen Freiwilligen vonnöten. In Kairo haben sich mehr Fremdsprachenkundige gemeldet, als die Nationalbibliothek bei den Sortierarbeiten eintakten kann.
Am 26. Dezember wurde eine neue Institutsleitung gewählt, da der bisherigen Direktor eine Woche nach dem Brand gestorben ist. Der neue Vizedirektor ist Prof. Ismail Serageldin, der Chef der Bibliotheca Alexandrina. Dadurch wird nun auch die andere große (und innovative) ägyptische Bibliothek eingebunden - aus meiner Sicht ist dies eine sehr kluge Entscheidung. Und dass er früher Vizedirektor der Weltbank war, könnte auch hilfreich sein ...
Rund 120 Bände aus der zerstörten Bibliothek sind digitalisiert worden und online abrufbar; dies war ein Projekt der Bibliotheca Alexandrina. Überhaupt ist Serageldin ein Befürworter der Digitalisierung. Er hat ein umfassendes Konzept für Ägypten entwickelt, es wurde jedoch in diesem Jahr von beiden Ministerpräsidenten abgelehnt.
[Zusatz KG: Siehe auch hier http://archiv.twoday.net/search?q=egypt ]
thomschu - am Freitag, 30. Dezember 2011, 23:04 - Rubrik: Kulturgut
Beim Stöbern in Informationen über das Internet Archive in San Francisco fand ich folgende Bilddatei:

(Bild: Dvortygirl, Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)
Interessant ist die Bildbeschreibung:
"An on-demand book printer at the Internet Archive headquarters in San Francisco, California. A finished copy of Darwin's On the Origin of Species emerges from a slot about 20 minutes after the job was started."
Dies erinnerte mich an eine Stelle in dem utopischen Roman "Ökotopia":
"[…] die Zeitungen […] können an elektronischen Kopie-Automaten an den Kiosken, in Büchereien und an anderen Stellen gekauft werden. Die Ausgabestellen stehen mit zentralen Computerspeichern in Verbindung, die von den Verlagen >gemietet< werden. […]
Dieses System erstreckt sich auch auf Buchveröffentlichungen. Während viele populäre Bücher normal gedruckt und an Kiosken und in Buchhandlungen verkauft werden, sind speziellere Titel nur über besondere Abrufleitungen erhältlich. Man sucht die Nummer des Buches im Katalog, drückt sie auf einer Tastatur […] und liest den Klappentext, Stichproben einzelner Kapitel sowie schließlich den Preis auf einem Videoschirm. […] Innerhalb weniger Minuten erscheint eine Kopie des Bandes in einem Ausgabeschlitz. Solche Bücherbanken werden meines Wissens von der Stadtbevölkerung nicht sehr häufig benutzt, weil sie die besser lesbaren gedruckten Bücher vorziehen; dafür findet man sie aber auch in entlegensten Winkeln Ökotopias, so daß sich auch die Bürger auf dem Lande sowohl mit der derzeit populären als auch mit Spezialliteratur eindecken können. […] jeder einzelne Band der riesigen Nationalbibliothek in Berkeley kann elektronisch abgerufen und übermittelt werden."
Ernest Callenbach: Ökotopia. Berlin: Rotbuch Verl. 1978, S. 148f.

(Bild: Dvortygirl, Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)
Interessant ist die Bildbeschreibung:
"An on-demand book printer at the Internet Archive headquarters in San Francisco, California. A finished copy of Darwin's On the Origin of Species emerges from a slot about 20 minutes after the job was started."
Dies erinnerte mich an eine Stelle in dem utopischen Roman "Ökotopia":
"[…] die Zeitungen […] können an elektronischen Kopie-Automaten an den Kiosken, in Büchereien und an anderen Stellen gekauft werden. Die Ausgabestellen stehen mit zentralen Computerspeichern in Verbindung, die von den Verlagen >gemietet< werden. […]
Dieses System erstreckt sich auch auf Buchveröffentlichungen. Während viele populäre Bücher normal gedruckt und an Kiosken und in Buchhandlungen verkauft werden, sind speziellere Titel nur über besondere Abrufleitungen erhältlich. Man sucht die Nummer des Buches im Katalog, drückt sie auf einer Tastatur […] und liest den Klappentext, Stichproben einzelner Kapitel sowie schließlich den Preis auf einem Videoschirm. […] Innerhalb weniger Minuten erscheint eine Kopie des Bandes in einem Ausgabeschlitz. Solche Bücherbanken werden meines Wissens von der Stadtbevölkerung nicht sehr häufig benutzt, weil sie die besser lesbaren gedruckten Bücher vorziehen; dafür findet man sie aber auch in entlegensten Winkeln Ökotopias, so daß sich auch die Bürger auf dem Lande sowohl mit der derzeit populären als auch mit Spezialliteratur eindecken können. […] jeder einzelne Band der riesigen Nationalbibliothek in Berkeley kann elektronisch abgerufen und übermittelt werden."
Ernest Callenbach: Ökotopia. Berlin: Rotbuch Verl. 1978, S. 148f.
SW - am Freitag, 30. Dezember 2011, 21:39 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.kanzlei.biz/nc/urteile/12-07-2011-olg-dresden-az-4-u-188-11.html
OLG Dresden mit Aussagen u.a. zum postmortalen Persönlichkeitsrecht.
OLG Dresden mit Aussagen u.a. zum postmortalen Persönlichkeitsrecht.
KlausGraf - am Freitag, 30. Dezember 2011, 20:04 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Peinlich, dass ein deutsches Gericht so etwas schreibt:
http://www.kanzlei.biz/nc/urteile/01-12-2011-ag-frankfurt-az-30-c-1849-11-25.html
Ansonsten ist der Entscheidung des AG Frankfurt, das sich gegen den von der herrschenden juristischen Meinung bejahten "fliegenden Gerichtsstand" in Internetsachen wendet, voll und ganz zuzustimmen:
"Mit dem Landgericht Krefeld ist das hier erkennende Gericht der Auffassung, dass einer „uferlosen Ausdehnung“ des „fliegenden Gerichtsstands“ im Hinblick auf das Gebot des gesetzlichen Richters und das Willkürverbot durch einschränkende Kriterien Einhalt gegeben werden muss. Das hier erkennende Gericht vermag nicht zu erkennen, warum für die urheberrechtswidrige und den Kläger in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzende Veröffentlichung des inkriminierten Artikels der Beklagten einschließlich eines Fotos des Klägers auf ihrer Internetplattform nach Wahl des Klägers beliebige Gerichtsstände von Flensburg bis Konstanz, von Saarbrücken bis Rostock eröffnet sein sollen, begrenzt lediglich durch die Zahl der vorhandenen Gerichte in Deutschland. "
http://www.kanzlei.biz/nc/urteile/01-12-2011-ag-frankfurt-az-30-c-1849-11-25.html
Ansonsten ist der Entscheidung des AG Frankfurt, das sich gegen den von der herrschenden juristischen Meinung bejahten "fliegenden Gerichtsstand" in Internetsachen wendet, voll und ganz zuzustimmen:
"Mit dem Landgericht Krefeld ist das hier erkennende Gericht der Auffassung, dass einer „uferlosen Ausdehnung“ des „fliegenden Gerichtsstands“ im Hinblick auf das Gebot des gesetzlichen Richters und das Willkürverbot durch einschränkende Kriterien Einhalt gegeben werden muss. Das hier erkennende Gericht vermag nicht zu erkennen, warum für die urheberrechtswidrige und den Kläger in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzende Veröffentlichung des inkriminierten Artikels der Beklagten einschließlich eines Fotos des Klägers auf ihrer Internetplattform nach Wahl des Klägers beliebige Gerichtsstände von Flensburg bis Konstanz, von Saarbrücken bis Rostock eröffnet sein sollen, begrenzt lediglich durch die Zahl der vorhandenen Gerichte in Deutschland. "
KlausGraf - am Freitag, 30. Dezember 2011, 18:58 - Rubrik: Archivrecht
In Baden-Württemberg wurden kürzlich, nach 2-jähriger Bearbeitungszeit, die Digitalisierung aller landesweit erstellten Kriegsgräberlisten aus den Jahren 1954-1968 abgeschlossen. Neben der Bestandserhaltung, soll dadurch auch eine einfacher Nutzung möglich sein.
Desweiteren ist vorgesehen, die Listen im kommenden Jahr auch im Internet öffentlich zugänglich zu machen.
Näheres dazu findet man man RP Stuttgart
http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1334864/index.html
und noch hier
http://www.mainpost.de/regional/main-tauber/Digitalisierung-der-Graeberlisten;art21526,6518815
Desweiteren ist vorgesehen, die Listen im kommenden Jahr auch im Internet öffentlich zugänglich zu machen.
Näheres dazu findet man man RP Stuttgart
http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1334864/index.html
und noch hier
http://www.mainpost.de/regional/main-tauber/Digitalisierung-der-Graeberlisten;art21526,6518815
A. Gaugele - am Freitag, 30. Dezember 2011, 11:49 - Rubrik: Erschließung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
„Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.“
Sagt Artikel 17 des deutschen Grundgesetzes. Siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Petitionsrecht
Die Petition ist für den Petenten kostenlos:
http://www.google.de/search?hl=de&q=%22kosten%20d%C3%BCrfen%20dem%20petenten%22&tbm=bks
Anders im skurril verkrusteten Alpenstaat. Da kosten "Eingaben von Privatpersonen (natürlichen und juristischen Personen) an Organe der Gebietskörperschaften in Angelegenheiten ihres öffentlich-rechtlichen Wirkungskreises, die die Privatinteressen der Einschreiter betreffen" 14,30 Euro - es sei denn eine der spärlichen Ausnahmen ist gegeben.
Obwohl der Gesetzeswortlaut eindeutig ist ("Privatinteressen"), wollte man jetzt für ein Protestschreiben einer Journalistin an das Innenressort gegen die geplante Abschiebung einer tschetschenischen Familie kassieren. Nach dem öffentlichen Aufschrei ruderte das Innenministerium zurück und versprach, in vergleichbaren Fällen künftig keine Eingabegebühr zu berechnen.
http://derstandard.at/1324501518329/Abschiebegegner-Innenministerium-nimmt-Gebuehr-fuer-Protestschreiben-zurueck
Nachtrag: Ich fand noch ein ziemlich abstruses Urteil
https://findok.bmf.gv.at/findok/link?bereich=ufs-tx&gz=%22RV%2F1298-L%2F02%22
Im Zusammenhang mit Aufsichtsbeschwerden besteht das verfassungsgesetzlich gewährleistete Petitionsrecht (Art. 11 Staatsgrundgesetz) in der Freiheit, Anträge allgemeiner Art an die Organe der Gesetzgebung oder Vollziehung zu stellen und die Erlassung bestimmter Anordnungen oder die Abstellung bestimmter rechtlicher Zustände zu begehren. Nur dann, wenn eine Eingabe solche Anträge oder Anregungen allgemeiner Art enthält, habe sie ausschließlich den Charakter einer Petition. Die Dienstaufsicht sei zwar im öffentlichen Interesse auszuüben, es könne aber ein Einschreiter durchaus ein Privatinteresse daran haben, dass diese Dienstaufsicht von der Aufsichtsbehörde ausgeübt wird, und wenn er dann eine Aufsichtsbeschwerde überreicht, so überreicht er diese zumindest auch in seinem privaten Interesse. Das Aufzeigen von Unzukömmlichkeiten in Verwaltung oder Rechtspflege kann jedoch nicht schon deshalb, weil der Anlass auch ihre Interessen berührt hat, als eine Angelegenheit angesehen werden, die die Privatinteressen des Einschreiters betrifft. Kein Privatinteresse ist bei Eingaben anzunehmen, in denen zum Vorteil der Allgemeinheit tatsächliche oder vermeintliche Unzkömmlichkeiten in der Verwaltung aufgezeigt werden und deren Beseitigung angeregt wird. Dies gilt selbst dann, wenn der Anlass der Eingabe eine die Privatinteressen des Einschreiters berührende Angelegenheit betrifft. Beschwerden, die einen eigenen konkreten Fall des Einschreiters nur zum Anlass nehmen, um die Behörde im Interesse der Allgemeinheit auf die Wahrnehmung der Dienstaufsicht hinzuweisen, sind daher gebührenfrei. Strebt der Einschreiter mit seiner Beschwerde aber gleichzeitig die Beseitigung oder Änderung der ihn betreffenden behördlichen Verfügung oder die Erteilung einer Information an, so ist die Eingabe - wenn im konkreten Fall nicht eine sachliche Gebührenbefreiung Platz greift - gebührenpflichtig.
Historische Verfassungstexte zum Petitionsrecht nach
http://www.schmitz-www.de/SiteH1.data/Komponenten/petition03material.pdf
preuß. ALR 1794:
§ 156 II (Teil) 20 (Titel)
Dagegen steht einem jeden frey, seine Zweifel, Einwendungen und Bedenklichkeiten gegen Gesetze und
andere Anordnungen im Staate sowie überhaupt seine Bemerkungen und Vorschläge über Mängel und Verbesserungen sowohl dem Oberhaupt des Staates als den Vorgesetzten der Departements anzuzeigen; und letztere sind dergleichen Anzeigen mit erforderlicher Aufmerksamkeit zu prüfen verpflichtet.
PaulskirchenV 1849:
§ 159
(1) Jeder Deutsche hat das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden schriftlich an die Behörden, an die
Volksvertretungen und an den Reichstag zu wenden.
(2) Dieses Recht kann sowohl von Einzelnen als von Corporationen und von Mehreren im Vereine ausgeübt
werden; beim Heer und der Kriegsflotte jedoch nur in der Weise, wie es die Disciplinarvorschriften bestimmen.
§ 160
Eine vorgängige Genehmigung der Behörden ist nicht notwendig, um öffentliche Beamte wegen ihrer amtlichen Handlungen gerichtlich zu verfolgen.
RV 1871:
Art. 23
Der Reichstag hat das Recht, innerhalb der Kompetenz des Reichs Gesetze vorzuschlagen und an ihn gerichtete Petitionen dem Bundesrate ... zu überweisen.
WRV:
Art. 126
Jeder Deutsche hat das Recht, sich schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständige Behörde oder
an die Volksvertretung zu wenden. Dieses Recht kann sowohl von Einzelnen als auch von mehreren gemeinsam ausgeübt werden.
Zu Petitionen bei Gemeindevertretungen
http://www.anwalt-offenbach.de/petit.html
 http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Petitions
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Petitions
Sagt Artikel 17 des deutschen Grundgesetzes. Siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Petitionsrecht
Die Petition ist für den Petenten kostenlos:
http://www.google.de/search?hl=de&q=%22kosten%20d%C3%BCrfen%20dem%20petenten%22&tbm=bks
Anders im skurril verkrusteten Alpenstaat. Da kosten "Eingaben von Privatpersonen (natürlichen und juristischen Personen) an Organe der Gebietskörperschaften in Angelegenheiten ihres öffentlich-rechtlichen Wirkungskreises, die die Privatinteressen der Einschreiter betreffen" 14,30 Euro - es sei denn eine der spärlichen Ausnahmen ist gegeben.
Obwohl der Gesetzeswortlaut eindeutig ist ("Privatinteressen"), wollte man jetzt für ein Protestschreiben einer Journalistin an das Innenressort gegen die geplante Abschiebung einer tschetschenischen Familie kassieren. Nach dem öffentlichen Aufschrei ruderte das Innenministerium zurück und versprach, in vergleichbaren Fällen künftig keine Eingabegebühr zu berechnen.
http://derstandard.at/1324501518329/Abschiebegegner-Innenministerium-nimmt-Gebuehr-fuer-Protestschreiben-zurueck
Nachtrag: Ich fand noch ein ziemlich abstruses Urteil
https://findok.bmf.gv.at/findok/link?bereich=ufs-tx&gz=%22RV%2F1298-L%2F02%22
Im Zusammenhang mit Aufsichtsbeschwerden besteht das verfassungsgesetzlich gewährleistete Petitionsrecht (Art. 11 Staatsgrundgesetz) in der Freiheit, Anträge allgemeiner Art an die Organe der Gesetzgebung oder Vollziehung zu stellen und die Erlassung bestimmter Anordnungen oder die Abstellung bestimmter rechtlicher Zustände zu begehren. Nur dann, wenn eine Eingabe solche Anträge oder Anregungen allgemeiner Art enthält, habe sie ausschließlich den Charakter einer Petition. Die Dienstaufsicht sei zwar im öffentlichen Interesse auszuüben, es könne aber ein Einschreiter durchaus ein Privatinteresse daran haben, dass diese Dienstaufsicht von der Aufsichtsbehörde ausgeübt wird, und wenn er dann eine Aufsichtsbeschwerde überreicht, so überreicht er diese zumindest auch in seinem privaten Interesse. Das Aufzeigen von Unzukömmlichkeiten in Verwaltung oder Rechtspflege kann jedoch nicht schon deshalb, weil der Anlass auch ihre Interessen berührt hat, als eine Angelegenheit angesehen werden, die die Privatinteressen des Einschreiters betrifft. Kein Privatinteresse ist bei Eingaben anzunehmen, in denen zum Vorteil der Allgemeinheit tatsächliche oder vermeintliche Unzkömmlichkeiten in der Verwaltung aufgezeigt werden und deren Beseitigung angeregt wird. Dies gilt selbst dann, wenn der Anlass der Eingabe eine die Privatinteressen des Einschreiters berührende Angelegenheit betrifft. Beschwerden, die einen eigenen konkreten Fall des Einschreiters nur zum Anlass nehmen, um die Behörde im Interesse der Allgemeinheit auf die Wahrnehmung der Dienstaufsicht hinzuweisen, sind daher gebührenfrei. Strebt der Einschreiter mit seiner Beschwerde aber gleichzeitig die Beseitigung oder Änderung der ihn betreffenden behördlichen Verfügung oder die Erteilung einer Information an, so ist die Eingabe - wenn im konkreten Fall nicht eine sachliche Gebührenbefreiung Platz greift - gebührenpflichtig.
Historische Verfassungstexte zum Petitionsrecht nach
http://www.schmitz-www.de/SiteH1.data/Komponenten/petition03material.pdf
preuß. ALR 1794:
§ 156 II (Teil) 20 (Titel)
Dagegen steht einem jeden frey, seine Zweifel, Einwendungen und Bedenklichkeiten gegen Gesetze und
andere Anordnungen im Staate sowie überhaupt seine Bemerkungen und Vorschläge über Mängel und Verbesserungen sowohl dem Oberhaupt des Staates als den Vorgesetzten der Departements anzuzeigen; und letztere sind dergleichen Anzeigen mit erforderlicher Aufmerksamkeit zu prüfen verpflichtet.
PaulskirchenV 1849:
§ 159
(1) Jeder Deutsche hat das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden schriftlich an die Behörden, an die
Volksvertretungen und an den Reichstag zu wenden.
(2) Dieses Recht kann sowohl von Einzelnen als von Corporationen und von Mehreren im Vereine ausgeübt
werden; beim Heer und der Kriegsflotte jedoch nur in der Weise, wie es die Disciplinarvorschriften bestimmen.
§ 160
Eine vorgängige Genehmigung der Behörden ist nicht notwendig, um öffentliche Beamte wegen ihrer amtlichen Handlungen gerichtlich zu verfolgen.
RV 1871:
Art. 23
Der Reichstag hat das Recht, innerhalb der Kompetenz des Reichs Gesetze vorzuschlagen und an ihn gerichtete Petitionen dem Bundesrate ... zu überweisen.
WRV:
Art. 126
Jeder Deutsche hat das Recht, sich schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständige Behörde oder
an die Volksvertretung zu wenden. Dieses Recht kann sowohl von Einzelnen als auch von mehreren gemeinsam ausgeübt werden.
Zu Petitionen bei Gemeindevertretungen
http://www.anwalt-offenbach.de/petit.html
 http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Petitions
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PetitionsKlausGraf - am Donnerstag, 29. Dezember 2011, 17:39 - Rubrik: Archivrecht
Citizen Archivist Dashboard:
http://www.archives.gov/citizen-archivist/
Siehe etwa: "Researchers scan and photograph National Archives records every day in our research rooms across the country -- that’s a lot of digital images for records that are not yet available online. If you have taken scans or photographs of records you can help make them accessible to the public and other researchers by sharing your images with the National Archives Citizen Archivist Research Group on Flickr." Für den typischen deutschen Archivar, der sich als Zwingherr seiner Bestände aufspielt, wäre das der größte anzunehmende Unfall.
http://www.archives.gov/citizen-archivist/
Siehe etwa: "Researchers scan and photograph National Archives records every day in our research rooms across the country -- that’s a lot of digital images for records that are not yet available online. If you have taken scans or photographs of records you can help make them accessible to the public and other researchers by sharing your images with the National Archives Citizen Archivist Research Group on Flickr." Für den typischen deutschen Archivar, der sich als Zwingherr seiner Bestände aufspielt, wäre das der größte anzunehmende Unfall.
KlausGraf - am Donnerstag, 29. Dezember 2011, 15:58 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sagt Richard Heigl:
http://kritischegeschichte.wordpress.com/2011/12/28/public-historians-dahin-gehen-wo-es-brennt/
Auf dessen Kommentar
http://archiv.twoday.net/stories/55775415/#59213634
ausdrücklich aufmerksam gemacht sei.
http://kritischegeschichte.wordpress.com/2011/12/28/public-historians-dahin-gehen-wo-es-brennt/
Auf dessen Kommentar
http://archiv.twoday.net/stories/55775415/#59213634
ausdrücklich aufmerksam gemacht sei.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Reiner Wieland, Gründer des Schriftgut-Archivs Ostwürttemberg, veröffentlichte 1997 in Heft 93 von ostalb/einhorn S. 60f. folgenden Nachruf, wobei er sich auf einen Text von mir stützen konnte.
Herta Graf (1911-1996)
Kurz vor der Vollendung des 85. Lebensjahres ist die Schriftstellerin
Herta Graf am 16. Dezember 1996 in Schorndorf nach kurzer schwerer
Krankheit verstorben. Schon in jungen Jahren entdeckte sie für sich die
Literatur als Ausdrucksmittel. Gedichte, Erzählungen, Romane,
Reisebeschreibungen - nur weniges davon wurde im Druck veröffentlicht.
Ihrem Wunsch entsprechend wird das "Schriftgut-Archiv Ostwürttemberg"
ihren literarischen Nachlaß übernehmen. Noch mit letzter Kraft konnte
Herta Graf ihre Lebenserinnerungen "Mit Dünawasser getauft" vollenden,
ein stattliches Manuskript von rund 240 Schreibmaschinenseiten, gewidmet
ihrer Jugend im Baltikum bis zur Umsiedlung von 1939. Es bleibt zu
hoffen, daß es bald gelingt, einen Verlag für dieses eindrucksvolle,
atmosphärisch dichte Werk zu finden. Neben einfühlsamen
Naturschilderungen besonders ansprechend ist darin die Beschreibung des
"multikulturellen" Zusammenlebens im lettischen Staat zwischen den
Weltkriegen. Zeitlebens fühlte sie sich als Baltendeutsche mit
lettischen Verwandten der lettischen Kultur sehr verbunden.
Herta Graf, geborene Enderneit, kam zur Welt am 28. Dezember 1911
und lebte bis 1939 in ihrer Geburtsstadt Riga. Geprägt vom hanseatischen
Luthertum der deutschen Gemeinde dieser weltoffenen Kaufmannsstadt, trat
sie nach dem Besuch der Handelsschule ihre erste Stelle an: bei der
"Baltischen Rußlandarbeit", einer Institution der evangelischen Kirche,
die vor allem protestantische Pastoren betreute - für die junge Frau
weit mehr als ein Brotberuf. Schon in der Kindheit konfrontiert mit dem
bolschewistischen Terror, entschied sich ihre Familie 1939 für die
Auswanderung nach Deutschland, wurde jedoch vom Nazi-Regime auf
polnischem Staatsgebiet in Posen angesiedelt. Tätig bei einem Posener
Verlag, fand Herta Graf Gefallen am Schreiben und veröffentlichte
Erstlingsversuche in Posener Zeitungen. Bald nach der Heirat 1944 mußte
sie 1945 wie viele ihrer Landsleute fliehen. Sie lebte zunächst bei der
Familie ihres Mannes in der Matthesmühle bei Wemding
(Bayerisch-Schwaben), anschließend in Wallerstein und Wustenriet bei
Schwäbisch Gmünd, bevor sie 1958 nach Schwäbisch Gmünd hinabzog. Im
gleichen Jahr wurde ihr Sohn Klaus geboren, der sich als Historiker
seiner Heimatstadt einen Namen gemacht hat. Seit 1989 wohnte Herta Graf
bei einer befreundeten Familie in Schorndorf.
Bis zuletzt war sie geistig äußerst vital, kulturell vielseitig
interessiert, aufgeschlossen für alles Musische. Am wohlsten fühlte sie
sich auf ihren unzähligen Reisen. Sie genoß die Begegnung mit der Kunst,
Geschichte und Landschaft fremder Länder. Am meisten faszinierte sie das
kulturelle Erbe Italiens. Außerordentlich sprachbegabt, sprach sie
Lettisch und Russisch fließend, beherrschte darüberhinaus Englisch,
Italienisch, Französisch und sogar die Anfangsgründe des Lateinischen.
(Nur mit dem Schwäbischen haperte es etwas ...) Besonders interessiert
war sie an der Sprachgeschichte und insbesondere an den indogermanischen
Wurzeln der europäischen Sprachen. Als eine Art Hobby pflegte sie die
Bauernmalerei, verzierte Schränke, aber auch Spanschachteln mit
kunstvollen Blumenornamenten. Wer ihr begegnete, war auf Anhieb
eingenommen von der jugendlich lebhaften Freundlichkeit und
Bescheidenheit ihres Charakters.
1955 erschien in einem Sammelwerk der Heimatvertriebenen "Aber das
Herz hängt daran" ihre nach einem Preisausschreiben ausgewählte
baltische Erzählung "Der Weg nach Rom". Einige Zeit später folgte die
Erzählung "Die Nacht der Gnade" (in einem Sammelbändchen "Urlaub in
Butzengrün"). 1959 veröffentlichte der Stuttgarter Quell-Verlag das
Büchlein "Fräulein Bertram feiert Weihnachten", aus der die Erzählung
"Ein feste Burg ist unser Gott", versehen mit einer Kurzvorstellung
"Poesie aus fraulichem Herzen" durch den Schriftleiter Eduard Funk, auch
in Heft 38 der Gmünder Heimatzeitschrift "einhorn" abgedruckt wurde.
1963 kam, ebenfalls im Quell-Verlag, die Erzählung "Sommerkind Silvia"
heraus. Aus familiären Rücksichten stellte Herta Graf das Publizieren in
der Folgezeit fast völlig ein. Gelegentlich erschien von ihr ein
Gedicht, so 1994 im Band "Labile Harmonien" des Einhorn-Verlags, und
sporadisch schrieb sie für die Gmünder Tageszeitungen Berichte über
kulturelle Veranstaltungen.
Obwohl sie an ihrer alten Heimat Riga hing, lebte Herta Graf sehr
gern in der traditionsreichen Reichsstadt an der Rems mit ihrem
vielgestaltigen kulturellen Angebot. Und so mag denn auch eine kleine
poetische Huldigung an die Atmosphäre der Stadt am Schluß dieses
Nachrufs stehen, entnommen der genannten Weihnachtserzählung "Ein feste
Burg ist unser Gott": "Unten lag die Stadt Gmünd im Scheine unzähliger
Lichter. Der Himmel hinter dem Münster glänzte davon in einem sanften,
ockerfarbenen Ton wie Seide. Glühbirnen zeichneten die Konturen der
Giebel auf dem Marktplatze nach. Die Straßenlampen, die an unsichtbaren
Drähten schwangen, glichen fernen, bläulichen Monden. Alles Licht aber
sammelte sich in einem irrealen Glanz um das Heilig-Kreuz-Münster, das
mit seinem gewaltigen Baukörper auch die höchsten Häuser der Stadt
überragte. Das Dach mit dem zierlichen Dachreiter darüber schimmerte wie
ein sehr dunkler Kobalt. So hell war das Licht, daß Fräulein Bertram
deutlich die Fialen und Kreuzblumen, das Maßwerk der Fenster und die
chimärenhaften Fratzen der Wasserspeier wahrzunehmen meinte. Nun
schwebte Glockenklang den Hügel herauf. Unten in Gmünd läutete man zur
Christmette."
Unterlagen Schriftgut-Archiv Ostwürttemberg
Eine einfühlsame Würdigung von Herta Graf veröffentlichte Elke Heer in: Literarische Vielfalt in Ostwürttemberg. Frauen greifen zur Feder I. Schwäbisch Gmünd 2008, S. 24-31
Von den erwähnten Lebenserinnerungen sind zwei Auszüge online:
http://archiv.twoday.net/stories/11502453/
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/riga_vi.htm
Nachtrag:
http://de.wikipedia.org/wiki/Herta_Graf
http://www.dichter.in/2011/12/herta-graf-venedig.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Herta_Graf (Texte unter CC-BY, darunter ein siebenseitiger Lebenslauf von 1979)
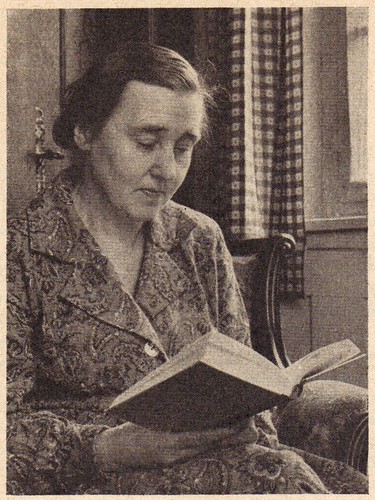
Herta Graf (1911-1996)
Kurz vor der Vollendung des 85. Lebensjahres ist die Schriftstellerin
Herta Graf am 16. Dezember 1996 in Schorndorf nach kurzer schwerer
Krankheit verstorben. Schon in jungen Jahren entdeckte sie für sich die
Literatur als Ausdrucksmittel. Gedichte, Erzählungen, Romane,
Reisebeschreibungen - nur weniges davon wurde im Druck veröffentlicht.
Ihrem Wunsch entsprechend wird das "Schriftgut-Archiv Ostwürttemberg"
ihren literarischen Nachlaß übernehmen. Noch mit letzter Kraft konnte
Herta Graf ihre Lebenserinnerungen "Mit Dünawasser getauft" vollenden,
ein stattliches Manuskript von rund 240 Schreibmaschinenseiten, gewidmet
ihrer Jugend im Baltikum bis zur Umsiedlung von 1939. Es bleibt zu
hoffen, daß es bald gelingt, einen Verlag für dieses eindrucksvolle,
atmosphärisch dichte Werk zu finden. Neben einfühlsamen
Naturschilderungen besonders ansprechend ist darin die Beschreibung des
"multikulturellen" Zusammenlebens im lettischen Staat zwischen den
Weltkriegen. Zeitlebens fühlte sie sich als Baltendeutsche mit
lettischen Verwandten der lettischen Kultur sehr verbunden.
Herta Graf, geborene Enderneit, kam zur Welt am 28. Dezember 1911
und lebte bis 1939 in ihrer Geburtsstadt Riga. Geprägt vom hanseatischen
Luthertum der deutschen Gemeinde dieser weltoffenen Kaufmannsstadt, trat
sie nach dem Besuch der Handelsschule ihre erste Stelle an: bei der
"Baltischen Rußlandarbeit", einer Institution der evangelischen Kirche,
die vor allem protestantische Pastoren betreute - für die junge Frau
weit mehr als ein Brotberuf. Schon in der Kindheit konfrontiert mit dem
bolschewistischen Terror, entschied sich ihre Familie 1939 für die
Auswanderung nach Deutschland, wurde jedoch vom Nazi-Regime auf
polnischem Staatsgebiet in Posen angesiedelt. Tätig bei einem Posener
Verlag, fand Herta Graf Gefallen am Schreiben und veröffentlichte
Erstlingsversuche in Posener Zeitungen. Bald nach der Heirat 1944 mußte
sie 1945 wie viele ihrer Landsleute fliehen. Sie lebte zunächst bei der
Familie ihres Mannes in der Matthesmühle bei Wemding
(Bayerisch-Schwaben), anschließend in Wallerstein und Wustenriet bei
Schwäbisch Gmünd, bevor sie 1958 nach Schwäbisch Gmünd hinabzog. Im
gleichen Jahr wurde ihr Sohn Klaus geboren, der sich als Historiker
seiner Heimatstadt einen Namen gemacht hat. Seit 1989 wohnte Herta Graf
bei einer befreundeten Familie in Schorndorf.
Bis zuletzt war sie geistig äußerst vital, kulturell vielseitig
interessiert, aufgeschlossen für alles Musische. Am wohlsten fühlte sie
sich auf ihren unzähligen Reisen. Sie genoß die Begegnung mit der Kunst,
Geschichte und Landschaft fremder Länder. Am meisten faszinierte sie das
kulturelle Erbe Italiens. Außerordentlich sprachbegabt, sprach sie
Lettisch und Russisch fließend, beherrschte darüberhinaus Englisch,
Italienisch, Französisch und sogar die Anfangsgründe des Lateinischen.
(Nur mit dem Schwäbischen haperte es etwas ...) Besonders interessiert
war sie an der Sprachgeschichte und insbesondere an den indogermanischen
Wurzeln der europäischen Sprachen. Als eine Art Hobby pflegte sie die
Bauernmalerei, verzierte Schränke, aber auch Spanschachteln mit
kunstvollen Blumenornamenten. Wer ihr begegnete, war auf Anhieb
eingenommen von der jugendlich lebhaften Freundlichkeit und
Bescheidenheit ihres Charakters.
1955 erschien in einem Sammelwerk der Heimatvertriebenen "Aber das
Herz hängt daran" ihre nach einem Preisausschreiben ausgewählte
baltische Erzählung "Der Weg nach Rom". Einige Zeit später folgte die
Erzählung "Die Nacht der Gnade" (in einem Sammelbändchen "Urlaub in
Butzengrün"). 1959 veröffentlichte der Stuttgarter Quell-Verlag das
Büchlein "Fräulein Bertram feiert Weihnachten", aus der die Erzählung
"Ein feste Burg ist unser Gott", versehen mit einer Kurzvorstellung
"Poesie aus fraulichem Herzen" durch den Schriftleiter Eduard Funk, auch
in Heft 38 der Gmünder Heimatzeitschrift "einhorn" abgedruckt wurde.
1963 kam, ebenfalls im Quell-Verlag, die Erzählung "Sommerkind Silvia"
heraus. Aus familiären Rücksichten stellte Herta Graf das Publizieren in
der Folgezeit fast völlig ein. Gelegentlich erschien von ihr ein
Gedicht, so 1994 im Band "Labile Harmonien" des Einhorn-Verlags, und
sporadisch schrieb sie für die Gmünder Tageszeitungen Berichte über
kulturelle Veranstaltungen.
Obwohl sie an ihrer alten Heimat Riga hing, lebte Herta Graf sehr
gern in der traditionsreichen Reichsstadt an der Rems mit ihrem
vielgestaltigen kulturellen Angebot. Und so mag denn auch eine kleine
poetische Huldigung an die Atmosphäre der Stadt am Schluß dieses
Nachrufs stehen, entnommen der genannten Weihnachtserzählung "Ein feste
Burg ist unser Gott": "Unten lag die Stadt Gmünd im Scheine unzähliger
Lichter. Der Himmel hinter dem Münster glänzte davon in einem sanften,
ockerfarbenen Ton wie Seide. Glühbirnen zeichneten die Konturen der
Giebel auf dem Marktplatze nach. Die Straßenlampen, die an unsichtbaren
Drähten schwangen, glichen fernen, bläulichen Monden. Alles Licht aber
sammelte sich in einem irrealen Glanz um das Heilig-Kreuz-Münster, das
mit seinem gewaltigen Baukörper auch die höchsten Häuser der Stadt
überragte. Das Dach mit dem zierlichen Dachreiter darüber schimmerte wie
ein sehr dunkler Kobalt. So hell war das Licht, daß Fräulein Bertram
deutlich die Fialen und Kreuzblumen, das Maßwerk der Fenster und die
chimärenhaften Fratzen der Wasserspeier wahrzunehmen meinte. Nun
schwebte Glockenklang den Hügel herauf. Unten in Gmünd läutete man zur
Christmette."
Unterlagen Schriftgut-Archiv Ostwürttemberg
Eine einfühlsame Würdigung von Herta Graf veröffentlichte Elke Heer in: Literarische Vielfalt in Ostwürttemberg. Frauen greifen zur Feder I. Schwäbisch Gmünd 2008, S. 24-31
Von den erwähnten Lebenserinnerungen sind zwei Auszüge online:
http://archiv.twoday.net/stories/11502453/
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/riga_vi.htm
Nachtrag:
http://de.wikipedia.org/wiki/Herta_Graf
http://www.dichter.in/2011/12/herta-graf-venedig.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Herta_Graf (Texte unter CC-BY, darunter ein siebenseitiger Lebenslauf von 1979)
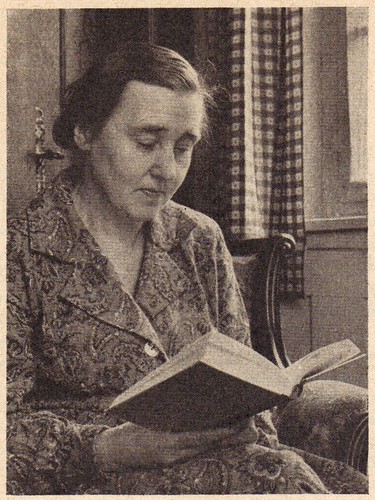
KlausGraf - am Mittwoch, 28. Dezember 2011, 19:05 - Rubrik: Literaturarchive
Am 20. März 2011 versandte ich die folgende Mail:
Hochwuerdiger Herr Propst, dear Mr. Schoenberg, sehr geehrte Damen und Herren,
wie ich unter
http://archiv.twoday.net/stories/15732139/
ausfuehre, vermute ich, dass Cod. Herzogenburg 82, 1444 wohl fuer die
Katharinenkapelle der Gotzoburg in Krems geschrieben, identisch ist
mit LJS 10. Mich wuerde nun interessieren, ob diese Identitaet
bestaetigt werden kann, und wenn ja: ob der Codex rechtmaessig das
Stift Herzogenburg verlassen hat, wie und wann er in die Sammlung
Schoenberg kam und ob er dort verbleiben soll.
Besten Dank im voraus fuer eine Mitteilung und freundliche Gruesse
Dr. Klaus Graf
Neuss/Aachen
Zu diesem Zeitpunkt war mir noch nicht klar, dass Schoenberg die Handschrift 2001 die Handschrift bei Sotheby's verkauft hatte. Das von mir verlinkte Bild aus der Handschrift ist unter der angegebenen Adresse nicht mehr erreichbar [aber noch online, jetzt auch auf Commons
 ]
]
Meine Mail ging an
praelatur@stift-herzogenburg.at;
"ljschoenberg@verizon.net"
cc Otto.Kresten@univie.ac.at;
ksbm@oeaw.ac.at;
"andreas.fingernagel@onb.ac.at" ;
dmcknigh@pobox.upenn.edu;
kulturamt@krems.gv.at;
w-metzger@web.de
Schoenberg wies mich auf Nachfrage darauf hin, dass er nur auf Englisch korrespondiere.
Am 28. März schrieb mir Dr. Helga Penz, die ich als Archivarin von Herzogenburg zusätzlich unterrichtet hatte, nachdem keine unmittelbare Antwort kam: "Sehr geehrter Herr Graf,
vor 8 Tagen verstarb völlig unerwartet in seinem 46. Lebensjahr der Stiftsdechant von Herzogenburg. Heute findet sein Begräbnis statt. Ich bin sicher, dass unser Stiftsbibliothekar Ihre Nachricht in Evidenz hat und bitte darum, ihm Zeit für seine Nachforschungen zu geben, bis die arbeitsintensivste Zeit - die österliche - vorüber ist." Bei einem späteren längeren Telefonat erläuterte Frau Penz, weshalb es angeblich bislang unmöglich gewesen sein, dass der Stiftsbibliothekar mir antwortete. Wir einigten uns darauf, dass man ja doch immerhin überprüfen könne, ob das Sotheby's-Foto aus der Handschrift mit dem Mikrofilm übereinstimme. Daraufhin war wieder Funkstille, das Stift Herzogenburg hat es also seit März 2011 nicht für nötig empfunden, sich mit mir wegen meines Nachweises, dass eine offenbar dem Stift gestohlene Handschrift sich bis zur Versteigerung bei Sotheby's 2001 in der Sammlung Schoenbergs befand, schriftlich in Verbindung zu setzen.
Keine Antwort kam von der HMML, die ich um einen Vergleich des Sotheby's-Fotos mit ihrem Mikrofilm bat. [Update: M. Heintzelman reagierte sofort auf eine Mail vom heutigen Tag und entschuldigte sich für die Nichtbeantwortung. Er gab als Verfilmungsdatum 1966 an. Die Verfilmung der Herzogenburger Handschriften wurde am 17. April 1966 abgeschlossen. Ein Vergleich des Fotos bei Sotheby's ergab die Identität mit Herzogenburg 82: "I have now checked the microfilm of this manuscript and indeed, the photo cited below appears to be from the same leaf as fol. 188v in the HMML microfilm. So the identity of this manuscript appears to be verified as Herzogenburg ms. 82." M. Heintzelman an die Mailing-List Exlibris, 28.12.2011.]
Ansonsten reagierten auf die Mail nur Franz Lackner und das Kulturamt Krems ("Zu Ihrem Rundschreiben vom 20. März müssen wir mitteilen, dass es in Krems dazu keinerlei Unterlagen gibt.")
In manuscripta.at findet sich zu Herzogenburg 82 ein Link auf meinen Archivalia-Beitrag. Allerdings wird der Eindruck erweckt, die Handschrift befinde sich noch in Philadelphia (was ich ursprünglich annahm).
http://manuscripta.at/?ID=27181
Ich denke, ich brauche das Ganze nicht noch zu kommentieren.
Hochwuerdiger Herr Propst, dear Mr. Schoenberg, sehr geehrte Damen und Herren,
wie ich unter
http://archiv.twoday.net/stories/15732139/
ausfuehre, vermute ich, dass Cod. Herzogenburg 82, 1444 wohl fuer die
Katharinenkapelle der Gotzoburg in Krems geschrieben, identisch ist
mit LJS 10. Mich wuerde nun interessieren, ob diese Identitaet
bestaetigt werden kann, und wenn ja: ob der Codex rechtmaessig das
Stift Herzogenburg verlassen hat, wie und wann er in die Sammlung
Schoenberg kam und ob er dort verbleiben soll.
Besten Dank im voraus fuer eine Mitteilung und freundliche Gruesse
Dr. Klaus Graf
Neuss/Aachen
Zu diesem Zeitpunkt war mir noch nicht klar, dass Schoenberg die Handschrift 2001 die Handschrift bei Sotheby's verkauft hatte. Das von mir verlinkte Bild aus der Handschrift ist unter der angegebenen Adresse nicht mehr erreichbar [aber noch online, jetzt auch auf Commons
 ]
]Meine Mail ging an
praelatur@stift-herzogenburg.at;
"ljschoenberg@verizon.net"
cc Otto.Kresten@univie.ac.at;
ksbm@oeaw.ac.at;
"andreas.fingernagel@onb.ac.at" ;
dmcknigh@pobox.upenn.edu;
kulturamt@krems.gv.at;
w-metzger@web.de
Schoenberg wies mich auf Nachfrage darauf hin, dass er nur auf Englisch korrespondiere.
Am 28. März schrieb mir Dr. Helga Penz, die ich als Archivarin von Herzogenburg zusätzlich unterrichtet hatte, nachdem keine unmittelbare Antwort kam: "Sehr geehrter Herr Graf,
vor 8 Tagen verstarb völlig unerwartet in seinem 46. Lebensjahr der Stiftsdechant von Herzogenburg. Heute findet sein Begräbnis statt. Ich bin sicher, dass unser Stiftsbibliothekar Ihre Nachricht in Evidenz hat und bitte darum, ihm Zeit für seine Nachforschungen zu geben, bis die arbeitsintensivste Zeit - die österliche - vorüber ist." Bei einem späteren längeren Telefonat erläuterte Frau Penz, weshalb es angeblich bislang unmöglich gewesen sein, dass der Stiftsbibliothekar mir antwortete. Wir einigten uns darauf, dass man ja doch immerhin überprüfen könne, ob das Sotheby's-Foto aus der Handschrift mit dem Mikrofilm übereinstimme. Daraufhin war wieder Funkstille, das Stift Herzogenburg hat es also seit März 2011 nicht für nötig empfunden, sich mit mir wegen meines Nachweises, dass eine offenbar dem Stift gestohlene Handschrift sich bis zur Versteigerung bei Sotheby's 2001 in der Sammlung Schoenbergs befand, schriftlich in Verbindung zu setzen.
Keine Antwort kam von der HMML, die ich um einen Vergleich des Sotheby's-Fotos mit ihrem Mikrofilm bat. [Update: M. Heintzelman reagierte sofort auf eine Mail vom heutigen Tag und entschuldigte sich für die Nichtbeantwortung. Er gab als Verfilmungsdatum 1966 an. Die Verfilmung der Herzogenburger Handschriften wurde am 17. April 1966 abgeschlossen. Ein Vergleich des Fotos bei Sotheby's ergab die Identität mit Herzogenburg 82: "I have now checked the microfilm of this manuscript and indeed, the photo cited below appears to be from the same leaf as fol. 188v in the HMML microfilm. So the identity of this manuscript appears to be verified as Herzogenburg ms. 82." M. Heintzelman an die Mailing-List Exlibris, 28.12.2011.]
Ansonsten reagierten auf die Mail nur Franz Lackner und das Kulturamt Krems ("Zu Ihrem Rundschreiben vom 20. März müssen wir mitteilen, dass es in Krems dazu keinerlei Unterlagen gibt.")
In manuscripta.at findet sich zu Herzogenburg 82 ein Link auf meinen Archivalia-Beitrag. Allerdings wird der Eindruck erweckt, die Handschrift befinde sich noch in Philadelphia (was ich ursprünglich annahm).
http://manuscripta.at/?ID=27181
Ich denke, ich brauche das Ganze nicht noch zu kommentieren.
KlausGraf - am Mittwoch, 28. Dezember 2011, 16:54 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://actapublica.eu
Eine Kooperation von Archiven in Brünn, Pilsen und Prag sowie des Diözesanarchivs St. Pölten. Die ohne Registrierung aufrufbaren Digitalisate sind mit einem Wasserzeichen verziert.
Via
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/59213302/
Eine Kooperation von Archiven in Brünn, Pilsen und Prag sowie des Diözesanarchivs St. Pölten. Die ohne Registrierung aufrufbaren Digitalisate sind mit einem Wasserzeichen verziert.
Via
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/59213302/
KlausGraf - am Mittwoch, 28. Dezember 2011, 16:03 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"December 16, 2011 was an important day for the study of Hermeticism and related currents. After a year of disaster, in which the Bibliotheca Philosophica Hermetica came close to extinction, the library re-opened its doors to the public and celebrated that event with a new exhibition, Infinite Fire."
http://www.ritmanlibrary.com/2011/12/per-aspera-ad-fontes/
Die Bibliothek soll nun schuldenfrei sein:
http://www.ritmanlibrary.com/2011/12/i-just-had-to-save-my-lifes-work/?mid=5647
Zu den Verkäufen, zu denen Ritman gezwungen war:
"The owner himself had to sell some 350 books from his collection to the value of 13 million euros to fulfil his financial obligations. These books were mainly incunabula, the oldest printed books, which he claims are also to be found in other Dutch libraries. But a copy of the first illustrated edition of Dante’s La Divina Commedia, printed in 1472, is also gone."
http://www.ritmanlibrary.com/2011/12/een-bibliotheek-als-een-ark/
Zum Thema hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=hermetic
http://www.ritmanlibrary.com/2011/12/per-aspera-ad-fontes/
Die Bibliothek soll nun schuldenfrei sein:
http://www.ritmanlibrary.com/2011/12/i-just-had-to-save-my-lifes-work/?mid=5647
Zu den Verkäufen, zu denen Ritman gezwungen war:
"The owner himself had to sell some 350 books from his collection to the value of 13 million euros to fulfil his financial obligations. These books were mainly incunabula, the oldest printed books, which he claims are also to be found in other Dutch libraries. But a copy of the first illustrated edition of Dante’s La Divina Commedia, printed in 1472, is also gone."
http://www.ritmanlibrary.com/2011/12/een-bibliotheek-als-een-ark/
Zum Thema hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=hermetic
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Samstag, 3.3.2012 Tag der Archive und Tag der Offenen Tür: Führungen im RDZ (Restaurierungs- und Digitalisierungszentrum) in Porz-Lind
Dienstag, 8.5.2012 19:00 Uhr Heumarkt 14: Dr. Elisabeth Tharandt und Dr. Gisela Fleckenstein „Vom Retten und Reisen“. Ein Praxisbericht aus den "Asylarchiven"
Dienstag, 26.6.2012 19:00 Uhr Heumarkt 14: Podiumsdiskussion zur Konzeption des Archivs im Neubau
Freitag, 7.9.2012 Besichtigung eines Asylarchivs [Welches ?]
Dienstag, 6.11.2012 Heumarkt 14: 18:00 Uhr Mitgliederversammlung, 19:00 Uhr Vortrag Dr. Max Plassmann zum Thema Familienforschung"
Link
Dienstag, 8.5.2012 19:00 Uhr Heumarkt 14: Dr. Elisabeth Tharandt und Dr. Gisela Fleckenstein „Vom Retten und Reisen“. Ein Praxisbericht aus den "Asylarchiven"
Dienstag, 26.6.2012 19:00 Uhr Heumarkt 14: Podiumsdiskussion zur Konzeption des Archivs im Neubau
Freitag, 7.9.2012 Besichtigung eines Asylarchivs [Welches ?]
Dienstag, 6.11.2012 Heumarkt 14: 18:00 Uhr Mitgliederversammlung, 19:00 Uhr Vortrag Dr. Max Plassmann zum Thema Familienforschung"
Link
Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. Dezember 2011, 13:44 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Historische Archiv eröffnet am 3. Januar 2012 den Lesesaal im Restaurierungs- und Digitalisierungszentrum (RDZ), Haus 3, Frankfurter Straße 50, 51147 Köln-Porz/Lind. Das Angebot ist zunächst noch sehr klein im Vergleich zu dem, was vor dem Einsturz am 3. März 2009 zur Verfügung stand. Die Restaurierung der Archivalien geht jedoch zügig voran, so dass sich der Bestand nach und nach erweitert. Bereits benutzbar sind beispielsweise Teile der Bibliothek und Fotosammlung, Neuerwerbungen seit dem Einsturz und erste restaurierte mittelalterliche Urkunden und Handschriften.
Der Lesesaal hat dienstags bis freitags von 9 bis 16:30 Uhr, mittwochs von 9 bis 19:45 Uhr geöffnet. Für den Besuch ist eine Voranmeldung mit Terminabsprache unter 0221 / 221-29462 oder lesesaal.hastk@stadt-koeln.de erforderlich. Dabei muss geklärt werden, ob die benötigten Archivalien bereits wieder benutzbar sind.
Die Öffnung des Lesesaals ist Teil der mehrstufigen Benutzungsstrategie des Historischen Archivs. Diese sieht vor, zunächst hauptsächlich Digitalisate und künftig auch immer mehr Originale zur Verfügung zu stellen."
Quelle: Pressemitteilung Stadt Köln, 28.12.2011
Der Lesesaal hat dienstags bis freitags von 9 bis 16:30 Uhr, mittwochs von 9 bis 19:45 Uhr geöffnet. Für den Besuch ist eine Voranmeldung mit Terminabsprache unter 0221 / 221-29462 oder lesesaal.hastk@stadt-koeln.de erforderlich. Dabei muss geklärt werden, ob die benötigten Archivalien bereits wieder benutzbar sind.
Die Öffnung des Lesesaals ist Teil der mehrstufigen Benutzungsstrategie des Historischen Archivs. Diese sieht vor, zunächst hauptsächlich Digitalisate und künftig auch immer mehr Originale zur Verfügung zu stellen."
Quelle: Pressemitteilung Stadt Köln, 28.12.2011
Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. Dezember 2011, 13:39 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Digitalisate im Internet Archive weist nach:
http://www.univ-nancy2.fr/MOYENAGE/UREEF/MUSICOLOGIE/CMN/cgm.htm
In diesem Bereich erfindet jeder gern mal das Rad neu:
http://albrechtdiem.org/research/mmp/Catalogues-of-Latin-Manuscripts.html#France
http://www.uni-erfurt.de/amploniana/handschriftenkatalogeonline/international/f/land/
http://www.univ-nancy2.fr/MOYENAGE/UREEF/MUSICOLOGIE/CMN/cgm.htm
In diesem Bereich erfindet jeder gern mal das Rad neu:
http://albrechtdiem.org/research/mmp/Catalogues-of-Latin-Manuscripts.html#France
http://www.uni-erfurt.de/amploniana/handschriftenkatalogeonline/international/f/land/
KlausGraf - am Dienstag, 27. Dezember 2011, 19:54 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://bibliothekarisch.de/blog/2011/12/27/aktuelles-ueber-den-zustand-der-manuskripte-und-buecher-des-abgebrannten-institut-degypt-in-kairo/
Eine sehr wertvolle Zusammenfassung, nachdem unsere Kommentatoren keine Lust mehr haben, Nachrichten zusammenzutragen:
http://archiv.twoday.net/stories/59207202/
Eine sehr wertvolle Zusammenfassung, nachdem unsere Kommentatoren keine Lust mehr haben, Nachrichten zusammenzutragen:
http://archiv.twoday.net/stories/59207202/
http://www.medievalists.net/2011/12/26/top-10-medieval-news-stories-of-2011/
#10: The mayor of the southern French town of Saint Emilion has discreetly sold off its 14th century Cordeliers cloister to a private winemaker, leaving local residents shocked and upset.
http://www.medievalists.net/2011/11/15/french-towns-sells-off-14th-century-cloister-to-pay-debts/

Photo: Delphine Ménard http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/deed.de
#10: The mayor of the southern French town of Saint Emilion has discreetly sold off its 14th century Cordeliers cloister to a private winemaker, leaving local residents shocked and upset.
http://www.medievalists.net/2011/11/15/french-towns-sells-off-14th-century-cloister-to-pay-debts/

Photo: Delphine Ménard http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/deed.de
KlausGraf - am Dienstag, 27. Dezember 2011, 18:32 - Rubrik: English Corner
Der Download von Werken in Wikisource ist ein altes ungelöstes Problem. Die sogenannte Erstellung eines PDF-Buchs funktioniert nicht zuverlässig. Nachdem der Benutzer Finanzer einen Kindle geschenkt bekam, hat er versucht, Wikisource-Texte ins Epub-Format umzuwandeln. Sein Erfahrungsbericht:
http://www.finanzer.org/blog/2011/12/27/e-books-fur-wikisource/
Update: http://www.finanzer.org/blog/2011/12/28/e-books-fur-wikisource-2/
http://www.finanzer.org/blog/2011/12/27/e-books-fur-wikisource/
Update: http://www.finanzer.org/blog/2011/12/28/e-books-fur-wikisource-2/
http://www.bsb-muenchen.de/Einzeldarstellung.402+M5b69281dbac.0.html
Die Bayerische Staatsbibliothek, der Bibliotheksverbund Bayern und der Kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg haben ihren Katalog „B3Kat“ als OpenData im Format MARC-XML www.bib-bvb.de/open-data.html und als LinkedOpenData im Format RDF/XML lod.b3kat.de/download/ veröffentlicht. Enthalten sind die Beschreibungen zu über 23 Millionen Medien aus 180 wissenschaftlichen Bibliotheken in Bayern, Berlin und Brandenburg. Die Daten werden im Internet zur allgemeinen Nutzung unter der Lizenz „Creative Commons Zero“ bereitgestellt.
Dies ist das umfangreichste Datenpaket, das bisher von deutschen Bibliotheken und Bibliotheksverbünden als Linked Open Data zugänglich gemacht wurde. Zusammen mit den Datenfreistellungen des Hochschulbibliothekszentrums des Landes Nordrhein-Westfalen und mehrerer Bibliotheken weiterer Bundesländer steht damit nun ein erheblicher Teil der bibliografischen Titel- bzw. Mediennachweise wissenschaftlicher Bibliotheken in Deutschland unter einer freien Lizenz zur Verfügung.
Das Angebot ist u.a. über das Open-Data-Portal des Freistaats Bayern erreichbar: opendata.bayern.de
Ausgezeichnet!
Die Bayerische Staatsbibliothek, der Bibliotheksverbund Bayern und der Kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg haben ihren Katalog „B3Kat“ als OpenData im Format MARC-XML www.bib-bvb.de/open-data.html und als LinkedOpenData im Format RDF/XML lod.b3kat.de/download/ veröffentlicht. Enthalten sind die Beschreibungen zu über 23 Millionen Medien aus 180 wissenschaftlichen Bibliotheken in Bayern, Berlin und Brandenburg. Die Daten werden im Internet zur allgemeinen Nutzung unter der Lizenz „Creative Commons Zero“ bereitgestellt.
Dies ist das umfangreichste Datenpaket, das bisher von deutschen Bibliotheken und Bibliotheksverbünden als Linked Open Data zugänglich gemacht wurde. Zusammen mit den Datenfreistellungen des Hochschulbibliothekszentrums des Landes Nordrhein-Westfalen und mehrerer Bibliotheken weiterer Bundesländer steht damit nun ein erheblicher Teil der bibliografischen Titel- bzw. Mediennachweise wissenschaftlicher Bibliotheken in Deutschland unter einer freien Lizenz zur Verfügung.
Das Angebot ist u.a. über das Open-Data-Portal des Freistaats Bayern erreichbar: opendata.bayern.de
Ausgezeichnet!
KlausGraf - am Dienstag, 27. Dezember 2011, 16:11 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Aufsehen erregende Fehde Hans Diemars von Lindach gegen die Reichsstadt Schwäbisch Gmünd (1543-1554) wurde auch publizistisch ausgetragen und zwar durch gedruckte Ausschreiben, die sich an die Reichsöffentlichkeit wandten.
Eine durchaus im grobianischen Ton der Zeit gehaltene Widerlegung der Rechtsposition Diemars ist die "Confutation" aus dem Jahr 1544, von der Exemplare in den Bibliotheken von Wolfenbüttel und München sowie im Archivgut erhalten blieben und die nun nach dem Münchner Exemplar online vorliegt:
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00067057/image_1
Nach meinem Fund in der Stadtrechnung 1544, den ich 1984 publizierte, darf der Reichskammergerichts-Vertreter der Stadt Dr. Simon Engelhart als Autor dieser Schrift angesehen werden:
http://books.google.de/books?id=PoAgAAAAMAAJ&pg=PA124
Selbstverständlich hatte ich vor langen Jahren diesen Hinweis dem VD 16 mitgeteilt, der ihn jedoch ignorierte, wie die VD16-Datenbank beweist: VD16 S 4561. Schon im November 1543 hatte Gmünd eine vom VD 16 nicht berücksichtigte Druckschrift, die in Stuttgarter Akten überliefert ist, ausgehen lassen (Nachweis in meinem gleich zu nennenden Aufsatz, Anm. 13).
Eine moderne Darstellung hat die Fehde durch mich 1997 und im wesentlichen unverändert 2005 erfahren:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5496/ (Fassung von 2005: Gmünder Studien 7, S. 7-32)
Leider hatte ich es versäumt, die Abbildung der mir damals nicht bekannten abgeschnittenen Finger in den Wiener Akten auf Wikimedia Commons zu sichern:
http://archiv.twoday.net/stories/4411045/
Jetzt muss ich warten, ob mir ein freundlicher Archivalia-Leser einen Scan aus Manfred Wehdorn, Leopold Auer: Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Geschichte - Gebäude - Bestände - Wien 2003 zukommen lässt.

Update: Wenige Minuten später sandte mir Dr. Herrmann vom Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd per Mail einen Ausdruck meines seinerzeitigen Archivalia-Beitrags mit eingebundener (Mini-)Fingerabbildung, wofür auch hier herzlich gedankt sei. Größerer Scan wäre aber nach wie vor wünschenswert.

Eine durchaus im grobianischen Ton der Zeit gehaltene Widerlegung der Rechtsposition Diemars ist die "Confutation" aus dem Jahr 1544, von der Exemplare in den Bibliotheken von Wolfenbüttel und München sowie im Archivgut erhalten blieben und die nun nach dem Münchner Exemplar online vorliegt:
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00067057/image_1
Nach meinem Fund in der Stadtrechnung 1544, den ich 1984 publizierte, darf der Reichskammergerichts-Vertreter der Stadt Dr. Simon Engelhart als Autor dieser Schrift angesehen werden:
http://books.google.de/books?id=PoAgAAAAMAAJ&pg=PA124
Selbstverständlich hatte ich vor langen Jahren diesen Hinweis dem VD 16 mitgeteilt, der ihn jedoch ignorierte, wie die VD16-Datenbank beweist: VD16 S 4561. Schon im November 1543 hatte Gmünd eine vom VD 16 nicht berücksichtigte Druckschrift, die in Stuttgarter Akten überliefert ist, ausgehen lassen (Nachweis in meinem gleich zu nennenden Aufsatz, Anm. 13).
Eine moderne Darstellung hat die Fehde durch mich 1997 und im wesentlichen unverändert 2005 erfahren:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5496/ (Fassung von 2005: Gmünder Studien 7, S. 7-32)
Leider hatte ich es versäumt, die Abbildung der mir damals nicht bekannten abgeschnittenen Finger in den Wiener Akten auf Wikimedia Commons zu sichern:
http://archiv.twoday.net/stories/4411045/
Jetzt muss ich warten, ob mir ein freundlicher Archivalia-Leser einen Scan aus Manfred Wehdorn, Leopold Auer: Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Geschichte - Gebäude - Bestände - Wien 2003 zukommen lässt.

Update: Wenige Minuten später sandte mir Dr. Herrmann vom Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd per Mail einen Ausdruck meines seinerzeitigen Archivalia-Beitrags mit eingebundener (Mini-)Fingerabbildung, wofür auch hier herzlich gedankt sei. Größerer Scan wäre aber nach wie vor wünschenswert.

KlausGraf - am Dienstag, 27. Dezember 2011, 15:19 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bei Ebay versteigern oder auf dem Flohmarkt feilschen war gestern. Der neue Trend für Abgelegtes heißt Givebox. In diese Buden kann jeder Bücher, Kleidung oder Geschirr legen oder von anderen Aussortiertes mitnehmen. Die Düsseldorfer bauen dank der Vernetzung über Facebook am Samstag (19.11.2011) bereits ihre dritte Givebox.
http://www1.wdr.de/themen/panorama/givebox100.html
Hier kann man natürlich auch Bücher verschenken, ein Thema, zu dem ich Links unter
http://www.diigo.com/user/klausgraf/buchweggeben
zusammentrage und dem auch der Beitrag "Bücher weggeben statt wegwerfen" gilt (#19 der meistgelesenen Archivalia-Beiträge):
http://archiv.twoday.net/stories/3351291/
Update:
http://log.netbib.de/archives/2011/12/27/wie-krank-ist-das-denn-kaarster-bibliothekare-gegen-offentlichen-bucherschrank/
 Givebox in Berlin Okt. 2011 Foto: Songkran, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.en
Givebox in Berlin Okt. 2011 Foto: Songkran, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.en
http://www1.wdr.de/themen/panorama/givebox100.html
Hier kann man natürlich auch Bücher verschenken, ein Thema, zu dem ich Links unter
http://www.diigo.com/user/klausgraf/buchweggeben
zusammentrage und dem auch der Beitrag "Bücher weggeben statt wegwerfen" gilt (#19 der meistgelesenen Archivalia-Beiträge):
http://archiv.twoday.net/stories/3351291/
Update:
http://log.netbib.de/archives/2011/12/27/wie-krank-ist-das-denn-kaarster-bibliothekare-gegen-offentlichen-bucherschrank/
 Givebox in Berlin Okt. 2011 Foto: Songkran, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.en
Givebox in Berlin Okt. 2011 Foto: Songkran, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.enUngepflegte Linkliste:
http://www.bernstein.oeaw.ac.at/twiki/bin/view/Main/PaperDatabases
Das zeitweilig nicht erreichbare Genueser Projekt - siehe http://archiv.twoday.net/stories/4178502/ - ist inzwischen unter
http://www.labo.net/briquet/ erreichbar.
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=wasserzeichen
http://www.bernstein.oeaw.ac.at/twiki/bin/view/Main/PaperDatabases
Das zeitweilig nicht erreichbare Genueser Projekt - siehe http://archiv.twoday.net/stories/4178502/ - ist inzwischen unter
http://www.labo.net/briquet/ erreichbar.
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=wasserzeichen
KlausGraf - am Montag, 26. Dezember 2011, 23:10 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Im vergangenen Jahr wurde hier mehrfach die Verweigerung von Kopien für die Forschung zu Zwangsarbeit und Holocaust in Berlin-Neukölln durch den Internationalen Suchdienst des Roten Kreuzes (ITS) thematisiert - ein Konflikt, für den Klaus Graf den so treffenden Begriff "Arolser Kopienstreit" gefunden hat
http://archiv.twoday.net/stories/38745320/,
siehe beispielsweise auch
http://archiv.twoday.net/stories/38777979/.
Der (ITS) hat die Beschränkungen für die Kopienabgabe an Forscher nach einer internationalen Archivtagung Mitte Oktober aufgehoben.
http://www.its-arolsen.org/de/presse/pressemeldungen/index.html?expand=5543&cHash=31b1429677.
Auch das Aufsichtsgremium des ITS, der "Internationale Ausschuss" hat dem zugestimmt.
http://www.its-arolsen.org/de/presse/pressemeldungen/index.html?expand=5621&cHash=98ba52603b.
Der "Arolser Kopienstreit" ist beendet, ich habe die Kopien erhalten und kann damit arbeiten.
Am gestrigen Heiligabend hat die F.A.Z. unter der Überschrift "Arolser Kopierfriede" abschließend darüber berichtet. [Hier kein Link, da der Beitrag nur gegen Gebühr erhältlich ist. Einen Scan verschicke ich gerne auf Nachfrage.] Martin Otto fasst darin die Auseinandersetzung zusammen und schildert die neuen Ziele, die sich der ITS setzt, nämlich den Ausbau zu einem "internationalen Zentrum für Dokumentation, Information und Forschung".
Der Autor betont darin den Stellenwert, den die Presseberichterstattung für die Lösung des Kopienstreits und für die Neuorientierung des ITS hatte, unterstreicht aber auch, wie wichtig es sei, dass sich die Auseinandersetzung in zahlreichen Archivforen widerspiegelt.
Damit sind in erster Linie die "Archivalia" gemeint, denn ich habe vor allem hier darüber informiert. Für diese Möglichkeit bin ich besonders dankbar, vor allem auch für die solidarische Unterstützung, die ich von Ihrer Seite erfahren durfte.
Bernhard Bremberger
Im vergangenen Jahr wurde hier mehrfach die Verweigerung von Kopien für die Forschung zu Zwangsarbeit und Holocaust in Berlin-Neukölln durch den Internationalen Suchdienst des Roten Kreuzes (ITS) thematisiert - ein Konflikt, für den Klaus Graf den so treffenden Begriff "Arolser Kopienstreit" gefunden hat
http://archiv.twoday.net/stories/38745320/,
siehe beispielsweise auch
http://archiv.twoday.net/stories/38777979/.
Der (ITS) hat die Beschränkungen für die Kopienabgabe an Forscher nach einer internationalen Archivtagung Mitte Oktober aufgehoben.
http://www.its-arolsen.org/de/presse/pressemeldungen/index.html?expand=5543&cHash=31b1429677.
Auch das Aufsichtsgremium des ITS, der "Internationale Ausschuss" hat dem zugestimmt.
http://www.its-arolsen.org/de/presse/pressemeldungen/index.html?expand=5621&cHash=98ba52603b.
Der "Arolser Kopienstreit" ist beendet, ich habe die Kopien erhalten und kann damit arbeiten.
Am gestrigen Heiligabend hat die F.A.Z. unter der Überschrift "Arolser Kopierfriede" abschließend darüber berichtet. [Hier kein Link, da der Beitrag nur gegen Gebühr erhältlich ist. Einen Scan verschicke ich gerne auf Nachfrage.] Martin Otto fasst darin die Auseinandersetzung zusammen und schildert die neuen Ziele, die sich der ITS setzt, nämlich den Ausbau zu einem "internationalen Zentrum für Dokumentation, Information und Forschung".
Der Autor betont darin den Stellenwert, den die Presseberichterstattung für die Lösung des Kopienstreits und für die Neuorientierung des ITS hatte, unterstreicht aber auch, wie wichtig es sei, dass sich die Auseinandersetzung in zahlreichen Archivforen widerspiegelt.
Damit sind in erster Linie die "Archivalia" gemeint, denn ich habe vor allem hier darüber informiert. Für diese Möglichkeit bin ich besonders dankbar, vor allem auch für die solidarische Unterstützung, die ich von Ihrer Seite erfahren durfte.
Bernhard Bremberger
Bremberger - am Sonntag, 25. Dezember 2011, 21:12
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Open Access (OA) beseitigt als Gratis-OA die Kostenbarriere und als Libre-OA die "permission barrier". Es ist an der Zeit, sich nachdrücklich Gedanken auch hinsichtlich der Sprachbarriere zu machen. Da führende OA-Protagonisten wie Peter Suber oder Harnad in ihrer anglozentrischen Welt gefangen sind, haben sie (ebenso wie die Förderorganisationen) dem Problem der Sprachbarrieren bisher so gut wie keine Aufmerksamkeit geschenkt. Der offene Zugang zu den wissenschaftlichen Fachpublikationen setzt aber voraus, dass diese - zusätzlich zur Originalsprache - in wenigstens einer der großen westlichen Weltsprachen (idealerweise auch in Englisch) verfügbar sind.
Diese Sprachbarriere ist im wesentlichen ein Problem der Geisteswissenschaften, in denen weitgehend muttersprachlich wissenschaftlich publiziert wird. Bücher und Aufsätze, die nicht in der Muttersprache oder auf Englisch oder Französisch verfügbar sind, werden erfahrungsgemäß auch dann nicht oder kaum rezipiert, wenn sie an sich inhaltlich oder methodisch relevant sind. Dieses Problem wird von den Förderorganisationen, die sich OA auf die Fahnen geschrieben haben, offenkundig unterschätzt.
Bei geistes- oder sozialwissenschaftlichen Journals in englischer Sprache (goldener OA) sollte es keine Rolle spielen, in welcher Sprache ein Artikel eingereicht wird. Neben einem muttersprachlichen Peer-Review und einer ggf. in einem Repositorium zu deponierenden muttersprachlichen Fassung sollte nach Akzeptanz des Artikels auf Verlagskosten eine englische Version angefertigt werden.
Dies ist jedoch nur eine von vielen Maßnahmen, die sowohl auf Exzellenz wie auch auf Breitenwirkung abzielen sollten.
Ob Übersetzungen stattfinden, hängt nicht notwendigerweise von der Relevanz oder Qualität der Forschungen ab, sondern ist weitgehend dem Zufall überlassen. Dies muss sich ändern: Die Chance jedes einzelnen wissenschaftlichen Beitrags, der natürlich Mindeststandards nicht unterschreiten darf, außerhalb des eigenen Sprachraums wahrgenommen zu werden, muss entschieden verbessert werden.
Bei der einzig wahren OA-Lizenz CC-BY ist es urheberrechtlich ohne weiteres möglich, auch ohne Zustimmung von Verlag oder Autor Übersetzungen anzufertigen (oder auch umfangreiche Abstracts). Diese Lizenz ermöglicht es nicht nur, medizinisches Fachwissen in die Sprachen der Dritten Welt zu übersetzen, sondern auch entlegene, weil minderheitensprachliche Publikationen in einer Weltsprache zugänglich zu machen.
OA-Artikel sollten auch als HTML-Versionen bereitgestellt werden, da die Möglichkeiten maschineller Übersetzung besser sind.
Natürlich spräche nichts dagegen mit kleinen Schritten (Übersetzen von Metadaten - Titel, Abstract - ins Englische) anzufangen, aber dazu würden die Chancen von OA verspielt. Auch für das Volltextretrieval sind brauchbare Arbeitsversionen auf Englisch nicht nur für wichtige oder bedeutende Arbeiten unentbehrlich.
Metadaten (auch Abstrachts) sollten Public Domain sein (CC0), Übersetzungen CC-BY.
Da es schwierig sein dürfte, die für professionelle Übersetzer erforderlichen Mittel einzutreiben, könnte man an ein gemeinsames Wissensprojekt nach dem Muster der Wikipedia bzw. der Wikimedia-Projekte denken. Rohfassungen, die ggf. mit maschineller Unterstützung erstellt würden, könnten gemeinsam bearbeitet werden.
Während hier auf "perfekte" Übersetzungen verzichtet werden kann, sollte man bei der Auswahl unter dem Gesichtspunkt der "Exzellenz" nicht sparen. Wir brauchen dringend ein Bewertungssystem, das die Entscheidung, ob spannende (monografische) Texte übersetzt werden, nicht den kommerziellen Buchverlagen überlässt. Es müssen also fremdsprachige Bücher und Aufsätze systematisch auf inhaltlichen und methodischen Ertrag bewertet werden. Bei den Aufsätzen stellt sich das Problem, dass es nur für einen Teil der einschlägigen Disziplinen Referateorgane gibt, die die Bewertung bzw. Zusammenfassung der Aufsatzliteratur leisten.
Es ist bezeichnend, dass selbst bei einem sich so innovativ gerierenden Projekt wie recensio.net kein Sprach-Modul vorgesehen ist, das Sprachbarrieren mildern hilft. Ohnehin ist der meiste Stoff dieses Portals in Sprachen gehalten, die kaum ein Historiker beherrscht. Damit werden bestehende disziplinäre und sprachliche Grenzen zementiert.
(Nur am Rande sei bemerkt, dass sprachlich inkompetente Archivare bzw. Bibliothekare, die deutschsprachige Überlieferungen im Elsass, in Lothringen, der tschechischen Republik, der Slowakei, den baltischen Ländern usw. hüten, in einem vereinten Europa völlig fehl am Platz sind. Hier müssen an sich freie Projekte die sprachlichen Defizite der Archivare oder Bibliothekare z.B. in Straßburg ausgleichen und vehement dafür werben, dass deutschsprachige Bestände digitalisiert werden. Eine Erschliessung kann dann ggf. auch durch die freien Projekte erfolgen.)
Wenn es um herausragende Leistungen geht, soll durchaus das muttersprachliche Publizieren durch solche Importe gefördert und aufrechterhalten werden. Es kann nicht das Ziel sein, dass deutschsprachige Geisteswissenschaftler nur noch auf Englisch publizieren. Wir müssen unsere sprachliche Vielfalt in Europa, die sehr viel mit unserer kulturellen Identität zu tun hat, schützen und bewahren.
Der durchschnittliche Geisteswissenschaftler braucht aber erheblich mehr Angebote
- fremdsprachige Literatur, die nicht auf Englisch oder auch Französisch vorliegt, rezipieren zu können UND
- seine eigenen Publikationen in der STM-Verkehrssprache Englisch präsentieren zu können.
Dass Wissenschaftler einfach mehr Sprachen lernen, kann ja nicht die Lösung sein, denn z.B. der Aufwand, chinesische oder japanische Literatur zu berücksichtigen, dürfte kaum von einem entsprechenden Ertrag belohnt werden.
Sowohl OA als auch freie Projekte können bei dem Versuch, die Sprachenbarriere der Wissenschaft abzumildern unendlich hilfreich sein.Voraussetzung ist freilich, dass man das Problem endlich einmal als gravierendes wahrnimmt.
#sprache
Diese Sprachbarriere ist im wesentlichen ein Problem der Geisteswissenschaften, in denen weitgehend muttersprachlich wissenschaftlich publiziert wird. Bücher und Aufsätze, die nicht in der Muttersprache oder auf Englisch oder Französisch verfügbar sind, werden erfahrungsgemäß auch dann nicht oder kaum rezipiert, wenn sie an sich inhaltlich oder methodisch relevant sind. Dieses Problem wird von den Förderorganisationen, die sich OA auf die Fahnen geschrieben haben, offenkundig unterschätzt.
Bei geistes- oder sozialwissenschaftlichen Journals in englischer Sprache (goldener OA) sollte es keine Rolle spielen, in welcher Sprache ein Artikel eingereicht wird. Neben einem muttersprachlichen Peer-Review und einer ggf. in einem Repositorium zu deponierenden muttersprachlichen Fassung sollte nach Akzeptanz des Artikels auf Verlagskosten eine englische Version angefertigt werden.
Dies ist jedoch nur eine von vielen Maßnahmen, die sowohl auf Exzellenz wie auch auf Breitenwirkung abzielen sollten.
Ob Übersetzungen stattfinden, hängt nicht notwendigerweise von der Relevanz oder Qualität der Forschungen ab, sondern ist weitgehend dem Zufall überlassen. Dies muss sich ändern: Die Chance jedes einzelnen wissenschaftlichen Beitrags, der natürlich Mindeststandards nicht unterschreiten darf, außerhalb des eigenen Sprachraums wahrgenommen zu werden, muss entschieden verbessert werden.
Bei der einzig wahren OA-Lizenz CC-BY ist es urheberrechtlich ohne weiteres möglich, auch ohne Zustimmung von Verlag oder Autor Übersetzungen anzufertigen (oder auch umfangreiche Abstracts). Diese Lizenz ermöglicht es nicht nur, medizinisches Fachwissen in die Sprachen der Dritten Welt zu übersetzen, sondern auch entlegene, weil minderheitensprachliche Publikationen in einer Weltsprache zugänglich zu machen.
OA-Artikel sollten auch als HTML-Versionen bereitgestellt werden, da die Möglichkeiten maschineller Übersetzung besser sind.
Natürlich spräche nichts dagegen mit kleinen Schritten (Übersetzen von Metadaten - Titel, Abstract - ins Englische) anzufangen, aber dazu würden die Chancen von OA verspielt. Auch für das Volltextretrieval sind brauchbare Arbeitsversionen auf Englisch nicht nur für wichtige oder bedeutende Arbeiten unentbehrlich.
Metadaten (auch Abstrachts) sollten Public Domain sein (CC0), Übersetzungen CC-BY.
Da es schwierig sein dürfte, die für professionelle Übersetzer erforderlichen Mittel einzutreiben, könnte man an ein gemeinsames Wissensprojekt nach dem Muster der Wikipedia bzw. der Wikimedia-Projekte denken. Rohfassungen, die ggf. mit maschineller Unterstützung erstellt würden, könnten gemeinsam bearbeitet werden.
Während hier auf "perfekte" Übersetzungen verzichtet werden kann, sollte man bei der Auswahl unter dem Gesichtspunkt der "Exzellenz" nicht sparen. Wir brauchen dringend ein Bewertungssystem, das die Entscheidung, ob spannende (monografische) Texte übersetzt werden, nicht den kommerziellen Buchverlagen überlässt. Es müssen also fremdsprachige Bücher und Aufsätze systematisch auf inhaltlichen und methodischen Ertrag bewertet werden. Bei den Aufsätzen stellt sich das Problem, dass es nur für einen Teil der einschlägigen Disziplinen Referateorgane gibt, die die Bewertung bzw. Zusammenfassung der Aufsatzliteratur leisten.
Es ist bezeichnend, dass selbst bei einem sich so innovativ gerierenden Projekt wie recensio.net kein Sprach-Modul vorgesehen ist, das Sprachbarrieren mildern hilft. Ohnehin ist der meiste Stoff dieses Portals in Sprachen gehalten, die kaum ein Historiker beherrscht. Damit werden bestehende disziplinäre und sprachliche Grenzen zementiert.
(Nur am Rande sei bemerkt, dass sprachlich inkompetente Archivare bzw. Bibliothekare, die deutschsprachige Überlieferungen im Elsass, in Lothringen, der tschechischen Republik, der Slowakei, den baltischen Ländern usw. hüten, in einem vereinten Europa völlig fehl am Platz sind. Hier müssen an sich freie Projekte die sprachlichen Defizite der Archivare oder Bibliothekare z.B. in Straßburg ausgleichen und vehement dafür werben, dass deutschsprachige Bestände digitalisiert werden. Eine Erschliessung kann dann ggf. auch durch die freien Projekte erfolgen.)
Wenn es um herausragende Leistungen geht, soll durchaus das muttersprachliche Publizieren durch solche Importe gefördert und aufrechterhalten werden. Es kann nicht das Ziel sein, dass deutschsprachige Geisteswissenschaftler nur noch auf Englisch publizieren. Wir müssen unsere sprachliche Vielfalt in Europa, die sehr viel mit unserer kulturellen Identität zu tun hat, schützen und bewahren.
Der durchschnittliche Geisteswissenschaftler braucht aber erheblich mehr Angebote
- fremdsprachige Literatur, die nicht auf Englisch oder auch Französisch vorliegt, rezipieren zu können UND
- seine eigenen Publikationen in der STM-Verkehrssprache Englisch präsentieren zu können.
Dass Wissenschaftler einfach mehr Sprachen lernen, kann ja nicht die Lösung sein, denn z.B. der Aufwand, chinesische oder japanische Literatur zu berücksichtigen, dürfte kaum von einem entsprechenden Ertrag belohnt werden.
Sowohl OA als auch freie Projekte können bei dem Versuch, die Sprachenbarriere der Wissenschaft abzumildern unendlich hilfreich sein.Voraussetzung ist freilich, dass man das Problem endlich einmal als gravierendes wahrnimmt.
#sprache
KlausGraf - am Sonntag, 25. Dezember 2011, 20:11 - Rubrik: Open Access
Auf der virtuellen Europeana-Ausstellung Wiki Loves Art Noveau (nicht lizenzkonform!)
http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/wiki-loves-art-nouveau
wird als Zoomfunktion http://zoom.it verwendet, mit dem man ein beliebiges (natürlich möglichst großes) Bild aus dem Netz zoombar machen kann. Man gibt die URL ein, es dauert eine kleine Zeit, dann kann man das Bild verlinken oder einbetten (letzteres ging bei Tumblr und hier nicht).
Nürnberger Wappen (LoC)
http://zoom.it/CY6c
Bild des Wiener Parlaments von Thoodor (CC-BY-SA)
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Wien_Parlament_01.jpg
Resultat: http://zoom.it/lXJW
Selbstverständlich bedarf der Einsatz bei geschützten Bildern der Zustimmung des Rechteinhabers, auch wenn das in den FAQ fehlt.
http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/wiki-loves-art-nouveau
wird als Zoomfunktion http://zoom.it verwendet, mit dem man ein beliebiges (natürlich möglichst großes) Bild aus dem Netz zoombar machen kann. Man gibt die URL ein, es dauert eine kleine Zeit, dann kann man das Bild verlinken oder einbetten (letzteres ging bei Tumblr und hier nicht).
Nürnberger Wappen (LoC)
http://zoom.it/CY6c
Bild des Wiener Parlaments von Thoodor (CC-BY-SA)
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Wien_Parlament_01.jpg
Resultat: http://zoom.it/lXJW
Selbstverständlich bedarf der Einsatz bei geschützten Bildern der Zustimmung des Rechteinhabers, auch wenn das in den FAQ fehlt.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=12/
Selbstverständlich sollten solche Universitätsbibliographien auch als Open Linked Data zur Verfügung stehen, was hier natürlich nicht der Fall ist, wie generell der GBV den Open Data noch sehr reserviert gegenübersteht.
Ein Online-Filter ist installiert, weshalb man die Suchanfrage nach Hamburg (alle Wörter) - 12290 Treffer - und Hamburg mit Filter gegenüberstellen kann: 346. Geht man davon aus, dass es sich überwiegend um Open-Access-Quellen handelt, so ergibt sich - die Zuverlässigkeit der Datenerhebung und der Ermittlung von Online-Nachweisen vorausgesetzt - eine OA-Quote von nicht einmal 3 Prozent.
Selbstverständlich sollten solche Universitätsbibliographien auch als Open Linked Data zur Verfügung stehen, was hier natürlich nicht der Fall ist, wie generell der GBV den Open Data noch sehr reserviert gegenübersteht.
Ein Online-Filter ist installiert, weshalb man die Suchanfrage nach Hamburg (alle Wörter) - 12290 Treffer - und Hamburg mit Filter gegenüberstellen kann: 346. Geht man davon aus, dass es sich überwiegend um Open-Access-Quellen handelt, so ergibt sich - die Zuverlässigkeit der Datenerhebung und der Ermittlung von Online-Nachweisen vorausgesetzt - eine OA-Quote von nicht einmal 3 Prozent.
KlausGraf - am Sonntag, 25. Dezember 2011, 17:58 - Rubrik: Open Access
Dieser Spruch aus Cpg 355, Bl. 15v
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg355/0034
kam mir in den Sinn, als ich die Frankfurter Inkunabeldigitalisate durchsah.
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/inc/content/pageview/3595397
'Sechs Ding zierent den adel' (Mainz: Peter von Friedberg um 1495) ist ein Frankfurter Unicum, zu dem leider nicht der Eintrag im GW, sondern nur die Katalogseite Ohly/Sack verlinkt wird. Wieso Veit Hündler als Autor angesehen wird, kann ich dem GW nicht entnehmen:
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/n0196.htm
Zu den Sentenzen Bl. 15v fehlt im Heidelberger Katalogisat ein Nachweis:
http://www.ub.uni-heidelberg.de/digi-pdf-katalogisate/sammlung2/werk/pdf/cpg355.pdf
Man sieht unschwer, dass es sich um Varianten desselben Textes handelt. Freilich ist nicht nur die Reihenfolge eine andere.
Gundolf Keil betrachtet die von Koller aus dem bis 1471 geführten Briefbuch Veit Hündlers (Cod. Claustroneob. 941 = http://manuscripta.at/?ID=1188 Bl. 330v-331v laut hsl. Katalog) edierten Sprüche unkritisch als dessen geistiges Eigentum (Artikel im ²VL 4, 309f.).
[Handschriftendigitalisat:
http://manuscripta.at/diglit/AT5000-941/0663 ]
( http://d-nb.info/gnd/102573433 fehlt die eigenartigerweise von manuscripta.at gegen die Überlieferung bevorzugte Namensform Hendl)
Koller:
http://books.google.de/books?id=vRRMAAAAYAAJ&pg=PA295
Zu einer Zusammenstellung der Überlieferung der zuletzt wohl von Brinkhus (Fürstenspiegelkompilation) gedruckten priamelartigen "7 Sprüche" habe ich jetzt keine Zeit, ich verweise pauschal auf Google Books für das folgende:
Schneider zu Cgm 1119, Bl. 97rb-va mit weiteren Nachweisen (wichtig v.a. Kornrumpf/Völker)
Keller 2004 zu Eichstätt Cod. st. 623, Bl. 79r
Irtenkauf/Krekler zu Stuttgart Cod. poet. et phil. 10, Bl. 123ra-rb
Hagenmaier zu Freiburg EA Hs. 12, Bl. 55v-56r
Augsburger Hs. bei Keller, Fasn.
http://books.google.de/books?id=hjgLAAAAQAAJ&pg=PA326 (das ist 4° Halder 27, siehe Kiepe, Priameldichtung S. 312 und http://www.uni-bielefeld.de/lili/forschung/projekte/bra/Au1.html )
Zu Cgm 751
http://books.google.de/books?id=dOgPAAAAMAAJ&pg=PA92 (US)
Augsburg UB III.1.8.29 nach ManuMed
Hsl. Zusätze einer Inkunabel der Newberry-Libr. nach http://www.jstor.org/pss/27712983
2 Sprüche aus Cgm 216
http://books.google.de/books?id=1-gFAAAAQAAJ&pg=PA329 (US)
Cgm 4360 Schneider, aber besser bei Schnell:
http://www.google.de/search?num=100&hl=de&safe=off&tbo=1&tbm=bks&q=Item+drew+ding+machen+den+menschen+wey%C3%9F
Abdruck Euling aus Leipzig Hs. 1590 (um 1465)
http://de.wikisource.org/wiki/Datei:Germania_33_1888.pdf
http://books.google.de/books?id=eD89AQAAIAAJ&pg=PA170 (US)
Nutzlos dagegen der Abdruck des Adels-Spruchs, da keinerlei Quelle angegeben:
http://books.google.de/books?id=HQBCAAAAcAAJ&pg=RA2-PA71-IA6
Siehe auch Euling
http://books.google.de/books?id=qaETAAAAQAAJ&pg=PA81 (US)
Singers Thesaurus nennt Mones (Anz. 7, 500) Abdruck aus einer Indersdorfer Hs. (jetzt ein Cgm)
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/periodical/pageview/280430
Die 6 Dinge des Adels auch als Deckeninschrift in Stein am Rhein
http://books.google.de/books?id=yVBJAAAAYAAJ&pg=PA192 (US)
Paravicini, ritterl-höf. Kultur S. 106 nach dem Eptinger Hausbuch ed. Christ S. 190f.
2 der Sprüche in der Inkunabel
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00059953/image_65
Zum Richter-Spruch
http://www.google.de/search?tbm=bks&tbo=1&hl=de&q=ding+%22falschen+richter%22&btnG=
"Mein" Spruch nach Schmellers Wb. Sp. 739 auch im Clm 12274 VD.
Ich war übrigens nicht der erste, der obigen Spruch als eine Art Devise führte, wie Kilian Leib bezeugt:
http://books.google.de/books?id=FEkSAAAAIAAJ&q=%22b%C3%BCcher+lesen+vil%22
Und auch Mone machte ihn zum Motto (aus gleicher Quelle wie ich)
http://books.google.de/books?id=Q3QAAAAAcAAJ&pg=PR2
Nachtrag: Brinkhus-Ausgabe
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brinkhus_huendler.jpg
#forschung
KlausGraf - am Sonntag, 25. Dezember 2011, 04:32 - Rubrik: Kodikologie
Update zur Meldung vom Februar 2007:
http://archiv.twoday.net/stories/3345735/
Schön, dass das GNM wie schon die HAB ältere archäologische Literatur digitalisiert:
http://www.gnm.de/index.php?id=21
Schwachsinnig, dass das extrem bescheidene bisherige Digitalisate-Angebot aus dem Netz genommen wurde:
http://web.archive.org/web/20100109043353/http://forschung.gnm.de/ressourcen/bibliothek/index.htm
Dort sind anscheinend keine Bilddateien abrufbar. Die im GW mit Link zum GNM
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/SCHMHAN.htm
verzeichnete Inkunabel von Schmuttermayers Fialenbüchleins ist wenigstens von Wikisource "gerettet" worden:
http://de.wikisource.org/wiki/Fialenb%C3%BCchlein
http://archiv.twoday.net/stories/3345735/
Schön, dass das GNM wie schon die HAB ältere archäologische Literatur digitalisiert:
http://www.gnm.de/index.php?id=21
Schwachsinnig, dass das extrem bescheidene bisherige Digitalisate-Angebot aus dem Netz genommen wurde:
http://web.archive.org/web/20100109043353/http://forschung.gnm.de/ressourcen/bibliothek/index.htm
Dort sind anscheinend keine Bilddateien abrufbar. Die im GW mit Link zum GNM
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/SCHMHAN.htm
verzeichnete Inkunabel von Schmuttermayers Fialenbüchleins ist wenigstens von Wikisource "gerettet" worden:
http://de.wikisource.org/wiki/Fialenb%C3%BCchlein
KlausGraf - am Sonntag, 25. Dezember 2011, 03:52 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine Schlagwortwolke kann nur über eine externe Anwendung in ein Tumblr-Blog eingebunden werden:
http://archivalia.tumblr.com/tagcloud
Ich vergebe nicht systematisch Tags für jeden Eintrag, ieß aber früher bestehende Tags bestehen, bevor Tumblr die Voreinstellung änderte. Inzwischen werden keine Tags mehr automatisch übernommen. Auch zickt Tumblr öfter bei der Tagvergabe. Man muss also leider überprüfen, ob das vergebene Schlagwort auch tatsächlich unter dem Beitrag erscheint. Ziemlich konsequent verschlagwortet sind vor allem die Beiträge
medieval - Mittelalterliches
http://archivalia.tumblr.com/tagged/medieval
renaissance - Renaissance (in Deutschland ab ca. 1500, bis ca. 1650)
http://archivalia.tumblr.com/tagged/renaissance
manuscripts - Handschriften
http://archivalia.tumblr.com/tagged/manuscripts
naturalia - Abbildungen von Flora und Fauna und Anatomischem
http://archivalia.tumblr.com/tagged/naturalia
archives - Archivisches
http://archivalia.tumblr.com/tagged/archives
library - Bibliothekswesen, vor allem Abbildungen alter Bibliotheken
http://archivalia.tumblr.com/tagged/library
openaccess - Open Access
http://archivalia.tumblr.com/tagged/openaccess
copyright - Urheberrecht
http://archivalia.tumblr.com/tagged/copyright
books - Buchwesen
http://archivalia.tumblr.com/tagged/books
women - Frauen
http://archivalia.tumblr.com/tagged/women
castle - Burgen und Schlösser
http://archivalia.tumblr.com/tagged/castle
typewriter - Schreibmaschinen
http://archivalia.tumblr.com/tagged/typewriter
unicorn - Einhörner
http://archivalia.tumblr.com/tagged/unicorn
hares - Verkehrte Welt mit Hasen
http://archivalia.tumblr.com/tagged/hares
stadtbibliothek mainz
http://archivalia.tumblr.com/tagged/stadtbibliothek-mainz
christianeum - Stücke aus der Altonaer Gymnasialbibliothek
http://archivalia.tumblr.com/tagged/christianeum
Exkurs:
music - Musikstücke
http://archivalia.tumblr.com/tagged/music

http://archivalia.tumblr.com/tagcloud
Ich vergebe nicht systematisch Tags für jeden Eintrag, ieß aber früher bestehende Tags bestehen, bevor Tumblr die Voreinstellung änderte. Inzwischen werden keine Tags mehr automatisch übernommen. Auch zickt Tumblr öfter bei der Tagvergabe. Man muss also leider überprüfen, ob das vergebene Schlagwort auch tatsächlich unter dem Beitrag erscheint. Ziemlich konsequent verschlagwortet sind vor allem die Beiträge
medieval - Mittelalterliches
http://archivalia.tumblr.com/tagged/medieval
renaissance - Renaissance (in Deutschland ab ca. 1500, bis ca. 1650)
http://archivalia.tumblr.com/tagged/renaissance
manuscripts - Handschriften
http://archivalia.tumblr.com/tagged/manuscripts
naturalia - Abbildungen von Flora und Fauna und Anatomischem
http://archivalia.tumblr.com/tagged/naturalia
archives - Archivisches
http://archivalia.tumblr.com/tagged/archives
library - Bibliothekswesen, vor allem Abbildungen alter Bibliotheken
http://archivalia.tumblr.com/tagged/library
openaccess - Open Access
http://archivalia.tumblr.com/tagged/openaccess
copyright - Urheberrecht
http://archivalia.tumblr.com/tagged/copyright
books - Buchwesen
http://archivalia.tumblr.com/tagged/books
women - Frauen
http://archivalia.tumblr.com/tagged/women
castle - Burgen und Schlösser
http://archivalia.tumblr.com/tagged/castle
typewriter - Schreibmaschinen
http://archivalia.tumblr.com/tagged/typewriter
unicorn - Einhörner
http://archivalia.tumblr.com/tagged/unicorn
hares - Verkehrte Welt mit Hasen
http://archivalia.tumblr.com/tagged/hares
stadtbibliothek mainz
http://archivalia.tumblr.com/tagged/stadtbibliothek-mainz
christianeum - Stücke aus der Altonaer Gymnasialbibliothek
http://archivalia.tumblr.com/tagged/christianeum
Exkurs:
music - Musikstücke
http://archivalia.tumblr.com/tagged/music

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.templerlexikon.uni-hamburg.de/
Ein Internetangebot von Anke Napp. Es gibt außer dem Lexikon diverse Volltexte unterschiedlichen Niveaus.
Ein Internetangebot von Anke Napp. Es gibt außer dem Lexikon diverse Volltexte unterschiedlichen Niveaus.
KlausGraf - am Samstag, 24. Dezember 2011, 18:43 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://jusatpublicum.wordpress.com/2011/12/23/ganz-schon-viel-krabatz-um-krabat/
Nach dem Urteil des OVG "musste der Schulleiter eines Gymnasiums einen Schüler vom Besuch des Kinofilms „Krabat“ befreien, den die 7. Klasse im Rahmen des Deutschunterrichts als verbindliche Schulveranstaltung durchführte.
Die Eltern des 12-jährigen gehören den Zeugen Jehovas an und hatten beantragt, ihren Sohn davon zu befreien, weil ihre Religion ihnen alle Berührungspunkte mit Spiritismus und schwarzer Magie verbiete. Die Klasse hatte vor dem Kinobesuch im Unterricht das Buch „Krabat“ von Otfried Preußler besprochen, woran der Sohn teilnahm. Der Schulleiter lehnte den Antrag ab, weil er darin einen „Präzedenzfall“ sah. Das Verwaltungsgericht bestätigte diese Entscheidung unter Hinweis auf den staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag , dagegen hatten die Eltern des Schülers Berufung eingelegt -erfolgreich beim OVG. Nach dessen Meinung ist die Entscheidung des Schulleiters rechtswidrig. Die Eltern hätten nachvollziehbar und überzeugend ihre ernsthafte Glaubensüberzeugung dargestellt, nach der sie das im Buch beschriebene und im Film zur Anschauung gebrachte Praktizieren schwarzer Magie ablehnen. Der vom Grundgesetz gebotene schonende Ausgleich der widerstreitenden Rechtspositionen sei unter Aufrechterhaltung der Teilnahmepflicht des Sohnes nicht möglich gewesen. Insbesondere sei es dem Sohn nicht zumutbar gewesen, bei denjenigen Filmszenen, die seinen Glaubensüberzeugungen und denen seiner Eltern widersprachen, entweder die Augen zu verschließen und sich die Ohren zuzuhalten oder den Kinosaal für die Dauer dieser Szenen zu verlassen. Da der Sohn an der Besprechung des Buches im Unterricht sowohl vor als auch nach dem Kinobesuch teilgenommen habe, müsse der staatliche Bildungs- und Erziehungsauftrag im vorliegenden Einzelfall ausnahmsweise zurücktreten.
Das Oberverwaltungsgericht hat die Revision nicht zugelassen, es bleibt abzuwarten, ob das beklagte Land NRW mit der Beschwerde die Zulassung der Revision beantragen wird, über die das Bundesverwaltungsgericht entscheidet.
OVG NRW 22.12.2011, Aktenzeichen: 19 A 610/10"
Siehe auch
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,805507,00.html
Ungeheuerlich! Demnächst werden auch Kreationisten aus ihren Löchern kommen und wie in den USA den Biologieunterricht angreifen. Und auch die Behandlung von Harry Potter ist für diese ekelhaften Sektierer der Zeugen Jehovas, die bekanntlich auch Bluttransfusionen untersagen, nicht hinnehmbar. Aber Hauptsache, man verbietet Muslims das ostentative Beten in der Schule!
 Krabatdenkmal in Wittichenau, Foto: Paulis http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Krabatdenkmal in Wittichenau, Foto: Paulis http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Nach dem Urteil des OVG "musste der Schulleiter eines Gymnasiums einen Schüler vom Besuch des Kinofilms „Krabat“ befreien, den die 7. Klasse im Rahmen des Deutschunterrichts als verbindliche Schulveranstaltung durchführte.
Die Eltern des 12-jährigen gehören den Zeugen Jehovas an und hatten beantragt, ihren Sohn davon zu befreien, weil ihre Religion ihnen alle Berührungspunkte mit Spiritismus und schwarzer Magie verbiete. Die Klasse hatte vor dem Kinobesuch im Unterricht das Buch „Krabat“ von Otfried Preußler besprochen, woran der Sohn teilnahm. Der Schulleiter lehnte den Antrag ab, weil er darin einen „Präzedenzfall“ sah. Das Verwaltungsgericht bestätigte diese Entscheidung unter Hinweis auf den staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag , dagegen hatten die Eltern des Schülers Berufung eingelegt -erfolgreich beim OVG. Nach dessen Meinung ist die Entscheidung des Schulleiters rechtswidrig. Die Eltern hätten nachvollziehbar und überzeugend ihre ernsthafte Glaubensüberzeugung dargestellt, nach der sie das im Buch beschriebene und im Film zur Anschauung gebrachte Praktizieren schwarzer Magie ablehnen. Der vom Grundgesetz gebotene schonende Ausgleich der widerstreitenden Rechtspositionen sei unter Aufrechterhaltung der Teilnahmepflicht des Sohnes nicht möglich gewesen. Insbesondere sei es dem Sohn nicht zumutbar gewesen, bei denjenigen Filmszenen, die seinen Glaubensüberzeugungen und denen seiner Eltern widersprachen, entweder die Augen zu verschließen und sich die Ohren zuzuhalten oder den Kinosaal für die Dauer dieser Szenen zu verlassen. Da der Sohn an der Besprechung des Buches im Unterricht sowohl vor als auch nach dem Kinobesuch teilgenommen habe, müsse der staatliche Bildungs- und Erziehungsauftrag im vorliegenden Einzelfall ausnahmsweise zurücktreten.
Das Oberverwaltungsgericht hat die Revision nicht zugelassen, es bleibt abzuwarten, ob das beklagte Land NRW mit der Beschwerde die Zulassung der Revision beantragen wird, über die das Bundesverwaltungsgericht entscheidet.
OVG NRW 22.12.2011, Aktenzeichen: 19 A 610/10"
Siehe auch
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,805507,00.html
Ungeheuerlich! Demnächst werden auch Kreationisten aus ihren Löchern kommen und wie in den USA den Biologieunterricht angreifen. Und auch die Behandlung von Harry Potter ist für diese ekelhaften Sektierer der Zeugen Jehovas, die bekanntlich auch Bluttransfusionen untersagen, nicht hinnehmbar. Aber Hauptsache, man verbietet Muslims das ostentative Beten in der Schule!
 Krabatdenkmal in Wittichenau, Foto: Paulis http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Krabatdenkmal in Wittichenau, Foto: Paulis http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.enKlausGraf - am Samstag, 24. Dezember 2011, 18:33 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der äußerst wertvolle ZKBW-Dialog (er ist nicht nur wertvoll, weil er Archivalia mehrfach -!- nennt) steht inzwischen auch in einer HTML-Version zur Verfügung:
https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=fl-team:publikationen:dialog70-html
Aus dem Inhalt:
Hinweise zum Urheber- und Online-Recht
"Als Beitrag zum Semantic Web hat das BSZ die PND-Identnummern aus der Katalogdatenbank des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB) als BEACON-Datei veröffentlicht. BEACON ist ein sehr einfaches Dateiformat, mit dem Links auf Webseiten angegeben werden können, die Inhalte zu bestimmten Normdaten bieten. Derzeit wird das Format vor allem für Personen genutzt, die mittels ihrer PND-Nummer identifiziert werden (PND-BEACON) (vgl. dazu die Wikipedia-Projektseite zu BEACON)."
"Die UB Heidelberg <16> hat ihr Exemplar der Schedel’schen Weltchronik digitalisiert. Insgesamt 800 Stücke der 1493 gedruckten Inkunabel sind bis heute erhalten. Das Heidelberger Exemplar gehörte einst dem Kloster Salem und gelangte 1826/27 gemeinsam mit anderen Buchbeständen aus Salem und Petershausen in die UB. Die Online-Präsentation steht unter http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/is00309000 zur Verfügung."
"Circa 9.000 Schwarz-Weiß-Fotografien aus der Sammlung des 1869 in Karlsruhe geborenen Hoffotografen Wilhelm Kratt, die über das Regierungspräsidium Karlsruhe Referat Denkmalpflege an das Generallandesarchiv Karlsruhe gelangt sind, stehen im Internetangebot des Landesarchivs Baden-Württemberg ( https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/startbild.php?bestand=22964 ) zur Verfügung. Bemerkenswert an den Fotografien ist, dass sich Kratt – im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen – nicht auf die Porträtfotografie konzentriert hat, sondern als Reisefotograf mit dem Schwerpunkt Kunstdenkmäler tätig war (nach: Archivnachrichten. Landesarchiv Baden-Württemberg Nr. 43 / September 2011)." Laut Findbuch ist Kratt 1887 geboren!
"In der Saarländischen Bibliographie ( http://www.sulb.uni-saarland.de/de/literatur/katalog/sbo/ ) verzeichnet die Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek (SULB) <291> seit fünfzig Jahren Nachweise zu landeskundlicher Literatur. Um Weblinks in der Wikipedia möglichst aktuell zu halten, verlinkt die SULB seit einiger Zeit Wikipedia-Artikel systematisch mit ihrer Regionalbibliographie. Bisher hat die Redaktion alle Städte und Gemeinden mit einem Link versehen; es folgen bekannte Organisationen, Persönlichkeiten und Einrichtungen des Saarlandes."
"Das Literaturarchiv Monacensia in München hat den kompletten Nachlass der Schriftstellerin und Journalistin Monika Mann, der Tochter von Thomas Mann, digitalisiert und im Internet zur Verfügung gestellt ( http://www.mann-digital.de/ ). Rund 500 Dokumente sind abrufbar, darunter mehr als 100 Briefe, 350 Zeitungsartikel und das erst kürzlich entdeckte New Yorker Tagebuch."
"Am 19.12.2011 wurde im Jenaer Stadtmuseum das Museumsportal Thüringen ( http://www.museen.thueringen.de/ ) freigeschaltet."
"Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Wissenschaftsrat (WR) haben eine strategische Neuausrichtung und Neuordnung des bibliothekarischen Verbundsystems empfohlen. Beide Wissenschaftsorganisationen sehen dringenden Handlungsbedarf und haben eine gemeinsame Erklärung mit zentralen Empfehlungen veröffentlicht. Unter http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10463-11.pdf?wa=BIB11-06&uid=3891551 sind die Empfehlungen des Wissenschaftsrates abrufbar; das Positionspapier der DFG steht unter http://www.dfg.de/service/presse/pressemitteilungen/2011/pressemitteilung_nr_04/index.html zur Lektüre bereit. Übergreifende Empfehlungen zu Informationsinfrastrukturen hat der Wissenschaftsrat unter http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10466-11.pdf veröffentlicht. Einige Autoren haben die Empfehlungen zum Anlass genommen, kritisch dazu Stellung zu nehmen.
Dugall, Berndt. „Informationsinfrastrukturen gestern, heute, morgen: Anmerkungen zu Empfehlungen des Wissenschaftsrats“. ABI-Technik 31 (2011) H.2. S. 92-107.
Haubfleisch, Dietmar. „Die aktuellen Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Wissenschaftsrates zur Zukunft der Bibliotheksverbünde aus Sicht einer Universitätsbibliothek“. BIBLIOTHEKSDIENST 45 (2011) H.10. S.843-867.
Wiesenmüller, Heidrun. „Die Zukunft der Bibliotheksverbünde: Ein kritischer Blick auf die Empfehlungen des Wissenschaftsrates und der Deutschen Forschungsgemeinschaft“. Buch und Bibliothek 63 (2011) H.11/12. S.790-796." Erbärmlich! Die Debatte findet in Toll-Access-Zeitschriften, nicht aber in Blogs statt.
Nachtrag: Dass Frau Wiesenmüller mir freundlicherweise ihren Artikel mailte und Hohoffs Beitrag, auf den sie mich verwies http://www.vdb-online.org/publikationen/vdb-mitteilungen/vdb-mitteilungen-2011-1.pdf#page=8 OA ist, ändert nichts an der Misere bzw. der Nichtakzeptanz des von Bibliothekaren den Wissenschaftlern gepredigten grünen Wegs durch die Bibliothekare.
Nachtrag zum Nachtrag: Wiesenmüller hat den Beitrag auf Mendeley zugänglich gemacht
http://www.mendeley.com/profiles/heidrun-wiesenmuller/
https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=fl-team:publikationen:dialog70-html
Aus dem Inhalt:
Hinweise zum Urheber- und Online-Recht
"Als Beitrag zum Semantic Web hat das BSZ die PND-Identnummern aus der Katalogdatenbank des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB) als BEACON-Datei veröffentlicht. BEACON ist ein sehr einfaches Dateiformat, mit dem Links auf Webseiten angegeben werden können, die Inhalte zu bestimmten Normdaten bieten. Derzeit wird das Format vor allem für Personen genutzt, die mittels ihrer PND-Nummer identifiziert werden (PND-BEACON) (vgl. dazu die Wikipedia-Projektseite zu BEACON)."
"Die UB Heidelberg <16> hat ihr Exemplar der Schedel’schen Weltchronik digitalisiert. Insgesamt 800 Stücke der 1493 gedruckten Inkunabel sind bis heute erhalten. Das Heidelberger Exemplar gehörte einst dem Kloster Salem und gelangte 1826/27 gemeinsam mit anderen Buchbeständen aus Salem und Petershausen in die UB. Die Online-Präsentation steht unter http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/is00309000 zur Verfügung."
"Circa 9.000 Schwarz-Weiß-Fotografien aus der Sammlung des 1869 in Karlsruhe geborenen Hoffotografen Wilhelm Kratt, die über das Regierungspräsidium Karlsruhe Referat Denkmalpflege an das Generallandesarchiv Karlsruhe gelangt sind, stehen im Internetangebot des Landesarchivs Baden-Württemberg ( https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/startbild.php?bestand=22964 ) zur Verfügung. Bemerkenswert an den Fotografien ist, dass sich Kratt – im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen – nicht auf die Porträtfotografie konzentriert hat, sondern als Reisefotograf mit dem Schwerpunkt Kunstdenkmäler tätig war (nach: Archivnachrichten. Landesarchiv Baden-Württemberg Nr. 43 / September 2011)." Laut Findbuch ist Kratt 1887 geboren!
"In der Saarländischen Bibliographie ( http://www.sulb.uni-saarland.de/de/literatur/katalog/sbo/ ) verzeichnet die Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek (SULB) <291> seit fünfzig Jahren Nachweise zu landeskundlicher Literatur. Um Weblinks in der Wikipedia möglichst aktuell zu halten, verlinkt die SULB seit einiger Zeit Wikipedia-Artikel systematisch mit ihrer Regionalbibliographie. Bisher hat die Redaktion alle Städte und Gemeinden mit einem Link versehen; es folgen bekannte Organisationen, Persönlichkeiten und Einrichtungen des Saarlandes."
"Das Literaturarchiv Monacensia in München hat den kompletten Nachlass der Schriftstellerin und Journalistin Monika Mann, der Tochter von Thomas Mann, digitalisiert und im Internet zur Verfügung gestellt ( http://www.mann-digital.de/ ). Rund 500 Dokumente sind abrufbar, darunter mehr als 100 Briefe, 350 Zeitungsartikel und das erst kürzlich entdeckte New Yorker Tagebuch."
"Am 19.12.2011 wurde im Jenaer Stadtmuseum das Museumsportal Thüringen ( http://www.museen.thueringen.de/ ) freigeschaltet."
"Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Wissenschaftsrat (WR) haben eine strategische Neuausrichtung und Neuordnung des bibliothekarischen Verbundsystems empfohlen. Beide Wissenschaftsorganisationen sehen dringenden Handlungsbedarf und haben eine gemeinsame Erklärung mit zentralen Empfehlungen veröffentlicht. Unter http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10463-11.pdf?wa=BIB11-06&uid=3891551 sind die Empfehlungen des Wissenschaftsrates abrufbar; das Positionspapier der DFG steht unter http://www.dfg.de/service/presse/pressemitteilungen/2011/pressemitteilung_nr_04/index.html zur Lektüre bereit. Übergreifende Empfehlungen zu Informationsinfrastrukturen hat der Wissenschaftsrat unter http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10466-11.pdf veröffentlicht. Einige Autoren haben die Empfehlungen zum Anlass genommen, kritisch dazu Stellung zu nehmen.
Dugall, Berndt. „Informationsinfrastrukturen gestern, heute, morgen: Anmerkungen zu Empfehlungen des Wissenschaftsrats“. ABI-Technik 31 (2011) H.2. S. 92-107.
Haubfleisch, Dietmar. „Die aktuellen Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Wissenschaftsrates zur Zukunft der Bibliotheksverbünde aus Sicht einer Universitätsbibliothek“. BIBLIOTHEKSDIENST 45 (2011) H.10. S.843-867.
Wiesenmüller, Heidrun. „Die Zukunft der Bibliotheksverbünde: Ein kritischer Blick auf die Empfehlungen des Wissenschaftsrates und der Deutschen Forschungsgemeinschaft“. Buch und Bibliothek 63 (2011) H.11/12. S.790-796." Erbärmlich! Die Debatte findet in Toll-Access-Zeitschriften, nicht aber in Blogs statt.
Nachtrag: Dass Frau Wiesenmüller mir freundlicherweise ihren Artikel mailte und Hohoffs Beitrag, auf den sie mich verwies http://www.vdb-online.org/publikationen/vdb-mitteilungen/vdb-mitteilungen-2011-1.pdf#page=8 OA ist, ändert nichts an der Misere bzw. der Nichtakzeptanz des von Bibliothekaren den Wissenschaftlern gepredigten grünen Wegs durch die Bibliothekare.
Nachtrag zum Nachtrag: Wiesenmüller hat den Beitrag auf Mendeley zugänglich gemacht
http://www.mendeley.com/profiles/heidrun-wiesenmuller/
KlausGraf - am Samstag, 24. Dezember 2011, 17:33 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://phaidra.univie.ac.at/o:104368
Wir erinnern uns: Die wichtigsten deutschen bibliothekarischen Zeitschriften wie die ZfBB sind noch nicht einmal gratis OA.
Aus dem Inhalt von Heft 3/4, 2011
Bruno Bauer: Österreichische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und der Goldene Weg zu Open Access: Ergebnisse aus der „Study of Open Access Publishing“ (SOAP) 413
Michael Birkner: Digitalisierung in Österreich – Teil 2: Auswertung eines Fragebogens zur Digitalisierung in Österreich 429
Isabella Peters: Folksonomies: Nutzergerechte Schlagwörter als Indexierungswerkzeug für die Massen 444
Wir erinnern uns: Die wichtigsten deutschen bibliothekarischen Zeitschriften wie die ZfBB sind noch nicht einmal gratis OA.
Aus dem Inhalt von Heft 3/4, 2011
Bruno Bauer: Österreichische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und der Goldene Weg zu Open Access: Ergebnisse aus der „Study of Open Access Publishing“ (SOAP) 413
Michael Birkner: Digitalisierung in Österreich – Teil 2: Auswertung eines Fragebogens zur Digitalisierung in Österreich 429
Isabella Peters: Folksonomies: Nutzergerechte Schlagwörter als Indexierungswerkzeug für die Massen 444
KlausGraf - am Samstag, 24. Dezember 2011, 17:22 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 Archivalia wünscht allen LeserInnen schöne und erholsame Weihnachtstage und bedankt sich für die Aufmerksamkeit.
Archivalia wünscht allen LeserInnen schöne und erholsame Weihnachtstage und bedankt sich für die Aufmerksamkeit.
Unser Bild stammt aus den sattsam bekannten Digitalen Sammlungen der Bayerischen Staatsbibliothek. Es ist einem Missale des Regensburger Buchmalers Berthold Furtmeyr entnommen.
Dieses Jahr stellten wir Digitale Sammlungen weltweit vor. Nochmals alle Türchen auf einen Blick:
(1) Dilibri, Stadtbibliothek Mainz
http://archiv.twoday.net/stories/55768711/
(2) Illuminierte Urkunden, Hauptstaatsarchiv Stuttgart
http://archiv.twoday.net/stories/55768740/
(3) Islamische Handschriften, Universität Melbourne
http://archiv.twoday.net/stories/55770371/
(4) Schreibkalender, Stadtarchiv Altenburg
http://archiv.twoday.net/stories/55771098/
(5) National Archives (US) auf Flickr Commons
http://archiv.twoday.net/stories/55771555/
(6) Dekanatsbücher der Theologischen Fakultät Ingolstadt, Universitätsarchiv München
http://archiv.twoday.net/stories/55772702/
(7) Gallica, Französische Nationalbibliothek
http://archiv.twoday.net/stories/55773409/
(8) Handschriften der Badischen Landesbibliothek - Der Unheilsspiegel
http://archiv.twoday.net/stories/55775123/
(9) Universitätsbibliothek Giessen
http://archiv.twoday.net/stories/55775387/
(10) AdAccess, Duke University
http://archiv.twoday.net/stories/55775432/
(11) Milmann Parry Collection, Harvard
http://archiv.twoday.net/stories/55776824/
(12) Hölderlin-Sammlung, Württembergische Landesbibliothek
http://archiv.twoday.net/stories/55778460/
(13) Kochbuchportal, Universitätsbibliothek Graz
http://archiv.twoday.net/stories/55778684/
(14) Universitätsbibliothek"Mykhailo Maksymovych" der Kyiv National Taras Shevchenko University (KNTSU) in Kiew
http://archiv.twoday.net/stories/55779436/
(15) Monasterium.net - Ein übersehenes Rennewart-Fragment
http://archiv.twoday.net/stories/59204071/
(16) Digitale Bibliothek Slowenien
http://archiv.twoday.net/stories/59204883/
(17) Universitätsbibliothek Tübingen - Neues zu Jakob Frischlin
http://archiv.twoday.net/stories/59205918/
(18) Stadtbibliothek Antwerpen - Die Handschrift des Herolds Heinrich von Heessel in Antwerpen
http://archiv.twoday.net/stories/59206605/
(19) Digitales Historisches Archiv Köln
http://archiv.twoday.net/stories/59207211/
(20) Bibliothèque Municipale Reims
http://archiv.twoday.net/stories/59207928/
(21) "Biblioteca Jose Maria Lafragua" der Autonomen Universität von Puebla in Mexiko
http://archiv.twoday.net/stories/59208512/
(22) Rosenwald-Collection der Library of Congress
http://archiv.twoday.net/stories/59209900/
(23) Handschriften der Oberösterreichischen Landesbibliothek Linz - Schrieb Gertrud von Büren im westpfälzischen Kloster Fischbach?
http://archiv.twoday.net/stories/59210885/
***
Aus dem Papierkorb der Redaktion: Nicht berücksichtigte Digitale Sammlungen
Da es für die ULB Darmstadt wichtiger ist, Millionen Graupner-Musikhandschriften ins Netz zu stellen statt längst angefertigte Handschriften-Digitalisate z.B. einer Rüxner-Handschrift, war es klar, dass ich mich dem Flehen von befreundeter Seite, diese Sammlung ebenfalls zu würdigen, verschließen musste.
Draußen bleiben mussten auch die löblichen Erlanger Sammlungen (Lied zu den Quaternionen der Reichsverfassung), Archivgut aus dem Einsiedler Klosterarchiv (Seite einer Meinrads-Legende), die wunderbaren Münchner Zimelien und die Kostbarkeiten der Athenaeumbibliothek in Deventer. Fotos aus Lyon blieben ebenso unberücksichtigt wie die Digitalisate einer spanischen Juristenbibliothek. Falls Otto Vervaart sie noch nicht kennt, seien sie ihm herzlich zu Weihnachten dediziert.
Auch wenn der Adventskalender letztendlich stark handschriftenlastig geriet, bin ich doch froh, dass es mir gelungen ist, einige kleinere Texte und Funde, die ich seit langem zur Publikation in diesem Blog vorbereitet hatte, endlich ans Licht der Öffentlichkeit zu befördern. Am wichtigsten ist sicher der Rennewart-Fund (gemacht just-in-time, also im Dezember, und kurioserweise gefolgt von einem zweiten), doch auch die anderen Mitteilungen verdienen, wie ich meine, Beachtung. Lob und Anerkennung gern in den Kommentaren ;-)
KlausGraf - am Samstag, 24. Dezember 2011, 01:37 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Wolf Thomas - am Samstag, 24. Dezember 2011, 00:01 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen