Peter Raue machte sich in der GRUR 2011, S. 1088-1090 Gedanken über sprichwörtliche Zitate aus Anlass der notorischen Abmahnung der Valentin-Erben („Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit”). Ein Kunsthaus hatte Zitate zur Kunst zusammengestellt.
Der Sprachschatz der Menschen in Deutschland, so sie überhaupt mit Sprache umgehen wollen, ist gespickt mit zeitgenössischen Zitaten:
„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.” (Gorbatschow),
„Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen.” (Loriot), „Kleiner Mann was nun?” (Fallada),
„Die Hölle, das sind die anderen.” (Sartre),
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.” (Erich Kästner),
„Es gibt kein richtiges Leben im falschen.” (Theodor W. Adorno),
„Jeder Mensch ist ein Künstler.” (Beuys),
„Alles, was mich interessiert, ist Geld.” (Dalí).
Endlos könnte man diese Beispiele ergänzen, Sätze, die unser Leben, unser Sprechen, unser Schreiben und Denken durchwirken.
Zunächst entsteht mit Blick auf Rechtsprechung und (eine ziemlich undeutliche) Literatur der Eindruck, dass all diesen zu Sprichwörtern geronnenen Zitaten der Mantel des Urheberrechtschutzes umgehängt ist, mit der Folge, dass keines dieser Zitate verwendet werden darf, wenn deren Verwendung nicht als Belegstellen i.S. von § URHG § 51 UrhG ausnahmsweise zugelassen ist. Ist diese Erkenntnis richtig, dann sind wir ein Volk von Urheberrechtsverletzern, wie wir Empfänger von „Verwarnungen” wegen Falschparkens sind. Mein „Gefühl”, dass derartige Sentenzen frei nutzbar sein sollten, ist freilich „Schall und Rauch” (Goethe), wenn das Gesetz dieses Gefühl nicht trägt.
Raue meint: Dass derartige „geflügelte Worte” Durchschlagskraft haben, ist kein Beleg für den Werkcharakter.
Er wendet sich vorsichtig gegen die herrschende Lehre nämlich die BGH-Entscheidung Handbuch moderner Zitate: Wollte man die Zitate, die unser Kunsthaus mühsam zusammengestellt hat, als urheberrechtlich geschützte, aber von § 51 UrhG nicht gedeckte Vervielfältigungen eines „Werkes” ansehen, so bliebe dem Kunsthaus nichts anderes übrig, als bei 20 (geschützten) Zitaten 20 Genehmigungen für den Gebrauch eines Sätzleins einzuholen. Dies zu verlangen, ist einfach unvernünftig, verletzt das Gebot der Verhältnismäßigkeit, Grenze jeder Rechtsausübung. Dann müsste eine solche Zusammenstellung ungeschrieben bleiben. Das verkenne ich nicht: Der BGH hat diesem Gedanken eine Absage erteilt: „Wird auf eine reine ‚Zitaten-Sammlung’ ohne Einfügung in ein gegenüber dem Entlehnten selbstständiges Werk Wert gelegt, so muss das gesetzliche Gebot beachtet werden, hierzu die Erlaubnis derjenigen einzuholen, die Inhaber der Urheberrechte an den entlehnten Textstellen sind.” Ob diese fast 40 Jahre zurückliegende Rechtsprechung heute noch greift, – vor dem Hintergrund der BVerfG-Entscheidung zum Zitatrecht – ist jedoch fraglich und klärungsbedürftig.
Das ist richtig: Zitatesammlungen wie Wikiquote, aber auch kommerzielle ads-gepflasterte Sammlungen moderner Zitate, müssen im Interesse der Meinungs- und Informationsfreiheit zulässig sein!
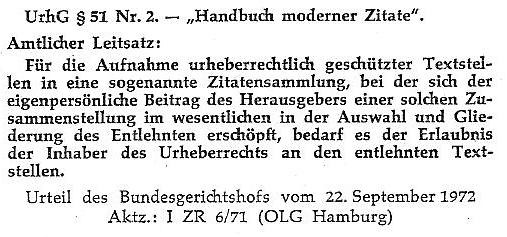
Der Sprachschatz der Menschen in Deutschland, so sie überhaupt mit Sprache umgehen wollen, ist gespickt mit zeitgenössischen Zitaten:
„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.” (Gorbatschow),
„Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen.” (Loriot), „Kleiner Mann was nun?” (Fallada),
„Die Hölle, das sind die anderen.” (Sartre),
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.” (Erich Kästner),
„Es gibt kein richtiges Leben im falschen.” (Theodor W. Adorno),
„Jeder Mensch ist ein Künstler.” (Beuys),
„Alles, was mich interessiert, ist Geld.” (Dalí).
Endlos könnte man diese Beispiele ergänzen, Sätze, die unser Leben, unser Sprechen, unser Schreiben und Denken durchwirken.
Zunächst entsteht mit Blick auf Rechtsprechung und (eine ziemlich undeutliche) Literatur der Eindruck, dass all diesen zu Sprichwörtern geronnenen Zitaten der Mantel des Urheberrechtschutzes umgehängt ist, mit der Folge, dass keines dieser Zitate verwendet werden darf, wenn deren Verwendung nicht als Belegstellen i.S. von § URHG § 51 UrhG ausnahmsweise zugelassen ist. Ist diese Erkenntnis richtig, dann sind wir ein Volk von Urheberrechtsverletzern, wie wir Empfänger von „Verwarnungen” wegen Falschparkens sind. Mein „Gefühl”, dass derartige Sentenzen frei nutzbar sein sollten, ist freilich „Schall und Rauch” (Goethe), wenn das Gesetz dieses Gefühl nicht trägt.
Raue meint: Dass derartige „geflügelte Worte” Durchschlagskraft haben, ist kein Beleg für den Werkcharakter.
Er wendet sich vorsichtig gegen die herrschende Lehre nämlich die BGH-Entscheidung Handbuch moderner Zitate: Wollte man die Zitate, die unser Kunsthaus mühsam zusammengestellt hat, als urheberrechtlich geschützte, aber von § 51 UrhG nicht gedeckte Vervielfältigungen eines „Werkes” ansehen, so bliebe dem Kunsthaus nichts anderes übrig, als bei 20 (geschützten) Zitaten 20 Genehmigungen für den Gebrauch eines Sätzleins einzuholen. Dies zu verlangen, ist einfach unvernünftig, verletzt das Gebot der Verhältnismäßigkeit, Grenze jeder Rechtsausübung. Dann müsste eine solche Zusammenstellung ungeschrieben bleiben. Das verkenne ich nicht: Der BGH hat diesem Gedanken eine Absage erteilt: „Wird auf eine reine ‚Zitaten-Sammlung’ ohne Einfügung in ein gegenüber dem Entlehnten selbstständiges Werk Wert gelegt, so muss das gesetzliche Gebot beachtet werden, hierzu die Erlaubnis derjenigen einzuholen, die Inhaber der Urheberrechte an den entlehnten Textstellen sind.” Ob diese fast 40 Jahre zurückliegende Rechtsprechung heute noch greift, – vor dem Hintergrund der BVerfG-Entscheidung zum Zitatrecht – ist jedoch fraglich und klärungsbedürftig.
Das ist richtig: Zitatesammlungen wie Wikiquote, aber auch kommerzielle ads-gepflasterte Sammlungen moderner Zitate, müssen im Interesse der Meinungs- und Informationsfreiheit zulässig sein!
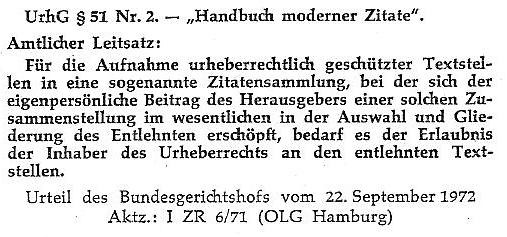
KlausGraf - am Freitag, 27. Januar 2012, 21:29 - Rubrik: Archivrecht
"Die Projekte Buchschätze der Mathematik, Sammlung Joseph Heller und Bamberger Halsgerichtsordnung wurden um verschiedene Digitalisate ergänzt.
Unter den neu hinzugekommenen 24 Handschriften und Drucken finden sich z.B. die von Johann von Schwarzenberg verfasste erste Ausgabe der Bamberger Halsgerichtsordnung von 1507, Johann Hauers Abschrift von Albrecht Dürers Tagebuch seiner Reise in die Niederlande sowie kalligraphische Schriftvorlagen des Kulmbacher Schreibers Johann Hering aus der Zeit um 1626-1634."
http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/bamberger-schaetze

Unter den neu hinzugekommenen 24 Handschriften und Drucken finden sich z.B. die von Johann von Schwarzenberg verfasste erste Ausgabe der Bamberger Halsgerichtsordnung von 1507, Johann Hauers Abschrift von Albrecht Dürers Tagebuch seiner Reise in die Niederlande sowie kalligraphische Schriftvorlagen des Kulmbacher Schreibers Johann Hering aus der Zeit um 1626-1634."
http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/bamberger-schaetze

KlausGraf - am Freitag, 27. Januar 2012, 21:00 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
BGH 23.05.1985 I ZR 28/83 "Geistchristentum" GRUR 1986, 59-61
Der Kl., der sich als "Geistige Loge" bezeichnet, ist ein Verein schweizerischen Rechts. Er versteht sich als "interkonfessionelle Kultusinstitution, frei von politischen Bindungen"; sein Gemeinschaftszweck ist "die aufschlußreiche, undogmatische Darlegung und Förderung der christlichen Lehre aufgrund eingehend geprüfter, in sich widerspruchsfreier Jenseitsbekundungen". Der Kl. führt regelmäßig Veranstaltungen durch, auf denen eine von ihm als Medium bezeichnete Mitarbeiterin Vorträge hält, bei denen es sich um Bekundungen aus dem Jenseits handeln soll; die Vorträge werden auch in Schriftform veröffentlicht. Der Kl., der u. a. das dreibändige Werk "Botschaften aus dem Jenseits" und die Jahresschrift "Meditationswoche" herausgibt, ist von seiner Mitarbeiterin zur umfassenden Verwertung der Vorträge ermächtigt.
Im beklagten Verlag ist das von seinem Inhaber verfaßte Buch "Das Geistchristentum" erschienen. Das Buch enthält eine Darstellung verschiedener "geistchristlicher Lehren" aus früheren Jahrhunderten und aus der heutigen Zeit. In ihm werden nach Themen geordnet unterschiedliche Strömungen gegenübergestellt. Zu 11 Einzelthemen ist der vom Kl. verbreiteten Lehre auf den Seiten 22 - 26, 48 - 51, 61, 67 - 69, 84 - 86, 100 - 102, 119 - 120, 136 - 140, 153 - 155, 159 - 160 und 174 - 175 des Buches jeweils ein eigener Abschnitt gewidmet. Dort finden sich - unter Anführung der jeweiligen Fundstelle - insgesamt 44 wörtliche Zitate aus den drei Bänden des Werkes "Botschaften aus dem Jenseits" und der "Meditationswoche" der Jahrgänge 1969 und 1971 bis 1975.
Der Kl. hält die Zitate für unzulässig und nimmt den Bekl. auf Unterlassung, Schadensersatz, Rechnungslegung und Beseitigung in Anspruch.
Er hat die Ansicht vertreten, der Bekl. könne sich nicht auf die Zitierfreiheit nach § 51 UrhG berufen, da die Übernahme fremden Geistesgutes nicht als Beleg oder zum besseren Verständnis der eigenen Ausführungen erfolge, sondern eigene Ausführungen ersetze. Der Bekl. habe Ausschnitte aus seinen - des Kl. - Werken mit dem Ziel veröffentlicht, dem Leser diese Werke in geraffter Form zu vermitteln.
Der Bekl. ist dem entgegengetreten. Er hat gemeint, die Zitate seien nach ihrem Zweck und Umfang durch § 51 UrhG gedeckt. Sein Werk stelle eine religionswissenschaftliche Auseinandersetzung mit ausgewählten religiösen Werken - u. a. auch denen des Kl. - dar. Dem Verfasser sei es bei der Darstellung der Einzelthemen vorrangig um eine vergleichende Analyse anhand textlicher Grundlagen gegangen.
Das LG hat die Zitate als zulässig beurteilt und die Klage abgewiesen. Das BerG hat den Bekl. - fünf Zitatstellen ausgenommen - antragsgemäß verurteilt. Die Revision des Bekl. führte zur Aufhebung des OLG-Urteils, soweit es der Klage stattgegeben hat; insoweit wurde die Sache zurückverwiesen.
Entscheidungsgründe
I. Das BerG hat dem Klagebegehren gemäß §§ 97, 98 in Verb. mit §§ 15 Abs. 1, 16, 17 UrhG im wesentlichen stattgegeben. Es hat die Ansicht vertreten, daß die wörtliche Textwiedergabe im Werk des Bekl. ganz überwiegend nicht durch die Zitierfreiheit nach § 51 UrhG gedeckt sei und dazu ausgeführt: Eine Zulässigkeit als Großzitat nach § 51 Nr. 1 UrhG scheitere daran, daß nicht nur aus einzelnen Werken, sondern aus einem erheblichen Teil der Veröffentlichungen des Kl. zitiert werde; ferner auch aus einer ganzen Anzahl von Schriftwerken anderer Verfasser. Die Zitate dienten auch in erster Linie nicht zur Erläuterung der in dem Buch des Bekl. enthaltenen Wertungen, Beurteilungen und Würdigungen, ihr Hauptzweck sei vielmehr, die Zitate zunächst für sich selbst sprechen zu lassen. Es handele sich aber auch nicht um zulässige Kleinzitate gemäß § 51 Nr. 2 UrhG. Der Umfang der Zitate sei, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht mehr durch den Zweck des Werkes des Bekl. gerechtfertigt. Der Verfasser habe sich nicht daran gehalten, nur ein oder zwei Kernsätze wörtlich und die übrige Gedankenführung in eigener Gestaltungsform wiederzugeben. Der Umfang der Zitate sei auch geeignet, den interessierten Leser davon abzuhalten, die Schriften des Kl. selbst zu erwerben.
II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
Im Streitfall kommt eine Zulässigkeit der von dem Kl. beanstandeten Zitate zwar nicht als sog. Großzitate nach § 51 Nr. 1 UrhG, wohl aber als sog. Kleinzitate nach § 51 Nr. 2 UrhG in Betracht; denn die zitierten Werke, deren Urheberrechtsschutzfähigkeit für die Prüfung in der Revisionsinstanz unterstellt werden kann, werden nach den Feststellungen des BerG nicht vollständig, sondern nur auszugsweise wiedergegeben.
Nach § 51 Nr. 2 UrhG ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe zulässig, wenn in einem durch den Zweck gebotenen Umfang Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selbständigen Sprachwerk angeführt werden. Diese Voraussetzungen sind vorliegend im Grundsatz - abgesehen von der noch offenen Frage des zulässigen Umfangs der Zitate - erfüllt. Die gegenteilige Annahme des BerG beruht darauf, daß es den Zweck des Werkes des Bekl. und die Besonderheiten der Werke des Kl. nicht hinreichend berücksichtigt hat.
1. Bei dem im Verlag des Bekl. erschienenen Buch "Das Geistchristentum" handelt es sich um ein selbständiges Sprachwerk. Dies hat das BerG - entgegen der Ansicht der Revision - nicht anzweifeln wollen. Soweit es ausgeführt hat, das Zusammenstellen der Textstellen enthalte sozusagen eine Sammlung mehrerer Werke mehrerer Urheber, bezieht sich dies ersichtlich auf die Frage, ob im Streitfall noch von einem Zitat "einzelner Werke" im Sinne des - hier ohnehin nicht einschlägigen - § 51 Nr. 1 UrhG gesprochen werden kann. Das BerG hat mit seinen von der Revision beanstandeten Ausführungen diese Frage verneinen, nicht aber das angegriffene Buch als eine schlichte Zitatensammlung qualifizieren wollen. Davon geht auch der Kl. in seiner Revisionserwiderung aus.
An der erforderlichen Selbständigkeit würde es nur dann fehlen, wenn in dem Buch des Bekl. fremdes Geistesgut unter dem Deckmantel einer Mehrheit von Zitaten ohne wesentliche eigene Leistung wiedergegeben worden wäre (vgl. BGHZ 28, 234, 239 f. - Verkehrskinderlied 1; E. Ulmer, Urheberund Verlagsrecht, 3. Aufl. 1980, S. 314). Das ist nach den Feststellungen des BerG hier nicht der Fall. Das angegriffene Buch erschöpft sich nicht in der bloßen Wiedergabe fremder Textstellen (vgl. dazu BGH, Urt. v. 22. 9. 1972 - I ZR 6/71 in GRUR 1973, 216 , 217 Handbuch moderner Zitate), vielmehr werden die angeführten Texte in den größeren Zusammenhang einer methodisch durchgeführten Untersuchung einer bestimmten geistigen Strömung eingeordnet und systematisch dargestellt (vgl. dazu nachfolgend unter 3.).
2. Das weitere Erfordernis des § 51 Nr. 2 UrhG, daß nur "Stellen" eines Werkes angeführt werden dürfen, läßt sich dagegen jedenfalls im Streitfall nicht mit der Erwägung des BerG verneinen, als Kleinzitate kämen nur ein oder zwei Kernsätze in Betracht.
Als Werkstellen, die zitiert werden dürfen, sind grundsätzlich nur kleine Ausschnitte aus geschützten Werken anzusehen. Ihr Umfang wird hinsichtlich ihres Ausmaßes durch das Verhältnis des Zitats zum benutzten Gesamtwerk bestimmt (vgl. BGHZ 28, 234, 242 - Verkehrskinderlied 1 ). Dabei ist davon auszugehen, daß nicht nur wenige Stellen von Werken eines einzelnen Autors zitiert werden dürfen (vgl. v. Gamm, Urheberrechtsgesetz, 1968, § 51 Rdn. 13; E. Ulmer, a.a.O., S. 314); denn in § 51 Nr. 2 UrhG ist die im früheren Recht (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 LUG) enthaltene Beschränkung auf "einzelne" Stellen fortgefallen. Bei der Ermittlung des sachlichen Umfangs lassen sich keine arithmetischen Maßstäbe anlegen (BGHZ 28, 234, 242 - Verkehrskinderlied 1; 50, 147, 158 Kandinsky 2 ). Es ist deshalb verfehlt, wenn das BerG generell nur ein oder zwei Kernsätze zulassen will. Es kann offenbleiben, ob eine derartige Beschränkung zumindest im Regelfall bei der Erörterung längerer Gedankengänge eines fremden Werkes anzunehmen ist, wenn sich die fremde Gedankenführung in eigener Gestaltungsform verständlich wiedergeben läßt (bejahend v. Gamm, a.a.O., § 51 Rdn. 13; weitergehend Fromm/Nordemann/Vinck, Urheberrecht, 5. Aufl. 1983, § 51 Rdn. 7, die ein Zitat von maximal einer Seite Länge zulassen wollen). Denn jedenfalls in Ausnahmefällen können sich auch längere Textwiedergaben, die einen wesentlichen Teil des zitierten Werkes ausmachen, noch im Rahmen der Zitierfreiheit halten; so ist in der Rechtsprechung die Wiedergabe der ganzen Strophe eines dreistrophigen Liedes noch als zulässig angesehen worden (vgl. BGHZ 28, 234, 242 - Verkehrskinderlied 1; vgl. auch OLG Hamburg in GRUR 1970, 38 , 40 für die Wiedergabe von sechs Zeilen eines fünfzehn Zeilen umfassenden Liedertextes).
Ob auch eine längere Textwiedergabe ausnahmsweise gerechtfertigt ist, ist unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls zu prüfen. Dem hat das BerG nicht hinreichend Rechnung getragen, indem es die Grenzen der Zitierfreiheit im wesentlichen nur generell und abstrakt aufgezeigt hat. Es ist dabei im Ansatz allerdings zutreffend davon ausgegangen, daß der sachliche Umfang des Kleinzitats durch den konkreten Zitatzweck im Rahmen des zitierenden Werkes, seiner Art, seines Inhalts und Zwecks begrenzt wird (vgl. RGZ 129, 252, 254 ff. - Operettenführer 3; auch BGHZ 50, 147, 151 - Kandinsky 2 ). Dabei ist für eine angemessene Abgrenzung auf den Grundgedanken des Gesetzes und den Interessenkonflikt zurückzugehen, dessen billige Lösung unter Berücksichtigung der Belange aller Beteiligten § 51 UrhG anstrebt. Die darin festgelegte Zitierfreiheit soll der Freiheit der geistigen Auseinandersetzung mit fremden Gedanken dienen und auch in der Form stattfinden können, daß politische, wissenschaftliche oder geistige Strömungen durch die wörtliche Wiedergabe einzelner Stellen aus den geschützten Werken verschiedener Autoren deutlich gemacht werden (BGH in GRUR 1973, 216 , 217 Handbuch moderner Zitate). Ausgehend von dem Gedanken, daß der Urheber bei seinem Schaffen auf den kulturellen Leistungen seiner Vorgänger aufbaut, wird es dem Urheber im Interesse der Allgemeinheit zugemutet, einen verhältnismäßig geringfügigen Eingriff in sein ausschließliches Verwertungsrecht (§ 15 Abs. 1 UrhG) hinzunehmen, wenn dies dem geistigen Schaffen anderer und damit zum Nutzen der Allgemeinheit der Förderung des kulturellen Lebens dient (BGHZ 28, 234, 242 f. - Verkehrskinderlied 1; 50, 147, 152 - Kandinsky 2 ). Mit diesem Zweck des Gesetzes wäre es nicht vereinbar, ein Werk um seiner selbst willen zur Kenntnis der Allgemeinheit zu bringen; andere sollen durch die Zitierfreiheit lediglich in die Lage versetzt werden, Entlehnungen als Hilfsmittel der eigenen Darstellung zu benutzen, sei es, daß sie das fremde Werk kritisch beleuchten, sei es, daß sie es als Ausgangspunkt und insbesondere zur Bekräftigung und Erläuterung des eigenen Gedankengangs auswerten, sei es schließlich auch, daß sie es in Gestalt von Leseproben zur Veranschaulichung eines selbständigen Berichts verwenden wollen (BGHZ 28, 234, 240 Verkehrskinderlied 1 ). Deshalb reicht es nicht aus, daß die Zitate in einer bloß äußerlichen, zusammenhanglosen Weise eingefügt und angehängt werden; vielmehr muß eine innere Verbindung mit den eigenen Gedanken hergestellt werden (BGHZ 28, 234, 240 - Verkehrskinderlied 1 ). Ein Zitat ist deshalb nur zulässig, wenn es als Beleg für eigene Erörterungen des Zitierenden erscheint (BGHZ 50, 147, 155 - Kandinsky 2; BGH in GRUR 1973, 216 , 218 Handbuch moderner Zitate). Das Anleihen bei dem Original darf schließlich nicht in einem solchen Umfang Kenntnis von dem Original oder dessen Kernstücken verschaffen, daß hierdurch ein gewisser Ersatz für den Erwerb des Exemplars des vollständigen Werkes geboten und damit die dem Schöpfer dieses Werkes zustehenden Verwertungsmöglichkeiten geschmälert werden (BGHZ 28, 234, 243 - Verkehrskinderlied 1; vgl. auch 50, 147, 153 - Kandinsky 2 ).
3. Im Streitfall läßt sich unter Berücksichtigung dieser Grundsätze nicht abschließend feststellen, ob sich der Umfang der aus den Werken des Kl. entnommenen Textstellen noch in den Grenzen der nach § 51 Nr. 2 UrhG zulässigen Zitierfreiheit hält.
Das BerG hat weder dem mit dem Werk des Bekl. verfolgten Zweck noch den Besonderheiten der zitierten Werke des Kl. und den fraglichen Werkstellen hinreichend Rechnung getragen.
Nach dem Klappentext und dem Vorwort des Buches war es das Anliegen des Autors, die sog. esoterischen Strömungen des Christentums anhand der Schriften von neun namentlich genannten Verfassern sowie des Kl. und einer weiteren Institution darzustellen. Es ging ihm vor allem um eine vergleichende Analyse anhand textlicher Grundlagen. Dabei ist er wie die einzelnen Kapitelüberschriften zeigen - um eine historische Einordnung und eine systematische Gliederung bemüht. Die einzelnen spirituellen Strömungen werden in einem methodischen Vergleich in Beziehung gesetzt. Ob das Buch den Charakter eines wissenschaftlichen Werkes hat, wie der Bekl. unter Berufung auf die von ihm vorgelegten gutachtlichen Äußerungen des Prof. Dr. H. (Prof. für vergleichende Religionswissenschaften der Universität B.) und des Prof. D. (ehemals Direktor des psychologischen Instituts der Universität B.) meint, kann letztlich auf sich beruhen; denn von der Privilegierung des § 51 Nr. 2 UrhG werden Sprachwerke jeder Art erfaßt.
Der Inhalt des vorliegenden Buches zeigt, daß sich der Verfasser nicht auf eine bloß äußerliche Aneinanderreihung fremder Textstellen beschränkt hat. Davon geht auch das BerG aus. Nach seinen Feststellungen enthält das Buch auch Wertungen, Beurteilungen und kritische oder sonst würdigende Darlegungen des Verfassers. Das BerG meint jedoch, daß die wiedergegebenen Textstellen nicht zur Erläuterung des Inhalts geboten erscheinen; ihr Hauptzweck sei es vielmehr, die Zitate zunächst für sich selbst sprechen zu lassen. Die Revision rügt insoweit zu Recht, daß das BerG dazu keine Feststellungen getroffen und sich - im Gegensatz zum LG auch nicht mit den einzelnen Textwiedergaben auseinandergesetzt hat. Es hätte dem Kl. vor allem auch gemäß §§ 139, 273 ZPO aufgeben müssen, die zitierten Werke vorzulegen, um zu klären, in welchem Verhältnis die Zitate zum benutzten Gesamtwerk stehen. Diese Feststellungen wird das BerG nachzuholen haben. Bei seiner erneuten Prüfung wird es zu beachten haben, daß es sich bei dem angegriffenen Werk um eine unter eigenen Gliederungsgesichtspunkten methodisch durchgeführte Untersuchung einzelner spiritueller Strömungen handelt, und daß die entlehnten Textstellen in den größeren Zusammenhang einer systematischen Darstellung eingeordnet worden sind. Das BerG wird die einzelnen Zitatstellen daraufhin zu überprüfen haben, ob sie im Rahmen der beabsichtigten vergleichenden Textanalyse als Beleg für eigene Darlegungen des Verfassers gewertet werden können; sei es, daß sie als Beispiel für eine ungewöhnliche Sprachgestaltung, zur Verdeutlichung übereinstimmender oder abweichender Aussagen, zum besseren Verständnis eigener Ausführungen, zur Begründung oder Vertiefung des Dargelegten oder als Ausgangspunkt für die eigene Darstellung dienen. Dabei wird das BerG weiter zu berücksichtigen haben, daß es in der Natur der dargestellten Materie liegt, daß auf eine Textinterpretation und damit auf eine wörtliche Wiedergabe von Werkauszügen nicht verzichtet werden kann. Die teils bildhafte, teils altertümliche und sonderbare Sprachgestaltung läßt wörtliche Zitate unerläßlich erscheinen. Aber auch die inhaltlichen Aussagen lassen sich - vor allem wegen ihres oft mystischen und spirituellen Bezugs - in eigener Gestaltungsform nicht immer verständlich wiedergeben. Einige Beispiele verdeutlichen dies. Auf den Seiten 48 - 51 des Werkes des Bekl. wird die Lehre des Kl. zum Thema "Die Auflehnung Luzifers gegen Christus" dargestellt. Dort werden zwei längere wörtliche Zitate (Nr. 113 und 114) aus den Werken des Kl. gegenübergestellt, in denen der Abfall Luzifers nach Angaben des Verfassers unterschiedlich geschildert werde. Der Verfasser geht auf inhaltliche Fragen und vor allem auch kritisch auf die Bildersprache ein, die sich (u. a.) in folgendem Zitatauszug findet:
"So möchte ich nun euch zuerst etwas erklären über das Haus Gottes und den Sturz Luzifers. Stellt euch nun einmal eine große Masse von Kristall vor, und sagen wir, diese Masse habe die Größe eines Hauses gehabt. Nun hatte dieser Kristall eine äußere Schicht, die aber düster war, wie wenn sie nicht bearbeitet worden wäre. Es lag eine dicke Hülle, eine feste Schicht oder Schale um dieses Haus, um diesen KristalL Das Innere dieses Kristalls nenne ich das Haus Gottes..."
Ähnliche sprachliche und inhaltliche Besonderheiten, die sich mit eigenen Worten kaum hinreichend verständlich wiedergeben lassen, finden sich an zahlreichen anderen Stellen. So heißt es in einem Auszug aus dem Zitat Nr. 61 (S. 25 des Buches), das zum Ausgangspunkt einer Kritik des Verfassers genommen wird:
"Da nun Gott Geist ist, ist sein Geist von feinstofflicher Art. Er besteht gewissermaßen aus feinstofflicher "Materie" und diese ist löslich. Diese lösliche,Geistmaterie ermöglichte es Gott, aus ihr eine Gestalt ins Dasein zu bringen, die sich als sein Abbild eben aus dieser feinstofflichen,Materie' herauslöste. Dieses Abbild war jedoch zunächst noch ohne Leben. Daher mußte Gott dieser feinstofflichen Gestalt von seinem Feuer, von seinem Ewigkeitsfunken übertragen, in dieses Abbild hineinverpflanzen. Dadurch erst erhielt es Leben - ewiges Leben."
Ein Auszug aus dem Zitat Nr. 55 (S. 22 des Buches) lautet:
"Die Chöre des Himmels jubeln dem Schöpfer zu. Sie jubeln dem unendlichen Lichte, der unendlichen Herrlichkeit, sie jubeln dem ständig Zeugenden zu. Es ist mein Vater, es ist dein Vater, es ist unser Vater! Die Chöre des Himmels jubeln dem liebenden Vater zu. Auch wir alle wollen ihn loben und preisen wie seine Chöre, wie der ganze Himmel. Der gütige Vater, der aIlmächtige Schöpfer ist an den schönsten Ort in der geistigen Welt gebunden..."
Im Anschluß an dieses Zitat heißt es, die Sprache in den Werken des Kl. sei sehr einfach gehalten; kritisch wird u. a. angemerkt, daß in seinen an menschliche Vorstellungen orientierten Bildern nur selten wirkliche geistige Tiefe erscheine. Die Notwendigkeit einer (vergleichenden) Textanalyse und damit die Wiedergabe wörtlicher Zitate kommt auch in der Zusammenfassung des Kapitels II "Der Abfall Sadhanas" auf Seite 54 zum Ausdruck. Dort heißt es, rückblickend ließen sich in den Schilderungen über den Geistfall zwei große Gruppen unterscheiden; die eine Gruppe, die eine personale Auflehnung eines Geistwesens Luzifer schildere, und eine zweite, die mehr allegorisch den Abfall der ersten Geistwesen darstelle, unter Hinweis auf die Unmöglichkeit, rein geistige Vorgänge in menschliche Sprachformen zu kleiden. An anderer Stelle wird vom Verfasser nicht ohne Grund die Schwierigkeit hervorgehoben, eine geistige Bildersprache in Bewußtseinsinhalte zu übersetzen (Seite 35).
Die wenigen angeführten Beispiele verdeutlichen, daß Wortwahl und Atmosphäre der Texte in den Werken des Kl. eine besondere Bedeutung besitzen; sie lassen sich mit ein oder zwei Kernsätzen nur unvollkommen belegen und veranschaulichen. Bei der vorliegenden besonders gelagerten Fallgestaltung müssen ausnahmsweise auch längere Zitate als zulässig angesehen werden. Werke, die für sich in Anspruch nehmen, auf überirdischen Wahrnehmungen und Beobachtungen zu beruhen und diese in einer eigentümlichen Symbolund Bildersprache wiedergeben, müssen im Interesse der geistigen Kommunikation einer vergleichenden Analyse anhand - auch längerer - textlicher Grundlagen zugänglich sein. Ein Verfasser, dessen Anliegen es ist, die einzelnen spirituellen Strömungen in diesem Bereich in einem methodischen Vergleich einander gegenüberzustellen, darf angesichts der bestehenden Besonderheiten davon ausgehen, daß seiner Zitierfreiheit ausnahmsweise ein breiterer Rahmen gesteckt ist; schon um die spezifische Atmosphäre und den Inhalt der Texte, die sich oft nur schwer oder gar nicht mit eigenen Worten verständlich wiedergeben lassen, zu vermitteln und zu analysieren.
Nach den vom BerG bislang getroffenen Feststellungen kann auch nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß das in Streit befindliche Werk des Bekl. angesichts der Besonderheiten des Falles eine unzumutbare Beeinträchtigung der ausschließlichen Verwertungsrechte des Kl. darstellt. Das BerG hat keine Anhaltspunkte angeführt, die seine Annahme gerechtfertigt erscheinen lassen, alle vom ausgesprochenen Verbot erfaßten Zitate seien geeignet, den interessierten Leser davon abzuhalten, die Schriften des Kl. zu erwerben. Dazu hätte es konkreter Feststellungen bedurft, daß die fraglichen Werkauszüge gemessen am - bislang nicht vorliegenden - Gesamtwerk des Kl. insgesamt so umfassend oder jedenfalls so lang sind, daß der ernsthafte Interessent davon abgehalten werden könnte, die Schriften des Kl. selbst heranzuziehen.
III. Die Sache bedarf nach alledem einer weiteren Aufklärung und einer erneuten Beurteilung durch den Tatrichter.
Zutreffend merkte RA Michael Abels (GRUR 1986, S. 62) an: Kann ein Radiolautsprecher Rechte gemäß § 31 UrhG einräumen? Darüber gibt es keinen Streit. Er kann nicht. Wenn das Medium also offensichtlich so wenig Urheber ist wie der Kläger (der Rechte ableitet), wer ist es dann? Das Je nseits. Niemand anders kommt nach dem Sachverhalt in Fragr. § 2 Absatz 2 UrhG stellt als tatsächliche Schutzvoraussetzung die "persönliche geistige Schöpfung"fest. " Geistige Schöpfung" mag ein Begriff sein, welchen der Senat so wenig wie ich in bezug auf das Jenseits in Frage stellen möchte. Aber - wie verhält es sich mit"persönlich "? Daraus wird abgeleitet, daß Urheber nur eine natürliche Person sein kann, deswegen nämlich (vgl. Fromm-Nordemann, 5. Aufl., § 7 Anm. 1; Ulmer, § 33 I, S. 183). Und hier erledigt sich eben die Schlüssigkeitsprüfung. Denn man mag dem Jenseits vieles nachsagen und zutrauen, jedenfalls nicht den Status einer natürlichen Person. Das sind nun einmal nur Menschen (vgl. für andere Soergel-Schultze-von Lasaulx, BGB, 11. Aufl., Rdz. 1 vor § 1; Staudinger/Coing, Rdz. 1 vor § 1BGB). Der Kläger also hätte genau dies, die Urheberschaft einer natürlichen Person, eines Menschen, darlegen und beweisen müssen (vgl. Baumgärtel/Laumen, Handbuch der Beweislast im Privatrecht, Ziff. 1 zu § 1 BGB). Der Kläger hat aber nicht. Wo kein Rechtssubjekt für das Urheberrecht vorhanden ist, gibt es keine Ansprüche nach § 97 UrhG.
Anlass der Urteilswiedergabe ist natürlich die eV in Sachen Zeitungszeugen:
http://archiv.twoday.net/stories/64960723/
Der Kl., der sich als "Geistige Loge" bezeichnet, ist ein Verein schweizerischen Rechts. Er versteht sich als "interkonfessionelle Kultusinstitution, frei von politischen Bindungen"; sein Gemeinschaftszweck ist "die aufschlußreiche, undogmatische Darlegung und Förderung der christlichen Lehre aufgrund eingehend geprüfter, in sich widerspruchsfreier Jenseitsbekundungen". Der Kl. führt regelmäßig Veranstaltungen durch, auf denen eine von ihm als Medium bezeichnete Mitarbeiterin Vorträge hält, bei denen es sich um Bekundungen aus dem Jenseits handeln soll; die Vorträge werden auch in Schriftform veröffentlicht. Der Kl., der u. a. das dreibändige Werk "Botschaften aus dem Jenseits" und die Jahresschrift "Meditationswoche" herausgibt, ist von seiner Mitarbeiterin zur umfassenden Verwertung der Vorträge ermächtigt.
Im beklagten Verlag ist das von seinem Inhaber verfaßte Buch "Das Geistchristentum" erschienen. Das Buch enthält eine Darstellung verschiedener "geistchristlicher Lehren" aus früheren Jahrhunderten und aus der heutigen Zeit. In ihm werden nach Themen geordnet unterschiedliche Strömungen gegenübergestellt. Zu 11 Einzelthemen ist der vom Kl. verbreiteten Lehre auf den Seiten 22 - 26, 48 - 51, 61, 67 - 69, 84 - 86, 100 - 102, 119 - 120, 136 - 140, 153 - 155, 159 - 160 und 174 - 175 des Buches jeweils ein eigener Abschnitt gewidmet. Dort finden sich - unter Anführung der jeweiligen Fundstelle - insgesamt 44 wörtliche Zitate aus den drei Bänden des Werkes "Botschaften aus dem Jenseits" und der "Meditationswoche" der Jahrgänge 1969 und 1971 bis 1975.
Der Kl. hält die Zitate für unzulässig und nimmt den Bekl. auf Unterlassung, Schadensersatz, Rechnungslegung und Beseitigung in Anspruch.
Er hat die Ansicht vertreten, der Bekl. könne sich nicht auf die Zitierfreiheit nach § 51 UrhG berufen, da die Übernahme fremden Geistesgutes nicht als Beleg oder zum besseren Verständnis der eigenen Ausführungen erfolge, sondern eigene Ausführungen ersetze. Der Bekl. habe Ausschnitte aus seinen - des Kl. - Werken mit dem Ziel veröffentlicht, dem Leser diese Werke in geraffter Form zu vermitteln.
Der Bekl. ist dem entgegengetreten. Er hat gemeint, die Zitate seien nach ihrem Zweck und Umfang durch § 51 UrhG gedeckt. Sein Werk stelle eine religionswissenschaftliche Auseinandersetzung mit ausgewählten religiösen Werken - u. a. auch denen des Kl. - dar. Dem Verfasser sei es bei der Darstellung der Einzelthemen vorrangig um eine vergleichende Analyse anhand textlicher Grundlagen gegangen.
Das LG hat die Zitate als zulässig beurteilt und die Klage abgewiesen. Das BerG hat den Bekl. - fünf Zitatstellen ausgenommen - antragsgemäß verurteilt. Die Revision des Bekl. führte zur Aufhebung des OLG-Urteils, soweit es der Klage stattgegeben hat; insoweit wurde die Sache zurückverwiesen.
Entscheidungsgründe
I. Das BerG hat dem Klagebegehren gemäß §§ 97, 98 in Verb. mit §§ 15 Abs. 1, 16, 17 UrhG im wesentlichen stattgegeben. Es hat die Ansicht vertreten, daß die wörtliche Textwiedergabe im Werk des Bekl. ganz überwiegend nicht durch die Zitierfreiheit nach § 51 UrhG gedeckt sei und dazu ausgeführt: Eine Zulässigkeit als Großzitat nach § 51 Nr. 1 UrhG scheitere daran, daß nicht nur aus einzelnen Werken, sondern aus einem erheblichen Teil der Veröffentlichungen des Kl. zitiert werde; ferner auch aus einer ganzen Anzahl von Schriftwerken anderer Verfasser. Die Zitate dienten auch in erster Linie nicht zur Erläuterung der in dem Buch des Bekl. enthaltenen Wertungen, Beurteilungen und Würdigungen, ihr Hauptzweck sei vielmehr, die Zitate zunächst für sich selbst sprechen zu lassen. Es handele sich aber auch nicht um zulässige Kleinzitate gemäß § 51 Nr. 2 UrhG. Der Umfang der Zitate sei, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht mehr durch den Zweck des Werkes des Bekl. gerechtfertigt. Der Verfasser habe sich nicht daran gehalten, nur ein oder zwei Kernsätze wörtlich und die übrige Gedankenführung in eigener Gestaltungsform wiederzugeben. Der Umfang der Zitate sei auch geeignet, den interessierten Leser davon abzuhalten, die Schriften des Kl. selbst zu erwerben.
II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
Im Streitfall kommt eine Zulässigkeit der von dem Kl. beanstandeten Zitate zwar nicht als sog. Großzitate nach § 51 Nr. 1 UrhG, wohl aber als sog. Kleinzitate nach § 51 Nr. 2 UrhG in Betracht; denn die zitierten Werke, deren Urheberrechtsschutzfähigkeit für die Prüfung in der Revisionsinstanz unterstellt werden kann, werden nach den Feststellungen des BerG nicht vollständig, sondern nur auszugsweise wiedergegeben.
Nach § 51 Nr. 2 UrhG ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe zulässig, wenn in einem durch den Zweck gebotenen Umfang Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selbständigen Sprachwerk angeführt werden. Diese Voraussetzungen sind vorliegend im Grundsatz - abgesehen von der noch offenen Frage des zulässigen Umfangs der Zitate - erfüllt. Die gegenteilige Annahme des BerG beruht darauf, daß es den Zweck des Werkes des Bekl. und die Besonderheiten der Werke des Kl. nicht hinreichend berücksichtigt hat.
1. Bei dem im Verlag des Bekl. erschienenen Buch "Das Geistchristentum" handelt es sich um ein selbständiges Sprachwerk. Dies hat das BerG - entgegen der Ansicht der Revision - nicht anzweifeln wollen. Soweit es ausgeführt hat, das Zusammenstellen der Textstellen enthalte sozusagen eine Sammlung mehrerer Werke mehrerer Urheber, bezieht sich dies ersichtlich auf die Frage, ob im Streitfall noch von einem Zitat "einzelner Werke" im Sinne des - hier ohnehin nicht einschlägigen - § 51 Nr. 1 UrhG gesprochen werden kann. Das BerG hat mit seinen von der Revision beanstandeten Ausführungen diese Frage verneinen, nicht aber das angegriffene Buch als eine schlichte Zitatensammlung qualifizieren wollen. Davon geht auch der Kl. in seiner Revisionserwiderung aus.
An der erforderlichen Selbständigkeit würde es nur dann fehlen, wenn in dem Buch des Bekl. fremdes Geistesgut unter dem Deckmantel einer Mehrheit von Zitaten ohne wesentliche eigene Leistung wiedergegeben worden wäre (vgl. BGHZ 28, 234, 239 f. - Verkehrskinderlied 1; E. Ulmer, Urheberund Verlagsrecht, 3. Aufl. 1980, S. 314). Das ist nach den Feststellungen des BerG hier nicht der Fall. Das angegriffene Buch erschöpft sich nicht in der bloßen Wiedergabe fremder Textstellen (vgl. dazu BGH, Urt. v. 22. 9. 1972 - I ZR 6/71 in GRUR 1973, 216 , 217 Handbuch moderner Zitate), vielmehr werden die angeführten Texte in den größeren Zusammenhang einer methodisch durchgeführten Untersuchung einer bestimmten geistigen Strömung eingeordnet und systematisch dargestellt (vgl. dazu nachfolgend unter 3.).
2. Das weitere Erfordernis des § 51 Nr. 2 UrhG, daß nur "Stellen" eines Werkes angeführt werden dürfen, läßt sich dagegen jedenfalls im Streitfall nicht mit der Erwägung des BerG verneinen, als Kleinzitate kämen nur ein oder zwei Kernsätze in Betracht.
Als Werkstellen, die zitiert werden dürfen, sind grundsätzlich nur kleine Ausschnitte aus geschützten Werken anzusehen. Ihr Umfang wird hinsichtlich ihres Ausmaßes durch das Verhältnis des Zitats zum benutzten Gesamtwerk bestimmt (vgl. BGHZ 28, 234, 242 - Verkehrskinderlied 1 ). Dabei ist davon auszugehen, daß nicht nur wenige Stellen von Werken eines einzelnen Autors zitiert werden dürfen (vgl. v. Gamm, Urheberrechtsgesetz, 1968, § 51 Rdn. 13; E. Ulmer, a.a.O., S. 314); denn in § 51 Nr. 2 UrhG ist die im früheren Recht (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 LUG) enthaltene Beschränkung auf "einzelne" Stellen fortgefallen. Bei der Ermittlung des sachlichen Umfangs lassen sich keine arithmetischen Maßstäbe anlegen (BGHZ 28, 234, 242 - Verkehrskinderlied 1; 50, 147, 158 Kandinsky 2 ). Es ist deshalb verfehlt, wenn das BerG generell nur ein oder zwei Kernsätze zulassen will. Es kann offenbleiben, ob eine derartige Beschränkung zumindest im Regelfall bei der Erörterung längerer Gedankengänge eines fremden Werkes anzunehmen ist, wenn sich die fremde Gedankenführung in eigener Gestaltungsform verständlich wiedergeben läßt (bejahend v. Gamm, a.a.O., § 51 Rdn. 13; weitergehend Fromm/Nordemann/Vinck, Urheberrecht, 5. Aufl. 1983, § 51 Rdn. 7, die ein Zitat von maximal einer Seite Länge zulassen wollen). Denn jedenfalls in Ausnahmefällen können sich auch längere Textwiedergaben, die einen wesentlichen Teil des zitierten Werkes ausmachen, noch im Rahmen der Zitierfreiheit halten; so ist in der Rechtsprechung die Wiedergabe der ganzen Strophe eines dreistrophigen Liedes noch als zulässig angesehen worden (vgl. BGHZ 28, 234, 242 - Verkehrskinderlied 1; vgl. auch OLG Hamburg in GRUR 1970, 38 , 40 für die Wiedergabe von sechs Zeilen eines fünfzehn Zeilen umfassenden Liedertextes).
Ob auch eine längere Textwiedergabe ausnahmsweise gerechtfertigt ist, ist unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls zu prüfen. Dem hat das BerG nicht hinreichend Rechnung getragen, indem es die Grenzen der Zitierfreiheit im wesentlichen nur generell und abstrakt aufgezeigt hat. Es ist dabei im Ansatz allerdings zutreffend davon ausgegangen, daß der sachliche Umfang des Kleinzitats durch den konkreten Zitatzweck im Rahmen des zitierenden Werkes, seiner Art, seines Inhalts und Zwecks begrenzt wird (vgl. RGZ 129, 252, 254 ff. - Operettenführer 3; auch BGHZ 50, 147, 151 - Kandinsky 2 ). Dabei ist für eine angemessene Abgrenzung auf den Grundgedanken des Gesetzes und den Interessenkonflikt zurückzugehen, dessen billige Lösung unter Berücksichtigung der Belange aller Beteiligten § 51 UrhG anstrebt. Die darin festgelegte Zitierfreiheit soll der Freiheit der geistigen Auseinandersetzung mit fremden Gedanken dienen und auch in der Form stattfinden können, daß politische, wissenschaftliche oder geistige Strömungen durch die wörtliche Wiedergabe einzelner Stellen aus den geschützten Werken verschiedener Autoren deutlich gemacht werden (BGH in GRUR 1973, 216 , 217 Handbuch moderner Zitate). Ausgehend von dem Gedanken, daß der Urheber bei seinem Schaffen auf den kulturellen Leistungen seiner Vorgänger aufbaut, wird es dem Urheber im Interesse der Allgemeinheit zugemutet, einen verhältnismäßig geringfügigen Eingriff in sein ausschließliches Verwertungsrecht (§ 15 Abs. 1 UrhG) hinzunehmen, wenn dies dem geistigen Schaffen anderer und damit zum Nutzen der Allgemeinheit der Förderung des kulturellen Lebens dient (BGHZ 28, 234, 242 f. - Verkehrskinderlied 1; 50, 147, 152 - Kandinsky 2 ). Mit diesem Zweck des Gesetzes wäre es nicht vereinbar, ein Werk um seiner selbst willen zur Kenntnis der Allgemeinheit zu bringen; andere sollen durch die Zitierfreiheit lediglich in die Lage versetzt werden, Entlehnungen als Hilfsmittel der eigenen Darstellung zu benutzen, sei es, daß sie das fremde Werk kritisch beleuchten, sei es, daß sie es als Ausgangspunkt und insbesondere zur Bekräftigung und Erläuterung des eigenen Gedankengangs auswerten, sei es schließlich auch, daß sie es in Gestalt von Leseproben zur Veranschaulichung eines selbständigen Berichts verwenden wollen (BGHZ 28, 234, 240 Verkehrskinderlied 1 ). Deshalb reicht es nicht aus, daß die Zitate in einer bloß äußerlichen, zusammenhanglosen Weise eingefügt und angehängt werden; vielmehr muß eine innere Verbindung mit den eigenen Gedanken hergestellt werden (BGHZ 28, 234, 240 - Verkehrskinderlied 1 ). Ein Zitat ist deshalb nur zulässig, wenn es als Beleg für eigene Erörterungen des Zitierenden erscheint (BGHZ 50, 147, 155 - Kandinsky 2; BGH in GRUR 1973, 216 , 218 Handbuch moderner Zitate). Das Anleihen bei dem Original darf schließlich nicht in einem solchen Umfang Kenntnis von dem Original oder dessen Kernstücken verschaffen, daß hierdurch ein gewisser Ersatz für den Erwerb des Exemplars des vollständigen Werkes geboten und damit die dem Schöpfer dieses Werkes zustehenden Verwertungsmöglichkeiten geschmälert werden (BGHZ 28, 234, 243 - Verkehrskinderlied 1; vgl. auch 50, 147, 153 - Kandinsky 2 ).
3. Im Streitfall läßt sich unter Berücksichtigung dieser Grundsätze nicht abschließend feststellen, ob sich der Umfang der aus den Werken des Kl. entnommenen Textstellen noch in den Grenzen der nach § 51 Nr. 2 UrhG zulässigen Zitierfreiheit hält.
Das BerG hat weder dem mit dem Werk des Bekl. verfolgten Zweck noch den Besonderheiten der zitierten Werke des Kl. und den fraglichen Werkstellen hinreichend Rechnung getragen.
Nach dem Klappentext und dem Vorwort des Buches war es das Anliegen des Autors, die sog. esoterischen Strömungen des Christentums anhand der Schriften von neun namentlich genannten Verfassern sowie des Kl. und einer weiteren Institution darzustellen. Es ging ihm vor allem um eine vergleichende Analyse anhand textlicher Grundlagen. Dabei ist er wie die einzelnen Kapitelüberschriften zeigen - um eine historische Einordnung und eine systematische Gliederung bemüht. Die einzelnen spirituellen Strömungen werden in einem methodischen Vergleich in Beziehung gesetzt. Ob das Buch den Charakter eines wissenschaftlichen Werkes hat, wie der Bekl. unter Berufung auf die von ihm vorgelegten gutachtlichen Äußerungen des Prof. Dr. H. (Prof. für vergleichende Religionswissenschaften der Universität B.) und des Prof. D. (ehemals Direktor des psychologischen Instituts der Universität B.) meint, kann letztlich auf sich beruhen; denn von der Privilegierung des § 51 Nr. 2 UrhG werden Sprachwerke jeder Art erfaßt.
Der Inhalt des vorliegenden Buches zeigt, daß sich der Verfasser nicht auf eine bloß äußerliche Aneinanderreihung fremder Textstellen beschränkt hat. Davon geht auch das BerG aus. Nach seinen Feststellungen enthält das Buch auch Wertungen, Beurteilungen und kritische oder sonst würdigende Darlegungen des Verfassers. Das BerG meint jedoch, daß die wiedergegebenen Textstellen nicht zur Erläuterung des Inhalts geboten erscheinen; ihr Hauptzweck sei es vielmehr, die Zitate zunächst für sich selbst sprechen zu lassen. Die Revision rügt insoweit zu Recht, daß das BerG dazu keine Feststellungen getroffen und sich - im Gegensatz zum LG auch nicht mit den einzelnen Textwiedergaben auseinandergesetzt hat. Es hätte dem Kl. vor allem auch gemäß §§ 139, 273 ZPO aufgeben müssen, die zitierten Werke vorzulegen, um zu klären, in welchem Verhältnis die Zitate zum benutzten Gesamtwerk stehen. Diese Feststellungen wird das BerG nachzuholen haben. Bei seiner erneuten Prüfung wird es zu beachten haben, daß es sich bei dem angegriffenen Werk um eine unter eigenen Gliederungsgesichtspunkten methodisch durchgeführte Untersuchung einzelner spiritueller Strömungen handelt, und daß die entlehnten Textstellen in den größeren Zusammenhang einer systematischen Darstellung eingeordnet worden sind. Das BerG wird die einzelnen Zitatstellen daraufhin zu überprüfen haben, ob sie im Rahmen der beabsichtigten vergleichenden Textanalyse als Beleg für eigene Darlegungen des Verfassers gewertet werden können; sei es, daß sie als Beispiel für eine ungewöhnliche Sprachgestaltung, zur Verdeutlichung übereinstimmender oder abweichender Aussagen, zum besseren Verständnis eigener Ausführungen, zur Begründung oder Vertiefung des Dargelegten oder als Ausgangspunkt für die eigene Darstellung dienen. Dabei wird das BerG weiter zu berücksichtigen haben, daß es in der Natur der dargestellten Materie liegt, daß auf eine Textinterpretation und damit auf eine wörtliche Wiedergabe von Werkauszügen nicht verzichtet werden kann. Die teils bildhafte, teils altertümliche und sonderbare Sprachgestaltung läßt wörtliche Zitate unerläßlich erscheinen. Aber auch die inhaltlichen Aussagen lassen sich - vor allem wegen ihres oft mystischen und spirituellen Bezugs - in eigener Gestaltungsform nicht immer verständlich wiedergeben. Einige Beispiele verdeutlichen dies. Auf den Seiten 48 - 51 des Werkes des Bekl. wird die Lehre des Kl. zum Thema "Die Auflehnung Luzifers gegen Christus" dargestellt. Dort werden zwei längere wörtliche Zitate (Nr. 113 und 114) aus den Werken des Kl. gegenübergestellt, in denen der Abfall Luzifers nach Angaben des Verfassers unterschiedlich geschildert werde. Der Verfasser geht auf inhaltliche Fragen und vor allem auch kritisch auf die Bildersprache ein, die sich (u. a.) in folgendem Zitatauszug findet:
"So möchte ich nun euch zuerst etwas erklären über das Haus Gottes und den Sturz Luzifers. Stellt euch nun einmal eine große Masse von Kristall vor, und sagen wir, diese Masse habe die Größe eines Hauses gehabt. Nun hatte dieser Kristall eine äußere Schicht, die aber düster war, wie wenn sie nicht bearbeitet worden wäre. Es lag eine dicke Hülle, eine feste Schicht oder Schale um dieses Haus, um diesen KristalL Das Innere dieses Kristalls nenne ich das Haus Gottes..."
Ähnliche sprachliche und inhaltliche Besonderheiten, die sich mit eigenen Worten kaum hinreichend verständlich wiedergeben lassen, finden sich an zahlreichen anderen Stellen. So heißt es in einem Auszug aus dem Zitat Nr. 61 (S. 25 des Buches), das zum Ausgangspunkt einer Kritik des Verfassers genommen wird:
"Da nun Gott Geist ist, ist sein Geist von feinstofflicher Art. Er besteht gewissermaßen aus feinstofflicher "Materie" und diese ist löslich. Diese lösliche,Geistmaterie ermöglichte es Gott, aus ihr eine Gestalt ins Dasein zu bringen, die sich als sein Abbild eben aus dieser feinstofflichen,Materie' herauslöste. Dieses Abbild war jedoch zunächst noch ohne Leben. Daher mußte Gott dieser feinstofflichen Gestalt von seinem Feuer, von seinem Ewigkeitsfunken übertragen, in dieses Abbild hineinverpflanzen. Dadurch erst erhielt es Leben - ewiges Leben."
Ein Auszug aus dem Zitat Nr. 55 (S. 22 des Buches) lautet:
"Die Chöre des Himmels jubeln dem Schöpfer zu. Sie jubeln dem unendlichen Lichte, der unendlichen Herrlichkeit, sie jubeln dem ständig Zeugenden zu. Es ist mein Vater, es ist dein Vater, es ist unser Vater! Die Chöre des Himmels jubeln dem liebenden Vater zu. Auch wir alle wollen ihn loben und preisen wie seine Chöre, wie der ganze Himmel. Der gütige Vater, der aIlmächtige Schöpfer ist an den schönsten Ort in der geistigen Welt gebunden..."
Im Anschluß an dieses Zitat heißt es, die Sprache in den Werken des Kl. sei sehr einfach gehalten; kritisch wird u. a. angemerkt, daß in seinen an menschliche Vorstellungen orientierten Bildern nur selten wirkliche geistige Tiefe erscheine. Die Notwendigkeit einer (vergleichenden) Textanalyse und damit die Wiedergabe wörtlicher Zitate kommt auch in der Zusammenfassung des Kapitels II "Der Abfall Sadhanas" auf Seite 54 zum Ausdruck. Dort heißt es, rückblickend ließen sich in den Schilderungen über den Geistfall zwei große Gruppen unterscheiden; die eine Gruppe, die eine personale Auflehnung eines Geistwesens Luzifer schildere, und eine zweite, die mehr allegorisch den Abfall der ersten Geistwesen darstelle, unter Hinweis auf die Unmöglichkeit, rein geistige Vorgänge in menschliche Sprachformen zu kleiden. An anderer Stelle wird vom Verfasser nicht ohne Grund die Schwierigkeit hervorgehoben, eine geistige Bildersprache in Bewußtseinsinhalte zu übersetzen (Seite 35).
Die wenigen angeführten Beispiele verdeutlichen, daß Wortwahl und Atmosphäre der Texte in den Werken des Kl. eine besondere Bedeutung besitzen; sie lassen sich mit ein oder zwei Kernsätzen nur unvollkommen belegen und veranschaulichen. Bei der vorliegenden besonders gelagerten Fallgestaltung müssen ausnahmsweise auch längere Zitate als zulässig angesehen werden. Werke, die für sich in Anspruch nehmen, auf überirdischen Wahrnehmungen und Beobachtungen zu beruhen und diese in einer eigentümlichen Symbolund Bildersprache wiedergeben, müssen im Interesse der geistigen Kommunikation einer vergleichenden Analyse anhand - auch längerer - textlicher Grundlagen zugänglich sein. Ein Verfasser, dessen Anliegen es ist, die einzelnen spirituellen Strömungen in diesem Bereich in einem methodischen Vergleich einander gegenüberzustellen, darf angesichts der bestehenden Besonderheiten davon ausgehen, daß seiner Zitierfreiheit ausnahmsweise ein breiterer Rahmen gesteckt ist; schon um die spezifische Atmosphäre und den Inhalt der Texte, die sich oft nur schwer oder gar nicht mit eigenen Worten verständlich wiedergeben lassen, zu vermitteln und zu analysieren.
Nach den vom BerG bislang getroffenen Feststellungen kann auch nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß das in Streit befindliche Werk des Bekl. angesichts der Besonderheiten des Falles eine unzumutbare Beeinträchtigung der ausschließlichen Verwertungsrechte des Kl. darstellt. Das BerG hat keine Anhaltspunkte angeführt, die seine Annahme gerechtfertigt erscheinen lassen, alle vom ausgesprochenen Verbot erfaßten Zitate seien geeignet, den interessierten Leser davon abzuhalten, die Schriften des Kl. zu erwerben. Dazu hätte es konkreter Feststellungen bedurft, daß die fraglichen Werkauszüge gemessen am - bislang nicht vorliegenden - Gesamtwerk des Kl. insgesamt so umfassend oder jedenfalls so lang sind, daß der ernsthafte Interessent davon abgehalten werden könnte, die Schriften des Kl. selbst heranzuziehen.
III. Die Sache bedarf nach alledem einer weiteren Aufklärung und einer erneuten Beurteilung durch den Tatrichter.
Zutreffend merkte RA Michael Abels (GRUR 1986, S. 62) an: Kann ein Radiolautsprecher Rechte gemäß § 31 UrhG einräumen? Darüber gibt es keinen Streit. Er kann nicht. Wenn das Medium also offensichtlich so wenig Urheber ist wie der Kläger (der Rechte ableitet), wer ist es dann? Das Je nseits. Niemand anders kommt nach dem Sachverhalt in Fragr. § 2 Absatz 2 UrhG stellt als tatsächliche Schutzvoraussetzung die "persönliche geistige Schöpfung"fest. " Geistige Schöpfung" mag ein Begriff sein, welchen der Senat so wenig wie ich in bezug auf das Jenseits in Frage stellen möchte. Aber - wie verhält es sich mit"persönlich "? Daraus wird abgeleitet, daß Urheber nur eine natürliche Person sein kann, deswegen nämlich (vgl. Fromm-Nordemann, 5. Aufl., § 7 Anm. 1; Ulmer, § 33 I, S. 183). Und hier erledigt sich eben die Schlüssigkeitsprüfung. Denn man mag dem Jenseits vieles nachsagen und zutrauen, jedenfalls nicht den Status einer natürlichen Person. Das sind nun einmal nur Menschen (vgl. für andere Soergel-Schultze-von Lasaulx, BGB, 11. Aufl., Rdz. 1 vor § 1; Staudinger/Coing, Rdz. 1 vor § 1BGB). Der Kläger also hätte genau dies, die Urheberschaft einer natürlichen Person, eines Menschen, darlegen und beweisen müssen (vgl. Baumgärtel/Laumen, Handbuch der Beweislast im Privatrecht, Ziff. 1 zu § 1 BGB). Der Kläger hat aber nicht. Wo kein Rechtssubjekt für das Urheberrecht vorhanden ist, gibt es keine Ansprüche nach § 97 UrhG.
Anlass der Urteilswiedergabe ist natürlich die eV in Sachen Zeitungszeugen:
http://archiv.twoday.net/stories/64960723/
KlausGraf - am Freitag, 27. Januar 2012, 20:29 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Britisches Gericht entscheidet: Ähnlichkeit von Bildmotiven ist ausreichend für Urheberrechtsverletzung
»Similar, but no directly copied«
In Großbritannien erregt derzeit ein Urheberrechtsfall große Aufmerksamkeit, wie »gulli« berichtet. Ein Londoner Gericht hat mit Urteil vom 12. Januar 2012 entschieden, dass die unerlaubte Verwendung eines Motivs, das ähnlich einem bereits existierenden Bildmotiv arrangiert wurde, eine Urheberrechtsverletzung darstellt.
http://www.urheberrecht.org/news/4493/ m.w.N.
Weitere Meldungen:
http://www.heise.de/foto/artikel/Urteil-Wie-das-Bild-eines-roten-Busses-das-Urheberrecht-verletzt-1423127.html
http://www.heise.de/tp/blogs/6/151307
Cory Doctorow bezeichnet das Urteil als "verrückt", schließlich sei zu erwarten, dass jeder, der eine große Sammlung an Fotografien hat, mal schnell alle durchschaut, dann nach anderen Fotos sucht, die ähnliche Motive haben, und zu klagen beginnt: "Wir haben das Copyright auf "zwei Typen trinken Bier und richten den Boden ihrer Gläser gen Himmel!" Doctorow kann sich kaum halten: "It's an apocalyptically bad ruling, and an utter disaster in the making."
http://the1709blog.blogspot.com/2012/01/1709-blog-red-bus-seminar-early.html mit englischsprachiger Resonanz
Zur deutschen Rechtslage: "In der Regel hat der Fotograf keinen Schutz an dem vorgegebenen Motiv" (Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl. § 72 Rz. 14). Der Beck-Verlag fasst den Aufsatz von Bullinger/Garbers-von Boehm, Der Blick ist frei
Nachgestellte Fotos aus urheberrechtlicher Sicht, in: GRUR 2008, S. 26ff. in seiner Leitsatzkartei so zusammen:
Bei Lichtbildwerken erkennt die Rechtsprechung grundsätzlich keinen Motivschutz an. Das Motiv ist nur dann ausnahmsweise geschützt, wenn dessen Übernahme eine unfreie Bearbeitung i.S. des § 23 UrhG darstellt. Grundsätzlich sind Motive, genau wie Ideen, nicht urheberrechtlich geschützt. Sie sind, sofern ihnen nicht selbst Werkcharakter zukommt, gemeinfrei. Ein Monopol auf ein Motiv ist dem Urheberrecht fremd. Ein Fotograf kann nicht einen anderen Fotografen daran hindern, ein bestimmtes, möglicherweise von ihm "entdecktes" Motiv zu fotografieren. Das künstlerische Motiv selbst ist - genau wie Technik, Manier, Stil oder Vorgehensweise - nicht geschützt. Da es für das Vorliegen urheberrechtlichen Schutzes allein auf die Art und Weise der Darstellung ankommt, bezieht sich auch der Schutzumfang nur auf die Darstellung.
Die Autoren schreiben: Ein extensiver Motivschutz hätte gravierende Konsequenzen: Im Extremfall könnte ein umfassender Motivschutz zur Monopolisierung an sich gemeinfreier Perspektiven oder ganzer Objekte führen. Ein Fotograf, der das Brandenburger Tor aus einer besonders eindrucksvollen Perspektive fotografiert hat, könnte gegen Fotografien, die aus der gleichen Perspektive aufgenommen sind, vorgehen. Ein Museumsfotograf, der besonders gute Perspektiven bei der Fotografie von Skulpturen aus der Sammlung des Museums findet, könnte gegen andere Fotografien aus der gleichen Perspektive vorgehen. Dies hätte die – unpraktikable – Konsequenz, dass ein Fotograf, der eine Skulptur oder ein Gebäude fotografieren möchte, zunächst alle existierenden Fotografien des Motivs ausfindig machen und begutachten müsste, um einer Urheberrechtsverletzung vorzubeugen. Hierdurch würde künstlerisches Schaffen von Fotografen unsachgemäß behindert. Fotografen würden sich gegenseitig einschränken. Werkschutz für die Realität oder ein künstlerisches Konzept kann und soll es nicht geben. (S. 30)
»Similar, but no directly copied«
In Großbritannien erregt derzeit ein Urheberrechtsfall große Aufmerksamkeit, wie »gulli« berichtet. Ein Londoner Gericht hat mit Urteil vom 12. Januar 2012 entschieden, dass die unerlaubte Verwendung eines Motivs, das ähnlich einem bereits existierenden Bildmotiv arrangiert wurde, eine Urheberrechtsverletzung darstellt.
http://www.urheberrecht.org/news/4493/ m.w.N.
Weitere Meldungen:
http://www.heise.de/foto/artikel/Urteil-Wie-das-Bild-eines-roten-Busses-das-Urheberrecht-verletzt-1423127.html
http://www.heise.de/tp/blogs/6/151307
Cory Doctorow bezeichnet das Urteil als "verrückt", schließlich sei zu erwarten, dass jeder, der eine große Sammlung an Fotografien hat, mal schnell alle durchschaut, dann nach anderen Fotos sucht, die ähnliche Motive haben, und zu klagen beginnt: "Wir haben das Copyright auf "zwei Typen trinken Bier und richten den Boden ihrer Gläser gen Himmel!" Doctorow kann sich kaum halten: "It's an apocalyptically bad ruling, and an utter disaster in the making."
http://the1709blog.blogspot.com/2012/01/1709-blog-red-bus-seminar-early.html mit englischsprachiger Resonanz
Zur deutschen Rechtslage: "In der Regel hat der Fotograf keinen Schutz an dem vorgegebenen Motiv" (Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl. § 72 Rz. 14). Der Beck-Verlag fasst den Aufsatz von Bullinger/Garbers-von Boehm, Der Blick ist frei
Nachgestellte Fotos aus urheberrechtlicher Sicht, in: GRUR 2008, S. 26ff. in seiner Leitsatzkartei so zusammen:
Bei Lichtbildwerken erkennt die Rechtsprechung grundsätzlich keinen Motivschutz an. Das Motiv ist nur dann ausnahmsweise geschützt, wenn dessen Übernahme eine unfreie Bearbeitung i.S. des § 23 UrhG darstellt. Grundsätzlich sind Motive, genau wie Ideen, nicht urheberrechtlich geschützt. Sie sind, sofern ihnen nicht selbst Werkcharakter zukommt, gemeinfrei. Ein Monopol auf ein Motiv ist dem Urheberrecht fremd. Ein Fotograf kann nicht einen anderen Fotografen daran hindern, ein bestimmtes, möglicherweise von ihm "entdecktes" Motiv zu fotografieren. Das künstlerische Motiv selbst ist - genau wie Technik, Manier, Stil oder Vorgehensweise - nicht geschützt. Da es für das Vorliegen urheberrechtlichen Schutzes allein auf die Art und Weise der Darstellung ankommt, bezieht sich auch der Schutzumfang nur auf die Darstellung.
Die Autoren schreiben: Ein extensiver Motivschutz hätte gravierende Konsequenzen: Im Extremfall könnte ein umfassender Motivschutz zur Monopolisierung an sich gemeinfreier Perspektiven oder ganzer Objekte führen. Ein Fotograf, der das Brandenburger Tor aus einer besonders eindrucksvollen Perspektive fotografiert hat, könnte gegen Fotografien, die aus der gleichen Perspektive aufgenommen sind, vorgehen. Ein Museumsfotograf, der besonders gute Perspektiven bei der Fotografie von Skulpturen aus der Sammlung des Museums findet, könnte gegen andere Fotografien aus der gleichen Perspektive vorgehen. Dies hätte die – unpraktikable – Konsequenz, dass ein Fotograf, der eine Skulptur oder ein Gebäude fotografieren möchte, zunächst alle existierenden Fotografien des Motivs ausfindig machen und begutachten müsste, um einer Urheberrechtsverletzung vorzubeugen. Hierdurch würde künstlerisches Schaffen von Fotografen unsachgemäß behindert. Fotografen würden sich gegenseitig einschränken. Werkschutz für die Realität oder ein künstlerisches Konzept kann und soll es nicht geben. (S. 30)
KlausGraf - am Freitag, 27. Januar 2012, 19:56 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/photos.html
Via
http://bibliostoria.wordpress.com/2012/01/27/yad-vashem-photo-archive/
 http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/17397.html
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/17397.html
Via
http://bibliostoria.wordpress.com/2012/01/27/yad-vashem-photo-archive/
 http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/17397.html
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/17397.htmlKlausGraf - am Freitag, 27. Januar 2012, 19:43 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das ist einfach genial:
http://phantanews.de/wp/2012/01/hilfe-fur-von-buchblogger-rezensionen-frustrierte-autoren-und-verleger/
Gefunden durch
http://edlf.wordpress.com/2012/01/27/social-media-und-wie-man-es-besser-nicht-macht/
Hintergrundinfos zur Affäre:
http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2012/01/john-asht-und-die-organisierte-literaturkriminalitat-im-internet.php
Anstatt die Leute, die seine Arbeit kritisieren mit Klagen zu bedrohen, sollte Herr Asht vielleicht überlegen, ob es nicht sinnvollere Arten gibt, mit Feedback (auch wenn es negativ ist) umzugehen. Eigentlich sollte man ja davon ausgehen, dass ein Autor seine Bücher für die Leser schreibt und nicht die studierten Literaturkritiker. Die Leser sind es, die die Bücher kaufen (die Literaturkritiker kriegen ihre Bücher meistens vom Verlag geschenkt). Zu behaupten, dass nur die Meinung eines "offiziellen" Literaturkritikers zähle, der normale Leser sich aber gefälligst nicht öffentlich über das Buch zu äußern hat, ist absurd. Ich bezweifle nicht, dass es tatsächlich gefälschte Rezensionen gibt. Ich bezweifle nicht, dass es Leute gibt, die gegen Geld absichtlich schlechte (oder gute) Rezensionen verfassen. Aber deswegen den Leuten verbieten zu wollen, ihre Meinung über Bücher öffentlich kund zu tun, ist lächerlich.
Dem möchte ich eigentlich nur als persönliche Anmerkung hinzufügen, dass eine Trierer Historikerin, die in der Rezension des Buchs eines Dritten durch mich in Archivalia erwähnt wurde (beleidigend, wie sie fand) und mich durch ihren Anwalt vors AG Trier zerren ließ, damit voll und ganz auf die Schnauze gefallen ist. Die Klage wurde abgewiesen und war für sie bestimmt nicht billig.
http://phantanews.de/wp/2012/01/hilfe-fur-von-buchblogger-rezensionen-frustrierte-autoren-und-verleger/
Gefunden durch
http://edlf.wordpress.com/2012/01/27/social-media-und-wie-man-es-besser-nicht-macht/
Hintergrundinfos zur Affäre:
http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2012/01/john-asht-und-die-organisierte-literaturkriminalitat-im-internet.php
Anstatt die Leute, die seine Arbeit kritisieren mit Klagen zu bedrohen, sollte Herr Asht vielleicht überlegen, ob es nicht sinnvollere Arten gibt, mit Feedback (auch wenn es negativ ist) umzugehen. Eigentlich sollte man ja davon ausgehen, dass ein Autor seine Bücher für die Leser schreibt und nicht die studierten Literaturkritiker. Die Leser sind es, die die Bücher kaufen (die Literaturkritiker kriegen ihre Bücher meistens vom Verlag geschenkt). Zu behaupten, dass nur die Meinung eines "offiziellen" Literaturkritikers zähle, der normale Leser sich aber gefälligst nicht öffentlich über das Buch zu äußern hat, ist absurd. Ich bezweifle nicht, dass es tatsächlich gefälschte Rezensionen gibt. Ich bezweifle nicht, dass es Leute gibt, die gegen Geld absichtlich schlechte (oder gute) Rezensionen verfassen. Aber deswegen den Leuten verbieten zu wollen, ihre Meinung über Bücher öffentlich kund zu tun, ist lächerlich.
Dem möchte ich eigentlich nur als persönliche Anmerkung hinzufügen, dass eine Trierer Historikerin, die in der Rezension des Buchs eines Dritten durch mich in Archivalia erwähnt wurde (beleidigend, wie sie fand) und mich durch ihren Anwalt vors AG Trier zerren ließ, damit voll und ganz auf die Schnauze gefallen ist. Die Klage wurde abgewiesen und war für sie bestimmt nicht billig.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Öffentliche Anhörung im Ausschuss für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages am 25. Januar 2012
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/37449210_kw04_pa_kultur/index.html
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/37449210_kw04_pa_kultur/index.html
Angela Ullmann - am Freitag, 27. Januar 2012, 13:09 - Rubrik: Digitale Unterlagen
"Der Trend zur Digitalisierung von Akten und Unterlagen stellt Archivare vor große Herausforderungen. "Digitale Daten müssen ununterbrochen gestreichelt und gehätschelt werden", sagt Dr. Marcus Stumpf, Leiter des LWL-Archivamts für Westfalen, in der aktuellen Ausgabe des Westfalenspiegels, die am 28. Januar erscheint. So seien sämtliche Daten der Apollomission der Nasa verloren, da diese auf Magnetbänder kopiert wurden, die heute nicht mehr gelesen werden können. "Diese Daten sind tot", so Stumpf. Im Archivamt des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in Münster werden Akten zwar ebenfalls digitalisiert, zusätzlich deponieren die Mitarbeiter die Original-Unterlagen aber in säurefreie Mappen aus Pappe. Die dafür genutzte Regalfläche in den speziell klimatisierten Magazinen hat eine Länge von zehn bis zwölf
Kilometern. Privatpersonen rät Dr. Marcus Stumpf, wichtige Daten wie etwa Familienfotos immer wieder auf neue Datenträger zu überspielen."
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Preiswürdiges Zitat des Kolegen Stumpf - m. E.!
Kilometern. Privatpersonen rät Dr. Marcus Stumpf, wichtige Daten wie etwa Familienfotos immer wieder auf neue Datenträger zu überspielen."
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Preiswürdiges Zitat des Kolegen Stumpf - m. E.!
Wolf Thomas - am Freitag, 27. Januar 2012, 12:13 - Rubrik: Digitale Unterlagen

Pressegespräch, 26.1. 2012 im Stadtarchiv Speyer, mit Bürgermeisterin Monika Kabs. Vorstellung der Vortragsreihe 2012 und des Jahresberichts 2011.
Quelle: Stadtarchiv Speyer (flickr-account), http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Jahresbericht 2011
View more documents from Stadtarchiv Speyer
Wolf Thomas - am Freitag, 27. Januar 2012, 09:40 - Rubrik: Kommunalarchive
Die aktuelle Vortragsreihe (Mittwochabend im Stadtarchiv) ist online abrufbar unter
http://www.speyer.de/de/bildung/bibliotheken/stadtarchiv/Vortragsreihe__Mittwochabend_im_Stadtarchiv_
http://www.speyer.de/de/bildung/bibliotheken/stadtarchiv/Vortragsreihe__Mittwochabend_im_Stadtarchiv_
J. Kemper - am Freitag, 27. Januar 2012, 09:12 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://rzbl04.biblio.etc.tu-bs.de:8080/docportal/servlets/MCRSearchServlet?mode=results&id=-iwxk2wa7eztogxwhq6jb&page=1&numPerPage=10
Bislang bis 1931 online.
Bislang bis 1931 online.
KlausGraf - am Freitag, 27. Januar 2012, 01:46 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Spicilegium Casinense [electronic resource] : complectens analecta sacra et profana e codd. Casinensibus aliarumque bibliothecarum / collecta atque edita cura et studio Monachorum S. Benedicti.
Published:
[N.p.]: Typis Archiocoenobii Montis Casini, 1888.
http://www.columbia.edu/cu/lweb/digital/collections/cul/texts/ldpd_9130382_000/
Published:
[N.p.]: Typis Archiocoenobii Montis Casini, 1888.
http://www.columbia.edu/cu/lweb/digital/collections/cul/texts/ldpd_9130382_000/
KlausGraf - am Freitag, 27. Januar 2012, 01:33 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Wie immer von stupender Quellen- und Digitalisat-Kenntnis Otto Vervaarts neuester Blogeintrag:
http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2012/01/26/legal-history-and-heraldic-manuscripts/
Wir beschränken uns darauf, Otto auf die Digitalisate von Dünnebeil I-II aufmerksam zu machen
http://www.francia.honds.de/index.php?action=parcourir&ouvrage=37
und auf die Arbeit von Hiltmann zu den Heroldskompendien zum größeren Kontext des Beitrags hinzuweisen.
http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2012/01/26/legal-history-and-heraldic-manuscripts/
Wir beschränken uns darauf, Otto auf die Digitalisate von Dünnebeil I-II aufmerksam zu machen
http://www.francia.honds.de/index.php?action=parcourir&ouvrage=37
und auf die Arbeit von Hiltmann zu den Heroldskompendien zum größeren Kontext des Beitrags hinzuweisen.
KlausGraf - am Freitag, 27. Januar 2012, 01:03 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=19948
"Die Wiener Symphoniker schreiben im Rahmen eines Werkvertrags die Leistung der Betreuung des historischen Archivs aus."
"Die Wiener Symphoniker schreiben im Rahmen eines Werkvertrags die Leistung der Betreuung des historischen Archivs aus."
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Januar 2012, 23:45 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Auch bei Public-Domain-Büchern ist das Abspeichern von Seiten mittels der rechten Maustaste von Google deaktiviert. Wie man trotzdem an die Grafiken kommt, erklärt für Firefox und Chrome:
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Google_Book_Search#Umgehen_von_Googles_Digital_Rights_Management
In beiden Fällen ruft man mit rechter Maustaste ein Menü auf, in dem man "Seiteninformationen" (FF) oder "Element untersuchen" (Chrome) auswählt. Bei FF findet man die Grafiken unter "Medien", bei Chrome unter "Resources". Der Screenshot zeigt das Resultat bei Chrome.
Funktioniert so auch bei Amazon
http://sitb-images-eu.amazon.com/Qffs+v35lerRXGTQR11R8ZFGVYnoHqBso6qPrdI9tnpJ8/FODsR3bxlzqX+DaC0E
Zum Herunterladen von Vorschaubüchern:
http://www.gbooksdownloader.com/ (höchste Auflösung wählen)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gbs_speichern_chrome.jpg
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Google_Book_Search#Umgehen_von_Googles_Digital_Rights_Management
In beiden Fällen ruft man mit rechter Maustaste ein Menü auf, in dem man "Seiteninformationen" (FF) oder "Element untersuchen" (Chrome) auswählt. Bei FF findet man die Grafiken unter "Medien", bei Chrome unter "Resources". Der Screenshot zeigt das Resultat bei Chrome.
Funktioniert so auch bei Amazon
http://sitb-images-eu.amazon.com/Qffs+v35lerRXGTQR11R8ZFGVYnoHqBso6qPrdI9tnpJ8/FODsR3bxlzqX+DaC0E
Zum Herunterladen von Vorschaubüchern:
http://www.gbooksdownloader.com/ (höchste Auflösung wählen)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gbs_speichern_chrome.jpg
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Januar 2012, 23:01 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Eine empörende Entscheidung eines UK-Gerichts wegen der illegalen Nutzung von Fotografien:
http://the1709blog.blogspot.com/2012/01/innocent-infringement-is-not-defence.html
Eine karitative Organisation zu verklagen halte ich für absolut schäbig. Dumme Richter dürfen dekretieren, was zumutbar ist und was nicht: "the fact that they thought they had permission is not relevant. Although this may seem harsh, it is not. From the copyright owners point of view, the copyright is his property and his rights have been infringed if he did not give permission." Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte, wenn ich dergleichen lese. Und mich beschleicht klammheimliche Freude, wenn ich weiß, dass die Werke solcher Fotografen unendlich oft im Internet unerlaubt genutzt werden.
http://the1709blog.blogspot.com/2012/01/innocent-infringement-is-not-defence.html
Eine karitative Organisation zu verklagen halte ich für absolut schäbig. Dumme Richter dürfen dekretieren, was zumutbar ist und was nicht: "the fact that they thought they had permission is not relevant. Although this may seem harsh, it is not. From the copyright owners point of view, the copyright is his property and his rights have been infringed if he did not give permission." Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte, wenn ich dergleichen lese. Und mich beschleicht klammheimliche Freude, wenn ich weiß, dass die Werke solcher Fotografen unendlich oft im Internet unerlaubt genutzt werden.
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Januar 2012, 21:10 - Rubrik: Archivrecht
From: "Dr. Karsten Uhde"
Sender: archivliste-request@lists.uni-marburg.de
Subject: WG: GDA-A2-1022-5/1/34 - EAPl-Aufbewahrungsfristenverzeichnis 2011; - hier: Mailinglisten und Newsletter
Date: Fri, 4 Nov 2011 10:24:38 +0100
To:
Auf Bitte von Frau Pollach weitergeleitet.
K.Uhde
---------------------------------------------------------------------
Dr. Karsten Uhde
Archivschule Marburg
Bismarckstr. 32
35037 Marburg
Germany
Tel.: +49 6421 16971 25
e-mail:uhde@staff.uni-marburg.de
Von: Claudia.Pollach@gda.bayern.de [mailto:Claudia.Pollach@gda.bayern.de]
Gesendet: Freitag, 4. November 2011 10:05
An: uhde@staff.uni-marburg.de
Betreff: WG: GDA-A2-1022-5/1/34 - EAPl-Aufbewahrungsfristenverzeichnis 2011; - hier: Mailinglisten und Newsletter
From:
Subject: GDA-A2-1022-5/1/34 - EAPl-Aufbewahrungsfristenverzeichnis 2011; - hier: Mailinglisten und Newsletter
Date: Thu, 20 Oct 2011 14:31:09 +0100
To:
<> In der
Anlage erhalten Sie ein Schreiben der Generaldirektion der Staatlichen
Archive Bayerns.
Cl. Pollach
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns
Schönfeldstr. 5, 80539 München
Postfach 221152, 80501 München
Tel. 089/28638-2485, Fax 089/28638-2615
www.gda.bayern.de
E-Mail: poststelle@gda.bayern.de
Attachment: Brief_ohne_IA_GDion_13.10.2011 11_29_Archivschule Marburg.PDF (90K)
Kein Kommentar.
Sender: archivliste-request@lists.uni-marburg.de
Subject: WG: GDA-A2-1022-5/1/34 - EAPl-Aufbewahrungsfristenverzeichnis 2011; - hier: Mailinglisten und Newsletter
Date: Fri, 4 Nov 2011 10:24:38 +0100
To:
Auf Bitte von Frau Pollach weitergeleitet.
K.Uhde
---------------------------------------------------------------------
Dr. Karsten Uhde
Archivschule Marburg
Bismarckstr. 32
35037 Marburg
Germany
Tel.: +49 6421 16971 25
e-mail:uhde@staff.uni-marburg.de
Von: Claudia.Pollach@gda.bayern.de [mailto:Claudia.Pollach@gda.bayern.de]
Gesendet: Freitag, 4. November 2011 10:05
An: uhde@staff.uni-marburg.de
Betreff: WG: GDA-A2-1022-5/1/34 - EAPl-Aufbewahrungsfristenverzeichnis 2011; - hier: Mailinglisten und Newsletter
From:
Subject: GDA-A2-1022-5/1/34 - EAPl-Aufbewahrungsfristenverzeichnis 2011; - hier: Mailinglisten und Newsletter
Date: Thu, 20 Oct 2011 14:31:09 +0100
To:
<> In der
Anlage erhalten Sie ein Schreiben der Generaldirektion der Staatlichen
Archive Bayerns.
Cl. Pollach
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns
Schönfeldstr. 5, 80539 München
Postfach 221152, 80501 München
Tel. 089/28638-2485, Fax 089/28638-2615
www.gda.bayern.de
E-Mail: poststelle@gda.bayern.de
Attachment: Brief_ohne_IA_GDion_13.10.2011 11_29_Archivschule Marburg.PDF (90K)
Kein Kommentar.
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Januar 2012, 17:19 - Rubrik: Staatsarchive
Eindrucksvolle Testergebnisse für Googles Übersetzungs-App:
http://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/clip/263464-dolmetscher-app-1.3047644/
Update: Auf einem befreundeten iPad konnte ich mir die App ansehen. Cool!
http://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/clip/263464-dolmetscher-app-1.3047644/
Update: Auf einem befreundeten iPad konnte ich mir die App ansehen. Cool!
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Januar 2012, 15:36 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Lambert Heller schreibt in der neuen Liste repositorymanagement:
"ich halte Alumni OA für eine exzellente strategische Idee für IRs.
(IRs sollten so schnell wie möglich auf PND und demnächst auch auf ORCID verlinken - schon richtig, aber ich will mal kurz bei dieser Idee bleiben.)
Alumni-Community-Management steht bei den Hochschulen gerade hoch im Kurs.
Eines der Lieblingsthemen des Hochschulmarketing nah und fern. Nach
haltbaren und *greifbaren* Bezugspunkten zwischen Akademikern und "ihrer"
(ehemaligen) Hochschule wird Ausschau gehalten!
Und das ist keineswegs nur eine Modeerscheinung. Die Frage nach der Bindung
der Alumni passt vielmehr perfekt in Zeiten der endlosen Atomisierung des
Konzepts "Hochschulzugehörigkeit". MITx, Udacity und Co. zeigen, was hier
vor sich geht.
Eine tolle, bisher kaum genutzte Gelegenheit für Institutional Repositories also. Die Idee ist ja nicht neu, vgl.
http://archiv.twoday.net/stories/5262756/ - weniger bekannt ist vielleicht, daß z.B. die Bodleian Library in Oxford dieses Konzept bereits umsetzt und bewirbt, vgl.
http://www.bodleian.ox.ac.uk/ora/oxford_etheses/eligible_ethesis_depositors/alumni_holding_oxford_pg_degrees_by_research
Neuerdings einschließlich des i-Tüpfelchens der Retrodigitalisierung
http://www.bodleian.ox.ac.uk/notices/2011-feb-23 "
Hier nochmals der Wortlaut meines Beitrags vom 17. Oktober 2008 http://archiv.twoday.net/stories/5262756/ :
Hochschulen in aller Welt fördern die Verbindung der Hochschulabsolventen (Alumni) mit der Hochschule. Die Alumni werden als höchst wertvolle Ressource gesehen, die durch finanzielle, aber auch ideelle Förderung der Hochschule in den Kreis der Akteure einbezogen sind, die daran arbeiten, die Ziele der Hochschule zu verwirklichen.
Um auch auf dem Gebiet des Open Access die Verbundenheit der Alumni und der Hochschule zu stärken, wäre es sinnvoll, den Alumni die Möglichkeit zu eröffnen, wissenschaftliche Publikationen auf dem Hochschulschriftenserver zu deponieren.
Bereits jetzt dürften viele Hochschulen hinsichtlich der Qualifikationsarbeiten wie Dissertationen und Habilitationen, die an der Hochschule entstanden sind, eine Veröffentlichung auf dem Hochschulschriftenserver ohne zeitliche Begrenzung ermöglichen. Als ich vor Jahren in Tübingen wegen meiner Dissertation (1987) anklopfte, erhielt ich die Auskunft, diese könne auf dem Tübinger Schriftenserver veröffentlicht werden.
Es dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen, dass ein Hochschulschriftenserver (auch wenn ärmelschonerbewehrte bürokratische Verwalter nicht selten sind, wie ich von Freidok weiss) die Beiträge eines Alumnus, der Nobelpreisträger ist, aufnehmen würde, auch wenn dieser an einer anderer Universität inzwischen lehrt.
Eine Öffnung der Schriftenserver hätte überwiegend Vorteile:
(1) Der Schriftenserver würde weiter gefüllt, siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/3264283/
(2) Es besteht die Chance, wertvolle Fachpublikationen Open Access zu machen, etwa aus dem Bereich der Wirtschaft oder der Politik.
Es wäre vermutlich der Universität Leipzig hochwillkommen, Publikationen einer ehemaligen Diplomandin, Frau Angela Merkel, einstellen zu dürfen.
(3) Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Open Access für die Wissenschaftskommunikation wäre eine Stärkung der Bindungen zwischen Universität und Alumni auch auf diesem Gebiet wichtig.
Daher hat die Uni Göttingen 2007 auf dem Göttinger Alumni-Tag auch Open Access vorgestellt.
(4) Da Peter Suber und Brewster Kahle derzeit ihren Plan eines universalen Repositoriums nicht weiterverfolgen und für Publikationen aus vielen Disziplinen auch aus Sprachgründen ein disziplinäres Repositorium nicht in Betracht kommt, würde eine flächendeckende Alumni-Regelung eine große Lücke bei der Möglichkeit, Open Access-Publikationen in einem anerkannten OA-Server unterzubringen, schließen.
Die meisten wissenschaftlich Tätigen, die nicht an eine Hochschule angebunden sind, haben einen Hochschulabschluss, sind also Alumni. Ihre Publikationen wären also mit dem Alumni-Privileg ohne weiteres für OA (im Sinne des grünen Wegs) gesichert.
Auch Wissenschaftler (z.B. aus der Dritten Welt), die an einer Hochschule tätig sind, die noch keinen Schriftenserver unterhält, können auf diese Weise Self-Archiving betreiben.
Als Nachteile könnten angesprochen werden:
a) die strikte Begrenzung der Schriftenserver für Hochschulangehörige wird aufgeweicht
In vielen Hochschulen lässt man aber auch bereits jetzt schon nach Einzelfallprüfung hochwertige externe Publikationen zu (z.B. die FU Berlin die Vier Prinzen) zu.
b) einzelne Alumni-Publikationen genügen nicht wissenschaftlichen Standards
Das ist auch bei Publikationen von Hochschulangehörigen mitunter der Fall. Eine kursorische Prüfung vor Einstellung wäre sicher akzeptabel, sollte sich herausstellen, dass Inakzeptables eingeliefert wird.
Dieser Vorschlag plädiert dafür, von der mantra-artigen Behauptung, nur institutionelle Mandate könnten Dokumentenserver füllen, abzusehen und neue Wege auszuprobieren. Es ist definitiv falsch, dass nur institutionelle Mandate OA wirklich fördern können, wie das niederländische Programm "Cream of Science" beweist. Und die wissenschaftliche Produktion der nicht an einer Hochschule Tätigen wird durch dieses Mantra in schäbiger Weise mit Füßen getreten.
"ich halte Alumni OA für eine exzellente strategische Idee für IRs.
(IRs sollten so schnell wie möglich auf PND und demnächst auch auf ORCID verlinken - schon richtig, aber ich will mal kurz bei dieser Idee bleiben.)
Alumni-Community-Management steht bei den Hochschulen gerade hoch im Kurs.
Eines der Lieblingsthemen des Hochschulmarketing nah und fern. Nach
haltbaren und *greifbaren* Bezugspunkten zwischen Akademikern und "ihrer"
(ehemaligen) Hochschule wird Ausschau gehalten!
Und das ist keineswegs nur eine Modeerscheinung. Die Frage nach der Bindung
der Alumni passt vielmehr perfekt in Zeiten der endlosen Atomisierung des
Konzepts "Hochschulzugehörigkeit". MITx, Udacity und Co. zeigen, was hier
vor sich geht.
Eine tolle, bisher kaum genutzte Gelegenheit für Institutional Repositories also. Die Idee ist ja nicht neu, vgl.
http://archiv.twoday.net/stories/5262756/ - weniger bekannt ist vielleicht, daß z.B. die Bodleian Library in Oxford dieses Konzept bereits umsetzt und bewirbt, vgl.
http://www.bodleian.ox.ac.uk/ora/oxford_etheses/eligible_ethesis_depositors/alumni_holding_oxford_pg_degrees_by_research
Neuerdings einschließlich des i-Tüpfelchens der Retrodigitalisierung
http://www.bodleian.ox.ac.uk/notices/2011-feb-23 "
Hier nochmals der Wortlaut meines Beitrags vom 17. Oktober 2008 http://archiv.twoday.net/stories/5262756/ :
Hochschulen in aller Welt fördern die Verbindung der Hochschulabsolventen (Alumni) mit der Hochschule. Die Alumni werden als höchst wertvolle Ressource gesehen, die durch finanzielle, aber auch ideelle Förderung der Hochschule in den Kreis der Akteure einbezogen sind, die daran arbeiten, die Ziele der Hochschule zu verwirklichen.
Um auch auf dem Gebiet des Open Access die Verbundenheit der Alumni und der Hochschule zu stärken, wäre es sinnvoll, den Alumni die Möglichkeit zu eröffnen, wissenschaftliche Publikationen auf dem Hochschulschriftenserver zu deponieren.
Bereits jetzt dürften viele Hochschulen hinsichtlich der Qualifikationsarbeiten wie Dissertationen und Habilitationen, die an der Hochschule entstanden sind, eine Veröffentlichung auf dem Hochschulschriftenserver ohne zeitliche Begrenzung ermöglichen. Als ich vor Jahren in Tübingen wegen meiner Dissertation (1987) anklopfte, erhielt ich die Auskunft, diese könne auf dem Tübinger Schriftenserver veröffentlicht werden.
Es dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen, dass ein Hochschulschriftenserver (auch wenn ärmelschonerbewehrte bürokratische Verwalter nicht selten sind, wie ich von Freidok weiss) die Beiträge eines Alumnus, der Nobelpreisträger ist, aufnehmen würde, auch wenn dieser an einer anderer Universität inzwischen lehrt.
Eine Öffnung der Schriftenserver hätte überwiegend Vorteile:
(1) Der Schriftenserver würde weiter gefüllt, siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/3264283/
(2) Es besteht die Chance, wertvolle Fachpublikationen Open Access zu machen, etwa aus dem Bereich der Wirtschaft oder der Politik.
Es wäre vermutlich der Universität Leipzig hochwillkommen, Publikationen einer ehemaligen Diplomandin, Frau Angela Merkel, einstellen zu dürfen.
(3) Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Open Access für die Wissenschaftskommunikation wäre eine Stärkung der Bindungen zwischen Universität und Alumni auch auf diesem Gebiet wichtig.
Daher hat die Uni Göttingen 2007 auf dem Göttinger Alumni-Tag auch Open Access vorgestellt.
(4) Da Peter Suber und Brewster Kahle derzeit ihren Plan eines universalen Repositoriums nicht weiterverfolgen und für Publikationen aus vielen Disziplinen auch aus Sprachgründen ein disziplinäres Repositorium nicht in Betracht kommt, würde eine flächendeckende Alumni-Regelung eine große Lücke bei der Möglichkeit, Open Access-Publikationen in einem anerkannten OA-Server unterzubringen, schließen.
Die meisten wissenschaftlich Tätigen, die nicht an eine Hochschule angebunden sind, haben einen Hochschulabschluss, sind also Alumni. Ihre Publikationen wären also mit dem Alumni-Privileg ohne weiteres für OA (im Sinne des grünen Wegs) gesichert.
Auch Wissenschaftler (z.B. aus der Dritten Welt), die an einer Hochschule tätig sind, die noch keinen Schriftenserver unterhält, können auf diese Weise Self-Archiving betreiben.
Als Nachteile könnten angesprochen werden:
a) die strikte Begrenzung der Schriftenserver für Hochschulangehörige wird aufgeweicht
In vielen Hochschulen lässt man aber auch bereits jetzt schon nach Einzelfallprüfung hochwertige externe Publikationen zu (z.B. die FU Berlin die Vier Prinzen) zu.
b) einzelne Alumni-Publikationen genügen nicht wissenschaftlichen Standards
Das ist auch bei Publikationen von Hochschulangehörigen mitunter der Fall. Eine kursorische Prüfung vor Einstellung wäre sicher akzeptabel, sollte sich herausstellen, dass Inakzeptables eingeliefert wird.
Dieser Vorschlag plädiert dafür, von der mantra-artigen Behauptung, nur institutionelle Mandate könnten Dokumentenserver füllen, abzusehen und neue Wege auszuprobieren. Es ist definitiv falsch, dass nur institutionelle Mandate OA wirklich fördern können, wie das niederländische Programm "Cream of Science" beweist. Und die wissenschaftliche Produktion der nicht an einer Hochschule Tätigen wird durch dieses Mantra in schäbiger Weise mit Füßen getreten.
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Januar 2012, 15:16 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/zeitungszeugen-gericht-verbietet-abdruck-von-mein-kampf-11623802.html
Ich kenne die einstweilige Verfügung des LG München (az: 7 O 1533/12) zwar nicht im Wortlaut, halte sie aber für völlig falsch. Am 1.1.2016 sind Hitlers Werke ohnehin gemeinfrei, was soll das, so kurz vor Torschluss kommentierte Auszüge zu verbieten? Hier wurde ganz offensichtlich das Grundrecht der Pressefreiheit entschieden zu wenig berücksichtigt.
Zum Umfang von Zitaten lesen wir gemeinsam die BGH-Entscheidung Geistchristentum (I ZR 28/83, leider kein Volltext online) [jetzt schon: http://archiv.twoday.net/stories/64961860/ ]
Siehe auch
http://zeitungszeugen.de/dasunlesbarebuch/
http://www.sueddeutsche.de/medien/bayern-setzt-sich-in-streit-um-mein-kampf-durch-hitlers-hetzschrift-erscheint-nur-unleserlich-1.1267085
http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/nz-kultur/hitlers-mein-kampf-ist-ein-unlesbares-buch-1.1801857
http://archiv.twoday.net/search?q=zeitungszeugen
Update:
http://www.lto.de/de/html/nachrichten/5396/auszuege-aus-mein-kampf-der-diktator-und-das-urheberrecht/

Ich kenne die einstweilige Verfügung des LG München (az: 7 O 1533/12) zwar nicht im Wortlaut, halte sie aber für völlig falsch. Am 1.1.2016 sind Hitlers Werke ohnehin gemeinfrei, was soll das, so kurz vor Torschluss kommentierte Auszüge zu verbieten? Hier wurde ganz offensichtlich das Grundrecht der Pressefreiheit entschieden zu wenig berücksichtigt.
Zum Umfang von Zitaten lesen wir gemeinsam die BGH-Entscheidung Geistchristentum (I ZR 28/83, leider kein Volltext online) [jetzt schon: http://archiv.twoday.net/stories/64961860/ ]
Siehe auch
http://zeitungszeugen.de/dasunlesbarebuch/
http://www.sueddeutsche.de/medien/bayern-setzt-sich-in-streit-um-mein-kampf-durch-hitlers-hetzschrift-erscheint-nur-unleserlich-1.1267085
http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/nz-kultur/hitlers-mein-kampf-ist-ein-unlesbares-buch-1.1801857
http://archiv.twoday.net/search?q=zeitungszeugen
Update:
http://www.lto.de/de/html/nachrichten/5396/auszuege-aus-mein-kampf-der-diktator-und-das-urheberrecht/

KlausGraf - am Donnerstag, 26. Januar 2012, 14:56 - Rubrik: Archivrecht
Die enttäuschende Antwort des WDR, wie zu erwarten:
http://www.piksa.info/blog/2012/01/03/offener-brief-an-den-wdr-5-zu-creative-commons-und-depublikationspflicht/
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/64023585/
Siehe auch
http://netzpolitik.org/2012/wdr-beantwortet-offenen-brief-zu-depublikationspflicht-und-cc/

http://www.piksa.info/blog/2012/01/03/offener-brief-an-den-wdr-5-zu-creative-commons-und-depublikationspflicht/
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/64023585/
Siehe auch
http://netzpolitik.org/2012/wdr-beantwortet-offenen-brief-zu-depublikationspflicht-und-cc/

KlausGraf - am Donnerstag, 26. Januar 2012, 14:45 - Rubrik: Medienarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.nzz.ch/nachrichten/hintergrund/wissenschaft/ein_baerendienst_an_der_forschung_1.14511447.html
Seit 2008 verlangt das National Institute of Health (NIH), dass alle wissenschaftlichen Arbeiten, die durch diese Institution gefördert wurden, spätestens nach einem halben Jahr über das hauseigene Archiv «PubMed Central» frei zugänglich sind. Diese Errungenschaft will die am 16. Dezember 2011 im amerikanischen Kongress eingegebene Gesetzesvorlage «Research Works Act» wieder rückgängig machen. Sie will verbieten, dass die Gewährung von öffentlichen Fördermitteln an die Bedingung geknüpft wird, dass die Forschungsergebnisse auf frei zugänglichen Plattformen publiziert werden. Die Gesetzesvorlage wurde von den Kongressabgeordneten Darrell Issa und Carolyn Maloney mit der Begründung eingereicht, dass mit der NIH-Bedingung Wissenschaftsverlage nicht mehr überlebensfähig seien. Wie inzwischen bekanntwurde, ist der Wahlkampf von Maloney durch Spenden des Wissenschaftsverlags Elsevier unterstützt worden.
Fast zur gleichen Zeit, am 19. Dezember 2011, haben die Wissenschaftsverlage Elsevier, Thieme und Springer eine Klage beim Zürcher Handelsgericht eingereicht, mit welcher der ETH-Bibliothek verboten werden soll, ihren Dokumentenlieferdienst in der heutigen Form weiterzuführen. Über diesen Dienst können Kunden der ETH-Bibliothek die elektronische Zusendung von Artikeln aus wissenschaftlichen Zeitschriften verlangen. Die Kopien dürfen nur für den internen Gebrauch verwendet und nicht weitergegeben werden. Zudem entrichtet die ETH-Bibliothek der Verwertungsgesellschaft Pro Litteris eine jährliche Vergütung. Die klagenden Verlage wollen diese Dienstleistung mit der Begründung verbieten, dass sie diese Artikel selbst online anbieten, allerdings in der Regel für ungefähr 30 Euro pro Artikel, ein Vielfaches dessen, was der Bezug durch die ETH-Bibliothek kostet.
Mit ihrer Klage wollen die Wissenschaftsverlage eine Regelung des schweizerischen Urheberrechtsgesetzes unterlaufen, die das auszugsweise Kopieren aus Zeitschriften ausdrücklich erlaubt. Diese Regelung ist, im Vergleich etwa zur Situation in Deutschland, wo derartige Kopien verboten sind, ein eindeutiger Standortvorteil für den Forschungsplatz Schweiz.
Via Sebastian Dosch G+
Update: Siehe auch
http://www.steigerlegal.ch/2012/01/26/freies-wissen-verlage-verklagen-bibliothek-der-eth-zuerich/
"Im Bereich der Rechtswissenschaften übrigens ist «Open Access» in der Schweiz leider noch völlig unterentwickelt. Erst wenige Juristen haben erkannt, dass ein möglichst freier Zugang zu ihren Publikationen in ihrem eigenen Interesse liegt und veröffentlichen ihre Publikationen beispielsweise online."
Seit 2008 verlangt das National Institute of Health (NIH), dass alle wissenschaftlichen Arbeiten, die durch diese Institution gefördert wurden, spätestens nach einem halben Jahr über das hauseigene Archiv «PubMed Central» frei zugänglich sind. Diese Errungenschaft will die am 16. Dezember 2011 im amerikanischen Kongress eingegebene Gesetzesvorlage «Research Works Act» wieder rückgängig machen. Sie will verbieten, dass die Gewährung von öffentlichen Fördermitteln an die Bedingung geknüpft wird, dass die Forschungsergebnisse auf frei zugänglichen Plattformen publiziert werden. Die Gesetzesvorlage wurde von den Kongressabgeordneten Darrell Issa und Carolyn Maloney mit der Begründung eingereicht, dass mit der NIH-Bedingung Wissenschaftsverlage nicht mehr überlebensfähig seien. Wie inzwischen bekanntwurde, ist der Wahlkampf von Maloney durch Spenden des Wissenschaftsverlags Elsevier unterstützt worden.
Fast zur gleichen Zeit, am 19. Dezember 2011, haben die Wissenschaftsverlage Elsevier, Thieme und Springer eine Klage beim Zürcher Handelsgericht eingereicht, mit welcher der ETH-Bibliothek verboten werden soll, ihren Dokumentenlieferdienst in der heutigen Form weiterzuführen. Über diesen Dienst können Kunden der ETH-Bibliothek die elektronische Zusendung von Artikeln aus wissenschaftlichen Zeitschriften verlangen. Die Kopien dürfen nur für den internen Gebrauch verwendet und nicht weitergegeben werden. Zudem entrichtet die ETH-Bibliothek der Verwertungsgesellschaft Pro Litteris eine jährliche Vergütung. Die klagenden Verlage wollen diese Dienstleistung mit der Begründung verbieten, dass sie diese Artikel selbst online anbieten, allerdings in der Regel für ungefähr 30 Euro pro Artikel, ein Vielfaches dessen, was der Bezug durch die ETH-Bibliothek kostet.
Mit ihrer Klage wollen die Wissenschaftsverlage eine Regelung des schweizerischen Urheberrechtsgesetzes unterlaufen, die das auszugsweise Kopieren aus Zeitschriften ausdrücklich erlaubt. Diese Regelung ist, im Vergleich etwa zur Situation in Deutschland, wo derartige Kopien verboten sind, ein eindeutiger Standortvorteil für den Forschungsplatz Schweiz.
Via Sebastian Dosch G+
Update: Siehe auch
http://www.steigerlegal.ch/2012/01/26/freies-wissen-verlage-verklagen-bibliothek-der-eth-zuerich/
"Im Bereich der Rechtswissenschaften übrigens ist «Open Access» in der Schweiz leider noch völlig unterentwickelt. Erst wenige Juristen haben erkannt, dass ein möglichst freier Zugang zu ihren Publikationen in ihrem eigenen Interesse liegt und veröffentlichen ihre Publikationen beispielsweise online."
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Januar 2012, 14:34 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://sympa.cms.hu-berlin.de/sympa/arc/repositorymanagement/2012-01/msg00029.html
"IR-Manager leben in einer Blase weit weg von der Wissenschaft."
Update zu
http://archiv.twoday.net/stories/64956648/
"IR-Manager leben in einer Blase weit weg von der Wissenschaft."
Update zu
http://archiv.twoday.net/stories/64956648/
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Januar 2012, 14:11 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Christof Schöch stellt ein neues Buch zum wissenschaftlichen Publizieren im digitalen Kontext vor.
http://redaktionsblog.hypotheses.org/193
Was hat Kathleen Fitzpatrick nun speziell zum wissenschaftlichen Bloggen zu sagen? Als drei Kernmerkmale von Blogs nennt Fitzpatrick, die für sie die erste und erfolgreichste neue Form wissenschaftlichen Publizierens sind, dass sie “commenting, linking, and versioning” (S. 67) ermöglichen, drei Merkmale die alle den eigentlich immer schon vorhandenen, interaktiven, netzwerkhaften und prozessualen Charakter wissenschaftlichen Schreibens zu realisieren erlauben, der Fitzpatrick besonders wichtig ist (wobei die Versionierung doch vor allem Wikis auszeichnet und nur selten, und recht primitiv, in Blogs realisiert ist). Konkrete Vorteile des Bloggens für Forscher sieht sie außerdem vor allem darin, dass das Bloggen gewissermaßen die Finger lockert für andere Schreibaktivitäten, dass man seine im Blog formulierten Ideen durch das Feedback tatsächlich weiter und tiefer verfolgen kann, und dass man schon während des Forschungsprozesses ein interessiertes Publikum erreicht oder für sich aufbauen kann.
Zentral und grundsätzlich scheint mir an Fitzpatrick Plaidoyer für das Bloggen zu sein, dass sie Wissenschaft als im Kern kommunikativ, interaktiv und prozesshaft definiert – es geht darum, dass Wissen, Ideen und Texte frei zirkulieren können, diskutiert werden können, dadurch weiterentwickelt werden und zugleich ihr Publikum erreichen (S. 100). In dieser Perspektive ist der Blog natürlich ein ideales Medium, in dem man schnell, unkompliziert, offen und interaktiv publizieren kann. Fitzpatrick gibt selbst gerne zu, dass all dies eher für Kurzformen gilt und dass für die wissenschaftlichen Langformen noch keine vergleichbar elegante digitale Form existiert (S. 109-110).
http://redaktionsblog.hypotheses.org/193
Was hat Kathleen Fitzpatrick nun speziell zum wissenschaftlichen Bloggen zu sagen? Als drei Kernmerkmale von Blogs nennt Fitzpatrick, die für sie die erste und erfolgreichste neue Form wissenschaftlichen Publizierens sind, dass sie “commenting, linking, and versioning” (S. 67) ermöglichen, drei Merkmale die alle den eigentlich immer schon vorhandenen, interaktiven, netzwerkhaften und prozessualen Charakter wissenschaftlichen Schreibens zu realisieren erlauben, der Fitzpatrick besonders wichtig ist (wobei die Versionierung doch vor allem Wikis auszeichnet und nur selten, und recht primitiv, in Blogs realisiert ist). Konkrete Vorteile des Bloggens für Forscher sieht sie außerdem vor allem darin, dass das Bloggen gewissermaßen die Finger lockert für andere Schreibaktivitäten, dass man seine im Blog formulierten Ideen durch das Feedback tatsächlich weiter und tiefer verfolgen kann, und dass man schon während des Forschungsprozesses ein interessiertes Publikum erreicht oder für sich aufbauen kann.
Zentral und grundsätzlich scheint mir an Fitzpatrick Plaidoyer für das Bloggen zu sein, dass sie Wissenschaft als im Kern kommunikativ, interaktiv und prozesshaft definiert – es geht darum, dass Wissen, Ideen und Texte frei zirkulieren können, diskutiert werden können, dadurch weiterentwickelt werden und zugleich ihr Publikum erreichen (S. 100). In dieser Perspektive ist der Blog natürlich ein ideales Medium, in dem man schnell, unkompliziert, offen und interaktiv publizieren kann. Fitzpatrick gibt selbst gerne zu, dass all dies eher für Kurzformen gilt und dass für die wissenschaftlichen Langformen noch keine vergleichbar elegante digitale Form existiert (S. 109-110).
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/01/2012121132641226409.html
Excerpt:
Appealing to the tastes of package tourists and neglecting the interest of ordinary Egyptians, the Antiquities Council has long scorned what cannot be displayed in expensive vitrines and hastily photographed. Egypt's post-"Islamic" - and particularly its 19th and 20th century - culture has therefore been ignored, if not actively denigrated, by the Council.
Most recently, the furore over the alleged smuggling and sale of Naguib Mahfouz's archives has made more visible than ever the state's failure to safeguard its "modern" heritage. Although Sotheby's would eventually call the auction off, the patriotic Egyptian public was infuriated. It provoked the country's preeminent newspapers to ask how the manuscripts of Egypt's Nobel Laureate could be sold in the chambers of a foreign auction house, and why the state had not intervened to protect them. And yet, the Mahfouz sale further prompts the more important question: where and with whom should the private papers of public personalities be deposited?
For example, at his death earlier this month, Egypt's celebrated novelist Ibrahim Aslan left behind a number of unpublished manuscripts. How could his heirs, should they so wish, make this material accessible to an interested public?
In theory, the answer is easy - either the National Archives of Egypt or the adjacent "Dar al-Kutub". But in practice, the logic by which both institutions operate makes this issue a lot more complicated than it first appears to be.
Essentially, the current National Archive is descended from a series of disparate document repositories cobbled together in the 1920s. This new centralised archive was designed to provide the infrastructure behind professional history writing, which aimed to forge a monolithic national (and more importantly monarchical) identity for the country. During this state-building period, documents that did not promote a certain view of Egyptian history, and the reigning monarchy of the time, were either discarded or destroyed.
True to its etymological origins, the National Archive of Egypt continues to be held within the state's coercive grip. State security plays arbiter. Despite the efforts of Egypt's preeminent historian, Khaled Fahmy, it continues to viciously restrict access to the documents to all but a privileged few: These tend to be professional historians whose research is perceived as non-subversive to the state and its narratives, which are overwhelmingly nationalist.
Excerpt:
Appealing to the tastes of package tourists and neglecting the interest of ordinary Egyptians, the Antiquities Council has long scorned what cannot be displayed in expensive vitrines and hastily photographed. Egypt's post-"Islamic" - and particularly its 19th and 20th century - culture has therefore been ignored, if not actively denigrated, by the Council.
Most recently, the furore over the alleged smuggling and sale of Naguib Mahfouz's archives has made more visible than ever the state's failure to safeguard its "modern" heritage. Although Sotheby's would eventually call the auction off, the patriotic Egyptian public was infuriated. It provoked the country's preeminent newspapers to ask how the manuscripts of Egypt's Nobel Laureate could be sold in the chambers of a foreign auction house, and why the state had not intervened to protect them. And yet, the Mahfouz sale further prompts the more important question: where and with whom should the private papers of public personalities be deposited?
For example, at his death earlier this month, Egypt's celebrated novelist Ibrahim Aslan left behind a number of unpublished manuscripts. How could his heirs, should they so wish, make this material accessible to an interested public?
In theory, the answer is easy - either the National Archives of Egypt or the adjacent "Dar al-Kutub". But in practice, the logic by which both institutions operate makes this issue a lot more complicated than it first appears to be.
Essentially, the current National Archive is descended from a series of disparate document repositories cobbled together in the 1920s. This new centralised archive was designed to provide the infrastructure behind professional history writing, which aimed to forge a monolithic national (and more importantly monarchical) identity for the country. During this state-building period, documents that did not promote a certain view of Egyptian history, and the reigning monarchy of the time, were either discarded or destroyed.
True to its etymological origins, the National Archive of Egypt continues to be held within the state's coercive grip. State security plays arbiter. Despite the efforts of Egypt's preeminent historian, Khaled Fahmy, it continues to viciously restrict access to the documents to all but a privileged few: These tend to be professional historians whose research is perceived as non-subversive to the state and its narratives, which are overwhelmingly nationalist.
KlausGraf - am Donnerstag, 26. Januar 2012, 13:03 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Lokale und regionale Geschichte hautnah erlebten jetzt Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Geschichte des Gymnasiums Arnoldinum Steinfurt mit ihrem Lehrer Ulrich Schmid.
Im Kreisarchiv Steinfurt sahen sie zum Beispiel Fotos von Baracken in Lotte aus dem Jahr 1946, in denen Flüchtlinge und Vertriebene untergebracht waren und schauten im Adressbuch für den Kreis Steinfurt von 1938, ob ihre Groß- und Urgroßeltern mit Beruf und Straßenbezeichnung dort aufgeführt sind.
Ute Langkamp, Leiterin des Kreisarchivs, berichtete unter anderem über ihren Berufsalltag: "Der Archivar trifft letztlich die Entscheidung, welche Akten dauernd aufzubewahren sind und welche in den Reißwolf kommen - eine der schwierigsten Aufgaben." Die Schüler konnten konkret erfahren, wie sie Archive nutzen können und welche Informationen sie dort erhalten, welche Archive die richtigen für ihre Forschungsthemen sind und wie Archive sie bei ihren Facharbeiten unterstützen. So plant eine Schülerin beispielsweise eine Facharbeit zum Thema "Flüchtlinge und Vertriebene" und erfuhr, welche Quellen, Bücher und Forschungsarbeiten dazu im Kreisarchiv zu finden sind.
Ein Blick ins Magazin, das Drehen an den Kurbeln der Rollregalanlage, um Tonnen von Papier zu bewegen - Schwellenangst Archiv gibt es für die Schüler nach ihrem Besuch im Kreisarchiv nicht mehr, ist Ute Langkamp überzeugt. Damit die Schüler direkt mit ihr Kontakt aufnehmen können, gab sie ihre Email-Adresse gerne weiter: ute.langkamp@kreis-steinfurt.de."
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Im Kreisarchiv Steinfurt sahen sie zum Beispiel Fotos von Baracken in Lotte aus dem Jahr 1946, in denen Flüchtlinge und Vertriebene untergebracht waren und schauten im Adressbuch für den Kreis Steinfurt von 1938, ob ihre Groß- und Urgroßeltern mit Beruf und Straßenbezeichnung dort aufgeführt sind.
Ute Langkamp, Leiterin des Kreisarchivs, berichtete unter anderem über ihren Berufsalltag: "Der Archivar trifft letztlich die Entscheidung, welche Akten dauernd aufzubewahren sind und welche in den Reißwolf kommen - eine der schwierigsten Aufgaben." Die Schüler konnten konkret erfahren, wie sie Archive nutzen können und welche Informationen sie dort erhalten, welche Archive die richtigen für ihre Forschungsthemen sind und wie Archive sie bei ihren Facharbeiten unterstützen. So plant eine Schülerin beispielsweise eine Facharbeit zum Thema "Flüchtlinge und Vertriebene" und erfuhr, welche Quellen, Bücher und Forschungsarbeiten dazu im Kreisarchiv zu finden sind.
Ein Blick ins Magazin, das Drehen an den Kurbeln der Rollregalanlage, um Tonnen von Papier zu bewegen - Schwellenangst Archiv gibt es für die Schüler nach ihrem Besuch im Kreisarchiv nicht mehr, ist Ute Langkamp überzeugt. Damit die Schüler direkt mit ihr Kontakt aufnehmen können, gab sie ihre Email-Adresse gerne weiter: ute.langkamp@kreis-steinfurt.de."
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Wolf Thomas - am Donnerstag, 26. Januar 2012, 12:04 - Rubrik: Archivpaedagogik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Notfallverbund von Archiven und Bibliotheken in Münster übergibt am 1. Februar 2012 um 15 Uhr in der Speicherstadt in Münster-Coerde neu angeschaffte Notfallcontainer an die städtische Feuerwehr.
Die Notfallcontainer beinhalten Gerät und Material, das nach Katastrophenfällen für die Bergung und Sicherung von Kulturgut benötigt wird. Dazu zählen ein Notstromaggregat, Nasssauger, eine Vielzahl von Transportbehältern, Schutzbekleidung, geeignete Arbeitstische und Werkzeuge. Diese Hilfsmittel können nicht bei jeder der am Notfallverbund beteiligten Einrichtungen selbst vorgehalten werden. Daher entstand die Idee, gemeinsam Notfallcontainer zu bestücken und diese bei der Feuerwehr der Stadt Münster als zuständiger Katastrophenschutzbehörde zu lagern. Durch die Kooperationsbereitschaft der Feuerwehr ist gewährleistet, dass das für den Aufbau der Bergung und Erstversorgung des Kulturguts erforderliche Material und Gerät im Ernstfall kurzfristig zur Verfügung steht.
Die Beschaffung und Bestückung der Notfallcontainer wurde als Modellprojekt von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturerbes mit Mitteln des Kulturstaatsministers Bernd Neumann und der Kulturstiftung der Länder in Höhe von 20.000 € gefördert. Hinzu kommt ein Eigenanteil der am Notfallverbund Münster beteiligten Einrichtungen in Höhe von rund 8.000 €.
Am Notfallverbund der Archive und Bibliotheken in der Stadt Münster beteiligen sich der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, die Stadt und das Bistum Münster, die Westfälische Wilhelms-Universität, die Fachhochschule Münster sowie das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen. Der Notfallverbund verfolgt das Ziel, bei einer akuten, umfangreichen Gefährdung etwa durch Brand, Wasser, Unwetter, technische Defekte oder andere unvorsehbare Ereignisse die personellen und sachlichen Ressourcen der teilnehmenden Einrichtungen zur gegenseitigen Hilfestellung bei der Sicherung des Kulturguts zu bündeln. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am 23. September 2010 unterzeichnet.
Zur Vorstellung und Übergabe der Notfallcontainer sind Vertreter der Medien herzlich eingeladen. Es besteht die Möglichkeit, vor Ort mit Fachleuten über Fragen des Katastrophenschutzes und der Notfallvorsorge in Archiven und Bibliotheken zu sprechen.
Der Notfallverbund Münster präsentiert sich darüber hinaus anlässlich des Tags der Archive am Sonntag, 4. März 2012, 12-14 Uhr, mit einer Notfallübung auf dem Gelände der Speicherstadt. Interessierte haben dann die Möglichkeit, selbst Erfahrung im Umgang mit der Bergung und Sicherung von brand- und wassergeschädigten Unterlagen zu gewinnen.
Ansprechpartner (als Vorsitzender der Notfallverbunds Münster):
Dr. Johannes Kistenich, Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
Fachbereich Grundsätze – Grundsätze der Bestandserhaltung / Technisches Zentrum
An den Speichern 11, 48157 Münster
Tel.: 0251 / 620 650 65 – E-Mail: johannes.kistenich@lav.nrw.de
Die Notfallcontainer beinhalten Gerät und Material, das nach Katastrophenfällen für die Bergung und Sicherung von Kulturgut benötigt wird. Dazu zählen ein Notstromaggregat, Nasssauger, eine Vielzahl von Transportbehältern, Schutzbekleidung, geeignete Arbeitstische und Werkzeuge. Diese Hilfsmittel können nicht bei jeder der am Notfallverbund beteiligten Einrichtungen selbst vorgehalten werden. Daher entstand die Idee, gemeinsam Notfallcontainer zu bestücken und diese bei der Feuerwehr der Stadt Münster als zuständiger Katastrophenschutzbehörde zu lagern. Durch die Kooperationsbereitschaft der Feuerwehr ist gewährleistet, dass das für den Aufbau der Bergung und Erstversorgung des Kulturguts erforderliche Material und Gerät im Ernstfall kurzfristig zur Verfügung steht.
Die Beschaffung und Bestückung der Notfallcontainer wurde als Modellprojekt von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturerbes mit Mitteln des Kulturstaatsministers Bernd Neumann und der Kulturstiftung der Länder in Höhe von 20.000 € gefördert. Hinzu kommt ein Eigenanteil der am Notfallverbund Münster beteiligten Einrichtungen in Höhe von rund 8.000 €.
Am Notfallverbund der Archive und Bibliotheken in der Stadt Münster beteiligen sich der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, die Stadt und das Bistum Münster, die Westfälische Wilhelms-Universität, die Fachhochschule Münster sowie das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen. Der Notfallverbund verfolgt das Ziel, bei einer akuten, umfangreichen Gefährdung etwa durch Brand, Wasser, Unwetter, technische Defekte oder andere unvorsehbare Ereignisse die personellen und sachlichen Ressourcen der teilnehmenden Einrichtungen zur gegenseitigen Hilfestellung bei der Sicherung des Kulturguts zu bündeln. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am 23. September 2010 unterzeichnet.
Zur Vorstellung und Übergabe der Notfallcontainer sind Vertreter der Medien herzlich eingeladen. Es besteht die Möglichkeit, vor Ort mit Fachleuten über Fragen des Katastrophenschutzes und der Notfallvorsorge in Archiven und Bibliotheken zu sprechen.
Der Notfallverbund Münster präsentiert sich darüber hinaus anlässlich des Tags der Archive am Sonntag, 4. März 2012, 12-14 Uhr, mit einer Notfallübung auf dem Gelände der Speicherstadt. Interessierte haben dann die Möglichkeit, selbst Erfahrung im Umgang mit der Bergung und Sicherung von brand- und wassergeschädigten Unterlagen zu gewinnen.
Ansprechpartner (als Vorsitzender der Notfallverbunds Münster):
Dr. Johannes Kistenich, Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
Fachbereich Grundsätze – Grundsätze der Bestandserhaltung / Technisches Zentrum
An den Speichern 11, 48157 Münster
Tel.: 0251 / 620 650 65 – E-Mail: johannes.kistenich@lav.nrw.de
Andreas Pilger - am Mittwoch, 25. Januar 2012, 14:56 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Bildarchiv des Landtags NRW umfasst einen Bestand von ca. 150.000 Bildern. Seit einigen Jahren wird eine Bilddatenbank aufgebaut, die aktuell rund 33.000 digitale bzw. digitalisierte und erschlossene Fotos beinhaltet. Eine Auswahl von rund 16.000 Fotos seit 1970 wird nun im Internet bereitgestellt. Im Internetangebot des Landtags NRW ( http://www.landtag.nrw.de ) kann das Bildarchiv im Menü „Aktuelles & Presse“ und unter „Dokumente & Recherche“ angesteuert werden.
Bildsammlungen vermitteln einen Eindruck über den Gesamtbestand, der Fotos von Abgeordneten und anderen Personen des politischen Lebens, Plenarsitzungen, Veranstaltungen und z.B. zum Gebäude bietet. Die Suchfunktionen ermöglichen das gezielte Auffinden von Fotos, die in verschiedenen Qualitäten im Rahmen der Nutzungsbedingungen kostenlos heruntergeladen werden können. Die Bildredaktion des Landtags NRW bereichert den Bestand kontinuierlich durch aktuelle Fotos. Parallel dazu werden die Altbestände digitalisiert und erschlossen, so dass die Bilddatenbank beständig anwächst.
Bei Rückfragen und für weitere Auskünfte steht Ihnen als Ansprechpartnerin Frau Konradt gerne zur Verfügung.
Kontakt: Bildarchiv@landtag.nrw.de; Tel.: 0211/884-2441
via Archivliste
Bildsammlungen vermitteln einen Eindruck über den Gesamtbestand, der Fotos von Abgeordneten und anderen Personen des politischen Lebens, Plenarsitzungen, Veranstaltungen und z.B. zum Gebäude bietet. Die Suchfunktionen ermöglichen das gezielte Auffinden von Fotos, die in verschiedenen Qualitäten im Rahmen der Nutzungsbedingungen kostenlos heruntergeladen werden können. Die Bildredaktion des Landtags NRW bereichert den Bestand kontinuierlich durch aktuelle Fotos. Parallel dazu werden die Altbestände digitalisiert und erschlossen, so dass die Bilddatenbank beständig anwächst.
Bei Rückfragen und für weitere Auskünfte steht Ihnen als Ansprechpartnerin Frau Konradt gerne zur Verfügung.
Kontakt: Bildarchiv@landtag.nrw.de; Tel.: 0211/884-2441
via Archivliste
Wolf Thomas - am Mittwoch, 25. Januar 2012, 14:07 - Rubrik: Parlamentsarchive

In der Nacht zum 17. Januar 1955 trat der Rhein nach starken Regenfällen mit Orkanwinden an vielen Stellen über die Ufer. Speyer war besonders betroffen, der Domgarten und die Bereiche um den Speyerbach, wie der Hasenpfuhl und der Fischmarkt, wurden überflutet... Neues Flickr-Album des Stadtarchivs Speyer: http://www.flickr.com/photos/stadtarchiv_speyer/sets/72157629011958977/
http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q="Der+Stand+einer+Sache+muss+jederzeit+aus+den+Akten"
Sollte man im Eingangsbereich der Ministerien in Erz graben. SPIEGEL 4/2012, S. 14: Eine Aufklärung des umstrittenen Aktiendeals um den Energieversorger EnBW wird schwierig, da ein Prüfbericht große Lücken in der Aktenführung dokumentiert.
Der wahre Schatz sind die Akten der niedersächsischen Staatskanzlei, als Christian Wulff dort noch regiert hat. Aber sein damaliger Sprecher Olaf Glaeseker hat, so sagt es sein Nachfolger, ein "aktenfreies Büro" übergeben, bevor er mit Wulff aufs Schloss Bellevue umzog.
http://www.stern.de/politik/deutschland/fragen-und-antworten-zur-wulff-affaere-die-grosse-lehr-stunde-1775935.html
http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=%22aktenfreies+b%C3%BCro%22&btnG=Google-Suche&meta=&aq=f&oq=
Quousque tandem?
Sollte man im Eingangsbereich der Ministerien in Erz graben. SPIEGEL 4/2012, S. 14: Eine Aufklärung des umstrittenen Aktiendeals um den Energieversorger EnBW wird schwierig, da ein Prüfbericht große Lücken in der Aktenführung dokumentiert.
Der wahre Schatz sind die Akten der niedersächsischen Staatskanzlei, als Christian Wulff dort noch regiert hat. Aber sein damaliger Sprecher Olaf Glaeseker hat, so sagt es sein Nachfolger, ein "aktenfreies Büro" übergeben, bevor er mit Wulff aufs Schloss Bellevue umzog.
http://www.stern.de/politik/deutschland/fragen-und-antworten-zur-wulff-affaere-die-grosse-lehr-stunde-1775935.html
http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=%22aktenfreies+b%C3%BCro%22&btnG=Google-Suche&meta=&aq=f&oq=
Quousque tandem?
http://www.augsburger-allgemeine.de/aichach/Neuer-Klang-fuer-die-Sebastiankapelle-id18426961.html
Seit 1320 wird der heilige Sebastian in der Stadt Aichach verehrt und als Stadtpatron angerufen. 1484 weihte Weihbischof Ulrich von Augsburg die Sebastiankapelle an der Stelle eines Vorgängerbaus an der Stadtmauer. Nach dem Schwedeneinfall 1634 wurde das kleine Kirchlein völlig zerstört. Pfarrer Mathias Müller (Molitor) ließ die Kapelle neu erbauen. Die bestehende Bruderschaft wurde durch Papst Alexander VII. neu bestätigt.
1656 brach in der Stadt die Pest aus. Im März starben 33 Menschen, im April waren es 51, im Mai 42 Todesfälle. Die Aichacher legten ein Gelübde ab: Falls ihre Stadt von der Seuche verschont bliebe, sollte alljährlich im Januar eine Prozession zur Sebastiankapelle stattfinden.
Eine umfassende Renovierung war dann 1937 nötig. Im Zweiten Weltkrieg musste die 68 Kilogramm schwere Glocke abgeliefert werden.
Kommerzienrat Robert Haselberger stiftete nach den schweren Kriegsjahren im Jahre 1947, neben anderen Aichacher Glocken, auch zwei Glocken für die Sebastiankapelle. 1974 renovierte die Stadt die Kapelle umfassend.
Auch die Schützen erkoren Sebastian zu ihrem Schutzheiligen. Schon seit Alters her gab es nahe der Aichacher Sebastiankapelle einen Schießstand, wie auf alten Stichen zu sehen ist. Die Aichacher Schützen und die Sebastianbruderschaft hatten ein besonderes Verhältnis. Bei der Hundert-Jahr-Feier bezüglich der Wiedererrichtung der Bruderschaft 1756 feierten die Aichacher Bürger ihre Sebastianbruderschaft und die Schützenkompanie hatte sich dabei besonders hervorgetan. Während der gesamten Veranstaltung wurde in Uniform paradiert und auf den Wällen der Befestigungsanlage Salut geschossen.
Die große Sebastianprozession, wie sie momentan von der Stadtpfarrei gepflegt wird, wurde 1985 bezüglich des 750-jährigen Stadtjubiläums der Stadt von Bürgermeister Alfred Riepl wiederbelebt.
Auch Stühlingen ehrte ihn
http://www.badische-zeitung.de/stuehlingen/zeichen-oekumenischer-verbundenheit--55037412.html
Und Eltville
http://www.wiesbadener-kurier.de/region/rheingau/eltville/11594940.htm
Landsberg
http://www.augsburger-allgemeine.de/landsberg/Zu-Ehren-des-Stadtpatrons-id18417546.html
Seit 1320 wird der heilige Sebastian in der Stadt Aichach verehrt und als Stadtpatron angerufen. 1484 weihte Weihbischof Ulrich von Augsburg die Sebastiankapelle an der Stelle eines Vorgängerbaus an der Stadtmauer. Nach dem Schwedeneinfall 1634 wurde das kleine Kirchlein völlig zerstört. Pfarrer Mathias Müller (Molitor) ließ die Kapelle neu erbauen. Die bestehende Bruderschaft wurde durch Papst Alexander VII. neu bestätigt.
1656 brach in der Stadt die Pest aus. Im März starben 33 Menschen, im April waren es 51, im Mai 42 Todesfälle. Die Aichacher legten ein Gelübde ab: Falls ihre Stadt von der Seuche verschont bliebe, sollte alljährlich im Januar eine Prozession zur Sebastiankapelle stattfinden.
Eine umfassende Renovierung war dann 1937 nötig. Im Zweiten Weltkrieg musste die 68 Kilogramm schwere Glocke abgeliefert werden.
Kommerzienrat Robert Haselberger stiftete nach den schweren Kriegsjahren im Jahre 1947, neben anderen Aichacher Glocken, auch zwei Glocken für die Sebastiankapelle. 1974 renovierte die Stadt die Kapelle umfassend.
Auch die Schützen erkoren Sebastian zu ihrem Schutzheiligen. Schon seit Alters her gab es nahe der Aichacher Sebastiankapelle einen Schießstand, wie auf alten Stichen zu sehen ist. Die Aichacher Schützen und die Sebastianbruderschaft hatten ein besonderes Verhältnis. Bei der Hundert-Jahr-Feier bezüglich der Wiedererrichtung der Bruderschaft 1756 feierten die Aichacher Bürger ihre Sebastianbruderschaft und die Schützenkompanie hatte sich dabei besonders hervorgetan. Während der gesamten Veranstaltung wurde in Uniform paradiert und auf den Wällen der Befestigungsanlage Salut geschossen.
Die große Sebastianprozession, wie sie momentan von der Stadtpfarrei gepflegt wird, wurde 1985 bezüglich des 750-jährigen Stadtjubiläums der Stadt von Bürgermeister Alfred Riepl wiederbelebt.
Auch Stühlingen ehrte ihn
http://www.badische-zeitung.de/stuehlingen/zeichen-oekumenischer-verbundenheit--55037412.html
Und Eltville
http://www.wiesbadener-kurier.de/region/rheingau/eltville/11594940.htm
Landsberg
http://www.augsburger-allgemeine.de/landsberg/Zu-Ehren-des-Stadtpatrons-id18417546.html
KlausGraf - am Dienstag, 24. Januar 2012, 11:38 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sehr geehrte Damen und Herren,
am kommenden Donnerstag schließt die Reihe „Institutsgespräche“ für dieses Semester mit einem Beitrag von Susanne Huber-Wintermantel M.A. (Hüfingen), ehemalige Vorsitzende des Vereins für Geschichte und Naturgeschichte der Baar e.V., ab:
„Die geretteten Bücher. Von der Fürstlich-fürstenbergischen Hofbibliothek zur Bibliothek des Vereins für Geschichte und Naturgeschichte der Baar e.V.“
S. Huber-Wintermantel berichtet über die Schätze, die sich in der Bibliothek des Baar-Vereins befinden, unter anderem aus der Laßberg-Bibliothek. Daneben sind dort rare Kostbarkeiten, die oft in Baden-Württemberg gar nicht, ja selbst in Deutschland nicht vorhanden sind.
Die Bibliothek war Bestandteil der ehemaligen Fürstlich-fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen, mit der die Vereinsbibliothek über knapp zwei Jahrhunderte symbiotisch verbunden war und die deshalb im Umfeld des Verkaufs im Jahr 1999 nur unter größten Schwierigkeiten aus dieser herausgelöst werden konnte.
Ort. Bibliothek des Alemannischen Instituts, Bertoldstr. 45, Rückgebäude
Zeit: Donnerstag, 26. Januar 2012, 18.15 h
Freundlicher Hinweis von Herrn Staatsarchivreferendar Clemens Joos.
http://archiv.twoday.net/search?q=hofbibliothek+donaueschingen
am kommenden Donnerstag schließt die Reihe „Institutsgespräche“ für dieses Semester mit einem Beitrag von Susanne Huber-Wintermantel M.A. (Hüfingen), ehemalige Vorsitzende des Vereins für Geschichte und Naturgeschichte der Baar e.V., ab:
„Die geretteten Bücher. Von der Fürstlich-fürstenbergischen Hofbibliothek zur Bibliothek des Vereins für Geschichte und Naturgeschichte der Baar e.V.“
S. Huber-Wintermantel berichtet über die Schätze, die sich in der Bibliothek des Baar-Vereins befinden, unter anderem aus der Laßberg-Bibliothek. Daneben sind dort rare Kostbarkeiten, die oft in Baden-Württemberg gar nicht, ja selbst in Deutschland nicht vorhanden sind.
Die Bibliothek war Bestandteil der ehemaligen Fürstlich-fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen, mit der die Vereinsbibliothek über knapp zwei Jahrhunderte symbiotisch verbunden war und die deshalb im Umfeld des Verkaufs im Jahr 1999 nur unter größten Schwierigkeiten aus dieser herausgelöst werden konnte.
Ort. Bibliothek des Alemannischen Instituts, Bertoldstr. 45, Rückgebäude
Zeit: Donnerstag, 26. Januar 2012, 18.15 h
Freundlicher Hinweis von Herrn Staatsarchivreferendar Clemens Joos.
http://archiv.twoday.net/search?q=hofbibliothek+donaueschingen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Werbefilm über einen Forscher, der über seiner traditionellen Quellensuche alt wird, dann aber doch noch einen effektiveren Weg entdeckt.
Das Internetportal "Adelskartei.de" ist eine Einrichtung des Kieler Instituts Deutsche Adelsforschung und hilft Forschern durch die Vermittlung von Quellennachweisen auf historische Akten- und Buchinhalte in Bibliotheken und Archiven. Spezialgebiete: Kriminelle und Deutscher Adel aus der Zeit 1200-1945
Wolf Thomas - am Montag, 23. Januar 2012, 20:52 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Um 1900 wurden psychisch kranke Menschen in Irrenanstalten eingesperrt. Heute können viele Patienten dank medikamentöser Behandlung die Klinik schon bald wieder verlassen und in ihrer vertrauten Umgebung ein ganz normales Leben führen. Diesen Wandel in der praktischen psychiatrischen Versorgung zeigen die mehr als 11 500 Patientenakten des Ameos-Klinikums Neustadt aus der Zeit von 1893 bis 1950, die in den vergangenen drei Jahren im Landesarchiv Schleswig-Holstein erfasst und dokumentiert wurden. Zum Abschluss des Projektes übergab der Leiter des Archivs, Rainer Hering, der Leitung des Klinikums am Montag vier sogenannte Findbücher, in denen die Akten mit ihren Archivnummern erfasst sind.
«Dadurch haben Wissenschaftler jetzt Zugang zu den Dokumenten, die sowohl die Geschichte des Krankenhauses als auch die Entwicklung der Psychiatrie in Schleswig-Holstein dokumentieren», sagte der Geschäftsführer des heute zur Schweizer Ameos-Gruppe gehörenden Klinikums, Michael Dieckmann. Das Krankenhaus hat sich mit 55 000 Euro an den Kosten der Erfassung beteiligt. «Wir wollten einfach nicht, dass die Akten verloren gehen oder vernichtet werden», sagte Diekmann. Eine wissenschaftliche Auswertung sei bislang nicht geplant, werde aber bestimmt nicht lange auf sich warten lassen.
Nach Ansicht des Direktors des Instituts für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung der Universität Lübeck, Cornelius Borck, sind die Akten eine Fundgrube für Mediziner und Historiker. Die Akten aus der Zeit vom Kaiserreich bis in die frühe Nachkriegszeit umfassten einen Zeitraum, in dem sich nicht nur politische Systeme, sondern auch medizinische Weltanschauungen verändert hätten, sagte er.
Die Klinik in Neustadt im Kreis Ostholstein wurde 1893 unter dem Namen Provinzial-Pflegeanstalt als Außenstelle der «Irrenanstalt zu Schleswig» gegründet. Zwischen 1939 und 1945 wurden die meisten Patienten von den Nationalsozialisten verschleppt und in Konzentrationslagern ermordet. Nach 1945 wurde die Klinik zu einem Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie, seit 1978 werden hier auch Suchtkranke behandelt. 2005 übernahm die Schweizer Ameos-Gruppe die Einrichtung."
Quelle: Welt, 23.1.2012
«Dadurch haben Wissenschaftler jetzt Zugang zu den Dokumenten, die sowohl die Geschichte des Krankenhauses als auch die Entwicklung der Psychiatrie in Schleswig-Holstein dokumentieren», sagte der Geschäftsführer des heute zur Schweizer Ameos-Gruppe gehörenden Klinikums, Michael Dieckmann. Das Krankenhaus hat sich mit 55 000 Euro an den Kosten der Erfassung beteiligt. «Wir wollten einfach nicht, dass die Akten verloren gehen oder vernichtet werden», sagte Diekmann. Eine wissenschaftliche Auswertung sei bislang nicht geplant, werde aber bestimmt nicht lange auf sich warten lassen.
Nach Ansicht des Direktors des Instituts für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung der Universität Lübeck, Cornelius Borck, sind die Akten eine Fundgrube für Mediziner und Historiker. Die Akten aus der Zeit vom Kaiserreich bis in die frühe Nachkriegszeit umfassten einen Zeitraum, in dem sich nicht nur politische Systeme, sondern auch medizinische Weltanschauungen verändert hätten, sagte er.
Die Klinik in Neustadt im Kreis Ostholstein wurde 1893 unter dem Namen Provinzial-Pflegeanstalt als Außenstelle der «Irrenanstalt zu Schleswig» gegründet. Zwischen 1939 und 1945 wurden die meisten Patienten von den Nationalsozialisten verschleppt und in Konzentrationslagern ermordet. Nach 1945 wurde die Klinik zu einem Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie, seit 1978 werden hier auch Suchtkranke behandelt. 2005 übernahm die Schweizer Ameos-Gruppe die Einrichtung."
Quelle: Welt, 23.1.2012
Wolf Thomas - am Montag, 23. Januar 2012, 20:26 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In Cottas vielgelesenem "Morgenblatt" veröffentlichte Gustav Schwab (1792-1850) am 14. April 1815 zwei Sagenballaden "Die Achalm" und "Die Tübinger Schloß-Linde":
http://books.google.de/books?id=6mpEAAAAcAAJ&hl=de&pg=PA353
Zum 17. April ist das Digitalisat unbrauchbar. Ist natürlich aus München. Und da ist es wie immer ebenso mies:
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10531671_00381.html
Gefunden dank
http://de.wikisource.org/wiki/Morgenblatt_(Cotta) = http://goo.gl/rd21S
Zur Sache
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3459/pdf/Graf_schwabensagen.pdf S. 14
http://books.google.de/books?id=6mpEAAAAcAAJ&hl=de&pg=PA353
Zum 17. April ist das Digitalisat unbrauchbar. Ist natürlich aus München. Und da ist es wie immer ebenso mies:
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10531671_00381.html
Gefunden dank
http://de.wikisource.org/wiki/Morgenblatt_(Cotta) = http://goo.gl/rd21S
Zur Sache
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3459/pdf/Graf_schwabensagen.pdf S. 14
KlausGraf - am Montag, 23. Januar 2012, 18:49 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Auch wenn es der Titel auf den ersten Blick nicht vermuten läßt: eigentlich eine gute Gelegenheit, sich einen archivischen Twitter-Account zuzulegen...
Hashtag: #loveheritage
http://askarchivists.wordpress.com/2012/01/21/valentines-day-2012-in-archives/
Hashtag: #loveheritage
http://askarchivists.wordpress.com/2012/01/21/valentines-day-2012-in-archives/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Gesucht werden die Lebensdaten des württembergischen Juristen Gustav Hohbach, der z.B. eine Geiselstein-Ballade schrieb:
http://books.google.de/books?id=VwpHAQAAIAAJ&pg=PA267
Tipp: Adventskalender!
 Geiselstein
Geiselstein
http://books.google.de/books?id=VwpHAQAAIAAJ&pg=PA267
Tipp: Adventskalender!
 Geiselstein
GeiselsteinKlausGraf - am Montag, 23. Januar 2012, 15:10 - Rubrik: Unterhaltung
Der Beweis: Tonaufnahme "Auf der schwäbschen Eisenbahne... ", gesungen 1954 in Damme, Kreis Vechta (!!).
http://www.lwl.org/VokoArchivTon/ShowDetailAction.do?id=167748
http://www.lwl.org/VokoArchivTon/ShowDetailAction.do?id=167748
KlausGraf - am Montag, 23. Januar 2012, 11:43 - Rubrik: Unterhaltung
http://paper.lib.uiowa.edu/index.php
Das Forschungsprojekt untersuchte Papiere des 14.-19. Jahrhunderts, ohne sie zu beschädigen.
In the fall of 2010, we completed a new analysis of 1,578 papers using only nondestructive techniques. Book, manuscript, and printmaking papers made between the fourteenth and the nineteenth centuries were tested using XRF (X-ray fluorescence) and UV-Vis-NIR (ultraviolet-visible-near-infrared) spectrometers. For each specimen, we gathered data on gelatin and alum concentration; calcium (Ca) and iron (Fe) concentration (in whatever form they appeared, such as oxides, salts, or metal fragments); color; sheet dimensions and thickness; paper strength; publication (date, title, author, country, etc.); and quality of materials and workmanship.
Auf http://paper.lib.uiowa.edu/testing.php gibt es jeweils eine Abbildung aus den untersuchten Handschriften und Drucken.
Das Forschungsprojekt untersuchte Papiere des 14.-19. Jahrhunderts, ohne sie zu beschädigen.
In the fall of 2010, we completed a new analysis of 1,578 papers using only nondestructive techniques. Book, manuscript, and printmaking papers made between the fourteenth and the nineteenth centuries were tested using XRF (X-ray fluorescence) and UV-Vis-NIR (ultraviolet-visible-near-infrared) spectrometers. For each specimen, we gathered data on gelatin and alum concentration; calcium (Ca) and iron (Fe) concentration (in whatever form they appeared, such as oxides, salts, or metal fragments); color; sheet dimensions and thickness; paper strength; publication (date, title, author, country, etc.); and quality of materials and workmanship.
Auf http://paper.lib.uiowa.edu/testing.php gibt es jeweils eine Abbildung aus den untersuchten Handschriften und Drucken.
KlausGraf - am Montag, 23. Januar 2012, 11:06 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.derwesten.de/staedte/plettenberg/grabsteinfotos-stehen-im-internet-id6265416.html
Hätten Sie gedacht, dass im Internet Hunderte von Grabstein-Fotos der heimischen Friedhöfe am Hirtenböhl und in Holthausen zu finden sind? Interesse an den Grabsteininschriften haben Ahnenforscher, die an aktuelle Geburts- und Sterbedaten anders nicht herankommen.
Reichlich erstaunt zeigt sich Pfarrer Dietmar Auner von der Evangelischen Kirchengemeinde Plettenberg über dieses Internet-Angebot. „Hier nimmt man keine Rücksicht auf die Trauer der Menschen“, erachtet er die gesetzlichen Zeiten für den Datenschutz (30 Jahre nach dem Sterbetag) als richtig und sinnvoll. „Ich verstehe zwar das Interesse von Familienforschern an Familien-Daten, schließlich sind sie das Gedächtnis des Volkes, aber an die Gefühle der Hinterbliebenen denkt man wohl nicht.“
Auner will sich mit dem Landeskirchenamt in Verbindung setzen und nachfragen, wie die Meinung der Kirche zu den Grabstein-Fotos ist. Schließlich handelt es sich um Kirchengelände. Für solche Fotoserien müsste man seiner Auffassung nach eine Genehmigung einholen.
Kirchengesetze sind aus meiner Sicht keine richtigen Gesetze, und nach den richtigen Gesetzes dieses Landes endet der Datenschutz mit dem Tod des Betroffenen, die kommerzielle Komponente des postmortalen Persönlichkeitsrechts 10 Jahre nach dem Tod, desgleichen das Recht am eigenen Bild. Archivrechtliche Schutzfristen variieren: 10-30 Jahre nach dem Tod.
Ich kann auch nicht im mindesten erkennen, wieso das Gefühl der Hinterbliebenen verletzt wird, wenn man öffentlich zugängliche Daten auf öffentlich zugänglichen Friedhöfen fotografiert und im Internet zugänglich macht. Hauptsache verbieten, Bedenkentragen ...
Update: Damit das Prinzip der Alitteration auch denjenigen klar wird, die hier herummobben statt sich ein eigenes Forum zu suchen, habe ich die Überschrift durch einen Buchstaben ergänzt. Wer mit so ungeheurem moralischem Anspruch wie die Kirchen auftritt, muss damit leben, dass Spuren von Herabwürdigung im Meinungskampf nicht ganz vermieden werden können, wenn Kirchenvertreter offensichtlich Inkompetentes und Datenschutz-Hysterisches äußern, was ich mit dem von mir erfundenen Wort pfaseln zum Ausdruck bringen möchte.
Update:
http://klawtext.blogspot.com/2012/03/personlichkeitsrechte-auf-dem-friedhof.html
Hätten Sie gedacht, dass im Internet Hunderte von Grabstein-Fotos der heimischen Friedhöfe am Hirtenböhl und in Holthausen zu finden sind? Interesse an den Grabsteininschriften haben Ahnenforscher, die an aktuelle Geburts- und Sterbedaten anders nicht herankommen.
Reichlich erstaunt zeigt sich Pfarrer Dietmar Auner von der Evangelischen Kirchengemeinde Plettenberg über dieses Internet-Angebot. „Hier nimmt man keine Rücksicht auf die Trauer der Menschen“, erachtet er die gesetzlichen Zeiten für den Datenschutz (30 Jahre nach dem Sterbetag) als richtig und sinnvoll. „Ich verstehe zwar das Interesse von Familienforschern an Familien-Daten, schließlich sind sie das Gedächtnis des Volkes, aber an die Gefühle der Hinterbliebenen denkt man wohl nicht.“
Auner will sich mit dem Landeskirchenamt in Verbindung setzen und nachfragen, wie die Meinung der Kirche zu den Grabstein-Fotos ist. Schließlich handelt es sich um Kirchengelände. Für solche Fotoserien müsste man seiner Auffassung nach eine Genehmigung einholen.
Kirchengesetze sind aus meiner Sicht keine richtigen Gesetze, und nach den richtigen Gesetzes dieses Landes endet der Datenschutz mit dem Tod des Betroffenen, die kommerzielle Komponente des postmortalen Persönlichkeitsrechts 10 Jahre nach dem Tod, desgleichen das Recht am eigenen Bild. Archivrechtliche Schutzfristen variieren: 10-30 Jahre nach dem Tod.
Ich kann auch nicht im mindesten erkennen, wieso das Gefühl der Hinterbliebenen verletzt wird, wenn man öffentlich zugängliche Daten auf öffentlich zugänglichen Friedhöfen fotografiert und im Internet zugänglich macht. Hauptsache verbieten, Bedenkentragen ...
Update: Damit das Prinzip der Alitteration auch denjenigen klar wird, die hier herummobben statt sich ein eigenes Forum zu suchen, habe ich die Überschrift durch einen Buchstaben ergänzt. Wer mit so ungeheurem moralischem Anspruch wie die Kirchen auftritt, muss damit leben, dass Spuren von Herabwürdigung im Meinungskampf nicht ganz vermieden werden können, wenn Kirchenvertreter offensichtlich Inkompetentes und Datenschutz-Hysterisches äußern, was ich mit dem von mir erfundenen Wort pfaseln zum Ausdruck bringen möchte.
Update:
http://klawtext.blogspot.com/2012/03/personlichkeitsrechte-auf-dem-friedhof.html
KlausGraf - am Montag, 23. Januar 2012, 10:55 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Eine für 200 Jahre verschollene Handschrift des romantischen Dichters Novalis hat der Träger des Frankfurter Goethe-Hauses erworben.
Handschriften zu zentralen Werken der Weltliteratur tauchten nur äußerst selten auf dem Markt auf, teilte das Museum am Sonntag mit. Bei dem Fund handelt es sich um ein beidseitig beschriebenes Blatt aus einem Entwurf zum berühmten Romanfragment "Heinrich von Ofterdingen".
Zusätzlich konnte sich das Goethe-Haus rund 870 Handschriften aus dem Umkreis der deutschen Romantik sichern."
Quelle: hr-Videotext, S. 152, 22.1.2012
Wikipedia-Artikel Novalis
Wolf Thomas - am Sonntag, 22. Januar 2012, 21:22 - Rubrik: Literaturarchive
Ich hatte bereits über diese Tagung berichtet: hier und hier. Nun liegt die online-Tagungsdokumentation vor: http://www.lwl.org/LWL/Kultur/LWL-LMZ/Bild_Film_Tonarchiv/Tagung_Filmarchiv/ .
Ich empfehle folgende Vorträge:
1) Drs. Harry Romijn (Stellv. Direktor des RHC Groningen Archiven, Abt.-Leiter Neue Medien, Bild und Ton, Niederlande):
Das Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven und seine audiovisuellen Bestände
Hoffentlich ist dieses Plädoyer für die Video-Überlieferung der 70er und 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts bald online!
2) Viviane Thill (Stellv. Direktorin des Centre national de l'audiovisuel (CNA), Luxembourg): Das Centre national de l'audiovisuel (CNA), Luxemburg (PDF)
Auf S. 19 ihrer PDF verweist Till auf den therapeutischen Nutzen historischer Filme (und auch Bilder) bei der Behandlung von Alzheimer- und Demenz-Patienten hin. Ein Aspket, der in Deutschland . W. noch nicht diskutiert wurde.
3) Dr. Jens Murken (Leiter des Landeskirchlichen Archivs der Evangelischen Kirche von Westfalen): Amtlich und ehrenamtlich. Filmarchivierung für die Landeskirche (PDF).
Selbstkritik par excellence!
Ich empfehle folgende Vorträge:
1) Drs. Harry Romijn (Stellv. Direktor des RHC Groningen Archiven, Abt.-Leiter Neue Medien, Bild und Ton, Niederlande):
Das Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven und seine audiovisuellen Bestände
Hoffentlich ist dieses Plädoyer für die Video-Überlieferung der 70er und 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts bald online!
2) Viviane Thill (Stellv. Direktorin des Centre national de l'audiovisuel (CNA), Luxembourg): Das Centre national de l'audiovisuel (CNA), Luxemburg (PDF)
Auf S. 19 ihrer PDF verweist Till auf den therapeutischen Nutzen historischer Filme (und auch Bilder) bei der Behandlung von Alzheimer- und Demenz-Patienten hin. Ein Aspket, der in Deutschland . W. noch nicht diskutiert wurde.
3) Dr. Jens Murken (Leiter des Landeskirchlichen Archivs der Evangelischen Kirche von Westfalen): Amtlich und ehrenamtlich. Filmarchivierung für die Landeskirche (PDF).
Selbstkritik par excellence!
Wolf Thomas - am Sonntag, 22. Januar 2012, 20:59 - Rubrik: Filmarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://openstreetmap.de/lizenzaenderung.html
Dass eine PD-Lizenz, die für Daten einzig sinnvoll ist, nicht auf Akzeptanz stoßen würde, zeigt, dass ein solches freies Projekt an die abstrusen Vorstellungen der Community gebunden ist.
Siehe auch
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Open_Database_License
Dass eine PD-Lizenz, die für Daten einzig sinnvoll ist, nicht auf Akzeptanz stoßen würde, zeigt, dass ein solches freies Projekt an die abstrusen Vorstellungen der Community gebunden ist.
Siehe auch
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Open_Database_License
KlausGraf - am Sonntag, 22. Januar 2012, 12:48 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Thomas Flottenamt Just macht in der geschlossenen Facebook-Gruppe Archivfragen auf einen FAZ-Artikel aufmerksam:
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/blb-skandal-raetselhafte-immo-raserei-in-ruhrtopia-11616716.html
Siehe hier
http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/blb-skandal-raetselhafte-immo-raserei-in-ruhrtopia-11616716.html
Siehe hier
http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg
KlausGraf - am Sonntag, 22. Januar 2012, 12:41 - Rubrik: Staatsarchive
Seit 10 Jahren wird der Festtag des Heiligen Sebastian in Herzogenaurach wieder mit einer Prozession feierlich begangen. In diesem Jahr feiert die Stadtpfarrei am Sonntag, 22. Januar, mit den Herzogenaurachern das Fest mit einer Prozession. Aber auch schon früher gedachten die Herzogenauracher ihres Stadtpatrons.
Früher war der 20. Januar, der Tag des Heiligen Sebastian, in Herzogenaurach sogar ein lokaler Feiertag. Gottesdienste mit auswärtigen Predigern und Beichtgelegenheiten prägten diesen Festtag des Herzogenauracher Stadtpatrons.
Bis zu den Umbrüchen in der Napoleonischen Zeit gab es in Herzogenaurach eine eigene Sebastiani-Bruderschaft. Über die Entstehung dieser Bruderschaft konnte der Herzogenauracher Forscher Luitpold Maier einiges in Erfahrung bringen. Im Jahr 2006 hat außerdem die Herzogenauracherin Julia Bucher ihre Zulassungsarbeit zu diesem Thema verfasst. Es war im Jahre 1496, als unsere ganze Pfarrei von einer fürchterlichen Pest heimgesucht wurde. Täglich wurden mehrere Leichen zu Grabe getragen und der Tod droht die Pfarrei völlig zu entvölkern. Da nahm die hiesige Bürgerschaft ihre Zuflucht zum heiligen Sebastian, errichtete zu seiner Ehre einen Altar in der Kirche, und trat in ein Heiliges Bündnis zusammen.
Im Jahr 1670, unter Pfarrer Johann Georg Ruppert, erhielt diese fromme Anstalt die bischöfliche Bestätigung. Seit diesem Jahre wurde eine Totenmatrikel über die Angehörigen der Bruderschaft mit dem barocken Titel angelegt: „Sanct Sebastians Bruderschaft Todtenbuch in welchem aller Abgestorbenen Brüder und Schwester Nahmen zu finden. Angefangen den 20. Monattag January A° 1671“. Im Jahre 1699 wurde begonnen, alljährlich gesonderte Rechnung hierüber zu führen. Es fielen aber auch Ausgaben für die Bruderschaft an. So mussten einige Tage vor den Festtagen um den 20. Januar Verkündigungszettel in die umliegenden Ortschaften, die nicht mehr zur Pfarrei zählten, getragen werden. Solche kamen sogar nach Höchstadt und Etzelskirchen. Auch die Geistlichen Herren von auswärts, die mit Beichthören und anderen kirchlichen Funktionen hier tätig waren, mussten für zwei Tage entschädigt werden. Den größten Teil davon trug jedoch die Kirchenverwaltung.
Einen ziemlichen Aufwand beanspruchte natürlich die öffentliche Prozession. Sowohl während des Gottesdienstes als auch der Prozession musizierten die Türmer von Höchstadt. Lediglich 1715 und 1718 werden auch die Türmer von Bruck als Musikanten erwähnt. Während des Hochamtes wurden an diesem Tage vor der Kirchentür drei Böllerschüsse abgegeben, und es paradierte eine Abteilung Bürgerwehr vor dem Altar.
1710 ließ Hans Steeger, der damals Bruderschaftspfleger war, die Bilder der Heiligen Maria Magdalena, Sebastian und Maria in Erlangen malen, die bei Leichenbegängnissen von Bruderschaftsmitgliedern an das Bahrtuch gehängt wurden. 1719 wurde das alte Altarbild an den Schuhmacher Hans Ziegler um 48 Kreuzer verkauft. Es wurde nun eine neue Statue angeschafft, die jetzige, deren Kosten 12 Gulden und 50 Kreuzer für den leider nicht genannten Maler und Bildhauer in Bamberg betrugen.
In den Wirren der Napoleonischen Zeit um 1800 gingen die finanzielle Ausstattung und die Kostbarkeiten der Bruderschaft verloren. Bedauerlicherweise wurde auch der Altar 1902 abgebrochen und mit unbekanntem Empfänger verkauft, sodass lediglich die Statue des Heiligen Sebastian aus dieser Zeit auf uns überkommen ist. 1935 wurde sie in den neugeschaffenen, jetzigen Altar eingefügt, der eine Kopie eines Altars aus Pettstadt ist.
http://www.nordbayern.de/region/hoechstadt/lichter-fur-den-stadtpatron-1.1799042 (Manfred Welker)
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=stadtpatron
Früher war der 20. Januar, der Tag des Heiligen Sebastian, in Herzogenaurach sogar ein lokaler Feiertag. Gottesdienste mit auswärtigen Predigern und Beichtgelegenheiten prägten diesen Festtag des Herzogenauracher Stadtpatrons.
Bis zu den Umbrüchen in der Napoleonischen Zeit gab es in Herzogenaurach eine eigene Sebastiani-Bruderschaft. Über die Entstehung dieser Bruderschaft konnte der Herzogenauracher Forscher Luitpold Maier einiges in Erfahrung bringen. Im Jahr 2006 hat außerdem die Herzogenauracherin Julia Bucher ihre Zulassungsarbeit zu diesem Thema verfasst. Es war im Jahre 1496, als unsere ganze Pfarrei von einer fürchterlichen Pest heimgesucht wurde. Täglich wurden mehrere Leichen zu Grabe getragen und der Tod droht die Pfarrei völlig zu entvölkern. Da nahm die hiesige Bürgerschaft ihre Zuflucht zum heiligen Sebastian, errichtete zu seiner Ehre einen Altar in der Kirche, und trat in ein Heiliges Bündnis zusammen.
Im Jahr 1670, unter Pfarrer Johann Georg Ruppert, erhielt diese fromme Anstalt die bischöfliche Bestätigung. Seit diesem Jahre wurde eine Totenmatrikel über die Angehörigen der Bruderschaft mit dem barocken Titel angelegt: „Sanct Sebastians Bruderschaft Todtenbuch in welchem aller Abgestorbenen Brüder und Schwester Nahmen zu finden. Angefangen den 20. Monattag January A° 1671“. Im Jahre 1699 wurde begonnen, alljährlich gesonderte Rechnung hierüber zu führen. Es fielen aber auch Ausgaben für die Bruderschaft an. So mussten einige Tage vor den Festtagen um den 20. Januar Verkündigungszettel in die umliegenden Ortschaften, die nicht mehr zur Pfarrei zählten, getragen werden. Solche kamen sogar nach Höchstadt und Etzelskirchen. Auch die Geistlichen Herren von auswärts, die mit Beichthören und anderen kirchlichen Funktionen hier tätig waren, mussten für zwei Tage entschädigt werden. Den größten Teil davon trug jedoch die Kirchenverwaltung.
Einen ziemlichen Aufwand beanspruchte natürlich die öffentliche Prozession. Sowohl während des Gottesdienstes als auch der Prozession musizierten die Türmer von Höchstadt. Lediglich 1715 und 1718 werden auch die Türmer von Bruck als Musikanten erwähnt. Während des Hochamtes wurden an diesem Tage vor der Kirchentür drei Böllerschüsse abgegeben, und es paradierte eine Abteilung Bürgerwehr vor dem Altar.
1710 ließ Hans Steeger, der damals Bruderschaftspfleger war, die Bilder der Heiligen Maria Magdalena, Sebastian und Maria in Erlangen malen, die bei Leichenbegängnissen von Bruderschaftsmitgliedern an das Bahrtuch gehängt wurden. 1719 wurde das alte Altarbild an den Schuhmacher Hans Ziegler um 48 Kreuzer verkauft. Es wurde nun eine neue Statue angeschafft, die jetzige, deren Kosten 12 Gulden und 50 Kreuzer für den leider nicht genannten Maler und Bildhauer in Bamberg betrugen.
In den Wirren der Napoleonischen Zeit um 1800 gingen die finanzielle Ausstattung und die Kostbarkeiten der Bruderschaft verloren. Bedauerlicherweise wurde auch der Altar 1902 abgebrochen und mit unbekanntem Empfänger verkauft, sodass lediglich die Statue des Heiligen Sebastian aus dieser Zeit auf uns überkommen ist. 1935 wurde sie in den neugeschaffenen, jetzigen Altar eingefügt, der eine Kopie eines Altars aus Pettstadt ist.
http://www.nordbayern.de/region/hoechstadt/lichter-fur-den-stadtpatron-1.1799042 (Manfred Welker)
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=stadtpatron
KlausGraf - am Samstag, 21. Januar 2012, 16:35 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Auswertung der Kurzumfrage
http://infobib.de/blog/2012/01/20/ergebnisse-wessen-inhalte-durfen-ins-institutional-repository/
Siehe
http://archiv.twoday.net/stories/64025890/
37 Antworten gabs (überwiegend UBs). 23 davon sind der Ansicht, dass das Werk von Wissenschaftlern in ihrem IR nicht zerrissen wird. Eine ziemlich unbelegte Meinungsäußerung, mit der man wenig anfängt.
10 IRs nehmen tatsächlich ungern Arbeiten vor dem Eintritt des Autors in die eigene Institution. Das ist ein höherer Anteil als ich dachte und natürlich aus Sicht von OA völlig unsinnig.
In 22 IRs muss sich der Wissenschaftler eine andere OA-Bleibe suchen.
Lesenswert auch die Kommentare. Insgesamt bestätigt mich die Auswertung in meiner IR-Skepsis.
http://infobib.de/blog/2012/01/20/ergebnisse-wessen-inhalte-durfen-ins-institutional-repository/
Siehe
http://archiv.twoday.net/stories/64025890/
37 Antworten gabs (überwiegend UBs). 23 davon sind der Ansicht, dass das Werk von Wissenschaftlern in ihrem IR nicht zerrissen wird. Eine ziemlich unbelegte Meinungsäußerung, mit der man wenig anfängt.
10 IRs nehmen tatsächlich ungern Arbeiten vor dem Eintritt des Autors in die eigene Institution. Das ist ein höherer Anteil als ich dachte und natürlich aus Sicht von OA völlig unsinnig.
In 22 IRs muss sich der Wissenschaftler eine andere OA-Bleibe suchen.
Lesenswert auch die Kommentare. Insgesamt bestätigt mich die Auswertung in meiner IR-Skepsis.
KlausGraf - am Samstag, 21. Januar 2012, 16:21 - Rubrik: Open Access
Wenn wir nicht in der Lage sind, Liebermanns Selbstbildnisse und Corinths Spätwerk in der deutschsprachigen WP zu zeigen, obwohl es vollkommen unzweifelhaft nach deutschem Recht legal und gemeinfrei ist, sollten wir das Thema "Förderung Freien Wissens" aus unserer Agenda streichen. (Achim Raschka)
http://lists.wikimedia.org/pipermail/vereinde-l/2012-January/005969.html
Via
http://www.finanzer.org/blog/2012/01/19/gedanken-zu-ingenieuren-und-freiem-wissen/
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/64038866/
http://lists.wikimedia.org/pipermail/vereinde-l/2012-January/005969.html
Via
http://www.finanzer.org/blog/2012/01/19/gedanken-zu-ingenieuren-und-freiem-wissen/
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/64038866/
KlausGraf - am Samstag, 21. Januar 2012, 16:04 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus Sagen der Schwäbischen Alb, hrsg. und kommentiert von Klaus Graf, Leinfelden-Echterdingen: DRW Verlag 2008 gebe ich im folgenden das Kapitel "Im Sagenreich der Pfullinger Urschel" (S. 115-146 mit Nachweisen S. 292f.) wieder.
Mehr zum Buch und weitere Auszüge:
http://archiv.twoday.net/stories/5401895/
Zu den Pfullinger Sagen ist künftig auch mein im Manuskript abgeschlossener Beitrag "Urschel, Nachtfräulein und andere Gespenster Überlieferungen und Sagen in Reutlingen und Pfullingen" (erscheint in: Reutlinger Geschichtsblätter) einschlägig.
Weitergeführt werden dort die Überlegungen in meinen "Schwabensagen" von 2007:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3459/
Zu den Texten siehe auch die Nachweise von Digitalisaten:
http://de.wikisource.org/wiki/Pfullingen
***
Pfullingen
Andres Mährchen
Wiederum erzählt die Sage, der Ursulenberg sey nur des Tages ein Berg, des Nachts aber eine Höhle, in der ein weiblicher Geist bei unendlichen Schätzen auf Erlösung harre. Einst habe ein Bürger von Pfullingen sich zu diesem Versuche entschlossen, und sey in der Nacht nach der Höhle gegangen. Dort erschien ihm der Geist in Gestalt einer Nonne, und lud ihn ein, mit ihm drei Nächte hintereinander zu speisen, ohne sich zu fürchten, und ohne einen Laut von sich zu geben. Dann werde der Geist erlöst seyn, der Mann aber den ungeheuren Schatz erheben. Die erste Nacht erschien der Geist in seiner gewöhnlichen Gestalt als Nonne; der Bürger schmauste ohne Furcht und Rede bei ihm. In der zweiten Nacht erschien aber statt der Nonne eine gräßliche Schlange vor dem wohlbesetzten Tisch, bäumte sich schwellend, und leckte zischend von dem Speisen. Der Mann überwand sein Grausen, und unterdrückte den Schrei des Entsetzens, der über seine Lippe wollte; des Morgens kehrte er zur Stadt und in sein Haus zurück. Als aber die dritte Nacht heran kam, die das Abentheuer enden sollte, da fand man ihn todt auf seinem Lager: der Schrecken der zweiten hatte ihn umgebracht. (85)
Niemand weiss, warum ausgerechnet Pfullingen, am Fuß der Alb gelegen, den reichsten Sagenbestand Schwabens aufweist. Am frühesten greifbar ist die Geschichte von der gescheiterten Erlösung der alten Urschel in diesem Text, der Gustav Schwabs Albführer 1823 entnommen ist. 1828 gab Pfarrer Friedrich Meyer Sagen in seiner handschriftlichen Pfarrbeschreibung wieder. Ernst Meier eröffnete mit 14 Pfullinger Sagen seine 1852 gedruckte Sammlung schwäbischer Sagen. Nicht weniger als zwölf Texte schrieben Schüler des Stuttgarter Gymnasiallehrers Albert Schott 1845/1847 auf. Einige sind hier erstmals ediert.
Der schwäbische Literat Hermann Kurz (1813-1873) arbeitete die Erlösungsgeschichte vom Urschelberg in seinen historischen Roman „Schiller's Heimatjahre“ (Stuttgart 1843) ein und hat dadurch wohl spätere Sagenversionen beeinflusst. Dank der gedruckten Fassungen kam es zu einem Austausch zwischen lebendiger mündlicher Überlieferung und schriftlicher Fixierung. Die Sagen kursierten in Pfullingen in unterschiedlichen Versionen. Der Heimatbuchautor Wilhelm Kinkelin beobachtete, dass „in bestimmten Familien die Sagen in einer bestimmten besonderen Weise erzählt werden. Mein Vater wußte alles so wie meine Mutter dem Inhalt nach genau, und doch immer wieder ein bißchen anders“.
Ernst Meier deutete die alte Urschel mythologisch, und über seine Sammlung ging sie in die internationale volkskundliche Literatur ein. In Pfullingen ist sie bis heute populär. Auf dem Pfullinger Marktbrunnen aus den 1950er Jahren ist sie mit anderen Sagengestalten dargestellt. 1999 gründete sich ein Narrenverein „Die Uschlaberghexa“.
Der Ursulaberg
In Pfullingen lebte vor vielen Jahren ein armer Taglöhner, der in der schweren Zeit außer Stand gesetzt war, sich, sein Weib und sein Kind zu ernähren, so daß sie oft bitteren Hunger leiden mußten. In einer Nacht, als seine Lieben schon lange neben ihm schliefen, wachte er noch kummervoll uund dachte daran, wie er sein trauriges Loos ändern könnte. Aber nirgend zeigte sich ihm ein Ausweg, und er war der Verzweiflung nahe. Von Sorgen erschöpft und halb betäubt, schlief er ein. Im Traume aber sah er den Ursulaberg vor sich, sah wie ein enger Spalt an demselben immer weiter wurde, und endlich als weites Gewölbe vor seinen Augen stand, die von dem angehäuften Golde und den Edelsteinen, von den reichen Schmucksachen, welche die Wände zierten, ganz geblendet waren. Unruhig erwachte er und theilte seinem Weibe den Vorsatz mit, in der nächsten Nacht den Berg zu besuchen, vielleicht, daß das Glück ihm mit einem Male günstig sei. Umsonst bat ihn sein Weib, das Vertrauen auf Gott nicht fahren zu lassen, wie dieser am besten wisse, was dem Menschen nütze.
In der kommenden Nacht ging der Arme hin, fand den Spalt, der sich auch öffnete, wie die nahe Thurmuhr anzeigte, daß es Mitternacht sei. Wie er es im Traume gesehen, so stand das Gewölbe vor seinen Blicken, nur daß sich in demselben noch eine Jungfrau von wunderbarer Schönheit befand, die ihn zu einer reichbesetzten Tafel führte, und ihn köstlich bewirthete. Als das Mahl geendet war, ergriff sie eine Laute und sang Lieder voller Liebesklage und Liebessehnsucht, ohne daß sie den Armen verführen wollte, der treu an seinem Weibe hing, und endlich die Jungfrau bat, daß sie ihm erlauben möge, etwas von den herrlichen Speisen nach Hause nehmen zu dürfen. Die Jungfrau aber füllte alle seine Taschen, so viel sie nur fassen konnten, mit Gold und Edelsteinen, worauf sie ihn an den Ausgang des Gewölbes führte. Die Morgensonne war eben im Aufgehen, und der Arme glaubte geträumt zu haben, als er umsah und keine Spur einer Oeffnung in dem Berge gewahr wurde. Aber die Schätze, welche ihn belasteten, überzeugten ihn von der Wirklichkeit des Erlebten. Voll Freude eilte er nach Hause, und sein Weib fiel auf die Kniee betend nieder, denn jetzt waren sie plötzlich reich geworden. Aber, wie leider der Besitz so häufig die Begierde nach Mehrbesitz erzeugt, und immer heftiger steigert, so geschah es auch hier. Der dem Hungertod so nah Gewesene konnte eines Reichthums nicht froh werden; beständig sah er die Schätze, welche in der Höhle zurückgeblieben, und dachte nur daran, sie auch zu erhalten und war entschlossen, sie mit Gewalt an sich zu reißen, wenn sie die Jungfrau nicht freiwillig hergeben würde.
Um diese zu zwingen, ging er mit einem Dolche bewaffnet in der kommenden Nacht zur Höhle, die er ganz so reich geschmückt fand, wie früher, nur daß an der Stelle der Schönen ein gräßlicher Drache lag, der ihn aus dem Gewölbe jagte und ihn den ganzen Berg hinab mit Gebrüll verfolgte.
Der Habgierige erreichte zwar unbeschädigt seine Wohnung, aber schon am nächsten Tage starb er an den Folgen des erlittenen Schreckens. (86)
Alexander Patuzzi bearbeitete in seiner Schwäbischen Sagen-Kronik (1844) offenkundig ein 1832 erschienenes sozialkritisches Gedicht des späteren Bauernkrieghistorikers Wilhelm Zimmermann (1807-1878): „Der Ursulenberg bei Pfullingen“. Patuzzi hat aber Zimmermanns Erlösungs-Motiv weggelassen: Im Gedicht erhält der Arme keine Schätze, er muss am nächsten Tag wiederkehren, um die Maid zu erlösen und lässt sich von dem Drachen verjagen.
Der Dreieichenweg auf dem Ursulaberg
Ein Bauer von Pfullingen, Namens Jakob Hättler, fuhr öfters mit einem Wagen in den Wald auf dem Ursulaberge, um dort Holz zu holen und durfte, während andere Bauern beim Herabfahren alle vier Räder an ihren Wagen sperren mußten, nie an seinen Wagen einen Radschu anlegen, weil ihm diß Geschäft jedesmal von einer Frau besorgt wurde. Eines Tags nun fuhr der Bauer, wie gewöhnlich, wieder in den Wald, verspätete sich aber, weil ihm ein böser Geist am Wagen etwas zerbrochen hatte, bis in die tiefe Nacht hinein, so daß er erst gegen 12 Uhr von demselben wieder abfahren konnte. Kaum hatte er einen kleinen Theil seines Wegs zurückgelegt, als es 12 schlug und plötzlich eine reichgekleidete Frau vor ihm stand, welche sich ihm als die Ursula, die in diesem Berge hause, zu erkennen gab und zu ihm sagte, daß nur er sie erlösen könnte. Nachdem sie ihn mit den zu der Erlösung nötigen Verhaltungsmaaßregeln näher bekannt gemacht hatte, zeigte sie ihm eine Öffnung, welche in den Berg hinein gieng, und gab ihm dann ein Schwert, ein Scepter und ein Kraut in die Hände. Hierauf stieg der Bauer in den Berg hinunter u. stieß dann bald auf eine Thüre, welche durch die Berührung mit seinem Kraute sogleich aufflog. Hier kam ein großer schwarzer Pudel mit feurigen Augen und mit einem langen Messer in der Pfote auf ihn zugesprungen, welcher sobald jener mit der Linken sein Scepter diesem entgegenhielt, ruhig stehen blieb, und sich durch des Bauern Schwert tödten ließ. Damit war es aber noch nicht genug, sondern er hatte noch zwei Ungeheuer, nemlich einen grimigen Löwen und eine furchtbar große Schlange umzubringen, was ihm zwar auch gelang, aber doch viel mehr Mühe kostete als die erste That. Sofort trat er noch durch eine zweite von ihm geöffnete Thüre, in einen äußerst prächtigen, mit Kostbarkeiten aller Art und einer Menge Goldes angefüllten Saal, wo er dann theils durch die glückliche Vollbringung freudetrunken, theils durch die Masse Kostbarkeiten geblendet, leider nicht mehr der Ursula gedachte, welche ihn vorher gewarnt hatte, nicht lange unter einer Thüre zu verweilen und nicht mehr von den Kostbarkeiten zu nehmen, als er zum Berge hinaustragen könne, sondern so viel mitnahm, daß er schon an der letzten Thüre Etwas von seinem Golde fallen ließ. Dadurch, daß er noch unter der Thüre stehen blieb und daß die Thüre plötzlich zuknarrte, hatte er das Unglück, um beide Fersen zu kommen. Auf der Oberfläche des Berges angekommen, erschien ihm wieder mit bleichem und von Jammer verzerrtem Aussehen die Ursula mit 3 Eicheln, u. sagte ihm, indem sie diese fallen ließ, sie müße von jetzt an so lange in dem Berge herumschweben, bis diese 3 Eicheln zu 3 vollständigen Eichen emporgewachsen und dann wieder abgestorben seien. Nach diesen Worten verschwand sie wieder und der Bauer fuhr vollends mit seinem Wagen, den er noch angetroffen hatte, nach Hause, starb aber bald darauf. Es stehen nun wirklich 3 Eichen auf dem Ursulaberge, von welchen die Sage geht, daß sie in Folge von der Nichterlösung der Ursula entstanden seien. (87)
In der Fassung der Erlösungs-Geschichte des Stuttgarter Gymnasiasten Schmückle (1847) sind die magischen Hilfsmittel des Bauern vermutlich dem Motivbestand der Märchen entnommen.
Die Feien des Ursulenberges
Wenn die Nebel Schleier weben.
Um Gebirg und Flur,
Regt in der Natur
Sich ein anderes Leben.
Aus den Blumen, die sich neigen
In der Erde Kluft
Vor des Winters Luft,
Ihre Seelen steigen.
Anzuschaun wie zarte Weiber
Schweben sie heraus
Aus des Berges Haus,
Jungfräuliche Leiber.
Mit dem Blau der Genziane,
Mit der Lilie Glanz,
Mit des Rosenbrands
Gluthen angethane.
Flattern, wenn sie Lichter sehen,
In die Hüten, wo
Spinnerinnen froh
Seidne Fäden drehen.
Setzen an der Mägde Kunkel,
Luft’ge Gäste, sich,
Spinnen emsiglich
Durch der Nächte Dunkel
Und von ihren Lippen wallen
Worte leicht und leis,
Goldner Sagen Preis,
Die behagen Allen.
Von des Berges tiefen Spalten,
Wo in ew’ger Nacht
In dem kühlen Schacht
Blumen Hochzeit halten.
Von der Erdengeister Treiben,
Fürstlichem Geschlecht,
Und von Gnom und Knecht,
Und von Wasserweiben.
Und die Spindel rollet Allen
Lustig durch die Hand,
Bis daß an der Wand
Morgenlichter wallen.
Da entschlüpfen schnell die Frauen:
An des Bergs Gestein
Sind die seel’gen Fei’n
Nebeln gleich zu schauen.
Doch der Flachs ist abgesponnen,
Und die Spindel ruht,
Und ein zehnfach Gut
Jede hat gewonnen. (88)
Autor dieses Gedichtes ist Gustav Schwab, der es im Taschenbuch „Urania“ auf das Jahr 1823 veröffentlichte und es später auch in seine „Neckarseite der Schwäbischen Alb“ (1823) aufnahm.
Die Nachtfräulein und die alte Urschel
Noch bey zwey erst vor wenigen Jahren verstorbenen Frauen, ins Keßlers Haus auf Wiel, und beym Wielweber, fanden sich regelmäßig an jedem stillen Winterabende zwey Nachtfräulein ein, kleine, zierliche, wunderschöne Gestalten, schneeweiß angethan und glänzend in Gesicht und Kleidern, wie der funkelnde Schnee. Sie spannen an der Weiber Kunkeln die feinsten Fäden hurtig und flink, gegen die Menschen schweigsam, nur unter sich zuweilen einige Worte in kindischer Aussprache wechselnd. Wenn der Morgen graute, giengen sie davon und man sah ihr Laternchen bis in die Gegend des Nachtfräuleinloches; dann war auf einmal Alles verschwunden. Der Flachs indeß war abgesponnen, wie groß die Kunkeln auch gewesen waren.
Als Ursache ihres Ausbleibens wird erzählt: der Wielweber hatte einst Fruchtmangel und klagte diese Noth seinem Weibe, als eben die Nachtfräulein da waren. Da öffnete die eine von ihnen den zierlichen Mund und bot ihm Frucht an, so viel er begehre, jedoch auf Wiedererstattung. Nur dürfe die zurük zu gebende ja nicht am Sonntag gedroschen seyn. Abends standen zwei schneeweiße Säke voll herrlicher Frucht an der Treppe, wußte Niemand, wie sie hergekommen seyn mochten. Den Ersatz des Darlehens stellte der Wielweber in denselben Säken wieder an die Treppe hin. Da blieb er Tage und Wochen unberührt stehen. Endlich kam die eine von den Nachtfräulein und bitterlich weinend jammerte sie: die Frucht sey am Sonntag gedroschen; sie könne nun nimmer zu den Menschen kommen, die sie betrogen. Sie verschwand und man hat seitdem nichts mehr von beiden gesehen. Der Segen wich mit ihnen aus dem Hause. Die Frucht war am Samstags von dem Wielweber gedroschen, und, um zu sehen, was daraus erfolgen möge, hatte er damit bis Nachts nach 12 Uhr fortgemacht.
In dieser Sage finden wir unverkennbar die freundlichen Elfen der Vorzeit, deren Erscheinen die Volkssage von einem Geschlecht zum andern bis in die nächste Vergangenheit herüberzieht. Auch die tückischen Alfe (Gnomen) fehlen nicht; nur identificirt sie die Sage mit jenen und nennt auch diese: Nachtfräulein.
In eine Grube am Ursulaberge, sie ist eben das sogenannte Nachtfräuleinsloch, wirft noch ein Jeder, der vorüber geht, einen Stein, und doch wird sie nie ausgefüllt. Wer dieses Opfer nicht bringt, dem legen die Nachtfräulein einen Stein so in den Weg, daß er darüber durchaus fallen muß, oder sie spielen ihm auf irgend eine andere Weise einen argen Streich.
Das Schloß auf dem Ursulaberge soll mit unendlichen Schäzen versunken seyn. Die Bergsage, die alte Urschel, suche noch, als Steingeist diejenigen, die bey Nacht über die Steinge gehn, zu blenden, und nach dem Ursulaberge hin zu verführen, damit sie diese Schäze haben, und damit sie gleich zu erlösen.
Eine ältere Sage erzählt: Ein junger Geselle gieng einst mit seinen Eltern auf ein Feld am Ursulaberge, um Kartoffeln zu holen. Die abgeschirrten Pferde ließen sie einstweilen weiden. Sie nachher auf dem Berge wiedersuchend, findet dort der Geselle ein neues Pferdekummet, nimmt und sezt sichs, wie es der Brauch ist, auf beyde Schultern, den Kopf zwischend durchstekend. Da sieht er augenbliks die alte Urschel vor sich stehn, im grünen Rok, mit rothen Strümpfen. Ich und noch Jemand, spricht sie, freuen uns, daß du endlich kommen bist. Wir warten hier schon Jahrhunderte auf Erlösung durch dich. Dann führt sie ihm zu Gemüthe, wie sie, mit unendlichem Sehnen, des Baumes (ein Baum zu gleicher Bestimmung soll eben jezt wieder auf dem Ursulaberge stehn und von der alten Urschel gehegt und gepflegt werden), daraus man seine Wiege gemacht, Keimen und Wachsen belauscht und betrieben und Minuten, Jahre und Jahrhunderte gezählt habe, bis er endlich gehauen ward. Sie habe ihn in dieser Wiege gepflegt und vor den Nachstellungen ihres Feindes geschirmt, und jezt sey die Zeit für ihn gekommen, dankbar dafür zu seyn und sie zu erlösen, was einzig ihm möglich sey. Sie hüte unermeßliche Schäze. (Auch auf der Achalm sollen von 2 Pudeln unendliche Reichthümer gehütet werden.) Die wolle sie alle ihm geben und einen noch tausendmal köstlichern Schaz, wenn er sie erlöse. Sie werde ihn durch einen allen andern Menschen unsichtbaren Eingang in den innern Berg führen. Dort stehe jezt das alte herrliche Schloß, das vordem auf dem Berge stand. Dort werde aber eine Schlange, furchtbar anzusehen, ihm auf das Herz losfahren. Die solle er jedoch nur herzhaft in die Arme schließen und fest an sein Herz drüken. Dann werde er das schönste Weib der Welt in seinen Armen finden. Dann sey der Fluch gelöst. Das alte Schloß werde von neuem ans Licht des Tages heraufsteigen und er mit seinem Schaz in solchem Schloße all dessen goldene Schäze theilen. Mit noch viel andern verführerischen Worten suchte sie ihn zu berüken. Er aber, als ein frommer Jüngling, betete zu Gott im Stillen: Vater Unser da war urplözlich die Urschel verschwunden. Nachher erschien sie ihm indeß noch zu verschiedenen Malen und suchte ihn mit gar beweglichen Worten dahin zu bringen, daß er ihr zu Willen seyn möchte. Er wiederstand jedoch kräftig jeder Versuchung, zumal da ihm die alte Urschel nicht einmal gestatten wollte, seine Eltern zu dem Abentheuer mitzunehmen. Sie sollten höchstens bis an den Eingang des Berges mitgehn dürfen.
Einst kam der junge Geselle mit andern Kammeraden wieder an den Ursulaberg. Auch da erschien die alte Urschel wieder und drohte ihm nun, daß es sein junges Leben gelte, wenn er nach ihrem Begehren nicht thue. Die andern aber sahen nichts und hörten nichts von ihr. Da sagt’ er es endlich ihr zu. Doch fragt er vorher noch den Geistlichen, der sein Beichtvater war, um Rath; der aber hielt dafür, daß eine einmal verfluchte Seele durchaus nicht erlöst werden dürfe. Dies führte er noch in einer Predigt, die er am nächsten Sonntag hielt, des Weitern aus, und schloß damit, das Ganze sey ein Teufelsspuk, die arme Seele dieses frommen Jünglings zu verderben. Die ältesten Leute wollen von ihren Eltern wissen, daß diese die besagte Predigt angehört haben. Nach Jahr und Tagen gieng darauf der junge Geselle mit seinen Eltern einmal wieder auf den Aker am Ursulaberg, um Kartoffeln zu holen. Sie hatten wieder ihre Pferde bey sich, von denen eines das gefundene Kummet anhatte. Da erschien ihm denn die alte Urschel, ungesehen von seinen Eltern, wieder, schalt ihn heftig aus, daß er dem Pfarrer von ihr gesagt, und fiel dann wieder in ihr altes Jammern, daß, wenn er sie nicht erlöse, sie noch Jahrhunderte zu leiden habe. So geschieht dies eben recht, gab ihr der junge Geselle zur Antwort, wer einmal verflucht ist, ist ewig verflucht. Solche Rede hörten seine Eltern und merkten daraus, daß er mit der Urschel rede, von deren Worten sie jedoch nichts vernommen hatten. Bald aber sahn sie ihre furchtbare Rache. Ihr Kind fiel plötzlich todt vor ihren Augen nieder, die alte Urschel hatte ihn erwürgt; das gefundene Kummet verschwand. – Von dieser Geschichte sollen die Aeker hinter dem Ursulaberge den Namen haben: Mordios-Aeker.
b) Auf dem Uebersberge soll ehedem oberhalb ein Schloß gestanden seyn. Noch dröhnt es dumpf und hohl aus der Erde herauf, wenn man nicht weit vom Mädchenfelsen hart auftritt. Dort sollen von dem verfallenen Schloße noch die Keller seyn. Es mögen indeß, wohl natürliche Felsenhöhlen seyn.
Mädchenfelsen oder Dorotheen-Felsen heißt die vorspringende Felsenstirn des Uebersberges. Die Sage über den Ursprung dieses Namens erzählt: eine fromme Jungfrau, von einem bösen Jäger verfolgt, kommt an die steile Felsenwand, und wagt in Gottes Namen, betend: Der Herr wird seinen Engeln über dir Befehl thun, daß sie dich auf ihren Händen tragen, den Sprung die schwindelnde Höhe hinab und wird wunderbar erhalten. Der nachspringende Verfolger zerschellt an den Felsen. (89)
Der Sagenabschnitt aus der umfangreichen handschriftlichen Pfarrchronik (1828) von Friedrich Meyer (1794-1848), seit 1820 in Pfullingen als protestantischer Geistlicher tätig, wird hier erstmals vollständig abgedruckt. Meyer war Ludwig Uhlands Schwager und ein Freund von Gustav Schwab.
Vom Urschelberg
Ueber Pfullingen erhebt sich ein Berg, der Urschelberg genannt. Wie sein Name an den Hörseelenberg (vom Volke Hörschelberg gesprochen), in Thüringen erinnert, so hat er auch an einem Abhang, der das Hörnle heißt, gleich jenem, der unter seinem, Eisenach zugestrecktem Horn eine Höhle hat, das Hörselloch - ebenfalls eine solche, die bei den Umwohnern das Nachtfräuleinsloch genannt wird.
Gleich der Frau Holle, der alten Spinnefrau im Hörseelenberge (Sage Nr. 459 und 757), wohnt die alte Urschel als Spinnerin im Urschelberge, und ist des Berges ganze Umgegend mit Sagen über sie erfüllt. Ein Theil dieser Sagen deutet darauf hin, daß die Urschel gleich andern wandernden Jungfrauen aus verwünschten oder versunkenen Schlössern (zwei Schlösser sollen auf dem Urschelberge versunken sein), auf Erlösung harre, die auf einer Eichel, deren erwachsen zum Baume, auf das fertigen einer Wiege aus diesem Baume, und auf einem darin gewiegten Sonntagskinde beruht - der hoffenden aber stets fehl geschlagen, weil der erkorene Gesell, der sie durch ein aufgefundenes Pferdekummt sichtbar geschaut, nicht Muth genug gehabt, das Werk der Erlösung zu vollführen. Nach andern war es keine Eiche, sondern eine von der Urschel selbst gepflanzte Buche, aus welcher die Wiege gefertigt wurde, und noch immer soll eine solche Buche auf dem Urschelberge stehen und von ihr gehüthet werden. Anderntheils deuten die Urschelsagen rein auf sie als Spinnefrau. Wie die Berchtha im Voigtlande ihr Gefolge hat von Heimchen, hat die Urschel eines von Nachtfräulein, nur nicht so zahlreich, meist nur auf die Dreizahl beschränkt. In deren Begleitung kam sie nach Pfullingen „auf Wiel," eine also genannte Häuserreihe, an welche die Heergasse (Sage Nr. 918) vorüberführt - leise Hindeutung auf die Urschel auch als wilde Jagdfrau - in die Lichtkarz, und spannen allda sehr fleißig. Einst machte sich aber ein Bursche den Scherz, einem der Nachtfräulein den Faden abzubrechen, und wollte nach der üblichen Sitte, indem er den Rocken nahm, diesen mit einem Kuß ausgelöst haben - das nahmen die Urschel und die Nachtfräulein sehr übel, nahmen ihre Spindeln, gingen von dannen und kamen nie wieder in dieses Haus. Von dem Hause aber wich seitdem aller Segen. Sie besuchten dagegen bisweilen andere Häuser, und spannen nicht allein für sich, sondern auch für die Frauen, die sie besuchten, und spannen deren Kunkeln ganz leer, und alle Spindeln voll, und den feinsten Faden, den es geben konnte, spannen sie, und wann sie gingen, sah man ihre schloßschleierweißen Kleider beim Schein ihres Laternchens bis nahe an das Nachtfräuleinsloch am Urschelberge leuchten. In Reutlingen heißen sie Bergfräulein, weil sie im Urschelberge wohnen, da sollen sie ihren Aus- und Eingang, wenn sie auch dorthin zum Spinnen kamen, mitten auf dem Markt gehabt haben. So ganz ledigen Standes müssen aber die Urschelbergerinnen doch nicht gelebt haben, denn es sind Sagen von in den Berg geholten Hebammen vorhanden, welche mit Strohhalmen belohnt wurden, von denen sich die in Goldstangen und Goldstücke verwandelten, die nicht verächtlich weggeworfen worden waren. (90)
Ludwig Bechstein, der vor allem durch seine Märchensammlung bekannte Thüringer Autor, arbeitete gern Parallelen in die Texte seines Deutschen Sagenbuchs von 1853 ein. Hier gibt er eine Zusammenfassung der verschiedenen Urschelberg-Sagen aus der kurz zuvor erschienenen Sammlung von Ernst Meier (1852).
Der Ursulaberg (Urschelberg) bei Pfullingen
Unweit Pfullingen ragt auf dem Alpgebirge unter andern ein ziemlich hoher Berg hervor, welcher von alter Zeit her nach der unter den dortigen Bewohnern noch gehenden Sage, seine Benennung von einer gewissen Feenkönigin, Ursula genannt, erhalten haben soll.
Diese Ursula war, nach der Aussage, keine von den bösartigen Feen, sondern im Gegentheil eine sehr wohlthätige und machte öfters unter den Leuten von Pfullingen und den umliegenden Ortschaften Besuche, wenn sie Nachts mit dem Spinnen beschäftigt waren, wo sie dann auch meistens mitgesponnen und ihnen mit ihren Weissagungen nützliche Dienste erwiesen hat; so kündigte sie z. B. an, wenn ein gutes oder ein schlechtes Flachsjahr kommen werde. Zuweilen kamen auch noch einige andere Feen, welche ihr unterthänig waren, mit ihr. In diesem Ursulaberge hatte sie ein prächtiges Schloß und darinn Ueberfluß von Gold und Silber, wovon sie fast jedesmal bei ihrem Besuche einen bestimmten Theil je nach Umständen ausgetheilt hat. Auf dem Gipfel des Berges befindet sich ein sehr tiefes Loch, aus welchem Ursula herausgestiegen ist, und von wo aus man oft einen wunderbar schönen Gesang gehört hat. (91)
Aufgezeichnet von dem Gymnasiasten Schmückle 1846.
Die versiegte Quelle der Ursula
Als ich im vergangenen Spätjahre mich zu Pfullingen aufhielt, besuchte ich auch die Berge der Umgegend, von denen aus man eine schöne und weite Aussicht genießen konnte. Als einen solchen Punkt rühmte man mir auch den Jungfrauenfelsen. Der Weg dahin, den ich in Begleitung eines Bauern machte, führte uns über den Ursulaberg, der ringsum mit einem schönen Grün bekleidet ist. Um so mehr fiel mir eine Stelle neben dem Wege auf, die ganz mit Steinen bedekt war, welche absichtlich hingeworfen zu sein schienen. Diese meine Vermuthung bestätigte sich, indem mein Begleiter einen Stein auf dem Wege aufhob, und ihn mit den Worten: "da, Ursula!" auf die Stelle hinwarf. Zugleich forderte er mich auf, dasselbe zu thun. Lachend warf ich einen Stein hin und fragte den Bauern dann um die Ursache seiner sonderbaren Handlung. "Ja, antwortete er, dazu haben wir unsere guten Gründe, da Ihr aber die Sache nicht zu wissen scheint, will ich sie Euch erzählen: Hier an dieser Stelle war früher ein Loch, in dem sich eine schöne Quelle befand. Neben der Quelle saß gewöhnlich so ein Bergfräulein, Namens Ursula, welcher der ganze Berg gehörte. Wer nun ihr Gebiet betrat, mußte ihr etwas, woran er gerade Überfluß hatte, vor oder in ihr Loch werfen, sonst zog sie die Vorübergehenden hinein oder ließ ihnen auf dem Wege ein Unglück zustoßen. Weil nun aber wir Bauern an Steinen immer den größten Ueberfluß haben, werfen wir gewöhnlich der Ursula statt einer Gabe nur einen Stein hin. Vielleicht nun wäre ihr etwas Anderes lieber gewesen, oder fürchtete sie, von den Steinen, die in ihr Loch fielen, getroffen zu werden; kurzum sie ließ sich von da an auf dem Berg nicht mehr sehen, nahm uns aber auch dafür die Quelle mit. Dennoch unterlassen wir nicht ihr diese Steine zu schenken, da auch jezt noch gewöhnlich dem, der diese Sitte vernachlässigt, die Ursula etwas, wäre es auch nur ein Regen oder Gewitter, auf den Hals schickt. (92)
Der Stuttgarter Gymnasiast Wanser wusste 1847 von einem „Opfer“-Ritual, das in anderer Form in der Nr. 1 der Sagensammlung Ernst Meiers „Das Opfer für die alte Urschel“ erscheint. Meier zufolge legten am Remselesstein Pfullinger Kinder durchlöcherte Hornknöpfe, die „Remsele“ hießen, als Opfer nieder. Um 1900 wurde dieser angebliche Opferbrauch als Kinderspiel berichtet. Die Buben spielten auf dem Weg zum Berg auf dem Remselesstein:
Man warf die Remsele in die Höhe und je nach Lage, in der sie auf den Stein zu liegen kamen, fielen sie der einen oder anderen der spielenden Parteien zu. So spielte man der Urschel zuliebe, damit einem im Walde nichts zustoße, der Urschel übergab man aber die Remsele nicht, auch nannte man das Spiel nicht Opfer.
Die auch andernorts im 19. Jahrhundert belegten „Opferbräuche“ lassen sich zwar nicht sicher deuten, aber es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass es sich um uralte heidnische Traditionen handelt, wie man im 19. Jahrhundert vermutete.
Das versunkene Kloster Ursulenberg
Über den Ursulaberg bei Pfullingen ist folgende Sage im Umlauf, als deren Gewährsmann ich einen alten Pfullinger anführen kann. Dort soll einst ein Kloster der heiligen Ursula gestanden sein, dessen Nonnen sich nur des Tags mit geistlichen Dingen beschäftigten, Nachts jedoch allerlei Zauberei trieben. Deshalb wurden sie in der Umgegend theils als Wunderthäterinnen gepriesen, theils als Hexen verrufen. Dieser letztern Ansicht war auch der Schutzherr des Klosters und er wollte es daher bei Nacht zerstören. Da sich aber die Nonnen in allerlei Gestalten verwandelten, um ihm zu entgehen, rief er erzürnt aus: "Der Teufel möge euch und euer Kloster verschlingen!" Dieser Wunsch gefiel dem Bösen und er ließ den Berg mit Allem, was darauf war, in den Boden versinken. Da aber der Geist der Finsterniß nur des Nachts Macht hat, konnte er nicht verhindern, daß am nächsten Morgen der Berg sich wieder erhob, wiewohl ohne Kloster, das durch Zauberei entweiht, ganz in den Händen des Teufels war. Und auch jetzt noch soll an der Stelle, wo des Tags der Berg steht, Nachts ein Abgrund gähnen, in dessen Tiefe die Klosterschätze liegen. (93)
So der Stuttgarter Gymnasiast Martens 1847. Ein Kloster stand nie auf dem Ursulaberg, der 1370 erstmals als „Ursenberg“ bezeugt ist.
Die Nixe von der Echatz. Eine Sage
Nicht weit von dem Fußwege, welcher an der Echatz hin von Reutlingen nach Pfullingen führt befindet sich ein schöner Wasserfall, der sich einen nach der Sage unergründlichen Kessel gehöhlt hat.
Folgende Sage geht über denselben im Munde des Volks.
Vor grauen Zeiten kam jeden Abend eine Jungfrau, die dem Strudel des Wasserfalls entstiegen war in die Spinnstube (Karz) nach Pfullingen. Die Jungfrau erzählte schöne Mährchen und sang während des Spinnens liebliche Lieder. Dadurch wurde allen der Abend erheitert, allein mit dem 10ten Stundenschlag kehrte sie eiligst in den Strudel zurück.
Bald liebte sie der Sohn des Meßners, der ebenfalls den Karz besuchte, unaussprechlich, allein auch dieser vermochte sie nie [zu bewegen], länger, als bis 10 Uhr zu bleiben.
Seine Sehnsucht war so groß, daß er oft bey Tag an den Wasserfall gieng und denselben ganze Stunden anstarrte.
Das Nahen des Frühlings machte ihn noch trauriger, da mit Frühlingsanfang der Karz zu Ende gieng. Jede Minute, die er bey ihr zubrachte, war ihm daher kostbar, er sann auf eine List und glaubte sie darin gefunden zu haben, daß er die Kirchenuhr um Eine Stunde zurückrichtete. Dadurch gelang es ihm, daß sie sich erst entfernte, als es 10 Uhr schlug.
Die Echatz brauste zerstörend durchs Thal, als der Jüngling erwachte, vom nahen Ursulaberge her tönten Seufzer, aus welchem Laute wie Todesschmerzen schoßen und auf welchem ein schauriger Blutfleck schwamm. Aus Verzweiflung stürzte sich der Jüngling in den Strudel aus welchem die Jungfrau nie mehr zurückkehrte. (94)
Carl Albert Zeller hielt diese Sage für seinen Lehrer Albert Schott 1845 fest.
Der Haule im Sörgenthal
Es mögen schon sehr viele Jahre verflossen seyn, seitdem in Pfullingen ein Mezger, Namens Haule, lebte, welcher durch Leichtsinn und Verschwendung seines ziemlich grossen Vermögens so weit herabgekommen war, daß er darben mußte. Anstatt daß er nun getrachtet hätte, durch Arbeit sein Brod zu verdienen, gieng er mit mörderischen Gedanken um, und machte sich eines Tags auf den Weg in einen naheliegenden Wald, durch den ein Bauer, welcher viel Geld bei sich trug, kommen mußte, um denselben zu ermorden. Als dieser an ihm vorüber war, schlich er ihm leise nach, brachte ihm von hinten mit einem Knittel einen Hieb bei, daß er sogleich todt zu Boden stürzte und eilte dann mit diesem Geld nach Hause, welches bald aufgebraucht war. Alsbald nach dem Morde wachte in ihm sein Gewissen auf und ließ ihm keine Ruhe mehr, bis er sich in seinem Hause aufhenkte. Er hinterließ ein Weib und einige Kinder, welche durch die Noth gezwungen wurden, ihr Haus zu verkaufen. Der neue Hausbesitzer und seine ganze Familie wurde jede Nacht durch ein unheimliches Winzeln und starkes Poltern und Rasseln im Schlafe gestört, das Gesinde blieb nicht mehr und streute in der Stadt das Gerücht aus, daß es in dem Hause spucke, weil sich darin der Haule erhenkt habe. Als die Unruhe in dem Hause nicht aufhörte, sondern nur noch zunahm, ließ der Hauseigenthümer aus der Umgegend von Pfullingen einen Geisterbeschwörer komen, welcher den Geist in ein Fläschgen bannte und in eine Schlucht des Sörgenthals trug. Von jetzt an war die Ruhe in dem Hause wiederhergestellt, allein in dem Sörgenthal wurde es nach einiger Zeit um so lebhafter, obschon man niemals daselbst etwas gesehen oder gehört hatte. Es fand nemlich ein Schnitter das Fläschchen, von welchem er sogleich den Stöpsel wegthat um zu sehen, ob etwas darin enthalten sei; aber kaum war derselbe weg, so wurde plötzlich ein starkes Geräusch hörbar, und es trabte an ihm ein Mann auf einem Schimmel vorbei, welcher immer "hup hup" schrie. Sehr viele Leute wollen von der Zeit an den Reiter bei Nacht gesehen und hup hup rufen gehört haben, auch soll man, wenn man an diesem Thale vorbei komme, sehr gerne darin verirren und Ohrfeigen bekommen. (95)
Der Stuttgarter Gymnasiast Schmückle schrieb diese Geschichte 1847 nieder. Noch heute ist dieser Geist, der Haule vom Serchental, in Pfullingen bekannt, glaubt man den „Pfullinger Sagen“ von 1987. Als Übereinstimmungen sind zu registrieren: Der Haule habe einen Fremden umgebracht und reite meist auf einem Schimmel. Die anderen Motive aus Schmückles Version sind nicht mehr bekannt, andere sind an ihre Stelle getreten. Im Pfullinger Konferenzaufsatz des Schullehrers Schäf (1900) heißt es zu dieser Sagengestalt:
Vor wenigen Monaten starb hier eine Frau, die nicht nur fest an ihn glaubte, sondern ihn auch öfters gesehen hatte.Einmal fuhr sie mit anderen bei Nacht auf einem Leiterwagen von einer Hochzeit in Gönningen her. Im „Serchenthal“ sah sie den Haule, wie er sich mit einer Hand am hinteren Ende des Wagens hielt und diesem nachlief, während er in der anderen Hand seinen Kopf trug. Ein andermal wollte dieselbe Frau, vom Heuen auf den Holzwiesen ermüdet, ein Mittagsschläfchen machen. Der Haule ließ sie aber nicht dazu kommen und störte sie immer wieder durch Zupfen an ihrem Kleide. Von da an ging die Frau nie mehr in jene Gegend.
Weißes Schwein geht um
In mehren Gassen von Pfullingen läuft um Weihnachten ein kleines weißes Schweinchen um. Es begegnet namentlich solchen, die auf verbotenen Wegen gehen. So wollte einmal ein Bursch zu einem Mädchen durchs Fenster steigen; allein das Schwein litt es nicht. Ebenso gieng es ihm am folgenden Abend. Schon oft hat man versucht, es zu fangen, hat es umstellt und eingeschloßen; aber es verschwand jedesmal den Leuten unter den Händen. (96)
Von den gespenstischen „Dorftieren“ wusste man in allen Gegenden Deutschlands zu erzählen. Im Pfullinger Konferenzaufsatz von 1900 liest man:
Vom 1. Advent bis zum Erscheinungsfest läßt sich bei Nacht in den Straßen, namentlich in der Heergasse ein "Säule" sehen, dessen ganze Thätigkeit im Umherspringen besteht. Am häufigsten ist`s um 12 Uhr zu sehen. Auch auf dem Kunstmühleweg (5 Min. vor der Stadt) soll es zu sehen sein.
Geist bringt Radfahrer zu Fall
An der Arbachbrücke (zwischen hier und Reutlingen) soll ebenfalls ein Geist zu sehen sein, der es als fortschrittlicher Geist auf die Radfahrer abgesehen hat, die er zu Fall bringt, indem er ihnen die Luft aus den Reifen zieht. (97)
So der Konferenzaufsatz von 1900, aus dem auch der nächste Text stammt.
Kröte in der Pfarrkirche
Im Jahr 1889 wurde die hiesige Kirche umgebaut. Als man den Staffeltritt im Chor wegnahm, sei eine große Kröte darunter gewesen, die dann in den benachbarten Hirschgarten hüpfte. (98)
Im Mondschein soll man nicht arbeiten
In Pfullingen spann einmal eine Frau noch um Mitternacht bei Mondschein, um Oel zu sparen. Da trat ein nackter Mann herein und bot ihr den Hintern hin und sagte, daß sie ihn kratzen solle, was sie in der Angst denn auch that. Darauf gieng er fort. Die Frau begab sich dann zu Bett und erzählte noch ihrem Manne die Geschichte. In der folgenden Nacht blieb der Mann auf, um zu sehen, was geschehen würde, und hechelte Flachs beim Mondschein. Da erschien wieder der nackte Mann; als er aber seinen Hintern herhielt, um sich kratzen zu laßen, da nahm der Andere die Hechel in die Hand und kratzte ihn damit recht ordentlich, worauf der nackte Mann fortgegangen und nicht wieder gekommen ist. (99)
Die Glockenhöhle
Ganz in der Nähe desselben Weilers [Breitenbach] befand sich ehedem die Glockenhöhle, darin es, wenn einer redet, wie eine Glocke klingt. Sie findet sich nimmer, wie sorgfältig ich auch gesucht habe. (100)
Am 20. Juni 1834 schrieb Ludwig Uhland sein Gedicht „Die Glockenhöhle“ nieder. Inspiriert wurde er von dieser Passage aus der Pfarrbeschreibung seines Schwagers Meyer. In einer Beschreibung des Blauhofs von 1572 wird ein Markstein genannt, „so in die Klingen- und Glockenhöhle hinabsteht“.
Sage vom Mägdleinsfelsen
Die Sage vom Mägdleinsfels ist dieselbe, die sich in allen Gebirgen Deutschlands bei ähnlichen Felsenvorsprüngen wiederholt: es ist die der Riesentrappe, des Jungfernsprungs und andrer Stellen: Ein Jäger, der ein schönes Mägdlein verfolgt, und sie auf die Spitze des Felsen treibt, wo sie nicht weiter kann. Sie stürzt sich betend hinab; aber sie wird von unsichtbaren Händen getragen, und ihr wiederfährt kein Leid, Der Jäger springt ihr nach, und findet in der Tiefe zerschmettert seinen Tod. (101)
So Gustav Schwab 1823. Er kannte diese Überlieferung bereits 1816. Ernst Meier ergänzte 1852, man sage auch, diese Jungfrau sei eins von den Nachtfräulein des Urschelberges gewesen. Der „Mädchenstein“ erscheint 1521 als „Metlinstein“.
Eningen unter Achalm
Ursprung des Namens Achalm
Die von mir poetisch bearbeitete Sage vom Ursprung des Namens der Burg Achalm (s. Morgenbl. März 1815), wo ich nur aus Versehen einen Pfeilschuß statt des sagengemässen Schwertstosses (den Uhland in seinem Eberhard dem Greiner s. dessen Gedichte beibehalten) gesetzt habe, wird auch anders und prosaischer so erzählt: Ein Kaiser habe den hohen und steilen Berg bestiegen, und unterwegens in der Ermattung ausrufen wollen: ach allmächtiger Gott! Wobei ihm der Athem ausgegangen, und er nur Ach allm- hervorgebracht.
Derselbe spitze und isolierte Berg auf dem die Ruinen von Achalm stehen, soll zu seinem Fusse unter der Erde mit einer goldenen Kette umflochten seyn; weswegen die Bauern da schon öfters Schatzgräbereien angestellt. (102)
Dies teilte Gustav Schwab Wilhelm Grimm im Rahmen einer kleinen Sagensammlung am 20. Oktober 1816 mit. Er hatte die Texte überwiegend aus der Beschreibung Württembergs von Johann Martin Rebstock (1699) exzerpiert.
Gespenster und umgehende Tote
Die Lage Eningens am Fuße der Alb, wo die Sagen „reicher fließen“ (Oberamtsbeschreibung von Reutlingen von 1893, Seite 152), und die kühngeformten Berge der prächtigen Umgebung schon von alten Zeiten her mächtig auf das Gemüt und die Phantasie eingewirkt haben, sowie das lebhafte und bewegte Naturell der Eninger, das sich für Neues leicht, wenn auch nicht gerade nachhaltig tief erregen läßt, endlich der Umstand, daß viele Kauf- und Handelsleute („Eninger Krämer“) fast in allen Städten und Dörfern des In- und Auslandes verkehrten - diese drei Punkte bringen es mit sich, daß an volkstümlichen Überlieferungen auf allen Gebieten Vieles sich hier findet. Aber unsere materialistische, verstandeskalte Zeit drängt das Alte, das Überlieferte, besonders aber den alten Aberglauben mit der früher so beliebten Sage mehr und mehr in den Winkel oder in den Kreis weniger Freunde, Nachbarn oder Familien.
Und auch hier will das junge Geschlecht von Vielem nichts mehr wissen; das "dumme" Alte wird erzählt, um ein mitleidiges Lächeln über die vielgläubigen Ahnen anbringen zu können - wenigstens ist das so in größerer Gesellschaft, im Wirtshaus. So ein Aufgeklärter bringt es mitunter aber doch trotzdem fertig, bei Unannehmlichkeiten mancher Art, bei Krankheit oder bei der gefürchteten Aushebung zum Militär „zu jemand zu gehen“, um sich mit Sprüchen, Amuletten und anderen Mitteln feien zu lassen. Traurig, aber leider wahr!
Will der Sammler reichere Kunde und gläubigere Anhänger alter Überlieferungen finden, so muß er sich an ein altes Mütterlein oder einen ergrauten Vertreter vergangener Tage wenden; man darf dabei aber ja nicht glauben, alles aus den Leuten herausbringen zu können; mit einem kurzen "das sag ich nicht!" oder "ich kann es nicht sagen!" werden die schönsten Geheimnisse zu einem Privatbesitz weniger Eingeweihter gemacht. "So lebt vieles unter der Oberfläche unvermerkt fort", und der Sammler muß nicht selten die betrübende Wahrnehmung machen, einen alten Schatz zwar nach seinem Vorhandensein zu kennen, ihn aber nicht heben und der Vergessenheit entziehen zu können. [...]
Ein "feuriger Reiter" ohne Kopf ergeht sich unter der Achalm am Hag; aber nicht alle Leute sehen ihn. Ein schwarzer "gottsträflicher" Pudel zeigt sich bisweilen auf dem Fußweg von Eningen nach Pfullingen (sog. Boll); das Gespenst nimmt seinen Weg dem Ursulaberg zu und hat auch einmal einen, der nachts von der Mühle heimkehrte, auf Irrwegen diesem Berge zugeführt. Ganz gefährlich steht es um die Leute, die nachts von einer Bösen (Hexe ?) ohne Kopf besucht werden. Geräuschlos schleicht sie daher; am andern Morgen ist alles Vieh losgebunden; ja einmal hat die Böse sogar einen Mann im Arrest aufgesucht und ihn weidlich durchgeprügelt.
Irrlichter giebt es an verschiedenen Orten, so im sog. Banget, am Weistenberg, Katzenbuckel. Auf dem Kirchhof zeigt sich ein Licht, das nahe kommt, so bald man etwas vom Boden aufhebt. Auch in der Eninger Kirche soll es nicht ganz geheuer sein. Man habe sogar vor nicht zu langer Zeit während der Sonntagskinderlehre einen früheren Geistlichen zum Altar gehen sehen, so daß viele Mädchen in Ohnmacht gesunken seien und der Geistliche das Amen habe sprechen müssen. Aus vielen Äußerungen hiesiger Bewohner kann geschlossen werden, daß das "Volk" zwischen dem rechen Glauben (Kirchenglauben) und den Gespenstern, den Irrlichtern, den Spukgeister, dem wilden Heer u.a. insofern einen Zusammenhang herstellt, als ein gläubig-frommer Sinn vor allen bösen Einflüssen bewahrt. So äußerte sich ein Bewohner: "Ich glaube ja nicht viel und will auch nicht zu den Frommen gehören; aber wenn ich des Morgens aufstehe, so sage ich: "Das walte Gott". Ich mag dann hingehen, wo ich will, so fürchte ich mich nicht; auch beim Gewitter denke ich, du hast den Tag mit Gebet angefangen und auch sonst nichts besonderes Böses gethan, deswegen wird es dir auch nicht schaden." Wie überall ist ferner die Ansicht verbreitet, daß, wer Marksteine versetzt, Opfer stiehlt, sich in den unrechten Besitz von Häusern und Äckern setzt, geisten d.h. umgehen muß. Nur (wenig) Jahre zurück hat es in einem hiesigen Hause ganz gewaltig gespukt, so daß alle Nachbarn und, wie erzählt wurde, der Geistliche in das betreffende Haus gerufen wurde. Eine Nachtwache, gebildet aus dem Landjäger und einem hiesigen Bäcker und Gemeinderat, letzterer seinen Mut in Gestalt einer Flasche Rotwein mit sich führend, hörte auf das ängstliche Schreien und Jammern der Hausfrau und Kinder hin wirklich ein "starkes 3maliges Klopfen." Aber "was" und "wer" es sei, weiß man bis heute noch nicht. (103)
Die Überlieferungen zeichnete Schullehrer G. Krieg in seinem Konferenzaufsatz im Jahr 1900 auf.
Genkingen
Der Geist in der Esche
Bei Genkingen auf der Alb steht an dem Wege, der nach Pfullingen führt, eine alte hohle Esche, darin wohnt ein Geist, der die vorübergehenden Menschen erschreckt, sie anhält und mit in die Esche zu nehmen sucht. Deshalb wagt es Niemand, selbst nicht bei Regenwetter, sich in den hohlen Baum hineinzustellen. Diesen Geist will man sogar schon gesehen haben. Er soll eine rothe Weste, schwarze Hosen und weiße Strümpfe tragen. (104)
Belsen
Die Belsener Kapelle
Die Volkssage von Belsen erklärt diese Kirche, die seit undenklicher Zeit zum Gottesdienst der Gemeinde eingerichtet ist, für einen heidnischen Bels- oder Baalstempel, von dem sie auch den Namen Belsen ableitet, setzt den Farrenberg, wohl auch den Roßberg damit in Verbindung, indem sie erzählt, daß auf diesen Höhen das heilige Opfervieh geweidet wurde, und zeigt noch im Innern der Capelle den Stein, an welchen die Opfer gebunden wurden. (105)
Die von Gustav Schwab in seinem Albführer 1823 als „Volkssage“ bezeichnete Deutung der rätselhaften romanischen Bildwerke der Belsener Kapelle ist natürlich eher eine Sage der Gebildeten, denen der antike Baals-Kult geläufig war. Bereits im 18. Jahrhundert haben sich Altertumsforscher an Interpretationen der Plastiken versucht. In einem kritischen Exkurs setzte sich Schwab mit den gelehrten Phantasien auseinander. Er stellte fest, dass auch die „Volkstradition“ die Baals-Deutung bevorzuge, bemerkte dann aber durchaus einsichtsvoll:
Doch möchte sie dorthin erst durch die gelehrte Welt, durch Pfarrer oder Schulmeister gekommen seyn.
Dem Pfarrer die Predigt aus dem Kopf nehmen
Der Hexen- und Geisterglauben wurzelt in Belsen im fruchtbarsten Boden; denn wo einst Götter verehrt wurden, treiben Geister und Hexen ihr Wesen. Ganze Familien sind im Verdacht, Hexerei zu treiben. Von weit her werden die Hexenmeister besucht um Unholde zu bannen. In der Schlucht zwischen dem Farren- und Heuberge ist es nicht geheuer und gefährlich den Weg des Nachts zu gehen. Hier begegnet man Hexen und Kobolden und zuweilen einem Manne, der kein Herz, an dessen Statt aber ein Licht hat und den Kopf unter dem Arm trägt. Es ist diess eine merkwürdige Identifizirung Wuodans und Frô's für eine Stelle, wo ganz in der Nähe ein Licht- oder Sonnen-Kultus bestanden hat.
Wenn der Redefluss des Geistlichen, welcher in der Kapelle zu predigen hat ins Stocken gerathet. so sind die Leute fest überzeugt, dass die Jungfrau, welche von der Ruine Andeck herkommt ihm auf seinem Gang zur Kirche begegnet ist. Mehr noch als diese Begegnung ist die Sage verbreitet, dass noch ein Heide in der Kapelle sei, welcher dem Pfarrer die Predigt aus dem Kopf nehme. (106)
Theophil Rupps Buch „Aus der Vorzeit Reutlingens und seiner Umgebung“ (1864) ist einer der zahlreichen Versuche, mythologische Kombinationen auf heimatliche Namen und Überlieferungen anzuwenden. Selbstverständlich durfte darin ein Kapitel über die Belsener Kapelle nicht fehlen.
Unterhausen
Gang unter der Echaz
Unterhausen gegenüber, auf der rechten Thalseite, ragt das sogenannte Burgholz mit einem vorspringenden Felsen hervor, welcher der Burgerstein, Burgstein genannt wird, und nach Crusius einst eine Greifensteinische Burg trug. Unter demselben bemerkt man noch ein gemauertes Gewölbe, das tief in den Berg hineinführt, und der Sage nach mit einem, unter der Echaz durchgehenden unterirdischen Gang zusammenhängt. (107)
Unterirdische Gänge werden von den Leuten auch da vermutet, wo sie eigentlich unmöglich sind. Wenn alle diese Geschichten wahr wären, wäre ganz Deutschland von einem riesigen Höhlensystem durchlöchert. Man darf annehmen, dass es sich um dasjenige traditionelle Sagen-Motiv handelt, das heute noch am weitesten mündlich verbreitet ist.
Lichtenstein
Herzog Ulrichs Zuflucht
Gewiß ist aus diesem Wenigen schon ersichtlich, wie der Lichtenstein eigentlich der Glanzpunkt der Alppartie ist, die wir von Reutlingen aus angetreten haben; allein welchem Württemberger und Schwaben würde nicht, wenn er den Namen „Lichtenstein“ hört, unwillkürlich auch das Wort „Nebelhöhle“ oder „Nebelloch“, wie man es früher hieß, auf die Zunge kommen? Beide sind ja in der württembergischen Volkssage unzertrennlich, laut welcher Herzog Ulrich, als er sich von dem schwäbischen Bunde flüchtig im Lande herumtrieb, in der Nebelhöhle eine sichere Zuflucht gefunden habe und allda von dem nahem Lichtenstein aus mit Speise und Trank versehen worden sei! (108)
Wie hier Theodor Griesinger 1866 wusste schon Wilhelm Zimmermann 1836 von einer angeblichen „Volkssage“ vom Aufenthalt Ulrichs in der Nebelhöhle. Diese Überlieferung geht aber ganz auf den 1826 erschienenen Erfolgsroman „Lichtenstein“ von Wilhelm Hauff zurück. Dieses Buch war auch der Grund für die Erbauung des historistischen „Märchenschlosses“ Lichtenstein um 1840.
Während der Nebelhöhlen-Aufenthalt von Hauff erfunden wurde, gab es eine ältere Tradition über Herzog Ulrich und Schloss Lichtenstein. Schwabs Albbeschreibung, eine Quelle Hauffs, zitierte die Beschreibung des Schlosses Lichtenstein bei Martin Crusius am Ende des 16. Jahrhunderts. Diese lautet in der Übersetzung von Johann Jakob Moser:
Einen Stuck-Schuß weit von Holzelfingen, gegen Mittag sieht man das Schloß Lichtenstein, welches nicht groß ist und auf einem Felsen ligt, so daß die untere Zimmer in den Felsen gehauen sind. Dieses hat, wie man sagt, eine alte Edel-Frau erbauet; man weißt aber nicht, wer sie gewesen und zu welcher Zeit sie gelebt. Doch ist von alten Leuthen erzehlt worden, daß sie, da der Bau zu Ende war, gesagt habe: Nun bin ich GOttes Freundin, aber der gantzen Welt Feindin. Denn sie glaubte, sie sey nun wieder jedermann in demselben sicher. [...] Im obern Stockwerck ist eine überaus schöne Stuben oder Saal, rings herum mit Fenstern, aus welchen man biß an den Asperg sehen kan: Darinn hat der vertriebene Fürst, Ulrich von Würtemberg, öffters gewohnt, der des Nachts vor das Schloß kam, und nur sagte: Der Mann ist da; so wurde er eingelassen.
NACHWEISE
Zu den Abkürzungen:
http://archiv.twoday.net/stories/5401895/
(85) Schwab S. 73. Vgl. Graf, Schwabensagen; Wilhelm Kinkelin, Das Pfullinger Heimatbuch, 1956, S. 559. Deutung der Marktbrunnendarstellungen: Martin Fink/Ina Brandmaier, Pfullinger Sagen, 1987, S. 7f.
(86) Alexander Patuzzi, Schwäbische Sagen-Kronik, 1844, S. 30f. Vgl. Wilhelm Zimmermann, Gedichte, 1832, S. 170-173 (in der 2. Aufl. 1839, S. 245-249 ohne Ortsbezug unter dem Titel „Der verzauberte Schatz. Volkssage“); Birlinger II, S. 263: Mündlich.
(87) Haderthauer S. 139f. nach Schott II, Bl. 117-119v: Schmückle IX. 1847.
(88) Schwab S. 72f.
(89) Pfarrbeschreibung von Dietrich Friedrich Wilhelm Meyer (1828), Stadtarchiv Pfullingen B 1123, S. 40-43 (Ü). Vgl. Hermann Taigel, in: Pfullingen einst und jetzt, 1982, S. 110-113 (dort leicht gekürzt). Herrn Taigel danke ich auch hier für Unterstützung.
(90) Ludwig Bechstein, Deutsches Sagenbuch, 1853, S. 751f. Vgl. Meier S. 3-18.
(91) Haderthauer S. 138 nach Schott II, Bl. 112-112v: Schmückle VIII. 1846.
(92) Schott II, Bl. 108-110: Wanser VIII. 1847; Karl Bohnenberger, Volkstümliche Überlieferungen in Württemberg, 1980, S. 5 = Württembergische Jahrbücher 1904 I, S. 95. Vgl. Meier S. 3f.
(93) Schott II, Bl. 125-125v: Martens VIII. 1847. Ursenberg: Martin Fink/Ina Brandmaier, Pfullinger Sagen, 1987, S. 17.
(94) Haderthauer S. 148 nach Schott II, Bl. 145-145v: Carl Albert Zeller 26.12.1845.
(95) Haderthauer S. 140f. nach Schott II, Bl. 123-124v: Schmückle IX. 1847. Vgl. Martin Fink/Ina Brandmaier, Pfullinger Sagen, 1987, S. 49; KA Pfullingen; OAB Reutlingen, 1893, S. 159.
(96) Meier S. 224f.: Mündlich aus Pfullingen (Ü); KA Pfullingen. Vgl. HDA 2 (1930), Sp. 352-357.
(97) KA (Ü).
(98) KA (Ü).
(99) Meier S. 234f.: Mündlich aus Pfullingen.
(100) Paul Schwarz, Ludwig Uhlands Beziehungen zu Pfullingen, in: BllSAV 86 (1980), S. 115 nach der Pfarrbeschreibung Meyers (Ü). Vgl. Meier S. 345.
(101) Schwab S. 74. Vgl. Haderthauer S. 35; Meier S. 288f.; Martin Fink/Ina Brandmaier, Pfullinger Sagen, 1987, S. 19.
(102) Haderthauer S. 34 nach Staatsbibliothek Berlin, Nachl. Grimm 688 (Ü). Vgl. Schwab S. 79f.; Meier S. 344.
(103) KA (Ü).
(104) Meier S. 251: Mündlich aus Genkingen.
(105) Schwab S. 51, 300. Vgl. Meier S. 296-298.
(106) Theophil Rupp, Aus der Vorzeit Reutlingens und seiner Umgebung, 1864, S. 42f. (Ü)
(107) OAB Reutlingen, 1824, S. 127 (Ü). Vgl. Graf, Stuttgart, S. 18; Keith Thomas, Vergangenheit, Zukunft, Lebensalter, 1988, S. 37 (für England).
(108) Theodor Griesinger, Württemberg. Nach seiner Vergangenheit und Gegenwart in Land und Leuten, 1866, S. 169 (Ü); Martin Crusius, Schwäbische Chronick, Bd. 2, Frankfurt a. M. 1733, S. 426. Vgl. Max Schuster, Der geschichtliche Kern von Hauffs Lichtenstein, 1904, S. 9, 18-30; Hans Binder, Ein Fürst und ein Dichter begründen den Ruhm der Nebelhöhle, in: Abhandlungen zur Karst- und Höhlenkunde, Reihe A Heft 4,1969, S. 33-55, hier S. 47-51. Zum Schloss vgl. Barbara Potthast, Der Lichtenstein – ein Sehnsuchtsort des 19. Jahrhunderts, in: Kurzer Aufenthalt, 2007, S. 197-201.
 Urschel-Wandgemälde Wilhelm-Blos-Straße 2, Pfullingen
Urschel-Wandgemälde Wilhelm-Blos-Straße 2, Pfullingen
Archivversion dieses Eintrags:
http://www.webcitation.org/66SlMnkR9
Mehr zum Buch und weitere Auszüge:
http://archiv.twoday.net/stories/5401895/
Zu den Pfullinger Sagen ist künftig auch mein im Manuskript abgeschlossener Beitrag "Urschel, Nachtfräulein und andere Gespenster Überlieferungen und Sagen in Reutlingen und Pfullingen" (erscheint in: Reutlinger Geschichtsblätter) einschlägig.
Weitergeführt werden dort die Überlegungen in meinen "Schwabensagen" von 2007:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3459/
Zu den Texten siehe auch die Nachweise von Digitalisaten:
http://de.wikisource.org/wiki/Pfullingen
***
Pfullingen
Andres Mährchen
Wiederum erzählt die Sage, der Ursulenberg sey nur des Tages ein Berg, des Nachts aber eine Höhle, in der ein weiblicher Geist bei unendlichen Schätzen auf Erlösung harre. Einst habe ein Bürger von Pfullingen sich zu diesem Versuche entschlossen, und sey in der Nacht nach der Höhle gegangen. Dort erschien ihm der Geist in Gestalt einer Nonne, und lud ihn ein, mit ihm drei Nächte hintereinander zu speisen, ohne sich zu fürchten, und ohne einen Laut von sich zu geben. Dann werde der Geist erlöst seyn, der Mann aber den ungeheuren Schatz erheben. Die erste Nacht erschien der Geist in seiner gewöhnlichen Gestalt als Nonne; der Bürger schmauste ohne Furcht und Rede bei ihm. In der zweiten Nacht erschien aber statt der Nonne eine gräßliche Schlange vor dem wohlbesetzten Tisch, bäumte sich schwellend, und leckte zischend von dem Speisen. Der Mann überwand sein Grausen, und unterdrückte den Schrei des Entsetzens, der über seine Lippe wollte; des Morgens kehrte er zur Stadt und in sein Haus zurück. Als aber die dritte Nacht heran kam, die das Abentheuer enden sollte, da fand man ihn todt auf seinem Lager: der Schrecken der zweiten hatte ihn umgebracht. (85)
Niemand weiss, warum ausgerechnet Pfullingen, am Fuß der Alb gelegen, den reichsten Sagenbestand Schwabens aufweist. Am frühesten greifbar ist die Geschichte von der gescheiterten Erlösung der alten Urschel in diesem Text, der Gustav Schwabs Albführer 1823 entnommen ist. 1828 gab Pfarrer Friedrich Meyer Sagen in seiner handschriftlichen Pfarrbeschreibung wieder. Ernst Meier eröffnete mit 14 Pfullinger Sagen seine 1852 gedruckte Sammlung schwäbischer Sagen. Nicht weniger als zwölf Texte schrieben Schüler des Stuttgarter Gymnasiallehrers Albert Schott 1845/1847 auf. Einige sind hier erstmals ediert.
Der schwäbische Literat Hermann Kurz (1813-1873) arbeitete die Erlösungsgeschichte vom Urschelberg in seinen historischen Roman „Schiller's Heimatjahre“ (Stuttgart 1843) ein und hat dadurch wohl spätere Sagenversionen beeinflusst. Dank der gedruckten Fassungen kam es zu einem Austausch zwischen lebendiger mündlicher Überlieferung und schriftlicher Fixierung. Die Sagen kursierten in Pfullingen in unterschiedlichen Versionen. Der Heimatbuchautor Wilhelm Kinkelin beobachtete, dass „in bestimmten Familien die Sagen in einer bestimmten besonderen Weise erzählt werden. Mein Vater wußte alles so wie meine Mutter dem Inhalt nach genau, und doch immer wieder ein bißchen anders“.
Ernst Meier deutete die alte Urschel mythologisch, und über seine Sammlung ging sie in die internationale volkskundliche Literatur ein. In Pfullingen ist sie bis heute populär. Auf dem Pfullinger Marktbrunnen aus den 1950er Jahren ist sie mit anderen Sagengestalten dargestellt. 1999 gründete sich ein Narrenverein „Die Uschlaberghexa“.
Der Ursulaberg
In Pfullingen lebte vor vielen Jahren ein armer Taglöhner, der in der schweren Zeit außer Stand gesetzt war, sich, sein Weib und sein Kind zu ernähren, so daß sie oft bitteren Hunger leiden mußten. In einer Nacht, als seine Lieben schon lange neben ihm schliefen, wachte er noch kummervoll uund dachte daran, wie er sein trauriges Loos ändern könnte. Aber nirgend zeigte sich ihm ein Ausweg, und er war der Verzweiflung nahe. Von Sorgen erschöpft und halb betäubt, schlief er ein. Im Traume aber sah er den Ursulaberg vor sich, sah wie ein enger Spalt an demselben immer weiter wurde, und endlich als weites Gewölbe vor seinen Augen stand, die von dem angehäuften Golde und den Edelsteinen, von den reichen Schmucksachen, welche die Wände zierten, ganz geblendet waren. Unruhig erwachte er und theilte seinem Weibe den Vorsatz mit, in der nächsten Nacht den Berg zu besuchen, vielleicht, daß das Glück ihm mit einem Male günstig sei. Umsonst bat ihn sein Weib, das Vertrauen auf Gott nicht fahren zu lassen, wie dieser am besten wisse, was dem Menschen nütze.
In der kommenden Nacht ging der Arme hin, fand den Spalt, der sich auch öffnete, wie die nahe Thurmuhr anzeigte, daß es Mitternacht sei. Wie er es im Traume gesehen, so stand das Gewölbe vor seinen Blicken, nur daß sich in demselben noch eine Jungfrau von wunderbarer Schönheit befand, die ihn zu einer reichbesetzten Tafel führte, und ihn köstlich bewirthete. Als das Mahl geendet war, ergriff sie eine Laute und sang Lieder voller Liebesklage und Liebessehnsucht, ohne daß sie den Armen verführen wollte, der treu an seinem Weibe hing, und endlich die Jungfrau bat, daß sie ihm erlauben möge, etwas von den herrlichen Speisen nach Hause nehmen zu dürfen. Die Jungfrau aber füllte alle seine Taschen, so viel sie nur fassen konnten, mit Gold und Edelsteinen, worauf sie ihn an den Ausgang des Gewölbes führte. Die Morgensonne war eben im Aufgehen, und der Arme glaubte geträumt zu haben, als er umsah und keine Spur einer Oeffnung in dem Berge gewahr wurde. Aber die Schätze, welche ihn belasteten, überzeugten ihn von der Wirklichkeit des Erlebten. Voll Freude eilte er nach Hause, und sein Weib fiel auf die Kniee betend nieder, denn jetzt waren sie plötzlich reich geworden. Aber, wie leider der Besitz so häufig die Begierde nach Mehrbesitz erzeugt, und immer heftiger steigert, so geschah es auch hier. Der dem Hungertod so nah Gewesene konnte eines Reichthums nicht froh werden; beständig sah er die Schätze, welche in der Höhle zurückgeblieben, und dachte nur daran, sie auch zu erhalten und war entschlossen, sie mit Gewalt an sich zu reißen, wenn sie die Jungfrau nicht freiwillig hergeben würde.
Um diese zu zwingen, ging er mit einem Dolche bewaffnet in der kommenden Nacht zur Höhle, die er ganz so reich geschmückt fand, wie früher, nur daß an der Stelle der Schönen ein gräßlicher Drache lag, der ihn aus dem Gewölbe jagte und ihn den ganzen Berg hinab mit Gebrüll verfolgte.
Der Habgierige erreichte zwar unbeschädigt seine Wohnung, aber schon am nächsten Tage starb er an den Folgen des erlittenen Schreckens. (86)
Alexander Patuzzi bearbeitete in seiner Schwäbischen Sagen-Kronik (1844) offenkundig ein 1832 erschienenes sozialkritisches Gedicht des späteren Bauernkrieghistorikers Wilhelm Zimmermann (1807-1878): „Der Ursulenberg bei Pfullingen“. Patuzzi hat aber Zimmermanns Erlösungs-Motiv weggelassen: Im Gedicht erhält der Arme keine Schätze, er muss am nächsten Tag wiederkehren, um die Maid zu erlösen und lässt sich von dem Drachen verjagen.
Der Dreieichenweg auf dem Ursulaberg
Ein Bauer von Pfullingen, Namens Jakob Hättler, fuhr öfters mit einem Wagen in den Wald auf dem Ursulaberge, um dort Holz zu holen und durfte, während andere Bauern beim Herabfahren alle vier Räder an ihren Wagen sperren mußten, nie an seinen Wagen einen Radschu anlegen, weil ihm diß Geschäft jedesmal von einer Frau besorgt wurde. Eines Tags nun fuhr der Bauer, wie gewöhnlich, wieder in den Wald, verspätete sich aber, weil ihm ein böser Geist am Wagen etwas zerbrochen hatte, bis in die tiefe Nacht hinein, so daß er erst gegen 12 Uhr von demselben wieder abfahren konnte. Kaum hatte er einen kleinen Theil seines Wegs zurückgelegt, als es 12 schlug und plötzlich eine reichgekleidete Frau vor ihm stand, welche sich ihm als die Ursula, die in diesem Berge hause, zu erkennen gab und zu ihm sagte, daß nur er sie erlösen könnte. Nachdem sie ihn mit den zu der Erlösung nötigen Verhaltungsmaaßregeln näher bekannt gemacht hatte, zeigte sie ihm eine Öffnung, welche in den Berg hinein gieng, und gab ihm dann ein Schwert, ein Scepter und ein Kraut in die Hände. Hierauf stieg der Bauer in den Berg hinunter u. stieß dann bald auf eine Thüre, welche durch die Berührung mit seinem Kraute sogleich aufflog. Hier kam ein großer schwarzer Pudel mit feurigen Augen und mit einem langen Messer in der Pfote auf ihn zugesprungen, welcher sobald jener mit der Linken sein Scepter diesem entgegenhielt, ruhig stehen blieb, und sich durch des Bauern Schwert tödten ließ. Damit war es aber noch nicht genug, sondern er hatte noch zwei Ungeheuer, nemlich einen grimigen Löwen und eine furchtbar große Schlange umzubringen, was ihm zwar auch gelang, aber doch viel mehr Mühe kostete als die erste That. Sofort trat er noch durch eine zweite von ihm geöffnete Thüre, in einen äußerst prächtigen, mit Kostbarkeiten aller Art und einer Menge Goldes angefüllten Saal, wo er dann theils durch die glückliche Vollbringung freudetrunken, theils durch die Masse Kostbarkeiten geblendet, leider nicht mehr der Ursula gedachte, welche ihn vorher gewarnt hatte, nicht lange unter einer Thüre zu verweilen und nicht mehr von den Kostbarkeiten zu nehmen, als er zum Berge hinaustragen könne, sondern so viel mitnahm, daß er schon an der letzten Thüre Etwas von seinem Golde fallen ließ. Dadurch, daß er noch unter der Thüre stehen blieb und daß die Thüre plötzlich zuknarrte, hatte er das Unglück, um beide Fersen zu kommen. Auf der Oberfläche des Berges angekommen, erschien ihm wieder mit bleichem und von Jammer verzerrtem Aussehen die Ursula mit 3 Eicheln, u. sagte ihm, indem sie diese fallen ließ, sie müße von jetzt an so lange in dem Berge herumschweben, bis diese 3 Eicheln zu 3 vollständigen Eichen emporgewachsen und dann wieder abgestorben seien. Nach diesen Worten verschwand sie wieder und der Bauer fuhr vollends mit seinem Wagen, den er noch angetroffen hatte, nach Hause, starb aber bald darauf. Es stehen nun wirklich 3 Eichen auf dem Ursulaberge, von welchen die Sage geht, daß sie in Folge von der Nichterlösung der Ursula entstanden seien. (87)
In der Fassung der Erlösungs-Geschichte des Stuttgarter Gymnasiasten Schmückle (1847) sind die magischen Hilfsmittel des Bauern vermutlich dem Motivbestand der Märchen entnommen.
Die Feien des Ursulenberges
Wenn die Nebel Schleier weben.
Um Gebirg und Flur,
Regt in der Natur
Sich ein anderes Leben.
Aus den Blumen, die sich neigen
In der Erde Kluft
Vor des Winters Luft,
Ihre Seelen steigen.
Anzuschaun wie zarte Weiber
Schweben sie heraus
Aus des Berges Haus,
Jungfräuliche Leiber.
Mit dem Blau der Genziane,
Mit der Lilie Glanz,
Mit des Rosenbrands
Gluthen angethane.
Flattern, wenn sie Lichter sehen,
In die Hüten, wo
Spinnerinnen froh
Seidne Fäden drehen.
Setzen an der Mägde Kunkel,
Luft’ge Gäste, sich,
Spinnen emsiglich
Durch der Nächte Dunkel
Und von ihren Lippen wallen
Worte leicht und leis,
Goldner Sagen Preis,
Die behagen Allen.
Von des Berges tiefen Spalten,
Wo in ew’ger Nacht
In dem kühlen Schacht
Blumen Hochzeit halten.
Von der Erdengeister Treiben,
Fürstlichem Geschlecht,
Und von Gnom und Knecht,
Und von Wasserweiben.
Und die Spindel rollet Allen
Lustig durch die Hand,
Bis daß an der Wand
Morgenlichter wallen.
Da entschlüpfen schnell die Frauen:
An des Bergs Gestein
Sind die seel’gen Fei’n
Nebeln gleich zu schauen.
Doch der Flachs ist abgesponnen,
Und die Spindel ruht,
Und ein zehnfach Gut
Jede hat gewonnen. (88)
Autor dieses Gedichtes ist Gustav Schwab, der es im Taschenbuch „Urania“ auf das Jahr 1823 veröffentlichte und es später auch in seine „Neckarseite der Schwäbischen Alb“ (1823) aufnahm.
Die Nachtfräulein und die alte Urschel
Noch bey zwey erst vor wenigen Jahren verstorbenen Frauen, ins Keßlers Haus auf Wiel, und beym Wielweber, fanden sich regelmäßig an jedem stillen Winterabende zwey Nachtfräulein ein, kleine, zierliche, wunderschöne Gestalten, schneeweiß angethan und glänzend in Gesicht und Kleidern, wie der funkelnde Schnee. Sie spannen an der Weiber Kunkeln die feinsten Fäden hurtig und flink, gegen die Menschen schweigsam, nur unter sich zuweilen einige Worte in kindischer Aussprache wechselnd. Wenn der Morgen graute, giengen sie davon und man sah ihr Laternchen bis in die Gegend des Nachtfräuleinloches; dann war auf einmal Alles verschwunden. Der Flachs indeß war abgesponnen, wie groß die Kunkeln auch gewesen waren.
Als Ursache ihres Ausbleibens wird erzählt: der Wielweber hatte einst Fruchtmangel und klagte diese Noth seinem Weibe, als eben die Nachtfräulein da waren. Da öffnete die eine von ihnen den zierlichen Mund und bot ihm Frucht an, so viel er begehre, jedoch auf Wiedererstattung. Nur dürfe die zurük zu gebende ja nicht am Sonntag gedroschen seyn. Abends standen zwei schneeweiße Säke voll herrlicher Frucht an der Treppe, wußte Niemand, wie sie hergekommen seyn mochten. Den Ersatz des Darlehens stellte der Wielweber in denselben Säken wieder an die Treppe hin. Da blieb er Tage und Wochen unberührt stehen. Endlich kam die eine von den Nachtfräulein und bitterlich weinend jammerte sie: die Frucht sey am Sonntag gedroschen; sie könne nun nimmer zu den Menschen kommen, die sie betrogen. Sie verschwand und man hat seitdem nichts mehr von beiden gesehen. Der Segen wich mit ihnen aus dem Hause. Die Frucht war am Samstags von dem Wielweber gedroschen, und, um zu sehen, was daraus erfolgen möge, hatte er damit bis Nachts nach 12 Uhr fortgemacht.
In dieser Sage finden wir unverkennbar die freundlichen Elfen der Vorzeit, deren Erscheinen die Volkssage von einem Geschlecht zum andern bis in die nächste Vergangenheit herüberzieht. Auch die tückischen Alfe (Gnomen) fehlen nicht; nur identificirt sie die Sage mit jenen und nennt auch diese: Nachtfräulein.
In eine Grube am Ursulaberge, sie ist eben das sogenannte Nachtfräuleinsloch, wirft noch ein Jeder, der vorüber geht, einen Stein, und doch wird sie nie ausgefüllt. Wer dieses Opfer nicht bringt, dem legen die Nachtfräulein einen Stein so in den Weg, daß er darüber durchaus fallen muß, oder sie spielen ihm auf irgend eine andere Weise einen argen Streich.
Das Schloß auf dem Ursulaberge soll mit unendlichen Schäzen versunken seyn. Die Bergsage, die alte Urschel, suche noch, als Steingeist diejenigen, die bey Nacht über die Steinge gehn, zu blenden, und nach dem Ursulaberge hin zu verführen, damit sie diese Schäze haben, und damit sie gleich zu erlösen.
Eine ältere Sage erzählt: Ein junger Geselle gieng einst mit seinen Eltern auf ein Feld am Ursulaberge, um Kartoffeln zu holen. Die abgeschirrten Pferde ließen sie einstweilen weiden. Sie nachher auf dem Berge wiedersuchend, findet dort der Geselle ein neues Pferdekummet, nimmt und sezt sichs, wie es der Brauch ist, auf beyde Schultern, den Kopf zwischend durchstekend. Da sieht er augenbliks die alte Urschel vor sich stehn, im grünen Rok, mit rothen Strümpfen. Ich und noch Jemand, spricht sie, freuen uns, daß du endlich kommen bist. Wir warten hier schon Jahrhunderte auf Erlösung durch dich. Dann führt sie ihm zu Gemüthe, wie sie, mit unendlichem Sehnen, des Baumes (ein Baum zu gleicher Bestimmung soll eben jezt wieder auf dem Ursulaberge stehn und von der alten Urschel gehegt und gepflegt werden), daraus man seine Wiege gemacht, Keimen und Wachsen belauscht und betrieben und Minuten, Jahre und Jahrhunderte gezählt habe, bis er endlich gehauen ward. Sie habe ihn in dieser Wiege gepflegt und vor den Nachstellungen ihres Feindes geschirmt, und jezt sey die Zeit für ihn gekommen, dankbar dafür zu seyn und sie zu erlösen, was einzig ihm möglich sey. Sie hüte unermeßliche Schäze. (Auch auf der Achalm sollen von 2 Pudeln unendliche Reichthümer gehütet werden.) Die wolle sie alle ihm geben und einen noch tausendmal köstlichern Schaz, wenn er sie erlöse. Sie werde ihn durch einen allen andern Menschen unsichtbaren Eingang in den innern Berg führen. Dort stehe jezt das alte herrliche Schloß, das vordem auf dem Berge stand. Dort werde aber eine Schlange, furchtbar anzusehen, ihm auf das Herz losfahren. Die solle er jedoch nur herzhaft in die Arme schließen und fest an sein Herz drüken. Dann werde er das schönste Weib der Welt in seinen Armen finden. Dann sey der Fluch gelöst. Das alte Schloß werde von neuem ans Licht des Tages heraufsteigen und er mit seinem Schaz in solchem Schloße all dessen goldene Schäze theilen. Mit noch viel andern verführerischen Worten suchte sie ihn zu berüken. Er aber, als ein frommer Jüngling, betete zu Gott im Stillen: Vater Unser da war urplözlich die Urschel verschwunden. Nachher erschien sie ihm indeß noch zu verschiedenen Malen und suchte ihn mit gar beweglichen Worten dahin zu bringen, daß er ihr zu Willen seyn möchte. Er wiederstand jedoch kräftig jeder Versuchung, zumal da ihm die alte Urschel nicht einmal gestatten wollte, seine Eltern zu dem Abentheuer mitzunehmen. Sie sollten höchstens bis an den Eingang des Berges mitgehn dürfen.
Einst kam der junge Geselle mit andern Kammeraden wieder an den Ursulaberg. Auch da erschien die alte Urschel wieder und drohte ihm nun, daß es sein junges Leben gelte, wenn er nach ihrem Begehren nicht thue. Die andern aber sahen nichts und hörten nichts von ihr. Da sagt’ er es endlich ihr zu. Doch fragt er vorher noch den Geistlichen, der sein Beichtvater war, um Rath; der aber hielt dafür, daß eine einmal verfluchte Seele durchaus nicht erlöst werden dürfe. Dies führte er noch in einer Predigt, die er am nächsten Sonntag hielt, des Weitern aus, und schloß damit, das Ganze sey ein Teufelsspuk, die arme Seele dieses frommen Jünglings zu verderben. Die ältesten Leute wollen von ihren Eltern wissen, daß diese die besagte Predigt angehört haben. Nach Jahr und Tagen gieng darauf der junge Geselle mit seinen Eltern einmal wieder auf den Aker am Ursulaberg, um Kartoffeln zu holen. Sie hatten wieder ihre Pferde bey sich, von denen eines das gefundene Kummet anhatte. Da erschien ihm denn die alte Urschel, ungesehen von seinen Eltern, wieder, schalt ihn heftig aus, daß er dem Pfarrer von ihr gesagt, und fiel dann wieder in ihr altes Jammern, daß, wenn er sie nicht erlöse, sie noch Jahrhunderte zu leiden habe. So geschieht dies eben recht, gab ihr der junge Geselle zur Antwort, wer einmal verflucht ist, ist ewig verflucht. Solche Rede hörten seine Eltern und merkten daraus, daß er mit der Urschel rede, von deren Worten sie jedoch nichts vernommen hatten. Bald aber sahn sie ihre furchtbare Rache. Ihr Kind fiel plötzlich todt vor ihren Augen nieder, die alte Urschel hatte ihn erwürgt; das gefundene Kummet verschwand. – Von dieser Geschichte sollen die Aeker hinter dem Ursulaberge den Namen haben: Mordios-Aeker.
b) Auf dem Uebersberge soll ehedem oberhalb ein Schloß gestanden seyn. Noch dröhnt es dumpf und hohl aus der Erde herauf, wenn man nicht weit vom Mädchenfelsen hart auftritt. Dort sollen von dem verfallenen Schloße noch die Keller seyn. Es mögen indeß, wohl natürliche Felsenhöhlen seyn.
Mädchenfelsen oder Dorotheen-Felsen heißt die vorspringende Felsenstirn des Uebersberges. Die Sage über den Ursprung dieses Namens erzählt: eine fromme Jungfrau, von einem bösen Jäger verfolgt, kommt an die steile Felsenwand, und wagt in Gottes Namen, betend: Der Herr wird seinen Engeln über dir Befehl thun, daß sie dich auf ihren Händen tragen, den Sprung die schwindelnde Höhe hinab und wird wunderbar erhalten. Der nachspringende Verfolger zerschellt an den Felsen. (89)
Der Sagenabschnitt aus der umfangreichen handschriftlichen Pfarrchronik (1828) von Friedrich Meyer (1794-1848), seit 1820 in Pfullingen als protestantischer Geistlicher tätig, wird hier erstmals vollständig abgedruckt. Meyer war Ludwig Uhlands Schwager und ein Freund von Gustav Schwab.
Vom Urschelberg
Ueber Pfullingen erhebt sich ein Berg, der Urschelberg genannt. Wie sein Name an den Hörseelenberg (vom Volke Hörschelberg gesprochen), in Thüringen erinnert, so hat er auch an einem Abhang, der das Hörnle heißt, gleich jenem, der unter seinem, Eisenach zugestrecktem Horn eine Höhle hat, das Hörselloch - ebenfalls eine solche, die bei den Umwohnern das Nachtfräuleinsloch genannt wird.
Gleich der Frau Holle, der alten Spinnefrau im Hörseelenberge (Sage Nr. 459 und 757), wohnt die alte Urschel als Spinnerin im Urschelberge, und ist des Berges ganze Umgegend mit Sagen über sie erfüllt. Ein Theil dieser Sagen deutet darauf hin, daß die Urschel gleich andern wandernden Jungfrauen aus verwünschten oder versunkenen Schlössern (zwei Schlösser sollen auf dem Urschelberge versunken sein), auf Erlösung harre, die auf einer Eichel, deren erwachsen zum Baume, auf das fertigen einer Wiege aus diesem Baume, und auf einem darin gewiegten Sonntagskinde beruht - der hoffenden aber stets fehl geschlagen, weil der erkorene Gesell, der sie durch ein aufgefundenes Pferdekummt sichtbar geschaut, nicht Muth genug gehabt, das Werk der Erlösung zu vollführen. Nach andern war es keine Eiche, sondern eine von der Urschel selbst gepflanzte Buche, aus welcher die Wiege gefertigt wurde, und noch immer soll eine solche Buche auf dem Urschelberge stehen und von ihr gehüthet werden. Anderntheils deuten die Urschelsagen rein auf sie als Spinnefrau. Wie die Berchtha im Voigtlande ihr Gefolge hat von Heimchen, hat die Urschel eines von Nachtfräulein, nur nicht so zahlreich, meist nur auf die Dreizahl beschränkt. In deren Begleitung kam sie nach Pfullingen „auf Wiel," eine also genannte Häuserreihe, an welche die Heergasse (Sage Nr. 918) vorüberführt - leise Hindeutung auf die Urschel auch als wilde Jagdfrau - in die Lichtkarz, und spannen allda sehr fleißig. Einst machte sich aber ein Bursche den Scherz, einem der Nachtfräulein den Faden abzubrechen, und wollte nach der üblichen Sitte, indem er den Rocken nahm, diesen mit einem Kuß ausgelöst haben - das nahmen die Urschel und die Nachtfräulein sehr übel, nahmen ihre Spindeln, gingen von dannen und kamen nie wieder in dieses Haus. Von dem Hause aber wich seitdem aller Segen. Sie besuchten dagegen bisweilen andere Häuser, und spannen nicht allein für sich, sondern auch für die Frauen, die sie besuchten, und spannen deren Kunkeln ganz leer, und alle Spindeln voll, und den feinsten Faden, den es geben konnte, spannen sie, und wann sie gingen, sah man ihre schloßschleierweißen Kleider beim Schein ihres Laternchens bis nahe an das Nachtfräuleinsloch am Urschelberge leuchten. In Reutlingen heißen sie Bergfräulein, weil sie im Urschelberge wohnen, da sollen sie ihren Aus- und Eingang, wenn sie auch dorthin zum Spinnen kamen, mitten auf dem Markt gehabt haben. So ganz ledigen Standes müssen aber die Urschelbergerinnen doch nicht gelebt haben, denn es sind Sagen von in den Berg geholten Hebammen vorhanden, welche mit Strohhalmen belohnt wurden, von denen sich die in Goldstangen und Goldstücke verwandelten, die nicht verächtlich weggeworfen worden waren. (90)
Ludwig Bechstein, der vor allem durch seine Märchensammlung bekannte Thüringer Autor, arbeitete gern Parallelen in die Texte seines Deutschen Sagenbuchs von 1853 ein. Hier gibt er eine Zusammenfassung der verschiedenen Urschelberg-Sagen aus der kurz zuvor erschienenen Sammlung von Ernst Meier (1852).
Der Ursulaberg (Urschelberg) bei Pfullingen
Unweit Pfullingen ragt auf dem Alpgebirge unter andern ein ziemlich hoher Berg hervor, welcher von alter Zeit her nach der unter den dortigen Bewohnern noch gehenden Sage, seine Benennung von einer gewissen Feenkönigin, Ursula genannt, erhalten haben soll.
Diese Ursula war, nach der Aussage, keine von den bösartigen Feen, sondern im Gegentheil eine sehr wohlthätige und machte öfters unter den Leuten von Pfullingen und den umliegenden Ortschaften Besuche, wenn sie Nachts mit dem Spinnen beschäftigt waren, wo sie dann auch meistens mitgesponnen und ihnen mit ihren Weissagungen nützliche Dienste erwiesen hat; so kündigte sie z. B. an, wenn ein gutes oder ein schlechtes Flachsjahr kommen werde. Zuweilen kamen auch noch einige andere Feen, welche ihr unterthänig waren, mit ihr. In diesem Ursulaberge hatte sie ein prächtiges Schloß und darinn Ueberfluß von Gold und Silber, wovon sie fast jedesmal bei ihrem Besuche einen bestimmten Theil je nach Umständen ausgetheilt hat. Auf dem Gipfel des Berges befindet sich ein sehr tiefes Loch, aus welchem Ursula herausgestiegen ist, und von wo aus man oft einen wunderbar schönen Gesang gehört hat. (91)
Aufgezeichnet von dem Gymnasiasten Schmückle 1846.
Die versiegte Quelle der Ursula
Als ich im vergangenen Spätjahre mich zu Pfullingen aufhielt, besuchte ich auch die Berge der Umgegend, von denen aus man eine schöne und weite Aussicht genießen konnte. Als einen solchen Punkt rühmte man mir auch den Jungfrauenfelsen. Der Weg dahin, den ich in Begleitung eines Bauern machte, führte uns über den Ursulaberg, der ringsum mit einem schönen Grün bekleidet ist. Um so mehr fiel mir eine Stelle neben dem Wege auf, die ganz mit Steinen bedekt war, welche absichtlich hingeworfen zu sein schienen. Diese meine Vermuthung bestätigte sich, indem mein Begleiter einen Stein auf dem Wege aufhob, und ihn mit den Worten: "da, Ursula!" auf die Stelle hinwarf. Zugleich forderte er mich auf, dasselbe zu thun. Lachend warf ich einen Stein hin und fragte den Bauern dann um die Ursache seiner sonderbaren Handlung. "Ja, antwortete er, dazu haben wir unsere guten Gründe, da Ihr aber die Sache nicht zu wissen scheint, will ich sie Euch erzählen: Hier an dieser Stelle war früher ein Loch, in dem sich eine schöne Quelle befand. Neben der Quelle saß gewöhnlich so ein Bergfräulein, Namens Ursula, welcher der ganze Berg gehörte. Wer nun ihr Gebiet betrat, mußte ihr etwas, woran er gerade Überfluß hatte, vor oder in ihr Loch werfen, sonst zog sie die Vorübergehenden hinein oder ließ ihnen auf dem Wege ein Unglück zustoßen. Weil nun aber wir Bauern an Steinen immer den größten Ueberfluß haben, werfen wir gewöhnlich der Ursula statt einer Gabe nur einen Stein hin. Vielleicht nun wäre ihr etwas Anderes lieber gewesen, oder fürchtete sie, von den Steinen, die in ihr Loch fielen, getroffen zu werden; kurzum sie ließ sich von da an auf dem Berg nicht mehr sehen, nahm uns aber auch dafür die Quelle mit. Dennoch unterlassen wir nicht ihr diese Steine zu schenken, da auch jezt noch gewöhnlich dem, der diese Sitte vernachlässigt, die Ursula etwas, wäre es auch nur ein Regen oder Gewitter, auf den Hals schickt. (92)
Der Stuttgarter Gymnasiast Wanser wusste 1847 von einem „Opfer“-Ritual, das in anderer Form in der Nr. 1 der Sagensammlung Ernst Meiers „Das Opfer für die alte Urschel“ erscheint. Meier zufolge legten am Remselesstein Pfullinger Kinder durchlöcherte Hornknöpfe, die „Remsele“ hießen, als Opfer nieder. Um 1900 wurde dieser angebliche Opferbrauch als Kinderspiel berichtet. Die Buben spielten auf dem Weg zum Berg auf dem Remselesstein:
Man warf die Remsele in die Höhe und je nach Lage, in der sie auf den Stein zu liegen kamen, fielen sie der einen oder anderen der spielenden Parteien zu. So spielte man der Urschel zuliebe, damit einem im Walde nichts zustoße, der Urschel übergab man aber die Remsele nicht, auch nannte man das Spiel nicht Opfer.
Die auch andernorts im 19. Jahrhundert belegten „Opferbräuche“ lassen sich zwar nicht sicher deuten, aber es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass es sich um uralte heidnische Traditionen handelt, wie man im 19. Jahrhundert vermutete.
Das versunkene Kloster Ursulenberg
Über den Ursulaberg bei Pfullingen ist folgende Sage im Umlauf, als deren Gewährsmann ich einen alten Pfullinger anführen kann. Dort soll einst ein Kloster der heiligen Ursula gestanden sein, dessen Nonnen sich nur des Tags mit geistlichen Dingen beschäftigten, Nachts jedoch allerlei Zauberei trieben. Deshalb wurden sie in der Umgegend theils als Wunderthäterinnen gepriesen, theils als Hexen verrufen. Dieser letztern Ansicht war auch der Schutzherr des Klosters und er wollte es daher bei Nacht zerstören. Da sich aber die Nonnen in allerlei Gestalten verwandelten, um ihm zu entgehen, rief er erzürnt aus: "Der Teufel möge euch und euer Kloster verschlingen!" Dieser Wunsch gefiel dem Bösen und er ließ den Berg mit Allem, was darauf war, in den Boden versinken. Da aber der Geist der Finsterniß nur des Nachts Macht hat, konnte er nicht verhindern, daß am nächsten Morgen der Berg sich wieder erhob, wiewohl ohne Kloster, das durch Zauberei entweiht, ganz in den Händen des Teufels war. Und auch jetzt noch soll an der Stelle, wo des Tags der Berg steht, Nachts ein Abgrund gähnen, in dessen Tiefe die Klosterschätze liegen. (93)
So der Stuttgarter Gymnasiast Martens 1847. Ein Kloster stand nie auf dem Ursulaberg, der 1370 erstmals als „Ursenberg“ bezeugt ist.
Die Nixe von der Echatz. Eine Sage
Nicht weit von dem Fußwege, welcher an der Echatz hin von Reutlingen nach Pfullingen führt befindet sich ein schöner Wasserfall, der sich einen nach der Sage unergründlichen Kessel gehöhlt hat.
Folgende Sage geht über denselben im Munde des Volks.
Vor grauen Zeiten kam jeden Abend eine Jungfrau, die dem Strudel des Wasserfalls entstiegen war in die Spinnstube (Karz) nach Pfullingen. Die Jungfrau erzählte schöne Mährchen und sang während des Spinnens liebliche Lieder. Dadurch wurde allen der Abend erheitert, allein mit dem 10ten Stundenschlag kehrte sie eiligst in den Strudel zurück.
Bald liebte sie der Sohn des Meßners, der ebenfalls den Karz besuchte, unaussprechlich, allein auch dieser vermochte sie nie [zu bewegen], länger, als bis 10 Uhr zu bleiben.
Seine Sehnsucht war so groß, daß er oft bey Tag an den Wasserfall gieng und denselben ganze Stunden anstarrte.
Das Nahen des Frühlings machte ihn noch trauriger, da mit Frühlingsanfang der Karz zu Ende gieng. Jede Minute, die er bey ihr zubrachte, war ihm daher kostbar, er sann auf eine List und glaubte sie darin gefunden zu haben, daß er die Kirchenuhr um Eine Stunde zurückrichtete. Dadurch gelang es ihm, daß sie sich erst entfernte, als es 10 Uhr schlug.
Die Echatz brauste zerstörend durchs Thal, als der Jüngling erwachte, vom nahen Ursulaberge her tönten Seufzer, aus welchem Laute wie Todesschmerzen schoßen und auf welchem ein schauriger Blutfleck schwamm. Aus Verzweiflung stürzte sich der Jüngling in den Strudel aus welchem die Jungfrau nie mehr zurückkehrte. (94)
Carl Albert Zeller hielt diese Sage für seinen Lehrer Albert Schott 1845 fest.
Der Haule im Sörgenthal
Es mögen schon sehr viele Jahre verflossen seyn, seitdem in Pfullingen ein Mezger, Namens Haule, lebte, welcher durch Leichtsinn und Verschwendung seines ziemlich grossen Vermögens so weit herabgekommen war, daß er darben mußte. Anstatt daß er nun getrachtet hätte, durch Arbeit sein Brod zu verdienen, gieng er mit mörderischen Gedanken um, und machte sich eines Tags auf den Weg in einen naheliegenden Wald, durch den ein Bauer, welcher viel Geld bei sich trug, kommen mußte, um denselben zu ermorden. Als dieser an ihm vorüber war, schlich er ihm leise nach, brachte ihm von hinten mit einem Knittel einen Hieb bei, daß er sogleich todt zu Boden stürzte und eilte dann mit diesem Geld nach Hause, welches bald aufgebraucht war. Alsbald nach dem Morde wachte in ihm sein Gewissen auf und ließ ihm keine Ruhe mehr, bis er sich in seinem Hause aufhenkte. Er hinterließ ein Weib und einige Kinder, welche durch die Noth gezwungen wurden, ihr Haus zu verkaufen. Der neue Hausbesitzer und seine ganze Familie wurde jede Nacht durch ein unheimliches Winzeln und starkes Poltern und Rasseln im Schlafe gestört, das Gesinde blieb nicht mehr und streute in der Stadt das Gerücht aus, daß es in dem Hause spucke, weil sich darin der Haule erhenkt habe. Als die Unruhe in dem Hause nicht aufhörte, sondern nur noch zunahm, ließ der Hauseigenthümer aus der Umgegend von Pfullingen einen Geisterbeschwörer komen, welcher den Geist in ein Fläschgen bannte und in eine Schlucht des Sörgenthals trug. Von jetzt an war die Ruhe in dem Hause wiederhergestellt, allein in dem Sörgenthal wurde es nach einiger Zeit um so lebhafter, obschon man niemals daselbst etwas gesehen oder gehört hatte. Es fand nemlich ein Schnitter das Fläschchen, von welchem er sogleich den Stöpsel wegthat um zu sehen, ob etwas darin enthalten sei; aber kaum war derselbe weg, so wurde plötzlich ein starkes Geräusch hörbar, und es trabte an ihm ein Mann auf einem Schimmel vorbei, welcher immer "hup hup" schrie. Sehr viele Leute wollen von der Zeit an den Reiter bei Nacht gesehen und hup hup rufen gehört haben, auch soll man, wenn man an diesem Thale vorbei komme, sehr gerne darin verirren und Ohrfeigen bekommen. (95)
Der Stuttgarter Gymnasiast Schmückle schrieb diese Geschichte 1847 nieder. Noch heute ist dieser Geist, der Haule vom Serchental, in Pfullingen bekannt, glaubt man den „Pfullinger Sagen“ von 1987. Als Übereinstimmungen sind zu registrieren: Der Haule habe einen Fremden umgebracht und reite meist auf einem Schimmel. Die anderen Motive aus Schmückles Version sind nicht mehr bekannt, andere sind an ihre Stelle getreten. Im Pfullinger Konferenzaufsatz des Schullehrers Schäf (1900) heißt es zu dieser Sagengestalt:
Vor wenigen Monaten starb hier eine Frau, die nicht nur fest an ihn glaubte, sondern ihn auch öfters gesehen hatte.Einmal fuhr sie mit anderen bei Nacht auf einem Leiterwagen von einer Hochzeit in Gönningen her. Im „Serchenthal“ sah sie den Haule, wie er sich mit einer Hand am hinteren Ende des Wagens hielt und diesem nachlief, während er in der anderen Hand seinen Kopf trug. Ein andermal wollte dieselbe Frau, vom Heuen auf den Holzwiesen ermüdet, ein Mittagsschläfchen machen. Der Haule ließ sie aber nicht dazu kommen und störte sie immer wieder durch Zupfen an ihrem Kleide. Von da an ging die Frau nie mehr in jene Gegend.
Weißes Schwein geht um
In mehren Gassen von Pfullingen läuft um Weihnachten ein kleines weißes Schweinchen um. Es begegnet namentlich solchen, die auf verbotenen Wegen gehen. So wollte einmal ein Bursch zu einem Mädchen durchs Fenster steigen; allein das Schwein litt es nicht. Ebenso gieng es ihm am folgenden Abend. Schon oft hat man versucht, es zu fangen, hat es umstellt und eingeschloßen; aber es verschwand jedesmal den Leuten unter den Händen. (96)
Von den gespenstischen „Dorftieren“ wusste man in allen Gegenden Deutschlands zu erzählen. Im Pfullinger Konferenzaufsatz von 1900 liest man:
Vom 1. Advent bis zum Erscheinungsfest läßt sich bei Nacht in den Straßen, namentlich in der Heergasse ein "Säule" sehen, dessen ganze Thätigkeit im Umherspringen besteht. Am häufigsten ist`s um 12 Uhr zu sehen. Auch auf dem Kunstmühleweg (5 Min. vor der Stadt) soll es zu sehen sein.
Geist bringt Radfahrer zu Fall
An der Arbachbrücke (zwischen hier und Reutlingen) soll ebenfalls ein Geist zu sehen sein, der es als fortschrittlicher Geist auf die Radfahrer abgesehen hat, die er zu Fall bringt, indem er ihnen die Luft aus den Reifen zieht. (97)
So der Konferenzaufsatz von 1900, aus dem auch der nächste Text stammt.
Kröte in der Pfarrkirche
Im Jahr 1889 wurde die hiesige Kirche umgebaut. Als man den Staffeltritt im Chor wegnahm, sei eine große Kröte darunter gewesen, die dann in den benachbarten Hirschgarten hüpfte. (98)
Im Mondschein soll man nicht arbeiten
In Pfullingen spann einmal eine Frau noch um Mitternacht bei Mondschein, um Oel zu sparen. Da trat ein nackter Mann herein und bot ihr den Hintern hin und sagte, daß sie ihn kratzen solle, was sie in der Angst denn auch that. Darauf gieng er fort. Die Frau begab sich dann zu Bett und erzählte noch ihrem Manne die Geschichte. In der folgenden Nacht blieb der Mann auf, um zu sehen, was geschehen würde, und hechelte Flachs beim Mondschein. Da erschien wieder der nackte Mann; als er aber seinen Hintern herhielt, um sich kratzen zu laßen, da nahm der Andere die Hechel in die Hand und kratzte ihn damit recht ordentlich, worauf der nackte Mann fortgegangen und nicht wieder gekommen ist. (99)
Die Glockenhöhle
Ganz in der Nähe desselben Weilers [Breitenbach] befand sich ehedem die Glockenhöhle, darin es, wenn einer redet, wie eine Glocke klingt. Sie findet sich nimmer, wie sorgfältig ich auch gesucht habe. (100)
Am 20. Juni 1834 schrieb Ludwig Uhland sein Gedicht „Die Glockenhöhle“ nieder. Inspiriert wurde er von dieser Passage aus der Pfarrbeschreibung seines Schwagers Meyer. In einer Beschreibung des Blauhofs von 1572 wird ein Markstein genannt, „so in die Klingen- und Glockenhöhle hinabsteht“.
Sage vom Mägdleinsfelsen
Die Sage vom Mägdleinsfels ist dieselbe, die sich in allen Gebirgen Deutschlands bei ähnlichen Felsenvorsprüngen wiederholt: es ist die der Riesentrappe, des Jungfernsprungs und andrer Stellen: Ein Jäger, der ein schönes Mägdlein verfolgt, und sie auf die Spitze des Felsen treibt, wo sie nicht weiter kann. Sie stürzt sich betend hinab; aber sie wird von unsichtbaren Händen getragen, und ihr wiederfährt kein Leid, Der Jäger springt ihr nach, und findet in der Tiefe zerschmettert seinen Tod. (101)
So Gustav Schwab 1823. Er kannte diese Überlieferung bereits 1816. Ernst Meier ergänzte 1852, man sage auch, diese Jungfrau sei eins von den Nachtfräulein des Urschelberges gewesen. Der „Mädchenstein“ erscheint 1521 als „Metlinstein“.
Eningen unter Achalm
Ursprung des Namens Achalm
Die von mir poetisch bearbeitete Sage vom Ursprung des Namens der Burg Achalm (s. Morgenbl. März 1815), wo ich nur aus Versehen einen Pfeilschuß statt des sagengemässen Schwertstosses (den Uhland in seinem Eberhard dem Greiner s. dessen Gedichte beibehalten) gesetzt habe, wird auch anders und prosaischer so erzählt: Ein Kaiser habe den hohen und steilen Berg bestiegen, und unterwegens in der Ermattung ausrufen wollen: ach allmächtiger Gott! Wobei ihm der Athem ausgegangen, und er nur Ach allm- hervorgebracht.
Derselbe spitze und isolierte Berg auf dem die Ruinen von Achalm stehen, soll zu seinem Fusse unter der Erde mit einer goldenen Kette umflochten seyn; weswegen die Bauern da schon öfters Schatzgräbereien angestellt. (102)
Dies teilte Gustav Schwab Wilhelm Grimm im Rahmen einer kleinen Sagensammlung am 20. Oktober 1816 mit. Er hatte die Texte überwiegend aus der Beschreibung Württembergs von Johann Martin Rebstock (1699) exzerpiert.
Gespenster und umgehende Tote
Die Lage Eningens am Fuße der Alb, wo die Sagen „reicher fließen“ (Oberamtsbeschreibung von Reutlingen von 1893, Seite 152), und die kühngeformten Berge der prächtigen Umgebung schon von alten Zeiten her mächtig auf das Gemüt und die Phantasie eingewirkt haben, sowie das lebhafte und bewegte Naturell der Eninger, das sich für Neues leicht, wenn auch nicht gerade nachhaltig tief erregen läßt, endlich der Umstand, daß viele Kauf- und Handelsleute („Eninger Krämer“) fast in allen Städten und Dörfern des In- und Auslandes verkehrten - diese drei Punkte bringen es mit sich, daß an volkstümlichen Überlieferungen auf allen Gebieten Vieles sich hier findet. Aber unsere materialistische, verstandeskalte Zeit drängt das Alte, das Überlieferte, besonders aber den alten Aberglauben mit der früher so beliebten Sage mehr und mehr in den Winkel oder in den Kreis weniger Freunde, Nachbarn oder Familien.
Und auch hier will das junge Geschlecht von Vielem nichts mehr wissen; das "dumme" Alte wird erzählt, um ein mitleidiges Lächeln über die vielgläubigen Ahnen anbringen zu können - wenigstens ist das so in größerer Gesellschaft, im Wirtshaus. So ein Aufgeklärter bringt es mitunter aber doch trotzdem fertig, bei Unannehmlichkeiten mancher Art, bei Krankheit oder bei der gefürchteten Aushebung zum Militär „zu jemand zu gehen“, um sich mit Sprüchen, Amuletten und anderen Mitteln feien zu lassen. Traurig, aber leider wahr!
Will der Sammler reichere Kunde und gläubigere Anhänger alter Überlieferungen finden, so muß er sich an ein altes Mütterlein oder einen ergrauten Vertreter vergangener Tage wenden; man darf dabei aber ja nicht glauben, alles aus den Leuten herausbringen zu können; mit einem kurzen "das sag ich nicht!" oder "ich kann es nicht sagen!" werden die schönsten Geheimnisse zu einem Privatbesitz weniger Eingeweihter gemacht. "So lebt vieles unter der Oberfläche unvermerkt fort", und der Sammler muß nicht selten die betrübende Wahrnehmung machen, einen alten Schatz zwar nach seinem Vorhandensein zu kennen, ihn aber nicht heben und der Vergessenheit entziehen zu können. [...]
Ein "feuriger Reiter" ohne Kopf ergeht sich unter der Achalm am Hag; aber nicht alle Leute sehen ihn. Ein schwarzer "gottsträflicher" Pudel zeigt sich bisweilen auf dem Fußweg von Eningen nach Pfullingen (sog. Boll); das Gespenst nimmt seinen Weg dem Ursulaberg zu und hat auch einmal einen, der nachts von der Mühle heimkehrte, auf Irrwegen diesem Berge zugeführt. Ganz gefährlich steht es um die Leute, die nachts von einer Bösen (Hexe ?) ohne Kopf besucht werden. Geräuschlos schleicht sie daher; am andern Morgen ist alles Vieh losgebunden; ja einmal hat die Böse sogar einen Mann im Arrest aufgesucht und ihn weidlich durchgeprügelt.
Irrlichter giebt es an verschiedenen Orten, so im sog. Banget, am Weistenberg, Katzenbuckel. Auf dem Kirchhof zeigt sich ein Licht, das nahe kommt, so bald man etwas vom Boden aufhebt. Auch in der Eninger Kirche soll es nicht ganz geheuer sein. Man habe sogar vor nicht zu langer Zeit während der Sonntagskinderlehre einen früheren Geistlichen zum Altar gehen sehen, so daß viele Mädchen in Ohnmacht gesunken seien und der Geistliche das Amen habe sprechen müssen. Aus vielen Äußerungen hiesiger Bewohner kann geschlossen werden, daß das "Volk" zwischen dem rechen Glauben (Kirchenglauben) und den Gespenstern, den Irrlichtern, den Spukgeister, dem wilden Heer u.a. insofern einen Zusammenhang herstellt, als ein gläubig-frommer Sinn vor allen bösen Einflüssen bewahrt. So äußerte sich ein Bewohner: "Ich glaube ja nicht viel und will auch nicht zu den Frommen gehören; aber wenn ich des Morgens aufstehe, so sage ich: "Das walte Gott". Ich mag dann hingehen, wo ich will, so fürchte ich mich nicht; auch beim Gewitter denke ich, du hast den Tag mit Gebet angefangen und auch sonst nichts besonderes Böses gethan, deswegen wird es dir auch nicht schaden." Wie überall ist ferner die Ansicht verbreitet, daß, wer Marksteine versetzt, Opfer stiehlt, sich in den unrechten Besitz von Häusern und Äckern setzt, geisten d.h. umgehen muß. Nur (wenig) Jahre zurück hat es in einem hiesigen Hause ganz gewaltig gespukt, so daß alle Nachbarn und, wie erzählt wurde, der Geistliche in das betreffende Haus gerufen wurde. Eine Nachtwache, gebildet aus dem Landjäger und einem hiesigen Bäcker und Gemeinderat, letzterer seinen Mut in Gestalt einer Flasche Rotwein mit sich führend, hörte auf das ängstliche Schreien und Jammern der Hausfrau und Kinder hin wirklich ein "starkes 3maliges Klopfen." Aber "was" und "wer" es sei, weiß man bis heute noch nicht. (103)
Die Überlieferungen zeichnete Schullehrer G. Krieg in seinem Konferenzaufsatz im Jahr 1900 auf.
Genkingen
Der Geist in der Esche
Bei Genkingen auf der Alb steht an dem Wege, der nach Pfullingen führt, eine alte hohle Esche, darin wohnt ein Geist, der die vorübergehenden Menschen erschreckt, sie anhält und mit in die Esche zu nehmen sucht. Deshalb wagt es Niemand, selbst nicht bei Regenwetter, sich in den hohlen Baum hineinzustellen. Diesen Geist will man sogar schon gesehen haben. Er soll eine rothe Weste, schwarze Hosen und weiße Strümpfe tragen. (104)
Belsen
Die Belsener Kapelle
Die Volkssage von Belsen erklärt diese Kirche, die seit undenklicher Zeit zum Gottesdienst der Gemeinde eingerichtet ist, für einen heidnischen Bels- oder Baalstempel, von dem sie auch den Namen Belsen ableitet, setzt den Farrenberg, wohl auch den Roßberg damit in Verbindung, indem sie erzählt, daß auf diesen Höhen das heilige Opfervieh geweidet wurde, und zeigt noch im Innern der Capelle den Stein, an welchen die Opfer gebunden wurden. (105)
Die von Gustav Schwab in seinem Albführer 1823 als „Volkssage“ bezeichnete Deutung der rätselhaften romanischen Bildwerke der Belsener Kapelle ist natürlich eher eine Sage der Gebildeten, denen der antike Baals-Kult geläufig war. Bereits im 18. Jahrhundert haben sich Altertumsforscher an Interpretationen der Plastiken versucht. In einem kritischen Exkurs setzte sich Schwab mit den gelehrten Phantasien auseinander. Er stellte fest, dass auch die „Volkstradition“ die Baals-Deutung bevorzuge, bemerkte dann aber durchaus einsichtsvoll:
Doch möchte sie dorthin erst durch die gelehrte Welt, durch Pfarrer oder Schulmeister gekommen seyn.
Dem Pfarrer die Predigt aus dem Kopf nehmen
Der Hexen- und Geisterglauben wurzelt in Belsen im fruchtbarsten Boden; denn wo einst Götter verehrt wurden, treiben Geister und Hexen ihr Wesen. Ganze Familien sind im Verdacht, Hexerei zu treiben. Von weit her werden die Hexenmeister besucht um Unholde zu bannen. In der Schlucht zwischen dem Farren- und Heuberge ist es nicht geheuer und gefährlich den Weg des Nachts zu gehen. Hier begegnet man Hexen und Kobolden und zuweilen einem Manne, der kein Herz, an dessen Statt aber ein Licht hat und den Kopf unter dem Arm trägt. Es ist diess eine merkwürdige Identifizirung Wuodans und Frô's für eine Stelle, wo ganz in der Nähe ein Licht- oder Sonnen-Kultus bestanden hat.
Wenn der Redefluss des Geistlichen, welcher in der Kapelle zu predigen hat ins Stocken gerathet. so sind die Leute fest überzeugt, dass die Jungfrau, welche von der Ruine Andeck herkommt ihm auf seinem Gang zur Kirche begegnet ist. Mehr noch als diese Begegnung ist die Sage verbreitet, dass noch ein Heide in der Kapelle sei, welcher dem Pfarrer die Predigt aus dem Kopf nehme. (106)
Theophil Rupps Buch „Aus der Vorzeit Reutlingens und seiner Umgebung“ (1864) ist einer der zahlreichen Versuche, mythologische Kombinationen auf heimatliche Namen und Überlieferungen anzuwenden. Selbstverständlich durfte darin ein Kapitel über die Belsener Kapelle nicht fehlen.
Unterhausen
Gang unter der Echaz
Unterhausen gegenüber, auf der rechten Thalseite, ragt das sogenannte Burgholz mit einem vorspringenden Felsen hervor, welcher der Burgerstein, Burgstein genannt wird, und nach Crusius einst eine Greifensteinische Burg trug. Unter demselben bemerkt man noch ein gemauertes Gewölbe, das tief in den Berg hineinführt, und der Sage nach mit einem, unter der Echaz durchgehenden unterirdischen Gang zusammenhängt. (107)
Unterirdische Gänge werden von den Leuten auch da vermutet, wo sie eigentlich unmöglich sind. Wenn alle diese Geschichten wahr wären, wäre ganz Deutschland von einem riesigen Höhlensystem durchlöchert. Man darf annehmen, dass es sich um dasjenige traditionelle Sagen-Motiv handelt, das heute noch am weitesten mündlich verbreitet ist.
Lichtenstein
Herzog Ulrichs Zuflucht
Gewiß ist aus diesem Wenigen schon ersichtlich, wie der Lichtenstein eigentlich der Glanzpunkt der Alppartie ist, die wir von Reutlingen aus angetreten haben; allein welchem Württemberger und Schwaben würde nicht, wenn er den Namen „Lichtenstein“ hört, unwillkürlich auch das Wort „Nebelhöhle“ oder „Nebelloch“, wie man es früher hieß, auf die Zunge kommen? Beide sind ja in der württembergischen Volkssage unzertrennlich, laut welcher Herzog Ulrich, als er sich von dem schwäbischen Bunde flüchtig im Lande herumtrieb, in der Nebelhöhle eine sichere Zuflucht gefunden habe und allda von dem nahem Lichtenstein aus mit Speise und Trank versehen worden sei! (108)
Wie hier Theodor Griesinger 1866 wusste schon Wilhelm Zimmermann 1836 von einer angeblichen „Volkssage“ vom Aufenthalt Ulrichs in der Nebelhöhle. Diese Überlieferung geht aber ganz auf den 1826 erschienenen Erfolgsroman „Lichtenstein“ von Wilhelm Hauff zurück. Dieses Buch war auch der Grund für die Erbauung des historistischen „Märchenschlosses“ Lichtenstein um 1840.
Während der Nebelhöhlen-Aufenthalt von Hauff erfunden wurde, gab es eine ältere Tradition über Herzog Ulrich und Schloss Lichtenstein. Schwabs Albbeschreibung, eine Quelle Hauffs, zitierte die Beschreibung des Schlosses Lichtenstein bei Martin Crusius am Ende des 16. Jahrhunderts. Diese lautet in der Übersetzung von Johann Jakob Moser:
Einen Stuck-Schuß weit von Holzelfingen, gegen Mittag sieht man das Schloß Lichtenstein, welches nicht groß ist und auf einem Felsen ligt, so daß die untere Zimmer in den Felsen gehauen sind. Dieses hat, wie man sagt, eine alte Edel-Frau erbauet; man weißt aber nicht, wer sie gewesen und zu welcher Zeit sie gelebt. Doch ist von alten Leuthen erzehlt worden, daß sie, da der Bau zu Ende war, gesagt habe: Nun bin ich GOttes Freundin, aber der gantzen Welt Feindin. Denn sie glaubte, sie sey nun wieder jedermann in demselben sicher. [...] Im obern Stockwerck ist eine überaus schöne Stuben oder Saal, rings herum mit Fenstern, aus welchen man biß an den Asperg sehen kan: Darinn hat der vertriebene Fürst, Ulrich von Würtemberg, öffters gewohnt, der des Nachts vor das Schloß kam, und nur sagte: Der Mann ist da; so wurde er eingelassen.
NACHWEISE
Zu den Abkürzungen:
http://archiv.twoday.net/stories/5401895/
(85) Schwab S. 73. Vgl. Graf, Schwabensagen; Wilhelm Kinkelin, Das Pfullinger Heimatbuch, 1956, S. 559. Deutung der Marktbrunnendarstellungen: Martin Fink/Ina Brandmaier, Pfullinger Sagen, 1987, S. 7f.
(86) Alexander Patuzzi, Schwäbische Sagen-Kronik, 1844, S. 30f. Vgl. Wilhelm Zimmermann, Gedichte, 1832, S. 170-173 (in der 2. Aufl. 1839, S. 245-249 ohne Ortsbezug unter dem Titel „Der verzauberte Schatz. Volkssage“); Birlinger II, S. 263: Mündlich.
(87) Haderthauer S. 139f. nach Schott II, Bl. 117-119v: Schmückle IX. 1847.
(88) Schwab S. 72f.
(89) Pfarrbeschreibung von Dietrich Friedrich Wilhelm Meyer (1828), Stadtarchiv Pfullingen B 1123, S. 40-43 (Ü). Vgl. Hermann Taigel, in: Pfullingen einst und jetzt, 1982, S. 110-113 (dort leicht gekürzt). Herrn Taigel danke ich auch hier für Unterstützung.
(90) Ludwig Bechstein, Deutsches Sagenbuch, 1853, S. 751f. Vgl. Meier S. 3-18.
(91) Haderthauer S. 138 nach Schott II, Bl. 112-112v: Schmückle VIII. 1846.
(92) Schott II, Bl. 108-110: Wanser VIII. 1847; Karl Bohnenberger, Volkstümliche Überlieferungen in Württemberg, 1980, S. 5 = Württembergische Jahrbücher 1904 I, S. 95. Vgl. Meier S. 3f.
(93) Schott II, Bl. 125-125v: Martens VIII. 1847. Ursenberg: Martin Fink/Ina Brandmaier, Pfullinger Sagen, 1987, S. 17.
(94) Haderthauer S. 148 nach Schott II, Bl. 145-145v: Carl Albert Zeller 26.12.1845.
(95) Haderthauer S. 140f. nach Schott II, Bl. 123-124v: Schmückle IX. 1847. Vgl. Martin Fink/Ina Brandmaier, Pfullinger Sagen, 1987, S. 49; KA Pfullingen; OAB Reutlingen, 1893, S. 159.
(96) Meier S. 224f.: Mündlich aus Pfullingen (Ü); KA Pfullingen. Vgl. HDA 2 (1930), Sp. 352-357.
(97) KA (Ü).
(98) KA (Ü).
(99) Meier S. 234f.: Mündlich aus Pfullingen.
(100) Paul Schwarz, Ludwig Uhlands Beziehungen zu Pfullingen, in: BllSAV 86 (1980), S. 115 nach der Pfarrbeschreibung Meyers (Ü). Vgl. Meier S. 345.
(101) Schwab S. 74. Vgl. Haderthauer S. 35; Meier S. 288f.; Martin Fink/Ina Brandmaier, Pfullinger Sagen, 1987, S. 19.
(102) Haderthauer S. 34 nach Staatsbibliothek Berlin, Nachl. Grimm 688 (Ü). Vgl. Schwab S. 79f.; Meier S. 344.
(103) KA (Ü).
(104) Meier S. 251: Mündlich aus Genkingen.
(105) Schwab S. 51, 300. Vgl. Meier S. 296-298.
(106) Theophil Rupp, Aus der Vorzeit Reutlingens und seiner Umgebung, 1864, S. 42f. (Ü)
(107) OAB Reutlingen, 1824, S. 127 (Ü). Vgl. Graf, Stuttgart, S. 18; Keith Thomas, Vergangenheit, Zukunft, Lebensalter, 1988, S. 37 (für England).
(108) Theodor Griesinger, Württemberg. Nach seiner Vergangenheit und Gegenwart in Land und Leuten, 1866, S. 169 (Ü); Martin Crusius, Schwäbische Chronick, Bd. 2, Frankfurt a. M. 1733, S. 426. Vgl. Max Schuster, Der geschichtliche Kern von Hauffs Lichtenstein, 1904, S. 9, 18-30; Hans Binder, Ein Fürst und ein Dichter begründen den Ruhm der Nebelhöhle, in: Abhandlungen zur Karst- und Höhlenkunde, Reihe A Heft 4,1969, S. 33-55, hier S. 47-51. Zum Schloss vgl. Barbara Potthast, Der Lichtenstein – ein Sehnsuchtsort des 19. Jahrhunderts, in: Kurzer Aufenthalt, 2007, S. 197-201.
 Urschel-Wandgemälde Wilhelm-Blos-Straße 2, Pfullingen
Urschel-Wandgemälde Wilhelm-Blos-Straße 2, PfullingenArchivversion dieses Eintrags:
http://www.webcitation.org/66SlMnkR9
KlausGraf - am Samstag, 21. Januar 2012, 13:28 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://filosofiastoria.wordpress.com/2012/01/20/mediatheca-franciscana-manoscritti-del-fondo-antico-del-sacro-convento-di-assisi/
weist auf die Handschriftendigitalisierung hin, die mir zumindest schon seit langem bekannt ist.
weist auf die Handschriftendigitalisierung hin, die mir zumindest schon seit langem bekannt ist.
KlausGraf - am Samstag, 21. Januar 2012, 10:47 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Da es genügend Archive gibt, die davon keine Ahnung haben (wollen):
http://vifabenelux.wordpress.com/2012/01/20/was-ist-eigentlich-ein-rss-feed/
http://vifabenelux.wordpress.com/2012/01/20/was-ist-eigentlich-ein-rss-feed/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen