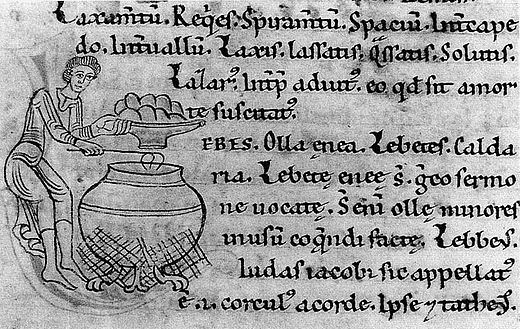Die Frage, ob Websites und insbesondere Blogs, ein Impressum benötigen, ist durchaus umstritten. Ratgeber und Informationsseiten tendieren dazu, für die meisten Internetangebote eine Impressumspflicht zu bejahen. Exemplarisch aus der jüngsten Zeit:
http://buch-blogger-recht.blogspot.de/2012/08/impressum-ja-oder-nein.html
http://www.connektar.de/blog/impressumspflicht-fuer-websites-wer-ist-betroffen/
http://dominikruisinger.wordpress.com/2012/08/22/impressumspflicht-im-internet-tipps-und-tools-im-uberblick/
http://linksandlaw.info/Impressumspflicht-Notwendige-Angaben.html (juristische Darstellung von einem Spezialisten, sehr restriktiv)
http://de.wikipedia.org/wiki/Impressumspflicht
Weniger restriktiv hat sich Ende 2010 das Landgericht Köln geäußert. Ein privates Blog brauche kein Impressum:
Gemäß § 55 Abs. 1 RStV haben Anbieter von Telemedien, die nicht ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dienen, Namen und Anschrift leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten.
Nach der Begründung zu § 55 im 9. RÄStV (abgedruckt bei Held in Beck`scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 2. Auflage 2008, § 55 Rz. 6), in dem die Informationspflichten neu geregelt wurden, soll mit der Ausnahme von der Informationspflicht sicher gestellt werden, dass Kommunikation im privaten (persönlichen oder familiären) Bereich ohne Nennung des Namens und der Anschrift erfolgen kann. Damit werde dem Schutz der Privatsphäre Rechnung getragen. Nicht kennzeichnungspflichtig sei demnach private Kommunikation, auch wenn sie über die reine Telekommunikation hinausgehe. Dies betreffe etwa die Einstellung von Meinungsäußerungen in Foren. In diesen Fällen sei über den Plattformanbieter sichergestellt, dass die schutzwürdigen Belange der Beteiligten gewahrt werden können. Eine Kennzeichnungspflicht würde ansonsten dazu führen, dass die Kommunikation unterbliebe.
Danach fallen unter die Ausnahme von der Informationspflicht jedenfalls Einstellungen von Meinungsäußerungen in Foren. Das gilt auch, wenn das Thema der Meinungsäußerung weder persönlich noch familiär ist. "Persönlich" bezieht sich nach dem Wortlaut auf die Zwecke der Kommunikation, nicht etwa auf das behandelte Thema. Persönlich ist der Zweck der Kommunikation aber auch dann, wenn der sich Äußernde dem persönlichen Bedürfnis nach Kommunikation politischer Meinungen, persönlichen Ärgers oder Enttäuschung nachkommt. Nach der Gesetzesbegründung bezieht sich persönlich auf die Kommunikation, auch wenn sie über die reine Telekommunikation hinaus geht. Insofern kann sich diese Kommunikation eben – typisch für das Internet – an die gesamte Internetgemeinschaft wenden. Die Ausnahme erfährt auch keine weitere Einschränkung dadurch, dass durch die Inhalte der Meinungsäußerung ein Bedürfnis entsteht, zu erfahren, wer hinter diesen Aussagen steht. Dies ist bei der Abfassung des Gesetzes vielmehr bereits bedacht worden, da keine Informationspflicht für notwendig erachtet wird, wo durch einen Plattformanbieter sichergestellt ist, dass die schutzwürdigen Belange der Beteiligten gewahrt sind. Daher geht die Auffassung zu weit, nach der die Ausnahme nur in Betracht kommt, wenn die Inhalte passwortgeschützt sind oder nur Inhalte aus dem engsten persönlichen Lebensbereich betroffen sind (so aber Ott, MMR 2007, 354, 356; für die Notwendigkeit einer weiten Fassung hingegen Kitz, ZUM 2007, 368, 372).
Unaufgeregt sieht die Sachlage auch der Lawblogger Udo Vetter (Video 2012, Zitat daraus). In einem Interview [depubliziert] sagte er 2012:
Grundsätzlich unterliegen Blogger in Deutschland der Impressumspflicht, aber die wird hier nur sehr lasch verfolgt. Es handelt sich um eine mögliche Ordnungswidrigkeit. Aber mir ist bisher kein Fall bekannt, bei dem ein Blogger ein Bußgeld bezahlen musste, weil er kein Impressum hatte. Das einzige, was die Behörden mitunter verschicken, sind höfliche Schreiben, in denen sie darum bitten, innerhalb von vier Wochen ein Impressum einzusetzen. Wenn man das dann nicht macht, kann es problematisch werden. Aber an sich kann man erst einmal beruhigt abwarten. Ich halte das auch für eine vernünftige Praxis der Behörden. Es gibt genug andere Missstände, beispielsweise bloggende Frauen, die zu Opfern von sexuellen Nachstellungen werden. Es ist vernünftig, da mit Augenmaß dran zu gehen.
Wer "geschäftlich" agiert, ist bereits bei Einsatz von "Google-Ads" gut beraten, ein korrektes Impressum (wie das auszusehen hat, sagen die oben verlinkten Seiten) anzubieten. Das gilt auch für soziale Netzwerke wie Facebook und sogar für Twitter. Er kann sich sonst leicht eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung einfangen.
Bei reinen Wissenschaftsblogs schätze ich das Risiko, ein Bußgeld zu erhalten, als sehr gering ein. Die Aufsichtsbehörden haben, das sieht Vetter richtig, Wichtigeres zu tun.
Wo der Anbieter der Blogmöglichkeit (Bloghoster z.B. blogger.com) sitzt, spielt keine Rolle. Richten sich z.B. Blogs von de.hypotheses.org an ein Publikum in Deutschland, so unterliegen sie der deutschen Impressumspflicht.
Bei institutionellen Blogs sollte ein Impressum kein Problem sein. Bei Gemeinschaftsblogs sollte eine Person als verantwortlich angegeben werden, an die man sich bei Rechtsverletzungen wenden kann. Möchte eine bloggende Wissenschaftlerin ihre Identität nicht preisgeben, ist die Nennung eines Strohmanns (oder einer Strohfrau?) eine empfehlenswerte Option.
Wer seriös wissenschaftlich bloggt, wird in der Regel mit offenem Visier agieren und seinen Namen nennen, zumal damit zu rechnen ist, dass dereinst auch Blogbeiträge als wissenschaftliche Leistungen anerkannt werden. In Ausnahmefällen, wenn es etwa um rechtmäßige, aber brisante Meinungsäußerungen geht oder wenn der Blogger "undercover" ermittelt, muss man es aber auch als legitim ansehen, wenn er anonym bleiben möchte.
Mein Impressum:
http://archiv.twoday.net/stories/134812/
***
Nachtrag:
Es wurde beanstandet, dass ich nicht gesagt habe, was denn nun zwingend in ein Impressum gehört. Je nach Rechtsgrundlage leider Unterschiedliches. Wer ein strikt-nichtgewerbliches Wissenschaftsblog unterhält und nicht ganz auf ein Impressum verzichten möchte, kann sich auf die Vorgabe des Rundfunkstaatsvertrags (§ 55, PDF) stützen und nur Name (voller Vorname!) und Anschrift angeben. Bei dem Telemediengesetz (§ 5) sind unverzichtbar zusätzlich die Emailadresse und mindestens ein zweiter effizienter Kommunikationsweg, um den Anbieter zu erreichen (vor allem kommen in Betracht: Telefonnummer oder Faxnummer oder Anfragemaske). Es existiert aber auch die Ansicht, die Telefonnummer sei auf jeden Fall zu nennen.
Das Impressum muss von jeder Seite aus erreichbar sein. Wenn man es Impressum nennt, macht man am wenigsten falsch, da die Bezeichnung "Kontakt" von einem Teil der Experten als nicht ausreichend angesehen wird.
Siehe auch das Hoeren-Skript S. 255ff. (PDF).
Es gibt Impressum-Generatoren, die die entsprechenden Angaben abfragen und dann ein hoffentlich korrektes Impressum erzeugen. Hier ein Musterimpressum, erstellt mit einem dieser Angebote.
***
Blog & Recht 1: Darf ich Bilder lebender Personen veröffentlichen?
http://archiv.twoday.net/stories/156271221/
Blog&Recht 2: Darf ich mein Blog mit einem Porträtfoto von mir schmücken?
http://archiv.twoday.net/stories/156272358/
http://buch-blogger-recht.blogspot.de/2012/08/impressum-ja-oder-nein.html
http://www.connektar.de/blog/impressumspflicht-fuer-websites-wer-ist-betroffen/
http://dominikruisinger.wordpress.com/2012/08/22/impressumspflicht-im-internet-tipps-und-tools-im-uberblick/
http://linksandlaw.info/Impressumspflicht-Notwendige-Angaben.html (juristische Darstellung von einem Spezialisten, sehr restriktiv)
http://de.wikipedia.org/wiki/Impressumspflicht
Weniger restriktiv hat sich Ende 2010 das Landgericht Köln geäußert. Ein privates Blog brauche kein Impressum:
Gemäß § 55 Abs. 1 RStV haben Anbieter von Telemedien, die nicht ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dienen, Namen und Anschrift leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten.
Nach der Begründung zu § 55 im 9. RÄStV (abgedruckt bei Held in Beck`scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 2. Auflage 2008, § 55 Rz. 6), in dem die Informationspflichten neu geregelt wurden, soll mit der Ausnahme von der Informationspflicht sicher gestellt werden, dass Kommunikation im privaten (persönlichen oder familiären) Bereich ohne Nennung des Namens und der Anschrift erfolgen kann. Damit werde dem Schutz der Privatsphäre Rechnung getragen. Nicht kennzeichnungspflichtig sei demnach private Kommunikation, auch wenn sie über die reine Telekommunikation hinausgehe. Dies betreffe etwa die Einstellung von Meinungsäußerungen in Foren. In diesen Fällen sei über den Plattformanbieter sichergestellt, dass die schutzwürdigen Belange der Beteiligten gewahrt werden können. Eine Kennzeichnungspflicht würde ansonsten dazu führen, dass die Kommunikation unterbliebe.
Danach fallen unter die Ausnahme von der Informationspflicht jedenfalls Einstellungen von Meinungsäußerungen in Foren. Das gilt auch, wenn das Thema der Meinungsäußerung weder persönlich noch familiär ist. "Persönlich" bezieht sich nach dem Wortlaut auf die Zwecke der Kommunikation, nicht etwa auf das behandelte Thema. Persönlich ist der Zweck der Kommunikation aber auch dann, wenn der sich Äußernde dem persönlichen Bedürfnis nach Kommunikation politischer Meinungen, persönlichen Ärgers oder Enttäuschung nachkommt. Nach der Gesetzesbegründung bezieht sich persönlich auf die Kommunikation, auch wenn sie über die reine Telekommunikation hinaus geht. Insofern kann sich diese Kommunikation eben – typisch für das Internet – an die gesamte Internetgemeinschaft wenden. Die Ausnahme erfährt auch keine weitere Einschränkung dadurch, dass durch die Inhalte der Meinungsäußerung ein Bedürfnis entsteht, zu erfahren, wer hinter diesen Aussagen steht. Dies ist bei der Abfassung des Gesetzes vielmehr bereits bedacht worden, da keine Informationspflicht für notwendig erachtet wird, wo durch einen Plattformanbieter sichergestellt ist, dass die schutzwürdigen Belange der Beteiligten gewahrt sind. Daher geht die Auffassung zu weit, nach der die Ausnahme nur in Betracht kommt, wenn die Inhalte passwortgeschützt sind oder nur Inhalte aus dem engsten persönlichen Lebensbereich betroffen sind (so aber Ott, MMR 2007, 354, 356; für die Notwendigkeit einer weiten Fassung hingegen Kitz, ZUM 2007, 368, 372).
Unaufgeregt sieht die Sachlage auch der Lawblogger Udo Vetter (Video 2012, Zitat daraus). In einem Interview [depubliziert] sagte er 2012:
Grundsätzlich unterliegen Blogger in Deutschland der Impressumspflicht, aber die wird hier nur sehr lasch verfolgt. Es handelt sich um eine mögliche Ordnungswidrigkeit. Aber mir ist bisher kein Fall bekannt, bei dem ein Blogger ein Bußgeld bezahlen musste, weil er kein Impressum hatte. Das einzige, was die Behörden mitunter verschicken, sind höfliche Schreiben, in denen sie darum bitten, innerhalb von vier Wochen ein Impressum einzusetzen. Wenn man das dann nicht macht, kann es problematisch werden. Aber an sich kann man erst einmal beruhigt abwarten. Ich halte das auch für eine vernünftige Praxis der Behörden. Es gibt genug andere Missstände, beispielsweise bloggende Frauen, die zu Opfern von sexuellen Nachstellungen werden. Es ist vernünftig, da mit Augenmaß dran zu gehen.
Wer "geschäftlich" agiert, ist bereits bei Einsatz von "Google-Ads" gut beraten, ein korrektes Impressum (wie das auszusehen hat, sagen die oben verlinkten Seiten) anzubieten. Das gilt auch für soziale Netzwerke wie Facebook und sogar für Twitter. Er kann sich sonst leicht eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung einfangen.
Bei reinen Wissenschaftsblogs schätze ich das Risiko, ein Bußgeld zu erhalten, als sehr gering ein. Die Aufsichtsbehörden haben, das sieht Vetter richtig, Wichtigeres zu tun.
Wo der Anbieter der Blogmöglichkeit (Bloghoster z.B. blogger.com) sitzt, spielt keine Rolle. Richten sich z.B. Blogs von de.hypotheses.org an ein Publikum in Deutschland, so unterliegen sie der deutschen Impressumspflicht.
Bei institutionellen Blogs sollte ein Impressum kein Problem sein. Bei Gemeinschaftsblogs sollte eine Person als verantwortlich angegeben werden, an die man sich bei Rechtsverletzungen wenden kann. Möchte eine bloggende Wissenschaftlerin ihre Identität nicht preisgeben, ist die Nennung eines Strohmanns (oder einer Strohfrau?) eine empfehlenswerte Option.
Wer seriös wissenschaftlich bloggt, wird in der Regel mit offenem Visier agieren und seinen Namen nennen, zumal damit zu rechnen ist, dass dereinst auch Blogbeiträge als wissenschaftliche Leistungen anerkannt werden. In Ausnahmefällen, wenn es etwa um rechtmäßige, aber brisante Meinungsäußerungen geht oder wenn der Blogger "undercover" ermittelt, muss man es aber auch als legitim ansehen, wenn er anonym bleiben möchte.
Mein Impressum:
http://archiv.twoday.net/stories/134812/
***
Nachtrag:
Es wurde beanstandet, dass ich nicht gesagt habe, was denn nun zwingend in ein Impressum gehört. Je nach Rechtsgrundlage leider Unterschiedliches. Wer ein strikt-nichtgewerbliches Wissenschaftsblog unterhält und nicht ganz auf ein Impressum verzichten möchte, kann sich auf die Vorgabe des Rundfunkstaatsvertrags (§ 55, PDF) stützen und nur Name (voller Vorname!) und Anschrift angeben. Bei dem Telemediengesetz (§ 5) sind unverzichtbar zusätzlich die Emailadresse und mindestens ein zweiter effizienter Kommunikationsweg, um den Anbieter zu erreichen (vor allem kommen in Betracht: Telefonnummer oder Faxnummer oder Anfragemaske). Es existiert aber auch die Ansicht, die Telefonnummer sei auf jeden Fall zu nennen.
Das Impressum muss von jeder Seite aus erreichbar sein. Wenn man es Impressum nennt, macht man am wenigsten falsch, da die Bezeichnung "Kontakt" von einem Teil der Experten als nicht ausreichend angesehen wird.
Siehe auch das Hoeren-Skript S. 255ff. (PDF).
Es gibt Impressum-Generatoren, die die entsprechenden Angaben abfragen und dann ein hoffentlich korrektes Impressum erzeugen. Hier ein Musterimpressum, erstellt mit einem dieser Angebote.
Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG:
Klaus Graf
Deutsche Straße 8
41464 Neuss
Kontakt:
Telefon: |
491774880893 |
Telefax: |
|
E-Mail: |
klausgraf@googlemail.com |
Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:
Dr. Klaus Graf
Deutsche Str. 8
41464 Neuss
Quelle: Impressumgenerator des Anwaltes Sören Siebert
Ich rate dringend davon ab, die Entscheidung für oder gegen ein Impressum und über seinen Inhalt allein auf diesen Beitrag zu stützen. Es sollten in jedem Fall noch weitere (z.B. die angegebenen) Internetquellen konsultiert werden!***
Blog & Recht 1: Darf ich Bilder lebender Personen veröffentlichen?
http://archiv.twoday.net/stories/156271221/
Blog&Recht 2: Darf ich mein Blog mit einem Porträtfoto von mir schmücken?
http://archiv.twoday.net/stories/156272358/
KlausGraf - am Samstag, 13. Oktober 2012, 23:08 - Rubrik: Archivrecht
Das Buch 2011 "Knowledge Policy for the 21st Century: A Legal Perspective", das auf eine Tagung 2007 zurückgeht, ist auch online Open Access verfügbar und enthält auch einen Aufsatz von Damien O'Brien "Blogs and the Law: Key Legal Issues for the Blogosphere"
http://www.irwinlaw.com/pages/knowledge-policy-for-the-21st-century--a-legal-perspective
Zitat:
In particular,
copyright law, defamation law, Internet jurisdiction, employment law, and
the law of authorization for intermediaries will all prove to be a significant impediment to the functioning of the blogosphere. The many challenges that these areas of the law will have on the blogosphere have, to a
small degree, already been experienced, with an increase in actions filed
against bloggers, specifically for defamation. It is expected that the amount
of litigation in the courts involving blogs will increase dramatically, as blogs
become a mainstream form of online communication.
http://www.irwinlaw.com/pages/knowledge-policy-for-the-21st-century--a-legal-perspective
Zitat:
In particular,
copyright law, defamation law, Internet jurisdiction, employment law, and
the law of authorization for intermediaries will all prove to be a significant impediment to the functioning of the blogosphere. The many challenges that these areas of the law will have on the blogosphere have, to a
small degree, already been experienced, with an increase in actions filed
against bloggers, specifically for defamation. It is expected that the amount
of litigation in the courts involving blogs will increase dramatically, as blogs
become a mainstream form of online communication.
KlausGraf - am Samstag, 13. Oktober 2012, 21:18 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bei einem Teil der auf Wikimedia Commons zugänglichen Bilder wird unter dem Reiter "Einbinden" ein Einbettungscode angeboten, der zunächst eine Textzeile "Nennung der Urheberschaft" und danach einen HTML-Einbettungscode vorgibt. Unzweckmäßig, aber rechtmäßig ist, dass die Lizenz darin nicht anklickbar ist. Aber meine Bedenken
http://archiv.twoday.net/stories/156272262/
haben sich inzwischen zu der Einschätzung verdichtet, dass ich diesen Code für nicht lizenzkonform und daher illegal ansehe.
Wie eine Anfrage in der Wikipedia-Auskunft ergab, unterstützen sowohl alte Browser als auch weit verbreitete mobile Geräte (iPad und andere mit Betriebssystem iOS das title-Attribut von HTML 4 nicht, was bedeutet, dass auf diesen Geräten eine korrekte Attribuierung (Namens- und Lizenznennung) nur über den Quelltext möglich ist.
Wenn auf WP:UF bestritten wird, dass kein Rechtsbruch vorliege, wenn " iOS html-4.0 nicht richtig rendert", so trifft das angesichts der Verbreitung mobiler Geräte mit iOS nicht den Punkt. Eine korrekte Attribuierung muss plattformunabhängig gültig sein. Es sollte nicht darauf ankommen, ob sich das eigene Gerät an einen akzeptierten Standard hält und auch nicht darauf, ob der Nutzer auf die Idee kommt, mit der Maus über das Bild zu fahren. Mit gleichem Recht könnte man auch einen Bilddateinamen, in dem der Name des Autors und die Lizenz-URL versteckt ist, als gültig ansehen, da man mit einem Mouseover auch ihn in vielen Browsern sehen kann.
Túrelio schrieb in der WP-UF-Diksussion:
[...] dass die CC-BY-xy-Vorlagen die Nachnutzer zwar über die Namensnennungspflicht, NICHT aber über die (für die meisten Nutzungsformen) ebenso bestehende Pflicht zur Mitteilung der anwendbaren Lizenzbedingungen (üblicherweise zu erzielen durch Link auf legal-code oder notfalls auf den sog. deed) informieren. Dieser Mangel ist seit langem bekannt, aber bis heute nicht behoben. CC ist daran allerdings nicht ganz unschuldig, weil sie in den meist ausschließlich gelesenen Lizenz-deeds (Zusammenfassung) diese 2. Nutzungsbedingung nicht gleichrangig neben die Namensnennung, sondern unten auf der Seite (so quasi in Kleingedruckte) plaziert haben. Solange das auf Commons nicht korrigiert ist, darf man sich nicht wundern, wenn Nachnutzer diese Bedingung nicht einhalten, sofern nicht beim betroffenen Bild auf Commons ein individueller Hinweis (z.B. in der Creditline; Beispiel) vorhanden war.
Maßgeblich ist der Lizenzcode von CC, ich zitiere CC 3.0 unported:
"You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. "
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
Punkt 4c lautet: "f You Distribute, or Publicly Perform the Work or any Adaptations or Collections, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and (iv) , consistent with Ssection 3(b), in the case of an Adaptation, a credit identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g., "French translation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). The credit required by this Section 4(c) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Adaptation or Collection, at a minimum such credit will appear, if a credit for all contributing authors of the Adaptation or Collection appears, then as part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing authors."
Bei Commons-Bildern existiert in der Regel kein beizubehaltender Titel. Weder der Dateiname noch die Beschreibung, die ja beliebig von anderen änderbar ist, muss bei der Nutzung angegeben werden - es sei denn, ein Titel wird ausdrücklich angegeben. maßgeblich ist auf Commons die sogenannte Credit Line:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Credit_line
Im Quellcode des von Túrelio angegebenen Bilds sieht man, dass ein Standardfeld für die Credit Line nicht existiert, man muss diese bei "Sonstiges" mittels Vorlage einbinden, und der HTML-Einbettungscode ignoriert die Vorlage Credit-Line, was ganz und gar nicht lizenzkonform ist.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DurchgebrannteG4HalogenBirne_5632.JPG
Es muss grundsätzlich klar und eindeutig erkennbar sein, was der Urheber im Rahmen der von CC vorgegebenen Befugnis, fordert.
Wo und wie diese Angaben angebracht werden, kann der Urheber nicht vorgeben, da es auf die Auslegung von "reasonable to the medium or means" der Lizenz ankommt. Ich bezweifle, dass deutsche Gerichte Nutzern da sehr viel durchgehen lassen werden.
Wenn es für eine der norwegische Wikipedien möglich ist, den Namen des Urhebers direkt beim Bild zu nennen, siehe etwa den Artikel Oslo
http://no.wikipedia.org/wiki/Oslo
sollte es generell bei Online-Veröffentlichungen möglich zu sein, Urhebername und Lizenz direkt am Foto zu nennen. Bei gedruckten Büchern kann der Bildnachweis in einem eigenen Anhang nach wie vor als branchenüblich gelten.
Eine Nennung nur im Quelltext oder nur im Dateinamen sehe ich nicht als lizenzkonform an. Auch das name-Attribut von img in HTML ist ungeeignet, da es in der Regel nur dann angezeigt wird, wenn das Bild nicht zu sehen ist.
Für den Fotografen ist es am günstigsten, wenn die Nennung direkt am Bild steht. Bei Online-Nutzungen sehe ich es aber als rechtmäßig an, wenn der Bildnachweis auf der gleichen HTML-Seite (auch als Fußtext) erfolgt, wenn er ohne weiteres sichtbar ist. Das ist beim title-Attribut nicht der Fall, da es ein Mouseover voraussetzt und weit verbreitete mobile Geräte das Attribut nicht unterstützen.

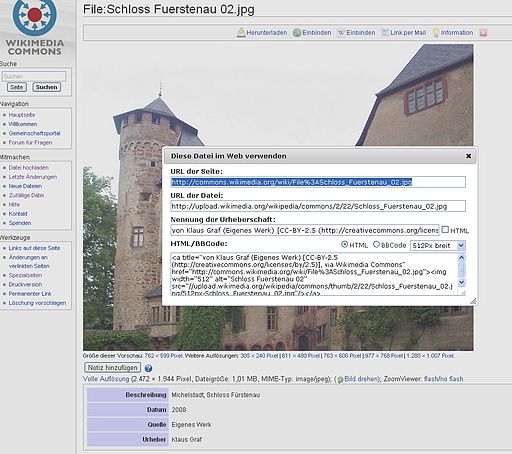
http://archiv.twoday.net/stories/156272262/
haben sich inzwischen zu der Einschätzung verdichtet, dass ich diesen Code für nicht lizenzkonform und daher illegal ansehe.
Wie eine Anfrage in der Wikipedia-Auskunft ergab, unterstützen sowohl alte Browser als auch weit verbreitete mobile Geräte (iPad und andere mit Betriebssystem iOS das title-Attribut von HTML 4 nicht, was bedeutet, dass auf diesen Geräten eine korrekte Attribuierung (Namens- und Lizenznennung) nur über den Quelltext möglich ist.
Wenn auf WP:UF bestritten wird, dass kein Rechtsbruch vorliege, wenn " iOS html-4.0 nicht richtig rendert", so trifft das angesichts der Verbreitung mobiler Geräte mit iOS nicht den Punkt. Eine korrekte Attribuierung muss plattformunabhängig gültig sein. Es sollte nicht darauf ankommen, ob sich das eigene Gerät an einen akzeptierten Standard hält und auch nicht darauf, ob der Nutzer auf die Idee kommt, mit der Maus über das Bild zu fahren. Mit gleichem Recht könnte man auch einen Bilddateinamen, in dem der Name des Autors und die Lizenz-URL versteckt ist, als gültig ansehen, da man mit einem Mouseover auch ihn in vielen Browsern sehen kann.
Túrelio schrieb in der WP-UF-Diksussion:
[...] dass die CC-BY-xy-Vorlagen die Nachnutzer zwar über die Namensnennungspflicht, NICHT aber über die (für die meisten Nutzungsformen) ebenso bestehende Pflicht zur Mitteilung der anwendbaren Lizenzbedingungen (üblicherweise zu erzielen durch Link auf legal-code oder notfalls auf den sog. deed) informieren. Dieser Mangel ist seit langem bekannt, aber bis heute nicht behoben. CC ist daran allerdings nicht ganz unschuldig, weil sie in den meist ausschließlich gelesenen Lizenz-deeds (Zusammenfassung) diese 2. Nutzungsbedingung nicht gleichrangig neben die Namensnennung, sondern unten auf der Seite (so quasi in Kleingedruckte) plaziert haben. Solange das auf Commons nicht korrigiert ist, darf man sich nicht wundern, wenn Nachnutzer diese Bedingung nicht einhalten, sofern nicht beim betroffenen Bild auf Commons ein individueller Hinweis (z.B. in der Creditline; Beispiel) vorhanden war.
Maßgeblich ist der Lizenzcode von CC, ich zitiere CC 3.0 unported:
"You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. "
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
Punkt 4c lautet: "f You Distribute, or Publicly Perform the Work or any Adaptations or Collections, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and (iv) , consistent with Ssection 3(b), in the case of an Adaptation, a credit identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g., "French translation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). The credit required by this Section 4(c) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Adaptation or Collection, at a minimum such credit will appear, if a credit for all contributing authors of the Adaptation or Collection appears, then as part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing authors."
Bei Commons-Bildern existiert in der Regel kein beizubehaltender Titel. Weder der Dateiname noch die Beschreibung, die ja beliebig von anderen änderbar ist, muss bei der Nutzung angegeben werden - es sei denn, ein Titel wird ausdrücklich angegeben. maßgeblich ist auf Commons die sogenannte Credit Line:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Credit_line
Im Quellcode des von Túrelio angegebenen Bilds sieht man, dass ein Standardfeld für die Credit Line nicht existiert, man muss diese bei "Sonstiges" mittels Vorlage einbinden, und der HTML-Einbettungscode ignoriert die Vorlage Credit-Line, was ganz und gar nicht lizenzkonform ist.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DurchgebrannteG4HalogenBirne_5632.JPG
Es muss grundsätzlich klar und eindeutig erkennbar sein, was der Urheber im Rahmen der von CC vorgegebenen Befugnis, fordert.
Wo und wie diese Angaben angebracht werden, kann der Urheber nicht vorgeben, da es auf die Auslegung von "reasonable to the medium or means" der Lizenz ankommt. Ich bezweifle, dass deutsche Gerichte Nutzern da sehr viel durchgehen lassen werden.
Wenn es für eine der norwegische Wikipedien möglich ist, den Namen des Urhebers direkt beim Bild zu nennen, siehe etwa den Artikel Oslo
http://no.wikipedia.org/wiki/Oslo
sollte es generell bei Online-Veröffentlichungen möglich zu sein, Urhebername und Lizenz direkt am Foto zu nennen. Bei gedruckten Büchern kann der Bildnachweis in einem eigenen Anhang nach wie vor als branchenüblich gelten.
Eine Nennung nur im Quelltext oder nur im Dateinamen sehe ich nicht als lizenzkonform an. Auch das name-Attribut von img in HTML ist ungeeignet, da es in der Regel nur dann angezeigt wird, wenn das Bild nicht zu sehen ist.
Für den Fotografen ist es am günstigsten, wenn die Nennung direkt am Bild steht. Bei Online-Nutzungen sehe ich es aber als rechtmäßig an, wenn der Bildnachweis auf der gleichen HTML-Seite (auch als Fußtext) erfolgt, wenn er ohne weiteres sichtbar ist. Das ist beim title-Attribut nicht der Fall, da es ein Mouseover voraussetzt und weit verbreitete mobile Geräte das Attribut nicht unterstützen.

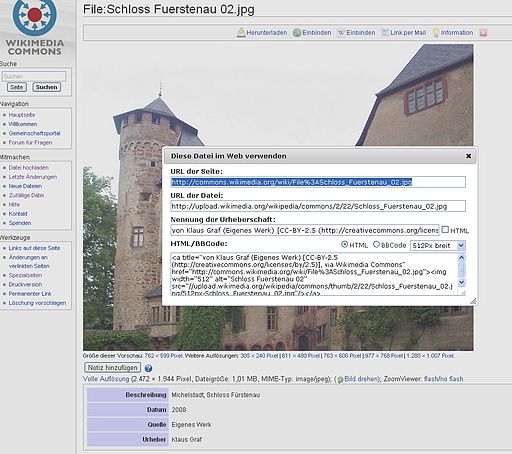
KlausGraf - am Samstag, 13. Oktober 2012, 19:21 - Rubrik: Archivrecht
Plagiatsjäger Stefan Weber analysiert den Abschlussbericht von Schavanplag zur Dissertation von Annette Schavan
http://plagiatsgutachten.de/blog.php/endbericht-zum-fall-schavan-tauschungsabsicht-ist-nachweisbar/
Frau Schavan hat nämlich wiederholt und methodisch so getan, als würde sie Originalliteratur gelesen haben (von Jakob von Uexküll über Sigmund Freud bis zu Martin Heidegger), hat aber nicht nur den Wortlaut der Originalautoren, sondern auch Interpretationen dieses Wortlauts von bei diesen Interpretationen ungenannten Quellen abgeschrieben. Damit erfüllt das Vorgehen Schavans jede Plagiatsdefinition, die es auch schon vor 1980 gab und die immer schon der kleinste gemeinsame Nenner einer Definition von “Plagiat” war: Ein Textplagiat ist eine unbefugte Aneignung fremder Ausführungen ohne Quellenangabe.
Der Bericht:
http://schavanplag.files.wordpress.com/2012/10/plagiatsdokumentation_schavan_09102012.pdf
Wir erinnern uns: Professor Gerd Schwerhoff, mit dem ich befreundet war, bevor er mir die Freundschaft aufkündigte, hat mir in einem Kommentar hier Tugendterror vorgeworfen, was dramatische Konsequenzen in der von mir administrierten Mailingliste Hexenforschung hatte. Schwerhoff mokierte sich dort über mich, Katrin Möller sprang ihm bei und verließ die Liste türenknallend, der wissenschaftliche Beirat der Liste ist dann - ohne Rücksprache mit mir - geschlossen zurückgetreten.
http://archiv.twoday.net/search?q=schwerhoff
Update: Ein dümmlicher Kommentar auf Spiegel Online
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fall-schavan-jan-fleischhauer-ueber-plagiate-und-moderne-tugendwaechter-a-860733.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article109721723/92-heikle-Vorwuerfe-gegen-Annette-Schavan.html
Was ist das für ein absurdes Argument:
"Seine Glaubwürdigkeit stellen allerdings zwei Dinge in Frage: Die Richtigkeit der Vorwürfe lässt sich ohne Zugang zu einer umfangreichen philosophischen Bibliothek kaum überprüfen."
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/plagiatsverdacht-gegen-schavan-doktorarbeit-mit-freud-schwaeche-a-860446.html
Hallo? Dann soll dieser Schreiberling eben in die Bibliothek marschieren und nachsehen, ob da alles korrekt ist, wovon prima facie auszugehen ist.
***
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/doktorarbeit-von-annette-schavan-gutachter-erkennt-taeuschungsabsicht-a-861187.html
"Ein Gutachter der Uni Düsseldorf wirft ihr nach SPIEGEL-Informationen vor, in ihrer Dissertation getäuscht zu haben. In einer vertraulichen Analyse, die dem SPIEGEL vorliegt, schreibt er von einer "leitenden Täuschungsabsicht" und erkennt "das charakteristische Bild einer plagiierenden Vorgehensweise". 60 Textstellen auf 351 Seiten beanstandet er, jetzt muss die Fakultät entscheiden, ob Schavan ihren Titel verliert oder behalten darf."
PS: Ich finde es durchaus in Ordnung, wenn man sich über bestimmte Personen empört, diese auch mit einem großen Bild zu zeigen.
***
http://archiv.twoday.net/stories/172007898/
 Foto Laurence Chaperon http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de
Foto Laurence Chaperon http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de
http://plagiatsgutachten.de/blog.php/endbericht-zum-fall-schavan-tauschungsabsicht-ist-nachweisbar/
Frau Schavan hat nämlich wiederholt und methodisch so getan, als würde sie Originalliteratur gelesen haben (von Jakob von Uexküll über Sigmund Freud bis zu Martin Heidegger), hat aber nicht nur den Wortlaut der Originalautoren, sondern auch Interpretationen dieses Wortlauts von bei diesen Interpretationen ungenannten Quellen abgeschrieben. Damit erfüllt das Vorgehen Schavans jede Plagiatsdefinition, die es auch schon vor 1980 gab und die immer schon der kleinste gemeinsame Nenner einer Definition von “Plagiat” war: Ein Textplagiat ist eine unbefugte Aneignung fremder Ausführungen ohne Quellenangabe.
Der Bericht:
http://schavanplag.files.wordpress.com/2012/10/plagiatsdokumentation_schavan_09102012.pdf
Wir erinnern uns: Professor Gerd Schwerhoff, mit dem ich befreundet war, bevor er mir die Freundschaft aufkündigte, hat mir in einem Kommentar hier Tugendterror vorgeworfen, was dramatische Konsequenzen in der von mir administrierten Mailingliste Hexenforschung hatte. Schwerhoff mokierte sich dort über mich, Katrin Möller sprang ihm bei und verließ die Liste türenknallend, der wissenschaftliche Beirat der Liste ist dann - ohne Rücksprache mit mir - geschlossen zurückgetreten.
http://archiv.twoday.net/search?q=schwerhoff
Update: Ein dümmlicher Kommentar auf Spiegel Online
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fall-schavan-jan-fleischhauer-ueber-plagiate-und-moderne-tugendwaechter-a-860733.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article109721723/92-heikle-Vorwuerfe-gegen-Annette-Schavan.html
Was ist das für ein absurdes Argument:
"Seine Glaubwürdigkeit stellen allerdings zwei Dinge in Frage: Die Richtigkeit der Vorwürfe lässt sich ohne Zugang zu einer umfangreichen philosophischen Bibliothek kaum überprüfen."
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/plagiatsverdacht-gegen-schavan-doktorarbeit-mit-freud-schwaeche-a-860446.html
Hallo? Dann soll dieser Schreiberling eben in die Bibliothek marschieren und nachsehen, ob da alles korrekt ist, wovon prima facie auszugehen ist.
***
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/doktorarbeit-von-annette-schavan-gutachter-erkennt-taeuschungsabsicht-a-861187.html
"Ein Gutachter der Uni Düsseldorf wirft ihr nach SPIEGEL-Informationen vor, in ihrer Dissertation getäuscht zu haben. In einer vertraulichen Analyse, die dem SPIEGEL vorliegt, schreibt er von einer "leitenden Täuschungsabsicht" und erkennt "das charakteristische Bild einer plagiierenden Vorgehensweise". 60 Textstellen auf 351 Seiten beanstandet er, jetzt muss die Fakultät entscheiden, ob Schavan ihren Titel verliert oder behalten darf."
PS: Ich finde es durchaus in Ordnung, wenn man sich über bestimmte Personen empört, diese auch mit einem großen Bild zu zeigen.
***
http://archiv.twoday.net/stories/172007898/
 Foto Laurence Chaperon http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de
Foto Laurence Chaperon http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.deKlausGraf - am Samstag, 13. Oktober 2012, 18:04 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
http://www.ifla-deutschland.de/de/downloads/Code-of-Ethics_German_Full.pdf
Zitat:
"Es liegt im Interesse von Bibliothekarinnen und anderen im Informationssektor Beschäftigten, Bibliotheksnutzern
den bestmöglichen Zugang zu Informationen und Ideen unabhängig von Medium und Format anzubieten. Daraus
folgt, dass sie die Grundsätze von Open Access, Open Source und Open License unterstützen."
Übrigens nichts zur Beihilfe zur Kulturgutvernichtung, zur Kumpanei mit Antiquariaten usw.
Via
http://log.netbib.de/archives/2012/10/12/ifla-ethikkodex-nun-in-deutscher-sprache-verfugbar/
Zitat:
"Es liegt im Interesse von Bibliothekarinnen und anderen im Informationssektor Beschäftigten, Bibliotheksnutzern
den bestmöglichen Zugang zu Informationen und Ideen unabhängig von Medium und Format anzubieten. Daraus
folgt, dass sie die Grundsätze von Open Access, Open Source und Open License unterstützen."
Übrigens nichts zur Beihilfe zur Kulturgutvernichtung, zur Kumpanei mit Antiquariaten usw.
Via
http://log.netbib.de/archives/2012/10/12/ifla-ethikkodex-nun-in-deutscher-sprache-verfugbar/
KlausGraf - am Samstag, 13. Oktober 2012, 17:57 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"OLG Hamburg, Beschluss vom 26.04.2010, Az. 5 U 160/08
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG, § 2 Abs. 2 UrhG
Das OLG Hamburg hat in diesem Hinweisbeschluss darauf hingewiesen, dass der Refrain eines Liedes, der aus wenigen Worten oder einem Satz besteht, nicht isoliert als Sprachwerk dem Urheberrechtsschutz unterfällt, auch wenn er über einen gewissen Grad an Originalität verfügt. Der vom Kläger erdachten Textzeile „alles ist gut so lange du wild bist” fehle es an der erforderlichen Schöpfungshöhe."
http://www.damm-legal.de/olg-hamburg-zum-urheberrechtlichen-schutz-einer-einzigen-zeile-eines-liedes
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG, § 2 Abs. 2 UrhG
Das OLG Hamburg hat in diesem Hinweisbeschluss darauf hingewiesen, dass der Refrain eines Liedes, der aus wenigen Worten oder einem Satz besteht, nicht isoliert als Sprachwerk dem Urheberrechtsschutz unterfällt, auch wenn er über einen gewissen Grad an Originalität verfügt. Der vom Kläger erdachten Textzeile „alles ist gut so lange du wild bist” fehle es an der erforderlichen Schöpfungshöhe."
http://www.damm-legal.de/olg-hamburg-zum-urheberrechtlichen-schutz-einer-einzigen-zeile-eines-liedes
KlausGraf - am Samstag, 13. Oktober 2012, 17:51 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In meiner Urheberrechtsfibel (PDF) behandelte ich 2009 folgenden fiktiven Fall zu § 17 UrhG, der das Verbreitungsrecht und den sogenannten Erschöpfungsgrundsatz regelt:
"Wer aus dem Thailand-Urlaub eine dort legal vertriebene Musik-DVD mitbringt und bei eBay anbietet, kann wegen Urheberrechtsverletzung abgemahnt werden. Angebot und Inverkehrbringen des Werks (Original oder Kopie)
müssen sich in der Öffentlichkeit abspielen. Wenn der Thailandurlauber die DVD im Freundeskreis verschenkt oder verkauft, handelt er legal. Mit der Einstellung der Auktion bei dem Online-Auktionshaus erfolgt aber ein öffentliches Anbieten.
Durch das Inverkehrbringen wird das Werk aus der internen Betriebssphäre des Urhebers, Herstellers oder Verwerters entlassen. Eine konzerninterne Weitergabe ist kein Inverkehrbringen. [...]
Absatz 2 ist der sogenannte Erschöpfungsgrundsatz. Dem Urheber
steht nur das Recht der Erstverbreitung zu. Verschenkt, verkauft oder tauscht er das Werk, soll er weitere Veräußerungen nicht mehr kontrollieren dürfen. Einzig und allein die Vermietung unterliegt seinem Verbotsrecht. Wer einen urheberrechtlich geschützten Gartenzwerg kauft, darf diesen sowohl weiterverkaufen als auch in seinen Vorgarten stellen, wo er
dann – gemäß der Panoramafreiheit des § 59 – vom Gartenzaun aus
vergütungsfrei fotografiert werden darf (auch zu gewerblichen Zwecken).
Die Erschöpfung gilt nur für die EU/EWR (der Europäische Wirtschaftsraum erweitert die EU um Liechtenstein, Norwegen und Island), nicht aber z. B. für Thailand in meinem Beispiel. Hier lauert eine üble Abmahnfalle, denn der normale Bürger wird selbstverständlich davon ausgehen, dass er legal erworbene Waren – schließlich handelt es sich ja nicht etwa um Raubkopien – ohne weiteres weiterverkaufen kann. Dass die Erschöpfung nur europaweit gilt, ist schlicht und einfach nicht fair und verstößt auch gegen das Eigentumsgrundrecht des nichtsahnenden
Verbrauchers. Ist eine Weitergabe nur im Bekannten- oder Freundeskreis möglich, so wird die Verkehrsfähigkeit der Ware unzumutbar beeinträchtigt. Die Erschöpfung muss weltweit gelten!"
Zu ergänzen ist, dass der Europäische Gerichtshof 2006 im Laserdisken-Fall verboten hat, dass der nationale Gesetzgeber die Erschöpfung über den EU-Wirtschaftsraum hinaus erstreckt.
Die Erwähnung Thailands war insofern von mir prophetisch, als 2012 ein solcher Import aus Thailand die US-Rechtsszene beschäftigt.
"Durch den Verkauf gebrauchter und neuer Bücher wollte sich der thailändische Student Supap Kirtsaeng sein Studium in den USA finanzieren. Dazu gehörten auch acht echte und legal gekaufte Lehrbücher des Wiley Verlags, die ihm Verwandte aus Thailand geschickt hatten. Eine Jury verurteilte ihn dafür wegen willentlicher Urheberrechtsverletzung zu 600.000 Dollar Strafschadenersatz.
Das Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung mit 2:1 Stimmen der Richter. Nun hat der Oberste Gerichtshof der USA (Supreme Court) eingewilligt, diesen und einen sehr ähnlichen Fall zu behandeln. Die zentrale Rechtsfrage ist, ob die sogenannte "First Sale Doctrine" (Erschöpfungsgrundsatz) auch für Werkstücke gilt, die legal im Ausland angefertigt und dann in den USA verkauft werden. "
http://derstandard.at/1341526759646/US-Gericht-erwaegt-ewiges-Urheberrecht
Schon die unsinnige Überschrift des Standard-Artikels lässt den Verdacht aufkommen, dass da nicht alles korrekt verstanden wurde.
Was prima facie als Rechtsfrage erscheint, die uns nicht zu kümmern braucht, kann sehr wohl - und das nicht nur in den USA - Auswirkungen auf die Kulturinstitutionen haben.
In einer Eingabe an den Supreme Court (Amicus-Brief) haben Museums-Institutionen davor gewarnt, dass eine Beschränkung der First-sale-Doktrin (die dem Erschöpfungsgrundsatz des EU-Rechts entspricht) auf die USA dazu führen könnte, dass Museen ausländische Werke weder zeigen noch ankaufen können.
http://clancco.com/wp/2012/10/first-sale-doctrine-copyright-art/
Aus dem Schriftsatz:
To avoid the risk of liability, museums could be forced to seek licenses from copyright owners. But clearing rights will be expensive and in many cases impossible. The cost of having to find copyright owners and negotiate individual licenses will be high, and museums likely will be unable to locate the copyright owner in every instance even after a diligent search. Copyright owners, who have no obligation to grant licenses, could demand sizeable royalty payments and non-monetary concessions like control over curatorial decisions. Where museums are unable to secure permissions, they would face an untenable choice: running the risk of copyright infringement liability or not making art available to the public or even acquiring art, whether by gift, bequest, or purchase.
Auch die US-Bibliotheken sind alarmiert:
http://newsandinsight.thomsonreuters.com/New_York/News/2012/07_-_July/A_Supreme_Court_copyright_case_has_libraries_fighting_for_the_right_to_lend/
[I]f the Supreme Court agrees with the 2nd Circuit's Kirtsaeng reasoning, according to the libraries' brief, libraries may no longer be legally permitted to lend books that were manufactured outside the United States, whether they be foreign-language books or books from U.S. publishers that are printed overseas.
Ich hatte schon 2010 auf einen Beitrag von Peter Hirtle aufmerksam gemacht, der auch Implikationen für Archive bzw. Manuskriptsammlungen erwägt:
http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2010/07/costco-v-omega.html
In der EU gilt der Erschöpfungsgrundsatz wie gesagt nur EU-weit. Konstruiertes Beispiel: Der berühmte englische Künstler Damien H. malt in Moskau für Oligarch A ein Bild, das dieser an Oligarch Б verkauft, der das Bild in Köln versteigern lassen will. Damien kann die Versteigerung unterbinden, da sein Verbreitungsrecht nicht erschöpft ist. Jeder Verkauf in der EU kann nur mit seiner Zustimmung erfolgen.
Erwirbt eine deutsche Bibliothek ein vom Ulmer Verlag in der Türkei in den Handel gebrachtes Lehrbuch gebraucht von einem türkischstämmigen Studenten, so darf sie es nicht verleihen, da das Verleihrecht als ausschließliches Recht in der EU nach wie vor besteht. Folgt man der abzulehnenden Auffassung von Schulze in Dreier/Schulze, UrhG 3. Aufl. 2008 § 27 Rz. 17 (siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/5837518/ ), wonach auch die Präsenznutzung ein Verleihen sei, so darf die Bibliothek mit ihrem Eigentum gar nichts machen als es bis zum Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers aufzubewahren - oder sie erhält die Zustimmung von Ulmer, der freilich an seinen Maserati denken muss.
Ein Museum dürfte ein Kunstwerk, dessen Verbreitungsrecht nicht erschöpft ist, allerdings zeigen, wenn das auf die Erstveröffentlichung bezogene Ausstellungsrecht verbraucht ist (§ 18 UrhG).
Eine oberflächliche Recherche in Beck-Online erbrachte keine Stellungnahmen von deutschen Juristen zu den Implikationen der Nichterschöpfung des Verbreitungsrechts auf Kunsthandel und Kulturinstitutionen. Das Problem hat glücklicherweise wohl hierzulande nur theoretischen Charakter, aber auch hier gilt "Grafs Law": Alles was abgemahnt werden kann, wird einmal abgemahnt werden ...
 Bilderverkauf in Bangkok, Foto: leekiza CC-BY-SA
Bilderverkauf in Bangkok, Foto: leekiza CC-BY-SA
"Wer aus dem Thailand-Urlaub eine dort legal vertriebene Musik-DVD mitbringt und bei eBay anbietet, kann wegen Urheberrechtsverletzung abgemahnt werden. Angebot und Inverkehrbringen des Werks (Original oder Kopie)
müssen sich in der Öffentlichkeit abspielen. Wenn der Thailandurlauber die DVD im Freundeskreis verschenkt oder verkauft, handelt er legal. Mit der Einstellung der Auktion bei dem Online-Auktionshaus erfolgt aber ein öffentliches Anbieten.
Durch das Inverkehrbringen wird das Werk aus der internen Betriebssphäre des Urhebers, Herstellers oder Verwerters entlassen. Eine konzerninterne Weitergabe ist kein Inverkehrbringen. [...]
Absatz 2 ist der sogenannte Erschöpfungsgrundsatz. Dem Urheber
steht nur das Recht der Erstverbreitung zu. Verschenkt, verkauft oder tauscht er das Werk, soll er weitere Veräußerungen nicht mehr kontrollieren dürfen. Einzig und allein die Vermietung unterliegt seinem Verbotsrecht. Wer einen urheberrechtlich geschützten Gartenzwerg kauft, darf diesen sowohl weiterverkaufen als auch in seinen Vorgarten stellen, wo er
dann – gemäß der Panoramafreiheit des § 59 – vom Gartenzaun aus
vergütungsfrei fotografiert werden darf (auch zu gewerblichen Zwecken).
Die Erschöpfung gilt nur für die EU/EWR (der Europäische Wirtschaftsraum erweitert die EU um Liechtenstein, Norwegen und Island), nicht aber z. B. für Thailand in meinem Beispiel. Hier lauert eine üble Abmahnfalle, denn der normale Bürger wird selbstverständlich davon ausgehen, dass er legal erworbene Waren – schließlich handelt es sich ja nicht etwa um Raubkopien – ohne weiteres weiterverkaufen kann. Dass die Erschöpfung nur europaweit gilt, ist schlicht und einfach nicht fair und verstößt auch gegen das Eigentumsgrundrecht des nichtsahnenden
Verbrauchers. Ist eine Weitergabe nur im Bekannten- oder Freundeskreis möglich, so wird die Verkehrsfähigkeit der Ware unzumutbar beeinträchtigt. Die Erschöpfung muss weltweit gelten!"
Zu ergänzen ist, dass der Europäische Gerichtshof 2006 im Laserdisken-Fall verboten hat, dass der nationale Gesetzgeber die Erschöpfung über den EU-Wirtschaftsraum hinaus erstreckt.
Die Erwähnung Thailands war insofern von mir prophetisch, als 2012 ein solcher Import aus Thailand die US-Rechtsszene beschäftigt.
"Durch den Verkauf gebrauchter und neuer Bücher wollte sich der thailändische Student Supap Kirtsaeng sein Studium in den USA finanzieren. Dazu gehörten auch acht echte und legal gekaufte Lehrbücher des Wiley Verlags, die ihm Verwandte aus Thailand geschickt hatten. Eine Jury verurteilte ihn dafür wegen willentlicher Urheberrechtsverletzung zu 600.000 Dollar Strafschadenersatz.
Das Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung mit 2:1 Stimmen der Richter. Nun hat der Oberste Gerichtshof der USA (Supreme Court) eingewilligt, diesen und einen sehr ähnlichen Fall zu behandeln. Die zentrale Rechtsfrage ist, ob die sogenannte "First Sale Doctrine" (Erschöpfungsgrundsatz) auch für Werkstücke gilt, die legal im Ausland angefertigt und dann in den USA verkauft werden. "
http://derstandard.at/1341526759646/US-Gericht-erwaegt-ewiges-Urheberrecht
Schon die unsinnige Überschrift des Standard-Artikels lässt den Verdacht aufkommen, dass da nicht alles korrekt verstanden wurde.
Was prima facie als Rechtsfrage erscheint, die uns nicht zu kümmern braucht, kann sehr wohl - und das nicht nur in den USA - Auswirkungen auf die Kulturinstitutionen haben.
In einer Eingabe an den Supreme Court (Amicus-Brief) haben Museums-Institutionen davor gewarnt, dass eine Beschränkung der First-sale-Doktrin (die dem Erschöpfungsgrundsatz des EU-Rechts entspricht) auf die USA dazu führen könnte, dass Museen ausländische Werke weder zeigen noch ankaufen können.
http://clancco.com/wp/2012/10/first-sale-doctrine-copyright-art/
Aus dem Schriftsatz:
To avoid the risk of liability, museums could be forced to seek licenses from copyright owners. But clearing rights will be expensive and in many cases impossible. The cost of having to find copyright owners and negotiate individual licenses will be high, and museums likely will be unable to locate the copyright owner in every instance even after a diligent search. Copyright owners, who have no obligation to grant licenses, could demand sizeable royalty payments and non-monetary concessions like control over curatorial decisions. Where museums are unable to secure permissions, they would face an untenable choice: running the risk of copyright infringement liability or not making art available to the public or even acquiring art, whether by gift, bequest, or purchase.
Auch die US-Bibliotheken sind alarmiert:
http://newsandinsight.thomsonreuters.com/New_York/News/2012/07_-_July/A_Supreme_Court_copyright_case_has_libraries_fighting_for_the_right_to_lend/
[I]f the Supreme Court agrees with the 2nd Circuit's Kirtsaeng reasoning, according to the libraries' brief, libraries may no longer be legally permitted to lend books that were manufactured outside the United States, whether they be foreign-language books or books from U.S. publishers that are printed overseas.
Ich hatte schon 2010 auf einen Beitrag von Peter Hirtle aufmerksam gemacht, der auch Implikationen für Archive bzw. Manuskriptsammlungen erwägt:
http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2010/07/costco-v-omega.html
In der EU gilt der Erschöpfungsgrundsatz wie gesagt nur EU-weit. Konstruiertes Beispiel: Der berühmte englische Künstler Damien H. malt in Moskau für Oligarch A ein Bild, das dieser an Oligarch Б verkauft, der das Bild in Köln versteigern lassen will. Damien kann die Versteigerung unterbinden, da sein Verbreitungsrecht nicht erschöpft ist. Jeder Verkauf in der EU kann nur mit seiner Zustimmung erfolgen.
Erwirbt eine deutsche Bibliothek ein vom Ulmer Verlag in der Türkei in den Handel gebrachtes Lehrbuch gebraucht von einem türkischstämmigen Studenten, so darf sie es nicht verleihen, da das Verleihrecht als ausschließliches Recht in der EU nach wie vor besteht. Folgt man der abzulehnenden Auffassung von Schulze in Dreier/Schulze, UrhG 3. Aufl. 2008 § 27 Rz. 17 (siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/5837518/ ), wonach auch die Präsenznutzung ein Verleihen sei, so darf die Bibliothek mit ihrem Eigentum gar nichts machen als es bis zum Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers aufzubewahren - oder sie erhält die Zustimmung von Ulmer, der freilich an seinen Maserati denken muss.
Ein Museum dürfte ein Kunstwerk, dessen Verbreitungsrecht nicht erschöpft ist, allerdings zeigen, wenn das auf die Erstveröffentlichung bezogene Ausstellungsrecht verbraucht ist (§ 18 UrhG).
Eine oberflächliche Recherche in Beck-Online erbrachte keine Stellungnahmen von deutschen Juristen zu den Implikationen der Nichterschöpfung des Verbreitungsrechts auf Kunsthandel und Kulturinstitutionen. Das Problem hat glücklicherweise wohl hierzulande nur theoretischen Charakter, aber auch hier gilt "Grafs Law": Alles was abgemahnt werden kann, wird einmal abgemahnt werden ...
 Bilderverkauf in Bangkok, Foto: leekiza CC-BY-SA
Bilderverkauf in Bangkok, Foto: leekiza CC-BY-SAKlausGraf - am Freitag, 12. Oktober 2012, 21:03 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Angebot der über die Plattform retro.seals.ch zugänglichen wissenschaftlichen Zeitschriften hat sich erweitert. Die folgenden digitalisierten Zeitschriften sind neu im Volltext online verfügbar:
Appenzellische Jahrbücher
Bernisches Freytagsblättchen
Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Jahresbericht / Gesellschaft Pro Vindonissa
Mémoires / Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Versants: Revue suisse des littératures romanes
L'Émilie: magazine socio-culturelles
Le pays du dimanche
Pionier: Organ der schweizerischen permanenten Schulausstellung in Bern
Schweizerisches Schularchiv : Organ der Schweizerischen Schulausstellung in Zürich
Volksschulblatt
http://retro.seals.ch/digbib/home "
Wer die Appenzellischen Jahrbücher als uninteressant aussortiert, dem entgeht ein interessantes Themenheft von 2005 über Robert Walser:
http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=ajb-001:2005:133::3&id=&id2=&id3=
Aus der Sicht des deutschen Landeshistorikers wären vordringlich, stehen leider aber nicht auf der Liste des Geplanten:
Schaffhauser Beiträge
http://www.historischerverein-sh.ch/index.php?id=7
(ist "beabsichtigt")
Thurgauer Beiträge
http://www.hvtg.ch/publikationen.php
(ist noch nicht einmal beabsichtigt)
Jahrbuch für solothurnische Geschichte ist im Gang laut
https://www.digicoord.ch/index.php/Digitalisierungsprojekte
Wichtig wären auch die Schriften des Vereins für die Geschichte des Bodensees, aber die zu ihrer Digitalisierung berufenen Bodensee-Bibliotheken kommen nicht in die Gänge. Insbesondere die UB Konstanz hat bisher auf dem Gebiet der Retrodigitalisierung buchstäblich NICHTS getan.
Das St. Galler Neujahrblatt bietet der Historische Verein 2004-2011 Open Access als PDFs an:
http://www.hvsg.ch/neujahrsblaetter.php
Von den MVG gibt es leider noch nichts, hier sollte retro.seals.ch einspringen (aber da ist nichts geplant):
http://www.hvsg.ch/mitteilungen.php
Das Bündner Jahrbuch ist in den Klauen des Tardis-Verlags:
http://www.tardis-verlag.ch/
Appenzellische Jahrbücher
Bernisches Freytagsblättchen
Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Jahresbericht / Gesellschaft Pro Vindonissa
Mémoires / Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Versants: Revue suisse des littératures romanes
L'Émilie: magazine socio-culturelles
Le pays du dimanche
Pionier: Organ der schweizerischen permanenten Schulausstellung in Bern
Schweizerisches Schularchiv : Organ der Schweizerischen Schulausstellung in Zürich
Volksschulblatt
http://retro.seals.ch/digbib/home "
Wer die Appenzellischen Jahrbücher als uninteressant aussortiert, dem entgeht ein interessantes Themenheft von 2005 über Robert Walser:
http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=ajb-001:2005:133::3&id=&id2=&id3=
Aus der Sicht des deutschen Landeshistorikers wären vordringlich, stehen leider aber nicht auf der Liste des Geplanten:
Schaffhauser Beiträge
http://www.historischerverein-sh.ch/index.php?id=7
(ist "beabsichtigt")
Thurgauer Beiträge
http://www.hvtg.ch/publikationen.php
(ist noch nicht einmal beabsichtigt)
Jahrbuch für solothurnische Geschichte ist im Gang laut
https://www.digicoord.ch/index.php/Digitalisierungsprojekte
Wichtig wären auch die Schriften des Vereins für die Geschichte des Bodensees, aber die zu ihrer Digitalisierung berufenen Bodensee-Bibliotheken kommen nicht in die Gänge. Insbesondere die UB Konstanz hat bisher auf dem Gebiet der Retrodigitalisierung buchstäblich NICHTS getan.
Das St. Galler Neujahrblatt bietet der Historische Verein 2004-2011 Open Access als PDFs an:
http://www.hvsg.ch/neujahrsblaetter.php
Von den MVG gibt es leider noch nichts, hier sollte retro.seals.ch einspringen (aber da ist nichts geplant):
http://www.hvsg.ch/mitteilungen.php
Das Bündner Jahrbuch ist in den Klauen des Tardis-Verlags:
http://www.tardis-verlag.ch/
KlausGraf - am Freitag, 12. Oktober 2012, 19:29 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://fuldig.hs-fulda.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:hebis:66:fuldig-1528820
Kann nicht jemand mal dem Bibliotheksdirektor Bescheid stoßen, dass Metadaten zu einem Zeitschriftenband, die weder Jahrgang noch Jahreszahl nennen, purer Schwachsinn sind?
Kann nicht jemand mal dem Bibliotheksdirektor Bescheid stoßen, dass Metadaten zu einem Zeitschriftenband, die weder Jahrgang noch Jahreszahl nennen, purer Schwachsinn sind?
KlausGraf - am Freitag, 12. Oktober 2012, 19:25 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die EU-Kommission fordert Patrick Breyer auf, Dokumente über die Vorratsdatenspeicherung von seiner Webseite zu entfernen. Das geht aus einem Schreiben der Brüsseler Behörde hervor, das der Fraktionsvorsitzende der Piratenpartei Schleswig-Holstein auf seiner Webseite veröffentlichte. Die Kommission stört sich daran, dass die Öffentlichkeit Kritik üben könnte.
https://netzpolitik.org/2012/klagedrohung-eu-kommission-will-dokumente-zur-vorratsdatenspeicherung-aus-dem-internet-entfernen/
Es gibt aber bereits einige Spiegel für die Dateien. Der Streisand-Effekt lässt grüßen!
https://netzpolitik.org/2012/klagedrohung-eu-kommission-will-dokumente-zur-vorratsdatenspeicherung-aus-dem-internet-entfernen/
Es gibt aber bereits einige Spiegel für die Dateien. Der Streisand-Effekt lässt grüßen!
KlausGraf - am Freitag, 12. Oktober 2012, 18:22 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Mikrofilm ist tot!? Aber er erfüllt seine Aufgabe selbst in diesem Zustand prächtig!
Seit Ende 2004 "werbe" ich – damals noch als Mitarbeiter eines gemeinsamen Projektes des Landesarchivs Baden-Württemberg und der Universitätsbibliothek Stuttgart – für die Nutzung des laserbelichteten Farbmikrofilms im Archiv. Mit unserer Firma archium setze ich diese Arbeit seit 2008 fort. Ich hielt darüber Vorträge und betrieb gemeinsam mit der Firma Media de Lux Messestände auf Archivtagen, Bibliothekartagen, der Archiving-Conference, der Messe Denkmal und sehr zahlreichen Hausmessen. Auf dem Dresdner Bibliothekartag 2005 wurde ich bei der Ankündigung meines "rückwärtsgewandten" Vortrages zu diesem "ausgestorbenen Medium" noch regelrecht ausgelacht. Und in den Folgejahren wurden wir mindestens belächelt, wenn wir über dieses Thema gemeinsam referierten. "Wir", das sind in regelmäßigen Abständen das Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik IPM, der Filmhersteller Ilford, die Firmen archium und Media de Lux und der Experte für visuelle Binärdatensicherung Christoph Voges von der TU Braunschweig. Und nicht selten haben wir Zuspruch aus dem Publikum erhalten von Vertretern des Landesarchivs Baden-Württemberg, dem Bundesarchiv und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK, welches den laserbelichteten Farbmikrofilm seit 2010 nämlich nutzt (http://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2010/Kulturgutschutz_Sicherungsverfilmung_Weimar.html).
Meistens aber wurden wir belächelt wenn wir Katastrophenszenarien aufzeigten. Unter dem Eindruck des Brandes von Weimar oder dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs wurde manch einer zwar nachdenklich – doch dann wurden wieder die Stimmen derer laut, die nun erst recht zur Digitalisierung rieten, als Maßnahme zur Informationserhaltung am physischen Verlust vorbei. Und hierfür standen öffentliche Gelder bereit.
Über ein weiteres Szenario aber kann man seit heute nicht mehr lachen: Den Diebstahl von Daten aus sicher geglaubten sensiblen digitalen Systemen. Was nun im Kreiskrankenhaus Rastatt und dem Klinikum Mittelbaden durch den Diebstahl von Datensicherungsbändern mit 200.000 bis 300.000 Patientendaten passiert ist (http://www.klinikum-mittelbaden.de/internet/datenschutz.php Stand 12.11.2012 9:00 Uhr), sollte bei jedem, der sensible Daten verwaltet und archiviert, alle Alarmglocken schrillen lassen!
Natürlich können auch Mikrofilme gestohlen werden. Doch es ist anzunehmen, daß das, was die Diebe mit diesen Daten vorhaben, auf einem analogen Medium unendlich schwerer wäre, möglicherweise sogar so unattraktiv schwierig, daß ein Massendiebstahl vielleicht gar nicht, schlimmstenfalls ein Einzeldiebstahl stattgefunden hätte.
Was steht dem Kreiskrankenhaus Rastatt und dem Klinikum Mittelbaden nun bevor? Vielleicht ein teurer Rückkauf entführter Daten? Gewiß wird man sowas erwogen und die Chance dazu vielleicht sogar erhofft haben, in den letzten Wochen, nachdem der Datenklau schon am 19. September stattgefunden hatte, wie die Welt online schreibt (http://www.welt.de/wirtschaft/article109779761/Zehntausende-Datensaetze-aus-Kliniken-verschwunden.html). Denn viel teurer wiegen werden jetzt die zahllosen Schadensersatzforderungen, die mit Sicherheit gestellt werden. Das Klinikum mit seiner Nachweispflicht hat auf einen Schlag jegliche Rechtssicherheit verloren!
Wieviel Geld hätten die jetzt erpressbaren Krankenhäuser selbst mit einer einfachen Sicherheitsverfilmung gespart, wenn nun wenigstens analoge Kopien noch vorhanden wären?
Dabei ist es heute doch sogar möglich, gerade auch visualisierbare digitale Ausgangsdaten hochaufgelöst und laserpunktgenau in Farbe auf alterungsbeständigem Mikrofilm zu sichern! Daß das Aussehen und der Zustand der in den digitalen Daten gespeicherten Informationen dabei sehr authentisch und ziemlich fälschungssicher auf den Zeitpunkt der Belichtung eingefroren wird, sollte nicht nur in Krankenhausarchiven mit ihrem rechtlich sehr sensiblen Archivgut relevant sein. Denn selbst wenn diese Datenbänder jemals wieder auftauchen sollten, wer kann dann noch garantieren, daß nicht trotzdem zwischendurch ein Kopiervorgang oder eine Datenmanipulation stattgefunden hat?
Ich habe sehr oft erlebt, daß Archivare den analogen Mikrofilm durchaus schätzen, diesem heute aber trotzdem eine adäquate digitale Alternative vorziehen würden und in der Hoffnung, diese könne es irgendwann einmal geben, lieber weiter darauf warten. Vielen fällt es schwer, sich wieder diesem "ausgestorbenen" Medium zuzuwenden, gerade weil doch mancherorts eben erst sehr viel Geld in die Hand genommen wurde, um das alte Mikrofilmarchiv zu digitalisieren.
Bei diesem Denken wird aber ausgeblendet, daß digital kodierte Datenträger eines grundsätzlich niemals können, was analoge Medien sind: Analoge Medien sind physisch vorhanden. Deshalb müssen sie auch physisch dupliziert werden, sind dafür aber von gesunden Menschen physisch verwendbar. Dabei endet ihr Sicherungsvermögen nicht abrupt, sondern erkennbar und allmählich. Und solange kein geeigneteres analoges Medium existiert, spielt es doch keine Rolle, daß der Mikrofilm veraltet und unmodern ist?
Der Mikrofilm ist keineswegs tot! Er ist nur sehr konservativ! Im wahrsten Sinne des Wortes.
Klaus Wendel
Seit Ende 2004 "werbe" ich – damals noch als Mitarbeiter eines gemeinsamen Projektes des Landesarchivs Baden-Württemberg und der Universitätsbibliothek Stuttgart – für die Nutzung des laserbelichteten Farbmikrofilms im Archiv. Mit unserer Firma archium setze ich diese Arbeit seit 2008 fort. Ich hielt darüber Vorträge und betrieb gemeinsam mit der Firma Media de Lux Messestände auf Archivtagen, Bibliothekartagen, der Archiving-Conference, der Messe Denkmal und sehr zahlreichen Hausmessen. Auf dem Dresdner Bibliothekartag 2005 wurde ich bei der Ankündigung meines "rückwärtsgewandten" Vortrages zu diesem "ausgestorbenen Medium" noch regelrecht ausgelacht. Und in den Folgejahren wurden wir mindestens belächelt, wenn wir über dieses Thema gemeinsam referierten. "Wir", das sind in regelmäßigen Abständen das Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik IPM, der Filmhersteller Ilford, die Firmen archium und Media de Lux und der Experte für visuelle Binärdatensicherung Christoph Voges von der TU Braunschweig. Und nicht selten haben wir Zuspruch aus dem Publikum erhalten von Vertretern des Landesarchivs Baden-Württemberg, dem Bundesarchiv und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK, welches den laserbelichteten Farbmikrofilm seit 2010 nämlich nutzt (http://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2010/Kulturgutschutz_Sicherungsverfilmung_Weimar.html).
Meistens aber wurden wir belächelt wenn wir Katastrophenszenarien aufzeigten. Unter dem Eindruck des Brandes von Weimar oder dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs wurde manch einer zwar nachdenklich – doch dann wurden wieder die Stimmen derer laut, die nun erst recht zur Digitalisierung rieten, als Maßnahme zur Informationserhaltung am physischen Verlust vorbei. Und hierfür standen öffentliche Gelder bereit.
Über ein weiteres Szenario aber kann man seit heute nicht mehr lachen: Den Diebstahl von Daten aus sicher geglaubten sensiblen digitalen Systemen. Was nun im Kreiskrankenhaus Rastatt und dem Klinikum Mittelbaden durch den Diebstahl von Datensicherungsbändern mit 200.000 bis 300.000 Patientendaten passiert ist (http://www.klinikum-mittelbaden.de/internet/datenschutz.php Stand 12.11.2012 9:00 Uhr), sollte bei jedem, der sensible Daten verwaltet und archiviert, alle Alarmglocken schrillen lassen!
Natürlich können auch Mikrofilme gestohlen werden. Doch es ist anzunehmen, daß das, was die Diebe mit diesen Daten vorhaben, auf einem analogen Medium unendlich schwerer wäre, möglicherweise sogar so unattraktiv schwierig, daß ein Massendiebstahl vielleicht gar nicht, schlimmstenfalls ein Einzeldiebstahl stattgefunden hätte.
Was steht dem Kreiskrankenhaus Rastatt und dem Klinikum Mittelbaden nun bevor? Vielleicht ein teurer Rückkauf entführter Daten? Gewiß wird man sowas erwogen und die Chance dazu vielleicht sogar erhofft haben, in den letzten Wochen, nachdem der Datenklau schon am 19. September stattgefunden hatte, wie die Welt online schreibt (http://www.welt.de/wirtschaft/article109779761/Zehntausende-Datensaetze-aus-Kliniken-verschwunden.html). Denn viel teurer wiegen werden jetzt die zahllosen Schadensersatzforderungen, die mit Sicherheit gestellt werden. Das Klinikum mit seiner Nachweispflicht hat auf einen Schlag jegliche Rechtssicherheit verloren!
Wieviel Geld hätten die jetzt erpressbaren Krankenhäuser selbst mit einer einfachen Sicherheitsverfilmung gespart, wenn nun wenigstens analoge Kopien noch vorhanden wären?
Dabei ist es heute doch sogar möglich, gerade auch visualisierbare digitale Ausgangsdaten hochaufgelöst und laserpunktgenau in Farbe auf alterungsbeständigem Mikrofilm zu sichern! Daß das Aussehen und der Zustand der in den digitalen Daten gespeicherten Informationen dabei sehr authentisch und ziemlich fälschungssicher auf den Zeitpunkt der Belichtung eingefroren wird, sollte nicht nur in Krankenhausarchiven mit ihrem rechtlich sehr sensiblen Archivgut relevant sein. Denn selbst wenn diese Datenbänder jemals wieder auftauchen sollten, wer kann dann noch garantieren, daß nicht trotzdem zwischendurch ein Kopiervorgang oder eine Datenmanipulation stattgefunden hat?
Ich habe sehr oft erlebt, daß Archivare den analogen Mikrofilm durchaus schätzen, diesem heute aber trotzdem eine adäquate digitale Alternative vorziehen würden und in der Hoffnung, diese könne es irgendwann einmal geben, lieber weiter darauf warten. Vielen fällt es schwer, sich wieder diesem "ausgestorbenen" Medium zuzuwenden, gerade weil doch mancherorts eben erst sehr viel Geld in die Hand genommen wurde, um das alte Mikrofilmarchiv zu digitalisieren.
Bei diesem Denken wird aber ausgeblendet, daß digital kodierte Datenträger eines grundsätzlich niemals können, was analoge Medien sind: Analoge Medien sind physisch vorhanden. Deshalb müssen sie auch physisch dupliziert werden, sind dafür aber von gesunden Menschen physisch verwendbar. Dabei endet ihr Sicherungsvermögen nicht abrupt, sondern erkennbar und allmählich. Und solange kein geeigneteres analoges Medium existiert, spielt es doch keine Rolle, daß der Mikrofilm veraltet und unmodern ist?
Der Mikrofilm ist keineswegs tot! Er ist nur sehr konservativ! Im wahrsten Sinne des Wortes.
Klaus Wendel
Klaus Wendel - am Freitag, 12. Oktober 2012, 10:58 - Rubrik: Digitale Unterlagen
Im Vergleich zur Reverse-Bildersuche von http://www.tineye.com/ ist http://images.google.de außerordentlich ergiebig, wenn es darum geht, Bildnutzungen zu einem gegebenen Bild ausfindig zu machen.
Beispiel: http://goo.gl/eBUU4
Tipp: Immer auf Alle Größen klicken, sonst entgehen einem unter Umständen Treffer.
Beispiel: http://goo.gl/eBUU4
Tipp: Immer auf Alle Größen klicken, sonst entgehen einem unter Umständen Treffer.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 12. Oktober 2012, 01:20 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://de.slideshare.net/archaeologienockemann/dasprojekt-digitalisierung-der-archologischen-sammlung-des-landesmuseums-detmold
Die Präsentation ist vielleicht auch für manche Archive von Interesse.
Die Präsentation ist vielleicht auch für manche Archive von Interesse.
KlausGraf - am Freitag, 12. Oktober 2012, 01:16 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://rkb.hypotheses.org/267
Dazu habe ich als Kommentar geschrieben, der nicht freigeschaltet wurde:
Mit über 120 wissenschaftlichen Beiträgen in Archivalia http://archiv.twoday.net/search?q=%23forschung darf ich wohl für mich in den Geisteswissenschaften in Anspruch nehmen, derjenige Blogger zu sein, der Forschungsmiszellen am intensivsten in ein Blog einbringt. Zugleich kann ich seit 1975 auf weit über 200 gedruckte wissenschaftliche Veröffentlichungen zurückblicken, von welchen genau eine (1), gemeinsam mit Mareike König verfasste zum Thema Bloggen bisher ein Peer Review durchlaufen hat (im Druck). Das in den Geiseswissenschaften vor kurzem dominierende Herausgeber- bzw. Redaktions-Review hat nicht zu eklatanten Missständen geführt, während umgekehrt das Peer Review nicht automatisch für größere Qualität bürgt.
Abgesehen davon, dass ich anderes wichtiger fand, ist die Frage der Qualitätssicherung sicher auch ein Grund, dass die von mir angedachte Zeitschrift “Historische Miszellen” noch nicht über ein vages Planungsstadium hinaus kam. Von der ZfdA weiß ich, dass der Herausgeber das neu eingeführte Peer Review sehr positiv sieht. Auch große Namen wurden nicht reingelassen. Letztlich halte ich es aber mit Kohles “Publish first, filter later” und der Einsicht, dass sich Qualität (oft) letztlich durchsetzt und der wissenschaftliche Rezipient am besten beurteilen kann, was ein Blogbeitrag bzw. ein gedruckter Artikel wirklich leistet, wenn er Quellenkritik beherrscht.
Archivalia wird durchaus in gedruckten Publikationen (sogar der HZ) zitiert.
Hinweisen möchte ich auch auf K. H. Schneider Plädoyer für eine Gegenöffentlichkeit:
http://digireg.twoday.net/stories/156260895/
Dass Bloggen Schreibblockaden lösen kann, ist unbestreitbar richtig, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Die großen halb- oder dreiviertelrecherchierten Aufsätze bleiben bei mir nach wie vor in der Schublade, ich fange gern Neues an, ohne Altes zu Ende zu führen, aber bei überschaubaren Themen blogge ich lieber darüber.
Dazu habe ich als Kommentar geschrieben, der nicht freigeschaltet wurde:
Mit über 120 wissenschaftlichen Beiträgen in Archivalia http://archiv.twoday.net/search?q=%23forschung darf ich wohl für mich in den Geisteswissenschaften in Anspruch nehmen, derjenige Blogger zu sein, der Forschungsmiszellen am intensivsten in ein Blog einbringt. Zugleich kann ich seit 1975 auf weit über 200 gedruckte wissenschaftliche Veröffentlichungen zurückblicken, von welchen genau eine (1), gemeinsam mit Mareike König verfasste zum Thema Bloggen bisher ein Peer Review durchlaufen hat (im Druck). Das in den Geiseswissenschaften vor kurzem dominierende Herausgeber- bzw. Redaktions-Review hat nicht zu eklatanten Missständen geführt, während umgekehrt das Peer Review nicht automatisch für größere Qualität bürgt.
Abgesehen davon, dass ich anderes wichtiger fand, ist die Frage der Qualitätssicherung sicher auch ein Grund, dass die von mir angedachte Zeitschrift “Historische Miszellen” noch nicht über ein vages Planungsstadium hinaus kam. Von der ZfdA weiß ich, dass der Herausgeber das neu eingeführte Peer Review sehr positiv sieht. Auch große Namen wurden nicht reingelassen. Letztlich halte ich es aber mit Kohles “Publish first, filter later” und der Einsicht, dass sich Qualität (oft) letztlich durchsetzt und der wissenschaftliche Rezipient am besten beurteilen kann, was ein Blogbeitrag bzw. ein gedruckter Artikel wirklich leistet, wenn er Quellenkritik beherrscht.
Archivalia wird durchaus in gedruckten Publikationen (sogar der HZ) zitiert.
Hinweisen möchte ich auch auf K. H. Schneider Plädoyer für eine Gegenöffentlichkeit:
http://digireg.twoday.net/stories/156260895/
Dass Bloggen Schreibblockaden lösen kann, ist unbestreitbar richtig, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Die großen halb- oder dreiviertelrecherchierten Aufsätze bleiben bei mir nach wie vor in der Schublade, ich fange gern Neues an, ohne Altes zu Ende zu führen, aber bei überschaubaren Themen blogge ich lieber darüber.
Zu ihnen liegt der neue Artikel von Wilfried Sponsel vor:
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45736
Sponsel klammert die interessanteste Frage, nämlich die ständegeschichtliche Einordnung der ursprünglichen Edelherren, die im 16. Jahrhundert "einfache" Reichsritter sind (also keine "Herren" im Sinne des Stands der Grafen und Herren) aus.
Im Literaturverzeichnis wird Lausser 1990 vermisst, zitiert bei
http://books.google.de/books?id=-V4jhcJqY-UC&pg=PA430
Die Redaktion vom Historischen Lexikon Bayerns hat sich wieder viel Mühe gegeben, alles zu ignorieren, was ich hier über dieses Nachschlagewerk schrieb. Andere Artikel verlinken die ZBLG-Artikel, die online sind, dieser nicht. Auch Kudorfers Nördlingen-Band ist online, von dem Aufsatz von Bauer ganz zu schweigen:
http://bavarica.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10333424_00170.html
Wieso man dem Artikel nicht einmal eine Wappenabbildung spendiert hat? Die Wikipedia hat eine schöne Illustration, bezeichnenderweise aus dem Bestand der MDZ-Digitalisate.
Zu Hildegard von Hürnheim habe ich mich 1999 kurz aber zutreffend geäußert, die Zuschreibung wird in der Literatur seither überwiegend nicht mehr vertreten:
http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/1999/0310.html

http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45736
Sponsel klammert die interessanteste Frage, nämlich die ständegeschichtliche Einordnung der ursprünglichen Edelherren, die im 16. Jahrhundert "einfache" Reichsritter sind (also keine "Herren" im Sinne des Stands der Grafen und Herren) aus.
Im Literaturverzeichnis wird Lausser 1990 vermisst, zitiert bei
http://books.google.de/books?id=-V4jhcJqY-UC&pg=PA430
Die Redaktion vom Historischen Lexikon Bayerns hat sich wieder viel Mühe gegeben, alles zu ignorieren, was ich hier über dieses Nachschlagewerk schrieb. Andere Artikel verlinken die ZBLG-Artikel, die online sind, dieser nicht. Auch Kudorfers Nördlingen-Band ist online, von dem Aufsatz von Bauer ganz zu schweigen:
http://bavarica.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10333424_00170.html
Wieso man dem Artikel nicht einmal eine Wappenabbildung spendiert hat? Die Wikipedia hat eine schöne Illustration, bezeichnenderweise aus dem Bestand der MDZ-Digitalisate.
Zu Hildegard von Hürnheim habe ich mich 1999 kurz aber zutreffend geäußert, die Zuschreibung wird in der Literatur seither überwiegend nicht mehr vertreten:
http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/1999/0310.html

KlausGraf - am Donnerstag, 11. Oktober 2012, 20:34 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Kirchenbuch ist sehr gut erhalten, nur einzelne Seiten müssen restauriert und stabilisiert werden", sagte Archivdirektor Christoph Schmider über das Kirchenbuch aus St. Laurentius in Hemsbach. Das Register war dem "Verein für Computer-Genealogie" angeboten worden. "Wir sind angerufen worden, dass man in einem Nachlass ein altes Buch gefunden habe und ob wir es wollten", berichtete Vereinsmitglied Marie-Luise Carl. Aufgrund von Fotos sei schnell klar gewesen, um was für einen Fund es sich handelte. "Solche Bücher sind Kircheneigentum und kein Privatbesitz. Deswegen haben wir es gegen einen Finderlohn angenommen und sind froh, es dem rechtmäßigen Besitzer wieder zurückgeben zu können", sagt Carl. Sie brachte das Buch persönlich von Erkrath bei Düsseldorf nach Freiburg.
http://www.domradio.de/aktuell/84458/verschollenes-kirchenbuch-wieder-aufgetaucht.html
Via
http://nachrichten.geneanet.org/index.php/post/2012/10/Verschollenes-Kirchenbuch-wieder-aufgetaucht-Sensationsfund-im-Erzbistum-Freiburg.html
http://www.domradio.de/aktuell/84458/verschollenes-kirchenbuch-wieder-aufgetaucht.html
Via
http://nachrichten.geneanet.org/index.php/post/2012/10/Verschollenes-Kirchenbuch-wieder-aufgetaucht-Sensationsfund-im-Erzbistum-Freiburg.html
KlausGraf - am Donnerstag, 11. Oktober 2012, 18:22 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Probleme mit den §§ 52a, 52b UrhG und den verwaisten Werken bespricht:
http://bildungsklick.de/a/85524/illegal-im-lesesaal/
Dazu passt vielleicht auch ein sarkastischer Beitrag von Dr. jur. Eric Steinhauer in INETBIB unter dem Betreff "Klartext: Suppenküche Öffentliche Bibliothek":
in einer Pressemitteilung auf börsenblatt.net, in der ein neues
Geschäftsmodell für die Direkt-Ausleihe von eBooks über Verlage bzw. Verwerter direkt an Leser vorgestellt wird, spricht Herr Ulmer vom Börsenverein bemerkenswerten Klartext:
"Längst sprächen die Bibliotheken nicht mehr ihre ursprüngliche, eher einkommensschwache Zielgruppe an, sondern einen wesentlich größeren Nutzerkreis."
Quelle: http://www.boersenblatt.net/552865/
Öffentliche Bibliotheken sind also für sozialschwache Bevölkerungskreise da. Wer den hermeneutischen Schlüssel für die Unterfinanzierung von Bibliotheken im Vergleich zur so genannten Hochkultur sucht, hier ist er. Bibliotheken sind nicht Bildungs- oder Kultureinrichtungen, wie man immer denkt, sondern ressortieren offenbar bei der Armenfürsorge. Da die Sozialbudgets bekanntlich die größten sind, sind das doch tolle Aussichten.
Außerdem können sich interessante neue Kooperationsmöglichkeiten mit dem Buchhandel ergeben, denn die örtliche "Büchertafel" nimmt sicher gerne Ladenhüter und Remittenden, die die Besserverdienenden nicht haben wollen, in ihren Bestand auf. Geschenkt, versteht sich. :)
http://bildungsklick.de/a/85524/illegal-im-lesesaal/
Dazu passt vielleicht auch ein sarkastischer Beitrag von Dr. jur. Eric Steinhauer in INETBIB unter dem Betreff "Klartext: Suppenküche Öffentliche Bibliothek":
in einer Pressemitteilung auf börsenblatt.net, in der ein neues
Geschäftsmodell für die Direkt-Ausleihe von eBooks über Verlage bzw. Verwerter direkt an Leser vorgestellt wird, spricht Herr Ulmer vom Börsenverein bemerkenswerten Klartext:
"Längst sprächen die Bibliotheken nicht mehr ihre ursprüngliche, eher einkommensschwache Zielgruppe an, sondern einen wesentlich größeren Nutzerkreis."
Quelle: http://www.boersenblatt.net/552865/
Öffentliche Bibliotheken sind also für sozialschwache Bevölkerungskreise da. Wer den hermeneutischen Schlüssel für die Unterfinanzierung von Bibliotheken im Vergleich zur so genannten Hochkultur sucht, hier ist er. Bibliotheken sind nicht Bildungs- oder Kultureinrichtungen, wie man immer denkt, sondern ressortieren offenbar bei der Armenfürsorge. Da die Sozialbudgets bekanntlich die größten sind, sind das doch tolle Aussichten.
Außerdem können sich interessante neue Kooperationsmöglichkeiten mit dem Buchhandel ergeben, denn die örtliche "Büchertafel" nimmt sicher gerne Ladenhüter und Remittenden, die die Besserverdienenden nicht haben wollen, in ihren Bestand auf. Geschenkt, versteht sich. :)
KlausGraf - am Donnerstag, 11. Oktober 2012, 16:06 - Rubrik: Archivrecht
Das Gericht sah in dem Scannen und Zugänglichmachen der geschützten Bücher für Blinde und vergleichbar Behinderte einen klaren Fall von Fair Use.
Links dazu
http://archivalia.tumblr.com/post/33362742451/judge-rules-in-authors-guild-v-hathitrust-lj
Update: Wenig informierte Heise-Meldung
http://www.heise.de/newsticker/meldung/US-Richter-Googles-Buchdigitalisierung-als-Fair-use-legal-1727613.html
Zum Streit:
http://archiv.twoday.net/stories/38779828/
Links dazu
http://archivalia.tumblr.com/post/33362742451/judge-rules-in-authors-guild-v-hathitrust-lj
Update: Wenig informierte Heise-Meldung
http://www.heise.de/newsticker/meldung/US-Richter-Googles-Buchdigitalisierung-als-Fair-use-legal-1727613.html
Zum Streit:
http://archiv.twoday.net/stories/38779828/
KlausGraf - am Donnerstag, 11. Oktober 2012, 15:44 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
From the Exlibris-List:
The GW database was updated on Oct 5, and here’s (some of) the news:
-- New entries since last “news” message to Exlibris (June 26)
GW 0130650N Almanach auf das Jahr 1475(?), lat. [Augsburg: Anton Sorg]. Broadside
ISTC ia00491770.
Wolfenbüttel HerzogAugustB (Fragment).
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW0130650N.htm (source: Wolfenbüttel)
GW 0633850N Cato, deutsch. [Speyer]: K[onrad] Hist, [um 1497]. 4°
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW0633850N.htm
The copy, formerly in Czech private ownership, is now in the library of the National Museum, Prague (source: Richard Sipek, NM Prague)
GW 0267250N L’Art et science d’arithmétique. Paris: Michel Toulouse, [nicht nach 1496]. 8°
CRF XVIII 45. ISTC ia01140600.
Paris EcBeauxArts.
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW0267250N.htm (source: CRF)
GW M1665050 Laet, Jaspar: Prognostikon auf das Jahr 1499 [Dutch]. Antwerpen: [Govert Bac, nicht vor 8.IV.1498]. 4°
ISTC il00022040.
Brussel BR (Bl. 1 def.).
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M1665050.htm (source: Renaud Adam’s paper in Gutenberg-Jahrbuch 2012, pp. 157-64, and personal communication)
GW M2037833 Mancinus, Dominicus: De passione Christi. Daran: Oratio ad virginem. [Paris: Ulrich Gering, um 1484]. 4°
Glasgow UL.
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M2037833.htm (source: Glasgow Incunabula Project: http://www.gla.ac.uk/services/specialcollections/incunabulaproject/a-zofauthorsa-j/mancinusdominicuscarmendepassionechristiparisca1484/#d.en.193491
M3404750 Plenarium, lat. Epistolare et evangeliare per totum annum de tempore et de sanctis. [Köln: Hermann Bungart, um 1498]. 4°
Trier StB (Bl. 1 u. 52 fehlen)
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M3404750.htm, provisional description (source: Anne-Beate Riecke, Berlin SB, personal communication)
Furthermore:
-- Entries containing links to one or more digitised copies: 11,697
-- A recent online article about the re-dating of what was hitherto considered a 16th-century edition (GW M2046350): Shaw, David J.: “An Unidentified French Incunable: Sir John Mandeville, Le lapidaire en francoys [Lyon, c. 1495–1496]”, Electronic British Library Journal 2012, Article 6 = http://www.bl.uk/eblj/2012articles/article6.html
-- Finally, one of the outstanding incunabula from our own collection has been digitized: the Hebrew Bible GW 4200, Brescia 1494 (shelfmark 4° Inc 2840), with plenty of notes by Martin Luther who owned this copy and used it for his translation of the Bible. The digi is brand new and not yet cross-referenced in GW. URL: http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB000099B400000000
Best, Falk
Dr. Falk Eisermann
Referatsleiter
Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz
Gesamtkatalog der Wiegendrucke / Inkunabelsammlung
The GW database was updated on Oct 5, and here’s (some of) the news:
-- New entries since last “news” message to Exlibris (June 26)
GW 0130650N Almanach auf das Jahr 1475(?), lat. [Augsburg: Anton Sorg]. Broadside
ISTC ia00491770.
Wolfenbüttel HerzogAugustB (Fragment).
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW0130650N.htm (source: Wolfenbüttel)
GW 0633850N Cato, deutsch. [Speyer]: K[onrad] Hist, [um 1497]. 4°
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW0633850N.htm
The copy, formerly in Czech private ownership, is now in the library of the National Museum, Prague (source: Richard Sipek, NM Prague)
GW 0267250N L’Art et science d’arithmétique. Paris: Michel Toulouse, [nicht nach 1496]. 8°
CRF XVIII 45. ISTC ia01140600.
Paris EcBeauxArts.
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW0267250N.htm (source: CRF)
GW M1665050 Laet, Jaspar: Prognostikon auf das Jahr 1499 [Dutch]. Antwerpen: [Govert Bac, nicht vor 8.IV.1498]. 4°
ISTC il00022040.
Brussel BR (Bl. 1 def.).
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M1665050.htm (source: Renaud Adam’s paper in Gutenberg-Jahrbuch 2012, pp. 157-64, and personal communication)
GW M2037833 Mancinus, Dominicus: De passione Christi. Daran: Oratio ad virginem. [Paris: Ulrich Gering, um 1484]. 4°
Glasgow UL.
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M2037833.htm (source: Glasgow Incunabula Project: http://www.gla.ac.uk/services/specialcollections/incunabulaproject/a-zofauthorsa-j/mancinusdominicuscarmendepassionechristiparisca1484/#d.en.193491
M3404750 Plenarium, lat. Epistolare et evangeliare per totum annum de tempore et de sanctis. [Köln: Hermann Bungart, um 1498]. 4°
Trier StB (Bl. 1 u. 52 fehlen)
http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M3404750.htm, provisional description (source: Anne-Beate Riecke, Berlin SB, personal communication)
Furthermore:
-- Entries containing links to one or more digitised copies: 11,697
-- A recent online article about the re-dating of what was hitherto considered a 16th-century edition (GW M2046350): Shaw, David J.: “An Unidentified French Incunable: Sir John Mandeville, Le lapidaire en francoys [Lyon, c. 1495–1496]”, Electronic British Library Journal 2012, Article 6 = http://www.bl.uk/eblj/2012articles/article6.html
-- Finally, one of the outstanding incunabula from our own collection has been digitized: the Hebrew Bible GW 4200, Brescia 1494 (shelfmark 4° Inc 2840), with plenty of notes by Martin Luther who owned this copy and used it for his translation of the Bible. The digi is brand new and not yet cross-referenced in GW. URL: http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB000099B400000000
Best, Falk
Dr. Falk Eisermann
Referatsleiter
Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz
Gesamtkatalog der Wiegendrucke / Inkunabelsammlung
KlausGraf - am Donnerstag, 11. Oktober 2012, 15:37 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Michael Tangls Tafelwerk ist online:
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/4108548
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/4108548
KlausGraf - am Donnerstag, 11. Oktober 2012, 15:33 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der UB Heidelberg ist sehr zu danken, dass sie erreicht hat, dass die über 130 digitalisierten Handschriften der BAV, die bisher nur in Heidelberg lokal eingesehen werden durften, nun Open Access bereitstehen. Fast alle entstammen dem im 17. Jahrhundert nach Rom entführten Palatina-Bestand.
http://www.bibliotheca-laureshamensis-digital.de/de/virtuelle_bibliothek/bav/uebersicht.html
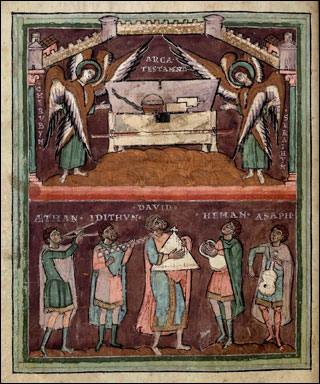
http://www.bibliotheca-laureshamensis-digital.de/de/virtuelle_bibliothek/bav/uebersicht.html
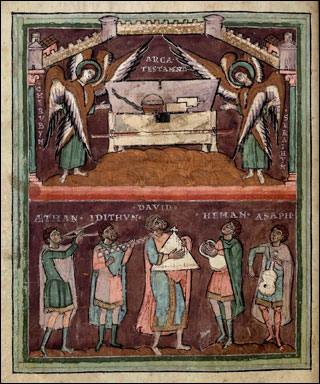
KlausGraf - am Donnerstag, 11. Oktober 2012, 15:04 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Blog "siwiarchiv.de" stellt heute in seiner kleinen Reihe "Archivare aus dem Kreisgebiet", Wilhelm Güthling, Siegener Stadtarchivar von 1948 bis 1971, vor.
Die biographische Notizen zeigen einen Archivaren, der während des Zweiten Weltkriegs im "West-Einsatz" (Frankreich und Belgien) tätig war. In der frühen Bundesrepublik nutzte er seine guten Kontakte aus Vorkriegs- (2. Lehrgang am Berliner Institut für Archivwissenschaft unter Albert Brackmann 1931-1933) und Kriegszeit (Reichsarchiv Potsdam 1938 - 1945), um die siegerländische Geschichtsforschung voranzutreiben.
Archivhistorisch interessant: 1962 gehörte er zu den Gründungsmitglieder eines, nur kurz bestehenden Landesverbandes des VdA. 1964 organisierte er den Westdeutschen Archivtag in Siegen.
Folgende, während der Recherche ermittelten Quellen und Literatur konnten für die Notizen (noch) nicht ausgewertet werden:
Quellen:
Bundesarchiv, Bestand Militärbefehlshaber Frankreich und nachgeordnete Dienststellen RW 35/407 Verzeichnis der an Frankreich zu stellenden archivalischen Forderungen, alphabetisch nach den einzelnen Archiven geordnet, aufgestellt von Archivrat Dr.Güthling, Sept. 1940
Literatur:
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën: De Duitse Archivschutz in België tijdens de Tweede Wereldoorlog / door Els Herrebout. – Brussel 1997
Brackmann, Albert: Bericht über den zweiten Lehrgang am Institut für Archivwissenschaft und geschichtswissenschaftliche Fortbildung in Berlin-Dahlem vom 2. November 1931 bis 18. März 1933, 1933, 12 S.
Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1970, S. 928
Franz Herberhold, Archivpflege – wesenhafter Bestandteil der landschaftlichen Kulturpflege, in: Selbstverwaltung einer Landschaft. Initiativen und Aufgaben am Beispiel Westfalens, hg. von Ludger Baumeister und Helmut Naunin, Stuttgart 1967 (= Verwaltung und Wirtschaft, Heft 35), S. 133 – 176 (mit Quellenanhang).
Els Herrebout Die deutsche Archivpolitik in Belgien während des Zweiten Weltkriegs Archives Générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces Brussel 2010
Wolfgang Leesch: Die deutschen Archivare 1500 – 1945, München 1985, S. 207
Torsten Musial: Staatsarchive im Dritten Reich: zur Geschichte des staatlichen Archivwesens in Deutschland, 1933-1945, Berlin 1996, s. 154, 194
Ulrich Pfeil, Archivraub und historische Deutungsmacht. Ein anderer Einblick in die deutsche Besatzungspolitik in Frankreich, in: Francia, Band 33,Ausgabe 3, 2006, S. 163-194
Helmut Richtering, Fünfzig Jahre landschaftliche Archivpflege. Die Sorge um die nichtstaatlichen Archive in Westfalen, in: Archivpflege in Westfalen und Lippe, Heft 9, 1977, S. 3 – 15.
Dieter Scriverius: Geschichte des Nordrhein-westfälischen Hauptstaatsarchivs, Düsseldorf 1983
Johanna Weiser: Geschichte der preußischen Archivverwaltung und ihrer Leiter, 2000
Die biographische Notizen zeigen einen Archivaren, der während des Zweiten Weltkriegs im "West-Einsatz" (Frankreich und Belgien) tätig war. In der frühen Bundesrepublik nutzte er seine guten Kontakte aus Vorkriegs- (2. Lehrgang am Berliner Institut für Archivwissenschaft unter Albert Brackmann 1931-1933) und Kriegszeit (Reichsarchiv Potsdam 1938 - 1945), um die siegerländische Geschichtsforschung voranzutreiben.
Archivhistorisch interessant: 1962 gehörte er zu den Gründungsmitglieder eines, nur kurz bestehenden Landesverbandes des VdA. 1964 organisierte er den Westdeutschen Archivtag in Siegen.
Folgende, während der Recherche ermittelten Quellen und Literatur konnten für die Notizen (noch) nicht ausgewertet werden:
Quellen:
Bundesarchiv, Bestand Militärbefehlshaber Frankreich und nachgeordnete Dienststellen RW 35/407 Verzeichnis der an Frankreich zu stellenden archivalischen Forderungen, alphabetisch nach den einzelnen Archiven geordnet, aufgestellt von Archivrat Dr.Güthling, Sept. 1940
Literatur:
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën: De Duitse Archivschutz in België tijdens de Tweede Wereldoorlog / door Els Herrebout. – Brussel 1997
Brackmann, Albert: Bericht über den zweiten Lehrgang am Institut für Archivwissenschaft und geschichtswissenschaftliche Fortbildung in Berlin-Dahlem vom 2. November 1931 bis 18. März 1933, 1933, 12 S.
Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1970, S. 928
Franz Herberhold, Archivpflege – wesenhafter Bestandteil der landschaftlichen Kulturpflege, in: Selbstverwaltung einer Landschaft. Initiativen und Aufgaben am Beispiel Westfalens, hg. von Ludger Baumeister und Helmut Naunin, Stuttgart 1967 (= Verwaltung und Wirtschaft, Heft 35), S. 133 – 176 (mit Quellenanhang).
Els Herrebout Die deutsche Archivpolitik in Belgien während des Zweiten Weltkriegs Archives Générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces Brussel 2010
Wolfgang Leesch: Die deutschen Archivare 1500 – 1945, München 1985, S. 207
Torsten Musial: Staatsarchive im Dritten Reich: zur Geschichte des staatlichen Archivwesens in Deutschland, 1933-1945, Berlin 1996, s. 154, 194
Ulrich Pfeil, Archivraub und historische Deutungsmacht. Ein anderer Einblick in die deutsche Besatzungspolitik in Frankreich, in: Francia, Band 33,Ausgabe 3, 2006, S. 163-194
Helmut Richtering, Fünfzig Jahre landschaftliche Archivpflege. Die Sorge um die nichtstaatlichen Archive in Westfalen, in: Archivpflege in Westfalen und Lippe, Heft 9, 1977, S. 3 – 15.
Dieter Scriverius: Geschichte des Nordrhein-westfälischen Hauptstaatsarchivs, Düsseldorf 1983
Johanna Weiser: Geschichte der preußischen Archivverwaltung und ihrer Leiter, 2000
Wolf Thomas - am Donnerstag, 11. Oktober 2012, 14:30 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=4407
Zitat:
"In ihrem Vortrag „Stadt im Bild 2.0: Digitale Fotosammlungen in der Stadtverwaltung Worms“ ging die Referentin TANJA WOLF (Worms) auf Herausforderungen bei der Archivierung von digitalen Fotosammlungen ein und stellte Lösungsansätze vor. Große Schwierigkeiten bereiteten die durch das digitale Fotografieren ermöglichte Bilderflut und die verschiedenen Arten der Ablage, so Wolf. Um sich zunächst einen Überblick über die an vielen Stellen entstehenden Bilder zu verschaffen, wurde durch das Stadtarchiv Worms ein Fragebogen an ausgewählte Ämter geschickt, mit dem zumindest die wichtigsten Angaben wie beispielsweise Umfang und Formate der verschiedenen Fotosammlungen abgefragt wurden. Des weiteren eröffnet das sogenannte „Cloud-Projekt“, das eigentlich für einen erleichterten Zugang zu den Digitalbildern innerhalb der Stadtverwaltung Worms geplant ist, dem Stadtarchiv die Möglichkeit, die in der Cloud zentral gespeicherten und mit Metadaten versehenen Fotos zu übernehmen, zu bewerten und in geeigneten Bildverwaltungsprogrammen abzulegen. Die von den städtischen Ämtern vergebenen Metadaten können in die Verzeichnungssoftware (hier Augias) automatisch übernommen werden. Wolf betonte in ihrem Fazit, dass eine Vorauswahl der Bilder durch den Bestandsbildner und eine spätere Bewertung der übernommenen Fotos durch das Archiv unumgänglich seien, um mit der Masse der digitalen Fotografien umgehen zu können"
Das ist Unsinn. Die gängige Praxis, AV-Unterlagen, zurückhaltend zu bewerten, ist richtig. Die pure Masse ist kein Grund zur Löschung, was "Bewertung" ja letztlich bedeutet. Wenn die Bilder ordentliche Metadaten haben, kann man es durchaus künftigen Generationen überlassen, das zu nutzen, was bedeutsam ist. Wir archivieren auf Vorrat und im digitalen Bereich stellt sich das Platzproblem nicht (wenngleich es andere Probleme mit der Langzeitarchivierung gibt).
Zitat:
"In ihrem Vortrag „Stadt im Bild 2.0: Digitale Fotosammlungen in der Stadtverwaltung Worms“ ging die Referentin TANJA WOLF (Worms) auf Herausforderungen bei der Archivierung von digitalen Fotosammlungen ein und stellte Lösungsansätze vor. Große Schwierigkeiten bereiteten die durch das digitale Fotografieren ermöglichte Bilderflut und die verschiedenen Arten der Ablage, so Wolf. Um sich zunächst einen Überblick über die an vielen Stellen entstehenden Bilder zu verschaffen, wurde durch das Stadtarchiv Worms ein Fragebogen an ausgewählte Ämter geschickt, mit dem zumindest die wichtigsten Angaben wie beispielsweise Umfang und Formate der verschiedenen Fotosammlungen abgefragt wurden. Des weiteren eröffnet das sogenannte „Cloud-Projekt“, das eigentlich für einen erleichterten Zugang zu den Digitalbildern innerhalb der Stadtverwaltung Worms geplant ist, dem Stadtarchiv die Möglichkeit, die in der Cloud zentral gespeicherten und mit Metadaten versehenen Fotos zu übernehmen, zu bewerten und in geeigneten Bildverwaltungsprogrammen abzulegen. Die von den städtischen Ämtern vergebenen Metadaten können in die Verzeichnungssoftware (hier Augias) automatisch übernommen werden. Wolf betonte in ihrem Fazit, dass eine Vorauswahl der Bilder durch den Bestandsbildner und eine spätere Bewertung der übernommenen Fotos durch das Archiv unumgänglich seien, um mit der Masse der digitalen Fotografien umgehen zu können"
Das ist Unsinn. Die gängige Praxis, AV-Unterlagen, zurückhaltend zu bewerten, ist richtig. Die pure Masse ist kein Grund zur Löschung, was "Bewertung" ja letztlich bedeutet. Wenn die Bilder ordentliche Metadaten haben, kann man es durchaus künftigen Generationen überlassen, das zu nutzen, was bedeutsam ist. Wir archivieren auf Vorrat und im digitalen Bereich stellt sich das Platzproblem nicht (wenngleich es andere Probleme mit der Langzeitarchivierung gibt).
KlausGraf - am Donnerstag, 11. Oktober 2012, 00:05 - Rubrik: Staatsarchive
Ich mag den Begriff “Internetsucht” nicht. Als ich vor ein paar Monaten in irgend einem Fragebogen ankreuzen sollte, wie oft ich täglich im Internet bin, kreuzte ich mit gutem Gewissen an: Einmal. Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen.
Habe ich deshalb ein Problem? Ja, klar. Wie unsere ganze Gesellschaft.
Torsten Kleinz
http://notes.computernotizen.de/2012/10/10/ist-es-wirklich-internetsucht/
Habe ich deshalb ein Problem? Ja, klar. Wie unsere ganze Gesellschaft.
Torsten Kleinz
http://notes.computernotizen.de/2012/10/10/ist-es-wirklich-internetsucht/
Sakramentar (Sacramentarium Gregorio-Hadrianum) - MS-D-1
Westfränkisch/Nordwestdeutsch, um 867/72
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/id/3664968
Missale - MS-D-3 : Sakramentar mit Lektionar sowie neumiertem Graduale und Antiphonale
Essen, 2. Hälfte 10. Jh.
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/id/3822299
Liber ordinarius canonicorum ecclesiae Assindiensis - MS-C-47
Köln, 1513
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/id/3603205

Westfränkisch/Nordwestdeutsch, um 867/72
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/id/3664968
Missale - MS-D-3 : Sakramentar mit Lektionar sowie neumiertem Graduale und Antiphonale
Essen, 2. Hälfte 10. Jh.
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/id/3822299
Liber ordinarius canonicorum ecclesiae Assindiensis - MS-C-47
Köln, 1513
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/id/3603205

KlausGraf - am Mittwoch, 10. Oktober 2012, 21:21 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Grundsätzlich geht es ja voll in Ordnung, dass ein Uli Geiger auf der HR-Website vor verbotenen Motiven auf Facebook und im Netz warnt.
http://www.hr-online.de/website/radio/hr4/index.jsp?rubrik=6656&key=standard_document_46267427
Aber ein bisschen Sachkenntnis wäre eindeutig von Vorteil gewesen.
"Eigentlich scheint es ganz einfach: Für die eigene Facebook- oder Internetseite suche ich ein neues Motiv – warum nicht eines aus dem letzten Urlaub in Paris – das stimmungsvolle Eiffelturm-Bild bei Nacht? Das dürfte doch kein Problem sein, denn der Eiffelturm steht – für alle Menschen sichtbar mitten in Paris und es ist mein eigenes, selbst geschossenes Foto. Die Sache ist nur, dass der französische Künstler Pierre Bideau die Beleuchtung des Eiffelturms als Kunstwerk entworfen hat und das Werk damit urheberrechtlich geschützt ist. Tagsüber kann man den Turm knipsen und im Netz publizieren – nachts leider nicht. Wenn man das Bild im Internet publiziert, dann verletzt man das Urheberrecht von Pierre Bideau und dafür könnte seine Firma einen kostenpflichtig abmahnen. Und da kommen schnell ein paar hundert Euro zusammen und kann sogar noch teurer werden."
Das stimmt. Allerdings muss ein französisches Gericht urteilen, wenn der Abmahner so hartnäckig ist, seinen Anspruch gerichtlich zu verfolgen. Ob solche Abmahnungen in Deutschland häufiger erfolgen? Ich bezweifle es. Ein deutsches Gericht beurteilt den Sachverhalt nach deutschem Recht und da gilt - anders als in Frankreich - auch für den nächtlich kunstvoll beleuchteten Eiffelturm die Panoramafreiheit nach § 59 UrhG.
Wir lesen dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Panoramafreiheit
Und speziell zur Eiffelturm-Beleuchtung:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Eiffel_Tower_at_night
Uli Geiger fährt fort:
" Und diese Regelung betrifft nicht nur den Eiffelturm. Auch das Atomium in Brüssel ist geschützt, das Guggenheim-Museum in Bilbao, das Empire State Building in New York, der Louvre in Paris – und das sind nur ein paar Beispiele. Die Liste ließe sich beliebig fortführen."
Daran ist so gut wie nichts richtig.
Für das Atomium gilt das Gleiche wie für den Eiffelturm: Belgien hat keine Panoramafreiheit, der Anspruch kann aber in Ländern mit Panoramafreiheit nicht geltend gemacht werden. In der deutschsprachigen Wikipedia, die sich nach dem Recht von Deutschland, Österreich und der Schweiz richtet, findet sich unbeanstandet ein Atomium-Bild:
http://de.wikipedia.org/wiki/Atomium
Selbstverständlich ist der Louvre, wenn man nicht die moderne Pyramide davor mitfotografiert, gemeinfrei. Für die Pyramide gilt genau dasselbe wie für den nächtlichen Eiffelturm.
Bilbao liegt im Baskenland und das in Spanien, ein Land mit Panoramafreiheit. Daher wundert es nicht, wenn man in der Wikipedia und auf Wikimedia Commons etliche Fotos der spektakulären Architektur antrifft:
http://de.wikipedia.org/wiki/Guggenheim-Museum_Bilbao
Zum Empire State Building lesen wir im Artikel Panoramafreiheit der Wikipedia: "In den USA bedarf man keiner Erlaubnis, urheberrechtlich geschützte Gebäude (vor dem 1. Dezember 1990 geschaffene Gebäude unterliegen nicht dem Copyright) zu fotografieren und die Fotografien genehmigungsfrei zu veröffentlichen, soweit sie sich an öffentlichen Plätzen befinden oder von öffentlichem Verkehrsgrund aus sichtbar sind, ebenso kann man Innenaufnahmen öffentlicher Gebäude genehmigungsfrei veröffentlichen. Dies gilt nur für Gebäude, nicht für Skulpturen, Statuen und Denkmäler." Also darf man auch dieses Gebäude ohne weiteres im Netz zeigen.
"Eine Panoramaaufnahme scheint ja erst einmal unkritisch, allerdings gilt das Panorama-Schutzgesetz nur in Deutschland und in ein paar anderen Ländern. Aber in vielen Ländern mit besonders viel Baukunst, wie Frankreich oder auch Italien – genau da gibt es dieses Panorama-Schutzgesetz eben nicht. Da muss man aufpassen. Es ist wie immer: Dort wo es am schönsten ist, dort ist es auch am teuersten."
Hier wird besonders deutlich, dass Uli Geiger eigentlich gar keine Ahnung von dem hat, worüber er schreibt. Es gibt kein Panorama-Schutzgesetz, vielmehr ist die Panoramafreiheit wie gesagt im Urheberrechtsgesetz und da in § 59 geregelt:
§ 59 UrhG – Werke an öffentlichen Plätzen
(1) Zulässig ist, Werke, die sich bleibend an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, mit Mitteln der Malerei oder Grafik, durch Lichtbild oder durch Film zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Bei Bauwerken erstrecken sich diese Befugnisse nur auf die äußere Ansicht.
(2) Die Vervielfältigungen dürfen nicht an einem Bauwerk vorgenommen werden.
Es stimmt, dass Italien keine Panoramafreiheit kennt. Aber meist wird man ohnehin in Italien keine moderne geschützte Architektur fotografieren, sondern altes Zeug, welches gemeinfrei ist. Und aufpassen muss man auch nicht sonderlich, da mir kein Fall bekannt ist, dass mit Abmahnungen gegen ausländische Internetseiten vorgegangen wurde. In Deutschland kann kein Gericht eine solche Abmahnung bestätigen. Sonst würde auch die deutschsprachige Wikipedia kaum solche Bilder zeigen.
Eine ausgezeichnete Liste der Länder mit Panoramafreiheit unterhält Wikimedia Commons:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Freedom_of_panorama
Man braucht nur auf die grünen Häkchen zu schauen um festzustellen, dass keineswegs nur Deutschland "und ein paar andere Länder" die Veröffentlichung urheberrechtlich geschützter Bauten im Straßenbild erlauben.

Kapiert Uli Geiger wenigstens die Sachlage bei Markenlogos? Leider nein!
"Nicht nur Kunstwerke sind geschützt, sondern auch Marken wie Coca Cola, Maggi, Adidas, Puma und viele mehr. Und da muss man beim Fotografieren richtig aufpassen. Denn Firmen verstehen überhaupt keinen Spaß, wenn man deren Logo abfotografiert und einfach mal für die eigene Seite im Internet verwendet. Da gibt es professionelle Dienstleister, die im Internet gezielt nach derartigen Verstößen Ausschau halten und dann eine kostenpflichtige Abmahnung vorbei schicken. "
Abgemahnt werden kann nur eine Nutzung im geschäftlichen Verkehr bzw. wenn die Marke kennzeichenmäßig eingesetzt wird.
Siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bildrechte#Logos
http://de.wikipedia.org/wiki/Marke_%28Recht%29#Rechte_aus_einer_Marke_.28Markenschutz.29
Daher kann die Wikipedia solche Logos - wenn sie nicht urheberrechtlich geschützt sind - ohne weiteres abbilden. Wer nicht den Eindruck erweckt, dass er die Marke als Herkunftsbezeichnung einsetzt (das ist dem Rechteinhaber vorbehalten), kann nicht abgemahnt werden. Ein Getränkehändler darf das Logo von Coca Cola im Netz nur verwenden, wenn er dazu befugt ist. Wenn ein Privatmann einen Blogeintrag zu Coca-Cola verfasst, darf er selbstverständlich das Logo zeigen.
Uli Geiger: "Bei Kunstwerken sollte man immer den Urheber als Quelle nennen – dann ist schon viel gewonnen."
Man sollte nicht nur bei Kunstwerken, sondern allen genutzten Medien den Urheber angeben. Bei Fotos fällt bei der Abmahnung dann wenigstens der Zuschlag für die unterbliebene Namensnennung weg - es kann aber immer noch sehr teuer werden. Also sehr viel ist da nicht gewonnen.
Uli Geiger: "Man kann nur dringend davon abraten, einfach mal im Netz nach Bildern zu suchen, sich ein schönes Foto 'unter den Nagel zu reißen' und es dann auf der eigenen Facebook-Seite zu veröffentlichen."
Absolut richtig! Aber für eine öffentlichrechtliche Rundfunkanstalt ist das Ausmaß an sonstiger Fehlinformation in dem Artikel erschreckend. Der HR sollte lieber jemand über Recht schreiben lassen, der sich damit auskennt.
Update: Der HR-Beitrag wurde aus dem Netz genommen! Ich hatte eine Beschwerde beim (unzuständigen) Rundfunkrat eingereicht, zuständig wäre die Intendanz gewesen. Gleichwohl teilte der HR am 18.10.2012 mit:
vielen Dank für Ihre E-Mail vom 10. Oktober und Ihre Kritik an dem Beitrag "Vorsicht Falle: Verbotene Motive auf Facebook & Co".
Ihre Kritik an dem Beitrag können wir zwar nicht in allen Punkten teilen, müssen aber mit Bedauern feststellen, dass die rechtlichen Ausführungen in dem Beitrag zu großen Teilen ungenau sind und beim Hörer bzw. Leser eine Fehlvorstellung über die Grenzen rechtlich zulässigen Publizierens von Fotografien im Internet erzeugen. Leider hat der Autor die rechtlichen Aspekte seines Beitrags nicht - wie vorgesehen - mit der hr-Rechtsabteilung abgestimmt.
Der von Ihnen beanstandete Internet-Artikel (der auf dem Hörfunk-Beitrag basiert) wurde inzwischen von der hr4-Website entfernt. Gleiches gilt für ähnliche Artikel zum gleichen Thema, die auf anderen Seiten von www.hr-online.de waren.
Einer unserer Leitsätze lautet: "Wir informieren stets aktuell, sorgfältig recherchiert, kompetent und zuverlässig". Das ist uns in diesem Fall leider nicht gelungen. Das ärgert uns am meisten und dafür entschuldige ich mich.
Bitte bleiben Sie uns weiterhin als kritischer Zuhörer, Zuschauer und User gewogen.
Mit besten Grüßen
Tobias Häuser
Hessischer Rundfunk
Pressesprecher / Leiter Pressestelle
 Foto: Tobias Balzer http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Foto: Tobias Balzer http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://www.hr-online.de/website/radio/hr4/index.jsp?rubrik=6656&key=standard_document_46267427
Aber ein bisschen Sachkenntnis wäre eindeutig von Vorteil gewesen.
"Eigentlich scheint es ganz einfach: Für die eigene Facebook- oder Internetseite suche ich ein neues Motiv – warum nicht eines aus dem letzten Urlaub in Paris – das stimmungsvolle Eiffelturm-Bild bei Nacht? Das dürfte doch kein Problem sein, denn der Eiffelturm steht – für alle Menschen sichtbar mitten in Paris und es ist mein eigenes, selbst geschossenes Foto. Die Sache ist nur, dass der französische Künstler Pierre Bideau die Beleuchtung des Eiffelturms als Kunstwerk entworfen hat und das Werk damit urheberrechtlich geschützt ist. Tagsüber kann man den Turm knipsen und im Netz publizieren – nachts leider nicht. Wenn man das Bild im Internet publiziert, dann verletzt man das Urheberrecht von Pierre Bideau und dafür könnte seine Firma einen kostenpflichtig abmahnen. Und da kommen schnell ein paar hundert Euro zusammen und kann sogar noch teurer werden."
Das stimmt. Allerdings muss ein französisches Gericht urteilen, wenn der Abmahner so hartnäckig ist, seinen Anspruch gerichtlich zu verfolgen. Ob solche Abmahnungen in Deutschland häufiger erfolgen? Ich bezweifle es. Ein deutsches Gericht beurteilt den Sachverhalt nach deutschem Recht und da gilt - anders als in Frankreich - auch für den nächtlich kunstvoll beleuchteten Eiffelturm die Panoramafreiheit nach § 59 UrhG.
Wir lesen dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Panoramafreiheit
Und speziell zur Eiffelturm-Beleuchtung:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Eiffel_Tower_at_night
Uli Geiger fährt fort:
" Und diese Regelung betrifft nicht nur den Eiffelturm. Auch das Atomium in Brüssel ist geschützt, das Guggenheim-Museum in Bilbao, das Empire State Building in New York, der Louvre in Paris – und das sind nur ein paar Beispiele. Die Liste ließe sich beliebig fortführen."
Daran ist so gut wie nichts richtig.
Für das Atomium gilt das Gleiche wie für den Eiffelturm: Belgien hat keine Panoramafreiheit, der Anspruch kann aber in Ländern mit Panoramafreiheit nicht geltend gemacht werden. In der deutschsprachigen Wikipedia, die sich nach dem Recht von Deutschland, Österreich und der Schweiz richtet, findet sich unbeanstandet ein Atomium-Bild:
http://de.wikipedia.org/wiki/Atomium
Selbstverständlich ist der Louvre, wenn man nicht die moderne Pyramide davor mitfotografiert, gemeinfrei. Für die Pyramide gilt genau dasselbe wie für den nächtlichen Eiffelturm.
Bilbao liegt im Baskenland und das in Spanien, ein Land mit Panoramafreiheit. Daher wundert es nicht, wenn man in der Wikipedia und auf Wikimedia Commons etliche Fotos der spektakulären Architektur antrifft:
http://de.wikipedia.org/wiki/Guggenheim-Museum_Bilbao
Zum Empire State Building lesen wir im Artikel Panoramafreiheit der Wikipedia: "In den USA bedarf man keiner Erlaubnis, urheberrechtlich geschützte Gebäude (vor dem 1. Dezember 1990 geschaffene Gebäude unterliegen nicht dem Copyright) zu fotografieren und die Fotografien genehmigungsfrei zu veröffentlichen, soweit sie sich an öffentlichen Plätzen befinden oder von öffentlichem Verkehrsgrund aus sichtbar sind, ebenso kann man Innenaufnahmen öffentlicher Gebäude genehmigungsfrei veröffentlichen. Dies gilt nur für Gebäude, nicht für Skulpturen, Statuen und Denkmäler." Also darf man auch dieses Gebäude ohne weiteres im Netz zeigen.
"Eine Panoramaaufnahme scheint ja erst einmal unkritisch, allerdings gilt das Panorama-Schutzgesetz nur in Deutschland und in ein paar anderen Ländern. Aber in vielen Ländern mit besonders viel Baukunst, wie Frankreich oder auch Italien – genau da gibt es dieses Panorama-Schutzgesetz eben nicht. Da muss man aufpassen. Es ist wie immer: Dort wo es am schönsten ist, dort ist es auch am teuersten."
Hier wird besonders deutlich, dass Uli Geiger eigentlich gar keine Ahnung von dem hat, worüber er schreibt. Es gibt kein Panorama-Schutzgesetz, vielmehr ist die Panoramafreiheit wie gesagt im Urheberrechtsgesetz und da in § 59 geregelt:
§ 59 UrhG – Werke an öffentlichen Plätzen
(1) Zulässig ist, Werke, die sich bleibend an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, mit Mitteln der Malerei oder Grafik, durch Lichtbild oder durch Film zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Bei Bauwerken erstrecken sich diese Befugnisse nur auf die äußere Ansicht.
(2) Die Vervielfältigungen dürfen nicht an einem Bauwerk vorgenommen werden.
Es stimmt, dass Italien keine Panoramafreiheit kennt. Aber meist wird man ohnehin in Italien keine moderne geschützte Architektur fotografieren, sondern altes Zeug, welches gemeinfrei ist. Und aufpassen muss man auch nicht sonderlich, da mir kein Fall bekannt ist, dass mit Abmahnungen gegen ausländische Internetseiten vorgegangen wurde. In Deutschland kann kein Gericht eine solche Abmahnung bestätigen. Sonst würde auch die deutschsprachige Wikipedia kaum solche Bilder zeigen.
Eine ausgezeichnete Liste der Länder mit Panoramafreiheit unterhält Wikimedia Commons:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Freedom_of_panorama
Man braucht nur auf die grünen Häkchen zu schauen um festzustellen, dass keineswegs nur Deutschland "und ein paar andere Länder" die Veröffentlichung urheberrechtlich geschützter Bauten im Straßenbild erlauben.

Kapiert Uli Geiger wenigstens die Sachlage bei Markenlogos? Leider nein!
"Nicht nur Kunstwerke sind geschützt, sondern auch Marken wie Coca Cola, Maggi, Adidas, Puma und viele mehr. Und da muss man beim Fotografieren richtig aufpassen. Denn Firmen verstehen überhaupt keinen Spaß, wenn man deren Logo abfotografiert und einfach mal für die eigene Seite im Internet verwendet. Da gibt es professionelle Dienstleister, die im Internet gezielt nach derartigen Verstößen Ausschau halten und dann eine kostenpflichtige Abmahnung vorbei schicken. "
Abgemahnt werden kann nur eine Nutzung im geschäftlichen Verkehr bzw. wenn die Marke kennzeichenmäßig eingesetzt wird.
Siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bildrechte#Logos
http://de.wikipedia.org/wiki/Marke_%28Recht%29#Rechte_aus_einer_Marke_.28Markenschutz.29
Daher kann die Wikipedia solche Logos - wenn sie nicht urheberrechtlich geschützt sind - ohne weiteres abbilden. Wer nicht den Eindruck erweckt, dass er die Marke als Herkunftsbezeichnung einsetzt (das ist dem Rechteinhaber vorbehalten), kann nicht abgemahnt werden. Ein Getränkehändler darf das Logo von Coca Cola im Netz nur verwenden, wenn er dazu befugt ist. Wenn ein Privatmann einen Blogeintrag zu Coca-Cola verfasst, darf er selbstverständlich das Logo zeigen.
Uli Geiger: "Bei Kunstwerken sollte man immer den Urheber als Quelle nennen – dann ist schon viel gewonnen."
Man sollte nicht nur bei Kunstwerken, sondern allen genutzten Medien den Urheber angeben. Bei Fotos fällt bei der Abmahnung dann wenigstens der Zuschlag für die unterbliebene Namensnennung weg - es kann aber immer noch sehr teuer werden. Also sehr viel ist da nicht gewonnen.
Uli Geiger: "Man kann nur dringend davon abraten, einfach mal im Netz nach Bildern zu suchen, sich ein schönes Foto 'unter den Nagel zu reißen' und es dann auf der eigenen Facebook-Seite zu veröffentlichen."
Absolut richtig! Aber für eine öffentlichrechtliche Rundfunkanstalt ist das Ausmaß an sonstiger Fehlinformation in dem Artikel erschreckend. Der HR sollte lieber jemand über Recht schreiben lassen, der sich damit auskennt.
Update: Der HR-Beitrag wurde aus dem Netz genommen! Ich hatte eine Beschwerde beim (unzuständigen) Rundfunkrat eingereicht, zuständig wäre die Intendanz gewesen. Gleichwohl teilte der HR am 18.10.2012 mit:
vielen Dank für Ihre E-Mail vom 10. Oktober und Ihre Kritik an dem Beitrag "Vorsicht Falle: Verbotene Motive auf Facebook & Co".
Ihre Kritik an dem Beitrag können wir zwar nicht in allen Punkten teilen, müssen aber mit Bedauern feststellen, dass die rechtlichen Ausführungen in dem Beitrag zu großen Teilen ungenau sind und beim Hörer bzw. Leser eine Fehlvorstellung über die Grenzen rechtlich zulässigen Publizierens von Fotografien im Internet erzeugen. Leider hat der Autor die rechtlichen Aspekte seines Beitrags nicht - wie vorgesehen - mit der hr-Rechtsabteilung abgestimmt.
Der von Ihnen beanstandete Internet-Artikel (der auf dem Hörfunk-Beitrag basiert) wurde inzwischen von der hr4-Website entfernt. Gleiches gilt für ähnliche Artikel zum gleichen Thema, die auf anderen Seiten von www.hr-online.de waren.
Einer unserer Leitsätze lautet: "Wir informieren stets aktuell, sorgfältig recherchiert, kompetent und zuverlässig". Das ist uns in diesem Fall leider nicht gelungen. Das ärgert uns am meisten und dafür entschuldige ich mich.
Bitte bleiben Sie uns weiterhin als kritischer Zuhörer, Zuschauer und User gewogen.
Mit besten Grüßen
Tobias Häuser
Hessischer Rundfunk
Pressesprecher / Leiter Pressestelle
 Foto: Tobias Balzer http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Foto: Tobias Balzer http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.deKlausGraf - am Mittwoch, 10. Oktober 2012, 20:19 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 10. Oktober 2012, 18:54 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Neben der schon länger im Netz befindlichen Klerikerdatenbank gibt es nun ein digitales Personenregister zu den publizierten Bänden und eine Volltextsuche:
http://personendatenbank.germania-sacra.de/
http://personendatenbank.germania-sacra.de/
KlausGraf - am Mittwoch, 10. Oktober 2012, 17:45 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
http://googleblog.blogspot.fr/2012/10/bringing-history-to-life.html
"Today you can discover 42 new online historical exhibitions telling the stories behind major events of the last century, including Apartheid, D-Day and the Holocaust. The stories have been put together by 17 partners including museums and cultural foundations who have drawn on their archives of letters, manuscripts, first-hand video testimonials and much more. Much of the material is very moving—and some is on the Internet for the first time. "
"Today you can discover 42 new online historical exhibitions telling the stories behind major events of the last century, including Apartheid, D-Day and the Holocaust. The stories have been put together by 17 partners including museums and cultural foundations who have drawn on their archives of letters, manuscripts, first-hand video testimonials and much more. Much of the material is very moving—and some is on the Internet for the first time. "
KlausGraf - am Mittwoch, 10. Oktober 2012, 17:16 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Grenzüberschreitendes Netzwerk digitaler Geschichtsquellen: Archive als Gedächtnisse der historisch gewachsenen Landschaft Oberrhein (Réseau transfrontalier de sources historiques
numérisées : les archives comme mémoire de l’espace du Rhin supérieur et de sa formation)
Eine kurze Projektbeschreibung (englisch) des im Januar 2013 startenden Projekts findet sich unter http://icar-us.eu/?page_id=3456
numérisées : les archives comme mémoire de l’espace du Rhin supérieur et de sa formation)
Eine kurze Projektbeschreibung (englisch) des im Januar 2013 startenden Projekts findet sich unter http://icar-us.eu/?page_id=3456
J. Kemper - am Mittwoch, 10. Oktober 2012, 10:12 - Rubrik: Landesgeschichte
http://www.stadtbibliothek-neuss.de/index.php?option=com_chronoforms&chronoform=Onleihe
Man kann sich für 10 Euro im Jahr nur für die Onleihe anmelden, wobei das wohl auch für Auswärtige gilt.
Zur Onleihe siehe
http://archiv.twoday.net/search?q=onleihe
Man kann sich für 10 Euro im Jahr nur für die Onleihe anmelden, wobei das wohl auch für Auswärtige gilt.
Zur Onleihe siehe
http://archiv.twoday.net/search?q=onleihe
KlausGraf - am Dienstag, 9. Oktober 2012, 21:22 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nun hat auch die Oxforder Bodleiana, einer von Googles europäischen Partnern, ein eigenes Angebot mit den Googlescans realisiert. (Von den europäischen Partnern trägt die Complutense zu HathiTrust bei, München und Gent bieten die Google-Scans in eigenen Angeboten an.) Man findet die Digitalisate über den OPAC:
http://solo.bodleian.ox.ac.uk
In den Facetten links findet man "Digitized Copies" (heißt es nicht eigentlich im britischen Englisch digitised?). Anders als bei Google und in HathiTrust gilt die Grenze von derzeit 1872 erfreulicherweise nicht. Ich finde sogar einen Titel von 1921:
http://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=OXVU1&docId=oxfaleph013381115
Dass die PDFs CC-BY-NC-SA lizenziert sind, ist natürlich Copyfraud. Das Zeug ist Public Domain, basta.
Sehr hilfreich sind die Listungen mehrbändiger Werke (siehe Screenshot).
Informationen und Anleitung:
http://www.bodleian.ox.ac.uk/news/oxfords-google-books-project-reaches-milestone20121009
http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks
Update: Seit Juni unbemerkt im Netz:
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Google_Book_Search/Partnerbibliotheken/Oxford

http://solo.bodleian.ox.ac.uk
In den Facetten links findet man "Digitized Copies" (heißt es nicht eigentlich im britischen Englisch digitised?). Anders als bei Google und in HathiTrust gilt die Grenze von derzeit 1872 erfreulicherweise nicht. Ich finde sogar einen Titel von 1921:
http://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=OXVU1&docId=oxfaleph013381115
Dass die PDFs CC-BY-NC-SA lizenziert sind, ist natürlich Copyfraud. Das Zeug ist Public Domain, basta.
Sehr hilfreich sind die Listungen mehrbändiger Werke (siehe Screenshot).
Informationen und Anleitung:
http://www.bodleian.ox.ac.uk/news/oxfords-google-books-project-reaches-milestone20121009
http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks
Update: Seit Juni unbemerkt im Netz:
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Google_Book_Search/Partnerbibliotheken/Oxford

KlausGraf - am Dienstag, 9. Oktober 2012, 18:57 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Der ORF gibt eine kurze Zusammenfassung der Causa Girolamini-Bibliothek in Neapel auf Deutsch:
http://oe1.orf.at/artikel/319555
Siehe hier
http://archiv.twoday.net/search?q=girolamini
http://oe1.orf.at/artikel/319555
Siehe hier
http://archiv.twoday.net/search?q=girolamini

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bahnhof_Cochem.jpg
Natürlich nicht lizenzgerecht genutzt. Ich hoffe, alle Bilder sind jugendfrei, ich sehe keine Nippel oder primären Geschlechtsorgane freiliegend.
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/156272262/
KlausGraf - am Dienstag, 9. Oktober 2012, 16:50 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Falk Eisermann berichtet über ein aus der Kirchenbibliothek St. Blasius gestohlenes Manuskript, das bei Bassenge versteigert wurde. Es wurde von Krown & Spellman, of Culver City, CA an eine öffentliche Bibliothek in den USA verkauft, doch Krown & Spellmann weigert sich, die Institution zu benennen. Das ist nur ein weiteres Beispiel für das halbseidene Gebaren der Antiquare.
Englischer Beitrag von Eisermann:
http://archivalia.tumblr.com/post/33224628590/manuscript-stolen-dealer-does-not-support-research
Update:
https://de.wikipedia.org/wiki/Himmelgarten_(Nordhausen)#Die_Himmelgarten-Bibliothek

Englischer Beitrag von Eisermann:
http://archivalia.tumblr.com/post/33224628590/manuscript-stolen-dealer-does-not-support-research
Update:
https://de.wikipedia.org/wiki/Himmelgarten_(Nordhausen)#Die_Himmelgarten-Bibliothek

Eine nützliche Linkzusammenstellung:
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/type=nachrichten&id=1909
Past & Present hat Hobsbawms Artikel in der von ihm mitgegründeten Zeitschrift Open Access zugänglich gemacht:
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/past/hobsbawm.html
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/156270654/
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/type=nachrichten&id=1909
Past & Present hat Hobsbawms Artikel in der von ihm mitgegründeten Zeitschrift Open Access zugänglich gemacht:
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/past/hobsbawm.html
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/156270654/
KlausGraf - am Dienstag, 9. Oktober 2012, 10:40 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Graeme Dunphy (ed.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle. 2 vol., Leiden/Boston (Brill) 2010, LXXXIV–1748 p., ISBN 978-90-04-18464-0, EUR 399,00 wird viel zu positiv angezeigt von Claire de Cazonove in der Francia Recensio:
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2012-3/MA/dunphy_decazanove
"Cette encyclopédie est très utile pour le chercheur." Das bezweifle ich entschieden.
Die elektronische Fassung 2012 steht im Rahmen von Brill Reference Works online zur Verfügung. Laut DBIS hat bislang nur die HU Berlin eine Lizenz, also muss der Einzelkunde mindestens einen 24-stündigen Zugang kaufen (PayPal erforderlich), der gut 8 Euro kostet. Es gibt einen nicht ganz mit der Druckfassung identischen E-Text (die Abweichungen sind nicht dokumentiert), ohne die Möglichkeit, ein Faksimile des Drucks oder auch nur die Seitenzahlen der Druckversion abzurufen. Es versteht sich wohl von selbst, dass das wissenschaftlichen Anforderungen nicht im mindesten genügt. Zugleich habe ich im Frühjahr mir Exzerpte aus den gedruckten Bänden gemacht (vor allem zu Chroniken aus der Zeit der Burgunderkriege und mir vertrauten mitteleuropäischen Werken). Die beiden Bände haben eine durchgehende Paginierung (Bd. 1: A-I, Bd. 2: J-Z).
Das übliche "Ceterum censeo" vorweg: Ein solches Nachschlagewerk sollte Open Access zur Verfügung stehen und mit anderen elektronischen Angeboten (v.a. Digitalisaten von Quellen und Literatur) verknüpft sein. Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/96988260/
Über die Sachartikel kann ich wenig sagen, aber mir fiel auf, dass der Artikel "Heraldry" die deutschsprachige Forschung ignoriert. Die Bildauswahl ist phantasielos, die SW-Reproduktionen sind von denkbar schlechter Qualität, was sich auch in der E-Version nicht geändert hat.
Ab und zu haben renommierte Wissenschaftler (B. Studt, U. Goerlitz, M. Thumser, J. Wolf usw.) die Artikel verfasst, aber bei den von mir durchgesehenen Werk- und Autorenartikeln dominieren doch No-Name-Autoren aus der zweiten oder dritten Reihe, die nicht selten nur einen faden Aufguss des Verfasserlexikon-Artikels auf Englisch zustandebekommen haben. Zu den beiden Artikeln zur Ulmer Historiographie siehe
http://archiv.twoday.net/stories/914849/
Es gibt auch völlig unverständliche Lücken: Wenn man die von mir im Verfasserlexikon traktierte, doch recht marginale "Chronik der Kaiser, Könige und Päpste, sowie der Grafen von Württemberg" aufgenommen hat, hätte man die ungleich wichtigere "Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium" nicht weglassen dürfen.
Die handschriftliche Überlieferung wird nur selten erwähnt. Was zu den Handschriften der Magdeburger Schöppenchronik von Martin Przybilski zu lesen ist, ist schlichtweg falsch. Dass die komplettesten Hss. in Dessau liegen, ist Unsinn. Der Autor hat es vorgezogen, eine Anfrage von mir dazu nicht zu beantworten.
Wie eine moderne Quellenkunde aussehen könnte, zeigt wenigstens ansatzweise meine Burgunderkriege-Seite auf Wikisource:
http://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege (im folgenden zitiert: B.)
Immer wieder stellte ich fest, dass die Autoren den neueren Forschungsstand nicht im Griff haben, dass zentrale Werke fehlen, obwohl man mit ein wenig Googeln in der Regel fündig wird.
Notizen zu einzelnen Artikeln:
Beheim - was soll ein Artikel, in dem die zentrale jüngere Monographie (Niemeyer 2001) fehlt? Die Schweinfurter Hs. ist zerstört, ohne dass dies vermerkt wird.
Birk - wenn man Baumanns Forschungen zitiert, braucht man den Abdruck in der Alemannia nicht zu nennen, siehe auch hier
http://archiv.twoday.net/search?q=kempten+birk
Bollstatter - mein NDB-Artikel fehlt und auch die Ursberg-Übersetzung
http://archiv.twoday.net/stories/5399535/
Bote, Konrad - dass die zentrale Monographie von Funke fehlt, ist unentschuldbar.
Burgmann - es gibt, wie man seit langem weiß, nicht nur die eine Münchner Hs.
http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_00743.html, 2012-10-08
Chronicon Colmariense - ich habe keinen Zweifel an der Identifizierung des Colmarer Dominikanerchronisten mit dem sog. Rudolf von Schlettstadt durch Stefan Georges, die von Joos ausgespart wird:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/hsslink.htm (Stand 1999, mit Zustimmung von Georges veröffentlicht)
Chronicon Elwacense - Eberl hat übersehen
http://periodika.digitale-sammlungen.de/bdlg/Blatt_bsb00000333,00186.html
Fabri Felix - Uwe Israel ohne
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5278/
Besser informieren jetzt die Wikipedia und Klingner im DLL-MA
Gmünder Chronik - das besser Gmünder Kaiserchronik genannte Werk von mir 1987 in meiner Dissertation behandelt, von Ralf Schlechtweg-Jahn fahrig und inkompetent dargestellt: "in a 1585/86 print", recte: 1485/86, print meint üblicherweise Druckgrafik, nicht Druck. "Gmünd was an imperial free city founded by the Saxonian dukes" - interessant, das hat noch niemand behauptet! Es muss "Swabian" heißen. Was sollen die Jahreszahlen am Anfang: 1376-1414? "This is more an imperial than a town chronicle" - es ist überhaupt keine Stadtchronik! Die Hauptquellen werden irreführend abgegeben, da die von mir ermittelte Hauptquelle, die Glossen zu Spechtsharts Chronik, fehlt. Was soll angesichts der vorliegenden Digitalisate das alte Voulliemé-Faksimile unter Texts? Und diese Mängel sind in einem ganz kurzen Artikel vorhanden!
Grünenberg - Kümper wird dem Wappenbuch als historiographischem Zeugnis nicht gerecht, siehe
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5632/
Gundelfingen - Druckfehler "Humanistenkultur" statt "Humanistenlektur". Vgl. auch B.
Historia Welforum - hier hat man den Bock zum Gärtner gemacht, denn den Artikel durfte Leila Werthschulte schreiben:
http://archiv.twoday.net/stories/5531082/
Irenicus - Goerlitz gibt das Todesdatum 1559/64. Das richtige Datum 1553 kennt man dank Seeliger-Zeiss seit 1995 und seit 2004 steht es in der Wikipedia.
Lintner - schwacher Artikel von Thumser, als Lit. nur Pistorius-Struve. "Zum Autor und zur Überlieferung: Jakob Wimpfeling Briefwechsel. Hrsg. von Otto Herding/Dieter Mertens. Bd. 1, München 1990, S. 173 Anm. 6. Bislang ist der gesuchte deutsche Druck der Rolevinck-Fortsetzung nicht ans Licht gekommen; der Pariser Druck von ca. 1525, der sie enthält, ist anscheinend nur in der British Library London und der Bibliothek der Cornell University nachgewiesen." (WWW)
Matthäus von Pappenheim - Thomas Schauerte wird nicht müde, den alten Fehler vom Pariser Doktorat zu wiederholen, der schon in der NDB verbessert worden war, mein Artikel im VL Humanismus (erschienen 2009) ist online:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8759/
Meisterlin - Classen lässt das ²VL weg! Dass 1998 "Cronographia Augustensium = Cronik der Augspurger : nach der Handschrift 158/4 in St. Paul in Kärnten" erschien, hat sich offenkundig immer noch nicht herumgesprochen.
Nauclerus - veraltete, unbrauchbare Lit.
Nicolai de preliis et occasu ducis Burgundie historia - völlig veralteter Forschungsstand, vgl. B. Selbst der Druckfehler Hegenbach statt Hagenbach wurde in der E-Version nicht verbessert.
Öhem - mein jüngerer Aufsatz 2001 ist übersehen
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5278/
Pfettisheim - Wenn Kerstin Pfeiffer die 1994 versteigerte Inkunabel der Hofbibliothek Donaueschingen mit diesem Standort nennt, dann sagt das Einiges über ihre Kompetenz ... Vgl. auch B.
Rötteler Chronik - neue Ausgabe von Schubring 1995 fehlt, siehe
http://www.handschriftencensus.de/20836
Sächsische Weltchronik - Dass Frank Shaw die Monographie von Jürgen Wolf übergeht, hätte nicht passieren dürfen.
Scheneck de Rockenhusen - ²VL fehlt, obwohl daraus von Kerstin Pfeiffer abgeschrieben!
Spechtshart - ²VL, Ausgabe Stiefel und neuere Literatur fehlt, siehe etwa
http://www.handschriftencensus.de/18578
Speyerer-Chronik - das Weglassen meines ²VL-Artikels durch Ursula Kundert ist aus meiner Sicht ein Verstoß gegen die Grundsätze guten wissenschaftlichen Arbeitens. Vgl. auch B.
Stolle - Bünz 2000 fehlt, vgl. B.
Turnierchronik - die dumme Magdeburger These von Stamm ist unkritisch rezipiert, der zentrale Aufsatz von Klaus Arnold fehlt; die Suchfunktion von Archivalia informiert hundertmal besser:
http://archiv.twoday.net/search?q=r%C3%BCxner
Weihenstephaner Chronik - was soll der Aufsatz von Hafner, der für die Chronik selbst keinen Ertrag bringt?
Wierstraet - Albrecht Classen mag ja manche Meriten haben (welche?), aber dieser Artikel ist alles andere als profund. In der Lit. außer der Ausgabe nur Schanze in ²VL. Vgl. auch B.
Soweit so schlecht. Dunphy hätte die Beiträge besser redigieren müssen und vor allem in jedem einzelnen Fall darauf achten müssen, dass der ²VL-Artikel nicht fehlt und auch andere Standardwerke gleichmäßig verarbeitet sind. Ich hoffe gezeigt zu haben, dass nicht nur kleinere Mängel vorliegen.
Das Nachschlagewerk als Ganzes ist ein hoffentlich bald aussterbendes Beispiel eines gedruckten Nachschlagewerks, das in nicht oder kaum aktualisierter Form elektronisch angeboten wird, ohne dass man die digitalen Möglichkeiten nützt. Obwohl ich bekanntlich kein Fan der "Geschichtsquellen" bin, informieren diese in der Regel umfassender und oft auch aktueller (wenngleich nicht auf Englisch). Ich erkenne ja an, dass so ein teures Buch für den englischsprachigen Markt als Wissenstransfer aus den Nationalsprachen verdienstvoll sein kann, aber wenn die Details nicht stimmen, ist das nicht hinzunehmen.
Dunphy sollte sich schämen, für diese "Enzyklopädie" verantwortlich zu zeichnen.
#forschung
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2012-3/MA/dunphy_decazanove
"Cette encyclopédie est très utile pour le chercheur." Das bezweifle ich entschieden.
Die elektronische Fassung 2012 steht im Rahmen von Brill Reference Works online zur Verfügung. Laut DBIS hat bislang nur die HU Berlin eine Lizenz, also muss der Einzelkunde mindestens einen 24-stündigen Zugang kaufen (PayPal erforderlich), der gut 8 Euro kostet. Es gibt einen nicht ganz mit der Druckfassung identischen E-Text (die Abweichungen sind nicht dokumentiert), ohne die Möglichkeit, ein Faksimile des Drucks oder auch nur die Seitenzahlen der Druckversion abzurufen. Es versteht sich wohl von selbst, dass das wissenschaftlichen Anforderungen nicht im mindesten genügt. Zugleich habe ich im Frühjahr mir Exzerpte aus den gedruckten Bänden gemacht (vor allem zu Chroniken aus der Zeit der Burgunderkriege und mir vertrauten mitteleuropäischen Werken). Die beiden Bände haben eine durchgehende Paginierung (Bd. 1: A-I, Bd. 2: J-Z).
Das übliche "Ceterum censeo" vorweg: Ein solches Nachschlagewerk sollte Open Access zur Verfügung stehen und mit anderen elektronischen Angeboten (v.a. Digitalisaten von Quellen und Literatur) verknüpft sein. Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/96988260/
Über die Sachartikel kann ich wenig sagen, aber mir fiel auf, dass der Artikel "Heraldry" die deutschsprachige Forschung ignoriert. Die Bildauswahl ist phantasielos, die SW-Reproduktionen sind von denkbar schlechter Qualität, was sich auch in der E-Version nicht geändert hat.
Ab und zu haben renommierte Wissenschaftler (B. Studt, U. Goerlitz, M. Thumser, J. Wolf usw.) die Artikel verfasst, aber bei den von mir durchgesehenen Werk- und Autorenartikeln dominieren doch No-Name-Autoren aus der zweiten oder dritten Reihe, die nicht selten nur einen faden Aufguss des Verfasserlexikon-Artikels auf Englisch zustandebekommen haben. Zu den beiden Artikeln zur Ulmer Historiographie siehe
http://archiv.twoday.net/stories/914849/
Es gibt auch völlig unverständliche Lücken: Wenn man die von mir im Verfasserlexikon traktierte, doch recht marginale "Chronik der Kaiser, Könige und Päpste, sowie der Grafen von Württemberg" aufgenommen hat, hätte man die ungleich wichtigere "Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium" nicht weglassen dürfen.
Die handschriftliche Überlieferung wird nur selten erwähnt. Was zu den Handschriften der Magdeburger Schöppenchronik von Martin Przybilski zu lesen ist, ist schlichtweg falsch. Dass die komplettesten Hss. in Dessau liegen, ist Unsinn. Der Autor hat es vorgezogen, eine Anfrage von mir dazu nicht zu beantworten.
Wie eine moderne Quellenkunde aussehen könnte, zeigt wenigstens ansatzweise meine Burgunderkriege-Seite auf Wikisource:
http://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege (im folgenden zitiert: B.)
Immer wieder stellte ich fest, dass die Autoren den neueren Forschungsstand nicht im Griff haben, dass zentrale Werke fehlen, obwohl man mit ein wenig Googeln in der Regel fündig wird.
Notizen zu einzelnen Artikeln:
Beheim - was soll ein Artikel, in dem die zentrale jüngere Monographie (Niemeyer 2001) fehlt? Die Schweinfurter Hs. ist zerstört, ohne dass dies vermerkt wird.
Birk - wenn man Baumanns Forschungen zitiert, braucht man den Abdruck in der Alemannia nicht zu nennen, siehe auch hier
http://archiv.twoday.net/search?q=kempten+birk
Bollstatter - mein NDB-Artikel fehlt und auch die Ursberg-Übersetzung
http://archiv.twoday.net/stories/5399535/
Bote, Konrad - dass die zentrale Monographie von Funke fehlt, ist unentschuldbar.
Burgmann - es gibt, wie man seit langem weiß, nicht nur die eine Münchner Hs.
http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_00743.html, 2012-10-08
Chronicon Colmariense - ich habe keinen Zweifel an der Identifizierung des Colmarer Dominikanerchronisten mit dem sog. Rudolf von Schlettstadt durch Stefan Georges, die von Joos ausgespart wird:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/hsslink.htm (Stand 1999, mit Zustimmung von Georges veröffentlicht)
Chronicon Elwacense - Eberl hat übersehen
http://periodika.digitale-sammlungen.de/bdlg/Blatt_bsb00000333,00186.html
Fabri Felix - Uwe Israel ohne
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5278/
Besser informieren jetzt die Wikipedia und Klingner im DLL-MA
Gmünder Chronik - das besser Gmünder Kaiserchronik genannte Werk von mir 1987 in meiner Dissertation behandelt, von Ralf Schlechtweg-Jahn fahrig und inkompetent dargestellt: "in a 1585/86 print", recte: 1485/86, print meint üblicherweise Druckgrafik, nicht Druck. "Gmünd was an imperial free city founded by the Saxonian dukes" - interessant, das hat noch niemand behauptet! Es muss "Swabian" heißen. Was sollen die Jahreszahlen am Anfang: 1376-1414? "This is more an imperial than a town chronicle" - es ist überhaupt keine Stadtchronik! Die Hauptquellen werden irreführend abgegeben, da die von mir ermittelte Hauptquelle, die Glossen zu Spechtsharts Chronik, fehlt. Was soll angesichts der vorliegenden Digitalisate das alte Voulliemé-Faksimile unter Texts? Und diese Mängel sind in einem ganz kurzen Artikel vorhanden!
Grünenberg - Kümper wird dem Wappenbuch als historiographischem Zeugnis nicht gerecht, siehe
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5632/
Gundelfingen - Druckfehler "Humanistenkultur" statt "Humanistenlektur". Vgl. auch B.
Historia Welforum - hier hat man den Bock zum Gärtner gemacht, denn den Artikel durfte Leila Werthschulte schreiben:
http://archiv.twoday.net/stories/5531082/
Irenicus - Goerlitz gibt das Todesdatum 1559/64. Das richtige Datum 1553 kennt man dank Seeliger-Zeiss seit 1995 und seit 2004 steht es in der Wikipedia.
Lintner - schwacher Artikel von Thumser, als Lit. nur Pistorius-Struve. "Zum Autor und zur Überlieferung: Jakob Wimpfeling Briefwechsel. Hrsg. von Otto Herding/Dieter Mertens. Bd. 1, München 1990, S. 173 Anm. 6. Bislang ist der gesuchte deutsche Druck der Rolevinck-Fortsetzung nicht ans Licht gekommen; der Pariser Druck von ca. 1525, der sie enthält, ist anscheinend nur in der British Library London und der Bibliothek der Cornell University nachgewiesen." (WWW)
Matthäus von Pappenheim - Thomas Schauerte wird nicht müde, den alten Fehler vom Pariser Doktorat zu wiederholen, der schon in der NDB verbessert worden war, mein Artikel im VL Humanismus (erschienen 2009) ist online:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8759/
Meisterlin - Classen lässt das ²VL weg! Dass 1998 "Cronographia Augustensium = Cronik der Augspurger : nach der Handschrift 158/4 in St. Paul in Kärnten" erschien, hat sich offenkundig immer noch nicht herumgesprochen.
Nauclerus - veraltete, unbrauchbare Lit.
Nicolai de preliis et occasu ducis Burgundie historia - völlig veralteter Forschungsstand, vgl. B. Selbst der Druckfehler Hegenbach statt Hagenbach wurde in der E-Version nicht verbessert.
Öhem - mein jüngerer Aufsatz 2001 ist übersehen
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5278/
Pfettisheim - Wenn Kerstin Pfeiffer die 1994 versteigerte Inkunabel der Hofbibliothek Donaueschingen mit diesem Standort nennt, dann sagt das Einiges über ihre Kompetenz ... Vgl. auch B.
Rötteler Chronik - neue Ausgabe von Schubring 1995 fehlt, siehe
http://www.handschriftencensus.de/20836
Sächsische Weltchronik - Dass Frank Shaw die Monographie von Jürgen Wolf übergeht, hätte nicht passieren dürfen.
Scheneck de Rockenhusen - ²VL fehlt, obwohl daraus von Kerstin Pfeiffer abgeschrieben!
Spechtshart - ²VL, Ausgabe Stiefel und neuere Literatur fehlt, siehe etwa
http://www.handschriftencensus.de/18578
Speyerer-Chronik - das Weglassen meines ²VL-Artikels durch Ursula Kundert ist aus meiner Sicht ein Verstoß gegen die Grundsätze guten wissenschaftlichen Arbeitens. Vgl. auch B.
Stolle - Bünz 2000 fehlt, vgl. B.
Turnierchronik - die dumme Magdeburger These von Stamm ist unkritisch rezipiert, der zentrale Aufsatz von Klaus Arnold fehlt; die Suchfunktion von Archivalia informiert hundertmal besser:
http://archiv.twoday.net/search?q=r%C3%BCxner
Weihenstephaner Chronik - was soll der Aufsatz von Hafner, der für die Chronik selbst keinen Ertrag bringt?
Wierstraet - Albrecht Classen mag ja manche Meriten haben (welche?), aber dieser Artikel ist alles andere als profund. In der Lit. außer der Ausgabe nur Schanze in ²VL. Vgl. auch B.
Soweit so schlecht. Dunphy hätte die Beiträge besser redigieren müssen und vor allem in jedem einzelnen Fall darauf achten müssen, dass der ²VL-Artikel nicht fehlt und auch andere Standardwerke gleichmäßig verarbeitet sind. Ich hoffe gezeigt zu haben, dass nicht nur kleinere Mängel vorliegen.
Das Nachschlagewerk als Ganzes ist ein hoffentlich bald aussterbendes Beispiel eines gedruckten Nachschlagewerks, das in nicht oder kaum aktualisierter Form elektronisch angeboten wird, ohne dass man die digitalen Möglichkeiten nützt. Obwohl ich bekanntlich kein Fan der "Geschichtsquellen" bin, informieren diese in der Regel umfassender und oft auch aktueller (wenngleich nicht auf Englisch). Ich erkenne ja an, dass so ein teures Buch für den englischsprachigen Markt als Wissenstransfer aus den Nationalsprachen verdienstvoll sein kann, aber wenn die Details nicht stimmen, ist das nicht hinzunehmen.
Dunphy sollte sich schämen, für diese "Enzyklopädie" verantwortlich zu zeichnen.
#forschung
KlausGraf - am Montag, 8. Oktober 2012, 21:16 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://rechtsportlich.net/?p=1405
Wird auf einer Facebook-Fanseite ein urheberrechtlich geschütztes Bild von einem Fan unbefugt hochgeladen, haftet der Betreiber der Fanseite, wenn er nach Benachrichtigung nichts dagegen unternimmt. Nicht geklärt wurde, ob er bereits dann haftet, wenn er das Bild mit einem "Gefällt mir" versieht und es sich so zu eigen macht. Hier dürften die üblichen Prinzipien der sogenannten Forenhaftung anzuwenden sein: Nur wenn der Betreiber der Fanseite sofort erkennen konnte, dass keine rechtmäßige Nutzung vorliegt, haftet er.
Wird auf einer Facebook-Fanseite ein urheberrechtlich geschütztes Bild von einem Fan unbefugt hochgeladen, haftet der Betreiber der Fanseite, wenn er nach Benachrichtigung nichts dagegen unternimmt. Nicht geklärt wurde, ob er bereits dann haftet, wenn er das Bild mit einem "Gefällt mir" versieht und es sich so zu eigen macht. Hier dürften die üblichen Prinzipien der sogenannten Forenhaftung anzuwenden sein: Nur wenn der Betreiber der Fanseite sofort erkennen konnte, dass keine rechtmäßige Nutzung vorliegt, haftet er.
KlausGraf - am Montag, 8. Oktober 2012, 18:44 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Neue Beiträge auf http://kulturgueter.kath-orden.at
Österreichischer Archivtag 2012 - Bericht
Am 24. September luden der Verband Österreichischer Archivarinnen und Archivare sowie das Niederösterreichische Landesarchiv zum 37. Österreichischer Archivtag nach Krems ein. Hier weiterlesen.
Aufbaukurs 2012 - Bericht
Es waren engagierte Archivarinnen und Archivare, die von 27. bis 30. 9. 2012 ein verlängertes Wochenende „opferten“, um sich im Bildungshaus Stift Vorau zum Aufbaukurs der Fachgruppe der Archive und Religionsgemeinschaften zu treffen. Hier weiterlesen.
Gemeinschaftsblog Ordensgeschichte
Die ordenshistorische Forschung ist im deutschsprachigen Raum sehr vielfältig, oft auf inhaltliche oder regionale Fachthemen spezialisiert und in mehreren Disziplinen angesiedelt. Hier weiterlesen.
Alte Schriften lesen lernen – Kurse und Handbücher
Alte Schriften und damit historische Archivquellen und Handschriften lesen zu können, ist die Grundvoraussetzung für die Arbeit als ArchivarIn und BibliothekarIn. Hier weiterlesen.
Österreichischer Archivtag 2012 - Bericht
Am 24. September luden der Verband Österreichischer Archivarinnen und Archivare sowie das Niederösterreichische Landesarchiv zum 37. Österreichischer Archivtag nach Krems ein. Hier weiterlesen.
Aufbaukurs 2012 - Bericht
Es waren engagierte Archivarinnen und Archivare, die von 27. bis 30. 9. 2012 ein verlängertes Wochenende „opferten“, um sich im Bildungshaus Stift Vorau zum Aufbaukurs der Fachgruppe der Archive und Religionsgemeinschaften zu treffen. Hier weiterlesen.
Gemeinschaftsblog Ordensgeschichte
Die ordenshistorische Forschung ist im deutschsprachigen Raum sehr vielfältig, oft auf inhaltliche oder regionale Fachthemen spezialisiert und in mehreren Disziplinen angesiedelt. Hier weiterlesen.
Alte Schriften lesen lernen – Kurse und Handbücher
Alte Schriften und damit historische Archivquellen und Handschriften lesen zu können, ist die Grundvoraussetzung für die Arbeit als ArchivarIn und BibliothekarIn. Hier weiterlesen.
Helga Penz - am Montag, 8. Oktober 2012, 17:58 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Erich von Bercken: Die Malerei der Früh- und Hochrenaissance in Oberitalien, Berlin-Neubabelsberg 1927, S. 128 sagt bei Besprechung des Wiener Sebastians von Mantegna: "Als Symbol des christenverfolgenden Heidentums erscheint in den Wolken die Gestalt des Theodrich, König der Goten (Dietrich von Bern), vermutlich war der Künstler hier von der plastischen Darstellung an der Fassade von S. Zeno in Verona inspiriert".
Die Deutung geht zurück auf Paul Kristellers Mantegna-Monographie, ich verlinke die englische Ausgaqbe von 1901, die der deutschen von 1902 voranging:
http://archive.org/stream/andreamantegna00kris#page/168/mode/2up
Die englische Wikipedia datiert Andrea Mantegnas St. Sebastian 1456/57 und verweist für den Wolkenreiter auf eine Interpretation als Saturn.
http://en.wikipedia.org/wiki/St._Sebastian_(Mantegna)
Weitere Quellen bestätigen, dass man inzwischen von Kristellers Deutung ganz abgekommen ist, siehe etwa Andreas Hauser zu Mantegnas Wolkenreiter in: Die Unvermeidlichkeit der Bilder, Tübingen 2001, S. 157ff. (zur Forschungsgeschichte und Kristellers Deutung S. 151), Auszüge:
http://books.google.de/books?id=2IIei1AHny8C
Selbst wenn man konzediert, dass der Reiter an San Zeno in Verona als formales Modell gedient haben könnte, heißt das noch lange nicht, dass der rätselhafte Wolkenreiter den dort mutmaßlich dargestellten Theoderich bedeuten sollte. Eine endgültige Deutung des Wolkenreiters liegt bislang nicht vor und ist wohl auch nie zu erwarten. Es mag weit schlüssigere Interpretationen geben, aber gänzlich ausschließen kann man Kristellers Vorschlag nicht.
Es bestand somit kein Grund, das Zeugnis aus der Liste der nicht gesicherten und zweifelhaften Bildzeugnisse in Lienerts Dietrich-Testimonien (S. 271ff.), siehe http://archiv.twoday.net/stories/156273365/
auszuklammern. Man wird annehmen dürfen, dass dieses Meisterwerk der Renaissance zu entlegen war, um in den Focus des Bremer Projekts zu geraten.

 Reiter von San Zeno (Foto: MM, PD auf Commons)
Reiter von San Zeno (Foto: MM, PD auf Commons)
Die Deutung geht zurück auf Paul Kristellers Mantegna-Monographie, ich verlinke die englische Ausgaqbe von 1901, die der deutschen von 1902 voranging:
http://archive.org/stream/andreamantegna00kris#page/168/mode/2up
Die englische Wikipedia datiert Andrea Mantegnas St. Sebastian 1456/57 und verweist für den Wolkenreiter auf eine Interpretation als Saturn.
http://en.wikipedia.org/wiki/St._Sebastian_(Mantegna)
Weitere Quellen bestätigen, dass man inzwischen von Kristellers Deutung ganz abgekommen ist, siehe etwa Andreas Hauser zu Mantegnas Wolkenreiter in: Die Unvermeidlichkeit der Bilder, Tübingen 2001, S. 157ff. (zur Forschungsgeschichte und Kristellers Deutung S. 151), Auszüge:
http://books.google.de/books?id=2IIei1AHny8C
Selbst wenn man konzediert, dass der Reiter an San Zeno in Verona als formales Modell gedient haben könnte, heißt das noch lange nicht, dass der rätselhafte Wolkenreiter den dort mutmaßlich dargestellten Theoderich bedeuten sollte. Eine endgültige Deutung des Wolkenreiters liegt bislang nicht vor und ist wohl auch nie zu erwarten. Es mag weit schlüssigere Interpretationen geben, aber gänzlich ausschließen kann man Kristellers Vorschlag nicht.
Es bestand somit kein Grund, das Zeugnis aus der Liste der nicht gesicherten und zweifelhaften Bildzeugnisse in Lienerts Dietrich-Testimonien (S. 271ff.), siehe http://archiv.twoday.net/stories/156273365/
auszuklammern. Man wird annehmen dürfen, dass dieses Meisterwerk der Renaissance zu entlegen war, um in den Focus des Bremer Projekts zu geraten.

 Reiter von San Zeno (Foto: MM, PD auf Commons)
Reiter von San Zeno (Foto: MM, PD auf Commons)KlausGraf - am Montag, 8. Oktober 2012, 15:18 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ich stelle im folgenden einige Materialien zu Bildabmahnungen im Netz zusammen.
Sehr hilfreich finde ich die aktuellen FAQ von RA Thomas Schwenke:
http://rechtsanwalt-schwenke.de/faq-abmahnung-unerlaubte-bildernutzung/
Dass Gerichte den Streitwert sehr unterschiedlich ansetzen (Tendenz nach unten), zeigt folgende Tabelle von RA Jacob Metzler:
http://www.rechtsanwalt-metzler.de/urheberrecht-streitwerte-bildnutzung/
Die Gerichte fackeln in der Regel nicht lange: "Beim Verschulden gilt im Urheberrecht ein strenger Maßstab. An der Pflicht, sich mit gehöriger Sorgfalt danach zu erkundigen, ob die Person, von der sie glaubte, Rechte herleiten zu können, selbst im Besitz Verwertungsrechte war, ändert sich auch nichts, wenn es um Nutzungshandlungen geht, die wie hier im Internet erfolgt sind. Wer auf seinen Internetseiten im Rahmen von Werbung viele fremde Bilder veröffentlicht, muss auch entsprechend sorgfältig die Berechtigung hieran recherchieren. ". So das unter http://archiv.twoday.net/stories/156272219/ angezeigte Urteil. Siehe aber auch http://archiv.twoday.net/stories/156273535/ .
Zur Zeit spuken Horrorzahlen in der Blogosphäre herum. Die Abmahnung über 19.000 Euro für drei Bilder wurde wieder zurückgezogen:
http://www.blog-mal.de/allgemein/content-fuer-den-blog-vorsicht-vor-teuren-abmahnungen
Abmahnungen bei Bildern unter CC bzw. aus der Wikipedia.
Der "Klassiker" in diesem Blog ist:
http://archiv.twoday.net/stories/38723599/ (mit vielen weiteren Nachweisen)
https://www.taz.de/Abmahnung-bei-CC-Lizenzen/!101303/ (Sept. 2012)
1000 Euro anscheinend für drei Bilder. Laut einer Statistik des „Vereins gegen den Abmahnwahn“ kam es in Deutschland 2011 zu 218.560 Abmahnungen, mit denen insgesamt über 165 Millionen Euro gefordert wurden. „Bislang blieben aber die CC-Lizenzen davon großteils verschont“, sagt Frauke Andresen, die als Anwältin Opfer von Abmahnungen vertritt. Ein potenzieller Markt für Abmahn-Kanzleien sei das aber auf jeden Fall. 700 Euro zahlen Abgemahnte im Schnitt für den Fehler, den sie gemacht haben.
http://www.gulli.com/news/19712-abmahnung-wegen-bild-aus-der-wikipedia-2012-09-13
Am 12. Juni 2012 erhielt Frau Kampmann als Geschäftsführerin der MünzenWoche GmbH eine Abmahnung und strafbewehrte Unterlassungserklärung. Sie hatte bei der Verwendung eines Wikipedia-Fotos auf ihrer Webseite nicht den Namen des Urhebers angegeben. Bei einer Prüfung stellte sie fest, dass tatsächlich bei der Wikipedia vermerkt ist, dass man den Namen zwingend nennen muss. Die Quelle des Bildes hatte ihr diesen Umstand verschwiegen. Rechtsanwalt Dr. jur. Hans G. Müsse aus Hechingen, selbst ein Fotograf, der häufiger Bilder bei der Wikipedia einstellt, forderte die Abgemahnte zur Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung auf. Ansonsten würde er "die notwendigen gerichtlichen Schritte einleiten", wie er schrieb. Nach Abgabe der beiden Erklärungen wartete Ursula Kampmann auf ihre Rechnung, allerdings fiel diese dann weitaus höher aus, als zunächst angekündigt. Die Rechnung setzte sich zusammen aus einem Schadensersatz in Höhe einer fiktiven Lizenzgebühr von 200 Euro. Dazu kam Schadensersatz wegen Verletzung des Namensnennungsrechts in Höhe von 150 Euro, die Geschäftsgebühr mit 245,70 Euro, eine Auslagenpauschale von 20 Euro und 19 % MWSt: 50,48 Euro. Zusammen ergaben sich daraus 666,18 Euro.
Zum gleichen fall:
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Aktuell-Internet-Wikipedia-Abmahnung-fuer-Fotos-7760596.html
RA Dosch weist zurecht die Ansicht des Gulli-Autors zurück, wer abmahnen lasse, habe das Wesen der CC-Lizenzen nicht verstanden:
http://klawtext.blogspot.de/2012/09/neuer-volkssport-abmahnung-von-bildern.html
***
Ich selbst versuche meine Bilder, die aus der Wikipedia geklaut werden, mit Augenmaß abzumahnen, also private Nutzer und nichtkommerzielle Blogger durch kostenlosen Hinweis, behördliche und gewerbliche Nutzer zunächst ohne Einschaltung eines Anwalts.
Bei Bloggern, die mehr als nur dezente Werbung schalten, bin ich eher nicht mehr großzügig. Die dürfen sich bei einem Blogger bedanken, dessen Antwort ich doch recht schäbig finde.
Hallo Herr Graf,
erstmal vielen Dank für Ihre Mail und den Verzicht darauf die Anwaltschaft noch weiter zu bereichern.
Es tut mir sehr leid, dass wir Ihr Bild ohne Verweis benutzt haben, das war eine Einsendung von einem Leser der uns Glauben gemacht hat es wäre sein Bild. Die entsprechende Mail habe ich leider erfolglos gesucht.
Ich habe Ihr Bild entfernt, wir benutzten eigentlich nur unsere eigenen Bilder oder Screenshots von Seiten. Noch etwas kurz zum Blog an sich, das ist ein reines Hobby Blog von mir, es ist zwar Google Werbung drin, aber das bringt kaum etwas am Ende des Tages, deckt aber immerhin die Kosten für den Server, die Domain und so Kram.
Ich hoffe Sie verstehen, dass ich Ihnen nichts überweise, ich überlasse Ihnen gerne die kompletten Einnahmen dieses Artikels, diese belaufen sich allerdings genau auf 1 Dollar-Cent. Eigentlich ne spannende Geschichte mal zu sehen was ein einzelner Artikel an Einnahmen bringt, es wäre aber recht albern Ihnen einen Cent zu überweisen.
Ich hatte geschrieben:
Sehr geehrte Damen und Herren,
private Nachnutzer meiner Bilder mahne ich bei Erstkontakt
grundsätzlich nicht kostenpflichtig ab. Kommerzielle Nutzer sollten
aber nach meiner Auffassung inzwischen wissen, wie man Bilder von
Wikipedia etc. lizenzgerecht verwendet:
http://archiv.twoday.net/stories/38723599/
Sie haben auf der Internetseite
[...]
mein Bild
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sommerloch_Schild.jpg
ohne Urheberbezeichnung genutzt und ohne die
Creative-Commons-Lizenz anzugeben bzw. zu verlinken.
Um eine anwaltliche Abmahnung zu vermeiden, haben Sie bis zum 10. Oktober 2012 Zeit, auf mein Konto
[...]
einen Ihnen angemessen erscheinenden Betrag für die nicht
lizenzgerechte Nutzung zu überweisen und die
Nutzung lizenzgerecht zu gestalten (Urhebernennung Klaus Graf; Verlinkung von
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.de).
Kommerziellen Nutzern berechne ich für Nutzung ohne Namensnennung in der Regel 400 Euro je Bild. Blogger mahne ich aber grundsätzlich ungern kostenpflichtig ab. Ich hoffe, dass die reichliche Werbung, mit der Sie Ihr kommerzielles Angebot pflastern, es Ihnen ermöglicht, den Verstoß gegen die freie Lizenz anständig zu honorieren. Einen Anwalt werde ich aber nur beauftragen, wenn Sie noch nach der Frist nicht
lizenzgerecht nutzen.
Nicht ohne Grund werden Schadensersatzzahlungen nach dem Prinzip der Lizenzanalogie berechnet. Selbst ein eher symbolischer Betrag von 20 Euro wäre für mich in Ordnung gewesen, aber was der Blogger schreibt, empfinde ich als Vera***
Im übrigen haben einige nicht-kommerzielle Nutzer, die ich kostenlos auf Lizenzprobleme aufmerksam gemacht hatte, umgehend und konstruktiv reagiert.
Update: http://archiv.twoday.net/stories/189903121/
Sehr hilfreich finde ich die aktuellen FAQ von RA Thomas Schwenke:
http://rechtsanwalt-schwenke.de/faq-abmahnung-unerlaubte-bildernutzung/
Dass Gerichte den Streitwert sehr unterschiedlich ansetzen (Tendenz nach unten), zeigt folgende Tabelle von RA Jacob Metzler:
http://www.rechtsanwalt-metzler.de/urheberrecht-streitwerte-bildnutzung/
Die Gerichte fackeln in der Regel nicht lange: "Beim Verschulden gilt im Urheberrecht ein strenger Maßstab. An der Pflicht, sich mit gehöriger Sorgfalt danach zu erkundigen, ob die Person, von der sie glaubte, Rechte herleiten zu können, selbst im Besitz Verwertungsrechte war, ändert sich auch nichts, wenn es um Nutzungshandlungen geht, die wie hier im Internet erfolgt sind. Wer auf seinen Internetseiten im Rahmen von Werbung viele fremde Bilder veröffentlicht, muss auch entsprechend sorgfältig die Berechtigung hieran recherchieren. ". So das unter http://archiv.twoday.net/stories/156272219/ angezeigte Urteil. Siehe aber auch http://archiv.twoday.net/stories/156273535/ .
Zur Zeit spuken Horrorzahlen in der Blogosphäre herum. Die Abmahnung über 19.000 Euro für drei Bilder wurde wieder zurückgezogen:
http://www.blog-mal.de/allgemein/content-fuer-den-blog-vorsicht-vor-teuren-abmahnungen
Abmahnungen bei Bildern unter CC bzw. aus der Wikipedia.
Der "Klassiker" in diesem Blog ist:
http://archiv.twoday.net/stories/38723599/ (mit vielen weiteren Nachweisen)
https://www.taz.de/Abmahnung-bei-CC-Lizenzen/!101303/ (Sept. 2012)
1000 Euro anscheinend für drei Bilder. Laut einer Statistik des „Vereins gegen den Abmahnwahn“ kam es in Deutschland 2011 zu 218.560 Abmahnungen, mit denen insgesamt über 165 Millionen Euro gefordert wurden. „Bislang blieben aber die CC-Lizenzen davon großteils verschont“, sagt Frauke Andresen, die als Anwältin Opfer von Abmahnungen vertritt. Ein potenzieller Markt für Abmahn-Kanzleien sei das aber auf jeden Fall. 700 Euro zahlen Abgemahnte im Schnitt für den Fehler, den sie gemacht haben.
http://www.gulli.com/news/19712-abmahnung-wegen-bild-aus-der-wikipedia-2012-09-13
Am 12. Juni 2012 erhielt Frau Kampmann als Geschäftsführerin der MünzenWoche GmbH eine Abmahnung und strafbewehrte Unterlassungserklärung. Sie hatte bei der Verwendung eines Wikipedia-Fotos auf ihrer Webseite nicht den Namen des Urhebers angegeben. Bei einer Prüfung stellte sie fest, dass tatsächlich bei der Wikipedia vermerkt ist, dass man den Namen zwingend nennen muss. Die Quelle des Bildes hatte ihr diesen Umstand verschwiegen. Rechtsanwalt Dr. jur. Hans G. Müsse aus Hechingen, selbst ein Fotograf, der häufiger Bilder bei der Wikipedia einstellt, forderte die Abgemahnte zur Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung auf. Ansonsten würde er "die notwendigen gerichtlichen Schritte einleiten", wie er schrieb. Nach Abgabe der beiden Erklärungen wartete Ursula Kampmann auf ihre Rechnung, allerdings fiel diese dann weitaus höher aus, als zunächst angekündigt. Die Rechnung setzte sich zusammen aus einem Schadensersatz in Höhe einer fiktiven Lizenzgebühr von 200 Euro. Dazu kam Schadensersatz wegen Verletzung des Namensnennungsrechts in Höhe von 150 Euro, die Geschäftsgebühr mit 245,70 Euro, eine Auslagenpauschale von 20 Euro und 19 % MWSt: 50,48 Euro. Zusammen ergaben sich daraus 666,18 Euro.
Zum gleichen fall:
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Aktuell-Internet-Wikipedia-Abmahnung-fuer-Fotos-7760596.html
RA Dosch weist zurecht die Ansicht des Gulli-Autors zurück, wer abmahnen lasse, habe das Wesen der CC-Lizenzen nicht verstanden:
http://klawtext.blogspot.de/2012/09/neuer-volkssport-abmahnung-von-bildern.html
***
Ich selbst versuche meine Bilder, die aus der Wikipedia geklaut werden, mit Augenmaß abzumahnen, also private Nutzer und nichtkommerzielle Blogger durch kostenlosen Hinweis, behördliche und gewerbliche Nutzer zunächst ohne Einschaltung eines Anwalts.
Bei Bloggern, die mehr als nur dezente Werbung schalten, bin ich eher nicht mehr großzügig. Die dürfen sich bei einem Blogger bedanken, dessen Antwort ich doch recht schäbig finde.
Hallo Herr Graf,
erstmal vielen Dank für Ihre Mail und den Verzicht darauf die Anwaltschaft noch weiter zu bereichern.
Es tut mir sehr leid, dass wir Ihr Bild ohne Verweis benutzt haben, das war eine Einsendung von einem Leser der uns Glauben gemacht hat es wäre sein Bild. Die entsprechende Mail habe ich leider erfolglos gesucht.
Ich habe Ihr Bild entfernt, wir benutzten eigentlich nur unsere eigenen Bilder oder Screenshots von Seiten. Noch etwas kurz zum Blog an sich, das ist ein reines Hobby Blog von mir, es ist zwar Google Werbung drin, aber das bringt kaum etwas am Ende des Tages, deckt aber immerhin die Kosten für den Server, die Domain und so Kram.
Ich hoffe Sie verstehen, dass ich Ihnen nichts überweise, ich überlasse Ihnen gerne die kompletten Einnahmen dieses Artikels, diese belaufen sich allerdings genau auf 1 Dollar-Cent. Eigentlich ne spannende Geschichte mal zu sehen was ein einzelner Artikel an Einnahmen bringt, es wäre aber recht albern Ihnen einen Cent zu überweisen.
Ich hatte geschrieben:
Sehr geehrte Damen und Herren,
private Nachnutzer meiner Bilder mahne ich bei Erstkontakt
grundsätzlich nicht kostenpflichtig ab. Kommerzielle Nutzer sollten
aber nach meiner Auffassung inzwischen wissen, wie man Bilder von
Wikipedia etc. lizenzgerecht verwendet:
http://archiv.twoday.net/stories/38723599/
Sie haben auf der Internetseite
[...]
mein Bild
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sommerloch_Schild.jpg
ohne Urheberbezeichnung genutzt und ohne die
Creative-Commons-Lizenz anzugeben bzw. zu verlinken.
Um eine anwaltliche Abmahnung zu vermeiden, haben Sie bis zum 10. Oktober 2012 Zeit, auf mein Konto
[...]
einen Ihnen angemessen erscheinenden Betrag für die nicht
lizenzgerechte Nutzung zu überweisen und die
Nutzung lizenzgerecht zu gestalten (Urhebernennung Klaus Graf; Verlinkung von
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.de).
Kommerziellen Nutzern berechne ich für Nutzung ohne Namensnennung in der Regel 400 Euro je Bild. Blogger mahne ich aber grundsätzlich ungern kostenpflichtig ab. Ich hoffe, dass die reichliche Werbung, mit der Sie Ihr kommerzielles Angebot pflastern, es Ihnen ermöglicht, den Verstoß gegen die freie Lizenz anständig zu honorieren. Einen Anwalt werde ich aber nur beauftragen, wenn Sie noch nach der Frist nicht
lizenzgerecht nutzen.
Nicht ohne Grund werden Schadensersatzzahlungen nach dem Prinzip der Lizenzanalogie berechnet. Selbst ein eher symbolischer Betrag von 20 Euro wäre für mich in Ordnung gewesen, aber was der Blogger schreibt, empfinde ich als Vera***
Im übrigen haben einige nicht-kommerzielle Nutzer, die ich kostenlos auf Lizenzprobleme aufmerksam gemacht hatte, umgehend und konstruktiv reagiert.
Update: http://archiv.twoday.net/stories/189903121/
KlausGraf - am Montag, 8. Oktober 2012, 00:32 - Rubrik: Archivrecht
KlausGraf - am Sonntag, 7. Oktober 2012, 20:26 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.ferner-alsdorf.de/2012/10/rechtsanwalt-ferner-betreibt-panikmache/
Wenn RA Ferner es nötig hat, mich auf diesem Niveau abzukanzeln, dann soll er das tun. Er stärkt seine Position damit nicht. Ich kenne durchaus den Unterschied zwischen Unterlassungsanspruch und Schadensersatz, wobei ich im Gegensatz zu RA Ferner einen Kommentar zum Urheberrecht geschrieben habe, der von juristischer Seite bislang nicht auseinandergenommen wurde, im Gegenteil. Dr. Matthias Losert (Berlin) hat mir erlaubt, aus seiner Mail vom 25. April 2012 zu zitieren: "ich bin Rechtsanwalt auf dem Gebiet des Urheberrechts. Mir fiel Ihre Urheberrechtsfibel in die Hände. Gratulation, ich habe selten so einen gut geschriebenen Kommentar in der Hand gehalten. Wenn dieser etwas früher erschienen wäre, hätte ich sicherlich eine viel spannendere Zeit der Examensvorbereitung gehabt." Und auch was der Antiquar Rudolf Angeli (Hamburg) mir schrieb, darf ich zitieren: "Mit
großem Interesse und vielen AHA-Erlebnissen habe ich Ihre Abhandlung "Urheberrechtsfibel - nicht nur für Piraten" gelesen. Dies hat viele Fragen beantwortet."
Selbstverständlich hat der Gesetzgeber zu freien Lizenzen mehrfach Stellung genommen, sowohl im Gesetz als auch in den amtlichen Begründungen. Es geht um die sog. Linux-Klausel zur Möglichkeit, einfache Nutzungsrechte zugunsten der Allgemeinheit zu bestellen. Nachweise zur Gesetzgebung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Linux-Klausel
Siehe in der Urheberrechtsfibel etwa S. 75f.
Ich fürchtete schon, ich müsse endlos in den Gesetzesmaterialien auf urheberrecht.org wühlen, aber die Wikipedia hat erfreulicherweise den Nachweis, den ich im Sinn hatte:
http://www.urheberrecht.org/topic/Korb-2/bmj/1601828.pdf
Zunehmend werden wissenschaftlich relevante Publika-
tionen ausschließlich oder ergänzend online nach Open-
Access-Grundsätzen veröffentlicht. Gleichzeitig gewinnt
Open-Source-Software in vielen Bereichen der Gesell-
schaft an Bedeutung. Beide Entwicklungen sind davon
geprägt, dass der Urheber sein Werk bzw. den Quelltext
eines Softwareprogramms der Allgemeinheit zur Ver-
fügung stellt. Die Bedingungen, unter denen jedermann
dieses Werk nutzen kann, ergeben sich aus der vom Ur-
heber gewählten Lizenz. Mit der freien Verfügbarkeit
der Werke nach den genannten Grundsätzen entsteht
auch ein neues Interessen- und Schutzgefüge zwischen
Urhebern, Verwertern und Endnutzern.
In diesem Zusammenhang erscheint das Schriftform-
erfordernis in § 31a Abs. 1 Satz 1 UrhG-E als wenig
praktikabel. Denn üblicherweise werden in diesen Fällen
- Drucksache 16/1828 – 38 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode [S. 38] -
gerade keine schriftlichen Verträge zwischen Werkschaf-
fenden und Nutzern abgeschlossen. Vielmehr sind die
Open-Source- bzw. Open-Access-Lizenzen unmittelbar
mit dem Werk verbunden, so dass Lizenzgeber und
Lizenznehmer nicht in unmittelbaren Kontakt treten.
Das ist aus der Stellungnahme des Bundesrats, der die Bundesregierung ebd. S. 46 nicht widersprochen hat. Was steht in § 31a UrhG? "Der Schriftform bedarf es nicht, wenn der Urheber unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht für jedermann einräumt. "
RA Ferner und die anderen erbärmlichen Korinthensucher, die sich regelmäßig in den Kommentaren zu Wort melden, um mir juristisch am Zeug flicken, dürfen gern die "amtliche Begründung" zu dieser Änderung in den weiteren Materialien suchen. Ich weiß, dass eine Stellungnahme des Bundesrats das nicht ist.
Wenn der Gesetzgeber der Ansicht war, dass die Schriftform in Fällen freier Lizenzen entbehrlich ist, weil die Freigabe mit dem Werk verbunden ist (also in Form von Metadaten mit Lizenznennung), kann man ihm nicht unterstellen, dass er wollte, dass in jedem Einzelfall die Rechtekette zum Urheber überprüft wird. Wollte man eine solche Überprüfung in jedem Fall bei freien Lizenzen fordern, würde das den Kontakt zum Urheber erfordern, der ja, wie die Bundesregierung durch ihre Zustimmung zu den Bedenken des Bundesrats anerkannte, in der Regel gar nicht besteht. Der Nutzer müsste also in jedem Fall nochmals beim angegebenen Urheber nachfragen, will er sichergehen, sich keine Unterlassungsverfügung und kostenpflichtige Abmahnung (selbst bei gedeckelten Anwaltskosten von 100 Euro) einzuhandeln.
Ich habe in der jetzigen Diskussion im Kern nichts anderes gesagt, als was ich 2009 in der Urheberrechtsfibel S. 198 schrieb:
"Im Fall freier Lizenzen, bei denen der Lizenzgeber einen entsprechenden Vermerk an der digitalen Kopie anbringt, bedeuten diese völlig überspannten Anforderungen, dass dieses Lizenzmodell auf Dauer einfach zu riskant ist. Man kann vielleicht als „Grafs Gesetz“ formulieren: Alles, was abgemahnt werden kann, wird auch einmal abgemahnt werden. Wenn ein Mitarbeiter der Wikipedia unter Pseudonym ein Bild hochlädt, das eine Urheberrechtsverletzung darstellt, und ein Nachnutzer verwendet es im Vertrauen auf die freie Lizenz, dann kann er vom wahren Rechteinhaber in Anspruch genommen werden. Er muss in den
sauren Apfel beißen und kann sich auch nicht an dem (nicht
ermittelbaren) Hochlader schadlos halten.
Umfangreiche Nachforschungen und vor allem Nachfragen beim
Urheber soll die freie Lizenz ja gerade entbehrlich machen. Wenn sicherheitshalber immer nachgefragt werden muss, um der Sorgfaltspflicht zu genügen, wird die freie Lizenz ad absurdum geführt. Hier muss dringend Rechtssicherheit geschaffen werden.
Gottgegeben sind die deutschen Regelungen keineswegs. Im US-Recht stellen die Regelungen über die „take-down-notice“ eine sinnvollere Verteilung der Haftung dar."
Damit es auch RA Ferner versteht, nochmals das Argument mit dem "Gesetzgeber": Der Gesetzgeber ging in anderem Zusammenhang bei Open Content davon aus, dass die Lizenz am Bild steht und es OK ist, dass der Nutzer keinen Kontakt mit dem Urheber aufnimmt, um einen schriftlichen Vertrag mit ihm zu schließen. Die Rechtsprechung - insbesondere die unfähigen alten Männer des BGH - hat dagegen überzogene Sorgfaltsansprüche im Urheberrecht statuiert (kein gutgläubiger Erwerb von Rechten). Natürlich wäre eine Klarstellung durch den Gesetzgeber wichtig und zu bevorzugen, aber de lege lata sind die Gerichte in der Pflicht, Nutzer freier Lizenzen nicht in eine Falle laufen zu lassen, die mit der Funktionsweise freier Lizenzen, wie sie der Gesetzgeber anerkannt hat, unvereinbar ist.
Dass ein deutsches Gericht angesichts dieser Sachlage bei einem nicht-gewerblichen Laiennutzer auf Erstattung der Abmahnkosten erkennen wird, möchte ich nicht annehmen. Wenn es keine Verdachtsmomente gibt, die sich auch unerfahrenen Nutzern aufdrängen müssen, kann bei gefälschten CC-Bildern nicht an der bisherigen drakonischen Rechtsprechung festgehalten werden. es muss also auf eine Lösung wie bei der Forenhaftung hinauslaufen, dass nach Benachrichtigung das betreffende Medium beseitigt werden muss. Wer ein CC-lizenziertes Medium auf Flickr oder Wikimedia Commons findet, braucht nicht mit einer Fälschung zu rechnen und nicht sicherheitshalber beim Urheber nachzufragen.
Zusammenfassend halte ich nochmals fest: RA Ferner betreibt unverantwortliche Panikmache und schadet der Kultur des Open Content, wenn er bei allen CC-lizenzierten Bildern sicherheitshalber Nachfragen beim Urheber empfiehlt (bzw. wenn dieser nicht greifbar ist, dürfte er wohl vorschlagen, ganz auf das Bild zu verzichten). Ich habe nachgewiesen, dass der Gesetzgeber bei freien Lizenzen ausdrücklich berücksichtigt hat, dass kein Kontakt zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer besteht. Es ist an den Gerichten, dem Rechnung zu tragen. Da es noch keine Urteile dazu gibt, rate ich anders als RA Ferner, sehr wohl zur bedenkenlosen Nutzung freier Bilder unter CC. Auf ein faules Ei in diesem Sinn zu stoßen, ist extrem unwahrscheinlich.
Je wichtiger ein Foto ist, um so mehr müssen insbesondere gewerbliche Nutzer (z.B. in der Google-Bildersuche) recherchieren, um einen Betrug auszuschließen. Wenn sie Nacktbilder von Kate und William unter freier Lizenz finden, müssen sie stutzig werden und die Finger davon lassen. Der einfache Blogger, der auf Flickr oder Commons ein unspektakuläres Bild unter CC findet, soll es getrost - lizenzkonform - nutzen. Das nehme ich auf meine Kappe!
 Risikolos auch in D: Solche Obama-Bilder auf http://www.whitehouse.gov/ sind in den USA Public Domain und de facto weltweit. Keine Notwendigkeit auch für RA-Ferner-Klienten, dort nachzufragen!
Risikolos auch in D: Solche Obama-Bilder auf http://www.whitehouse.gov/ sind in den USA Public Domain und de facto weltweit. Keine Notwendigkeit auch für RA-Ferner-Klienten, dort nachzufragen!
Wenn RA Ferner es nötig hat, mich auf diesem Niveau abzukanzeln, dann soll er das tun. Er stärkt seine Position damit nicht. Ich kenne durchaus den Unterschied zwischen Unterlassungsanspruch und Schadensersatz, wobei ich im Gegensatz zu RA Ferner einen Kommentar zum Urheberrecht geschrieben habe, der von juristischer Seite bislang nicht auseinandergenommen wurde, im Gegenteil. Dr. Matthias Losert (Berlin) hat mir erlaubt, aus seiner Mail vom 25. April 2012 zu zitieren: "ich bin Rechtsanwalt auf dem Gebiet des Urheberrechts. Mir fiel Ihre Urheberrechtsfibel in die Hände. Gratulation, ich habe selten so einen gut geschriebenen Kommentar in der Hand gehalten. Wenn dieser etwas früher erschienen wäre, hätte ich sicherlich eine viel spannendere Zeit der Examensvorbereitung gehabt." Und auch was der Antiquar Rudolf Angeli (Hamburg) mir schrieb, darf ich zitieren: "Mit
großem Interesse und vielen AHA-Erlebnissen habe ich Ihre Abhandlung "Urheberrechtsfibel - nicht nur für Piraten" gelesen. Dies hat viele Fragen beantwortet."
Selbstverständlich hat der Gesetzgeber zu freien Lizenzen mehrfach Stellung genommen, sowohl im Gesetz als auch in den amtlichen Begründungen. Es geht um die sog. Linux-Klausel zur Möglichkeit, einfache Nutzungsrechte zugunsten der Allgemeinheit zu bestellen. Nachweise zur Gesetzgebung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Linux-Klausel
Siehe in der Urheberrechtsfibel etwa S. 75f.
Ich fürchtete schon, ich müsse endlos in den Gesetzesmaterialien auf urheberrecht.org wühlen, aber die Wikipedia hat erfreulicherweise den Nachweis, den ich im Sinn hatte:
http://www.urheberrecht.org/topic/Korb-2/bmj/1601828.pdf
Zunehmend werden wissenschaftlich relevante Publika-
tionen ausschließlich oder ergänzend online nach Open-
Access-Grundsätzen veröffentlicht. Gleichzeitig gewinnt
Open-Source-Software in vielen Bereichen der Gesell-
schaft an Bedeutung. Beide Entwicklungen sind davon
geprägt, dass der Urheber sein Werk bzw. den Quelltext
eines Softwareprogramms der Allgemeinheit zur Ver-
fügung stellt. Die Bedingungen, unter denen jedermann
dieses Werk nutzen kann, ergeben sich aus der vom Ur-
heber gewählten Lizenz. Mit der freien Verfügbarkeit
der Werke nach den genannten Grundsätzen entsteht
auch ein neues Interessen- und Schutzgefüge zwischen
Urhebern, Verwertern und Endnutzern.
In diesem Zusammenhang erscheint das Schriftform-
erfordernis in § 31a Abs. 1 Satz 1 UrhG-E als wenig
praktikabel. Denn üblicherweise werden in diesen Fällen
- Drucksache 16/1828 – 38 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode [S. 38] -
gerade keine schriftlichen Verträge zwischen Werkschaf-
fenden und Nutzern abgeschlossen. Vielmehr sind die
Open-Source- bzw. Open-Access-Lizenzen unmittelbar
mit dem Werk verbunden, so dass Lizenzgeber und
Lizenznehmer nicht in unmittelbaren Kontakt treten.
Das ist aus der Stellungnahme des Bundesrats, der die Bundesregierung ebd. S. 46 nicht widersprochen hat. Was steht in § 31a UrhG? "Der Schriftform bedarf es nicht, wenn der Urheber unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht für jedermann einräumt. "
RA Ferner und die anderen erbärmlichen Korinthensucher, die sich regelmäßig in den Kommentaren zu Wort melden, um mir juristisch am Zeug flicken, dürfen gern die "amtliche Begründung" zu dieser Änderung in den weiteren Materialien suchen. Ich weiß, dass eine Stellungnahme des Bundesrats das nicht ist.
Wenn der Gesetzgeber der Ansicht war, dass die Schriftform in Fällen freier Lizenzen entbehrlich ist, weil die Freigabe mit dem Werk verbunden ist (also in Form von Metadaten mit Lizenznennung), kann man ihm nicht unterstellen, dass er wollte, dass in jedem Einzelfall die Rechtekette zum Urheber überprüft wird. Wollte man eine solche Überprüfung in jedem Fall bei freien Lizenzen fordern, würde das den Kontakt zum Urheber erfordern, der ja, wie die Bundesregierung durch ihre Zustimmung zu den Bedenken des Bundesrats anerkannte, in der Regel gar nicht besteht. Der Nutzer müsste also in jedem Fall nochmals beim angegebenen Urheber nachfragen, will er sichergehen, sich keine Unterlassungsverfügung und kostenpflichtige Abmahnung (selbst bei gedeckelten Anwaltskosten von 100 Euro) einzuhandeln.
Ich habe in der jetzigen Diskussion im Kern nichts anderes gesagt, als was ich 2009 in der Urheberrechtsfibel S. 198 schrieb:
"Im Fall freier Lizenzen, bei denen der Lizenzgeber einen entsprechenden Vermerk an der digitalen Kopie anbringt, bedeuten diese völlig überspannten Anforderungen, dass dieses Lizenzmodell auf Dauer einfach zu riskant ist. Man kann vielleicht als „Grafs Gesetz“ formulieren: Alles, was abgemahnt werden kann, wird auch einmal abgemahnt werden. Wenn ein Mitarbeiter der Wikipedia unter Pseudonym ein Bild hochlädt, das eine Urheberrechtsverletzung darstellt, und ein Nachnutzer verwendet es im Vertrauen auf die freie Lizenz, dann kann er vom wahren Rechteinhaber in Anspruch genommen werden. Er muss in den
sauren Apfel beißen und kann sich auch nicht an dem (nicht
ermittelbaren) Hochlader schadlos halten.
Umfangreiche Nachforschungen und vor allem Nachfragen beim
Urheber soll die freie Lizenz ja gerade entbehrlich machen. Wenn sicherheitshalber immer nachgefragt werden muss, um der Sorgfaltspflicht zu genügen, wird die freie Lizenz ad absurdum geführt. Hier muss dringend Rechtssicherheit geschaffen werden.
Gottgegeben sind die deutschen Regelungen keineswegs. Im US-Recht stellen die Regelungen über die „take-down-notice“ eine sinnvollere Verteilung der Haftung dar."
Damit es auch RA Ferner versteht, nochmals das Argument mit dem "Gesetzgeber": Der Gesetzgeber ging in anderem Zusammenhang bei Open Content davon aus, dass die Lizenz am Bild steht und es OK ist, dass der Nutzer keinen Kontakt mit dem Urheber aufnimmt, um einen schriftlichen Vertrag mit ihm zu schließen. Die Rechtsprechung - insbesondere die unfähigen alten Männer des BGH - hat dagegen überzogene Sorgfaltsansprüche im Urheberrecht statuiert (kein gutgläubiger Erwerb von Rechten). Natürlich wäre eine Klarstellung durch den Gesetzgeber wichtig und zu bevorzugen, aber de lege lata sind die Gerichte in der Pflicht, Nutzer freier Lizenzen nicht in eine Falle laufen zu lassen, die mit der Funktionsweise freier Lizenzen, wie sie der Gesetzgeber anerkannt hat, unvereinbar ist.
Dass ein deutsches Gericht angesichts dieser Sachlage bei einem nicht-gewerblichen Laiennutzer auf Erstattung der Abmahnkosten erkennen wird, möchte ich nicht annehmen. Wenn es keine Verdachtsmomente gibt, die sich auch unerfahrenen Nutzern aufdrängen müssen, kann bei gefälschten CC-Bildern nicht an der bisherigen drakonischen Rechtsprechung festgehalten werden. es muss also auf eine Lösung wie bei der Forenhaftung hinauslaufen, dass nach Benachrichtigung das betreffende Medium beseitigt werden muss. Wer ein CC-lizenziertes Medium auf Flickr oder Wikimedia Commons findet, braucht nicht mit einer Fälschung zu rechnen und nicht sicherheitshalber beim Urheber nachzufragen.
Zusammenfassend halte ich nochmals fest: RA Ferner betreibt unverantwortliche Panikmache und schadet der Kultur des Open Content, wenn er bei allen CC-lizenzierten Bildern sicherheitshalber Nachfragen beim Urheber empfiehlt (bzw. wenn dieser nicht greifbar ist, dürfte er wohl vorschlagen, ganz auf das Bild zu verzichten). Ich habe nachgewiesen, dass der Gesetzgeber bei freien Lizenzen ausdrücklich berücksichtigt hat, dass kein Kontakt zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer besteht. Es ist an den Gerichten, dem Rechnung zu tragen. Da es noch keine Urteile dazu gibt, rate ich anders als RA Ferner, sehr wohl zur bedenkenlosen Nutzung freier Bilder unter CC. Auf ein faules Ei in diesem Sinn zu stoßen, ist extrem unwahrscheinlich.
Je wichtiger ein Foto ist, um so mehr müssen insbesondere gewerbliche Nutzer (z.B. in der Google-Bildersuche) recherchieren, um einen Betrug auszuschließen. Wenn sie Nacktbilder von Kate und William unter freier Lizenz finden, müssen sie stutzig werden und die Finger davon lassen. Der einfache Blogger, der auf Flickr oder Commons ein unspektakuläres Bild unter CC findet, soll es getrost - lizenzkonform - nutzen. Das nehme ich auf meine Kappe!
 Risikolos auch in D: Solche Obama-Bilder auf http://www.whitehouse.gov/ sind in den USA Public Domain und de facto weltweit. Keine Notwendigkeit auch für RA-Ferner-Klienten, dort nachzufragen!
Risikolos auch in D: Solche Obama-Bilder auf http://www.whitehouse.gov/ sind in den USA Public Domain und de facto weltweit. Keine Notwendigkeit auch für RA-Ferner-Klienten, dort nachzufragen!KlausGraf - am Sonntag, 7. Oktober 2012, 01:23 - Rubrik: Archivrecht
Quoting the mailing list EXLIBRIS:
The latest news concerning the Gerolamini library affaire which has been reported in the media, has resulted in ALAI, according to its statutes, suspending Luca Cableri (Studio Bibliografico Wunderkammer) from membership.
Furthermore we have been informed that others may be involved in the case, including non-ILAB booksellers Stephane Del Salle and Maurizio Bifolco. The Italian association invites all ILAB members who purchased material from these persons (or from Massimo De Caro) from Spring 2011 onwards to contact:
Colonello Raffaele Mancino (Mail from ALAI council)
Mail from Jennifer Lowe:
On October 3rd, four more individuals were arrested for alleged involvement in the De Caro scandal, and the investigation has made progress in determining their specific roles in the operation. According to the investigation, Father Sandro Marsano, 38, former curator of the Girolamini Library, would allow people identified by De Caro to select and take away the volumes; he has been placed under house arrest. In custody are three others: Stephane Delsalle, 38, a French citizen and an expert in antiquarian books, who would allegedly work with De Caro to select the most important titles to put on the market in Italy and abroad. Maurizio Bifolco, 65, of Rome, would allegedly sell the volumes to buyers and collect and distribute the proceeds among the suspects. Finally, Luca Cableri, 39, of Udine, proprietor of Studio Bibliografico Wunderkammer, is alleged to have targeted the auction house Zisska and Schauer as a seller through which to funnel hundreds of books purloined from the Girolamini. (You will recall that Zisska recalled these books before their sale.)
The Corriere del Mezzogiorno reported this here: http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2012/3-ottobre-2012/furto-all-biblioteca-girolamini-4-arresti-c-anche-sacerdote-2112082635692.shtml
Yesterday, La Repubblica Napoli reported that the investigation found that two volumes from the Girolamini Library (by Leon Battista Alberti and Giambattista Vico) had been transferred by De Caro to Senator Marcello Dell’Utri, known bibliophile and organizer of the Milan Antiquarian Book Fair.
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/10/04/news/finirono_a_marcello_dell_utri_2_libri_sottratti_ai_girolamini-43840078/
Finally, today it was reported by TG1 Online that De Caro, during a visit to the National Library of Naples in his role as advisor to the Minister of Cultural Heritage, allegedly stole a copy of the Sidereus nuncius of Galileo, printed in 1610, and substituted a forgery in its place. This article also expands on the possible role of former curator Fr. Sandro Marsano in the plundering of the Girolamini. Marsano’s interrogation is scheduled for Monday.
http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-7a13b33f-06a9-4d49-b082-8b9075032fb5.html?refresh_ce
Addendum by Lowe:
Il Mattino reports that De Caro has confessed to working with Stephane Delsalle to ransack other Italian libraries, including the library of Don Provolo of Verona from 1999-2000, the biblioteca capitolare di Padova between 2003 and 2005, the seminario di Verona in 2009 or 2010 and the Abbey of Montecassino on several occasions.
http://www.ilmattino.it/napoli/citta/inchiesta_girolamini_laquocentinaia_di_libri_rubati_dal_direttore_in_altre_biblioteche_sostitui_un_volume_con_un_fac_simileraquo/notizie/223716.shtml
See here
http://archiv.twoday.net/search?q=girolamini
Update:
http://www.corriere.it/cronache/12_ottobre_08/quel-saccheggio-continuo-predatore-libri-gian-antonio-stella_081d7b72-110c-11e2-b61f-b7b290547c92.shtml
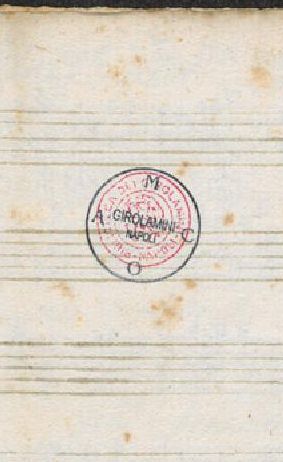
The latest news concerning the Gerolamini library affaire which has been reported in the media, has resulted in ALAI, according to its statutes, suspending Luca Cableri (Studio Bibliografico Wunderkammer) from membership.
Furthermore we have been informed that others may be involved in the case, including non-ILAB booksellers Stephane Del Salle and Maurizio Bifolco. The Italian association invites all ILAB members who purchased material from these persons (or from Massimo De Caro) from Spring 2011 onwards to contact:
Colonello Raffaele Mancino (Mail from ALAI council)
Mail from Jennifer Lowe:
On October 3rd, four more individuals were arrested for alleged involvement in the De Caro scandal, and the investigation has made progress in determining their specific roles in the operation. According to the investigation, Father Sandro Marsano, 38, former curator of the Girolamini Library, would allow people identified by De Caro to select and take away the volumes; he has been placed under house arrest. In custody are three others: Stephane Delsalle, 38, a French citizen and an expert in antiquarian books, who would allegedly work with De Caro to select the most important titles to put on the market in Italy and abroad. Maurizio Bifolco, 65, of Rome, would allegedly sell the volumes to buyers and collect and distribute the proceeds among the suspects. Finally, Luca Cableri, 39, of Udine, proprietor of Studio Bibliografico Wunderkammer, is alleged to have targeted the auction house Zisska and Schauer as a seller through which to funnel hundreds of books purloined from the Girolamini. (You will recall that Zisska recalled these books before their sale.)
The Corriere del Mezzogiorno reported this here: http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2012/3-ottobre-2012/furto-all-biblioteca-girolamini-4-arresti-c-anche-sacerdote-2112082635692.shtml
Yesterday, La Repubblica Napoli reported that the investigation found that two volumes from the Girolamini Library (by Leon Battista Alberti and Giambattista Vico) had been transferred by De Caro to Senator Marcello Dell’Utri, known bibliophile and organizer of the Milan Antiquarian Book Fair.
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/10/04/news/finirono_a_marcello_dell_utri_2_libri_sottratti_ai_girolamini-43840078/
Finally, today it was reported by TG1 Online that De Caro, during a visit to the National Library of Naples in his role as advisor to the Minister of Cultural Heritage, allegedly stole a copy of the Sidereus nuncius of Galileo, printed in 1610, and substituted a forgery in its place. This article also expands on the possible role of former curator Fr. Sandro Marsano in the plundering of the Girolamini. Marsano’s interrogation is scheduled for Monday.
http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-7a13b33f-06a9-4d49-b082-8b9075032fb5.html?refresh_ce
Addendum by Lowe:
Il Mattino reports that De Caro has confessed to working with Stephane Delsalle to ransack other Italian libraries, including the library of Don Provolo of Verona from 1999-2000, the biblioteca capitolare di Padova between 2003 and 2005, the seminario di Verona in 2009 or 2010 and the Abbey of Montecassino on several occasions.
http://www.ilmattino.it/napoli/citta/inchiesta_girolamini_laquocentinaia_di_libri_rubati_dal_direttore_in_altre_biblioteche_sostitui_un_volume_con_un_fac_simileraquo/notizie/223716.shtml
See here
http://archiv.twoday.net/search?q=girolamini
Update:
http://www.corriere.it/cronache/12_ottobre_08/quel-saccheggio-continuo-predatore-libri-gian-antonio-stella_081d7b72-110c-11e2-b61f-b7b290547c92.shtml
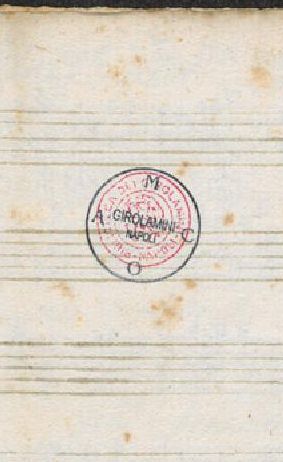
KlausGraf - am Sonntag, 7. Oktober 2012, 00:41 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 7. Oktober 2012, 00:35 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen