Am 24.9.2012 meldete Katja Schmidtberger in der Thüringischen Allgemeinen:
" .... "Der Weg der Haushaltskonsolidierung ist nicht schön, aber wir haben keine Wahl", versicherte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) am Montagnachmittag vor den Medien. Man gehe diese Woche mit dem Haushaltssicherungskonzept auf die Ziellinie, am morgigen Mittwoch wird der Stadtrat dazu entscheiden.
Gestern Abend diskutierte der Hauptausschuss in gut drei Stunden die im Papier vorgestellten Einschnitte, ... Die Einschnitte im Konzept sind heftig. Bibliothek, Stadtarchiv, Volkshochschule und die städtischen Museen werden in den Folgejahren mit gekürzten Budgets, die sie künftig eigenverantwortlich verwalten, leben müssen. Die Einführung dieser sogenannten Budgetierung soll die Wirtschaftlichkeit erhöhen, heißt es in dem Sparpapier. .... Einsparungen müssten im Personalbereich einsetzen, ist weiter zu lesen. Sehr konkret wird die Verwaltung bereits beim Stadtarchiv. Hier sollen schon 2013 1,5 Stellen reduziert werden. .... Die Leiterstelle für das Thüringer Museum bleibt weiter unbesetzt. Geprüft wird auch die Steigerung der Eintrittsentgelte. Der Zuschuss für die Bibliothek sinkt in den nächsten zwei Haushaltsjahren. "
Ob der zuständige Landesverband im VdA sich rührt oder die Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim Deutschen Städtetag einmal sich regt oder gar der Deutsche Kulturrat das Eisenacher Stadtarchiv auf seine "Rote Liste" setzt, wir werden sehen ....
" .... "Der Weg der Haushaltskonsolidierung ist nicht schön, aber wir haben keine Wahl", versicherte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) am Montagnachmittag vor den Medien. Man gehe diese Woche mit dem Haushaltssicherungskonzept auf die Ziellinie, am morgigen Mittwoch wird der Stadtrat dazu entscheiden.
Gestern Abend diskutierte der Hauptausschuss in gut drei Stunden die im Papier vorgestellten Einschnitte, ... Die Einschnitte im Konzept sind heftig. Bibliothek, Stadtarchiv, Volkshochschule und die städtischen Museen werden in den Folgejahren mit gekürzten Budgets, die sie künftig eigenverantwortlich verwalten, leben müssen. Die Einführung dieser sogenannten Budgetierung soll die Wirtschaftlichkeit erhöhen, heißt es in dem Sparpapier. .... Einsparungen müssten im Personalbereich einsetzen, ist weiter zu lesen. Sehr konkret wird die Verwaltung bereits beim Stadtarchiv. Hier sollen schon 2013 1,5 Stellen reduziert werden. .... Die Leiterstelle für das Thüringer Museum bleibt weiter unbesetzt. Geprüft wird auch die Steigerung der Eintrittsentgelte. Der Zuschuss für die Bibliothek sinkt in den nächsten zwei Haushaltsjahren. "
Ob der zuständige Landesverband im VdA sich rührt oder die Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim Deutschen Städtetag einmal sich regt oder gar der Deutsche Kulturrat das Eisenacher Stadtarchiv auf seine "Rote Liste" setzt, wir werden sehen ....
Wolf Thomas - am Samstag, 6. Oktober 2012, 20:52 - Rubrik: Kommunalarchive

"Band 25 der Reihe "Texte und Untersuchungen zur Archivpflege"
Nichtamtliches Archivgut in Kommunalarchiven. Teil 2: Bestandserhaltung, Dokumentationsprofil, Rechtsfragen; Beiträge des 20. Fortbildungsseminars der Bundeskonferenz der Kommunalarchive (BKK) in Eisenach vom 23. – 25. November 2011 / Marcus Stumpf / Katharina Tiemann (Hg.). - Münster, 2012. - 162 S. : Abb. - ISBN 978-3-936258-15-8 / 10 €"
Fotoimpressionen der Fortbildung s. http://archiv.twoday.net/stories/49621130/
Wolf Thomas - am Samstag, 6. Oktober 2012, 20:39 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
Lienerts Dietrich-Testimonien - http://archiv.twoday.net/stories/156272722/ - sind auch im Bereich der Bildüberlieferung alles andere als vorbildlich. Sie werden eher stiefmütterlich abgehandelt und in der Einleitung nicht berücksichtigt.
Katalogartig erfasst werden 24 Zeugnisse (B1 bis B24), gefolgt von nicht gesicherten und zweifelhaften Bildzeugnissen (Z1 bis Z25). Positiv zu vermerken ist, dass die vielen Jagdszenen und Drachenkämpfe, die vor allem Wolfgang Stammler spekulativ ins Spiel gebracht wurde, nun ausgegrenzt sind.
Stammlers RDK-Artikel von 1954 über Dietrich von Bern ist online:
Link
Auch in diesem Bereich erweist sich Lienerts Team als nicht sonderlich recherchierfreudig, was Nedoma in seiner konstruktiven und weiterführenden Rezension allzu zurückhaltend formuliert ("dass Lienert und Mitarbeiterinnen bei entlegeneren Quellen manchmal die Flinte zu früh ins Korn geworfen haben", PBB 2012, S. 129).
Schon die Auswahl überzeugt nicht so recht. Es gibt ja von Theoderich nicht nur die eine Münze (B1, das Goldmedaillon von Morro d'Alba) - was ist mit den anderen [siehe z.B.
http://www.smb.museum/ikmk/object.php?id=18201433 ]? Stammler erwähnt im RDK Sp. 1490 ein Elfenbeinrelief des 13./14. Jh. im GNM - Lienerts Team hatte wohl keine Lust, sich darum zu kümmern und beim Museum nachzufragen.
Am "Glockenturm der Johanneskirche zu Schwäb. Gmünd", phantasierte Stammler im RDK Sp. 1488, befinde sich unterhalb einer Muttergottes das Relief einer Hirschjagd, das wohl ebenfalls als Dietrichs Höllenritt angesehen werden dürfe. Das Relief befindet sich nicht am Glockenturm, sondern an der Südwestecke der Kirche. Ich habe 1987 (Ring der Herzogin S. 127 Anm. 23) Stammlers Deutung als abwegig zurückgewiesen. Zur Ikonographie der Johanniskirche vergleiche man Richard Strobels großes Inventar der Schwäbisch Gmünder Kunstdenkmale (Bd. II, 1995), sein Johanniskirchenbuch von 1997 und jüngst den Aufsatz Strobels in der ZWLG 71 (2012), S. 327ff. Auch dieses Denkmal fehlt im Katalog der fraglichen Bild-Testimonien Lienerts.
 Die Madonna an der Johanniskirche ist heute durch eine Kopie ersetzt (Foto 2012)
Die Madonna an der Johanniskirche ist heute durch eine Kopie ersetzt (Foto 2012)
Beim Andlauer Fries (Bilder auf Commons) vermisst man den Aufsatz von Robert Will: Die epischen Themen der romanischen Bauplastik des Elsaß, in: Baukunst des Mittelalters in Europa. Hans Erich Kubach zum 75. Geburtstag, Stuttgart 1988, S. 323-336, auch wenn dieser methodisch abzulehnen ist.
Schäbigerweise hat der Niemeyer-Verlag gerade einmal 12 schlechte Schwarzweiß-Abbildungen dem knapp 90 Euro teuren Buch spendiert, wobei allerdings drei unverständlicherweise für in bester Qualität im Netz befindliche Heidelberger Handschriften geopfert wurden.
In der Regel sind die Abbildungen im Internet von erheblich besserer Qualität. Ich trage zusammen, was ich zu B1 bis B24 fand, wobei ich vorzugsweise Wikimedia Commons verlinke.
B1. Goldmedaillon von Morro d'Alba
http://archeoroma.beniculturali.it/musei/museo-nazionale-romano/palazzo-massimo/medagliere/collezione-francesco-gnecchi
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teodorico_re_dei_Goti_(493-526).png
B2. Relief von Sant'Ellero, Galeata
Gute Farbabbildung auf empfehlenswerter Informationsseite zum Theoderich-Palast
http://www.archeobo.arti.beniculturali.it/galeata/terme_teodorico.htm
B3. Relief von San Zeno Maggiore, Verona
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basilica_di_san_zeno_protiro,_pannelli_dx_della_scuola_di_niccol%C3%B2_01.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VeronaSZenoMaggScultureDx.jpg
und weitere
B4. Karlsruher Theoderich-Initiale
BLB Karlsruhe U.H. Fragm. 16, 12. Jh.
Der moderne Handschriftenkatalog aus dem Jahr 2000 wird von Lienert nicht zitiert (wie man Handschriftenkataloge auch sonst bei den Handschriftenabbildungen vermisst):
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0545_b482_jpg.htm
Farbabbildung auf dem Schutzumschlag des Lienert-Buchs und
http://shop.blb-karlsruhe.de/images/BigImage/nib_05.gif
[ = http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theoderich_karlsruhe.gif
SW:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0545_b171_jpg.htm ]
B5. Leidener Federzeichnung 'Theodericus rex'
UB Leiden, Cod. VUL 46
Große SW-Abbildung:
https://socrates.leidenuniv.nl/R/-?func=dbin-jump-full&object_id=680928
Kleine Farbabbildung:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gesta_Theodorici_-_Theodoric_the_Great_(455-526).jpg
B6. 'Chronica Theodericiana', Federzeichnung: Kampf Theoderichs mit Odoaker
BAV Rom, Cod. Pal. Lat. 927, Bl. 122r von 1181 aus dem Kloster Mons Olivetus in Verona
Im Netz von mir nicht gefunden, siehe jetzt
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theoderich_odoaker_bav_cpl_927.jpg
B7. Miniaturen zur 'Expositio in Apocalypsim' des Alexander Minorita
Genannt werden Dresden Mscr. A 117, Breslau, UB, Cod. I Q 19 und Prag, Metropolitankapitel Cim. 5, abgebildet Breslau Bl. 45r (Abb. 5), Dresden Bl. 36r (Abb. 6).
Unverzeihlich ist das Fehlen von Schmolinskys Monographie (1991), siehe
http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_00101.html
Im Netz nichts gefunden.
[In Breslau und auf manuscriptorium.com ist der Breslauer Codex vom Ende des 13. Jahrhunderts online:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=72&from=PIONIER%20DLF (Djvu!)
Bl. 45r daraus in Farbe:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theoderich_alexander_minorita.jpg
Dresden (nach Lienert):
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theoderich_alexander_minorita_dresden.jpg
Zu den Bildern die Ausgabe Wachtels 1955:
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00000626/image_48
]

B8. Londoner Apokalypsenaltar
Auf den leider nicht sehr großen Farbabbildungen des VAM
http://collections.vam.ac.uk/item/O89176/altarpiece-with-45-scenes-of-altarpiece-master-bertram/
habe ich die Szene nicht identifiziert.
[Es muss sich um
http://media.vam.ac.uk/media/thira/collection_images/2009CR/2009CR8206_jpg_l.jpg
handeln.]
B9. Fresken auf Schloss Runkelstein
Dietrich im Netz jedenfalls nicht auf Anhieb zu finden, siehe etwa
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Runkelstein_Castle
[Nachtrag: Via Wikipedia gefunden die Triade mit Dietrich, Siegfried und Dietleib:
http://www.runkelstein.info/images_big/triade_6x.html
Demzufolge:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Runkelstein_Castle_22.jpg ]
B10. Laurin-Fesken in Schloss Lichtenberg, Vinschgau
Der grundlegende Aufsatz von Thali in den Wolfram-Studien 2006 (nicht bei Lienert!) ist wenigstens in Auszügen online:
http://books.google.de/books?id=jtl7iRFibmAC
SW-Abbildung aus dem RDK:
http://rdk.zikg.net/rdkdaten/sca/03/03-1489.jpg
B11. Heinrich von München, 'Weltchronik', Dietrich-Miniatur in der New Yorker Handschrift
Pierpont-Morgan-Library M 769, Bl. 331r, farbig und mit Detail der Miniatur:
http://utu.morganlibrary.org/medren/single_image2.cfm?imagename=m769.331r.jpg&page=ICA000189330
Vgl. zur Hs. http://www.mr1314.de/8573 (der Handschriftencensus wird von Lienert nirgends zitiert!)
B12. Rosengarten-Miniaturen im Cpg 359
Digitalisat wird von Lienert genannt:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg359
B13. 'Virginal'-Miniaturen im Cpg 324
Digitalisat wird von Lienert genannt:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg324
B14. 'Sigenot'-Miniaturen im Cpg 67
Digitalisat wird von Lienert genannt:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg67
B15. 'Dresdner Heldenbuch', Titelminiaturen
Farbdigitalisat liegt inzwischen vor:
http://digital.slub-dresden.de/id274282186
Vgl. http://www.handschriftencensus.de/6805
B16. Gedrucktes Heldenbuch (Erstausgabe 1479), Holzschnitte
Farbdigitalisat des Darmstädter Exemplars des Straßburger Drucks liegt inzwischen vor:
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/inc-iii-27
Nicht zitiert ist, obwohl maßgeblich GW 12185
http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12185.htm
B17. Albertus Pictor, Fresko in der Floda Kyrka, Södermanland (Schweden)
SW-Abbildung des um 1479 entstandenen Freskos:
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000200094528
B18. 'Sigenot'-Druck, Holzschnitte
Nicht zitiert ist der GW 12794 zur Erstausgabe in Augsburg (vor 1487)
http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12794.htm
Digitalisiert liegen nur die Münchner Probebögen vor:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00017547-9
Man vergleiche aber auch
http://archive.org/details/dietrichvonbern00heitgoog
Die Bilder sind im PDF, nicht aber im Viewer vorhanden:
https://ia700408.us.archive.org/29/items/dietrichvonbern00heitgoog/dietrichvonbern00heitgoog.pdf
B19. Linhart Scheubels Heldenbuch, Titelminiatur zur 'Virginal'
Wien Cod. 15478, Bl. 1v
http://www.handschriftencensus.de/3627 mit Hinweis auf die Online-SW-Abbildung im Katalog der illustrierten Handschriften (angesichts von http://archiv.twoday.net/stories/115270340/ spare ich mir die Mühe, die Bilddatei in ManuMed als jpg direkt zu verlinken.)
B20. Wiener Federzeichnung eines Theoderich-Standbildes
Indiskutabel ist die Literaturauswahl zur sog. Köldererrolle von 1512/13 (nur Oberhammer 1935), siehe nur den Katalog Hispania Austria 1992 S. 363 Nr. 177, vermutlich gibt es noch jüngere Ausstellungskataloge zum Stück.
Dietrich in Farbe:
http://bilddatenbank.khm.at/images/500/KK_5333_21401.jpg
Kontext:
http://bilddatenbank.khm.at/viewArtefact?id=91340
[Nachtrag: http://archiv.twoday.net/stories/219025120/ ]
B21. Peter Vischer d.Ä., Bronzestatue Theoderichs, Hofkirche Innsbruck
Gute Farbabbildungen:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Innsbruck_1_268.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theoderich_(Vischer).JPG
B22. 'Ehrenpforte' für Kaiser Maximilian I.
Das Exemplar des Braunschweiger Museums ist online:
http://kk.haum-bs.de/?id=a-duerer-wb2-h0279-0h1-036
Dietrich:
http://kk.haum-bs.de/?id=a-duerer-wb2-h0279-016
B23. Burg Wildenstein (bei Sigmaringen), 'Sigenot'-Freskenzyklus
Nachzutragen ist zum literarischen Kontext zuletzt Kragl in den Wolfram-Studien 22 (2012), S. 537f. und zum historischen der Katalog "Mäzene Sammler Chronisten" (2012), S. 194 (Bernd Konrad), siehe aber auch das Register des Bandes s.v. Wildenstein.
Farbige Bilddokumentation von Henrike Lähnemann:
http://www.staff.ncl.ac.uk/henrike.laehnemann/sigenot/
B24. 'Berliner Rosengartenspiel', Federzeichnungen
Zu mgf 800 siehe
http://www.handschriftencensus.de/4412
Online sind die Abbildungen im Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften sowie Bl. 2v
http://books.google.de/books?id=4Sz4f9YS53EC&lpg=PA236&q=rosengartenspiel
[= http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berliner_rosengartenspiel_sw.jpg ]
Ein Online-Projekt zu den Dietrich-Testimonien wäre aus meiner Sicht hundertmal sinnvoller als die in Lienerts Dietrich-Testimonien getroffene Entscheidung, die Bildzeugnisse (zu denen, wie gezeigt, oft schlecht recherchiert wurde) in fragwürdiger Auswahl mit schlechten Schwarzweißabbildungen zu dokumentieren.
[Nach weiterer Suche lässt sich feststellen: Von allen 24 Bildzeugnissen ist wenigstens eine Abbildung im Netz.
Unverständlich ist, dass die Abbildungen Dietrichs von Bern im Hundeshagenschen Codex (um 1440) Berlin mgf 855
http://www.handschriftencensus.de/3622
ausgeklammert wurden.
So zeigt
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dietrich_von_Bern_ueberwaeltigt_Hagen_Kriemhild_betrachtet_die_Szene_Hundeshagenscher_Kodex.jpeg
Dietrich von Bern, desgleichen
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hildebrand_warnt_die_Burgunder_an_der_Mauer_warten_Kriemhild_Dietrich_Hundeshagenscher_Kodex.jpeg ]
Nachtrag: Ein fragliches Testimonium (Mantegnas Wolkenreiter)
http://archiv.twoday.net/stories/156945336/
#forschung
 Leidener Federzeichnung (Fulda, vor 1176)
Leidener Federzeichnung (Fulda, vor 1176)
Katalogartig erfasst werden 24 Zeugnisse (B1 bis B24), gefolgt von nicht gesicherten und zweifelhaften Bildzeugnissen (Z1 bis Z25). Positiv zu vermerken ist, dass die vielen Jagdszenen und Drachenkämpfe, die vor allem Wolfgang Stammler spekulativ ins Spiel gebracht wurde, nun ausgegrenzt sind.
Stammlers RDK-Artikel von 1954 über Dietrich von Bern ist online:
Link
Auch in diesem Bereich erweist sich Lienerts Team als nicht sonderlich recherchierfreudig, was Nedoma in seiner konstruktiven und weiterführenden Rezension allzu zurückhaltend formuliert ("dass Lienert und Mitarbeiterinnen bei entlegeneren Quellen manchmal die Flinte zu früh ins Korn geworfen haben", PBB 2012, S. 129).
Schon die Auswahl überzeugt nicht so recht. Es gibt ja von Theoderich nicht nur die eine Münze (B1, das Goldmedaillon von Morro d'Alba) - was ist mit den anderen [siehe z.B.
http://www.smb.museum/ikmk/object.php?id=18201433 ]? Stammler erwähnt im RDK Sp. 1490 ein Elfenbeinrelief des 13./14. Jh. im GNM - Lienerts Team hatte wohl keine Lust, sich darum zu kümmern und beim Museum nachzufragen.
Am "Glockenturm der Johanneskirche zu Schwäb. Gmünd", phantasierte Stammler im RDK Sp. 1488, befinde sich unterhalb einer Muttergottes das Relief einer Hirschjagd, das wohl ebenfalls als Dietrichs Höllenritt angesehen werden dürfe. Das Relief befindet sich nicht am Glockenturm, sondern an der Südwestecke der Kirche. Ich habe 1987 (Ring der Herzogin S. 127 Anm. 23) Stammlers Deutung als abwegig zurückgewiesen. Zur Ikonographie der Johanniskirche vergleiche man Richard Strobels großes Inventar der Schwäbisch Gmünder Kunstdenkmale (Bd. II, 1995), sein Johanniskirchenbuch von 1997 und jüngst den Aufsatz Strobels in der ZWLG 71 (2012), S. 327ff. Auch dieses Denkmal fehlt im Katalog der fraglichen Bild-Testimonien Lienerts.
 Die Madonna an der Johanniskirche ist heute durch eine Kopie ersetzt (Foto 2012)
Die Madonna an der Johanniskirche ist heute durch eine Kopie ersetzt (Foto 2012)Beim Andlauer Fries (Bilder auf Commons) vermisst man den Aufsatz von Robert Will: Die epischen Themen der romanischen Bauplastik des Elsaß, in: Baukunst des Mittelalters in Europa. Hans Erich Kubach zum 75. Geburtstag, Stuttgart 1988, S. 323-336, auch wenn dieser methodisch abzulehnen ist.
Schäbigerweise hat der Niemeyer-Verlag gerade einmal 12 schlechte Schwarzweiß-Abbildungen dem knapp 90 Euro teuren Buch spendiert, wobei allerdings drei unverständlicherweise für in bester Qualität im Netz befindliche Heidelberger Handschriften geopfert wurden.
In der Regel sind die Abbildungen im Internet von erheblich besserer Qualität. Ich trage zusammen, was ich zu B1 bis B24 fand, wobei ich vorzugsweise Wikimedia Commons verlinke.
B1. Goldmedaillon von Morro d'Alba
http://archeoroma.beniculturali.it/musei/museo-nazionale-romano/palazzo-massimo/medagliere/collezione-francesco-gnecchi
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teodorico_re_dei_Goti_(493-526).png
B2. Relief von Sant'Ellero, Galeata
Gute Farbabbildung auf empfehlenswerter Informationsseite zum Theoderich-Palast
http://www.archeobo.arti.beniculturali.it/galeata/terme_teodorico.htm
B3. Relief von San Zeno Maggiore, Verona
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basilica_di_san_zeno_protiro,_pannelli_dx_della_scuola_di_niccol%C3%B2_01.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VeronaSZenoMaggScultureDx.jpg
und weitere
B4. Karlsruher Theoderich-Initiale
BLB Karlsruhe U.H. Fragm. 16, 12. Jh.
Der moderne Handschriftenkatalog aus dem Jahr 2000 wird von Lienert nicht zitiert (wie man Handschriftenkataloge auch sonst bei den Handschriftenabbildungen vermisst):
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0545_b482_jpg.htm
Farbabbildung auf dem Schutzumschlag des Lienert-Buchs und
http://shop.blb-karlsruhe.de/images/BigImage/nib_05.gif
[ = http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theoderich_karlsruhe.gif
SW:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0545_b171_jpg.htm ]
B5. Leidener Federzeichnung 'Theodericus rex'
UB Leiden, Cod. VUL 46
Große SW-Abbildung:
https://socrates.leidenuniv.nl/R/-?func=dbin-jump-full&object_id=680928
Kleine Farbabbildung:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gesta_Theodorici_-_Theodoric_the_Great_(455-526).jpg
B6. 'Chronica Theodericiana', Federzeichnung: Kampf Theoderichs mit Odoaker
BAV Rom, Cod. Pal. Lat. 927, Bl. 122r von 1181 aus dem Kloster Mons Olivetus in Verona
Im Netz von mir nicht gefunden, siehe jetzt
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theoderich_odoaker_bav_cpl_927.jpg
B7. Miniaturen zur 'Expositio in Apocalypsim' des Alexander Minorita
Genannt werden Dresden Mscr. A 117, Breslau, UB, Cod. I Q 19 und Prag, Metropolitankapitel Cim. 5, abgebildet Breslau Bl. 45r (Abb. 5), Dresden Bl. 36r (Abb. 6).
Unverzeihlich ist das Fehlen von Schmolinskys Monographie (1991), siehe
http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_00101.html
Im Netz nichts gefunden.
[In Breslau und auf manuscriptorium.com ist der Breslauer Codex vom Ende des 13. Jahrhunderts online:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=72&from=PIONIER%20DLF (Djvu!)
Bl. 45r daraus in Farbe:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theoderich_alexander_minorita.jpg
Dresden (nach Lienert):
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theoderich_alexander_minorita_dresden.jpg
Zu den Bildern die Ausgabe Wachtels 1955:
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00000626/image_48
]

B8. Londoner Apokalypsenaltar
Auf den leider nicht sehr großen Farbabbildungen des VAM
http://collections.vam.ac.uk/item/O89176/altarpiece-with-45-scenes-of-altarpiece-master-bertram/
habe ich die Szene nicht identifiziert.
[Es muss sich um
http://media.vam.ac.uk/media/thira/collection_images/2009CR/2009CR8206_jpg_l.jpg
handeln.]
B9. Fresken auf Schloss Runkelstein
Dietrich im Netz jedenfalls nicht auf Anhieb zu finden, siehe etwa
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Runkelstein_Castle
[Nachtrag: Via Wikipedia gefunden die Triade mit Dietrich, Siegfried und Dietleib:
http://www.runkelstein.info/images_big/triade_6x.html
Demzufolge:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Runkelstein_Castle_22.jpg ]
B10. Laurin-Fesken in Schloss Lichtenberg, Vinschgau
Der grundlegende Aufsatz von Thali in den Wolfram-Studien 2006 (nicht bei Lienert!) ist wenigstens in Auszügen online:
http://books.google.de/books?id=jtl7iRFibmAC
SW-Abbildung aus dem RDK:
http://rdk.zikg.net/rdkdaten/sca/03/03-1489.jpg
B11. Heinrich von München, 'Weltchronik', Dietrich-Miniatur in der New Yorker Handschrift
Pierpont-Morgan-Library M 769, Bl. 331r, farbig und mit Detail der Miniatur:
http://utu.morganlibrary.org/medren/single_image2.cfm?imagename=m769.331r.jpg&page=ICA000189330
Vgl. zur Hs. http://www.mr1314.de/8573 (der Handschriftencensus wird von Lienert nirgends zitiert!)
B12. Rosengarten-Miniaturen im Cpg 359
Digitalisat wird von Lienert genannt:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg359
B13. 'Virginal'-Miniaturen im Cpg 324
Digitalisat wird von Lienert genannt:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg324
B14. 'Sigenot'-Miniaturen im Cpg 67
Digitalisat wird von Lienert genannt:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg67
B15. 'Dresdner Heldenbuch', Titelminiaturen
Farbdigitalisat liegt inzwischen vor:
http://digital.slub-dresden.de/id274282186
Vgl. http://www.handschriftencensus.de/6805
B16. Gedrucktes Heldenbuch (Erstausgabe 1479), Holzschnitte
Farbdigitalisat des Darmstädter Exemplars des Straßburger Drucks liegt inzwischen vor:
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/inc-iii-27
Nicht zitiert ist, obwohl maßgeblich GW 12185
http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12185.htm
B17. Albertus Pictor, Fresko in der Floda Kyrka, Södermanland (Schweden)
SW-Abbildung des um 1479 entstandenen Freskos:
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000200094528
B18. 'Sigenot'-Druck, Holzschnitte
Nicht zitiert ist der GW 12794 zur Erstausgabe in Augsburg (vor 1487)
http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12794.htm
Digitalisiert liegen nur die Münchner Probebögen vor:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00017547-9
Man vergleiche aber auch
http://archive.org/details/dietrichvonbern00heitgoog
Die Bilder sind im PDF, nicht aber im Viewer vorhanden:
https://ia700408.us.archive.org/29/items/dietrichvonbern00heitgoog/dietrichvonbern00heitgoog.pdf
B19. Linhart Scheubels Heldenbuch, Titelminiatur zur 'Virginal'
Wien Cod. 15478, Bl. 1v
http://www.handschriftencensus.de/3627 mit Hinweis auf die Online-SW-Abbildung im Katalog der illustrierten Handschriften (angesichts von http://archiv.twoday.net/stories/115270340/ spare ich mir die Mühe, die Bilddatei in ManuMed als jpg direkt zu verlinken.)
B20. Wiener Federzeichnung eines Theoderich-Standbildes
Indiskutabel ist die Literaturauswahl zur sog. Köldererrolle von 1512/13 (nur Oberhammer 1935), siehe nur den Katalog Hispania Austria 1992 S. 363 Nr. 177, vermutlich gibt es noch jüngere Ausstellungskataloge zum Stück.
Dietrich in Farbe:
http://bilddatenbank.khm.at/images/500/KK_5333_21401.jpg
Kontext:
http://bilddatenbank.khm.at/viewArtefact?id=91340
[Nachtrag: http://archiv.twoday.net/stories/219025120/ ]
B21. Peter Vischer d.Ä., Bronzestatue Theoderichs, Hofkirche Innsbruck
Gute Farbabbildungen:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Innsbruck_1_268.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theoderich_(Vischer).JPG
B22. 'Ehrenpforte' für Kaiser Maximilian I.
Das Exemplar des Braunschweiger Museums ist online:
http://kk.haum-bs.de/?id=a-duerer-wb2-h0279-0h1-036
Dietrich:
http://kk.haum-bs.de/?id=a-duerer-wb2-h0279-016
B23. Burg Wildenstein (bei Sigmaringen), 'Sigenot'-Freskenzyklus
Nachzutragen ist zum literarischen Kontext zuletzt Kragl in den Wolfram-Studien 22 (2012), S. 537f. und zum historischen der Katalog "Mäzene Sammler Chronisten" (2012), S. 194 (Bernd Konrad), siehe aber auch das Register des Bandes s.v. Wildenstein.
Farbige Bilddokumentation von Henrike Lähnemann:
http://www.staff.ncl.ac.uk/henrike.laehnemann/sigenot/
B24. 'Berliner Rosengartenspiel', Federzeichnungen
Zu mgf 800 siehe
http://www.handschriftencensus.de/4412
Online sind die Abbildungen im Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften sowie Bl. 2v
http://books.google.de/books?id=4Sz4f9YS53EC&lpg=PA236&q=rosengartenspiel
[= http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berliner_rosengartenspiel_sw.jpg ]
Ein Online-Projekt zu den Dietrich-Testimonien wäre aus meiner Sicht hundertmal sinnvoller als die in Lienerts Dietrich-Testimonien getroffene Entscheidung, die Bildzeugnisse (zu denen, wie gezeigt, oft schlecht recherchiert wurde) in fragwürdiger Auswahl mit schlechten Schwarzweißabbildungen zu dokumentieren.
[Nach weiterer Suche lässt sich feststellen: Von allen 24 Bildzeugnissen ist wenigstens eine Abbildung im Netz.
Unverständlich ist, dass die Abbildungen Dietrichs von Bern im Hundeshagenschen Codex (um 1440) Berlin mgf 855
http://www.handschriftencensus.de/3622
ausgeklammert wurden.
So zeigt
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dietrich_von_Bern_ueberwaeltigt_Hagen_Kriemhild_betrachtet_die_Szene_Hundeshagenscher_Kodex.jpeg
Dietrich von Bern, desgleichen
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hildebrand_warnt_die_Burgunder_an_der_Mauer_warten_Kriemhild_Dietrich_Hundeshagenscher_Kodex.jpeg ]
Nachtrag: Ein fragliches Testimonium (Mantegnas Wolkenreiter)
http://archiv.twoday.net/stories/156945336/
#forschung
 Leidener Federzeichnung (Fulda, vor 1176)
Leidener Federzeichnung (Fulda, vor 1176)KlausGraf - am Samstag, 6. Oktober 2012, 16:20 - Rubrik: Bildquellen
Lienerts Dietrich-Testimonien - http://archiv.twoday.net/stories/156272722/ - führen als Nr. 161 das mittelniederländische strophische Gedicht "De vier heren wenschen" an. Ich lasse mal dahingestellt, ob "Gesinnungswettstreit" eine so glückliche Beschreibung ist, aber die Angaben zu Ausgaben und Literatur sind inakzeptabel. Diese sollen laut Vorwort in "strengster Auswahl" erfolgen, aber hier hat man beinahe alles weggelassen, was der heutige Benutzer über den Text wissen sollte, über den es ja keinen eigenen Verfasserlexikonartikel gibt.
Die Überlieferung ist unikal, aber dass der Text in der berühmten Hulthemschen Handschrift in Brüssel (drei Wikipedia-Sprachversionen enthalten zu ihr Artikel!) vorliegt, erfährt der zunehmend ärgerliche Leser nicht.
Die Handschrift wird derzeit um 1410 datiert:
http://www.handschriftencensus.de/6926
http://www.mrfreidank.de/50
DBNL hat zu ihr eine eigene Seite:
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_hul001
Hier liegt auch die Ausgabe von 1999 gescannt vor (was im Handschriftencensus übersehen wurde):
http://www.dbnl.org/tekst/_hul001hult02_01/
Diese Ausgabe (S. 555-559) nach Bl. 99va-100rb der Handschrift ist als maßgeblich anzusehen und hätte nicht weggelassen werden dürfen!
Lienert nennt nur die Ausgabe Blommaerts
http://books.google.de/books?id=GWo_AAAAcAAJ&pg=PA101
und die Erstausgabe Mones
http://books.google.de/books?id=-egIAAAAQAAJ&pg=PA145
Das Zitat bei Lienert "S. 147-154, Text S. 148-154" ist allerdings nicht korrekt, es muss S. 145-155, Text S. 148-154 heißen.
Als Sekundärliteratur nennt Lienert nur Grimms Heldensage, obwohl man mühelos mehrere moderne Aufsätze, die sich mit dem Text befassen, findet. Allein Kragls Nibelungenlied-Bibliographie, auszugsweise:
http://books.google.de/books?id=2VqCy80P52cC
hat drei. Einer von 1973 (Faes im Spectator) ist online:
http://www.dbnl.org/tekst/_spe011197301_01/_spe011197301_01_0002.php
Voorwinden hat sich auf dem 3. Pöchlarner Heldenliedgespräch (Tagungsband erschien 1995!) zu dem Gedicht geäußert, was man in Bremen nun wirklich hätte zur Kenntnis nehmen müssen.
Was die hier besprochene Nr. 206 angeht, möchte ich Lienerts Testimonien als unbrauchbar bezeichnen.
Die Überlieferung ist unikal, aber dass der Text in der berühmten Hulthemschen Handschrift in Brüssel (drei Wikipedia-Sprachversionen enthalten zu ihr Artikel!) vorliegt, erfährt der zunehmend ärgerliche Leser nicht.
Die Handschrift wird derzeit um 1410 datiert:
http://www.handschriftencensus.de/6926
http://www.mrfreidank.de/50
DBNL hat zu ihr eine eigene Seite:
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_hul001
Hier liegt auch die Ausgabe von 1999 gescannt vor (was im Handschriftencensus übersehen wurde):
http://www.dbnl.org/tekst/_hul001hult02_01/
Diese Ausgabe (S. 555-559) nach Bl. 99va-100rb der Handschrift ist als maßgeblich anzusehen und hätte nicht weggelassen werden dürfen!
Lienert nennt nur die Ausgabe Blommaerts
http://books.google.de/books?id=GWo_AAAAcAAJ&pg=PA101
und die Erstausgabe Mones
http://books.google.de/books?id=-egIAAAAQAAJ&pg=PA145
Das Zitat bei Lienert "S. 147-154, Text S. 148-154" ist allerdings nicht korrekt, es muss S. 145-155, Text S. 148-154 heißen.
Als Sekundärliteratur nennt Lienert nur Grimms Heldensage, obwohl man mühelos mehrere moderne Aufsätze, die sich mit dem Text befassen, findet. Allein Kragls Nibelungenlied-Bibliographie, auszugsweise:
http://books.google.de/books?id=2VqCy80P52cC
hat drei. Einer von 1973 (Faes im Spectator) ist online:
http://www.dbnl.org/tekst/_spe011197301_01/_spe011197301_01_0002.php
Voorwinden hat sich auf dem 3. Pöchlarner Heldenliedgespräch (Tagungsband erschien 1995!) zu dem Gedicht geäußert, was man in Bremen nun wirklich hätte zur Kenntnis nehmen müssen.
Was die hier besprochene Nr. 206 angeht, möchte ich Lienerts Testimonien als unbrauchbar bezeichnen.
KlausGraf - am Freitag, 5. Oktober 2012, 19:53 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nachtrag zu: http://archiv.twoday.net/stories/156272722/
Zu Lienerts Dietrich-Testimonien Nr. 291 S. 211f. - "Klagred eines jungen münchs über sein kutten" - heißt es in der Konkordanz "nicht gefunden". Hier wird überdeutlich, dass die Mitarbeiterinnen des Projekts nicht bibliographieren konnten. Mit dem KVK findet man im VD 16 auf Anhieb zwei Ausgaben: Straßburg 1520
http://gateway-bayern.de/VD16+K+1222
und Speyer 1522
http://gateway-bayern.de/VD16+K+1223
[Vgl. auch Nedoma, PBB 2012, S. 131, der aber nur die jüngere Ausgabe 1522 nennt.]
Generell sind die Angaben zur Überlieferung bei Lienert unbefriedigend. Bei Inkunabeln wären die Inkunabelbibliographien (GW, meinetwegen auch ISTC) unbedingt zu zitieren gewesen, bei Drucken des 16. Jahrhunderts muss man das VD 16 angeben. Bei handschriftlich überlieferten Texten kann man sich darüber streiten, wie intensiv man dokumentiert, aber mindestens bei unikal überlieferten Texten hätte man die Handschrift nennen sollen (Nr. 209 wird bei Hugo von Montfort aber ausnahmsweise der Cpg 329 ausdrücklich angeführt, freilich ohne die beiden Stellen in der Handschrift aufzusuchen und im Digitalisat zu verlinken!).
Zu Lienerts Dietrich-Testimonien Nr. 291 S. 211f. - "Klagred eines jungen münchs über sein kutten" - heißt es in der Konkordanz "nicht gefunden". Hier wird überdeutlich, dass die Mitarbeiterinnen des Projekts nicht bibliographieren konnten. Mit dem KVK findet man im VD 16 auf Anhieb zwei Ausgaben: Straßburg 1520
http://gateway-bayern.de/VD16+K+1222
und Speyer 1522
http://gateway-bayern.de/VD16+K+1223
[Vgl. auch Nedoma, PBB 2012, S. 131, der aber nur die jüngere Ausgabe 1522 nennt.]
Generell sind die Angaben zur Überlieferung bei Lienert unbefriedigend. Bei Inkunabeln wären die Inkunabelbibliographien (GW, meinetwegen auch ISTC) unbedingt zu zitieren gewesen, bei Drucken des 16. Jahrhunderts muss man das VD 16 angeben. Bei handschriftlich überlieferten Texten kann man sich darüber streiten, wie intensiv man dokumentiert, aber mindestens bei unikal überlieferten Texten hätte man die Handschrift nennen sollen (Nr. 209 wird bei Hugo von Montfort aber ausnahmsweise der Cpg 329 ausdrücklich angeführt, freilich ohne die beiden Stellen in der Handschrift aufzusuchen und im Digitalisat zu verlinken!).
KlausGraf - am Freitag, 5. Oktober 2012, 18:58 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
via TwitterImmer, wenn man mir im Staatsarchiv weiße Handschuhe gibt, weiß ich nicht ob ich den Moonwalk tanzen oder nur Bücher durchblättern soll.
— BlackadderBlog (@BlackadderBlog) October 3, 2012
Wolf Thomas - am Freitag, 5. Oktober 2012, 15:56 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das von Elisabeth Lienert herausgegebene Buch "Dietrich-Testimonien des 6. bis 16. Jahrhunderts" (2008) wurde mir erst jetzt bekannt und zwar durch die (zu positive) Besprechung von Robert Nedoma: Dietrich-Testimonien, ed. Elisabeth Lienert et al. (= Texte und Studien zur mittelhochdeutschen Heldenepik 4; Tübingen 2008). In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 134 (2012), S. 127‒133.
Mit knapp 90 Euro ist es sehr teuer, glücklicherweise konnte ich es antiquarisch günstiger erwerben. Obwohl es ein Standardwerk zur Heldensage darstellt (eine teilweise Neubearbeitung von Wilhelm Grimms Heldensagen-Zeugnissen), ist es nur spärlich in wissenschaftlichen Bibliotheken verbreitet (meine "Urheberrechtsfibel" ist z.B. laut KVK in NRW in mehr Standorten nachgewiesen). Wie immer in solchen Fällen halte ich ein solches Nachschlagewerk in Druckform für völlig anachronistisch und wissenschaftsschädlich. Eine Open-Access-Veröffentlichung würde es ermöglichen, die vielen Fehler und Lücken, die mir bereits in den wenigen Stunden, in denen ich mit dem Buch arbeite, spontan auffielen, nach und nach auszubessern und - das ist aus meiner Sicht ebenso wichtig - Links zu den teilweise sehr entlegenen Quellen und zur älteren Sekundärliteratur beizufügen.
Ich selbst habe mich ja in meinem Aufsatz "Heroisches Herkommen" von 1993 (der in dem Band häufig zitiert wird) mit Heldensagen-Testimonien befasst:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5306/
Ich habe in der Zwischenzeit weitergesammelt und z.B. zu den Wormser Testimonien weiteres, teilweise unbekanntes Material, ohne dass ich es bisher geschafft habe, es zu publizieren. Auch mein seit 2004 online zugänglicher Vortrag zum Nibelungenlied im späten Mittelalter, der mit einem in dem Band fehlenden Dietrich-Testimonium Wigand Gerstenbergs beginnt
http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2004/0198.html
ist noch nicht gedruckt.
Eine nähere Kritik des Lienert-Bandes behalte ich mir vor, heute möchte ich nur gleichsam aus dem Handgelenk an einem Beispiel verdeutlichen, wie wenig kompetent das DFG-Projekt im Einzelfall agierte und wie wenig Mühe es sich mitunter gegeben hat. Das Projekt war 2006 im wesentlichen fertiggestellt, und man mag es als selbstgerecht empfinden, wenn ich mit den Suchmöglichkeiten des Jahres 2012 argumentiere, aber ich bin überzeugt, dass man schon damals bei gewissenhafter und sorgfältiger Recherche vielleicht nicht zehn Minuten mit Hilfe von Google Book Search wie heute gebraucht hätte, aber doch mit zumutbarem Aufwand der Quelle hätte auf die Spur kommen können - womöglich auch allein aufgrund von Auskünften von Bibliotheken oder der Recherche ausschließlich in gedruckter Literatur.
Es geht um die Nr. 200 S. 157 "Inschrift zur Abbildung eines Streitwagens" aus einer Tiroler lateinischen Handschrift, die Alois Primisser bekannt gemacht hatte. Meine These ist nun, dass es sehr wohl möglich gewesen wäre, von diesen Angaben - über Umwege und weitere Recherchen - auf den Artikel "Allerley Kriegsrüstung" im Verfasserlexikon (²VL) zu kommen, der als moderne Signatur des Codex Kunsthistorisches Museum Wien Ambraser Sammlung cod. 49 angibt:
http://www.libreka.de/9783110072648/151
http://www.handschriftencensus.de/15935 (ohne weitere Angaben)
Zwar war die Suche nach Textbruchstücken ("biga dytrici") erfolglos, aber die Suche in Google Books nach primisser streitwagen ein Volltreffer.
Primisser hatte 1819 ein Buch über die Ambraser Sammlung veröffentlicht (darauf hätte man auch ganz traditionell offline bei Recherchen nach dem Namen Primisser kommen können), in dem er die gleiche Handschrift nochmals beschreibt:
http://books.google.de/books?id=mqwAAAAAcAAJ&pg=PA285
Von hier aus hätte man früher brieflich bei der ÖNB Wien angefragt, die einen dann - hoffentlich - an das Kunsthistorische Museum verwiesen hätte. Mit der Google-Books-Suche wien "charr ist" kam ich dann auf Jähns, der in einem Schnipsel
http://books.google.de/books?id=0JgrAAAAYAAJ&q=wien+%22charr+ist%22
den Titel "Allerley Kriegsrüstung" nennt.
Sollte man nicht erwarten können, dass auch Hilfskräfte - wenn auch mit mehr Aufwand - zum gleichen Ergebnis hätten gelangen können?
Die ältere Literatur zitiert Primissers Aufsatz nach Büschings wöchentlichen Nachrichten Bd. 4, S. 225
http://books.google.de/books?id=5apGAAAAcAAJ&pg=PA225
während Lienert eine andere Zeitschrift Büschings aber mit der gleichen Seitenzahl für den Aufsatz Primissers zitiert.
Grimms Heldensage in der 3., von Reinhold Steig besorgten Auflage 1889:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Die_deutsche_Heldensage_%28Grimm_W.%29_351.jpg
Wie schon Grimm begeht Lienert den kapitalen Fehler, den bei Primisser präsenten Troja-Kontext des Zeugnisses auszublenden. Nach der Handschrift handelt es sich eben nicht um den Streitwagen Dietrichs, sondern um den Wagen Hektors von Troja (bekanntlich wurde dieser in Xanten mit Hagen von Tronje identifiziert). Wer den unmittelbaren Kontext des Zeugnisses weglässt (wobei konzediert sei, dass der Sinn der lateinischen Verse nicht auf Anhieb verständlich ist) verfälscht es!
Und das soll exzellente Wissenschaft sein?
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/1022372433/
http://archiv.twoday.net/stories/948988035/
http://archiv.twoday.net/stories/931537561/
http://archiv.twoday.net/stories/931535686/
http://archiv.twoday.net/stories/156272785/
http://archiv.twoday.net/stories/156272845/
http://archiv.twoday.net/stories/156273365/ (Bild-Testimonien)
http://archiv.twoday.net/stories/156945336/
http://archiv.twoday.net/stories/172009062/
http://archiv.twoday.net/stories/172009103/
#forschung
 Theoderich-Initiale der BLB (S. 261 Nr. B 4 falsch "Karlsruhe, Universitätsbibliothek", richtig im Bildnachweis S. 325 zur schlechten SW-Abb. 2)
Theoderich-Initiale der BLB (S. 261 Nr. B 4 falsch "Karlsruhe, Universitätsbibliothek", richtig im Bildnachweis S. 325 zur schlechten SW-Abb. 2)
Mit knapp 90 Euro ist es sehr teuer, glücklicherweise konnte ich es antiquarisch günstiger erwerben. Obwohl es ein Standardwerk zur Heldensage darstellt (eine teilweise Neubearbeitung von Wilhelm Grimms Heldensagen-Zeugnissen), ist es nur spärlich in wissenschaftlichen Bibliotheken verbreitet (meine "Urheberrechtsfibel" ist z.B. laut KVK in NRW in mehr Standorten nachgewiesen). Wie immer in solchen Fällen halte ich ein solches Nachschlagewerk in Druckform für völlig anachronistisch und wissenschaftsschädlich. Eine Open-Access-Veröffentlichung würde es ermöglichen, die vielen Fehler und Lücken, die mir bereits in den wenigen Stunden, in denen ich mit dem Buch arbeite, spontan auffielen, nach und nach auszubessern und - das ist aus meiner Sicht ebenso wichtig - Links zu den teilweise sehr entlegenen Quellen und zur älteren Sekundärliteratur beizufügen.
Ich selbst habe mich ja in meinem Aufsatz "Heroisches Herkommen" von 1993 (der in dem Band häufig zitiert wird) mit Heldensagen-Testimonien befasst:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5306/
Ich habe in der Zwischenzeit weitergesammelt und z.B. zu den Wormser Testimonien weiteres, teilweise unbekanntes Material, ohne dass ich es bisher geschafft habe, es zu publizieren. Auch mein seit 2004 online zugänglicher Vortrag zum Nibelungenlied im späten Mittelalter, der mit einem in dem Band fehlenden Dietrich-Testimonium Wigand Gerstenbergs beginnt
http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2004/0198.html
ist noch nicht gedruckt.
Eine nähere Kritik des Lienert-Bandes behalte ich mir vor, heute möchte ich nur gleichsam aus dem Handgelenk an einem Beispiel verdeutlichen, wie wenig kompetent das DFG-Projekt im Einzelfall agierte und wie wenig Mühe es sich mitunter gegeben hat. Das Projekt war 2006 im wesentlichen fertiggestellt, und man mag es als selbstgerecht empfinden, wenn ich mit den Suchmöglichkeiten des Jahres 2012 argumentiere, aber ich bin überzeugt, dass man schon damals bei gewissenhafter und sorgfältiger Recherche vielleicht nicht zehn Minuten mit Hilfe von Google Book Search wie heute gebraucht hätte, aber doch mit zumutbarem Aufwand der Quelle hätte auf die Spur kommen können - womöglich auch allein aufgrund von Auskünften von Bibliotheken oder der Recherche ausschließlich in gedruckter Literatur.
Es geht um die Nr. 200 S. 157 "Inschrift zur Abbildung eines Streitwagens" aus einer Tiroler lateinischen Handschrift, die Alois Primisser bekannt gemacht hatte. Meine These ist nun, dass es sehr wohl möglich gewesen wäre, von diesen Angaben - über Umwege und weitere Recherchen - auf den Artikel "Allerley Kriegsrüstung" im Verfasserlexikon (²VL) zu kommen, der als moderne Signatur des Codex Kunsthistorisches Museum Wien Ambraser Sammlung cod. 49 angibt:
http://www.libreka.de/9783110072648/151
http://www.handschriftencensus.de/15935 (ohne weitere Angaben)
Zwar war die Suche nach Textbruchstücken ("biga dytrici") erfolglos, aber die Suche in Google Books nach primisser streitwagen ein Volltreffer.
Primisser hatte 1819 ein Buch über die Ambraser Sammlung veröffentlicht (darauf hätte man auch ganz traditionell offline bei Recherchen nach dem Namen Primisser kommen können), in dem er die gleiche Handschrift nochmals beschreibt:
http://books.google.de/books?id=mqwAAAAAcAAJ&pg=PA285
Von hier aus hätte man früher brieflich bei der ÖNB Wien angefragt, die einen dann - hoffentlich - an das Kunsthistorische Museum verwiesen hätte. Mit der Google-Books-Suche wien "charr ist" kam ich dann auf Jähns, der in einem Schnipsel
http://books.google.de/books?id=0JgrAAAAYAAJ&q=wien+%22charr+ist%22
den Titel "Allerley Kriegsrüstung" nennt.
Sollte man nicht erwarten können, dass auch Hilfskräfte - wenn auch mit mehr Aufwand - zum gleichen Ergebnis hätten gelangen können?
Die ältere Literatur zitiert Primissers Aufsatz nach Büschings wöchentlichen Nachrichten Bd. 4, S. 225
http://books.google.de/books?id=5apGAAAAcAAJ&pg=PA225
während Lienert eine andere Zeitschrift Büschings aber mit der gleichen Seitenzahl für den Aufsatz Primissers zitiert.
Grimms Heldensage in der 3., von Reinhold Steig besorgten Auflage 1889:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Die_deutsche_Heldensage_%28Grimm_W.%29_351.jpg
Wie schon Grimm begeht Lienert den kapitalen Fehler, den bei Primisser präsenten Troja-Kontext des Zeugnisses auszublenden. Nach der Handschrift handelt es sich eben nicht um den Streitwagen Dietrichs, sondern um den Wagen Hektors von Troja (bekanntlich wurde dieser in Xanten mit Hagen von Tronje identifiziert). Wer den unmittelbaren Kontext des Zeugnisses weglässt (wobei konzediert sei, dass der Sinn der lateinischen Verse nicht auf Anhieb verständlich ist) verfälscht es!
Und das soll exzellente Wissenschaft sein?
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/1022372433/
http://archiv.twoday.net/stories/948988035/
http://archiv.twoday.net/stories/931537561/
http://archiv.twoday.net/stories/931535686/
http://archiv.twoday.net/stories/156272785/
http://archiv.twoday.net/stories/156272845/
http://archiv.twoday.net/stories/156273365/ (Bild-Testimonien)
http://archiv.twoday.net/stories/156945336/
http://archiv.twoday.net/stories/172009062/
http://archiv.twoday.net/stories/172009103/
#forschung
 Theoderich-Initiale der BLB (S. 261 Nr. B 4 falsch "Karlsruhe, Universitätsbibliothek", richtig im Bildnachweis S. 325 zur schlechten SW-Abb. 2)
Theoderich-Initiale der BLB (S. 261 Nr. B 4 falsch "Karlsruhe, Universitätsbibliothek", richtig im Bildnachweis S. 325 zur schlechten SW-Abb. 2)KlausGraf - am Freitag, 5. Oktober 2012, 15:48 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Natürlich beteiligt sich auch Archivalia kurz vor Torschluss noch am Welttiertag.
 Der Ablassbrief von 1335 für die Aachener Aegidiuskapelle liegt heute im Bestand Bemalte Urkunden des Hauptstaatsarchivs Stuttgart. Dorthin ist er wohl über den Deutschen Orden geraten.
Der Ablassbrief von 1335 für die Aachener Aegidiuskapelle liegt heute im Bestand Bemalte Urkunden des Hauptstaatsarchivs Stuttgart. Dorthin ist er wohl über den Deutschen Orden geraten.
 Der Ablassbrief von 1335 für die Aachener Aegidiuskapelle liegt heute im Bestand Bemalte Urkunden des Hauptstaatsarchivs Stuttgart. Dorthin ist er wohl über den Deutschen Orden geraten.
Der Ablassbrief von 1335 für die Aachener Aegidiuskapelle liegt heute im Bestand Bemalte Urkunden des Hauptstaatsarchivs Stuttgart. Dorthin ist er wohl über den Deutschen Orden geraten.KlausGraf - am Donnerstag, 4. Oktober 2012, 23:50 - Rubrik: Unterhaltung
Ich selbst habe zwar kein Foto von mir im Impressum, aber andere Blogger schätzen es, wenn sie auch durch ein Bild kenntlich werden.
Man mag geneigt sein, schon die Frage, ob das denn erlaubt sei, als albern zu empfinden und mit der Gegenfrage zu antworten: Warum denn nicht? Tückisch ist nicht das bereits hier behandelte "Recht am eigenen Bild", sondern das Urheberrecht.
Faustregel: Völlig unproblematisch sind Bilder von sich mit Selbstauslöser und solche, bei denen man sich die ausschließlichen Nutzungsrechte ausdrücklich hat übertragen lassen.
In meinem Urlaub in den Alpen habe ich ein paarmal andere Wanderer mit ihrem Fotoapparat fotografiert und wurde umgekehrt auch einmal selbst abgelichtet. Zwar wird "kein Hahn danach krähen", wenn sie z.B. auf Facebook verwendet werden, aber eigentlich liegen die urheberrechtlichen Nutzungsrechte solcher Fotos (sie sind in jedem Fall mindestens nach § 72 UrhG geschützt) beim Fotografen und nicht beim Abgebildeten.
Es liegt nahe, wenn man nicht den Schnappschuss eines befreundeten Wikipedianers nutzen möchte, der natürlich keinen Ärger machen wird, auf die teuer bezahlten Pass- oder Bewerbungsfotos eines Profi-Fotografen zurückzugreifen. Meistens passiert dann zwar nichts, aber in Einzelfällen kann man doch eine böse Überraschung erleben, wenn man an einen Fotografen geraten ist, der nichts Besseres zu tun hat, als die Verwendung seiner Bilder im Netz zu recherchieren.
Die Rechtslage ist leider eindeutig: Ist nichts anderes vereinbart, darf man bestellte Bilder nicht ins Internet stellen. Denn die Ausnahmeregelung in § 60 UrhG (siehe auch Wikipedia)gilt gerade nicht für Online_Nutzungen. Keinerlei Verständnis habe ich für die Entscheidung des Landgerichts Köln, das 2006 einem Fotostudio Recht gab, obwohl der Besteller der Fotos den Auftrag erteilt hatte, "ein digitales Porträtfoto von ihm anzufertigen, um damit online für seine berufliche Tätigkeit zu werben". Das umfasse keineswegs, meinte das Gericht, die Internetveröffentlichung, sondern nur die Versendung per Mail zu Bewerbungszwecken.
Trotzdem: Das Risiko, mit einem Foto von sich urheberrechtlichen Ärger zu bekommen, schätze ich als sehr gering ein. Nur ein kleiner Teil der Fotografen springt so mit seiner Kundschaft um.
Natürlich kann man diese Einsichten auf den Fall übertragen, dass ein Blogger einen Wissenschaftler abbilden möchte und um ein Foto bittet. In mindestens 99 % der Fälle - schätze ich - ist sich der so Angesprochene der urheberrechtlichen Problematik überhaupt nicht bewusst. Er gibt ein Foto aus der Hand, auf dem er sich gut getroffen glaubt und denkt nicht daran, dass es ja von einem anderen stammt. Es empfiehlt sich in solchen Fällen, um unkalkulierbaren Ärger zu vermeiden, sich den Namen des Urhebers nennen zu lassen und diesen um Zustimmung zu bitten.
 Keine Probleme bereitet mein Avatar auf Tumblr, denn das ist eine gemeinfreie Abbildung von Konrad Peutinger.
Keine Probleme bereitet mein Avatar auf Tumblr, denn das ist eine gemeinfreie Abbildung von Konrad Peutinger.
Man mag geneigt sein, schon die Frage, ob das denn erlaubt sei, als albern zu empfinden und mit der Gegenfrage zu antworten: Warum denn nicht? Tückisch ist nicht das bereits hier behandelte "Recht am eigenen Bild", sondern das Urheberrecht.
Faustregel: Völlig unproblematisch sind Bilder von sich mit Selbstauslöser und solche, bei denen man sich die ausschließlichen Nutzungsrechte ausdrücklich hat übertragen lassen.
In meinem Urlaub in den Alpen habe ich ein paarmal andere Wanderer mit ihrem Fotoapparat fotografiert und wurde umgekehrt auch einmal selbst abgelichtet. Zwar wird "kein Hahn danach krähen", wenn sie z.B. auf Facebook verwendet werden, aber eigentlich liegen die urheberrechtlichen Nutzungsrechte solcher Fotos (sie sind in jedem Fall mindestens nach § 72 UrhG geschützt) beim Fotografen und nicht beim Abgebildeten.
Es liegt nahe, wenn man nicht den Schnappschuss eines befreundeten Wikipedianers nutzen möchte, der natürlich keinen Ärger machen wird, auf die teuer bezahlten Pass- oder Bewerbungsfotos eines Profi-Fotografen zurückzugreifen. Meistens passiert dann zwar nichts, aber in Einzelfällen kann man doch eine böse Überraschung erleben, wenn man an einen Fotografen geraten ist, der nichts Besseres zu tun hat, als die Verwendung seiner Bilder im Netz zu recherchieren.
Die Rechtslage ist leider eindeutig: Ist nichts anderes vereinbart, darf man bestellte Bilder nicht ins Internet stellen. Denn die Ausnahmeregelung in § 60 UrhG (siehe auch Wikipedia)gilt gerade nicht für Online_Nutzungen. Keinerlei Verständnis habe ich für die Entscheidung des Landgerichts Köln, das 2006 einem Fotostudio Recht gab, obwohl der Besteller der Fotos den Auftrag erteilt hatte, "ein digitales Porträtfoto von ihm anzufertigen, um damit online für seine berufliche Tätigkeit zu werben". Das umfasse keineswegs, meinte das Gericht, die Internetveröffentlichung, sondern nur die Versendung per Mail zu Bewerbungszwecken.
Trotzdem: Das Risiko, mit einem Foto von sich urheberrechtlichen Ärger zu bekommen, schätze ich als sehr gering ein. Nur ein kleiner Teil der Fotografen springt so mit seiner Kundschaft um.
Natürlich kann man diese Einsichten auf den Fall übertragen, dass ein Blogger einen Wissenschaftler abbilden möchte und um ein Foto bittet. In mindestens 99 % der Fälle - schätze ich - ist sich der so Angesprochene der urheberrechtlichen Problematik überhaupt nicht bewusst. Er gibt ein Foto aus der Hand, auf dem er sich gut getroffen glaubt und denkt nicht daran, dass es ja von einem anderen stammt. Es empfiehlt sich in solchen Fällen, um unkalkulierbaren Ärger zu vermeiden, sich den Namen des Urhebers nennen zu lassen und diesen um Zustimmung zu bitten.
KlausGraf - am Donnerstag, 4. Oktober 2012, 21:50 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://ordensgeschichte.hypotheses.org/408
Mit über 30 registrierten AutorInnen und nicht wenigen Beiträgen ist das neue Blog erfreulich erfolgreich. Möge die Kraft weiter mit ihm sein!
Mit über 30 registrierten AutorInnen und nicht wenigen Beiträgen ist das neue Blog erfreulich erfolgreich. Möge die Kraft weiter mit ihm sein!
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Peter Zadek (1926-2009) gehörte seit den sechziger Jahren zu den einflussreichsten und bedeutendsten Regisseuren des deutschsprachigen und europäischen Theaters. Die Zeugnisse dieses reichen Theaterlebens, das wie kein anderes die Theaterlandschaft von Grund auf veränderte, werden heute in dem umfangreichen Peter-Zadek-Archiv der Akademie aufbewahrt, deren Mitglied Zadek seit 1991 bis zu seinem Tod war.
....
Das Peter-Zadek-Archiv erstreckt sich über 35 Regalmeter. Es enthält Regiebücher, Konzeptions- und Produktionspapiere, Fotos, Kritiken, Briefwechsel, Plakate und Bühnengrundrisse sowie die Familienalben der Familie Zadek. Ohne diese einmalige Quelle wäre z.B. das 24seitige Werkverzeichnis der aktuellen Akademie-Publikation zu Zadek nicht möglich gewesen, das u.a. die legendären einwöchigen Regien Zadeks Mitte der 1950er Jahre in Pontybridd bzw. Swansea belegen. Auch Zadeks akribische Textarbeit spiegelt sich in den unterschiedlichen Textfassungen der Übersetzungen wider, die sich im Archiv befinden. Erhalten sind auch die Illustrationen seiner assoziativen Bilderwände, die als Anschauungsmaterial für Regieteam und Schauspieler schon bei dem 1977er Hamlet belegt sind. Peter Zadeks Arbeit als Regisseur und seine Tätigkeit als Intendant in Bochum, Hamburg und Berlin (dort zusammen mit Matthias Langhoff, Fritz Marquardt, Heiner Müller und Peter Palitzsch) werden so nachvollziehbar und für die Forschung erreichbar.
...
Publikation
Peter Zadek und seine Bühnenbildner. Herausgegeben von Elisabeth Plessen im Auftrag der Akademie der Künste, Berlin 2012, 200 Farb- u. s/w-Abb., 208 S., ISBN 978-3-88331-191-3, Preis 24 €"
Quelle: Pressemitteilung der Akademie der Künste Berlin, 24.9.2012
....
Das Peter-Zadek-Archiv erstreckt sich über 35 Regalmeter. Es enthält Regiebücher, Konzeptions- und Produktionspapiere, Fotos, Kritiken, Briefwechsel, Plakate und Bühnengrundrisse sowie die Familienalben der Familie Zadek. Ohne diese einmalige Quelle wäre z.B. das 24seitige Werkverzeichnis der aktuellen Akademie-Publikation zu Zadek nicht möglich gewesen, das u.a. die legendären einwöchigen Regien Zadeks Mitte der 1950er Jahre in Pontybridd bzw. Swansea belegen. Auch Zadeks akribische Textarbeit spiegelt sich in den unterschiedlichen Textfassungen der Übersetzungen wider, die sich im Archiv befinden. Erhalten sind auch die Illustrationen seiner assoziativen Bilderwände, die als Anschauungsmaterial für Regieteam und Schauspieler schon bei dem 1977er Hamlet belegt sind. Peter Zadeks Arbeit als Regisseur und seine Tätigkeit als Intendant in Bochum, Hamburg und Berlin (dort zusammen mit Matthias Langhoff, Fritz Marquardt, Heiner Müller und Peter Palitzsch) werden so nachvollziehbar und für die Forschung erreichbar.
...
Publikation
Peter Zadek und seine Bühnenbildner. Herausgegeben von Elisabeth Plessen im Auftrag der Akademie der Künste, Berlin 2012, 200 Farb- u. s/w-Abb., 208 S., ISBN 978-3-88331-191-3, Preis 24 €"
Quelle: Pressemitteilung der Akademie der Künste Berlin, 24.9.2012
Wolf Thomas - am Donnerstag, 4. Oktober 2012, 18:54 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Es kommt häufig vor, dass Bilder in der Wikipedia oder auf Wikimedia Commons, die unter freier Lizenz (CC-BY oder CC-BY-SA) stehen, ohne Namensnennung oder ohne Nennung der Lizenz genutzt werden. Nicht jeder betroffene Urheber möchte das hinnehmen, zumal bei kommerziellen oder behördlichen Nutzern. Etliche Fotografen, darunter auch ich, vertreten die Ansicht, dass sich inzwischen herumgesprochen haben sollte, wie man solche Bilder korrekt nutzt.
Siehe
http://archiv.twoday.net/stories/38723599/ mit vielen weiteren Nachweisen
Wer gegen die Bedingungen der Lizenz verstößt, dessen Nutzungsrecht erlischt und er kann ebenso wie derjenige behandelt werden, der ein beliebiges urheberrechtlich geschütztes Bild widerrechtlich nutzt.
Das LG Berlin hat 2010 in einem Beschluss bekräftigt, dass die Urhebernennung und der Lizenztext bzw. die URL der Lizenz beizugeben sind:
http://www.ifross.org/Fremdartikel/LG%20Berlin%20CC-Lizenz.pdf
Wer sich dagegen wendet, dass penetrant gegen diese ja nun wirklich simplen zwei Grundsätze verstoßen wird, kann sich auf triftige moralische Argumente stützen:
* Die Urhebernennung ist die einzige Gegenleistung für eine umfassende Nutzung auch zu kommerziellen Zwecken, die dem Autor direkt zugutekommt. Kommerzielle Bildagenturen und Berufsfotografen fordern für teure Bilder solche Urhebernennungen ohne weiteres. Da ist es doch nicht zuviel verlangt, wenn die symbolische Anerkennung durch Namensnennung auch bei freien Bildern als Conditio sine qua non der Nutzung angesehen wird.
* Als Urheber möchte ich, dass möglichst viele Bilder frei nutzbar sind. Es ist also notwendig, für die CC-Lizenzen zu werben und Nutzern beim Bild jeweils auch zu signalisieren, unter welchen Bedingungen sie es kostenfrei verwenden dürfen. Daher ist auch das Weglassen der Lizenz in meiner Sicht kein Kavaliersdelikt. Wenn ein Bild von mir genutzt wird, soll jeder wissen, dass ich es unter CC freigegeben habe.
* Es genügt nicht einfach, "CC" dranzuschreiben, da es viele verschiedene CC-Lizenzen gibt. Anzugeben ist daher korrekterweise immer die URL der spezifischen Lizenz. Woher weiß ein Laie, wenn er irgendwo im Bildnachweis Klaus Graf, CC findet, dass das nicht Kocosinseln oder Corpus Christianorum meint?
http://de.wikipedia.org/wiki/CC
Es gibt verschiedene Einschränkungen (SA, ND = keine Bearbeitung, NC = keine kommerzielle Nutzung), verschiedene Lizenzversionen (2.0, 3.0 usw.) und verschiedene nationale Versionen, die sich durchaus in Kleinigkeiten unterscheiden können.
Wer mein Foto http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creativecommons_spanien.jpg nutzen möchte, findet oben einen Link "Einbinden". Unter Nennung der Urheberschaft kann er sofort kopieren:
von Klaus Graf (Eigenes Werk) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons
Die Einbindungsmöglichkeit, bei der der Urheber und die Lizenz-URL nur sichtbar sind, wenn man mit der Maus über das Bild fährt, gefällt mir weniger gut. Sie mag indessen juristisch korrekt sein, und ich selbst würde sie auch niemals abmahnen.
[Nachtrag: Ich halte sie inzwischen als nicht lizenzkonform:
http://archiv.twoday.net/stories/165211461/ ]

Es ist also ganz einfach, lizenzkonform zu nutzen!
[Leider gibt es einen Einbindungslink nur bei einem Teil der Bilder auf Commons!]
Wie beweise ich aber, dass es mein Bild ist, was unrechtmäßig genutzt wird? Da schreibt mir eine Stadtverwaltung dreist: "Generell verwenden wir nämlich auf unserer Homepage nur eigenes Bildmaterial oder solches, an dem wir die Rechte erworben haben." Da könnte ja jeder kommen und behaupten, es handle sich um sein Bild.
Wenn auf der Beschreibungsseite des Bilds der Urhebername (oder ein Pseudonym) steht, so gilt die gesetzliche Vermutung des § 10 UrhG, dass er tatsächlich der Urheber ist. Diese Vermutung bürdet die Beweisleist der Gegenseite auf. Die Vermutung ist also widerlegbar z.B. indem man den wahren Urheber namentlich benennt oder die Umstände der Entstehung des Fotos angibt.
Dass nur eine Auslegung von § 10, die auch Online-Veröffentlichungen berücksichtigt, mit EU-Recht konform ist, hat das LG Frankfurt 2008 schlüssig gezeigt:
http://openjur.de/u/300057.html
Im Wege der richtlinienkonformen Auslegung ist jedoch nach Einschätzung der Kammer § 10 Abs. 1 UrhG auch auf nicht erschienene Werke anzuwenden (vgl. auch Dreier/Schulze-Schulkze, 2. Aufl., UrhG, § 10 Rd. 1, 6 a; allgemein im Hinblick auf online-Veröffentlichungen schon Möhring/Nicolini, 2. Aufl., § 10 Rd. 5; unter Bezugnahme schon auf Art. 15 der revidierten Übereinkunft Fromm/Nordermann, 9. Aufl., § 10 Rd. 5). Gemäß Art. 5 der EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Richtlinie 2004/48/EG vom 29.4.2004) ist das Erscheinen des Werkes unerheblich. Es genügt, wenn der Name des Urhebers in üblicher Weise auf dem Werkstück angegeben ist. Da diese Richtlinie bis Ende April 2006 umzusetzen war, eine entsprechende Änderung des § 10 UrhG jedoch weder dem sogenannten ersten Korb (BGBl. I 2003, S. 1774 ff) noch dem zweiten Korb (BGBl. I 2007, S. 2513 ff) zur Änderung des Urhebergesetzes zu entnehmen ist (und offen ist, ob und mit welchem Inhalt ein sogenannter dritter Korb verabschiedet werden wird), sind die nationalen Gerichte nunmehr nach Ablauf der Umsetzungsfrist gehalten, die nationalen Normen vor dem Hintergrund dieser Richtlinie auszulegen. Die Bedeutung der bei Erlass des § 10 Abs. 1 UrhG vom nationalen Gesetzgeber gegebenen Begründung wird durch die Fortentwicklung der europäischen Normgebung – in Reaktion auf die technischen Neuerungen – relativiert (anders: Wandtke/Bullinger, 1. Aufl., UrhG, § 10 Rd. 20). Im Wege der Auslegung sind nunmehr in den Anwendungsbereich des § 10 Abs. 1 UrhG auch Erscheinungsformen des § 15 Abs. 2 UrhG mit einzubeziehen.
Nicht ich muss beweisen, dass die Stadtverwaltung mein Foto widerrechtlich nutzt, sondern sie, dass ich nicht der Urheber bin. Im konkreten Fall habe ich auf der Datensicherung meines ehemaligen Laptops nachgesehen und mein Foto in einer kleinen Fotoserie vom Juli 2005 gefunden. Zudem lässt sich mittels des Internet Archives belegen, dass die entsprechende Seite der Stadtverwaltung 2008 noch gar nicht im Netz war, während mein Foto bereits 2005 hochgeladen wurde.
Siehe auch
http://www.wbs-law.de/internetrecht/fotorecht-bildrecht/serie-zum-foto-und-bildrecht-teil-13-beweis-der-urheberschaft-i-7804/
http://www.wbs-law.de/internetrecht/fotorecht-bildrecht/serie-zum-foto-und-bildrecht-teil-14-beweis-der-urheberschaft-ii-7806/
Bei der (in der Wikipedia weit verbreiteten) Nutzung eines Pseudonyms/Nicks kann die Gegenseite natürlich einwenden, dass man ja nicht wisse, dass derjenige, der sich an sie wendet, tatsächlich mit dem Urheber identisch sei.
Um diese Identität nachvollziehbar zu belegen, kann man verschiedenste Belegmöglichkeiten ausprobieren. Man kann sich z.B. von anderen Wikipedianern, denen man persönlich bekannt ist, die Identität bestätigen lassen. Wenn man in der Wikipedia eine Mailadresse hinterlegt hat, kann man auf eine Mail der Gegenseite mit Klarnamen reagieren. Oder man kann einen Edit auf einer Benutzerdiskussionsseite vereinbaren, der nachweist, dass man Zugriff auf das Konto des betreffenden Pseudonyms hat. Die Gegenseite kann natürlich alles anzweifeln, aber wenn man wahrheitsgetreu agiert, hat man vor Gericht sicher nicht die schlechtesten Karten.

Siehe
http://archiv.twoday.net/stories/38723599/ mit vielen weiteren Nachweisen
Wer gegen die Bedingungen der Lizenz verstößt, dessen Nutzungsrecht erlischt und er kann ebenso wie derjenige behandelt werden, der ein beliebiges urheberrechtlich geschütztes Bild widerrechtlich nutzt.
Das LG Berlin hat 2010 in einem Beschluss bekräftigt, dass die Urhebernennung und der Lizenztext bzw. die URL der Lizenz beizugeben sind:
http://www.ifross.org/Fremdartikel/LG%20Berlin%20CC-Lizenz.pdf
Wer sich dagegen wendet, dass penetrant gegen diese ja nun wirklich simplen zwei Grundsätze verstoßen wird, kann sich auf triftige moralische Argumente stützen:
* Die Urhebernennung ist die einzige Gegenleistung für eine umfassende Nutzung auch zu kommerziellen Zwecken, die dem Autor direkt zugutekommt. Kommerzielle Bildagenturen und Berufsfotografen fordern für teure Bilder solche Urhebernennungen ohne weiteres. Da ist es doch nicht zuviel verlangt, wenn die symbolische Anerkennung durch Namensnennung auch bei freien Bildern als Conditio sine qua non der Nutzung angesehen wird.
* Als Urheber möchte ich, dass möglichst viele Bilder frei nutzbar sind. Es ist also notwendig, für die CC-Lizenzen zu werben und Nutzern beim Bild jeweils auch zu signalisieren, unter welchen Bedingungen sie es kostenfrei verwenden dürfen. Daher ist auch das Weglassen der Lizenz in meiner Sicht kein Kavaliersdelikt. Wenn ein Bild von mir genutzt wird, soll jeder wissen, dass ich es unter CC freigegeben habe.
* Es genügt nicht einfach, "CC" dranzuschreiben, da es viele verschiedene CC-Lizenzen gibt. Anzugeben ist daher korrekterweise immer die URL der spezifischen Lizenz. Woher weiß ein Laie, wenn er irgendwo im Bildnachweis Klaus Graf, CC findet, dass das nicht Kocosinseln oder Corpus Christianorum meint?
http://de.wikipedia.org/wiki/CC
Es gibt verschiedene Einschränkungen (SA, ND = keine Bearbeitung, NC = keine kommerzielle Nutzung), verschiedene Lizenzversionen (2.0, 3.0 usw.) und verschiedene nationale Versionen, die sich durchaus in Kleinigkeiten unterscheiden können.
Wer mein Foto http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creativecommons_spanien.jpg nutzen möchte, findet oben einen Link "Einbinden". Unter Nennung der Urheberschaft kann er sofort kopieren:
von Klaus Graf (Eigenes Werk) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons
Die Einbindungsmöglichkeit, bei der der Urheber und die Lizenz-URL nur sichtbar sind, wenn man mit der Maus über das Bild fährt, gefällt mir weniger gut. Sie mag indessen juristisch korrekt sein, und ich selbst würde sie auch niemals abmahnen.
[Nachtrag: Ich halte sie inzwischen als nicht lizenzkonform:
http://archiv.twoday.net/stories/165211461/ ]

Es ist also ganz einfach, lizenzkonform zu nutzen!
[Leider gibt es einen Einbindungslink nur bei einem Teil der Bilder auf Commons!]
Wie beweise ich aber, dass es mein Bild ist, was unrechtmäßig genutzt wird? Da schreibt mir eine Stadtverwaltung dreist: "Generell verwenden wir nämlich auf unserer Homepage nur eigenes Bildmaterial oder solches, an dem wir die Rechte erworben haben." Da könnte ja jeder kommen und behaupten, es handle sich um sein Bild.
Wenn auf der Beschreibungsseite des Bilds der Urhebername (oder ein Pseudonym) steht, so gilt die gesetzliche Vermutung des § 10 UrhG, dass er tatsächlich der Urheber ist. Diese Vermutung bürdet die Beweisleist der Gegenseite auf. Die Vermutung ist also widerlegbar z.B. indem man den wahren Urheber namentlich benennt oder die Umstände der Entstehung des Fotos angibt.
Dass nur eine Auslegung von § 10, die auch Online-Veröffentlichungen berücksichtigt, mit EU-Recht konform ist, hat das LG Frankfurt 2008 schlüssig gezeigt:
http://openjur.de/u/300057.html
Im Wege der richtlinienkonformen Auslegung ist jedoch nach Einschätzung der Kammer § 10 Abs. 1 UrhG auch auf nicht erschienene Werke anzuwenden (vgl. auch Dreier/Schulze-Schulkze, 2. Aufl., UrhG, § 10 Rd. 1, 6 a; allgemein im Hinblick auf online-Veröffentlichungen schon Möhring/Nicolini, 2. Aufl., § 10 Rd. 5; unter Bezugnahme schon auf Art. 15 der revidierten Übereinkunft Fromm/Nordermann, 9. Aufl., § 10 Rd. 5). Gemäß Art. 5 der EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Richtlinie 2004/48/EG vom 29.4.2004) ist das Erscheinen des Werkes unerheblich. Es genügt, wenn der Name des Urhebers in üblicher Weise auf dem Werkstück angegeben ist. Da diese Richtlinie bis Ende April 2006 umzusetzen war, eine entsprechende Änderung des § 10 UrhG jedoch weder dem sogenannten ersten Korb (BGBl. I 2003, S. 1774 ff) noch dem zweiten Korb (BGBl. I 2007, S. 2513 ff) zur Änderung des Urhebergesetzes zu entnehmen ist (und offen ist, ob und mit welchem Inhalt ein sogenannter dritter Korb verabschiedet werden wird), sind die nationalen Gerichte nunmehr nach Ablauf der Umsetzungsfrist gehalten, die nationalen Normen vor dem Hintergrund dieser Richtlinie auszulegen. Die Bedeutung der bei Erlass des § 10 Abs. 1 UrhG vom nationalen Gesetzgeber gegebenen Begründung wird durch die Fortentwicklung der europäischen Normgebung – in Reaktion auf die technischen Neuerungen – relativiert (anders: Wandtke/Bullinger, 1. Aufl., UrhG, § 10 Rd. 20). Im Wege der Auslegung sind nunmehr in den Anwendungsbereich des § 10 Abs. 1 UrhG auch Erscheinungsformen des § 15 Abs. 2 UrhG mit einzubeziehen.
Nicht ich muss beweisen, dass die Stadtverwaltung mein Foto widerrechtlich nutzt, sondern sie, dass ich nicht der Urheber bin. Im konkreten Fall habe ich auf der Datensicherung meines ehemaligen Laptops nachgesehen und mein Foto in einer kleinen Fotoserie vom Juli 2005 gefunden. Zudem lässt sich mittels des Internet Archives belegen, dass die entsprechende Seite der Stadtverwaltung 2008 noch gar nicht im Netz war, während mein Foto bereits 2005 hochgeladen wurde.
Siehe auch
http://www.wbs-law.de/internetrecht/fotorecht-bildrecht/serie-zum-foto-und-bildrecht-teil-13-beweis-der-urheberschaft-i-7804/
http://www.wbs-law.de/internetrecht/fotorecht-bildrecht/serie-zum-foto-und-bildrecht-teil-14-beweis-der-urheberschaft-ii-7806/
Bei der (in der Wikipedia weit verbreiteten) Nutzung eines Pseudonyms/Nicks kann die Gegenseite natürlich einwenden, dass man ja nicht wisse, dass derjenige, der sich an sie wendet, tatsächlich mit dem Urheber identisch sei.
Um diese Identität nachvollziehbar zu belegen, kann man verschiedenste Belegmöglichkeiten ausprobieren. Man kann sich z.B. von anderen Wikipedianern, denen man persönlich bekannt ist, die Identität bestätigen lassen. Wenn man in der Wikipedia eine Mailadresse hinterlegt hat, kann man auf eine Mail der Gegenseite mit Klarnamen reagieren. Oder man kann einen Edit auf einer Benutzerdiskussionsseite vereinbaren, der nachweist, dass man Zugriff auf das Konto des betreffenden Pseudonyms hat. Die Gegenseite kann natürlich alles anzweifeln, aber wenn man wahrheitsgetreu agiert, hat man vor Gericht sicher nicht die schlechtesten Karten.

KlausGraf - am Donnerstag, 4. Oktober 2012, 18:43 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der US-Verlegerverband AAP und Google haben sich im Streit um das unerlaubte Digitalisieren von Büchern in Bibliotheken und das Anzeigens von Auszügen (Snippets) im Internet geeinigt. Die Autoren suchen dagegen weiterhin eine juristische Entscheidung.
Rückblick: Google war 2005 von Autoren und Verlegern per Gruppenklage („Class Action“) wegen des unerlaubten Digitalisierens von Büchern in Bibliotheken und des Anzeigens von Auszügen (Snippets) im Internet verklagt worden. 2006 nahmen die Parteien Verhandlungen auf, die 2008 in einen Vergleich mündeten, nach dem Google bei Zahlung von 125 Millionen Dollar das Recht gehabt hätte, in den USA registrierte Bücher einzuscannen und ohne Rückfrage beim Rechteinhaber online zu stellen. 2009 überarbeiteten die Parteien den Vergleich, doch im März 2011 lehnte der zuständige Richter Denny Chin den Vergleich ab.
Jetzt liegt ein weiteres Settlement vor, das nicht mehr gerichtlich abgesegnet werden muss. Die zentralen Bestandteile:
Anders als beim ersten Settlement zahlt Google offenbar keine Entschädigung, zumindest ist in der gemeinsamen Mitteilung davon keine Rede.
Die US-Verlagen haben die Wahl, ob sie ihre Bücher und Zeitschriften im Google-Programm lassen oder sie zurückziehen.
Die Verlage, die ihre Titel nicht herausnehmen, bekommen eine digitale Kopie für die eigene Nutzung.
Unabhängig vom Vergleich können die Verlage und Google für sonstige Titel individuelle Vereinbarungen treffen
Die Nutzer können bis zu 20% der Titel online einsehen und die kompletten Inhalte kostenpflichtig erwerben über den Google Play-Shop, falls der entsprechende Verlag zustimmt.
http://www.buchreport.de/nachrichten/verlage/verlage_nachricht/datum/2012/10/04/settlement-das-zweite.htm
Siehe auch
http://www.bbc.co.uk/news/technology-19835808
http://arstechnica.com/tech-policy/2012/10/publishers-abandon-fight-against-google-book-scanning/
http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/digital/copyright/article/54224-google-publishers-settle-lawsuit-over-book-scanning.html
Rückblick: Google war 2005 von Autoren und Verlegern per Gruppenklage („Class Action“) wegen des unerlaubten Digitalisierens von Büchern in Bibliotheken und des Anzeigens von Auszügen (Snippets) im Internet verklagt worden. 2006 nahmen die Parteien Verhandlungen auf, die 2008 in einen Vergleich mündeten, nach dem Google bei Zahlung von 125 Millionen Dollar das Recht gehabt hätte, in den USA registrierte Bücher einzuscannen und ohne Rückfrage beim Rechteinhaber online zu stellen. 2009 überarbeiteten die Parteien den Vergleich, doch im März 2011 lehnte der zuständige Richter Denny Chin den Vergleich ab.
Jetzt liegt ein weiteres Settlement vor, das nicht mehr gerichtlich abgesegnet werden muss. Die zentralen Bestandteile:
Anders als beim ersten Settlement zahlt Google offenbar keine Entschädigung, zumindest ist in der gemeinsamen Mitteilung davon keine Rede.
Die US-Verlagen haben die Wahl, ob sie ihre Bücher und Zeitschriften im Google-Programm lassen oder sie zurückziehen.
Die Verlage, die ihre Titel nicht herausnehmen, bekommen eine digitale Kopie für die eigene Nutzung.
Unabhängig vom Vergleich können die Verlage und Google für sonstige Titel individuelle Vereinbarungen treffen
Die Nutzer können bis zu 20% der Titel online einsehen und die kompletten Inhalte kostenpflichtig erwerben über den Google Play-Shop, falls der entsprechende Verlag zustimmt.
http://www.buchreport.de/nachrichten/verlage/verlage_nachricht/datum/2012/10/04/settlement-das-zweite.htm
Siehe auch
http://www.bbc.co.uk/news/technology-19835808
http://arstechnica.com/tech-policy/2012/10/publishers-abandon-fight-against-google-book-scanning/
http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/digital/copyright/article/54224-google-publishers-settle-lawsuit-over-book-scanning.html
KlausGraf - am Donnerstag, 4. Oktober 2012, 18:24 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Aktuell geht wieder eine Welle durch die Blogosphäre weil Abmahnungen unterwegs sind, mit denen angeblich 3.000 Euro für ein Foto oder gar 19.000 Euro für 3 Fotos von Objekten von Künstlern “verlangt” werden "
http://www.ferner-alsdorf.de/2012/10/abmahnwahnsinn-3000-euro-fuer-ein-foto/
"Und wer fremde Bilder nutzt, gleich unter welcher Lizenz sie stehen, hat derzeit immer das Damoklesschwert der Abmahnung über sich schweben – auch wenn man Bilder unter einer CC-Lizenz nutzt. Warum? Weil der Verwender eines Werks im Zweifelsfall immer die gesamte Rechtekette bis zum Hersteller nachweisen muss. Und wenn irgendjemand (unerlaubt) ein Bild unter eine freie Lizenz gestellt hat, hilft das dem Verwender wenig. Mir geht es dabei nicht darum, das Thema rechtspolitisch als “gut” darzustellen, sondern nur darum, die rechtliche Lage nochmals ins Rechte Licht zu rücken. Eine davon losgelöste Frage ist, inwiefern man diesen rechtlichen Zustand, der für Verwender insgesamt als Problem zu bezeichnen ist, verbessern kann. Denn tatsächlich ist es heute unheimlich schwer, rechtssicher irgendwelche urheberrechtlich geschützten Werke Dritter zu verwenden."
Ferner betreibt Panikmache, was CC-Lizenzen angeht. Der Gesetzgeber hat sich ausdrücklich dafür entschieden, solche Lizenzen zuzulassen, bei denen eine Erlaubnis am Werk selbst angebracht wird. Die Rechtsprechung wird sich vernünftigerweise auf ein "opt out" bei CC-lizenzierten Bildern einlassen müssen, da das Grundprinzip - freie Nutzung ohne Rückfrage beim Urheber - durch ein lückenloses Nachverfolgen der Rechtekette ad absurdum geführt wird. In der Regel möchte ja der Urheber auch gar keine Rückfrage, da dies immer mit Aufwand verbunden ist. Und es gibt unzählige Medien auf Wikimedia Commons, die unter Pseudonym hochgeladen wurden, bei denen eine Kontaktaufnahme zum Urheber unmöglich ist. Gerade Laien können nicht erkennen, wann CC-lizenzierte Medien "verdächtig" sind.
Halten wir fest, dass mir keine Abmahnungen bei fälschlich als CC lizenzierten Bildern bekannt sind und dass das Risiko bei ihrer unerkannten Verwendung außerordentlich gering ist.
Update:
http://klawtext.blogspot.de/2012/10/foto-abmahnungen-das-geht-auch-billiger.html
http://www.ferner-alsdorf.de/2012/10/abmahnwahnsinn-3000-euro-fuer-ein-foto/
"Und wer fremde Bilder nutzt, gleich unter welcher Lizenz sie stehen, hat derzeit immer das Damoklesschwert der Abmahnung über sich schweben – auch wenn man Bilder unter einer CC-Lizenz nutzt. Warum? Weil der Verwender eines Werks im Zweifelsfall immer die gesamte Rechtekette bis zum Hersteller nachweisen muss. Und wenn irgendjemand (unerlaubt) ein Bild unter eine freie Lizenz gestellt hat, hilft das dem Verwender wenig. Mir geht es dabei nicht darum, das Thema rechtspolitisch als “gut” darzustellen, sondern nur darum, die rechtliche Lage nochmals ins Rechte Licht zu rücken. Eine davon losgelöste Frage ist, inwiefern man diesen rechtlichen Zustand, der für Verwender insgesamt als Problem zu bezeichnen ist, verbessern kann. Denn tatsächlich ist es heute unheimlich schwer, rechtssicher irgendwelche urheberrechtlich geschützten Werke Dritter zu verwenden."
Ferner betreibt Panikmache, was CC-Lizenzen angeht. Der Gesetzgeber hat sich ausdrücklich dafür entschieden, solche Lizenzen zuzulassen, bei denen eine Erlaubnis am Werk selbst angebracht wird. Die Rechtsprechung wird sich vernünftigerweise auf ein "opt out" bei CC-lizenzierten Bildern einlassen müssen, da das Grundprinzip - freie Nutzung ohne Rückfrage beim Urheber - durch ein lückenloses Nachverfolgen der Rechtekette ad absurdum geführt wird. In der Regel möchte ja der Urheber auch gar keine Rückfrage, da dies immer mit Aufwand verbunden ist. Und es gibt unzählige Medien auf Wikimedia Commons, die unter Pseudonym hochgeladen wurden, bei denen eine Kontaktaufnahme zum Urheber unmöglich ist. Gerade Laien können nicht erkennen, wann CC-lizenzierte Medien "verdächtig" sind.
Halten wir fest, dass mir keine Abmahnungen bei fälschlich als CC lizenzierten Bildern bekannt sind und dass das Risiko bei ihrer unerkannten Verwendung außerordentlich gering ist.
Update:
http://klawtext.blogspot.de/2012/10/foto-abmahnungen-das-geht-auch-billiger.html
KlausGraf - am Donnerstag, 4. Oktober 2012, 18:12 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.dodis.ch/quaderni
Die «Quaderni di Dodis» sind eine Publikationsreihe, in der wissenschaftliche Studien – Monografien oder Aufsätze, aber auch Quellen und andere Materialien – in digitaler Form veröffentlicht werden. In der Reihe werden insbesondere Forschungsresultate publiziert, die aus unterschiedlichen Initiativen der Forschungsstelle [Dodis = Diplomatische Dokumente der Schweiz] hervorgegangen sind: von grossen internationalen Tagungen bis hin zu Kolloquien oder Workshops für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Die «Quaderni di Dodis» beabsichtigen die Publikationsmöglichkeiten im etablierten Bereich der Zeitgeschichte und der Aussenpolitik zu stärken und dem wissenschaftlichen Nachwuchs eine attraktive Publikationsplattform zu bieten.
Open Access
Die «Quaderni di Dodis» sind als e-Book konzipiert und dem Open Access-Prinzip verpflichtet. Die Bände der Reihe, bzw. die einzelnen Artikel eines Sammelbandes, sind mittels Digital Objects Identifier (DOI) eindeutig identifiziert, was einen permanenten Zugriff garantiert. Die Bände der «Quaderni di Dodis» können hier in den Formaten der gängigen e-Reader heruntergeladen oder in Buchform als Print on Demand bei Amazon bestellt werden.
Bisher 2 Bände.
Bd. 2: Bernd Haunfelder (Hg.), Aus Adenauers Nähe. Die politische Korrespondenz der schweizerischen Botschaft in der Bundesrepublik Deutschland 1956–1963
Freundlicher Hinweis von Sacha Zala.
Die «Quaderni di Dodis» sind eine Publikationsreihe, in der wissenschaftliche Studien – Monografien oder Aufsätze, aber auch Quellen und andere Materialien – in digitaler Form veröffentlicht werden. In der Reihe werden insbesondere Forschungsresultate publiziert, die aus unterschiedlichen Initiativen der Forschungsstelle [Dodis = Diplomatische Dokumente der Schweiz] hervorgegangen sind: von grossen internationalen Tagungen bis hin zu Kolloquien oder Workshops für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Die «Quaderni di Dodis» beabsichtigen die Publikationsmöglichkeiten im etablierten Bereich der Zeitgeschichte und der Aussenpolitik zu stärken und dem wissenschaftlichen Nachwuchs eine attraktive Publikationsplattform zu bieten.
Open Access
Die «Quaderni di Dodis» sind als e-Book konzipiert und dem Open Access-Prinzip verpflichtet. Die Bände der Reihe, bzw. die einzelnen Artikel eines Sammelbandes, sind mittels Digital Objects Identifier (DOI) eindeutig identifiziert, was einen permanenten Zugriff garantiert. Die Bände der «Quaderni di Dodis» können hier in den Formaten der gängigen e-Reader heruntergeladen oder in Buchform als Print on Demand bei Amazon bestellt werden.
Bisher 2 Bände.
Bd. 2: Bernd Haunfelder (Hg.), Aus Adenauers Nähe. Die politische Korrespondenz der schweizerischen Botschaft in der Bundesrepublik Deutschland 1956–1963
Freundlicher Hinweis von Sacha Zala.
KlausGraf - am Donnerstag, 4. Oktober 2012, 18:07 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.rechtambild.de/2011/11/olg-hamm-unterlassungs-und-erstattungsanspruch-bei-verwendung-von-fotos-aus-einer-dissertation/
"Die Zahnärztin hatte im Jahr 1987 eine Dissertation zum Thema Zahnreinigung an der RWTH Bochum erstellt und innerhalb dieser selbst geschossene Fotografien von Patienten-Gebissen verwendet. "
Da ist schon mal der Wurm drin - wer findet den Fehler?
Volltext:
http://www.rechtambild.de/2011/11/olg-hamm-unterlassungs-und-erstattungsanspruch-einer-zahnarztin-an-zahn-fotos/
"Die Zahnärztin hatte im Jahr 1987 eine Dissertation zum Thema Zahnreinigung an der RWTH Bochum erstellt und innerhalb dieser selbst geschossene Fotografien von Patienten-Gebissen verwendet. "
Da ist schon mal der Wurm drin - wer findet den Fehler?
Volltext:
http://www.rechtambild.de/2011/11/olg-hamm-unterlassungs-und-erstattungsanspruch-einer-zahnarztin-an-zahn-fotos/
KlausGraf - am Donnerstag, 4. Oktober 2012, 17:35 - Rubrik: Archivrecht
Der Beitrag von 2005 wurde durch einen umfangreichen Nachtrag aktualisiert:
http://archiv.twoday.net/stories/914849/
Scharfe Vorwürfe erhebe ich dort gegen die Encyclopedia of Medieval Chronicle und das DLL-MA.
http://archiv.twoday.net/stories/914849/
Scharfe Vorwürfe erhebe ich dort gegen die Encyclopedia of Medieval Chronicle und das DLL-MA.
KlausGraf - am Donnerstag, 4. Oktober 2012, 02:15 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
§1 Zu prüfen ist zunächst: Liegt ein schriftlicher Vertrag mit dem VdA vor? Ist das der Fall, stellt sich die Frage, ob die übertragenen Rechte einer Publikation online entgegenstehen. Hat der VdA keine auschließlichen Rechte erworben, darf der Autor den Beitrag ins Netz stellen, ohne nachzufragen.
Angesichts der sehr erfreulichen Haltung des VdA zur freien Zugänglichkeit früherer Archivar-Jahrgänge in HathiTrust, wofür ich mich ausdrücklich bedanken möchte
http://archiv.twoday.net/stories/138662584/
gehe ich davon aus, dass zumindest bei älteren Beiträgen der VdA eine entsprechende Anfrage, falls sie nötig sein sollte oder aus Höflichkeit/Kollegialität ohne Rechtspflicht erfolgt, positiv bescheiden würde.
Die jüngeren Tagungsbände erscheinen im Selbstverlag des VdA, bei älteren Bänden wird auf dem Titelblatt "Verlag Franz Schmitt" angegeben, ohne dass aber im Impressum ein entsprechender Rechtevermerk steht. Dort erscheint nur der VdA. Der VdA müsste also erklären, ob er von Anfang an hinsichtlich der Tagungsbände Rechteinhaber ist oder nicht.
Nachdem Collega Wolf sich soeben in der geschlossenen Facebook-Gruppe Archivfragen glaubte erinnern zu können, dass es 2005 noch keinen schriftlichen Vertrag gab, liegen aber die Rechte für die älteren Aufsätze, auch wenn sie bei Franz Schmitt erschienen sind, vermutlich ohnehin bei den Autoren (siehe unten zu § 38 UrhG).
Nach erfolgter Klärung der möglichen Rechte von früheren Partner-Verlagen (vermutlich Kommissions-Verlagen) rege ich an, dass der VdA öffentlich erklärt, dass alle Beiträge, die vor mehr als einem Jahr erschienen sind, ohne Nachfrage Open Access veröffentlicht werden dürfen.
§ 2 Ebenso rege ich an, dass der VdA auch das einzige (von zwei erschienenen) in HathiTrust vorhandenen Beiheften des Archivar nach dem Muster der Zeitschrift ebenfalls freigibt:
http://catalog.hathitrust.org/Record/000600231
Es handelt sich um:
Übersicht über die Veröffentlichungen der Archivverwaltungen und Archive in der Bundesrepublik Deutschland, 1945 - 1970 / zsgest. ... von Hans Schmitz und Hannelore Tiepelmann
Verfasser:
Schmitz, Hans ; Tiepelmann, Hannelore
Ort/Jahr:
Düsseldorf : Hauptstaatsarchiv, 1971
Umfang:
115 S. ; 4°
Schriftenreihe:
Der Archivar : Beiheft ; 1
in HathiTrust habe ich zwar keine Archivtagbände gefunden, aber Google hat nicht nur
http://books.google.de/books?id=L1krAQAAIAAJ
gescannt.
Hier geht es nicht ganz so mühelos wie bei HathiTrust. Um Google dazu zu bewegen, die Archivtags-Bände zu öffnen (was ich hinsichtlich meiner Bücher, soweit ich deren Online-Rechte besitze, getan habe), muss sich der VdA 1. im Partner-Programm von Google anmelden
http://support.google.com/books/partner/bin/static.py?hl=de&guide=1346912&page=guide.cs
und 2. Google begreiflich machen, dass er in ein Pionier-Programm möchte, bei dem die Bücher nicht nochmals gescannt werden (man sendet ein Exemplar an eine von Google genannte Adresse, wo es zerschnitten und gescannt wird, kann aber auch ein PDF/EPUB hochladen), sondern ein bereits gescanntes Exemplar aus dem sogenannten Bibliotheksprogramm verwendet wird, siehe
http://archiv.twoday.net/stories/41794350/
Leider ist es nicht ganz trivial, passende Bände in Google Books ausfindig zu machen, da Google seine Buchsuche mit bloßen Metadaten zumüllt. Man muss genau schauen, welche Bände tatsächlich gescannt sind, was man an den Schnipseln oder der (in obigem Beispiel fehlenden) Angabe der Bibliothek sieht.
Der wichtige Band zu den Archiven im Nationalsozialismus wurde in der University von Virginia gescannt:
http://books.google.de/books?id=F_oZAAAAYAAJ
Falls es mit Google nicht so klappt, wie erwünscht und oben beschrieben, kann der VdA sich in diesem Fall an die U Virginia wenden, die zu den Partnern von HathiTrust gehört, um sie zu bitten, die von Google erhaltenen Beleg-Scans an HathiTrust zu liefern (wo sie dann freigeschaltet werden können). Man kann natürlich auch bei HathiTrust mit der Bitte vorstellig werden, die U Virginia diesbezüglich zu kontaktieren. Ob die U Virginia die Google-Scans direkt an den VdA abgeben würde, kann ich nicht prognostizieren, aber mehr als Nein sagen kann sie auch nicht.
§ 3 Liegt kein schriftlicher Vertrag vor, gilt § 38 UrhG und der Autor darf ohne weiteres ins Netz stellen, wenn der Beitrag älter als ein Jahr ist:
Selbstarchivierung von Beiträgen, die bereits in Sammelwerken (z.B. Festschriften) veröffentlicht wurden
Beiträge, die in Büchern oder Festschriften erschienen sind, dürfen ein Jahr nach ihrem ersten Erscheinen anderweitig verbreitet werden, wenn vertraglich nichts anderes vereinbart wurde und der Autor/die Autorin für die (erste) Veröffentlichung keine Vergütung erhalten hat. Das Recht zur Online-Verbreitung nach Jahresfrist besteht jedoch nur, wenn es zur Online-Verbreitung keine vertragliche Regelung gibt, denn dann bezieht sich der § 38 UrhG ausschließlich auf die Verbreitung in körperlicher Form.
§ 38 UrhG: "(1) Gestattet der Urheber die Aufnahme des Werkes in eine periodisch erscheinende Sammlung, so erwirbt der Verleger oder Herausgeber im Zweifel ein ausschließliches Nutzungsrecht zur Vervielfältigung und Verbreitung. Jedoch darf der Urheber das Werk nach Ablauf eines Jahres seit Erscheinen anderweitig vervielfältigen und verbreiten, wenn nichts anderes vereinbart ist.
(2) Absatz 1, Satz 2 gilt auch für einen Beitrag zu einer nicht periodisch erscheinenden Sammlung, für dessen Überlassung dem Urheber kein Anspruch auf Vergütung zusteht."
Viele Verlage erlauben inzwischen die Selbstarchivierung solcher Beiträge, auch wenn Honorar bezahlt wurde. Eine kurze Anfrage beim Verlag kann sich daher lohnen
Read more: http://open-access.net/de/allgemeines/rechtsfragen/bereitstellen_von_dokumenten_in_repositorien/#ixzz28GjE9A28
Ist der Beitrag jünger als ein Jahr gilt:
Der Historiker Klaus Graf dagegen ist der Ansicht, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Artikel auch vor Ablauf der Einjahresfrist online publizieren können, weil § 38 UrhG nur die körperliche Verbreitung regelt und die öffentliche Zugänglichmachung davon unberührt ist. Einzig das Stellen unter eine freie Creative-Commons-Lizenz sei erst nach Ablauf des Jahres möglich, da diese ein einfaches Nutzungsrecht für jedermann einräumen, das die körperliche Verbreitung mit einschließt (Graf, 2006).
Read more: http://open-access.net/de/allgemeines/rechtsfragen/bereitstellen_von_dokumenten_in_repositorien/#ixzz28GvyPsWm
http://archiv.twoday.net/search?q=38+urhg
Wenn die Rechte geklärt sind, stellt sich die Frage: Wohin mit dem Scan? Passt er nicht auf die eigene Archivwebsite, empfehle ich E-LIS, das aucharchivwissenschaftliche archivkundliche Beiträge gern aufnimmt:
http://eprints.rclis.org/
Die dauerhafte Verfügbarkeit dürfte durch Einstellung auf einem Open-Access-Repositorium wie E-LIS gegeben sein. Man kann sich aber auch an Qucosa http://www.qucosa.de/ wenden, das auch nicht-sächsischen Autoren zur Verfügung steht.
Nichts spricht dagegen, den Beitrag an mehreren Stellen zu hinterlegen (z.B. Researchgate, Mendeley, Scribd usw.) - zusätzlich zu einem (hoffentlich) langzeitarchivierten E-Print (in Deutschland meist mit URN).
Update: Zu Österreich siehe immer noch
http://archiv.twoday.net/stories/241406/
Zur Schweiz: http://archiv.twoday.net/stories/6166799/
Angesichts der sehr erfreulichen Haltung des VdA zur freien Zugänglichkeit früherer Archivar-Jahrgänge in HathiTrust, wofür ich mich ausdrücklich bedanken möchte
http://archiv.twoday.net/stories/138662584/
gehe ich davon aus, dass zumindest bei älteren Beiträgen der VdA eine entsprechende Anfrage, falls sie nötig sein sollte oder aus Höflichkeit/Kollegialität ohne Rechtspflicht erfolgt, positiv bescheiden würde.
Die jüngeren Tagungsbände erscheinen im Selbstverlag des VdA, bei älteren Bänden wird auf dem Titelblatt "Verlag Franz Schmitt" angegeben, ohne dass aber im Impressum ein entsprechender Rechtevermerk steht. Dort erscheint nur der VdA. Der VdA müsste also erklären, ob er von Anfang an hinsichtlich der Tagungsbände Rechteinhaber ist oder nicht.
Nachdem Collega Wolf sich soeben in der geschlossenen Facebook-Gruppe Archivfragen glaubte erinnern zu können, dass es 2005 noch keinen schriftlichen Vertrag gab, liegen aber die Rechte für die älteren Aufsätze, auch wenn sie bei Franz Schmitt erschienen sind, vermutlich ohnehin bei den Autoren (siehe unten zu § 38 UrhG).
Nach erfolgter Klärung der möglichen Rechte von früheren Partner-Verlagen (vermutlich Kommissions-Verlagen) rege ich an, dass der VdA öffentlich erklärt, dass alle Beiträge, die vor mehr als einem Jahr erschienen sind, ohne Nachfrage Open Access veröffentlicht werden dürfen.
§ 2 Ebenso rege ich an, dass der VdA auch das einzige (von zwei erschienenen) in HathiTrust vorhandenen Beiheften des Archivar nach dem Muster der Zeitschrift ebenfalls freigibt:
http://catalog.hathitrust.org/Record/000600231
Es handelt sich um:
Übersicht über die Veröffentlichungen der Archivverwaltungen und Archive in der Bundesrepublik Deutschland, 1945 - 1970 / zsgest. ... von Hans Schmitz und Hannelore Tiepelmann
Verfasser:
Schmitz, Hans ; Tiepelmann, Hannelore
Ort/Jahr:
Düsseldorf : Hauptstaatsarchiv, 1971
Umfang:
115 S. ; 4°
Schriftenreihe:
Der Archivar : Beiheft ; 1
in HathiTrust habe ich zwar keine Archivtagbände gefunden, aber Google hat nicht nur
http://books.google.de/books?id=L1krAQAAIAAJ
gescannt.
Hier geht es nicht ganz so mühelos wie bei HathiTrust. Um Google dazu zu bewegen, die Archivtags-Bände zu öffnen (was ich hinsichtlich meiner Bücher, soweit ich deren Online-Rechte besitze, getan habe), muss sich der VdA 1. im Partner-Programm von Google anmelden
http://support.google.com/books/partner/bin/static.py?hl=de&guide=1346912&page=guide.cs
und 2. Google begreiflich machen, dass er in ein Pionier-Programm möchte, bei dem die Bücher nicht nochmals gescannt werden (man sendet ein Exemplar an eine von Google genannte Adresse, wo es zerschnitten und gescannt wird, kann aber auch ein PDF/EPUB hochladen), sondern ein bereits gescanntes Exemplar aus dem sogenannten Bibliotheksprogramm verwendet wird, siehe
http://archiv.twoday.net/stories/41794350/
Leider ist es nicht ganz trivial, passende Bände in Google Books ausfindig zu machen, da Google seine Buchsuche mit bloßen Metadaten zumüllt. Man muss genau schauen, welche Bände tatsächlich gescannt sind, was man an den Schnipseln oder der (in obigem Beispiel fehlenden) Angabe der Bibliothek sieht.
Der wichtige Band zu den Archiven im Nationalsozialismus wurde in der University von Virginia gescannt:
http://books.google.de/books?id=F_oZAAAAYAAJ
Falls es mit Google nicht so klappt, wie erwünscht und oben beschrieben, kann der VdA sich in diesem Fall an die U Virginia wenden, die zu den Partnern von HathiTrust gehört, um sie zu bitten, die von Google erhaltenen Beleg-Scans an HathiTrust zu liefern (wo sie dann freigeschaltet werden können). Man kann natürlich auch bei HathiTrust mit der Bitte vorstellig werden, die U Virginia diesbezüglich zu kontaktieren. Ob die U Virginia die Google-Scans direkt an den VdA abgeben würde, kann ich nicht prognostizieren, aber mehr als Nein sagen kann sie auch nicht.
§ 3 Liegt kein schriftlicher Vertrag vor, gilt § 38 UrhG und der Autor darf ohne weiteres ins Netz stellen, wenn der Beitrag älter als ein Jahr ist:
Selbstarchivierung von Beiträgen, die bereits in Sammelwerken (z.B. Festschriften) veröffentlicht wurden
Beiträge, die in Büchern oder Festschriften erschienen sind, dürfen ein Jahr nach ihrem ersten Erscheinen anderweitig verbreitet werden, wenn vertraglich nichts anderes vereinbart wurde und der Autor/die Autorin für die (erste) Veröffentlichung keine Vergütung erhalten hat. Das Recht zur Online-Verbreitung nach Jahresfrist besteht jedoch nur, wenn es zur Online-Verbreitung keine vertragliche Regelung gibt, denn dann bezieht sich der § 38 UrhG ausschließlich auf die Verbreitung in körperlicher Form.
§ 38 UrhG: "(1) Gestattet der Urheber die Aufnahme des Werkes in eine periodisch erscheinende Sammlung, so erwirbt der Verleger oder Herausgeber im Zweifel ein ausschließliches Nutzungsrecht zur Vervielfältigung und Verbreitung. Jedoch darf der Urheber das Werk nach Ablauf eines Jahres seit Erscheinen anderweitig vervielfältigen und verbreiten, wenn nichts anderes vereinbart ist.
(2) Absatz 1, Satz 2 gilt auch für einen Beitrag zu einer nicht periodisch erscheinenden Sammlung, für dessen Überlassung dem Urheber kein Anspruch auf Vergütung zusteht."
Viele Verlage erlauben inzwischen die Selbstarchivierung solcher Beiträge, auch wenn Honorar bezahlt wurde. Eine kurze Anfrage beim Verlag kann sich daher lohnen
Read more: http://open-access.net/de/allgemeines/rechtsfragen/bereitstellen_von_dokumenten_in_repositorien/#ixzz28GjE9A28
Ist der Beitrag jünger als ein Jahr gilt:
Der Historiker Klaus Graf dagegen ist der Ansicht, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Artikel auch vor Ablauf der Einjahresfrist online publizieren können, weil § 38 UrhG nur die körperliche Verbreitung regelt und die öffentliche Zugänglichmachung davon unberührt ist. Einzig das Stellen unter eine freie Creative-Commons-Lizenz sei erst nach Ablauf des Jahres möglich, da diese ein einfaches Nutzungsrecht für jedermann einräumen, das die körperliche Verbreitung mit einschließt (Graf, 2006).
Read more: http://open-access.net/de/allgemeines/rechtsfragen/bereitstellen_von_dokumenten_in_repositorien/#ixzz28GvyPsWm
http://archiv.twoday.net/search?q=38+urhg
Wenn die Rechte geklärt sind, stellt sich die Frage: Wohin mit dem Scan? Passt er nicht auf die eigene Archivwebsite, empfehle ich E-LIS, das auch
http://eprints.rclis.org/
Die dauerhafte Verfügbarkeit dürfte durch Einstellung auf einem Open-Access-Repositorium wie E-LIS gegeben sein. Man kann sich aber auch an Qucosa http://www.qucosa.de/ wenden, das auch nicht-sächsischen Autoren zur Verfügung steht.
Nichts spricht dagegen, den Beitrag an mehreren Stellen zu hinterlegen (z.B. Researchgate, Mendeley, Scribd usw.) - zusätzlich zu einem (hoffentlich) langzeitarchivierten E-Print (in Deutschland meist mit URN).
Update: Zu Österreich siehe immer noch
http://archiv.twoday.net/stories/241406/
Zur Schweiz: http://archiv.twoday.net/stories/6166799/
KlausGraf - am Mittwoch, 3. Oktober 2012, 22:02 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
UB Tübingen Mh 877 ist online:
http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/Mh877
Volker Pfeifers Arbeit zur Ulmer Geschichtsschreibung (Kurze Rezension von mir 1984: http://swbplus.bsz-bw.de/bsz002495619rez.pdf ) hat die Handschrift wie viele andere nicht. Eine nähere Einordnung bleibt noch zu leisten, der Grundstock könnte aus paläographischer Sicht noch in die Mitte des 16. Jahrhunderts gehören.
Zur früheren Ulmer Geschichtsschreibung:
http://archiv.twoday.net/stories/914849/
http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/Mh877
Volker Pfeifers Arbeit zur Ulmer Geschichtsschreibung (Kurze Rezension von mir 1984: http://swbplus.bsz-bw.de/bsz002495619rez.pdf ) hat die Handschrift wie viele andere nicht. Eine nähere Einordnung bleibt noch zu leisten, der Grundstock könnte aus paläographischer Sicht noch in die Mitte des 16. Jahrhunderts gehören.
Zur früheren Ulmer Geschichtsschreibung:
http://archiv.twoday.net/stories/914849/
KlausGraf - am Mittwoch, 3. Oktober 2012, 16:44 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Seit August 2012 kann man sich in e-rara.ch auch an gedruckten historischen Karten erfreuen. Die Universitätsbibliothek Basel präsentiert topografische Karten vor 1700, unabhängig vom geografischen Fokus.
Hinzu kommen Karten sowie Stadt- und Baupläne der Region Basel aus dem Zeitraum 1701-1900. Gegenwärtig sind bereits mehr als 200 Karten online. Ergänzt werden sie durch ausgewählte Schweizer Karten und Panoramen des 19. Jahrhunderts aus dem Bestand der ETH-Bibliothek."
http://www.e-rara.ch/maps/nav/classification/3273917
Zoombar.
Hinzu kommen Karten sowie Stadt- und Baupläne der Region Basel aus dem Zeitraum 1701-1900. Gegenwärtig sind bereits mehr als 200 Karten online. Ergänzt werden sie durch ausgewählte Schweizer Karten und Panoramen des 19. Jahrhunderts aus dem Bestand der ETH-Bibliothek."
http://www.e-rara.ch/maps/nav/classification/3273917
Zoombar.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nachweise bietet:
http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Universit%C3%A4tsmatrikel
Es lohnt aber auch ein Blick auf:
http://de.wikisource.org/wiki/Universit%C3%A4tsgeschichte
http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Universit%C3%A4tsmatrikel
Es lohnt aber auch ein Blick auf:
http://de.wikisource.org/wiki/Universit%C3%A4tsgeschichte
KlausGraf - am Mittwoch, 3. Oktober 2012, 15:52 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Zahl der im Internet verfügbaren digitalisierten Leichenpredigten nimmt ständig zu. Um den Wünschen ihrer Datenbanknutzer entgegenzukommen, hat die Forschungsstelle für Personalschriften damit begonnen, in GESA solche Digitalisate für Recherchen zu erschließen." Bisher leider nur Digitalisate der SB Berlin, aber ein höchst löblicher Schritt voran!
http://www.personalschriften.de/aktuelles/artikelansicht/details/neues-feature-in-gesa-links-zu-digitalisaten.html
http://www.personalschriften.de/aktuelles/artikelansicht/details/neues-feature-in-gesa-links-zu-digitalisaten.html
KlausGraf - am Mittwoch, 3. Oktober 2012, 15:49 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
K. Kühnel machte in der geschlossenen Facebook-Gruppe Archivfragen auf die tadelnswerte Entscheidung des Hofer Stadtrats aufmerksam, den Straßennamen, der an den verdienten Heimatforscher und Stadtarchivar Ernst Dietlein erinnert, beizubehalten, obwohl Dietlein die NS-Ideologie offensiv vertrat:
http://www.frankenpost.de/lokal/hofrehau/hof-stadt/art2390,2137049
Leider liegt mir nicht vor: Kluge, Arnd: Das Archiv als Diener der Ideologie : Dr. Ernst Dietlein und der Aufbau des Stadtarchivs Hof. - In: Das deutsche Archivwesen und der Nationalsozialismus : 75. Deutscher Archivtag 2005 in Stuttgart / Hrsg.: Kretzschmar, Robert, 2007, S. 393-398
http://www.hof.de/hof/bestfuehr/ArchGesch.pdf ist leider nicht sonderlich einschlägig, einige Details bei
http://www.frankenpost.de/lokal/hofrehau/hof-stadt/art2390,1985662
http://www.forum.lnv-hof.de/index.php?page=Thread&threadID=708
 Publikation Dietleins 1948
Publikation Dietleins 1948
http://www.frankenpost.de/lokal/hofrehau/hof-stadt/art2390,2137049
Leider liegt mir nicht vor: Kluge, Arnd: Das Archiv als Diener der Ideologie : Dr. Ernst Dietlein und der Aufbau des Stadtarchivs Hof. - In: Das deutsche Archivwesen und der Nationalsozialismus : 75. Deutscher Archivtag 2005 in Stuttgart / Hrsg.: Kretzschmar, Robert, 2007, S. 393-398
http://www.hof.de/hof/bestfuehr/ArchGesch.pdf ist leider nicht sonderlich einschlägig, einige Details bei
http://www.frankenpost.de/lokal/hofrehau/hof-stadt/art2390,1985662
http://www.forum.lnv-hof.de/index.php?page=Thread&threadID=708
 Publikation Dietleins 1948
Publikation Dietleins 1948KlausGraf - am Mittwoch, 3. Oktober 2012, 15:29 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Historians Ask the Public to Help Organize the Past
http://chronicle.com/article/Historians-Ask-the-Public-to/134054/
"The challenge now for scholars is navigating the new world of crowdsourcing"
See also here in Archivalia
http://archiv.twoday.net/search?q=crowds
http://chronicle.com/article/Historians-Ask-the-Public-to/134054/
"The challenge now for scholars is navigating the new world of crowdsourcing"
See also here in Archivalia
http://archiv.twoday.net/search?q=crowds
KlausGraf - am Mittwoch, 3. Oktober 2012, 15:06 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Archiv der deutschsprachigen Literatur
Vor 100 Jahren wurde die Deutsche Nationalbibliothek gegründet
Von Manuel Waltz
"Der Auftrag für die Archivare der Deutschen Nationalbibliothek lautet: Jedes deutschsprachige Buch zu sammeln und zu archivieren. Insbesondere die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten und die Doppelbestände der Nationalbibliotheken zweier deutscher Staaten sind eine echte Herausforderung."
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/kalenderblatt/1880945/
Vor 100 Jahren wurde die Deutsche Nationalbibliothek gegründet
Von Manuel Waltz
"Der Auftrag für die Archivare der Deutschen Nationalbibliothek lautet: Jedes deutschsprachige Buch zu sammeln und zu archivieren. Insbesondere die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten und die Doppelbestände der Nationalbibliotheken zweier deutscher Staaten sind eine echte Herausforderung."
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/kalenderblatt/1880945/
SW - am Mittwoch, 3. Oktober 2012, 09:25 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
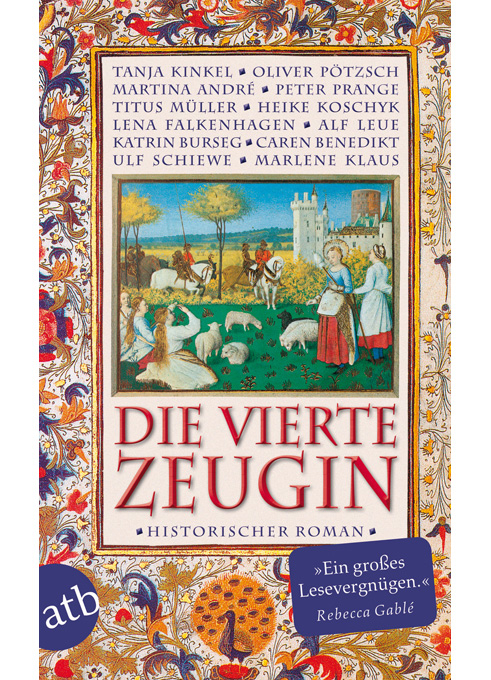
"Köln, 1534: Urplötzlich steht die schöne Tuchhändlewitwe Agnes Imhoff vor dem Nichts. Ihr verstorbener Mann hat ihr nur Schulden hinterlassen und ein Londoner Geschäftsmann klagt sie des Betruges an. Als sie ihre Unschuld beweisen will, verstrickt sie sich in einem Netz aus tödlichen Intrigen und politischen Ränkespielen.
Bei dem Gemeinschaftsroman "Die vierte Zeugin", der in diesen Tagen erschienen ist, diente der Inhalt einer mittelalterlichen Urkunde aus dem Historischen Archiv als Basis.
Zwölf Mitglieder des über 100-köpfigen Autorenkreises Quo Vadis haben daraus einen Kriminalroman geschrieben, bei dem jede Schriftstellerin und jeder Schriftsteller zwei Kapitel des Buchs verfasste und der hervorragende historische Unterhaltung bietet.
Die Autorinnen und Autoren hatten auf Lesereisen Gelder für die Restaurierung gesammelt und eine Urkunde wiederherstellen lassen. Dieses Dokument nahm Quo Vadis zum Ausgangsstoff für das Buch, das wiederum zu Spenden für die Stiftung Stadtgedächtnis aufruft.
"Die vierte Zeugin" ist als Taschenbuch mit der ISBN 978-3-74662879-0 im Aufbau Verlag, Berlin zum Preis von 9,99 Euro und als E-Book (Kindle) für 7,99 Euro erschienen."
Quelle: Homepage Stadtarchiv Köln
Wolf Thomas - am Mittwoch, 3. Oktober 2012, 08:51 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
vermeldet das Blog des Kölner Stadtarchivs am 28. September 2012. Wenn´s hilft ......
Wolf Thomas - am Mittwoch, 3. Oktober 2012, 08:47 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Dreieinhalb Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs wird der Platz für die restaurierten Dokumente eng. Je länger sich der Neubau des Archivs nach hinten verschiebt desto prekärer wird die Lage, so Archivdirektorin Bettina Schmidt-Czaia. Bis voraussichtlich kommenden Mai solle die Hälfte der verschütteten Akten, Bücher und Handschriften erfasst sein. Dann sei nur noch für zwei Regalkilometer Platz. Eigentlich sollte das neue Archiv 2015 öffnen. Der Termin wurde aber um zwei Jahre verschoben.'"
Quelle: WDR, Lokalzeit Köln, 2.10.2012
Mehr Information hier:
1) http://www.report-k.de/Politik/Lokales/Koelner-Stadtarchiv-droht-Platzmangel-11946
2) http://www.ksta.de/innenstadt/restaurierung-kein-platz-fuer-archivalien,15187556,20076440.html
Quelle: WDR, Lokalzeit Köln, 2.10.2012
Mehr Information hier:
1) http://www.report-k.de/Politik/Lokales/Koelner-Stadtarchiv-droht-Platzmangel-11946
2) http://www.ksta.de/innenstadt/restaurierung-kein-platz-fuer-archivalien,15187556,20076440.html
Wolf Thomas - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 20:04 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Darf ein Blogger auf einer wissenschaftlichen Konferenz fotografieren und die Bilder der Teilnehmenden dann in seinem Blog veröffentlichen?
Blogger sind keine Paparazzi. Daher sind die meisten Urteile, die sich mit dem Recht der Presse befassen, Bilder von Prominenten oder Straftätern zu veröffentlichen, für sie nicht einschlägig. Das betreffende Rechtsgebiet nennt sich "Recht am eigenen Bild" (siehe etwa Wikipedia) und ist im "Kunsturheberrechtsgesetz" (KG) aus dem Jahr 1907 geregelt, dessen Paragraphen 22, 23, 24 und 33 weiterhin gelten, während der Rest des Gesetzes durch das geltende Urheberrechtsgesetz ersetzt wurde.
Auch ohne Rechtskenntnisse dürfte klar sein, was in § 22 KUG unmissverständlich formuliert wird: "Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden." Dies gilt auch noch bis 10 Jahre nach dem Tod des Abgebildeten.
Das Anfertigen von Bildern in der Öffentlichkeit ist nur in Ausnahmefällen verboten. (Seit 2004 untersagt § 201a Strafgesetzbuch das unbefugte Fotografieren in geschützten Räumen.) Ein Forscher darf also für wissenschaftliche Zwecke Personenfotos ohne Zustimmung der Fotografierten erstellen, doch für ihre Veröffentlichung braucht er die Genehmigung der so Porträtierten.
Daher gilt als Faustregel: Konflikte lassen sich vermeiden, wenn man sich die geplante Veröffentlichung vom Abgebildeten genehmigen lässt.
Fotografieren bei einer Tagung Pressefotografen und Blogger einen Referenten, hat der Blogger wenig zu befürchten, da dem Referenten klar sein muss, dass Fotos von ihm veröffentlicht werden. Duldet er das Fotografieren, erteilt er implizit die Veröffentlichungserlaubnis.
Neben dem sogenanten "Beiwerk" (z.B. Personen als unwesentlicher Teil des Stadtbilds oder einer Landschaft) ist vor allem die Ausnahme für "Versammlungen" hier relevant. Private Veranstaltungen sind zwar nicht erfasst, aber auch kleinere wissenschaftliche Tagungen darf man als öffentlich ansehen. Gruppenfotos und Fotos vom Auditorium sind also, wenn nicht gezielt eine einzelne Person in den Blick genommen wird, unproblematisch.
Wie sieht es mit den Referenten aus? Wenn man die Tagung als "Ereignis der Zeitgeschichte" ansieht, darf man auch die Referenten ablichten. Die Bildberichterstattung der Presse darf "grundsätzlich alle Geschehnisse von gesellschaftlicher Relevanz" erfassen (Dreier in: Dreier/Schulze 3. Aufl. 2008, S. 1854). Die frühere Unterscheidung zwischen "absoluten Personen der Zeitgeschichte" (vulgo A-Promis) und "relevativen Personen der Zeitgeschichte", die nur vorübergehend vom Scheinwerfer der Öffentlichkeit erfasst werden (z.B. Täter oder Opfer eines spektakulären Verbrechens), wurde von der Rechtsprechung aufgegeben.
In jedem Fall ist das Interesse der Öffentlichkeit an der Bildberichterstattung mit dem Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten abzuwägen. Respektvolle Fotos von öffentlichen Veranstaltungen sind daher kaum riskant. Kann ein seriöses Informationsinteresse der Öffentlichkeit zum Thema bejaht werden, darf man auch Personenbilder ohne Zustimmung veröffentlichen, die nicht in der ersten Reihe der gesellschaftlichen Leistungssträger stehen. Ist die Person in der Wikipedia seit längerem mit einem Foto vertreten oder hat sie Fotos von sich auf Facebook usw. veröffentlicht, kann sie sich gegen eine Bildberichterstattung schlecht wehren, auch wenn es um eine kritische Auseinandersetzung geht.
Wer sich auf brisantem Terrain wie der Stasi-Geschichte bewegt, sollte sich über juristischen Gegenwind nicht wundern, wenn er ehemalige Stasi-Mitarbeiter outet oder sogar abbildet. Bei einem eindeutigen zeithistorischen Dokument musste das Oberlandesgericht München im Dezember 2010 für Rechtssicherheit sorgen: Ein ehemaliger IM war neben einem Militärstaatsanwalt bei der Versiegelung der Räumlichkeiten des MfS 1989 zu sehen. Die Internetseite stasi-in-erfurt.de durfte ihn zeigen (ich empfehle die Lektüre des Urteils (PDF)). Bemerkenswert ist, dass das Gericht dem Anbieter dieser Seite, der eine ernsthafte Auseindersetzung mit dem Thema attestiert wurde, das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 GG) neben der Informations- und Meinungsfreiheit zugute kommen ließ.
Wer seriös wissenschaftlich berichtet, braucht sich bei der Veröffentlichung von Bildern lebender oder noch nicht 10 Jahre toter Personen also auch dann nur wenig Sorgen zu machen, wenn das Bild keine herausragende Persönlichkeit betrifft.
Das Risiko, dass ein Wissenschaftsblogger Ärger wegen des "Rechts am eigenen Bild" bekommt, schätze ich als eher gering ein.
Es gibt zum Recht am eigenen Bild unzählige Gerichtsentscheidungen, Literatur und Internetquellen. Daher sollte es sich von selbst verstehen, dass dieser Beitrag keine Rechtsberatung leisten und das Thema nur allzu holzschnitthaft in den Blick nehmen kann. Hoffentlich überflüssiger Hinweis: Wer ein fremdes Foto benutzt, braucht immer auch die Zustimmung des Rechteinhabers nach dem Urheberrechtsgesetz. Aber das ist ein anderes Thema.
***
Tipp: Instruktive Bildergalerie auf Wikiversity von Ralf Roletschek:
http://de.wikiversity.org/wiki/Kurs:Urheberrecht_im_Internet/Recht_am_eigenen_Bild
Fortsetzung Blog&Recht: http://archiv.twoday.net/stories/156272358/
 Viele Urteile zum Recht am eigenen Bild erstritt Caroline von Monaco (hier bei einem öffentlichen Vortrag) . Foto: simone.brunozzi CC-BY-SA
Viele Urteile zum Recht am eigenen Bild erstritt Caroline von Monaco (hier bei einem öffentlichen Vortrag) . Foto: simone.brunozzi CC-BY-SA
Blogger sind keine Paparazzi. Daher sind die meisten Urteile, die sich mit dem Recht der Presse befassen, Bilder von Prominenten oder Straftätern zu veröffentlichen, für sie nicht einschlägig. Das betreffende Rechtsgebiet nennt sich "Recht am eigenen Bild" (siehe etwa Wikipedia) und ist im "Kunsturheberrechtsgesetz" (KG) aus dem Jahr 1907 geregelt, dessen Paragraphen 22, 23, 24 und 33 weiterhin gelten, während der Rest des Gesetzes durch das geltende Urheberrechtsgesetz ersetzt wurde.
Auch ohne Rechtskenntnisse dürfte klar sein, was in § 22 KUG unmissverständlich formuliert wird: "Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden." Dies gilt auch noch bis 10 Jahre nach dem Tod des Abgebildeten.
Das Anfertigen von Bildern in der Öffentlichkeit ist nur in Ausnahmefällen verboten. (Seit 2004 untersagt § 201a Strafgesetzbuch das unbefugte Fotografieren in geschützten Räumen.) Ein Forscher darf also für wissenschaftliche Zwecke Personenfotos ohne Zustimmung der Fotografierten erstellen, doch für ihre Veröffentlichung braucht er die Genehmigung der so Porträtierten.
Daher gilt als Faustregel: Konflikte lassen sich vermeiden, wenn man sich die geplante Veröffentlichung vom Abgebildeten genehmigen lässt.
Fotografieren bei einer Tagung Pressefotografen und Blogger einen Referenten, hat der Blogger wenig zu befürchten, da dem Referenten klar sein muss, dass Fotos von ihm veröffentlicht werden. Duldet er das Fotografieren, erteilt er implizit die Veröffentlichungserlaubnis.
Neben dem sogenanten "Beiwerk" (z.B. Personen als unwesentlicher Teil des Stadtbilds oder einer Landschaft) ist vor allem die Ausnahme für "Versammlungen" hier relevant. Private Veranstaltungen sind zwar nicht erfasst, aber auch kleinere wissenschaftliche Tagungen darf man als öffentlich ansehen. Gruppenfotos und Fotos vom Auditorium sind also, wenn nicht gezielt eine einzelne Person in den Blick genommen wird, unproblematisch.
Wie sieht es mit den Referenten aus? Wenn man die Tagung als "Ereignis der Zeitgeschichte" ansieht, darf man auch die Referenten ablichten. Die Bildberichterstattung der Presse darf "grundsätzlich alle Geschehnisse von gesellschaftlicher Relevanz" erfassen (Dreier in: Dreier/Schulze 3. Aufl. 2008, S. 1854). Die frühere Unterscheidung zwischen "absoluten Personen der Zeitgeschichte" (vulgo A-Promis) und "relevativen Personen der Zeitgeschichte", die nur vorübergehend vom Scheinwerfer der Öffentlichkeit erfasst werden (z.B. Täter oder Opfer eines spektakulären Verbrechens), wurde von der Rechtsprechung aufgegeben.
In jedem Fall ist das Interesse der Öffentlichkeit an der Bildberichterstattung mit dem Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten abzuwägen. Respektvolle Fotos von öffentlichen Veranstaltungen sind daher kaum riskant. Kann ein seriöses Informationsinteresse der Öffentlichkeit zum Thema bejaht werden, darf man auch Personenbilder ohne Zustimmung veröffentlichen, die nicht in der ersten Reihe der gesellschaftlichen Leistungssträger stehen. Ist die Person in der Wikipedia seit längerem mit einem Foto vertreten oder hat sie Fotos von sich auf Facebook usw. veröffentlicht, kann sie sich gegen eine Bildberichterstattung schlecht wehren, auch wenn es um eine kritische Auseinandersetzung geht.
Wer sich auf brisantem Terrain wie der Stasi-Geschichte bewegt, sollte sich über juristischen Gegenwind nicht wundern, wenn er ehemalige Stasi-Mitarbeiter outet oder sogar abbildet. Bei einem eindeutigen zeithistorischen Dokument musste das Oberlandesgericht München im Dezember 2010 für Rechtssicherheit sorgen: Ein ehemaliger IM war neben einem Militärstaatsanwalt bei der Versiegelung der Räumlichkeiten des MfS 1989 zu sehen. Die Internetseite stasi-in-erfurt.de durfte ihn zeigen (ich empfehle die Lektüre des Urteils (PDF)). Bemerkenswert ist, dass das Gericht dem Anbieter dieser Seite, der eine ernsthafte Auseindersetzung mit dem Thema attestiert wurde, das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 GG) neben der Informations- und Meinungsfreiheit zugute kommen ließ.
Wer seriös wissenschaftlich berichtet, braucht sich bei der Veröffentlichung von Bildern lebender oder noch nicht 10 Jahre toter Personen also auch dann nur wenig Sorgen zu machen, wenn das Bild keine herausragende Persönlichkeit betrifft.
Das Risiko, dass ein Wissenschaftsblogger Ärger wegen des "Rechts am eigenen Bild" bekommt, schätze ich als eher gering ein.
Es gibt zum Recht am eigenen Bild unzählige Gerichtsentscheidungen, Literatur und Internetquellen. Daher sollte es sich von selbst verstehen, dass dieser Beitrag keine Rechtsberatung leisten und das Thema nur allzu holzschnitthaft in den Blick nehmen kann. Hoffentlich überflüssiger Hinweis: Wer ein fremdes Foto benutzt, braucht immer auch die Zustimmung des Rechteinhabers nach dem Urheberrechtsgesetz. Aber das ist ein anderes Thema.
***
Tipp: Instruktive Bildergalerie auf Wikiversity von Ralf Roletschek:
http://de.wikiversity.org/wiki/Kurs:Urheberrecht_im_Internet/Recht_am_eigenen_Bild
Fortsetzung Blog&Recht: http://archiv.twoday.net/stories/156272358/
 Viele Urteile zum Recht am eigenen Bild erstritt Caroline von Monaco (hier bei einem öffentlichen Vortrag) . Foto: simone.brunozzi CC-BY-SA
Viele Urteile zum Recht am eigenen Bild erstritt Caroline von Monaco (hier bei einem öffentlichen Vortrag) . Foto: simone.brunozzi CC-BY-SAKlausGraf - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 18:34 - Rubrik: Archivrecht
Am 6. Juli dieses Jahres schleimte Dr. Julia Schreiner vom Oldenbourg-Verlag per Mail:
Sie hatten als Themen-Vorschlag "Zitierfähigkeit von Blogs" eingereicht. Wir würden gerne einen Aspekt Ihres abstracts herausgreifen: die urheberrechtlichen Fragen - und diesen Aspekt weiterentwickeln. Könnten Sie sich vorstellen, für das Projekt einen Überblick zu verfassen über die rechtlichen Fragen, die mit dem Medium Blog/Weblog verknüpft sind? Was müssen Blogger beachten? Was sind die rechtlichen Grundlagen? Gelten für das Medium Blog besondere Regeln - auch hinsichtlich Urheberrecht? ...
Es wäre großartig das Thema im historyblogosphere Projekt dabei zu haben. Und Sie sind sicherlich der einzige Experte, der diese wichtigen Fragen behandeln könnte.
Wenn Sie sich mit unserem Vorschlag anfreunden könnten, würden wir Sie um einen Beitrag von bis zu 16.000 Zeichen bitten (inklusive Leerzeichen und - knappen - Literaturangaben).
Ich war nicht überzeugt und hakte nach. Dr. Julia Schreiner lud am 9. Juli 2012 daraufhin reichlich Schleim nach:
Die Frage der Zitierfähigkeit klingt in einigen anderen Beiträgen an - wir freuen uns, wenn Sie sich dazu kräftig im Open Peer Review äußern.
Die Rechtsthematik wäre im Band hingegen nicht abgedeckt, was eine große Lücke lassen würde. Uns wäre es daher wichtig, mit Ihnen DEN Experten zum unverzichtbaren Thema Urheberrecht zu gewinnen.
So umworben war ich doch etwas überrascht, dass dieselbe Lektorin mir dann am 19. September schrieb:
Sehr geehrter Herr Graf,
nach Ihrem Angriff auf Herrn Peter Haber in Ihrem Blog Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/142784574/
werden Sie voraussichtlich selbst wenig Interesse daran haben, Autor im von Herrn Haber zusammen mit Eva Pfanzelter herausgegebenen Projekt "historyblogosphere" http://historyblogosphere.org/ zu sein.
Herausgeber und Verlag nehmen ebenso einhellig davon Abstand, einen Text von Ihnen im Buchprojekt "historyblogosphere" zu veröffentlichen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Julia Schreiner
Oldenbourg Verlag München
Priv.-Doz. Dr. Peter Haber
hist.net | Plattform für Digitale Geschichtswissenschaft
Ass.Prof. Dr. Eva Pfanzelter
Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck
Aus meiner Sicht hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Der OIdenbourg-Verlag hat durch konkludentes Handeln einen Verlagsvertrag mit mir geschlossen, den er ohne wichtigen Grund gekündigt hat. Mein Rechtsanwalt prüft.
Die Thematik des Beitrags werde ich in einzelnen Beiträgen in Archivalia beleuchten.
Update:
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/156272066/
Sie hatten als Themen-Vorschlag "Zitierfähigkeit von Blogs" eingereicht. Wir würden gerne einen Aspekt Ihres abstracts herausgreifen: die urheberrechtlichen Fragen - und diesen Aspekt weiterentwickeln. Könnten Sie sich vorstellen, für das Projekt einen Überblick zu verfassen über die rechtlichen Fragen, die mit dem Medium Blog/Weblog verknüpft sind? Was müssen Blogger beachten? Was sind die rechtlichen Grundlagen? Gelten für das Medium Blog besondere Regeln - auch hinsichtlich Urheberrecht? ...
Es wäre großartig das Thema im historyblogosphere Projekt dabei zu haben. Und Sie sind sicherlich der einzige Experte, der diese wichtigen Fragen behandeln könnte.
Wenn Sie sich mit unserem Vorschlag anfreunden könnten, würden wir Sie um einen Beitrag von bis zu 16.000 Zeichen bitten (inklusive Leerzeichen und - knappen - Literaturangaben).
Ich war nicht überzeugt und hakte nach. Dr. Julia Schreiner lud am 9. Juli 2012 daraufhin reichlich Schleim nach:
Die Frage der Zitierfähigkeit klingt in einigen anderen Beiträgen an - wir freuen uns, wenn Sie sich dazu kräftig im Open Peer Review äußern.
Die Rechtsthematik wäre im Band hingegen nicht abgedeckt, was eine große Lücke lassen würde. Uns wäre es daher wichtig, mit Ihnen DEN Experten zum unverzichtbaren Thema Urheberrecht zu gewinnen.
So umworben war ich doch etwas überrascht, dass dieselbe Lektorin mir dann am 19. September schrieb:
Sehr geehrter Herr Graf,
nach Ihrem Angriff auf Herrn Peter Haber in Ihrem Blog Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/142784574/
werden Sie voraussichtlich selbst wenig Interesse daran haben, Autor im von Herrn Haber zusammen mit Eva Pfanzelter herausgegebenen Projekt "historyblogosphere" http://historyblogosphere.org/ zu sein.
Herausgeber und Verlag nehmen ebenso einhellig davon Abstand, einen Text von Ihnen im Buchprojekt "historyblogosphere" zu veröffentlichen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Julia Schreiner
Oldenbourg Verlag München
Priv.-Doz. Dr. Peter Haber
hist.net | Plattform für Digitale Geschichtswissenschaft
Ass.Prof. Dr. Eva Pfanzelter
Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck
Aus meiner Sicht hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Der OIdenbourg-Verlag hat durch konkludentes Handeln einen Verlagsvertrag mit mir geschlossen, den er ohne wichtigen Grund gekündigt hat. Mein Rechtsanwalt prüft.
Die Thematik des Beitrags werde ich in einzelnen Beiträgen in Archivalia beleuchten.
Update:
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/156272066/
http://historiana.eu/
Historiana - Your Portal to the Past“ ist eine digitale Plattfom, die Lehrern ab sofort unter http://historiana.eu multiperspektivisches und vergleichendes Unterrichtsmaterial zur europäischen Geschichte zur Verfügung stellt. Ins Leben gerufen wurde das Projekt vom Europäischen Geschichtslehrerverband EUROCLIO unter Beteiligung des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung und vielen anderen Partnern.
http://idw-online.de/pages/de/news499543
Was ist das nur für ein Schrott! Was fängt man denn bitteschön als Lehrer mit einem kleinen Schwarzweissbildchen von Lech Walesa an, das nur durch das Geburtsdatum erläutert wird?
http://historiana.eu/people/person/lech-walesa
Keinerlei Link zu weiterführenden Materialien im Netz - schon daher im Ansatz verfehlt. Hat aber gewisslich gewaltig Geld verschlungen ...
Fertig ist es auch nicht, gähnend leer ist etwa die Rubrik Cartoons:
http://historiana.eu/sources/filter/cartoons/
Und Nachnutzbarkeit - Fehlanzeige? Wer ein Foto einer bemalten Wand aus Belfast in seiner Vorlesung nutzen will, kann das nicht ohne Erlaubnis des angegebenen Copyright-Inhabers, obwohl das eigentlich im Interesse des Portals sein sollte.
Wie schon tausendfach zuvor kreißte der Berg ...

Historiana - Your Portal to the Past“ ist eine digitale Plattfom, die Lehrern ab sofort unter http://historiana.eu multiperspektivisches und vergleichendes Unterrichtsmaterial zur europäischen Geschichte zur Verfügung stellt. Ins Leben gerufen wurde das Projekt vom Europäischen Geschichtslehrerverband EUROCLIO unter Beteiligung des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung und vielen anderen Partnern.
http://idw-online.de/pages/de/news499543
Was ist das nur für ein Schrott! Was fängt man denn bitteschön als Lehrer mit einem kleinen Schwarzweissbildchen von Lech Walesa an, das nur durch das Geburtsdatum erläutert wird?
http://historiana.eu/people/person/lech-walesa
Keinerlei Link zu weiterführenden Materialien im Netz - schon daher im Ansatz verfehlt. Hat aber gewisslich gewaltig Geld verschlungen ...
Fertig ist es auch nicht, gähnend leer ist etwa die Rubrik Cartoons:
http://historiana.eu/sources/filter/cartoons/
Und Nachnutzbarkeit - Fehlanzeige? Wer ein Foto einer bemalten Wand aus Belfast in seiner Vorlesung nutzen will, kann das nicht ohne Erlaubnis des angegebenen Copyright-Inhabers, obwohl das eigentlich im Interesse des Portals sein sollte.
Wie schon tausendfach zuvor kreißte der Berg ...
KlausGraf - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 17:27 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.pr.uni-freiburg.de/pm/2012/pm.2012-07-30.205
Der Historiker Kurt Andermann ist Referatsleiter für die Altbestände am Generallandesarchiv Karlsruhe und leitet seit Anfang 2012 zusätzlich das Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein. Er wurde 1982 an der Universität Mannheim promoviert und arbeitete anschließend bis 2010 in der baden-württembergischen Landes- und Kreisbeschreibung, seit 1994 als Leiter von deren Karlsruher Außenstelle. Seit 2000 ist er Lehrbeauftragter am Historischen Seminar der Universität Freiburg. Andermann ist ein ausgewiesener Kenner der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte Südwestdeutschlands unter Einschluss der Pfalz und Frankens und gilt als herausragender Ansprechpartner für Forschungen zum Adel. Sein Schriftenverzeichnis umfasst neun selbstständige Monografien, etwa 160 wissenschaftliche Aufsätze und eine Vielzahl von Lexikonartikeln und Rezensionen. Der Historiker ist unter anderem Mitglied der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. Andermann wird an der Philosophischen Fakultät Lehrveranstaltungen im Fach Mittelalterliche Geschichte / Frühe Neuzeit mit besonderer Berücksichtigung der Landesgeschichte halten. Eine enge wissenschaftliche Kooperation mit dem Landesarchiv Baden-Württemberg wird angestrebt.
Der Historiker Kurt Andermann ist Referatsleiter für die Altbestände am Generallandesarchiv Karlsruhe und leitet seit Anfang 2012 zusätzlich das Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein. Er wurde 1982 an der Universität Mannheim promoviert und arbeitete anschließend bis 2010 in der baden-württembergischen Landes- und Kreisbeschreibung, seit 1994 als Leiter von deren Karlsruher Außenstelle. Seit 2000 ist er Lehrbeauftragter am Historischen Seminar der Universität Freiburg. Andermann ist ein ausgewiesener Kenner der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte Südwestdeutschlands unter Einschluss der Pfalz und Frankens und gilt als herausragender Ansprechpartner für Forschungen zum Adel. Sein Schriftenverzeichnis umfasst neun selbstständige Monografien, etwa 160 wissenschaftliche Aufsätze und eine Vielzahl von Lexikonartikeln und Rezensionen. Der Historiker ist unter anderem Mitglied der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. Andermann wird an der Philosophischen Fakultät Lehrveranstaltungen im Fach Mittelalterliche Geschichte / Frühe Neuzeit mit besonderer Berücksichtigung der Landesgeschichte halten. Eine enge wissenschaftliche Kooperation mit dem Landesarchiv Baden-Württemberg wird angestrebt.
KlausGraf - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 16:29 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bislang klammerten die deutschen Rechtsschutzversicherer in ihren Bedingungen Medienrecht aus, sodass insbesondere Streitigkeiten mit Bezug zum Persönlichkeitsrecht oder irrtümlichen Urheberrechtsverstößen stets aus eigener Tasche finanziert werden mussten. Nunmehr will die ARAG für Privatleute diese Lücke schließen und bietet als erster Versicherer ein umfangreiches Paket an Übernahme-Leistungen an. [...] Für Blogger, Twitterer und Forennutzer besonders interessant ist der Rechtsschutz gegen den Vorwurf rechtswidriger Äußerungen, bei denen man schnell einen kostspieligen Termin z.B. am Landgericht Hamburg erhält. Derartige Streitigkeiten sollen allerdings nur im privaten Bereich übernommen werden, politisch kontroverse Blogger veröffentlichen also auch nach wie vor auf eigenes Risiko.
http://www.heise.de/tp/blogs/6/152899
http://www.heise.de/tp/blogs/6/152899
KlausGraf - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 15:16 - Rubrik: Archivrecht
Gemälde, Zeichnungen und ergänzende Dokumente sind im Fernzugriff abrufbar, meldet das VÖBBLOG:
http://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado

http://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado

KlausGraf - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 15:00 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Ausstellung zur Geschichte der Universität Salzburg ist auch virtuell zu bewundern:
http://www.uni-salzburg.at/portal/page?_pageid=147,1181515&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.uni-salzburg.at/portal/page?_pageid=147,1181515&_dad=portal&_schema=PORTAL
KlausGraf - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 14:37 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Test!
KlausGraf - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 12:49 - Rubrik: Fotoueberlieferung
http://www.youtube.com/watch?v=xkzcE5PnDgc
"Zwangsarbeiter im Dritten Reich . damit ihre Geschichten nicht in Vergessenheit geraten, gibt es das Online-Archiv "Zwangsarbeit 1939-1945. Erinnerungen und Geschichte". Zeitzeugen aus 26 Ländern berichten, rund 2000 Gesprächsstunden bilden die Grundlage des Archivs. Dahinter stehen die Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" und das Center für Digitale Systeme an der FU Berlin."
Hinweis: Diesen Beitrag habe ich angelegt, um die Einbettung von Youtube-Videos zu testen.
siehe: http://archiv.twoday.net/stories/156270465/
"Zwangsarbeiter im Dritten Reich . damit ihre Geschichten nicht in Vergessenheit geraten, gibt es das Online-Archiv "Zwangsarbeit 1939-1945. Erinnerungen und Geschichte". Zeitzeugen aus 26 Ländern berichten, rund 2000 Gesprächsstunden bilden die Grundlage des Archivs. Dahinter stehen die Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" und das Center für Digitale Systeme an der FU Berlin."
Hinweis: Diesen Beitrag habe ich angelegt, um die Einbettung von Youtube-Videos zu testen.
siehe: http://archiv.twoday.net/stories/156270465/
SW - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 09:50 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Patrick Sahle beobachtete die Digital-Humanities-Sektion des Historikertags:
http://dhd-blog.org/?p=915
Aus der Sektion ging die AG Digitale Geschichtswissenschaft hervor, über die man auf der Homepage (!) und im Newsletter des VHD (!!) dereinst mehr erfahren wird:
http://idw-online.de/pages/de/news499237
http://dhd-blog.org/?p=915
Aus der Sektion ging die AG Digitale Geschichtswissenschaft hervor, über die man auf der Homepage (!) und im Newsletter des VHD (!!) dereinst mehr erfahren wird:
http://idw-online.de/pages/de/news499237
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Geneva 1 October 2012. Representatives from the science funding agencies and library communities of 29 countries are meeting at CERN1 today to launch the SCOAP32 Open Access initiative. Open Access revolutionizes the traditional scientific publishing model with scientific papers being made freely available to all, and publishers paid directly for their indispensable peer-review services to the community.
“It is gratifying to see how the model of international collaboration in particle physics has been applied to addressing the important societal issue of open access to scientific information,” said CERN Director General Rolf Heuer. “I am proud that CERN has contributed to exploring win-win solutions to this issue, which is important to both scientists and science policy makers the world over.”
“It has been very much like working on a CERN experiment,” added Salvatore Mele, head of Open Access at CERN, who has coordinated the initiative so far, “amazing collaboration from experts from all over the world, both volunteers from libraries and partners in the publishing industry, bringing together their different expertise and working together to build something never tried before.”
The objective of SCOAP3 is to grant unrestricted access to scientific articles appearing in scientific journals in the field of particle physics, which so far have only been available to scientists through certain university libraries, and generally unavailable to a wider public. Open dissemination of preliminary information, in the form of pre-peer review articles known as preprints, has been the norm in particle physics for two decades. SCOAP3 now brings the vital peer review service provided by journals into the Open Access world.
In the SCOAP3 model, libraries and funding agencies pool resources currently used to subscribe to journal content and use them to support the peer-review system directly instead. Journal publishers then make their articles Open Access, which means that anyone can read them. Authors retain the copyright, and generous licenses for re-use are used.
Publishers of 12 journals, accounting for the vast majority of articles in the field, have been identified for participation in SCOAP3 through an open and competitive process, and the SCOAP3 initiative looks forward to establishing more partnerships with key institutions in Europe, America and Asia as it moves through the technical steps of organizing the re-direction of funds from the current subscription model to a common internationally coordinated fund.
SCOAP3 expects to be operational for articles published as of 2014. (http://press.web.cern.ch/)
“It is gratifying to see how the model of international collaboration in particle physics has been applied to addressing the important societal issue of open access to scientific information,” said CERN Director General Rolf Heuer. “I am proud that CERN has contributed to exploring win-win solutions to this issue, which is important to both scientists and science policy makers the world over.”
“It has been very much like working on a CERN experiment,” added Salvatore Mele, head of Open Access at CERN, who has coordinated the initiative so far, “amazing collaboration from experts from all over the world, both volunteers from libraries and partners in the publishing industry, bringing together their different expertise and working together to build something never tried before.”
The objective of SCOAP3 is to grant unrestricted access to scientific articles appearing in scientific journals in the field of particle physics, which so far have only been available to scientists through certain university libraries, and generally unavailable to a wider public. Open dissemination of preliminary information, in the form of pre-peer review articles known as preprints, has been the norm in particle physics for two decades. SCOAP3 now brings the vital peer review service provided by journals into the Open Access world.
In the SCOAP3 model, libraries and funding agencies pool resources currently used to subscribe to journal content and use them to support the peer-review system directly instead. Journal publishers then make their articles Open Access, which means that anyone can read them. Authors retain the copyright, and generous licenses for re-use are used.
Publishers of 12 journals, accounting for the vast majority of articles in the field, have been identified for participation in SCOAP3 through an open and competitive process, and the SCOAP3 initiative looks forward to establishing more partnerships with key institutions in Europe, America and Asia as it moves through the technical steps of organizing the re-direction of funds from the current subscription model to a common internationally coordinated fund.
SCOAP3 expects to be operational for articles published as of 2014. (http://press.web.cern.ch/)
KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 23:06 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nachrufe:
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/nachruf-auf-britischen-historiker-eric-hobsbawm-a-858999.html
http://www.guardian.co.uk/books/2012/oct/01/eric-hobsbawm-died-aged-95
Update: http://archiv.twoday.net/stories/158961357/
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/nachruf-auf-britischen-historiker-eric-hobsbawm-a-858999.html
http://www.guardian.co.uk/books/2012/oct/01/eric-hobsbawm-died-aged-95
Update: http://archiv.twoday.net/stories/158961357/
KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 23:02 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Teilnehmer haben Tolles geleistet (nämlich die Ausbeute mehr als verdoppelt - 2011: 168.208 Bilder), während die Öffentlichkeitsarbeit noch mieser als 2011 war. Es gibt auf
http://www.wikilovesmonuments.org/
keine abschließende Erfolgsmeldung, von einer Pressemitteilung ganz zu schweigen.
http://www.wikilovesmonuments.de/ ist eine Ruine (und zeigt nicht nur eine, nämlich eine Klosterruine auf freiem Feld in der Nähe von Crailsheim, das deutsche Siegerbild 2011)
Siehe zum Wettbewerb 2012 hier:
http://archiv.twoday.net/stories/156263500/
http://archiv.twoday.net/stories/142783530/
Bei den deutschen Hochladern stehe ich mit 445 Fotos auf Platz 13:
http://toolserver.org/~superzerocool/wlm/?pais=germany
http://toolserver.org/~superzerocool/wlm/usuario.php?pais=germany&usuario=Historiograf
 Eigenes Foto von Burg Hohengeroldseck
Eigenes Foto von Burg Hohengeroldseck
http://www.wikilovesmonuments.org/
keine abschließende Erfolgsmeldung, von einer Pressemitteilung ganz zu schweigen.
http://www.wikilovesmonuments.de/ ist eine Ruine (und zeigt nicht nur eine, nämlich eine Klosterruine auf freiem Feld in der Nähe von Crailsheim, das deutsche Siegerbild 2011)
Siehe zum Wettbewerb 2012 hier:
http://archiv.twoday.net/stories/156263500/
http://archiv.twoday.net/stories/142783530/
Bei den deutschen Hochladern stehe ich mit 445 Fotos auf Platz 13:
http://toolserver.org/~superzerocool/wlm/?pais=germany
http://toolserver.org/~superzerocool/wlm/usuario.php?pais=germany&usuario=Historiograf
 Eigenes Foto von Burg Hohengeroldseck
Eigenes Foto von Burg HohengeroldseckDer ehemalige Handelsblatt-Redakteur Doener zeigt die irreführende Berichterstattung seines einstigen Arbeitgebers in Sachen "geistiges Eigentum" detailliert auf:
http://doener.blogage.de/entries/2012/9/30/Missverstaendnisse-zum-Urheberrecht-in-der-Presse
http://doener.blogage.de/entries/2012/9/30/Missverstaendnisse-zum-Urheberrecht-in-der-Presse
KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 22:29 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://bildungundgutesleben.wordpress.com/2012/09/26/jemand-macht-geld-mit-google-books-ist-das-schlimm/
Gleich im ersten Fachbeitrag der aktuellen B.I.T. Online behauptet Clemens Alexander Wimmer, dass sich die Bibliotheken, welche mit Google Books zusammenarbeiten, abschaffen würden. (Wimmer, Clemens Alexander (2012) / Die Bibliothek schafft sich ab oder wie Goole books zu Geld werden. In: B.I.T. Online 15 (2012) 4, 315-328) Das ist eine gerne einmal aufgestellte Behauptung, die sich trotzdem bislang nicht bewahrheitet hat. Bei diesem speziellen Artikel scheint mir aber zudem auch ein Unverständnis im Bezug auf Freie Daten vorzuherrschen.
Bibliothekswissenschaftler Karsten Schuldt unterzieht den Text einer detaillierten Kritik, der zuzustimmen ist.
Zitat:
Insoweit scheint mir im Artikel von Wimmer eine interessante Beschreibung von Geschäftsprozessen rund um Google Books vorzuliegen, aber die angebrachte Kritik am Handeln von Bibliotheken auf einer Vorstellung zu beruhen, dass einmal gemeinfreie Werke, die in Bibliotheken angekommen sind, keinen kommerziellen Interessen dienen dürften. Das ist nicht richtig. (Gemein)frei Daten können selbstverständlich auch zur Produktion von Gewinn (Wenn er den überhaupt eintritt. Wir wissen nicht, wie viel die Nachdruckverlage verdienen, nur dass sie, wie Wimmer richtig bemerkt, noch nicht eingegangen sind, sondern vielmehr immer mehr Produkte auf den Markt werfen.) genutzt werden. Wem das nicht passt, der oder die muss die Gesellschaft sehr radikal ändern, aber – nochmal – darum scheint es Wimmer nicht zu gehen.
Archivalia wird in dem Beitrag Wimmers zitiert, aber die einleitenden Ausführungen zur Rechtslage sind daneben und lassen keinerlei Einsicht in die Problemlage erkennen.
Zu einer früheren Wimmeriade über Google Books:
http://archiv.twoday.net/stories/75224454/
Gleich im ersten Fachbeitrag der aktuellen B.I.T. Online behauptet Clemens Alexander Wimmer, dass sich die Bibliotheken, welche mit Google Books zusammenarbeiten, abschaffen würden. (Wimmer, Clemens Alexander (2012) / Die Bibliothek schafft sich ab oder wie Goole books zu Geld werden. In: B.I.T. Online 15 (2012) 4, 315-328) Das ist eine gerne einmal aufgestellte Behauptung, die sich trotzdem bislang nicht bewahrheitet hat. Bei diesem speziellen Artikel scheint mir aber zudem auch ein Unverständnis im Bezug auf Freie Daten vorzuherrschen.
Bibliothekswissenschaftler Karsten Schuldt unterzieht den Text einer detaillierten Kritik, der zuzustimmen ist.
Zitat:
Insoweit scheint mir im Artikel von Wimmer eine interessante Beschreibung von Geschäftsprozessen rund um Google Books vorzuliegen, aber die angebrachte Kritik am Handeln von Bibliotheken auf einer Vorstellung zu beruhen, dass einmal gemeinfreie Werke, die in Bibliotheken angekommen sind, keinen kommerziellen Interessen dienen dürften. Das ist nicht richtig. (Gemein)frei Daten können selbstverständlich auch zur Produktion von Gewinn (Wenn er den überhaupt eintritt. Wir wissen nicht, wie viel die Nachdruckverlage verdienen, nur dass sie, wie Wimmer richtig bemerkt, noch nicht eingegangen sind, sondern vielmehr immer mehr Produkte auf den Markt werfen.) genutzt werden. Wem das nicht passt, der oder die muss die Gesellschaft sehr radikal ändern, aber – nochmal – darum scheint es Wimmer nicht zu gehen.
Archivalia wird in dem Beitrag Wimmers zitiert, aber die einleitenden Ausführungen zur Rechtslage sind daneben und lassen keinerlei Einsicht in die Problemlage erkennen.
Zu einer früheren Wimmeriade über Google Books:
http://archiv.twoday.net/stories/75224454/
KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 22:21 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
URN: urn:nbn:de:bsz:25-opus-87679
URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8767/
Graf, Klaus: Gottfried Wilhelm Leibniz, Ladislaus Sunthaim und die süddeutsche Welfen-Historiographie
Kurzfassung in Deutsch:
In Band 1 der Scriptores rerum Brunsvicensium von 1707 druckte Leibniz auf sechs Seiten als Nr. 58 die 1511 datierte genealogische Ausarbeitung zur Geschichte der Welfen des aus Ravensburg gebürtigen Wiener Kanonikers Ladislaus Sunthaim - Hofhistoriograph Maximilians I. und einer der Väter der modernen Genealogie. Der Beitrag würdigt Sunthaim als Vorläufer des "Genealogen" Leibniz und erwägt, ob die anonyme "Summula de Guelfis", das wichtigste Zeugnis der süddeutschen Welfen-Historiographie um 1500, aus Sunthaims Feder stammen könnte. S. 39 Anm. 25 wird ein wichtiger Neufund zur Überlieferung der Werke Sunthaims mitgeteilt: Zwei bislang unidentifizierte Sammelbände Sunthayms verwahrt als Handschriften Nr. 189 und 193 des Schlüsselberg-Archivs das Oberösterreichische Landesarchiv.
SWD-Schlagwörter: Sunthaym, Ladislaus , Leibniz, Gottfried Wilhelm , Welfen
Freie Schlagwörter (deutsch): Wissenschaftsgeschichte der Genealogie
Freie Schlagwörter (englisch): genealogy
Institut: Historisches Seminar
DDC-Sachgruppe: Geschichte
Dokumentart: Aufsatz
Quelle: Leibniz als Sammler und Herausgeber historischer Quellen, hrsg. von Nora Gädeke (Wolfenbütteler Forschungen 129), Wiesbaden 2012, S. 33-47
Sprache: Deutsch
Erstellungsjahr: 2012
Publikationsdatum: 01.10.2012
Bemerkung: Verlags-PDF. Preprint mit Links: Archivalia vom 14. Oktober 2007: http://archiv.twoday.net/stories/4349225/ bzw. Archivversion http://www.webcitation.org/5xQyrF4hi
***
Passend dazu teile ich den von mir für die NDB geschriebenen Artikel über Sunthaim mit (in der von mir eingereichten, nicht redigierten Fassung):
Sunthaym, Ladislaus, Historiograph, Genealoge und Geograph
* um 1440 in Ravensburg
+ wohl um den 1. Februar 1513 in Wien
Der aus einer Ravensburger Bürgersfamilie stammende S. begegnet
erstmals 1460 in der Wiener Universitätsmatrikel. 1465 Baccalaureus geworden, schlug er in Wien eine Klerikerlaufbahn ein. Bevor er 1504 ein Kanonikat am Stephansdom erhielt, versorgten ihn drei Messpfründen an der gleichen Kirche. Seit 1500 erhielt er finanzielle Zuwendungen als Historiograph und "cronickmaister" Maximilians I.
Aufgrund seiner fundierten genealogischen Forschungen war S. zunächst der führende Kopf des Gelehrtenkreises, der gemeinsam mit dem Herrscher das singuläre Ruhmes- und Erinnerungswerk Maximilians konzipierte. Ab 1505 verdrängte ihn der für kühnere genealogische Konstruktionen aufgeschlossenere Jurist Jakob Mennel aus dieser Position. Zwei große Interessensgebiete bestimmten S.s Studien: die landesbeschreibende Geographie und die Genealogie des Adels. Wenn es an Geld und Schreibern nicht fehle, schrieb er 1503 an Matthäus Lang, wolle er sich beeilen, sein Wissen in zwei Büchern zusammenzufassen, das eine vom Adel, das andere von Ländern, Städten, Klöstern und Flüssen.
S.s Werke liegen vor allem in mehreren Sammelhandschriften vor. Die wohl weitgehend auf ausgedehnten eigenen Reisen fußende Beschreibung oberdeutscher Regionen (um 1500) in den Stuttgarter Codices hist. 2° 250 und 249 liefern überwiegend nüchterne topographisch-statistische Notizen, die aber immer wieder mit reizvollen Beobachtungen angereichert werden. Sie waren für Sebastian Münsters Kosmographie (Erstausgabe 1544) eine
wichtige Quelle. Die geographischen Arbeiten S.s, zu denen auch eine auf seine Materialien zurückgehende Beschreibung Österreichs gezählt werden darf, sind zu sehen vor dem Hintergrund der
kosmographisch-ethnographischen Darstellungen des Humanismus und des ambitionierten Plans von Konrad Celtis einer "Germania illustrata". Mit dem Poeten Celtis verband S. ein enges, wenn auch
nicht immer konfliktfreies Verhältnis.
Wie Mennel und Matthäus Marschalk von Pappenheim kann S. als Pionier der "modernen" Genealogie gelten. In einer Zeit, die noch keine genealogischen Nachschlagewerke kannte, war es eine große Leistung, Ordnung in die Stammfolgen mitteleuropäischer Dynastien zu bringen (neben den Habsburgern dokumentieren die Sammelbände z.B. auch die Welfen, Wittelsbacher und Württemberger). Bereits die anlässlich der Heiligsprechung des Babenbergerherzogs Leopold 1485 für das Stift
Klosterneuburg verfasste Babenberger-Genealogie "Tabulae
Claustroneoburgenses" (1491 anonym in Basel gedruckt) demonstrieren S.s Kennerschaft im Umgang mit der hochmittelalterlichen Quellenüberlieferung.
S. gehörte zum neuen Typ des "reisenden Historikers" (F. Eheim), der insbesondere in klösterlichen Bibliotheken und Archiven auf
Quellensuche ging. Integriert in die Wiener humanistische Sodalitas,
kann S. doch nicht als Humanist betrachtet werden, wählt man den
programmatischen Bezug auf die Antike als Kriterium. Seine
historischen Studien ordnen ihn vielmehr den ausgeprägten
retrospektiven Strömungen der Zeit um 1500 zu, wie sie damals nicht nur am deutschen Königshof gepflegt wurden, sondern auch im
"monastischen Historismus" reformierter Benediktinerklöster (mit
Johannes Trithemius an der Spitze) und im Kontext der ritterlichen
Altertümern nachspürenden "Ritter-Renaissance" (z.B. im Wappenbuch Konrad Grünenbergs).
Werke: A. F. Oefele, Rerum Boicarum Scriptores, Bd. 2, 1763, S.
557-644; K. Uhde, Ladislaus Sunthayms geographisches Werk und seine Rezeption durch Sebastian Münster. 1-2. 1993
Literatur: ADB; ²VL (W. Stelzer); F. Eheim, Ladislaus Sunthaym. Leben und Werk. masch. Diss. Wien 1949, Ders., Ladislaus Sunthaym. Ein Historiker aus dem Gelehrtenkreis um Maximilian I., in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 67 (1959), S. 54-91; R. Perger: Sunthaym-Beiträge, in: Adler 10 (1974/76), S. 224-239; R. Götz,
Wege und Irrwege frühneuzeitlicher Historiographie,
2007, S. 25-32; K. Graf, Gottfried Wilhelm Leibniz, Ladislaus Sunthaim und die süddeutsche Welfen-Historiographie, in: Leibniz als Sammler und Herausgeber historischer Quellen (in Vorb.)
[Druckfassung: Neue Deutsche Biographie 25 (2013), S. 706f.]
 Markgräfin Agnes (aus Sunthaims Klosterneuburger Stammbaum)
Markgräfin Agnes (aus Sunthaims Klosterneuburger Stammbaum)
URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8767/
Graf, Klaus: Gottfried Wilhelm Leibniz, Ladislaus Sunthaim und die süddeutsche Welfen-Historiographie
Kurzfassung in Deutsch:
In Band 1 der Scriptores rerum Brunsvicensium von 1707 druckte Leibniz auf sechs Seiten als Nr. 58 die 1511 datierte genealogische Ausarbeitung zur Geschichte der Welfen des aus Ravensburg gebürtigen Wiener Kanonikers Ladislaus Sunthaim - Hofhistoriograph Maximilians I. und einer der Väter der modernen Genealogie. Der Beitrag würdigt Sunthaim als Vorläufer des "Genealogen" Leibniz und erwägt, ob die anonyme "Summula de Guelfis", das wichtigste Zeugnis der süddeutschen Welfen-Historiographie um 1500, aus Sunthaims Feder stammen könnte. S. 39 Anm. 25 wird ein wichtiger Neufund zur Überlieferung der Werke Sunthaims mitgeteilt: Zwei bislang unidentifizierte Sammelbände Sunthayms verwahrt als Handschriften Nr. 189 und 193 des Schlüsselberg-Archivs das Oberösterreichische Landesarchiv.
SWD-Schlagwörter: Sunthaym, Ladislaus , Leibniz, Gottfried Wilhelm , Welfen
Freie Schlagwörter (deutsch): Wissenschaftsgeschichte der Genealogie
Freie Schlagwörter (englisch): genealogy
Institut: Historisches Seminar
DDC-Sachgruppe: Geschichte
Dokumentart: Aufsatz
Quelle: Leibniz als Sammler und Herausgeber historischer Quellen, hrsg. von Nora Gädeke (Wolfenbütteler Forschungen 129), Wiesbaden 2012, S. 33-47
Sprache: Deutsch
Erstellungsjahr: 2012
Publikationsdatum: 01.10.2012
Bemerkung: Verlags-PDF. Preprint mit Links: Archivalia vom 14. Oktober 2007: http://archiv.twoday.net/stories/4349225/ bzw. Archivversion http://www.webcitation.org/5xQyrF4hi
***
Passend dazu teile ich den von mir für die NDB geschriebenen Artikel über Sunthaim mit (in der von mir eingereichten, nicht redigierten Fassung):
Sunthaym, Ladislaus, Historiograph, Genealoge und Geograph
* um 1440 in Ravensburg
+ wohl um den 1. Februar 1513 in Wien
Der aus einer Ravensburger Bürgersfamilie stammende S. begegnet
erstmals 1460 in der Wiener Universitätsmatrikel. 1465 Baccalaureus geworden, schlug er in Wien eine Klerikerlaufbahn ein. Bevor er 1504 ein Kanonikat am Stephansdom erhielt, versorgten ihn drei Messpfründen an der gleichen Kirche. Seit 1500 erhielt er finanzielle Zuwendungen als Historiograph und "cronickmaister" Maximilians I.
Aufgrund seiner fundierten genealogischen Forschungen war S. zunächst der führende Kopf des Gelehrtenkreises, der gemeinsam mit dem Herrscher das singuläre Ruhmes- und Erinnerungswerk Maximilians konzipierte. Ab 1505 verdrängte ihn der für kühnere genealogische Konstruktionen aufgeschlossenere Jurist Jakob Mennel aus dieser Position. Zwei große Interessensgebiete bestimmten S.s Studien: die landesbeschreibende Geographie und die Genealogie des Adels. Wenn es an Geld und Schreibern nicht fehle, schrieb er 1503 an Matthäus Lang, wolle er sich beeilen, sein Wissen in zwei Büchern zusammenzufassen, das eine vom Adel, das andere von Ländern, Städten, Klöstern und Flüssen.
S.s Werke liegen vor allem in mehreren Sammelhandschriften vor. Die wohl weitgehend auf ausgedehnten eigenen Reisen fußende Beschreibung oberdeutscher Regionen (um 1500) in den Stuttgarter Codices hist. 2° 250 und 249 liefern überwiegend nüchterne topographisch-statistische Notizen, die aber immer wieder mit reizvollen Beobachtungen angereichert werden. Sie waren für Sebastian Münsters Kosmographie (Erstausgabe 1544) eine
wichtige Quelle. Die geographischen Arbeiten S.s, zu denen auch eine auf seine Materialien zurückgehende Beschreibung Österreichs gezählt werden darf, sind zu sehen vor dem Hintergrund der
kosmographisch-ethnographischen Darstellungen des Humanismus und des ambitionierten Plans von Konrad Celtis einer "Germania illustrata". Mit dem Poeten Celtis verband S. ein enges, wenn auch
nicht immer konfliktfreies Verhältnis.
Wie Mennel und Matthäus Marschalk von Pappenheim kann S. als Pionier der "modernen" Genealogie gelten. In einer Zeit, die noch keine genealogischen Nachschlagewerke kannte, war es eine große Leistung, Ordnung in die Stammfolgen mitteleuropäischer Dynastien zu bringen (neben den Habsburgern dokumentieren die Sammelbände z.B. auch die Welfen, Wittelsbacher und Württemberger). Bereits die anlässlich der Heiligsprechung des Babenbergerherzogs Leopold 1485 für das Stift
Klosterneuburg verfasste Babenberger-Genealogie "Tabulae
Claustroneoburgenses" (1491 anonym in Basel gedruckt) demonstrieren S.s Kennerschaft im Umgang mit der hochmittelalterlichen Quellenüberlieferung.
S. gehörte zum neuen Typ des "reisenden Historikers" (F. Eheim), der insbesondere in klösterlichen Bibliotheken und Archiven auf
Quellensuche ging. Integriert in die Wiener humanistische Sodalitas,
kann S. doch nicht als Humanist betrachtet werden, wählt man den
programmatischen Bezug auf die Antike als Kriterium. Seine
historischen Studien ordnen ihn vielmehr den ausgeprägten
retrospektiven Strömungen der Zeit um 1500 zu, wie sie damals nicht nur am deutschen Königshof gepflegt wurden, sondern auch im
"monastischen Historismus" reformierter Benediktinerklöster (mit
Johannes Trithemius an der Spitze) und im Kontext der ritterlichen
Altertümern nachspürenden "Ritter-Renaissance" (z.B. im Wappenbuch Konrad Grünenbergs).
Werke: A. F. Oefele, Rerum Boicarum Scriptores, Bd. 2, 1763, S.
557-644; K. Uhde, Ladislaus Sunthayms geographisches Werk und seine Rezeption durch Sebastian Münster. 1-2. 1993
Literatur: ADB; ²VL (W. Stelzer); F. Eheim, Ladislaus Sunthaym. Leben und Werk. masch. Diss. Wien 1949, Ders., Ladislaus Sunthaym. Ein Historiker aus dem Gelehrtenkreis um Maximilian I., in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 67 (1959), S. 54-91; R. Perger: Sunthaym-Beiträge, in: Adler 10 (1974/76), S. 224-239; R. Götz,
Wege und Irrwege frühneuzeitlicher Historiographie,
2007, S. 25-32; K. Graf, Gottfried Wilhelm Leibniz, Ladislaus Sunthaim und die süddeutsche Welfen-Historiographie, in: Leibniz als Sammler und Herausgeber historischer Quellen (in Vorb.)
[Druckfassung: Neue Deutsche Biographie 25 (2013), S. 706f.]
 Markgräfin Agnes (aus Sunthaims Klosterneuburger Stammbaum)
Markgräfin Agnes (aus Sunthaims Klosterneuburger Stammbaum)KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 21:41 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die von Abt Peter Gremmelsbach kurz vor 1500 angelegte Handschrift (heute Karlsruhe St. Peter perg. 86) wurde von Dieter Mertens ausführlich analysiert:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2804/
Interessant ist der Fall von St. Peter deshalb, weil die Handschrift zwar für den (von mir sogenannten) "monastischen Historismus" um 1500 steht, St. Peter sich aber von den Reformbewegungen des Benediktinerordens im deutschen Südwesten (Bursfelder und Melker Reform) fernhielt. Mertens zieht vergleichend meine Studien zu Lorch heran und verweist auch auf meine Überlegungen zu Augsburg.
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=ordensreform
Die Texte der Handschrift sind, wie Mertens zeigte, sehr unglücklich ediert. Nun ist der ursprüngliche Überlieferungszusammenhang anhand des Digitalisats auch ohne Einsichtnahme in das Original rekonstruierbar:
http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-28021
Update: Ausführlicher mein Eintrag in:
http://ordensgeschichte.hypotheses.org/315

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2804/
Interessant ist der Fall von St. Peter deshalb, weil die Handschrift zwar für den (von mir sogenannten) "monastischen Historismus" um 1500 steht, St. Peter sich aber von den Reformbewegungen des Benediktinerordens im deutschen Südwesten (Bursfelder und Melker Reform) fernhielt. Mertens zieht vergleichend meine Studien zu Lorch heran und verweist auch auf meine Überlegungen zu Augsburg.
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=ordensreform
Die Texte der Handschrift sind, wie Mertens zeigte, sehr unglücklich ediert. Nun ist der ursprüngliche Überlieferungszusammenhang anhand des Digitalisats auch ohne Einsichtnahme in das Original rekonstruierbar:
http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-28021
Update: Ausführlicher mein Eintrag in:
http://ordensgeschichte.hypotheses.org/315

KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 21:06 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Bibliographie ist anscheinend bereits seit 2003 im Netz, war mir aber bislang entgangen:
http://www.sfn.historicum-archiv.net/materialien/muenchnerdrucke/
Via
http://www.aussichten-online.net/2012/09/2950/
http://www.sfn.historicum-archiv.net/materialien/muenchnerdrucke/
Via
http://www.aussichten-online.net/2012/09/2950/
KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 20:59 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Buch des Monats der UB Salzburg ist ein Rundenbuch aus dem 15. Jahrhundert (ja Rundenbuch ist ein Neologismus von mir).
http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/bdm/bdm1012.htm

http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/bdm/bdm1012.htm

KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 20:56 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/tp/artikel/37/37734/1.html
Telepolis macht auf eine Veranstaltung zum Mainzer Historikertag aufmerksam:
In der Podiumsdiskussion "Zeitgeschichte ohne Ressourcen? Probleme der Nutzung audiovisueller Quellen" kam unter anderem zur Sprache, dass die umfassende Aufbewahrung des aus Gebühren der Bürger bezahlten Materials keineswegs gesichert ist. Tatsächlich prahlten Medienarchivare des ZDF noch in den Nuller Jahren auf Fortbildungsveranstaltungen damit, wie viel ihre Anstalt wegwerfen würde. Und zu dem Material, das sie aufheben, geben die Sender Historikern nur sehr bedingt Zugang. Das hängt auch damit zusammen, dass nur ein winziger Bruchteil des Rundfunkgebührenaufkommens in Höhe von jährlich siebeneinhalb Milliarden Euro in ihre Archive fließt und sich ein großer Teil des dortigen Personals eher als Abwimmler von Bittstellern, denn als Dienstleister versteht. Ob etwas eingesehen werden kann oder nicht, hängt deshalb oft von persönlichen Beziehungen ab.
Solch ein Gebaren ist auch deshalb möglich, weil es der Staat den Sendern bislang erlaubt, den Zugang zu den Archiven nach Gutsherrenart zu gewähren oder zu versagen.
Telepolis macht auf eine Veranstaltung zum Mainzer Historikertag aufmerksam:
In der Podiumsdiskussion "Zeitgeschichte ohne Ressourcen? Probleme der Nutzung audiovisueller Quellen" kam unter anderem zur Sprache, dass die umfassende Aufbewahrung des aus Gebühren der Bürger bezahlten Materials keineswegs gesichert ist. Tatsächlich prahlten Medienarchivare des ZDF noch in den Nuller Jahren auf Fortbildungsveranstaltungen damit, wie viel ihre Anstalt wegwerfen würde. Und zu dem Material, das sie aufheben, geben die Sender Historikern nur sehr bedingt Zugang. Das hängt auch damit zusammen, dass nur ein winziger Bruchteil des Rundfunkgebührenaufkommens in Höhe von jährlich siebeneinhalb Milliarden Euro in ihre Archive fließt und sich ein großer Teil des dortigen Personals eher als Abwimmler von Bittstellern, denn als Dienstleister versteht. Ob etwas eingesehen werden kann oder nicht, hängt deshalb oft von persönlichen Beziehungen ab.
Solch ein Gebaren ist auch deshalb möglich, weil es der Staat den Sendern bislang erlaubt, den Zugang zu den Archiven nach Gutsherrenart zu gewähren oder zu versagen.
KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 20:51 - Rubrik: Medienarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://netzpolitik.org/2012/exklusiv-wir-veroffentlichen-das-geheime-gutachten-das-strengere-gesetze-gegen-abgeordnetenbestechung-fordert/
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/64980315/
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/64980315/
KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 20:45 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Gibt es Literatur zum Archivar des Politischen Archivs des Auswärtigen Amtes Werner Frauendienst, später Professor an der Universität Halle? Finde irgendwie nix. Siehe http://www.catalogus-professorum-halensis.de/frauendienstwerner.html
ThomasJust - am Montag, 1. Oktober 2012, 20:37 - Rubrik: Archivgeschichte
http://www.youtube.com/watch?v=ZTXu2S8HCqo
YouTube bietet anscheinend den bislang hier allein funktionierenden alten Einbettungscode nicht mehr an, es können also nicht mehr YouTube-Videos in Archivalia eingebettet werden :-( Falls jemand das Problem lösen kann, Hinweise sind willkommen.
Via
http://www.philipvickersfithian.com/2012/09/a-song-about-archives.html
YouTube bietet anscheinend den bislang hier allein funktionierenden alten Einbettungscode nicht mehr an, es können also nicht mehr YouTube-Videos in Archivalia eingebettet werden :-( Falls jemand das Problem lösen kann, Hinweise sind willkommen.
Via
http://www.philipvickersfithian.com/2012/09/a-song-about-archives.html
KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 17:26 - Rubrik: Unterhaltung
Seit mehr als 125 Jahren bietet das Stadtarchiv Karlsruhe Platz für Dokumente. Doch in letzter Zeit wurde es etwas eng im Archiv. Zeit für eine Erweiterung. Präsentiert von Videovalis
s. a. http://www.karlsruhe.de/b1/stadtgeschichte/stadtarchiv/presse/aufbaubnn2012.de
Wolf Thomas - am Montag, 1. Oktober 2012, 12:00 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die PPT-Folien des "Praxisberichts" stehen ab heute online zum Nachlesen zur Verfügung:
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Verzeichnung, Personal
Die Ordnung und Erschließung ist seit dem Umzug von 2008 nicht zum Abschluss gebracht worden. Die physische Archivierung wurde offenbar bislang durch Studenten während der Sommersemesterferien vorgenommen. Wegen der noch ausstehenden Erschließungsarbeiten ist das Archiv weiterhin nur auf Anfrage zugänglich; man scheint allgemein hilfsbereit zu sein. Steigende Nachfrage sei vor allem durch Studenten zu bemerken, die, wenn sie sich nun auf Stipendien im Ausland bewerben, offenbar mehr mit Primärquellen arbeiten, als das früher der Fall war. Während der Kämpfe von 2011 blieb das Archiv ganz geschlossen; seither hat kein ausländischer Forscher die Bestände benutzt.
Unter den insgesamt zehn Beschäftigten der Archivabteilung verfügt niemand über eine Fachausbildung. Von einer Person, die sich zu diesem Zweck seit 2010 in Italien aufhält, ist unsicher, ob sie nach Libyen und in den Beruf zurückkehrt, hieß es. Maßgeblich sind auch Probleme mit den insgesamt fünf Verwaltungssprachen der letzten drei Jahrhunderte. Zur Zeit der Karamanli-Dynastie (1711–1835) wurde französisch und türkisch ("osmanisch") geschrieben, mit der osmanischen Wiederbesetzung des Landes 1835 wurde Türkisch Verwaltungssprache, dann folgten Italienisch, Englisch und Arabisch. Im Archiv spricht niemand Türkisch; zuletzt ordnete ein türkischer Archivar 2010 in zwei zweimonatigen Missionen entsprechendes Schriftgut.
Zwei Fälle jüdischen Schriftguts
Das Archiv befindet sich im Besitz von etwa 80 Pergamenten mit Texten in hebräischer Sprache unbekannten Inhalts, ferner einiger Tora-Rollen. Sie wurden aus der Burg übernommen. Ihr Erhaltungszustand ist schlecht, viele sind eingefaltet oder geknautscht und können ohne Bruchgefahr nicht geglättet werden. Sie liegen in einem eigenen Schrank in einigen Stapeln aufeinander und werden derzeit nicht bewegt, um weitere Beschädigungen zu vermeiden. Es gibt keinerlei Hilfsmittel für eine angemessene konservatorische Behandlung. Außer für die bereits beschriebenen 30 lfdm beschädigten Papierschriftguts herrscht auch hier Handlungsbedarf.
Als das Archiv 2008 in das Gebäude des Zentrums zog, fand sich dort die schriftliche Überlieferung der jüdischen Gemeinde von Tripolis, deren letzte 6000 Mitglieder 1967, nach dem Sechstagekrieg in Israel und antisemitischen Ausschreitungen in Tripoli, das Land Richtung Italien verließen. Diese Archivalien sind in ungefähr 200 Schachteln verpackt, die gegen Entnahmen mit Plastikband verklebt sind; der Umfang mag 75 lfdm entsprechen. Der Inhalt ist vollständig unbekannt; es ist auch unklar, ob es sich um das Schriftgut einer jüdischen Institution oder um hinterlassene Papiere aus Privatbesitz handelt. Gleichfalls gibt es keine Information darüber, ob in diesem Bestand (Bezeichnung: IB für ibraico) je geforscht worden ist.
Weitere Abteilungen des Zentrums
Zwei Abteilungen des Zentrums beschäftigen sich mit Libyana in auswärtigen Archiven. So werden z. B. Gesandtschaftsberichte, Unterlagen militärischer Dienststellen und Schifffahrtsakten gesucht. Eine Abteilung ist für europäische Archive zuständig, die andere für arabische. Es liegen je über eine Million Blatt vor, teils auf Mikrofilm, teils als Fotokopie. Die Übersetzungs- und Veröffentlichungstätigkeit ist rege; so erschienen 1991 ein und 2005 zwei deutsch-arabische Bände mit deutschen Archivalien von 1911-1917, also aus der Zeit der italienischen Eroberung und des Ersten Weltkriegs. Die beiden Bände von 2005, ISBN 9959-23-097-X und 9959-23-098-8, sind via KVK und Worldcat nicht nachweisbar, also zumindest in den großen Bibliotheken des deutschen Sprachraums wohl nicht vorhanden.
Das Fotoarchiv verfügt über 100.000 Aufnahmen seit 1911 als Negative und Positive. Sie werden seit den 1980er Jahren gesammelt. Die konservatorisch-technische Ausstattung ist nach Aussage der dort Tätigen unzureichend; 70 Prozent des Bestandes ist gescannt.
Die Abteilung für mündliche Überlieferung hat mehr als 8000 Tonband-Cassetten mit Interviews gesammelt. Ab 1979 auf Erinnerungen an den Widerstand gegen die italienische Kolonialmacht fokussiert, sind die Interviews nun thematisch breiter angelegt, doch hat dieser Forschungszweig stark an Intensität verloren. Beim Besuch wurde gerade der einzige neue Eingang der Woche erfasst, die Erinnerungen eines alten Mannes an die französische Besatzung in der südlibyschen Stadt Ghat ab 1943. Mehr als die Hälfte der Interviews liegen in fast 50 Bänden ediert vor, der Bestand ist komplett auf CD gesichert.
Die Handschriftenabteilung verfügt über 10.000 Manuskripte ab dem 14. Jahrhundert, alle mikroverfilmt, meist religiöse Literatur im Original oder in Abschrift. Es handelt sich zu 99 Prozent um arabische Texte, einige wenige osmanische und hebräische. Der 4. Band des Bestandskataloges befindet sich in Druck. Die Unterbringung in lackbehandelten Holzregalen hinter einer Art Plastikfurnier ist prekär.
Die Bibliothek hat 28.000 Bände in arabischer Sprache und 14.000 in anderen Sprachen. Es werden 750 arabischsprachige Zeitschriften und weitere in anderen Sprachen gehalten.
Schlussbemerkung
Vorstehendes Material ist Ergebnis zweier jeweils dreistündiger Besuche. Der Autor ist besonders der Archivleiterin Fatma Baghni für ihre Auskunftsbereitschaft und seinem Übersetzer Ali Arajshi für dessen Geduld verpflichtet. Es wäre erstaunlich, wenn nicht wenigstens in der italienischen Fachliteratur Weiteres über das Archiv in Erfahrung zu bringen wäre. Ergänzungen und Kommentierungen von Lesern werden also begrüßt.
Dietmar Bartz, Tripolis, 1. Oktober 2012
Die Ordnung und Erschließung ist seit dem Umzug von 2008 nicht zum Abschluss gebracht worden. Die physische Archivierung wurde offenbar bislang durch Studenten während der Sommersemesterferien vorgenommen. Wegen der noch ausstehenden Erschließungsarbeiten ist das Archiv weiterhin nur auf Anfrage zugänglich; man scheint allgemein hilfsbereit zu sein. Steigende Nachfrage sei vor allem durch Studenten zu bemerken, die, wenn sie sich nun auf Stipendien im Ausland bewerben, offenbar mehr mit Primärquellen arbeiten, als das früher der Fall war. Während der Kämpfe von 2011 blieb das Archiv ganz geschlossen; seither hat kein ausländischer Forscher die Bestände benutzt.
Unter den insgesamt zehn Beschäftigten der Archivabteilung verfügt niemand über eine Fachausbildung. Von einer Person, die sich zu diesem Zweck seit 2010 in Italien aufhält, ist unsicher, ob sie nach Libyen und in den Beruf zurückkehrt, hieß es. Maßgeblich sind auch Probleme mit den insgesamt fünf Verwaltungssprachen der letzten drei Jahrhunderte. Zur Zeit der Karamanli-Dynastie (1711–1835) wurde französisch und türkisch ("osmanisch") geschrieben, mit der osmanischen Wiederbesetzung des Landes 1835 wurde Türkisch Verwaltungssprache, dann folgten Italienisch, Englisch und Arabisch. Im Archiv spricht niemand Türkisch; zuletzt ordnete ein türkischer Archivar 2010 in zwei zweimonatigen Missionen entsprechendes Schriftgut.
Zwei Fälle jüdischen Schriftguts
Das Archiv befindet sich im Besitz von etwa 80 Pergamenten mit Texten in hebräischer Sprache unbekannten Inhalts, ferner einiger Tora-Rollen. Sie wurden aus der Burg übernommen. Ihr Erhaltungszustand ist schlecht, viele sind eingefaltet oder geknautscht und können ohne Bruchgefahr nicht geglättet werden. Sie liegen in einem eigenen Schrank in einigen Stapeln aufeinander und werden derzeit nicht bewegt, um weitere Beschädigungen zu vermeiden. Es gibt keinerlei Hilfsmittel für eine angemessene konservatorische Behandlung. Außer für die bereits beschriebenen 30 lfdm beschädigten Papierschriftguts herrscht auch hier Handlungsbedarf.
Als das Archiv 2008 in das Gebäude des Zentrums zog, fand sich dort die schriftliche Überlieferung der jüdischen Gemeinde von Tripolis, deren letzte 6000 Mitglieder 1967, nach dem Sechstagekrieg in Israel und antisemitischen Ausschreitungen in Tripoli, das Land Richtung Italien verließen. Diese Archivalien sind in ungefähr 200 Schachteln verpackt, die gegen Entnahmen mit Plastikband verklebt sind; der Umfang mag 75 lfdm entsprechen. Der Inhalt ist vollständig unbekannt; es ist auch unklar, ob es sich um das Schriftgut einer jüdischen Institution oder um hinterlassene Papiere aus Privatbesitz handelt. Gleichfalls gibt es keine Information darüber, ob in diesem Bestand (Bezeichnung: IB für ibraico) je geforscht worden ist.
Weitere Abteilungen des Zentrums
Zwei Abteilungen des Zentrums beschäftigen sich mit Libyana in auswärtigen Archiven. So werden z. B. Gesandtschaftsberichte, Unterlagen militärischer Dienststellen und Schifffahrtsakten gesucht. Eine Abteilung ist für europäische Archive zuständig, die andere für arabische. Es liegen je über eine Million Blatt vor, teils auf Mikrofilm, teils als Fotokopie. Die Übersetzungs- und Veröffentlichungstätigkeit ist rege; so erschienen 1991 ein und 2005 zwei deutsch-arabische Bände mit deutschen Archivalien von 1911-1917, also aus der Zeit der italienischen Eroberung und des Ersten Weltkriegs. Die beiden Bände von 2005, ISBN 9959-23-097-X und 9959-23-098-8, sind via KVK und Worldcat nicht nachweisbar, also zumindest in den großen Bibliotheken des deutschen Sprachraums wohl nicht vorhanden.
Das Fotoarchiv verfügt über 100.000 Aufnahmen seit 1911 als Negative und Positive. Sie werden seit den 1980er Jahren gesammelt. Die konservatorisch-technische Ausstattung ist nach Aussage der dort Tätigen unzureichend; 70 Prozent des Bestandes ist gescannt.
Die Abteilung für mündliche Überlieferung hat mehr als 8000 Tonband-Cassetten mit Interviews gesammelt. Ab 1979 auf Erinnerungen an den Widerstand gegen die italienische Kolonialmacht fokussiert, sind die Interviews nun thematisch breiter angelegt, doch hat dieser Forschungszweig stark an Intensität verloren. Beim Besuch wurde gerade der einzige neue Eingang der Woche erfasst, die Erinnerungen eines alten Mannes an die französische Besatzung in der südlibyschen Stadt Ghat ab 1943. Mehr als die Hälfte der Interviews liegen in fast 50 Bänden ediert vor, der Bestand ist komplett auf CD gesichert.
Die Handschriftenabteilung verfügt über 10.000 Manuskripte ab dem 14. Jahrhundert, alle mikroverfilmt, meist religiöse Literatur im Original oder in Abschrift. Es handelt sich zu 99 Prozent um arabische Texte, einige wenige osmanische und hebräische. Der 4. Band des Bestandskataloges befindet sich in Druck. Die Unterbringung in lackbehandelten Holzregalen hinter einer Art Plastikfurnier ist prekär.
Die Bibliothek hat 28.000 Bände in arabischer Sprache und 14.000 in anderen Sprachen. Es werden 750 arabischsprachige Zeitschriften und weitere in anderen Sprachen gehalten.
Schlussbemerkung
Vorstehendes Material ist Ergebnis zweier jeweils dreistündiger Besuche. Der Autor ist besonders der Archivleiterin Fatma Baghni für ihre Auskunftsbereitschaft und seinem Übersetzer Ali Arajshi für dessen Geduld verpflichtet. Es wäre erstaunlich, wenn nicht wenigstens in der italienischen Fachliteratur Weiteres über das Archiv in Erfahrung zu bringen wäre. Ergänzungen und Kommentierungen von Lesern werden also begrüßt.
Dietmar Bartz, Tripolis, 1. Oktober 2012
Dietmar Bartz - am Montag, 1. Oktober 2012, 08:38 - Rubrik: Internationale Aspekte
In den letzten Tagen ergab sich die Gelegenheit zu zwei kurzfristig organisierbaren Besuchen im libyschen Nationalarchiv in Tripolis. Auch wenn die mitgeteilten Fakten nur auf Interviews beruhen und nicht gegengecheckt wurden, mögen sie ein Bild der Lage dieses nur wenigen Kollegen bekannten Archives zeichnen. Es wurde auch keine Literatur aus europäischen Fachveröffentlichungen über das Nationalarchiv herangezogen – nach Auskunft von libyscher Seite gibt es keine.
Es herrschte Fotografierverbot auch hinsichtlich banaler Motive wie Archivboxen oder Urkunden, obwohl im Mai noch Filmaufnahmen für den Fernsehsender al-Jazira im Magazin möglich waren (s. u.). Der Besucher ist geneigt, dies im Zusammenhang mit der neuerlichen Schließung aller Museen in Libyen zu sehen. Beim derzeitigen Machtkampf zwischen Regierung und Milizen wird befürchtet, dass Unruhen zu gezielten Diebstählen in Gedächtniseinrichtungen genutzt werden können. Aus diesem Grund werden hier auch keine Sicherheitseinrichtungen des Archivs erörtert.
Zur Terminologie: Die Bezeichnung für den Krieg von 2011, mit dem die Libyer das mehr als 40 Jahre andauernde Regime des Machthabers Gaddafi stürzten, lautet allgemein "die Revolution". Die Bezeichnung ist hier übernommen.
Archivgeschichte
Das Nationalarchiv gehörte bis 2008 institutionell zum Libyschen Nationalmuseum mit seiner reichen archäologischen Überlieferung und einem großem Interesse von Forschern und touristischen Besuchern. In einem Nebenbereich der alten Burg untergebracht, die das Museum beherbergt, ist das Archiv vernachlässigt worden. Ein Raum mit historischem Schriftgut existierte dort offenbar schon 1928, als die neue italienische Kolonialmacht das Museum einrichtete. Eine etwa zehnseitige Bestandsübersicht des "historischen Archivs" mit Tabellen über die Umfänge von allgemeinem Schriftgut sowie Gerichts- und Steuerakten, wie er sie 2008 vorfand, veröffentlichte der libysche Historiker Mohamed Altaher Arebi im Rahmen einer Einführung in die Archivkunde, die 2010 in Bengasi erschien (196 S.); der Verfasser starb 2011. Zum "historischen Archiv" aus der Burg sind nach dem Umzug nur wenige neue Bestände hinzugekommen.
Institutionelle Einbindung
Ein zunehmendes Interesse an landesgeschichtlichen Fragen führte zu einer Änderung der Zuständigkeit. Ende 2008 zog das Archiv physisch und organisatorisch um. Es ist seither eine Abteilung des zum Kulturministerium gehörenden "Center for National Archives and Historical Studies". Diese Geschichtseinrichtung ging nach der Revolution aus einer 1978 gegründeten Forschungseinrichtung über den "Libyschen Djihad", den Kampf gegen die italienischen Kolonialherren ab 1911, hervor. Sie ist die zentrale Instanz für die historische Forschung und die Veröffentlichung historiografischer Literatur. Das Zentrum bemüht sich jetzt sehr, dem Eindruck entgegenzutreten, es habe Auftragsforschung im Interesse des Regimes betrieben.
Eine umfangreiche Veröffentlichung zum 25-jährigen Jubiläum (2003) des Zentrums liegt in arabischer Sprache vor (330 S., 27 Abb.); allerdings war es zu dieser Zeit noch nicht für das Archiv zuständig. Eine in Veröffentlichungen des Zentrums gelegentlich zu lesende Internet-Adresse "http://www.libsc.org" ist falsch, richtig ist http://www.libsc.org.ly. Die Webpräsenz ist nur auf Arabisch verfasst, automatisierte Sprachübersetzung ins Deutsche, Englische und zahlreiche andere Sprachen ist anwählbar und begrenzt hilfreich. Dort ist auch ein Youtube-Video über das Zentrum verlinkt, das ein arabischsprachiges Fernsehporträt des Senders Al Jazira vom Mai 2012 zeigt. Angemerkt sei, dass 80 Prozent meiner Gesprächspartner(innen) weiblich waren, während im Video keine Frau zu Wort kommt.
Umfang, Lagerung, Erhaltungszustand
Der Umfang des Archivs wird mit 1508 Regalmetern angegeben; das älteste bisher aufgefundene Dokument datiert von 1727. Die Bestände sind einerseits zeitlich geordnet: präkolonial (bis 1835), osmanisch (bis 1911), italienisch (bis 1943), britische Militärverwaltung (bis 1951), Königreich (bis 1969) und Dschamahirija (nur kleine Bestände); der Bestand Königreich trägt die Bezeichnung ID für König Idris, eine Sympathiebezeugung für den Monarchen. Große gesonderte Gruppen bestehen aus über zeitgenössische Registerbücher erschlossene Gerichts- und Steuerakten. Die einzige vom Umfang her nennenswerte Ablieferung nach dem Umzug erfolgte durch den Gerichtshof in Tripoli.
Ein großer Teil der Archivalien wird in Halbkompaktusanlagen in stabilen Archivklappboxen italienischer Provenienz überwiegend stehend aufbewahrt. Die Archivalien selbst zeigten sich, soweit willkürlich um die Öffnung solcher Boxen gebeten wurde, entmetallisiert, in Pappen eingeschlagen, teils mit Baumwoll-, teils mit Plastikbändern verknotet (es wurde extra auf den Mangel an Baumwollbändern hingewiesen) und beschriftet. Das Magazin ist klimatisiert. Die Arbeiten zur Errichtung weiterer Halbkompaktusanlagen mit einer Kapazitätserweiterung um 20 Prozent wurden mit dem Beginn des Aufstandes gegen Gaddafi im Februar 2011 abgebrochen, als die Monteure Tripolis verließen. Die Arbeiten ruhen seither, die Bauteile liegen bereit.
Etwa 30 Regalmeter beträgt der Umfang von stark und sehr stark beschädigten Archivalien, die in solchen Boxen – gleichfalls in problematischer Stehendaufbewahrung – stabilisiert sind. Die betroffenen Schriftstücke reichen vom 18. Jahrhundert bis nach 1950. Die Schäden gehen überwiegend auf Feuchtigkeit zurück. Es gibt im Archiv keinerlei Gerätschaft, auch kein Hygrometer, und keinerlei Kenntnis im konservatorischen Umgang mit den Schäden.
Über Schriftgutverluste im 20. Jahrhundert innerhalb des Archives wurde nichts mitgeteilt. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Archiv offenbar unbeschädigt, ebenso die militärischen Auseinandersetzungen des Jahres 2011. Über Verluste archivreifen Schriftguts in Behördenregistraturen des 20. Jahrhunderts scheint kein Überblick zu bestehen; über Verluste durch die Kämpfe während der Revolution und über die Vernichtung von Akten der Repressionsorgane konnte nichts in Erfahrung gebracht werden. Alles Verwaltungsschriftgut bis 1969 unterliegt der Abgabepflicht an das Archiv; für die Ablieferungen ist ein Ausschuss zuständig. 2010 fand mit Unterstützung aus Italien ein fünftägiger Kurs statt, in dem Verantwortliche für die Registraturen in den Ministerien geschult wurden. Es scheint seit dem Sturz Gaddafis ein Problem damit zu geben, Behörden zur Abgabe von Akten zu bewegen, weil durch den Zutritt zu Registraturen eine Verschleierung von Schandtaten des alten Regimes befürchtet wird.
Der TV-Sender Al Jazira porträtierte im Mai 2012 das libysche Nationalarchiv und andere Abteilungen des Center for National Archives and Historical Studies:
http://www.youtube.com/watch?v=A67IZTbUOVU
Es herrschte Fotografierverbot auch hinsichtlich banaler Motive wie Archivboxen oder Urkunden, obwohl im Mai noch Filmaufnahmen für den Fernsehsender al-Jazira im Magazin möglich waren (s. u.). Der Besucher ist geneigt, dies im Zusammenhang mit der neuerlichen Schließung aller Museen in Libyen zu sehen. Beim derzeitigen Machtkampf zwischen Regierung und Milizen wird befürchtet, dass Unruhen zu gezielten Diebstählen in Gedächtniseinrichtungen genutzt werden können. Aus diesem Grund werden hier auch keine Sicherheitseinrichtungen des Archivs erörtert.
Zur Terminologie: Die Bezeichnung für den Krieg von 2011, mit dem die Libyer das mehr als 40 Jahre andauernde Regime des Machthabers Gaddafi stürzten, lautet allgemein "die Revolution". Die Bezeichnung ist hier übernommen.
Archivgeschichte
Das Nationalarchiv gehörte bis 2008 institutionell zum Libyschen Nationalmuseum mit seiner reichen archäologischen Überlieferung und einem großem Interesse von Forschern und touristischen Besuchern. In einem Nebenbereich der alten Burg untergebracht, die das Museum beherbergt, ist das Archiv vernachlässigt worden. Ein Raum mit historischem Schriftgut existierte dort offenbar schon 1928, als die neue italienische Kolonialmacht das Museum einrichtete. Eine etwa zehnseitige Bestandsübersicht des "historischen Archivs" mit Tabellen über die Umfänge von allgemeinem Schriftgut sowie Gerichts- und Steuerakten, wie er sie 2008 vorfand, veröffentlichte der libysche Historiker Mohamed Altaher Arebi im Rahmen einer Einführung in die Archivkunde, die 2010 in Bengasi erschien (196 S.); der Verfasser starb 2011. Zum "historischen Archiv" aus der Burg sind nach dem Umzug nur wenige neue Bestände hinzugekommen.
Institutionelle Einbindung
Ein zunehmendes Interesse an landesgeschichtlichen Fragen führte zu einer Änderung der Zuständigkeit. Ende 2008 zog das Archiv physisch und organisatorisch um. Es ist seither eine Abteilung des zum Kulturministerium gehörenden "Center for National Archives and Historical Studies". Diese Geschichtseinrichtung ging nach der Revolution aus einer 1978 gegründeten Forschungseinrichtung über den "Libyschen Djihad", den Kampf gegen die italienischen Kolonialherren ab 1911, hervor. Sie ist die zentrale Instanz für die historische Forschung und die Veröffentlichung historiografischer Literatur. Das Zentrum bemüht sich jetzt sehr, dem Eindruck entgegenzutreten, es habe Auftragsforschung im Interesse des Regimes betrieben.
Eine umfangreiche Veröffentlichung zum 25-jährigen Jubiläum (2003) des Zentrums liegt in arabischer Sprache vor (330 S., 27 Abb.); allerdings war es zu dieser Zeit noch nicht für das Archiv zuständig. Eine in Veröffentlichungen des Zentrums gelegentlich zu lesende Internet-Adresse "http://www.libsc.org" ist falsch, richtig ist http://www.libsc.org.ly. Die Webpräsenz ist nur auf Arabisch verfasst, automatisierte Sprachübersetzung ins Deutsche, Englische und zahlreiche andere Sprachen ist anwählbar und begrenzt hilfreich. Dort ist auch ein Youtube-Video über das Zentrum verlinkt, das ein arabischsprachiges Fernsehporträt des Senders Al Jazira vom Mai 2012 zeigt. Angemerkt sei, dass 80 Prozent meiner Gesprächspartner(innen) weiblich waren, während im Video keine Frau zu Wort kommt.
Umfang, Lagerung, Erhaltungszustand
Der Umfang des Archivs wird mit 1508 Regalmetern angegeben; das älteste bisher aufgefundene Dokument datiert von 1727. Die Bestände sind einerseits zeitlich geordnet: präkolonial (bis 1835), osmanisch (bis 1911), italienisch (bis 1943), britische Militärverwaltung (bis 1951), Königreich (bis 1969) und Dschamahirija (nur kleine Bestände); der Bestand Königreich trägt die Bezeichnung ID für König Idris, eine Sympathiebezeugung für den Monarchen. Große gesonderte Gruppen bestehen aus über zeitgenössische Registerbücher erschlossene Gerichts- und Steuerakten. Die einzige vom Umfang her nennenswerte Ablieferung nach dem Umzug erfolgte durch den Gerichtshof in Tripoli.
Ein großer Teil der Archivalien wird in Halbkompaktusanlagen in stabilen Archivklappboxen italienischer Provenienz überwiegend stehend aufbewahrt. Die Archivalien selbst zeigten sich, soweit willkürlich um die Öffnung solcher Boxen gebeten wurde, entmetallisiert, in Pappen eingeschlagen, teils mit Baumwoll-, teils mit Plastikbändern verknotet (es wurde extra auf den Mangel an Baumwollbändern hingewiesen) und beschriftet. Das Magazin ist klimatisiert. Die Arbeiten zur Errichtung weiterer Halbkompaktusanlagen mit einer Kapazitätserweiterung um 20 Prozent wurden mit dem Beginn des Aufstandes gegen Gaddafi im Februar 2011 abgebrochen, als die Monteure Tripolis verließen. Die Arbeiten ruhen seither, die Bauteile liegen bereit.
Etwa 30 Regalmeter beträgt der Umfang von stark und sehr stark beschädigten Archivalien, die in solchen Boxen – gleichfalls in problematischer Stehendaufbewahrung – stabilisiert sind. Die betroffenen Schriftstücke reichen vom 18. Jahrhundert bis nach 1950. Die Schäden gehen überwiegend auf Feuchtigkeit zurück. Es gibt im Archiv keinerlei Gerätschaft, auch kein Hygrometer, und keinerlei Kenntnis im konservatorischen Umgang mit den Schäden.
Über Schriftgutverluste im 20. Jahrhundert innerhalb des Archives wurde nichts mitgeteilt. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Archiv offenbar unbeschädigt, ebenso die militärischen Auseinandersetzungen des Jahres 2011. Über Verluste archivreifen Schriftguts in Behördenregistraturen des 20. Jahrhunderts scheint kein Überblick zu bestehen; über Verluste durch die Kämpfe während der Revolution und über die Vernichtung von Akten der Repressionsorgane konnte nichts in Erfahrung gebracht werden. Alles Verwaltungsschriftgut bis 1969 unterliegt der Abgabepflicht an das Archiv; für die Ablieferungen ist ein Ausschuss zuständig. 2010 fand mit Unterstützung aus Italien ein fünftägiger Kurs statt, in dem Verantwortliche für die Registraturen in den Ministerien geschult wurden. Es scheint seit dem Sturz Gaddafis ein Problem damit zu geben, Behörden zur Abgabe von Akten zu bewegen, weil durch den Zutritt zu Registraturen eine Verschleierung von Schandtaten des alten Regimes befürchtet wird.
Der TV-Sender Al Jazira porträtierte im Mai 2012 das libysche Nationalarchiv und andere Abteilungen des Center for National Archives and Historical Studies:
http://www.youtube.com/watch?v=A67IZTbUOVU
Dietmar Bartz - am Montag, 1. Oktober 2012, 00:10 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus der Liste EXLIBRIS:
May I encourage members of the list to drawn the attention of their contacts to the appeal for donations that has been launched to help the French State acquire the manuscripts of Émilie Du Châtelet and Voltaire that will be sold at auction in Paris by Christie's on 29 October?
The appeal, undertaken with the approval of the Archives de France and the Bibliothèque nationale de France, aims to assist public libraries and archives in France to preempt at the sale. All contributions received will be made over to the public bodies able to make purchases on 29 October. Payments made will not be banked until after the sale.
Substantial tax credits are available to those paying tax in France and all donors may appear, if they wish, on the published list of donors.
Donations play a double role, financial and moral. All contributions, at whatever level, support the decisions that must soon be taken by those who will determine the public funding available.
Donations can be made by French cheque, Visa or Mastercard, bank transfer (all charges at the expense of the donor, please) and by Pay Pal.
These links may be useful:
– Presentation of the appeal and of the discovery of the manuscripts : http://fonds-voltaire.org/index.php/patrimoine/cirey
– Make a donation : http://fonds-voltaire.org/edc1
– An article on the history of the manuscripts, due to appear on 12 October in the "Cahiers Voltaire" 11 : http://fonds-voltaire.org/edc1/cv11-brown.pdf
– PDF of the appeal (colour or mono) to be distributed or printed : http://fonds-voltaire.org/index.php/patrimoine/cirey/edc-doc
– Banners for your web site linking to the appeal : http://fonds-voltaire.org/index.php/patrimoine/cirey/edc-doc
– The sale catalogue should soon be available at http://christies.com
With thanks for all that you can do to pass the word.
Andrew Brown
Président
Fonds de dotation Voltaire
26 Grand'rue, F-01210 Ferney-Voltaire
In der Tat eine sensationelle Entdeckung, denn Émilie Du Châtelet war eine der wichtigsten Wissenschaftlerinnen des 18. Jahrhunderts. Das Schlossarchiv Cirey ist im Departementalarchiv in Chaumont gelandet, über die ebenfalls wieder aufgetauchte Bibliothek erfährt man aus den oben verlinkten Quellen nichts.
Katalog der Versteigerung:
http://fonds-voltaire.org/images/edc-catalogue.pdf
Es ist ein Unding, dass diese miesen Verscherbeler (sei es Eigentümer, sei es Christie's) den Nachlass in Einzelstücken versteigern wollen. Man kann nur hoffen, dass genügend Geld zusammenkommt für einen Erwerb en bloc.
Wozu gibt es eigentlich einen Denkmalschutz?

May I encourage members of the list to drawn the attention of their contacts to the appeal for donations that has been launched to help the French State acquire the manuscripts of Émilie Du Châtelet and Voltaire that will be sold at auction in Paris by Christie's on 29 October?
The appeal, undertaken with the approval of the Archives de France and the Bibliothèque nationale de France, aims to assist public libraries and archives in France to preempt at the sale. All contributions received will be made over to the public bodies able to make purchases on 29 October. Payments made will not be banked until after the sale.
Substantial tax credits are available to those paying tax in France and all donors may appear, if they wish, on the published list of donors.
Donations play a double role, financial and moral. All contributions, at whatever level, support the decisions that must soon be taken by those who will determine the public funding available.
Donations can be made by French cheque, Visa or Mastercard, bank transfer (all charges at the expense of the donor, please) and by Pay Pal.
These links may be useful:
– Presentation of the appeal and of the discovery of the manuscripts : http://fonds-voltaire.org/index.php/patrimoine/cirey
– Make a donation : http://fonds-voltaire.org/edc1
– An article on the history of the manuscripts, due to appear on 12 October in the "Cahiers Voltaire" 11 : http://fonds-voltaire.org/edc1/cv11-brown.pdf
– PDF of the appeal (colour or mono) to be distributed or printed : http://fonds-voltaire.org/index.php/patrimoine/cirey/edc-doc
– Banners for your web site linking to the appeal : http://fonds-voltaire.org/index.php/patrimoine/cirey/edc-doc
– The sale catalogue should soon be available at http://christies.com
With thanks for all that you can do to pass the word.
Andrew Brown
Président
Fonds de dotation Voltaire
26 Grand'rue, F-01210 Ferney-Voltaire
In der Tat eine sensationelle Entdeckung, denn Émilie Du Châtelet war eine der wichtigsten Wissenschaftlerinnen des 18. Jahrhunderts. Das Schlossarchiv Cirey ist im Departementalarchiv in Chaumont gelandet, über die ebenfalls wieder aufgetauchte Bibliothek erfährt man aus den oben verlinkten Quellen nichts.
Katalog der Versteigerung:
http://fonds-voltaire.org/images/edc-catalogue.pdf
Es ist ein Unding, dass diese miesen Verscherbeler (sei es Eigentümer, sei es Christie's) den Nachlass in Einzelstücken versteigern wollen. Man kann nur hoffen, dass genügend Geld zusammenkommt für einen Erwerb en bloc.
Wozu gibt es eigentlich einen Denkmalschutz?

http://www.spiegel.de/politik/ausland/buergerkrieg-in-syrien-basar-von-aleppo-geht-in-flammen-auf-a-858756.html
"Der Kampf um die syrische Handelsstadt Aleppo tobt seit Wochen, Hunderte Menschen sind dabei bereits umgekommen. Nun verwüstet ein Feuer das historische Kleinod der Stadt, den weltberühmten Basar. Anwohner versuchen verzweifelt, die Flammen zu löschen.
[...]
Aktivist Rahman sagte, alle historischen Gebäude von Aleppo würden nach und nach beschädigt oder sogar zerstört. Besonders heftig umkämpft ist die alte Zitadelle über der Stadt, in der sich laut Vertretern der Rebellen Scharfschützen der Regierungstruppen verschanzt haben.
Die Schäden sind nicht auf Aleppo begrenzt. Laut Unesco besteht ein "extrem hohes" Risiko, dass die bekannten Kulturschätze des Landes zerstört oder geplündert werden. Der britischen Archäologin Emma Cunliffe zufolge haben alle sechs Weltkulturerbestätten in Syrien "potentiell irreversible" Schäden erlitten. "Aus archäologischer Sicht ist Syrien ein Katastrophengebiet", sagte Cunliffe kürzlich.
Schwere Schäden werden unter anderem auch gemeldet aus:
der historischen Altstadt von Homs, die von Regierungstruppen mit Artillerie und Bomben angegriffen wurde
dem Krak des Chevaliers, einer ehemaligen Kreuzritterburg in der Nähe von Homs; sie wurde von Rebellen besetzt und ist deshalb regelmäßigen Artillerieangriffen ausgesetzt
der Oasenstadt Palmyra; ihre Ruinen wurden vom Regime zum Truppenstandort gemacht, immer wieder wird dort auch der Vorwurf von Plünderungen laut
Bosra, einer Stadt im Südwesten von Syrien, die unter anderem für ihr römisches Amphitheater bekannt ist
Am Montag wollen Experten in Kairo diskutieren, wie man die Zerstörung historischer Stätten in Syrien eindämmen kann. An der Tagung nehmen nach Angaben der ägyptischen Antikenverwaltung auch Diplomaten aus Kuwait, Syrien, Katar und Saudi-Arabien teil."
Update:
http://archaeologik.blogspot.de/2012/10/neue-meldungen-zu-syrien-september.html
"Der Kampf um die syrische Handelsstadt Aleppo tobt seit Wochen, Hunderte Menschen sind dabei bereits umgekommen. Nun verwüstet ein Feuer das historische Kleinod der Stadt, den weltberühmten Basar. Anwohner versuchen verzweifelt, die Flammen zu löschen.
[...]
Aktivist Rahman sagte, alle historischen Gebäude von Aleppo würden nach und nach beschädigt oder sogar zerstört. Besonders heftig umkämpft ist die alte Zitadelle über der Stadt, in der sich laut Vertretern der Rebellen Scharfschützen der Regierungstruppen verschanzt haben.
Die Schäden sind nicht auf Aleppo begrenzt. Laut Unesco besteht ein "extrem hohes" Risiko, dass die bekannten Kulturschätze des Landes zerstört oder geplündert werden. Der britischen Archäologin Emma Cunliffe zufolge haben alle sechs Weltkulturerbestätten in Syrien "potentiell irreversible" Schäden erlitten. "Aus archäologischer Sicht ist Syrien ein Katastrophengebiet", sagte Cunliffe kürzlich.
Schwere Schäden werden unter anderem auch gemeldet aus:
der historischen Altstadt von Homs, die von Regierungstruppen mit Artillerie und Bomben angegriffen wurde
dem Krak des Chevaliers, einer ehemaligen Kreuzritterburg in der Nähe von Homs; sie wurde von Rebellen besetzt und ist deshalb regelmäßigen Artillerieangriffen ausgesetzt
der Oasenstadt Palmyra; ihre Ruinen wurden vom Regime zum Truppenstandort gemacht, immer wieder wird dort auch der Vorwurf von Plünderungen laut
Bosra, einer Stadt im Südwesten von Syrien, die unter anderem für ihr römisches Amphitheater bekannt ist
Am Montag wollen Experten in Kairo diskutieren, wie man die Zerstörung historischer Stätten in Syrien eindämmen kann. An der Tagung nehmen nach Angaben der ägyptischen Antikenverwaltung auch Diplomaten aus Kuwait, Syrien, Katar und Saudi-Arabien teil."
Update:
http://archaeologik.blogspot.de/2012/10/neue-meldungen-zu-syrien-september.html
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen