Boris Spix: Abschied vom Elfenbeinturm? Politisches Verhalten Studierender 1957-1967. Berlin und Nordrhein-Westfalen im Vergleich. Klartext Verlag Essen 2008. 722 S.
Die dem Hochschularchiv der RWTH Aachen erfreulicherweise als Belegeexemplar abgelieferte Siegener Dissertation bei Jürgen Reulecke setzt sich - aufgrund sehr breiter archivalischer Recherchen - differenziert mit der Vorgeschichte der 1968er Bewegung und dem "Politisierungs"-Konzept auseinander. "Das Bild einer zunächst unpolitischen und später überall rebellischen Studentenschaft ist zu revidieren", so der Text auf dem hinteren Umschlag.

Die dem Hochschularchiv der RWTH Aachen erfreulicherweise als Belegeexemplar abgelieferte Siegener Dissertation bei Jürgen Reulecke setzt sich - aufgrund sehr breiter archivalischer Recherchen - differenziert mit der Vorgeschichte der 1968er Bewegung und dem "Politisierungs"-Konzept auseinander. "Das Bild einer zunächst unpolitischen und später überall rebellischen Studentenschaft ist zu revidieren", so der Text auf dem hinteren Umschlag.

KlausGraf - am Dienstag, 8. April 2008, 23:26 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Heute geht es bei der Auseinandersetzung mit dem Professorenentwurf für ein neues Bundesarchivgesetz (siehe
http://archiv.twoday.net/stories/4838980/ )
um den dort vorgeschlagenen § 7:
§ 7 Anforderung und Übergabe von Unterlagen privater Stellen
(1) Das Bundesarchiv kann von Privatpersonen Unterlagen von gesamtstaatlicher Bedeutung anfordern, wenn daran ein zwingendes öffentliches Interesse besteht. Die Übergabe der Unterlagen kann verweigert werden, wenn überwiegende private Belange entgegenstehen.
(2) Politische Parteien können nach einer Anforderung gemäß Absatz 1 Satz 1 die Übergabe der Unterlagen nur ablehnen, wenn zwingende Gründe entgegenstehen.
(3) Soweit dem Bundesarchiv Unterlagen von Privatpersonen angeboten oder von diesen angefordert oder übernommen werden, können diese Unterlagen auch Angaben im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 1 enthalten.
Dieser bemerkenswerte und neuartige Vorschlag verdient im Kern Unterstützung. Privates Archivgut könne von großem öffentlichen Interesse sein, betonen die Autoren (S. 46f.). Ein reines Freiwilligkeitsprinzip genüge nicht.
Im Detail gibt es viel zu kritisieren (der Kommentar zu den Vorschlägen findet sich auf den Seiten 120-128). Das beginnt mit der mangelnden Verarbeitung der archivrechtlichen Fachliteratur. Eines der Standardwerke in diesem Bereich ist das Buch des Juristen Strauch über das Archivalieneigentum - es fehlt im Literaturverzeichnis! Strauch lehnt einen Zugriff auf Privatarchive als verfassungswidrig ab. Sodann wäre etwa zu nennen:
Norbert Reimann
Privates Archivgut und öffentliches Interesse. Westfälische Adelsarchive - Pflege, Nutzung, Bedeutung für die Forschung, in: Archive und Gedächtnis (FS Brachmann), 2005
http://www.ecrit.de/reimann.pdf
Stellungnahme von mir: http://archiv.twoday.net/stories/52906/
Übersehen haben die Autoren offenkundig die - wie ein Fremdkörper anmutende - denkmalschutzrechtliche Regelung des § 13 RLP-Archivgesetzes (S. 344 als Änderung des Denkmalschutzgesetzes bezeichnenderweise nicht abgedruckt, was den überdimensionierten Dokumentenanhang einmal mehr entwertet).
http://www.lha-rlp.de/wirueberuns/lag.html#denkmal
Verzeihlich ist dagegen die Unkenntnis des hier kurz erörterten NRW-Vermessungsgesetzes, das den Zugriff auf private Luftbildaufnahmen ermöglicht:
http://archiv.twoday.net/stories/2583905/
Die hohe Hürde des Eigentumsgrundrechts Art. 14 GG wird von den Autoren recht unbekümmert genommen unter Verweis auf den Umstand, dass das zivilrechtliche Eigentum unberührt bleibt, und das Thurn-und-Taxis-Urteil des BayObLG
http://de.wikisource.org/wiki/Bayerisches_Oberstes_Landesgericht_-_Kulturgutsicherung
Der Hinweis auf die gesamtstaatliche Bedeutung wirft als weitere Frage die nach dem Kulturförderalismus und dem Primat der politischen Geschichte auf. Was ist mit dem Archivgut eines bundesweit bekannten Entertainers?
Zutreffend sehen die Autoren einen solchen Zugriff auf Privateigentum als absolute Ausnahme, wenn dem Archivgut sonst eine Zersplitterung drohte. Die reine Erhaltung kann aber kaum durch Bundesrecht sichergestellt werden (auch wenn die Kulturgutschutzliste mit den national wertvollen Archiven eigentlich ein solches Instrument ist), sondern nur durch denkmalschutzrechtliche Regelung der Länder. Diese aber haben - mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz (siehe oben) - aber keine Möglichkeiten, die Zugänglichkeit der Unterlagen sicherzustellen.
Sofern ein Eigentümer eines herausragenden Politikernachlasses diesen versteigern lassen möchte, stellt sich die Frage, ob die Anforderungsmöglichkeit nach dem Ermessen des Bundesarchivs nicht einer ausgleichspflichtigen Enteignung gleichkommt. Von seinen Eigentümerbefugnissen bleibt ihm ja faktisch nichts: Er kann nicht den gewünschten Erlös erzielen und Nutzungen zu verhindern. Ob man nicht eher an ein Vorkaufsrecht denken sollte?
Bei den Unterlagen der politischen Parteien vermisst man den Hinweis, dass das Archivwesen der großen Volksparteien doch im Rahmen der einschlägigen Stiftungen jedenfalls insoweit funktioniert, dass ein Eingriff des Bundesarchivs nicht angezeigt ist, siehe die Homepages
http://www.archivschule.de/content/36.html
Das Bundesarchiv wird das mehr oder minder kollegiale Verhältnis zu den Parteiarchiven kaum mit einer solchen Eingriffs-Norm aufs Spiel setzen wollen, auch wenn es sich bei manchen Politiker-Nachlässen wünschen würde, dass diese nicht in den Parteiarchiven landen.
Ob ein Zugriff auf das Parteiarchiv kleinerer Parteien wie beispielsweise der NPD sinnvoll wäre, sollte man zunächst archivfachlich klären.
Absatz 3 soll vom Bundesarchiv übernommene Privatunterlagen hinsichtlich des Geheimnisschutzes und des Datenschutzes den Unterlagen anbietungspflichtiger Stellen gleichsetzen (§ 6 Abs. 3 bezieht sich auf personenbezogene Angaben und Unterlagen, die besonderen Geheimhaltungsvorschriften unterliegen). Die auf bundesrechtliche Geheimhaltungsvorschriften bezügliche Befugnisnorm des jetzigen § 11 BArchG wird in den sechs Zeilen, die diesem Absatz gewidmet sind, gar nicht angesprochen. Zur Erforderlichkeit einer datenschutzrechtlichen Befugnisnorm habe ich am Beispiel des CDU-Entwurfs des Thüringer Bibliotheksgesetzes Stellung genommen:
http://archiv.twoday.net/stories/4834214/
Zu § 6 Abs. 7 des ProfE werden S. 110f. Nachweise gegeben, die meine dortigen Ausführungen unterstreichen. Nur eine qualifizierte Befugnisnorm sichert die Verfassungsmäßigkeit der Anbietungs- und Ablieferungspflicht von Unterlagen mit personenbezogenen Daten.
Dass Abs. 3 im § 7 ProfE als notwendig angesehen wird, macht deutlich, dass bei der Übergabe von privaten Nachlässen an wissenschaftliche Bibliotheken ebenfalls eine gesetzliche Grundlage für die Erhebung der personenbezogenen Daten von Dritten erforderlich ist.
Fazit: Das Zugriffsrecht ist gut gemeint, aber es ist nicht damit zu rechnen, dass dieses "heisse Eisen" aufgegriffen werden wird. Eine vorsichtige Erweiterung des defizitären Kulturgutschutzes auf gesamtstaatlicher Ebene kann angesichts des Kulturföderalismus wohl nur über die Denkmalschutzgesetze und die Gesetzgebung der Länder funktionieren. Ein Vorkaufsrecht des Bundesarchivs wäre erst einmal zu testen.
Eine souveräne Beherrschung des Themas, die mögliche Bezüge zu anderen Rechtsgebieten hinreichend deutlich macht, konnte erneut nicht festgestellt werden.
http://archiv.twoday.net/stories/4838980/ )
um den dort vorgeschlagenen § 7:
§ 7 Anforderung und Übergabe von Unterlagen privater Stellen
(1) Das Bundesarchiv kann von Privatpersonen Unterlagen von gesamtstaatlicher Bedeutung anfordern, wenn daran ein zwingendes öffentliches Interesse besteht. Die Übergabe der Unterlagen kann verweigert werden, wenn überwiegende private Belange entgegenstehen.
(2) Politische Parteien können nach einer Anforderung gemäß Absatz 1 Satz 1 die Übergabe der Unterlagen nur ablehnen, wenn zwingende Gründe entgegenstehen.
(3) Soweit dem Bundesarchiv Unterlagen von Privatpersonen angeboten oder von diesen angefordert oder übernommen werden, können diese Unterlagen auch Angaben im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 1 enthalten.
Dieser bemerkenswerte und neuartige Vorschlag verdient im Kern Unterstützung. Privates Archivgut könne von großem öffentlichen Interesse sein, betonen die Autoren (S. 46f.). Ein reines Freiwilligkeitsprinzip genüge nicht.
Im Detail gibt es viel zu kritisieren (der Kommentar zu den Vorschlägen findet sich auf den Seiten 120-128). Das beginnt mit der mangelnden Verarbeitung der archivrechtlichen Fachliteratur. Eines der Standardwerke in diesem Bereich ist das Buch des Juristen Strauch über das Archivalieneigentum - es fehlt im Literaturverzeichnis! Strauch lehnt einen Zugriff auf Privatarchive als verfassungswidrig ab. Sodann wäre etwa zu nennen:
Norbert Reimann
Privates Archivgut und öffentliches Interesse. Westfälische Adelsarchive - Pflege, Nutzung, Bedeutung für die Forschung, in: Archive und Gedächtnis (FS Brachmann), 2005
http://www.ecrit.de/reimann.pdf
Stellungnahme von mir: http://archiv.twoday.net/stories/52906/
Übersehen haben die Autoren offenkundig die - wie ein Fremdkörper anmutende - denkmalschutzrechtliche Regelung des § 13 RLP-Archivgesetzes (S. 344 als Änderung des Denkmalschutzgesetzes bezeichnenderweise nicht abgedruckt, was den überdimensionierten Dokumentenanhang einmal mehr entwertet).
http://www.lha-rlp.de/wirueberuns/lag.html#denkmal
Verzeihlich ist dagegen die Unkenntnis des hier kurz erörterten NRW-Vermessungsgesetzes, das den Zugriff auf private Luftbildaufnahmen ermöglicht:
http://archiv.twoday.net/stories/2583905/
Die hohe Hürde des Eigentumsgrundrechts Art. 14 GG wird von den Autoren recht unbekümmert genommen unter Verweis auf den Umstand, dass das zivilrechtliche Eigentum unberührt bleibt, und das Thurn-und-Taxis-Urteil des BayObLG
http://de.wikisource.org/wiki/Bayerisches_Oberstes_Landesgericht_-_Kulturgutsicherung
Der Hinweis auf die gesamtstaatliche Bedeutung wirft als weitere Frage die nach dem Kulturförderalismus und dem Primat der politischen Geschichte auf. Was ist mit dem Archivgut eines bundesweit bekannten Entertainers?
Zutreffend sehen die Autoren einen solchen Zugriff auf Privateigentum als absolute Ausnahme, wenn dem Archivgut sonst eine Zersplitterung drohte. Die reine Erhaltung kann aber kaum durch Bundesrecht sichergestellt werden (auch wenn die Kulturgutschutzliste mit den national wertvollen Archiven eigentlich ein solches Instrument ist), sondern nur durch denkmalschutzrechtliche Regelung der Länder. Diese aber haben - mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz (siehe oben) - aber keine Möglichkeiten, die Zugänglichkeit der Unterlagen sicherzustellen.
Sofern ein Eigentümer eines herausragenden Politikernachlasses diesen versteigern lassen möchte, stellt sich die Frage, ob die Anforderungsmöglichkeit nach dem Ermessen des Bundesarchivs nicht einer ausgleichspflichtigen Enteignung gleichkommt. Von seinen Eigentümerbefugnissen bleibt ihm ja faktisch nichts: Er kann nicht den gewünschten Erlös erzielen und Nutzungen zu verhindern. Ob man nicht eher an ein Vorkaufsrecht denken sollte?
Bei den Unterlagen der politischen Parteien vermisst man den Hinweis, dass das Archivwesen der großen Volksparteien doch im Rahmen der einschlägigen Stiftungen jedenfalls insoweit funktioniert, dass ein Eingriff des Bundesarchivs nicht angezeigt ist, siehe die Homepages
http://www.archivschule.de/content/36.html
Das Bundesarchiv wird das mehr oder minder kollegiale Verhältnis zu den Parteiarchiven kaum mit einer solchen Eingriffs-Norm aufs Spiel setzen wollen, auch wenn es sich bei manchen Politiker-Nachlässen wünschen würde, dass diese nicht in den Parteiarchiven landen.
Ob ein Zugriff auf das Parteiarchiv kleinerer Parteien wie beispielsweise der NPD sinnvoll wäre, sollte man zunächst archivfachlich klären.
Absatz 3 soll vom Bundesarchiv übernommene Privatunterlagen hinsichtlich des Geheimnisschutzes und des Datenschutzes den Unterlagen anbietungspflichtiger Stellen gleichsetzen (§ 6 Abs. 3 bezieht sich auf personenbezogene Angaben und Unterlagen, die besonderen Geheimhaltungsvorschriften unterliegen). Die auf bundesrechtliche Geheimhaltungsvorschriften bezügliche Befugnisnorm des jetzigen § 11 BArchG wird in den sechs Zeilen, die diesem Absatz gewidmet sind, gar nicht angesprochen. Zur Erforderlichkeit einer datenschutzrechtlichen Befugnisnorm habe ich am Beispiel des CDU-Entwurfs des Thüringer Bibliotheksgesetzes Stellung genommen:
http://archiv.twoday.net/stories/4834214/
Zu § 6 Abs. 7 des ProfE werden S. 110f. Nachweise gegeben, die meine dortigen Ausführungen unterstreichen. Nur eine qualifizierte Befugnisnorm sichert die Verfassungsmäßigkeit der Anbietungs- und Ablieferungspflicht von Unterlagen mit personenbezogenen Daten.
Dass Abs. 3 im § 7 ProfE als notwendig angesehen wird, macht deutlich, dass bei der Übergabe von privaten Nachlässen an wissenschaftliche Bibliotheken ebenfalls eine gesetzliche Grundlage für die Erhebung der personenbezogenen Daten von Dritten erforderlich ist.
Fazit: Das Zugriffsrecht ist gut gemeint, aber es ist nicht damit zu rechnen, dass dieses "heisse Eisen" aufgegriffen werden wird. Eine vorsichtige Erweiterung des defizitären Kulturgutschutzes auf gesamtstaatlicher Ebene kann angesichts des Kulturföderalismus wohl nur über die Denkmalschutzgesetze und die Gesetzgebung der Länder funktionieren. Ein Vorkaufsrecht des Bundesarchivs wäre erst einmal zu testen.
Eine souveräne Beherrschung des Themas, die mögliche Bezüge zu anderen Rechtsgebieten hinreichend deutlich macht, konnte erneut nicht festgestellt werden.
KlausGraf - am Dienstag, 8. April 2008, 21:21 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Between 1843 and 1914, photography became the main means of illustrating stories in the French press, paving the way for many new kinds of publications. Photographic production increased massively during this period. Photo-mechanical printing methods made it possible to combine typecast letters and silver print images and newspaper editors rushed to use this new tandem to illustrate their pages. From the magazine L’Illustration, created in 1843 to La Vie au grand air, which appeared during the Belle Époque, photography’s importance increased enormously. Initially used by engravers as a basis for their drawings and not published themselves, photographs soon became the main medium for illustrating news stories. The press began using more and more photographic images. Under the guidance of artistic directors, skilled in the art of marrying words and images, picture stories began to cover newspaper pages, transforming illustrated journals into magazines. Between these two dates, the protocols of photographic illustration were established, producing a spectacular form of visual news.
* Télécharger le mémoire (format pdf, 15,2 Mo)
Gervais, Thierry, L’Illustration photographique. Naissance du spectacle de l’information, 1843-1914, thèse de doctorat d’histoire (dir. André Gunthert, Christophe Prochasson), EHESS, 2007, 554 p.
Via Fotostoria
* Télécharger le mémoire (format pdf, 15,2 Mo)
Gervais, Thierry, L’Illustration photographique. Naissance du spectacle de l’information, 1843-1914, thèse de doctorat d’histoire (dir. André Gunthert, Christophe Prochasson), EHESS, 2007, 554 p.
Via Fotostoria
KlausGraf - am Dienstag, 8. April 2008, 21:02 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Mehr als 7000 Gewebeproben von über 600 Mumien aus aller Welt hat er in seinem Archiv, viele Proben hat er mit dem Taschenmesser von uralten Knochen abgeschabt. Arthur Aufderheide sammelt Mumien ...."
Ich konnte nicht widerstehen.
Quelle:
http://www.daserste.de/wwiewissen/vorschau.asp
Nachtrag 12.04.2008:
Zum Mumin-Archivar in der Atacama-Wüste:
http://www.br-online.de/wissen/forschung/mumien-atacama-suedamaerika-ID1207921553896.xml
s. a.
http://archiv.twoday.net/stories/4691086/
http://archiv.twoday.net/stories/4309718/
Ich konnte nicht widerstehen.
Quelle:
http://www.daserste.de/wwiewissen/vorschau.asp
Nachtrag 12.04.2008:
Zum Mumin-Archivar in der Atacama-Wüste:
http://www.br-online.de/wissen/forschung/mumien-atacama-suedamaerika-ID1207921553896.xml
s. a.
http://archiv.twoday.net/stories/4691086/
http://archiv.twoday.net/stories/4309718/
Wolf Thomas - am Dienstag, 8. April 2008, 21:01 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... es gibt in den meisten Ensembles zwar keinen Chef, aber einen Spiritus Rector. Und außerdem: den Manager, den Witzereißer und den stillen Archivar. ..."
Quelle:
http://www.zeit.de/2008/12/SM-Quartett
Quelle:
http://www.zeit.de/2008/12/SM-Quartett
Wolf Thomas - am Dienstag, 8. April 2008, 20:59 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wer einen wirklich brillant geschriebenen Artikel eines Wikipedia-"Inklusionisten" (das sind die, die bei Löschanträgen - wie ich - "Behalten" schreien, wenn die allgegenwärtigen Baumschulabsolventen mit der Relevanz-Klatsche kommen) lesen will, voilà:
http://www.sueddeutsche.de/computer/artikel/748/167268/
Auszug:
Trotzdem werden immer noch viele gute Beiträge - verifizierbar, informativ, anregend, aber ungewöhnlich - aus diesem papierlosen, unendlich erweiterbaren, wie eine Ziehharmonika gefalteten Archiv verbannt, von Menschen mit einem allzu engen, klippschulmäßigen Verständnis davon, welche Wissensbedürfnisse eine Online-Enzyklopädie jetzt und in Zukunft erfüllen sollte.
Ein Artikel, bei dem ich versucht bin, bei beinahe jeder Zeile auszurufen: Ja, genau, so ist es! (So glänzend wie Baker hat noch nie jemand die Wikipedia-Löschpraxis beurteilt.) Auch wenn sich die mir vertraute deutschsprachige Wikipedia von der von Baker geschildeten "en" hinsichtlich der Löschpraxis sehr unterscheiden soll.
Über den Autor:
Nicholson Baker, geboren 1957 in Rochester, New York, lebt als Schriftsteller in Berwick, Maine. Auf deutsch erschien von ihm zuletzt "Eckenknick oder wie die Bibliotheken sich an den Büchern versündigen" (2005). Sein Buch "Human Smoke" (2008) über den Zweiten Weltkrieg erregt derzeit in den Vereinigten Staaten und England Aufsehen.
Das englische Original erschien bereits Ende Februar
http://www.nybooks.com/articles/21131
In der Wikipedia überschlugen sich die Editoren (einschließlich einiger Deletionisten) vor Begeisterung, was angesichts der stilistischen Eleganz nicht weiter verwunderlich ist:
http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Wageless#Loved_your_article_in_the_New_York_Review_of_Books.21

Achja: Ich hatte ganz vergessen, die Kommentare wie üblich hier zu sperren. Man muss nur die Ignoranz des Wikipedia-Pöbels in den Kommentaren von
http://www.boersenblatt.net/184464/ (Es ging um die Löschung eines Kleinverlags in der deutschsprachigen Wikipedia)
gegen die überwiegend klugen Meinungen aus der Verlagswelt halten ...
http://www.sueddeutsche.de/computer/artikel/748/167268/
Auszug:
Trotzdem werden immer noch viele gute Beiträge - verifizierbar, informativ, anregend, aber ungewöhnlich - aus diesem papierlosen, unendlich erweiterbaren, wie eine Ziehharmonika gefalteten Archiv verbannt, von Menschen mit einem allzu engen, klippschulmäßigen Verständnis davon, welche Wissensbedürfnisse eine Online-Enzyklopädie jetzt und in Zukunft erfüllen sollte.
Ein Artikel, bei dem ich versucht bin, bei beinahe jeder Zeile auszurufen: Ja, genau, so ist es! (So glänzend wie Baker hat noch nie jemand die Wikipedia-Löschpraxis beurteilt.) Auch wenn sich die mir vertraute deutschsprachige Wikipedia von der von Baker geschildeten "en" hinsichtlich der Löschpraxis sehr unterscheiden soll.
Über den Autor:
Nicholson Baker, geboren 1957 in Rochester, New York, lebt als Schriftsteller in Berwick, Maine. Auf deutsch erschien von ihm zuletzt "Eckenknick oder wie die Bibliotheken sich an den Büchern versündigen" (2005). Sein Buch "Human Smoke" (2008) über den Zweiten Weltkrieg erregt derzeit in den Vereinigten Staaten und England Aufsehen.
Das englische Original erschien bereits Ende Februar
http://www.nybooks.com/articles/21131
In der Wikipedia überschlugen sich die Editoren (einschließlich einiger Deletionisten) vor Begeisterung, was angesichts der stilistischen Eleganz nicht weiter verwunderlich ist:
http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Wageless#Loved_your_article_in_the_New_York_Review_of_Books.21

Achja: Ich hatte ganz vergessen, die Kommentare wie üblich hier zu sperren. Man muss nur die Ignoranz des Wikipedia-Pöbels in den Kommentaren von
http://www.boersenblatt.net/184464/ (Es ging um die Löschung eines Kleinverlags in der deutschsprachigen Wikipedia)
gegen die überwiegend klugen Meinungen aus der Verlagswelt halten ...
Das mr des no erläba dirfet:
Auf dem 8. Tübinger Handschriftensymposium in Blaubeuren (20.10.-22.10) wird Frau Sorbello Staub über die Digitalisierung von Sonderbeständen der Württ. Landesbibliothek Stuttgart referieren.
Programm, PDF
Nach meinen Ermittlungen hat die WLB bislang genau zwei (in Zahlen: 2) alte Drucke ins Netz gestellt:
http://www.wlb-stuttgart.de/referate/theologie/vulg1519.html
http://wiesel.wlb-stuttgart.de/referate/drucke/aldus_1500/aldus_1500.htm

Auf dem 8. Tübinger Handschriftensymposium in Blaubeuren (20.10.-22.10) wird Frau Sorbello Staub über die Digitalisierung von Sonderbeständen der Württ. Landesbibliothek Stuttgart referieren.
Programm, PDF
Nach meinen Ermittlungen hat die WLB bislang genau zwei (in Zahlen: 2) alte Drucke ins Netz gestellt:
http://www.wlb-stuttgart.de/referate/theologie/vulg1519.html
http://wiesel.wlb-stuttgart.de/referate/drucke/aldus_1500/aldus_1500.htm

KlausGraf - am Dienstag, 8. April 2008, 16:36 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
PDF
Eine wichtige Quelle für die Anwendung des IFG nicht nur auf Bundesebene!
Einige Stichworte:
S. 55 Aus Anlass von Indizierungsentscheidungen der BPjM: Bei Akteneinsicht vor Ort sei das urheberrechtliche Vervielfältigungsrecht nicht betroffen
[ UrhG vs. IFG http://archiv.twoday.net/search?q=urhg+ifg ]
S. 14, 52 Auch von den Ländern erhobene Informationen in Bundesakten unterliegen dem IFG
S. 17, 40, 57 Vertraulichkeitsabreden können das IFG nicht aushebeln
S. 53 Auch Forschungsdaten sind amtliche Informationen.
S. 67 DFG und Wissenschaftsrat unterliegen nicht dem IFG.
Eine wichtige Quelle für die Anwendung des IFG nicht nur auf Bundesebene!
Einige Stichworte:
S. 55 Aus Anlass von Indizierungsentscheidungen der BPjM: Bei Akteneinsicht vor Ort sei das urheberrechtliche Vervielfältigungsrecht nicht betroffen
[ UrhG vs. IFG http://archiv.twoday.net/search?q=urhg+ifg ]
S. 14, 52 Auch von den Ländern erhobene Informationen in Bundesakten unterliegen dem IFG
S. 17, 40, 57 Vertraulichkeitsabreden können das IFG nicht aushebeln
S. 53 Auch Forschungsdaten sind amtliche Informationen.
S. 67 DFG und Wissenschaftsrat unterliegen nicht dem IFG.
KlausGraf - am Dienstag, 8. April 2008, 15:30 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://rara.ub.umu.se/bookview/ipac/booklist.jsp
Die UB Umea hat eine ganze Anzahl erlesener alter Drucke (u.a. zur Kalligraphie) in einem schicken Viewer zugänglich gemacht, darunter auch ein deutscher Druck des 16. Jahrhunderts.
Der schwedische Verbundkatalog LIBRIS
http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=ext
ermöglicht eine Suche nach Sprachen des Mediums, ohne dass man ein weiteres Suchwort angeben muss (leider muss man Deutsch nicht unter G, sondern am Kopf der Auswahl suchen). In der Ergebnisliste kann dann auf "material digitized at LIBRIS libraries" eingegrenzt werden, was mehr ist, als deutsche Verbundkataloge bieten. Darüber hinaus sind in LIBRIS auch viele internationale Digitalisierungsprojekte mit ihren Inhalten erfasst.
Insgesamt gibt es derzeit 43 digitalisierte Drucke auf Deutsch in Schweden, u.a. dieser Stockholmer Druck aus dem 16. Jahrhundert:
http://lauren.kb.se:8080/fedora/get/kb:1635/bdef:PagedObject/view/
Das meiste sind aber Erlasse an die damaligen deutschsprachigen Gebiete des Königreichs Schweden, z.B.
http://lauren.kb.se:8080/fedora/get/kb:2163/bdef:PagedObject/view/
Weitere skandinavische Initiativen:
http://wiki.netbib.de/coma/DigiNorden

Die UB Umea hat eine ganze Anzahl erlesener alter Drucke (u.a. zur Kalligraphie) in einem schicken Viewer zugänglich gemacht, darunter auch ein deutscher Druck des 16. Jahrhunderts.
Der schwedische Verbundkatalog LIBRIS
http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=ext
ermöglicht eine Suche nach Sprachen des Mediums, ohne dass man ein weiteres Suchwort angeben muss (leider muss man Deutsch nicht unter G, sondern am Kopf der Auswahl suchen). In der Ergebnisliste kann dann auf "material digitized at LIBRIS libraries" eingegrenzt werden, was mehr ist, als deutsche Verbundkataloge bieten. Darüber hinaus sind in LIBRIS auch viele internationale Digitalisierungsprojekte mit ihren Inhalten erfasst.
Insgesamt gibt es derzeit 43 digitalisierte Drucke auf Deutsch in Schweden, u.a. dieser Stockholmer Druck aus dem 16. Jahrhundert:
http://lauren.kb.se:8080/fedora/get/kb:1635/bdef:PagedObject/view/
Das meiste sind aber Erlasse an die damaligen deutschsprachigen Gebiete des Königreichs Schweden, z.B.
http://lauren.kb.se:8080/fedora/get/kb:2163/bdef:PagedObject/view/
Weitere skandinavische Initiativen:
http://wiki.netbib.de/coma/DigiNorden
KlausGraf - am Dienstag, 8. April 2008, 10:44 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Peter Murray-Rust fordert zu Recht einmal mehr die Reduktion der "Permission barriers", nicht nur der Preisbarrieren. Moderne maschinelle Textauswertungsverfahren ermöglichen wichtige Entdeckungen, setzen aber voraus, dass sie vom Anbieter faktisch und rechtlich ermöglicht werden.
http://wwmm.ch.cam.ac.uk/blogs/murrayrust/?p=1027
Siehe auch:
http://zzzoot.blogspot.com/2008/04/free-articles-full-text-for-researchers.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Textmining
http://medinfo.netbib.de/archives/2008/04/08/2550#comment-40582
http://wwmm.ch.cam.ac.uk/blogs/murrayrust/?p=1027
Siehe auch:
http://zzzoot.blogspot.com/2008/04/free-articles-full-text-for-researchers.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Textmining
http://medinfo.netbib.de/archives/2008/04/08/2550#comment-40582
KlausGraf - am Dienstag, 8. April 2008, 00:35 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .....Etwa ein Drittel aller in der Ausstellung gezeigten Bilder war entweder noch nie zu sehen, seit langem im Archiv verschwunden oder vor Jahrzehnten nur einmal in einer Illustrierten gedruckt worden. ....."
Quelle
http://www.ad-hoc-news.de/Marktberichte/de/16222878/(Feature)+Ich+wollte+Stars+immer+als+Menschen
Quelle
http://www.ad-hoc-news.de/Marktberichte/de/16222878/(Feature)+Ich+wollte+Stars+immer+als+Menschen
Wolf Thomas - am Montag, 7. April 2008, 20:38 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
„Wir haben einen weiteren Schatz aufgetan“, verkündete Gerhard Kilian während der Jahreshauptversammlung der Franz-Völker-/Anny-Schlemm-Gesellschaft. Der umtriebige Archivar präsentierte dem kleinen Kreis der Versammelten im Robert-Maier-Haus eine Platte mit Auszügen aus der Oper „Die Jüdin“ - mit Franz Völker als Tenor. „Die Platte wurde im Januar 1933 gepresst. Ende Januar war die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, und vom 1. Februar an galt das Gebot, alles mit jüdischem Inhalt zu vernichten“, erläuterte Kilian die Rarität. ..."
Quelle:
http://www.rhein-main.net/sixcms/list.php?page=fnp2_news_article&sv%5Bid%5D=4440905
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/4518365/
Quelle:
http://www.rhein-main.net/sixcms/list.php?page=fnp2_news_article&sv%5Bid%5D=4440905
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/4518365/
Wolf Thomas - am Montag, 7. April 2008, 20:36 - Rubrik: Musikarchive
"... Die höchstens fünf Millionen Euro, die Sachsen zahlen will, würde Schmid «nicht akzeptieren». «Das ist eine künstliche und nicht korrekte Berechnung», urteilt er. Er findet es «geradezu wahnsinnig», dass Sachsen sich das «wichtigste Gut» nicht leisten wolle. Schließlich befasse sich auch die Forschung ständig mit den Werken. Die Zeit für dasGeschäft wird langsam knapp, weiß Schmid. Sollte der Deal scheitern, steht schon eines fest: Ins Ausland kann der Nachlass nicht verkauft werden. Seit Anfang März steht das Karl May-Archiv auf der Liste zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung ins Ausland. ....."
" ......Zudem habe allein die Ordnung des riesigen Archivs rund zehn Jahre in Anspruch genommen und eine sechsstellige Summe gekostet. So umfasst der Nachlass zehn handschriftlich verfasste Werkmanuskripte mit rund 10 000 Seiten, darunter «Winnetou IV», «Im Reich des silbernen Löwen» Band III und IV, Teile von «Old Surehand» sowie «Ardistan und Dschinnistan». Außerdem sind in dem Nachlass Postkarten, Notizbücher, Reisepässe, Gedichte und musikalische Kompositionen enthalten. Schmid vergleicht die Auflistung des Nachlasses mit der Leistung des Köchel-Verzeichnisses, in dem die Werke des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart geordnet wurden. ....."
Quelle:
http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/REGIONALES/1265700.html
s a. http://archiv.twoday.net/stories/4840102/
" ......Zudem habe allein die Ordnung des riesigen Archivs rund zehn Jahre in Anspruch genommen und eine sechsstellige Summe gekostet. So umfasst der Nachlass zehn handschriftlich verfasste Werkmanuskripte mit rund 10 000 Seiten, darunter «Winnetou IV», «Im Reich des silbernen Löwen» Band III und IV, Teile von «Old Surehand» sowie «Ardistan und Dschinnistan». Außerdem sind in dem Nachlass Postkarten, Notizbücher, Reisepässe, Gedichte und musikalische Kompositionen enthalten. Schmid vergleicht die Auflistung des Nachlasses mit der Leistung des Köchel-Verzeichnisses, in dem die Werke des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart geordnet wurden. ....."
Quelle:
http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/REGIONALES/1265700.html
s a. http://archiv.twoday.net/stories/4840102/
Wolf Thomas - am Montag, 7. April 2008, 20:33 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
I would like to announce the Phase 1 launch of Scriptorium: Medieval and Early Modern Manuscripts Online, an AHRC-funded project based at the Faculty of English, Cambridge University.
http://scriptorium.english.cam.ac.uk
Scriptorium will comprise full digital facsimiles of at least twenty late medieval and early modern manuscript miscellanies and commonplace books, along with descriptions, transcriptions and bibliographical information; a set of research and teaching resources for students and scholars working on manuscript studies; and an enhanced version of English Handwriting: An Online Course, our interactive palaeography tool:
http://www.english.cam.ac.uk/ceres/ehoc/
All parts of the site will remain freely and publicly available.
Currently, the resource includes images of St Johns College, Cambridge, MS S.23, an early seventeenth-century poetic miscellany. More images and information will be added progressively in the coming weeks and months, as the site is enhanced, expanded and developed. (SHARP-L)

Was it necessary to give the project the same name Scriptorium like http://www.scriptorium.columbia.edu/ ?
The resolution of the pictures could be better. They are licensed CC-BY-NC-ND but manuscript scans are not copyrightable even in the UK.
http://scriptorium.english.cam.ac.uk
Scriptorium will comprise full digital facsimiles of at least twenty late medieval and early modern manuscript miscellanies and commonplace books, along with descriptions, transcriptions and bibliographical information; a set of research and teaching resources for students and scholars working on manuscript studies; and an enhanced version of English Handwriting: An Online Course, our interactive palaeography tool:
http://www.english.cam.ac.uk/ceres/ehoc/
All parts of the site will remain freely and publicly available.
Currently, the resource includes images of St Johns College, Cambridge, MS S.23, an early seventeenth-century poetic miscellany. More images and information will be added progressively in the coming weeks and months, as the site is enhanced, expanded and developed. (SHARP-L)

Was it necessary to give the project the same name Scriptorium like http://www.scriptorium.columbia.edu/ ?
The resolution of the pictures could be better. They are licensed CC-BY-NC-ND but manuscript scans are not copyrightable even in the UK.
KlausGraf - am Montag, 7. April 2008, 14:34 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 7. April 2008, 13:12 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Handschriftlicher Nachlass des Schriftstellers Wilhelm Heinse (1746 - 1803)
http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2007/9999998/

http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2007/9999998/

KlausGraf - am Montag, 7. April 2008, 04:30 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine großartige Bibliographie.
http://wiki.netbib.de/coma/DigitaleHandschriften
wurde aktualisiert.
Es gibt einen neuen Spitzenreiter: Troyes. Ich habe die 655 Treffer mit dem Suchwort manuscrits in der Datenbank Livres numérisés durchgeklickt, keine 10 sind junge neuzeitliche Handschriften, das meiste sind digitalisierte Mikrofilme wie in Valencienne. Macht also über 640 Handschriften online (überwiegend Theologica).
Mir ebenfalls unbekannt waren die über 100 Handschriften in Turin:
http://158.102.224.39:8080/opac/sp_opac/html/elenco.jsp?full=
Leider ist dort die Bildauflösung (oft) zu gering!

http://wiki.netbib.de/coma/DigitaleHandschriften
wurde aktualisiert.
Es gibt einen neuen Spitzenreiter: Troyes. Ich habe die 655 Treffer mit dem Suchwort manuscrits in der Datenbank Livres numérisés durchgeklickt, keine 10 sind junge neuzeitliche Handschriften, das meiste sind digitalisierte Mikrofilme wie in Valencienne. Macht also über 640 Handschriften online (überwiegend Theologica).
Mir ebenfalls unbekannt waren die über 100 Handschriften in Turin:
http://158.102.224.39:8080/opac/sp_opac/html/elenco.jsp?full=
Leider ist dort die Bildauflösung (oft) zu gering!
KlausGraf - am Montag, 7. April 2008, 02:39 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Als erstes Archiv eines österreichischen Bundeslandes präsentiert das Vorarlberger Landesarchiv seine Urkundensammlung – insgesamt rund 10.000 Exemplare - im Rahmen des Projekts «MOnasteriuM.net» in digitaler Form. Sämtliche Urkunden, vom ältesten Exemplar aus dem Jahr 1139 bis zum jüngsten Dokument von 1994, stehen ab sofort im Internet frei zur Verfügung."
Hier geht es zur Recherche bei Monasterium.net.
[via kultur-online]
Hier geht es zur Recherche bei Monasterium.net.
[via kultur-online]
Joern Borchert - am Sonntag, 6. April 2008, 23:16 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.wissen-im-netz.info/literatur/schiller/biografien/lang/index.htm
Diese private Seite bietet insbesondere zu Schiller eine Menge E-Texte. Das Buch über Schiller und Schwaben liegt aber löblicherweise auch mit Scans vor!
Diese private Seite bietet insbesondere zu Schiller eine Menge E-Texte. Das Buch über Schiller und Schwaben liegt aber löblicherweise auch mit Scans vor!
KlausGraf - am Sonntag, 6. April 2008, 23:13 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Im Projektraum MD 72 am Mehringdamm 72 (Kreuzberg) ist auf Anregung der Künstlerin Paulina Olowska ein klingendes Archiv entstanden. Videos, Platten und Kassetten dokumentieren die Musik der Neuen Polnischen Welle der 80er-Jahre.
Quelle:
http://www.morgenpost.de/content/2008/04/06/berlin/955819.html
Quelle:
http://www.morgenpost.de/content/2008/04/06/berlin/955819.html
Wolf Thomas - am Sonntag, 6. April 2008, 16:46 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die HAB Wolfenbüttel hat die von ihr der Kasseler Bibliothek weggeschnappte, für einen mittleren sechsstelligen Betrag erworbene Schönrainer Liederhandschrift (zu ihr http://archiv.twoday.net/stories/4816154 ) bereits digitalisiert und ins Netz gestellt:
http://diglib.hab.de/mss/326-noviss-8f/start.htm

Update:
Der Direktor der HAB bekräftigte mir gegenüber, dass er über Preise nur mit den Geldgebern rede. "Im übrigen möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich in die Kaufverhandlungen zur Schönrainer Liederhandschrift erst nach Rücksprache mit dem Leiter der Kasseler Bibliothek eingetreten bin."
Am 18. Juni 2003 fand in Kassel eine Informationsveranstaltung statt. In der Ankündigung heisst es:
"Die Schönrainer Liederhandschrift ist eine Textsammlung epischer und lyrischer Dichtungen in mittelhochdeutscher Sprache. Sie entstand um 1330 in Hessen und wurde nun der Kasseler Universitätsbibliothek von einem Hamburger Antiquariat zum Kauf angeboten. Die Universitätsbibliothek Kassel, in deren Handschriftensammlung sich seit 1923 schon zwei Blätter der Liederhandschrift befinden, plant nun den Ankauf der Liederhandschrift. Damit würde sie ihren hervorragenden Bestand alt- und mittelhochdeutscher Schriften, zu denen unter anderem das Hildebrandlied und der Willehalmkodex gehören, ausbauen.
Gemeinsam mit dem Fachbereich Germanistik lädt die Universitätsbibliothek der Universität Kassel zu der Veranstaltung über dieses wertvolle und seltene hessische Kulturgut am 18. Juni im Eulensaal der Murhardschen Bibliothek am Brüder Grimm Platz 4 a ein.
Die von der Kasseler Universitätsbibliothek beauftragten Gutachter Prof. Dr. Hans-Jochen Schiewer (Freiburg) und Prof. Dr. Tilo Brandis (Berlin) sehen in der Schönrainer Liederhandschrift ein Kulturgut von außergewöhnlichem Rang und empfehlen der Bibliothek ausdrücklich den Ankauf des Fragments.
Für die Einwerbung der Kaufsumme von 300.000 Euro wurden Anträge bei der Hessischen Kulturstiftung und der Kulturstiftung der Länder über jeweils 100.000 Euro gestellt. Ein Drittel der Summe muss vor Ort und aus der Region finanziert werden. Bislang liegen Zusagen über knapp 40.000 Euro vor."
Dr. Jörn Günther hat die Liederhandschrift mit den anderen Fragmenten und Handschriften aus Büdingen "fürn Appel undn Ei" erhalten, wie zu erfahren war. Vermutlich hat er die Liederhandschrift aufwändig restaurieren lassen und sie nun mit sattem Gewinn Wolfenbüttel verkaufen können, nachdem früher auch einmal die Stabi in Hamburg im Gespräch war.
http://diglib.hab.de/mss/326-noviss-8f/start.htm

Update:
Der Direktor der HAB bekräftigte mir gegenüber, dass er über Preise nur mit den Geldgebern rede. "Im übrigen möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich in die Kaufverhandlungen zur Schönrainer Liederhandschrift erst nach Rücksprache mit dem Leiter der Kasseler Bibliothek eingetreten bin."
Am 18. Juni 2003 fand in Kassel eine Informationsveranstaltung statt. In der Ankündigung heisst es:
"Die Schönrainer Liederhandschrift ist eine Textsammlung epischer und lyrischer Dichtungen in mittelhochdeutscher Sprache. Sie entstand um 1330 in Hessen und wurde nun der Kasseler Universitätsbibliothek von einem Hamburger Antiquariat zum Kauf angeboten. Die Universitätsbibliothek Kassel, in deren Handschriftensammlung sich seit 1923 schon zwei Blätter der Liederhandschrift befinden, plant nun den Ankauf der Liederhandschrift. Damit würde sie ihren hervorragenden Bestand alt- und mittelhochdeutscher Schriften, zu denen unter anderem das Hildebrandlied und der Willehalmkodex gehören, ausbauen.
Gemeinsam mit dem Fachbereich Germanistik lädt die Universitätsbibliothek der Universität Kassel zu der Veranstaltung über dieses wertvolle und seltene hessische Kulturgut am 18. Juni im Eulensaal der Murhardschen Bibliothek am Brüder Grimm Platz 4 a ein.
Die von der Kasseler Universitätsbibliothek beauftragten Gutachter Prof. Dr. Hans-Jochen Schiewer (Freiburg) und Prof. Dr. Tilo Brandis (Berlin) sehen in der Schönrainer Liederhandschrift ein Kulturgut von außergewöhnlichem Rang und empfehlen der Bibliothek ausdrücklich den Ankauf des Fragments.
Für die Einwerbung der Kaufsumme von 300.000 Euro wurden Anträge bei der Hessischen Kulturstiftung und der Kulturstiftung der Länder über jeweils 100.000 Euro gestellt. Ein Drittel der Summe muss vor Ort und aus der Region finanziert werden. Bislang liegen Zusagen über knapp 40.000 Euro vor."
Dr. Jörn Günther hat die Liederhandschrift mit den anderen Fragmenten und Handschriften aus Büdingen "fürn Appel undn Ei" erhalten, wie zu erfahren war. Vermutlich hat er die Liederhandschrift aufwändig restaurieren lassen und sie nun mit sattem Gewinn Wolfenbüttel verkaufen können, nachdem früher auch einmal die Stabi in Hamburg im Gespräch war.
PDF.
Auszug:
"University institutional policies should require that their researchers deposit (selfarchive) their scientific publications in their institutional repository upon acceptance for publication. Permissible embargoes should apply only to the date of open access provision and not the date of deposit."
Siehe dazu hier zuletzt:
http://archiv.twoday.net/stories/4704017/
Auszug:
"University institutional policies should require that their researchers deposit (selfarchive) their scientific publications in their institutional repository upon acceptance for publication. Permissible embargoes should apply only to the date of open access provision and not the date of deposit."
Siehe dazu hier zuletzt:
http://archiv.twoday.net/stories/4704017/
KlausGraf - am Sonntag, 6. April 2008, 14:15 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Open Research Society hatten wir schon:
http://archiv.twoday.net/stories/4828444/
Nun gibt es eine Frage zu Bentham Open in Harnads Liste.
von Stevan Harnad
Antwort an American Scientist Open Access Forum
Datum 5. April 2008 16:56
Betreff Re: Fwd: Bentham Science Publishers (fwd)
Date: Sat, 5 Apr 2008 09:31:07 -0500
From: [deleted]
Subject: Re: Fwd: Bentham Science Publishers
I don't know if this is relevant but it sounds like it might be. This email is
several weeks old:
>From Scope Knowledge today:
Wiley-Blackwell, the STM and scholarly publishing business of John Wiley
& Sons, Inc., US, and STM publisher Elsevier, Netherlands, have alerted
authors against an e-mail spam through their respective websites.
An e-mail message, circulated last week, sought manuscript submissions
for peer-reviewed journals and claimed to come from Blackwell
Publishing. It called for articles 'in all fields of human endeavor,'
and said that the editors would decide on which journal it should appear
in. The message, which came from a gmail.com address, requested
manuscripts be sent to someone at live.com.
A similar message was circulated a few months ago asking for manuscripts
for Elsevier journals. People who responded to the message were asked to
send money for a handling fee. An investigation conducted by Elsevier
traced the e-mail to an Internet cafe in Nigeria. In response to the
Elsevier scam, the International Association of Science, Technical and
Medical Publishers also placed a warning on its website.
Wendy
Dr. Wendy A. Warr
Wendy Warr & Associates
6 Berwick Court, Holmes Chapel
Cheshire, CW4 7HZ, England
Tel./fax +44 (0)1477 533837
wendy -- warr.com http://www.warr.com
---------- Forwarded message ----------
Date: Sat, 5 Apr 2008 11:23:18 +0100
From: Richard Poynder
To: AMERICAN-SCIENTIST-OPEN-ACCESS-FORUM -- LISTSERVER.SIGMAXI.ORG
Subject: Bentham Science Publishers
Dear All,
I would be grateful if anyone could help me. I am interested in an Open
Access publisher called Bentham Science Publishers
(http://www.bentham.org/). I have been contacted by a number of researchers
who say that the company is bombarding them with invitations to contribute
papers to its journals. Apparently requests by the recipients to remove them
from Bentham's mailing list have little or no effect.
I have tried to make contact with a number of people in the company
including Richard Scott, who is most often the person whose name appears at
the bottom of the invitation letters, and was until recently listed as the
editorial director of the company on its web site
(http://www.bentham.org/Contact.php). I also copied into my emails Bentham's
US contact Richard Morrissey, and Matthew Honan, who earlier this year was
also described as the company's editorial director
(http://www.earlham.edu/~peters/fos/2008/01/bentham-oa-publishing-program.html).
Likewise I copied in Professor Thomas Salt, since he too has signed
some of the offending emails in his capacity as Editor-in-Chief of a Bentham
journal called Current Neuropharmacology. Tom Salt appears to be based in
the Department of Visual Science at the Institute of Ophthalmology in
London.
Despite all my attempts to make email contact with the company and its
representatives, however, the only response I have received has come from
someone called Mahmood Alam who seems to be based in Pakistan. He informed
me that Richard Scott was too busy to speak with me, but invited me to email
my questions to him. After I sent some questions through to Mahmood Alam,
however, he failed to answer them.
I have also tried calling the telephone numbers listed on the Bentham web
site, but have only been able to get through to voice mail messages. The
number listed for Richard Morrissey simply invites callers to email him (the
address given is the one that I have failed to get any response from).
I would be most grateful if anyone who has any knowledge of Bentham, or any
experience of publishing with the company, or editing any of its journals,
or anyone who regularly reads any of the Bentham journals, could contact me
on: richardpoynder1 -- o2.co.uk.
Thank you.
Richard Poynder
www.richardpoynder.co.uk
http://www.bentham.org/open macht keinen guten Eindruck, wenn man die Editorial Boards durchschaut. Längst nicht alle der Zeitschriften haben einen geschäftsführenden Herausgeber, und bei diesem fehlen jegliche Kontaktdaten. Beim Herausgeber von "The Open Paleontology Journal" steht nur France, es ist offenbar ein ehemaliger Esso-Mitarbeiter. Immerhin trägt er einen Vornamen, während beim Editorial Advisory Board lediglich Initialen stehen (auch hier keine Institutionen nur das Land). Mit den Namen kann man also nur wenig anfangen. Seriöse Zeitschriften geben den vollen Namen und die Institution an.
Das ist auch der Fall bei Subscription-based Bentham-Journals z.B.
http://www.bentham.org/cn/EBM.htm
Inwieweit der anonyme Peer-Review-Prozess funktionierte, kann man von außen nicht beurteilen (nur das Resultat in Form der akzeptierten Artikel).
Zur Bewertung von Peer-Review-Zeitschriften aus Autorensicht siehe
http://www.cerge-ei.cz/multiversity/jfeedback/
Besonders unterhaltsam dort auf der Links-Seite ein Mailwechsel, bei der ein Autor gebeten wurde, seinen eigenen Artikel zu begutachten.
Update:
http://medinfo.netbib.de/archives/2008/04/25/2573
http://poynder.blogspot.com/2008/04/open-access-interviews-matthew-honan.html
http://www.earlham.edu/~peters/fos/2008/04/some-background-on-bentham-open-but.html
Bentham Ltd. ist eine dubiose Firma nach dem Recht der Vereinigten Arabischen Emirate, deren Eigentumsverhältnisse nicht transparent sind.
[#beall]
http://archiv.twoday.net/stories/4828444/
Nun gibt es eine Frage zu Bentham Open in Harnads Liste.
von Stevan Harnad
Antwort an American Scientist Open Access Forum
Datum 5. April 2008 16:56
Betreff Re: Fwd: Bentham Science Publishers (fwd)
Date: Sat, 5 Apr 2008 09:31:07 -0500
From: [deleted]
Subject: Re: Fwd: Bentham Science Publishers
I don't know if this is relevant but it sounds like it might be. This email is
several weeks old:
>From Scope Knowledge today:
Wiley-Blackwell, the STM and scholarly publishing business of John Wiley
& Sons, Inc., US, and STM publisher Elsevier, Netherlands, have alerted
authors against an e-mail spam through their respective websites.
An e-mail message, circulated last week, sought manuscript submissions
for peer-reviewed journals and claimed to come from Blackwell
Publishing. It called for articles 'in all fields of human endeavor,'
and said that the editors would decide on which journal it should appear
in. The message, which came from a gmail.com address, requested
manuscripts be sent to someone at live.com.
A similar message was circulated a few months ago asking for manuscripts
for Elsevier journals. People who responded to the message were asked to
send money for a handling fee. An investigation conducted by Elsevier
traced the e-mail to an Internet cafe in Nigeria. In response to the
Elsevier scam, the International Association of Science, Technical and
Medical Publishers also placed a warning on its website.
Wendy
Dr. Wendy A. Warr
Wendy Warr & Associates
6 Berwick Court, Holmes Chapel
Cheshire, CW4 7HZ, England
Tel./fax +44 (0)1477 533837
wendy -- warr.com http://www.warr.com
---------- Forwarded message ----------
Date: Sat, 5 Apr 2008 11:23:18 +0100
From: Richard Poynder
To: AMERICAN-SCIENTIST-OPEN-ACCESS-FORUM -- LISTSERVER.SIGMAXI.ORG
Subject: Bentham Science Publishers
Dear All,
I would be grateful if anyone could help me. I am interested in an Open
Access publisher called Bentham Science Publishers
(http://www.bentham.org/). I have been contacted by a number of researchers
who say that the company is bombarding them with invitations to contribute
papers to its journals. Apparently requests by the recipients to remove them
from Bentham's mailing list have little or no effect.
I have tried to make contact with a number of people in the company
including Richard Scott, who is most often the person whose name appears at
the bottom of the invitation letters, and was until recently listed as the
editorial director of the company on its web site
(http://www.bentham.org/Contact.php). I also copied into my emails Bentham's
US contact Richard Morrissey, and Matthew Honan, who earlier this year was
also described as the company's editorial director
(http://www.earlham.edu/~peters/fos/2008/01/bentham-oa-publishing-program.html).
Likewise I copied in Professor Thomas Salt, since he too has signed
some of the offending emails in his capacity as Editor-in-Chief of a Bentham
journal called Current Neuropharmacology. Tom Salt appears to be based in
the Department of Visual Science at the Institute of Ophthalmology in
London.
Despite all my attempts to make email contact with the company and its
representatives, however, the only response I have received has come from
someone called Mahmood Alam who seems to be based in Pakistan. He informed
me that Richard Scott was too busy to speak with me, but invited me to email
my questions to him. After I sent some questions through to Mahmood Alam,
however, he failed to answer them.
I have also tried calling the telephone numbers listed on the Bentham web
site, but have only been able to get through to voice mail messages. The
number listed for Richard Morrissey simply invites callers to email him (the
address given is the one that I have failed to get any response from).
I would be most grateful if anyone who has any knowledge of Bentham, or any
experience of publishing with the company, or editing any of its journals,
or anyone who regularly reads any of the Bentham journals, could contact me
on: richardpoynder1 -- o2.co.uk.
Thank you.
Richard Poynder
www.richardpoynder.co.uk
http://www.bentham.org/open macht keinen guten Eindruck, wenn man die Editorial Boards durchschaut. Längst nicht alle der Zeitschriften haben einen geschäftsführenden Herausgeber, und bei diesem fehlen jegliche Kontaktdaten. Beim Herausgeber von "The Open Paleontology Journal" steht nur France, es ist offenbar ein ehemaliger Esso-Mitarbeiter. Immerhin trägt er einen Vornamen, während beim Editorial Advisory Board lediglich Initialen stehen (auch hier keine Institutionen nur das Land). Mit den Namen kann man also nur wenig anfangen. Seriöse Zeitschriften geben den vollen Namen und die Institution an.
Das ist auch der Fall bei Subscription-based Bentham-Journals z.B.
http://www.bentham.org/cn/EBM.htm
Inwieweit der anonyme Peer-Review-Prozess funktionierte, kann man von außen nicht beurteilen (nur das Resultat in Form der akzeptierten Artikel).
Zur Bewertung von Peer-Review-Zeitschriften aus Autorensicht siehe
http://www.cerge-ei.cz/multiversity/jfeedback/
Besonders unterhaltsam dort auf der Links-Seite ein Mailwechsel, bei der ein Autor gebeten wurde, seinen eigenen Artikel zu begutachten.
Update:
http://medinfo.netbib.de/archives/2008/04/25/2573
http://poynder.blogspot.com/2008/04/open-access-interviews-matthew-honan.html
http://www.earlham.edu/~peters/fos/2008/04/some-background-on-bentham-open-but.html
Bentham Ltd. ist eine dubiose Firma nach dem Recht der Vereinigten Arabischen Emirate, deren Eigentumsverhältnisse nicht transparent sind.
[#beall]
KlausGraf - am Samstag, 5. April 2008, 17:13 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ... Ganz im Gegensatz zu den nachfolgenden Bildserien mit den wohlvertrauten, lebensfrohen Quietschtiermotiven, die uns in ihrer Farbigkeit aus der Leinwand entgegenzuspringen scheinen, oder einfach nur anglotzen. Poppige Motive aus der Welt der Kinderspielzeuge, der Welt der Plastikcowboys, Dinosaurier, Schweinchen und Schmusepüppchen. Ein Kindheitstraum, der kein Ende findet, ein kleines privates Disneyworld, ein Idyll im Hosentaschenformat. Diesem Bildschaffen liegt eine besondere Sammelleidenschaft zugrunde, die sich auf alle Arten von Plastikspielzeugfigürchen konzentriert. Daraus entstand ein ganzes Archiv, das jedes Kleinkind vor Neid erblassen lassen könnte. Aus diesem Archiv rekrutiert er, mit fachmännischem Blick, seine Bildfiguren. ...."
Quelle:
http://www.im-salzkammergut.at/salzkammergut/alle_themen/artikel-lesen/frmArticleID/3312/
Quelle:
http://www.im-salzkammergut.at/salzkammergut/alle_themen/artikel-lesen/frmArticleID/3312/
Wolf Thomas - am Samstag, 5. April 2008, 15:41 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... In einem Malkurs mit Erdfarben zeigt Roswitha Schlecker, Leiterin des Stadtarchivs Hofheim, den Teilnehmern, was bei der Anfertigung einer Skizze wichtig ist. ...."
Quelle:
http://www.wiesbadener-kurier.de/region/objekt.php3?artikel_id=3229102
Quelle:
http://www.wiesbadener-kurier.de/region/objekt.php3?artikel_id=3229102
Wolf Thomas - am Samstag, 5. April 2008, 15:39 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Mit einem neuen Angebot will der Bamberger Verleger Lothar Schmid den seit vier Jahren schwelenden Streit um den Verkauf seines umfangreichen Karl-May-Archivs beenden. Er schlägt in einem Brief an die sächsische Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) und die Radebeuler Karl-May-Gesellschaft eine Halbierung des Archivs vor. ....
Zudem habe er dem Freistaat eine Ratenzahlung vorgeschlagen. Dieses Angebot, nach dem Sachsen zunächst nur eine Hälfte des Archivs kauft und für die andere eine Option erhält, bewertet Schmid als guten Weg, das Archiv für die wissenschaftliche Forschung und die Öffentlichkeit zu erhalten. "
Quelle:
http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/REGIONALES/1264712.html
Archivalia hat bereits berichtet:
http://archiv.twoday.net/stories/4830321/
http://archiv.twoday.net/stories/4806734/
Zudem habe er dem Freistaat eine Ratenzahlung vorgeschlagen. Dieses Angebot, nach dem Sachsen zunächst nur eine Hälfte des Archivs kauft und für die andere eine Option erhält, bewertet Schmid als guten Weg, das Archiv für die wissenschaftliche Forschung und die Öffentlichkeit zu erhalten. "
Quelle:
http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/REGIONALES/1264712.html
Archivalia hat bereits berichtet:
http://archiv.twoday.net/stories/4830321/
http://archiv.twoday.net/stories/4806734/
Wolf Thomas - am Samstag, 5. April 2008, 15:36 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" Das Archiv besteht seit 1992. Es ist eine Einrichtung der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein.
Es kooperiert mit dem Landesarchiv in Schleswig und befindet sich in dessen Räumen im Prinzenpalais. Die inventarisierten Unterlagen können über Kataloge im Lesesaal des Landesarchives bestellt und dort eingesehen werden.
Unser Ziel ist es, bedeutende Beiträge zur Baukultur des Landes zu sichern und für Forschungen und Publikationen zugänglich zu machen. Daneben bauen wir eine Fachbibliothek, um wichtige Veröffentlichungen anbieten zu können.
.....
Den Grundstock der stetig anwachsenden Sammlung bilden zahlreiche Bestände mit dem Werk einzelner ArchitektInnen. Zu den bedeutendsten und zugleich auch umfangreichsten gehören die Arbeiten von Ernst Prinz, Harry Maasz, Klaus Groth und Alfred Schulze mit jeweils mehreren tausend Plänen, Skizzen, Fotos und Modellen.
Daneben sind zahlreiche weitere, kleinere Bestände vorhanden - vom Schwerpunkte der Sammlung ist zur Zeit noch die hochklassige Heimatschutz- Architektur der 20er und 30er Jahre aber vereinzelt finden sich auch Zeugnisse der hier ohnehin raren und eher moderaten Moderne aus derselben Zeit. Ähnliches gilt für die Jahre des Wiederaufbaus nach 1945; diese Dokumente kommen jetzt - nicht zuletzt durch den Generationswechsel bedingt - in größerem Umfang zu uns und werden dazu beitragen, den Blick auf die von vielen Klischees umstellten Aufbaujahre und ihre architektonischen und städtebaulichen Leitbilder zu schärfen und Qualitäten zu entdecken. Herausragendes Beispiel und wichtigstes städtebauliches wie architektonisches Ensemble dieser Zeit in Schleswig-Holstein ist das Neue Helgoland, dessen Entstehungsgeschichte das AAI dank jüngster nahezu lückenlos dokumentieren kann. ..."
Quelle:
http://www.aai.rulz.de/
Es kooperiert mit dem Landesarchiv in Schleswig und befindet sich in dessen Räumen im Prinzenpalais. Die inventarisierten Unterlagen können über Kataloge im Lesesaal des Landesarchives bestellt und dort eingesehen werden.
Unser Ziel ist es, bedeutende Beiträge zur Baukultur des Landes zu sichern und für Forschungen und Publikationen zugänglich zu machen. Daneben bauen wir eine Fachbibliothek, um wichtige Veröffentlichungen anbieten zu können.
.....
Den Grundstock der stetig anwachsenden Sammlung bilden zahlreiche Bestände mit dem Werk einzelner ArchitektInnen. Zu den bedeutendsten und zugleich auch umfangreichsten gehören die Arbeiten von Ernst Prinz, Harry Maasz, Klaus Groth und Alfred Schulze mit jeweils mehreren tausend Plänen, Skizzen, Fotos und Modellen.
Daneben sind zahlreiche weitere, kleinere Bestände vorhanden - vom Schwerpunkte der Sammlung ist zur Zeit noch die hochklassige Heimatschutz- Architektur der 20er und 30er Jahre aber vereinzelt finden sich auch Zeugnisse der hier ohnehin raren und eher moderaten Moderne aus derselben Zeit. Ähnliches gilt für die Jahre des Wiederaufbaus nach 1945; diese Dokumente kommen jetzt - nicht zuletzt durch den Generationswechsel bedingt - in größerem Umfang zu uns und werden dazu beitragen, den Blick auf die von vielen Klischees umstellten Aufbaujahre und ihre architektonischen und städtebaulichen Leitbilder zu schärfen und Qualitäten zu entdecken. Herausragendes Beispiel und wichtigstes städtebauliches wie architektonisches Ensemble dieser Zeit in Schleswig-Holstein ist das Neue Helgoland, dessen Entstehungsgeschichte das AAI dank jüngster nahezu lückenlos dokumentieren kann. ..."
Quelle:
http://www.aai.rulz.de/
Wolf Thomas - am Samstag, 5. April 2008, 15:34 - Rubrik: Architekturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein reibungsloses Funktionieren des RSS-Feeds bei Bloglines schaffen zwar alle möglichen obskuren Anbieter reibungslos, aber deutsche Digitalisierungsprojekte beschäftigen wohl besondere Stümper. Bis man gemerkt hat, dass der Feed tot ist, ist viel Interessantes unregistriert vorbeigerauscht.
http://digital.slub-dresden.de/sammlungen/kollektionen/projekt-deutschsprachige-mittelalterliche-handschriften/
http://digital.slub-dresden.de/sammlungen/kollektionen/projekt-deutschsprachige-mittelalterliche-handschriften/
KlausGraf - am Samstag, 5. April 2008, 03:23 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Im Rahmen meiner Serie zum Professorenentwurf für ein neues Bundesarchivgesetz
http://archiv.twoday.net/stories/4838980/
wende ich mich § 18 (Ablieferung von Belegexemplaren) Absatz 2 vor. Der Vorschlag lautet:
Die in § 6 Abs. 1 genannten Stellen sind verpflichtet, dem Bundesarchiv ein Exemplar der von ihnen herausgegeben oder in ihrem Auftrag erschienenen Druckschriften und anderen Veröffentlichungen zur Übernahme anzubieten.
Die Begründung (S. 222f., 225) geht vor allem auf den Absatz 1 (Benutzerbelegexemplar) ein, zu Absatz 2 wird lediglich ausgeführt, dass es Parallelen im Archivrecht einiger Länder gibt, dass die Bestimmung nach den Erfahrungen der Staatsarchive notwendig sei, da sonst die Archive die Druckschriften nicht vollzählig erhielten und dass es sich - eine Formulierung aus einer Bremischen Landtagsdrucksache aufgreifend - regelmäßig um besonders wichtige Unterlagen handle, die schon im Vorfeld der Anbietung normaler Unterlagen bereits nach dem Erscheinen den Archiven anzubieten seien.
Diese kursorischen Bemerkungen schürfen ganz an der Oberfläche des Problems. Archivare sprechen von Amtsdrucksachen oder Amtsdruckschriften, Bibliothekare überwiegend von Amtsdruckschriften.
Es mag ja sein, dass Archivare eine solche Ablieferungspflicht für nützlich halten, aber von Informationsrechtlern erwarte ich eine strikte Kontextualisierung im Rahmen eines "Informationsgesetzbuches", die sich die Frage stellt, ob Archive oder Bibliotheken oder womöglich beide diese Schriften für die Nachwelt sammeln sollen und ob dafür eine gesetzliche Grundlage sinnvoll ist. Ohne Bibliotheksrecht kann man hier kein Archivrecht betreiben!
Als bibliothekarisches Portal zu diesem Thema ist zu nennen:
http://amtsdruckschriften.staatsbibliothek-berlin.de/
Dort erfährt man auch, dass die Ablieferung der amtlichen Druckschriften des Bundes durch einen Erlass aus dem Jahr 1958 (Text ebenda) geregelt ist und einige Bibliotheken als Amtsdrucksachen-Pflichtexemplar-Bibliotheken genannt werden.
Zu landesrechtlichen Vorschriften verweise ich auf einige Notizen im Weblog des Bibliotheksjuristen Steinhauer:
http://www.bibliotheksrecht.de/?tag=amtsdruckschriften
Alle entscheidenden Fragen lässt der Regelungsvorschlag daher offen:
* Wie sind bibliothekarische und archivarische Interessen an amtlichen Drucksachen und anderen Veröffentlichungen (Websites?) abzugrenzen?
* Wäre es sinnvoll, den Amtsdrucksachenerlass des Bundes auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen (und folgerichtig neben den bedachten Bibliotheken auch das Bundesarchiv als Pflichtexemplarstelle zu verankern)?
* Wäre es sinnvoll, ein digitales Informationssystem des Bundes zu schaffen (siehe auch für die USA http://www.gpoaccess.gov/ ), wobei hinsichtlich der Archivierung der veralteten Dokumente die Deutsche Nationalbibliothek ("Digitales Pflichtexemplar") und nicht das Bundesarchiv ins Spiel käme?
In diesem digitalen Informationssystem würde die gesamte Öffentlichkeitsarbeit aller Bundesbehörden den Bürgern "Open Access" angeboten.
* Sollte man nicht liberale Nachnutzungsmöglichkeiten der öffentlichen Informationen (in den USA sind ja die Werke der Bediensteten des Federal Government vom Urheberrechtsschutz gänzlich ausgenommen) schaffen? Zur Problematik des Informationsweiterverwendungsgesetzes siehe
http://archiv.twoday.net/stories/3095107/
Bevor diese Fragen nicht beantwortet und erörtert sind, ist es nicht sinnvoll, ein Amtsdruckschriftenbelegexemplar in das Bundesarchivgesetz aufzunehmen. Die Autoren des ProfE hätten die Aufgabe gehabt, einer bornierten Selbstgenügsamkeit auszuweichen, die nur die Wünsche der Archive sieht, sich aber einer größeren Einordnung in informationsrechtliche Fragen verweigert.
(Abgesehen davon, dass man sicher auch archivische Sekundärliteratur zu Amtsdrucksachen anführen könnte, die von den Verfassern hätte gesichtet werden müssen und sei es nur der in der Archivwissenschaftlichen Bibliographie auf der Website der Archivschule Marburg nachgewiesene Titel aus der den Verfassern durchaus bekannten Festschrift für Kahlenberg 2000: Dolatowski,
Das Bemühen um Amtsdruckschriften als bleibende Herausforderung)
http://archiv.twoday.net/stories/4838980/
wende ich mich § 18 (Ablieferung von Belegexemplaren) Absatz 2 vor. Der Vorschlag lautet:
Die in § 6 Abs. 1 genannten Stellen sind verpflichtet, dem Bundesarchiv ein Exemplar der von ihnen herausgegeben oder in ihrem Auftrag erschienenen Druckschriften und anderen Veröffentlichungen zur Übernahme anzubieten.
Die Begründung (S. 222f., 225) geht vor allem auf den Absatz 1 (Benutzerbelegexemplar) ein, zu Absatz 2 wird lediglich ausgeführt, dass es Parallelen im Archivrecht einiger Länder gibt, dass die Bestimmung nach den Erfahrungen der Staatsarchive notwendig sei, da sonst die Archive die Druckschriften nicht vollzählig erhielten und dass es sich - eine Formulierung aus einer Bremischen Landtagsdrucksache aufgreifend - regelmäßig um besonders wichtige Unterlagen handle, die schon im Vorfeld der Anbietung normaler Unterlagen bereits nach dem Erscheinen den Archiven anzubieten seien.
Diese kursorischen Bemerkungen schürfen ganz an der Oberfläche des Problems. Archivare sprechen von Amtsdrucksachen oder Amtsdruckschriften, Bibliothekare überwiegend von Amtsdruckschriften.
Es mag ja sein, dass Archivare eine solche Ablieferungspflicht für nützlich halten, aber von Informationsrechtlern erwarte ich eine strikte Kontextualisierung im Rahmen eines "Informationsgesetzbuches", die sich die Frage stellt, ob Archive oder Bibliotheken oder womöglich beide diese Schriften für die Nachwelt sammeln sollen und ob dafür eine gesetzliche Grundlage sinnvoll ist. Ohne Bibliotheksrecht kann man hier kein Archivrecht betreiben!
Als bibliothekarisches Portal zu diesem Thema ist zu nennen:
http://amtsdruckschriften.staatsbibliothek-berlin.de/
Dort erfährt man auch, dass die Ablieferung der amtlichen Druckschriften des Bundes durch einen Erlass aus dem Jahr 1958 (Text ebenda) geregelt ist und einige Bibliotheken als Amtsdrucksachen-Pflichtexemplar-Bibliotheken genannt werden.
Zu landesrechtlichen Vorschriften verweise ich auf einige Notizen im Weblog des Bibliotheksjuristen Steinhauer:
http://www.bibliotheksrecht.de/?tag=amtsdruckschriften
Alle entscheidenden Fragen lässt der Regelungsvorschlag daher offen:
* Wie sind bibliothekarische und archivarische Interessen an amtlichen Drucksachen und anderen Veröffentlichungen (Websites?) abzugrenzen?
* Wäre es sinnvoll, den Amtsdrucksachenerlass des Bundes auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen (und folgerichtig neben den bedachten Bibliotheken auch das Bundesarchiv als Pflichtexemplarstelle zu verankern)?
* Wäre es sinnvoll, ein digitales Informationssystem des Bundes zu schaffen (siehe auch für die USA http://www.gpoaccess.gov/ ), wobei hinsichtlich der Archivierung der veralteten Dokumente die Deutsche Nationalbibliothek ("Digitales Pflichtexemplar") und nicht das Bundesarchiv ins Spiel käme?
In diesem digitalen Informationssystem würde die gesamte Öffentlichkeitsarbeit aller Bundesbehörden den Bürgern "Open Access" angeboten.
* Sollte man nicht liberale Nachnutzungsmöglichkeiten der öffentlichen Informationen (in den USA sind ja die Werke der Bediensteten des Federal Government vom Urheberrechtsschutz gänzlich ausgenommen) schaffen? Zur Problematik des Informationsweiterverwendungsgesetzes siehe
http://archiv.twoday.net/stories/3095107/
Bevor diese Fragen nicht beantwortet und erörtert sind, ist es nicht sinnvoll, ein Amtsdruckschriftenbelegexemplar in das Bundesarchivgesetz aufzunehmen. Die Autoren des ProfE hätten die Aufgabe gehabt, einer bornierten Selbstgenügsamkeit auszuweichen, die nur die Wünsche der Archive sieht, sich aber einer größeren Einordnung in informationsrechtliche Fragen verweigert.
(Abgesehen davon, dass man sicher auch archivische Sekundärliteratur zu Amtsdrucksachen anführen könnte, die von den Verfassern hätte gesichtet werden müssen und sei es nur der in der Archivwissenschaftlichen Bibliographie auf der Website der Archivschule Marburg nachgewiesene Titel aus der den Verfassern durchaus bekannten Festschrift für Kahlenberg 2000: Dolatowski,
Das Bemühen um Amtsdruckschriften als bleibende Herausforderung)
KlausGraf - am Freitag, 4. April 2008, 22:16 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Friedrich Schoch/Michael Kloepfer/Hansjürgen Garstka: Archivgesetz. Entwurf eines Archivgesetzes des Bundes (= Beiträge zum Informationsrecht Bd. 21), Berlin: Duncker & Humblot 2007. 439 S. 98 Euro (Das zu teure Buch lag mir - anders als andere hier angezeigte Werke - zunächst NICHT zur Besprechung vor. Nachträglich hat der Verlag mir auf meine Bitte hin ein Besprechungsexemplar zugesandt.)
Drei renommierte Rechtsprofessoren legen damit den Entwurf für ein vollständig überarbeitetes Bundesarchivgesetz vor.
Der Verwaltungsrechtler Schoch (Freiburg i.Br.) ist Vorsitzender der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Kloepfer ist Staats- und Verwaltungsrechtler an der Humboldt-Universität in Berlin, Garstka, lange Jahre Datenschutzbeauftragter des Landes Berlin, lehrt an der TU Berlin. (Zu allen drei siehe auch die Wikipedia.)
Der Vorschlag wird sehr ausführlich und sachkundig begründet. Die Autoren haben sich - soweit das Außenstehende überhaupt können - in die Materie des Archivrechts eingearbeitet und ein Standardwerk zu diesem Thema vorgelegt. Ihr Text geht bis S. 237, der Rest ist Abdruck des Bundesarchivgesetzes und der Landesarchivgesetzes zweier europäischer Verordnungen sowie des IFG (sammt IFG-ProfE). Angesichts der Online-Verfügbarkeit wohl der meisten dieser Normen hätte man im Interesse einer wohlfeileren Ausgabe darauf verzichten können. Überhaupt existiert das Internet für die Autoren so gut wie nicht, das Literaturverzeichnis weist keine Online-Ressource auf.
Generell stehen die Autoren für eine begrüßenswerte Liberalisierung der Archivbenutzung. Nur bei Archivgut, das besonderen Geheimhaltungsvorschriften unterlag, kommt bei ihnen die dreißigjährige Schutzfrist zum Tragen. Bei personenbezogenem Archivgut reichen den Autoren 10 Jahre nach dem Tod (bzw. 110 Jahre nach der Geburt) aus.
Neu ist der § 7, der den Zugriff auf die Unterlagen von Privatpersonen ermöglicht, sofern diese gesamtstaatliche Bedeutung haben und überwiegende private Belange nicht entgegenstehen.
Der Hamburger Stadtsiegelfall hat Spuren im § 10 Abs. 7 hinterlassen, das Archivgut zu öffentlichem Eigentum erklärt, auf das entgegenstehende Vorschriften des BGB nicht angewendet werden.
Unverständlicherweise hat man einen § 18 über die Ablieferung von Belegexemplaren eingefügt.
Auf die hier immer wieder traktierte Bildrechte-Problematik geht der § 19 zur Benutzungs- und Gebührenordnung nicht ein; überhaupt vermisst man eine Reflexion der urheberrechtlichen Problematik.
Ich werde detaillierter auf einzelne Vorschläge in künftigen Einträgen (siehe Liste unten) eingehen. Wer archivrechtlich interessiert ist, wird nicht umhin kommen, dieses Buch zur Kenntnis zu nehmen.
(2) Amtsdruckschriften
http://archiv.twoday.net/stories/4839104/
(3) Zugriff auf privates Archivgut
http://archiv.twoday.net/stories/4848784/
(4) Archivwürdigkeit
http://archiv.twoday.net/stories/4872537/
(5) Öffentliches Eigentum am Archivgut
http://archiv.twoday.net/stories/4889840/
(6) Belegexemplar als Pflicht
http://archiv.twoday.net/stories/4898706/
(7) Bundesrechtliche Geheimhaltungsvorschriften
http://archiv.twoday.net/stories/4904278/
(8) Benutzungs- und Gebührenordnung
http://archiv.twoday.net/stories/4939537/
(9) Sonderarchive
http://archiv.twoday.net/stories/4945454/
(10) SAPMO
http://archiv.twoday.net/stories/4969431/
Update: Steinhauer über das Buch http://archiv.twoday.net/stories/5749390/
Besprechung ZRG GA
http://archiv.twoday.net/stories/75224768/
Drei renommierte Rechtsprofessoren legen damit den Entwurf für ein vollständig überarbeitetes Bundesarchivgesetz vor.
Der Verwaltungsrechtler Schoch (Freiburg i.Br.) ist Vorsitzender der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Kloepfer ist Staats- und Verwaltungsrechtler an der Humboldt-Universität in Berlin, Garstka, lange Jahre Datenschutzbeauftragter des Landes Berlin, lehrt an der TU Berlin. (Zu allen drei siehe auch die Wikipedia.)
Der Vorschlag wird sehr ausführlich und sachkundig begründet. Die Autoren haben sich - soweit das Außenstehende überhaupt können - in die Materie des Archivrechts eingearbeitet und ein Standardwerk zu diesem Thema vorgelegt. Ihr Text geht bis S. 237, der Rest ist Abdruck des Bundesarchivgesetzes und der Landesarchivgesetzes zweier europäischer Verordnungen sowie des IFG (sammt IFG-ProfE). Angesichts der Online-Verfügbarkeit wohl der meisten dieser Normen hätte man im Interesse einer wohlfeileren Ausgabe darauf verzichten können. Überhaupt existiert das Internet für die Autoren so gut wie nicht, das Literaturverzeichnis weist keine Online-Ressource auf.
Generell stehen die Autoren für eine begrüßenswerte Liberalisierung der Archivbenutzung. Nur bei Archivgut, das besonderen Geheimhaltungsvorschriften unterlag, kommt bei ihnen die dreißigjährige Schutzfrist zum Tragen. Bei personenbezogenem Archivgut reichen den Autoren 10 Jahre nach dem Tod (bzw. 110 Jahre nach der Geburt) aus.
Neu ist der § 7, der den Zugriff auf die Unterlagen von Privatpersonen ermöglicht, sofern diese gesamtstaatliche Bedeutung haben und überwiegende private Belange nicht entgegenstehen.
Der Hamburger Stadtsiegelfall hat Spuren im § 10 Abs. 7 hinterlassen, das Archivgut zu öffentlichem Eigentum erklärt, auf das entgegenstehende Vorschriften des BGB nicht angewendet werden.
Unverständlicherweise hat man einen § 18 über die Ablieferung von Belegexemplaren eingefügt.
Auf die hier immer wieder traktierte Bildrechte-Problematik geht der § 19 zur Benutzungs- und Gebührenordnung nicht ein; überhaupt vermisst man eine Reflexion der urheberrechtlichen Problematik.
Ich werde detaillierter auf einzelne Vorschläge in künftigen Einträgen (siehe Liste unten) eingehen. Wer archivrechtlich interessiert ist, wird nicht umhin kommen, dieses Buch zur Kenntnis zu nehmen.
(2) Amtsdruckschriften
http://archiv.twoday.net/stories/4839104/
(3) Zugriff auf privates Archivgut
http://archiv.twoday.net/stories/4848784/
(4) Archivwürdigkeit
http://archiv.twoday.net/stories/4872537/
(5) Öffentliches Eigentum am Archivgut
http://archiv.twoday.net/stories/4889840/
(6) Belegexemplar als Pflicht
http://archiv.twoday.net/stories/4898706/
(7) Bundesrechtliche Geheimhaltungsvorschriften
http://archiv.twoday.net/stories/4904278/
(8) Benutzungs- und Gebührenordnung
http://archiv.twoday.net/stories/4939537/
(9) Sonderarchive
http://archiv.twoday.net/stories/4945454/
(10) SAPMO
http://archiv.twoday.net/stories/4969431/
Update: Steinhauer über das Buch http://archiv.twoday.net/stories/5749390/
Besprechung ZRG GA
http://archiv.twoday.net/stories/75224768/
KlausGraf - am Freitag, 4. April 2008, 21:35 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 4. April 2008, 20:41 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolfgang Runschke: Web-Rezension zu: Fachdatenbank Buchwissenschaft. In: H-Soz-u-Kult, 05.04.2008, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/id=145&type=rezwww
http://www.buchwissenschaft.info/
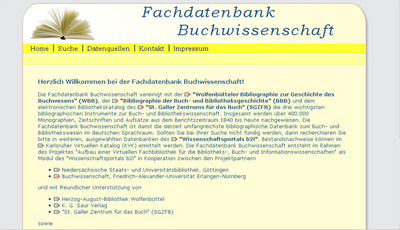
http://www.buchwissenschaft.info/
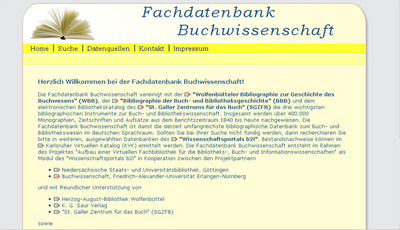
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.librarian.net/stax/2273/updatefilter-bpls-evolving-online-collection/
http://www.flickr.com/photos/boston_public_library/

http://www.flickr.com/photos/boston_public_library/

KlausGraf - am Freitag, 4. April 2008, 20:27 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://medinfo.netbib.de/archives/2008/04/04/2548
http://weblogs.elearning.ubc.ca/googlescholar/archives/045760.html

http://weblogs.elearning.ubc.ca/googlescholar/archives/045760.html
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wie ich im Kommentar zu
http://infobib.de/blog/2008/04/04/international-directory-of-art-libraries/
ausgeführt habe, empfand ich diese Linksammlung bereits 2004 als verwahrlost. Gisela Holzüter (!, recte: Holzhüter) ist dort nach wie vor die Bibliothekarin der Donaueschinger Hofbibliothek mit angeblich 130.000 Bänden (1999 ff. verscherbelt bis auf einen kleinen Rest im Archiv, der immer noch als Hofbibliothek firmiert).
Über die OPACs der wichtigsten Kunstbibliotheken informiert die auch nicht mehr ganz aktuelle Seite:
http://wiki.netbib.de/coma/KunstBibliotheken
http://infobib.de/blog/2008/04/04/international-directory-of-art-libraries/
ausgeführt habe, empfand ich diese Linksammlung bereits 2004 als verwahrlost. Gisela Holzüter (!, recte: Holzhüter) ist dort nach wie vor die Bibliothekarin der Donaueschinger Hofbibliothek mit angeblich 130.000 Bänden (1999 ff. verscherbelt bis auf einen kleinen Rest im Archiv, der immer noch als Hofbibliothek firmiert).
Über die OPACs der wichtigsten Kunstbibliotheken informiert die auch nicht mehr ganz aktuelle Seite:
http://wiki.netbib.de/coma/KunstBibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Wie kann man Zeit in ein künstlerisches Archiv bannen? Was nehmen wir vom tagesaktuellen Geschehen selektiv wahr? Was bleibt in unserer Erinnerung? Um diese Fragen kreist die Schau der in Mainz arbeitenden Sandra Heinz im Wiesbadener Kunsthaus ...."
Quelle:
Allgemeine Zeitung, 04.04.2008
Quelle:
Allgemeine Zeitung, 04.04.2008
Wolf Thomas - am Freitag, 4. April 2008, 19:14 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Fast unbeachtet schlummerte über sechzig Jahre lang in einem alten Militärfort bei Paris ein riesiges Fotoarchiv der Wehrmacht. Wie es nach der Befreiung Frankreichs dahin kam, weiß niemand mehr.
Klar ist, dass in den Kasematten der Festung 347.000 Bilder lagern, die von Reportern der Propagandakompanien der Wehrmacht geschossen wurden - und noch auf Jahre hinaus Stoff für Historiker liefern dürften.
.....«Aus Furcht vor Missverständnissen», wie die Archiv-Beauftragte Violaine Challéat sagt. «Man wollte nicht zuviel darüber reden, dass die französische Armee Wehrmachtsbilder aufbewahrt, auf denen zuweilen Hakenkreuze zu sehen sind.» ....." Hä ? Haben wir nicht 2008 ?
Quelle:
Der Westen, 04.04.2008
Klar ist, dass in den Kasematten der Festung 347.000 Bilder lagern, die von Reportern der Propagandakompanien der Wehrmacht geschossen wurden - und noch auf Jahre hinaus Stoff für Historiker liefern dürften.
.....«Aus Furcht vor Missverständnissen», wie die Archiv-Beauftragte Violaine Challéat sagt. «Man wollte nicht zuviel darüber reden, dass die französische Armee Wehrmachtsbilder aufbewahrt, auf denen zuweilen Hakenkreuze zu sehen sind.» ....." Hä ? Haben wir nicht 2008 ?
Quelle:
Der Westen, 04.04.2008
Wolf Thomas - am Freitag, 4. April 2008, 19:11 - Rubrik: Fotoueberlieferung
" Nach der Aufgabe seines Büros aus gesundheitlichen Gründen hat der Architekt des Berliner Spreedreiecks, Mark Braun, sein Archiv der Akademie der Künste übergeben. Das Baukunstarchiv der Akademie habe Computerzeichnungen, 3-D-Animationen, Modelle und zahlreiche Handskizzen erhalten, teilte die Akademie am Freitag in Berlin mit. ...."
Quelle:
Artikel in der Freien Presse
s. a. Pressemitteilung der Akademie der Künste
zum Architekturbüro Braun s. http://www.braunarchitekten.com/
Quelle:
Artikel in der Freien Presse
s. a. Pressemitteilung der Akademie der Künste
zum Architekturbüro Braun s. http://www.braunarchitekten.com/
Wolf Thomas - am Freitag, 4. April 2008, 19:09 - Rubrik: Architekturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Medien Bildungsgesellschaft Babelsberg veröffentlicht mit dem „CineArchiv Wegweiser 2008“ erstmals ein Verzeichnis audiovisueller Materialien und Archive in Berlin und Brandenburg.
Das über 100 Adressen umfassende Quellenverzeichnis präsentiert eine systematische Erfassung von Filmbeständen sowie deren Besitzer und Lagerungsort in der Region Berlin-Brandenburg. Zu jeder einzelnen Quellenangabe erhält der Benutzer ausführliche Informationen u.a. zu Umfang, Inhalt und Zeitbezug des Filmbestandes sowie zu den vorhandenen Filmformaten und Nutzungsmöglichkeiten. Der „CineArchiv-Wegweiser“ bietet somit Filmschaffenden, Interessierten und wissenschaftlich Arbeitenden ein wertvolles Nachschlagewerk bei der Suche nach bekannten und unbekannten Filmschätzen.
Ab sofort ist der „CineArchiv Wegweiser 2008“ unter http://www.mb-babelsberg.de
kostenfrei herunterzuladen oder als broschierte Ausgabe direkt bei der Gesellschaft gegen eine Schutzgebühr zu beziehen.
Ex Archivliste.
Download-Link:
http://www.mb-babelsberg.de/images/cinearchiv_wegweiser.pdf
Das über 100 Adressen umfassende Quellenverzeichnis präsentiert eine systematische Erfassung von Filmbeständen sowie deren Besitzer und Lagerungsort in der Region Berlin-Brandenburg. Zu jeder einzelnen Quellenangabe erhält der Benutzer ausführliche Informationen u.a. zu Umfang, Inhalt und Zeitbezug des Filmbestandes sowie zu den vorhandenen Filmformaten und Nutzungsmöglichkeiten. Der „CineArchiv-Wegweiser“ bietet somit Filmschaffenden, Interessierten und wissenschaftlich Arbeitenden ein wertvolles Nachschlagewerk bei der Suche nach bekannten und unbekannten Filmschätzen.
Ab sofort ist der „CineArchiv Wegweiser 2008“ unter http://www.mb-babelsberg.de
kostenfrei herunterzuladen oder als broschierte Ausgabe direkt bei der Gesellschaft gegen eine Schutzgebühr zu beziehen.
Ex Archivliste.
Download-Link:
http://www.mb-babelsberg.de/images/cinearchiv_wegweiser.pdf
KlausGraf - am Freitag, 4. April 2008, 17:08 - Rubrik: Medienarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das eco-Archiv, das vor allem Materialien aus dem Bereich Naturschutz, Arbeiterkultur und Jugendbewegung sammelte, wird/wurde in die Friedrich-Ebert-Stiftung überführt.
Einige dürftige Informationen unter http://www.eco-archiv.net/
Kritisch anzumerken ist aus meiner Sicht, dass dieser Vorgang, gegen den in meinen Augen in seiner Faktizität nichts einzuwenden ist, in der Szene der freien Archive nicht kommuniziert wurde. Zumindest soweit ich das überblicke....
Einige dürftige Informationen unter http://www.eco-archiv.net/
Kritisch anzumerken ist aus meiner Sicht, dass dieser Vorgang, gegen den in meinen Augen in seiner Faktizität nichts einzuwenden ist, in der Szene der freien Archive nicht kommuniziert wurde. Zumindest soweit ich das überblicke....
Bernd Hüttner - am Freitag, 4. April 2008, 08:14 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://copyright-project.law.cam.ac.uk/htdocs/index.html
Die Seite enthält unter anderem Druckprivilegien in Faksimile (wechselnde Qualität der Auflösung!) und Transkription bzw. englischer Übersetzung aus verschiedenen Ländern.

Die Seite enthält unter anderem Druckprivilegien in Faksimile (wechselnde Qualität der Auflösung!) und Transkription bzw. englischer Übersetzung aus verschiedenen Ländern.

KlausGraf - am Freitag, 4. April 2008, 04:15 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Alexander Hartmann hat eine amüsante Serie über die Marotte des Stammvaters aller deutschen Landblawgenden, auch dann in der ersten Person zu sprechen, wenn er fremde Inhalte plündert:
http://www.jurabilis.de/index.php?/archives/1387-LL.M.-in-Neuseeland-beliebt-wie-nie.html
http://www.jurabilis.de/index.php?/archives/1645-Tausendsassa.html
http://www.jurabilis.de/index.php?/archives/1581-CopyPaste-Kaskaden.html

Quelle: http://www.germanblawgs.de/category/rechtsprechung/
http://www.jurabilis.de/index.php?/archives/1387-LL.M.-in-Neuseeland-beliebt-wie-nie.html
http://www.jurabilis.de/index.php?/archives/1645-Tausendsassa.html
http://www.jurabilis.de/index.php?/archives/1581-CopyPaste-Kaskaden.html
Quelle: http://www.germanblawgs.de/category/rechtsprechung/
KlausGraf - am Freitag, 4. April 2008, 01:18 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 4. April 2008, 01:08 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Am 28.3.2008 wurde in H-German ein von zahlreichen US-Professorinnen unterzeichneter offener Brief veröffentlicht, der sein Befremden darüber artikuliert, dass in der im April an der Uni Mainz beginnenden Ringvorlesung zur Geschichte und Wirkung der
1968er Bewegung in transnationaler Perspektive keine weiblichen
Vortragenden eingeplant wurden. Der Dekan des FB 07 hat nun mit einer peinlichen Klarstellung reagiert, in der sich der denkwürdige Abschnitt findet:
Es ist meines Erachtens schlicht indiskutabel, dass Wissenschaftler/innen anderen Kolleg/innen per Offenem Brief und öffentlichem Druck vorzuschreiben versuchen, welche Themen in deren Veranstaltungen behandelt werden sollen. Das ist mit ganz grundlegenden Prinzipien des freien Diskurses nicht vereinbar.
Da verwechselt der Dekan aber etwas. Mit grundlegenden Prinzipien des freien Diskurses ist es nicht vereinbar, öffentliche Kritik an universitären Mißständen abzuwürgen. Wissenschaft agiert nicht im luftleeren Raum, und auch Praktiken der Wissenschaftsorganisation können und müssen öffentlich debattiert werden. Ob man in einer Rezension des womöglich aus der Ringvorlesung entstehenden Sammelbands die in der Tat fragwürdige Gender-Lücke bemängelt oder in einer fachlichen Mailingliste macht keinen Unterschied.
Wissenschaft lebt von Kritik, nicht von männerbündlerischer Kumpanei.
1968er Bewegung in transnationaler Perspektive keine weiblichen
Vortragenden eingeplant wurden. Der Dekan des FB 07 hat nun mit einer peinlichen Klarstellung reagiert, in der sich der denkwürdige Abschnitt findet:
Es ist meines Erachtens schlicht indiskutabel, dass Wissenschaftler/innen anderen Kolleg/innen per Offenem Brief und öffentlichem Druck vorzuschreiben versuchen, welche Themen in deren Veranstaltungen behandelt werden sollen. Das ist mit ganz grundlegenden Prinzipien des freien Diskurses nicht vereinbar.
Da verwechselt der Dekan aber etwas. Mit grundlegenden Prinzipien des freien Diskurses ist es nicht vereinbar, öffentliche Kritik an universitären Mißständen abzuwürgen. Wissenschaft agiert nicht im luftleeren Raum, und auch Praktiken der Wissenschaftsorganisation können und müssen öffentlich debattiert werden. Ob man in einer Rezension des womöglich aus der Ringvorlesung entstehenden Sammelbands die in der Tat fragwürdige Gender-Lücke bemängelt oder in einer fachlichen Mailingliste macht keinen Unterschied.
Wissenschaft lebt von Kritik, nicht von männerbündlerischer Kumpanei.
KlausGraf - am Freitag, 4. April 2008, 00:48 - Rubrik: Frauenarchive
"Kaiwan Mehta
Plaster, Desire & Those Cities
Architektur kann als literarischer Text gelesen und als Archiv wahrgenommen werden, in denen architektonische Elemente und Motive Speicher der Geschichte und der Erinnerung sind. In seiner Arbeit versucht Kaiwan Mehta die verschiedenen historischen Schichten einer urbanen Nachbarschaft zu entziffern – das zeitgenössische Leben der einst als »native town« bezeichneten Gegend im kolonialen Bombay. Die architektonische Hülle bildet dabei eine reichhaltige Komposition von Erzählungen, in denen Familien und Gemeinden einen sozialen sowie politischen Raum definieren. Kaiwan Mehta erforscht das architektonische Ornament als Objekt der Bildgeschichte und verwendet es zur Erarbeitung einer Theorie der Stadt und der damit verbundenen Kultur. Vor dem Hintergrund seiner narrativen Analysen Bombays offenbaren Kaiwan Mehtas Texte unsichtbare Geschichten über verschiedene europäische Städte, die in Anlehnung an Stilbücher aus dem 19. Jahrhundert erzählt und illustriert werden.
Kaiwan Mehta (*1975 in Mumbai/Indien) studierte Architektur, Englische Literatur und Indische Ästhetik und Kultur an der Universität von Mumbai. Seit 1999 unterrichtet Mehta am Kamla Raheja Vidyanidhi-Institut für Architektur und ist Redakteur für die Zeitschrift »Indian Architect and Builder«. Er war Gastdozent an verschiedenen Universitäten in Indien und in anderen Ländern. Sein Buch »Alice in Bhuleshwar« über Orte und Geschichte im »native town« des kolonialen Bombays wird in Kürze erscheinen. Kaiwan Mehta ist 2007/2008 Stipendiat der Akademie."
Quelle:
http://www.kulturkurier.de/veranstaltung_128979.html?KKSESSION=54a5654bda86b910e751a93ca2d22421
Plaster, Desire & Those Cities
Architektur kann als literarischer Text gelesen und als Archiv wahrgenommen werden, in denen architektonische Elemente und Motive Speicher der Geschichte und der Erinnerung sind. In seiner Arbeit versucht Kaiwan Mehta die verschiedenen historischen Schichten einer urbanen Nachbarschaft zu entziffern – das zeitgenössische Leben der einst als »native town« bezeichneten Gegend im kolonialen Bombay. Die architektonische Hülle bildet dabei eine reichhaltige Komposition von Erzählungen, in denen Familien und Gemeinden einen sozialen sowie politischen Raum definieren. Kaiwan Mehta erforscht das architektonische Ornament als Objekt der Bildgeschichte und verwendet es zur Erarbeitung einer Theorie der Stadt und der damit verbundenen Kultur. Vor dem Hintergrund seiner narrativen Analysen Bombays offenbaren Kaiwan Mehtas Texte unsichtbare Geschichten über verschiedene europäische Städte, die in Anlehnung an Stilbücher aus dem 19. Jahrhundert erzählt und illustriert werden.
Kaiwan Mehta (*1975 in Mumbai/Indien) studierte Architektur, Englische Literatur und Indische Ästhetik und Kultur an der Universität von Mumbai. Seit 1999 unterrichtet Mehta am Kamla Raheja Vidyanidhi-Institut für Architektur und ist Redakteur für die Zeitschrift »Indian Architect and Builder«. Er war Gastdozent an verschiedenen Universitäten in Indien und in anderen Ländern. Sein Buch »Alice in Bhuleshwar« über Orte und Geschichte im »native town« des kolonialen Bombays wird in Kürze erscheinen. Kaiwan Mehta ist 2007/2008 Stipendiat der Akademie."
Quelle:
http://www.kulturkurier.de/veranstaltung_128979.html?KKSESSION=54a5654bda86b910e751a93ca2d22421
Wolf Thomas - am Donnerstag, 3. April 2008, 17:48 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ....Die Berliner Architekturgalerie Aedes am Pfefferberg präsentiert einen faszinierenden Einblick in das Werk und die Werkstatt der 1945 in den Niederlanden geborenen Malerin und Illustratorin Madelon Vriesendorp ..... (Tatsächlich) dürfte ein großer Teil der Inspiration für Vriesendorps Bilder aus der uferlosen Sammlung kommen, die seit Anfang der Siebziger in ihrer Londoner Wohnung beständig wächst: zum einen sind es Tausende Ansichtspostkarten, ein sorgfältig thematisch sortiertes Archiv des idealisierten touristischen Blicks. ...."
Quelle:
http://www.art-magazin.de/architektur/5264/madelon_vriesendorp_berlin
Quelle:
http://www.art-magazin.de/architektur/5264/madelon_vriesendorp_berlin
Wolf Thomas - am Donnerstag, 3. April 2008, 17:44 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die EU plant, ihren Bürgern das auf Tonträger gebannte musikalische Erbe zu klauen und der darbenden Musikindustrie zu schenken. In einer Zeit des Open Access ist das natürlich ein Witz, der allerdings überhaupt nicht zum Lachen ist.
Eine Petition der Veropedia wendet sich dagegen:
http://petition.veropedia.com/
Veropedia is saddened by the efforts of the European Union to limit access to the vast creative output of the human spirit by extending copyright restrictions on the works of musicians and performers from 50 to 95 years. Such legislation would limit access to the earliest recordings of classical music and the songs of both World Wars. It would inhibit the creativity of modern artists, who build upon the works of forebears in their own works, and it would impede the efforts of our era to make the creative genius of the past free and accessible to all.
While we embrace the principle that people have a right to be rewarded for their creativity, we also believe in the ideal of a shared cultural heritage, which is the right of all people everywhere. The proposed extension of copyright provisions prevents free access to this priceless human legacy. It limits the creative freedom of a new generation of artists and the cultural freedom of communities of listeners and learners.
We therefore call on Commissioner Charlie McCreevey of the European Union to reconsider the extension of copyright protection for performers from 50 to 95 years. This will not only benefit modern performers and listeners, but serve as an example to other countries, including the United States, to relax their copyright laws and share the wealth of our common cultural heritage.
Eine Petition der Veropedia wendet sich dagegen:
http://petition.veropedia.com/
Veropedia is saddened by the efforts of the European Union to limit access to the vast creative output of the human spirit by extending copyright restrictions on the works of musicians and performers from 50 to 95 years. Such legislation would limit access to the earliest recordings of classical music and the songs of both World Wars. It would inhibit the creativity of modern artists, who build upon the works of forebears in their own works, and it would impede the efforts of our era to make the creative genius of the past free and accessible to all.
While we embrace the principle that people have a right to be rewarded for their creativity, we also believe in the ideal of a shared cultural heritage, which is the right of all people everywhere. The proposed extension of copyright provisions prevents free access to this priceless human legacy. It limits the creative freedom of a new generation of artists and the cultural freedom of communities of listeners and learners.
We therefore call on Commissioner Charlie McCreevey of the European Union to reconsider the extension of copyright protection for performers from 50 to 95 years. This will not only benefit modern performers and listeners, but serve as an example to other countries, including the United States, to relax their copyright laws and share the wealth of our common cultural heritage.
Ladislaus - am Donnerstag, 3. April 2008, 08:59 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die folgende Liste nennt meine Veröffentlichungen zu Personen und Familien, einschließlich ganz (oder teilweise) online vorliegender Fassungen. Die Links bei den Personennamen beziehen sich auf die Wikipedia.
[ Achtung: Fast alle Texte sind inzwischen online. Nachweise
http://archiv.twoday.net/stories/4974627/
Mai 2013: defekte Links wurden durchgestrichen. Nicht online sind nur noch Bebel: Wider (1993, die Zweitauflage ist online); Diemar 1997 (die Neufassung ist online); Heinrich, in: Das Haus Württemberg (ausführlicher 1999 online); Jäger: Eine Ergänzung 1981; Judenkönig; Ruge]
***
Bebel, Heinrich
Heinrich Bebel (1472-1518). Wider ein barbarisches Latein, in:
Humanismus im deutschen Südwesten. Biographische Profile, hrsg. von Paul Gerhardt Schmidt, Sigmaringen 1993, S. 179-194
Heinrich Bebel, in: Deutsche Dichter der frühen Neuzeit
(1450-1600). Ihr Leben und Werk, hrsg. von Stephan Füssel, Berlin
1993, S. 281-295
Heinrich Bebel (1472-1518). Wider ein barbarisches Latein, in:
Humanismus im deutschen Südwesten. Biographische Profile, hrsg. von Paul Gerhardt Schmidt, 2. Aufl., Stuttgart 2000, S. 179-194
Bollstatter, Konrad siehe Müller
Carové, Friedrich Wilhelm
Friedrich Wilhelm Carové (1789-1852), Ein Tag auf dem Stadtturm
zu Andernach, neu hrsg. von Klaus Graf, in: Andernacher Annalen 4
(2001/2002), S. 57-76
Online: http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/carove.htm (E-Text)
Debler, Dominikus
Dominikus Debler - ein großer Schwäbisch Gmünder Chronist, in:
Die Chronik des Dominikus Debler (1756-1836). Stadtgeschichte in
Bildern, hrsg. von Werner H. A. Debler/Klaus Jürgen Herrmann,
Schwäbisch Gmünd 2006, S. 45-54
Diemar, Hans
Die Fehde Hans Diemars von Lindach gegen die Reichsstadt
Schwäbisch Gmünd (1543-1554). Ein Beitrag zur Geschichte der
Städtefeindschaft, in: "Raubritter" oder "Rechtschaffene vom Adel"?
Aspekte von Politik, Friede und Recht im späten Mittelalter, hrsg. von Kurt Andermann (= Oberrheinische Studien 14), Sigmaringen 1997, S. 167-189
Die Fehde Diemars von Lindach gegen die Reichsstadt Schwäbisch
Gmünd (1543-1554), in: Gmünder Studien 7 (2005), S. 7-32
Eberhard im Bart, Graf/Herzog von Württemberg
Geschichtsschreibung und Landesdiskurs im Umkreis Graf Eberhards
im Bart von Württemberg (1459-1496), in: Blätter für deutsche
Landesgeschichte 129 (1993) [erschienen 1994], S. 165-193
Online:http://mdz1.bib-bvb.de/cocoon/bdlg/Blatt_bsb00000333,00175.html (Digitalisat)
Eberhard im Bart und die Herzogserhebung 1495, in: 1495:
Württemberg wird Herzogtum. Dokumente aus dem Hauptstaatsarchiv
Stuttgart zu einem epochalen Ereignis, bearb. von Stephan Molitor,
Stuttgart 1995, S. 9-43
Finck, Thomas
Zur Biographie des Thomas Finck, in: Studien und Mitteilungen zur
Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige 110 (1999), S.
169-173
Thomas Finck - Arzt, Benediktiner in Blaubeuren und Kartäuser in Güterstein, in:
Tübingen in Lehre und Forschung um 1500, hrsg. von Sönke Lorenz/Dieter Bauer/Oliver Auge
(= Tübinger Bausteine zur Landesgeschichte 9), Ostfildern 2008, S. 159-175
Online: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4798/ (Verlags-PDF)
Fulrad von Saint-Denis
Zur Frage einer Fulradzelle in Schwäbisch Gmünd, in: Gmünder Studien 2 (1979), S. 173-202
Ginzburg, Carlo
Carlo Ginzburgs "Hexensabbat" - Herausforderung an die
Methodendiskussion der Geschichtswissenschaft, in: kea. Zeitschrift für Kulturwissenschaft 5 (1993), S. 1-16
Carlo Ginzburgs Buch "Hexensabbat" - eine Herausforderung an die
Methodendiskussion der Geschichtswissenschaft (1994)
Online: http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/ginzbg.htm
identisch mit
http://sammelpunkt.philo.at:8080/340/1/ginzbg.htm (gegenüber der Druckfassung von 1993 erweiterter E-Text)
Goldstainer, Paul
Gmünder Chroniken im 16. Jahrhundert. Texte und Untersuchungen
zur Geschichtsschreibung der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Gmünd 1984
Online: http://www.literature.at/webinterface/library/ALO-BOOK_V01?objid=12643 (Digitalisat)
Gräter, Jakob
Jacob Graeter (1547-1611), in: Encyclopaedia of Witchcraft. The
Western Tradition, hrsg. von Richard M. Golden, Santa Barbara 2006, S. 454-455
Deutsche Fassung online:
http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind0304&L=HEXENFORSCHUNG&P=R1957&I=-3
Heinrich von Schönegg, Bischof von Augsburg
Bischof Heinrich III. von Schönegg und Schwäbisch Gmünd, in: Jahrbuch des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte e.V. 15 (1981), S. 216-220
Heinrich, Graf von Württemberg und seine Familie
Heinrich, in: Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon,
hrsg. von Sönke Lorenz/Dieter Mertens/Volker Press,
Stuttgart/Berlin/Köln 1997, S. 123; Elisabeth, S. 124; Eva, S. 125;
Maria, S. 125; Literatur S. 449f.
Graf Heinrich von Württemberg (+1519) - Aspekte eines
ungewöhnlichen Fürstenlebens, in: Württemberg und Mömpelgard 600 Jahre Begegnung. Montbéliard - Wurtemberg 600 Ans de Relations, hrsg. von Sönke Lorenz/Peter Rückert (= Schriften zur Südwestdeutschen Landeskunde 26), Leinfelden-Echterdingen 1999, S. 107-120
Online: http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/heinr.htm (E-Text mit Nachträgen)
Hochmut, Jörg
Hochmut, Jörg, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters.
Verfasserlexikon. 2. Aufl., hrsg. von Burghart Wachinger Bd. 11 Lief. 3, Berlin-New York 2002, Sp. 683-684
Online: Google Books
Hug, Johannes
Der Straßburger Gelehrte Johannes Hug und sein vergessenes Werk
Quadruvium ecclesiae (Straßburg: Johann Grüninger 1504), in:
Humanisten am Oberrhein. Neue Gelehrte im Dienst alter Herren, hrsg. von Sven Lembke/Markus Müller (= Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde 37), Leinfelden-Echterdingen 2004, S. 175-187
Jäger von Jägersberg, Familie
Eine Ergänzung zur Genealogie der Jäger von Jägersberg aus
Schwäbisch Gmünd, in: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und
Wappenkunde 16 (1981), S. 496-497
Eine Aufzeichnung vom Ende des 16. Jahrhunderts zur Genealogie
der Schwäbisch Gmünder Familien Debler und Jäger, in: Gmünder Studien 5 (1997), S. 95-119
Zu den Schwäbisch Gmünder und den altwürttembergischen Jäger von Jägersberg, in: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde 23 (2001), H. 2, S. 82-84
Judenkönig, Hans
Zur Familie des Lautenspielers Hans Judenkönig aus Schwäbisch
Gmünd, in: ostalb/einhorn 6 (1979), S. 118, 120
Konrad von Weinsberg
Quellen zur Geschichte der Göppinger Oberhofenkirche (1439, 1447)
aus dem Lehenkopialbuch Konrads von Weinsberg und dem Weinsberger Archiv, in: Hohenstaufen/Helfenstein. Historisches Jahrbuch für den Kreis Göppingen 2 (1992), S. 55-73
Nur der Quellenanhang ist als E-Text online:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/weinsb.htm
Lehmann, Christoph
Lehmann, Christoph, in: Enzyklopädie des Märchens.
Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, hrsg. von Rolf Wilhelm Brednich u.a., Bd. 8 Lief. 3/4, Berlin-New York 1996, Sp. 881-883
Online (ohne Sp. 883): Google Books
Lirer, Thomas
Thomas Lirer, in: Neue Deutsche Biographie 14 (1985), S. 680-681
Online:http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0001/bsb00016332/images/index.html?seite=696 (Digitalisat)
Exemplarische Geschichten. Thomas Lirers "Schwäbische Chronik"
und die "Gmünder Kaiserchronik" (=Forschungen zur Geschichte der
Älteren Deutschen Literatur 7), München 1987
Online: http://www.literature.at/webinterface/library/ALO_PDF_V01?objid=22215 (PDF-Digitalisat)
Luz, Georg
Gedenkblatt für Georg Luz Lehrer in Heubach (1818-1884),
ostalb/einhorn 8 (1981), S. 294-296
Matthias von Kemnat
Matthias von Kemnat, in: Neue Deutsche Biographie 16 (1990), S. 410-411
Online:http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0001/bsb00016334/images/index.html?seite=424 (Digitalisat)
Maucher, Künstlerfamilie in Schwäbisch Gmünd
Höfische Künstler in der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd. Zu
Angelika Ehmers Buch "Die Maucher", in: ostalb/einhorn 19 (1992), S. 244-250
Online: http://naxos.bsz-bw.de/rekla/showData.php?meta_id=54 (E-Text)
Mülich, Hektor
Mülich, Hektor, in: Neue Deutsche Biographie 18 (1997), S. 303
Online:http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0001/bsb00016336/images/index.html?seite=319 (Digitalisat)
Müller, Konrad genannt Bollstatter
Müller, Konrad (gen. Bollstatter), in: Neue Deutsche Biographie
18 (1997), S. 447-448
Online:http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0001/bsb00016336/images/index.html?seite=463 (Digitalisat)
http://www.aedph.uni-bayreuth.de/2004/0021.html (E-Text mit Ergänzungen)
Nikolaus vom Schwert
Nikolaus vom Schwert (um 1400), ein Sohn des Schwäbisch Gmünder
Arztes Peter von Grünenberg, in: Sudhoffs Archiv 74 (1990), S. 236-238
Pahl, Johann Gottfried
"... ein stattlicher schwäbischer Ritter, kühn und tapfer...".
Johann Gottfried Pahls Ritterroman "Ulrich von Rosenstein" (Basel
1795) im Internet, in: einhorn-Jahrbuch Schwäbisch Gmünd 2005, S. 115-128
Parler, Baumeisterfamilie
Die Heilig-Kreuz-Kirche in Schwäbisch Gmünd im Mittelalter.
Kirchen- und baugeschichtliche Beiträge, in: einhorn-Jahrbuch Schwäbisch Gmünd 1989, S. 81-108
Gmünd im 14. Jahrhundert. Ein Beitrag zum
Peter-Parler-Gedächtnisjahr 1999, einhorn-Jahrbuch Schwäbisch Gmünd 1999, S. 81-96
Online: http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/gd14.htm (E-Text mit Nachträgen)
Rauchbein, Hans
Hans Rauchbein. Ein Gmünder Bürgermeister im 16. Jahrhundert und sein falscher Ruhm, in: ostalb/einhorn 18 (1991), S. 116-126
Reuchlin, Johannes
Aus krichsscher sprach in das swebischs teutschs gebracht.
Bemerkungen zu Reuchlins Patriotismus, in: Reuchlin und die
politischen Kräfte seiner Zeit, hrsg. von Stefan Rhein (= Pforzheimer Reuchlinschriften 5), Sigmaringen 1998, S. 205-224
Rink, Joseph Alois
Nachwort, in: Joseph Alois Rink, Kurzgefaßte Geschichte und
Beschreibung der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd. Nachdruck Schwäbisch Gmünd 1982, S. 100-114
Ruge, Arnold
Eine von Himmler angeregte antikirchliche Kampfschrift Arnold
Ruges (1881-1945) über die Hexenprozesse (1936), in: Himmlers
Hexenkartothek. Das Interesse des Nationalsozialismus an der
Hexenverfolgung, hrsg. von Sönke Lorenz, Dieter R. Bauer, Wolfgang Behringer und Jürgen Michael Schmidt (= Hexenforschung 4), Bielefeld 1999, S. 35-45 (2., unveränderte Aufl. 2000)
Stubenberg, Herren von
Die Herren von Stubenberg und ihre Burg auf Markung Weiler in den
Bergen, in: einhorn-Jahrbuch Schwäbisch Gmünd 1978, S. 218-220
Nochmals: Die Herren von Stubenberg, in: einhorn-Jahrbuch Schwäbisch Gmünd 1979, S. 155
Zum dritten Mal: Die Herren von Stubenberg, in: einhorn-Jahrbuch
Schwäbisch Gmünd 1997, S. 115-116
Trutwin, Arzt in Esslingen (um 1300)
Trutwin, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters.
Verfasserlexikon. 2. Aufl., hrsg. von Burghart Wachinger Bd. 9 Lief.
3/4, Berlin-New York 1995, Sp. 1109-1111
Online: Google Books
Vener, Geschlechterfamilie in Schwäbisch Gmünd
Speisung der 12 Armen. Eine Gründonnerstagsstiftung der Vener in
Schwäbisch Gmünd, in: ostalb/einhorn 6 (1979), S. 52-56
Die Vener, ein Gmünder Stadtgeschlecht. Zu Hermann Heimpels
Monographie, in: Gmünder Studien 3 (1989), S. 121-159
Warbeck, Veit
Klaus Graf und Stephan Opitz, Veit Warbeck aus Gmünd und seine
"Schöne Magelone", in: ostalb/einhorn 10 (1983), S. 431-436
Veit Warbeck, der Übersetzer der "Schönen Magelone" (1527) und
seine Familie, in: einhorn-Jahrbuch Schwäbisch Gmünd 1986, S. 139-150
Online: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5584/ (Digitalisat mit OCR)
Wolleber, David
Gmünder Chroniken im 16. Jahrhundert. Texte und Untersuchungen
zur Geschichtsschreibung der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Gmünd 1984
Online: http://www.literature.at/webinterface/library/ALO-BOOK_V01?objid=12643 (Digitalisat)
[ Achtung: Fast alle Texte sind inzwischen online. Nachweise
http://archiv.twoday.net/stories/4974627/
Mai 2013: defekte Links wurden durchgestrichen. Nicht online sind nur noch Bebel: Wider (1993, die Zweitauflage ist online); Diemar 1997 (die Neufassung ist online); Heinrich, in: Das Haus Württemberg (ausführlicher 1999 online); Jäger: Eine Ergänzung 1981; Judenkönig; Ruge]
***
Bebel, Heinrich
Heinrich Bebel (1472-1518). Wider ein barbarisches Latein, in:
Humanismus im deutschen Südwesten. Biographische Profile, hrsg. von Paul Gerhardt Schmidt, Sigmaringen 1993, S. 179-194
Heinrich Bebel, in: Deutsche Dichter der frühen Neuzeit
(1450-1600). Ihr Leben und Werk, hrsg. von Stephan Füssel, Berlin
1993, S. 281-295
Heinrich Bebel (1472-1518). Wider ein barbarisches Latein, in:
Humanismus im deutschen Südwesten. Biographische Profile, hrsg. von Paul Gerhardt Schmidt, 2. Aufl., Stuttgart 2000, S. 179-194
Bollstatter, Konrad siehe Müller
Carové, Friedrich Wilhelm
Friedrich Wilhelm Carové (1789-1852), Ein Tag auf dem Stadtturm
zu Andernach, neu hrsg. von Klaus Graf, in: Andernacher Annalen 4
(2001/2002), S. 57-76
Online: http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/carove.htm (E-Text)
Debler, Dominikus
Dominikus Debler - ein großer Schwäbisch Gmünder Chronist, in:
Die Chronik des Dominikus Debler (1756-1836). Stadtgeschichte in
Bildern, hrsg. von Werner H. A. Debler/Klaus Jürgen Herrmann,
Schwäbisch Gmünd 2006, S. 45-54
Diemar, Hans
Die Fehde Hans Diemars von Lindach gegen die Reichsstadt
Schwäbisch Gmünd (1543-1554). Ein Beitrag zur Geschichte der
Städtefeindschaft, in: "Raubritter" oder "Rechtschaffene vom Adel"?
Aspekte von Politik, Friede und Recht im späten Mittelalter, hrsg. von Kurt Andermann (= Oberrheinische Studien 14), Sigmaringen 1997, S. 167-189
Die Fehde Diemars von Lindach gegen die Reichsstadt Schwäbisch
Gmünd (1543-1554), in: Gmünder Studien 7 (2005), S. 7-32
Eberhard im Bart, Graf/Herzog von Württemberg
Geschichtsschreibung und Landesdiskurs im Umkreis Graf Eberhards
im Bart von Württemberg (1459-1496), in: Blätter für deutsche
Landesgeschichte 129 (1993) [erschienen 1994], S. 165-193
Online:
Eberhard im Bart und die Herzogserhebung 1495, in: 1495:
Württemberg wird Herzogtum. Dokumente aus dem Hauptstaatsarchiv
Stuttgart zu einem epochalen Ereignis, bearb. von Stephan Molitor,
Stuttgart 1995, S. 9-43
Finck, Thomas
Zur Biographie des Thomas Finck, in: Studien und Mitteilungen zur
Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige 110 (1999), S.
169-173
Thomas Finck - Arzt, Benediktiner in Blaubeuren und Kartäuser in Güterstein, in:
Tübingen in Lehre und Forschung um 1500, hrsg. von Sönke Lorenz/Dieter Bauer/Oliver Auge
(= Tübinger Bausteine zur Landesgeschichte 9), Ostfildern 2008, S. 159-175
Online: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4798/ (Verlags-PDF)
Fulrad von Saint-Denis
Zur Frage einer Fulradzelle in Schwäbisch Gmünd, in: Gmünder Studien 2 (1979), S. 173-202
Ginzburg, Carlo
Carlo Ginzburgs "Hexensabbat" - Herausforderung an die
Methodendiskussion der Geschichtswissenschaft, in: kea. Zeitschrift für Kulturwissenschaft 5 (1993), S. 1-16
Carlo Ginzburgs Buch "Hexensabbat" - eine Herausforderung an die
Methodendiskussion der Geschichtswissenschaft (1994)
Online: http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/ginzbg.htm
identisch mit
http://sammelpunkt.philo.at:8080/340/1/ginzbg.htm (gegenüber der Druckfassung von 1993 erweiterter E-Text)
Goldstainer, Paul
Gmünder Chroniken im 16. Jahrhundert. Texte und Untersuchungen
zur Geschichtsschreibung der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Gmünd 1984
Online: http://www.literature.at/webinterface/library/ALO-BOOK_V01?objid=12643 (Digitalisat)
Gräter, Jakob
Jacob Graeter (1547-1611), in: Encyclopaedia of Witchcraft. The
Western Tradition, hrsg. von Richard M. Golden, Santa Barbara 2006, S. 454-455
Deutsche Fassung online:
http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind0304&L=HEXENFORSCHUNG&P=R1957&I=-3
Heinrich von Schönegg, Bischof von Augsburg
Bischof Heinrich III. von Schönegg und Schwäbisch Gmünd, in: Jahrbuch des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte e.V. 15 (1981), S. 216-220
Heinrich, Graf von Württemberg und seine Familie
Heinrich, in: Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon,
hrsg. von Sönke Lorenz/Dieter Mertens/Volker Press,
Stuttgart/Berlin/Köln 1997, S. 123; Elisabeth, S. 124; Eva, S. 125;
Maria, S. 125; Literatur S. 449f.
Graf Heinrich von Württemberg (+1519) - Aspekte eines
ungewöhnlichen Fürstenlebens, in: Württemberg und Mömpelgard 600 Jahre Begegnung. Montbéliard - Wurtemberg 600 Ans de Relations, hrsg. von Sönke Lorenz/Peter Rückert (= Schriften zur Südwestdeutschen Landeskunde 26), Leinfelden-Echterdingen 1999, S. 107-120
Online: http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/heinr.htm (E-Text mit Nachträgen)
Hochmut, Jörg
Hochmut, Jörg, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters.
Verfasserlexikon. 2. Aufl., hrsg. von Burghart Wachinger Bd. 11 Lief. 3, Berlin-New York 2002, Sp. 683-684
Hug, Johannes
Der Straßburger Gelehrte Johannes Hug und sein vergessenes Werk
Quadruvium ecclesiae (Straßburg: Johann Grüninger 1504), in:
Humanisten am Oberrhein. Neue Gelehrte im Dienst alter Herren, hrsg. von Sven Lembke/Markus Müller (= Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde 37), Leinfelden-Echterdingen 2004, S. 175-187
Jäger von Jägersberg, Familie
Eine Ergänzung zur Genealogie der Jäger von Jägersberg aus
Schwäbisch Gmünd, in: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und
Wappenkunde 16 (1981), S. 496-497
Eine Aufzeichnung vom Ende des 16. Jahrhunderts zur Genealogie
der Schwäbisch Gmünder Familien Debler und Jäger, in: Gmünder Studien 5 (1997), S. 95-119
Zu den Schwäbisch Gmünder und den altwürttembergischen Jäger von Jägersberg, in: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde 23 (2001), H. 2, S. 82-84
Judenkönig, Hans
Zur Familie des Lautenspielers Hans Judenkönig aus Schwäbisch
Gmünd, in: ostalb/einhorn 6 (1979), S. 118, 120
Konrad von Weinsberg
Quellen zur Geschichte der Göppinger Oberhofenkirche (1439, 1447)
aus dem Lehenkopialbuch Konrads von Weinsberg und dem Weinsberger Archiv, in: Hohenstaufen/Helfenstein. Historisches Jahrbuch für den Kreis Göppingen 2 (1992), S. 55-73
Nur der Quellenanhang ist als E-Text online:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/weinsb.htm
Lehmann, Christoph
Lehmann, Christoph, in: Enzyklopädie des Märchens.
Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, hrsg. von Rolf Wilhelm Brednich u.a., Bd. 8 Lief. 3/4, Berlin-New York 1996, Sp. 881-883
Lirer, Thomas
Thomas Lirer, in: Neue Deutsche Biographie 14 (1985), S. 680-681
Online:
Exemplarische Geschichten. Thomas Lirers "Schwäbische Chronik"
und die "Gmünder Kaiserchronik" (=Forschungen zur Geschichte der
Älteren Deutschen Literatur 7), München 1987
Online: http://www.literature.at/webinterface/library/ALO_PDF_V01?objid=22215 (PDF-Digitalisat)
Luz, Georg
Gedenkblatt für Georg Luz Lehrer in Heubach (1818-1884),
ostalb/einhorn 8 (1981), S. 294-296
Matthias von Kemnat
Matthias von Kemnat, in: Neue Deutsche Biographie 16 (1990), S. 410-411
Online:
Maucher, Künstlerfamilie in Schwäbisch Gmünd
Höfische Künstler in der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd. Zu
Angelika Ehmers Buch "Die Maucher", in: ostalb/einhorn 19 (1992), S. 244-250
Online: http://naxos.bsz-bw.de/rekla/showData.php?meta_id=54 (E-Text)
Mülich, Hektor
Mülich, Hektor, in: Neue Deutsche Biographie 18 (1997), S. 303
Online:
Müller, Konrad genannt Bollstatter
Müller, Konrad (gen. Bollstatter), in: Neue Deutsche Biographie
18 (1997), S. 447-448
Online:
Nikolaus vom Schwert
Nikolaus vom Schwert (um 1400), ein Sohn des Schwäbisch Gmünder
Arztes Peter von Grünenberg, in: Sudhoffs Archiv 74 (1990), S. 236-238
Pahl, Johann Gottfried
"... ein stattlicher schwäbischer Ritter, kühn und tapfer...".
Johann Gottfried Pahls Ritterroman "Ulrich von Rosenstein" (Basel
1795) im Internet, in: einhorn-Jahrbuch Schwäbisch Gmünd 2005, S. 115-128
Parler, Baumeisterfamilie
Die Heilig-Kreuz-Kirche in Schwäbisch Gmünd im Mittelalter.
Kirchen- und baugeschichtliche Beiträge, in: einhorn-Jahrbuch Schwäbisch Gmünd 1989, S. 81-108
Gmünd im 14. Jahrhundert. Ein Beitrag zum
Peter-Parler-Gedächtnisjahr 1999, einhorn-Jahrbuch Schwäbisch Gmünd 1999, S. 81-96
Online: http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/gd14.htm (E-Text mit Nachträgen)
Rauchbein, Hans
Hans Rauchbein. Ein Gmünder Bürgermeister im 16. Jahrhundert und sein falscher Ruhm, in: ostalb/einhorn 18 (1991), S. 116-126
Reuchlin, Johannes
Aus krichsscher sprach in das swebischs teutschs gebracht.
Bemerkungen zu Reuchlins Patriotismus, in: Reuchlin und die
politischen Kräfte seiner Zeit, hrsg. von Stefan Rhein (= Pforzheimer Reuchlinschriften 5), Sigmaringen 1998, S. 205-224
Rink, Joseph Alois
Nachwort, in: Joseph Alois Rink, Kurzgefaßte Geschichte und
Beschreibung der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd. Nachdruck Schwäbisch Gmünd 1982, S. 100-114
Ruge, Arnold
Eine von Himmler angeregte antikirchliche Kampfschrift Arnold
Ruges (1881-1945) über die Hexenprozesse (1936), in: Himmlers
Hexenkartothek. Das Interesse des Nationalsozialismus an der
Hexenverfolgung, hrsg. von Sönke Lorenz, Dieter R. Bauer, Wolfgang Behringer und Jürgen Michael Schmidt (= Hexenforschung 4), Bielefeld 1999, S. 35-45 (2., unveränderte Aufl. 2000)
Stubenberg, Herren von
Die Herren von Stubenberg und ihre Burg auf Markung Weiler in den
Bergen, in: einhorn-Jahrbuch Schwäbisch Gmünd 1978, S. 218-220
Nochmals: Die Herren von Stubenberg, in: einhorn-Jahrbuch Schwäbisch Gmünd 1979, S. 155
Zum dritten Mal: Die Herren von Stubenberg, in: einhorn-Jahrbuch
Schwäbisch Gmünd 1997, S. 115-116
Trutwin, Arzt in Esslingen (um 1300)
Trutwin, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters.
Verfasserlexikon. 2. Aufl., hrsg. von Burghart Wachinger Bd. 9 Lief.
3/4, Berlin-New York 1995, Sp. 1109-1111
Vener, Geschlechterfamilie in Schwäbisch Gmünd
Speisung der 12 Armen. Eine Gründonnerstagsstiftung der Vener in
Schwäbisch Gmünd, in: ostalb/einhorn 6 (1979), S. 52-56
Die Vener, ein Gmünder Stadtgeschlecht. Zu Hermann Heimpels
Monographie, in: Gmünder Studien 3 (1989), S. 121-159
Warbeck, Veit
Klaus Graf und Stephan Opitz, Veit Warbeck aus Gmünd und seine
"Schöne Magelone", in: ostalb/einhorn 10 (1983), S. 431-436
Veit Warbeck, der Übersetzer der "Schönen Magelone" (1527) und
seine Familie, in: einhorn-Jahrbuch Schwäbisch Gmünd 1986, S. 139-150
Online: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5584/ (Digitalisat mit OCR)
Wolleber, David
Gmünder Chroniken im 16. Jahrhundert. Texte und Untersuchungen
zur Geschichtsschreibung der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Gmünd 1984
Online: http://www.literature.at/webinterface/library/ALO-BOOK_V01?objid=12643 (Digitalisat)
KlausGraf - am Donnerstag, 3. April 2008, 02:14 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bibliothekare übersehen gemeinhin, dass in modernen Nachlässen, die von Handschriftenabteilungen verwahrt werden, Unterlagen (Briefe, Fotos, usw.) lebender Personen sich befinden, die nicht vom Nachlassgeber stammen. Dabei handelt es sich eindeutig um personenbezogene Daten im Sinne des Thüringer Datenschutzgesetzes.
Dieses sagt eindeutig: "Die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder anordnet oder soweit der Betroffene eingewilligt hat." (§ 4 Abs. 1). Zur Verarbeitung zählt auch das Erheben der Daten durch Übernahme des entsprechenden Nachlasses.
Beispiele für personenbezogene Daten, die nicht mit Zustimmung des Betroffenen erhoben werden, wenn ein privater Nach- oder Vorlass übernommen wird:
- Briefe Dritter an den Nachlassgeber (Korrespondenz-Eingang)
- Fotos, die Dritte zeigen
- Ausführungen in Unterlagen (Briefen, Schriften) über Dritte, die Einzelangaben über persönliche Verhältnisse enthalten.
Denkbar ist aber auch, dass Bibliotheken Forschungsunterlagen und Sammlungen aus dem Bereich der qualitativen Sozialforschung übernehmen, in denen personenbezogene Daten nicht-anonymisiert vorhanden sind (z.B. Oral-History-Projekte).
Inbesondere bei Briefen ist es leicht vorstellbar, dass die nach § 4 Abs. 5 Thüringer DatenschutzG besonders "sensiblen" "Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen" betroffen sind, deren Erhebung nur unter strengen Voraussetzungen zulässig ist.
In allen diesen Fällen fehlt - anders als bei den Archiven, die mit den Archivgesetzen die entsprechende Rechtsgrundlage haben - die datenschutzrechtliche Befugnisnorm, die es den Bibliotheken ermöglicht, Unterlagen, in denen sich personenbezogene Daten befinden, zu übernehmen.
Das Sammeln von Nachlässen zählt gewohnheitsrechtlich zu den Aufgaben von Bibliothek. Für Thüringen siehe etwa:
http://hans.uni-erfurt.de/hans/index.htm
Datenschutzbeauftragte aber fragen, welche Norm und Aufgabenbeschreibung es Bibliotheken ermöglicht, personenbezogene Unterlagen zu übernehmen. Es gilt ja § 19 Thüringer DatenschutzG, dass die Kenntnis der Daten "zur Erfüllung der Aufgaben der erhebenden Stellen erforderlich ist".
Aus dem Gesetzentwurf der CDU - siehe Steinhauer zitiert in
http://archiv.twoday.net/stories/4832758/ - lassen sich solche rechtfertigenden Aufgaben aber nicht ohne weiteres ableiten.
"Das große Problem: Handschriften Dritter" hat der Bibliotheksjurist Harald Müller einen Abschnitt seines leider vergriffenen und auch nicht online verfügbaren, nach wie vor grundlegenden Buchs "Rechtsprobleme bei Nachlässen in Bibliotheken und Archiven", Hamburg/Augsburg 1983, S. 129-132 überschrieben. Damals ging es um die Katalogisierung. Müller stellte dar, dass die Katalogisierung nichtveröffentlichter Briefe noch lebender Absender nach den Datenschutzgesetzen nicht möglich ist. Er sprach von "katastrophalen" Konsequenzen für die Nachlaßpflege (S. 131).
Heute kann man diese Ausführungen, die meines Wissens zu keinerlei Konsequenzen in den Handschriftenabteilungen der Bibliotheken geführt haben, noch schärfer fassen: Nicht bereits die Katalogisierung der Briefe ist unzulässig, bereits die Übernahme in den Bibliotheksbestand kann ohne Rechtsgrundlage (oder Zustimmung aller Betroffenen) nicht erfolgen!
Wenn man an einen literarischen Nachlass denkt, so liegt auf der Hand, dass die beim Autor sich einfindenden oder von ihm geschaffenen Unterlagen Teil eines kommunikativen Netzes sind, bei dem es ständig um andere Personen geht. Autoren setzen sich mit anderen Autoren auseinander, Schriftstellerbriefe sind voll von Bemerkungen über Kolleginnen und Kollegen. Autoren, die in Gremien tätig sind, erheben eine Vielzahl personenbezogener Daten, von denen längst nicht alle öffentlichen Quellen entnommen sind.
Es ist schlicht und einfach nicht praktikabel und sinnvoll, aus einem Nachlass personenbezogene Daten Dritter auszusondern oder gar die Betroffenen um Zustimmung zu bitten.
Glücklicherweise gibt es ja für den Umgang mit Nachlässen in Archiven eine Rechtsgrundlage, die man ohne weiteres auf die Bibliotheken übertragen könnte.
Ich schlage daher folgende Datenschutzklausel für das Thüringer Bibliotheksgesetz vor:
Soweit Bibliotheken im Rahmen ihrer Dokumentationsaufgaben und insbesondere bei der Übernahme, Erschließung und Nutzbarmachung von aus wissenschaftlichen Gründen erhaltenswerten Nachlässen personenbezogene Daten lebender Personen im Sinne des Thüringer Datenschutzgesetzes verarbeiten, gelten die Vorschriften des Thüringer Archivgesetzes entsprechend.
Durch die an sich überflüssige Nennung lebender Personen soll klargestellt werden, dass sich die Sperrfristen des Thüringer Archivgesetzes nicht auf bereits Verstorbene beziehen. Das Archivgesetz hat sich datenschutzrechtlich bewährt, daher besteht kein Bedarf für eine eigenständige Regelung. Zugleich macht die Klausel deutlich, dass die Einwerbung von wissenschaftlich wertvollen Nachlässen zu den rechtmäßigen Aufgaben der Bibliotheken zählt. Künstlerische und heimatgeschichtliche Gründe können ohne weiteres den wissenschaftlichen Gründen subsummiert werden.
Eine Datenschutzklausel, die sich auf die Kernaufgabe der Bibliotheken, die Sammlung gedruckter Bücher oder anderer erschienenen Medien (z.B. DVDs), bezieht, wird hoffentlich nicht erforderlich sein, wenn der Thüringer Datenschutzbeauftragte mitspielt ...
Dieses sagt eindeutig: "Die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder anordnet oder soweit der Betroffene eingewilligt hat." (§ 4 Abs. 1). Zur Verarbeitung zählt auch das Erheben der Daten durch Übernahme des entsprechenden Nachlasses.
Beispiele für personenbezogene Daten, die nicht mit Zustimmung des Betroffenen erhoben werden, wenn ein privater Nach- oder Vorlass übernommen wird:
- Briefe Dritter an den Nachlassgeber (Korrespondenz-Eingang)
- Fotos, die Dritte zeigen
- Ausführungen in Unterlagen (Briefen, Schriften) über Dritte, die Einzelangaben über persönliche Verhältnisse enthalten.
Denkbar ist aber auch, dass Bibliotheken Forschungsunterlagen und Sammlungen aus dem Bereich der qualitativen Sozialforschung übernehmen, in denen personenbezogene Daten nicht-anonymisiert vorhanden sind (z.B. Oral-History-Projekte).
Inbesondere bei Briefen ist es leicht vorstellbar, dass die nach § 4 Abs. 5 Thüringer DatenschutzG besonders "sensiblen" "Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen" betroffen sind, deren Erhebung nur unter strengen Voraussetzungen zulässig ist.
In allen diesen Fällen fehlt - anders als bei den Archiven, die mit den Archivgesetzen die entsprechende Rechtsgrundlage haben - die datenschutzrechtliche Befugnisnorm, die es den Bibliotheken ermöglicht, Unterlagen, in denen sich personenbezogene Daten befinden, zu übernehmen.
Das Sammeln von Nachlässen zählt gewohnheitsrechtlich zu den Aufgaben von Bibliothek. Für Thüringen siehe etwa:
http://hans.uni-erfurt.de/hans/index.htm
Datenschutzbeauftragte aber fragen, welche Norm und Aufgabenbeschreibung es Bibliotheken ermöglicht, personenbezogene Unterlagen zu übernehmen. Es gilt ja § 19 Thüringer DatenschutzG, dass die Kenntnis der Daten "zur Erfüllung der Aufgaben der erhebenden Stellen erforderlich ist".
Aus dem Gesetzentwurf der CDU - siehe Steinhauer zitiert in
http://archiv.twoday.net/stories/4832758/ - lassen sich solche rechtfertigenden Aufgaben aber nicht ohne weiteres ableiten.
"Das große Problem: Handschriften Dritter" hat der Bibliotheksjurist Harald Müller einen Abschnitt seines leider vergriffenen und auch nicht online verfügbaren, nach wie vor grundlegenden Buchs "Rechtsprobleme bei Nachlässen in Bibliotheken und Archiven", Hamburg/Augsburg 1983, S. 129-132 überschrieben. Damals ging es um die Katalogisierung. Müller stellte dar, dass die Katalogisierung nichtveröffentlichter Briefe noch lebender Absender nach den Datenschutzgesetzen nicht möglich ist. Er sprach von "katastrophalen" Konsequenzen für die Nachlaßpflege (S. 131).
Heute kann man diese Ausführungen, die meines Wissens zu keinerlei Konsequenzen in den Handschriftenabteilungen der Bibliotheken geführt haben, noch schärfer fassen: Nicht bereits die Katalogisierung der Briefe ist unzulässig, bereits die Übernahme in den Bibliotheksbestand kann ohne Rechtsgrundlage (oder Zustimmung aller Betroffenen) nicht erfolgen!
Wenn man an einen literarischen Nachlass denkt, so liegt auf der Hand, dass die beim Autor sich einfindenden oder von ihm geschaffenen Unterlagen Teil eines kommunikativen Netzes sind, bei dem es ständig um andere Personen geht. Autoren setzen sich mit anderen Autoren auseinander, Schriftstellerbriefe sind voll von Bemerkungen über Kolleginnen und Kollegen. Autoren, die in Gremien tätig sind, erheben eine Vielzahl personenbezogener Daten, von denen längst nicht alle öffentlichen Quellen entnommen sind.
Es ist schlicht und einfach nicht praktikabel und sinnvoll, aus einem Nachlass personenbezogene Daten Dritter auszusondern oder gar die Betroffenen um Zustimmung zu bitten.
Glücklicherweise gibt es ja für den Umgang mit Nachlässen in Archiven eine Rechtsgrundlage, die man ohne weiteres auf die Bibliotheken übertragen könnte.
Ich schlage daher folgende Datenschutzklausel für das Thüringer Bibliotheksgesetz vor:
Soweit Bibliotheken im Rahmen ihrer Dokumentationsaufgaben und insbesondere bei der Übernahme, Erschließung und Nutzbarmachung von aus wissenschaftlichen Gründen erhaltenswerten Nachlässen personenbezogene Daten lebender Personen im Sinne des Thüringer Datenschutzgesetzes verarbeiten, gelten die Vorschriften des Thüringer Archivgesetzes entsprechend.
Durch die an sich überflüssige Nennung lebender Personen soll klargestellt werden, dass sich die Sperrfristen des Thüringer Archivgesetzes nicht auf bereits Verstorbene beziehen. Das Archivgesetz hat sich datenschutzrechtlich bewährt, daher besteht kein Bedarf für eine eigenständige Regelung. Zugleich macht die Klausel deutlich, dass die Einwerbung von wissenschaftlich wertvollen Nachlässen zu den rechtmäßigen Aufgaben der Bibliotheken zählt. Künstlerische und heimatgeschichtliche Gründe können ohne weiteres den wissenschaftlichen Gründen subsummiert werden.
Eine Datenschutzklausel, die sich auf die Kernaufgabe der Bibliotheken, die Sammlung gedruckter Bücher oder anderer erschienenen Medien (z.B. DVDs), bezieht, wird hoffentlich nicht erforderlich sein, wenn der Thüringer Datenschutzbeauftragte mitspielt ...
KlausGraf - am Mittwoch, 2. April 2008, 23:17 - Rubrik: Datenschutz
Zwei neue Bücher aus dem Verlag Friedrich Pustet widmen sich der Geschichte des Hauses Baden im 19. Jahrhundert.
http://www.pustet.de/verlag/gesamtverzeichnis/Baden_2007_Internet.pdf
Uwe A. Oster: Die Großherzöge von Baden (1806-1918), Regensburg 2007. 240 S., 29,90 Euro
Anna Schiener: Markgräfin Amalie von Baden (1754-1832), Regensburg 2007, 208 S., 22 Euro
Das Buch über die Großherzöge von Baden erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch. Es zeichnet den Lebensweg der sieben badischen Großherzöge von 1806 bis 1918 nach. Auch wenn das Privatleben der Herrscher eine gewisse Rolle spielt, liegt der Schwerpunkt auf der politischen Geschichte. Das ansprechend illustrierte Buch ist allgemeinverständlich geschrieben und gut lesbar (der Autor ist stellvertretender Chefredakteur von "DAMALS"). Tiefgang darf man freilich nicht erwarten, struktur- und sozialgeschichtliche Zusammenhänge oder eingehender politische Analysen fehlen.
Bereits die Kapitelüberschriften:
Deutschlands bester Fürst? Karl Friedrich
Eine tragische Gestalt. Karl
Despot und Modernisierer. Ludwig I.
Der bescheidene „Bürgerfreund“. Leopold
Der Herrscher, der keiner war. Ludwig II.
Der ewige Landesvater. Friedrich I.
Herrscher ohne Chance. Friedrich II.
zeigen, dass die traditionelle Anhänglichkeit des badischen Volkes an seine Ausbeuter jedenfalls nicht auf ihren Leistungen als Großherzöge beruhen kann. Karl Friedrich und Friedrich I. können als gute Regenten durchgehen, aber der Rest?
Dr. Anna Schiener, freiberufliche Historikerin, durfte nach Herzenslust in dem - mir verschlossenen - Familienarchiv des Hauses Baden im Generallandesarchiv (siehe http://archiv.twoday.net/stories/3003267/ ) Unterlagen zu Markgräfin Amalie von Baden sichten, und "Seine Königliche Hoheit Bernhard Prinz von Baden" ließ es sich nicht nehmen, ein Geleitwort zu schreiben.
Das Buch weist vor allem Zitate in einem Anmerkungsapparat nach. Eine Hauptquelle stellten die (natürlich völlig unkritischen) Erinnerungen der Hofdame von Freystedt (1902 von Karl Obser herausgegeben, einsehbar bei Google USA) dar.
Verschlagen blickt die Markgräfin vom Buchumschlag, eine sympathische Person scheint die "Schwiegermutter Europas" nicht gewesen zu sein. Wieso sie unbedingt Thema einer Monographie werden musste, erschließt sich mir nicht, denn die Kammerdienerin-Perspektive der Autorin, die das Privatleben der Fürstin und das "Heiratskarussel", also die dynastischen Verbindungen ihrer Kinder, in den Vordergrund rückt, verhindert neue Einsichten.
WissenschaftlerInnen können auf die beiden Bücher verzichten, Leserinnen des Goldenen Blatts mögen das anders sehen.

http://www.pustet.de/verlag/gesamtverzeichnis/Baden_2007_Internet.pdf
Uwe A. Oster: Die Großherzöge von Baden (1806-1918), Regensburg 2007. 240 S., 29,90 Euro
Anna Schiener: Markgräfin Amalie von Baden (1754-1832), Regensburg 2007, 208 S., 22 Euro
Das Buch über die Großherzöge von Baden erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch. Es zeichnet den Lebensweg der sieben badischen Großherzöge von 1806 bis 1918 nach. Auch wenn das Privatleben der Herrscher eine gewisse Rolle spielt, liegt der Schwerpunkt auf der politischen Geschichte. Das ansprechend illustrierte Buch ist allgemeinverständlich geschrieben und gut lesbar (der Autor ist stellvertretender Chefredakteur von "DAMALS"). Tiefgang darf man freilich nicht erwarten, struktur- und sozialgeschichtliche Zusammenhänge oder eingehender politische Analysen fehlen.
Bereits die Kapitelüberschriften:
Deutschlands bester Fürst? Karl Friedrich
Eine tragische Gestalt. Karl
Despot und Modernisierer. Ludwig I.
Der bescheidene „Bürgerfreund“. Leopold
Der Herrscher, der keiner war. Ludwig II.
Der ewige Landesvater. Friedrich I.
Herrscher ohne Chance. Friedrich II.
zeigen, dass die traditionelle Anhänglichkeit des badischen Volkes an seine Ausbeuter jedenfalls nicht auf ihren Leistungen als Großherzöge beruhen kann. Karl Friedrich und Friedrich I. können als gute Regenten durchgehen, aber der Rest?
Dr. Anna Schiener, freiberufliche Historikerin, durfte nach Herzenslust in dem - mir verschlossenen - Familienarchiv des Hauses Baden im Generallandesarchiv (siehe http://archiv.twoday.net/stories/3003267/ ) Unterlagen zu Markgräfin Amalie von Baden sichten, und "Seine Königliche Hoheit Bernhard Prinz von Baden" ließ es sich nicht nehmen, ein Geleitwort zu schreiben.
Das Buch weist vor allem Zitate in einem Anmerkungsapparat nach. Eine Hauptquelle stellten die (natürlich völlig unkritischen) Erinnerungen der Hofdame von Freystedt (1902 von Karl Obser herausgegeben, einsehbar bei Google USA) dar.
Verschlagen blickt die Markgräfin vom Buchumschlag, eine sympathische Person scheint die "Schwiegermutter Europas" nicht gewesen zu sein. Wieso sie unbedingt Thema einer Monographie werden musste, erschließt sich mir nicht, denn die Kammerdienerin-Perspektive der Autorin, die das Privatleben der Fürstin und das "Heiratskarussel", also die dynastischen Verbindungen ihrer Kinder, in den Vordergrund rückt, verhindert neue Einsichten.
WissenschaftlerInnen können auf die beiden Bücher verzichten, Leserinnen des Goldenen Blatts mögen das anders sehen.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Kolorierte Filmstreifen aus dem Archiv von Montreal beispielsweise sind das Ausgangsmaterial der Moires. Rondepierre benutzt hier Bilder, die im Lauf der Zeit
korrodiert sind und deren Vermächtnis sich langsam auf dem nitrithaltigen Träger auflöst. ...."
Quelle:
http://www.villaoppenheim.de/presse/rondepierre.pdf
s. a. http://www.ericrondepierre.com/
korrodiert sind und deren Vermächtnis sich langsam auf dem nitrithaltigen Träger auflöst. ...."
Quelle:
http://www.villaoppenheim.de/presse/rondepierre.pdf
s. a. http://www.ericrondepierre.com/
Wolf Thomas - am Mittwoch, 2. April 2008, 21:51 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... So sammelt er Friedrich Mielke im oberbayerischen Konstein, einem verschlafenen Ort im Altmühltal, Baupläne, Fotografien und Modelle von Treppen aus der ganzen Welt. Über 10.000 sind es mittlerweile. Seine "Arbeitsstelle für Treppenforschung" beherberge die "weltweit größte Literatursammlung zur Treppenkunde", verkündet der emeritierte Professor für Denkmalpflege stolz. .... Zwar hat das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg angekündigt, seinen Nachlass zu übernehmen. Findet sich jedoch niemand, der sich dafür interessiert, werden seine Treppenpläne, Modelle und Dias wohl im dortigen Archiv verstauben - und mit ihnen eine ganze Wissenschaft. ...."
Quelle:
http://www.n-tv.de/942743.html
Nachtrag 04.04.2008:
Linkliste:
http://www.scalalogie.de/
http://www.treppenforschung.de/
http://lexikon.meyers.de/meyers/Scalalogie
http://de.wikipedia.org/wiki/Scalalogie
Quelle:
http://www.n-tv.de/942743.html
Nachtrag 04.04.2008:
Linkliste:
http://www.scalalogie.de/
http://www.treppenforschung.de/
http://lexikon.meyers.de/meyers/Scalalogie
http://de.wikipedia.org/wiki/Scalalogie
Wolf Thomas - am Mittwoch, 2. April 2008, 21:49 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
" .... Zu verdanken hat die Bodenseestadt die Ausstellung der Kooperation der Fotografenfamilie. Sohn und Multimediakünstler Alexander Lauterwasser, der ebenfalls in Überlingen zu Hause ist, hat Arbeiten aus dem umfangreichen Archiv seines Vaters ausgesucht. ...."
Quelle:
http://www.n-tv.de/943064.html
Quelle:
http://www.n-tv.de/943064.html
Wolf Thomas - am Mittwoch, 2. April 2008, 21:48 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wikipedia Review ist eine Plattform für Kritik an Wikipedia außerhalb des Einflussbereichs von Wikipedia. Seit heute gibt es dort auch ein Unterforum, das sich speziell der deutschsprachigen Ausgabe von Wikipedia widmet. Die Beiträge in diesem Unterforum dürfen auch gerne auf Deutsch geschrieben werden, obwohl der Rest des Forums und das Interface auf Englisch sind.
Link zum Unterforum:
http://wikipediareview.com/index.php?showforum=66

Link zum Unterforum:
http://wikipediareview.com/index.php?showforum=66

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN558636845
Gibts auch bei Google Book Search. Zum Herausgeber (GDZ hat erbärmliche Metadaten ohne seine Nennung):
http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Wigand
Moderne Ausgabe: Klemens Honselmann (Hrsg.): Die alten Mönchslisten und die Traditionen von Corvey (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen X = Abhandlungen zur Corveyer Geschichtsschreibung, Bd. 6, Teil 1), Paderborn 1982

Gibts auch bei Google Book Search. Zum Herausgeber (GDZ hat erbärmliche Metadaten ohne seine Nennung):
http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Wigand
Moderne Ausgabe: Klemens Honselmann (Hrsg.): Die alten Mönchslisten und die Traditionen von Corvey (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen X = Abhandlungen zur Corveyer Geschichtsschreibung, Bd. 6, Teil 1), Paderborn 1982

KlausGraf - am Mittwoch, 2. April 2008, 20:05 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Heinrich Hävecker, Johann Heinrich Hävecker. „... daß man an solchen schönen Gemählden und Bildern
gleichsam eine kleine Biebel habe ...“. Die barocke Dorfkirche zu Brumby im Kreis Schönebeck / Elbe und die
Pfarrfamilie Hävecker - die historische Beschreibung in der Kirchweihpredigt 1671. Mit einer Einleitung von
Bernhard Pabst. 2. erw. u. korr. Aufl. Bonn: Bearbeiter 2006 (1. Aufl. ebd. 2004).
© für die Bearbeitung 2004-2006 by Bernhard Pabst, Bonn.
© für die Transkription by Ev. Kirchengemeinde Brumby, Kantorberg 13, 39240 Brumby. Vervielfältigungen
und Veröffentlichungen nur mit Genehmigung.
PDF auf dem Server der ULB Halle mit entsprechendem Rechtevermerk in den Metadaten.
Der Rechtevermerk ist reines Copyfraud. An der originalgetreuen Transkription einer historischen Quelle entsteht kein Urheberrecht. Die in den 1990er Jahren veranlasste Transkription der Kirchweihpredigt im Pfarrerbuch stellt keine geschützte wissenschaftliche Ausgabe dar, und es liegt auch keine "Editio princeps" vor - http://archiv.twoday.net/stories/4807346/ . Zugang zu dem Text im Pfarrerbuch hatten nicht nur die Pfarrer, sondern höchstwahrscheinlich auch andere Personen (Honoratioren, Heimatforscher), der Beweis des Nichterscheinens kann also nicht erbracht werden.
gleichsam eine kleine Biebel habe ...“. Die barocke Dorfkirche zu Brumby im Kreis Schönebeck / Elbe und die
Pfarrfamilie Hävecker - die historische Beschreibung in der Kirchweihpredigt 1671. Mit einer Einleitung von
Bernhard Pabst. 2. erw. u. korr. Aufl. Bonn: Bearbeiter 2006 (1. Aufl. ebd. 2004).
© für die Bearbeitung 2004-2006 by Bernhard Pabst, Bonn.
© für die Transkription by Ev. Kirchengemeinde Brumby, Kantorberg 13, 39240 Brumby. Vervielfältigungen
und Veröffentlichungen nur mit Genehmigung.
PDF auf dem Server der ULB Halle mit entsprechendem Rechtevermerk in den Metadaten.
Der Rechtevermerk ist reines Copyfraud. An der originalgetreuen Transkription einer historischen Quelle entsteht kein Urheberrecht. Die in den 1990er Jahren veranlasste Transkription der Kirchweihpredigt im Pfarrerbuch stellt keine geschützte wissenschaftliche Ausgabe dar, und es liegt auch keine "Editio princeps" vor - http://archiv.twoday.net/stories/4807346/ . Zugang zu dem Text im Pfarrerbuch hatten nicht nur die Pfarrer, sondern höchstwahrscheinlich auch andere Personen (Honoratioren, Heimatforscher), der Beweis des Nichterscheinens kann also nicht erbracht werden.
KlausGraf - am Mittwoch, 2. April 2008, 17:34 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Gastbeitrag zur Reihe von Wolf Thomas mit Belegen zu Archivmetaphern und -zitaten, und zur Priesterschaft der Archivare ...
Weitere Nachweise:
(Fundorte: ad 1: Lesefrucht, die übrigen: Textkorpus von Google Book Search, deutscher Sprachraum; Hervorhebungen von uns)
Von den Stellen die er sich unter seinen Manuscripten, in dem kleinen Archive der Freundschaft, aufbehalten hat, sollen auch in diesem Andenken einige aufbehalten seyn; sie erinnern zu kräftig an den Geist ihres Siegelbewahrers, an den Grund und an das Element der Freundschaft, und deuten auf den tiefen Sinn eines Mannes, von dem die gelehrten und politischen Blätter nichts wissen.
(Sailer, J. M.: Winkelhofer, der Mensch und der Prediger. Ein Andenken für seine Freunde. München: Lentner 1807)
Weitere Nachweise:
Immer noch mußte unser Freund die Welt durch das wunderliche Medium seines Brinkmann ansehen. Da gab es gerade jetzt merkwürdige Ereignisse. ... Der Kampf zwischen Eberhard und dem jungen feurigen Kantianer Reinhold war wie eine Bombe in seine friedliche Zeit gefallen; die Agnes, Jenny, Auguste, Elise - wer könnte seine Freundinnen aufzählen? - stoben verschüchtert nach entgegengesetzten Seiten. Er verließ Halle mit seinem ganzen Archiv der Freundschaft, ..., voll von Zweifeln über seine Zukunft und sehr wenig tröstliche Erfahrungen über die Dauerhaftigkeit freundschaftlicher Liebe mit sich fortnehmend ...
(Leben Schleiermachers, von Wilhelm Dilthey, I. Bd. Jugendjahre und erste Bildung, Berlin 1870)
Sie sind der Mann, der Freund für den ich immer Sie hielt! Von allem was ich in den funfzig Jahren Ihnen schrieb möge die Welt alles zu lesen bekommen, es wäre mir gleichgültig, denn alles ist wahr, ..., besser aber ist, daß Sies nicht alles zu lesen bekommt. Als ein Heiligthum wirds im Tempel der Freundschaft niedergelegt! in ungeweihte Priesterhände kommt nichts, dafür wird bestens gesorgt! Ein naher Anverwandter wird Verwahrer, und so gehts auf die Nachwelt fort. Archiv der Freundschaft ist der Bücherschrank, der den Briefwechsel mit meinen Freunden enthält, überschrieben, und zu diesem Archiv hat nur der beeydigte Bücherverwahrer den Schlüßel. Also seyn Sie, wegen ihrer Briefe, nur immer unbesorgt; diese send' ich Ihnen nicht zurück; sie sind, und bleiben ein Denkmal unsrer Freundschaft.
(Gleim an Uz, Halberstadt, den 22ten May 1795)
Ihre Briefe sind mir ein kostbarer Schatz, welchen ich in dem Archiv der Freundschaft heilig aufbewahre. Da so manches schöne Wort vom Hauche der Luft verweht wird, so freuet es mich um desto mehr, daß ich diese schriftlichen bleibenden Zeugnisse, der schönen Empfindungen meiner Cecilia, in Besitz habe.
(aus Karl Philipp Moritz Briefroman "Die neue Cecilia" (Fragment, 1794), 7. Brief)
Die aus diesen Briefen von dem Herausg. getroffene Auswahl scheint dem Ref. so beschaffen zu sein, dass er die Beschuldigung nicht zu fürchten braucht, indiscret gespendet zu haben, was in dem geheimen Archive der Liebe und Freundschaft hätte verborgen bleiben sollen.
(anon. Rezension aus dem "Repertorium der gesammten deutschen Literatur" (1841) zu Liebetruts Biographie des Arnold August Sybel, zuletzt Diakonus zu Luckenwalde, nach seinem Leben und Wirken, und nach seinem schriftl. Nachlasse, Berlin 1841)
(Fundorte: ad 1: Lesefrucht, die übrigen: Textkorpus von Google Book Search, deutscher Sprachraum; Hervorhebungen von uns)
BCK - am Mittwoch, 2. April 2008, 16:48 - Rubrik: Wahrnehmung
http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/04/02/thuringer-bibliotheksrechtsgesetz-3985914
Auf ihrer Homepage hat die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag ihren Entwurf für ein Thüringer Bibliotheksgesetz vorgelegt.
Link [PDF].
Das Thüringer Bibliotheksrechtsgesetz ist ein Artikelgesetz und soll als LT-Drs. 4/3956 im nächsten Plenum in erster Lesung beraten werden.
Art. 1 enthält das Thüringer Bibliotheksgesetz. Es besteht aus 5 Paragraphen.
§ 1 trägt die Überschrift "Informationsfreiheit" und statuiert den freien und ungehinderten Zugang zu allen Bibliotheken in öffentlicher Trägerschaft im Sinne des Grundrechts der Informationsfreiheit.
§ 2 umschreibt in 6 Absätzen die verschiedenen Bibliotheksarten in Thüringen. In Absatz 1 wird die Landesbibliothek festgelegt. Absatz 2 behandelt die wissenschaftlichen Bibliotheken. Bemerkenswert ist, dass hier auch das elektronische Publizieren als bibliothekarische Aufgabe vermerkt wird. Absatz 3 handelt von den öffentlichen Bibliotheken und der Landesfachstelle. In Absatz 4 werden die Behördenbibliotheken und die Bibliothek des Thüringer Landtages unter Wahrung ihrer vorrangigen dienstlichen Funktion für öffentlich zugänglich erklärt. Absatz 5 behandelt die Schulbibliotheken. Absatz 6 würdigt die privaten und kirchlichen Bibliotheken.
§ 3 definiert Bibliotheken als Bildungseinrichtungen und betont die Kooperation von Bibliothek und Schule. Die Vermittlung von Lese-, Informations- und Medienkompetenz wird als bibliothekarische Aufgabe genannt.
§ 4 widmet sich dem kulturellen Erbe und damit dem Altbestand in Thüringer Bibliotheken, das zu erhalten und zu pflegen ist. Der öffentliche Gebrauch soll gewährleistet werden. Als Maßnahme hierzu wird auch die Digitalisierung genannt. Im Zusammenhang mit dem Altbestand enthält § 4 Abs. 2 eine Belegexemplarregelung. Damit wird eine notwendige gesetzliche Grundlage für entsprechende Vorschriften in den Benutzungsordnungen der Bibliotheken geschaffen. Die Belegexemplarregelung ist medienneutral formuliert.
§ 5 behandelt die Finanzierung. Es gibt keine Pflichtaufgabe. Die öffentlichen Bibliotheken sind aus den Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleiches zu finanzieren. Darüber hinaus aber gibt es eine Landesförderung nach Maßgabe zu erlassener Richtlinien.
Art. 2 enthält Änderungen im Thüringer Hochschulgesetz. Hervorgehoben sei, dass das zuständige Ministerium die Fachaufsicht erhält für Aufgaben, die über die bibliothekarische Versorgung der Hochschule hinausgehen.
Art. 3 ändert das Thüringer Pressegesetz. Für den Freistaat Thüringen wird ein elektronisches Pflichtexemplar eingeführt.
Art. 4 ändert das Thüringer Archivgesetz. In Entsprechung zur Belegexemplarregelung im Bibliotheksgesetz wird auch die schon vorhandene Belegexemplarregelung im Archivgesetz medienneutral gefasst.
Art. 5 regelt das Inkrafttreten.
Dem Gesetz ist eine sehr ausführliche Begründung beigegeben, die u.a. auch Aussagen zu Open Access enthält.
Ein erster Vergleich zu dem von der Opposition vorgelegten und vom Landesverband Thüringen im DBV erarbeiteten Gesetzentwurf (LT-Drs. 4/3503) zeigt, dass der Entwurf der CDU wesentlich juristischer gefasst ist und die bibliothekarischen Aussagen weniger in das Gesetz selbst, sondern mehr in die Begründung geschrieben hat. Weiterführend und positiv ist die Einführung des elektronischen Pflichtexemplars. In der Frage der Finanzierung ist der CDU-Entwurf genauso zurückhaltend wie der Entwurf der Opposition.
Mit Blick auf Pflichtaufgabe und verbindlicher Finanzierungsregelung bleibt der Entwurf der CDU hinter den Empfehlungen der EK Kultur zurück. Kritisch zu sehen ist insbesondere die ausdrückliche gesetzliche Festschreibung, dass Bibliotheken in den Kommunen freiwillige Aufgaben sind. Ansonsten erfüllt der Gesetzentwurf aber die Forderung der EK Kultur nach einer juristischen Aufwertung des Bibliothekswesens. Programmatisch sehr gelungen ist es, den Begriff "Informationsfreiheit" gleichsam als Leitbegriff dem Bibliotheksgesetz voranzustellen.
Mit Spannung darf die weitere politische Debatte erwartet werden, auch und gerade außerhalb Thüringens. Denn das von der CDU vorgelegte Gesetz zeigt, dass man juristisch substanzielle Bibliotheksgesetze formulieren kann, auch ohne zugleich finanzielle Utopien zu bemühen. Vielleicht mag das die Reserviertheit mancher Landes- und Kommunalpolitiker gegenüber Bibliotheksgesetzen zu mildern.
Der kulturpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Jörg Schwäblein, hat in einer Pressemitteilung angekündigt, dass eine Verabschiedung des Gesetzes noch vor der Sommerpause beabsichtigt ist. (Soweit Steinhauer, nähere Stellungnahme folgt.)
Zur fehlenden Datenschutzklausel:
http://archiv.twoday.net/stories/4834214/
Auf ihrer Homepage hat die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag ihren Entwurf für ein Thüringer Bibliotheksgesetz vorgelegt.
Link [PDF].
Das Thüringer Bibliotheksrechtsgesetz ist ein Artikelgesetz und soll als LT-Drs. 4/3956 im nächsten Plenum in erster Lesung beraten werden.
Art. 1 enthält das Thüringer Bibliotheksgesetz. Es besteht aus 5 Paragraphen.
§ 1 trägt die Überschrift "Informationsfreiheit" und statuiert den freien und ungehinderten Zugang zu allen Bibliotheken in öffentlicher Trägerschaft im Sinne des Grundrechts der Informationsfreiheit.
§ 2 umschreibt in 6 Absätzen die verschiedenen Bibliotheksarten in Thüringen. In Absatz 1 wird die Landesbibliothek festgelegt. Absatz 2 behandelt die wissenschaftlichen Bibliotheken. Bemerkenswert ist, dass hier auch das elektronische Publizieren als bibliothekarische Aufgabe vermerkt wird. Absatz 3 handelt von den öffentlichen Bibliotheken und der Landesfachstelle. In Absatz 4 werden die Behördenbibliotheken und die Bibliothek des Thüringer Landtages unter Wahrung ihrer vorrangigen dienstlichen Funktion für öffentlich zugänglich erklärt. Absatz 5 behandelt die Schulbibliotheken. Absatz 6 würdigt die privaten und kirchlichen Bibliotheken.
§ 3 definiert Bibliotheken als Bildungseinrichtungen und betont die Kooperation von Bibliothek und Schule. Die Vermittlung von Lese-, Informations- und Medienkompetenz wird als bibliothekarische Aufgabe genannt.
§ 4 widmet sich dem kulturellen Erbe und damit dem Altbestand in Thüringer Bibliotheken, das zu erhalten und zu pflegen ist. Der öffentliche Gebrauch soll gewährleistet werden. Als Maßnahme hierzu wird auch die Digitalisierung genannt. Im Zusammenhang mit dem Altbestand enthält § 4 Abs. 2 eine Belegexemplarregelung. Damit wird eine notwendige gesetzliche Grundlage für entsprechende Vorschriften in den Benutzungsordnungen der Bibliotheken geschaffen. Die Belegexemplarregelung ist medienneutral formuliert.
§ 5 behandelt die Finanzierung. Es gibt keine Pflichtaufgabe. Die öffentlichen Bibliotheken sind aus den Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleiches zu finanzieren. Darüber hinaus aber gibt es eine Landesförderung nach Maßgabe zu erlassener Richtlinien.
Art. 2 enthält Änderungen im Thüringer Hochschulgesetz. Hervorgehoben sei, dass das zuständige Ministerium die Fachaufsicht erhält für Aufgaben, die über die bibliothekarische Versorgung der Hochschule hinausgehen.
Art. 3 ändert das Thüringer Pressegesetz. Für den Freistaat Thüringen wird ein elektronisches Pflichtexemplar eingeführt.
Art. 4 ändert das Thüringer Archivgesetz. In Entsprechung zur Belegexemplarregelung im Bibliotheksgesetz wird auch die schon vorhandene Belegexemplarregelung im Archivgesetz medienneutral gefasst.
Art. 5 regelt das Inkrafttreten.
Dem Gesetz ist eine sehr ausführliche Begründung beigegeben, die u.a. auch Aussagen zu Open Access enthält.
Ein erster Vergleich zu dem von der Opposition vorgelegten und vom Landesverband Thüringen im DBV erarbeiteten Gesetzentwurf (LT-Drs. 4/3503) zeigt, dass der Entwurf der CDU wesentlich juristischer gefasst ist und die bibliothekarischen Aussagen weniger in das Gesetz selbst, sondern mehr in die Begründung geschrieben hat. Weiterführend und positiv ist die Einführung des elektronischen Pflichtexemplars. In der Frage der Finanzierung ist der CDU-Entwurf genauso zurückhaltend wie der Entwurf der Opposition.
Mit Blick auf Pflichtaufgabe und verbindlicher Finanzierungsregelung bleibt der Entwurf der CDU hinter den Empfehlungen der EK Kultur zurück. Kritisch zu sehen ist insbesondere die ausdrückliche gesetzliche Festschreibung, dass Bibliotheken in den Kommunen freiwillige Aufgaben sind. Ansonsten erfüllt der Gesetzentwurf aber die Forderung der EK Kultur nach einer juristischen Aufwertung des Bibliothekswesens. Programmatisch sehr gelungen ist es, den Begriff "Informationsfreiheit" gleichsam als Leitbegriff dem Bibliotheksgesetz voranzustellen.
Mit Spannung darf die weitere politische Debatte erwartet werden, auch und gerade außerhalb Thüringens. Denn das von der CDU vorgelegte Gesetz zeigt, dass man juristisch substanzielle Bibliotheksgesetze formulieren kann, auch ohne zugleich finanzielle Utopien zu bemühen. Vielleicht mag das die Reserviertheit mancher Landes- und Kommunalpolitiker gegenüber Bibliotheksgesetzen zu mildern.
Der kulturpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Jörg Schwäblein, hat in einer Pressemitteilung angekündigt, dass eine Verabschiedung des Gesetzes noch vor der Sommerpause beabsichtigt ist. (Soweit Steinhauer, nähere Stellungnahme folgt.)
Zur fehlenden Datenschutzklausel:
http://archiv.twoday.net/stories/4834214/
KlausGraf - am Mittwoch, 2. April 2008, 16:36 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Am Freitag, 4. April 2008 findet um 10.00 Uhr im Vorarlberger Landesarchiv in Bregenz (Kirchstraße 28) die Präsentation
"10.000 Vorarlberger Urkunden im Internet"
( http://www.monasterium.net )
mit
Landesstatthalter Mag. Markus Wallner
Landesarchivar Dr. Alois Niederstätter
Dr. Thomas Aigner
(Diözesanarchiv St. Pölten)
Dr. Manfred Tschaikner
(Vorarlberger Landesarchiv)
statt. Das Vorarlberger Landesarchiv nützt die Möglichkeit, im Rahmen des europäischen Projekts "MOnasteriuM.net" als erstes Landesarchiv seinen gesamten Urkundenbestand, der bis ins Jahr 1139 zurückreicht, digital zu präsentieren. Sämtliche Urkunden stehen nun als originalgetreue Abbildungen samt Inhaltsangaben weltweit im Internet zur Verfügung.
Wir hoffen, dass Sie diesen Termin wahrnehmen können und freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen!
Quelle: Archivliste
"10.000 Vorarlberger Urkunden im Internet"
( http://www.monasterium.net )
mit
Landesstatthalter Mag. Markus Wallner
Landesarchivar Dr. Alois Niederstätter
Dr. Thomas Aigner
(Diözesanarchiv St. Pölten)
Dr. Manfred Tschaikner
(Vorarlberger Landesarchiv)
statt. Das Vorarlberger Landesarchiv nützt die Möglichkeit, im Rahmen des europäischen Projekts "MOnasteriuM.net" als erstes Landesarchiv seinen gesamten Urkundenbestand, der bis ins Jahr 1139 zurückreicht, digital zu präsentieren. Sämtliche Urkunden stehen nun als originalgetreue Abbildungen samt Inhaltsangaben weltweit im Internet zur Verfügung.
Wir hoffen, dass Sie diesen Termin wahrnehmen können und freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen!
Quelle: Archivliste
KlausGraf - am Mittwoch, 2. April 2008, 16:31 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nach dem Ausscheiden des dafür zuständigen Bibliothekars Rainer Pörzgen wird die Datenbank Lüneburger Judaika (3000 Einträge mit selbstständiger und unselbstständiger Literatur aus den Beständen der Universitätsbibliothek Lüneburg)
http://db.uni-lueneburg.de/db/judaika/index.php
Mitte April 2008 abgeschaltet, meldet netbib.
Hier sollte dringend eine andere Lösung gefunden werden!
http://db.uni-lueneburg.de/db/judaika/index.php
Mitte April 2008 abgeschaltet, meldet netbib.
Hier sollte dringend eine andere Lösung gefunden werden!
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Besonders dankbar bin ich Christoph Graf Waldburg, dass er zu dem folgenden Mailinterview über das Wolfegger Hausbuch
(Gesamtübersicht unserer Meldungen: http://archiv.twoday.net/stories/4775647/ ) bereit war.
Graf Waldburg, Sie haben intensiv mit dem "Mittelalterlichen Hausbuch" gearbeitet, sogar ein Buch darüber geschrieben ("Venus und Mars"). Was bedeutet diese Handschrift für Sie persönlich?
Einen Aspekt finde ich natürlich besonders spannend: Das Rätselhafte und das schwer Kategorisierbare des Hausbuchs. Es fasziniert mich. Darüber hinaus sind es die Leichtigkeit, Heiterkeit und das sichere Erfassen menschlichen Tuns, die nicht nur für mich den Reiz ausmachen.
Wie stehen Sie zu Daniel Hess?
Als detailgenauen Wissenschaftler schätze ich ihn. Im Bereich des Hausbuchs kann ich viele Schlüsse nicht teilen.
Ich habe die Frage der Künstler nur gestreift. Denn letztlich ist der Streit über die Zahl der beteiligten Hände fast so alt wie die Forschung über das Hausbuch. Bereits die Autoren des Faksimiles von 1912 gingen anfangs von mehreren, dann von einem Künstler für die Hauptzeichnungen aus. Die Unterschiede sind offensichtlich. Rüdiger Becksmann nannte 1968 sechs Hände, die von Daniel Hess aufgenommen wurden. Ich sehe eine gewisse Stagnation in dieser Frage.
Auch die Trennung des Hausbuchs in zwei Teile halte ich für riskant. Das Hausbuch mit seiner eigenartigen Mischung verleitet zur Abtrennung des Teils, mit dem Geisteswissenschaftler nichts anfangen können, Bergbau und Krieg. Von dem Inhalt Kriegstechnik und Bergbau auf den Beruf des Besitzers zu schließen, halte ich für sehr gewagt. Mehr als ein bloßes Interesse an den Themen kann nicht vermutet werden. Beispielsweise der Bellifortis, eine beliebte kriegstechnische Bilderhandschrift, findet sich in Ratsbibliotheken und bei Bürgerlichen. Von daher ist der Kreis der in Fragekommenden sehr weit. Dagegen lässt sich feststellen, dass die Mitarbeiter bei dem neuen Faksimile jeder für sich eine Ordnung festgestellt haben. Ich selbst konnte feststellen, dass die sogenannten Genreszenen keine sind, sondern sich paarweise aufeinander beziehen. Ich vermute einen Minnezyklus, aber hier ist noch Forschungsarbeit vonnöten.
Wie haben Sie vom Verkauf des Hausbuchs erfahren?
Durch die Medien.
Wie bewerten Sie den Verkauf?
Ich habe natürlich eine emotionale Beziehung zum Hausbuch, als Teil des Kulturerbes meiner Familie. Von daher empfinde ich es als Verlust.
Stehen Sie mit dieser Position in der Familie allein?
Nein. Die Stimmung bei den Familienmitgliedern, mit denen ich gesprochen habe, ist ähnlich meiner. Und das nicht nur in dem Zweig, der sich mit historischen Fragen beschäftigt. Mein Grossvater hatte ein Buch über das Nord- und Südreich der Staufer verfasst und von daher sehe ich mich in seiner Tradition.
Vor etlichen Jahren haben wir uns schon einmal über die Kunstschätze Ihres Hauses Waldburg-Wolfegg und Waldsee unterhalten. Damals haben Sie das Traditionsbewusstsein der Familie unterstrichen, das für den Zusammenhalt der einzigartigen Kunstschätze in Wolfegg sorgt. Sind Sie nach dem Hausbuch-Verkauf nun mehr in Sorge?
Ich hoffe natürlich sehr, dass der Trend sich ändert und eine für die Familie annehmbare Lösung gefunden wird.
Was sollte Ihrer Ansicht nach mit dem Hausbuch geschehen?
Idealerweise wäre es im deutschsprachigen Raum untergebracht. Es wäre schön, wenn es zumindest im europäischen Raum bleiben würde. Der Zugang wäre sicher ähnlich eingeschränkt, wenn es in die Obhut des Staates käme. In der Verantwortung meiner Familie sind allein drei Faksimiles entstanden und wurden der Öffentlichkeit vorgestellt. Ein engagierter Privatmann könnte ebenfalls das Hausbuch verantwortungsvoll erhalten. Vom Standpunkt des Kunstwerks aus gesehen wäre es natürlich am besten, es gut zu lagern und wenig zu strapazieren. Wer den Schutz gewährt, ist zweitrangig.
Muss es nicht alarmierend wirken, wenn der Chef des Hauses in einem im Ausstellungskatalog "Adel im Wandel" (Sigmaringen 2006) abgedruckten Interview moderne betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte in den Vordergrund stellt und sagt: "Man darf der Dynamik in den kunstsammlerischen Kreisen nicht zu viel in den Weg legen"?
Es gibt andere Interviews von Familienchefs in dem Band, die meinen Standpunkt eher vertreten.
Wie sehen Sie die Rolle des Kunsthandels beim "Ausverkauf" traditioneller adeliger Sammlungen?
Dass Antiquitätenhändler diese Sammlungen umschwirren wie Motten das Licht, ist klar. Es sind Händler und dieses Verhalten ist ihnen nicht vorzuwerfen. Als Eigentümer muss niemand darauf eingehen und es gibt einige Fürstenhäuser, bei denen diese Verkäufer Persona non grata sind. Wobei die Vorgehensweise oft sehr subtil ist, persönliche Beziehungen und geschäftliche werden vermischt und Verkäufe als wirtschaftlicher Erfolg verkauft. Unentgeltlich und freundschaftlich werden Sammlungen katalogisiert und ganz nebenbei pekuniär bewertet. Bei passender Gelegenheit wird auf aktuelle Verkaufspreise hingewiesen, der Eigentümer geködert. Der Einsatz von zumeist schlecht bezahlten, meist adligen jungen Damen bis zu gar fürstlichen Vertretern dient natürlich nebenbei dem Status der Firmen gegenüber den nichtadligen Käufern. Aber wie gesagt ist dies nicht verwerflich, sondern das berechtigte Interesse jeder Firma, sich ein Profil zu geben, das auf dem Markt Erfolg verspricht.
Wenn die familien-interne, durch Erbverzichte abgesicherte Fortsetzung des Fideikommiss-Gedankens, der den Zusammenhalt des Vermögens in der Hand des Chefs des Hauses vorsah, um den "Splendor" des Hauses zu bewahren, an Geltung verliert - was könnte das für die Waldburger Kunstsammlungen bedeuten?
Ich hoffe, dass „Nachhaltigkeit" auch in Kulturdingen üblich wird. Denn die Konsequenzen in ähnlich gelagerten Fällen könnte sein, dass Zweit- und Drittgeborene nicht mehr einsehen, im Erbfall auf einen Teil des Hauptbesitzes zu verzichten, wenn dieser dann als Privatvermögen angesehen wird, über das frei verfügt werden kann. Eine Zersplitterung führt zum wirtschaftlichen Niedergang und in Folge verschwindet das kulturelle Erbe.
Ich fürchte, dass wir mit diesem Problem langfristig verstärkt zu kämpfen haben werden, denn alte Rechtformen, die nur noch moralisch gehalten werden, werden sich nicht auf Dauer halten lassen.
Gibt es etwas, was der Staat oder die Bürgergesellschaft Ihrer Ansicht nach tun könnte, um das einzigartige Ensemble der Sammlungen Max Willibalds aus dem 17. Jahrhundert, zu dem ja neben dem Kupferstichkabinett auch die noch unerforschte Bibliothek gehört, dauerhaft zu bewahren?
Das kann ich nicht beantworten.
Ich habe ja 2005 in meinem Artikel "Adelige Schatzhäuser in Gefahr" (in der Kunstchronik, Volltext: http://archiv.twoday.net/stories/2944976/ ) auf den zunehmenden Zerfall gewachsener alter Sammlungen in Adelshand hingewiesen. Wie sehen Sie die Problematik, was sollte man tun, um diese
Schätze zu retten?
Eine sehr schwere Frage. Zwang und größere staatliche Kontrolle sind eine Strafe für alle diejenigen, die sich um ihr kulturelles Erbe kümmern. Im Denkmalbereich zeigt es sich, dass der Einsatz der Eigentümer - so unzureichend er auch sein mag - immer noch besser ist als die Verwaltung von Außen. Ich glaube, der beste Weg ist eine Förderung der Eigentümer und eine Bestärkung derjenigen, die sich für Kultur einsetzen.
Gleichzeitig wäre es hilfreich, wenn im Falle eines Verkaufs versucht würde, die Kulturgüter am Ort zu halten und auch einen fairen Preis zu zahlen. Politisch ist dies ein Dilemma, denn erst die öffentliche Aufregung macht mancherorts den ideellen Wert vermittelbar. In der Vergangenheit gab es Fälle, in denen Kulturgut staatlichen Stellen zu einem günstigen Wert angeboten wurde, dies zurückgewiesen und dann doch zum Marktwert gekauft wurde. Ein Imageschaden für alle Seiten.
Sie heissen "Christoph Hubertus Willibald Maria Maximilian Eusebius Graf von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee", Ihre Ehefrau ist eine geborene Freiin von Rosenberg, und auch Ihre Kinder haben 4-5 Vornamen. Was bedeutet für Sie persönlich "Adel"?
Titel wurden mit dem Zusammenbruch der Monarchie abgeschafft und gelten heute als Bestandteil des Namens. Von daher gilt der Spagat des „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen". Der Begriff Adel ist sehr abstrakt und allgemein. Er beinhaltet u.a. das Bemühen um ein kulturelles und moralisches Erbe, aber auch die Verpflichtung dazu. Die Familie Waldburg und der „Splendor" - wie Sie es nennen - sind mir wichtig. Mit meiner Frau und unseren Kindern bemühe ich mich, die traditionellen Werte des Adels zu bewahren und zu leben. Dies tun aber viele Familien, ob adelig oder nicht, deren Selbstverständnis über die aktuell Lebenden hinausgeht.
Sie leben im zauberhaften Wasserschloss Unsleben. Was tun Sie selbst, um adelige Kulturgüter zu bewahren und nutzbar zu machen?
Ich selbst tue momentan aus Zeitmangel zu wenig, da wir erst vor einigen Jahren nach Unsleben gezogen sind. Die Wirtschaftlichkeit ist im Moment noch ein grosses Thema für uns, aber gleichwohl unterstütze ich und freue mich über die wissenschaftliche Bearbeitung des Baues und seiner Bewohner. Das nur einen Schrank füllende Archiv steht für wissenschaftliche Bearbeitung offen. Das Schloss stammt von der Familie meiner Mutter, der Freiherrn v. Habermann, die als Juristen in Würzburg im 18. Jahrhundert geadelt wurden. Es ist ein Teil der lokalen Geschichte und daraus erwachsen gewisse Verpflichtungen, denen ich versuche, nachzukommen. Ich möchte auch das Bild geraderücken: Der weitaus grösste Teil der Privatbesitzer historischer Adelssitze kümmert sich um den Besitz und erhält sein Kulturelles Erbe. Nur wenige - meist aus finanzieller Not – „schlagen aus der Art"
Vielen Dank für das Interview!

(Gesamtübersicht unserer Meldungen: http://archiv.twoday.net/stories/4775647/ ) bereit war.
Graf Waldburg, Sie haben intensiv mit dem "Mittelalterlichen Hausbuch" gearbeitet, sogar ein Buch darüber geschrieben ("Venus und Mars"). Was bedeutet diese Handschrift für Sie persönlich?
Einen Aspekt finde ich natürlich besonders spannend: Das Rätselhafte und das schwer Kategorisierbare des Hausbuchs. Es fasziniert mich. Darüber hinaus sind es die Leichtigkeit, Heiterkeit und das sichere Erfassen menschlichen Tuns, die nicht nur für mich den Reiz ausmachen.
Wie stehen Sie zu Daniel Hess?
Als detailgenauen Wissenschaftler schätze ich ihn. Im Bereich des Hausbuchs kann ich viele Schlüsse nicht teilen.
Ich habe die Frage der Künstler nur gestreift. Denn letztlich ist der Streit über die Zahl der beteiligten Hände fast so alt wie die Forschung über das Hausbuch. Bereits die Autoren des Faksimiles von 1912 gingen anfangs von mehreren, dann von einem Künstler für die Hauptzeichnungen aus. Die Unterschiede sind offensichtlich. Rüdiger Becksmann nannte 1968 sechs Hände, die von Daniel Hess aufgenommen wurden. Ich sehe eine gewisse Stagnation in dieser Frage.
Auch die Trennung des Hausbuchs in zwei Teile halte ich für riskant. Das Hausbuch mit seiner eigenartigen Mischung verleitet zur Abtrennung des Teils, mit dem Geisteswissenschaftler nichts anfangen können, Bergbau und Krieg. Von dem Inhalt Kriegstechnik und Bergbau auf den Beruf des Besitzers zu schließen, halte ich für sehr gewagt. Mehr als ein bloßes Interesse an den Themen kann nicht vermutet werden. Beispielsweise der Bellifortis, eine beliebte kriegstechnische Bilderhandschrift, findet sich in Ratsbibliotheken und bei Bürgerlichen. Von daher ist der Kreis der in Fragekommenden sehr weit. Dagegen lässt sich feststellen, dass die Mitarbeiter bei dem neuen Faksimile jeder für sich eine Ordnung festgestellt haben. Ich selbst konnte feststellen, dass die sogenannten Genreszenen keine sind, sondern sich paarweise aufeinander beziehen. Ich vermute einen Minnezyklus, aber hier ist noch Forschungsarbeit vonnöten.
Wie haben Sie vom Verkauf des Hausbuchs erfahren?
Durch die Medien.
Wie bewerten Sie den Verkauf?
Ich habe natürlich eine emotionale Beziehung zum Hausbuch, als Teil des Kulturerbes meiner Familie. Von daher empfinde ich es als Verlust.
Stehen Sie mit dieser Position in der Familie allein?
Nein. Die Stimmung bei den Familienmitgliedern, mit denen ich gesprochen habe, ist ähnlich meiner. Und das nicht nur in dem Zweig, der sich mit historischen Fragen beschäftigt. Mein Grossvater hatte ein Buch über das Nord- und Südreich der Staufer verfasst und von daher sehe ich mich in seiner Tradition.
Vor etlichen Jahren haben wir uns schon einmal über die Kunstschätze Ihres Hauses Waldburg-Wolfegg und Waldsee unterhalten. Damals haben Sie das Traditionsbewusstsein der Familie unterstrichen, das für den Zusammenhalt der einzigartigen Kunstschätze in Wolfegg sorgt. Sind Sie nach dem Hausbuch-Verkauf nun mehr in Sorge?
Ich hoffe natürlich sehr, dass der Trend sich ändert und eine für die Familie annehmbare Lösung gefunden wird.
Was sollte Ihrer Ansicht nach mit dem Hausbuch geschehen?
Idealerweise wäre es im deutschsprachigen Raum untergebracht. Es wäre schön, wenn es zumindest im europäischen Raum bleiben würde. Der Zugang wäre sicher ähnlich eingeschränkt, wenn es in die Obhut des Staates käme. In der Verantwortung meiner Familie sind allein drei Faksimiles entstanden und wurden der Öffentlichkeit vorgestellt. Ein engagierter Privatmann könnte ebenfalls das Hausbuch verantwortungsvoll erhalten. Vom Standpunkt des Kunstwerks aus gesehen wäre es natürlich am besten, es gut zu lagern und wenig zu strapazieren. Wer den Schutz gewährt, ist zweitrangig.
Muss es nicht alarmierend wirken, wenn der Chef des Hauses in einem im Ausstellungskatalog "Adel im Wandel" (Sigmaringen 2006) abgedruckten Interview moderne betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte in den Vordergrund stellt und sagt: "Man darf der Dynamik in den kunstsammlerischen Kreisen nicht zu viel in den Weg legen"?
Es gibt andere Interviews von Familienchefs in dem Band, die meinen Standpunkt eher vertreten.
Wie sehen Sie die Rolle des Kunsthandels beim "Ausverkauf" traditioneller adeliger Sammlungen?
Dass Antiquitätenhändler diese Sammlungen umschwirren wie Motten das Licht, ist klar. Es sind Händler und dieses Verhalten ist ihnen nicht vorzuwerfen. Als Eigentümer muss niemand darauf eingehen und es gibt einige Fürstenhäuser, bei denen diese Verkäufer Persona non grata sind. Wobei die Vorgehensweise oft sehr subtil ist, persönliche Beziehungen und geschäftliche werden vermischt und Verkäufe als wirtschaftlicher Erfolg verkauft. Unentgeltlich und freundschaftlich werden Sammlungen katalogisiert und ganz nebenbei pekuniär bewertet. Bei passender Gelegenheit wird auf aktuelle Verkaufspreise hingewiesen, der Eigentümer geködert. Der Einsatz von zumeist schlecht bezahlten, meist adligen jungen Damen bis zu gar fürstlichen Vertretern dient natürlich nebenbei dem Status der Firmen gegenüber den nichtadligen Käufern. Aber wie gesagt ist dies nicht verwerflich, sondern das berechtigte Interesse jeder Firma, sich ein Profil zu geben, das auf dem Markt Erfolg verspricht.
Wenn die familien-interne, durch Erbverzichte abgesicherte Fortsetzung des Fideikommiss-Gedankens, der den Zusammenhalt des Vermögens in der Hand des Chefs des Hauses vorsah, um den "Splendor" des Hauses zu bewahren, an Geltung verliert - was könnte das für die Waldburger Kunstsammlungen bedeuten?
Ich hoffe, dass „Nachhaltigkeit" auch in Kulturdingen üblich wird. Denn die Konsequenzen in ähnlich gelagerten Fällen könnte sein, dass Zweit- und Drittgeborene nicht mehr einsehen, im Erbfall auf einen Teil des Hauptbesitzes zu verzichten, wenn dieser dann als Privatvermögen angesehen wird, über das frei verfügt werden kann. Eine Zersplitterung führt zum wirtschaftlichen Niedergang und in Folge verschwindet das kulturelle Erbe.
Ich fürchte, dass wir mit diesem Problem langfristig verstärkt zu kämpfen haben werden, denn alte Rechtformen, die nur noch moralisch gehalten werden, werden sich nicht auf Dauer halten lassen.
Gibt es etwas, was der Staat oder die Bürgergesellschaft Ihrer Ansicht nach tun könnte, um das einzigartige Ensemble der Sammlungen Max Willibalds aus dem 17. Jahrhundert, zu dem ja neben dem Kupferstichkabinett auch die noch unerforschte Bibliothek gehört, dauerhaft zu bewahren?
Das kann ich nicht beantworten.
Ich habe ja 2005 in meinem Artikel "Adelige Schatzhäuser in Gefahr" (in der Kunstchronik, Volltext: http://archiv.twoday.net/stories/2944976/ ) auf den zunehmenden Zerfall gewachsener alter Sammlungen in Adelshand hingewiesen. Wie sehen Sie die Problematik, was sollte man tun, um diese
Schätze zu retten?
Eine sehr schwere Frage. Zwang und größere staatliche Kontrolle sind eine Strafe für alle diejenigen, die sich um ihr kulturelles Erbe kümmern. Im Denkmalbereich zeigt es sich, dass der Einsatz der Eigentümer - so unzureichend er auch sein mag - immer noch besser ist als die Verwaltung von Außen. Ich glaube, der beste Weg ist eine Förderung der Eigentümer und eine Bestärkung derjenigen, die sich für Kultur einsetzen.
Gleichzeitig wäre es hilfreich, wenn im Falle eines Verkaufs versucht würde, die Kulturgüter am Ort zu halten und auch einen fairen Preis zu zahlen. Politisch ist dies ein Dilemma, denn erst die öffentliche Aufregung macht mancherorts den ideellen Wert vermittelbar. In der Vergangenheit gab es Fälle, in denen Kulturgut staatlichen Stellen zu einem günstigen Wert angeboten wurde, dies zurückgewiesen und dann doch zum Marktwert gekauft wurde. Ein Imageschaden für alle Seiten.
Sie heissen "Christoph Hubertus Willibald Maria Maximilian Eusebius Graf von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee", Ihre Ehefrau ist eine geborene Freiin von Rosenberg, und auch Ihre Kinder haben 4-5 Vornamen. Was bedeutet für Sie persönlich "Adel"?
Titel wurden mit dem Zusammenbruch der Monarchie abgeschafft und gelten heute als Bestandteil des Namens. Von daher gilt der Spagat des „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen". Der Begriff Adel ist sehr abstrakt und allgemein. Er beinhaltet u.a. das Bemühen um ein kulturelles und moralisches Erbe, aber auch die Verpflichtung dazu. Die Familie Waldburg und der „Splendor" - wie Sie es nennen - sind mir wichtig. Mit meiner Frau und unseren Kindern bemühe ich mich, die traditionellen Werte des Adels zu bewahren und zu leben. Dies tun aber viele Familien, ob adelig oder nicht, deren Selbstverständnis über die aktuell Lebenden hinausgeht.
Sie leben im zauberhaften Wasserschloss Unsleben. Was tun Sie selbst, um adelige Kulturgüter zu bewahren und nutzbar zu machen?
Ich selbst tue momentan aus Zeitmangel zu wenig, da wir erst vor einigen Jahren nach Unsleben gezogen sind. Die Wirtschaftlichkeit ist im Moment noch ein grosses Thema für uns, aber gleichwohl unterstütze ich und freue mich über die wissenschaftliche Bearbeitung des Baues und seiner Bewohner. Das nur einen Schrank füllende Archiv steht für wissenschaftliche Bearbeitung offen. Das Schloss stammt von der Familie meiner Mutter, der Freiherrn v. Habermann, die als Juristen in Würzburg im 18. Jahrhundert geadelt wurden. Es ist ein Teil der lokalen Geschichte und daraus erwachsen gewisse Verpflichtungen, denen ich versuche, nachzukommen. Ich möchte auch das Bild geraderücken: Der weitaus grösste Teil der Privatbesitzer historischer Adelssitze kümmert sich um den Besitz und erhält sein Kulturelles Erbe. Nur wenige - meist aus finanzieller Not – „schlagen aus der Art"
Vielen Dank für das Interview!

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.datenschutz-berlin.de/attachments/438/Jahresbericht_2007_DIN_A5.pdf?1207132313
Zum Informationsfreiheitsgesetz wird S. 232 festgestellt:
"Die Urheberrechtsklausel in § 13 Abs. 5 IFG betrifft nur die Frage der Verwertung erlangter Informationen. Sie steht dem Informationszugang als solchem (durch Herausgabe von Kopien) nicht entgegen."
Siehe dazu auch den nächsten dort dargestellten Fall.
Zu diesem Thema http://archiv.twoday.net/stories/4130906/
[Zu UrhG vs. IFG
http://archiv.twoday.net/search?q=urhg+ifg ]
Zum Informationsfreiheitsgesetz wird S. 232 festgestellt:
"Die Urheberrechtsklausel in § 13 Abs. 5 IFG betrifft nur die Frage der Verwertung erlangter Informationen. Sie steht dem Informationszugang als solchem (durch Herausgabe von Kopien) nicht entgegen."
Siehe dazu auch den nächsten dort dargestellten Fall.
Zu diesem Thema http://archiv.twoday.net/stories/4130906/
[Zu UrhG vs. IFG
http://archiv.twoday.net/search?q=urhg+ifg ]
KlausGraf - am Mittwoch, 2. April 2008, 13:59 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Heft 1/2008 der Zeitschrift Archiv und Wirtschaft enthält folgende Beiträge:
Aufsätze:
Susan Becker: „Tradition verpflichtet zum Fortschritt“ – Erinnerungskultur im Unternehmen am Beispiel der BASF AG
Frank Wittendorfer: Warum ist Siemens in München?
Gabriele Fünfrock: Die Anfänge des Archivs der Dyckerhoff AG
Jana Hoffmann, Britta Weschke u. Claudia Wöhnl: Vom Sammeln, Bewahren und Ausstellen historischer Schätze – Sparkassenmuseen in Sachsen
Hans Eyvind Næss: Tried and trusted strategies for archivists: Overcome frontiers, take part in the international community and boost your vigour!
Berichte:
Katja Glock; Bayer – „eine spannende Geschichte“
Horst A. Wessel: Filme in Archiven: Sammeln – Sichern – Sichten. Öffentliche Fachtagung des AK Filmarchivierung NRW am 4. Oktober 2007 in Schwerte
Renate Köhne-Lindenlaub u. Manfred Rasch: 30 Jahre Regionaler Erfahrungsaustausch Ruhrge-biet
Rezensionen:
Martin Burkhardt: Arbeiten im Archiv. Praktischer Leitfaden für Historiker und andere Nutzer
Sabine Brenner-Wilczek, Gertrude Cepl-Kaufman u. Max Plassmann: Einführung in die moder-ne Archivarbeit (Johannes Grützmacher)
Britta Leise: Die Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e.V. (VdW). Aspekte zur Entwick-lung des Archivwesens der Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland bis 1990 (Volker Beckmann)
Hans-Jürgen Gerhard u. Alexander Engel: Preisgeschichte der vorindustriellen Zeit. Ein Kom-pendium auf Basis ausgewählter Hamburger Materialien (Wilfried Reininghaus)
Stephan Lindner: Hoechst – ein I. G. Farben Werk im Dritten Reich (Harald Wixforth)
Jennifer Schevardo: Vom Wert des Notwendigen. Preispolitik und Lebensstandard in der DDR der fünfziger Jahre (Gerhard Neumeier)
Peter Danylow u. Ulrich S. Soénius (Hrsg.): Otto Wolff. Ein Unternehmen zwischen Wirtschaft und Politik (Harald Wixforth)
Karsten Rudolph u. Jana Wüstenhagen: Große Politik – kleine Begegnungen. Die Leipziger Mes-se im Ost-West-Konflikt (Evelyn Kroker)
Kim Christian Priemel: Flick. Eine Konzerngeschichte vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik (Christian Marx)
Konrad Schneider (Hrsg.): Gewerbe im Kronthal. Mineralwasser und Ziegel aus dem Taunus (Wilfried Reininghaus)
Nachrichten
Impressum
www.wirtschaftsarchive.de
Jahresabonnement: 26 €
Einzelheft: 8 €
Aufsätze:
Susan Becker: „Tradition verpflichtet zum Fortschritt“ – Erinnerungskultur im Unternehmen am Beispiel der BASF AG
Frank Wittendorfer: Warum ist Siemens in München?
Gabriele Fünfrock: Die Anfänge des Archivs der Dyckerhoff AG
Jana Hoffmann, Britta Weschke u. Claudia Wöhnl: Vom Sammeln, Bewahren und Ausstellen historischer Schätze – Sparkassenmuseen in Sachsen
Hans Eyvind Næss: Tried and trusted strategies for archivists: Overcome frontiers, take part in the international community and boost your vigour!
Berichte:
Katja Glock; Bayer – „eine spannende Geschichte“
Horst A. Wessel: Filme in Archiven: Sammeln – Sichern – Sichten. Öffentliche Fachtagung des AK Filmarchivierung NRW am 4. Oktober 2007 in Schwerte
Renate Köhne-Lindenlaub u. Manfred Rasch: 30 Jahre Regionaler Erfahrungsaustausch Ruhrge-biet
Rezensionen:
Martin Burkhardt: Arbeiten im Archiv. Praktischer Leitfaden für Historiker und andere Nutzer
Sabine Brenner-Wilczek, Gertrude Cepl-Kaufman u. Max Plassmann: Einführung in die moder-ne Archivarbeit (Johannes Grützmacher)
Britta Leise: Die Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e.V. (VdW). Aspekte zur Entwick-lung des Archivwesens der Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland bis 1990 (Volker Beckmann)
Hans-Jürgen Gerhard u. Alexander Engel: Preisgeschichte der vorindustriellen Zeit. Ein Kom-pendium auf Basis ausgewählter Hamburger Materialien (Wilfried Reininghaus)
Stephan Lindner: Hoechst – ein I. G. Farben Werk im Dritten Reich (Harald Wixforth)
Jennifer Schevardo: Vom Wert des Notwendigen. Preispolitik und Lebensstandard in der DDR der fünfziger Jahre (Gerhard Neumeier)
Peter Danylow u. Ulrich S. Soénius (Hrsg.): Otto Wolff. Ein Unternehmen zwischen Wirtschaft und Politik (Harald Wixforth)
Karsten Rudolph u. Jana Wüstenhagen: Große Politik – kleine Begegnungen. Die Leipziger Mes-se im Ost-West-Konflikt (Evelyn Kroker)
Kim Christian Priemel: Flick. Eine Konzerngeschichte vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik (Christian Marx)
Konrad Schneider (Hrsg.): Gewerbe im Kronthal. Mineralwasser und Ziegel aus dem Taunus (Wilfried Reininghaus)
Nachrichten
Impressum
www.wirtschaftsarchive.de
Jahresabonnement: 26 €
Einzelheft: 8 €
dkrause - am Mittwoch, 2. April 2008, 10:33 - Rubrik: Wirtschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://de.wikisource.org/wiki/Biographische_Nachschlagewerke#N
Glücklicherweise kein Aprilscherz.
Wer gestern hier einen Aprilscherz gefunden hat, darf ihn behalten!
Glücklicherweise kein Aprilscherz.
Wer gestern hier einen Aprilscherz gefunden hat, darf ihn behalten!
KlausGraf - am Mittwoch, 2. April 2008, 02:11 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen


