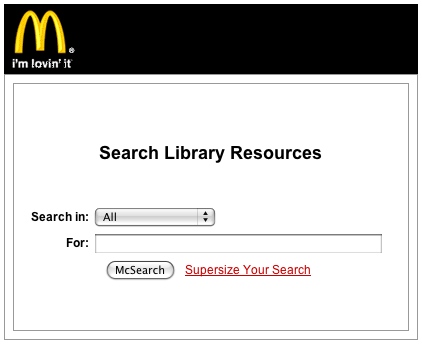http://www.ub.uni-koeln.de/index.php
270 Flugschriften der Sammlung Alff zur Brabanter und der Lütticher Revolution stehen in Köln digitalisiert (in dem in Europa eher seltener eingesetzten Content-dm-System) zur Einsicht bereit.
Aber wieso ist es ein Ding der Unmöglichkeit, auf die Startseite einen Link zur Erschließung der Sammlung auf dem gleichen Server zu setzen?
http://www.ub.uni-koeln.de/usbdoc/alff/alff.htm

270 Flugschriften der Sammlung Alff zur Brabanter und der Lütticher Revolution stehen in Köln digitalisiert (in dem in Europa eher seltener eingesetzten Content-dm-System) zur Einsicht bereit.
Aber wieso ist es ein Ding der Unmöglichkeit, auf die Startseite einen Link zur Erschließung der Sammlung auf dem gleichen Server zu setzen?
http://www.ub.uni-koeln.de/usbdoc/alff/alff.htm
KlausGraf - am Samstag, 19. Juli 2008, 21:48 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.x-cago.com/hoensbroek/
Die Digitalisate sollen leider nur auf Mail-Anfrage zugänglich sein (kostenfrei?). Wenn man die Nummer des gedruckten Inventars (nicht online) wissen muss, um Zugang zu erhalten, fragt man sich wirklich, was die niederländischen Kollegen im Hirn haben. So verhindert man wirksam Online-Entdeckungen.
Die Digitalisate sollen leider nur auf Mail-Anfrage zugänglich sein (kostenfrei?). Wenn man die Nummer des gedruckten Inventars (nicht online) wissen muss, um Zugang zu erhalten, fragt man sich wirklich, was die niederländischen Kollegen im Hirn haben. So verhindert man wirksam Online-Entdeckungen.
KlausGraf - am Samstag, 19. Juli 2008, 19:07 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ich wusste doch, dass Rüxners Turnierbuch bis heute Anhänger hat ...
Das Adelsgeschlecht derer von Ingelheim ist seit dem 10. Jahrhundert nachgewiesen, dürfte aber noch älter sein.
Erste Urkunden zu diesem Uradel mit dem Stammhause Ober-Ingelheim (Kr. Bingen) nennen Heinrich von Ingelheim als Ministerialen im Zusammenhang mit der Synode in Ingelheim 948 und Gerlachus de ingilnheim, ministerialis regis, 1140.
Die Stammreihe beginnt mit Johann v. Ingelheim, Ritter, 1192. Ebendieser Johann von Ingelheim ist nach Rixners Turnierbuch von 1566 Turnierkönig (=Turniersieger) auf Turnieren in Nürnberg 1197 und Worms 1209 gewesen.
In Turnierbüchern wird auch ein Turnier von 935 in Magdeburg erwähnt, an dem obiger (?) Ritter Heinrich von Ingelheim teilgenommen hat. Die Tatsache, dass nur Ritter mit sieben ritterbürtigen Ahnen an Turnieren teilnehmen durften und das fränkische Königsgut zu Ingelheim seit merowingischer Zeit und die Einrichtung der Pfalz unter Karl dem Großen begünstigen die Vorstellung, dass der Verwalter dieser Pfalz oder ein Edelfreier aus dem Ingelheimer Grund zur Zeit Karls des Großen der Begründer des Adelsgeschlechtes gewesen sein könnte. Eine Urkunde von 835 auf der der "exator palaciae" Arbo, sechs "liberi homines" und neun "fiscalines" unterschrieben haben, lässt vermuten, dass einer davon ein Ahnherr des Geschlechtes war.
Interessant ist ein in der Burgkirche (Ingelheim) zu besichtigender Türstein einer Vorgängerkirche aus dem 7. Jahrhundert, auf dem ein geschachtetes Kreuz zwischen zwei germanischen Sonnenrädern zu sehen ist. Ob dieses Kreuz Vorbild für das Familienwappen war, muss in den Bereich der Spekulation verwiesen werden.
Unabhängig von solchen Spekulationen gehört die Familie aber eindeutig zum Uradel und lebte schon Jahrhunderte im Ingelheimer Grund, als dieser 1375 vom Pfalzgrafen Ruprecht I. als Reichspfand erworben wurde. In dieser Zeit nahmen sie vielfältige Aufgaben am Ingelheimer Oberhof als Schöffen, Schultheißen und Oberschultheißen war.
Artikel Ingelheim (Adelsgeschlecht). In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 18. April 2008, 09:34 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingelheim_%28Adelsgeschlecht%29&oldid=45028078 (Abgerufen: 19. Juli 2008, 14:19 UTC)
Artikel über Adelsfamilien sind in der Wikipedia in der Regel inakzeptabel schlecht. Während in anderen Bereichen die Wikipedia-interne Qualitätssicherung greift, lungert im Bereich der Adelsfamilien noch der größte Schrott jahrelang herum, ohne dass sich jemand darum kümmert. Warnhinweise ("Überarbeiten") werden entweder entfernt oder ignoriert.
Weitere aktuelle Rüxner-Rezeption gefällig? Bittesehr:
In sehr alten Gemmingenschen Familienchroniken werden Vorfahren bis in die Merowingerzeit um 600 aufgelistet. Später sogar, einem Modetrend folgend, bis in die Römerzeit und das damals als fränkisch vermutete Geschlecht, in ein vornehmes Römisches gedeutet. Letzteres, wie auch der Versuch eine Beziehung zu einem Ort Gemmingen in Friesland herzustellen, werden aber in jüngeren Chroniken als unhaltbar bezeichnet.
Stocker sieht die Herren von Gemmingen als urgermanische Familie, deren Häupter an der Spitze eines größeren Stammes standen und in Krieg und Frieden sich hervortaten und solchen Einfluss erlangten, dass ihnen die Gegend um Gemmingen als Beute zugewiesen wurde, als das Land in deutschen Besitz kam. Weiter führt er aus, dass nach der Unterwerfung der Alemannen durch die Franken es wahrscheinlich sei, dass einige alemannische Geschlechter, so auch die Gemmingen, sich in das fränkische Reich hinüberretteten und ihre Würde und Bedeutung behielten, spätestens jedoch durch Dagobert I. Besitzungen erhielten. Stocker bezieht sich weiter auf ein „Traktat des Pfarrherrn aus dem Ulmischen“ welches Reinhard dem Gelehrten bei der Verfassung seiner Familienchronik 1631 noch vorlag, mittlerweile (1895) aber nicht mehr auffindbar sei und sieht einen Bodo „der mit König Dagobert in Teutschland kommen sei; ihr rechtes Stammhaus sei 5 meil von Paris gelegen, Gemmingen genannt…“, als ersten erwähnten Gemmingen.
Johann Brandmüller bezeichnet die Familie Gemmingen in seinem Lexikon von 1726, als uraltes adeliges Geschlecht am Rhein, in Franken und in Schwaben. Als ersten greifbaren Urahn sieht er einen Ulrich (oder Heinrich, nach Stocker) im Schloss Gemmingen in der unteren Pfalz, welcher den Stammsitz seiner Vorfahren um 872 besessen und Kloster Murrhard reich beschenkt habe und, nach anderen Quellen, dort begraben sein soll. Danach spricht er von einem Bernolph in Merseburg um 968 und erwähnt einen Henricus der 1165 an einem Turnier in Zürich teilgenommen habe, weist aber darauf hin, dass, wie vielfach in Turnierbüchern, die Jahresangabe möglicherweise nicht stimme. Die im Jahre 1991 erschienene Gemmingensche Familienchronik bezieht sich indirekt auf ihn, als hinreichend sicheren ältesten Vorfahren.
Artikel Freiherren von Gemmingen. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Mai 2008, 13:56 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Freiherren_von_Gemmingen&oldid=46600159 (Abgerufen: 19. Juli 2008, 14:26 UTC)
Die Herren von Sattelbogen, auch Satlboger genannt, waren eines der mächtigsten, einflussreichsten und angesehensten Rittergeschlechter des Bayerischen Waldes.
Bereits im 10. Jahrhundert war in Sattelbogen ein so genannter Burgstall zu einer kleinen Festung eingerichtet. Die Ausdehnung dieser alten Burganlage ist auch heutzutage noch wahrzunehmen, obwohl kein Stein der einstigen wehrhaften Mauern mehr zu sehen ist. Der einzige Zeuge grauer Vorzeit, der seinerzeit zur Befestigung eingerichtete Wallgraben, lässt den Standort und die enormen Ausmaße der Befestigung erkennen.
Die erste Erwähnung führt auf das Jahr 948 zurück, als sie am Turnier zu Konstanz teilnahmen. Der erste urkundliche Nachweis datiert auf das Jahr 1130, als Albert von Satlpogen als Zeuge „in einer Übergab Herzogs Hainrichs von Bayrn und Sachsen“ beiwohnte. Durch die zahlreichen Erwähnungen über die Teilnahme an Turnieren, wie z.B. zu Zürich im Jahre 1165, lässt darauf schließen, dass man es mit einem kampffähigen und streitbaren Rittergeschlecht zu tun hat.
Artikel Sattelbogen (Adelsgeschlecht). In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Juni 2008, 19:18 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sattelbogen_%28Adelsgeschlecht%29&oldid=47286679
Bärenstein wurde 1165 zum ersten Mal erwähnt, in Zusammenhang mi einem Ritter Albrecht von Bernstein, welcher aus der Schweiz stammte und in Zürich an einem Turnier teilnahm.
Artikel Bärenstein (Altenberg). In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Juni 2008, 15:57 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A4renstein_%28Altenberg%29&oldid=47279071 (Abgerufen: 19. Juli 2008, 14:32 UTC)
Erstmals wird das Geschlecht [Goldacker] mit Siegmund 1119 zu Göttingen erwähnt, der einem Turnier beigewohnt haben soll.
Artikel Goldacker. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Februar 2008, 23:49 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Goldacker&oldid=42569382 (Abgerufen: 19. Juli 2008, 14:37 UTC)
Neben verschiedenen Entstehungsgeschichten gilt es am wahrscheinlichsten, dass dem Mohr der Heilige Mauritius zugrunde liegt. Dies wird durch die folgenden Indizien untermauert:
* Die Erwähnung eines Stammherrn der Wolfskeels 930 durch die Teilnahme an einem Magdeburger (Schutzpatron Mauritius) Turnier, war ein familiengeschichtlich herausragender Meilenstein. Die Schlacht auf dem Lechfeld, in Verbindung mit der heiligen Lanze 25 Jahre später und die 962 bestätigte Verehrung Mauritius´ waren vermutlich ursächlich dafür, dass der Heilige seinen Weg in das Wappen gefunden haben könnte.
Artikel Wolffskeel. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. Juli 2008, 18:48 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wolffskeel&oldid=48078118 (Abgerufen: 19. Juli 2008, 14:41 UTC)
Das Adelsgeschlecht derer von Ingelheim ist seit dem 10. Jahrhundert nachgewiesen, dürfte aber noch älter sein.
Erste Urkunden zu diesem Uradel mit dem Stammhause Ober-Ingelheim (Kr. Bingen) nennen Heinrich von Ingelheim als Ministerialen im Zusammenhang mit der Synode in Ingelheim 948 und Gerlachus de ingilnheim, ministerialis regis, 1140.
Die Stammreihe beginnt mit Johann v. Ingelheim, Ritter, 1192. Ebendieser Johann von Ingelheim ist nach Rixners Turnierbuch von 1566 Turnierkönig (=Turniersieger) auf Turnieren in Nürnberg 1197 und Worms 1209 gewesen.
In Turnierbüchern wird auch ein Turnier von 935 in Magdeburg erwähnt, an dem obiger (?) Ritter Heinrich von Ingelheim teilgenommen hat. Die Tatsache, dass nur Ritter mit sieben ritterbürtigen Ahnen an Turnieren teilnehmen durften und das fränkische Königsgut zu Ingelheim seit merowingischer Zeit und die Einrichtung der Pfalz unter Karl dem Großen begünstigen die Vorstellung, dass der Verwalter dieser Pfalz oder ein Edelfreier aus dem Ingelheimer Grund zur Zeit Karls des Großen der Begründer des Adelsgeschlechtes gewesen sein könnte. Eine Urkunde von 835 auf der der "exator palaciae" Arbo, sechs "liberi homines" und neun "fiscalines" unterschrieben haben, lässt vermuten, dass einer davon ein Ahnherr des Geschlechtes war.
Interessant ist ein in der Burgkirche (Ingelheim) zu besichtigender Türstein einer Vorgängerkirche aus dem 7. Jahrhundert, auf dem ein geschachtetes Kreuz zwischen zwei germanischen Sonnenrädern zu sehen ist. Ob dieses Kreuz Vorbild für das Familienwappen war, muss in den Bereich der Spekulation verwiesen werden.
Unabhängig von solchen Spekulationen gehört die Familie aber eindeutig zum Uradel und lebte schon Jahrhunderte im Ingelheimer Grund, als dieser 1375 vom Pfalzgrafen Ruprecht I. als Reichspfand erworben wurde. In dieser Zeit nahmen sie vielfältige Aufgaben am Ingelheimer Oberhof als Schöffen, Schultheißen und Oberschultheißen war.
Artikel Ingelheim (Adelsgeschlecht). In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 18. April 2008, 09:34 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingelheim_%28Adelsgeschlecht%29&oldid=45028078 (Abgerufen: 19. Juli 2008, 14:19 UTC)
Artikel über Adelsfamilien sind in der Wikipedia in der Regel inakzeptabel schlecht. Während in anderen Bereichen die Wikipedia-interne Qualitätssicherung greift, lungert im Bereich der Adelsfamilien noch der größte Schrott jahrelang herum, ohne dass sich jemand darum kümmert. Warnhinweise ("Überarbeiten") werden entweder entfernt oder ignoriert.
Weitere aktuelle Rüxner-Rezeption gefällig? Bittesehr:
In sehr alten Gemmingenschen Familienchroniken werden Vorfahren bis in die Merowingerzeit um 600 aufgelistet. Später sogar, einem Modetrend folgend, bis in die Römerzeit und das damals als fränkisch vermutete Geschlecht, in ein vornehmes Römisches gedeutet. Letzteres, wie auch der Versuch eine Beziehung zu einem Ort Gemmingen in Friesland herzustellen, werden aber in jüngeren Chroniken als unhaltbar bezeichnet.
Stocker sieht die Herren von Gemmingen als urgermanische Familie, deren Häupter an der Spitze eines größeren Stammes standen und in Krieg und Frieden sich hervortaten und solchen Einfluss erlangten, dass ihnen die Gegend um Gemmingen als Beute zugewiesen wurde, als das Land in deutschen Besitz kam. Weiter führt er aus, dass nach der Unterwerfung der Alemannen durch die Franken es wahrscheinlich sei, dass einige alemannische Geschlechter, so auch die Gemmingen, sich in das fränkische Reich hinüberretteten und ihre Würde und Bedeutung behielten, spätestens jedoch durch Dagobert I. Besitzungen erhielten. Stocker bezieht sich weiter auf ein „Traktat des Pfarrherrn aus dem Ulmischen“ welches Reinhard dem Gelehrten bei der Verfassung seiner Familienchronik 1631 noch vorlag, mittlerweile (1895) aber nicht mehr auffindbar sei und sieht einen Bodo „der mit König Dagobert in Teutschland kommen sei; ihr rechtes Stammhaus sei 5 meil von Paris gelegen, Gemmingen genannt…“, als ersten erwähnten Gemmingen.
Johann Brandmüller bezeichnet die Familie Gemmingen in seinem Lexikon von 1726, als uraltes adeliges Geschlecht am Rhein, in Franken und in Schwaben. Als ersten greifbaren Urahn sieht er einen Ulrich (oder Heinrich, nach Stocker) im Schloss Gemmingen in der unteren Pfalz, welcher den Stammsitz seiner Vorfahren um 872 besessen und Kloster Murrhard reich beschenkt habe und, nach anderen Quellen, dort begraben sein soll. Danach spricht er von einem Bernolph in Merseburg um 968 und erwähnt einen Henricus der 1165 an einem Turnier in Zürich teilgenommen habe, weist aber darauf hin, dass, wie vielfach in Turnierbüchern, die Jahresangabe möglicherweise nicht stimme. Die im Jahre 1991 erschienene Gemmingensche Familienchronik bezieht sich indirekt auf ihn, als hinreichend sicheren ältesten Vorfahren.
Artikel Freiherren von Gemmingen. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Mai 2008, 13:56 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Freiherren_von_Gemmingen&oldid=46600159 (Abgerufen: 19. Juli 2008, 14:26 UTC)
Die Herren von Sattelbogen, auch Satlboger genannt, waren eines der mächtigsten, einflussreichsten und angesehensten Rittergeschlechter des Bayerischen Waldes.
Bereits im 10. Jahrhundert war in Sattelbogen ein so genannter Burgstall zu einer kleinen Festung eingerichtet. Die Ausdehnung dieser alten Burganlage ist auch heutzutage noch wahrzunehmen, obwohl kein Stein der einstigen wehrhaften Mauern mehr zu sehen ist. Der einzige Zeuge grauer Vorzeit, der seinerzeit zur Befestigung eingerichtete Wallgraben, lässt den Standort und die enormen Ausmaße der Befestigung erkennen.
Die erste Erwähnung führt auf das Jahr 948 zurück, als sie am Turnier zu Konstanz teilnahmen. Der erste urkundliche Nachweis datiert auf das Jahr 1130, als Albert von Satlpogen als Zeuge „in einer Übergab Herzogs Hainrichs von Bayrn und Sachsen“ beiwohnte. Durch die zahlreichen Erwähnungen über die Teilnahme an Turnieren, wie z.B. zu Zürich im Jahre 1165, lässt darauf schließen, dass man es mit einem kampffähigen und streitbaren Rittergeschlecht zu tun hat.
Artikel Sattelbogen (Adelsgeschlecht). In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Juni 2008, 19:18 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sattelbogen_%28Adelsgeschlecht%29&oldid=47286679
Bärenstein wurde 1165 zum ersten Mal erwähnt, in Zusammenhang mi einem Ritter Albrecht von Bernstein, welcher aus der Schweiz stammte und in Zürich an einem Turnier teilnahm.
Artikel Bärenstein (Altenberg). In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Juni 2008, 15:57 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A4renstein_%28Altenberg%29&oldid=47279071 (Abgerufen: 19. Juli 2008, 14:32 UTC)
Erstmals wird das Geschlecht [Goldacker] mit Siegmund 1119 zu Göttingen erwähnt, der einem Turnier beigewohnt haben soll.
Artikel Goldacker. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Februar 2008, 23:49 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Goldacker&oldid=42569382 (Abgerufen: 19. Juli 2008, 14:37 UTC)
Neben verschiedenen Entstehungsgeschichten gilt es am wahrscheinlichsten, dass dem Mohr der Heilige Mauritius zugrunde liegt. Dies wird durch die folgenden Indizien untermauert:
* Die Erwähnung eines Stammherrn der Wolfskeels 930 durch die Teilnahme an einem Magdeburger (Schutzpatron Mauritius) Turnier, war ein familiengeschichtlich herausragender Meilenstein. Die Schlacht auf dem Lechfeld, in Verbindung mit der heiligen Lanze 25 Jahre später und die 962 bestätigte Verehrung Mauritius´ waren vermutlich ursächlich dafür, dass der Heilige seinen Weg in das Wappen gefunden haben könnte.
Artikel Wolffskeel. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. Juli 2008, 18:48 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wolffskeel&oldid=48078118 (Abgerufen: 19. Juli 2008, 14:41 UTC)
KlausGraf - am Samstag, 19. Juli 2008, 14:32 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Via
http://www.iaas.uni-bremen.de/sprachblog/2008/07/19/wissenschaftliche-hochstapler/
[© by xkcd (Bearbeitung © by Anatol Stefanowitsch). Sowohl das Original als auch die deutsche Bearbeitung stehen unter der Creative-Commons-BY-NC-2.5-Lizenz.]
KlausGraf - am Samstag, 19. Juli 2008, 14:14 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ob man dieses Zitat von Sex Pistols-Manager Malcolm McLaren nicht in Einführungs-Lehrveranstaltungen zur Diskussion stellen sollte?
fragt http://adresscomptoir.twoday.net/stories/5069022/
Ich habe meine ganzen politischen Ansichten, mein Verständnis der Welt aus der Kunstgeschichte. (...) In der Welt geht es ums Plagiieren. Wenn man nicht anfängt, Dinge zu sehen und zu klauen, weil sie einen inspirieren, bleibt man dumm.
Zit. nach: Savage, John: England's Dreaming. Anarchie, Sex Pistols, Punk Rock. (=Critica Diabolis; 100). Berlin: Bittermann/Edition TIAMAT CD 100, 2. Aufl., 2003, S.31.
fragt http://adresscomptoir.twoday.net/stories/5069022/
Ich habe meine ganzen politischen Ansichten, mein Verständnis der Welt aus der Kunstgeschichte. (...) In der Welt geht es ums Plagiieren. Wenn man nicht anfängt, Dinge zu sehen und zu klauen, weil sie einen inspirieren, bleibt man dumm.
Zit. nach: Savage, John: England's Dreaming. Anarchie, Sex Pistols, Punk Rock. (=Critica Diabolis; 100). Berlin: Bittermann/Edition TIAMAT CD 100, 2. Aufl., 2003, S.31.
KlausGraf - am Samstag, 19. Juli 2008, 14:05 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der bedeutende polnische Historiker und Politiker starb bei einem Autounfall.
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/5068902/
http://de.wikipedia.org/wiki/Geremek
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/5068902/
http://de.wikipedia.org/wiki/Geremek
KlausGraf - am Samstag, 19. Juli 2008, 14:00 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 19. Juli 2008, 04:44 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://almirall.ateneubcn.org/
Die digitale Sammlung des Ateneu von Barcelona umfasst Handschriften, darunter auch mittelalterliche, und Zeitschriften.

Die digitale Sammlung des Ateneu von Barcelona umfasst Handschriften, darunter auch mittelalterliche, und Zeitschriften.

KlausGraf - am Samstag, 19. Juli 2008, 04:24 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Repertorium der deutschen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek, Bd. 7: Cgm 5155-7385
(Karin Schneiders Kataloge enden mit Cgm 5247)
Erwerbungen bis 1938. Cgm 7377 wurde dank der Unterstützung des Führers und Reichskanzlers Adolf Hitler erworben (Heinrich von München)
http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0002/bsb00026274/images/

[Nachtrag: Die neuzeitlichen Handschriften aus Cgm 5155-5500 wurden 2000 beschrieben von Dieter Kudorfer
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge/HSK0595.htm ]
(Karin Schneiders Kataloge enden mit Cgm 5247)
Erwerbungen bis 1938. Cgm 7377 wurde dank der Unterstützung des Führers und Reichskanzlers Adolf Hitler erworben (Heinrich von München)
http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0002/bsb00026274/images/

[Nachtrag: Die neuzeitlichen Handschriften aus Cgm 5155-5500 wurden 2000 beschrieben von Dieter Kudorfer
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge/HSK0595.htm ]
KlausGraf - am Samstag, 19. Juli 2008, 02:26 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Fortsetzung von: http://archiv.twoday.net/stories/5063852/
Dass die Möglichkeiten von Google Book Search noch nicht ausgereizt waren, zeigten verschiedene Suchanfragen, in deren Trefferlisten einige neue Hinweise zu entdecken waren.
***
Verkünder einer Reichsacht 1509
http://books.google.com/books?lr=&hl=de&q=amerang+%22j%C3%B6rg+jerusalem%22&btnG=Nach+B%C3%BCchern+suchen
enthält ja keinerlei Datierung der Zeichenfolge "Jörg Jerusalem". Dass ein erfreulicher neuer Beleg entdeckt war, zeigte die rasche Antwort der via QuestionPoint kontaktierten BSB, die einen Scan der Doppelseite kostenfrei übermittelte, wofür auch hier gedankt sei.
Franz von Crailsheim: Die Hofmarch Amerang. Ein Beitrag zur bayerischen Agrargeschichte, Berlin 1913, S. 8: "Auf dem Reichstag zu Worms erwirkte Hans von der Leytter am 13. Juni 1509 die Reichsacht gegen Leonardus Laurentanius, welche von dem bayrischen Ehrenknecht Jörg Jerusalem bei sämtlichen Reichsständen zur Vorlage gebracht wurde". Da die Anmerkung den Reichsachtbrief nennt, wird zu prüfen sein, wo sich dieser heute befindet.
Dass die Verkündigung der Reichsacht Aufgabe von Herolden im 16./17. Jahrhundert war, ist oft belegt:
http://books.google.com/books?lr=&hl=de&q=reichsacht+herold&btnG=Nach+B%C3%BCchern+suchen
[Siehe auch Seyler: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/1077707 ]
 Erfurter Bürger überfallen 1663 den Reichsherold
Erfurter Bürger überfallen 1663 den Reichsherold
***
Brief aus Würzburg 1523
Wohl 1957 (vermutlich Auktion Haus der Bücher Nr. 279) kam ein eigenhändiger Brief unter den Hammer, der 1523 aus Würzburg datiert ist und einen Streit mit einem Amtmann zu Marburg betrifft.
http://tinyurl.com/5ufty2
Hier muss man im "Jahrbuch der Auktionspreise" das Datum 1957 erschließen, bevor man weiter recherchieren kann.
[Nachtrag: Katalog Erasmushaus Basel: Auktion XXVIII [...]. Die Schlossbibliothek des Freiherrn von Berstett [...] 11. und 12. April 1957, S. 28 Nr. 279 Rüxner, Georg "L.a.s. Würzburg, "Mittwoch nach St. Veizentag" 1523. Betrifft einen Streit mit dem Amtmann zu Marburg"]
[Nachtrag: Der Brief kam auch bei Stargardt mit ausführlicherer Beschreibung zur Auktion:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Ruexner_1523.JPG ]
***
Genealogie der Landgrafen von Leuchtenberg
Hund lehnt eine von Rixner angegebene Eheverbindung ab: "Das nimmt er vermutlich aus Hund, Stammenbuch II S. 6 : „Rixner Herold setzet
diesem Landgraf Ulrichen eine Hausfrau v. Sager aus der Schlesien — ist nit gewiß"
http://books.google.com/books?lr=&hl=de&q=stammenbuch+rixner&btnG=Nach+B%C3%BCchern+suchen
***
Ahnentafel Pfalzgraf Ludwigs von der Pfalz und seiner Gemahlin Sibille
Die Heirat Ludwig V. mit der 1519 gestorbenen Sibille fand 1511 statt.
Georg Jerusalem legte eine Ahnentafel zu 64 Ahnen vor laut Ludwig Rockinger "Die Pflege der Geschichte durch die Wittelsbacher", 1880, S. 20
http://tinyurl.com/6g7pk8
Rockingers Arbeit wird (ebenso wie die Beiträge zu den Handschriften des Hausarchivs) ganz durchzusehen sein.
Wieso findet die Suche nach Ehrenknecht und Jerusalem die Arbeit Rockingers, aber im Buch selbst wird nichts gefunden?
http://tinyurl.com/5hf643
Das hängt mit dem sogenannten Stemming von Google zusammen. Ebenso wie die Phrasensuche findet die Suche im Buch immer nur die exakten Zeichenfolgen, während die Suche über alle Bücher auch ähnliche Formen findet. Hat man die exakte Namensform, kann man die Stelle im Buch lokalisieren. Das ist mir bei Ehrenknecht allerdings nicht gelungen (ernknecht, ehrnknecht).
***
Bayerisches Stammenbuch von Rixner (?)
Wird in der Arbeit über den österreichischen Genealogen Streun von Großmann MIÖG Ergbd. 11, 1929, S. 568 erwähnt.
http://tinyurl.com/5qpugc
Streun lag der Wiener Cod. 2799 ( http://archiv.twoday.net/stories/5063852/ )vor, den er mit einem Register versah.
Dass die Möglichkeiten von Google Book Search noch nicht ausgereizt waren, zeigten verschiedene Suchanfragen, in deren Trefferlisten einige neue Hinweise zu entdecken waren.
***
Verkünder einer Reichsacht 1509
http://books.google.com/books?lr=&hl=de&q=amerang+%22j%C3%B6rg+jerusalem%22&btnG=Nach+B%C3%BCchern+suchen
enthält ja keinerlei Datierung der Zeichenfolge "Jörg Jerusalem". Dass ein erfreulicher neuer Beleg entdeckt war, zeigte die rasche Antwort der via QuestionPoint kontaktierten BSB, die einen Scan der Doppelseite kostenfrei übermittelte, wofür auch hier gedankt sei.
Franz von Crailsheim: Die Hofmarch Amerang. Ein Beitrag zur bayerischen Agrargeschichte, Berlin 1913, S. 8: "Auf dem Reichstag zu Worms erwirkte Hans von der Leytter am 13. Juni 1509 die Reichsacht gegen Leonardus Laurentanius, welche von dem bayrischen Ehrenknecht Jörg Jerusalem bei sämtlichen Reichsständen zur Vorlage gebracht wurde". Da die Anmerkung den Reichsachtbrief nennt, wird zu prüfen sein, wo sich dieser heute befindet.
Dass die Verkündigung der Reichsacht Aufgabe von Herolden im 16./17. Jahrhundert war, ist oft belegt:
http://books.google.com/books?lr=&hl=de&q=reichsacht+herold&btnG=Nach+B%C3%BCchern+suchen
[Siehe auch Seyler: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/1077707 ]
 Erfurter Bürger überfallen 1663 den Reichsherold
Erfurter Bürger überfallen 1663 den Reichsherold***
Brief aus Würzburg 1523
Wohl 1957 (vermutlich Auktion Haus der Bücher Nr. 279) kam ein eigenhändiger Brief unter den Hammer, der 1523 aus Würzburg datiert ist und einen Streit mit einem Amtmann zu Marburg betrifft.
http://tinyurl.com/5ufty2
Hier muss man im "Jahrbuch der Auktionspreise" das Datum 1957 erschließen, bevor man weiter recherchieren kann.
[Nachtrag: Katalog Erasmushaus Basel: Auktion XXVIII [...]. Die Schlossbibliothek des Freiherrn von Berstett [...] 11. und 12. April 1957, S. 28 Nr. 279 Rüxner, Georg "L.a.s. Würzburg, "Mittwoch nach St. Veizentag" 1523. Betrifft einen Streit mit dem Amtmann zu Marburg"]
[Nachtrag: Der Brief kam auch bei Stargardt mit ausführlicherer Beschreibung zur Auktion:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Ruexner_1523.JPG ]
***
Genealogie der Landgrafen von Leuchtenberg
Hund lehnt eine von Rixner angegebene Eheverbindung ab: "Das nimmt er vermutlich aus Hund, Stammenbuch II S. 6 : „Rixner Herold setzet
diesem Landgraf Ulrichen eine Hausfrau v. Sager aus der Schlesien — ist nit gewiß"
http://books.google.com/books?lr=&hl=de&q=stammenbuch+rixner&btnG=Nach+B%C3%BCchern+suchen
***
Ahnentafel Pfalzgraf Ludwigs von der Pfalz und seiner Gemahlin Sibille
Die Heirat Ludwig V. mit der 1519 gestorbenen Sibille fand 1511 statt.
Georg Jerusalem legte eine Ahnentafel zu 64 Ahnen vor laut Ludwig Rockinger "Die Pflege der Geschichte durch die Wittelsbacher", 1880, S. 20
http://tinyurl.com/6g7pk8
Rockingers Arbeit wird (ebenso wie die Beiträge zu den Handschriften des Hausarchivs) ganz durchzusehen sein.
Wieso findet die Suche nach Ehrenknecht und Jerusalem die Arbeit Rockingers, aber im Buch selbst wird nichts gefunden?
http://tinyurl.com/5hf643
Das hängt mit dem sogenannten Stemming von Google zusammen. Ebenso wie die Phrasensuche findet die Suche im Buch immer nur die exakten Zeichenfolgen, während die Suche über alle Bücher auch ähnliche Formen findet. Hat man die exakte Namensform, kann man die Stelle im Buch lokalisieren. Das ist mir bei Ehrenknecht allerdings nicht gelungen (ernknecht, ehrnknecht).
***
Bayerisches Stammenbuch von Rixner (?)
Wird in der Arbeit über den österreichischen Genealogen Streun von Großmann MIÖG Ergbd. 11, 1929, S. 568 erwähnt.
http://tinyurl.com/5qpugc
Streun lag der Wiener Cod. 2799 ( http://archiv.twoday.net/stories/5063852/ )vor, den er mit einem Register versah.
KlausGraf - am Samstag, 19. Juli 2008, 00:50 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Jan Banning, Will Tinnemans: Zu Tisch bei den Dienern des Staates. In: Geo, Heft 8/2008, S. 24-44, hier S. 26, verweisen am Beispiel des indischen Finanzbeamten Surinder Kumar Mandal auf ein universales Dilemma bürokratischen - und folglich auch archivarischen - Tuns und Handelns: Weiß Mandal, was in den Akten steht? Natürlich. Steuerbescheide lagern dort; ein Gesetz schreibt vor, dass sie 50 Jahre lang aufbewahrt werden müssen. Dass sie auffindbar sein sollen - darüber gibt es keinen Paragrafen.
Koelges Michael - am Freitag, 18. Juli 2008, 20:43 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.grenzen.rwth-aachen.de/
Die nächste Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaftgemeinschaft „Frühe Neuzeit“ im Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands wird vom 24. bis 26. September 2009 an der RWTH Aachen stattfinden.
Vorschläge für Sektionen sind herzlich willkommen und können noch bis zum 15. August 2008 eingereicht werden (christine.roll@rwth-aachen.de).
Zum Thema der Tagung
Je mehr Grenzen fallen, desto größer wird das Interesse der Wissenschaften an ihnen. Auch in der Geschichtswissenschaft und gerade in der Frühneuzeitforschung sind in den letzten Jahren Grenzen und Räume, Grenzregionen und Raumvorstellungen, Grenzüberschreitungen, Übergänge und Zwischenräume unter ganz verschiedenen Aspekten zu wichtigen Forschungsfeldern geworden – mit vielfältigen und teilweise beeindruckenden Ergebnissen. Deshalb ist es nun an der Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen und neue Perspektiven zu diskutieren. Zugleich erscheint das Thema besonders geeignet, die vielfältigen Interessen und Richtungen in der Frühneuzeitforschung zu spannenden Diskussionen zusammenzuführen und dabei zu neuen Einsichten über die Bedeutung von Grenzen für die Menschen in der Frühen Neuzeit zu gelangen – und damit das Bild einer lebendigen und innovativen Geschichtswissenschaft auch in die Öffentlichkeit zu tragen, einer Geschichtswissenschaft, die zu aktuellen Diskussionen etwas beizutragen hat.

Die nächste Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaftgemeinschaft „Frühe Neuzeit“ im Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands wird vom 24. bis 26. September 2009 an der RWTH Aachen stattfinden.
Vorschläge für Sektionen sind herzlich willkommen und können noch bis zum 15. August 2008 eingereicht werden (christine.roll@rwth-aachen.de).
Zum Thema der Tagung
Je mehr Grenzen fallen, desto größer wird das Interesse der Wissenschaften an ihnen. Auch in der Geschichtswissenschaft und gerade in der Frühneuzeitforschung sind in den letzten Jahren Grenzen und Räume, Grenzregionen und Raumvorstellungen, Grenzüberschreitungen, Übergänge und Zwischenräume unter ganz verschiedenen Aspekten zu wichtigen Forschungsfeldern geworden – mit vielfältigen und teilweise beeindruckenden Ergebnissen. Deshalb ist es nun an der Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen und neue Perspektiven zu diskutieren. Zugleich erscheint das Thema besonders geeignet, die vielfältigen Interessen und Richtungen in der Frühneuzeitforschung zu spannenden Diskussionen zusammenzuführen und dabei zu neuen Einsichten über die Bedeutung von Grenzen für die Menschen in der Frühen Neuzeit zu gelangen – und damit das Bild einer lebendigen und innovativen Geschichtswissenschaft auch in die Öffentlichkeit zu tragen, einer Geschichtswissenschaft, die zu aktuellen Diskussionen etwas beizutragen hat.

KlausGraf - am Freitag, 18. Juli 2008, 18:34 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Einige wichtige lokale Kartenwerke sind online verfügbar.
Beachtenswert die detailreiche Stadtansicht von Martini (1597), der Plan von Schumacher (siehe unten) oder die Topographische Karte des Kantons Luzern (1864-1867).
Die Digitalisate konnten dank der kostenlosen Software Zoomifyer EZ mit wenig Aufwand online publiziert werden.
Beachtenswert die detailreiche Stadtansicht von Martini (1597), der Plan von Schumacher (siehe unten) oder die Topographische Karte des Kantons Luzern (1864-1867).
Die Digitalisate konnten dank der kostenlosen Software Zoomifyer EZ mit wenig Aufwand online publiziert werden.
Markus Lischer - am Freitag, 18. Juli 2008, 10:30 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blogs.princeton.edu/mudd/2008/07/1748_charter_and_early_trustee.html
Der Viewer ist allerdings wenig komfortabel zu bedienen.

Der Viewer ist allerdings wenig komfortabel zu bedienen.

KlausGraf - am Freitag, 18. Juli 2008, 09:01 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.uflib.ufl.edu/ufdc/?c=jud1&m=hbtall
Die digitale Sammlung der U. of Florida enthält auch viele deutsche Titel.
Die digitale Sammlung der U. of Florida enthält auch viele deutsche Titel.
KlausGraf - am Freitag, 18. Juli 2008, 04:23 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.schollgymnasium.de/Bibliothek/index.htm
Ist die Andreas-Möller-Bibliothek des Scholl-Gymnasiums in Freiberg. Sie verfügt über einen beachtlichen Handschriftenbestand. Etliche ältere und jüngere, insbesondere bibliographische Darstellungen zur Bibliothek sind online verfügbar.
Archiv d. Ges. VIII, 711f. (nur 2 Hss.)
http://books.google.com/books?id=u-o1AAAAMAAJ&pg=PA711
Petzholdt, Literatur der sächsischen Bibliotheken, 1840
http://books.google.com/books?id=bjg5Pt9LMLcC&pg=PA18
Petzholdt, Bibliotheken der Klöster ... 1842
http://books.google.com/books?id=5Dz0w8uyZrYC
Bibliographie zur Schule und Schulbibliothek 1884
http://tinyurl.com/68d5zw
Blau im CfB 1886
http://tinyurl.com/6nn2tv
Kristeller Latin Manuscript Books
http://141.84.81.24/acwww25/regsrch.pl?wert=freiberg&recnums=1657:1658&index=1&db=kri&barcode=&nachname=
(lückenhaft)
Fabian-Handbuch
http://www.b2i.de/fabian?Geschwister-Scholl-Gymnasium_(Freiberg)
Handschriftencensus (5 deutsche Hss.)
http://cgi-host.uni-marburg.de/~mrep/liste_census.php?ort=RnJlaWJlcmcgKFNhY2hzZW4p
HSA-Beschreibungen (bisher 1 digitalisiert)
http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/freiberga.html
Ist die Andreas-Möller-Bibliothek des Scholl-Gymnasiums in Freiberg. Sie verfügt über einen beachtlichen Handschriftenbestand. Etliche ältere und jüngere, insbesondere bibliographische Darstellungen zur Bibliothek sind online verfügbar.
Archiv d. Ges. VIII, 711f. (nur 2 Hss.)
http://books.google.com/books?id=u-o1AAAAMAAJ&pg=PA711
Petzholdt, Literatur der sächsischen Bibliotheken, 1840
http://books.google.com/books?id=bjg5Pt9LMLcC&pg=PA18
Petzholdt, Bibliotheken der Klöster ... 1842
http://books.google.com/books?id=5Dz0w8uyZrYC
Bibliographie zur Schule und Schulbibliothek 1884
http://tinyurl.com/68d5zw
Blau im CfB 1886
http://tinyurl.com/6nn2tv
Kristeller Latin Manuscript Books
http://141.84.81.24/acwww25/regsrch.pl?wert=freiberg&recnums=1657:1658&index=1&db=kri&barcode=&nachname=
(lückenhaft)
Fabian-Handbuch
http://www.b2i.de/fabian?Geschwister-Scholl-Gymnasium_(Freiberg)
Handschriftencensus (5 deutsche Hss.)
http://cgi-host.uni-marburg.de/~mrep/liste_census.php?ort=RnJlaWJlcmcgKFNhY2hzZW4p
HSA-Beschreibungen (bisher 1 digitalisiert)
http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/freiberga.html
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Mindestens 2000 Mal Thomas", so besschreibt die Kempener Thomas-Archivleiterin Dr. Ulrike Bodemann-Kornhaas ihre Bestände, die am Thomas-Tag besichtigt werden können.
"Der Thomas-Tag schließt in der Heilig-Geist-Kapelle am Buttermarkt mit dem Vortrag „Berühmt, aber längst unverdaulich? Zur Aktualität des Thomas von Kempen“ . Es spricht der Theologe und Professor Michael Plattig, Institutsleiter an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Münster."
Ist allzu viel Thomas ungesund ?
Quelle:
http://www.rp-online.de/public/article/kempen/590867/Ein-Tag-mit-Thomas.html
Informationen zu Thomas von Kempen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_von_Kempen
Homepage des Thomas-Archivs:
http://www.thomas-archiv-online.de/
"Der Thomas-Tag schließt in der Heilig-Geist-Kapelle am Buttermarkt mit dem Vortrag „Berühmt, aber längst unverdaulich? Zur Aktualität des Thomas von Kempen“ . Es spricht der Theologe und Professor Michael Plattig, Institutsleiter an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Münster."
Ist allzu viel Thomas ungesund ?
Quelle:
http://www.rp-online.de/public/article/kempen/590867/Ein-Tag-mit-Thomas.html
Informationen zu Thomas von Kempen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_von_Kempen
Homepage des Thomas-Archivs:
http://www.thomas-archiv-online.de/
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juli 2008, 19:35 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .....Auch das diesjährige Plakatmotiv zum Rundgang 2008 stammt aus dem Studiengang Kostümbild. Die 26-jährige Dänin Lea Søvsø, die seit drei Jahren an der Universität der Künste Berlin studiert, entwarf das Plakat mit den vielen Beinen. „Ich wollte ein Motiv schaffen, das einerseits spiegelt, wie wir hier im Studiengang arbeiten und das andererseits für die Vielfalt der künstlerischen Inhalte unserer Hochschule steht. So kam ich auf dieses 'Archiv von Beinen', die allesamt berühmten Persönlichkeiten zugeordnet sind.“
Welches Bein zu welcher Figur gehört, ist durch die kleinen Schildchen erkennbar. So hat der Betrachter die Möglichkeit, das 'Beinkleid' auf sich wirken zu lassen und dann beim zweiten Hinschauen zu überprüfen, zu welcher Figur es gehört und ob sich sein Eindruck mit dem Charakter der Figur deckt. „Und wenn er sich dann die Frage stellt 'Wie um Himmels willen kommt jemand darauf, dass Ophelia oder Hamlet so etwas trägt?', dann hat das Konzept funktioniert und ein Dialog mit dem Betrachter findet statt.“
Quelle: http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Sonderthemen;art893,2572939
Ausführliches Programm mit mehreren Archivbezügen als PDF-Datei (Link ) downloadbar.
Welches Bein zu welcher Figur gehört, ist durch die kleinen Schildchen erkennbar. So hat der Betrachter die Möglichkeit, das 'Beinkleid' auf sich wirken zu lassen und dann beim zweiten Hinschauen zu überprüfen, zu welcher Figur es gehört und ob sich sein Eindruck mit dem Charakter der Figur deckt. „Und wenn er sich dann die Frage stellt 'Wie um Himmels willen kommt jemand darauf, dass Ophelia oder Hamlet so etwas trägt?', dann hat das Konzept funktioniert und ein Dialog mit dem Betrachter findet statt.“
Quelle: http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Sonderthemen;art893,2572939
Ausführliches Programm mit mehreren Archivbezügen als PDF-Datei (Link ) downloadbar.
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juli 2008, 19:29 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Im Todesjahr von Gottfried Semper (1803-1879), dem Begründer der "Bauschule" am Eidgenössischen Polytechnikum in Zürich, ergriffen einige seiner Zürcher Schüler die Initiative zur Gründung eines "Semper-Museums". Nach einer kurzen Zeit der Selbständigkeit (1880-84) wurde dessen Bestand der Bibliothek der Bauschule (später Architekturbibliothek, die 1950 von der Abteilung für Architektur an die Hauptbibliothek der ETH überging) zur Betreuung übergeben. Als 1967 das Institut für Geschichte und Theorie der Architektur (gta) gegründet wurde, erhielt es als Grundstock das aus dem "Semper-Museum" hervorgegangene "Semper-Archiv".
Die Bestände umfassten nebst dem Nachlass Sempers mittlerweile auch die Nachlässe seiner Nachfolger wie Georg Lasius, Alfred Friedrich Bluntschli, Gustav Gull, Karl Moser und einiger weiterer jüngerer und älterer Schweizer Architekten. Die Forschungstätigkeit des Instituts wurde begleitet durch eine rege Sammeltätigkeit. Zu einem grossen Bestandeszuwachs führte namentlich der Aufbau des CIAM-Archivs (Congrès Internationaux d'Architecture Moderne). Nachlässe und Bestände vermehrten sich, und allmählich wurde aus dem Semper-Archiv das "Archiv für moderne Schweizer Architektur". Heute nennt es sich "Archiv gta" und bildet neben den Ressorts Ausstellungen und Publikationen einen der Grundpfeiler des Instituts gta.
Bestände
Das Archiv besteht im Wesentlichen aus Nachlässen und verschiedenen Sammlungen. Unter vielen namhaften und bedeutenden Architekten und Architektinnen sind als wichtigste Komponenten vertreten das 19. Jahrhundert mit dem Semper-Archiv und dessen Umkreis, die Jahrhundertwende (Karl Moser, Gustav Gull u.a.) und umfassend und repräsentativ die Schweizer "Pioniere" des Modernen Architektur wie Hans Hofmann, Alfred Roth, O.R. Salvisberg und Hans Schmidt. Das CIAM Archiv dokumentiert lückenlos sämtliche Vor- und Nachkriegs-Kongresse; als theoretischer Bestand kann in diesem Zusammenhang das Archiv des bedeutenden Kunsthistorikers und Generalsekretärs der CIAM, Sigfried Giedion, erwähnt werden. Die Neuzugänge der letzten Jahre betreffen mittlerweile immer häufiger die Archive von Architekten und Architektinnen, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewirkt haben. (Ernst Gisel, Otto Glaus, Rudolf Olgiati, Lisbeth Sachs, A.H. Steiner). Ausserhalb der Nachlässe sind in einer Plansammlung mehr als 3000 einzelne Pläne vereinigt, eine Foto/ Bild-Sammlung umfasst rund 35'000 Dokumenteinheiten. ...."
Quelle: http://www.gta.arch.ethz.ch/d/archiv/
Die Bestände umfassten nebst dem Nachlass Sempers mittlerweile auch die Nachlässe seiner Nachfolger wie Georg Lasius, Alfred Friedrich Bluntschli, Gustav Gull, Karl Moser und einiger weiterer jüngerer und älterer Schweizer Architekten. Die Forschungstätigkeit des Instituts wurde begleitet durch eine rege Sammeltätigkeit. Zu einem grossen Bestandeszuwachs führte namentlich der Aufbau des CIAM-Archivs (Congrès Internationaux d'Architecture Moderne). Nachlässe und Bestände vermehrten sich, und allmählich wurde aus dem Semper-Archiv das "Archiv für moderne Schweizer Architektur". Heute nennt es sich "Archiv gta" und bildet neben den Ressorts Ausstellungen und Publikationen einen der Grundpfeiler des Instituts gta.
Bestände
Das Archiv besteht im Wesentlichen aus Nachlässen und verschiedenen Sammlungen. Unter vielen namhaften und bedeutenden Architekten und Architektinnen sind als wichtigste Komponenten vertreten das 19. Jahrhundert mit dem Semper-Archiv und dessen Umkreis, die Jahrhundertwende (Karl Moser, Gustav Gull u.a.) und umfassend und repräsentativ die Schweizer "Pioniere" des Modernen Architektur wie Hans Hofmann, Alfred Roth, O.R. Salvisberg und Hans Schmidt. Das CIAM Archiv dokumentiert lückenlos sämtliche Vor- und Nachkriegs-Kongresse; als theoretischer Bestand kann in diesem Zusammenhang das Archiv des bedeutenden Kunsthistorikers und Generalsekretärs der CIAM, Sigfried Giedion, erwähnt werden. Die Neuzugänge der letzten Jahre betreffen mittlerweile immer häufiger die Archive von Architekten und Architektinnen, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewirkt haben. (Ernst Gisel, Otto Glaus, Rudolf Olgiati, Lisbeth Sachs, A.H. Steiner). Ausserhalb der Nachlässe sind in einer Plansammlung mehr als 3000 einzelne Pläne vereinigt, eine Foto/ Bild-Sammlung umfasst rund 35'000 Dokumenteinheiten. ...."
Quelle: http://www.gta.arch.ethz.ch/d/archiv/
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juli 2008, 19:27 - Rubrik: Architekturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Reisetipp für architekturbegeisterte Archvierende: "Das nordjütländische Aalborg hat eine neue Attraktion: Das jetzt eröffnete Utzon Center an der wiederentdeckten Hafenfront am Limfjord ist ein 2.400 Quadratmeter großes Multifunktionshaus mit Ausstellungsräumen, Architekturbibliothek, einem großen Auditorium für Konzerte und Konferenzen sowie einem Archiv mit Zeichnungen und Entwürfen der dänischen Architektenlegende Jørn Utzon.
Die Eröffnungsausstellung im Utzon Center widmet sich mit Modellen, Skizzen und Hintergründen standesgemäß Utzons Meisterwerk: „Das Opernhaus von Sydney“.
Quelle: Link
Homepage des Centers: http://www.utzoncenter.org
Informationen zu Jorn Utzon: http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8rn_Utzon
Die Eröffnungsausstellung im Utzon Center widmet sich mit Modellen, Skizzen und Hintergründen standesgemäß Utzons Meisterwerk: „Das Opernhaus von Sydney“.
Quelle: Link
Homepage des Centers: http://www.utzoncenter.org
Informationen zu Jorn Utzon: http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8rn_Utzon
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juli 2008, 19:25 - Rubrik: Architekturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine Ausstellung in Bremer Focke zeigt Fotografien Andreas Feininger; sie entstand in Kooperation mit dem Tübinger Andreas Feininger Archiv (Infos zur Ausstellung: Link).
"Das Andreas Feininger Archive bemüht sich, bei Recherchen, Fragen und Auskünften zum Thema Andreas Feininger, zu seinem fotografischen Werk, zu seinem Leben im Rahmen des Archivumfanges und der Quellenlage behilflich zu sein.
Das Andreas Feininger Archive sammelt alte Bücher und Ausstellungskataloge von und über Andreas Feininger, Artikel aus Zeitschriften und ist auch an sonstigen Materialien interessiert, die helfen, sein fotografisches Leben zu verdichten.
Das Andreas Feininger Archive gibt zu bestimmten Anlässen eine limitierte Auflage besonders begehrter Fotografie-Klassiker von Andreas Feininger heraus.
Die Silbergelatineabzüge werden vom Negativ von Hand auf Barytpapier geprinted, sind nummeriert, authorisiert, aber nicht signiert und werden zu günstigen Sammlerkonditionen angeboten." So bewirbt die Dr. Thomas Buchsteiner, BuchsteinerArtManagement, das Fotoarchiv (Link).
Informationen zu Andreas Feininger:
http://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Feininger
"Das Andreas Feininger Archive bemüht sich, bei Recherchen, Fragen und Auskünften zum Thema Andreas Feininger, zu seinem fotografischen Werk, zu seinem Leben im Rahmen des Archivumfanges und der Quellenlage behilflich zu sein.
Das Andreas Feininger Archive sammelt alte Bücher und Ausstellungskataloge von und über Andreas Feininger, Artikel aus Zeitschriften und ist auch an sonstigen Materialien interessiert, die helfen, sein fotografisches Leben zu verdichten.
Das Andreas Feininger Archive gibt zu bestimmten Anlässen eine limitierte Auflage besonders begehrter Fotografie-Klassiker von Andreas Feininger heraus.
Die Silbergelatineabzüge werden vom Negativ von Hand auf Barytpapier geprinted, sind nummeriert, authorisiert, aber nicht signiert und werden zu günstigen Sammlerkonditionen angeboten." So bewirbt die Dr. Thomas Buchsteiner, BuchsteinerArtManagement, das Fotoarchiv (Link).
Informationen zu Andreas Feininger:
http://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Feininger
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juli 2008, 19:21 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"In der Mühlgasse ist es ab sofort zentrumsnahe und leicht erreichbar. Mit 356 Quadratmetern Fläche besitzt es auf drei Stockwerken etwa den dreifachen Raum für städtische Archivalien.
Rollregale, Buchaufzug sind ebenso Stand der Archivtechnik wie der klimatisierte Foto-Raum."
Klimatisierter Fotoraum - da werden manche Kommunalarchive aber neidisch sein.
Quelle:
http://www.merkur-online.de/regionen/toelz/;art8812,943744
Rollregale, Buchaufzug sind ebenso Stand der Archivtechnik wie der klimatisierte Foto-Raum."
Klimatisierter Fotoraum - da werden manche Kommunalarchive aber neidisch sein.
Quelle:
http://www.merkur-online.de/regionen/toelz/;art8812,943744
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juli 2008, 19:21 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Wiesbadener Landesbibliothek, eine der unbedeutendsten wissenschaftlichen Bibliotheken bundesweit, gibt einen kargen Überblick über retrodigitalisierte Nassau-Literatur:
http://www.hlb-wiesbaden.de/index.php?dom=1&lang=22&p=151
Leider nicht berücksichtigt werden die bei Google (ggf. mit Proxy abrufbaren) Bestände!
http://www.hlb-wiesbaden.de/index.php?dom=1&lang=22&p=151
Leider nicht berücksichtigt werden die bei Google (ggf. mit Proxy abrufbaren) Bestände!
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juli 2008, 17:37 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.ub.uni-frankfurt.de/archive/glossar.html
 Säurefraß
Säurefraß
Anbieter ist das sogenannte "Archivzentrum" der UB, das auch die Bibliotheksarchivalien (wie gehabt als unerwünschtes Behördenarchiv) verwahrt.
http://www.ub.uni-frankfurt.de/archive/bestaende.html
 Säurefraß
SäurefraßAnbieter ist das sogenannte "Archivzentrum" der UB, das auch die Bibliotheksarchivalien (wie gehabt als unerwünschtes Behördenarchiv) verwahrt.
http://www.ub.uni-frankfurt.de/archive/bestaende.html
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juli 2008, 17:10 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.irights.info/index.php?id=81&tx_ttnews%5Btt_news%5D=394&cHash=380b603f85
Wann wird man erkennen, dass solche Verlängerungen nur den Verwertern nützen und die Kreativität erdrosseln?

Wann wird man erkennen, dass solche Verlängerungen nur den Verwertern nützen und die Kreativität erdrosseln?

KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juli 2008, 16:55 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
NARA-archivist V. Paul Rood wrote today:
"[Below are a few words about archival training and the National Archives, which can be an excellent place to start--and finish--a career as an archivist. Please pardon this re-posting of a message, slightly edited, from two years ago.]
Archival Education at NARA.
NARA is the nation's largest employer of archivists, and I have been surprised that the current Listserv discussion has not included the practices of this agency. Although I am not any kind of spokesperson for NARA, a few basic facts about NARA's program are not privileged information. Basically, NARA existed before today's university programs to train archivists, and as a result, NARA has traditionally trained its own archivists.
When I came through the archivist training program in the 1980s, it was called the CIDS program (which I think stood for Career Intern Development System, or something similar). A group of a couple dozen of us trainees began the program with two weeks of instruction on the theory and practice of archival work. For the following two years, we trainees then worked in a number of different departments. In those two years, we each gained about 4,000 hours of on-the-job experience in arrangement & description, reference, appraisal, as well as other fields. Personally, I thought that this was an unrivalled program for training archivists. The program still exists [as the Archivist Development Program, or ADP], and most archivists at the National Archives have gone through it.
Library Training and NARA
Unlike much of the rest of the archival world, very few NARA archivists have librarian degrees. Until recently, NARA hired as archivists mostly people with backgrounds in American history. The educational requirements for archivists have changed recently, however, as has also the work of archivists at NARA. As our work becomes more centered on the computer, our work of processing records, for example, has become much more like library cataloging than traditional arrangement and description. [NARA is now hiring more librarians than before.]
Personally, I have a librarian's degree, and I also went through F. Gerald Ham's excellent archival training program at the State Historical Society of Wisconsin. All of this training has been useful to some degree, because it is largely complementary, concerned as it is with the storage and retrieval of information. I also have happy memories of wonderful information professionals, like Dr. Ham, that I worked with and learned from in those days. [Although the archives program involved some hands-on processing, I and many other students also worked part-time at the SHSW, which proved a fantastic addition to the formal training.]
While I am on the subject of NARA's differences from other archives, one could mention also the paucity of NARA archivists*please correct me if I am wrong!*who have become Certified Archivists. Perhaps that will change with time, also.
In Conclusion
Although NARA traditionally has trained its archivists on-the-job, I would not argue that it is inherently superior to academic training. In fact, I think that there is merit in both classroom and on-the-job training. In Germany, for example, its world-class archival training programs inherently combine study and on-the-job archival work.
Finally, I wish to repeat that I am in no way an official spokesperson for NARA. I am merely providing the archival community with non-privileged information about archival education at NARA so that well-considered judgments are possible.
V. Paul Rood, MA, MALS, Ph.D
Archivist, Initial Processing and Declassification Division (NWMD)
National Archives and Records Administration (NARA)
8601 Adelphi Road
College Park, Maryland 20740 "
From: The ARCHIVES & ARCHIVISTS (A&A) LIST (My emphasis)
"[Below are a few words about archival training and the National Archives, which can be an excellent place to start--and finish--a career as an archivist. Please pardon this re-posting of a message, slightly edited, from two years ago.]
Archival Education at NARA.
NARA is the nation's largest employer of archivists, and I have been surprised that the current Listserv discussion has not included the practices of this agency. Although I am not any kind of spokesperson for NARA, a few basic facts about NARA's program are not privileged information. Basically, NARA existed before today's university programs to train archivists, and as a result, NARA has traditionally trained its own archivists.
When I came through the archivist training program in the 1980s, it was called the CIDS program (which I think stood for Career Intern Development System, or something similar). A group of a couple dozen of us trainees began the program with two weeks of instruction on the theory and practice of archival work. For the following two years, we trainees then worked in a number of different departments. In those two years, we each gained about 4,000 hours of on-the-job experience in arrangement & description, reference, appraisal, as well as other fields. Personally, I thought that this was an unrivalled program for training archivists. The program still exists [as the Archivist Development Program, or ADP], and most archivists at the National Archives have gone through it.
Library Training and NARA
Unlike much of the rest of the archival world, very few NARA archivists have librarian degrees. Until recently, NARA hired as archivists mostly people with backgrounds in American history. The educational requirements for archivists have changed recently, however, as has also the work of archivists at NARA. As our work becomes more centered on the computer, our work of processing records, for example, has become much more like library cataloging than traditional arrangement and description. [NARA is now hiring more librarians than before.]
Personally, I have a librarian's degree, and I also went through F. Gerald Ham's excellent archival training program at the State Historical Society of Wisconsin. All of this training has been useful to some degree, because it is largely complementary, concerned as it is with the storage and retrieval of information. I also have happy memories of wonderful information professionals, like Dr. Ham, that I worked with and learned from in those days. [Although the archives program involved some hands-on processing, I and many other students also worked part-time at the SHSW, which proved a fantastic addition to the formal training.]
While I am on the subject of NARA's differences from other archives, one could mention also the paucity of NARA archivists*please correct me if I am wrong!*who have become Certified Archivists. Perhaps that will change with time, also.
In Conclusion
Although NARA traditionally has trained its archivists on-the-job, I would not argue that it is inherently superior to academic training. In fact, I think that there is merit in both classroom and on-the-job training. In Germany, for example, its world-class archival training programs inherently combine study and on-the-job archival work.
Finally, I wish to repeat that I am in no way an official spokesperson for NARA. I am merely providing the archival community with non-privileged information about archival education at NARA so that well-considered judgments are possible.
V. Paul Rood, MA, MALS, Ph.D
Archivist, Initial Processing and Declassification Division (NWMD)
National Archives and Records Administration (NARA)
8601 Adelphi Road
College Park, Maryland 20740 "
From: The ARCHIVES & ARCHIVISTS (A&A) LIST (My emphasis)
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juli 2008, 15:43 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5497/
Graf, Klaus: Aus krichsscher sprach in das swebischs teutschs gebracht. Bemerkungen zu Reuchlins Patriotismus, in: Reuchlin und die politischen Kräfte seiner Zeit, hrsg. von Stefan Rhein (= Pforzheimer Reuchlinschriften 5), Sigmaringen 1998, S. 205-224
Scan mit leicht korrigierter OCR.
Der Beitrag interpretiert zunächst die zwei von Johannes Reuchlin (1455-1522) für seinen Dienstherrn Eberhard im Bart von Württemberg während des Wormser Reichstags im Sommer 1495 angefertigten Übersetzungen aus dem Griechischen: die Übersetzung der 12. Totenrede des Lukian und der 1. Olynthischen Rede des Demosthenes. Aus einer poetischen Epistel Reuchlins an den Magdeburger Gesandten Wolf von Hermansgrün (ediert und übersetzt im Anhang, S. 223-224) geht hervor, wie sehr der Humanist darunter litt, daß er bei der Herzogserhebung Eberhards am 21. Juli nicht anwesend sein konnte. Reuchlins Bekenntnis zum schwäbischen Deutsch verweist auf die Bedeutung des humanistischen Gentilpatriotismus: Reuchlin begriff sich als Schwabe und wurde von seinen Zeitgenossen als solcher identifiziert. Es wird herausgearbeitet, dass Reuchlin einen kulturell akzentuierten Patriotismus vertrat, der vor allem auf seine Heimatstadt Pforzheim und die patria und alte Kulturnation Schwaben bezogen war.

Die poetische Epistel wurde in den Clarorum virorum epistolae, Tübingen 1514 publiziert. Digitalisat der Lutherhalle
Edition in: Johannes Reuchlin, Briefwechsel, Bd. 1, Stuttgart-Bad Cannstatt 1999, S. 236-239 Nr. 75
Lateinischer E-Text:
http://projekte.geschichte.uni-freiburg.de/mertens/graf/epistel.htm
Die deutsche Übersetzung kopiere ich aus dem zweischichtigen PDF, um die Qualität der OCR zu belegen:.
"Johannes Reuchlin aus Pforzheim an Johannes Lycaeus (Wolf von Hermansgrün) in Worms
(1495)
Du mahnst mich, die glänzenden Ruhmestitel des jetzigen Herzogs, des Grafen von einst,
der gefälligen Muse anzuvertrauen. Bitte verschone mich damit. Du weißt nicht, wie kalt
mir ums Herz ist. Allzu Großes forderst Du von einem sehr kleinen Redner. Oft singe ich
verhaltene Lieder zur sanften Laute, die meiner allzu geschwätzigen Kehle entfliehen. Aber
noch während ich daran denke, klagende Verse so vor mich hin zu summen, schluckt der
Schwamm ein Werk, das der Ohren nicht würdig. - Du kennst mein Herz, das bei eisigem
Blute stockt. - Umgarnen kann die Lyra noch ein weiterer mißlicher Umstand. Vieles pflegst
Du zu sehen, Lycaeus, und vieles scheint Dir würdig, daß die Nachwelt es liest gleich
nach den Schriften der Alten. Im festlichen Kreis von Worms siehst Du alles: Könige und
Herzöge, Banner, Trophäen, Chöre, glänzende Höfe des Adels in Begleitung der Musen.
Besinge sie selbst, da Du selbst ja alles Großartige erblickst! Mich fesselt mein Haus und das
ausgebesserte Getäfel eines alten Daches, das schwarze Dach eines düsteren Giebels. Ich
brumme so vor mich hin oder schlichte zuweilen an Gerichtstagen die Streitereien der Gerber;
so mußt Du Dir meine Taten vorstellen. Was soll ich aufzeichnen die Lustbarkeiten
eines festlich gekleideten Königs, die ich nicht gesehen habe, oder die Erscheinung des
schwäbischen Herzogs, die man vor mir verbirgt? Jene Ilias meines Stammes wird man in
Wasser schreiben; ein Windhauch wird forttragen die eitlen Namen der Geschichte. Immer
nämlich fliehen Neckar und Bacenerwald die Musen, und im Schwabenland kann kein Platz
sein für Dichter."
Zu Reuchlins Verhältnis zu Eberhard im Bart siehe auch den im gleichen Band erschienenen Beitrag von Dieter Mertens, ebenfalls in Freidok online:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2766/
***
Meine 1994 begonnene und 1995 behelfsmäßig fertiggestellte Scherz-Dichtung "Der Reichstag. Szene aus einem Humanistenleben"
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/reuchl.htm
war das erste Johannes Reuchlin Online-Dramen-Fragment (und ist es wohl immer noch). Sie thematisiert die Gefühlslage des Tübinger Humanisten, der nicht dabeisein durfte, als sein Herr Eberhard im Bart auf dem Wormser Reichstag zum Herzog erhoben wurde.
Graf, Klaus: Aus krichsscher sprach in das swebischs teutschs gebracht. Bemerkungen zu Reuchlins Patriotismus, in: Reuchlin und die politischen Kräfte seiner Zeit, hrsg. von Stefan Rhein (= Pforzheimer Reuchlinschriften 5), Sigmaringen 1998, S. 205-224
Scan mit leicht korrigierter OCR.
Der Beitrag interpretiert zunächst die zwei von Johannes Reuchlin (1455-1522) für seinen Dienstherrn Eberhard im Bart von Württemberg während des Wormser Reichstags im Sommer 1495 angefertigten Übersetzungen aus dem Griechischen: die Übersetzung der 12. Totenrede des Lukian und der 1. Olynthischen Rede des Demosthenes. Aus einer poetischen Epistel Reuchlins an den Magdeburger Gesandten Wolf von Hermansgrün (ediert und übersetzt im Anhang, S. 223-224) geht hervor, wie sehr der Humanist darunter litt, daß er bei der Herzogserhebung Eberhards am 21. Juli nicht anwesend sein konnte. Reuchlins Bekenntnis zum schwäbischen Deutsch verweist auf die Bedeutung des humanistischen Gentilpatriotismus: Reuchlin begriff sich als Schwabe und wurde von seinen Zeitgenossen als solcher identifiziert. Es wird herausgearbeitet, dass Reuchlin einen kulturell akzentuierten Patriotismus vertrat, der vor allem auf seine Heimatstadt Pforzheim und die patria und alte Kulturnation Schwaben bezogen war.

Die poetische Epistel wurde in den Clarorum virorum epistolae, Tübingen 1514 publiziert. Digitalisat der Lutherhalle
Edition in: Johannes Reuchlin, Briefwechsel, Bd. 1, Stuttgart-Bad Cannstatt 1999, S. 236-239 Nr. 75
Lateinischer E-Text:
http://projekte.geschichte.uni-freiburg.de/mertens/graf/epistel.htm
Die deutsche Übersetzung kopiere ich aus dem zweischichtigen PDF, um die Qualität der OCR zu belegen:.
"Johannes Reuchlin aus Pforzheim an Johannes Lycaeus (Wolf von Hermansgrün) in Worms
(1495)
Du mahnst mich, die glänzenden Ruhmestitel des jetzigen Herzogs, des Grafen von einst,
der gefälligen Muse anzuvertrauen. Bitte verschone mich damit. Du weißt nicht, wie kalt
mir ums Herz ist. Allzu Großes forderst Du von einem sehr kleinen Redner. Oft singe ich
verhaltene Lieder zur sanften Laute, die meiner allzu geschwätzigen Kehle entfliehen. Aber
noch während ich daran denke, klagende Verse so vor mich hin zu summen, schluckt der
Schwamm ein Werk, das der Ohren nicht würdig. - Du kennst mein Herz, das bei eisigem
Blute stockt. - Umgarnen kann die Lyra noch ein weiterer mißlicher Umstand. Vieles pflegst
Du zu sehen, Lycaeus, und vieles scheint Dir würdig, daß die Nachwelt es liest gleich
nach den Schriften der Alten. Im festlichen Kreis von Worms siehst Du alles: Könige und
Herzöge, Banner, Trophäen, Chöre, glänzende Höfe des Adels in Begleitung der Musen.
Besinge sie selbst, da Du selbst ja alles Großartige erblickst! Mich fesselt mein Haus und das
ausgebesserte Getäfel eines alten Daches, das schwarze Dach eines düsteren Giebels. Ich
brumme so vor mich hin oder schlichte zuweilen an Gerichtstagen die Streitereien der Gerber;
so mußt Du Dir meine Taten vorstellen. Was soll ich aufzeichnen die Lustbarkeiten
eines festlich gekleideten Königs, die ich nicht gesehen habe, oder die Erscheinung des
schwäbischen Herzogs, die man vor mir verbirgt? Jene Ilias meines Stammes wird man in
Wasser schreiben; ein Windhauch wird forttragen die eitlen Namen der Geschichte. Immer
nämlich fliehen Neckar und Bacenerwald die Musen, und im Schwabenland kann kein Platz
sein für Dichter."
Zu Reuchlins Verhältnis zu Eberhard im Bart siehe auch den im gleichen Band erschienenen Beitrag von Dieter Mertens, ebenfalls in Freidok online:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2766/
***
Meine 1994 begonnene und 1995 behelfsmäßig fertiggestellte Scherz-Dichtung "Der Reichstag. Szene aus einem Humanistenleben"
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/reuchl.htm
war das erste Johannes Reuchlin Online-Dramen-Fragment (und ist es wohl immer noch). Sie thematisiert die Gefühlslage des Tübinger Humanisten, der nicht dabeisein durfte, als sein Herr Eberhard im Bart auf dem Wormser Reichstag zum Herzog erhoben wurde.
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juli 2008, 15:18 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Graf, Klaus: Die Fehde Diemars von Lindach gegen die Reichsstadt Schwäbisch Gmünd (1543-1554), in: Gmünder Studien 7 (2005), S. 7-32
Der Aufsatz behandelt - aufgrund Stuttgarter und Wiener Akten - eine "späte Fehde" in der Mitte des 16. Jahrhunderts, den Konflikt zwischen einem in Lindach bei Schwäbisch Gmünd ansässigen Kleinadeligen Hans Diemar und der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd, der auch vor dem Reichskammergericht ausgetragen wurde. Diemar hatte den Rückhalt der württembergischen Herzöge Ulrich und Christoph, die damals eine Einschüchterungspolitik gegenüber den benachbarten Reichsstädten betrieben. Der letzte Teil des Beitrags diskutiert das Konzept "Städtefeindschaft" für die Konfliktkonstellation Fürsten und Adel versus Städte. Die Fehdeherren (und ihre Gegenspieler in den Städten) waren beides: souverän handelnde Akteure und Gefangene ihrer Ängste und Feindbilder.
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5496/
Scan mit leicht korrigierter OCR. Der Beitrag ist im wesentlichen ein Nachdruck von: Klaus Graf, Die Fehde Hans Diemars von Lindach gegen die Reichsstadt Schwäbisch Gmünd (1543-1554). Ein Beitrag zur Geschichte der Städtefeindschaft, in: 'Raubritter' oder 'Rechtschaffene vom Adel'? Aspekte von Politik, Friede und Recht im späten Mittelalter, hrsg. von Kurt Andermann (= Oberrheinische Studien 14), Sigmaringen 1997, S. 167-189 (dort waren die Autorenvornamen abgekürzt worden).

http://archiv.twoday.net/stories/4411045/
Abdruck des Fehdebriefs bei Grimm:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:De_Reichsstadt_Gm%C3%BCnd_Grimm_073.jpg
Der Aufsatz behandelt - aufgrund Stuttgarter und Wiener Akten - eine "späte Fehde" in der Mitte des 16. Jahrhunderts, den Konflikt zwischen einem in Lindach bei Schwäbisch Gmünd ansässigen Kleinadeligen Hans Diemar und der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd, der auch vor dem Reichskammergericht ausgetragen wurde. Diemar hatte den Rückhalt der württembergischen Herzöge Ulrich und Christoph, die damals eine Einschüchterungspolitik gegenüber den benachbarten Reichsstädten betrieben. Der letzte Teil des Beitrags diskutiert das Konzept "Städtefeindschaft" für die Konfliktkonstellation Fürsten und Adel versus Städte. Die Fehdeherren (und ihre Gegenspieler in den Städten) waren beides: souverän handelnde Akteure und Gefangene ihrer Ängste und Feindbilder.
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5496/
Scan mit leicht korrigierter OCR. Der Beitrag ist im wesentlichen ein Nachdruck von: Klaus Graf, Die Fehde Hans Diemars von Lindach gegen die Reichsstadt Schwäbisch Gmünd (1543-1554). Ein Beitrag zur Geschichte der Städtefeindschaft, in: 'Raubritter' oder 'Rechtschaffene vom Adel'? Aspekte von Politik, Friede und Recht im späten Mittelalter, hrsg. von Kurt Andermann (= Oberrheinische Studien 14), Sigmaringen 1997, S. 167-189 (dort waren die Autorenvornamen abgekürzt worden).

http://archiv.twoday.net/stories/4411045/
Abdruck des Fehdebriefs bei Grimm:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:De_Reichsstadt_Gm%C3%BCnd_Grimm_073.jpg
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juli 2008, 14:44 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Unabhängig seit über 150 Jahren, in der fünften Generation in Familienbesitz, innovativ aus Tradition: Die Papierfabrik Scheufelen, romantisch gelegen im Lenninger Tal am Fuße der Schwäbischen Alb, setzt weltweit die Maßstäbe bei gestrichenen Premiumpapieren – von der Erfindung des Kunstdruckpapiers bis heute. In der 1773 gegründeten Papiermühle, seit 1855 ununterbrochen geführt von der Familie Scheufelen, entwickeln Meister der Papiermacherkunst schon immer ganz besondere Papiere – für die Vatikanische Bibliothek, für mehrere Flüge zum Mond, für die Casinos von Las Vegas.
Nach Informationen des SWR hat die Papierfabrik aufgrund der hohen Energiepreise nun Insolvenz angemeldet.
http://www.swr.de/nachrichten/bw/-/id=1622/nid=1622/did=3757530/jrhx82/
http://www.boersenblatt.net/220239/

Nach Informationen des SWR hat die Papierfabrik aufgrund der hohen Energiepreise nun Insolvenz angemeldet.
http://www.swr.de/nachrichten/bw/-/id=1622/nid=1622/did=3757530/jrhx82/
http://www.boersenblatt.net/220239/

KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juli 2008, 14:08 - Rubrik: Bestandserhaltung
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juli 2008, 14:05 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juli 2008, 13:48 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juli 2008, 02:18 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juli 2008, 02:14 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juli 2008, 02:02 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Mag. Friedrich Simader von der ÖNB Wien habe ich für Mitteilungen zu Cod. 2799 zu danken (siehe http://archiv.twoday.net/stories/5059380/ ):
"Jörg Rixner wird mindestens zweimal in Cod. 2799 als Autor genannt: Der Eintrag Chmels bezieht sich auf eine Überschrift (fol. 75v) zu einer Liste mit den Königen von Frankreich: ‚Dissen volgenden Stam hat zusamengetragen Jörg Rixner genant Jherusalem gradierter Ernhold uff Brandenburg Konig der Wappen gesamelt von Doctor Matheus Marschalgk auß der Cronigk Brabantya und von dem Munch Drytonius anno 1515’.
In einem Beitrag von Karl Ausserer zu heraldischen Handschriften in der Festschrift von 1926 wird Cod. 2799 ebenfalls erwähnt. Fol. 20*r: ‚Dis ist der recht Stam ... Koninc sind’, darunter ‚Jörg Jerusalem Kundiger der Wappen Ernknecht zu Bairnn’." Diese Nennung bezieht sich auf die Genealogie der Pfalzgrafen bei Rhein und Herzöge von Bayern.
Auf fol. 99v steht 'Jörg Branndenburg Ernhalt Ernnknecht in Bairn'. ("Der Chronik geht auf fol. 98r-99v eine kurze Beschreibung der vier Bücher voran, und am Ende und vom Text etwas abgesetzt heißt es 'gehorsamer Jörg Branndenburg ...'", daher dürfte Chmel den Namen Rixner auch für diesen Text gewählt haben.)
Cod. 2799 dürfte also eine besonders wichtige Handschrift für Rüxners genealogisches Oeuvre sein.
Als neue Namensformen ergeben diese Nennungen:
* Jörg Jerusalem (Rüxner nannte sich also schon Jerusalem, bevor er Herold war.)
* Jörg Brandenburg.
Damit dürfte feststehen, dass der Herold Jörg Brandenburg, der 1505 als "Jorg Brandenburg, Ernhalt, kuryerer dys Registers" eine nur in zwei Drucken überlieferte Beschreibung des Kölner Reichstags von 1505 (ediert: Deutsche Reichstagsakten. Mittlere Reihe Bd. 8: Der Reichstag zu Köln 1505, bearb. von Dietmar Heil, München 2008, S. 1169-1196 Nr. 787) verfasste, ebenfalls Rüxner war.
Was gradierter Herold "uff Brandenburg" bedeutet, ist unklar. Ob ein Zusammenhang mit dem markgräflichen Schwanenorden besteht?
FORTSETZUNG: http://archiv.twoday.net/stories/5068636/

"Jörg Rixner wird mindestens zweimal in Cod. 2799 als Autor genannt: Der Eintrag Chmels bezieht sich auf eine Überschrift (fol. 75v) zu einer Liste mit den Königen von Frankreich: ‚Dissen volgenden Stam hat zusamengetragen Jörg Rixner genant Jherusalem gradierter Ernhold uff Brandenburg Konig der Wappen gesamelt von Doctor Matheus Marschalgk auß der Cronigk Brabantya und von dem Munch Drytonius anno 1515’.
In einem Beitrag von Karl Ausserer zu heraldischen Handschriften in der Festschrift von 1926 wird Cod. 2799 ebenfalls erwähnt. Fol. 20*r: ‚Dis ist der recht Stam ... Koninc sind’, darunter ‚Jörg Jerusalem Kundiger der Wappen Ernknecht zu Bairnn’." Diese Nennung bezieht sich auf die Genealogie der Pfalzgrafen bei Rhein und Herzöge von Bayern.
Auf fol. 99v steht 'Jörg Branndenburg Ernhalt Ernnknecht in Bairn'. ("Der Chronik geht auf fol. 98r-99v eine kurze Beschreibung der vier Bücher voran, und am Ende und vom Text etwas abgesetzt heißt es 'gehorsamer Jörg Branndenburg ...'", daher dürfte Chmel den Namen Rixner auch für diesen Text gewählt haben.)
Cod. 2799 dürfte also eine besonders wichtige Handschrift für Rüxners genealogisches Oeuvre sein.
Als neue Namensformen ergeben diese Nennungen:
* Jörg Jerusalem (Rüxner nannte sich also schon Jerusalem, bevor er Herold war.)
* Jörg Brandenburg.
Damit dürfte feststehen, dass der Herold Jörg Brandenburg, der 1505 als "Jorg Brandenburg, Ernhalt, kuryerer dys Registers" eine nur in zwei Drucken überlieferte Beschreibung des Kölner Reichstags von 1505 (ediert: Deutsche Reichstagsakten. Mittlere Reihe Bd. 8: Der Reichstag zu Köln 1505, bearb. von Dietmar Heil, München 2008, S. 1169-1196 Nr. 787) verfasste, ebenfalls Rüxner war.
Was gradierter Herold "uff Brandenburg" bedeutet, ist unklar. Ob ein Zusammenhang mit dem markgräflichen Schwanenorden besteht?
FORTSETZUNG: http://archiv.twoday.net/stories/5068636/

KlausGraf - am Mittwoch, 16. Juli 2008, 23:48 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Turnierkarte nach Rüxner war völlig entbehrlich; und es war offenbar zu viel Ehre für so grobe und armselige Lügen eines solchen Stümpers im Lügen, als Rüxner einer ist, dass man ihr eine Kupferplatte widmete", wetterte der Rezensent von Klübers "Das Ritterwesen des Mittelalters" Bd. 3, 1791, dem eine Karte der Rüxner'schen Turniere beigegeben war, in der Jenaer "Allgemeinen Literatur-Zeitung" 1792, Sp. 236.

Unter http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Georg_R%C3%BCxner
steht nicht nur dieses Bild, sondern auch die Feyerabend'sche Turnierbuch-Ausgabe von 1579 zur Verfügung.

Unter http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Georg_R%C3%BCxner
steht nicht nur dieses Bild, sondern auch die Feyerabend'sche Turnierbuch-Ausgabe von 1579 zur Verfügung.
KlausGraf - am Mittwoch, 16. Juli 2008, 23:13 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 16. Juli 2008, 22:20 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.archiv.sachsen.de/download/Archivblatt_1-2008.pdf
Arnd Vollmer: Archivbenutzung durch Behörden: Rechtliche Aspekte
Öffentliche Archive dienen nicht nur der
historischen Forschung. Schriftgut ist
nach der gesetzlichen Definition auch
dann archivwürdig, wenn ihm bleibender
Wert für Gesetzgebung, Rechtsprechung,
Regierung und Verwaltung
zukommt. Dementsprechend zählen
Behörden des Bundes und der Länder
sowie der kommunalen Ebene zu den
wichtigsten Nutzern öffentlicher Archive.
In den östlichen Bundesländern besonders
zahlreich sind beispielsweise
die Anfragen von Behörden, die mit der
Durchführung von Restitutions- oder
Entschädigungsverfahren nach dem
Vermögensgesetz oder dem Ausgleichsleistungsgesetz
befasst sind und zur Vorbereitung
ihrer Entscheidung Informationen
aus dem Archivgut benötigen.
Dabei gehen öffentliche Stellen vielfach
davon aus, dass es sich bei der Inanspruchnahme
der Archive um Amtshilfe
handele und dementsprechend keine
Gebühren erhoben werden dürften. Dass
diese Ansicht nicht zutrifft und dass
es sich auch bei der Bearbeitung von
behördlichen Auskunftsersuchen jedenfalls
im rechtlichen Sinne um „normale“,
ggf. gebührenpflichtige Benutzungsvorgänge
handelt, ist kürzlich
erneut in einem Musterverfahren vor dem
Verwaltungsgericht Dresden klargestellt
worden, in dem es um die Zulässigkeit
der Erhebung von Archivgebühren gegenüber
Dienststellen des Bundesamtes
für besondere Dienste und offene Vermögensfragen
ging (Bundesrepublik
Deutschland gegen Freistaat Sachsen,
Urteil des VG Dresden vom 13.11.2007,
Az.: 2 K 621/05 ). Das gibt Anlass zu
einem kurzen Überblick über die Rechtsnatur
der Archivbenutzung durch öffentliche
Stellen, insbesondere in gebührenrechtlicher
Hinsicht.
Arnd Vollmer: Archivbenutzung durch Behörden: Rechtliche Aspekte
Öffentliche Archive dienen nicht nur der
historischen Forschung. Schriftgut ist
nach der gesetzlichen Definition auch
dann archivwürdig, wenn ihm bleibender
Wert für Gesetzgebung, Rechtsprechung,
Regierung und Verwaltung
zukommt. Dementsprechend zählen
Behörden des Bundes und der Länder
sowie der kommunalen Ebene zu den
wichtigsten Nutzern öffentlicher Archive.
In den östlichen Bundesländern besonders
zahlreich sind beispielsweise
die Anfragen von Behörden, die mit der
Durchführung von Restitutions- oder
Entschädigungsverfahren nach dem
Vermögensgesetz oder dem Ausgleichsleistungsgesetz
befasst sind und zur Vorbereitung
ihrer Entscheidung Informationen
aus dem Archivgut benötigen.
Dabei gehen öffentliche Stellen vielfach
davon aus, dass es sich bei der Inanspruchnahme
der Archive um Amtshilfe
handele und dementsprechend keine
Gebühren erhoben werden dürften. Dass
diese Ansicht nicht zutrifft und dass
es sich auch bei der Bearbeitung von
behördlichen Auskunftsersuchen jedenfalls
im rechtlichen Sinne um „normale“,
ggf. gebührenpflichtige Benutzungsvorgänge
handelt, ist kürzlich
erneut in einem Musterverfahren vor dem
Verwaltungsgericht Dresden klargestellt
worden, in dem es um die Zulässigkeit
der Erhebung von Archivgebühren gegenüber
Dienststellen des Bundesamtes
für besondere Dienste und offene Vermögensfragen
ging (Bundesrepublik
Deutschland gegen Freistaat Sachsen,
Urteil des VG Dresden vom 13.11.2007,
Az.: 2 K 621/05 ). Das gibt Anlass zu
einem kurzen Überblick über die Rechtsnatur
der Archivbenutzung durch öffentliche
Stellen, insbesondere in gebührenrechtlicher
Hinsicht.
KlausGraf - am Mittwoch, 16. Juli 2008, 21:41 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das sind die Schachteln des Villa Jelmini. Diesen Wein haben wir lange getrunken. Ich habe immer gesagt, je mehr man säuft, desto mehr Ordnung kann man machen." Harald Szeemann.
" ....Er war Museumsdirektor, "documenta"-Leiter, Biennale-Chef und gilt als einer der weltweit bedeutendsten Ausstellungsmacher. ....
Harald Szeemann bewahrte alles, was mit seinen Ausstellungen zusammenhing auf. Flugbänder, Einladungen zu Vernissagen, Kataloge aus aller Welt, Plakate. Er hat alles gesammelt. Bis unter die Decke stapeln sich die Schachteln. Nichts wanderte in den Papierkorb. ....."
Quelle:
http://www.3sat.de/SCRIPTS/print.php?url=/kulturzeit/themen/124173/index.html
Information zu Szeemann: http://de.wikipedia.org/wiki/Harald_Szeemann
Falls das Bedürfnis nach dem flüssigen Arbeitsmittel besteht, finden sich Angaben zu Produkt und Hersteller hier: http://www.matasci-vini.ch/tedesco/home.html
" ....Er war Museumsdirektor, "documenta"-Leiter, Biennale-Chef und gilt als einer der weltweit bedeutendsten Ausstellungsmacher. ....
Harald Szeemann bewahrte alles, was mit seinen Ausstellungen zusammenhing auf. Flugbänder, Einladungen zu Vernissagen, Kataloge aus aller Welt, Plakate. Er hat alles gesammelt. Bis unter die Decke stapeln sich die Schachteln. Nichts wanderte in den Papierkorb. ....."
Quelle:
http://www.3sat.de/SCRIPTS/print.php?url=/kulturzeit/themen/124173/index.html
Information zu Szeemann: http://de.wikipedia.org/wiki/Harald_Szeemann
Falls das Bedürfnis nach dem flüssigen Arbeitsmittel besteht, finden sich Angaben zu Produkt und Hersteller hier: http://www.matasci-vini.ch/tedesco/home.html
Wolf Thomas - am Mittwoch, 16. Juli 2008, 20:30 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
Die FR (Link) berichtet zum 50. Geburtstag des Bossa nova u. .a. über die Wiederveröffentlichungswelle der Plattenfirmen:
" Universal Music, das Label-Konglomerat mit dem ansehnlichsten Bossa-Nova-Archiv, bietet gleich rund drei Dutzend CD-Neuauflagen seines Bossa-Katalogs an."
" Universal Music, das Label-Konglomerat mit dem ansehnlichsten Bossa-Nova-Archiv, bietet gleich rund drei Dutzend CD-Neuauflagen seines Bossa-Katalogs an."
Wolf Thomas - am Mittwoch, 16. Juli 2008, 19:27 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Denn die "Hausgeschichten", die der hallesche Künstler Daniel Herrmann zum 450. Jahrestag des Gebäudes inszeniert hat, wissen nicht nur von weitläufigen Gartenanlagen zu berichten, mit denen der Drucker und Verlagsbuchhändler Johann Jacob Gebauer im 18. Jahrhundert seinen Firmensitz in der Großen Märkerstraße umgab. Sie weisen in einer Galerie historischer Fotografien auch den Baum nach, der nun wieder wurzelt. .....
Man könnte sich stundenlang in den Details verlieren, die Herrmann mit seinem Ko-Autor Erik Neumann zusammengetragen hat und auch an Hörstationen präsentiert. Doch dann würde man möglicherweise jenes Archiv des Alltags und der Ideologien verpassen, das die Depot-Bestände zur Stadtgeschichte präsentiert - oder die Installationen, mit denen die Ausstellung auf den historischen Raumschmuck reagiert. ..."
Quelle:
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1213961241084
Man könnte sich stundenlang in den Details verlieren, die Herrmann mit seinem Ko-Autor Erik Neumann zusammengetragen hat und auch an Hörstationen präsentiert. Doch dann würde man möglicherweise jenes Archiv des Alltags und der Ideologien verpassen, das die Depot-Bestände zur Stadtgeschichte präsentiert - oder die Installationen, mit denen die Ausstellung auf den historischen Raumschmuck reagiert. ..."
Quelle:
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1213961241084
Wolf Thomas - am Mittwoch, 16. Juli 2008, 19:23 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .....Die Augustiner Chorherren von St. Florian [Linz] machen einen ungewöhnlichen Schatz der Öffentlichkeit zugänglich: Ihre Sammlung von insgesamt 130.000 historischen Ansichtskarten wird teilweise in einer Ausstellung gezeigt und soll später auch im Internet abrufbar sein. Die Schau mit dem Titel "Mit freundlichen Grüßen ..." ist ab 19. Juli im Stift geöffnet.
Begründet wurde die Sammlung durch den Chorherren Josef Ackerl (1863 bis 1917), der 1897 aus reiner Leidenschaft begonnen hatte, Ansichtskarten zu sammeln. Anfangs waren es nur Ansichten aus den Pfarren des Stiftes. Später dokumentierte der Chorherr Christoph von Chiusole seine Lebens- und Reiseerinnerungen mittels Ansichtskarten. Dazu kamen auch andere Chorherren, die ihren Mitbrüdern Karten aus allen Gegenden der Welt schickten. Sie wurden später dem Kloster-Archiv übergeben. So entstand eine Sammlung von Ortsansichten, die mit etwa 30.000 Motiven allein aus Oberösterreich einen Eindruck nicht nur von Land und Leuten, sondern auch vom Publikumsgeschmack und den Reproduktionstechniken jener Zeit vermitteln.
Quelle:
http://derstandard.at/?url=/?id=3415220
Begründet wurde die Sammlung durch den Chorherren Josef Ackerl (1863 bis 1917), der 1897 aus reiner Leidenschaft begonnen hatte, Ansichtskarten zu sammeln. Anfangs waren es nur Ansichten aus den Pfarren des Stiftes. Später dokumentierte der Chorherr Christoph von Chiusole seine Lebens- und Reiseerinnerungen mittels Ansichtskarten. Dazu kamen auch andere Chorherren, die ihren Mitbrüdern Karten aus allen Gegenden der Welt schickten. Sie wurden später dem Kloster-Archiv übergeben. So entstand eine Sammlung von Ortsansichten, die mit etwa 30.000 Motiven allein aus Oberösterreich einen Eindruck nicht nur von Land und Leuten, sondern auch vom Publikumsgeschmack und den Reproduktionstechniken jener Zeit vermitteln.
Quelle:
http://derstandard.at/?url=/?id=3415220
Wolf Thomas - am Mittwoch, 16. Juli 2008, 19:20 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar hat Dokumente aus dem Archiv der Gedenkstätte gestohlen und zu verkaufen versucht. Wie die Polizeidirektion Jena am Mittwoch mitteilte, war Mitarbeitern der Gedenkstätte aufgefallen, dass die Dokumente im Internet zum Verkauf angeboten wurden. Dabei handelte es sich um diverse Unterlagen, unter anderem Briefe und Bücher. ...."
Quelle:
http://www.mdr.de/thueringen/5630828.html
s. a. Bericht der Thüringischen Landeszeitung (Link)
Quelle:
http://www.mdr.de/thueringen/5630828.html
s. a. Bericht der Thüringischen Landeszeitung (Link)
Wolf Thomas - am Mittwoch, 16. Juli 2008, 19:15 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Barbara Bleisch, NZZ (Link), stellt die Leiterin des Züriches Max Frisch Archivs, Margit Unser, vor.
Wolf Thomas - am Mittwoch, 16. Juli 2008, 19:14 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau, die von "1964 bis 1967 am Aufbau dieses »ständigen Lernortes« beteiligt war – vornehmlich im und in der Bibliothek", geht nach 33 Jahren in den Ruhestand.
Quelle:
http://www.jungewelt.de/2008/07-16/014.php
Quelle:
http://www.jungewelt.de/2008/07-16/014.php
Wolf Thomas - am Mittwoch, 16. Juli 2008, 19:13 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Albert Huyskens, Spross einer rheinischen Kaufmannsfamilie, war 35 Jahre lang Direktor des
Aachener Stadtarchivs, 22 Jahre war er Vorsitzender des Aachener CV-Philisterzirkels, des
Zusammenschlusses von Altakademikern des Cartellverbandes der katholischen deutschen Studentenverbindungen.
Er war 17 Jahre lang Vorsitzender der Westdeutschen Gesellschaft für
Familienkunde und schließlich 18 Jahre Vorsitzender des Aachener Geschichtsvereins. Geboren
1879 in Mönchengladbach, gestorben 1956 in Aachen, reichte seine umfangreiche Tätigkeit als
Historiker, Archivar und Familienforscher vom Kaiserreich bis in die frühe Bundesrepublik.
Huyskens gilt in Aachen dank seiner „wertvollen Forschungsarbeiten zur Aachener, rheinischen
und deutschen Geschichte, vor allem auch durch sein Geschick in Organisation und Leitung
wissenschaftlicher Vereine und als Dozent an der Aachener TH“1 als „Nestor der Aachener
Geschichtsforschung“2. Die Wertschätzung, die ihm die Stadt entgegenbrachte, zeigt sich
u.a. darin, dass 1977 eine Straße im Melatener Erweiterungsgebiet der TH Aachen nach ihm
benannt wurde.
Fest verwurzelt im katholischen, national-konservativen Bildungsbürgertum3 und einem streng
positivistischen Wissenschaftsethos verpflichtet4, steuerte er – so der langjährige Stadtarchivar
und heutige Ehrenvorsitzende des Aachener Geschichtsvereins Herbert Lepper 1997 – mit strategischem
Geschick den Aachener Geschichtsverein, die Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde
und das Aachener Stadtarchiv unbeschadet durch die Zeit des Dritten Reiches. Und
soweit dies in seinen Möglichkeiten lag, leistete er nach Ansicht Leppers Widerstand gegen den
nationalsozialistischen Zeitgeist.5 Der Historiker Ulrich Kalkmann kommt in seiner 2003 erschienenen
Dissertation über die TH Aachen im Dritten Reich zu dem Schluss, dass Huyskens
„nicht den Vorstellungen der Aachener Nationalsozialisten“6 entsprach.
Diese Einschätzungen stehen in einem seltsamen Gegensatz zu zahlreichen in der NS-Zeit publizierten
Äußerungen von Albert Huyskens.
So beginnt der Aufsatz „Sippenforschung und Rassepolitik“ – Albert Huyskens und der Aachener Mythos vom katholischen Widerstand
von Stefan Krebs und Werner Tschacher, der in ungekürzter Form (mit Anmerkungen) online nachlesbar ist:
http://www.histech.rwth-aachen.de/content/1564/Sippenkunde.pdf
Zitat:
Für die große Ausstellung „Schaffendes Grenzland“ im Neuen Kurhaus vom 7. bis 19. Oktober
1938 schlug Huyskens Stadtoberinspektor Franck in einem Schreiben einen Figurenfries vor:
„Vom Beschauer links vor dem Hintergrund einer Ahnentafel ein Archivar, der einem vor ihm
stehenden SS-Mann eine Urkunde aushändigt, in der Mitte vor dem Hintergrund eines Aktengestells
hinter einem Tisch ein Forscher eine alte Pergamenturkunde mit Siegeln lesend, rechts
ein Bote einen Brief in einen Reichspostbriefkasten einwerfend.“

Aachener Stadtarchivs, 22 Jahre war er Vorsitzender des Aachener CV-Philisterzirkels, des
Zusammenschlusses von Altakademikern des Cartellverbandes der katholischen deutschen Studentenverbindungen.
Er war 17 Jahre lang Vorsitzender der Westdeutschen Gesellschaft für
Familienkunde und schließlich 18 Jahre Vorsitzender des Aachener Geschichtsvereins. Geboren
1879 in Mönchengladbach, gestorben 1956 in Aachen, reichte seine umfangreiche Tätigkeit als
Historiker, Archivar und Familienforscher vom Kaiserreich bis in die frühe Bundesrepublik.
Huyskens gilt in Aachen dank seiner „wertvollen Forschungsarbeiten zur Aachener, rheinischen
und deutschen Geschichte, vor allem auch durch sein Geschick in Organisation und Leitung
wissenschaftlicher Vereine und als Dozent an der Aachener TH“1 als „Nestor der Aachener
Geschichtsforschung“2. Die Wertschätzung, die ihm die Stadt entgegenbrachte, zeigt sich
u.a. darin, dass 1977 eine Straße im Melatener Erweiterungsgebiet der TH Aachen nach ihm
benannt wurde.
Fest verwurzelt im katholischen, national-konservativen Bildungsbürgertum3 und einem streng
positivistischen Wissenschaftsethos verpflichtet4, steuerte er – so der langjährige Stadtarchivar
und heutige Ehrenvorsitzende des Aachener Geschichtsvereins Herbert Lepper 1997 – mit strategischem
Geschick den Aachener Geschichtsverein, die Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde
und das Aachener Stadtarchiv unbeschadet durch die Zeit des Dritten Reiches. Und
soweit dies in seinen Möglichkeiten lag, leistete er nach Ansicht Leppers Widerstand gegen den
nationalsozialistischen Zeitgeist.5 Der Historiker Ulrich Kalkmann kommt in seiner 2003 erschienenen
Dissertation über die TH Aachen im Dritten Reich zu dem Schluss, dass Huyskens
„nicht den Vorstellungen der Aachener Nationalsozialisten“6 entsprach.
Diese Einschätzungen stehen in einem seltsamen Gegensatz zu zahlreichen in der NS-Zeit publizierten
Äußerungen von Albert Huyskens.
So beginnt der Aufsatz „Sippenforschung und Rassepolitik“ – Albert Huyskens und der Aachener Mythos vom katholischen Widerstand
von Stefan Krebs und Werner Tschacher, der in ungekürzter Form (mit Anmerkungen) online nachlesbar ist:
http://www.histech.rwth-aachen.de/content/1564/Sippenkunde.pdf
Zitat:
Für die große Ausstellung „Schaffendes Grenzland“ im Neuen Kurhaus vom 7. bis 19. Oktober
1938 schlug Huyskens Stadtoberinspektor Franck in einem Schreiben einen Figurenfries vor:
„Vom Beschauer links vor dem Hintergrund einer Ahnentafel ein Archivar, der einem vor ihm
stehenden SS-Mann eine Urkunde aushändigt, in der Mitte vor dem Hintergrund eines Aktengestells
hinter einem Tisch ein Forscher eine alte Pergamenturkunde mit Siegeln lesend, rechts
ein Bote einen Brief in einen Reichspostbriefkasten einwerfend.“

KlausGraf - am Mittwoch, 16. Juli 2008, 17:22 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ihre Anfrage beantwortet der OPAC Kalliope zum Teil: Signatur – Slg. Autogr.: Rüxner, Georg; Adressat - Unbekannt
Es handelt sich um einen Bittbrief für Rüxners 70-jährigen Schwager Hans Eisen. Eine Kopie des Briefes würde 5,--€ und Porto kosten, die Bearbeitungszeit nimmt cirka 4-6 Wochen in Anspruch.
Es handelt sich um einen Bittbrief für Rüxners 70-jährigen Schwager Hans Eisen. Eine Kopie des Briefes würde 5,--€ und Porto kosten, die Bearbeitungszeit nimmt cirka 4-6 Wochen in Anspruch.
KlausGraf - am Mittwoch, 16. Juli 2008, 01:46 - Rubrik: Landesgeschichte
Das Historische Archiv des Bankhauses Sal. Oppenheim sucht eine/n Praktikant/in für ein mindestens sechswöchiges Praktikum. Hauptbestandteil des Praktikums wird die Ordnung, Verzeichnung und Digitalisierung eines eigenen Archivbestands sein. Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes Grundstudium der Geschichte oder Archivwissenschaft, gute PC-Kenntnisse und selbständiges Arbeiten. Die Vergütung beträgt € 700,- im Monat.
Kontakt:
Gabriele Teichmann
Sal. Oppenheim jr. & Cie., Unter Sachsenhausen 4, 50667 Köln
0221 145 1613
0221 145 9 1613
gabriele.teichmann@oppenheim.de
URL: http://www.oppenheim.de
URL zur Zitation dieses Beitrageshttp://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/chancen/id=2911&type=stellen
Kontakt:
Gabriele Teichmann
Sal. Oppenheim jr. & Cie., Unter Sachsenhausen 4, 50667 Köln
0221 145 1613
0221 145 9 1613
gabriele.teichmann@oppenheim.de
URL: http://www.oppenheim.de
URL zur Zitation dieses Beitrageshttp://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/chancen/id=2911&type=stellen
KlausGraf - am Dienstag, 15. Juli 2008, 23:57 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
This paper has demonstrated that it is almost impossible to determine with certainty whether a work published from 1923 through 1963 in the US is in the public domain because of copyright restoration of foreign works. First you have to determine if the work was also published abroad or if it is based on or derived from a work published abroad. If a foreign edition is found, one then has to establish the order of publication, and whether the foreign publication occurred less than 30 days before the US publication. If foreign publication was more than 30 days before American publication, one next needs to determine if publication occurred in an eligible country and if at least one of the authors of the work was living in or a citizen of an eligible nation. Checking the copyright renewal database is still important, but only after one has determined that the work's foreign copyright was not restored or that it does not draw upon subsisting foreign copyrights.
Copyright restoration has been criticized for unnecessarily removing thousands of foreign-published works from the public domain in the United States. What has been little noticed up to now is its negative impact on the determination of the potential public domain status of works published in the US. In many cases the impossibility of determining with certainty the absence of subsisting foreign copyrights in American publications that otherwise would be in the public domain means that American institutions will either have to keep these works inaccessible to the general public or risk the possibility of an infringement suit.
Peter Hirtle: Copyright Renewal, Copyright Restoration, and the Difficulty of Determining Copyright Status, D-Lib Magazine Volume 14 Number 7/8, 2008
http://www.dlib.org/dlib/july08/hirtle/07hirtle.html
Copyright restoration has been criticized for unnecessarily removing thousands of foreign-published works from the public domain in the United States. What has been little noticed up to now is its negative impact on the determination of the potential public domain status of works published in the US. In many cases the impossibility of determining with certainty the absence of subsisting foreign copyrights in American publications that otherwise would be in the public domain means that American institutions will either have to keep these works inaccessible to the general public or risk the possibility of an infringement suit.
Peter Hirtle: Copyright Renewal, Copyright Restoration, and the Difficulty of Determining Copyright Status, D-Lib Magazine Volume 14 Number 7/8, 2008
http://www.dlib.org/dlib/july08/hirtle/07hirtle.html
KlausGraf - am Dienstag, 15. Juli 2008, 23:41 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Steff Steiner: Ein Aktenlocher.
In: Mühlviertler Heimatblätter Jg. 3 (1963) H. 1/2, S. 6
http://www.ooegeschichte.at/uploads/tx_iafbibliografiedb/mhbl1963_1_2_0006.pdf
In: Mühlviertler Heimatblätter Jg. 3 (1963) H. 1/2, S. 6
http://www.ooegeschichte.at/uploads/tx_iafbibliografiedb/mhbl1963_1_2_0006.pdf
Ladislaus - am Dienstag, 15. Juli 2008, 19:41 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 15. Juli 2008, 17:15 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 14. Juli 2008, 23:20 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ergänzungen, überwiegend zur Rezeption, zu dem Beitrag "Neues zu Jörg Rugen/Rüxner" http://archiv.twoday.net/stories/4993981/
***
Unbekannte genealogische Einblattdrucke
In das Wappenbuch ÖNB Wien Cod. 8769 wurden nachträglich im 16. Jahrhundert auf die Blätter 14 und 25 zwei (anderweitig anscheinend nicht erhaltene) Einblattdrucke zerschnitten aufgeklebt. Es handelt sich um Ahnentafeln des Herzogs Johann von Sachsen und des Pfalzgrafen Ludwig mit je 16 Holzschnittwappen. Beide tragen als Namen des Herausgebers: "Georg Rixner genandt hierosalem Eraldo".
E. Freiherr von Berchem u.a., Beiträge zur Geschichte der Heraldik, Berlin 1939, S. 81f.
***
Benutzung Rüxner'scher Genealogien in ÖNB Wien, Cod. 2799 (Mitte 16. Jh., aus Bayern), einem genealogischen Sammelband
"Frankreich: Rixner Ernholds vnd D. Mach. Marschalch. F. 75.b" (D. Mach. Marschalch ist wohl der bekannte Genealoge Matthäus Marschalk von Pappenheim)
"Zollern vnd Margrafen von Brandeburg weg Rixners 98"
Joseph Chmel: Die Handschriften der k.k. Hofbibliothek in Wien [...], Bd. 1, Wien 1840, S. 489
http://books.google.com/books?id=R3UDAAAAYAAJ&pg=PA489
[Nachtrag: http://archiv.twoday.net/stories/5063852/ ]
***
Wappenbuch eines bayerischen Herolds um 1520
Berchem u.a. (wie oben), S. 162 erwähnen das Wappenbuch eines bayerischen Herolds um 1520 damals im Besitz von Otto Hupp. Die Abb. S. 165 zeigt diesen Herold mit den bayerischen Rauten und einem Jerusalemkreuz auf der Brust. Es könnte sich daher um ein weiteres Wappenbuch Rüxners handeln. Vorlage der Darstellung war offenbar der Burgkmair-Holzschnitt von 1504, der Rüxner zeigt.

[Nachtrag: Der Burgkmair-Holzschnitt liegt im British Museum in guter Qualität online vor:
http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectId=1439892&partId=1 ]

[Die 4 Wappen dürften die Länder Schwaben, Bayern, Franken und Sachsen sein.]
***
Nachlass im Schönfeld'schen Adelsarchiv?
Hans von Schönfeld aus böhmischer Ritterfamilie, geboren 1720 und Hofbuchdrucker in Prag, "besaß eine beträchtliche Sammlung genealogisch-heraldischer Urkunden aus dem Nachlasse des berühmten Rixner, Verfassers des deutschen Turnierbuchs vom Jahre 1572", die er seinem Sohn Ignaz hinterließ, der sie erweiterte. Sie wurden Bestandteil des Wiener Schönfeld-Museum. Aufgrund dieser Sammlungen erschienen: Johann Ferdinand von Schönfeld: Materialien zur diplomatischen Genealogie des Adels der österreichischen Monarchie, Prag 1812; Ignaz von Schönfeld: Adels-Schematismus des österreichischen Kaiserstaates, 1824-1825.
Oesterreichische National-Encyklopädie Bd. 4, Wien 1836, S. 578
http://tinyurl.com/6k4c35
Rüxners Nachlass wird (ohne nähere Angaben) bereits erwähnt in dem Artikel: Schönfelds genealogisch-heraldisches Adels-Archiv in Wien, in: Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst 1811, S. 637-639, hier S. 638
http://books.google.de/books?id=reYEAAAAIAAJ&pg=RA3-PA634
Die Sammlungen wurden später zerstreut. Die Nachricht ist vorerst mit größter Vorsicht aufzunehmen.
***
Bearbeitung des Turnierbuchs in Gießen, UB, Hs. 284
Eine mit vielen Wappen illustrierte Neubearbeitung, gewidmet Kurfürst Ludwig von der Pfalz, liegt in Gießen (Hs. 284).
Katalog Adrian S. 90f.
http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2006/3169/
***
Theatrum Germanicae Nobilitatis
Unter diesem Titel überliefert LB Stuttgart Cod. hist. fol. 473 II, S. 1-62 ein alphabetisches Register zu Rüxners Turnierbuch, geschrieben von dem bekannten Zwiefalter Mönch Stephan Bochenthaler in Mariaberg 1643 (Katalog von Heyd). Das gleiche Werk ist auch in der Universitätsbibliothek Tübingen, Md 15, vorhanden (15./16. Jh.):
http://www.hmml.org/research06/catalogue/detail.asp?MSID=73323
***
Rüxner-Benutzung in der Ahnen-Galerie der Sturmfeder von Oppenweiler
Diese Serie von Ölgemälden befindet sich auf Schloss Thurn bei Forchheim und wurde um 1580 begonnen. Das erste Doppelporträt zeigt Philipp Sturmfeder und seine Ehefrau Guta von Westerstetten, die als Witwe auf dem Turnier von Nürnberg 1198 geholfen habe, die Kränze auszuteilen. Im Sturmfeder-Archiv blieb eine Zusammenstellung des Öhringer Lateinschul-Präzeptors Carl Christoph Beyer von 1580 erhalten, der von der Familie den Auftrag erhalten hatte, die Nennungen der Familie im Rüxnerschen Turnierbuch zu exzerpieren. Überhaupt wird man annehmen dürfen, dass die Adelsfamilien die Angaben des Turnierbuchs häufig indirekt über genealogische "Spezialisten" vermittelt erhielten.
Harald Drös/Gerhard Fritz: Die Inschriften des Rems-Murr-Kreises, Wiesbaden 1994, S. 98, 100.
***
Illuminierte Exemplare
Wappenbeschreibungen aus einem alten illuminierten Exemplar teilte eine Rezension in der Jenaer Allgemeinen Literatur-Zeitung 1786, S.p. 165f. mit.
http://books.google.de/books?id=LTACAAAAYAAJ&pg=RA2-PA176-IA1
Im Exemplar der UB Tübingen der Ausgabe 1532 (Signatur: Fo XII.a.52.2°) ist das Wappen der Nürnberger Patrizier Haller von Hallerstein durchgehend koloriert (Graf, Exemplarische Geschichten, 1987, S. 121 Anm. 28).
Anfang des 17. Jahrhunderts erwarb Erhard von Muggenthal Rixners Turnierbuch von 1530 mit handgemalten bayerischen Wappen (heute wohl in der UB Würzburg)
ZBLG 1 (1928), S. 74
http://mdz1.bib-bvb.de/cocoon/bayern/zblg/seite/zblg01_0083
***
Gedruckter Auszug von Clamorinus
Thurnirbüchlein : Ein newer Ausszug, aus dem alten Original, von 36. Thurnieren, von Keyser Heinrichs des ersten zeit an, Anno 936. biß auff Keyser Maximilanum den ersten ... Auch sonst von zweyen Ritterspielen, derer vom Adel vnd anderer Herren, Graffen vnd Fürsten mehr gehalten ... ; Mit einem Register darinne vber 360. Deudsche vom Adel derer Geschlechte vnd Namen erzehlet werden, wie sie in den alten Thurnieren vor 900. Jaren gefunden werden / zusammen verfasset durch M. Bartholomæum Clamorinum
Verfasser: Clamorinus, Bartholomaeus *1582-1601*
Erschienen: Dreßden : Berg, 1590
Umfang: [66] Bl. ; 4º
Anmerkung: Bibliogr. Nachweis: VD 16: C 4019
(OPAC HAB Wolfenbüttel)
[Nachtrag:
Clamorinus, Bartholomaeus: Thurnierbüchlein von Keyser Heinrich I. ... bis auf Maximilianum I. 1487, Dreßden 1591/(1590) [VD16 C 4020]
Online: http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0002/bsb00024327/images/ ]
***
Ist Rüxner mit anderen Herolden um 1500, die Jörg hiessen identisch?
Regesta Imperii XIV 1 n. 2528
1495 Oktober 8 Worms
KM gibt seinem Herold Georgio Elsas Heraldo einen Empfehlungsbrief an alle Kge, Fsten, Hge, Gfen etc.: Georg Elsaß hat die Absicht, das Hl. Grab in Jerusalem zu besuchen und verschiedene Teile der Welt zu bereisen, um die Sitten der Höfe, deren tapfere Taten (fortia gesta), ihre Wappen und alles, was zu seinen Pflichten gehört, zu erkunden. Wormatie 8. Octobris 1495.
RE: Wien HHSA, rrb JJ, 212.
http://www.regesta-imperii.de/regesten/index.php?uri=1495-10-08_6_0_14_1_0_2533_2528
Passen würde das gut zu Rüxner, nannte er sich doch später Jerusalem. Dies wird üblicherweise auf das Königreich Jerusalem bezogen, kann aber daneben auch auf eine Pilgerfahrt Bezug nehmen. In den Versen zum Wiener Heroldsbild Rugens Cod. 2396 wird Rugen als weitgereist ausgegeben. Die gleiche Person erscheint bereits 1489 als "Jorgen Elsässer" in Nürnberg, wo sie als königlicher Persevant ein Geldgeschenk erhielt (Chroniken der Deutschen Städte Bd. 11, S. 501). Wenn es sich um Rugen/Rüxner handeln sollte, hätte er seinen Amtsnamen gewechselt: vom Elsaß zu Jerusalem.
Derzeit stellt dieser Identifizierungsvorschlag allerdings nicht mehr als eine Spekulation dar.
1505 verfasste ein "Jorg Brandenburg, Ernhalt, kuryerer dys Registers" eine nur in zwei Drucken überlieferte Beschreibung des Kölner Reichstags von 1505. Ediert: Deutsche Reichstagsakten. Mittlere Reihe Bd. 8: Der Reichstag zu Köln 1505, bearb. von Dietmar Heil, München 2008, S. 1169-1196 Nr. 787. Undenkbar wäre es nicht, dass sich auch dahinter Rüxner verbirgt, erscheint er doch 15 Jahre später in brandenburgischen Diensten (ohne sein Amt als Reichsherold aufzugeben). 1505 waren mehrere königliche Herolde auf dem Reichstag, mit Namen wird aber nur ein Michel genannt. Köln zählte außer ihm noch drei weitere königliche Herolde, an anderer Stelle ist von drei Herolden des Königs und einem Persevant die Rede. Eine mecklenburgische Abrechnung weiß sogar von 10 Herolden des Königs (ebd., S. 1240, 1257).
[Da sich Rüxner auch Jörg Brandenburg nennt http://archiv.twoday.net/stories/5063852/ ist wohl von der Identität auszugehen.]
***
Der wichtigste Neufund, Rüxners Geschichte der sächsischen Herzöge um 1520 (zuvor erschließbar aus Georg Fabricius: Origines, 1598, pag. 72 http://tinyurl.com/6dftqp ), überliefert in Jena und Gotha, wird ebenso wie die Beteiligung Rüxners an der Textgeschichte der Turnierreime Johann Hollands zu einem späteren Zeitpunkt angezeigt werden.
NACHTRÄGE
Rüxners Schwager Hans Eisen erscheint in einem Berliner Bittbrief Rüxners:
http://archiv.twoday.net/stories/5061910/
Turnierkarte 1791 (und Hinweis auf Turnierbuch-Digitalisat):
http://archiv.twoday.net/stories/5063775/
Neue Namensformen
http://archiv.twoday.net/stories/5063852/
***
Unbekannte genealogische Einblattdrucke
In das Wappenbuch ÖNB Wien Cod. 8769 wurden nachträglich im 16. Jahrhundert auf die Blätter 14 und 25 zwei (anderweitig anscheinend nicht erhaltene) Einblattdrucke zerschnitten aufgeklebt. Es handelt sich um Ahnentafeln des Herzogs Johann von Sachsen und des Pfalzgrafen Ludwig mit je 16 Holzschnittwappen. Beide tragen als Namen des Herausgebers: "Georg Rixner genandt hierosalem Eraldo".
E. Freiherr von Berchem u.a., Beiträge zur Geschichte der Heraldik, Berlin 1939, S. 81f.
***
Benutzung Rüxner'scher Genealogien in ÖNB Wien, Cod. 2799 (Mitte 16. Jh., aus Bayern), einem genealogischen Sammelband
"Frankreich: Rixner Ernholds vnd D. Mach. Marschalch. F. 75.b" (D. Mach. Marschalch ist wohl der bekannte Genealoge Matthäus Marschalk von Pappenheim)
"Zollern vnd Margrafen von Brandeburg weg Rixners 98"
Joseph Chmel: Die Handschriften der k.k. Hofbibliothek in Wien [...], Bd. 1, Wien 1840, S. 489
http://books.google.com/books?id=R3UDAAAAYAAJ&pg=PA489
[Nachtrag: http://archiv.twoday.net/stories/5063852/ ]
***
Wappenbuch eines bayerischen Herolds um 1520
Berchem u.a. (wie oben), S. 162 erwähnen das Wappenbuch eines bayerischen Herolds um 1520 damals im Besitz von Otto Hupp. Die Abb. S. 165 zeigt diesen Herold mit den bayerischen Rauten und einem Jerusalemkreuz auf der Brust. Es könnte sich daher um ein weiteres Wappenbuch Rüxners handeln. Vorlage der Darstellung war offenbar der Burgkmair-Holzschnitt von 1504, der Rüxner zeigt.

[Nachtrag: Der Burgkmair-Holzschnitt liegt im British Museum in guter Qualität online vor:
http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectId=1439892&partId=1 ]

[Die 4 Wappen dürften die Länder Schwaben, Bayern, Franken und Sachsen sein.]
***
Nachlass im Schönfeld'schen Adelsarchiv?
Hans von Schönfeld aus böhmischer Ritterfamilie, geboren 1720 und Hofbuchdrucker in Prag, "besaß eine beträchtliche Sammlung genealogisch-heraldischer Urkunden aus dem Nachlasse des berühmten Rixner, Verfassers des deutschen Turnierbuchs vom Jahre 1572", die er seinem Sohn Ignaz hinterließ, der sie erweiterte. Sie wurden Bestandteil des Wiener Schönfeld-Museum. Aufgrund dieser Sammlungen erschienen: Johann Ferdinand von Schönfeld: Materialien zur diplomatischen Genealogie des Adels der österreichischen Monarchie, Prag 1812; Ignaz von Schönfeld: Adels-Schematismus des österreichischen Kaiserstaates, 1824-1825.
Oesterreichische National-Encyklopädie Bd. 4, Wien 1836, S. 578
http://tinyurl.com/6k4c35
Rüxners Nachlass wird (ohne nähere Angaben) bereits erwähnt in dem Artikel: Schönfelds genealogisch-heraldisches Adels-Archiv in Wien, in: Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst 1811, S. 637-639, hier S. 638
http://books.google.de/books?id=reYEAAAAIAAJ&pg=RA3-PA634
Die Sammlungen wurden später zerstreut. Die Nachricht ist vorerst mit größter Vorsicht aufzunehmen.
***
Bearbeitung des Turnierbuchs in Gießen, UB, Hs. 284
Eine mit vielen Wappen illustrierte Neubearbeitung, gewidmet Kurfürst Ludwig von der Pfalz, liegt in Gießen (Hs. 284).
Katalog Adrian S. 90f.
http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2006/3169/
***
Theatrum Germanicae Nobilitatis
Unter diesem Titel überliefert LB Stuttgart Cod. hist. fol. 473 II, S. 1-62 ein alphabetisches Register zu Rüxners Turnierbuch, geschrieben von dem bekannten Zwiefalter Mönch Stephan Bochenthaler in Mariaberg 1643 (Katalog von Heyd). Das gleiche Werk ist auch in der Universitätsbibliothek Tübingen, Md 15, vorhanden (15./16. Jh.):
http://www.hmml.org/research06/catalogue/detail.asp?MSID=73323
***
Rüxner-Benutzung in der Ahnen-Galerie der Sturmfeder von Oppenweiler
Diese Serie von Ölgemälden befindet sich auf Schloss Thurn bei Forchheim und wurde um 1580 begonnen. Das erste Doppelporträt zeigt Philipp Sturmfeder und seine Ehefrau Guta von Westerstetten, die als Witwe auf dem Turnier von Nürnberg 1198 geholfen habe, die Kränze auszuteilen. Im Sturmfeder-Archiv blieb eine Zusammenstellung des Öhringer Lateinschul-Präzeptors Carl Christoph Beyer von 1580 erhalten, der von der Familie den Auftrag erhalten hatte, die Nennungen der Familie im Rüxnerschen Turnierbuch zu exzerpieren. Überhaupt wird man annehmen dürfen, dass die Adelsfamilien die Angaben des Turnierbuchs häufig indirekt über genealogische "Spezialisten" vermittelt erhielten.
Harald Drös/Gerhard Fritz: Die Inschriften des Rems-Murr-Kreises, Wiesbaden 1994, S. 98, 100.
***
Illuminierte Exemplare
Wappenbeschreibungen aus einem alten illuminierten Exemplar teilte eine Rezension in der Jenaer Allgemeinen Literatur-Zeitung 1786, S.p. 165f. mit.
http://books.google.de/books?id=LTACAAAAYAAJ&pg=RA2-PA176-IA1
Im Exemplar der UB Tübingen der Ausgabe 1532 (Signatur: Fo XII.a.52.2°) ist das Wappen der Nürnberger Patrizier Haller von Hallerstein durchgehend koloriert (Graf, Exemplarische Geschichten, 1987, S. 121 Anm. 28).
Anfang des 17. Jahrhunderts erwarb Erhard von Muggenthal Rixners Turnierbuch von 1530 mit handgemalten bayerischen Wappen (heute wohl in der UB Würzburg)
ZBLG 1 (1928), S. 74
http://mdz1.bib-bvb.de/cocoon/bayern/zblg/seite/zblg01_0083
***
Gedruckter Auszug von Clamorinus
Thurnirbüchlein : Ein newer Ausszug, aus dem alten Original, von 36. Thurnieren, von Keyser Heinrichs des ersten zeit an, Anno 936. biß auff Keyser Maximilanum den ersten ... Auch sonst von zweyen Ritterspielen, derer vom Adel vnd anderer Herren, Graffen vnd Fürsten mehr gehalten ... ; Mit einem Register darinne vber 360. Deudsche vom Adel derer Geschlechte vnd Namen erzehlet werden, wie sie in den alten Thurnieren vor 900. Jaren gefunden werden / zusammen verfasset durch M. Bartholomæum Clamorinum
Verfasser: Clamorinus, Bartholomaeus *1582-1601*
Erschienen: Dreßden : Berg, 1590
Umfang: [66] Bl. ; 4º
Anmerkung: Bibliogr. Nachweis: VD 16: C 4019
(OPAC HAB Wolfenbüttel)
[Nachtrag:
Clamorinus, Bartholomaeus: Thurnierbüchlein von Keyser Heinrich I. ... bis auf Maximilianum I. 1487, Dreßden 1591/(1590) [VD16 C 4020]
Online: http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0002/bsb00024327/images/ ]
***
Ist Rüxner mit anderen Herolden um 1500, die Jörg hiessen identisch?
Regesta Imperii XIV 1 n. 2528
1495 Oktober 8 Worms
KM gibt seinem Herold Georgio Elsas Heraldo einen Empfehlungsbrief an alle Kge, Fsten, Hge, Gfen etc.: Georg Elsaß hat die Absicht, das Hl. Grab in Jerusalem zu besuchen und verschiedene Teile der Welt zu bereisen, um die Sitten der Höfe, deren tapfere Taten (fortia gesta), ihre Wappen und alles, was zu seinen Pflichten gehört, zu erkunden. Wormatie 8. Octobris 1495.
RE: Wien HHSA, rrb JJ, 212.
http://www.regesta-imperii.de/regesten/index.php?uri=1495-10-08_6_0_14_1_0_2533_2528
Passen würde das gut zu Rüxner, nannte er sich doch später Jerusalem. Dies wird üblicherweise auf das Königreich Jerusalem bezogen, kann aber daneben auch auf eine Pilgerfahrt Bezug nehmen. In den Versen zum Wiener Heroldsbild Rugens Cod. 2396 wird Rugen als weitgereist ausgegeben. Die gleiche Person erscheint bereits 1489 als "Jorgen Elsässer" in Nürnberg, wo sie als königlicher Persevant ein Geldgeschenk erhielt (Chroniken der Deutschen Städte Bd. 11, S. 501). Wenn es sich um Rugen/Rüxner handeln sollte, hätte er seinen Amtsnamen gewechselt: vom Elsaß zu Jerusalem.
Derzeit stellt dieser Identifizierungsvorschlag allerdings nicht mehr als eine Spekulation dar.
1505 verfasste ein "Jorg Brandenburg, Ernhalt, kuryerer dys Registers" eine nur in zwei Drucken überlieferte Beschreibung des Kölner Reichstags von 1505. Ediert: Deutsche Reichstagsakten. Mittlere Reihe Bd. 8: Der Reichstag zu Köln 1505, bearb. von Dietmar Heil, München 2008, S. 1169-1196 Nr. 787. Undenkbar wäre es nicht, dass sich auch dahinter Rüxner verbirgt, erscheint er doch 15 Jahre später in brandenburgischen Diensten (ohne sein Amt als Reichsherold aufzugeben). 1505 waren mehrere königliche Herolde auf dem Reichstag, mit Namen wird aber nur ein Michel genannt. Köln zählte außer ihm noch drei weitere königliche Herolde, an anderer Stelle ist von drei Herolden des Königs und einem Persevant die Rede. Eine mecklenburgische Abrechnung weiß sogar von 10 Herolden des Königs (ebd., S. 1240, 1257).
[Da sich Rüxner auch Jörg Brandenburg nennt http://archiv.twoday.net/stories/5063852/ ist wohl von der Identität auszugehen.]
***
Der wichtigste Neufund, Rüxners Geschichte der sächsischen Herzöge um 1520 (zuvor erschließbar aus Georg Fabricius: Origines, 1598, pag. 72 http://tinyurl.com/6dftqp ), überliefert in Jena und Gotha, wird ebenso wie die Beteiligung Rüxners an der Textgeschichte der Turnierreime Johann Hollands zu einem späteren Zeitpunkt angezeigt werden.
NACHTRÄGE
Rüxners Schwager Hans Eisen erscheint in einem Berliner Bittbrief Rüxners:
http://archiv.twoday.net/stories/5061910/
Turnierkarte 1791 (und Hinweis auf Turnierbuch-Digitalisat):
http://archiv.twoday.net/stories/5063775/
Neue Namensformen
http://archiv.twoday.net/stories/5063852/
KlausGraf - am Montag, 14. Juli 2008, 21:00 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Leiter des Dresdener Stadtarchivs freut sich über den Nachlass des Kapellmeister Ernst Schicketanz, den dessen Nichte dem Stadtarchiv geschenkt.
Neben den Korrespondenzen haben es dem Stadtarchivar seltene Bilder der Primadonna Anna Pawlowa angetan.
Quelle:
http://www.dresden-fernsehen.de/default.aspx?ID=1988&showNews=250282 [mit Videobeitrag]
zur Pawlowa: http://de.wikipedia.org/wiki/Anna_Pawlowna_Pawlowa
Neben den Korrespondenzen haben es dem Stadtarchivar seltene Bilder der Primadonna Anna Pawlowa angetan.
Quelle:
http://www.dresden-fernsehen.de/default.aspx?ID=1988&showNews=250282 [mit Videobeitrag]
zur Pawlowa: http://de.wikipedia.org/wiki/Anna_Pawlowna_Pawlowa
Wolf Thomas - am Montag, 14. Juli 2008, 18:37 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Zirkus-Dokumente übergab heute André Sarrasani dem Stadtarchiv. Darunter: alte Programmhefte, Plakate, Zeitschriften und das vollständig erhaltene Archiv der Geschäftsführung. ....So übertragen die Sarrasanis ihre Dokumente der über 100-jährigen Geschichte des Artistenlebens."
Quelle:
http://www.dresden-fernsehen.de/default.aspx?ID=1988&showNews=250282 [mit Videobeitrag]
Nachtrag 28.08.2008:
als "News" in: http://www.damals.de/sixcms/detail.php?id=185848
Quelle:
http://www.dresden-fernsehen.de/default.aspx?ID=1988&showNews=250282 [mit Videobeitrag]
Nachtrag 28.08.2008:
als "News" in: http://www.damals.de/sixcms/detail.php?id=185848
Wolf Thomas - am Montag, 14. Juli 2008, 18:33 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Am Institut für Medienwissenschaften der Universität Paderborn entsteht ein Forschungs- und Arbeitsschwerpunkt zum Avantgarde- und Experimentalfilm von Frauen in Deutschland. Im Rahmen der Professur für Film- und Fernsehwissenschaft, (Prof. Dr. Annette Brauerhoch) ist es gelungen, ein - bisher noch kleines - Filmarchiv aufzubauen, dessen Sammlung einen historischen Schwerpunkt setzt und Filme für die Lehre und Forschung zugänglich machen möchte, die aufgrund der mangelnden Präsenz und schlechter Kopienlage aus dem Bewusstsein verschwinden und für öffentliche Projektionen nicht mehr zugänglich sind. Filmemacherinnen aus ganz Deutschland sowie aus Österreich haben die Sammlung unentgeltlich und mit großem Engagement unterstützt. Nachdem bereits über zwanzig Kopien archiviert werden konnten ist es nun an der Zeit, den Fokus von der Kopienförderung zu deren Aufarbeitung zu verlegen. .....
Das Archiv mit einem Schwerpunkt auf den achtziger Jahren bietet eine gute Grundlage für die Erforschung einer eigenständigen aber womöglich historisch gewordenen (Film-)Ästhetik. Damals in einem lebendigen Kontext der Auseinandersetzung mit herrschenden Formen der Ästhetik und im Umfeld von Frauenfilmfestivals angesiedelt, gilt es nun, diese Filme einer Revision zu unterziehen. Welche Beziehung haben sie zu neueren Produktionen der Gegenwart? Wie hat sich ihre Rezeption verändert, nachdem sich der filmtheoretische Blick heute womöglich eher auf Fragen der Materialität als auf die (ideologische) Form der Repräsentation konzentriert? Wie sehen heutige Filmemacher/innen und Filmwissenschaftler/innen auf das Material ihrer ‚Vorgänger/innen'? Was geschieht bei dem Aufeinandertreffen heutiger Praxen des digitalen Filmens mit dem analogen Medium Film? Inwiefern archivieren diese Filme Geschichte - die spezifische Geschichte weiblicher Praxen. ....."
Quelle:
http://www.wochenspiegel-paderborn.de/?page=show&id=57860
Das Archiv mit einem Schwerpunkt auf den achtziger Jahren bietet eine gute Grundlage für die Erforschung einer eigenständigen aber womöglich historisch gewordenen (Film-)Ästhetik. Damals in einem lebendigen Kontext der Auseinandersetzung mit herrschenden Formen der Ästhetik und im Umfeld von Frauenfilmfestivals angesiedelt, gilt es nun, diese Filme einer Revision zu unterziehen. Welche Beziehung haben sie zu neueren Produktionen der Gegenwart? Wie hat sich ihre Rezeption verändert, nachdem sich der filmtheoretische Blick heute womöglich eher auf Fragen der Materialität als auf die (ideologische) Form der Repräsentation konzentriert? Wie sehen heutige Filmemacher/innen und Filmwissenschaftler/innen auf das Material ihrer ‚Vorgänger/innen'? Was geschieht bei dem Aufeinandertreffen heutiger Praxen des digitalen Filmens mit dem analogen Medium Film? Inwiefern archivieren diese Filme Geschichte - die spezifische Geschichte weiblicher Praxen. ....."
Quelle:
http://www.wochenspiegel-paderborn.de/?page=show&id=57860
Wolf Thomas - am Montag, 14. Juli 2008, 18:31 - Rubrik: Filmarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
U. a. der Standard (Link) meldet: " Im Archiv eines Nonnenkloster in Nordspanien haben Historiker den bisher ältesten Grundrissplan der Kathedrale von Sevilla entdeckt. "


Wolf Thomas - am Montag, 14. Juli 2008, 18:25 - Rubrik: Kirchenarchive
Christian Gampert vom Deutschlandfunk (Link) im Interview mit dem Direktor des Deutschen Literaturarchivs, Ulrich Raulff.
Muss das so martialisch formuliert werden ? Herr Raulff hatte wohl vor dem Gespräch in den "Stahlgewittern" geblättert.
Muss das so martialisch formuliert werden ? Herr Raulff hatte wohl vor dem Gespräch in den "Stahlgewittern" geblättert.
Wolf Thomas - am Montag, 14. Juli 2008, 18:23 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine sorgfältige Bibliographie der online verfügbaren Texte bietet:
http://www.haller.unibe.ch/hallerol.html

http://www.haller.unibe.ch/hallerol.html

KlausGraf - am Montag, 14. Juli 2008, 17:44 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Bibliothèque Municipale de Lyon, eine der grössten Bibliotheken Frankreichs, und Google machen über 500 000 Bücher online verfügbar, wie die beiden Beteiligten am Freitag mitteilten. Die Bibliothèque Municipale de Lyon beherbergt einige der grössten privaten Sammlungen von Werken französischer Intellektueller, Autoren, Wissenschaftler und Denker unserer Zeit – von den medizinischen Handbüchern Des Guidi bis hin zur Privatsammlung der Familie Amaldi. Google und die Bibliothèque Municipale de Lyon werden Tausende von Werken digitalisieren, die nicht mehr urheberrechtlich geschützt sind."
http://www.kleinreport.ch/meld.phtml?id=47399
http://derstandard.at/?url=/?id=3413041
Siehe auch:
http://books.google.com/googlebooks/partners.html
http://blogs.lexpress.fr/virtuel/2008/07/fac-de-lyon-google-rafle-la-mi.html

http://www.kleinreport.ch/meld.phtml?id=47399
http://derstandard.at/?url=/?id=3413041
Siehe auch:
http://books.google.com/googlebooks/partners.html
http://blogs.lexpress.fr/virtuel/2008/07/fac-de-lyon-google-rafle-la-mi.html

KlausGraf - am Montag, 14. Juli 2008, 17:07 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Während die Landes-Akademien als Körperschaften des öffentlichen Rechts (ggf. mit entsprechenden Transparenz-Pflichten) organisiert sind, ist die Haller "Leopoldina", die heute in einem Festakt zur Nationalen Akademie erhoben wurde, ein privater Verein.
Das Archiv der Leopoldina ist laut Benutzungsordnung nur für wissenschaftliche Zwecke zugänglich (also z.B. nicht für Journalisten oder für Familienforschungen).
http://www.leopoldina-halle.de/cms/de/akademie/archiv.html
In MIDOSA liegt eine Beständeübersicht vor.

Das Archiv der Leopoldina ist laut Benutzungsordnung nur für wissenschaftliche Zwecke zugänglich (also z.B. nicht für Journalisten oder für Familienforschungen).
http://www.leopoldina-halle.de/cms/de/akademie/archiv.html
In MIDOSA liegt eine Beständeübersicht vor.

KlausGraf - am Montag, 14. Juli 2008, 16:21 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Frau Gropp von der FAZ huldigt, wir gratulieren nicht. Mulzer erinnert im Kommentar zum Börsenblatt-Artikel an die Zerstörung der Hofbibliothek Donaueschingen.
Noch ein Zitat aus meinem Interview mit Christoph Graf Wolfegg:
Wie sehen Sie die Rolle des Kunsthandels beim "Ausverkauf" traditioneller adeliger Sammlungen?
Dass Antiquitätenhändler diese Sammlungen umschwirren wie Motten das Licht, ist klar. Es sind Händler und dieses Verhalten ist ihnen nicht vorzuwerfen. Als Eigentümer muss niemand darauf eingehen und es gibt einige Fürstenhäuser, bei denen diese Verkäufer Persona non grata sind. Wobei die Vorgehensweise oft sehr subtil ist, persönliche Beziehungen und geschäftliche werden vermischt und Verkäufe als wirtschaftlicher Erfolg verkauft. Unentgeltlich und freundschaftlich werden Sammlungen katalogisiert und ganz nebenbei pekuniär bewertet. Bei passender Gelegenheit wird auf aktuelle Verkaufspreise hingewiesen, der Eigentümer geködert. Der Einsatz von zumeist schlecht bezahlten, meist adligen jungen Damen bis zu gar fürstlichen Vertretern dient natürlich nebenbei dem Status der Firmen gegenüber den nichtadligen Käufern. Aber wie gesagt ist dies nicht verwerflich, sondern das berechtigte Interesse jeder Firma, sich ein Profil zu geben, das auf dem Markt Erfolg verspricht.

Noch ein Zitat aus meinem Interview mit Christoph Graf Wolfegg:
Wie sehen Sie die Rolle des Kunsthandels beim "Ausverkauf" traditioneller adeliger Sammlungen?
Dass Antiquitätenhändler diese Sammlungen umschwirren wie Motten das Licht, ist klar. Es sind Händler und dieses Verhalten ist ihnen nicht vorzuwerfen. Als Eigentümer muss niemand darauf eingehen und es gibt einige Fürstenhäuser, bei denen diese Verkäufer Persona non grata sind. Wobei die Vorgehensweise oft sehr subtil ist, persönliche Beziehungen und geschäftliche werden vermischt und Verkäufe als wirtschaftlicher Erfolg verkauft. Unentgeltlich und freundschaftlich werden Sammlungen katalogisiert und ganz nebenbei pekuniär bewertet. Bei passender Gelegenheit wird auf aktuelle Verkaufspreise hingewiesen, der Eigentümer geködert. Der Einsatz von zumeist schlecht bezahlten, meist adligen jungen Damen bis zu gar fürstlichen Vertretern dient natürlich nebenbei dem Status der Firmen gegenüber den nichtadligen Käufern. Aber wie gesagt ist dies nicht verwerflich, sondern das berechtigte Interesse jeder Firma, sich ein Profil zu geben, das auf dem Markt Erfolg verspricht.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blog.metaroll.de/2008/07/11/wirbt-wikipedia-fuer-apples-iphone/
Viralmythen fand die Apple-Werbung auf der Wikipedia-Hauptseite vor einigen Tagen merkwürdig.

Viralmythen fand die Apple-Werbung auf der Wikipedia-Hauptseite vor einigen Tagen merkwürdig.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 13. Juli 2008, 22:59 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Es ist ja schließlich unser Lebenswerk und jetzt auch unser schönes Archiv“
....
40 Jahre lang hatten die Filmleute Barbara und Winfried Junge die wenige Tage nach dem Mauerbau eher zufällig ausgesuchte Klasse mit Kamera und Mikrofon begleitet. „Anfangs sollte es tatsächlich nur ein Film über die Einschulung auf dem Lande werden“, erinnert sich Junge, der 1961 als einer der ersten Absolventen der Filmhochschule Babelsberg unbedingt einen Dokumentarstreifen produzieren wollte. „Dann gab mir mein Mentor Karl Gass den Tipp, doch die Geschichte der Kinder zu verfolgen.“ So liegt heute ein sehr emotional geprägtes Porträt des Lebens in der DDR, des Untergangs der kleinen Republik und des ganz unterschiedlich erlebten Neubeginns in der Bundesrepublik vor. Mit listigen Argumenten, einer meisterhaften Überzeugungskunst und dem Geschick, immer wieder Geld für das Projekt zu finden, gelang dem Ehepaar Junge ein beachtliches Werk, das Golzow und seine Kinder auch international bekannt machte.
Bürgermeister Klaus-Dieter Lehmann (FDP) führt voller Stolz durch die neuen Museumsräume. „Der im Jahr 2000 eröffnete kleine Raum in einem Nebengebäude konnte die vielen Exponate gar nicht mehr fassen“, erzählt er. „Nun zeigen wir nicht nur einen originalen Schneidetisch, rund 350 Filmrollen und die fast schon legendäre Sammlung von Karteien, auf denen die Filmemacher alle Details des Projektes vermerkten.“ Er träumt sogar von einem „filmischen Geschichtsbuch über Golzow“, das die Umstände der Dreharbeiten einmal festhalten und so die Reihe vielleicht sogar fortsetzen soll.
Quelle
http://www.tagesspiegel.de/berlin/Brandenburg;art128,2571027
s. zum Projekt:
www.kinder-von-golzow.de
....
40 Jahre lang hatten die Filmleute Barbara und Winfried Junge die wenige Tage nach dem Mauerbau eher zufällig ausgesuchte Klasse mit Kamera und Mikrofon begleitet. „Anfangs sollte es tatsächlich nur ein Film über die Einschulung auf dem Lande werden“, erinnert sich Junge, der 1961 als einer der ersten Absolventen der Filmhochschule Babelsberg unbedingt einen Dokumentarstreifen produzieren wollte. „Dann gab mir mein Mentor Karl Gass den Tipp, doch die Geschichte der Kinder zu verfolgen.“ So liegt heute ein sehr emotional geprägtes Porträt des Lebens in der DDR, des Untergangs der kleinen Republik und des ganz unterschiedlich erlebten Neubeginns in der Bundesrepublik vor. Mit listigen Argumenten, einer meisterhaften Überzeugungskunst und dem Geschick, immer wieder Geld für das Projekt zu finden, gelang dem Ehepaar Junge ein beachtliches Werk, das Golzow und seine Kinder auch international bekannt machte.
Bürgermeister Klaus-Dieter Lehmann (FDP) führt voller Stolz durch die neuen Museumsräume. „Der im Jahr 2000 eröffnete kleine Raum in einem Nebengebäude konnte die vielen Exponate gar nicht mehr fassen“, erzählt er. „Nun zeigen wir nicht nur einen originalen Schneidetisch, rund 350 Filmrollen und die fast schon legendäre Sammlung von Karteien, auf denen die Filmemacher alle Details des Projektes vermerkten.“ Er träumt sogar von einem „filmischen Geschichtsbuch über Golzow“, das die Umstände der Dreharbeiten einmal festhalten und so die Reihe vielleicht sogar fortsetzen soll.
Quelle
http://www.tagesspiegel.de/berlin/Brandenburg;art128,2571027
s. zum Projekt:
www.kinder-von-golzow.de
Wolf Thomas - am Sonntag, 13. Juli 2008, 13:03 - Rubrik: Filmarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Bericht aus der Welt am Sonntag (Link) über das Zeichentrick-Studio Pixar beschreibt ein im Werden befindliches Archiv:
" .... Über fünf Jahre hat man bei Pixar an dem Film [Wall-E]gearbeitet, und die Spuren der Arbeit sind in dem gesamten Gebäude ausgestellt. Fotostudien, Skizzen, Kohlezeichnungen, Aquarelle, digitale Gemälde, Bewegungs- und Designstudien, Kulissen und Storyboards hängen an den Wänden. Figuren von Wall-E, Eve, all den anderen Robotern und auch den Menschen, die in der zweiten Hälfte des Films eine Rolle spielen, werden stolz in Schaukästen präsentiert. "So wird das bei allen Pixar-Filmen gemacht", sagt Julia. "Und wenn ein neuer Film produziert wird, dekorieren wir um, und das alte Material kommt ins Archiv. ....."
" .... Über fünf Jahre hat man bei Pixar an dem Film [Wall-E]gearbeitet, und die Spuren der Arbeit sind in dem gesamten Gebäude ausgestellt. Fotostudien, Skizzen, Kohlezeichnungen, Aquarelle, digitale Gemälde, Bewegungs- und Designstudien, Kulissen und Storyboards hängen an den Wänden. Figuren von Wall-E, Eve, all den anderen Robotern und auch den Menschen, die in der zweiten Hälfte des Films eine Rolle spielen, werden stolz in Schaukästen präsentiert. "So wird das bei allen Pixar-Filmen gemacht", sagt Julia. "Und wenn ein neuer Film produziert wird, dekorieren wir um, und das alte Material kommt ins Archiv. ....."
Wolf Thomas - am Sonntag, 13. Juli 2008, 13:00 - Rubrik: Filmarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen