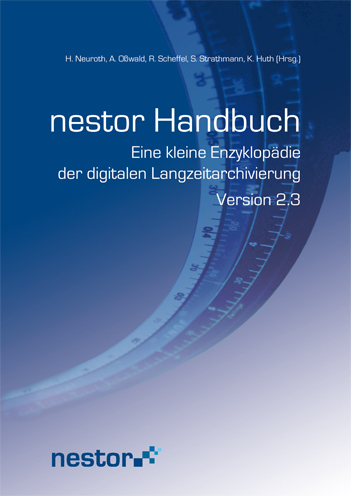noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Es bedeutet schon etwas Besonderes, wenn ein Arzt, ein Rechtsanwalt, ein Archivar und eine Kriminalkommissarin sich mit dem einzigen Musikprofi, Christian Deichstädter, zu einem beachtenswerten Bläserquintett zusammen finden. Vier Bläser und Klavier erfüllten am Samstag die Französische Kirche mit erlesenen Klängen.
. Das finale konzertante Quintett von Wolfgang Amadeus Mozart wurde von ihm selbst aus der Sinfonia concertante KV 297 b Es-Dur eigens kammermusikalisch bearbeitet. Das in Paris 1778 entstandene Konzert wurde dort in Ermangelung versierter Bläser nicht aufgeführt und erklang zu Mozarts Lebzeiten wohl nie öffentlich. Was der Oboist, Sven Hermerschmidt, der Klarinettist, Lorenz Beck, am Fagott Christian Pille und die ganz bestechend sauber blasende Polizistin, Anne Webers, am Horn leisteten, war professionell und erstaunte umso mehr, wenn es „musikalische Liebhaber“ ausführen. Die Themenvielfalt im Allegro, die Innigkeit und das Weihevolle im Adagio und dann das Gassenhauerthema im dritten Satz in zehn Variationen gekleidet, gaben den vier Bläsern einen gelungenen Vorwand zu virtuoser Spielweise.
2003 zum zehnjährigen Jubiläum der Schukeorgel in der katholischen St. Antonius-Kirche Babelsberg nach dem Mozartausspruch „Wo sind allzeit so fünf Leute beieinander?“ gegründet, ist dieses Ensemble aus der „Liebhaberei“ längst heraus und wir sollten mehr von ihm hören."
Dem Wunsch schließe ich mich gerne an. Aber wer ist denn nun unser Kollege - vermutlich die Oboe? Na ja wenigstens nicht die Bratsche!
Quelle: Märkische Allgemeine
. Das finale konzertante Quintett von Wolfgang Amadeus Mozart wurde von ihm selbst aus der Sinfonia concertante KV 297 b Es-Dur eigens kammermusikalisch bearbeitet. Das in Paris 1778 entstandene Konzert wurde dort in Ermangelung versierter Bläser nicht aufgeführt und erklang zu Mozarts Lebzeiten wohl nie öffentlich. Was der Oboist, Sven Hermerschmidt, der Klarinettist, Lorenz Beck, am Fagott Christian Pille und die ganz bestechend sauber blasende Polizistin, Anne Webers, am Horn leisteten, war professionell und erstaunte umso mehr, wenn es „musikalische Liebhaber“ ausführen. Die Themenvielfalt im Allegro, die Innigkeit und das Weihevolle im Adagio und dann das Gassenhauerthema im dritten Satz in zehn Variationen gekleidet, gaben den vier Bläsern einen gelungenen Vorwand zu virtuoser Spielweise.
2003 zum zehnjährigen Jubiläum der Schukeorgel in der katholischen St. Antonius-Kirche Babelsberg nach dem Mozartausspruch „Wo sind allzeit so fünf Leute beieinander?“ gegründet, ist dieses Ensemble aus der „Liebhaberei“ längst heraus und wir sollten mehr von ihm hören."
Dem Wunsch schließe ich mich gerne an. Aber wer ist denn nun unser Kollege - vermutlich die Oboe? Na ja wenigstens nicht die Bratsche!
Quelle: Märkische Allgemeine
Wolf Thomas - am Mittwoch, 3. Juni 2009, 21:37 - Rubrik: Personalia
" .... Im Nationalmuseum in Port Vila, der Hauptstadt von Vanuatu, ist er der zweite Mann. Außerdem ist er in seiner Heimat der Leiter des nationalen Foto-, Film- und Sound-Archives. Dessen Ziel ist es, die Kultur der verschiedenen kulturellen Gruppen in Vanuatu bildlich und im Ton zu dokumentieren. Eine Besonderheit, betont Lipp, auch entstanden aus der Tatsache, dass es keine schriftlichen Überlieferungen gibt. «Eine Wissensbank, die weltweit einmalig ist.» Und dennoch bleibe manches Wissen Tabu....."
Auf - oder in Vanuatu - habe ich mich auch einmal beworben .....
Quelle: Allgäuer Zeitung
Auf - oder in Vanuatu - habe ich mich auch einmal beworben .....
Quelle: Allgäuer Zeitung
Wolf Thomas - am Mittwoch, 3. Juni 2009, 21:32 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Vögel, die von einem Züchter oder beim Fachhandel gekauft wurden, sind in der Regel mit einem Ring gekennzeichnet, aus Artenschutzgründen und/oder wegen des Tierseuchengesetzes. Auf einem solchen Fußring sind verschiedene Informationen eingestanzt, über die der Züchter und damit auch der Besitzer ausfindig gemacht werden können. Ausschlaggebend ist eine siebenstellige Identifikationsnummer. Für Laien ist es oft schwierig, die Daten zu entziffern. Deshalb ist es ratsam, mit dem Fundtier einen vogelkundigen Tierarzt aufzusuchen. Dieser kann nicht nur die Nummer herauslesen, sondern den Vogel auch auf seinen Gesundheitszustand prüfen. Hilfestellung bietet auch der Suchdienst des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF). Dieser führt ein Archiv mit registrierten Fußringen. Wem ein fremder Vogel zugeflogen ist, kann sich per Post oder per E-Mail an die Ringstelle wenden."
http://www.ratgeberbox.de/ratgeber/artikel/artikel_921328/kommt-ein-vogel-geflogen-und-dann
http://www.ratgeberbox.de/ratgeber/artikel/artikel_921328/kommt-ein-vogel-geflogen-und-dann
Wolf Thomas - am Mittwoch, 3. Juni 2009, 21:26 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"For architectural archives, digital files are not just a new kind of datacarrier as was the case with microfilm. Digital materials require much more attention to be handled, described and stored in a consistent, safe and persistent way than paper or film. The awareness that our digital heritage is much more fragile than paper archives slowly starts to pervade the cultural heritage community. While some institutions are already testing e-repository test beds, most organisations are still searching for technical solutions for the new hybrid environment in which paper archives are accompanied by digital files.
Research and experiences
The conference will be a continuation of the Gau:di conference held in Paris from 8 to 10 November 2007 “Architecture and Digital Archives. Architecture in the Digital Age: a question of memory”. The conference is meant for architects, architectural museum staff, staff from cultural heritage institutions, architectural historians and researchers. The main purpose of the meeting is to map the development of research and experiences in creating, consuming and using digital architectural archives. The conference focuses on bringing together experts in the fields of architecture (the creators), architectural archives and museums (the keepers: preservation and access) and researchers (users).
Hybrid environment
The specific problems with permanent storage, access and retrieval of digital architectural archives are gradually revealing themselves. What are the consequences for organizations in a hybrid environment and what choices do we have to face?
With regard to digitising paper archives: should we digitise complete archives or parts of it retrospectively and describe them in the same way as our paper archives? How can we create a useful multi language thesaurus and vocabulary necessary to find the requested information? How should we present digital information and what will be the surplus value for users compared to the original paper drawings. How can users and providers make the most of this new digital content?
With regard to born digital archival material: how do we address the problem of authenticity when the digital original is the same as the copy on the web? What are the specific inherent qualities of digital designs? How do we preserve the functionalities of an architectural design produced by interactive software once the material is in a repository?
Conference themes
The questions above have been translated into the following themes:
Acquiring and processing digital archives in repositories
Producing digital archives in architectural practices
Architectural archives on the web
Users: expectations and use
Multilingual architecture thesauri and vocabularies
Wednesday June 10
14.15 Departure by bus from the NAi to the Open Model Storage
15.00 Tour Open Model Storage
16.15 Departure by bus from the Open Model Storage to the Town Hall
17.00 Welcome Reception at the Town Hall Rotterdam
Thursday June 11
Auditorium National Library, The Hague
8.30 Registration
9.30 Welcome by the Director of the National Library
9.45 Introduction by Patricia Alkhoven, conference chair and Head of Collections, NAI
10.00 Keynote 1 Yola de Lusenet
10.20 Keynote 2 Marcel Ras The KB E-Depot
10.40 Coffee and tea
11.15 Session 1 Producing Digital Archives in Architectural Practices
Paper 1 David Peycere Producing Digital Archives in Architectural Practices
Paper 2 Berthold Scharrer Save the Bubble
Paper 3 Gijs Joosen (Oosterhuis Architecten) Architecture = Information
12.30 Lunch
13.30 Tour National Library and National Archives
14.15 Session 2 Acquiring and Processing Digital Archives in Repositories (chaired by David Peycere)
Paper 1 Sophie De Caigny Building a Fedora Repository For Architectural Content
Paper 2 Henk Vanstappen Connecting the Digital With the Physical LAM (Library-Archive-Museum) Approach
Paper 3 Josje Everse cs. Connection Between E-depot And Project Construction Drawings
15.30 Coffee and tea
16.00 Session 3 Multilingual Architecture Thesauri and Vocabularies (chaired by Riccardo Domenichini)
Paper 1 Andrea Bocco Archiwordnet, a Bilingual Thesaurus
Paper 2 Ezio Arlati, Elena Bogani, Andrea Cammarata The PiacenzaLabs Repository, a MACE Application
Paper 3 Stefan Boeykens Connecting Digital Architectural Archives With MACE
17.15 Discussion
19.00 Dinner in restaurant Garoeda, The Hague
Friday June 12
Auditorium Netherlands Architecture Institute, Rotterdam
9.15 Welcome by Ole Bouman, Director NAi
9.30 Session 4 Users: Expectation And Use
Paper 1 Kristine Fallon Defining And Encoding Architectural Information For Digital Archives
Paper 2 Eduardo Aguirre Leon, Mauricio Ramírez Molina New Interfaces, New Scenarios
Paper 3 Bernd Kulawik Distributed Web-portal For World-wide Contribution Among Architectural Archives And Historians
10.45 Coffee and tea
11.15 Session 5 Three Dimensional Issues (chaired by Patricia Alkhoven)
Paper 1 Dennis Derycke, David Lo Buglio Digital Archiving For Inside Elevations By Orthophotography
Paper 2 and 3 Jean-Yves Blaise, Iwona Dudek, Livio de Luca 3D As Content And As Metaphor: Spatial Cognition.
12.30 Lunch
13.30 Tour NAi Collection Department
14.30 Session 6 Architecture On The Web (chaired by Henk Vanstappen)
Paper 1 Helga Kusolisch Nextroom, European Hub for Contemporary Architecture
Paper 2 Emmanuelle Cadet, René Pelfresne Mediation of Heterogeneous Digital Information on Modern Architecture in the Mediterranean (Musomed)
Paper 3 Paola Ricco Image ARCHIVE, an Operating Space for Architecture Videos
15.45 Coffee and tea
16.15 Wrap up, discussion and conclusion
17.15 Reception in Foyer NAi "
Link to conference: http://conference.nai.nl/
Research and experiences
The conference will be a continuation of the Gau:di conference held in Paris from 8 to 10 November 2007 “Architecture and Digital Archives. Architecture in the Digital Age: a question of memory”. The conference is meant for architects, architectural museum staff, staff from cultural heritage institutions, architectural historians and researchers. The main purpose of the meeting is to map the development of research and experiences in creating, consuming and using digital architectural archives. The conference focuses on bringing together experts in the fields of architecture (the creators), architectural archives and museums (the keepers: preservation and access) and researchers (users).
Hybrid environment
The specific problems with permanent storage, access and retrieval of digital architectural archives are gradually revealing themselves. What are the consequences for organizations in a hybrid environment and what choices do we have to face?
With regard to digitising paper archives: should we digitise complete archives or parts of it retrospectively and describe them in the same way as our paper archives? How can we create a useful multi language thesaurus and vocabulary necessary to find the requested information? How should we present digital information and what will be the surplus value for users compared to the original paper drawings. How can users and providers make the most of this new digital content?
With regard to born digital archival material: how do we address the problem of authenticity when the digital original is the same as the copy on the web? What are the specific inherent qualities of digital designs? How do we preserve the functionalities of an architectural design produced by interactive software once the material is in a repository?
Conference themes
The questions above have been translated into the following themes:
Acquiring and processing digital archives in repositories
Producing digital archives in architectural practices
Architectural archives on the web
Users: expectations and use
Multilingual architecture thesauri and vocabularies
Wednesday June 10
14.15 Departure by bus from the NAi to the Open Model Storage
15.00 Tour Open Model Storage
16.15 Departure by bus from the Open Model Storage to the Town Hall
17.00 Welcome Reception at the Town Hall Rotterdam
Thursday June 11
Auditorium National Library, The Hague
8.30 Registration
9.30 Welcome by the Director of the National Library
9.45 Introduction by Patricia Alkhoven, conference chair and Head of Collections, NAI
10.00 Keynote 1 Yola de Lusenet
10.20 Keynote 2 Marcel Ras The KB E-Depot
10.40 Coffee and tea
11.15 Session 1 Producing Digital Archives in Architectural Practices
Paper 1 David Peycere Producing Digital Archives in Architectural Practices
Paper 2 Berthold Scharrer Save the Bubble
Paper 3 Gijs Joosen (Oosterhuis Architecten) Architecture = Information
12.30 Lunch
13.30 Tour National Library and National Archives
14.15 Session 2 Acquiring and Processing Digital Archives in Repositories (chaired by David Peycere)
Paper 1 Sophie De Caigny Building a Fedora Repository For Architectural Content
Paper 2 Henk Vanstappen Connecting the Digital With the Physical LAM (Library-Archive-Museum) Approach
Paper 3 Josje Everse cs. Connection Between E-depot And Project Construction Drawings
15.30 Coffee and tea
16.00 Session 3 Multilingual Architecture Thesauri and Vocabularies (chaired by Riccardo Domenichini)
Paper 1 Andrea Bocco Archiwordnet, a Bilingual Thesaurus
Paper 2 Ezio Arlati, Elena Bogani, Andrea Cammarata The PiacenzaLabs Repository, a MACE Application
Paper 3 Stefan Boeykens Connecting Digital Architectural Archives With MACE
17.15 Discussion
19.00 Dinner in restaurant Garoeda, The Hague
Friday June 12
Auditorium Netherlands Architecture Institute, Rotterdam
9.15 Welcome by Ole Bouman, Director NAi
9.30 Session 4 Users: Expectation And Use
Paper 1 Kristine Fallon Defining And Encoding Architectural Information For Digital Archives
Paper 2 Eduardo Aguirre Leon, Mauricio Ramírez Molina New Interfaces, New Scenarios
Paper 3 Bernd Kulawik Distributed Web-portal For World-wide Contribution Among Architectural Archives And Historians
10.45 Coffee and tea
11.15 Session 5 Three Dimensional Issues (chaired by Patricia Alkhoven)
Paper 1 Dennis Derycke, David Lo Buglio Digital Archiving For Inside Elevations By Orthophotography
Paper 2 and 3 Jean-Yves Blaise, Iwona Dudek, Livio de Luca 3D As Content And As Metaphor: Spatial Cognition.
12.30 Lunch
13.30 Tour NAi Collection Department
14.30 Session 6 Architecture On The Web (chaired by Henk Vanstappen)
Paper 1 Helga Kusolisch Nextroom, European Hub for Contemporary Architecture
Paper 2 Emmanuelle Cadet, René Pelfresne Mediation of Heterogeneous Digital Information on Modern Architecture in the Mediterranean (Musomed)
Paper 3 Paola Ricco Image ARCHIVE, an Operating Space for Architecture Videos
15.45 Coffee and tea
16.15 Wrap up, discussion and conclusion
17.15 Reception in Foyer NAi "
Link to conference: http://conference.nai.nl/
Wolf Thomas - am Mittwoch, 3. Juni 2009, 18:36 - Rubrik: Architekturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Während über die Vorkriegsstädte unsere Archive nur lückenhaft Auskunft geben, erweist sich das Material zur Architektur nach 1945 als äußert umfangreich. Universitäten, Museen und Architekturzentren sind herausgefordert, die jüngere Architekturgeschichte zu erforschen. Herbei spielen Architektennachlässe eine zentrale Rolle. Um der Dokumentationsflut zu begegnen, werden neue Strukturen der Zusammenarbeit und Vermittlung notwendig sein – mit der Hilfe von Bund, Ländern und Städten. .....
Die Stadt stellt ein Schichtwerk dar, das mannigfaltige Kenntnisse voraussetzt, will man es als Zusammenhang deuten. Doch zumeist ging mit der Zerstörung im Krieg auch sämtliches Archivgut verloren. Ganze Stadt- und Architekturüberlieferungen sind nicht mehr existent. Die Nachwirkungen reichen bis in die Gegenwart. Die Biografien einzelner Bauten lassen sich daher nur mühsam rekonstruieren. Und von vielen Häusern der Vorkriegszeit ist bis heute kein Autor bekannt. Ebenso ergeht es unzähligen Architekten jener Zeit, denn auch das Wissen um ihr Leben und Werk ist häufig nicht mehr rekonstruierbar. Gerade die Architekten der Gründerzeit sind heute vielfach ohne Stimme, das Wissen um das Neue Bauen ist in den verschiedenen Städten vergleichsweise rar. Selbst zu maßgeblichen Protagonisten einer Stadt fehlt es uns an Material: etwa zu einem Alfred Hensen in Münster, einem Fritz Catta in Kassel oder einem Oskar Pfennig in Stuttgart. .....
Ganz anders stellt sich die Situation der Architekturgeschichte nach 1945 dar. Erstmals hat unsere Gesellschaft die Chance, wieder in eine Zeit hineinzuwachsen, die auf mehrere vollständig überlieferte Jahrzehnte zurückblicken kann. Denn das Material über die Zeit seit dem Wiederaufbau steht uns (noch) nahezu lückenlos zur Verfügung. Gepaart mit dem Fortschritt der Medien sind Bauten und Architektenbiografien wie nie zuvor in vielfältigen Formaten überliefert, in Plänen und Zeichnungen, in Modellen, Fotografien und Akten. Um dieses Material zu sammeln, aufzuarbeiten, zu dokumentieren, zu erforschen und zu veröffentlichen, wird es wichtig sein, neue Strukturen zu schaffen – eine Aufgabe, die nur mit der Hilfe von Bund, Ländern und Gemeinden zu bewältigen sein wird.
Im Vorteil sind hier die Hochschulen als traditionelle Orte der Forschung und Sammlung. Gerade die Technischen Hochschulen in München, Berlin und Karlsruhe (SAAI) haben in den letzten Jahren deutlich an Profil gewonnen, ihre Architekturmuseen zählen zu den ältesten und bedeutendsten der Republik. Als ebenso unerlässlich erweisen sich auch die spezielleren Kunstarchive, wie beispielsweise das 1954 von Hans Scharoun gegründete Baukunstarchiv der Akademie der Künste, das 1960 beschlossene Bauhaus-Archiv (beide Berlin) und das Deutsche Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg (1964). Einen wichtigen Schub erfuhr die Architekturarchivwelt sodann in den 1970er Jahren mit der Gründung der Berlinischen Galerie (1975) und des Deutschen Architektur Museums in Frankfurt (1979), gerade auch in den Fragen der Vermittlung. Nicht weniger verdienstvoll sind die Einrichtungen auf Länderebene, häufig initiiert durch die jeweiligen Architektenkammer, die in den 1980er und 1990er Jahren folgten. So entstanden das Hamburgische Architekturarchiv (1984), das Schleswig-Holsteinisches Archiv für Architektur und Ingenieurbaukunst (1992), das Architekturmuseum Schwaben (1995) und das an der TU Dortmund ansässige Archiv für Architektur und Ingenieurbaukunst NRW (A:AI), zuletzt die Initiative Architekturforum Rheinland und 2004 das Bremer Zentrum für Baukultur (b.zb). Einen besonderen Status nimmt hierbei das überregionale Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung in Erkner (IRS) ein, das 1992 im Wesentlichen aus dem “Institut für Städtebau und Architektur” der Bauakademie der DDR hervorgegangen ist und über eine umfangreiche Sammlung zur Planungs- und Baugeschichte der DDR verfügt. Für einzelne Städte aber im Zweifel wichtiger sind die lokalen Institutionen wie Stadtmuseen und Stadtarchive, Planungsämter, Bibliotheken, Privatarchive von Bürgern, Unternehmern, Instituten, Gesellschaften und Vereinen. Die Archivwelt in Deutschland zeigt sich in den unterschiedlichen Ebenen und Regionen somit unterschiedlich gut gewappnet und ausgestattet, doch wird es gerade darauf ankommen, auf jeder Stufe mit offenen Augen die Architektennachlässe zu sichern, solange sie noch zu greifen sind.Zeche Zollverein: Weltkulturerbe, 2010 Zentrum der Kulturstadt Essen und der gesamten Region Ruhr. Künftiger Ort des NRW-Baukunst-Archivs?
Klug ist daher die Idee der Stiftung Deutscher Architekten, die in NRW bislang mit der Archivarbeit befassten Einrichtungen, wie die Architektenkammer NRW, die Ingenieurkammer-Bau, die TU Dortmund, das Architekturforum Rheinland, M:AI und die Landschaftsverbände, in dieser Angelegenheit zusammenzuführen und ein zentrales Baukunst Archiv NRW zu gründen. Auch das Land NRW hat bereits für dieses Projekt Unterstützung zugesagt und angeboten, entsprechende Räumlichkeiten auf der Zeche Zollverein kostenlos zur Verfügung zu stellen. Jedoch nur, wenn die Projektpartner den laufenden Betrieb – geschätzte 500.000 Euro jährlich – finanzieren. Wie schnell man sich hier einig werden wird, ist offen, doch soll noch dieses Jahr eine Betreibergesellschaft gegründet werden. Gerade auch für die lokale Ebene, für die einzelnen Städte und Gemeinden in NRW, wäre diese Einrichtung ein wichtiges Signal. Es würde auch den Dialog vor Ort entfachen und so manches Material aus den Regalen, ob von privaten Dachkammern oder aus städtischen Kellern, ans Licht der Öffentlichkeit befördern. Das Modell wäre daher auch geeignet, an anderen Orten die lokale und die regionale Ebene miteinander zu verknüpfen, die professionelle Sicherung auch für jene Städte zu gewährleisten, die sonst damit möglicherweise überfordert wären. Da vielfach Geld fehlt, kann nur Synergie durch Kooperation das Gebot der Stunde sein, um unwiderbringliche Verluste zu verhindern. Will man nicht kommenden Generationen die Architekturgeschichte der Nachkriegszeit ähnlich lückenhaft wie die der Vorkriegszeit überlassen, darf die Frage nach dem Umgang mit den Architektennachlässen nicht weiter aufgeschoben werden, denn Architektennachlässe zählen zum Gedächtnis einer jeden Stadt."
Stefan Rethfeld ist Architekt, Journalist, Co-Autor des Architekturführers Münster und arbeitet derzeit als Stipendiat der Stiftung Deutscher Architekten an einer Dissertation zum Werk des Architekten Harald Deilmann (1920-2008).
Vollständiger Text:
http://german.magazin-world-architects.com/de_09_23_onlinemagazin_archiv_de.html
Die Stadt stellt ein Schichtwerk dar, das mannigfaltige Kenntnisse voraussetzt, will man es als Zusammenhang deuten. Doch zumeist ging mit der Zerstörung im Krieg auch sämtliches Archivgut verloren. Ganze Stadt- und Architekturüberlieferungen sind nicht mehr existent. Die Nachwirkungen reichen bis in die Gegenwart. Die Biografien einzelner Bauten lassen sich daher nur mühsam rekonstruieren. Und von vielen Häusern der Vorkriegszeit ist bis heute kein Autor bekannt. Ebenso ergeht es unzähligen Architekten jener Zeit, denn auch das Wissen um ihr Leben und Werk ist häufig nicht mehr rekonstruierbar. Gerade die Architekten der Gründerzeit sind heute vielfach ohne Stimme, das Wissen um das Neue Bauen ist in den verschiedenen Städten vergleichsweise rar. Selbst zu maßgeblichen Protagonisten einer Stadt fehlt es uns an Material: etwa zu einem Alfred Hensen in Münster, einem Fritz Catta in Kassel oder einem Oskar Pfennig in Stuttgart. .....
Ganz anders stellt sich die Situation der Architekturgeschichte nach 1945 dar. Erstmals hat unsere Gesellschaft die Chance, wieder in eine Zeit hineinzuwachsen, die auf mehrere vollständig überlieferte Jahrzehnte zurückblicken kann. Denn das Material über die Zeit seit dem Wiederaufbau steht uns (noch) nahezu lückenlos zur Verfügung. Gepaart mit dem Fortschritt der Medien sind Bauten und Architektenbiografien wie nie zuvor in vielfältigen Formaten überliefert, in Plänen und Zeichnungen, in Modellen, Fotografien und Akten. Um dieses Material zu sammeln, aufzuarbeiten, zu dokumentieren, zu erforschen und zu veröffentlichen, wird es wichtig sein, neue Strukturen zu schaffen – eine Aufgabe, die nur mit der Hilfe von Bund, Ländern und Gemeinden zu bewältigen sein wird.
Im Vorteil sind hier die Hochschulen als traditionelle Orte der Forschung und Sammlung. Gerade die Technischen Hochschulen in München, Berlin und Karlsruhe (SAAI) haben in den letzten Jahren deutlich an Profil gewonnen, ihre Architekturmuseen zählen zu den ältesten und bedeutendsten der Republik. Als ebenso unerlässlich erweisen sich auch die spezielleren Kunstarchive, wie beispielsweise das 1954 von Hans Scharoun gegründete Baukunstarchiv der Akademie der Künste, das 1960 beschlossene Bauhaus-Archiv (beide Berlin) und das Deutsche Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg (1964). Einen wichtigen Schub erfuhr die Architekturarchivwelt sodann in den 1970er Jahren mit der Gründung der Berlinischen Galerie (1975) und des Deutschen Architektur Museums in Frankfurt (1979), gerade auch in den Fragen der Vermittlung. Nicht weniger verdienstvoll sind die Einrichtungen auf Länderebene, häufig initiiert durch die jeweiligen Architektenkammer, die in den 1980er und 1990er Jahren folgten. So entstanden das Hamburgische Architekturarchiv (1984), das Schleswig-Holsteinisches Archiv für Architektur und Ingenieurbaukunst (1992), das Architekturmuseum Schwaben (1995) und das an der TU Dortmund ansässige Archiv für Architektur und Ingenieurbaukunst NRW (A:AI), zuletzt die Initiative Architekturforum Rheinland und 2004 das Bremer Zentrum für Baukultur (b.zb). Einen besonderen Status nimmt hierbei das überregionale Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung in Erkner (IRS) ein, das 1992 im Wesentlichen aus dem “Institut für Städtebau und Architektur” der Bauakademie der DDR hervorgegangen ist und über eine umfangreiche Sammlung zur Planungs- und Baugeschichte der DDR verfügt. Für einzelne Städte aber im Zweifel wichtiger sind die lokalen Institutionen wie Stadtmuseen und Stadtarchive, Planungsämter, Bibliotheken, Privatarchive von Bürgern, Unternehmern, Instituten, Gesellschaften und Vereinen. Die Archivwelt in Deutschland zeigt sich in den unterschiedlichen Ebenen und Regionen somit unterschiedlich gut gewappnet und ausgestattet, doch wird es gerade darauf ankommen, auf jeder Stufe mit offenen Augen die Architektennachlässe zu sichern, solange sie noch zu greifen sind.Zeche Zollverein: Weltkulturerbe, 2010 Zentrum der Kulturstadt Essen und der gesamten Region Ruhr. Künftiger Ort des NRW-Baukunst-Archivs?
Klug ist daher die Idee der Stiftung Deutscher Architekten, die in NRW bislang mit der Archivarbeit befassten Einrichtungen, wie die Architektenkammer NRW, die Ingenieurkammer-Bau, die TU Dortmund, das Architekturforum Rheinland, M:AI und die Landschaftsverbände, in dieser Angelegenheit zusammenzuführen und ein zentrales Baukunst Archiv NRW zu gründen. Auch das Land NRW hat bereits für dieses Projekt Unterstützung zugesagt und angeboten, entsprechende Räumlichkeiten auf der Zeche Zollverein kostenlos zur Verfügung zu stellen. Jedoch nur, wenn die Projektpartner den laufenden Betrieb – geschätzte 500.000 Euro jährlich – finanzieren. Wie schnell man sich hier einig werden wird, ist offen, doch soll noch dieses Jahr eine Betreibergesellschaft gegründet werden. Gerade auch für die lokale Ebene, für die einzelnen Städte und Gemeinden in NRW, wäre diese Einrichtung ein wichtiges Signal. Es würde auch den Dialog vor Ort entfachen und so manches Material aus den Regalen, ob von privaten Dachkammern oder aus städtischen Kellern, ans Licht der Öffentlichkeit befördern. Das Modell wäre daher auch geeignet, an anderen Orten die lokale und die regionale Ebene miteinander zu verknüpfen, die professionelle Sicherung auch für jene Städte zu gewährleisten, die sonst damit möglicherweise überfordert wären. Da vielfach Geld fehlt, kann nur Synergie durch Kooperation das Gebot der Stunde sein, um unwiderbringliche Verluste zu verhindern. Will man nicht kommenden Generationen die Architekturgeschichte der Nachkriegszeit ähnlich lückenhaft wie die der Vorkriegszeit überlassen, darf die Frage nach dem Umgang mit den Architektennachlässen nicht weiter aufgeschoben werden, denn Architektennachlässe zählen zum Gedächtnis einer jeden Stadt."
Stefan Rethfeld ist Architekt, Journalist, Co-Autor des Architekturführers Münster und arbeitet derzeit als Stipendiat der Stiftung Deutscher Architekten an einer Dissertation zum Werk des Architekten Harald Deilmann (1920-2008).
Vollständiger Text:
http://german.magazin-world-architects.com/de_09_23_onlinemagazin_archiv_de.html
Wolf Thomas - am Mittwoch, 3. Juni 2009, 18:35 - Rubrik: Architekturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Außer mir - http://twitter.com/Archivalia_kg -, dem angehenden Diplom-Archivar Sebastian Post http://twitter.com/Sebastian_Post twittert nun auch Premium-Contributor dieses Weblogs, der Siegener Kreisarchivar Thomas Wolf:
http://twitter.com/EiserfeldWolf
International:
http://archiv.twoday.net/stories/5651506/
Update:
http://twitter.com/stilangel

http://twitter.com/EiserfeldWolf
International:
http://archiv.twoday.net/stories/5651506/
Update:
http://twitter.com/stilangel

KlausGraf - am Mittwoch, 3. Juni 2009, 14:39 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Karlsruher Universitätsverlag präsentiert seine erste Online-Zeitschrift: Das Journal of New Frontiers in Spatial Concepts
http://blog.ubka.uni-karlsruhe.de/aktuelles/?p=527
Danke Beate!

http://blog.ubka.uni-karlsruhe.de/aktuelles/?p=527
Danke Beate!

KlausGraf - am Mittwoch, 3. Juni 2009, 13:29 - Rubrik: Open Access
http://www.literaturcafe.de/urheberrecht-warum-die-naivitaet-der-romanautoren-fuer-uns-alle-gefaehrlich-werden-kann/
Der Beitrag setzt sich mit teilweise unsäglich ahnungslosen Stellungnahmen von Belletristik-Autoren zum Internet auseinander und spricht am Rande auch Open Access an.
Der Beitrag setzt sich mit teilweise unsäglich ahnungslosen Stellungnahmen von Belletristik-Autoren zum Internet auseinander und spricht am Rande auch Open Access an.
KlausGraf - am Mittwoch, 3. Juni 2009, 12:58 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://wikibu.ch/
Ist mindestens hinsichtlich der Bilder ein Lizenzverstoß.
Update: http://weblog.histnet.ch/archives/2430 ist eine ausführliche Bewertung.
Die Kriterien können Zuverlässigkeit nicht messen. Meine eigenen Artikel sind in der Regel außerordentlich zuverlässig, werden aber oft nicht von vielen anderen bearbeitet, haben nicht viele Links, die auf sie zeigen, und nicht selten auch keine Nachweise, da diese sich aus Literatur/Weblinks ergeben.

Ist mindestens hinsichtlich der Bilder ein Lizenzverstoß.
Update: http://weblog.histnet.ch/archives/2430 ist eine ausführliche Bewertung.
Die Kriterien können Zuverlässigkeit nicht messen. Meine eigenen Artikel sind in der Regel außerordentlich zuverlässig, werden aber oft nicht von vielen anderen bearbeitet, haben nicht viele Links, die auf sie zeigen, und nicht selten auch keine Nachweise, da diese sich aus Literatur/Weblinks ergeben.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://books.google.com/books?id=BYgpAAAAYAAJ
Georgij Sabini Brandenburg. Schöne vnd lustige Beschrybung etlicher Rathschlegen vnnd Gesprächen in Erwelung eines Keysers, wie Sölichs Caroli dess V.: Säliger hochlöblicher Gedechtnuss Halbē verhandlet: Sampt dem Eidt mit welchem sich der Keyser dem Reych verpflicht: Item Nicolai Mamerani ...
Von Georg Sabinus, Nicolaus Mameranus, Hartmannus Maurus, Peter Schmid, Christian Carl Ludwig von Savigny
Mitwirkende Personen Peter Schmid, Christian Carl Ludwig von Savigny
Veröffentlicht von Peter Schmid, 1561
Original von Princeton University
Digitalisiert am 11. Juli 2008
318 Seiten
Kann zur Zeit nur mit Proxy eingesehen werden - was soll das?
Danke an Fred Lohre.
Georgij Sabini Brandenburg. Schöne vnd lustige Beschrybung etlicher Rathschlegen vnnd Gesprächen in Erwelung eines Keysers, wie Sölichs Caroli dess V.: Säliger hochlöblicher Gedechtnuss Halbē verhandlet: Sampt dem Eidt mit welchem sich der Keyser dem Reych verpflicht: Item Nicolai Mamerani ...
Von Georg Sabinus, Nicolaus Mameranus, Hartmannus Maurus, Peter Schmid, Christian Carl Ludwig von Savigny
Mitwirkende Personen Peter Schmid, Christian Carl Ludwig von Savigny
Veröffentlicht von Peter Schmid, 1561
Original von Princeton University
Digitalisiert am 11. Juli 2008
318 Seiten
Kann zur Zeit nur mit Proxy eingesehen werden - was soll das?
Danke an Fred Lohre.
KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 22:25 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Um am Donnerstag auf dem Rheinischen Archivtag etwas über Archivalia sagen zu können, habe ich die Beiträge des Monats Mai ausgewertet.
(1) Archivalia ist ein Weblog mit einem hohen Ausstoß an Beiträgen.
Insgesamt wurden 392 Beiträge geschrieben, also rund 12,6 je Tag.
(Der Twoday-Zähler steht gerade auf 10240 Beiträgen - davon 7303 von mir - in 2309 Tagen seit Februar 2003, was durchschnittlich 4,4 Einträge je Tag macht.)
(2) Archivalia ist ein Gemeinschaftsweblog
Von den 392 Beiträgen stammen "nur" 221 von mir, 129 von Thomas Wolf, 42 Postings von 12 weiteren Beiträgern (Schwalm 14, ho 5, Bartz 4, Eligius 4, Hüttner 4, ebertplatz 4, werkvermittlung 2, berich5t 1, Dressel 1, Radl 1, Schloeffel 1, Ullmann 1).
(3) Archivalia lädt mittels seiner Kommentarfunktion zur Diskussion ein
55 Beiträge erhielten 140 Kommentare. Am meisten kommentiert wurde "Kölner Exkulpationen" von D. Bartz am 20. Mai 2009 mit 16 Kommentaren:
http://archiv.twoday.net/stories/5711595/
(4) Archivalia weist ein breites Spektrum von Themen auf
Von den 55 "echten" Kategorien (Impressum ist abzuziehen) wurden zu 45 Beiträge geschrieben.
Nach wie vor dominierte der Kölner Archiveinsturz das Weblog, denn die meisten der 66 Beiträge zu den Kommunalarchiven galten ihm. Hinzu kommen noch einige Beiträge zum Einsturz, die in andere Schubladen einsortiert wurden.
Das von mir geförderte Thema Open Access brachte es - aufgrund des "Heidelberger Appells" - im Mai auf 43 Beiträge. Digitale Bibliotheken: 34. Archivrecht: 30.
Alle 22 Beiträge der Kategorie Wahrnehmung hat Thomas Wolf verfasst.
Archivalia bemüht sich, auch englischsprachigen Lesern ein attraktives Angebot zu machen. In der English Corner wurden 34 Beiträge auf Englisch veröffentlicht. Auch die 9 Beiträge zu Internationalen Aspekten zeigen, dass Archivalia über den Tellerrand blickt.
Gut vertreten sind auch Fragen der digitalen Archivierung (Digitale Unterlagen 11, Records Management 2, Webarchivierung 2) und das Web 2.0 (Web 2.0: 6, Weblogs 8, Wikis 3).
Zu den Beiträgen zum Kulturgutschutz (12) sind auch 2 der 5 Beiträge zur Landesgeschichte zu zählen.
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse habe ich in diesem Weblog im Mai im Artikel über Richalm von Schöntal publiziert:
http://archiv.twoday.net/stories/5680268/
(5) Archivalia ist unterhaltsam
Außer den 10 Beiträgen in der Rubrik Unterhaltung gab es im Mai 2009 etwas Besonderes, nämlich 9 Gedichte zum Archiveinsturz. Dass meine Idee so viel Kreativität auslösen würde, hat mich selbst überrascht. Auch wenn es sich um "Gebrauchspoesie" handelt, so zeigt doch die Tatsache, dass sie hier veröffentlicht wurden, wie sehr das Kölner Ereignis die Kollegen bewegte.
(1) Archivalia ist ein Weblog mit einem hohen Ausstoß an Beiträgen.
Insgesamt wurden 392 Beiträge geschrieben, also rund 12,6 je Tag.
(Der Twoday-Zähler steht gerade auf 10240 Beiträgen - davon 7303 von mir - in 2309 Tagen seit Februar 2003, was durchschnittlich 4,4 Einträge je Tag macht.)
(2) Archivalia ist ein Gemeinschaftsweblog
Von den 392 Beiträgen stammen "nur" 221 von mir, 129 von Thomas Wolf, 42 Postings von 12 weiteren Beiträgern (Schwalm 14, ho 5, Bartz 4, Eligius 4, Hüttner 4, ebertplatz 4, werkvermittlung 2, berich5t 1, Dressel 1, Radl 1, Schloeffel 1, Ullmann 1).
(3) Archivalia lädt mittels seiner Kommentarfunktion zur Diskussion ein
55 Beiträge erhielten 140 Kommentare. Am meisten kommentiert wurde "Kölner Exkulpationen" von D. Bartz am 20. Mai 2009 mit 16 Kommentaren:
http://archiv.twoday.net/stories/5711595/
(4) Archivalia weist ein breites Spektrum von Themen auf
Von den 55 "echten" Kategorien (Impressum ist abzuziehen) wurden zu 45 Beiträge geschrieben.
Nach wie vor dominierte der Kölner Archiveinsturz das Weblog, denn die meisten der 66 Beiträge zu den Kommunalarchiven galten ihm. Hinzu kommen noch einige Beiträge zum Einsturz, die in andere Schubladen einsortiert wurden.
Das von mir geförderte Thema Open Access brachte es - aufgrund des "Heidelberger Appells" - im Mai auf 43 Beiträge. Digitale Bibliotheken: 34. Archivrecht: 30.
Alle 22 Beiträge der Kategorie Wahrnehmung hat Thomas Wolf verfasst.
Archivalia bemüht sich, auch englischsprachigen Lesern ein attraktives Angebot zu machen. In der English Corner wurden 34 Beiträge auf Englisch veröffentlicht. Auch die 9 Beiträge zu Internationalen Aspekten zeigen, dass Archivalia über den Tellerrand blickt.
Gut vertreten sind auch Fragen der digitalen Archivierung (Digitale Unterlagen 11, Records Management 2, Webarchivierung 2) und das Web 2.0 (Web 2.0: 6, Weblogs 8, Wikis 3).
Zu den Beiträgen zum Kulturgutschutz (12) sind auch 2 der 5 Beiträge zur Landesgeschichte zu zählen.
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse habe ich in diesem Weblog im Mai im Artikel über Richalm von Schöntal publiziert:
http://archiv.twoday.net/stories/5680268/
(5) Archivalia ist unterhaltsam
Außer den 10 Beiträgen in der Rubrik Unterhaltung gab es im Mai 2009 etwas Besonderes, nämlich 9 Gedichte zum Archiveinsturz. Dass meine Idee so viel Kreativität auslösen würde, hat mich selbst überrascht. Auch wenn es sich um "Gebrauchspoesie" handelt, so zeigt doch die Tatsache, dass sie hier veröffentlicht wurden, wie sehr das Kölner Ereignis die Kollegen bewegte.
KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 21:04 - Rubrik: Allgemeines
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"An eine institutionelle Förderung des Archivs der Jugendkulturen durch den Bund ist nicht gedacht. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung (16/12990, Link zur PDF-Datei) auf die Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (16/12805, Link zur PDF-Datei) hervor. Die Zusammenarbeit des Bundes mit dem Archiv sei vielfältig. Die Regierung stütze die Arbeit mit der Finanzierung von Modellprojekten, heißt es in der Antwort."
Quelle: http://www.bundestag.de/aktuell/hib/2009/2009_168/06.html
Quelle: http://www.bundestag.de/aktuell/hib/2009/2009_168/06.html
Wolf Thomas - am Dienstag, 2. Juni 2009, 19:35 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Deutsche Welle gratuliert und wir schließen uns an. Keep swinging!
Quelle:
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4202975,00.html
Quelle:
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4202975,00.html
Wolf Thomas - am Dienstag, 2. Juni 2009, 19:31 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Im Mai war Kerpens Stadtarchivarin Susanne Harke-Schmidt an sechs Tagen im so genannten Erstversorgungszentrum (EVZ), einer Lagerhalle im Kölner Süden, im Einsatz, um bei der Bergung von Archivalien aus dem eingestürzten Kölner Stadtarchiv zu helfen. An zwei Tagen wurde sie dabei von Christian Bischof vom Stadtarchiv und von Rolf Axer vom Verein der Heimatfreunde unterstützt. Tröstlich sei die Tatsache, dass die Archivalien den Einsturz erstaunlich gut überstanden hätten. "Man hat den deutlichen Eindruck, dass die Archivalien je älter desto besser erhalten sind", so Susanne Harke-Schmidt. .....
Das Spektrum der von Susanne Harke-Schmidt und ihren Mitstreitern aus Kerpen erfassten Archivalien war äußerst vielfältig: neben Unterlagen des Domstiftes, des Klosters St. Gereon, der Hanse oder aus dem Bestand "Köln und das Reich" aus dem 16. bis 18. Jahrhundert waren darunter auch Akten aus der Registratur von Oberbürgermeister Konrad Adenauer.
Auch wenn die Kölner zurzeit große Hilfe aus dem In- und Ausland erfahren, der Einsatz im EVZ wird noch längere Zeit andauern. Susanne Harke-Schmidt wird für das Stadtarchiv Kerpen im Juni noch einmal für zwei Tage vor Ort sein. ...."
Quelle:
http://www.sonntags-post.de/rag-spo/docs/187265/lokales
Das Spektrum der von Susanne Harke-Schmidt und ihren Mitstreitern aus Kerpen erfassten Archivalien war äußerst vielfältig: neben Unterlagen des Domstiftes, des Klosters St. Gereon, der Hanse oder aus dem Bestand "Köln und das Reich" aus dem 16. bis 18. Jahrhundert waren darunter auch Akten aus der Registratur von Oberbürgermeister Konrad Adenauer.
Auch wenn die Kölner zurzeit große Hilfe aus dem In- und Ausland erfahren, der Einsatz im EVZ wird noch längere Zeit andauern. Susanne Harke-Schmidt wird für das Stadtarchiv Kerpen im Juni noch einmal für zwei Tage vor Ort sein. ...."
Quelle:
http://www.sonntags-post.de/rag-spo/docs/187265/lokales
Wolf Thomas - am Dienstag, 2. Juni 2009, 19:30 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Dass Archive geduldiger als Papier sind, erweist sich insofern immer dann als richtig, wenn der Newswire auf Schwachstrom umstellt und die Hochspannung eben anders erzeugt werden muss. Dann greifen übereifrige Redakteure zum Telefon, jagen ihren Dr.Praktikanten und Langzeit-Aspiranten auf eine feste Anstellung ins Archiv, damit er oder sie im Dunkel der Energiesparlampen die ein oder andere Sensation noch mal mit neuem Anstrich versehe. Tatsächlich speisen sich die meisten Nachrichtenredaktionen aus identischen Quellen und machen sich auch nicht die Mühe dies zu verbergen. ....."
Quelle:
http://womblog.de/2009/06/02/medienzin-fuers-volk/
Quelle:
http://womblog.de/2009/06/02/medienzin-fuers-volk/
Wolf Thomas - am Dienstag, 2. Juni 2009, 19:27 - Rubrik: Medienarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die ältesten bekannten Tonscherben der Welt sind rund 18 000 Jahre alt und stammen aus einer Höhle in der chinesischen Provinz Hunan. ......
Die Scherben selbst sind bereits seit einiger Zeit beschrieben, die Forscher um Xiaohong Wu von der Universität Peking bestimmten jetzt aber deren Alter genauer als zuvor.
Dazu analysierten sie nicht allein die Fundstücke, sondern auch das umgebende Erdreich sowie darin enthaltene Knochen- und Kohlereste aus dem Bodengrund der Yuchanyan-Höhle. Dort hat sich im Lauf der Jahrtausende Schicht um Schicht abgelagert, so dass ein in die Tiefe reichendes Archiv entstanden ist. ...."
Quelle: Stern
Die Scherben selbst sind bereits seit einiger Zeit beschrieben, die Forscher um Xiaohong Wu von der Universität Peking bestimmten jetzt aber deren Alter genauer als zuvor.
Dazu analysierten sie nicht allein die Fundstücke, sondern auch das umgebende Erdreich sowie darin enthaltene Knochen- und Kohlereste aus dem Bodengrund der Yuchanyan-Höhle. Dort hat sich im Lauf der Jahrtausende Schicht um Schicht abgelagert, so dass ein in die Tiefe reichendes Archiv entstanden ist. ...."
Quelle: Stern
Wolf Thomas - am Dienstag, 2. Juni 2009, 19:25 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Die Arbeit "Mutatoes" setzt sich mit zeitgenössischer Naturwahrnehmung auseinander. Das Mutato-Archiv ist eine umfangreiche photographische Sammlung von Früchten, Gemüse, Knollen und Pilzen, deren Wuchs vom Standardbild abweicht. Westphal verwendet das Wort "Mutato" als Sammel-Begriff für all jenes Obst und Gemüse, das diesen optischen Richtlinien widerspricht, und spiegelt damit eine Formenvielfalt wider, die durch unsere Wahrnehmung in Vergessenheit gerät und letztendlich zu verschwinden droht......."
Quelle:
http://idw-online.de/pages/de/news318008
Links:
http://www.phyletisches-museum.uni-jena.de/
http://uliwestphal.de/
Quelle:
http://idw-online.de/pages/de/news318008
Links:
http://www.phyletisches-museum.uni-jena.de/
http://uliwestphal.de/
Wolf Thomas - am Dienstag, 2. Juni 2009, 19:23 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Der aus Wesel stammende Diplom-Archivar erlag am vergangenen Dienstag in Darmstadt einer schweren Krankheit. Boss wurde 63 Jahre alt. Am 16. Juli 1945 wurde er – wegen Kriegsevakuierung der seit 1696 in Wesel ansässigen Familie – in Marienheide geboren. Der Sohn des früheren Leiters des Kreismuseums Dieburg Walter Boss (heute 92) hatte schon früh eine Ader für Geschichte und historische Gemäuer. Und für Wesel: Frieder Boss war Mitglied der Bürgerinitiative Historisches Rathaus Wesel, der Dombaustiftung und der Historischen Vereinigung. Außerdem war er auch aus der Ferne stets als freier Mitarbeiter für die Weseler RP schreibend tätig. In seiner Heimatstadt hatte Frieder Boss eine kaufmännische Ausbildung absolviert, später in München Betriebswirtschaft studiert.1972 begann er zunächst als Angestellter und nach Vorbereitungsdienst und Absolvierung der Archivschule Marburg diplomiert am Staatsarchiv in Darmstadt. Das Land Hessen würdigte sein 40-jähriges ehrenamtliches Engagement für die hessische Genealogie und Heraldik 2007 mit dem Verdienstorden am Bande. Boss hatte unter anderem 2002 die Amtswappen für die Mainzer Weihbischöfe Guballa und Neymeyr gestaltet. Frieder Boss hinterlässt Frau und zwei erwachsene Kinder. ...."
Quelle: Rheinische Post, Lokalteil Wesel
Quelle: Rheinische Post, Lokalteil Wesel
Wolf Thomas - am Dienstag, 2. Juni 2009, 19:20 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 17:04 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://hochschularchiv-aachen.blogspot.com/
Am 2. April 2008 wurde der erste Eintrag in diesem Weblog, dem ersten institutionellen Weblog eines deutschsprachigen Archivs, geschrieben. Dieses ist das 55. Posting, d.h. es wurde im Schnitt in jeder Woche ein Beitrag veröffentlicht. Die Themen waren neben Mitteilungen aus dem Archivbetrieb (Öffnungszeiten, Umzug, Hilfskraftsuche, Ankündigung der Präsentationen) Neuzugänge bei den Archivalien und in der Archivbibliothek. Außerdem erfolgten Hinweise auf Internetseiten meist zur Universitätsgeschichte. Seit September 2008 wird monatlich eine Archivalie des Monats aus den Archivbeständen vorgestellt. Nach Ansicht des Hochschularchivs hat sich das Weblog als unkompliziertes Mittel, Neues aus dem Archiv mitzuteilen, voll und ganz bewährt.
Glückwunsch!
Am 2. April 2008 wurde der erste Eintrag in diesem Weblog, dem ersten institutionellen Weblog eines deutschsprachigen Archivs, geschrieben. Dieses ist das 55. Posting, d.h. es wurde im Schnitt in jeder Woche ein Beitrag veröffentlicht. Die Themen waren neben Mitteilungen aus dem Archivbetrieb (Öffnungszeiten, Umzug, Hilfskraftsuche, Ankündigung der Präsentationen) Neuzugänge bei den Archivalien und in der Archivbibliothek. Außerdem erfolgten Hinweise auf Internetseiten meist zur Universitätsgeschichte. Seit September 2008 wird monatlich eine Archivalie des Monats aus den Archivbeständen vorgestellt. Nach Ansicht des Hochschularchivs hat sich das Weblog als unkompliziertes Mittel, Neues aus dem Archiv mitzuteilen, voll und ganz bewährt.
Glückwunsch!
KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 15:58 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 13:03
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 12:56 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 12:28 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Atlas liegt in Düsseldorf digitalisiert vor:
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/298378

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/298378

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein solcher Workshop stünde uns Archivierenden gut zu Gesicht. Tagungen, Fortbildungen haben wir ja genug.
Wolf Thomas - am Dienstag, 2. Juni 2009, 07:19 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Immer wieder muss man den Verächtern der Wikipedia, die mit maßloser Arroganz über sie herziehen, unter die Nase reiben, dass auch die renommierten Nachschlagewerke miese und schlechte Artikel enthalten.
Beispiel:
Jakob Mennel in der Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Mennel
Jakob Mennel im HLS (2008)
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D21568.php
Nun mag man der Wikipedia vorhalten, dass sie
K.-H. BURMEISTER, Seine Karriere begann auf dem Freiburger Reichstag. Der Jurist und Historiker Dr. Jakob Mennel (1460-1526), in: H. SCHADEK, Hg., Der Kaiser in seiner Stadt. Maximilian I. und der Reichstag zu Freiburg 1498, 1998, 94-113
nicht hatte. Aber unverzeihlich ist, dass die Zürcher Historikerin den Artikel schlampig heruntergeschrieben hat, ohne die maßgebliche neuere Literatur zu bibliographieren.
2007 erschien übrigens in Heft 147 von LiLi:
Beate Kellner und Linda Webers
Genealogische Entwürfe am Hof Kaiser Maximilians I. (am Beispiel von Jakob Mennels Fürstlicher Chronik)

Beispiel:
Jakob Mennel in der Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Mennel
Jakob Mennel im HLS (2008)
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D21568.php
Nun mag man der Wikipedia vorhalten, dass sie
K.-H. BURMEISTER, Seine Karriere begann auf dem Freiburger Reichstag. Der Jurist und Historiker Dr. Jakob Mennel (1460-1526), in: H. SCHADEK, Hg., Der Kaiser in seiner Stadt. Maximilian I. und der Reichstag zu Freiburg 1498, 1998, 94-113
nicht hatte. Aber unverzeihlich ist, dass die Zürcher Historikerin den Artikel schlampig heruntergeschrieben hat, ohne die maßgebliche neuere Literatur zu bibliographieren.
2007 erschien übrigens in Heft 147 von LiLi:
Beate Kellner und Linda Webers
Genealogische Entwürfe am Hof Kaiser Maximilians I. (am Beispiel von Jakob Mennels Fürstlicher Chronik)

KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 03:30 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 02:56 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00038996/images/
Die Handschrift wurde von Stamm ediert und überliefert ein Werk von Georg Rüxner (Turnierchronik und weitere Turnierlisten).
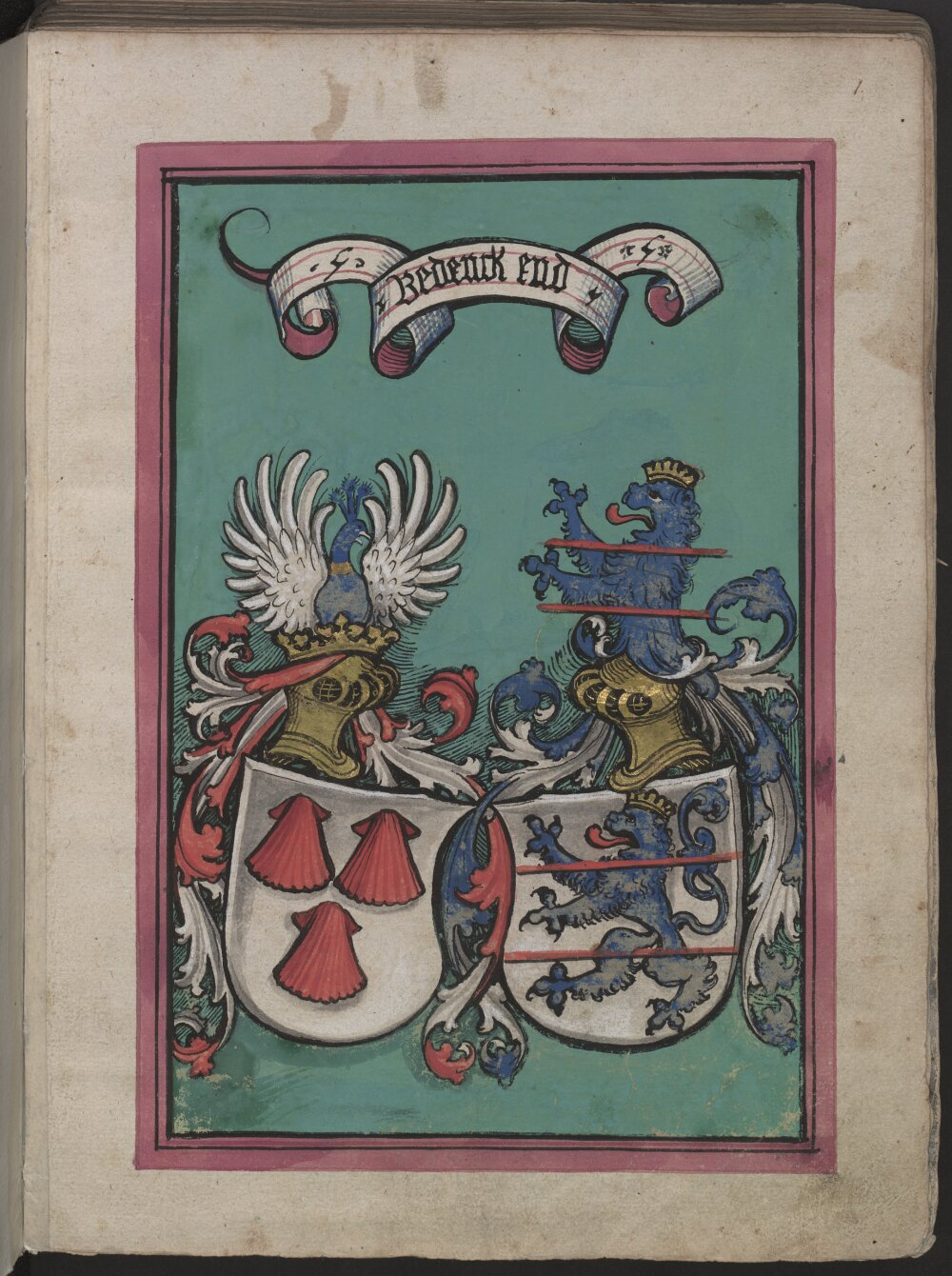
Die Handschrift wurde von Stamm ediert und überliefert ein Werk von Georg Rüxner (Turnierchronik und weitere Turnierlisten).
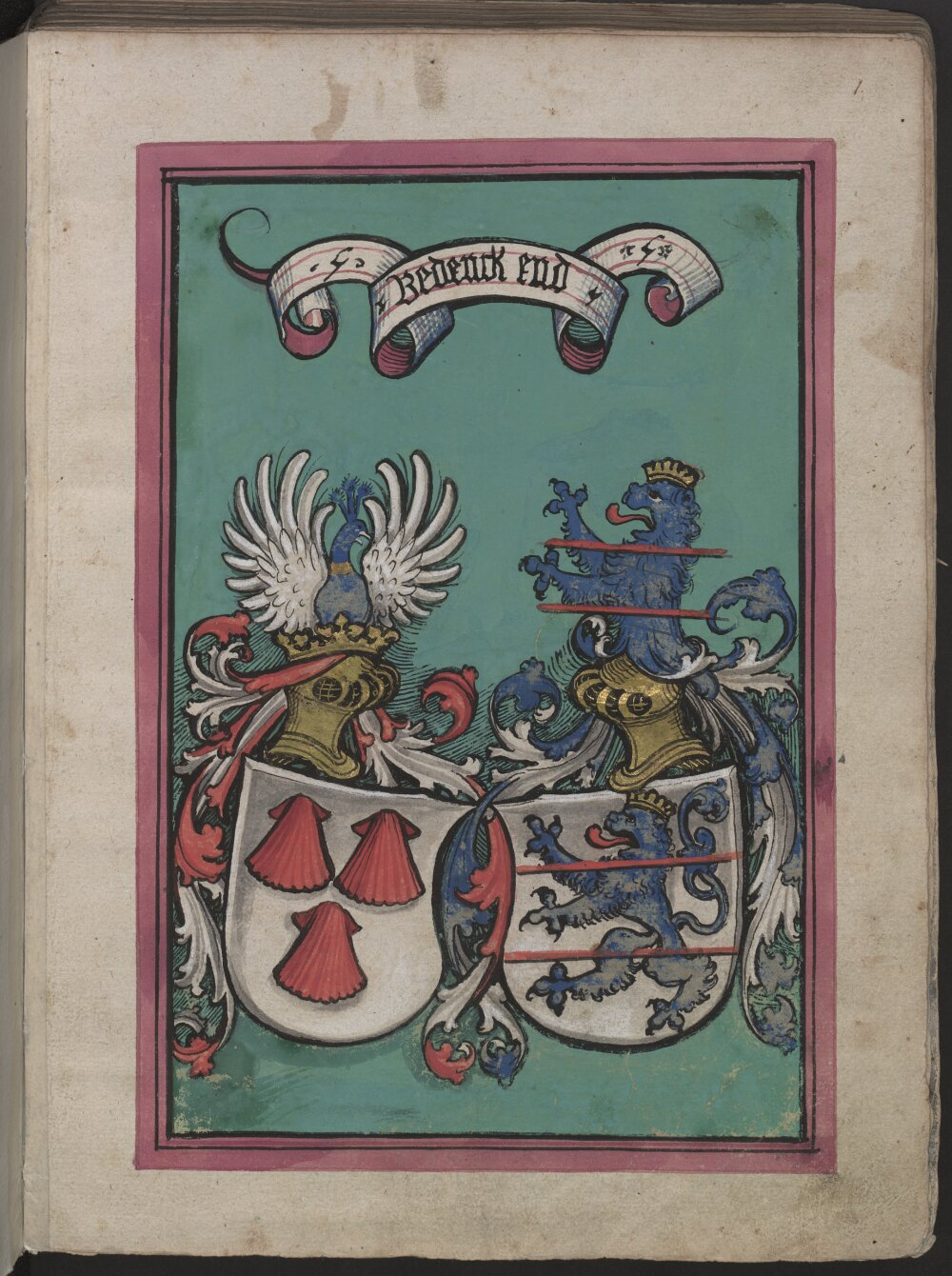
KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 02:19 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.handschriftencensus.de/9574
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00038912/images
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00038912/images
KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 02:11 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Diesmal beim MDZ:
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00039006/images/
Weitere:
http://diglib.hab.de/inkunabeln/13-1-eth-2f/start.htm?image=00001
http://digbijzcoll.library.uu.nl/lees_gfx.php?lang=nl&W=On&BoekID=1073
http://fondotesis.us.es/books/search/digitalbook_view?oid_page=2883
http://www.rarebookroom.org/Control/colhyp/index.html
http://aleph500.huji.ac.il/nnl/dig/books/bk001184637.html
http://posner.library.cmu.edu/Posner/books/book.cgi?call=853_C71HY
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k587910 (schlechte Qualität)
http://mitpress.mit.edu/e-books/HP/index.htm
= http://www.bk.tudelft.nl/dks/publications/hp/index.htm

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00039006/images/
Weitere:
http://diglib.hab.de/inkunabeln/13-1-eth-2f/start.htm?image=00001
http://digbijzcoll.library.uu.nl/lees_gfx.php?lang=nl&W=On&BoekID=1073
http://fondotesis.us.es/books/search/digitalbook_view?oid_page=2883
http://www.rarebookroom.org/Control/colhyp/index.html
http://aleph500.huji.ac.il/nnl/dig/books/bk001184637.html
http://posner.library.cmu.edu/Posner/books/book.cgi?call=853_C71HY
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k587910 (schlechte Qualität)
http://mitpress.mit.edu/e-books/HP/index.htm
= http://www.bk.tudelft.nl/dks/publications/hp/index.htm

KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 01:35 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.nb.no/bokhylla
Ohne Norwegischkenntnisse fällt es schwer festzustellen, ob da etwas neu und auch außerhalb Norwegens zugänglich ist. Eine Euklid-Inkunabel kann man jedenfalls nicht sonderlich vergrößern.
Lateinischer Druck zu Amsterdam:
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009032513001
Siehe http://archiv.twoday.net/stories/4802444/
http://archiv.twoday.net/stories/5711865/
Ohne Norwegischkenntnisse fällt es schwer festzustellen, ob da etwas neu und auch außerhalb Norwegens zugänglich ist. Eine Euklid-Inkunabel kann man jedenfalls nicht sonderlich vergrößern.
Lateinischer Druck zu Amsterdam:
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009032513001
Siehe http://archiv.twoday.net/stories/4802444/
http://archiv.twoday.net/stories/5711865/
KlausGraf - am Dienstag, 2. Juni 2009, 00:38 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Suche nach nachkassation
http://www.google.com/search?hl=de&rlz=1C1CHMB_deDE291DE303&num=100&q=nachkassation&btnG=Suche&lr=
44 Treffer, kein Stemming
http://www.bing.com/search?q=nachkassation&go=&form=QBLH&filt=all
109 Ergebnisse, einschließlich: nach Kassation [das Ergebnis ist nicht mehr reproduzierbar, siehe unten: 90 Treffer]
Mit +Nachkassation 22 Treffer
#1 bei Bing ist wichtiger als #1 bei Google.
Kommt man via MSN auf Bing gibt es nur 90 Ergebnisse bei nachkassation und bei dem Durchblättern der Ergebnisseiten sind es auch nur 47.
http://www.google.com/search?hl=de&rlz=1C1CHMB_deDE291DE303&num=100&q=nachkassation&btnG=Suche&lr=
44 Treffer, kein Stemming
http://www.bing.com/search?q=nachkassation&go=&form=QBLH&filt=all
109 Ergebnisse, einschließlich: nach Kassation [das Ergebnis ist nicht mehr reproduzierbar, siehe unten: 90 Treffer]
Mit +Nachkassation 22 Treffer
#1 bei Bing ist wichtiger als #1 bei Google.
Kommt man via MSN auf Bing gibt es nur 90 Ergebnisse bei nachkassation und bei dem Durchblättern der Ergebnisseiten sind es auch nur 47.
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2429/4378
Title: The German archival system 1945-1995
Author: Landwehr, Regina
Degree: Master of Archival Studies - MAS
Program: Library, Archival and Information Studies
Copyright Date: 1996
Abstract: After World War Two, Germany became divided into two countries commonly called East and West Germany. This thesis describes how the two countries, one communist and one pluralistic, developed distinctly different archival systems with respect to the organization, legislation and appraisal methods of government archival institutions. East Germany's archival system was organized and legislated into a rigorous hierarchical structure under central government control with the mandate of fulfilling in a systematic way primarily ideological objectives. Although professional collaboration between the archivists of the two countries had been officially severed since the early years of separation by East Germany, because of irreconcilable political differences, they influenced each others' thoughts. Specifically, East German archivists borrowed and implemented extensively appraisal concepts formulated in West Germany, such as the documentation profile idea. The examination of the archival system in West Germany reveals organizational characteristics typical of federalist countries. The development of archival legislation in West Germany was clearly the outcome of initiatives from the archival profession itself, and West Germany's appraisal methods reflected a diversity of theoretical considerations which, because of the pluralistic nature of the discussions, were marked by a lack of professional consensus. The description of the discussions that took place over time illustrates an ongoing struggle to identify and respect the perceived demand for sources, and to formulate appraisal methods focusing on the contextual and functional analysis of records creators' activities and competencies. The discussion of the. developments that followed Germany's political reunification in 1990 shows that East Germany's archival system was absorbed by the West German system. The thesis concludes that the main effect of reunification was a search for a balance between East and West appraisal concepts and methods, and a renewed constructive debate characterized by a reexamination of previous archival contributions supporting contextual and functional appraisal approaches.
Title: The German archival system 1945-1995
Author: Landwehr, Regina
Degree: Master of Archival Studies - MAS
Program: Library, Archival and Information Studies
Copyright Date: 1996
Abstract: After World War Two, Germany became divided into two countries commonly called East and West Germany. This thesis describes how the two countries, one communist and one pluralistic, developed distinctly different archival systems with respect to the organization, legislation and appraisal methods of government archival institutions. East Germany's archival system was organized and legislated into a rigorous hierarchical structure under central government control with the mandate of fulfilling in a systematic way primarily ideological objectives. Although professional collaboration between the archivists of the two countries had been officially severed since the early years of separation by East Germany, because of irreconcilable political differences, they influenced each others' thoughts. Specifically, East German archivists borrowed and implemented extensively appraisal concepts formulated in West Germany, such as the documentation profile idea. The examination of the archival system in West Germany reveals organizational characteristics typical of federalist countries. The development of archival legislation in West Germany was clearly the outcome of initiatives from the archival profession itself, and West Germany's appraisal methods reflected a diversity of theoretical considerations which, because of the pluralistic nature of the discussions, were marked by a lack of professional consensus. The description of the discussions that took place over time illustrates an ongoing struggle to identify and respect the perceived demand for sources, and to formulate appraisal methods focusing on the contextual and functional analysis of records creators' activities and competencies. The discussion of the. developments that followed Germany's political reunification in 1990 shows that East Germany's archival system was absorbed by the West German system. The thesis concludes that the main effect of reunification was a search for a balance between East and West appraisal concepts and methods, and a renewed constructive debate characterized by a reexamination of previous archival contributions supporting contextual and functional appraisal approaches.
KlausGraf - am Montag, 1. Juni 2009, 19:05 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
n24 schlagzeilte wörtlich :"Sensationsfund im Archiv. Echte Leiche Rosa Luxemburgs gefunden?"
Quelle:
http://www.n24.de/news/newsitem_5092921.html
Quelle:
http://www.n24.de/news/newsitem_5092921.html
Wolf Thomas - am Montag, 1. Juni 2009, 18:33 - Rubrik: Wahrnehmung
" ..... Den ehemaligen italienischen Pavillon in den Giardini will Baratta in einen "Palazzo delle Esposizioni" verwandeln - mit Biennale-Archiv, Bibliothek und einem Kulturzentrum, um die Kreativität des Nachwuchses zu entwickeln. ....."
Quelle: Welt am Sonntag
Quelle: Welt am Sonntag
Wolf Thomas - am Montag, 1. Juni 2009, 18:30 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Marietta Schwarz stellt im Rheinischer Merkur (Nr. 22, 28.05.2009) Hans Cybinski vor. Leseprobe: " ..... Regen kann es nie genug geben. Selbst wenn Hans Cybinski in seinem Archiv bei Deutschlandradio Kultur schon mehr alsgenug davon hat: auf den alten Tonbändern im vergilbten Pappschuber, auf CD gebrannt oder auf der Festplatte gesichert. Regen ist eben nicht gleich Regen. Cybinski findet in seinem Geräuschearchiv sofort 220 verschiedene Regensorten, „Atmos“, wie es beim Rundfunk heißt: Regen mittelstark, Regen plätschernd, Autofahrt im Regen. Regen kalt. Regen warm. ....."
Quelle:
http://www.merkur.de/2009_22_Die_ganze_Welt_au.34752.0.html?&no_cache=1
Quelle:
http://www.merkur.de/2009_22_Die_ganze_Welt_au.34752.0.html?&no_cache=1
Wolf Thomas - am Montag, 1. Juni 2009, 18:29 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Jeder Mensch ist ein Archiv der Menschheit. In seinen Erbanlagen spiegelt sich die Geschichte seiner Vorfahren..... "
Arndt Reuning im DLF-Beitrag "Knochen, Gene, Totempfähle"
Quelle:
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/wib/969695/
Arndt Reuning im DLF-Beitrag "Knochen, Gene, Totempfähle"
Quelle:
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/wib/969695/
Wolf Thomas - am Montag, 1. Juni 2009, 18:27 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"synopsis
A man explores his dual obsessions, his girlfriend and the art of vacuum packing, in a beautiful story about what it is to love and to never let go. Can a perfect moment be preserved forever?
short fact
Tasked with making a short film inspired by a piece of music (Wild Beasts - She Purred While I Grred) on a budget of only £5000, we challenged ourselves to tell an intricate story without dialogue, beautifully shot and about something which, in the tiniest darkest part of the mind, anyone that has ever been in love can relate to no matter how fantastical it may seem.
crew
director James Lees
writer David Whitehouse
producer Libby Durdy
editor William Bridges
director of photography Lol Crawley
sound Steve Parker and Richard Lewis
music Wild Beasts - She Purred
cast
The Archivist Finlay Robertson
Archive number 1723, Girl Shonagh Marshall
Cat Murray Mint
Link:
http://www.bbc.co.uk/dna/filmnetwork/A43554233
A man explores his dual obsessions, his girlfriend and the art of vacuum packing, in a beautiful story about what it is to love and to never let go. Can a perfect moment be preserved forever?
short fact
Tasked with making a short film inspired by a piece of music (Wild Beasts - She Purred While I Grred) on a budget of only £5000, we challenged ourselves to tell an intricate story without dialogue, beautifully shot and about something which, in the tiniest darkest part of the mind, anyone that has ever been in love can relate to no matter how fantastical it may seem.
crew
director James Lees
writer David Whitehouse
producer Libby Durdy
editor William Bridges
director of photography Lol Crawley
sound Steve Parker and Richard Lewis
music Wild Beasts - She Purred
cast
The Archivist Finlay Robertson
Archive number 1723, Girl Shonagh Marshall
Cat Murray Mint
Link:
http://www.bbc.co.uk/dna/filmnetwork/A43554233
Wolf Thomas - am Montag, 1. Juni 2009, 17:32 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Hot spot der Klimaforschung: Eis des Lomonossow-Gletscherfeldes ist etwa 2.000 Jahre alt. Ein ZEIT-Video unter: http://www.zeit.de/video/player?videoID=200905287629a4
Wolf Thomas - am Montag, 1. Juni 2009, 17:31 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Tibeter und Schweizer versahen tibetanische Kunst mit Schlagworten (tags).
http://www.archimuse.com/mw2008/papers/mannion/

http://www.archimuse.com/mw2008/papers/mannion/

KlausGraf - am Montag, 1. Juni 2009, 16:02
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2009/05/alert-action-needed-in-new-york-state.html
Peter Hirtle writes
There is a proposed new law making its way through the New York State legislature that would regulate how museums deaccession items in their collections. While ostensibly about museums, the law could have a major impact on how libraries function. All libraries and historical societies in NY should write to the legislation's sponsors and ask that passage be delayed until definitions are clarified.
The bills are A06959 (introduced by Richard L. Brodsky) and its identical counterpart S04584 (introduced by José M. Serrano). They would govern how museums acquire and dispose of objects. You can learn more from a hearing on the topic found here.
The proposal has generated some discussion and concern within the museum community (see, for example, the letter from the Art Law Committee of the New York City Bar or the posts on the bill in the Art Law blog). My concern is with its potential impact on libraries and archives. The problem is that while the bill discusses the issue surrounding collecting in museums, it defines museums so broadly that most libraries and archives would fall under its sway. Here is the definition:
"MUSEUM" means any institution having collecting as a stated purpose in its charter, certificate of incorporation, or other organizing documents, or owning or holding collections, or intending to own or hold collections that is a governmental entity, education corporation, not-for-profit corporation, or charitable trust.
Since almost every library in the state owns or holds collections, for the purposes of the law they would be museums. The law would sharply limit their ability to dispose of any material (other than returning it to the donor). Everything the library or archives gets would have to be accessioned before it could be discarded. And instead of throwing unwanted items into the trash or putting them in the local library book sale, a library would first have to offer the material to other "museums" in New York state and then the rest of the country. Proceeds from any sale could only be used to support further acquisitions.
I appreciate the NY efforts to prevent damagages to cultural heritage by deaccessioning historical collections. If real damages for the cultural heritage could prevented by the law I woould accept some minor disadvantages i.e. that deaccessioning which makes sense is'nt possible.
Museums, libraries and archives are memory institutions. They should preserve the items they own for the posterity.
For damages by deaccessioning historical collections see
http://archiv.twoday.net/search?q=deaccess
Hirtle-Update:
http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2009/06/update-deaccessioning-in-new-york-state.html
http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2009/08/ny-deaccessioning-update-some-good-news-for-libraries-but-less-so-for-historical-societies.html
Peter Hirtle writes
There is a proposed new law making its way through the New York State legislature that would regulate how museums deaccession items in their collections. While ostensibly about museums, the law could have a major impact on how libraries function. All libraries and historical societies in NY should write to the legislation's sponsors and ask that passage be delayed until definitions are clarified.
The bills are A06959 (introduced by Richard L. Brodsky) and its identical counterpart S04584 (introduced by José M. Serrano). They would govern how museums acquire and dispose of objects. You can learn more from a hearing on the topic found here.
The proposal has generated some discussion and concern within the museum community (see, for example, the letter from the Art Law Committee of the New York City Bar or the posts on the bill in the Art Law blog). My concern is with its potential impact on libraries and archives. The problem is that while the bill discusses the issue surrounding collecting in museums, it defines museums so broadly that most libraries and archives would fall under its sway. Here is the definition:
"MUSEUM" means any institution having collecting as a stated purpose in its charter, certificate of incorporation, or other organizing documents, or owning or holding collections, or intending to own or hold collections that is a governmental entity, education corporation, not-for-profit corporation, or charitable trust.
Since almost every library in the state owns or holds collections, for the purposes of the law they would be museums. The law would sharply limit their ability to dispose of any material (other than returning it to the donor). Everything the library or archives gets would have to be accessioned before it could be discarded. And instead of throwing unwanted items into the trash or putting them in the local library book sale, a library would first have to offer the material to other "museums" in New York state and then the rest of the country. Proceeds from any sale could only be used to support further acquisitions.
I appreciate the NY efforts to prevent damagages to cultural heritage by deaccessioning historical collections. If real damages for the cultural heritage could prevented by the law I woould accept some minor disadvantages i.e. that deaccessioning which makes sense is'nt possible.
Museums, libraries and archives are memory institutions. They should preserve the items they own for the posterity.
For damages by deaccessioning historical collections see
http://archiv.twoday.net/search?q=deaccess
Hirtle-Update:
http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2009/06/update-deaccessioning-in-new-york-state.html
http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2009/08/ny-deaccessioning-update-some-good-news-for-libraries-but-less-so-for-historical-societies.html
KlausGraf - am Montag, 1. Juni 2009, 15:38 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde e.V. WGfF stellt exklusiv für ihre Mitglieder eine digitale Bibliothek mit Auswertungen von Primärquellen wie Kirchenbücher, Zivilstandsregister, Steuer- und Kontributionslisten o.ä., die in Form von Abschriften, Verzeichnissen oder Verkartungen vorliegen, zur Verfügung. Auch Familienbücher, die nicht in digitaler Form vorliegen und/oder sich nicht für eine Veröffentlichung durch die WGfF als gedrucktes Buch eignen, können über diesen Weg ebenso angeboten werden wie ältere Veröffentlichungen und Publikationen, die längst vergriffen sind. Die Liste der Digitalisate enthält überwiegend rheinische Betreffe aus dem Arbeitsgebiet der Gesellschaft. Auf der Karte der Bezirksgruppen kann man sich die Quellen regional anzeigen lassen. Die umfangreichste Sammlung stammt aus der Bezirksgruppe Trier, die ihre Namensverzeichnisse zu den gedruckten Familienbüchern frei zugänglich auf der eigenen Homepage (ABC-Listen) zur Verfügung stellt. Der Zugang selbst ist kostenlos. Die Liste der digitalisierten Angebote ist für jedermann einsehbar, will man aber die einzelnen Seiten ansehen, so ist die Eingabe der zuvor mitgeteilten Benutzerkennung und des Passwortes bzw. die Registrierung notwendig. Nichtmitglieder können hier ihren Beitrittserklärung von der Homepage herunterladen und an die Geschäftstelle einsenden. (GJ)
http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2009/06#Neue_DigiBib_der_WGfF
http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2009/06#Neue_DigiBib_der_WGfF
KlausGraf - am Montag, 1. Juni 2009, 15:33 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Digitale Bibliothek im GenWiki war vom österlichen Plattencrash bei Compgen leider sehr stark betroffen. Derzeit laufen die Restaurierungsarbeiten noch auf Hochtour. Es werden immer noch einzelne DjVus gesucht, damit wirklich alle Wunden geheilt werden können. Eine Liste der noch nicht wieder hergestellten DjVus kann man hier einsehen: http://wiki-de.genealogy.net/GenWiki:Verlorengegangene_DjVus
Wenn Sie eines der dort gelisteten DjVus auf Ihrer privaten Festplatte abgespeichert haben, würden wir uns über Zusendung der Datei oder eine kurze Info an digibib@genealogy.net freuen.
(Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl)
http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2009/06#Neue_DigiBib_der_WGfF
Wenn Sie eines der dort gelisteten DjVus auf Ihrer privaten Festplatte abgespeichert haben, würden wir uns über Zusendung der Datei oder eine kurze Info an digibib@genealogy.net freuen.
(Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl)
http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2009/06#Neue_DigiBib_der_WGfF
KlausGraf - am Montag, 1. Juni 2009, 15:31 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Projekt Matricula – Kirchenbuch-Matrikelportal sieht die Schaffung eines Portals für Kirchenbücher bzw. Matrikel aus Mitteleuropa vor und agiert sowohl staaten- wie auch konfessionsübergreifend. Beteiligt sind sowohl der deutsche „Verband kirchlicher Archive“ (evang.), die „Bundeskonferenz der kirchlichen Archive“ (röm.-kath.), die Bistumsarchive Passau und Hildesheim, als auch das Diözesanarchiv St. Pölten, das Oberösterreichische Landesarchiv (beide AT) und das Moravský Zemský Archiv (CZ). Die Koordination erfolgt durch das International Centre for Archival Research, Wien (ICARUS Projektbetreuer: Dr. Karl Heinz).
Auf der URL http://www.matricula.findbuch.net stehen im Rahmen dieses Projektes seit dem 26. Februar 2009 die St. Pöltner Matriken als Digitalisate im Internet in einer Beta-Version zur Verfügung. Insgesamt handelt es sich um 643.578 Kirchenbuchseiten aus 164 Pfarren (von insgesamt 424) und 2439 Bänden. Auch aus dem Bistum Passau sind Digitalisate der 20 Kirchenbücher aus der Pfarre Passau-Hals für die Jahre 1613-1887 eingestellt, aus der evangelischen Landeskirche Hessen-Kassel 21 Kirchenbücher aus Gelnhausen 1727-1879.
Ganz im Sinne des OpenAccess-Gedankens können sämtliche Digitalisate kostenlos und ohne Registrierung betrachtet werden! Technisch wird nur ein Internetbrowser mit installiertem Flash-Player Plug-in benötigt.
Zusätzlich zu den im Diözesanarchiv verfügbaren Matriken sollen in einigen Jahren alle alten Matriken der Diözese im Internet verfügbar sein, also auch die, die noch in den Pfarren liegen und die, die in den Klöstern (z. B. Göttweig) liegen. Daran anschließend will das Diözesanarchiv St. Pölten auch damit beginnen, die Matriken der Wiener Erzdiözese zu digitalisieren. Beginnen will man dort mit dem Nord-Vikariat (Weinviertel).
Den Archivdirektoren aus St. Pölten, Dr. Thomas Aigner, und aus Passau, Dr. Herbert Wurster, und den anderen Projektbeteiligten kann die genealogische Gemeinschaft gar nicht genug danken. Sie haben den Genealogen eine riesige Arbeitserleichterung beschert und haben mit dieser Aktion den Maßstab für online verfügbare Kirchenbuch-Digitalisierungen gesetzt!
Speziell aus deutscher Sicht bleibt zu hoffen, dass auch die hiesigen Kirchenbucharchive sich endlich für einen offenen Umgang mit Kirchenbuchdigitalisaten entscheiden und keine kostenpflichtigen Lösungen etablieren. Die österreichische Lösung zeigt, dass es möglich ist! (KPW) (Hervorhebung von mir KG)
http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2009/06#Austria_goes_online.21
Diesen Ausführungen kann ich mich nur anschließen. Leider heisst es auf der Seite derzeit: "Aufgrund unvorhergesehener technischer Schwierigkeiten sind bis auf weiteres keine bzw. nur sporadisch Bilder abrufbar."
Für die Technik ist bei Findbuch.net AUGIAS Data zuständig. Solange Archivare sich in die Hände dieser Firma begeben, ist mit derlei zu rechnen.
Update: Inzwischen sind die Bilder nach Projektangaben wieder online, aber mit Chrome sehe ich sie nur in einem winzigen Bildschirmausschnitt in der Mitte, und die Auflösung ist keineswegs so großzügig, wie dies zum problemlosen Entziffern notwendig wäre.
Ich sehe auch mit dem FF bei einem anderen Beispiel nichts! Kein einziges Bild. Sehr beta ...
Auf der URL http://www.matricula.findbuch.net stehen im Rahmen dieses Projektes seit dem 26. Februar 2009 die St. Pöltner Matriken als Digitalisate im Internet in einer Beta-Version zur Verfügung. Insgesamt handelt es sich um 643.578 Kirchenbuchseiten aus 164 Pfarren (von insgesamt 424) und 2439 Bänden. Auch aus dem Bistum Passau sind Digitalisate der 20 Kirchenbücher aus der Pfarre Passau-Hals für die Jahre 1613-1887 eingestellt, aus der evangelischen Landeskirche Hessen-Kassel 21 Kirchenbücher aus Gelnhausen 1727-1879.
Ganz im Sinne des OpenAccess-Gedankens können sämtliche Digitalisate kostenlos und ohne Registrierung betrachtet werden! Technisch wird nur ein Internetbrowser mit installiertem Flash-Player Plug-in benötigt.
Zusätzlich zu den im Diözesanarchiv verfügbaren Matriken sollen in einigen Jahren alle alten Matriken der Diözese im Internet verfügbar sein, also auch die, die noch in den Pfarren liegen und die, die in den Klöstern (z. B. Göttweig) liegen. Daran anschließend will das Diözesanarchiv St. Pölten auch damit beginnen, die Matriken der Wiener Erzdiözese zu digitalisieren. Beginnen will man dort mit dem Nord-Vikariat (Weinviertel).
Den Archivdirektoren aus St. Pölten, Dr. Thomas Aigner, und aus Passau, Dr. Herbert Wurster, und den anderen Projektbeteiligten kann die genealogische Gemeinschaft gar nicht genug danken. Sie haben den Genealogen eine riesige Arbeitserleichterung beschert und haben mit dieser Aktion den Maßstab für online verfügbare Kirchenbuch-Digitalisierungen gesetzt!
Speziell aus deutscher Sicht bleibt zu hoffen, dass auch die hiesigen Kirchenbucharchive sich endlich für einen offenen Umgang mit Kirchenbuchdigitalisaten entscheiden und keine kostenpflichtigen Lösungen etablieren. Die österreichische Lösung zeigt, dass es möglich ist! (KPW) (Hervorhebung von mir KG)
http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2009/06#Austria_goes_online.21
Diesen Ausführungen kann ich mich nur anschließen. Leider heisst es auf der Seite derzeit: "Aufgrund unvorhergesehener technischer Schwierigkeiten sind bis auf weiteres keine bzw. nur sporadisch Bilder abrufbar."
Für die Technik ist bei Findbuch.net AUGIAS Data zuständig. Solange Archivare sich in die Hände dieser Firma begeben, ist mit derlei zu rechnen.
Update: Inzwischen sind die Bilder nach Projektangaben wieder online, aber mit Chrome sehe ich sie nur in einem winzigen Bildschirmausschnitt in der Mitte, und die Auflösung ist keineswegs so großzügig, wie dies zum problemlosen Entziffern notwendig wäre.
Ich sehe auch mit dem FF bei einem anderen Beispiel nichts! Kein einziges Bild. Sehr beta ...
KlausGraf - am Montag, 1. Juni 2009, 15:19 - Rubrik: Open Access
KlausGraf - am Montag, 1. Juni 2009, 15:18 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/05/31/AR2009053102262.html
On Sunday, staff from the National Archives called me from all over the country: Philadelphia, New York, Suitland, Maryland. No, they didn't want to archive some of my recent poetry or conduct an archival survey. These staffers were trying to access their voice mailbox, and they got me -- over and over and over again. [...] Makes me wonder what's really happening to all that valuable historical material they handle.

On Sunday, staff from the National Archives called me from all over the country: Philadelphia, New York, Suitland, Maryland. No, they didn't want to archive some of my recent poetry or conduct an archival survey. These staffers were trying to access their voice mailbox, and they got me -- over and over and over again. [...] Makes me wonder what's really happening to all that valuable historical material they handle.

KlausGraf - am Montag, 1. Juni 2009, 15:14 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
So gut wie nichts ist ganz verloren. Diese Bilanz hat die Leiterin des Kölner Stadtarchivs, Bettina Schmidt-Czaia, gezogen. Für sie sei es eine Sensation, dass trotz des Einsturzes des Archivgebäudes alles noch irgendwie da sei. Zwar sei der Zustand des Materials sehr unterschiedlich, doch nur ein Viertel der Dokumente sei zerschnippselt. Um diese Schriftstücke wieder zusammenzufügen, entwickle man eine eigene Computer-Software.
http://www.dradio.de/kulturnachrichten/2009053114/2/
Ausführlicher:
http://www.ksta.de/html/artikel/1243453917496.shtml
85 Prozent des Gesamtbestandes sind mittlerweile geborgen. Die restlichen 15 Prozent liegen in einer Baugrube der U-Bahn im Grundwasser. Die Feuerwehr prüft zurzeit, wie dieses Material am Besten hochgeholt werden kann. "Wir werden das nicht aufgeben", sagte Schmidt-Czaia. "Wir brauchen alles, wir fordern alles." Im übrigen benötige das Archiv vor allem eines: "Geld, Geld, Geld." Es gehe um "einen hohen dreistelligen Millionenbetrag".
http://www.dradio.de/kulturnachrichten/2009053114/2/
Ausführlicher:
http://www.ksta.de/html/artikel/1243453917496.shtml
85 Prozent des Gesamtbestandes sind mittlerweile geborgen. Die restlichen 15 Prozent liegen in einer Baugrube der U-Bahn im Grundwasser. Die Feuerwehr prüft zurzeit, wie dieses Material am Besten hochgeholt werden kann. "Wir werden das nicht aufgeben", sagte Schmidt-Czaia. "Wir brauchen alles, wir fordern alles." Im übrigen benötige das Archiv vor allem eines: "Geld, Geld, Geld." Es gehe um "einen hohen dreistelligen Millionenbetrag".
KlausGraf - am Montag, 1. Juni 2009, 14:32 - Rubrik: Kommunalarchive
http://147.231.53.91/src/index.php?s=v&cat=13&bookid=210&page=329
http://books.google.com/books?q=rummulonis
http://books.google.com/books?hl=de&q=rumulonis++&btnG=Nach+Büchern+suchen
http://books.google.com/books?id=9M9DAAAAIAAJ&q=rummulo+gamundia&pgis=1
http://books.google.com/books?id=CnkB23QthD8C&pg=PA494
http://books.google.com/books?ei=FY8iSsG6OZbozATKs4GKAQ&hl=de&q=rumilonis
Fehlanzeige: http://www.uni-goettingen.de/de/78229.html
http://books.google.com/books?hl=de&q=zisselmuller
http://books.google.com/books?hl=de&q=zeiselmüller
https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=17236&klassi=&anzeigeKlassi=002
[ http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=2-2489110 ]
http://books.google.com/books?ei=FY8iSsG6OZbozATKs4GKAQ&hl=de&q="konrad+bissinger"
http://books.google.com/books?id=u-vvNC2QT10C&pg=PA81
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alberti_Wappenbuch_H02_S_0064.jpg
http://books.google.com/books?id=XvdnAAAAMAAJ&q=zeisselmüller&dq=zeisselmüller&ei=YokiSsK2CIqsywSk4-DwDw&hl=de&pgis=1
= Moraw, Peter: Mutmaßung und Streiflicht : Eckhard Müller-Mertens, Kaiser Karl IV. und Peter Parler
In: Turbata per aequora mundi / unter Mitarb. von Mathias Lawo hrsg. von Olaf B. Rader, Hannover: Hahn (2001), S. 13-25
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/gd14.htm
http://books.google.com/books?q=rummulonis
http://books.google.com/books?hl=de&q=rumulonis++&btnG=Nach+Büchern+suchen
http://books.google.com/books?id=9M9DAAAAIAAJ&q=rummulo+gamundia&pgis=1
http://books.google.com/books?id=CnkB23QthD8C&pg=PA494
http://books.google.com/books?ei=FY8iSsG6OZbozATKs4GKAQ&hl=de&q=rumilonis
Fehlanzeige: http://www.uni-goettingen.de/de/78229.html
http://books.google.com/books?hl=de&q=zisselmuller
http://books.google.com/books?hl=de&q=zeiselmüller
[ http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=2-2489110 ]
http://books.google.com/books?ei=FY8iSsG6OZbozATKs4GKAQ&hl=de&q="konrad+bissinger"
http://books.google.com/books?id=u-vvNC2QT10C&pg=PA81
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alberti_Wappenbuch_H02_S_0064.jpg
http://books.google.com/books?id=XvdnAAAAMAAJ&q=zeisselmüller&dq=zeisselmüller&ei=YokiSsK2CIqsywSk4-DwDw&hl=de&pgis=1
= Moraw, Peter: Mutmaßung und Streiflicht : Eckhard Müller-Mertens, Kaiser Karl IV. und Peter Parler
In: Turbata per aequora mundi / unter Mitarb. von Mathias Lawo hrsg. von Olaf B. Rader, Hannover: Hahn (2001), S. 13-25
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/gd14.htm
KlausGraf - am Sonntag, 31. Mai 2009, 15:40 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://147.231.53.91/src/index.php?s=v&cat=22
Czech medieval sources online
[Kommentar: Großartig!]
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae
Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae
Codex diplomaticus Silesiae
Codex Diplomaticus Lusatiae Superioris
[ CDLS I
CDLS II/1 (1419-1428)
CDLS II/2 (1429-1437)
CDLS III
CDLS IV (1437-1457)
CDLS V Görlitzer Bürgerrechtslisten (1379-1600)
CDLS VI (1458-1463) ]
Codex iuris Bohemici
Reliquiae tabularum terrae
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae
Archiv český čili staré písemné památky české i moravské
Archivum Coronae regni Bohemiae
Fontes rerum Bohemicarum
Monumenta Historica Boemiae
Codex iuris municipalis
Deutsche Reichstagsakten
[ DRTA 10 Sigmund (1431-1433) ed. Herre
DRTA 12 Sigmund (1435-1437) ed. Beckmann
DRTA 13,1 Albrecht II. (1438) ed. Beckmann
DRTA 13,2 Albrecht II. (1438) ed. Beckmann
Siehe auch: http://de.wikisource.org/wiki/Deutsche_Reichstagsakten ]
Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia
Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem
Libri erectionum archidioecesis Pragensis saeculo XIV. et XV
Scriptores rerum Lusaticarum
Listáře a listináře
Městské listáře a listináře
[
Boehmisch-Kamnitzer Stadtbuch
Listiny a zápisy Bělské (ed. Kalousek)
Urkundenbuch Aussig (ed. Horčička)
Urkundenbuch Saaz (Ed.Schlesinger) ]
Kroniky
Varia
[
Das Wappenrecht (Ed. Hauptmann)
Decem registra censuum
Ein Bernaregister des Pilsner Kreises vom Jahre 1379 (Ed. Emler)
Hilaria Litoměřického traktát k Janovi z Rozenberka (Ed.Tobolka)
Inquisitio domorum hosp. S. Joh. Hierosolimitani 1373 (Ed. Novotný)
Jana z Lobkovic Naučení synu Jaroslavovi
Kniha Drnovská (Ed.Brandl)
Liber decanorum fac. phil. ab anno 1367, usque ad annum 1585 p. Prima
Matricula facultatis juridicae
Několik statutů a nařízení arcibiskupů pražských 1355-1377 (Ed.Menčík)
Purkrabské účty panství Novohradského z let 1390-1391 (Ed. Šusta)
Registra decimarum papalium
Seznamy měšťanů Pražských I. Staré Město 1438-1490 (ed.Teige)
Spisové císaře Karla IV. (Ed. Emler)
Účet pokladníka arcibiskupství pražského 1382-1383 (Ed. Chaloupecký)
Zbytky register králův Římských a Českých 1361 – 1480 (Ed. Sedláček)
Zlomek urbáře kláštera Hradištského (Ed. Emler) ]
Hussitica
[
Monumenta conciliorum generalium 1
Monumenta conciliorum generalium 2
Concilium Basiliense 1 (Ed. Haller)
Concilium Basiliense 2 (Ed. Haller)
Spisy M. Jana Husi - Expositio decalogi (Ed. Flajšhans)
Spisy M. Jana Husi - De corpore Christi (Ed. Flajšhans)
Spisy M. Jana Husi - De sanguine Christi (Ed. Flajšhans)
Spisy M. Jana Husi - Super IV Sententiarum (Ed. Flajšhans)
Spisy M. Jana Husi - Sermones de sanctis (Ed. Flajšhans)
Documenta Mag. Joannis Hus (Ed. Palacký)
Urkundliche Beitraege des Hussitenkrieges 1 (1419-1428)
Urkundliche Beitraege des Hussitenkrieges 2 (1429-1436)
Manualník Vácslava Korandy (Ed. Truhlář)
Processus iudiciarius contra Jeronimum de Praga 1410-1412 (Ed.Klicman)
Prameny k synodám strany pražské a táborské 1441-1444 (Ed.Nejedlý) ]
Formulářové sbírky
Acta judiciaria
Desky dvorské
Czech medieval sources online
[Kommentar: Großartig!]
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae
Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae
Codex diplomaticus Silesiae
Codex Diplomaticus Lusatiae Superioris
[ CDLS I
CDLS II/1 (1419-1428)
CDLS II/2 (1429-1437)
CDLS III
CDLS IV (1437-1457)
CDLS V Görlitzer Bürgerrechtslisten (1379-1600)
CDLS VI (1458-1463) ]
Codex iuris Bohemici
Reliquiae tabularum terrae
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae
Archiv český čili staré písemné památky české i moravské
Archivum Coronae regni Bohemiae
Fontes rerum Bohemicarum
Monumenta Historica Boemiae
Codex iuris municipalis
Deutsche Reichstagsakten
[ DRTA 10 Sigmund (1431-1433) ed. Herre
DRTA 12 Sigmund (1435-1437) ed. Beckmann
DRTA 13,1 Albrecht II. (1438) ed. Beckmann
DRTA 13,2 Albrecht II. (1438) ed. Beckmann
Siehe auch: http://de.wikisource.org/wiki/Deutsche_Reichstagsakten ]
Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia
Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem
Libri erectionum archidioecesis Pragensis saeculo XIV. et XV
Scriptores rerum Lusaticarum
Listáře a listináře
Městské listáře a listináře
[
Boehmisch-Kamnitzer Stadtbuch
Listiny a zápisy Bělské (ed. Kalousek)
Urkundenbuch Aussig (ed. Horčička)
Urkundenbuch Saaz (Ed.Schlesinger) ]
Kroniky
Varia
[
Das Wappenrecht (Ed. Hauptmann)
Decem registra censuum
Ein Bernaregister des Pilsner Kreises vom Jahre 1379 (Ed. Emler)
Hilaria Litoměřického traktát k Janovi z Rozenberka (Ed.Tobolka)
Inquisitio domorum hosp. S. Joh. Hierosolimitani 1373 (Ed. Novotný)
Jana z Lobkovic Naučení synu Jaroslavovi
Kniha Drnovská (Ed.Brandl)
Liber decanorum fac. phil. ab anno 1367, usque ad annum 1585 p. Prima
Matricula facultatis juridicae
Několik statutů a nařízení arcibiskupů pražských 1355-1377 (Ed.Menčík)
Purkrabské účty panství Novohradského z let 1390-1391 (Ed. Šusta)
Registra decimarum papalium
Seznamy měšťanů Pražských I. Staré Město 1438-1490 (ed.Teige)
Spisové císaře Karla IV. (Ed. Emler)
Účet pokladníka arcibiskupství pražského 1382-1383 (Ed. Chaloupecký)
Zbytky register králův Římských a Českých 1361 – 1480 (Ed. Sedláček)
Zlomek urbáře kláštera Hradištského (Ed. Emler) ]
Hussitica
[
Monumenta conciliorum generalium 1
Monumenta conciliorum generalium 2
Concilium Basiliense 1 (Ed. Haller)
Concilium Basiliense 2 (Ed. Haller)
Spisy M. Jana Husi - Expositio decalogi (Ed. Flajšhans)
Spisy M. Jana Husi - De corpore Christi (Ed. Flajšhans)
Spisy M. Jana Husi - De sanguine Christi (Ed. Flajšhans)
Spisy M. Jana Husi - Super IV Sententiarum (Ed. Flajšhans)
Spisy M. Jana Husi - Sermones de sanctis (Ed. Flajšhans)
Documenta Mag. Joannis Hus (Ed. Palacký)
Urkundliche Beitraege des Hussitenkrieges 1 (1419-1428)
Urkundliche Beitraege des Hussitenkrieges 2 (1429-1436)
Manualník Vácslava Korandy (Ed. Truhlář)
Processus iudiciarius contra Jeronimum de Praga 1410-1412 (Ed.Klicman)
Prameny k synodám strany pražské a táborské 1441-1444 (Ed.Nejedlý) ]
Formulářové sbírky
Acta judiciaria
Desky dvorské
KlausGraf - am Sonntag, 31. Mai 2009, 14:07 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.wissenschaftskultur.de/portal-geschichte/schriften/
Es stehen digitalisiert zur Verfügung:
Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig 1850-1926
Annalen der Naturphilosophie 1901-1921
Schriften der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis zu Dresden 1846-1939
Es stehen digitalisiert zur Verfügung:
Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig 1850-1926
Annalen der Naturphilosophie 1901-1921
Schriften der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis zu Dresden 1846-1939
KlausGraf - am Sonntag, 31. Mai 2009, 13:58 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.qucosa.de/ ist ein neues oder jedenfalls noch nicht sehr bekanntes Open-Access-Repositorium.
Die Suche in Google erbringt eine sehr überschaubare Trefferliste:
http://www.google.com/search?rlz=1C1CHMB_deDE291DE303&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=qucosa
Qucosa dient der Publikation, dem Nachweis und der langfristigen Archivierung von Dokumenten aus Wissenschaft und Wirtschaft. Das von den wissenschaftlichen Bibliotheken im Freistaat Sachsen getragene Angebot ist Teil der internationalen Open-Access-Bewegung.
Folgende Dokumentarten werden in elektronischer Form entgegen genommen:
Dissertationen und Habilitationen
Abschlussarbeiten wie Diplom-, Magister-, Masterarbeiten
Forschungsberichte
Proceedings
Preprints
Zeitschriftenartikel
sonstige Veröffentlichungen
Der Dokumenten- und Publikationsserver bietet den Autoren die weltweite Verfügbarkeit der Volltexte und eine langfristige Archivierung ihrer Publikationen.
Die Zitierfähigkeit ist durch eine dauerhafte, stabile WWW - Adresse (persistent identifier urn:nbn) garantiert.
Die elektronischen Dokumente werden mit Hilfe von strukturierten Metadaten bibliographisch beschrieben und über nationale und internationale Bibliothekskataloge, Suchmaschinen und andere Nachweisinstrumente erschlossen.
Zur Suche in Qucosa steht das Recherchemodul zur Verfügung.
Als registrierter Datenprovider der Open Archive Initiative (OAI) bietet dieser Server die Möglichkeit der Recherche und Erschließung der Metadaten durch Anbieter in aller Welt.
Qucosa beschränkt sich nicht auf Erstveröffentlichungen. Die meisten Verlage (u.a. Blackwell, Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley) gestatten ihren Autoren inzwischen paralleles Open Access-Publizieren auf Hochschulservern. Gemäß den Empfehlungen des Wissenschaftsrats können Autoren unter Einhaltung der Urheberechte die von ihnen verfassten Dokumente auch zusätzlich - eventuell nach einer Sperrfrist - auf dem Dokumentenserver veröffentlichen.
Die Einhaltung von Urheber- und Verwertungsrechten Dritter liegt in der Verantwortung der Autorinnen und Autoren bzw. der Herausgeber der elektronischen Dokumente.
Die Publikationen auf Qucosa sind ohne zeitliche Beschränkung verfügbar und für die langfristige Archivierung vorgesehen.
Das Ganze macht einen sehr unprofessionellen Eindruck, hat aber das Qualitätssiegel eines DINI-Zertifikats. Kritikpunkte sind:
* Es wird nicht deutlich, WER deponieren darf.
Auf http://www.sachsendigital.de/elektronisch-publizieren/ liest man:
Für wissenschaftliche Publikationen über Sachsen, insbesondere auch für Tagungsbeiträge und kleinere Forschungsarbeiten, besteht die Möglichkeit der zeitnahen Veröffentlichung auf elektronischem Wege.
Das von den wissenschaftlichen Bibliotheken im Freistaat Sachsen getragene Angebot des Dokumenten- und Publikationsservers Qucosa (Quality Content of Saxony) dient der kostenfreien Publikation, dem Nachweis und der langfristigen Archivierung von Dokumenten aus Wissenschaft und Wirtschaft.
Auf http://wwwcms.hs-zigr.de/HSB/de/index.html liest man:
Es gilt für Angehörige der sächsischen Hochschulen, die ihre Arbeiten einem breiten Publikum als Teil der internationalen Open-Access-Bewegung anbieten wollen.
Zusätzlich verlinkt
http://www.qucosa.de/otherinformation.php
noch den Kommunalen Arbeitgeberverband Sachsen, auf dessen Homepage mit der Suche nach Qucosa selbstverständlich keinerlei Informationen gefunden werden. Es bleibt offen, ob sächsische Kommunalbedienste, soweit diese wissenschaftliche Publikationen erstellen, Qucosa nützen können, auch wenn sich ihr Beitrag nicht auf Sachsen bezieht. Ebenso offen bleibt, ob Autoren außerhalb Sachsens, die über Sachsen publizieren, deponieren dürfen.
Gerade bei disziplinären Repositorien ist es das A und O, dass man transparent erfährt, welche Beiträge von welcher Personengruppe angenommen werden:
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories
Saardok ermöglicht den Vorschlag von (eigenen) Dokumenten, die sich auf das Saarland beziehen:
http://www.sulb.uni-saarland.de/welt/saardok/mail_formular.php
Ansonsten fällt mir aus dem deutschsprachigen Bereich nur noch ein:
http://www.ooegeschichte.at/Richtlinien_zur_Veroeffentlichung.441.0.html
* Es ist ja wohl ein Witz, dass Qucosa keinerlei Browsing erlaubt. Wer in Sachgebieten blättern will, muss die OAI-Schnittstelle bemühen:
http://search3.driver.research-infrastructures.eu/webInterface/showRepository.do?action=load&name=Qucosa
* Wenn man eine OAI-Schnittstelle hat, sollte man diese auch verlinken:
http://hsss.slub-dresden.de/oai/OAI-2.0
* Open Access heisst nicht nur gratis Open Access, das sollten endlich auch mal deutsche Repositorien-Manager merken. Es sollte mindestens die Möglichkeit vorgesehen werden, Beiträge unter eine CC- oder andere freie Lizenz zu stellen. Indem martialisch das bestehende Urheberrecht zugrundegelegt wird, schadet man der Open-Access-Bewegung nur.
* Besonders dumm ist es, jedes Dokument mit dem Titel "Einstieg zum Volltext" zu versehen. Selbst Freidok hat inzwischen begriffen, dass diese Art und Weise, seine Inhalte vor Suchmaschinen zu verstecken, kontraproduktiv ist (bei Suchmaschinen ist der Dokumenttitel ein wichtiges Kriterium).
Die Suche in Google erbringt eine sehr überschaubare Trefferliste:
http://www.google.com/search?rlz=1C1CHMB_deDE291DE303&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=qucosa
Qucosa dient der Publikation, dem Nachweis und der langfristigen Archivierung von Dokumenten aus Wissenschaft und Wirtschaft. Das von den wissenschaftlichen Bibliotheken im Freistaat Sachsen getragene Angebot ist Teil der internationalen Open-Access-Bewegung.
Folgende Dokumentarten werden in elektronischer Form entgegen genommen:
Dissertationen und Habilitationen
Abschlussarbeiten wie Diplom-, Magister-, Masterarbeiten
Forschungsberichte
Proceedings
Preprints
Zeitschriftenartikel
sonstige Veröffentlichungen
Der Dokumenten- und Publikationsserver bietet den Autoren die weltweite Verfügbarkeit der Volltexte und eine langfristige Archivierung ihrer Publikationen.
Die Zitierfähigkeit ist durch eine dauerhafte, stabile WWW - Adresse (persistent identifier urn:nbn) garantiert.
Die elektronischen Dokumente werden mit Hilfe von strukturierten Metadaten bibliographisch beschrieben und über nationale und internationale Bibliothekskataloge, Suchmaschinen und andere Nachweisinstrumente erschlossen.
Zur Suche in Qucosa steht das Recherchemodul zur Verfügung.
Als registrierter Datenprovider der Open Archive Initiative (OAI) bietet dieser Server die Möglichkeit der Recherche und Erschließung der Metadaten durch Anbieter in aller Welt.
Qucosa beschränkt sich nicht auf Erstveröffentlichungen. Die meisten Verlage (u.a. Blackwell, Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley) gestatten ihren Autoren inzwischen paralleles Open Access-Publizieren auf Hochschulservern. Gemäß den Empfehlungen des Wissenschaftsrats können Autoren unter Einhaltung der Urheberechte die von ihnen verfassten Dokumente auch zusätzlich - eventuell nach einer Sperrfrist - auf dem Dokumentenserver veröffentlichen.
Die Einhaltung von Urheber- und Verwertungsrechten Dritter liegt in der Verantwortung der Autorinnen und Autoren bzw. der Herausgeber der elektronischen Dokumente.
Die Publikationen auf Qucosa sind ohne zeitliche Beschränkung verfügbar und für die langfristige Archivierung vorgesehen.
Das Ganze macht einen sehr unprofessionellen Eindruck, hat aber das Qualitätssiegel eines DINI-Zertifikats. Kritikpunkte sind:
* Es wird nicht deutlich, WER deponieren darf.
Auf http://www.sachsendigital.de/elektronisch-publizieren/ liest man:
Für wissenschaftliche Publikationen über Sachsen, insbesondere auch für Tagungsbeiträge und kleinere Forschungsarbeiten, besteht die Möglichkeit der zeitnahen Veröffentlichung auf elektronischem Wege.
Das von den wissenschaftlichen Bibliotheken im Freistaat Sachsen getragene Angebot des Dokumenten- und Publikationsservers Qucosa (Quality Content of Saxony) dient der kostenfreien Publikation, dem Nachweis und der langfristigen Archivierung von Dokumenten aus Wissenschaft und Wirtschaft.
Auf http://wwwcms.hs-zigr.de/HSB/de/index.html liest man:
Es gilt für Angehörige der sächsischen Hochschulen, die ihre Arbeiten einem breiten Publikum als Teil der internationalen Open-Access-Bewegung anbieten wollen.
Zusätzlich verlinkt
http://www.qucosa.de/otherinformation.php
noch den Kommunalen Arbeitgeberverband Sachsen, auf dessen Homepage mit der Suche nach Qucosa selbstverständlich keinerlei Informationen gefunden werden. Es bleibt offen, ob sächsische Kommunalbedienste, soweit diese wissenschaftliche Publikationen erstellen, Qucosa nützen können, auch wenn sich ihr Beitrag nicht auf Sachsen bezieht. Ebenso offen bleibt, ob Autoren außerhalb Sachsens, die über Sachsen publizieren, deponieren dürfen.
Gerade bei disziplinären Repositorien ist es das A und O, dass man transparent erfährt, welche Beiträge von welcher Personengruppe angenommen werden:
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories
Saardok ermöglicht den Vorschlag von (eigenen) Dokumenten, die sich auf das Saarland beziehen:
http://www.sulb.uni-saarland.de/welt/saardok/mail_formular.php
Ansonsten fällt mir aus dem deutschsprachigen Bereich nur noch ein:
http://www.ooegeschichte.at/Richtlinien_zur_Veroeffentlichung.441.0.html
* Es ist ja wohl ein Witz, dass Qucosa keinerlei Browsing erlaubt. Wer in Sachgebieten blättern will, muss die OAI-Schnittstelle bemühen:
http://search3.driver.research-infrastructures.eu/webInterface/showRepository.do?action=load&name=Qucosa
* Wenn man eine OAI-Schnittstelle hat, sollte man diese auch verlinken:
http://hsss.slub-dresden.de/oai/OAI-2.0
* Open Access heisst nicht nur gratis Open Access, das sollten endlich auch mal deutsche Repositorien-Manager merken. Es sollte mindestens die Möglichkeit vorgesehen werden, Beiträge unter eine CC- oder andere freie Lizenz zu stellen. Indem martialisch das bestehende Urheberrecht zugrundegelegt wird, schadet man der Open-Access-Bewegung nur.
* Besonders dumm ist es, jedes Dokument mit dem Titel "Einstieg zum Volltext" zu versehen. Selbst Freidok hat inzwischen begriffen, dass diese Art und Weise, seine Inhalte vor Suchmaschinen zu verstecken, kontraproduktiv ist (bei Suchmaschinen ist der Dokumenttitel ein wichtiges Kriterium).
KlausGraf - am Sonntag, 31. Mai 2009, 13:11 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.zugang-zum-wissen.de/journal/index.php?/archives/75-Fragen-an-das-Europaeische-Parlament-zu-Open-Access-fuer-Bildung-und-Wissenschaft.html (Version mit Links)
Fragen an das Europäische Parlament zu "Open Access" für Bildung und Wissenschaft
Warum Bildung und Wissenschaft Open Access zu Forschungsergebnissen benötigen
Wissenschaftler werden direkt oder indirekt über staatliche Finanzierung bezahlt. Sie arbeiten in öffentlich geförderten Einrichtungen und Universitäten. Der Austausch ihrer Ergebnisse geschieht im Allgemeinen in Form referierter (von Fachkollegen begutachteter) Zeitschriftenaufsätze. Diese Form des Austausches ist eine absolute Notwendigkeit, um in der Forschung Fortschritte zu erzielen.
Diese Forscher sind Autoren, zu deren staatlich finanziertem Berufsauftrag das Publizieren gehört, im Gegensatz zu Honorar-Autoren, die gegen Vergütung oder auf Tantiemen-Basis schreiben. Wissenschaftler und ihre Institution wollen, dass ihre Ergebnisse unmittelbar zugänglich sind, damit weltweit jeder Nutzer sie lesen, benutzen, anwenden und darauf aufbauen kann, ohne finanzielle oder andere Zugangsbarrieren.
Es gibt eine globale Entwicklung zur Schaffung von "Open Access" (OA) für die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung (siehe den angehängten einführenden Text zu OA), eine Entwicklung, die rasch zunehmend Anerkennung und weltweite Unterstützung findet, bei Wissenschaftlern, ihren Forschungseinrichtungen und deren Geldgebern, wie auch in der Öffentlichkeit, die als Steuerzahler die Forschung finanziert.
Aber es gibt auch immer noch zahlreiche Missverständnisse, was Open Access bedeutet, selbst unter ihren Verfechtern. Und es gibt Opposition gegen Open Access - hauptsächlich von großen, kommerziellen Verlagen. Open Access lässt sich realisieren, indem eine digitale Kopie der zur Veröffentlichung angenommenen Endfassung des Manuskripts aller referierten Zeitschriftenaufsätze auf der Instituts-Website des Autors unmittelbar nach Annahme zur Veröffentlichung durch eine Zeitschrift hinterlegt wird.
Fragen, die Journalisten stellen und Kandidaten beantworten sollten
Wir haben einige sehr gezielte Fragen an die Kandidaten für das EU-Parlament formuliert; Antworten von Kandidaten werden wir anschließend in der Wissenschafts-Community verbreiten. Der Zweck dieser Fragen ist, zu eruieren und deutlich zu machen, welche Hürden gegenwärtig auf EU-Ebene zu überwinden sind, um Gesetzgebung und Politik zu einer stabilen und verlässlichen Unterstützung für Forschungsinformation im digitalen Zeitalter mittels Open Access zu bewegen (während es weiterhin ganz in der Hand der Forscher bleiben soll, was und wo sie veröffentlichen wollen).
1. Wie wollen Sie mit Forschern kommunizieren, um ihre Anforderungen hinsichtlich der Gesetzgebung zu erfahren und zu verstehen? Ist Ihnen bewußt, dass weltweit Forschungsorganisationen einmütig Open Access fordern, in Deutschland z. B. die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die Max-Planck-Gesellschaft (MPG), die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG), die Helmholtz-Gemeinschaft (HG), der Wissenschaftsrat (WR), die Hochschulrektorenkonferenz (HRK), genau wie die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen sowie das Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft ; in Großbritannien der Wellcome Trust, desgleichen auch in anderen EU-Ländern?
2. Sind Ihnen die Empfehlungen der Europäischen Gemeinschaft zugunsten von verpflichtendem OA bekannt, und kennen Sie die Petition für garantierten öffentlichen Zugang zu aus öffentlichen Mitteln geförderten Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung, die bis heute von 27.000 europäischen Wissenschaftlern und Forschungsorganisationen unterzeichnet wurde? Vgl. auch den von dem Journalisten Richard Poynder verfassten Artikel Open Access: The War in Europe.
3. Ist Ihnen die internationale Geltung der Empfehlungen von Wissenschaftsorganisationen zum Thema Open Access [UNESCO, SPARC, ...] bekannt? Und werden Sie mit den Trägern dieser Empfehlungen Kontakt aufnehmen?
4. Ist Ihnen bekannt, dass führende Universitäten der Welt eine Verpflichtung eingegangen sind, Open Access für das gesamte Aufkommen an referierten wissenschaftlichen Zeitschriftenaufsätzen ihrer Wissenschaftler sicherzustellen: Harvard, MIT, Universitäten Southampton (UK), Minho (PT) usf. (vgl. die Liste der OA-Verpflichtungserklärungen von Institutionen bei ROARMAP), und dass die meisten Universitäten und Forschungsinstitute inzwischen ein Open-Access-Repositorium für die digitalen Kopien der wissenschaftlichen Arbeiten ihrer Autoren eingerichtet haben?
5. Ist Ihnen bekannt, dass es eine besondere europäische Community gibt, nämlich die Wissenschaftler, für die noch keine spezifische Gesetzgebung existiert, die den notwendigen Anforderungen entspricht, um Forschung effizient betreiben zu können? Im Gegenteil, die derzeitige Gesetzgebung missbraucht das Copyright (und in Deutschland das Urheberrecht), um diese besondere Gruppe von Autoren, die ihre wissenschaftlichen Arbeiten als Teil ihrer Berufsaufgabe erstellen, in ein Rechtssystem zu zwängen, das ausschließlich für Honorar-Autoren entworfen wurde (die ihren Lebensunterhalt bestreiten, indem sie für den allgemeinen Verbraucher veröffentlichen). Das Ergebnis ist, dass die mit öffentlichen Mitteln geförderte Forschung ihres vollen potentiellen Nutzungsumfangs und ihres Impacts beraubt wird. Das Ergebnis sind Barrieren aufgrund von Subskriptionsgebühren und Lizenzverträgen, die den Zugriff der Forscher auf Forschung blockieren, die zur freien Weitergabe und Verbreitung bestimmt sein sollte.
Werden Sie dabei helfen, die Aufmerksamkeit auf eine dringend notwendige Gesetzgebung zu lenken, die öffentlich geförderte, zur freien Weitergabe und Verbreitung bestimmte Forschungspublikationen anders behandelt als auf Vergütung und Tantiemen gerichtete gewerbliche Publikationen?
Die Frage ist: Ist die EU bereit, die bereichsspezifische Gesetzgebung zu schaffen, die die wissenschaftliche Forschung benötigt, oder wird sie fortfahren, die Bedürfnisse und die Werke aus öffentlichen Mitteln finanzierter Wissenschaftler so zu behandeln, als wären sie die gleichen wie gewerblich tätiger Autoren?
Hier für Sie noch einige Hintergrundinformationen zum Thema Open Access
WAS IST OPEN ACCESS?
Freier Online-Zugriff.
OPEN ACCESS WORAUF?
Auf die ca. 2,5 Millionen Artikel, die jährlich in referierten wissenschaftlichen Zeitschriften aller Disziplinen (und Sprachen) publiziert werden, geschrieben, um rezipiert zu werden, für Gebrauch und Impact, nicht gegen Honorar oder Tantiemen. Der Inhalt, auf den dies abzielt, sind von Fachkollegen begutachtete Zeitschriftenartikel, unmittelbar nach ihrer Annahme zur Veröffentlichung.
OPEN ACCESS: WIE?
Durch Hinterlegung (durch die Wissenschaftler) der begutachteten Endfassung des Autoren-Manuskripts (des "Postprints") in ihrem institutionellen Repositorium, unmittelbar nach der Annahme zur Veröffentlichung.
Die Hinterlegung des Postprints sollte verpflichtend gemacht werden, ebenso wie dies inzwischen 80 Organisationen der Forschungsförderung und Institutionen weltweit verlangen (darunter die Université de Liège, Harvard, Stanford und MIT), sowie alle Forschungsförderungsgremien Großbritanniens, und das NIH in den Vereinigten Staaten.
OPEN ACCESS: WARUM?
Der Zweck von verpflichtendem OA ist, dass Rezeption, Nutzung und Impact der Forschungsergebnisse dramatisch verstärkt werden und damit zur Erhöhung der Produktivität der Forschung, ihrer Fortschritte, Anwendungen und ihres technologischen, medizinischen und kulturellen Nutzens für die steuerzahlende Gesellschaft, die ja die Forschung finanziert, beitragen sollen.
OPEN ACCESS: WO?
Forschungsergebnisse sollten in dem institutionellen Repositorium (IR) der Institution, an der der Wissenschaftler arbeitet, oder in einem zentralen, fachbezogenen Repositorium (FR) hinterlegt werden.
OPEN ACCESS: WANN?
Alle einschlägigen Studien demonstrieren: je früher und breiter auf Forschungsergebnisse zugegriffen werden kann, umso größer sind Rezeption und Impact. Daher sollte die Hinterlegung der von Fachkollegen begutachteten Endfassung des Manuskripts unmittelbar nach der Annahme zur Veröffentlichung verlangt werden.
IST OPEN ACCESS DAS GLEICHE WIE "OPEN ACCESS PUBLIZIEREN"?
Nein, und die Vermischung beider Begriffe ist einer der häufigsten Irrtümer hinsichtlich OA. Es gibt zwei Wege für Wissenschaftler, um OA für ihre Forschung zu schaffen:
Der "Grüne Weg zu OA" ist der, den wir beschrieben haben: in einer der 25.000 referierten wissenschaftlichen Zeitschriften zu publizieren, die es weltweit für alle wissenschaftlichen Disziplinen und Sprachen gibt, und zugleich die begutachtete Endfassung des Manuskripts selbst zu archivieren, unmittelbar nach der Annahme zur Veröffentlichung.
Der "Goldene Weg zu OA" bedeutet in einer OA-Zeitschrift zu publizieren, d.h. einer Zeitschrift, die alle Aufsätze online frei zugänglich macht. Die große Mehrheit der 25.000 Zeitschriften billigt und unterstützt die "Grüne" OA-Selbstarchivierung, aber nur eine kleine Minderheit von Ihnen sind Gold OA. Im Übrigen erheben die Top Gold OA-Zeitschriften Publikationsgebühren (anstelle, oder zusätzlich zu Subskriptionsgebühren).
Daher liegt der Goldene OA nicht in den Händen der Wissenschaftler, im Gegensatz zum Grünen OA; der goldene Weg liegt in der Hand der Verlage. Außerdem kostet der Goldene OA für die führenden Gold OA-Zeitschriften Geld, welches von den bereits knappen Forschungsmitteln abgezweigt werden muß; Grüner OA kostet nichts. Und, als letztes: Grüner OA (da ganz in der Hand der Wissenschafts-Community) kann von den Institutionen und Geldgebern der Forscher verpflichtend gemacht werden, während das für Goldenen OA nicht möglich ist (weil er in der Hand der Verlage liegt und weil die Wissenschaftler in ihrer Entscheidung frei bleiben müssen, welche Zeitschrift für ihre Arbeit optimal ist).
WIRD „GRÜNES“ VERPFLICHTENDES OA DAS PUBLIZIEREN WISSENSCHAFTLICHER ZEITSCHRIFTEN ZUGRUNDE RICHTEN?
Nein, verpflichtende OA-Verpflichtungen von Forschungsinstitutionen und Förderorganisationen, die fordern, dass all ihre referierten Zeitschriftenartikel online frei zugänglich gemacht werden (Grüner OA), werden wissenschaftliche Zeitschriften nicht zerstören. Falls und wenn universeller Grüner OA Institutionen dazu bringt, ihre Zeitschriftenabos zu kündigen und damit Subskriptionen als Mittel zur Deckung der Publikationskosten von Zeitschriften nicht mehr tragfähig sind, werden Zeitschriften zum Publikationsmodell des Goldenen OA übergehen und die Publikationskosten werden von den Institutionen oder Förderorganisationen in Form einer Gebühr für jeden publizierten Artikel gedeckt werden.
Einführung in Open Access
Das World Wide Web gibt den Wissenschaftlern die Mittel an die Hand, ihre Forschungsergebnisse frei zugänglich zu machen, für jeden und überall. Wissenschaftler verkaufen ihre Veröffentlichungen nicht, sie geben sie umsonst her, und da 90% der weltweiten Forschung aus öffentlichen Mitteln gefördert wird, sollten die Ergebnisse dieser Forschung öffentlich sein. Dies nennt man Open Access.
Warum ist Open Access so wichtig? Weil, im Fall von Zeitschriftenartikeln, nur die reichsten Institutionen in der Lage sind, sich einen leidlichen Anteil aller publizierten wissenschaftlichen Zeitschriften zu leisten; daher war es für die meisten Wissenschaftler nicht immer einfach, von solchen Aufsätzen Kenntnis zu erhalten und auf sie zuzugreifen. Aufsätze werden nicht von all denen wahrgenommen, für die sie relevant sind, und daher werden wissenschaftliche Ergebnisse nicht so verwertet wie sie könnten. Open Access ändert dies alles. Der Terminus "Open Access" wurde zuerst 2002 durch die "Budapest Open Access Initiative klar definiert. Sie definiert Open Access so:
"’Open Access’ meint, dass die wissenschaftliche Literatur kostenfrei und öffentlich im Internet zugänglich sein sollte, so dass Interessierte die Volltexte lesen, herunterladen, kopieren, verteilen, drucken, in ihnen suchen, auf sie verweisen, sie indexieren, als Daten an Software übergeben und sie auch sonst auf jede denkbare legale Weise benutzen können, ohne finanzielle, gesetzliche oder technische Barrieren abgesehen von denen, die mit dem Internet-Zugang selbst verbunden sind."
Die Open-Access-Forschungsliteratur besteht aus freien Online-Kopien referierter Zeitschriftenartikel und Konferenzberichte, ebenso technischen Berichten, Hochschulschriften und Arbeitspapieren, in manchen Fällen auch Buchkapiteln oder selbst ganzen Monographien. In den meisten Fällen gibt es keine Lizenzbeschränkungen für ihre Nutzung durch die Leser. Sie können daher frei für Forschung und Lehre und andere Zwecke benutzt werden. Manchmal bestehen Missverständnisse, was Open Access bedeutet. Es ist weder Publizieren im Selbstverlag, noch ein Weg, um die Begutachtung durch Fachkollegen (Peer review) und formelles Publizieren zu umgehen, noch ist es eine Art von zweitklassiger, Trivial-Publikation. Es ist einfach das Mittel der Wahl, um Forschungsergebnisse online für die gesamte Wissenschaftler-Community zugänglich zu machen.
Wie Open Access bereitgestellt wird
Open Access kann hauptsächlich auf zwei Wegen bereitgestellt werden. Erstens kann ein Wissenschaftler eine Kopie von jedem Artikel in ein Open-Access-Repositorium einstellen. Dies ist auch als Open Access Selbst-Archivieren bekannt. Zweitens, kann er oder sie Aufsätze in Open-Access-Zeitschriften veröffentlichen. Dies wird Open Access Publizieren genannt.
Open Access Selbst-Archivieren
Open-Access-Repositorien sind digitale Sammlungen von wissenschaftlichen Aufsätzen, die dort von ihren Autoren eingebracht wurden. Im Falle von Zeitschriftenartikeln kann dies entweder vor der Begutachtung ("Preprint") oder danach ("Postprint") geschehen. Der Postprint ist die Endfassung des Autoren-Manuskripts, nachdem die im Begutachtungsprozess verlangten Änderungen gemacht worden sind. Diese Fassung gehört noch dem Forscher, bis der Verlag sie annimmt und für eine Zeitschrift formatiert. Selbstarchivieren von Preprints ist in einigen Disziplinen üblich, in den meisten Disziplinen jedoch nicht.
Diese Open-Access-Repositorien enthalten Metadaten zu jedem Aufsatz (Titel, Verfasserangabe und andere bibliographische Details), und zwar in einem Format, das dem sog. Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) genügt. Mit anderen Worten, sämtliche Open-Access-Repositorien arbeiten in einer standardisierten Weise, wodurch ihre Inhalte leicht indexierbar werden. Um auf die Inhalte dieser Archive zuzugreifen, können sie Google, Google Scholar oder andere Web-Suchmaschinen benutzen. Diese Suchmaschinen grasen die Inhalte der Archive weltweit und systematisch ab, die so eine gemeinsame Datenbank der aktuellen globalen Forschung bilden.
Open-Access-Repositorien
Die meisten Open-Access-Repositorien sind multidisziplinär angelegt und sind in Universitäten oder anderen Forschungseinrichtungen zu finden. Es gibt insgesamt derzeit um die 1.300 Repositorien, und diese Zahl ist über die letzten drei Jahre im Schnitt um 1 pro Tag angewachsen. Es gibt auch einige zentrale, fachbezogene Repositorien wie z.B. das ArXiv, das bestimmte Gebiete der Physik und verwandter Disziplinen abdeckt. Eine Liste von Open-Access-Archiven wird von der EPrints Website an der Universität Southampton geführt. Auch ausführliche Information, wie ein Repositorium aufgesetzt werden kann, sind auf dieser Website zu finden. Eine andere Liste von Repositorien wird von dem SHERPA Projekt an der Universität Nottingham gepflegt.
Copyright
Die gegenwärtige Politik der einzelnen Verlage in Bezug auf das Selbstarchivieren und das Copyright kann im Detail der SHERPA Projekt-Website an der Universität Nottingham entnommen werden (deutschsprachige Schnittstelle auf den Seiten der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation e.V. (DINI): "Was gestatten Verlage bei der Selbstarchivierung im Open Access?"). Die Reform des Urheberrechts in Deutschland aus der Perspektive der Wissenschaft wird vom Aktionsbündnis inmitten einer heftig tobenden Debatte vorangetrieben: "EU-Parlament stimmt gegen Internetsperren bei Urheberrechtsverletzungen", und Lawrence Lessig: "Das alte Copyright muss weg."
Open Access Publizieren
Open-Access-Zeitschriften sind referierte Zeitschriften, auf deren Artikel online durch jedermann kostenlos zugegriffen werden kann. Einige erheben eine Publikationsgebühr für Artikel ("Article processing charges", oder APCs), womit sie das sonst übliche Modell, bei dem Bibliotheken für Abonnements auf Zeitschriften bezahlen, umkehren. Die Mehrheit der Open-Access-Zeitschriften erhebt allerdings keine solchen Gebühren und schafft es, die Publikation über Sponsoring, Zuschüsse, Anzeigenerlöse etc. zu finanzieren. APCs werden z.T. durch die Autoren bezahlt, in den meisten Fällen aber aus Forschungsbeihilfen oder institutionellen Fonds oder dem Instituts-Etat.
Eine umfassende Liste von Open-Access-Zeitschriften aus allen Fachgebieten wird von der Universität Lund gepflegt. Zum Zeitpunkt dieser Niederschrift enthielt die Liste ca. 4.000 Zeitschriften. Viele dieser Open-Access-Zeitschriften haben Impact-Faktoren und werden vom Institute for Scientific Information (ISI) für das Web of Science indexiert.
Warum Institutionen Open Access unterstützen sollten
Es wird Zeit für Universitäten und Forschungseinrichtungen, die neuen Technologien in die wissenschaftliche Kommunikation zu integrieren und die Papier-Ära und all die Publikationsregeln und -gewohnheiten, die mit ihr assoziiert waren, zu vergessen. Open Access erlaubt Wissen zu teilen und gemeinsam zu nutzen, beschleunigt den Fortschritt der Wissenschaft und ermöglicht den Entwicklungsländern Zugriff auf Forschungsinformation.
Für Forschungseinrichtungen selbst gibt es noch andere Gründe, warum sie Open Access unterstützen sollten. Empirisch lässt sich belegen, dass Artikel, die selbstarchiviert wurden, häufiger zitiert werden als solche, die nicht Open Access zugänglich sind. Eine Bibliographie von Studien zu Impact und Zitierhäufigkeit wird durch das "Open Citation Project" gepflegt. Universitäten und Forschungseinrichtungen profitieren von dem kumulativen Effekt des erhöhten Impacts (der erhöhten Sichtbarkeit und Wirksamkeit) ihrer Autoren. Darüber hinaus sind Open-Access-Repositorien von hohem Nutzen für akademische und Forschungseinrichtungen und die Forschungsförderorganisationen, um Steuerungs- und Managementinformationen und Berichte über ihre Forschungsprogramme zu generieren und so eine bessere Evaluierung, Überwachung und ein besseres Management der Forschung zu ermöglichen.
Verpflichtende Richtlinien, Forschungsergebnisse in Forschungsrepositorien abzulegen
Es gibt weltweit bereits 80 solcher Richtlinien: Die Hälfte kommt aus Institutionen, die andere von den Fördereinrichtungen (vgl. ROARMAP). Europa hat in dieser Hinsicht durchaus eine Vorreiterposition. Nicht nur hat eine Reihe von nationalen Organisationen der Forschungsförderung bereits verpflichtende Richtlinien verabschiedet und implementiert, auch die durch den neuen Europäischen Forschungsrat geförderten Arbeiten und 20% der im 7. Forschungsrahmenprogramm der EU unterstützten Forschungsvorhaben stehen ebenfalls unter einer solchen Verpflichtung. Das Europäische Parlament könnte dazu beitragen, dass 100% Open Access für die Ergebnisse der europäischen Forschung erreicht wird.
Warum das Europäische Parlament Open Access fördern sollte.
Das Europäische Parlament sollte Open Access für alle von der Europäischen Kommission geförderten Forschungsprogramme und für die Forschungsergebnisse aller von der EU geförderten Universitäten und Forschungseinrichtungen verpflichtend machen. Das Ziel ist es, die Rezeption, Nutzung und den Impact (Sichtbarkeit und Wirkung) der Forschung in der EU zu maximieren und dadurch Fortschritt, Produktivität, Anwendungen und Nutzen der Forschung für die EU-Steuerzahler und die Welt zu steigern.
26. Mai 2009, Euroscience Workgroup on Science Publishing
Autorisierte Übersetzung des englischen Originals durch Bernd-Christoph Kämper 29.5.2009 ( CC-BY )
Update 11.06.2009 bck: Hinweis auf die deutschsprachige Schnittstelle zur SHERPA Projekt-Website auf den DINI-Seiten ergänzt ("Was gestatten Verlage bei der Selbstarchivierung im Open Access?")
Fragen an das Europäische Parlament zu "Open Access" für Bildung und Wissenschaft
Warum Bildung und Wissenschaft Open Access zu Forschungsergebnissen benötigen
Wissenschaftler werden direkt oder indirekt über staatliche Finanzierung bezahlt. Sie arbeiten in öffentlich geförderten Einrichtungen und Universitäten. Der Austausch ihrer Ergebnisse geschieht im Allgemeinen in Form referierter (von Fachkollegen begutachteter) Zeitschriftenaufsätze. Diese Form des Austausches ist eine absolute Notwendigkeit, um in der Forschung Fortschritte zu erzielen.
Diese Forscher sind Autoren, zu deren staatlich finanziertem Berufsauftrag das Publizieren gehört, im Gegensatz zu Honorar-Autoren, die gegen Vergütung oder auf Tantiemen-Basis schreiben. Wissenschaftler und ihre Institution wollen, dass ihre Ergebnisse unmittelbar zugänglich sind, damit weltweit jeder Nutzer sie lesen, benutzen, anwenden und darauf aufbauen kann, ohne finanzielle oder andere Zugangsbarrieren.
Es gibt eine globale Entwicklung zur Schaffung von "Open Access" (OA) für die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung (siehe den angehängten einführenden Text zu OA), eine Entwicklung, die rasch zunehmend Anerkennung und weltweite Unterstützung findet, bei Wissenschaftlern, ihren Forschungseinrichtungen und deren Geldgebern, wie auch in der Öffentlichkeit, die als Steuerzahler die Forschung finanziert.
Aber es gibt auch immer noch zahlreiche Missverständnisse, was Open Access bedeutet, selbst unter ihren Verfechtern. Und es gibt Opposition gegen Open Access - hauptsächlich von großen, kommerziellen Verlagen. Open Access lässt sich realisieren, indem eine digitale Kopie der zur Veröffentlichung angenommenen Endfassung des Manuskripts aller referierten Zeitschriftenaufsätze auf der Instituts-Website des Autors unmittelbar nach Annahme zur Veröffentlichung durch eine Zeitschrift hinterlegt wird.
Fragen, die Journalisten stellen und Kandidaten beantworten sollten
Wir haben einige sehr gezielte Fragen an die Kandidaten für das EU-Parlament formuliert; Antworten von Kandidaten werden wir anschließend in der Wissenschafts-Community verbreiten. Der Zweck dieser Fragen ist, zu eruieren und deutlich zu machen, welche Hürden gegenwärtig auf EU-Ebene zu überwinden sind, um Gesetzgebung und Politik zu einer stabilen und verlässlichen Unterstützung für Forschungsinformation im digitalen Zeitalter mittels Open Access zu bewegen (während es weiterhin ganz in der Hand der Forscher bleiben soll, was und wo sie veröffentlichen wollen).
1. Wie wollen Sie mit Forschern kommunizieren, um ihre Anforderungen hinsichtlich der Gesetzgebung zu erfahren und zu verstehen? Ist Ihnen bewußt, dass weltweit Forschungsorganisationen einmütig Open Access fordern, in Deutschland z. B. die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die Max-Planck-Gesellschaft (MPG), die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG), die Helmholtz-Gemeinschaft (HG), der Wissenschaftsrat (WR), die Hochschulrektorenkonferenz (HRK), genau wie die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen sowie das Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft ; in Großbritannien der Wellcome Trust, desgleichen auch in anderen EU-Ländern?
2. Sind Ihnen die Empfehlungen der Europäischen Gemeinschaft zugunsten von verpflichtendem OA bekannt, und kennen Sie die Petition für garantierten öffentlichen Zugang zu aus öffentlichen Mitteln geförderten Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung, die bis heute von 27.000 europäischen Wissenschaftlern und Forschungsorganisationen unterzeichnet wurde? Vgl. auch den von dem Journalisten Richard Poynder verfassten Artikel Open Access: The War in Europe.
3. Ist Ihnen die internationale Geltung der Empfehlungen von Wissenschaftsorganisationen zum Thema Open Access [UNESCO, SPARC, ...] bekannt? Und werden Sie mit den Trägern dieser Empfehlungen Kontakt aufnehmen?
4. Ist Ihnen bekannt, dass führende Universitäten der Welt eine Verpflichtung eingegangen sind, Open Access für das gesamte Aufkommen an referierten wissenschaftlichen Zeitschriftenaufsätzen ihrer Wissenschaftler sicherzustellen: Harvard, MIT, Universitäten Southampton (UK), Minho (PT) usf. (vgl. die Liste der OA-Verpflichtungserklärungen von Institutionen bei ROARMAP), und dass die meisten Universitäten und Forschungsinstitute inzwischen ein Open-Access-Repositorium für die digitalen Kopien der wissenschaftlichen Arbeiten ihrer Autoren eingerichtet haben?
5. Ist Ihnen bekannt, dass es eine besondere europäische Community gibt, nämlich die Wissenschaftler, für die noch keine spezifische Gesetzgebung existiert, die den notwendigen Anforderungen entspricht, um Forschung effizient betreiben zu können? Im Gegenteil, die derzeitige Gesetzgebung missbraucht das Copyright (und in Deutschland das Urheberrecht), um diese besondere Gruppe von Autoren, die ihre wissenschaftlichen Arbeiten als Teil ihrer Berufsaufgabe erstellen, in ein Rechtssystem zu zwängen, das ausschließlich für Honorar-Autoren entworfen wurde (die ihren Lebensunterhalt bestreiten, indem sie für den allgemeinen Verbraucher veröffentlichen). Das Ergebnis ist, dass die mit öffentlichen Mitteln geförderte Forschung ihres vollen potentiellen Nutzungsumfangs und ihres Impacts beraubt wird. Das Ergebnis sind Barrieren aufgrund von Subskriptionsgebühren und Lizenzverträgen, die den Zugriff der Forscher auf Forschung blockieren, die zur freien Weitergabe und Verbreitung bestimmt sein sollte.
Werden Sie dabei helfen, die Aufmerksamkeit auf eine dringend notwendige Gesetzgebung zu lenken, die öffentlich geförderte, zur freien Weitergabe und Verbreitung bestimmte Forschungspublikationen anders behandelt als auf Vergütung und Tantiemen gerichtete gewerbliche Publikationen?
Die Frage ist: Ist die EU bereit, die bereichsspezifische Gesetzgebung zu schaffen, die die wissenschaftliche Forschung benötigt, oder wird sie fortfahren, die Bedürfnisse und die Werke aus öffentlichen Mitteln finanzierter Wissenschaftler so zu behandeln, als wären sie die gleichen wie gewerblich tätiger Autoren?
Hier für Sie noch einige Hintergrundinformationen zum Thema Open Access
WAS IST OPEN ACCESS?
Freier Online-Zugriff.
OPEN ACCESS WORAUF?
Auf die ca. 2,5 Millionen Artikel, die jährlich in referierten wissenschaftlichen Zeitschriften aller Disziplinen (und Sprachen) publiziert werden, geschrieben, um rezipiert zu werden, für Gebrauch und Impact, nicht gegen Honorar oder Tantiemen. Der Inhalt, auf den dies abzielt, sind von Fachkollegen begutachtete Zeitschriftenartikel, unmittelbar nach ihrer Annahme zur Veröffentlichung.
OPEN ACCESS: WIE?
Durch Hinterlegung (durch die Wissenschaftler) der begutachteten Endfassung des Autoren-Manuskripts (des "Postprints") in ihrem institutionellen Repositorium, unmittelbar nach der Annahme zur Veröffentlichung.
Die Hinterlegung des Postprints sollte verpflichtend gemacht werden, ebenso wie dies inzwischen 80 Organisationen der Forschungsförderung und Institutionen weltweit verlangen (darunter die Université de Liège, Harvard, Stanford und MIT), sowie alle Forschungsförderungsgremien Großbritanniens, und das NIH in den Vereinigten Staaten.
OPEN ACCESS: WARUM?
Der Zweck von verpflichtendem OA ist, dass Rezeption, Nutzung und Impact der Forschungsergebnisse dramatisch verstärkt werden und damit zur Erhöhung der Produktivität der Forschung, ihrer Fortschritte, Anwendungen und ihres technologischen, medizinischen und kulturellen Nutzens für die steuerzahlende Gesellschaft, die ja die Forschung finanziert, beitragen sollen.
OPEN ACCESS: WO?
Forschungsergebnisse sollten in dem institutionellen Repositorium (IR) der Institution, an der der Wissenschaftler arbeitet, oder in einem zentralen, fachbezogenen Repositorium (FR) hinterlegt werden.
OPEN ACCESS: WANN?
Alle einschlägigen Studien demonstrieren: je früher und breiter auf Forschungsergebnisse zugegriffen werden kann, umso größer sind Rezeption und Impact. Daher sollte die Hinterlegung der von Fachkollegen begutachteten Endfassung des Manuskripts unmittelbar nach der Annahme zur Veröffentlichung verlangt werden.
IST OPEN ACCESS DAS GLEICHE WIE "OPEN ACCESS PUBLIZIEREN"?
Nein, und die Vermischung beider Begriffe ist einer der häufigsten Irrtümer hinsichtlich OA. Es gibt zwei Wege für Wissenschaftler, um OA für ihre Forschung zu schaffen:
Der "Grüne Weg zu OA" ist der, den wir beschrieben haben: in einer der 25.000 referierten wissenschaftlichen Zeitschriften zu publizieren, die es weltweit für alle wissenschaftlichen Disziplinen und Sprachen gibt, und zugleich die begutachtete Endfassung des Manuskripts selbst zu archivieren, unmittelbar nach der Annahme zur Veröffentlichung.
Der "Goldene Weg zu OA" bedeutet in einer OA-Zeitschrift zu publizieren, d.h. einer Zeitschrift, die alle Aufsätze online frei zugänglich macht. Die große Mehrheit der 25.000 Zeitschriften billigt und unterstützt die "Grüne" OA-Selbstarchivierung, aber nur eine kleine Minderheit von Ihnen sind Gold OA. Im Übrigen erheben die Top Gold OA-Zeitschriften Publikationsgebühren (anstelle, oder zusätzlich zu Subskriptionsgebühren).
Daher liegt der Goldene OA nicht in den Händen der Wissenschaftler, im Gegensatz zum Grünen OA; der goldene Weg liegt in der Hand der Verlage. Außerdem kostet der Goldene OA für die führenden Gold OA-Zeitschriften Geld, welches von den bereits knappen Forschungsmitteln abgezweigt werden muß; Grüner OA kostet nichts. Und, als letztes: Grüner OA (da ganz in der Hand der Wissenschafts-Community) kann von den Institutionen und Geldgebern der Forscher verpflichtend gemacht werden, während das für Goldenen OA nicht möglich ist (weil er in der Hand der Verlage liegt und weil die Wissenschaftler in ihrer Entscheidung frei bleiben müssen, welche Zeitschrift für ihre Arbeit optimal ist).
WIRD „GRÜNES“ VERPFLICHTENDES OA DAS PUBLIZIEREN WISSENSCHAFTLICHER ZEITSCHRIFTEN ZUGRUNDE RICHTEN?
Nein, verpflichtende OA-Verpflichtungen von Forschungsinstitutionen und Förderorganisationen, die fordern, dass all ihre referierten Zeitschriftenartikel online frei zugänglich gemacht werden (Grüner OA), werden wissenschaftliche Zeitschriften nicht zerstören. Falls und wenn universeller Grüner OA Institutionen dazu bringt, ihre Zeitschriftenabos zu kündigen und damit Subskriptionen als Mittel zur Deckung der Publikationskosten von Zeitschriften nicht mehr tragfähig sind, werden Zeitschriften zum Publikationsmodell des Goldenen OA übergehen und die Publikationskosten werden von den Institutionen oder Förderorganisationen in Form einer Gebühr für jeden publizierten Artikel gedeckt werden.
Einführung in Open Access
Das World Wide Web gibt den Wissenschaftlern die Mittel an die Hand, ihre Forschungsergebnisse frei zugänglich zu machen, für jeden und überall. Wissenschaftler verkaufen ihre Veröffentlichungen nicht, sie geben sie umsonst her, und da 90% der weltweiten Forschung aus öffentlichen Mitteln gefördert wird, sollten die Ergebnisse dieser Forschung öffentlich sein. Dies nennt man Open Access.
Warum ist Open Access so wichtig? Weil, im Fall von Zeitschriftenartikeln, nur die reichsten Institutionen in der Lage sind, sich einen leidlichen Anteil aller publizierten wissenschaftlichen Zeitschriften zu leisten; daher war es für die meisten Wissenschaftler nicht immer einfach, von solchen Aufsätzen Kenntnis zu erhalten und auf sie zuzugreifen. Aufsätze werden nicht von all denen wahrgenommen, für die sie relevant sind, und daher werden wissenschaftliche Ergebnisse nicht so verwertet wie sie könnten. Open Access ändert dies alles. Der Terminus "Open Access" wurde zuerst 2002 durch die "Budapest Open Access Initiative klar definiert. Sie definiert Open Access so:
"’Open Access’ meint, dass die wissenschaftliche Literatur kostenfrei und öffentlich im Internet zugänglich sein sollte, so dass Interessierte die Volltexte lesen, herunterladen, kopieren, verteilen, drucken, in ihnen suchen, auf sie verweisen, sie indexieren, als Daten an Software übergeben und sie auch sonst auf jede denkbare legale Weise benutzen können, ohne finanzielle, gesetzliche oder technische Barrieren abgesehen von denen, die mit dem Internet-Zugang selbst verbunden sind."
Die Open-Access-Forschungsliteratur besteht aus freien Online-Kopien referierter Zeitschriftenartikel und Konferenzberichte, ebenso technischen Berichten, Hochschulschriften und Arbeitspapieren, in manchen Fällen auch Buchkapiteln oder selbst ganzen Monographien. In den meisten Fällen gibt es keine Lizenzbeschränkungen für ihre Nutzung durch die Leser. Sie können daher frei für Forschung und Lehre und andere Zwecke benutzt werden. Manchmal bestehen Missverständnisse, was Open Access bedeutet. Es ist weder Publizieren im Selbstverlag, noch ein Weg, um die Begutachtung durch Fachkollegen (Peer review) und formelles Publizieren zu umgehen, noch ist es eine Art von zweitklassiger, Trivial-Publikation. Es ist einfach das Mittel der Wahl, um Forschungsergebnisse online für die gesamte Wissenschaftler-Community zugänglich zu machen.
Wie Open Access bereitgestellt wird
Open Access kann hauptsächlich auf zwei Wegen bereitgestellt werden. Erstens kann ein Wissenschaftler eine Kopie von jedem Artikel in ein Open-Access-Repositorium einstellen. Dies ist auch als Open Access Selbst-Archivieren bekannt. Zweitens, kann er oder sie Aufsätze in Open-Access-Zeitschriften veröffentlichen. Dies wird Open Access Publizieren genannt.
Open Access Selbst-Archivieren
Open-Access-Repositorien sind digitale Sammlungen von wissenschaftlichen Aufsätzen, die dort von ihren Autoren eingebracht wurden. Im Falle von Zeitschriftenartikeln kann dies entweder vor der Begutachtung ("Preprint") oder danach ("Postprint") geschehen. Der Postprint ist die Endfassung des Autoren-Manuskripts, nachdem die im Begutachtungsprozess verlangten Änderungen gemacht worden sind. Diese Fassung gehört noch dem Forscher, bis der Verlag sie annimmt und für eine Zeitschrift formatiert. Selbstarchivieren von Preprints ist in einigen Disziplinen üblich, in den meisten Disziplinen jedoch nicht.
Diese Open-Access-Repositorien enthalten Metadaten zu jedem Aufsatz (Titel, Verfasserangabe und andere bibliographische Details), und zwar in einem Format, das dem sog. Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) genügt. Mit anderen Worten, sämtliche Open-Access-Repositorien arbeiten in einer standardisierten Weise, wodurch ihre Inhalte leicht indexierbar werden. Um auf die Inhalte dieser Archive zuzugreifen, können sie Google, Google Scholar oder andere Web-Suchmaschinen benutzen. Diese Suchmaschinen grasen die Inhalte der Archive weltweit und systematisch ab, die so eine gemeinsame Datenbank der aktuellen globalen Forschung bilden.
Open-Access-Repositorien
Die meisten Open-Access-Repositorien sind multidisziplinär angelegt und sind in Universitäten oder anderen Forschungseinrichtungen zu finden. Es gibt insgesamt derzeit um die 1.300 Repositorien, und diese Zahl ist über die letzten drei Jahre im Schnitt um 1 pro Tag angewachsen. Es gibt auch einige zentrale, fachbezogene Repositorien wie z.B. das ArXiv, das bestimmte Gebiete der Physik und verwandter Disziplinen abdeckt. Eine Liste von Open-Access-Archiven wird von der EPrints Website an der Universität Southampton geführt. Auch ausführliche Information, wie ein Repositorium aufgesetzt werden kann, sind auf dieser Website zu finden. Eine andere Liste von Repositorien wird von dem SHERPA Projekt an der Universität Nottingham gepflegt.
Copyright
Die gegenwärtige Politik der einzelnen Verlage in Bezug auf das Selbstarchivieren und das Copyright kann im Detail der SHERPA Projekt-Website an der Universität Nottingham entnommen werden (deutschsprachige Schnittstelle auf den Seiten der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation e.V. (DINI): "Was gestatten Verlage bei der Selbstarchivierung im Open Access?"). Die Reform des Urheberrechts in Deutschland aus der Perspektive der Wissenschaft wird vom Aktionsbündnis inmitten einer heftig tobenden Debatte vorangetrieben: "EU-Parlament stimmt gegen Internetsperren bei Urheberrechtsverletzungen", und Lawrence Lessig: "Das alte Copyright muss weg."
Open Access Publizieren
Open-Access-Zeitschriften sind referierte Zeitschriften, auf deren Artikel online durch jedermann kostenlos zugegriffen werden kann. Einige erheben eine Publikationsgebühr für Artikel ("Article processing charges", oder APCs), womit sie das sonst übliche Modell, bei dem Bibliotheken für Abonnements auf Zeitschriften bezahlen, umkehren. Die Mehrheit der Open-Access-Zeitschriften erhebt allerdings keine solchen Gebühren und schafft es, die Publikation über Sponsoring, Zuschüsse, Anzeigenerlöse etc. zu finanzieren. APCs werden z.T. durch die Autoren bezahlt, in den meisten Fällen aber aus Forschungsbeihilfen oder institutionellen Fonds oder dem Instituts-Etat.
Eine umfassende Liste von Open-Access-Zeitschriften aus allen Fachgebieten wird von der Universität Lund gepflegt. Zum Zeitpunkt dieser Niederschrift enthielt die Liste ca. 4.000 Zeitschriften. Viele dieser Open-Access-Zeitschriften haben Impact-Faktoren und werden vom Institute for Scientific Information (ISI) für das Web of Science indexiert.
Warum Institutionen Open Access unterstützen sollten
Es wird Zeit für Universitäten und Forschungseinrichtungen, die neuen Technologien in die wissenschaftliche Kommunikation zu integrieren und die Papier-Ära und all die Publikationsregeln und -gewohnheiten, die mit ihr assoziiert waren, zu vergessen. Open Access erlaubt Wissen zu teilen und gemeinsam zu nutzen, beschleunigt den Fortschritt der Wissenschaft und ermöglicht den Entwicklungsländern Zugriff auf Forschungsinformation.
Für Forschungseinrichtungen selbst gibt es noch andere Gründe, warum sie Open Access unterstützen sollten. Empirisch lässt sich belegen, dass Artikel, die selbstarchiviert wurden, häufiger zitiert werden als solche, die nicht Open Access zugänglich sind. Eine Bibliographie von Studien zu Impact und Zitierhäufigkeit wird durch das "Open Citation Project" gepflegt. Universitäten und Forschungseinrichtungen profitieren von dem kumulativen Effekt des erhöhten Impacts (der erhöhten Sichtbarkeit und Wirksamkeit) ihrer Autoren. Darüber hinaus sind Open-Access-Repositorien von hohem Nutzen für akademische und Forschungseinrichtungen und die Forschungsförderorganisationen, um Steuerungs- und Managementinformationen und Berichte über ihre Forschungsprogramme zu generieren und so eine bessere Evaluierung, Überwachung und ein besseres Management der Forschung zu ermöglichen.
Verpflichtende Richtlinien, Forschungsergebnisse in Forschungsrepositorien abzulegen
Es gibt weltweit bereits 80 solcher Richtlinien: Die Hälfte kommt aus Institutionen, die andere von den Fördereinrichtungen (vgl. ROARMAP). Europa hat in dieser Hinsicht durchaus eine Vorreiterposition. Nicht nur hat eine Reihe von nationalen Organisationen der Forschungsförderung bereits verpflichtende Richtlinien verabschiedet und implementiert, auch die durch den neuen Europäischen Forschungsrat geförderten Arbeiten und 20% der im 7. Forschungsrahmenprogramm der EU unterstützten Forschungsvorhaben stehen ebenfalls unter einer solchen Verpflichtung. Das Europäische Parlament könnte dazu beitragen, dass 100% Open Access für die Ergebnisse der europäischen Forschung erreicht wird.
Warum das Europäische Parlament Open Access fördern sollte.
Das Europäische Parlament sollte Open Access für alle von der Europäischen Kommission geförderten Forschungsprogramme und für die Forschungsergebnisse aller von der EU geförderten Universitäten und Forschungseinrichtungen verpflichtend machen. Das Ziel ist es, die Rezeption, Nutzung und den Impact (Sichtbarkeit und Wirkung) der Forschung in der EU zu maximieren und dadurch Fortschritt, Produktivität, Anwendungen und Nutzen der Forschung für die EU-Steuerzahler und die Welt zu steigern.
26. Mai 2009, Euroscience Workgroup on Science Publishing
Autorisierte Übersetzung des englischen Originals durch Bernd-Christoph Kämper 29.5.2009 ( CC-BY )
Update 11.06.2009 bck: Hinweis auf die deutschsprachige Schnittstelle zur SHERPA Projekt-Website auf den DINI-Seiten ergänzt ("Was gestatten Verlage bei der Selbstarchivierung im Open Access?")
KlausGraf - am Sonntag, 31. Mai 2009, 01:24 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 30. Mai 2009, 19:44 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Er saß als Kind auf Kafkas Schoß: der Philosoph Vilém Flusser, geboren 1920 in Prag. 1991 starb er bei einem Autounfall vor den Toren Wiens. Das Verschwinden des Menschen und der Dinge war eines seiner großen Themen. Beim Einsturz des Kölner Stadtarchivs hatte sein Nachlass großes Glück: Man fand ihn nahezu unbeschädigt. Für andere Archivalien und Nachlässe ging der Einsturz des Historischen Archivs nicht so glimpflich aus.
Gisela Fleckenstein, Abteilungsleiterin Nachlässe und Sammlungen des Kölner Stadtarchivs, hat ein Foto von dem Moment, in dem die Archivkartons gefunden wurden. Es war der 21. März 2009, als ganze Archivkartons auftauchten mit der Bestandskennzeichnung, "eindeutig zu identifizieren als der Bestand Flusser". Die Kartons waren nicht beschädigt. "Wir mussten sie nicht umpacken", so Fleckenstein. "Es waren ungefähr 70 Kartons, an denen nichts dran war." ....."
Quelle: 3sat Kulturzeit
Link zum Video (4:02 min):
http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/090529_koeln_kuz.asx
1. Folge (Albertus Magnus): http://archiv.twoday.net/stories/5664325/
Gisela Fleckenstein, Abteilungsleiterin Nachlässe und Sammlungen des Kölner Stadtarchivs, hat ein Foto von dem Moment, in dem die Archivkartons gefunden wurden. Es war der 21. März 2009, als ganze Archivkartons auftauchten mit der Bestandskennzeichnung, "eindeutig zu identifizieren als der Bestand Flusser". Die Kartons waren nicht beschädigt. "Wir mussten sie nicht umpacken", so Fleckenstein. "Es waren ungefähr 70 Kartons, an denen nichts dran war." ....."
Quelle: 3sat Kulturzeit
Link zum Video (4:02 min):
http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/090529_koeln_kuz.asx
1. Folge (Albertus Magnus): http://archiv.twoday.net/stories/5664325/
Wolf Thomas - am Samstag, 30. Mai 2009, 17:19 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 30. Mai 2009, 17:04 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .....Im so genannten Erstversorgungszentrum (EVZ) standen die Paderborner gemeinsam mit Archivaren und Restauratoren aus dem In- und Ausland, letztere zum Teil aus Spanien, Polen und Tschechien, vor den Überbleibseln, die nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs noch immer Tag für Tag von Feuerwehr und THW aus den Trümmern geborgen werden.
.......«Unsere Aufgabe war die Auflistung und Grobreinigung geretteten Archivgutes», berichtet Stadtarchivar Rolf-Dietrich Müller. Dabei gingen den beiden Paderbornern Archivalien unterschiedlichsten Typs und Alters durch die Hände. Wahre Schätze waren dabei: von der Pergamenthandschrift aus dem frühen 14. Jahrhundert über Ratsprotokolle des 17. Jahrhunderts, Standesamtsregister des 19. Jahrhunderts, Trümmerräumungsakten der Jahre nach 1945 bis hin zu Tonbandaufnahmen der Bläck Fööss und Fotografien von Willy Millowitsch.
Manches sei weitgehend unversehrt, vieles aber mit mehr oder minder schweren Schäden geliefert worden, berichtet Kreisarchivar Wilhelm Grabe. Auch ganze Wannen, nur mit kleinen verschmutzten und zerknüllten Papierschnipseln gefüllt, seien dabei gewesen. Arbeit für Restauratoren auf unabsehbare Zeit.
«Es war eine ausgesprochen ungewöhnliche und interessante Berufserfahrung», sind sich Wilhelm Grabe und Rolf-Dietrich Müller einig und froh, sich dieser schweißtreibenden Herausforderung gestellt zu haben. Aus Gründen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes war das Tragen von Schutzanzügen, Atemmasken, Handschuhen und Sicherheitsschuhen Pflicht, gearbeitet wurde im Stehen. «Da war man schon froh, wenn nachmittags der Schichtwechsel anstand und man sich ein Stündchen auf´s Ohr legen konnte», so Grabe."
Quelle:
http://www.sennefenster.de/app/page.php?modul=Article&op=read&nid=2386&rub=35&sort=0
.......«Unsere Aufgabe war die Auflistung und Grobreinigung geretteten Archivgutes», berichtet Stadtarchivar Rolf-Dietrich Müller. Dabei gingen den beiden Paderbornern Archivalien unterschiedlichsten Typs und Alters durch die Hände. Wahre Schätze waren dabei: von der Pergamenthandschrift aus dem frühen 14. Jahrhundert über Ratsprotokolle des 17. Jahrhunderts, Standesamtsregister des 19. Jahrhunderts, Trümmerräumungsakten der Jahre nach 1945 bis hin zu Tonbandaufnahmen der Bläck Fööss und Fotografien von Willy Millowitsch.
Manches sei weitgehend unversehrt, vieles aber mit mehr oder minder schweren Schäden geliefert worden, berichtet Kreisarchivar Wilhelm Grabe. Auch ganze Wannen, nur mit kleinen verschmutzten und zerknüllten Papierschnipseln gefüllt, seien dabei gewesen. Arbeit für Restauratoren auf unabsehbare Zeit.
«Es war eine ausgesprochen ungewöhnliche und interessante Berufserfahrung», sind sich Wilhelm Grabe und Rolf-Dietrich Müller einig und froh, sich dieser schweißtreibenden Herausforderung gestellt zu haben. Aus Gründen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes war das Tragen von Schutzanzügen, Atemmasken, Handschuhen und Sicherheitsschuhen Pflicht, gearbeitet wurde im Stehen. «Da war man schon froh, wenn nachmittags der Schichtwechsel anstand und man sich ein Stündchen auf´s Ohr legen konnte», so Grabe."
Quelle:
http://www.sennefenster.de/app/page.php?modul=Article&op=read&nid=2386&rub=35&sort=0
Wolf Thomas - am Samstag, 30. Mai 2009, 17:03 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
“Travis Holland writes exquisitely. The Archivist’s Story is that very rare book, a historical novel that makes us forget ‘historical’ and remember only ‘novel’, even as we take in hard historical fact— the archivist Pavel living in the midst of Stalin’s purges, could be any of us, and Holland conveys his world in indelible images. The beauty and reality of this novel linger long after one has read—reluctantly—the last page.”
Elizabeth Kostova, author of The Historian
Link
http://www.readinggroupguides.com/guides_A/the_archivists_story1.asp
Elizabeth Kostova, author of The Historian
Link
http://www.readinggroupguides.com/guides_A/the_archivists_story1.asp
Wolf Thomas - am Samstag, 30. Mai 2009, 17:02 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nach einer IDC Studie vom März 2007 überschritt die Menge der weltweit produzierten Daten erstmals bereits im Jahr 2007 die Kapazität der weltweit verfügbaren digitalen Speicher. Diese Schere wird sich weiter öffnen, denn im Jahr 2010 erwartet IDC einen Zuwachs auf 988 Exabytes – 2006 waren es noch 161 Exabytes. Maßgeblichen Anteil daran haben der immer weiter fortschreitende Einsatz digitaler Bildaufnahmegeräte – Digitalkameras, digitale Camcorder, digitale Röntgenaufnahmegeräte, usw. - anstelle analoger Systeme sowie die ständig wachsende Internetgemeinschaft mit geschätzten 1,6 Milliarden online Anschlüssen im Jahr 2010. Die Herstellung von Kopien wird extrem erleichtert, ebenso ihre Verbreitung weltweit.
Dazu passt auch die Aussage IDC´s, dass der Anteil der von einer Person erzeugten digitalen Daten geringer ist als der Anteil der über diese Person hergestellten Daten, z.B. Aufzeichnungen von Überwachungskameras etc.. Aus Sicherheitsgründen geforderte redundante Datenhaltung in der IT Industrie stellen eine weitere Quelle des Datenzuwachses dar. Zusätzliche Forderungen des Gesetzgebers Daten revisionssicher zu archivieren – Stichwort Compliance - steigern den Bedarf an entsprechenden Speichermedien. Davon betroffen sind etwa 20% aller Daten.
Um diesen Forderungen gerecht zu werden muss sich das IT-Management um bessere Nutzung der Kapazitäten (Stichwort De-Duplizierung), neue Regeln für die Erzeugung, Speicherung Verteilung und Sicherheit der Daten sowie um neue Hilfsmittel zur Erzielung flexibler, anpassbarer und erweiterbarer Speichertechniken kümmern. Aber auch die Speicherhersteller sind gefordert, den Bedarf an höherer Kapazität, schnelleren Zugriffszeiten und niedrigerem Energieverbrauch zu stillen.
Weiterlesen:
http://www.documanager.de/magazin/artikel_2092_digital_archivierung_datenspeicher.html
Dazu passt auch die Aussage IDC´s, dass der Anteil der von einer Person erzeugten digitalen Daten geringer ist als der Anteil der über diese Person hergestellten Daten, z.B. Aufzeichnungen von Überwachungskameras etc.. Aus Sicherheitsgründen geforderte redundante Datenhaltung in der IT Industrie stellen eine weitere Quelle des Datenzuwachses dar. Zusätzliche Forderungen des Gesetzgebers Daten revisionssicher zu archivieren – Stichwort Compliance - steigern den Bedarf an entsprechenden Speichermedien. Davon betroffen sind etwa 20% aller Daten.
Um diesen Forderungen gerecht zu werden muss sich das IT-Management um bessere Nutzung der Kapazitäten (Stichwort De-Duplizierung), neue Regeln für die Erzeugung, Speicherung Verteilung und Sicherheit der Daten sowie um neue Hilfsmittel zur Erzielung flexibler, anpassbarer und erweiterbarer Speichertechniken kümmern. Aber auch die Speicherhersteller sind gefordert, den Bedarf an höherer Kapazität, schnelleren Zugriffszeiten und niedrigerem Energieverbrauch zu stillen.
Weiterlesen:
http://www.documanager.de/magazin/artikel_2092_digital_archivierung_datenspeicher.html
KlausGraf - am Samstag, 30. Mai 2009, 16:56 - Rubrik: Digitale Unterlagen
KlausGraf - am Samstag, 30. Mai 2009, 03:34 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 30. Mai 2009, 02:07 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Dem Konservativen ist unwohl in einer Welt, in der nicht alles am Platz bleibt. Er hat schon die Stadt und den Asphalt gehasst, um wie viel mehr nun das Netz und die Blogs!
Gero von Randwo repliziert auf Adam Soboczynski
http://www.zeit.de/2009/23/Internet-Freiheit?page=2
Weiteres Zitat:
Im frühen 20. Jahrhundert ging es, wie die Literaturwissenschaftlerin Anke-Marie Lohmeier nachgewiesen hat, gegen die »Boulevardtheater, Revuen, Panoptiken, Tanzpaläste, Sportveranstaltungen, Naherholungszentren, Freizeitparks«. Der damaligen Geisteselite war es zuwider, »dass in ihnen die geschmähte ›Masse Mensch‹ erstmals als Öffentlichkeit und öffentlicher Faktor sichtbar hervortrat, dass sie öffentlichen Raum besetzte und zumal jenen Teil des öffentlichen Raumes, für den sich die Intellektuellen seit jeher exklusiv zuständig fühlten: den der Kultur«.
Sehr lesenswert ist der Beitrag Lohmeiers, der sich auch als Beschreibung der Genealogie der Argumentationen Soboczynskis lesen lässt:
http://iasl.uni-muenchen.de/discuss/lisforen/lohmeier.htm
 Foto: Pavel Krok CC-BY-SA
Foto: Pavel Krok CC-BY-SA
Gero von Randwo repliziert auf Adam Soboczynski
http://www.zeit.de/2009/23/Internet-Freiheit?page=2
Weiteres Zitat:
Im frühen 20. Jahrhundert ging es, wie die Literaturwissenschaftlerin Anke-Marie Lohmeier nachgewiesen hat, gegen die »Boulevardtheater, Revuen, Panoptiken, Tanzpaläste, Sportveranstaltungen, Naherholungszentren, Freizeitparks«. Der damaligen Geisteselite war es zuwider, »dass in ihnen die geschmähte ›Masse Mensch‹ erstmals als Öffentlichkeit und öffentlicher Faktor sichtbar hervortrat, dass sie öffentlichen Raum besetzte und zumal jenen Teil des öffentlichen Raumes, für den sich die Intellektuellen seit jeher exklusiv zuständig fühlten: den der Kultur«.
Sehr lesenswert ist der Beitrag Lohmeiers, der sich auch als Beschreibung der Genealogie der Argumentationen Soboczynskis lesen lässt:
http://iasl.uni-muenchen.de/discuss/lisforen/lohmeier.htm
 Foto: Pavel Krok CC-BY-SA
Foto: Pavel Krok CC-BY-SA noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Bundespatentgericht hatte in einer Entscheidung (Volltext PDF, bei Google findet man nur kostenpflichtige Volltext-Dokumente) über die Eintragung der Hooschebaa-Brunnenfigur in Sprendlingen zu entscheiden.
http://tinyurl.com/nkftk9
Zitat aus der Entscheidung:
Darüber hinaus hat die Markenabteilung auch zutreffend ausgeführt, dass die Begründung des (gegenüber dem Urheberrechtsschutz eigenständigen) Markenschutzes nach § 59 UrhG in Rechte Dritter eingreift, und dieser Eingriff auch Ziel der Eintragung war.
Die Markenabteilung des DPM vertrat die Ansicht: Durch die vom Bildhauer Hermann Will erteilte Erlaubnis, die von ihm erstellte urheberrechtlich geschützte Figur für die Brunnengestaltung zu nutzen, habe dieser sein Kunstwerk einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt; danach sei die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Figur mittels Mittel der Malerei oder Grafik, durch Lichtbild oder durch Film gestattet (§ 59 UrhG). Die „Hooschebaa“-Figur sei daher als Teil der alltäglichen Umwelt nicht länger monopolisierbar. Damit stelle sich die markenrechtliche Monopolisierung der Figur durch die Markeninhaberin, die weder als Erbin gem. § 28 UrhG noch als Rechtsnachfolgerin nach § 29 UrhG urheberrechtliche Verwertungsrechte besitze, als Behinderung der rechtlich gestatteten Nutzung durch Dritte dar, worauf sie, wie das Schreiben der Markeninhaberin vom 6. April 2006 dokumentiere, abziele. Wegen der damit gegebenen Behinderungsabsicht sei die angegriffene Marke nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zu löschen. Wegen der mit der Begründung des Markenrechts verfolgten rechtlich unzulässigen Ziele habe die Markeninhaberin auch die Verfahrenskosten zu tragen.
Meldet also jemand, der nicht im Besitz urheberrechtlicher Verwertungsrechte ist, eine der Panoramafreiheit unterliegende Skulptur/Gestaltung als Marke an, kann diese unter Umständen gelöscht werden. Wie Panoramafreiheit/Sacheigentum und Markenrecht sich verhalten ist damit aber nicht grundsätzlich geklärt.
Update: http://sewoma.de/berlinblawg/2009/05/30/sevriens/hooschebaa/
Robots.txt der Bundesgerichte:
http://www.jurabilis.de/index.php?/archives/2511-robots.txt-der-Bundesgerichte.html
http://tinyurl.com/nkftk9
Zitat aus der Entscheidung:
Darüber hinaus hat die Markenabteilung auch zutreffend ausgeführt, dass die Begründung des (gegenüber dem Urheberrechtsschutz eigenständigen) Markenschutzes nach § 59 UrhG in Rechte Dritter eingreift, und dieser Eingriff auch Ziel der Eintragung war.
Die Markenabteilung des DPM vertrat die Ansicht: Durch die vom Bildhauer Hermann Will erteilte Erlaubnis, die von ihm erstellte urheberrechtlich geschützte Figur für die Brunnengestaltung zu nutzen, habe dieser sein Kunstwerk einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt; danach sei die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Figur mittels Mittel der Malerei oder Grafik, durch Lichtbild oder durch Film gestattet (§ 59 UrhG). Die „Hooschebaa“-Figur sei daher als Teil der alltäglichen Umwelt nicht länger monopolisierbar. Damit stelle sich die markenrechtliche Monopolisierung der Figur durch die Markeninhaberin, die weder als Erbin gem. § 28 UrhG noch als Rechtsnachfolgerin nach § 29 UrhG urheberrechtliche Verwertungsrechte besitze, als Behinderung der rechtlich gestatteten Nutzung durch Dritte dar, worauf sie, wie das Schreiben der Markeninhaberin vom 6. April 2006 dokumentiere, abziele. Wegen der damit gegebenen Behinderungsabsicht sei die angegriffene Marke nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zu löschen. Wegen der mit der Begründung des Markenrechts verfolgten rechtlich unzulässigen Ziele habe die Markeninhaberin auch die Verfahrenskosten zu tragen.
Meldet also jemand, der nicht im Besitz urheberrechtlicher Verwertungsrechte ist, eine der Panoramafreiheit unterliegende Skulptur/Gestaltung als Marke an, kann diese unter Umständen gelöscht werden. Wie Panoramafreiheit/Sacheigentum und Markenrecht sich verhalten ist damit aber nicht grundsätzlich geklärt.
Update: http://sewoma.de/berlinblawg/2009/05/30/sevriens/hooschebaa/
Robots.txt der Bundesgerichte:
http://www.jurabilis.de/index.php?/archives/2511-robots.txt-der-Bundesgerichte.html
KlausGraf - am Freitag, 29. Mai 2009, 22:34 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Rechtsanwalt Prof. Dr. Stefan Ernst (Freiburg) kritisiert in seiner Anmerkung zu LG Potsdam, Urteile vom 21. November 2008 – 1 O 161/08, 175/08 und 330/08, ZUM 2009, S. 434f. die Rechtsprechung des LG Potsdam zum Fotografieren auf Grundstücken der Schlössertsiftung, siehe dazu:
http://archiv.twoday.net/stories/5431182/
Zitat aus der Anmerkung:
§ 59 UrhG setzt einen öffentlichen Platz voraus. Hat der Eigentümer den Platz der Öffentlichkeit gewidmet, liegt aber schon allein deshalb keine Eigentumsverletzung vor. Dies ist anders als etwa in einem Museum, wo zwar das Betreten der Öffentlichkeit gestattet, der Innenraum ihr aber nicht gewidmet, sondern ihr allein das Betreten zur Besichtigung gestattet ist. Wo § 59 UrhG greift – beim Fotografieren von öffentlichen Orten aus – kann das Eigentumsrecht schon sachlich auch nicht einschlägig sein. Besteht umgekehrt keine Widmung von privatem Grund für die Öffentlichkeit, ist auch § 59 UrhG nicht einschlägig.
Die Widmung der Grundstücke der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten ergibt sich zum einen aus Art. 2 des Staatsvertrages – wiederholt in § 1 Abs. 1 der Stiftungssatzung – und umfasst u. a. die Aufgabe, diese der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dies gilt zugegebenermaßen aber auch für die Gebäude. § 2 Abs. 3 der Stiftungssatzung bestimmt jedoch, dass die Benutzung der Schlossgärten und Parkanlagen anders als die Besichtigung von Gebäuden kostenfrei zu sein hat. Der Park ist der Öffentlichkeit ohne Einschränkung gewidmet und lässt daher eine Unterscheidung zwischen privaten und gewerblichen Fotografien nicht zu.
Die Stiftung mag formell Eigentümer sein, sie ist einem privaten Grundstückseigentümer dennoch nicht gleichgestellt – weshalb die ausführliche Auseinandersetzung mit den BGH-Entscheidungen »Schloss Tegel« und »Friesenhaus« m. E. am Kern vorbeigeht –, denn ihr wurden die Anwesen einschließlich der großzügigen Parks im Rahmen des Stiftungszwecks – und noch dazu kostenfrei – überschrieben. Stünden sie im Staatseigentum, wäre kaum jemand auf die Idee gekommen, hier eine gewerbliche Nutzung zu verbieten. Das Recht eines Eigentümers, mit der Sache nach Belieben zu verfahren und sie auch allein gewerblich zu verwerten, gilt eben nicht ohne weiteres für die öffentliche Hand. Dass die Stiftung das gute Geschäft mit Fotos und Filmen gerne zu ihren Gunsten monopolisieren möchte, mag verständlich sein, widerspricht aber dem Stiftungszweck, dass nur – »preußisch direkt« – zu hoffen ist, dass die Urteile nicht rechtskräftig werden.

Foto: Wolfgang Staudt. http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
http://archiv.twoday.net/stories/5431182/
Zitat aus der Anmerkung:
§ 59 UrhG setzt einen öffentlichen Platz voraus. Hat der Eigentümer den Platz der Öffentlichkeit gewidmet, liegt aber schon allein deshalb keine Eigentumsverletzung vor. Dies ist anders als etwa in einem Museum, wo zwar das Betreten der Öffentlichkeit gestattet, der Innenraum ihr aber nicht gewidmet, sondern ihr allein das Betreten zur Besichtigung gestattet ist. Wo § 59 UrhG greift – beim Fotografieren von öffentlichen Orten aus – kann das Eigentumsrecht schon sachlich auch nicht einschlägig sein. Besteht umgekehrt keine Widmung von privatem Grund für die Öffentlichkeit, ist auch § 59 UrhG nicht einschlägig.
Die Widmung der Grundstücke der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten ergibt sich zum einen aus Art. 2 des Staatsvertrages – wiederholt in § 1 Abs. 1 der Stiftungssatzung – und umfasst u. a. die Aufgabe, diese der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dies gilt zugegebenermaßen aber auch für die Gebäude. § 2 Abs. 3 der Stiftungssatzung bestimmt jedoch, dass die Benutzung der Schlossgärten und Parkanlagen anders als die Besichtigung von Gebäuden kostenfrei zu sein hat. Der Park ist der Öffentlichkeit ohne Einschränkung gewidmet und lässt daher eine Unterscheidung zwischen privaten und gewerblichen Fotografien nicht zu.
Die Stiftung mag formell Eigentümer sein, sie ist einem privaten Grundstückseigentümer dennoch nicht gleichgestellt – weshalb die ausführliche Auseinandersetzung mit den BGH-Entscheidungen »Schloss Tegel« und »Friesenhaus« m. E. am Kern vorbeigeht –, denn ihr wurden die Anwesen einschließlich der großzügigen Parks im Rahmen des Stiftungszwecks – und noch dazu kostenfrei – überschrieben. Stünden sie im Staatseigentum, wäre kaum jemand auf die Idee gekommen, hier eine gewerbliche Nutzung zu verbieten. Das Recht eines Eigentümers, mit der Sache nach Belieben zu verfahren und sie auch allein gewerblich zu verwerten, gilt eben nicht ohne weiteres für die öffentliche Hand. Dass die Stiftung das gute Geschäft mit Fotos und Filmen gerne zu ihren Gunsten monopolisieren möchte, mag verständlich sein, widerspricht aber dem Stiftungszweck, dass nur – »preußisch direkt« – zu hoffen ist, dass die Urteile nicht rechtskräftig werden.

Foto: Wolfgang Staudt. http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
KlausGraf - am Freitag, 29. Mai 2009, 22:15 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
DLF 29.5.2009, 19.15 Uhr
Das Kulturgespräch
mp3:
http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2009/05/29/dlf_20090529_1915_80ba423e.mp3
Erinnerung und Zeitgenossenschaft
Fragen nach dem Kölner Archivunglück
Am 3. März dieses Jahres ist das Kölner Stadtarchiv eingestürzt. Dabei
kamen zwei Menschen ums Leben. Zahlreiche Schätze der Kultur-, Kirchen-
und Verwaltungsgeschichte wurden in Mitleidenschaft gezogen. Im heutigen
Kulturgespräch am Freitagabend übertragen wir eine Diskussion über die
Folgen des Archiv-Unglücks, die am 12. Mai in der Kunststation St. Peter
in Köln stattgefunden hat.
Über das Thema "Erinnerung und Zeitgenossenschaft. Fragen nach dem
Kölner Archiv-Unglück." diskutieren die Schriftstellerin Ulla Hahn, der
Literaturwissenschaftler Michael Wetzel sowie der Leiter des Kolumba
Museums Köln, Stefan Kraus. Die Gesprächsleitung hat Andreas Platthaus,
Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Gesprächsteilnehmer:
Ulla Hahn, Schriftstellerin
Michael Wetzel, Literaturwissenschaftler
Stefan Kraus, Leiter des Kolumba Museums, Köln
Moderation: Andreas Platthaus, Feuilleton-Redakteur bei der F.A.Z.
Das Kulturgespräch
mp3:
http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2009/05/29/dlf_20090529_1915_80ba423e.mp3
Erinnerung und Zeitgenossenschaft
Fragen nach dem Kölner Archivunglück
Am 3. März dieses Jahres ist das Kölner Stadtarchiv eingestürzt. Dabei
kamen zwei Menschen ums Leben. Zahlreiche Schätze der Kultur-, Kirchen-
und Verwaltungsgeschichte wurden in Mitleidenschaft gezogen. Im heutigen
Kulturgespräch am Freitagabend übertragen wir eine Diskussion über die
Folgen des Archiv-Unglücks, die am 12. Mai in der Kunststation St. Peter
in Köln stattgefunden hat.
Über das Thema "Erinnerung und Zeitgenossenschaft. Fragen nach dem
Kölner Archiv-Unglück." diskutieren die Schriftstellerin Ulla Hahn, der
Literaturwissenschaftler Michael Wetzel sowie der Leiter des Kolumba
Museums Köln, Stefan Kraus. Die Gesprächsleitung hat Andreas Platthaus,
Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Gesprächsteilnehmer:
Ulla Hahn, Schriftstellerin
Michael Wetzel, Literaturwissenschaftler
Stefan Kraus, Leiter des Kolumba Museums, Köln
Moderation: Andreas Platthaus, Feuilleton-Redakteur bei der F.A.Z.
KlausGraf - am Freitag, 29. Mai 2009, 22:00 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blog.vergaberecht.cc/2009-04-27/vertragsverletzungsverfahren-fur-brd/
Der 1973 von der Bundesrepublik Deutschland gegründeten Juris-Datenbank werden exklusiv Gesetzesunterlagen und Gerichtsurteile in besonderer Form zur Verfügung gestellt.
Nach zwischenzeitlicher Teilprivatisierung der Juris GmbH hält die Bundesrepublik Deutschland heute noch 50,1 % der Anteile. Im Wege der Privatisierung wurden für die Nutzung der Datenbankdienste durch Bundesbehörden neue Kooperationsvereinbarungen getroffen bzw. bestehende geändert.
Die Europäische Kommission sieht in diesen Kooperationsvereinbarungen eine vergaberechtsrelevante und damit ausschreibungsbedürftige Neubeauftragung.
Die meisten Bundesländer haben im Jahre 2006 Aufträge über Datenbankdienste (vgl. Justizportal NRW) an Juris vergeben.
Die Bundesregierung meint, dass eine Ausschreibung der Aufträge deshalb unterbleiben dürfe, weil es keine, mit der Juris-Datenbkank vergleichbare Dienstleister auf dem Markt gebe.
Hiergegen wendet sich die Kommission. Sie ist der Ansicht, dass die Aufträge über Datenbankdienste nicht ohne vorheriger öffentlicher Bekanntmachung erfolgen dürfe.
Infolgedessen hat die Kommission am 14.04.09 den zweiten Schritt eines Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik eingeleitet.
Absolut nicht überzeugend ist der Aufsatz von Radke, Hilgert, Mardorf: Die Beschaffung von juristischen Datenbanken als Vergabeproblem, in: NVwZ 2008 Heft 10, S. 107 ff.
Bereits am 5. November 2002 geißelte ich in netbib das schamlose Juris-Monopol:
http://log.netbib.de/archives/2002/11/05/freie-rechtsprechung-fr-freie-brger/
Siehe auch Bohne: Die Informationsfreiheit und der Anspruch von Datenbankbetreibern auf Zugang zu Gerichtsentscheidungen, in: NVwZ 2007 Heft 6 S. 656 ff., hier S. 659
Die Gerichtsverwaltungen haben die Entscheidungen sowohl zur Erfüllung ihrer der Öffentlichkeit gegenüber bestehenden Pflicht in eine herausgabefähige Fassung zu bringen, als auch für die Juris-Datenbank zu bearbeiten. Allein die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils für Juris kann kein hinreichendes Kriterium einer Besserstellung bei gleichzeitig geringem Aufwand einer Gleichbehandlung sein. Andere Betreiber von juristischen Datenbanken haben somit einen Anspruch auf gleichzeitige Belieferung mit Entscheidungen.
Der 1973 von der Bundesrepublik Deutschland gegründeten Juris-Datenbank werden exklusiv Gesetzesunterlagen und Gerichtsurteile in besonderer Form zur Verfügung gestellt.
Nach zwischenzeitlicher Teilprivatisierung der Juris GmbH hält die Bundesrepublik Deutschland heute noch 50,1 % der Anteile. Im Wege der Privatisierung wurden für die Nutzung der Datenbankdienste durch Bundesbehörden neue Kooperationsvereinbarungen getroffen bzw. bestehende geändert.
Die Europäische Kommission sieht in diesen Kooperationsvereinbarungen eine vergaberechtsrelevante und damit ausschreibungsbedürftige Neubeauftragung.
Die meisten Bundesländer haben im Jahre 2006 Aufträge über Datenbankdienste (vgl. Justizportal NRW) an Juris vergeben.
Die Bundesregierung meint, dass eine Ausschreibung der Aufträge deshalb unterbleiben dürfe, weil es keine, mit der Juris-Datenbkank vergleichbare Dienstleister auf dem Markt gebe.
Hiergegen wendet sich die Kommission. Sie ist der Ansicht, dass die Aufträge über Datenbankdienste nicht ohne vorheriger öffentlicher Bekanntmachung erfolgen dürfe.
Infolgedessen hat die Kommission am 14.04.09 den zweiten Schritt eines Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik eingeleitet.
Absolut nicht überzeugend ist der Aufsatz von Radke, Hilgert, Mardorf: Die Beschaffung von juristischen Datenbanken als Vergabeproblem, in: NVwZ 2008 Heft 10, S. 107 ff.
Bereits am 5. November 2002 geißelte ich in netbib das schamlose Juris-Monopol:
http://log.netbib.de/archives/2002/11/05/freie-rechtsprechung-fr-freie-brger/
Siehe auch Bohne: Die Informationsfreiheit und der Anspruch von Datenbankbetreibern auf Zugang zu Gerichtsentscheidungen, in: NVwZ 2007 Heft 6 S. 656 ff., hier S. 659
Die Gerichtsverwaltungen haben die Entscheidungen sowohl zur Erfüllung ihrer der Öffentlichkeit gegenüber bestehenden Pflicht in eine herausgabefähige Fassung zu bringen, als auch für die Juris-Datenbank zu bearbeiten. Allein die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils für Juris kann kein hinreichendes Kriterium einer Besserstellung bei gleichzeitig geringem Aufwand einer Gleichbehandlung sein. Andere Betreiber von juristischen Datenbanken haben somit einen Anspruch auf gleichzeitige Belieferung mit Entscheidungen.
KlausGraf - am Freitag, 29. Mai 2009, 21:02 - Rubrik: Archivrecht
http://www.abgeordnetenwatch.de/brigitte_zypries-650-5639--f178223.html#q178223
Zu den Rechtsfragen siehe
http://archiv.twoday.net/stories/5715357/
Suchmaschinen nutzen auch geschützte Werke und vervielfältigen sie intern. Zum Googlecache und der in Deutschland illegalen Wayback-Machine siehe
http://www.jurpc.de/aufsatz/20020029.htm
Zu den Rechtsfragen siehe
http://archiv.twoday.net/stories/5715357/
Suchmaschinen nutzen auch geschützte Werke und vervielfältigen sie intern. Zum Googlecache und der in Deutschland illegalen Wayback-Machine siehe
http://www.jurpc.de/aufsatz/20020029.htm
KlausGraf - am Freitag, 29. Mai 2009, 19:34 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In der Stutttgarter Zeitung vom 26.05.2009 sind drei Leserbriefe abgedruckt, die ich kurz referieren möchte. Sie betreffen die kürzlich eingeführte Jahresgebühr von 30 Euro pro Jahr für die Benutzer der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart.
Ein Senior moniert, dass es eine Zwangs-Jahresgebühr ist, wie man sie im Öffentlichen Personennahverkehr nie erheben würde. Dort gäbe es auch Einzelfahrscheine, warum nicht in einer Bibliothek, wenn man sie nur gelegentlich in Anspruch nähme. Ausserdem habe man nicht einmal eine Ermäßigung für Senioren vorgesehen. Sein Schluss: “Dann eben nicht!”
Ein promovierter Leserbriefschreiber hebt auf die symbolische Bedeutung von Gebühren in einer Gesellschaft ab, die Lippenbekenntnisse zum “lebenslangen Lernen” ablegt. Man könne mit denselben fiskalischen Argumenten, mit denen man jetzt eine Gebühr von Bibliotheksbenutzern erhebe, auch von Wählern und Wählerinnen eine Gebühr zur Kostendeckung der Wahl erheben.
Der dritte, ein Tübinger Honorarprofessor, hebt darauf ab, dass das Land hier mit seiner Wissenschaftsförderung bricht, die in einer mehr als zweihundertjährigen kostenlosen Benutzung einer großen öffentlichen Bibliothek bestünde. Dank milliardenschwerer “Rettungsschirme” für die Wirtschaft müßten wohl noch die letzten Reserven mobilisiert werden. Er weist darauf hin, dass viele Bibliotheksbenutzer mehrere Bibliotheken benutzen müßten und es daher nicht nur bei einer Gebühr bleibe. Für wissenschaftlich Arbeitende würde sich daher der Aufwand summieren. Wer, wie er selbst, unentgeltlich Lehraufträge wahrnehme, werde für sein Engagement noch mit zusätzlichen Gebühren belegt. Und dieselbe Bibliothek, an die die Gebühren zu entrichten seien, müsse man noch unentgeltlich Pflichtexemplare der wissenschaftlichen Veröffentlichungen abliefern…
Man sieht, die Akzeptanz der den beiden baden-württembergischen Landesbibliotheken ist ungeheuer. Genau darum geht es: Wissenschaft - zumal Geisteswissenschaft - hat keine Lobby und die Landesregierung preßt hier einfach noch eine Zusatzeinnahme heraus. Es wird kolportiert, dass der betreffende Mitarbeiter des Landesrechnungshofes eine Gebühr von seiner Öffentlichen Bibliothek kannte und sich fragte, warum die Benutzer der Landesbibliotheken keine bezahlen müßten. - Das mag aber sein, wie es will, bemerkenswert bleibt, dass das eingeführt und nicht gestoppt wurde. Die beiden Landesbibliotheken werden jetzt den Benutzerschwund und unzufriedene Benutzer - diejenigen, die bleiben müssen, weil sie ihre wissenschaftliche Arbeit weiterführen möchten und zähneknirschens zahlen müssen - verkraften müssen. Die Politiker braucht es nicht zu kümmern. Einer der Leserbriefschreiber bemerkt denn auch zutreffend, dass es symptomatisch ist, dass man sich eine solche Maßnahme selbst im Wahljahr geleistet hat.
Jürgen Plieninger
http://log.netbib.de/archives/2009/05/29/die-letzten-reserven-mobilisiert/
Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/
Ein Senior moniert, dass es eine Zwangs-Jahresgebühr ist, wie man sie im Öffentlichen Personennahverkehr nie erheben würde. Dort gäbe es auch Einzelfahrscheine, warum nicht in einer Bibliothek, wenn man sie nur gelegentlich in Anspruch nähme. Ausserdem habe man nicht einmal eine Ermäßigung für Senioren vorgesehen. Sein Schluss: “Dann eben nicht!”
Ein promovierter Leserbriefschreiber hebt auf die symbolische Bedeutung von Gebühren in einer Gesellschaft ab, die Lippenbekenntnisse zum “lebenslangen Lernen” ablegt. Man könne mit denselben fiskalischen Argumenten, mit denen man jetzt eine Gebühr von Bibliotheksbenutzern erhebe, auch von Wählern und Wählerinnen eine Gebühr zur Kostendeckung der Wahl erheben.
Der dritte, ein Tübinger Honorarprofessor, hebt darauf ab, dass das Land hier mit seiner Wissenschaftsförderung bricht, die in einer mehr als zweihundertjährigen kostenlosen Benutzung einer großen öffentlichen Bibliothek bestünde. Dank milliardenschwerer “Rettungsschirme” für die Wirtschaft müßten wohl noch die letzten Reserven mobilisiert werden. Er weist darauf hin, dass viele Bibliotheksbenutzer mehrere Bibliotheken benutzen müßten und es daher nicht nur bei einer Gebühr bleibe. Für wissenschaftlich Arbeitende würde sich daher der Aufwand summieren. Wer, wie er selbst, unentgeltlich Lehraufträge wahrnehme, werde für sein Engagement noch mit zusätzlichen Gebühren belegt. Und dieselbe Bibliothek, an die die Gebühren zu entrichten seien, müsse man noch unentgeltlich Pflichtexemplare der wissenschaftlichen Veröffentlichungen abliefern…
Man sieht, die Akzeptanz der den beiden baden-württembergischen Landesbibliotheken ist ungeheuer. Genau darum geht es: Wissenschaft - zumal Geisteswissenschaft - hat keine Lobby und die Landesregierung preßt hier einfach noch eine Zusatzeinnahme heraus. Es wird kolportiert, dass der betreffende Mitarbeiter des Landesrechnungshofes eine Gebühr von seiner Öffentlichen Bibliothek kannte und sich fragte, warum die Benutzer der Landesbibliotheken keine bezahlen müßten. - Das mag aber sein, wie es will, bemerkenswert bleibt, dass das eingeführt und nicht gestoppt wurde. Die beiden Landesbibliotheken werden jetzt den Benutzerschwund und unzufriedene Benutzer - diejenigen, die bleiben müssen, weil sie ihre wissenschaftliche Arbeit weiterführen möchten und zähneknirschens zahlen müssen - verkraften müssen. Die Politiker braucht es nicht zu kümmern. Einer der Leserbriefschreiber bemerkt denn auch zutreffend, dass es symptomatisch ist, dass man sich eine solche Maßnahme selbst im Wahljahr geleistet hat.
Jürgen Plieninger
http://log.netbib.de/archives/2009/05/29/die-letzten-reserven-mobilisiert/
Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/
KlausGraf - am Freitag, 29. Mai 2009, 13:02 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.dwdl.de/story/21201/liebesalarm__co_wdr_stutzt_webangebot/
http://www.wdr.de/tv/ardrecht/hinweis.phtml?gebiet=01.07
Es lebe die kommerzielle kostenpflichtige Konkurrenz! Man kann nur hoffen, dass es freien Anbietern wie http://openjur.de/ gelingt, die Lücke zu füllen.
Der Rundfunkstaatsvertrag schwächt entschieden die Informationsfreiheit. Was von Gebührengeldern bezahlt wird, muss Open Access bereitstehen.
http://www.wdr.de/tv/ardrecht/hinweis.phtml?gebiet=01.07
Es lebe die kommerzielle kostenpflichtige Konkurrenz! Man kann nur hoffen, dass es freien Anbietern wie http://openjur.de/ gelingt, die Lücke zu füllen.
Der Rundfunkstaatsvertrag schwächt entschieden die Informationsfreiheit. Was von Gebührengeldern bezahlt wird, muss Open Access bereitstehen.
KlausGraf - am Freitag, 29. Mai 2009, 12:51 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Bedeutung des Niedersächsischen Münzkabinetts als
sichtbares und in seiner Art singuläres Symbol welfischen
Selbstverständnisses ist unstrittig. Es ist eine Sammlung, die
für die Landesgeschichte von herausragendem Wert ist.
Aus diesem Grund führt das Land intensive Verhandlungen
mit der Deutschen Bank, damit das Münzkabinett als vollständige
Sammlung in Niedersachsen für Öffentlichkeit und
Forschung erhalten bleibt. Die Kulturstiftung der Länder
wird die Verhandlungen begleiten. Unabhängige Wertgutachten
sind die Grundlage für die Verhandlungen mit dem
Eigentümer."
Aus: Weiße Mappe der Niedersächsischen Landesregierung, S. 19
http://www.niedersaechsischer-heimatbund.de/dokumente/dateien/WeisseMappe2009.pdf
sichtbares und in seiner Art singuläres Symbol welfischen
Selbstverständnisses ist unstrittig. Es ist eine Sammlung, die
für die Landesgeschichte von herausragendem Wert ist.
Aus diesem Grund führt das Land intensive Verhandlungen
mit der Deutschen Bank, damit das Münzkabinett als vollständige
Sammlung in Niedersachsen für Öffentlichkeit und
Forschung erhalten bleibt. Die Kulturstiftung der Länder
wird die Verhandlungen begleiten. Unabhängige Wertgutachten
sind die Grundlage für die Verhandlungen mit dem
Eigentümer."
Aus: Weiße Mappe der Niedersächsischen Landesregierung, S. 19
http://www.niedersaechsischer-heimatbund.de/dokumente/dateien/WeisseMappe2009.pdf
Eligius - am Freitag, 29. Mai 2009, 08:19 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Ende letzten Jahres bekannt gewordenen Pläne der
Deutschen Bank, Teile des „Niedersächsischen Münzkabinetts
der Deutschen Bank“ zu verkaufen, haben uns wie
weite Kreise der Fachöffentlichkeit zutiefst erschreckt.
Bei der rund 40.000 Stück umfassenden Sammlung handelt
es sich um eine der bedeutendsten Münzkollektionen
Europas, die nicht zu Unrecht als nationales Kulturgut eingestuft
ist. Sie gelangte 1983 in den Besitz der Deutschen
Bank. Damals griff erfreulicherweise der Bankier Hermann
J. Abs zu, als der Verkauf der Sammlung durch das
Welfenhaus erfolgte. Für diese Rettungsaktion, die zum
Verbleib des gesamten Bestandes unter dem Dach der
Deutschen Bank Hannover führte, ist Hermann J. Abs noch
heute zu danken!
Nun droht, nachdem die Deutsche Bank und das Land Niedersachsen
25 Jahre lang hohe Summen in die wissenschaftliche
Erschließung und öffentliche Präsentation investiert
haben, zum zweiten Mal nicht nur der Verlust für
Hannover und Niedersachsen, sondern auch die dann sicherlich
nicht rückgängig zu machende Zerschlagung der
Sammlung.
Das Land Niedersachsen, das über das Vorkaufsrecht für
die Sammlung verfügt, führt schon seit geraumer Zeit Verhandlungen mit der Deutschen Bank mit dem Ziel, eine akzeptable Lösung im Sinne des geschlossenen Erhalts der
Sammlung in Niedersachsen herbeizuführen. Angesichts
der großen Bedeutung der Sammlung wäre eine Schenkung
eine angemessene und daher anzustrebende Lösung.
Der Niedersächsische Heimatbund appelliert an alle Beteiligten,
die Deutsche Bank und das Land Niedersachsen, alles
in ihrer Macht Stehende zu tun, um das Niedersächsische
Münzkabinett in Hannover zu erhalten."
Aus: Rote Mappe, S. 30 f.
http://www.niedersaechsischer-heimatbund.de/dokumente/dateien/RoteMappe2009.pdf
Deutschen Bank, Teile des „Niedersächsischen Münzkabinetts
der Deutschen Bank“ zu verkaufen, haben uns wie
weite Kreise der Fachöffentlichkeit zutiefst erschreckt.
Bei der rund 40.000 Stück umfassenden Sammlung handelt
es sich um eine der bedeutendsten Münzkollektionen
Europas, die nicht zu Unrecht als nationales Kulturgut eingestuft
ist. Sie gelangte 1983 in den Besitz der Deutschen
Bank. Damals griff erfreulicherweise der Bankier Hermann
J. Abs zu, als der Verkauf der Sammlung durch das
Welfenhaus erfolgte. Für diese Rettungsaktion, die zum
Verbleib des gesamten Bestandes unter dem Dach der
Deutschen Bank Hannover führte, ist Hermann J. Abs noch
heute zu danken!
Nun droht, nachdem die Deutsche Bank und das Land Niedersachsen
25 Jahre lang hohe Summen in die wissenschaftliche
Erschließung und öffentliche Präsentation investiert
haben, zum zweiten Mal nicht nur der Verlust für
Hannover und Niedersachsen, sondern auch die dann sicherlich
nicht rückgängig zu machende Zerschlagung der
Sammlung.
Das Land Niedersachsen, das über das Vorkaufsrecht für
die Sammlung verfügt, führt schon seit geraumer Zeit Verhandlungen mit der Deutschen Bank mit dem Ziel, eine akzeptable Lösung im Sinne des geschlossenen Erhalts der
Sammlung in Niedersachsen herbeizuführen. Angesichts
der großen Bedeutung der Sammlung wäre eine Schenkung
eine angemessene und daher anzustrebende Lösung.
Der Niedersächsische Heimatbund appelliert an alle Beteiligten,
die Deutsche Bank und das Land Niedersachsen, alles
in ihrer Macht Stehende zu tun, um das Niedersächsische
Münzkabinett in Hannover zu erhalten."
Aus: Rote Mappe, S. 30 f.
http://www.niedersaechsischer-heimatbund.de/dokumente/dateien/RoteMappe2009.pdf
Eligius - am Freitag, 29. Mai 2009, 08:04 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In der FAZ.
Die Justizministerin äußert sich unter anderem zur Kulturflatrate mit verhaltener Sympathie und nimmt nicht gegen Open Axccess Stellung:
Die Frage nach mehr Open Access ist auch ein wichtiges Thema, das im Rahmen der laufenden Konsultation zur Weiterentwicklung des Urheberrechts eine Rolle spielt.
Die Justizministerin äußert sich unter anderem zur Kulturflatrate mit verhaltener Sympathie und nimmt nicht gegen Open Axccess Stellung:
Die Frage nach mehr Open Access ist auch ein wichtiges Thema, das im Rahmen der laufenden Konsultation zur Weiterentwicklung des Urheberrechts eine Rolle spielt.
KlausGraf - am Freitag, 29. Mai 2009, 03:18 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://scholarship20.blogspot.com/2009/05/introduction-to-webometrics.html
oder http://tinyurl.com/kv5rq7
oder http://tinyurl.com/kv5rq7
KlausGraf - am Freitag, 29. Mai 2009, 02:52 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 29. Mai 2009, 02:37 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein unabhängiger Blogger von der Erlanger Buchwissenschaft wagt es, den Heidelberger Appell und die herrschende Position der Verlage zu kritisieren und bekommt natürlich sofort Dresche von Ulmer und Sprang in den Kommentaren.
http://www.boersenblatt.net/322329/
http://www.boersenblatt.net/322329/
KlausGraf - am Freitag, 29. Mai 2009, 02:32 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

aus: T. Ungerers, Hintereinander, München 1991
Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. Mai 2009, 23:35 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Archivportal D mit neuen Projektinformationen, so u.a. Anwendung EAD, EAG:
http://www.archivgut-online.de
http://www.archivgut-online.de
schwalm.potsdam - am Donnerstag, 28. Mai 2009, 22:39 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Dokumentation zur Records Management Roadshow des Kollegen Kampffmeyer, mit Schwerpunkt auf MoReq 2 ist online:
Vgl.: Dokumentation Records Management Roadshow 2009
Vgl.: Dokumentation Records Management Roadshow 2009
schwalm.potsdam - am Donnerstag, 28. Mai 2009, 22:33 - Rubrik: Records Management
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... „Schneeball Erde” ist die landläufige Bezeichnung für ausgedehnte Vergletscherungen der Erde, die sich vor 726 bis 635 Millionen Jahren ereigneten. Da sich etwa um die gleiche Zeit ein großer Abfall in der Fossilienhäufigkeit zeigt, gingen Wissenschaftler bisher davon aus, dass die Vereisung die Ursache für dieses frühe Artensterben gewesen sein musste. Jetzt aber haben Wissenschaftlerinnen um die Doktorandin Robin Nagy und Susannah Porter, Professorin für Geowissenschaften an der Universität von Kalifornien in Santa Barbara diese Theorie widerlegt.
Die Forscherinnen untersuchten Proben aus der so genannten Chuar-Gruppe am Grund des Grand Canyon, die aus dem Neoproterozoikum, der Ära kurz vor der großen Vereisung stammen. Hier ist die Lebenswelt in den Wänden des Canyons wie ein einem Archiv der Erdgeschichte erhalten geblieben....."
Quelle:
http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-9971-2009-05-28.html
Die Forscherinnen untersuchten Proben aus der so genannten Chuar-Gruppe am Grund des Grand Canyon, die aus dem Neoproterozoikum, der Ära kurz vor der großen Vereisung stammen. Hier ist die Lebenswelt in den Wänden des Canyons wie ein einem Archiv der Erdgeschichte erhalten geblieben....."
Quelle:
http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-9971-2009-05-28.html
Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. Mai 2009, 21:05 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Als das Kölner Stadtarchiv im März einstürzte, standen Politik und Öffentlichkeit in Deutschland Kopf. Das „Gedächtnis der Stadt“ zerstört, 1.000 Jahre dokumentierte Geschichte vernichtet – ein unschätzbarer Verlust für Forschung und Kultur. „Wenn ein Archiv einstürzt oder eine Forschungsbibliothek brennt, ist es eigentlich zu spät“, kritisiert Dr. Ulrich Hohoff, Vorsitzender des Verbands Deutscher Bibliothekare (VDB) und Chef der Universitätsbibliothek Augsburg. Die Bibliothekarinnen und Bibliothekare an wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland fordern ein gemeinsames Vorgehen mit Wissenschaftlern und Politikern, um wissenschaftliche Fachliteratur auf aktuellem Stand bereitzustellen und um überliefertes Kulturgut in den Einrichtungen zu erhalten. Es geht um Prioritäten und um finanzielle Mittel...."
Quelle:
http://www.firmenpresse.de/pressinfo92593.html
Quelle:
http://www.firmenpresse.de/pressinfo92593.html
Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. Mai 2009, 21:03 - Rubrik: Kulturgut
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Institut für Filmwissenschaft und Mediendramaturgie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz veranstaltet im Sommersemester 2009 die internationale Vortragsreihe „Film Beyond Film // Film jenseits der Leinwand“. In insgesamt sieben Vorträgen sprechen Filmregisseure, Videokünstler und Politaktivisten, Museumsleiter und Kuratoren, Therapeuten und Theoretiker der virtuellen Realität über die heutigen Wirkungsräume des Films, das Erbe des Kinos und die Transformation seiner Bilder. Im vierten Vortrag der Reihe fragt Rainer Rother, Künstlerischer Direktor der Deutschen Kinemathek, am Mittwoch, 3. Juni, unter der Überschrift „Filme Einer Ausstellung“, ob sich die Historie mit Homevideos erzählen lässt. „Wir waren so frei. Momentaufnahmen 1989/90“ präsentiert nicht nur professionelle Dokumentarfilme als Ausstellungsobjekte, sondern auch private Filme und Fotos der Deutschen – ihre visuelle Erinnerung an die Wiedervereinigung. Zusätzlich zur Ausstellung werden diese Zeugnisse im Netz recherchierbar sein. Was vermögen Film und Internet als Bilder-Gedächtnis für Museum und Archiv?
Rainer Rother ist Künstlerischer Direktor der Deutschen Kinemathek und Leiter der Retrospektive der Berlinale, betreute unter anderem die Monumentalausstellungen „Das deutsche Bilderimperium. Die Ufa 1917-1945“ und „Die letzten Tage der Menschheit. Bilder des Ersten Weltkrieges“.
Der öffentliche Vortrag beginnt am Mittwoch, 3. Juni, um 19 Uhr im Hörsaal der Filmwissenschaft, Medienhaus, Wallstr. 11, in Mainz. Der Eintritt ist frei. Anmeldung nicht erforderlich."
Quelle:
http://www.dailynet.de/BildungTraining/43397.php
Rainer Rother ist Künstlerischer Direktor der Deutschen Kinemathek und Leiter der Retrospektive der Berlinale, betreute unter anderem die Monumentalausstellungen „Das deutsche Bilderimperium. Die Ufa 1917-1945“ und „Die letzten Tage der Menschheit. Bilder des Ersten Weltkrieges“.
Der öffentliche Vortrag beginnt am Mittwoch, 3. Juni, um 19 Uhr im Hörsaal der Filmwissenschaft, Medienhaus, Wallstr. 11, in Mainz. Der Eintritt ist frei. Anmeldung nicht erforderlich."
Quelle:
http://www.dailynet.de/BildungTraining/43397.php
Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. Mai 2009, 21:02 - Rubrik: Filmarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
85 Prozent konnten der Kulturgüter aus dem eingestürzten Stadtarchiv geborgen werden.
11.000 Tonnen Bauschutt von der Unglücksstelle abtransportiert worden.
13.000 Euro fürs Stadtarchiv beim Benefizkonzert(2)
22.000 Stunden waren bislang Feuerwehr und Hilfskräfte im Einsatz.
Quellen:
(1) http://www.ksta.de/html/artikel/1243453916373.shtml
(2) http://www.ksta.de/html/artikel/1242833470077.shtml
11.000 Tonnen Bauschutt von der Unglücksstelle abtransportiert worden.
13.000 Euro fürs Stadtarchiv beim Benefizkonzert(2)
22.000 Stunden waren bislang Feuerwehr und Hilfskräfte im Einsatz.
Quellen:
(1) http://www.ksta.de/html/artikel/1243453916373.shtml
(2) http://www.ksta.de/html/artikel/1242833470077.shtml
Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. Mai 2009, 21:01 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das letzte Nestor-Seminar im Bundesarchivs (kam auch via Archivliste) setzt sich mit der Emulation als Methode zur elektronischen Archivierung auseinander. Als Experte ist Jeffrey van der Hoeven, Nationalbibliothek der Niederlande beteiligt. Er stellt den dort entwickleten Dioscuri Emulator vor, der u.a. Thema beim ICA-Congress in Kuala Lumpur war - sprich eine weltweit maßgebliche Lösung.
Vgl.: Nestor-Seminar zur Emulation im Bundesarchiv
zum Dioscuri-Projekt vgl. auch: Archivalia-Beitrag zu dioscuri
Vgl.: Nestor-Seminar zur Emulation im Bundesarchiv
zum Dioscuri-Projekt vgl. auch: Archivalia-Beitrag zu dioscuri
schwalm.potsdam - am Donnerstag, 28. Mai 2009, 20:53 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Überblick über aktuelle Entwicklungen bzgl. Speicherlösungen für Langzeitspeicherung und Archivierung:
Datenspeicher Langzeitspeicherung und Archivierung
Datenspeicher Langzeitspeicherung und Archivierung
schwalm.potsdam - am Donnerstag, 28. Mai 2009, 20:51 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Gedanken zur Nutzung von Metadatenstandards für systemübergreifenden Recherche vom Kollegen Dr. Kampffmeyer
Metadatenstandards zur Repository-übergreifenden Recherche
Metadatenstandards zur Repository-übergreifenden Recherche
schwalm.potsdam - am Donnerstag, 28. Mai 2009, 20:48 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Josef Wermert (Stadtarchiv Olpe) und Dieter Tröps (Kreisarchiv Olpe) helfen noch bis zum Ende der Woche im Kölner Erstversorgungszentrum. (Quelle: Siegener Zeitung, 28.5.2009, Printausgabe)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. Mai 2009, 19:16 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
So verlautbarte der Kulturstaatsminister: "..... Daneben sollen auch die dringend sanierungsbedürftigen Gebäude des Bundesarchivs, der BStU (Birthler-Behörde) und Haus 1 / Normannenstraße Hilfen von über 12 Millionen Euro erhalten. Daneben sollen auch die dringend sanierungsbedürftigen Gebäude des Bundesarchivs, der BStU (Birthler-Behörde) und Haus 1 / Normannenstraße Hilfen von über 12 Millionen Euro erhalten. ...."
Quelle: Pressemitteilung der Bundesregierung
Quelle: Pressemitteilung der Bundesregierung
Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. Mai 2009, 18:46 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Update zu: http://archiv.twoday.net/stories/210509/
2009 ist die zweite Auflage des von mir seinerzeit (2004) mit Dreier/Schulze (inzwischen 3. Aufl. 2008) verglichenen Kommentars erschienen. Insgesamt ist mein Eindruck eher negativer als seinerzeit.
Zur Abwertung führt insbesondere die eigenartige Sonderansicht von Dr. Gunda Dreyer, Richterin am Landgericht (Kassel), zur Panoramafreiheit § 59 UrhG. Sie vertritt in Rn 9, 12 und 15 (= S. 903-905) die abwegige Ansicht, es sei unzulässig, das Werk auf CD-ROM oder Festplatte zu überspielen, um es so ins Internet stellen zu können, da Vervielfältigungen nur mit Mitteln der Malerei, der Grafik, durch Lichtbild und Film erlaubt seien. Mit dieser Ansicht steht sie allein auf weiter Flur; dezidiert anderer Ansicht ist sowohl der Schrickersche Kommentar als auch das VG Karlsruhe (NJW 2000, 2222). Auch die anderen Großkommentare schließen sich ihr nicht an (Nordemann, Wandtke/Bullinger).
Die von ihr angegebene Begrenzung bezieht sich nach herrschender Meinung nur auf das Verbot plastischer Nachbildungen. Zur Nutzung durch Lichtbilder (einschließlich Lichtbildwerke!) und Film zählt selbstverständlich auch die Benutzung einer Digitalkamera zur Aufnahme von Fotos und Filmen. Werden analoge Bilder digitalisiert, um die zulässige öffentliche Wiedergabe mittels Zugänglichmachung im Internet zu ermöglichen, liegt darin ein für die Norm nicht relevanter Zwischenschritt.
Zur Panoramafreiheit siehe
http://archiv.twoday.net/search?q=panoramafreiheit
 Foto: Andreas Praefcke CC-BY 3.0 unported - Gunda würde dieses Foto der Berliner Philharmonie verbieten
Foto: Andreas Praefcke CC-BY 3.0 unported - Gunda würde dieses Foto der Berliner Philharmonie verbieten
2009 ist die zweite Auflage des von mir seinerzeit (2004) mit Dreier/Schulze (inzwischen 3. Aufl. 2008) verglichenen Kommentars erschienen. Insgesamt ist mein Eindruck eher negativer als seinerzeit.
Zur Abwertung führt insbesondere die eigenartige Sonderansicht von Dr. Gunda Dreyer, Richterin am Landgericht (Kassel), zur Panoramafreiheit § 59 UrhG. Sie vertritt in Rn 9, 12 und 15 (= S. 903-905) die abwegige Ansicht, es sei unzulässig, das Werk auf CD-ROM oder Festplatte zu überspielen, um es so ins Internet stellen zu können, da Vervielfältigungen nur mit Mitteln der Malerei, der Grafik, durch Lichtbild und Film erlaubt seien. Mit dieser Ansicht steht sie allein auf weiter Flur; dezidiert anderer Ansicht ist sowohl der Schrickersche Kommentar als auch das VG Karlsruhe (NJW 2000, 2222). Auch die anderen Großkommentare schließen sich ihr nicht an (Nordemann, Wandtke/Bullinger).
Die von ihr angegebene Begrenzung bezieht sich nach herrschender Meinung nur auf das Verbot plastischer Nachbildungen. Zur Nutzung durch Lichtbilder (einschließlich Lichtbildwerke!) und Film zählt selbstverständlich auch die Benutzung einer Digitalkamera zur Aufnahme von Fotos und Filmen. Werden analoge Bilder digitalisiert, um die zulässige öffentliche Wiedergabe mittels Zugänglichmachung im Internet zu ermöglichen, liegt darin ein für die Norm nicht relevanter Zwischenschritt.
Zur Panoramafreiheit siehe
http://archiv.twoday.net/search?q=panoramafreiheit
 Foto: Andreas Praefcke CC-BY 3.0 unported - Gunda würde dieses Foto der Berliner Philharmonie verbieten
Foto: Andreas Praefcke CC-BY 3.0 unported - Gunda würde dieses Foto der Berliner Philharmonie verbietenKlausGraf - am Donnerstag, 28. Mai 2009, 16:41 - Rubrik: Archivrecht
Sehr interessante Wortmeldungen einer aktuellen Debatte zitiert:
http://hangingtogether.org/?p=692
Zum Thema hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=bildrecht
http://hangingtogether.org/?p=692
Zum Thema hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=bildrecht
KlausGraf - am Donnerstag, 28. Mai 2009, 01:05 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://statelibrary.ncdcr.gov/dimp/digital/ncfamilyrecords/
North Carolina Family Records Online currently contains over 200 Bible Records (lists of birth, marriage, and death information recorded in North Carolina Bibles throughout the 18th, 19th, and 20th centuries). The collection also contains a six-volume index of marriage and death notices that appeared in five North Carolina newspapers from 1799-1893.

North Carolina Family Records Online currently contains over 200 Bible Records (lists of birth, marriage, and death information recorded in North Carolina Bibles throughout the 18th, 19th, and 20th centuries). The collection also contains a six-volume index of marriage and death notices that appeared in five North Carolina newspapers from 1799-1893.

KlausGraf - am Donnerstag, 28. Mai 2009, 00:56 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wir sind jugendgefährdend. Infobib hat sich ein dubioses Jugendschutzprogramm vorgenommen und dort auch Archivalia festgestellt:
http://infobib.de/blog/2009/05/27/ist-infobib-jugendgefahrdend/

http://infobib.de/blog/2009/05/27/ist-infobib-jugendgefahrdend/

KlausGraf - am Donnerstag, 28. Mai 2009, 00:45 - Rubrik: Allgemeines
Zwei Besprechungen in Französisch:
http://blogusoperandi.blogspot.com/2009/05/la-bibliotheque-numerique-mondiale.html
http://bibliotheques.wordpress.com/2009/04/21/que-vient-faire-la-world-digital-library-dans-cette-galere/
Vor allem letztere ist doch sehr kritisch. Meine eigene Begeisterung hat sich jäh gelegt, als mir klar wurde, dass die ganzen Millionen in die Präsentation (zugegeben mehrsprachig) von gerade mal gut 1100 Objekten geflossen sind. Meine Frage per Mail anlässlich des Starts hinsichtlich eines OAI-Formats wurde nicht beantwortet.
http://blogusoperandi.blogspot.com/2009/05/la-bibliotheque-numerique-mondiale.html
http://bibliotheques.wordpress.com/2009/04/21/que-vient-faire-la-world-digital-library-dans-cette-galere/
Vor allem letztere ist doch sehr kritisch. Meine eigene Begeisterung hat sich jäh gelegt, als mir klar wurde, dass die ganzen Millionen in die Präsentation (zugegeben mehrsprachig) von gerade mal gut 1100 Objekten geflossen sind. Meine Frage per Mail anlässlich des Starts hinsichtlich eines OAI-Formats wurde nicht beantwortet.
KlausGraf - am Donnerstag, 28. Mai 2009, 00:26 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 28. Mai 2009, 00:10 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen