"Immer mehr Menschen machen die Familien- und Ahnenforschung zu ihrem Hobby. Beim oberösterreichischen Landesarchiv sind die entsprechenden Anfragen zuletzt in die Höhe geschnellt.
Viele wollen ihre familiären Wurzeln kennenlernen, und so mancher hofft darauf, vielleicht einen Adeligen unter den Vorfahren zu finden. "Den Menschen geht es um die eigene Identität. Viele fragen sich: Welche Tradition und Geschichte hat meine Familie?", erzählte Josef Weichenberger vom oberösterreichischen Landesarchiv.
Ein Drittel der Forschenden sind jüngere Personen, zwei Drittel sind ältere Menschen.
Insgesamt gibt es 30 Laufkilometer an Urkunden und Dokumenten, die auf neun Stockwerke verteilt lagern. Gerade für die jungen Forscher sei das Durchforsten der Unterlagen nicht immer leicht, da die Schriften bis 1942 in Kurrent geschrieben wurden.
Mittlerweile viele Dokumente digitalisiert
Die Suche nach den Vorfahren ist mittlerweile deutlich einfacher geworden. Viele alte Dokumente sind inzwischen im Internet abrufbar. Auch sämtliche pfarrliche Dokumente - also Tauf-, Trauungs- und Sterbebücher - wurden mittlerweile von den Pfarren übernommen und digitalisiert."
Quelle: orf.at
Link zum Landesarchiv Oberösterreich,Linz
(T)
Viele wollen ihre familiären Wurzeln kennenlernen, und so mancher hofft darauf, vielleicht einen Adeligen unter den Vorfahren zu finden. "Den Menschen geht es um die eigene Identität. Viele fragen sich: Welche Tradition und Geschichte hat meine Familie?", erzählte Josef Weichenberger vom oberösterreichischen Landesarchiv.
Ein Drittel der Forschenden sind jüngere Personen, zwei Drittel sind ältere Menschen.
Insgesamt gibt es 30 Laufkilometer an Urkunden und Dokumenten, die auf neun Stockwerke verteilt lagern. Gerade für die jungen Forscher sei das Durchforsten der Unterlagen nicht immer leicht, da die Schriften bis 1942 in Kurrent geschrieben wurden.
Mittlerweile viele Dokumente digitalisiert
Die Suche nach den Vorfahren ist mittlerweile deutlich einfacher geworden. Viele alte Dokumente sind inzwischen im Internet abrufbar. Auch sämtliche pfarrliche Dokumente - also Tauf-, Trauungs- und Sterbebücher - wurden mittlerweile von den Pfarren übernommen und digitalisiert."
Quelle: orf.at
Link zum Landesarchiv Oberösterreich,Linz
(T)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. April 2011, 20:13
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Maurice Quenet, Conseiller d’Etat, hat am 8. April 2011 dem französischen Ministerpräsidenten François Fillon seinen Bericht zur zukünftigen Entwicklung des französischen Archivwesens vorgelegt.
Darin empfiehlt er als zentralen Schritt für die Verbesserung des Zugangs zu den Beständen unter Erhaltung der gewachsenen Zusammenhänge den Aufbau eines nationalen Archivportals. Es soll als integraler Bestandteil des Europäischen Archivportals konzipiert sein, das im Projekt APEnet von 17 Mitgliedsländern der EU und Europeana gemeinsam erstellt wird. Das französische Nationalarchiv und das Bundesarchiv arbeiten dort mit den Niederlanden und Spanien in der Projektleitung eng zusammen. Frankreich hat die Verantwortung für die Aufbereitung und Integration der Erschließungsangaben durch die beteiligten Archive übernommen und dazu Werkzeuge entwickelt, während das Bundesarchiv federführend ist für die Architektur des Portals und die Nutzung der internationalen Standards.
In dem nationalen Archivportal Frankreichs sollen vorrangig die bereits vorhandenen Findmittel mit der Möglichkeit zur übergreifenden Recherche zusammengeführt werden. Sie sollen gleichzeitig zu den digitalen Reproduktionen der Bestände führen. Das Portal soll sowohl die Volltextsuche in den Erschließungsinformationen, eine Suche nach Online-Galerien und digitalen Ausstellungen der beteiligten Einrichtungen sowie einen strukturierten Zugang anbieten. Die Struktur der Herkunftsstellen und Archivbestände soll die volle Ausführlichkeit und Gründlichkeit einer wissenschaftlichen Recherche garantieren. Das Portal soll wie APnet die internationalen Standards nutzen.
Die weiteren drei Punkte des Berichts beziehen sich auf die Archivierung elektronischer Aufzeichnungen, die Nachnutzung von Informationen aus Verwaltungstätigkeit sowie die weitere Modernisierung des institutionellen Rahmens.
Der Bericht bezieht sich auf den Ratsbeschluß der EU vom 14. Nov. 2005 über die gemeinschaftlichen Vorhaben zur Stärkung der archivischen Kooperation in Europa von 2005, der im Anhang im Wortlaut widergegeben wird. Der 83-seitige Bericht ist auf der Webseite des Premierministers einsehbar."
Quelle:Bundesarchiv.de, Fachinformationen v. 21.04.2011
('T)
Darin empfiehlt er als zentralen Schritt für die Verbesserung des Zugangs zu den Beständen unter Erhaltung der gewachsenen Zusammenhänge den Aufbau eines nationalen Archivportals. Es soll als integraler Bestandteil des Europäischen Archivportals konzipiert sein, das im Projekt APEnet von 17 Mitgliedsländern der EU und Europeana gemeinsam erstellt wird. Das französische Nationalarchiv und das Bundesarchiv arbeiten dort mit den Niederlanden und Spanien in der Projektleitung eng zusammen. Frankreich hat die Verantwortung für die Aufbereitung und Integration der Erschließungsangaben durch die beteiligten Archive übernommen und dazu Werkzeuge entwickelt, während das Bundesarchiv federführend ist für die Architektur des Portals und die Nutzung der internationalen Standards.
In dem nationalen Archivportal Frankreichs sollen vorrangig die bereits vorhandenen Findmittel mit der Möglichkeit zur übergreifenden Recherche zusammengeführt werden. Sie sollen gleichzeitig zu den digitalen Reproduktionen der Bestände führen. Das Portal soll sowohl die Volltextsuche in den Erschließungsinformationen, eine Suche nach Online-Galerien und digitalen Ausstellungen der beteiligten Einrichtungen sowie einen strukturierten Zugang anbieten. Die Struktur der Herkunftsstellen und Archivbestände soll die volle Ausführlichkeit und Gründlichkeit einer wissenschaftlichen Recherche garantieren. Das Portal soll wie APnet die internationalen Standards nutzen.
Die weiteren drei Punkte des Berichts beziehen sich auf die Archivierung elektronischer Aufzeichnungen, die Nachnutzung von Informationen aus Verwaltungstätigkeit sowie die weitere Modernisierung des institutionellen Rahmens.
Der Bericht bezieht sich auf den Ratsbeschluß der EU vom 14. Nov. 2005 über die gemeinschaftlichen Vorhaben zur Stärkung der archivischen Kooperation in Europa von 2005, der im Anhang im Wortlaut widergegeben wird. Der 83-seitige Bericht ist auf der Webseite des Premierministers einsehbar."
Quelle:Bundesarchiv.de, Fachinformationen v. 21.04.2011
('T)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. April 2011, 18:59 - Rubrik: Kooperationsmodelle
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Ein gedrucktes Stück Dresdner Geschichte - der vierte Band der mittelalterlichen Stadtbücher ist fertig. Er beinhaltet das sechste und siebente Stadtbuch Dresdens und umfasst die Zeit von 1505 bis 1535. Im Stadtarchiv hat Kulturbürgermeister Ralf Lunau dem interessierten Publikum das Stadtbuch vorgestellt. Mit dem Abschluss des vierten Bandes liegt die Edition der spätmittelalterlichen Stadtbücher nun vollständig vor.
O-Ton: Ralf Lunau (parteilos), Kulturbürgermeister
Nicht hoch genug bewertet werden kann auch die Arbeit der Historiker, wie beispielsweise Jens Klingner. Als Vorlage dienten die originalen Stadtbücher, die sich seit 1925 als Dauerleihgabe im Stadtarchiv befinden.Vor mehr als sechs Jahren hat die Arbeit an den spätmittelalterlichen Stadtbüchern begonnen; allein eineinhalb Jahre hat die Arbeit an der letzten Edition gedauert.
O-Ton: Jens Klingner, Historiker
Die originalen Stadtbücher umfassen zwischen 60 und 150 Pergamentblätter, die von verschiedenen Stadtschreibern verfasst wurden. Die größte Herausforderung für die Historiker bildet die Entzifferung der früh-neuhochdeutschen Schrift und Sprache der Einträge. Die Texte sind die wichtigsten Quellen zur spätmittelalterlichen Verfassungs-, Wirtschafts-, und Alltagsgeschichte Dresdens. Mit über 1200 Einträgen sind die letzten beiden Stadtbücher die umfangreichsten der bereits erschienenen Bände.
O-Ton: Jens Klingner, Historiker
So geschehen auch im Fall von Familie Biener. Da heißt es im Eintrag vom 16. Juni 1515: Vereinbarung zwischen Peter Biener und seiner Mutter einerseits sowie Hans Schuntzig und dessen Mutter andererseits über den gegenseitigen Tausch ihrer Häuser. Diese Einträge aus dem Alltagsleben im Spätmittelalter haben über 500 Jahre überstanden und können nun frei zugänglich gelesen werden.
O-Ton: Ralf Lunau (parteilos), Kulturbürgermeister
Und wer sich den Weg in die Bibliothek sparen will: Der 4. Band der mittelalterlichen Stadtbücher ist zum Preis von 55 Euro auch im Handel erhältlich."
Quelle: dresdeneinstv v. 26.04.2011 mit Video (!)
(W)
O-Ton: Ralf Lunau (parteilos), Kulturbürgermeister
Nicht hoch genug bewertet werden kann auch die Arbeit der Historiker, wie beispielsweise Jens Klingner. Als Vorlage dienten die originalen Stadtbücher, die sich seit 1925 als Dauerleihgabe im Stadtarchiv befinden.Vor mehr als sechs Jahren hat die Arbeit an den spätmittelalterlichen Stadtbüchern begonnen; allein eineinhalb Jahre hat die Arbeit an der letzten Edition gedauert.
O-Ton: Jens Klingner, Historiker
Die originalen Stadtbücher umfassen zwischen 60 und 150 Pergamentblätter, die von verschiedenen Stadtschreibern verfasst wurden. Die größte Herausforderung für die Historiker bildet die Entzifferung der früh-neuhochdeutschen Schrift und Sprache der Einträge. Die Texte sind die wichtigsten Quellen zur spätmittelalterlichen Verfassungs-, Wirtschafts-, und Alltagsgeschichte Dresdens. Mit über 1200 Einträgen sind die letzten beiden Stadtbücher die umfangreichsten der bereits erschienenen Bände.
O-Ton: Jens Klingner, Historiker
So geschehen auch im Fall von Familie Biener. Da heißt es im Eintrag vom 16. Juni 1515: Vereinbarung zwischen Peter Biener und seiner Mutter einerseits sowie Hans Schuntzig und dessen Mutter andererseits über den gegenseitigen Tausch ihrer Häuser. Diese Einträge aus dem Alltagsleben im Spätmittelalter haben über 500 Jahre überstanden und können nun frei zugänglich gelesen werden.
O-Ton: Ralf Lunau (parteilos), Kulturbürgermeister
Und wer sich den Weg in die Bibliothek sparen will: Der 4. Band der mittelalterlichen Stadtbücher ist zum Preis von 55 Euro auch im Handel erhältlich."
Quelle: dresdeneinstv v. 26.04.2011 mit Video (!)
(W)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. April 2011, 18:50 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Mit dem Leben hat der Archivar Hugo Wallner (Ulrich Mühe) längst abgeschlossen. Seit der Facharzt ihm Lungenkrebs im Endstadium bescheinigt hat, plagt ihn nur noch eine Sorge: Wie kann er, der noch höchstens drei Monate zu leben hat, seine Frau Brigitte (Monika Baumgartner) und Tochter Isabel (Stephanie Engelmaier) absichern? Der zwielichtige Geschäftsmann Georg Mosbacher (Rolf Hoppe) offeriert die vermeintliche Lösung: Wenn Wallner die Geschäftsführung einer Firma übernimmt, winken ihm 500 000 Mark. Die Firma soll betrügerisch bankrott gehen und Wallner als alleinhaftender Gesellschafter alle Schulden mit ins Grab nehmen. Allerdings stellt sich bei einer erneuten Untersuchung heraus, daß der "Todkranke" kerngesund ist. Eine ausweglose Lage, denn nun ist Sterben für ihn viel gesünder… Der Thriller wirkt manchmal überkonstruiert. Aber das Spiel der Darsteller Mühe und Hoppe fesselt und fängt die logischen Widerhaken der Story mit komisch-ironischen Untertönen geschickt ab."
Quelle: tvspielfilm.de, Filmarchiv
(W)
Quelle: tvspielfilm.de, Filmarchiv
(W)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. April 2011, 18:45 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
You'd expect the frozen world to be silent. Far from it. Pascal Wyse records the extraordinary sounds of the wild on a voyage to the Antarctic peninsula
(T)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. April 2011, 18:37 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Seine Mission ist es, Musik vor dem Vergessen zu retten.
Sammler leben gefährlich, schon weil ihre Leidenschaft leicht zur Sucht werden kann. Den Deutschtunesier Samy Ben Redjeb hat es besonders hart erwischt: Er hat eine Stauballergie. Jahrelang teilte er sich seine kleine Wohnung in Frankfurt/Main mit knapp 30.000 Platten aus Afrika. Unlängst hat er die Wohnung renoviert und die meterhohen Vinyl-Schätze in einen separaten Raum umgelagert. In dem kleinen Hinterhofbüro, Sitz seines Plattenlabels Analog Africa, lagern hunderte weiterer Platten.
Samy Ben Redjebs Leidenschaft gilt afrikanischen Aufnahmen der sechziger und siebziger Jahre – einer Musikära, die in Europa und den USA derzeit wiederentdeckt wird.
So bringen britische Plattenfirmen wie Strut und Soundway Klassiker und Raritäten des Afro-Beat heraus, und Bands wie die Foals, Vampire Weekend oder Bombay Bicycle Club integrieren Highlife-Gitarren in ihren Sound. Samy Ben Redjeb hat in diesem Nischenmarkt mittlerweile neun Alben veröffentlicht – zuletzt die Kompilation „Angola Soundtrack: The unique Sound of Luanda (1968-1976)“.
In seinem Büro hat der 40-Jährige die Originalplatten nach Zeiten und Ländern sortiert. Südafrika, Zimbabwe, Angola Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Senegal. In all diesen Ländern hat er Wochen in verstaubten Plattenlagern verbracht, Musik und Musiker gesucht und Originalaufnahmen samt Lizenzen nach Deutschland gebracht. „Wenn ich eine geniale Platte finde, kaufe ich sie auch 50-mal, um mit dem Verkauf mein Label mitzufinanzieren“, sagt er.
Ben Redjeb ist ein lockerer Typ mit Kapuzenpulli und Turnschuhen. Bis er 17 war, lebte er beim Vater in Tunesien und besuchte seine deutsche Mutter nur in den Ferien. „Keine einfache Zeit“, sagt er – und vielleicht auch deshalb begeisterte er sich schon früh für Popmusik und nicht für arabische Klänge. Doch die demokratische Bewegung in seiner zweiten Heimat macht ihn stolz. „Anders als früher weiß heute jeder, wo Tunesien liegt.“
Ben Redjebs Geschichte ist die eines Rastlosen: Nach dem Realschulabschluss in Deutschland geht er zur Marine, wird Tauchlehrer in Griechenland, arbeitet als Hotel-DJ in der Türkei und im Senegal. In Dakar kommt er erstmals mit der Musik des Kontinents in Berührung – „ein Schlüsselerlebnis“. Mit Ende zwanzig eröffnet er einen Laden für afrikanische Accessoires in Frankfurt, mit wenig Erfolg. Eine Freundin bringt ihn auf die Idee, es als Steward zu versuchen. „Ein fester Job und günstig fliegen, um meine Musik zu suchen, das war es!“ Schon bald arbeitet er auf Flügen nach Accra, Lagos und Addis Abeba. Gut auch für ihn, dass er sechs Sprachen spricht: Neben Deutsch und Arabisch auch Französisch, Italienisch, Englisch und Spanisch.
Es sind die Sprachen der ehemaligen Kolonialisten, die dem offenherzigen Ben Redjeb Zugang zu Land und Leuten erleichtern. Der Kauf des Albums „Gwindingwi Raine Shuba“ von Thomas Mapfumo (1980), das in Zimbabwe am Ende des Unabhängigkeitskrieges aufgenommen wurde, habe alles verändert, sagt der 40-Jährige. „Das war der Klang, den ich immer gesucht habe.“ So startete seine Mission, Musik vor dem Vergessen zu retten. Er ist süchtig nach Befreiungsmusik: „Wo Menschen für ihre Freiheit kämpfen, da haben die Musiker etwas, das sie später vielleicht nie mehr besitzen.“
Den Grundstein für sein Label legte er 2004 mit der Veröffentlichung von Liedern der zimbabwischen Band The Green Arrows. Die Gruppe um Sänger Zexie Manatsa gehörte in den frühen Siebzigern zu den berühmtesten des Landes. Als Ben Redjeb den Bandleader zwanzig Jahre später wiedertrifft, ist dieser an die 60 Jahre alt und arbeitet als Pastor. „Er hat einer Veröffentlichung zugestimmt, obwohl er meinte, dass das mit der Musik für ihn schon lange vorbei sei“, sagte Ben Redjeb. Für die Wiederveröffentlichung fehlen Ben Redjeb zunächst die Referenznummern der Singles. Die aber braucht er, um an die Originaltonbänder heranzukommen, die bei einer Plattenfirma in Südafrika lagern.
Ben Redjebs Spürsinn erwacht. Er befragt Produzenten, Händler und Repräsentanten und wird Monate später im Hinterhoflager eines ehemaligen, südafrikanischen Plattenhändlers fündig. „Ich habe dort jede einzelne Platte der Green Arrows gefunden und etwa 4000 Singles gekauft“, sagt Ben Redjeb. Am Ende stecken im ersten Album vier Jahre Arbeit und ein materieller Gewinn von 2000 Euro – aber dafür ein größerer ideeller. „Durch die Veröffentlichung kehrte das Green Arrows-Fieber nach Zimbabwe zurück. Die Band ging wieder auf Tournee.“
Ben Redjeb ist wählerisch. „Ein Archäologe nimmt alles mit, was er ausgräbt. Ich aber bringe nur Lieder heraus, die in meinen Ohren speziell klingen“, sagt er. Afropsychedelik, polyrhythmisch-schräger Funk und tribalistischer Rhythm and Blues interessieren ihn besonders. Es ist der Klang westlicher Instrumente, variiert mit jahrhundertealten afrikanischen Musikrichtungen. Jedem Album legt er ein ausführliches Booklet über die Musiker und seine Recherchen bei. „Ich will die Leute genauso verliebt machen, wie ich es bin“, sagt er. Und diese Liebe kann man spüren...."
Quelle: Hadija Haruna, Der Tagesspiegel v. 25.4.2011
Am Ende klingt es nach einem Dokumentationsprofil des "Archivaren" ......
Blog des Labels
MySpace-Account des Labels
YouTube-Channel des Labels
(E, W)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. April 2011, 18:23 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Mit "Der Richter-Code" hat Autor und koeln.de-Chefredakteur Edgar Franzmann gerade seinen zweiten Köln-Krimi vorgelegt. Der rasant erzählte Kriminalfall greift den Einsturz des Historischen Stadtarchivs auf, der als Rahmenhandlung für die Entschlüsselung eines anderen Rätsels dient: eine geheime Botschaft, versteckt im Richter-Fenster des Kölner Doms. koeln.de-Redakteur Sven Plaggemeier sprach mit Edgar Franzmann über sein Werk. ...."
Link zum Interview
(T)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. April 2011, 17:22 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Berliner Staatsbibliothek hat 145 Briefe des Dirigenten und Pianisten Hans von Bülow ersteigert.
Es sind Briefe an Verwandte, in denen er u.a. über seine Erfahrungen auf Konzertreisen und politische Begebenheiten schreibt, wie die Bibliothek am Donnerstag mitteilt. Sie verwahrt den Nachlass des ersten Chefdirigenten des Berliner Philharmonischen Orchesters.
Dazu gehören unter anderem bereits 1.600 Briefe sowie 18 Bände mit Kompositionsautographen. Die nun ersteigerten Briefe umfassen insgesamt 550 Seiten.
Quelle: rbb-text, S. 137 v. 28.04.2011
Link zur Pressemitteilung der Berliner Staatsbibliothek
(E)
Es sind Briefe an Verwandte, in denen er u.a. über seine Erfahrungen auf Konzertreisen und politische Begebenheiten schreibt, wie die Bibliothek am Donnerstag mitteilt. Sie verwahrt den Nachlass des ersten Chefdirigenten des Berliner Philharmonischen Orchesters.
Dazu gehören unter anderem bereits 1.600 Briefe sowie 18 Bände mit Kompositionsautographen. Die nun ersteigerten Briefe umfassen insgesamt 550 Seiten.
Quelle: rbb-text, S. 137 v. 28.04.2011
Link zur Pressemitteilung der Berliner Staatsbibliothek
(E)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. April 2011, 16:24 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://archiv.twoday.net/stories/16585490/#16587249
Ich gehe der Sache derzeit nach.
(W)
Update 2.5.2011: Ich war am Freitag in Münnerstadt und hatte Gelegenheit, kurz mit dem Bibliothekar des Augustinerklosters Pater Ottokar zu sprechen. Um 1948 habe der Staat dem Kloster die Bestände der Gymnasialbibliothek zurückgegeben, nachdem ein Ordensmitglied das Eigentum der Augustiner habe nachweisen können. Von seinem Vorgänger als Bibliothekar habe er erfahren, dass um die 1000 Bücher weggekommen seien, Lexika und Ähnliches. Weggekommen meint: verkauft, nicht gestohlen. Wann das geschehen sei, konnte er nicht sagen. Als ich ihm mitteilte, mit welchen Summen die Bände angesetzt sind, war der Bibliothekar erstaunt, ja fast peinlich berührt. Ich habe vorerst keinen Grund, ihm nicht Glauben zu schenken. Aber auch wenn es sich um einen Sündenfall handelt, der womöglich Jahrzehnte zurückliegt, so war das Verkaufen so wertvoller und für die fränkische Bibliotheksgeschichte bedeutsamer Drucke eine schändliche und verantwortungslose Tat der Münnerstädter Augustiner! Seltsam ist jedenfalls, dass derzeit so viele Bände aus Münnerstadt auf einen Schlag auf den Markt kommen.
Unerfreulich ist, dass im Handbuch der historischen Buchbestände die Entfremdung eines so großen Bibliotheksbestandteils nicht vermerkt ist.
Angeblich sind die Handschriften, Inkunabeln und Frühdrucke des Klosters bis 1530 nach Würzburg gebracht worden.
Freundlicherweise hat jemand mir eine Liste der einschlägigen Reiss-Nummern zur Verfügung gestellt (aufgrund einer Durchsicht der Abbildungen):
883
904
1129
1489
1490
1499
1507
1523
1532
1536
1539
1544
1547
1549
1558
1560
1566
1567
1576
1578
1588
1589
1591
1593 [ http://www.reiss-sohn.de/auktion/bilderdetail/1593_2.jpg Stempel über Ministerialerlass über die Rückgabe vom 24.6.1949]
1605 münnerstädter signatur (ohne stempel)
1614
1615
1623
1624
1633
1659
1660
1661
1662 münnerstädter signatur (ohne stempel)
1663
1682 ?
1688 [Stempel des Ministerialerlasses ist gut erkennbar: http://www.reiss-sohn.de/auktion/bilderdetail/1688_2.jpg ]
1690
1696
1699
1704
1705
1706
1711
1714
1721
Update: Zur Bibliotheke siehe auch
http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2000/0032.html


Ich gehe der Sache derzeit nach.
(W)
Update 2.5.2011: Ich war am Freitag in Münnerstadt und hatte Gelegenheit, kurz mit dem Bibliothekar des Augustinerklosters Pater Ottokar zu sprechen. Um 1948 habe der Staat dem Kloster die Bestände der Gymnasialbibliothek zurückgegeben, nachdem ein Ordensmitglied das Eigentum der Augustiner habe nachweisen können. Von seinem Vorgänger als Bibliothekar habe er erfahren, dass um die 1000 Bücher weggekommen seien, Lexika und Ähnliches. Weggekommen meint: verkauft, nicht gestohlen. Wann das geschehen sei, konnte er nicht sagen. Als ich ihm mitteilte, mit welchen Summen die Bände angesetzt sind, war der Bibliothekar erstaunt, ja fast peinlich berührt. Ich habe vorerst keinen Grund, ihm nicht Glauben zu schenken. Aber auch wenn es sich um einen Sündenfall handelt, der womöglich Jahrzehnte zurückliegt, so war das Verkaufen so wertvoller und für die fränkische Bibliotheksgeschichte bedeutsamer Drucke eine schändliche und verantwortungslose Tat der Münnerstädter Augustiner! Seltsam ist jedenfalls, dass derzeit so viele Bände aus Münnerstadt auf einen Schlag auf den Markt kommen.
Unerfreulich ist, dass im Handbuch der historischen Buchbestände die Entfremdung eines so großen Bibliotheksbestandteils nicht vermerkt ist.
Angeblich sind die Handschriften, Inkunabeln und Frühdrucke des Klosters bis 1530 nach Würzburg gebracht worden.
Freundlicherweise hat jemand mir eine Liste der einschlägigen Reiss-Nummern zur Verfügung gestellt (aufgrund einer Durchsicht der Abbildungen):
883
904
1129
1489
1490
1499
1507
1523
1532
1536
1539
1544
1547
1549
1558
1560
1566
1567
1576
1578
1588
1589
1591
1593 [ http://www.reiss-sohn.de/auktion/bilderdetail/1593_2.jpg Stempel über Ministerialerlass über die Rückgabe vom 24.6.1949]
1605 münnerstädter signatur (ohne stempel)
1614
1615
1623
1624
1633
1659
1660
1661
1662 münnerstädter signatur (ohne stempel)
1663
1682 ?
1688 [Stempel des Ministerialerlasses ist gut erkennbar: http://www.reiss-sohn.de/auktion/bilderdetail/1688_2.jpg ]
1690
1696
1699
1704
1705
1706
1711
1714
1721
Update: Zur Bibliotheke siehe auch
http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2000/0032.html


noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.reiss-sohn.de
Sammelhandschrift mit Verserzählungen
Nr. 1973
Verserzählungen Märenhandschrift. - Sammelhandschrift mit drei mittelhochdeutschen Versnovellen auf Pergament. Süddeutschland (bairischer Sprachstand), späteres 13. Jahrhundert. Blattgr. 7,5:5,5 cm, Schriftraum ca. 6,5:4,5 cm. 19-25 Zeilen. Sehr kleine frühgotische Minuskel von einer Hand in brauner Tinte, Versanfänge rot gestrichelt, zahlr. rote Schlängellinien als Zeilenfüller. Mit 3 zweizeiligen roten Lombarden zu Beginn der Dichtungen, am Schluß jeweils rote Subskriptionen des Schreibers. 16 nn. Bll. (2 Quaternionen). Zeitgenössischer oder wenig späterer flex. Pergamentumschlag (Koperteinband) mit seitlichem Überschlag, ohne Schließband (Schlitze dafür vorhanden); Heftfaden der 1. Lage erneuert, Umschlag etwas nachgedunkelt, berieben u. mit Wurmspuren.
()
Einzigartige, der Forschung unbekannte und vollständige Sammelhandschrift aus dem späten 13. Jahrhundert. Enthält drei mittelhochdeutsche Versnovellen ("Mären"), von denen bisher nur weitaus spätere Textzeugen bekannt waren. In allen drei Texten scheint der ursprüngliche Versbestand sowie der Sprachstand der hochhöfischen Epik auf, während die bisher bekannten Überlieferungen sämtlich inhaltliche Ausschweifungen, Zusätze und Umschreibungen veralteter Wörter in modernerer, frühneuhochdeutscher Sprache aufweisen. Außergewöhnlich ist auch das sehr kleine Format der Handschrift, das in der Mären- und Legendenüberlieferung des Mittelalters sonst nicht belegt ist. Die frühgotische Minuskel ähnelt den Schriften der bekannten mittelhochdeutschen Epenhandschriften, z.B. der Pergamenthandschrift des "Parzival" in der Bayerischen Staatsbibliothek (Cgm 19). Der Umschlag besteht aus einem Ausschnitt aus einer einseitig beschriebenen Privaturkunde, auf der nur noch wenige Wörter zu lesen sind, das darin erwähnte "Ingolstat" bestätigt jedoch immerhin die bayerische Herkunft der Urkunde und des Bändchens. Bei der Neuheftung wurden die Doppelblätter der 1. Lage vertauscht, die Handschrift ist in richtiger Folge zu lesen: Bl. 1, 4, 2, 3-6, 7, 5, 8.
I. 'Studentenabenteuer A' (Bl. 1r-8v). Mittelhochdeutsche Märendichtung in Reimpaarversen. Anfang: "Man sagt daz gut ge sellschaft/ Hab wol brüderlich ie craft...", Subskription: "Explicit..." (Rest nicht zu entziffern). 472 Verse. - Vgl. Verfasserlexikon IX, 461-464 (mit weiterer Literatur); Ausgabe: W. Stehmann, Die mittelhochdeutsche Novelle vom Studentenabenteuer (Berlin 1909). - Die pikante Erzählung berichtet von zwei Studenten, die in Paris die Universität besuchen wollen, und variiert das auch aus Boccaccios "Decamerone" und Chaucers "Canterbury Tales" bekannte Motiv des Bettentauschs. Bislang war sie nur in drei wesentlich jüngeren Handschriften sowie einem Fragment aus der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts bekannt (Dresden, Landesbibl. = heute SLUB, Mscr. M 68; Innsbruck, Landesmuseum Ferdinandeum, Cod. FB 32001; Wien, Österr. Nationalbibl., Cod. 2885; ehem. Nikolsburger Fragment I.208, heute in Salzburg, Inst. für Germanistik), die von W. Stehmann kritisch ediert wurden.
II. 'Der Ritter und die Magd namens Maria' (Bl. 9r-14r). Mittelhochdeutsche Marienlegende in Reimpaarversen. Anfang: "Ejn ritter der siten phlack/ Daz er vil selten ver lack...", Subskription: "Detur pro penna scriptori pulchra puella". 218 Verse. - Nicht im Verfasserlexikon. - Die Mirakelerzählung stammt aus dem Umkreis des 1. Buchs (Marienleben) des im 13. Jahrhundert unter dem Einfluß des Deutschen Ordens verfaßten 'Passionals', das ähnliche Marienreimdichtungen mit Anklang an die weltliche, erotisch bestimmte Märenliteraturgattung aufweist. Sie berichtet von der keuschen Liebe eines Ritters zu einer armen Wirtstochter namens Maria. Nachdem der Ritter in einem Turnier zu Ehren der hl. Jungfrau stirbt, wächst auf seinem Grab ein Bäumlein, auf dessen Blättern "Ave Maria" zu lesen ist. Die Wirtstochter gesteht ihre Liebe zu dem Toten und wird in ein Kloster geführt, wo sie - nah bei dem dorthin umgebetteten Ritter - bis zu ihrem Tod Gott und Maria dient. Als Subskription fügte der Schreiber der frommen Legende einen auch aus vielen anderen Handschriften bekannten Hexameter an ("Man möge dem Schreiber für seine Arbeit ein schönes Mädchen geben"). Eine in der Nationalbibliothek Wien (Cod. 2677) aufbewahrte Sammelhandschrift enthält eine spätere (um 1320/30) Version der Dichtung (Bl. 26-27), weitere Handschriften sind nicht bekannt, auch eine Druckausgabe existiert offenbar nicht.
III. 'Die zwei Beichten A' (Bl. 14r-16r). Mittelhochdeutsche Märendichtung in Reimpaarversen. Anfang: "Ejn man vor einem walde saz/ In daucht im war ninder baz...", Subskription: "Finito libro... a magistro/ Est sine virtute..." (Rest nicht zu entziffern). 80 Verse (dazu Vers 36a doppelt eingetragen). - Vgl. Verfasserlexikon X, 1615 f. u. H. Fischer, Studien zur deutschen Märendichtung (Tübingen 1968), Nr. 12; krit. Ausgabe in H. Niewöhner, Neues Gesamtabenteuer I, Nr. 9. - Zwei Eheleute nehmen sich gegenseitig die Beichte ab. Nachdem die Frau dem Mann gesteht, sich mit mehreren Männern, darunter auch einem Pfaffen, eingelassen zu haben, beichtet ihr der Gatte, daß er einmal die Hand der Magd berührt habe - worauf er von seiner Frau gezüchtigt wird. Bisher waren nur drei sehr viel jüngere Handschriften der Dichtung bekannt (Karlsruhe, Landesbibl., ehem. Cod. Donaueschingen 104 ['Liedersaal-Handschrift'] u. Cod. K 408; Wien, Österr. Nationalbibl., Cod. 3027). Alle drei Textzeugen werden auf das 15. Jahrhundert datiert und bieten einen abweichenden und z.T. wesentlich erweiterten Textbestand.
Bis auf kleinere Insektenfraßlöcher, Wasserflecken u. -ränder altersgemäß sehr gut erhalten, rote Tinte bei Subskriptionen u. Zeilenfüllern stellenw. abgerieben. Die erste Lage wurde unsachgemäß neu geheftet, dabei die Bll. wie oben beschrieben vertauscht, Bl. 4/5 jetzt lose. Schlußblatt verso mit zeitgenössischer oder wenig späterer Federzeichnung eines nach links sitzenden nackten Teufels (?) mit Tierohren und einer Schelle (?) in der Hand sowie 5 waagerechten kurzen Einschnitten (je ca. 1 cm).
(W)
Update:
http://www.handschriftencensus.de/23619
Die Hs. ging zurück. Ich hätte das Bild von Reiss abspeichern und auf Commons laden sollen, dann hätten wir jetzt wenigstens eine Abbildung online.
Nachtrag: Die Handschrift, Berlin, Staatsbibl., mgo 1430, ist online.
Sammelhandschrift mit Verserzählungen
Nr. 1973
Verserzählungen Märenhandschrift. - Sammelhandschrift mit drei mittelhochdeutschen Versnovellen auf Pergament. Süddeutschland (bairischer Sprachstand), späteres 13. Jahrhundert. Blattgr. 7,5:5,5 cm, Schriftraum ca. 6,5:4,5 cm. 19-25 Zeilen. Sehr kleine frühgotische Minuskel von einer Hand in brauner Tinte, Versanfänge rot gestrichelt, zahlr. rote Schlängellinien als Zeilenfüller. Mit 3 zweizeiligen roten Lombarden zu Beginn der Dichtungen, am Schluß jeweils rote Subskriptionen des Schreibers. 16 nn. Bll. (2 Quaternionen). Zeitgenössischer oder wenig späterer flex. Pergamentumschlag (Koperteinband) mit seitlichem Überschlag, ohne Schließband (Schlitze dafür vorhanden); Heftfaden der 1. Lage erneuert, Umschlag etwas nachgedunkelt, berieben u. mit Wurmspuren.
()
Einzigartige, der Forschung unbekannte und vollständige Sammelhandschrift aus dem späten 13. Jahrhundert. Enthält drei mittelhochdeutsche Versnovellen ("Mären"), von denen bisher nur weitaus spätere Textzeugen bekannt waren. In allen drei Texten scheint der ursprüngliche Versbestand sowie der Sprachstand der hochhöfischen Epik auf, während die bisher bekannten Überlieferungen sämtlich inhaltliche Ausschweifungen, Zusätze und Umschreibungen veralteter Wörter in modernerer, frühneuhochdeutscher Sprache aufweisen. Außergewöhnlich ist auch das sehr kleine Format der Handschrift, das in der Mären- und Legendenüberlieferung des Mittelalters sonst nicht belegt ist. Die frühgotische Minuskel ähnelt den Schriften der bekannten mittelhochdeutschen Epenhandschriften, z.B. der Pergamenthandschrift des "Parzival" in der Bayerischen Staatsbibliothek (Cgm 19). Der Umschlag besteht aus einem Ausschnitt aus einer einseitig beschriebenen Privaturkunde, auf der nur noch wenige Wörter zu lesen sind, das darin erwähnte "Ingolstat" bestätigt jedoch immerhin die bayerische Herkunft der Urkunde und des Bändchens. Bei der Neuheftung wurden die Doppelblätter der 1. Lage vertauscht, die Handschrift ist in richtiger Folge zu lesen: Bl. 1, 4, 2, 3-6, 7, 5, 8.
I. 'Studentenabenteuer A' (Bl. 1r-8v). Mittelhochdeutsche Märendichtung in Reimpaarversen. Anfang: "Man sagt daz gut ge sellschaft/ Hab wol brüderlich ie craft...", Subskription: "Explicit..." (Rest nicht zu entziffern). 472 Verse. - Vgl. Verfasserlexikon IX, 461-464 (mit weiterer Literatur); Ausgabe: W. Stehmann, Die mittelhochdeutsche Novelle vom Studentenabenteuer (Berlin 1909). - Die pikante Erzählung berichtet von zwei Studenten, die in Paris die Universität besuchen wollen, und variiert das auch aus Boccaccios "Decamerone" und Chaucers "Canterbury Tales" bekannte Motiv des Bettentauschs. Bislang war sie nur in drei wesentlich jüngeren Handschriften sowie einem Fragment aus der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts bekannt (Dresden, Landesbibl. = heute SLUB, Mscr. M 68; Innsbruck, Landesmuseum Ferdinandeum, Cod. FB 32001; Wien, Österr. Nationalbibl., Cod. 2885; ehem. Nikolsburger Fragment I.208, heute in Salzburg, Inst. für Germanistik), die von W. Stehmann kritisch ediert wurden.
II. 'Der Ritter und die Magd namens Maria' (Bl. 9r-14r). Mittelhochdeutsche Marienlegende in Reimpaarversen. Anfang: "Ejn ritter der siten phlack/ Daz er vil selten ver lack...", Subskription: "Detur pro penna scriptori pulchra puella". 218 Verse. - Nicht im Verfasserlexikon. - Die Mirakelerzählung stammt aus dem Umkreis des 1. Buchs (Marienleben) des im 13. Jahrhundert unter dem Einfluß des Deutschen Ordens verfaßten 'Passionals', das ähnliche Marienreimdichtungen mit Anklang an die weltliche, erotisch bestimmte Märenliteraturgattung aufweist. Sie berichtet von der keuschen Liebe eines Ritters zu einer armen Wirtstochter namens Maria. Nachdem der Ritter in einem Turnier zu Ehren der hl. Jungfrau stirbt, wächst auf seinem Grab ein Bäumlein, auf dessen Blättern "Ave Maria" zu lesen ist. Die Wirtstochter gesteht ihre Liebe zu dem Toten und wird in ein Kloster geführt, wo sie - nah bei dem dorthin umgebetteten Ritter - bis zu ihrem Tod Gott und Maria dient. Als Subskription fügte der Schreiber der frommen Legende einen auch aus vielen anderen Handschriften bekannten Hexameter an ("Man möge dem Schreiber für seine Arbeit ein schönes Mädchen geben"). Eine in der Nationalbibliothek Wien (Cod. 2677) aufbewahrte Sammelhandschrift enthält eine spätere (um 1320/30) Version der Dichtung (Bl. 26-27), weitere Handschriften sind nicht bekannt, auch eine Druckausgabe existiert offenbar nicht.
III. 'Die zwei Beichten A' (Bl. 14r-16r). Mittelhochdeutsche Märendichtung in Reimpaarversen. Anfang: "Ejn man vor einem walde saz/ In daucht im war ninder baz...", Subskription: "Finito libro... a magistro/ Est sine virtute..." (Rest nicht zu entziffern). 80 Verse (dazu Vers 36a doppelt eingetragen). - Vgl. Verfasserlexikon X, 1615 f. u. H. Fischer, Studien zur deutschen Märendichtung (Tübingen 1968), Nr. 12; krit. Ausgabe in H. Niewöhner, Neues Gesamtabenteuer I, Nr. 9. - Zwei Eheleute nehmen sich gegenseitig die Beichte ab. Nachdem die Frau dem Mann gesteht, sich mit mehreren Männern, darunter auch einem Pfaffen, eingelassen zu haben, beichtet ihr der Gatte, daß er einmal die Hand der Magd berührt habe - worauf er von seiner Frau gezüchtigt wird. Bisher waren nur drei sehr viel jüngere Handschriften der Dichtung bekannt (Karlsruhe, Landesbibl., ehem. Cod. Donaueschingen 104 ['Liedersaal-Handschrift'] u. Cod. K 408; Wien, Österr. Nationalbibl., Cod. 3027). Alle drei Textzeugen werden auf das 15. Jahrhundert datiert und bieten einen abweichenden und z.T. wesentlich erweiterten Textbestand.
Bis auf kleinere Insektenfraßlöcher, Wasserflecken u. -ränder altersgemäß sehr gut erhalten, rote Tinte bei Subskriptionen u. Zeilenfüllern stellenw. abgerieben. Die erste Lage wurde unsachgemäß neu geheftet, dabei die Bll. wie oben beschrieben vertauscht, Bl. 4/5 jetzt lose. Schlußblatt verso mit zeitgenössischer oder wenig späterer Federzeichnung eines nach links sitzenden nackten Teufels (?) mit Tierohren und einer Schelle (?) in der Hand sowie 5 waagerechten kurzen Einschnitten (je ca. 1 cm).
(W)
Update:
http://www.handschriftencensus.de/23619
Die Hs. ging zurück. Ich hätte das Bild von Reiss abspeichern und auf Commons laden sollen, dann hätten wir jetzt wenigstens eine Abbildung online.
Nachtrag: Die Handschrift, Berlin, Staatsbibl., mgo 1430, ist online.
KlausGraf - am Donnerstag, 28. April 2011, 16:18 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Stadtbibliothek Mainz löste für mich freundlicherweise das Rätsel um den DBIS-Eintrag zur Drucker-/Verlegerdatei, der auf eine Seite der Stadtbibliothek mainz verweist, die auf eine nicht mehr erreichbare Seite der HAB Wolfenbüttel verwies:
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=alle&colors=&ocolors=&lett=fs&titel_id=2935
Unsere Anfrage bei der HAB Wolfenbüttel ergab, dass diese Datenbank nicht mehr existiert. Deshalb werden wir den Link auf unserer Homepage löschen. Hier die Information von Herrn Boveland:
die Drucker/verleger-Datein ist vor einigen Jahren in den GBV übernommen
worden. Sie existiert nicht mehr als eigenständige Datenbank.
Die Daten sind aber weiterhin frei zugänglich. Bitte nutzen Sie hierfür
die GBV-Datenbank http://www.gbv.de/gsomenu/opendb.php?db=2.1&ln=de
Leider ist die Such nach den Daten nicht sehr intuitiv.
Um z.B. auf http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=308524373 zu kommen,
müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
1. Tragen Sie den Suchbegriff im Suchfenster ein, beginnen Sie den
Eintrag mit dem Suchschlüssel für Drucker- und Verleger-Normsätze
dru (Abb. 1)
2. Wählen Sie einen Treffer aus der Kurzliste aus
3. Klicken Sie aus den Link "Drucker:" (Abb. 2)
4. Klicken Sie nun auf den Link in der Zeile "Ihre Aktion bezogen auf
..." (Abb. 1)
Da die Stadtbibliothek Mainz mir die Bilder nicht mitlieferte, bin ich nun so klug wie zuvor, da ich keine Ahnung habe, was "beginnen Sie den Eintrag mit dem Suchschlüssel für Drucker- und Verleger-Normsätze dru" bedeutet. Aber schön zu wissen, was es alles in der digitalen Welt gibt ...
(W)
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=alle&colors=&ocolors=&lett=fs&titel_id=2935
Unsere Anfrage bei der HAB Wolfenbüttel ergab, dass diese Datenbank nicht mehr existiert. Deshalb werden wir den Link auf unserer Homepage löschen. Hier die Information von Herrn Boveland:
die Drucker/verleger-Datein ist vor einigen Jahren in den GBV übernommen
worden. Sie existiert nicht mehr als eigenständige Datenbank.
Die Daten sind aber weiterhin frei zugänglich. Bitte nutzen Sie hierfür
die GBV-Datenbank http://www.gbv.de/gsomenu/opendb.php?db=2.1&ln=de
Leider ist die Such nach den Daten nicht sehr intuitiv.
Um z.B. auf http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=308524373 zu kommen,
müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
1. Tragen Sie den Suchbegriff im Suchfenster ein, beginnen Sie den
Eintrag mit dem Suchschlüssel für Drucker- und Verleger-Normsätze
dru (Abb. 1)
2. Wählen Sie einen Treffer aus der Kurzliste aus
3. Klicken Sie aus den Link "Drucker:" (Abb. 2)
4. Klicken Sie nun auf den Link in der Zeile "Ihre Aktion bezogen auf
..." (Abb. 1)
Da die Stadtbibliothek Mainz mir die Bilder nicht mitlieferte, bin ich nun so klug wie zuvor, da ich keine Ahnung habe, was "beginnen Sie den Eintrag mit dem Suchschlüssel für Drucker- und Verleger-Normsätze dru" bedeutet. Aber schön zu wissen, was es alles in der digitalen Welt gibt ...
(W)
... schon seit fast einem Jahr online,
http://www.facebook.com/pages/Stadtarchiv-Amberg/119890851372886?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/Stadtarchiv-Amberg/119890851372886?sk=wall
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=1541
Interview mit Anna Schreurs, Carsten Blüm und Thorsten Wübbena, die Ende März im Kunsthistorischen Institut in Florenz einen Workshop und Round Table zum Thema "Wissen(schaft) online" abgehalten haben.
(RSS)
Interview mit Anna Schreurs, Carsten Blüm und Thorsten Wübbena, die Ende März im Kunsthistorischen Institut in Florenz einen Workshop und Round Table zum Thema "Wissen(schaft) online" abgehalten haben.
(RSS)
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.wired.com/epicenter/2011/04/youtube-delicious/
Wer Delicious weiter nutzen will, muss dem Übergang zu AVOS ausdrücklich zustimmen.
(RSS)

Wer Delicious weiter nutzen will, muss dem Übergang zu AVOS ausdrücklich zustimmen.
(RSS)
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.hab.de/bibliothek/wdb/europeana-regia/
Der Handschriftencensus hat davon wieder nichts mitbekommen, sonst würde z.B. bei http://www.handschriftencensus.de/17241 oder http://www.handschriftencensus.de/17246 das Digitalisat vermerkt sein. Auch die Handschriftenbeschreibungen sind nicht verlinkt.
(W)
Der Handschriftencensus hat davon wieder nichts mitbekommen, sonst würde z.B. bei http://www.handschriftencensus.de/17241 oder http://www.handschriftencensus.de/17246 das Digitalisat vermerkt sein. Auch die Handschriftenbeschreibungen sind nicht verlinkt.
(W)
KlausGraf - am Donnerstag, 28. April 2011, 00:14 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 27. April 2011, 23:41 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blog.arthistoricum.net/osterratsel/
Bei unseren Rätseln hier gabs bisher echte Preise, wenn etwas ausgelobt wurde. Gewinner, die diese erhielten, können das bestätigen.
(W)
Bei unseren Rätseln hier gabs bisher echte Preise, wenn etwas ausgelobt wurde. Gewinner, die diese erhielten, können das bestätigen.
(W)
KlausGraf - am Mittwoch, 27. April 2011, 21:52 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
I hope that everyone saw in the latest “In the Loop” from SAA that it is making 82 out-of-print SAA publications freely accessible via the HathiTrust (http://www.hathitrust.org). There is a press release about it at http://www2.archivists.org/news/2011/treasure-trove.
This is a tremendous gift to archival research and education. Kudos to Paul Conway, Teresa Brinati, and the rest of the SAA staff who made this happen.
(ML) Peter Hirtle in Archives-L
SAA has granted full-view permission for 82 out-of-print publications. The oldest item is August Robert Sueflow’s A Preliminary Guide to Church Record Repositories (1969). Highlights among the released publications include the original SAA Fundamental Series, important SAA planning reports (e.g., Planning for the Archival Profession 1986, Image of Archivists 1984, and Evaluation of Archival Institutions 1982), and Steve Hensen’s Archives, Personal Papers, and Manuscripts (1989). Also available now are three glossaries of archival terms spanning a 30 year period (Evans 1973; Bellardo 1992; Pearce-Moses 2005). A 1996 reprint of T. R. Schellenberg’s archival classic Modern Archives: Principles and Techniques is also included in the release.
Beyond individual publications, the material available in HathiTrust includes a full run of the SAA Newsletter from 1979 to 1998 and a two-volume compilation index for the first 30 volumes of American Archivist. Volumes 1 through 62 (1938 to 1999) of the journal itself are fully viewable through the HathiTrust interface.
American Archivist:
http://catalog.hathitrust.org/Record/000597749
(ML)
This is a tremendous gift to archival research and education. Kudos to Paul Conway, Teresa Brinati, and the rest of the SAA staff who made this happen.
(ML) Peter Hirtle in Archives-L
SAA has granted full-view permission for 82 out-of-print publications. The oldest item is August Robert Sueflow’s A Preliminary Guide to Church Record Repositories (1969). Highlights among the released publications include the original SAA Fundamental Series, important SAA planning reports (e.g., Planning for the Archival Profession 1986, Image of Archivists 1984, and Evaluation of Archival Institutions 1982), and Steve Hensen’s Archives, Personal Papers, and Manuscripts (1989). Also available now are three glossaries of archival terms spanning a 30 year period (Evans 1973; Bellardo 1992; Pearce-Moses 2005). A 1996 reprint of T. R. Schellenberg’s archival classic Modern Archives: Principles and Techniques is also included in the release.
Beyond individual publications, the material available in HathiTrust includes a full run of the SAA Newsletter from 1979 to 1998 and a two-volume compilation index for the first 30 volumes of American Archivist. Volumes 1 through 62 (1938 to 1999) of the journal itself are fully viewable through the HathiTrust interface.
American Archivist:
http://catalog.hathitrust.org/Record/000597749
(ML)
KlausGraf - am Mittwoch, 27. April 2011, 19:30 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
(W)
Wolf Thomas - am Mittwoch, 27. April 2011, 19:00 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.netzpolitik.org/2011/bawu-grun-roter-koalitionsvertrag-zu-netzpolitik/
Open Access, Seite 21:
Gleichzeitig wollen wir größtmögliche Transparenz und allgemeine Zugänglichkeit zu wissenschaftlichen Daten herstellen. Dazu werden wir gemeinsam mit den Hochschulen und Universitätsbibliotheken des Landes eine Open-Access-Strategie entwickeln. Dabei prüfen wir, wie das Prinzip umgesetzt werden kann, alle öffentlich geförderten und alle durch das Land beauftragten Forschungsergebnisse kostenfrei der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Möglichkeit der Hochschulen zur Forschung im Auftrag Dritter darf dadurch nicht beeinträchtigt werden.
Ebenfalls wichtig:
Transparenz des Regierungshandelns im Netz
Wir stehen für eine offene Gesellschaft und eine transparente Verwaltung. Die bisherigen Aktivitäten Baden-Württembergs im Bereich e-Government und digitaler Demokratie werden wir ausbauen. Dabei werden wir insbesondere auch auf die Barrierefreiheit aller öffentlichen Angebote achten, und darauf, dass Teilhabe am öffentlichen Leben auch ohne Netzzugang möglich bleibt. Zu den großen Chancen digitaler Netze gehört die Möglichkeit, die Grundlagen des Regierungshandelns transparent und zugänglich zu machen. In einem umfassenden Informationsfreiheitsgesetz werden wir gesetzliche Regelungen treffen, damit Bürgerinnen und Bürger unter Beachtung des Datenschutzes grundsätzlich freien Zugang zu den bei den öffentlichen Verwaltungen vorhandenen Informationen haben. Wir werden unser Regierungshandeln daran orientieren, die zugrunde liegenden Daten und Dokumente weitestmöglich öffentlich zugänglich zu machen. Hier orientieren wir uns am Grundsatz „Open Data“.
Quelle:
http://www.gruene-bw.de/fileadmin/gruenebw/dateien/Koalitionsvertrag-web.pdf
(T)
Open Access, Seite 21:
Gleichzeitig wollen wir größtmögliche Transparenz und allgemeine Zugänglichkeit zu wissenschaftlichen Daten herstellen. Dazu werden wir gemeinsam mit den Hochschulen und Universitätsbibliotheken des Landes eine Open-Access-Strategie entwickeln. Dabei prüfen wir, wie das Prinzip umgesetzt werden kann, alle öffentlich geförderten und alle durch das Land beauftragten Forschungsergebnisse kostenfrei der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Möglichkeit der Hochschulen zur Forschung im Auftrag Dritter darf dadurch nicht beeinträchtigt werden.
Ebenfalls wichtig:
Transparenz des Regierungshandelns im Netz
Wir stehen für eine offene Gesellschaft und eine transparente Verwaltung. Die bisherigen Aktivitäten Baden-Württembergs im Bereich e-Government und digitaler Demokratie werden wir ausbauen. Dabei werden wir insbesondere auch auf die Barrierefreiheit aller öffentlichen Angebote achten, und darauf, dass Teilhabe am öffentlichen Leben auch ohne Netzzugang möglich bleibt. Zu den großen Chancen digitaler Netze gehört die Möglichkeit, die Grundlagen des Regierungshandelns transparent und zugänglich zu machen. In einem umfassenden Informationsfreiheitsgesetz werden wir gesetzliche Regelungen treffen, damit Bürgerinnen und Bürger unter Beachtung des Datenschutzes grundsätzlich freien Zugang zu den bei den öffentlichen Verwaltungen vorhandenen Informationen haben. Wir werden unser Regierungshandeln daran orientieren, die zugrunde liegenden Daten und Dokumente weitestmöglich öffentlich zugänglich zu machen. Hier orientieren wir uns am Grundsatz „Open Data“.
Quelle:
http://www.gruene-bw.de/fileadmin/gruenebw/dateien/Koalitionsvertrag-web.pdf
(T)
KlausGraf - am Mittwoch, 27. April 2011, 15:37 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.suedkurier.de/region/linzgau-zollern-alb/kreis-sigmaringen/Mit-einem-Klick-in-die-Geschichte;art372548,4851325
"Von den mehr als 132 000 im Gesamtbestand erfassten Personen sind 56 527 auch im Internet recherchierbar. Die übrigen Namen können zurzeit aus personenschutzrechtlichen Gründen noch nicht in das Internet eingestellt werden."
(RSS)

"Von den mehr als 132 000 im Gesamtbestand erfassten Personen sind 56 527 auch im Internet recherchierbar. Die übrigen Namen können zurzeit aus personenschutzrechtlichen Gründen noch nicht in das Internet eingestellt werden."
(RSS)

KlausGraf - am Mittwoch, 27. April 2011, 15:21 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://ast.signum.sns.it
Die Seite führt die Findmittel der Archive zusammen. Wenn man aber beim Blättern einen beliebigen in diesen gefundenen Begriff in den Suchschlitz füttert und dann keinen Treffer erhält
Nessun risultato trovato per la stringa Ruoli dei contribuenti
fragt man sich schon, was das soll.
(RSS)
Die Seite führt die Findmittel der Archive zusammen. Wenn man aber beim Blättern einen beliebigen in diesen gefundenen Begriff in den Suchschlitz füttert und dann keinen Treffer erhält
Nessun risultato trovato per la stringa Ruoli dei contribuenti
fragt man sich schon, was das soll.
(RSS)
KlausGraf - am Mittwoch, 27. April 2011, 15:06 - Rubrik: Erschließung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.kanzlei.biz/nc/urteile/26-01-2011-ag-hamburg-az-36-a-c-243-10.html
Die Entscheidung des AG Hamburg gegen Volker Rieble (Das Wissenschaftsplagiat S. 19) überzeugt nicht. Es muss erlaubt sein, im wissenschaftlichen Kontext einen Verdacht über mögliche Abhängigkeiten (Ideenklau) zu äußern, ohne von einer Hamburger Zensurkammer wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Rechenschaft gezogen zu werden. Hätte Stephan Lorenz für seine beiden NJW-Aufsätze 2003 und 2005 sorgfältig recherchiert, dann hätte er auf den Aufsatz Riebles DB 1989 stoßen müssen. Angesichts dieser Sachlage den Verdacht eines Ideenklaus zu äußern, ist eine vertretbare Hypothese und keine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Die Wissenschaft lebt von der Hypothesenbildung und sollte nicht der presserechtlichen Hamburger Zensurjustiz unterworfen werden.
(RSS)
Die Entscheidung des AG Hamburg gegen Volker Rieble (Das Wissenschaftsplagiat S. 19) überzeugt nicht. Es muss erlaubt sein, im wissenschaftlichen Kontext einen Verdacht über mögliche Abhängigkeiten (Ideenklau) zu äußern, ohne von einer Hamburger Zensurkammer wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Rechenschaft gezogen zu werden. Hätte Stephan Lorenz für seine beiden NJW-Aufsätze 2003 und 2005 sorgfältig recherchiert, dann hätte er auf den Aufsatz Riebles DB 1989 stoßen müssen. Angesichts dieser Sachlage den Verdacht eines Ideenklaus zu äußern, ist eine vertretbare Hypothese und keine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Die Wissenschaft lebt von der Hypothesenbildung und sollte nicht der presserechtlichen Hamburger Zensurjustiz unterworfen werden.
(RSS)
KlausGraf - am Mittwoch, 27. April 2011, 14:32 - Rubrik: Archivrecht
Gut versteckt:
http://www.lfdi.saarland.de/images/stories/pdf/Berichte/tb23.pdf
Einige wenige Seiten zur Informationsfreiheit.
(T)
http://www.lfdi.saarland.de/images/stories/pdf/Berichte/tb23.pdf
Einige wenige Seiten zur Informationsfreiheit.
(T)
KlausGraf - am Mittwoch, 27. April 2011, 13:56 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Interessante Taktik der Gegner des Whistleblowing:
1. Assange ist in seiner Reaktionsfähigkeit aufgrund des Auslieferungsverfahrens stark eingeschränkt
2. Er soll sexuelle Straftaten begangen haben
3. Oh Wunder: die Kontrolle über die wikileaks Unterlagen soll verloren gegangen sein. Wikileaks soll undicht sein, so habe NYT Guantanamo Unterlagen bereits vorher erhalten. Daniel Domscheit-Berg soll es nicht gewesen sein.
So wird Wikileaks mit folgendem Satz im Artikel der FAZ erodiert:
"Mit der Kontrolle über Dateien hat Wikileaks auch die Kontrolle des Informationsflusses verloren, mit dem gezielt Kampagnenarbeit betrieben wird".
Wie durchschaubar. Wikileaks habe nichts mehr zu bieten. Wirklich ?
Siehe FAZ
http://goo.gl/x5uO3
Und über die Sache selbst, soll niemand sprechen. Das Wegsperren kranker Menschen.
http://vierprinzen.blogspot.com/
1. Assange ist in seiner Reaktionsfähigkeit aufgrund des Auslieferungsverfahrens stark eingeschränkt
2. Er soll sexuelle Straftaten begangen haben
3. Oh Wunder: die Kontrolle über die wikileaks Unterlagen soll verloren gegangen sein. Wikileaks soll undicht sein, so habe NYT Guantanamo Unterlagen bereits vorher erhalten. Daniel Domscheit-Berg soll es nicht gewesen sein.
So wird Wikileaks mit folgendem Satz im Artikel der FAZ erodiert:
"Mit der Kontrolle über Dateien hat Wikileaks auch die Kontrolle des Informationsflusses verloren, mit dem gezielt Kampagnenarbeit betrieben wird".
Wie durchschaubar. Wikileaks habe nichts mehr zu bieten. Wirklich ?
Siehe FAZ
http://goo.gl/x5uO3
Und über die Sache selbst, soll niemand sprechen. Das Wegsperren kranker Menschen.
http://vierprinzen.blogspot.com/
vom hofe - am Mittwoch, 27. April 2011, 09:20 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine für die Region sehr wichtige historische Ausstellung hat Stadtarchivar Werner Mühlhäußer nach Gunzenhausen geholt: „Der Hesselberg – ein ‚heiliger‘ Ort der Täter“.
http://www.nordbayern.de/region/gunzenhausen/hesselberg-ausstellung-ein-heiliger-ort-der-tater-1.1142186
(W)

http://www.nordbayern.de/region/gunzenhausen/hesselberg-ausstellung-ein-heiliger-ort-der-tater-1.1142186
(W)

KlausGraf - am Mittwoch, 27. April 2011, 00:40 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.vivianmaier.com
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/11886297/
Zu Maier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Vivian_Maier
(ML)
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/11886297/
Zu Maier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Vivian_Maier
(ML)
KlausGraf - am Dienstag, 26. April 2011, 23:08 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.einsichten-online.de/2011/04/1240/
Ein eigenartiger Text im Kanzleistil ("können hierüber keine Auskünfte erteilt werden"), der nicht nur dort versagt, wo es konkret werden müsste (bei den Gebühren). Cui bono?
(RSS)
Ein eigenartiger Text im Kanzleistil ("können hierüber keine Auskünfte erteilt werden"), der nicht nur dort versagt, wo es konkret werden müsste (bei den Gebühren). Cui bono?
(RSS)
KlausGraf - am Dienstag, 26. April 2011, 21:19 - Rubrik: Universitaetsarchive
http://www.faz.net/-01t13d
Kniffelige Rechtslage. Vom Unglück, einen Schatz zu finden
Von Lukas Weber
Auszüge:
Ein Schatzregal hat durchaus weitreichende Folgen, erklärt Preuschen [Diethardt von Preuschen, Rechtsanwalt - KG]. „Vergisst“ jemand, seinen Fund von vielleicht kulturhistorischem Wert den zuständigen Behörden zu melden, begeht er nur eine Ordnungswidrigkeit. Gibt es ein Schatzregal, macht er sich der Unterschlagung schuldig – sogar dann, wenn er selbst der Grundstückseigentümer ist. Der Straftatbestand wird mit bis zu drei Jahren geahndet. Käufern der Münze droht eine Anzeige wegen Hehlerei. Höchst unterschiedlich ist freilich der Besitzanspruch der Länder: In Berlin und Sachsen hat der Staat ein totales Schatzregal eingeführt [...]. In Niedersachsen dagegen gibt es ein kleines Schatzregal, wonach nur Funde, die durch staatliche Nachforschungen entdeckt wurden, Eigentum des Landes werden; sonst gilt die Regelung des BGB.
Mit einer solchen Lösung können sich auch die meisten Kritiker des Schatzregals anfreunden. Jüngste Versuche der Regierung in Hannover, die Ansprüche zu einem totalen Schatzregal auszuweiten, sind offenbar am energischen Widerstand der Betroffenen gescheitert. Dazwischen steht das große Schatzregal. Es sieht vor, dass auch sämtliche Funde dem Land zufallen, die „einen hervorragenden wissenschaftlichen Wert haben“. Da man darüber trefflich streiten kann, ist der Ärger programmiert. „Alte Münzen haben immer einen wissenschaftlichen Wert“, meint Preuschen. Dennoch haben die meisten Bundesländer eine solche Regelung eingeführt. Rheinland-Pfalz sieht wenigstens einen Finderlohn vor, „im Rahmen der verfügbaren Mittel des Landeshaushalts“, was keine übertriebenen Erwartungen weckt, Sachsen-Anhalt verspricht eine „angemessene Entlohnung“, wenngleich nur als Kann-Vorschrift, Schleswig-Holstein definiert einen Anspruch darauf. Der Grundstückseigentümer geht in solchen Fällen indessen stets leer aus.
Die im Vergleich liberale Handhabung in Hessen könnte freilich bald ein Ende haben. Die Regierungsfraktionen im Landtag haben im vergangenen Jahr einen dringlichen Gesetzentwurf zur Einführung eines totalen Schatzregals vorgelegt. Dass ausgerechnet die christlich-liberale Koalition ein Enteignungsgesetz beschließen möchte, kann Preuschen nicht verstehen. Anderen ging es geradeso, es hagelte Proteste von Religionsgemeinschaften, Grundeigentümern, Waldbesitzern, Landwirtschaftsverbänden, Hobby-Archäologen und Numismatikern. Und von den eigenen Kommunen. Nach einer Anhörung vor dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst im Februar ist der Entwurf deswegen entschärft worden.
Man sei vielleicht etwas über das Ziel hinausgeschossen, sagt der Landtagsabgeordnete Mario Döweling, der in der FDP-Fraktion für das Gesetzesvorhaben zuständig ist. Jenes Ziel, dem Land besondere Funde von wissenschaftlichem Wert zu sichern, sei auch mit der jetzt gefundenen kleinen Lösung erreichbar, die nach der Osterpause im Landtag beschlossen werden soll. Sie entspricht dem, was Preuschen als großes Schatzregal definiert; der Staat behält, was ihm gefällt. „Im neuen Entwurf ist außerdem eine angemessene Entschädigung für den Finder vorgesehen“, sagt Döweling.
Das sei zu wenig konkret, kritisiert Walter Franke, der Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Argus, „ins Gesetz muss ein Prozentsatz hinein“. Die Hälfte des Werts sei angemessen. In Rheinland-Pfalz habe ein Sondengänger im vergangenen Jahr einen römischen Münzschatz von 50 Kilogramm gefunden und dafür 1000 Euro erhalten – er sei aber noch nicht einmal zur Präsentation eingeladen worden. Die Mitglieder von Argus suchen mit einem Metalldetektor und einer behördlichen Lizenz den Boden ab, vorwiegend „gestörte Flächen“, zum Beispiel Äcker. Was die Hobby-Archäologen finden, geben sie ab. Dass das Land sich den Finderlohn nicht leisten könne, hält Franke für vorgeschoben. „Wenn alle zehn Jahre mal ein herausragender Fund auftritt, ist das viel.“
Die Statue des Keltenfürsten vom Glauberg sei angeblich 70.000 Euro wert, das spiele keine Rolle im Vergleich zum Museum, das darum herum gebaut worden sei. Und der berühmte römische Pferdekopf sei gewiss die für den Ausschuss angegebenen 3 Millionen Euro nicht wert. Ein Schatzregal bewirkt nach Frankes Ansicht nur eines: „Es gibt weniger Funde.“ In Baden-Württemberg mit Schatzregal würden im Jahr etwa 80 Münzen gefunden, in Bayern ohne Schatzregal seien es 6000. Im Ausland sind die Erfahrungen ähnlich, in Ländern ohne Schatzregal wie Österreich findet sich regelmäßig mehr. So gesehen kann Sondengänger Franke verstehen, dass das hessische Landesamt für Denkmalschutz für ein Schatzregal kämpft. „Die versinken in Arbeit.“
Siehe hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=schatzregal
Weitere Materialien:
Unterschriftenliste gegen das große Schatzregal:
http://www.muenzclub-jever.de/umfrage/index.php
http://www.zeitung.schatzsuchen.de/
(RSS)
Kniffelige Rechtslage. Vom Unglück, einen Schatz zu finden
Von Lukas Weber
Auszüge:
Ein Schatzregal hat durchaus weitreichende Folgen, erklärt Preuschen [Diethardt von Preuschen, Rechtsanwalt - KG]. „Vergisst“ jemand, seinen Fund von vielleicht kulturhistorischem Wert den zuständigen Behörden zu melden, begeht er nur eine Ordnungswidrigkeit. Gibt es ein Schatzregal, macht er sich der Unterschlagung schuldig – sogar dann, wenn er selbst der Grundstückseigentümer ist. Der Straftatbestand wird mit bis zu drei Jahren geahndet. Käufern der Münze droht eine Anzeige wegen Hehlerei. Höchst unterschiedlich ist freilich der Besitzanspruch der Länder: In Berlin und Sachsen hat der Staat ein totales Schatzregal eingeführt [...]. In Niedersachsen dagegen gibt es ein kleines Schatzregal, wonach nur Funde, die durch staatliche Nachforschungen entdeckt wurden, Eigentum des Landes werden; sonst gilt die Regelung des BGB.
Mit einer solchen Lösung können sich auch die meisten Kritiker des Schatzregals anfreunden. Jüngste Versuche der Regierung in Hannover, die Ansprüche zu einem totalen Schatzregal auszuweiten, sind offenbar am energischen Widerstand der Betroffenen gescheitert. Dazwischen steht das große Schatzregal. Es sieht vor, dass auch sämtliche Funde dem Land zufallen, die „einen hervorragenden wissenschaftlichen Wert haben“. Da man darüber trefflich streiten kann, ist der Ärger programmiert. „Alte Münzen haben immer einen wissenschaftlichen Wert“, meint Preuschen. Dennoch haben die meisten Bundesländer eine solche Regelung eingeführt. Rheinland-Pfalz sieht wenigstens einen Finderlohn vor, „im Rahmen der verfügbaren Mittel des Landeshaushalts“, was keine übertriebenen Erwartungen weckt, Sachsen-Anhalt verspricht eine „angemessene Entlohnung“, wenngleich nur als Kann-Vorschrift, Schleswig-Holstein definiert einen Anspruch darauf. Der Grundstückseigentümer geht in solchen Fällen indessen stets leer aus.
Die im Vergleich liberale Handhabung in Hessen könnte freilich bald ein Ende haben. Die Regierungsfraktionen im Landtag haben im vergangenen Jahr einen dringlichen Gesetzentwurf zur Einführung eines totalen Schatzregals vorgelegt. Dass ausgerechnet die christlich-liberale Koalition ein Enteignungsgesetz beschließen möchte, kann Preuschen nicht verstehen. Anderen ging es geradeso, es hagelte Proteste von Religionsgemeinschaften, Grundeigentümern, Waldbesitzern, Landwirtschaftsverbänden, Hobby-Archäologen und Numismatikern. Und von den eigenen Kommunen. Nach einer Anhörung vor dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst im Februar ist der Entwurf deswegen entschärft worden.
Man sei vielleicht etwas über das Ziel hinausgeschossen, sagt der Landtagsabgeordnete Mario Döweling, der in der FDP-Fraktion für das Gesetzesvorhaben zuständig ist. Jenes Ziel, dem Land besondere Funde von wissenschaftlichem Wert zu sichern, sei auch mit der jetzt gefundenen kleinen Lösung erreichbar, die nach der Osterpause im Landtag beschlossen werden soll. Sie entspricht dem, was Preuschen als großes Schatzregal definiert; der Staat behält, was ihm gefällt. „Im neuen Entwurf ist außerdem eine angemessene Entschädigung für den Finder vorgesehen“, sagt Döweling.
Das sei zu wenig konkret, kritisiert Walter Franke, der Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Argus, „ins Gesetz muss ein Prozentsatz hinein“. Die Hälfte des Werts sei angemessen. In Rheinland-Pfalz habe ein Sondengänger im vergangenen Jahr einen römischen Münzschatz von 50 Kilogramm gefunden und dafür 1000 Euro erhalten – er sei aber noch nicht einmal zur Präsentation eingeladen worden. Die Mitglieder von Argus suchen mit einem Metalldetektor und einer behördlichen Lizenz den Boden ab, vorwiegend „gestörte Flächen“, zum Beispiel Äcker. Was die Hobby-Archäologen finden, geben sie ab. Dass das Land sich den Finderlohn nicht leisten könne, hält Franke für vorgeschoben. „Wenn alle zehn Jahre mal ein herausragender Fund auftritt, ist das viel.“
Die Statue des Keltenfürsten vom Glauberg sei angeblich 70.000 Euro wert, das spiele keine Rolle im Vergleich zum Museum, das darum herum gebaut worden sei. Und der berühmte römische Pferdekopf sei gewiss die für den Ausschuss angegebenen 3 Millionen Euro nicht wert. Ein Schatzregal bewirkt nach Frankes Ansicht nur eines: „Es gibt weniger Funde.“ In Baden-Württemberg mit Schatzregal würden im Jahr etwa 80 Münzen gefunden, in Bayern ohne Schatzregal seien es 6000. Im Ausland sind die Erfahrungen ähnlich, in Ländern ohne Schatzregal wie Österreich findet sich regelmäßig mehr. So gesehen kann Sondengänger Franke verstehen, dass das hessische Landesamt für Denkmalschutz für ein Schatzregal kämpft. „Die versinken in Arbeit.“
Siehe hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=schatzregal
Weitere Materialien:
Unterschriftenliste gegen das große Schatzregal:
http://www.muenzclub-jever.de/umfrage/index.php
http://www.zeitung.schatzsuchen.de/
(RSS)
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.stadtarchaeologie.at/wp-content/uploads/eBook_WS14_Part2_Workshops.pdf
Ein munteres Allerlei von der Archäologie bis zur Digitalisierung in Klosterbibliotheken.
Update dank VÖBBLOG: Inhaltsverzeichnis
http://www.stadtarchaeologie.at/?page_id=1322
(W)
Ein munteres Allerlei von der Archäologie bis zur Digitalisierung in Klosterbibliotheken.
Update dank VÖBBLOG: Inhaltsverzeichnis
http://www.stadtarchaeologie.at/?page_id=1322
(W)
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.ordensarchive.at/images/stories/beitrag/Regeln_fuer_den_Umgang_mit_bibliothekarischem_Altbestand.pdf
2. Unter Altbestand werden im Folgenden Bücher, Handschriften und Archivalien verstanden, die vor 1850 gedruckt oder geschrieben wurden. [...]
3. Die Bücher und Archivalien haben einzeln und als Sammlung eine deutlich individuelle Prägung; sie sind schützenswertes Kulturgut, zu deren Erhaltung die kirchlichen Einrichtungen verpflichtet sind. [...]
21. Altbestand ist integraler Bestandteil der Geschichte, Tradition und Kultur der jeweiligen kirchlichen Einrichtung. Diesen räumlichen und geschichtlichen Zusammenhang zu erhalten ist vorrangig.
22. Wenn aus räumlichen, finanziellen oder konservatorischen Gründen oder wegen fehlenden Fachpersonals Altbestand auf längere Sicht nicht verantwortlich aufbewahrt oder erschlossen werden kann, kann eine Abgabe an eine andere öffentlich zugängliche, bevorzugt kirchliche, unter Beachtung regionalhistorischer Zusammenhänge des Bestandes auch lokale Einrichtung erwogen werden.
23. Textidentische Exemplare, die sich durch Einband, handschriftliche Einträge etc. unterscheiden, können nicht als Dublette bewertet und abgegeben werden.
Hat man sich etwa im Fall Eichstätt daran gehalten?
http://archiv.twoday.net/search?q=eichst%C3%A4tt
(W)
2. Unter Altbestand werden im Folgenden Bücher, Handschriften und Archivalien verstanden, die vor 1850 gedruckt oder geschrieben wurden. [...]
3. Die Bücher und Archivalien haben einzeln und als Sammlung eine deutlich individuelle Prägung; sie sind schützenswertes Kulturgut, zu deren Erhaltung die kirchlichen Einrichtungen verpflichtet sind. [...]
21. Altbestand ist integraler Bestandteil der Geschichte, Tradition und Kultur der jeweiligen kirchlichen Einrichtung. Diesen räumlichen und geschichtlichen Zusammenhang zu erhalten ist vorrangig.
22. Wenn aus räumlichen, finanziellen oder konservatorischen Gründen oder wegen fehlenden Fachpersonals Altbestand auf längere Sicht nicht verantwortlich aufbewahrt oder erschlossen werden kann, kann eine Abgabe an eine andere öffentlich zugängliche, bevorzugt kirchliche, unter Beachtung regionalhistorischer Zusammenhänge des Bestandes auch lokale Einrichtung erwogen werden.
23. Textidentische Exemplare, die sich durch Einband, handschriftliche Einträge etc. unterscheiden, können nicht als Dublette bewertet und abgegeben werden.
Hat man sich etwa im Fall Eichstätt daran gehalten?
http://archiv.twoday.net/search?q=eichst%C3%A4tt
(W)
http://classic-web.archive.org/web/20000824090119/www.tu-chemnitz.de/~nosc/graf.htm
1997 gehalten auf dem Brackweder Arbeitskreis in Chemnitz
http://www.brackweder-ak.de/tagungen_bislang.html
(W)

1997 gehalten auf dem Brackweder Arbeitskreis in Chemnitz
http://www.brackweder-ak.de/tagungen_bislang.html
(W)

KlausGraf - am Dienstag, 26. April 2011, 20:14 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://goo.gl/rCrUK = www.heimatkundliche-vereinigung.de
Die „Heimatkundlichen Blätter“ sind das Organ des Vereins. Es erscheint seit 30. Januar 1954 als monatliche Beilage des derzeitigen Zollern-Alb-Kuriers. In den „Heimatkundlichen Blättern“ werden Berichte über Geschichte, Kunst, Kultur, Wirtschaft, Naturwissenschaften und Politik und insbesondere auch über Persönlichkeiten aus unserem Raum veröffentlicht. [...]
Die „Heimatkundlichen Blätter“ von 1954 bis 2008 finden Sie neuerdings im "Download"-Bereich. Diese Ausgaben sind OCR-behandelt, das heißt im Text kann mit der Suche-Funktion recherchiert werden. [...]
Erschlossen sind die "Heimatkundlichen Blätter Balingen" bis Dezember 1997 durch Autoren-, Orts-, Personen- und Sachregister [...].
1954 hießen die Blätter noch "Heimatkundliche Blätter für den Kreis Balingen". Erfreulich ist neben der OCR auch die Entscheidung für Faksimiles.
Am 30. April 1955 behandelte ein mir bislang natürlich unbekannter Artikel den wohl in vorterritoriale Zeit zurückreichenden Zollkornbereich von Balingen und Ebingen.
(PM)
#histverein
Die „Heimatkundlichen Blätter“ sind das Organ des Vereins. Es erscheint seit 30. Januar 1954 als monatliche Beilage des derzeitigen Zollern-Alb-Kuriers. In den „Heimatkundlichen Blättern“ werden Berichte über Geschichte, Kunst, Kultur, Wirtschaft, Naturwissenschaften und Politik und insbesondere auch über Persönlichkeiten aus unserem Raum veröffentlicht. [...]
Die „Heimatkundlichen Blätter“ von 1954 bis 2008 finden Sie neuerdings im "Download"-Bereich. Diese Ausgaben sind OCR-behandelt, das heißt im Text kann mit der Suche-Funktion recherchiert werden. [...]
Erschlossen sind die "Heimatkundlichen Blätter Balingen" bis Dezember 1997 durch Autoren-, Orts-, Personen- und Sachregister [...].
1954 hießen die Blätter noch "Heimatkundliche Blätter für den Kreis Balingen". Erfreulich ist neben der OCR auch die Entscheidung für Faksimiles.
Am 30. April 1955 behandelte ein mir bislang natürlich unbekannter Artikel den wohl in vorterritoriale Zeit zurückreichenden Zollkornbereich von Balingen und Ebingen.
(PM)
#histverein
KlausGraf - am Dienstag, 26. April 2011, 18:50 - Rubrik: Landesgeschichte
Mir ist unverständlich, wie Bibliotheken wie die UMich nach wie vor die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie GALE pflegen und damit die Public Domain nachhaltig schädigen.
http://www.lib.umich.edu/tcp/
Dass "2,231 searchable keyed-text editions of books from Eighteenth Century Collections Online (ECCO)" per Mail von interessierten Wissenschaftlern angefordert werden können (!), kann mich nicht zu Jubelschreien motivieren.
(RSS)
http://www.lib.umich.edu/tcp/
Dass "2,231 searchable keyed-text editions of books from Eighteenth Century Collections Online (ECCO)" per Mail von interessierten Wissenschaftlern angefordert werden können (!), kann mich nicht zu Jubelschreien motivieren.
(RSS)
KlausGraf - am Dienstag, 26. April 2011, 16:23 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
URN: urn:nbn:de:bsz:25-opus-80684
URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8068/
Graf, Klaus: Andreas Nawer († 29. April 1506), Pfarrer zu Lorch und Übersetzer einer Notariatslehre. In: Blätter für württembergische Kirchengeschichte 110 (2010), S. 265-271
Andreas Nawer, von 1492 bis zu seinem Tod einer der vier Pfarrer in Lorch (Ostalbkreis), übersetzte 1502 eine lateinische Notariatslehre. Aus Anlass der Digitalisierung des Nürnberger Drucks durch die UB München (urn:nbn:de:bvb:19-epub-11485-2) werden die spärlichen Lebenszeugnisse Nawers zusammengestellt und das intellektuelle Umfeld um 1500 in Lorch (Kloster und Stadtpfarrkirche) und in der nahegelegenen Reichsstadt Schwäbisch Gmünd ausgeleuchtet, nämlich die Kontakte zu: dem Gast-Benediktiner im Lorcher Kloster Thomas Finck (1493), der ein beeindruckendes Oeuvre an deutschsprachigen Erbauungsschriften hinterließ, dem Gmünder Notar Johannes Baldung, dem Gmünder Stadtschreiber Rudolf Holl, Verfasser des Turmeinsturzberichts 1497, dem Mönch Augustin Seiz, der die Überlieferung seiner Abtei schreibend durchforstete und dem »ordnungsliebenden« Pfarrer und Wittenberger Professor Thomas Köllin.
Bemerkung: PDF mit unkorrigierter OCR.
(RSS)
URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8068/
Graf, Klaus: Andreas Nawer († 29. April 1506), Pfarrer zu Lorch und Übersetzer einer Notariatslehre. In: Blätter für württembergische Kirchengeschichte 110 (2010), S. 265-271
Andreas Nawer, von 1492 bis zu seinem Tod einer der vier Pfarrer in Lorch (Ostalbkreis), übersetzte 1502 eine lateinische Notariatslehre. Aus Anlass der Digitalisierung des Nürnberger Drucks durch die UB München (urn:nbn:de:bvb:19-epub-11485-2) werden die spärlichen Lebenszeugnisse Nawers zusammengestellt und das intellektuelle Umfeld um 1500 in Lorch (Kloster und Stadtpfarrkirche) und in der nahegelegenen Reichsstadt Schwäbisch Gmünd ausgeleuchtet, nämlich die Kontakte zu: dem Gast-Benediktiner im Lorcher Kloster Thomas Finck (1493), der ein beeindruckendes Oeuvre an deutschsprachigen Erbauungsschriften hinterließ, dem Gmünder Notar Johannes Baldung, dem Gmünder Stadtschreiber Rudolf Holl, Verfasser des Turmeinsturzberichts 1497, dem Mönch Augustin Seiz, der die Überlieferung seiner Abtei schreibend durchforstete und dem »ordnungsliebenden« Pfarrer und Wittenberger Professor Thomas Köllin.
Bemerkung: PDF mit unkorrigierter OCR.
(RSS)
KlausGraf - am Dienstag, 26. April 2011, 14:47 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Gefangenendossiers aus Guantánamo veröffentlicht
Die Enthüllungsplattform Wikileaks hat 779 bislang geheime Dossiers des Pentagons öffentlich gemacht..."
mehr in
FAZ
http://goo.gl/6dDSz
http://vierprinzen.blogspot.com/
Die Enthüllungsplattform Wikileaks hat 779 bislang geheime Dossiers des Pentagons öffentlich gemacht..."
mehr in
FAZ
http://goo.gl/6dDSz
http://vierprinzen.blogspot.com/
vom hofe - am Montag, 25. April 2011, 21:51 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Living Memoirs from Yimeng Bai on Vimeo.
Assignment for Antiques for the Future, Video Sculpture class at ITPA video interactive installation, Projected archives streams from 6 words memoirs on a collection of antique postcards.
(W)
Wolf Thomas - am Montag, 25. April 2011, 18:44 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
John H. Blanton, Filmmaker/Archivist from Floyd Webb on Vimeo.
John H. Blanton talks about his 50 year career in photography, film and videography and how the John H. Blanton Music Archive came to be.(W)
Wolf Thomas - am Montag, 25. April 2011, 18:29 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
BBC Intelligent Archive from Marina Cherry on Vimeo.
BBC Archive from Sam Morris on Vimeo.
(W)Wolf Thomas - am Montag, 25. April 2011, 18:23 - Rubrik: Medienarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.archivnet.at/
"ArchivNet ist ein Zusammenschluss von österreichischen Archiven mit dem Ziel, deren Erschließungsdaten vernetzt und standortübergreifend abfragbar zu machen."
Natürlich im Würgegriff von AUGIAS: langsamer Server, Optik von anno 1997, benutzungsunfreundlich.
Ich muss es leider trotzdem in die archivischen Metasuchen aufnehmen:
http://archiv.twoday.net/stories/6424341/
Auf Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Archivportal-%C3%96sterreich/184390801598195
(F)
"ArchivNet ist ein Zusammenschluss von österreichischen Archiven mit dem Ziel, deren Erschließungsdaten vernetzt und standortübergreifend abfragbar zu machen."
Natürlich im Würgegriff von AUGIAS: langsamer Server, Optik von anno 1997, benutzungsunfreundlich.
Ich muss es leider trotzdem in die archivischen Metasuchen aufnehmen:
http://archiv.twoday.net/stories/6424341/
Auf Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Archivportal-%C3%96sterreich/184390801598195
(F)
KlausGraf - am Montag, 25. April 2011, 16:39 - Rubrik: Erschließung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wieder eine Radtfahrt durch Madrid.
Wikio gibt sich als weblog der weblogs aus.
http://archiv.twoday.net/stories/16578117/
Wikios Taktik führt dazu, dass die von uns bloggern, auch in archivalia, open access zugänglich gemachten Ausarbeitungen (=Arbeit) indirekt zur Werbung für Kosmetikunternehmen verwendet werden. Die Einnahmen gehen auf die Konten von wikio. Die Umsatzsteigerung beim Kosmetikunternehmen verbessert desse G & V Rechnung,
Das sind Tatsachen über die gesprochen werden sollte auch unter uns bloggern. Ausführungen von Herrn Dr. Graf hierzu wünsche ich mir. Vielleicht habe ich etwas übersehen.
Ich sehe nämlich nicht ein, wieso unsere Ausführungen unerlaubt KOMMERZIELL genutzt werden dürfen. Ich habe nichts dagegen, wenn interessierte Leser meine Recherchen, die mich viel Geld gekostet haben, zur Kenntnis nehmen. Ich sehe aber nicht ein, dass Opportunisten, die Anziehungskraft meiner Ausführungen zu Werbzwecken missbrauchen.
Somit soll jeder wissen, dass "open access" auch bedeutet, dass Opportunisten die nichts beitragen und nichts bieten, den Wert unserer geistigen Arbeit zum Nulltarif merkanitilisieren.
Wir dürfen uns nichts vormachen. So ist es.
Vor diesem Hintergrund kann der eine oder andere Leser dieses blogs verstehen, warum ich meine nächste Ausarbeitung längeren Ausmasses, vielleicht nicht open access zugänglich machen werde.
Ein Buch von 390 Seiten Seiten zu erstellen ist eine gigantische Arbeit, wenn man dies alleine durchführt.
Mein Beitrag zu open access kann hier eingesehen werden:
Titel: Vier Prinzen
http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000100
7.100 kostenlose downloads.
Wer profitiert davon ? Ein Zwischenhändler und die Industrie. Da stimmt etwas nicht, bei aller Sympathie zu open access.
Und noch eine unangenehme Frage: Ist es nicht etwas anderes, ob ein verbeamteter Wissenschaftler publiziert (was ja wohl zu seiner Arbeit gehört) oder ein privatrechtlich organisierter Freiberufler der das Investitionsrisiko und die Kosten alleine tragen muss ? Noch ein Stichwort: erlaubte Nebentätigkeit - Nebenverdienst.
Vielleicht rege ich hier eine neue Diskussion zu open access an.
Die Praktiken von wikio und ähnlichen Gaunern werden nicht eingeschränkt werden, weil diese von den etablierten Medien erwünscht und praktiziert werden.
Wer trotz alledem, seine Leistung verschenken möchte soll es tun.
Ich überlege mir das. Und ich lege meine Gedanken hier dar. Das wird wohl erlaubt sein.
Ich wünsche mir, dass Anfang Mai kein listing von wikio veröffentlicht wird.
(E)
http://vierprinzen.blogspot.com/
Wikio gibt sich als weblog der weblogs aus.
http://archiv.twoday.net/stories/16578117/
Wikios Taktik führt dazu, dass die von uns bloggern, auch in archivalia, open access zugänglich gemachten Ausarbeitungen (=Arbeit) indirekt zur Werbung für Kosmetikunternehmen verwendet werden. Die Einnahmen gehen auf die Konten von wikio. Die Umsatzsteigerung beim Kosmetikunternehmen verbessert desse G & V Rechnung,
Das sind Tatsachen über die gesprochen werden sollte auch unter uns bloggern. Ausführungen von Herrn Dr. Graf hierzu wünsche ich mir. Vielleicht habe ich etwas übersehen.
Ich sehe nämlich nicht ein, wieso unsere Ausführungen unerlaubt KOMMERZIELL genutzt werden dürfen. Ich habe nichts dagegen, wenn interessierte Leser meine Recherchen, die mich viel Geld gekostet haben, zur Kenntnis nehmen. Ich sehe aber nicht ein, dass Opportunisten, die Anziehungskraft meiner Ausführungen zu Werbzwecken missbrauchen.
Somit soll jeder wissen, dass "open access" auch bedeutet, dass Opportunisten die nichts beitragen und nichts bieten, den Wert unserer geistigen Arbeit zum Nulltarif merkanitilisieren.
Wir dürfen uns nichts vormachen. So ist es.
Vor diesem Hintergrund kann der eine oder andere Leser dieses blogs verstehen, warum ich meine nächste Ausarbeitung längeren Ausmasses, vielleicht nicht open access zugänglich machen werde.
Ein Buch von 390 Seiten Seiten zu erstellen ist eine gigantische Arbeit, wenn man dies alleine durchführt.
Mein Beitrag zu open access kann hier eingesehen werden:
Titel: Vier Prinzen
http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000100
7.100 kostenlose downloads.
Wer profitiert davon ? Ein Zwischenhändler und die Industrie. Da stimmt etwas nicht, bei aller Sympathie zu open access.
Und noch eine unangenehme Frage: Ist es nicht etwas anderes, ob ein verbeamteter Wissenschaftler publiziert (was ja wohl zu seiner Arbeit gehört) oder ein privatrechtlich organisierter Freiberufler der das Investitionsrisiko und die Kosten alleine tragen muss ? Noch ein Stichwort: erlaubte Nebentätigkeit - Nebenverdienst.
Vielleicht rege ich hier eine neue Diskussion zu open access an.
Die Praktiken von wikio und ähnlichen Gaunern werden nicht eingeschränkt werden, weil diese von den etablierten Medien erwünscht und praktiziert werden.
Wer trotz alledem, seine Leistung verschenken möchte soll es tun.
Ich überlege mir das. Und ich lege meine Gedanken hier dar. Das wird wohl erlaubt sein.
Ich wünsche mir, dass Anfang Mai kein listing von wikio veröffentlicht wird.
(E)
http://vierprinzen.blogspot.com/
vom hofe - am Sonntag, 24. April 2011, 17:16 - Rubrik: Open Access
Ostermärlein vom bayerischen Barockprediger Andreas Strobl (1698):
http://books.google.de/books?id=y11CAAAAcAAJ
Geringere Scan-Qualität:
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10363865-7
S. 123 steht der im Projekt Gutenberg modernisiert nachlesbare Schwank:
http://www.spiegel.de/kultur/gutenberg/dokument-GBA_colon__slash_antholog_slash_schwaenk_slash_schwaenk.xml_hash_chap33_hash_part228-name.html
Zur Biographie Strobls:
http://www.helmut-zenz.de/lexbaiu4.html
(W)
http://books.google.de/books?id=y11CAAAAcAAJ
Geringere Scan-Qualität:
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10363865-7
S. 123 steht der im Projekt Gutenberg modernisiert nachlesbare Schwank:
http://www.spiegel.de/kultur/gutenberg/dokument-GBA_colon__slash_antholog_slash_schwaenk_slash_schwaenk.xml_hash_chap33_hash_part228-name.html
Zur Biographie Strobls:
http://www.helmut-zenz.de/lexbaiu4.html
(W)
KlausGraf - am Sonntag, 24. April 2011, 14:53 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Yesterday, IMSLP, a website dedicated to archiving public domain sheet music lost its domain name due to a complaint sent by the UK’s Music Publishers Association to the site’s registrar, GoDaddy. The notice incorrectly claimed that IMSLP’s copy of Rachmaninoff’s The Bells infringed copyright.
http://www.publicknowledge.org/blog/sheet-music-domain-goes-down-over-bogus-copyr
(RSS)
http://www.publicknowledge.org/blog/sheet-music-domain-goes-down-over-bogus-copyr
(RSS)
KlausGraf - am Sonntag, 24. April 2011, 13:10 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Historiker, Medienwissenschafter und Mediensoziologe Alessandro Barberi hat u. a. die Studie Clio verwunde(r)t. Hayden White, Carlo Ginzburg und das Sprachproblem in der Geschichte verfasst. Seine neue Homepage - http://www.barberi.at/ - stellt viele seiner Texte zur Verfügung, teilt
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/16574327/ mit.
(RSS)
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/16574327/ mit.
(RSS)
KlausGraf - am Sonntag, 24. April 2011, 13:09 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Acht an der Zahl. Mit wirklich unangenehmem Wasserzeichen, zu geringe Auflösung:
http://badigit.comune.bologna.it/books/manoscritti.htm
Via
http://www.rechtshistorie.nl/en/digital-collections/digital-libraries
(W)
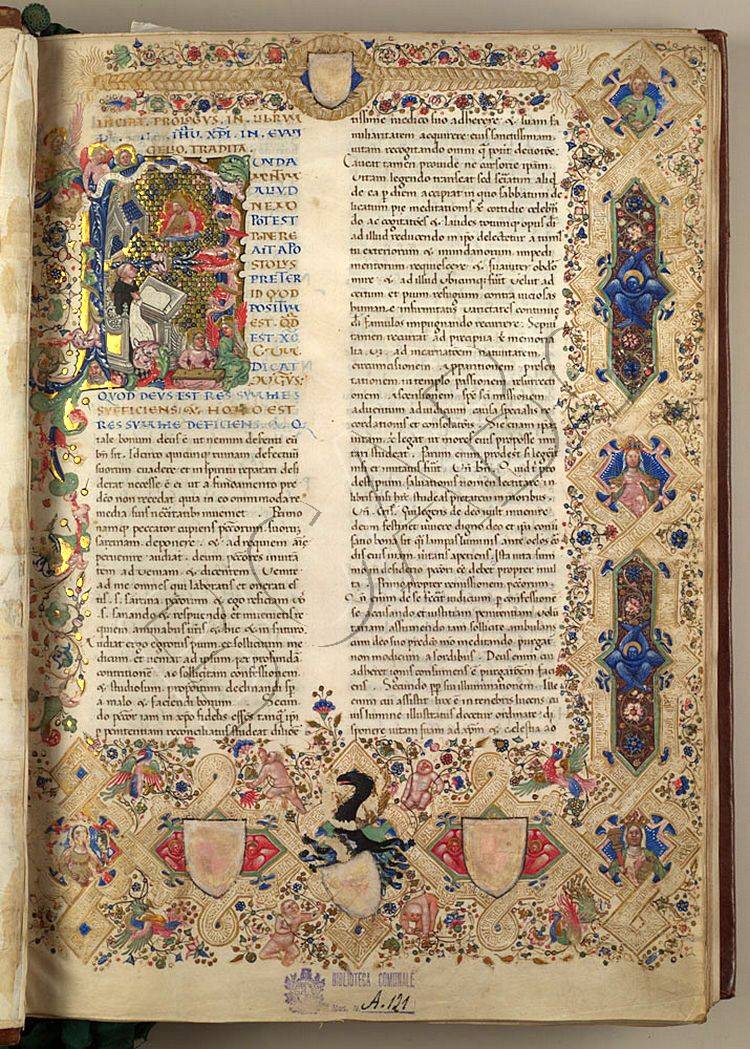
http://badigit.comune.bologna.it/books/manoscritti.htm
Via
http://www.rechtshistorie.nl/en/digital-collections/digital-libraries
(W)
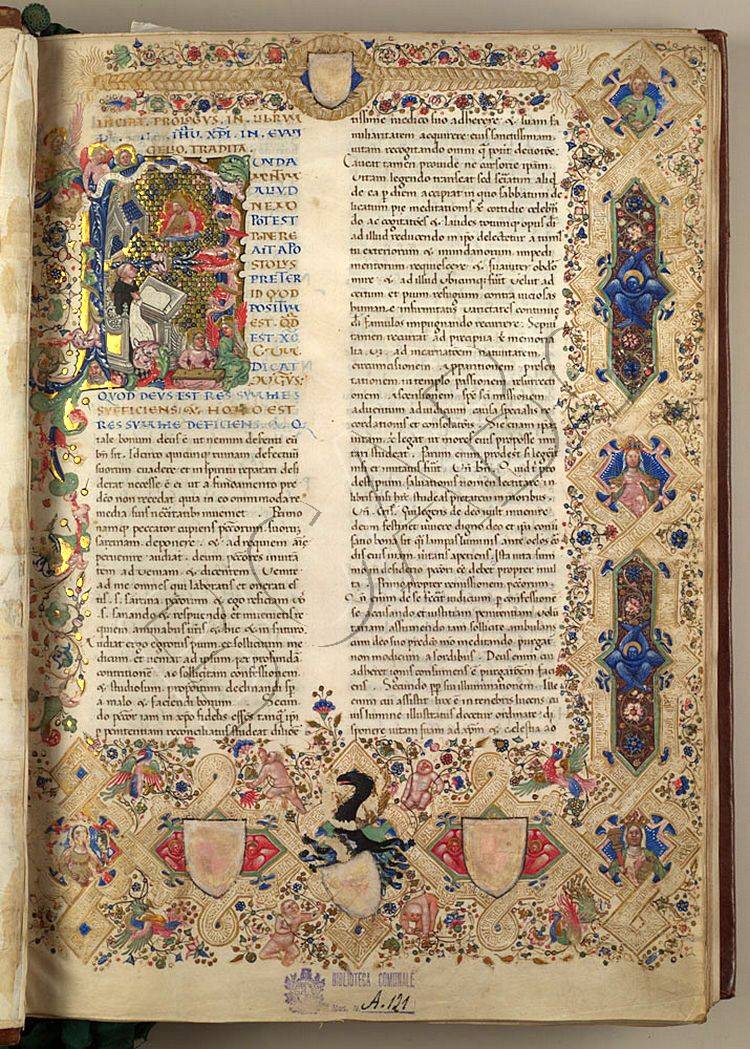
KlausGraf - am Samstag, 23. April 2011, 22:33 - Rubrik: Kodikologie
http://schmalenstroer.net/blog/2011/04/meilenstein-10-millionen-gemeinfreie-bilder-auf-den-wikimedia-commons/
Trotzdem haben die Wikimedia Commons ein anderes, besseres Internet geschaffen. Ohne sie (und die gesamte CC-Bewegung) wäre das Internet eine Spur schlechter – kommerzielle Bilddatenbanken würden sich jeden Pixel vergolden lassen, Museen und Archive ihre Bestände weiterhin per Copyfraud hüten und der Nutzer würde für jedes Bild, das er irgendwie sehen oder nutzen will, zahlen müssen. Danke Wikimedia Commons, dass es nicht so gekommen ist. Herzlichen Glückwunsch zu 10 Millionen Dateien!
(T)
 Burg Nassau, Luftbild von Fritz Geller-Grimm http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Burg Nassau, Luftbild von Fritz Geller-Grimm http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Trotzdem haben die Wikimedia Commons ein anderes, besseres Internet geschaffen. Ohne sie (und die gesamte CC-Bewegung) wäre das Internet eine Spur schlechter – kommerzielle Bilddatenbanken würden sich jeden Pixel vergolden lassen, Museen und Archive ihre Bestände weiterhin per Copyfraud hüten und der Nutzer würde für jedes Bild, das er irgendwie sehen oder nutzen will, zahlen müssen. Danke Wikimedia Commons, dass es nicht so gekommen ist. Herzlichen Glückwunsch zu 10 Millionen Dateien!
(T)
 Burg Nassau, Luftbild von Fritz Geller-Grimm http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Burg Nassau, Luftbild von Fritz Geller-Grimm http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ennoch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das ergibt sich aus folgender aktueller Meldung:
Wie das Bundesdenkmalamt (BDA) nun bekannt gab, hat eine Privatperson schon vor einiger Zeit in einem Garten im Raum Wiener Neustadt mehr als 200 Schmuckgegenstände entdeckt, die ein Alter von etwa 650 Jahren haben. Es handle sich dabei um einen der "qualitativ bedeutendsten mittelalterlichen Schatzfunde in Österreich". Die Goldschmiede-Arbeiten seien "atemberaubend", hieß es vom BDA - das auch eine gute Nachricht für den Finder hat: Er sei und bleibe "zu 100 Prozent Eigentümer".
http://derstandard.at/1303291249357/Ansichtssache-Spaetmittelalterlicher-Schatz-in-Niederoesterreich-gefunden
(RSS)
Update:
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,758790,00.html
Wie das Bundesdenkmalamt (BDA) nun bekannt gab, hat eine Privatperson schon vor einiger Zeit in einem Garten im Raum Wiener Neustadt mehr als 200 Schmuckgegenstände entdeckt, die ein Alter von etwa 650 Jahren haben. Es handle sich dabei um einen der "qualitativ bedeutendsten mittelalterlichen Schatzfunde in Österreich". Die Goldschmiede-Arbeiten seien "atemberaubend", hieß es vom BDA - das auch eine gute Nachricht für den Finder hat: Er sei und bleibe "zu 100 Prozent Eigentümer".
http://derstandard.at/1303291249357/Ansichtssache-Spaetmittelalterlicher-Schatz-in-Niederoesterreich-gefunden
(RSS)
Update:
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,758790,00.html
Sa T 2 P 186
"Sïischt, wia winn Oas a schtille Liab im Heaza hält verborga"
Ludwig Egler 1828 - 1898
Ausstellung im Städtischen Museum Hechingen
Darstellung: Foto Eglers mit einem Stück Kernseife und Chronik der Stadt Hechingen
42 x 59 cm
1 Plakat 26.11.1998 - 21.3.1999
hat laut Internetauftritt des Landesarchivs Baden-Württemberg den Permalink
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=6-241282
Der führt aber keineswegs zum Archivale, sondern zum Anfang der Klassifikationsgruppe. Dass man weiterblättern muss, um Egler zu finden, weiß der arglose Linkempfänger nicht. Dass Stichproben keine weiteren fehlerhaften Permalinks zutagebrachten, entschuldigt nichts.
(W)
"Sïischt, wia winn Oas a schtille Liab im Heaza hält verborga"
Ludwig Egler 1828 - 1898
Ausstellung im Städtischen Museum Hechingen
Darstellung: Foto Eglers mit einem Stück Kernseife und Chronik der Stadt Hechingen
42 x 59 cm
1 Plakat 26.11.1998 - 21.3.1999
hat laut Internetauftritt des Landesarchivs Baden-Württemberg den Permalink
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=6-241282
Der führt aber keineswegs zum Archivale, sondern zum Anfang der Klassifikationsgruppe. Dass man weiterblättern muss, um Egler zu finden, weiß der arglose Linkempfänger nicht. Dass Stichproben keine weiteren fehlerhaften Permalinks zutagebrachten, entschuldigt nichts.
(W)
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Cambridge University Library has one of five known sets of proof maps prepared for John Speed's Theatre of the Empire of Great Britaine, which was published in 1611/12.
Digitised at:
http://www.lib.cam.ac.uk/deptserv/maps/speed.html
(RSS)

Digitised at:
http://www.lib.cam.ac.uk/deptserv/maps/speed.html
(RSS)

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das 1927 erstmals erschienene Buch "Sagen der Heimat" von Oberlehrer Georg Stütz ist vom Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd wieder aufgelegt worden. Das broschierte Heft umfasst 96 Seiten, kostet 9,50 Euro und ist über den Einhorn-Verlag Schwäbisch Gmünd erhältlich. ISBN 978-3-936373-62-2.
Für die Neuausgabe habe ich meine Nachweise von 1981 (Quellennachweise, in: Georg Stütz, Sagen der Heimat. 3. leicht
gekürzte Auflage, bearbeitet und ergänzt von Lucie Stütz. Mit einem Quellennachweis von Klaus Graf, Schwäbisch Gmünd 1981, S. 92-95) überarbeitet und ergänzt sowie ein Nachwort hinzugefügt. Zusätze gegenüber der Druckfassung von 2011 stehen im folgenden in eckigen Klammern (zusätzliche Online-Nachweise, Berichtigung eines Druckfehlers). Ohne Kennzeichnung wurden die Überschriften der Sagen ergänzt.
Textprobe (S. 21 mit den Nummern 6 und 7):
http://www.flickr.com/photos/34028941@N00/5644683594/in/photostream
--------
[S. 87] Nachwort und Nachweise
Von Klaus Graf
“Heimat” war der Leitbegriff, dem die gesamte literarische Produktion des Schwäbisch Gmünder Lehrers Georg Stütz untergeordnet war. Er verfasste zahlreiche heimatgeschichtliche Artikel in den Gmünder Zeitungen, ein dreibändiges Heimatbuch und eine Chronik Gmünds im Ersten Weltkrieg. “Stütz war ein von christlichen Werten geprägter konservativer und patriotischer Schriftsteller, der mit seinen heimatkundlichen Büchern ganz gewiss nicht nur informieren, sondern auch die Liebe der Menschen zu ihrer Stadt wecken wollte”(Müller 171).
Der 1864 als Lehrersohn in Schlechtbach bei Gschwend geborene Stütz entschied sich ebenfalls für den Lehrerberuf. Ab 1898 wirkte er in Gmünd an der Mädchen-Volksschule. 1948 ist er in Gmünd gestorben.
1919 brachte Stütz sein heimatkundliches Wanderbuch heraus, das in der zweiten Auflage als Band II des “Heimatbuchs für Gmünd und weitere Umgebung” firmierte (1924). 1920 folgte der spätere erste Band, der Führer durch die Stadt (zweite Auflage 1926). Was der dritte Band unter dem Titel “Heimatbilder aus Natur und Kultur” enthalten sollte, deutet die Verlagsanzeige in Bd. II von 1924 an: die Ur- und Frühgeschichte (Archäologie war ein besonderes Steckenpferd von Stütz), “Sagen und Märchen, Sitte und Gebräuche”. Realisiert wurde nur der Teil über die Sagen, ergänzt durch ein neunseitiges Kapitel “Heimatliche Flurnamen”.1927 erschien die Erstausgabe dieses Buchs: “Sagen der Heimat” im Selbstverlag des Verfassers.
Stütz ging es um heimatkundliche Erkenntnisse, aber nicht präsentiert in akademisch-wissenschaftlicher Form. Sein Ansatz war vielmehr ein pädagogisch-popularisierender, der die emotionale Hinwendung zur Heimat in den Mittelpunkt stellte. Die um 1900 entstandene Heimatbewegung übte aus konservativer Perspektive Zivilisationskritik - der als bedrohlich empfundenen Moderne stellte man das Bild einer heilen traditionalen Welt gegenüber. Sagen betrachte man als altes Volksgut, das es ebenso zu pflegen galt wie Trachten oder traditionelle Bauweise. So heißt es denn auch im Vorwort der Sagensammlung: “Die Sage flieht die Eisenbahn und die Fabrik, aber in abgelegenen Dörfern und vereinsamten Bauernhöfen ist sie immer noch heimisch”.
Für Stütz weben Sagen “ihren Zauberschleier um einsame Kapellen und halbverwitterte Kreuzsteine; sie ... raunen und wispern geheimnisvoll in weltfernen Tälern und Wäldern”. Stütz folgt mit dieser Beschreibung einer Idylle somit einem romantischen Sagenkonzept. Im Vordergrund steht die - inzwischen abgelehnte - mythologisierende Deutung der Sagen, die schon im 19. [S. 88] Jahrhundert die deutsche Lehrerschaft begeisterte. Geradezu zwanghaft suchte man in den “dämonologischen” Sagen, die sich vor allem auf Geistererscheinungen beziehen, Spuren des altgermanischen Götterglaubens.
Natürlich deutete Stütz das Muetesheer als Wodansheer. Aber wie die Leute davon erzählten und welchen konkreten Stellenwert die Geschichten vom Mutesheer für die Erzähler und Hörer besaßen, ihr “Sitz im Leben” also, interessierte ihn offenbar gar nicht. Mit dem Hinweis auf Wodan war das Muetesheer abgehakt. Wenn sich an den Kameralverwalter von Schönlein auf dem Rehnenhof im 19. Jahrhundert eine Sage knüpfte (siehe “Der Heuranz”), war das für Stütz ein “Gebilde törichter Phantasie” und er begrüßte es, dass sie nur noch in Landorten wie Zimmerbach im Schwange, in der Nähe des Rehnenhofs aber erloschen war. Eine Vielzahl kurzer Geistersagen packte er in einen Abschnitt über Geistersagen am Ende seines Büchleins. Stütz ging also mit klaren Maßstäben, die er anderen Heimatbüchern und Sagensammlungen entnahm, an die Arbeit des Sagensammelns: Für die Eigenart und Vielfalt der mündlichen Überlieferung hatte er keinen Sinn.
Nur ein kleiner Teil seiner Sagen sind aus dem “Volksmund” zusammengetragen; die meisten stammen aus schriftlichen Quellen. Verdienstvoll ist seine Zusammenstellung der Kreuzsteinsagen. Daneben hat er vor allem in Degenfeld und Täferrot je drei Geschichten aus der mündlichen Überlieferung aufgezeichnet.
Außer der Geigersage wollte Stütz auf unechte, erfundene Sagen verzichten. Dies ist ihm aber überhaupt nicht gelungen, bereits Nr. 2 seiner Sammlung, “Der Stadtrichter von Gmünd”, geht auf eine literarische Erfindung, nämlich das Stuttgarter Blatt “Stadt-Glocke” zurück. Die Grenze zwischen Folklore, also authentischer Volksüberlieferung, und “Fakelore”, erfundenen Geschichten im Gewand von Volkserzählungen, ist zwar fließend, aber der Anteil von unecht wirkenden “Sagen” ist bei Stütz erheblich. Bei den beiden Sagen aus Johannes Scherrs Band “Sagen aus Schwabenland” (1836), literarischen Texten, die sich als Sagen tarnen, und der aus der (nicht auffindbaren) Neuberschen Chronik entnommenen Waldauer Sage schreibt Stütz selbst, sie seien novellenartig ausgeschmückt und dichterisch ausgestaltet. Solche Ausschmückungen begegnen aber auch bei den Sagen, die dem Heimatbuch von Bernhard Gaugele (1910) entnommen sind, und bei weiteren Texten.
Ohne die zahlreichen Erzählungen, die Stütz den gedruckten Sammlungen von Ernst Meier (1852) und Anton Birlinger (1861) entnahm, wäre sein Büchlein allzu schmal geworden, und Stütz hätte sich womöglich genötigt gesehen, die mündliche Erzählüberlieferung nicht nur gleichsam nebenbei zu berücksichtigen. Die vorgefundenen Texte gab Stütz nicht getreu wieder, sondern er schrieb sie um. Er modernisierte die Sprache und straffte sie, wenn er der An-[S. 89]sicht war, dass sie so für sein Publikum lesbarer wurden. Bei den Geschichten Scherrs gab er im Vorwort selbst zu, dass er sie stark gekürzt und verändert hat. “Nicht die Sage, nur ihr Kleid” sei damit umgestaltet worden.
Mit der gleichen Freiheit, die sich Stütz gegenüber seinen Vorlagen herausnahm, verfuhr auch seine Tochter Lucie Stütz, als es 1950 galt, das Sagenbuch ihres zwei Jahre zuvor verstorbenen Vaters neu aufzulegen. Sie fügte in den anderen beiden Bänden des Heimatbuchs enthaltene Texte hinzu und strich Teile des Vorworts, den Flurnamen-Anhang sowie Sagen aus Schorndorf und Geislingen, da diese Orte für ein “Gmünder Sagenbuch” wohl zu weit entfernt waren. Außerdem fügte sie eine kleine Anzahl weiterer Sagen aus anderen Quellen hinzu.
Lucie Stütz (1894-1982) war Lehrerin wie ihr Vater und Schriftstellerin. Ihre Eingriffe in den vorgefundenen Textbestand gingen sehr viel weiter als die ihres Vaters. Albert Deibele hatte in den Gmünder Heimatblättern 1933 eine kurze Notiz von Dominikus Debler über den Falschmünzer Sperfechter erzählerisch ausgestaltet. Lucie Stütz übernahm diese Geschichte, überarbeitete sie aber tiefgreifend. Das Verbrechen wird bei Deibele durch die vom Teufel entzündete Geldgier motiviert. Lucie Stütz bringt aber die Ehefrau ins Spiel: “Frau Barbara steht droben in der lichten Stube mit den Birnbaumkommoden und bauchigen Truhen. Sie hört die dröhnenden Hämmer drunten und weiß, was sie schreien. Auf ihren geizigen Mund springt ein triumphierendes Lächeln, sie wiegt sich vor dem goldgerahmten Spiegel und schwenkt die Hüften wie die reichen Patrizierinnen, die am Festtag vierspännig ins Münster fahren. Deren goldene Ringe, funkelnde Halsketten und blutrote Granatbroschen, seidene Röcke und samtene Mieder stechen ihr schon lange in die Augen. Wie gierige Zangen fegen ihre Hände in schlaflosen Nächten über die Bettdecke: 'Gold, Gold, Gold!' zischelte sie ihrem Mann ins Ohr”. Der Versuch, lebendig und anschaulich zu schreiben (wohl mit Blick auf den Schulunterricht), produzierte aus heutiger Sicht “Sagenkitsch”, der sich weit von dem entfernt, was man sich üblicherweise unter einer “Volkssage” vorstellt.
Es ist kein Zufall, dass sehr viele Autoren von Sagenbüchern Lehrer waren. Die Moral der Sagen, in denen Frevler stets hart bestraft wurden, kam ihnen entgegen. Ihnen gefiel der erhobene Zeigefinger.
Bei der dritten Auflage 1981, illustriert mit Zeichnungen von Martin Meisner, hat man auf solche fragwürdigen Eingriffe verzichtet. Allerdings fiel der letzte Teil des Büchleins von 1950 (ab den Sagen von Zimmerbach) einer Kürzung zum Opfer. Diese, wie auch die Ausführungen zu den sagenhaften Siedlungen sind aber in der vorliegenden Ausgabe wieder vertreten.
Heute sieht die Erzählforschung Sagen nicht als “wertvolles Erbgut”, das Botschaften aus uralter Zeit vermittelt. Sagen müssen zuallererst als litera-[S. 90]rische Texte aus der Zeit, in der sie niedergeschrieben wurden, begriffen werden. Sie sind kein Spiegel grauer Vorzeit, sondern allenfalls der Verhältnisse im 19. und 20. Jahrhundert. Beispielsweise sind die beliebten Raubrittergeschichten keine Zeugnisse aus dem Mittelalter, sondern dokumentieren den seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert von trivialen Rittergeschichten geprägten Lesegeschmack breiter Schichten. Also gab es auch keine alte Tradition, die die Beiswanger Kapelle mit dem weitab wirkenden Wettiner Friedrich mit der gebissenen Wange verknüpfte, sondern diese Verbindung wurde sicher erst im späten 18. Jahrhundert hergestellt und verdankt sich wohl der Lektüre eines populären Ritterromans über Friedrich mit der gebissenen Wange.
Als nostalgische Lektüre, die die nach wie vor beliebten Klischees über Sagen bedient, ist das Stützsche Sagenbuch sicher ausgezeichnet geeignet. Aber nach dem Gesagten wundert es nicht, wenn sein Wert für die Erforschung der Erzählkultur rund um Gmünd eher bescheiden einzuschätzen ist (sowohl in der Fassung von 1927 als auch in der von 1950).
Man könnte heute eine ganze Reihe weiterer Sagentexte ergänzen, teils Texte, die bewusst übergangen wurden, teils Texte, die in handschriftlichen Quellen neu aufgefunden wurden. Beispielsweise hat Stütz wohl ganz bewusst die bei Birlinger 1861 enthaltene Erzählung “Die Baumeisterin in Gmünd” weggelassen, die eine Figur am Münster als Baumeisterin deutet, die sich nach dem Festmahl nach Abschluss des Baus habe übergeben müssen. Das war für Stütz wohl eine ganz und gar unangemessene Erzählung, die weder seinen Vorstellungen von Volkspoesie entsprach noch mit seiner Auffassung von der Würde des Gmünder Münsters vereinbar war.
Aus der Sicht der Erzählforschung würde man sich wünschen, dass es möglich wäre, möglichst vollständig die wichtigsten Versionen einer Sage (z.B. der Ringsage einschließlich der poetischen Gestaltungen) wiederzugeben. Aber eine wissenschaftliche Ausgabe, die getreu dem Wortlaut ihrer Vorlagen folgt und einen ausführlichen Kommentar bietet, ist unter den derzeitigen Bedingungen des Verlagswesens so gut wie nicht realisierbar. Besseren Absatz versprechen die gefällig umgeschriebenen Sagenbücher, in denen der auf altes Volksgut gespannte Leser nicht durch ideologiekritische Hinweise, dass es sich bei den Volkssagen um einen romantischen Mythos handle, verschreckt wird.
Das Internet kennt solche beengenden Rahmenbedingungen nicht. So mag denn am Schluss der Hinweis auf die Schwäbisch Gmünd-Seite der freien Quellensammlung Wikisource stehen, die eine Sammlung vorlagengetreu wiedergegebener Gmünder Sagen bietet, einschließlich verschiedener Versionen. Hier finden sich bereits einige Sagen, die bei Georg und Lucie Stütz fehlen.
[S. 91] Abkürzungen und Literatur
B. = Birlinger, Anton/Buck, Michael: Volksthümliches aus Schwaben 1 (1861). Online:
http://books.google.com/books?id=lD4JAAAAQAAJ
Bullinger, Tanja: Lucie Stütz. In: Literarische Vielfalt in Ostwürttemberg. Frauen greifen zur Feder I (2008) 133-137
D. = Deibele, Albert: Zwischen Lein und Kocher. Sagen und Geschichten. In: GH 2 (1929) 41-51
Gaugele, Bernhard: Meiner Heimat Täler und Höhen (1910) - Exemplar StadtAG
[Online:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaugele_Meiner_Heimat_T%C3%A4ler_und_H%C3%B6hen.djvu ]
Graf, Klaus: Gebilde törichter Phantasie? Überlegungen zu Gmünder "Sagen",. In: ostalb/einhorn 25 (1998), H. 97, 36-45. Online:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/sagd.htm
Graf, Klaus: Gmünder Chroniken im 16. Jahrhundert (1984)
[Online: http://books.google.de/books?id=PoAgAAAAMAAJ ]
Graf, Klaus: Die Gmünder Ringsage. Entstehung und Entwicklung einer Staufer-Überlieferung. In: einhorn-Jahrbuch 1982, 129-150
Graf, Klaus: Kleine Beiträge zum historischen Erzählen in Schwäbisch Gmünd. In: einhorn-Jahrbuch 1991, 99-114
[Online:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7790/ ]
Graf, Klaus: Der Ring der Herzogin: Überlegungen zur "Historischen Sage" am Beispiel der Schwäbisch Gmünder Ringsage. In: Babenberger und Staufer (1987), 84-134. Online:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5841/
Graf, Klaus (Hrsg.): Sagen der Schwäbischen Alb (2008)
Graf, Klaus: Sagen rund um Stuttgart (1995). Online:
http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2009/113809/
Graf, Klaus: Das Salvatorbrünnlein. Eine bislang unbekannte Gmünder "Sage" aus der Sammlung des Stuttgarter Gymnasialprofessors Albert Schott d. J. (1809-1847). In: einhorn-Jahrbuch 1995, 109-118. Online:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5585/
Graf, Klaus: Schwabensagen. Zur Beschäftigung mit Sagen im 19. und 20. Jahrhundert (2007). Online:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3459/
Graf, Klaus: Der Stadtrichter von Gmünd. Eine erfundene Sage aus der "Stuttgarter Stadt-Glocke" 1845. In: einhorn-Jahrbuch 1998, 99-106. Online:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/enzing.htm
GH = Gmünder Heimatblätter
K. = Kettenmann, Jürgen: Sagen im Kreis Göppingen (³1989)
Kaißer, Bernhard: Aus der Vergangenheit Gmünds und seiner Umgebung (1911). Online:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Aus_der_Vergangenheit_Gm%C3%BCnds_und_seiner_Umgebung
M. = Meier, Ernst: Deutsche Sagen, Sitten und Gebräuche aus Schwaben (1852). Online:
http://books.google.com/books?id=t1sKAAAAIAAJ
Müller, Ulrich: Georg Stütz. In: Heimatforscher aus dem Raum Schwäbisch Gmünd (2009) 167-177
OAB = Beschreibung des Oberamts Gmünd (1870). Online:
http://de.wikisource.org/wiki/Beschreibung_des_Oberamts_Gm%C3%BCnd
RZ = Rems-Zeitung
Scherr, Johannes: Sagen aus Schwabenland (1836) . Online:
http://books.google.com/books?id=FkgWAAAAYAAJ
Setzen, Florian Henning: Geheimnisvolles Christental (1994)
St. = Stütz, Georg: Heimatbuch für Gmünd und weitere Umgebung. I: Gmünd in Wort und Bild (²1926), II: Wanderungen in der Heimat (²1924), III: Sagen der Heimat (1927)
StadtAG = Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd
Wikisource: Schwäbisch Gmünd [mit Sagensammlung]. Online:
http://de.wikisource.org/wiki/Schw%C3%A4bisch_Gm%C3%BCnd
[S. 92] Nachweise
An erster Stelle steht jeweils die unmittelbare Quelle, soweit ermittelt. Das Inhaltsverzeichnis der Erstausgabe 1927 (= St. III) S. 82f. enthielt - sehr kursorische, manchmal auch fehlerhafte - Quellenangaben, die stets zitiert werden. In der Ausgabe von 1950 gab es dann nur noch die Seite “Quellenverzeichnis” S. 83.
Mit “Vgl.” eingeleitet werden im folgenden Hinweise auf Parallelen und Sekundärliteratur. Es gilt (wie schon 1981), dass die wünschenswerte Vollständigkeit nicht erzielt werden konnte. In Zeitungen und Zeitschriften dürfte noch der eine oder andere ältere Beleg zu finden sein, in der (für mich nicht greifbaren) Lokalliteratur der erwähnten Orte um Gmünd weitere Materialien zur Erläuterung der Sagen. Nicht alle gedruckten Vorlagen konnten sicher bestimmt werden.
Der Geiger von Gmünd
(1) St. III, 5-7: “Just. Kerner”. Vgl. grundlegend Peter Spranger: Der Geiger von Gmünd (²1991).
Der Stadtrichter von Gmünd
(2) St. III, 8-11: “nach Neuber und nach ‘Württ. Volksbücher’ v. Württ. Ev. Lehrerunterstützungsverein Stuttgart”. Württembergische Volksbücher 1 (o. J., 1905) 170-174; die Quelle Neuber konnte nicht aufgefunden werden, vgl. einhorn-Jahrbuch 1981, S. 182, 185 (Klaus Graf). Vgl. zur erfundenen Sage, die zuerst in der Stuttgarter Stadt-Glocke vom 11.4.1845 erschien, ausführlich Graf: Stadtrichter.
Gründung der Johanniskirche
(3) St. I, 93-95. Vgl. zur Gmünder Ringsage Peter Spranger: Schwäbisch Gmünd bis zum Untergang der Staufer (1972) 25-29; Graf: Ringsage; Graf: Ring; Graf: Salvatorbrünnlein.
Der bestrafte Baumeister
(4) St. I, 98. Stütz folgt der Fassung von Dominikus Debler (Chronik im StadtAG) Bd. 1, S. 77.Vgl. zur Baumeistersage der Johanniskirche Graf: Kleine Beiträge, 107-109; Richard Strobel: Aus der Vorzeit der Inventarisation in Württemberg. In: Beiträge zur Denkmalkunde (1991) 19-29, hier 27.
Der Falschmünzer
(5) Albert Deibele: Sperfechter der Falschmünzer. In: GH 6 (1933) 174-176 vor allem nach Dominikus Debler (Chronik im StadtAG) Bd. 3, S. 559, der aber nur eine kurze Notiz bietet. In der Ausgabe von 1950 erheblich verändert. Vgl. Graf: Kleine Beiträge, 102-107.
Der Schlurkerle
(6) St. III, 11: “Nach Neuber” (siehe oben zu Nr. 2). Urquelle ist wohl B. 72.
Der Mauerbockeler
(7) Unmittelbare Quelle unbekannt. Vgl. RZ Nr. 27 vom 3.2.1876, 105.
Der Heuranz
(8) St. II, 87; D. 50f. Auf Deibele reagierte G. Stütz mit: Der wahre “Heuranz”. In: GH 2 (1929), 57f.
Die Lampe im Grab des Bruders David
(9) St. I, 162f. Die lateinische Vorlage, Chronik des Berard Müller: Alemania Franciscana Antiqua 12 (1964) 72. Vgl. Graf: Chroniken, 145.
Die Stiftung der Dreifaltigkeitskapelle
(10) Unmittelbare Quelle unbekannt. Von den bei Klaus Graf: Zur Geschichte der Dreifaltigkeitskapelle vor 1866. In: 300 Jahre Dreifaltigkeitskapelle in Schwäbisch Gmünd (1993) 18-28 zitierten Versionen folgt der (die Amsel-Variante aufweisende) Text am ehesten der Familienüberlieferung bei Winz 1877 (abgedruckt ebd., 88).
Die Gründung der Burg Rechberg und die Sagen vom Christental
(11) Erster Teil St. II, 243f., zweiter Teil St. III, 29: “Nach Birlinger und Buck”. B. 228 (Stütz nennt ausnahmsweise Birlingers Co-Autor Michael Buck). Die angebliche Christentalschlacht geht auf die Chronik Thomas Lirers zurück, vgl. ausführlich Setzen. Vgl. auch K. 103-108; Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 243-245.
Der Klopferle vom Rechberg
(12) St. II, 107f., in der Ausgabe 1950 erheblich erzählerisch umgestaltet. Vgl. Friedrich Gottschalck: Die Ritterburgen und Bergschlösser Deutschlands 3 (1813) 306f. (Joseph Alois Rink); Engelbert Hofele: Bilder aus Schwaben (o. J., 1881) 507-510; K. 133-136; Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 254f.
[Gottschalck 2. Aufl. 1820 online:
http://books.google.com/books?id=reEFAAAAQAAJ&pg=PA305 ]
"Schön Dorle" oder "Das Rambrechtsweible"
(13) St. III, 11-14: “Teilweise nach B. Gaugele”. Gaugele 100-110. Siehe auch zur folgenden Nummer.
Der Holzbrockeler
(14) Gegenüber Stütz III, 54f.: “Nach Hofelich und nach Birlinger” (Hofelich meint Hofele) und St. II, 226f. erheblich erweitert. B. 220, Engelbert Hofele: Bilder aus Schwaben (o. J., 1881) 487f. Vgl. OAB 460; Gaugele 93-100; Heimatbuch Donzdorf (1976) 53-58 (Georg Gaugele); K. 55-58; Setzen 150-187; Bernhardin Schellenberger: Die berühmt-berüchtigte Regierungs-[S. 93]zeit des Joachim Berchtold von Roth in Winzingen (1607-1621). In: Hohenstaufen/Helfenstein 4 (1994) 67-124; Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 245-247 (hat Schellenberger 115f. übersehen).
Der Einsiedler vom Heldenberg
(15) St. III, 15f.: “Nach dem Volksmund und nach B. Gaugele”. Gaugele 78-80.
Die feindlichen Brüder
(16) St. III, 52f.: “Nach Hofelich und nach Birlinger”. B. 256f. Vgl. K. 108; Setzen 28-34; Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 248f. nach der Chronik Friedrich Vogts 1674 (Handschrift StadtAG) S. 468. Zu den Graneckle-Sagen vgl. Setzen 57-108.
Das goldene Kegelspiel
(17) St. III, 53f.: “Nach Hofelich und nach Birlinger”. B. 101. Vgl. Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 250.
Der stumme Zwerg
(18) St. III, 54: “Nach Hofelich und nach Birlinger”. B. 41f. (Birlinger gibt Hofele als Quelle an).
Der Schatzgräber vom Graneckle
(19) Die Sage von Jakob Veit stammt von Gaugele 52-58; St. II, 198f. nennt den Namen noch nicht. Vgl. Engelbert Hofele: Bilder aus Schwaben (o. J., 1881) 488f.; Setzen 60-68 druckt den Text nach Gaugele 1910 wieder ab; Graf, Sagen der Schwäbischen Alb, 250f. (nach Hofele).
Das Nenninger Kirchbrünnlein
(20) St. III, 55f.: “Von Ä. Schweizer”. Gedicht von Ägidius Schweizer, der 1918-1923 Schulleiter in Nenningen war, vgl. Josef Seehofer:Ortgeschichte von Nenningen (1970) 110.
Sagen vom Wäscherschlösschen
(21) St. II, 121f. Vgl. K. 121f. Stütz bezieht sich auf Württemberg wie es war und ist 1 (1866) 306f. Die weiße Frau zu Büren ist aber ebenso eine Stadt-Glocke-Erfindung wie oben Nr. 2.
["Württemberg wie es war und ist" online:
http://books.google.de/books?id=J4AAAAAAcAAJ&pg=PA306 ]
Wie der Hohenstaufen entstanden ist
(22) Könnte aus Franz Georg Brustgi: Schwäbisches Sagenbuch (1940) 7f. stammen oder aus Württembergische Volksbücher 2 (o. J. 1905) 3. Vgl. K. 93f.
Herzogin Judit
(23) St. III, 22-25: “teilweise nach ‘Württ. Volksbücher’ vom Württ. ev. Lehrerunterstützungsverein”. Württembergische Volksbücher 2 (o.J., 1905) 6-13. Vgl. K. 94f.
Die Sage von der Barbarossa-Kapelle
(24) St. III, 25f.: “Nach M. Grimm und B. Kaißer”. Michael Grimm: Geschichte der ehemaligen Reichsstadt Gmünd (1867) 38; Kaißer:Vergangenheit, 65f. (oder andere Schriften von Kaißer). Vgl. K. 86; Harald Drös: Die Inschriften des Landkreises Göppingen (1997) 258-260.
Die Riesen in den Heidenlöchern
(25) St. III, 26f: “Nach E. Meier”. M. 279. Vgl. K. 92. Zum unterirdischen Gang im Schauppenwald vgl. St. II, 67; Die Staufer und Schwäbisch Gmünd (1977) 123 Anm. 65 (Gerhard M. Kolb). Zu weiteren unterirdischen Gängen vgl. Graf: Chroniken, 165f.
Eine Untat der Riesen
(26) St. III, 27: “Nach E. Meier”. M. 279f. Vgl. K. 82; Graf: Sagen rund um Stuttgart, 112.
Der Staufergeist
(27) St. III, 27f.: “Aus der Gedichtssammlung von Pfletschinger”. Deutsches Declamatorium für Elementarschüler, gesammelt von Joh. Pfletschinger (um 1840, Handschrift StadtAG) S. 368-370. Verfasser ist Rudolf Friedrich Heinrich Magenau: Poetische Volkssagen und Legenden (1825) 74-76. Vgl. K. 86, 88; Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 252.
[Magenau online:
http://books.google.de/books?id=oT0WAAAAYAAJ&pg=PA74 ]
Geistertanz
(28) St. III, 28f.: “Nach E. Meier”. M. 280f. Vgl. K. 90.
Geisterspuk auf dem Aasrücken
(29) St. III, 29: “Nach E. Meier”. M. 281. Vgl. K. 93.
Der Schimmelreiter
(30) St. III, 29.: “Nach E. Meier”. M. 107. Vgl. K. 92.
Die sprechenden Rinder
Der Geist auf dem Furtlepass
Warum man die Degenfelder "Huseldumme" heißt
(31)-(33) St. 57f.: “Nach dem Volksmund”. Nr. 32 auch bei Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 256. Zum Ortsnecknamen (Nr. 33) vgl. Hugo Moser: Schwäbischer Volkshumor (²1981) 279.
Sage vom Bernhardusberg
(34) Vorlage war wohl eine Schrift von Bernhard Kaißer, etwa Kaißer: Vergangenheit, 84. Vgl. K. 108, 110; Josef Seehofer: Die Geschichte der Bernharduswallfahrt (1978) 10f.; Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 255f.
Der rote Zwerg
(35) St. III, 30-38: “Nach H. Scherr”. Scherr 7-27.
Gründung der Kolomanskapelle bei Böhmenkirch
(36) St. III, 51: “Nach E. Meier und nach Stälin”. M. 318. Vgl. K. 43f. Zum Kolomanskult vgl. einhorn-Jb. 1983, 187-203 (Peter Spranger).
Das wilde Heer im Kolomanswald
(37) St. III, 51f.: “Nach E. Meier”. Irrtum, Quelle ist B. 30. Vgl. K. 44-46.
Der Raubritter vom Rosenstein
(38) St. III, 38-46: “Nach H. Scherr”. Scherr 87-112. Nacherzählung in Schüleraufsatz 1945 abgebildet bei Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 262f. Zu den Rosensteinsagen vgl. unter anderem Friedrich Gottschalck: Die Ritterburgen und Bergschlösser Deutschlands 6 (1825) 197-226 (Ferdinand Ludwig Immanuel Dillenius); Franz Keller: Sonderschrift über den Rosenstein (1938) 20-25; Heubach und die Burg Rosenstein (1984) 324-326 (Gerhard M. Kolb).
[Gottschalck online:
http://books.google.com/books?id=9uEFAAAAQAAJ&pg=PA197 ]
Die Erbauung der Beiswanger Kapelle
(39) Unmittelbare Vorlage nicht ermittelt. Friedrich der Freidige dürfte über den Ritterroman [S. 94] “Friedrich mit der gebissenen Wange” (1787/88) von Friedrich Schlenkert in die Sage gelangt sein, vgl. Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 262.
Die Beiswanger Kapelle
(40) St. III, 46-48: “Nach der Gedichtsammlung von Pfletschinger”. Declamatorium (wie Nr. 27) S. 58-61. Verfasser ist Gustav Schwab, siehe dessen: Die Neckarseite der Schwäbischen Alb (1823) 237f.
[Schwab-Gedicht online:
http://de.wikisource.org/wiki/Die_Bei%C3%9Fwanger_Kapelle ]
Das weiße Fräulein
(41) St. III, 38f.: “Nach E. Meier”. M. 39.
Der feurige Jäger auf dem Rosenstein
(42) St. III, 49: “Nach E. Meier”. M. 120.
Die niesende Schlange
(43) St. III, 49: “Nach E. Meier”. M. 209f.
Der Hahn in der Christnacht
(44) St. III, 49f.: “Nach E. Meier und B. Kaißer”. M. 316.
Die Stadt auf dem Hochberg
(45) St. III, 50: “Nach E. Meier und Fr. Keller”. M. 163; Franz Keller: Heubach am Rosenstein als Sommeraufenthalt (1903) 57. Vgl. Martin Crusius: Schwäbische Chronick 2 (1733) 427.
Die lederne Brücke
(46) St. III, 50: “Nach E. Meier”. M. 163.
Die Herrgottstritte
(47) St. III, 50: “Nach Crusius und E. Meier”. Martin Crusius: Schwäbische Chronick 2 (1733) 428; M. 161f. Vgl. einhorn-Jb. 1999, 123-134 (Gerhard M. Kolb); Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 257-262.
Eine Sage von Schloss Lauterburg
(48) St. III, 21f.: “Nach G. Schwab und dem Wöllwarthschen Familien-Archiv”. Gedicht von Gustav Schwab: Die Neckarseite der Schwäbischen Alb (1823) 245f.
[Schwab-Gedicht online:
http://de.wikisource.org/wiki/Sage_von_Schlo%C3%9F_Lauterburg ]
Die Freistatt im "Adler" zu Bargau
(49) St. II, 209f. (wohl mündlich überliefert).
Der Grubenholzmann
(50) St. III, 19f.: “Nach Birlinger und nach dem Volksmund”. B. 19.
Der Burgstallreiter von Herlikofen
(51) St. III, 20f.: “Nach Birlinger”. B. 26f.
Die Gründung Lindachs
(52) St. II, 94 (wohl mündlich überliefert).
Der letzte Ritter von Waldau
(53) St. III, 16-19: “Nach Neuber” (siehe oben zu Nr. 2). Vgl. Der letzte Ritter von Waldau, eine längst vergessene Sage; nach der Neuber’schen Chronik frei erzählt von Georg Stütz. In: RZ Nr. 262 vom 11.11.1922. Zur Burg Waldau vgl. einhorn-Jahrbuch 1980, 212 (Klaus Graf).
Der Weckenklingenreiter
(54) Quelle nicht ermittelt (vermutlich mündlich überliefert). Den Wettenklingenreiter erwähnt St. III, 62.
Das Holgenoferle
Der Schimmelreiter
Im Geisterbann
(55)-(57) St. III, 58-60: “Nach dem Volksmund”.
Der Spatzentannjäger
(58) Erster Teil St. II, 147f.; zweiter Teil D. 45f. Vgl. M. 120; OAB 236.
Die Sagen um Tanau
(59) D. 42f.
Die Tanauer Kirche
(60) D. 43f.
Das Tanauer Kerkerhaus
(61) D. 44f.
Sagen von Zimmerbach und Umgebung
(62) D. 46-50. Die Nummern 62 bis 67 [Druckfehler, richtig: 68] entfielen in der Ausgabe 1981.
Der Hexentanz auf der Schönhardter Heide
(63) St. III, 61f.: “Nach dem Volksmund”.
Der Hagmann
(64) Zweiter Teil nach Bernhard Kaißer: Geschichte und Beschreibung der Marktflecken Hohenstadt und Schechingen (1867) 12. Vgl. J. F.: Der Hagmann. In: Der Spion von Aalen 1927, 81-87.
Der Spion von Aalen
(65) St. II, 279f. Vgl. mit wichtigen Nachweisen Wikisource: Der Spion von Aalen. Online:
http://de.wikisource.org/wiki/Der_Spion_von_Aalen
Geistersagen
(66) St. III, 62f.: “Nach dem Volksmund”. Es finden sich aber auch Hinweise in schriftlichen Quellen, z.B. OAB 460, 394; Anton Birlinger: Aus Schwaben 1 (1874) 97; Gaugele 110-116.
Kreuzstein-Sagen
(67) St. III, 64-69: “Nach dem Volksmund”. Vgl. das Inventar von Bernhard Losch: Sühne und Gedenken (1981).
Sagenhafte Siedlungen und Anlagen
(68) St. III, 69-71: “Teilweise nach dem Volksmund”. Überwiegend aber nach schriftlichen Quellen. Zu den Burgen Etzelburg, Etzelwang und Wolfstal vgl. Graf: Chroniken, 141f. Sagenhaftes Dorf Buidingen: vgl. Blätter des Schwäbischen Albvereins 41 (1929) 286 (Isidor Fischer). Airlighofen und Edelweiler bei Iggingen: OAB 174. Laurentiuskapelle bei Hürbelsbach: Joseph Alois Rink: Beschreibung des ... Oberamts Geißlingen (1823) 117f. Kritik an der Annahme römischer Verschanzungen bezieht sich auf: OAB 167.
(D)
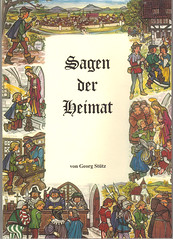
Für die Neuausgabe habe ich meine Nachweise von 1981 (Quellennachweise, in: Georg Stütz, Sagen der Heimat. 3. leicht
gekürzte Auflage, bearbeitet und ergänzt von Lucie Stütz. Mit einem Quellennachweis von Klaus Graf, Schwäbisch Gmünd 1981, S. 92-95) überarbeitet und ergänzt sowie ein Nachwort hinzugefügt. Zusätze gegenüber der Druckfassung von 2011 stehen im folgenden in eckigen Klammern (zusätzliche Online-Nachweise, Berichtigung eines Druckfehlers). Ohne Kennzeichnung wurden die Überschriften der Sagen ergänzt.
Textprobe (S. 21 mit den Nummern 6 und 7):
http://www.flickr.com/photos/34028941@N00/5644683594/in/photostream
--------
[S. 87] Nachwort und Nachweise
Von Klaus Graf
“Heimat” war der Leitbegriff, dem die gesamte literarische Produktion des Schwäbisch Gmünder Lehrers Georg Stütz untergeordnet war. Er verfasste zahlreiche heimatgeschichtliche Artikel in den Gmünder Zeitungen, ein dreibändiges Heimatbuch und eine Chronik Gmünds im Ersten Weltkrieg. “Stütz war ein von christlichen Werten geprägter konservativer und patriotischer Schriftsteller, der mit seinen heimatkundlichen Büchern ganz gewiss nicht nur informieren, sondern auch die Liebe der Menschen zu ihrer Stadt wecken wollte”(Müller 171).
Der 1864 als Lehrersohn in Schlechtbach bei Gschwend geborene Stütz entschied sich ebenfalls für den Lehrerberuf. Ab 1898 wirkte er in Gmünd an der Mädchen-Volksschule. 1948 ist er in Gmünd gestorben.
1919 brachte Stütz sein heimatkundliches Wanderbuch heraus, das in der zweiten Auflage als Band II des “Heimatbuchs für Gmünd und weitere Umgebung” firmierte (1924). 1920 folgte der spätere erste Band, der Führer durch die Stadt (zweite Auflage 1926). Was der dritte Band unter dem Titel “Heimatbilder aus Natur und Kultur” enthalten sollte, deutet die Verlagsanzeige in Bd. II von 1924 an: die Ur- und Frühgeschichte (Archäologie war ein besonderes Steckenpferd von Stütz), “Sagen und Märchen, Sitte und Gebräuche”. Realisiert wurde nur der Teil über die Sagen, ergänzt durch ein neunseitiges Kapitel “Heimatliche Flurnamen”.1927 erschien die Erstausgabe dieses Buchs: “Sagen der Heimat” im Selbstverlag des Verfassers.
Stütz ging es um heimatkundliche Erkenntnisse, aber nicht präsentiert in akademisch-wissenschaftlicher Form. Sein Ansatz war vielmehr ein pädagogisch-popularisierender, der die emotionale Hinwendung zur Heimat in den Mittelpunkt stellte. Die um 1900 entstandene Heimatbewegung übte aus konservativer Perspektive Zivilisationskritik - der als bedrohlich empfundenen Moderne stellte man das Bild einer heilen traditionalen Welt gegenüber. Sagen betrachte man als altes Volksgut, das es ebenso zu pflegen galt wie Trachten oder traditionelle Bauweise. So heißt es denn auch im Vorwort der Sagensammlung: “Die Sage flieht die Eisenbahn und die Fabrik, aber in abgelegenen Dörfern und vereinsamten Bauernhöfen ist sie immer noch heimisch”.
Für Stütz weben Sagen “ihren Zauberschleier um einsame Kapellen und halbverwitterte Kreuzsteine; sie ... raunen und wispern geheimnisvoll in weltfernen Tälern und Wäldern”. Stütz folgt mit dieser Beschreibung einer Idylle somit einem romantischen Sagenkonzept. Im Vordergrund steht die - inzwischen abgelehnte - mythologisierende Deutung der Sagen, die schon im 19. [S. 88] Jahrhundert die deutsche Lehrerschaft begeisterte. Geradezu zwanghaft suchte man in den “dämonologischen” Sagen, die sich vor allem auf Geistererscheinungen beziehen, Spuren des altgermanischen Götterglaubens.
Natürlich deutete Stütz das Muetesheer als Wodansheer. Aber wie die Leute davon erzählten und welchen konkreten Stellenwert die Geschichten vom Mutesheer für die Erzähler und Hörer besaßen, ihr “Sitz im Leben” also, interessierte ihn offenbar gar nicht. Mit dem Hinweis auf Wodan war das Muetesheer abgehakt. Wenn sich an den Kameralverwalter von Schönlein auf dem Rehnenhof im 19. Jahrhundert eine Sage knüpfte (siehe “Der Heuranz”), war das für Stütz ein “Gebilde törichter Phantasie” und er begrüßte es, dass sie nur noch in Landorten wie Zimmerbach im Schwange, in der Nähe des Rehnenhofs aber erloschen war. Eine Vielzahl kurzer Geistersagen packte er in einen Abschnitt über Geistersagen am Ende seines Büchleins. Stütz ging also mit klaren Maßstäben, die er anderen Heimatbüchern und Sagensammlungen entnahm, an die Arbeit des Sagensammelns: Für die Eigenart und Vielfalt der mündlichen Überlieferung hatte er keinen Sinn.
Nur ein kleiner Teil seiner Sagen sind aus dem “Volksmund” zusammengetragen; die meisten stammen aus schriftlichen Quellen. Verdienstvoll ist seine Zusammenstellung der Kreuzsteinsagen. Daneben hat er vor allem in Degenfeld und Täferrot je drei Geschichten aus der mündlichen Überlieferung aufgezeichnet.
Außer der Geigersage wollte Stütz auf unechte, erfundene Sagen verzichten. Dies ist ihm aber überhaupt nicht gelungen, bereits Nr. 2 seiner Sammlung, “Der Stadtrichter von Gmünd”, geht auf eine literarische Erfindung, nämlich das Stuttgarter Blatt “Stadt-Glocke” zurück. Die Grenze zwischen Folklore, also authentischer Volksüberlieferung, und “Fakelore”, erfundenen Geschichten im Gewand von Volkserzählungen, ist zwar fließend, aber der Anteil von unecht wirkenden “Sagen” ist bei Stütz erheblich. Bei den beiden Sagen aus Johannes Scherrs Band “Sagen aus Schwabenland” (1836), literarischen Texten, die sich als Sagen tarnen, und der aus der (nicht auffindbaren) Neuberschen Chronik entnommenen Waldauer Sage schreibt Stütz selbst, sie seien novellenartig ausgeschmückt und dichterisch ausgestaltet. Solche Ausschmückungen begegnen aber auch bei den Sagen, die dem Heimatbuch von Bernhard Gaugele (1910) entnommen sind, und bei weiteren Texten.
Ohne die zahlreichen Erzählungen, die Stütz den gedruckten Sammlungen von Ernst Meier (1852) und Anton Birlinger (1861) entnahm, wäre sein Büchlein allzu schmal geworden, und Stütz hätte sich womöglich genötigt gesehen, die mündliche Erzählüberlieferung nicht nur gleichsam nebenbei zu berücksichtigen. Die vorgefundenen Texte gab Stütz nicht getreu wieder, sondern er schrieb sie um. Er modernisierte die Sprache und straffte sie, wenn er der An-[S. 89]sicht war, dass sie so für sein Publikum lesbarer wurden. Bei den Geschichten Scherrs gab er im Vorwort selbst zu, dass er sie stark gekürzt und verändert hat. “Nicht die Sage, nur ihr Kleid” sei damit umgestaltet worden.
Mit der gleichen Freiheit, die sich Stütz gegenüber seinen Vorlagen herausnahm, verfuhr auch seine Tochter Lucie Stütz, als es 1950 galt, das Sagenbuch ihres zwei Jahre zuvor verstorbenen Vaters neu aufzulegen. Sie fügte in den anderen beiden Bänden des Heimatbuchs enthaltene Texte hinzu und strich Teile des Vorworts, den Flurnamen-Anhang sowie Sagen aus Schorndorf und Geislingen, da diese Orte für ein “Gmünder Sagenbuch” wohl zu weit entfernt waren. Außerdem fügte sie eine kleine Anzahl weiterer Sagen aus anderen Quellen hinzu.
Lucie Stütz (1894-1982) war Lehrerin wie ihr Vater und Schriftstellerin. Ihre Eingriffe in den vorgefundenen Textbestand gingen sehr viel weiter als die ihres Vaters. Albert Deibele hatte in den Gmünder Heimatblättern 1933 eine kurze Notiz von Dominikus Debler über den Falschmünzer Sperfechter erzählerisch ausgestaltet. Lucie Stütz übernahm diese Geschichte, überarbeitete sie aber tiefgreifend. Das Verbrechen wird bei Deibele durch die vom Teufel entzündete Geldgier motiviert. Lucie Stütz bringt aber die Ehefrau ins Spiel: “Frau Barbara steht droben in der lichten Stube mit den Birnbaumkommoden und bauchigen Truhen. Sie hört die dröhnenden Hämmer drunten und weiß, was sie schreien. Auf ihren geizigen Mund springt ein triumphierendes Lächeln, sie wiegt sich vor dem goldgerahmten Spiegel und schwenkt die Hüften wie die reichen Patrizierinnen, die am Festtag vierspännig ins Münster fahren. Deren goldene Ringe, funkelnde Halsketten und blutrote Granatbroschen, seidene Röcke und samtene Mieder stechen ihr schon lange in die Augen. Wie gierige Zangen fegen ihre Hände in schlaflosen Nächten über die Bettdecke: 'Gold, Gold, Gold!' zischelte sie ihrem Mann ins Ohr”. Der Versuch, lebendig und anschaulich zu schreiben (wohl mit Blick auf den Schulunterricht), produzierte aus heutiger Sicht “Sagenkitsch”, der sich weit von dem entfernt, was man sich üblicherweise unter einer “Volkssage” vorstellt.
Es ist kein Zufall, dass sehr viele Autoren von Sagenbüchern Lehrer waren. Die Moral der Sagen, in denen Frevler stets hart bestraft wurden, kam ihnen entgegen. Ihnen gefiel der erhobene Zeigefinger.
Bei der dritten Auflage 1981, illustriert mit Zeichnungen von Martin Meisner, hat man auf solche fragwürdigen Eingriffe verzichtet. Allerdings fiel der letzte Teil des Büchleins von 1950 (ab den Sagen von Zimmerbach) einer Kürzung zum Opfer. Diese, wie auch die Ausführungen zu den sagenhaften Siedlungen sind aber in der vorliegenden Ausgabe wieder vertreten.
Heute sieht die Erzählforschung Sagen nicht als “wertvolles Erbgut”, das Botschaften aus uralter Zeit vermittelt. Sagen müssen zuallererst als litera-[S. 90]rische Texte aus der Zeit, in der sie niedergeschrieben wurden, begriffen werden. Sie sind kein Spiegel grauer Vorzeit, sondern allenfalls der Verhältnisse im 19. und 20. Jahrhundert. Beispielsweise sind die beliebten Raubrittergeschichten keine Zeugnisse aus dem Mittelalter, sondern dokumentieren den seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert von trivialen Rittergeschichten geprägten Lesegeschmack breiter Schichten. Also gab es auch keine alte Tradition, die die Beiswanger Kapelle mit dem weitab wirkenden Wettiner Friedrich mit der gebissenen Wange verknüpfte, sondern diese Verbindung wurde sicher erst im späten 18. Jahrhundert hergestellt und verdankt sich wohl der Lektüre eines populären Ritterromans über Friedrich mit der gebissenen Wange.
Als nostalgische Lektüre, die die nach wie vor beliebten Klischees über Sagen bedient, ist das Stützsche Sagenbuch sicher ausgezeichnet geeignet. Aber nach dem Gesagten wundert es nicht, wenn sein Wert für die Erforschung der Erzählkultur rund um Gmünd eher bescheiden einzuschätzen ist (sowohl in der Fassung von 1927 als auch in der von 1950).
Man könnte heute eine ganze Reihe weiterer Sagentexte ergänzen, teils Texte, die bewusst übergangen wurden, teils Texte, die in handschriftlichen Quellen neu aufgefunden wurden. Beispielsweise hat Stütz wohl ganz bewusst die bei Birlinger 1861 enthaltene Erzählung “Die Baumeisterin in Gmünd” weggelassen, die eine Figur am Münster als Baumeisterin deutet, die sich nach dem Festmahl nach Abschluss des Baus habe übergeben müssen. Das war für Stütz wohl eine ganz und gar unangemessene Erzählung, die weder seinen Vorstellungen von Volkspoesie entsprach noch mit seiner Auffassung von der Würde des Gmünder Münsters vereinbar war.
Aus der Sicht der Erzählforschung würde man sich wünschen, dass es möglich wäre, möglichst vollständig die wichtigsten Versionen einer Sage (z.B. der Ringsage einschließlich der poetischen Gestaltungen) wiederzugeben. Aber eine wissenschaftliche Ausgabe, die getreu dem Wortlaut ihrer Vorlagen folgt und einen ausführlichen Kommentar bietet, ist unter den derzeitigen Bedingungen des Verlagswesens so gut wie nicht realisierbar. Besseren Absatz versprechen die gefällig umgeschriebenen Sagenbücher, in denen der auf altes Volksgut gespannte Leser nicht durch ideologiekritische Hinweise, dass es sich bei den Volkssagen um einen romantischen Mythos handle, verschreckt wird.
Das Internet kennt solche beengenden Rahmenbedingungen nicht. So mag denn am Schluss der Hinweis auf die Schwäbisch Gmünd-Seite der freien Quellensammlung Wikisource stehen, die eine Sammlung vorlagengetreu wiedergegebener Gmünder Sagen bietet, einschließlich verschiedener Versionen. Hier finden sich bereits einige Sagen, die bei Georg und Lucie Stütz fehlen.
[S. 91] Abkürzungen und Literatur
B. = Birlinger, Anton/Buck, Michael: Volksthümliches aus Schwaben 1 (1861). Online:
http://books.google.com/books?id=lD4JAAAAQAAJ
Bullinger, Tanja: Lucie Stütz. In: Literarische Vielfalt in Ostwürttemberg. Frauen greifen zur Feder I (2008) 133-137
D. = Deibele, Albert: Zwischen Lein und Kocher. Sagen und Geschichten. In: GH 2 (1929) 41-51
Gaugele, Bernhard: Meiner Heimat Täler und Höhen (1910) - Exemplar StadtAG
[Online:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaugele_Meiner_Heimat_T%C3%A4ler_und_H%C3%B6hen.djvu ]
Graf, Klaus: Gebilde törichter Phantasie? Überlegungen zu Gmünder "Sagen",. In: ostalb/einhorn 25 (1998), H. 97, 36-45. Online:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/sagd.htm
Graf, Klaus: Gmünder Chroniken im 16. Jahrhundert (1984)
[Online: http://books.google.de/books?id=PoAgAAAAMAAJ ]
Graf, Klaus: Die Gmünder Ringsage. Entstehung und Entwicklung einer Staufer-Überlieferung. In: einhorn-Jahrbuch 1982, 129-150
Graf, Klaus: Kleine Beiträge zum historischen Erzählen in Schwäbisch Gmünd. In: einhorn-Jahrbuch 1991, 99-114
[Online:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7790/ ]
Graf, Klaus: Der Ring der Herzogin: Überlegungen zur "Historischen Sage" am Beispiel der Schwäbisch Gmünder Ringsage. In: Babenberger und Staufer (1987), 84-134. Online:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5841/
Graf, Klaus (Hrsg.): Sagen der Schwäbischen Alb (2008)
Graf, Klaus: Sagen rund um Stuttgart (1995). Online:
http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2009/113809/
Graf, Klaus: Das Salvatorbrünnlein. Eine bislang unbekannte Gmünder "Sage" aus der Sammlung des Stuttgarter Gymnasialprofessors Albert Schott d. J. (1809-1847). In: einhorn-Jahrbuch 1995, 109-118. Online:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5585/
Graf, Klaus: Schwabensagen. Zur Beschäftigung mit Sagen im 19. und 20. Jahrhundert (2007). Online:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3459/
Graf, Klaus: Der Stadtrichter von Gmünd. Eine erfundene Sage aus der "Stuttgarter Stadt-Glocke" 1845. In: einhorn-Jahrbuch 1998, 99-106. Online:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/enzing.htm
GH = Gmünder Heimatblätter
K. = Kettenmann, Jürgen: Sagen im Kreis Göppingen (³1989)
Kaißer, Bernhard: Aus der Vergangenheit Gmünds und seiner Umgebung (1911). Online:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Aus_der_Vergangenheit_Gm%C3%BCnds_und_seiner_Umgebung
M. = Meier, Ernst: Deutsche Sagen, Sitten und Gebräuche aus Schwaben (1852). Online:
http://books.google.com/books?id=t1sKAAAAIAAJ
Müller, Ulrich: Georg Stütz. In: Heimatforscher aus dem Raum Schwäbisch Gmünd (2009) 167-177
OAB = Beschreibung des Oberamts Gmünd (1870). Online:
http://de.wikisource.org/wiki/Beschreibung_des_Oberamts_Gm%C3%BCnd
RZ = Rems-Zeitung
Scherr, Johannes: Sagen aus Schwabenland (1836) . Online:
http://books.google.com/books?id=FkgWAAAAYAAJ
Setzen, Florian Henning: Geheimnisvolles Christental (1994)
St. = Stütz, Georg: Heimatbuch für Gmünd und weitere Umgebung. I: Gmünd in Wort und Bild (²1926), II: Wanderungen in der Heimat (²1924), III: Sagen der Heimat (1927)
StadtAG = Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd
Wikisource: Schwäbisch Gmünd [mit Sagensammlung]. Online:
http://de.wikisource.org/wiki/Schw%C3%A4bisch_Gm%C3%BCnd
[S. 92] Nachweise
An erster Stelle steht jeweils die unmittelbare Quelle, soweit ermittelt. Das Inhaltsverzeichnis der Erstausgabe 1927 (= St. III) S. 82f. enthielt - sehr kursorische, manchmal auch fehlerhafte - Quellenangaben, die stets zitiert werden. In der Ausgabe von 1950 gab es dann nur noch die Seite “Quellenverzeichnis” S. 83.
Mit “Vgl.” eingeleitet werden im folgenden Hinweise auf Parallelen und Sekundärliteratur. Es gilt (wie schon 1981), dass die wünschenswerte Vollständigkeit nicht erzielt werden konnte. In Zeitungen und Zeitschriften dürfte noch der eine oder andere ältere Beleg zu finden sein, in der (für mich nicht greifbaren) Lokalliteratur der erwähnten Orte um Gmünd weitere Materialien zur Erläuterung der Sagen. Nicht alle gedruckten Vorlagen konnten sicher bestimmt werden.
Der Geiger von Gmünd
(1) St. III, 5-7: “Just. Kerner”. Vgl. grundlegend Peter Spranger: Der Geiger von Gmünd (²1991).
Der Stadtrichter von Gmünd
(2) St. III, 8-11: “nach Neuber und nach ‘Württ. Volksbücher’ v. Württ. Ev. Lehrerunterstützungsverein Stuttgart”. Württembergische Volksbücher 1 (o. J., 1905) 170-174; die Quelle Neuber konnte nicht aufgefunden werden, vgl. einhorn-Jahrbuch 1981, S. 182, 185 (Klaus Graf). Vgl. zur erfundenen Sage, die zuerst in der Stuttgarter Stadt-Glocke vom 11.4.1845 erschien, ausführlich Graf: Stadtrichter.
Gründung der Johanniskirche
(3) St. I, 93-95. Vgl. zur Gmünder Ringsage Peter Spranger: Schwäbisch Gmünd bis zum Untergang der Staufer (1972) 25-29; Graf: Ringsage; Graf: Ring; Graf: Salvatorbrünnlein.
Der bestrafte Baumeister
(4) St. I, 98. Stütz folgt der Fassung von Dominikus Debler (Chronik im StadtAG) Bd. 1, S. 77.Vgl. zur Baumeistersage der Johanniskirche Graf: Kleine Beiträge, 107-109; Richard Strobel: Aus der Vorzeit der Inventarisation in Württemberg. In: Beiträge zur Denkmalkunde (1991) 19-29, hier 27.
Der Falschmünzer
(5) Albert Deibele: Sperfechter der Falschmünzer. In: GH 6 (1933) 174-176 vor allem nach Dominikus Debler (Chronik im StadtAG) Bd. 3, S. 559, der aber nur eine kurze Notiz bietet. In der Ausgabe von 1950 erheblich verändert. Vgl. Graf: Kleine Beiträge, 102-107.
Der Schlurkerle
(6) St. III, 11: “Nach Neuber” (siehe oben zu Nr. 2). Urquelle ist wohl B. 72.
Der Mauerbockeler
(7) Unmittelbare Quelle unbekannt. Vgl. RZ Nr. 27 vom 3.2.1876, 105.
Der Heuranz
(8) St. II, 87; D. 50f. Auf Deibele reagierte G. Stütz mit: Der wahre “Heuranz”. In: GH 2 (1929), 57f.
Die Lampe im Grab des Bruders David
(9) St. I, 162f. Die lateinische Vorlage, Chronik des Berard Müller: Alemania Franciscana Antiqua 12 (1964) 72. Vgl. Graf: Chroniken, 145.
Die Stiftung der Dreifaltigkeitskapelle
(10) Unmittelbare Quelle unbekannt. Von den bei Klaus Graf: Zur Geschichte der Dreifaltigkeitskapelle vor 1866. In: 300 Jahre Dreifaltigkeitskapelle in Schwäbisch Gmünd (1993) 18-28 zitierten Versionen folgt der (die Amsel-Variante aufweisende) Text am ehesten der Familienüberlieferung bei Winz 1877 (abgedruckt ebd., 88).
Die Gründung der Burg Rechberg und die Sagen vom Christental
(11) Erster Teil St. II, 243f., zweiter Teil St. III, 29: “Nach Birlinger und Buck”. B. 228 (Stütz nennt ausnahmsweise Birlingers Co-Autor Michael Buck). Die angebliche Christentalschlacht geht auf die Chronik Thomas Lirers zurück, vgl. ausführlich Setzen. Vgl. auch K. 103-108; Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 243-245.
Der Klopferle vom Rechberg
(12) St. II, 107f., in der Ausgabe 1950 erheblich erzählerisch umgestaltet. Vgl. Friedrich Gottschalck: Die Ritterburgen und Bergschlösser Deutschlands 3 (1813) 306f. (Joseph Alois Rink); Engelbert Hofele: Bilder aus Schwaben (o. J., 1881) 507-510; K. 133-136; Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 254f.
[Gottschalck 2. Aufl. 1820 online:
http://books.google.com/books?id=reEFAAAAQAAJ&pg=PA305 ]
"Schön Dorle" oder "Das Rambrechtsweible"
(13) St. III, 11-14: “Teilweise nach B. Gaugele”. Gaugele 100-110. Siehe auch zur folgenden Nummer.
Der Holzbrockeler
(14) Gegenüber Stütz III, 54f.: “Nach Hofelich und nach Birlinger” (Hofelich meint Hofele) und St. II, 226f. erheblich erweitert. B. 220, Engelbert Hofele: Bilder aus Schwaben (o. J., 1881) 487f. Vgl. OAB 460; Gaugele 93-100; Heimatbuch Donzdorf (1976) 53-58 (Georg Gaugele); K. 55-58; Setzen 150-187; Bernhardin Schellenberger: Die berühmt-berüchtigte Regierungs-[S. 93]zeit des Joachim Berchtold von Roth in Winzingen (1607-1621). In: Hohenstaufen/Helfenstein 4 (1994) 67-124; Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 245-247 (hat Schellenberger 115f. übersehen).
Der Einsiedler vom Heldenberg
(15) St. III, 15f.: “Nach dem Volksmund und nach B. Gaugele”. Gaugele 78-80.
Die feindlichen Brüder
(16) St. III, 52f.: “Nach Hofelich und nach Birlinger”. B. 256f. Vgl. K. 108; Setzen 28-34; Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 248f. nach der Chronik Friedrich Vogts 1674 (Handschrift StadtAG) S. 468. Zu den Graneckle-Sagen vgl. Setzen 57-108.
Das goldene Kegelspiel
(17) St. III, 53f.: “Nach Hofelich und nach Birlinger”. B. 101. Vgl. Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 250.
Der stumme Zwerg
(18) St. III, 54: “Nach Hofelich und nach Birlinger”. B. 41f. (Birlinger gibt Hofele als Quelle an).
Der Schatzgräber vom Graneckle
(19) Die Sage von Jakob Veit stammt von Gaugele 52-58; St. II, 198f. nennt den Namen noch nicht. Vgl. Engelbert Hofele: Bilder aus Schwaben (o. J., 1881) 488f.; Setzen 60-68 druckt den Text nach Gaugele 1910 wieder ab; Graf, Sagen der Schwäbischen Alb, 250f. (nach Hofele).
Das Nenninger Kirchbrünnlein
(20) St. III, 55f.: “Von Ä. Schweizer”. Gedicht von Ägidius Schweizer, der 1918-1923 Schulleiter in Nenningen war, vgl. Josef Seehofer:Ortgeschichte von Nenningen (1970) 110.
Sagen vom Wäscherschlösschen
(21) St. II, 121f. Vgl. K. 121f. Stütz bezieht sich auf Württemberg wie es war und ist 1 (1866) 306f. Die weiße Frau zu Büren ist aber ebenso eine Stadt-Glocke-Erfindung wie oben Nr. 2.
["Württemberg wie es war und ist" online:
http://books.google.de/books?id=J4AAAAAAcAAJ&pg=PA306 ]
Wie der Hohenstaufen entstanden ist
(22) Könnte aus Franz Georg Brustgi: Schwäbisches Sagenbuch (1940) 7f. stammen oder aus Württembergische Volksbücher 2 (o. J. 1905) 3. Vgl. K. 93f.
Herzogin Judit
(23) St. III, 22-25: “teilweise nach ‘Württ. Volksbücher’ vom Württ. ev. Lehrerunterstützungsverein”. Württembergische Volksbücher 2 (o.J., 1905) 6-13. Vgl. K. 94f.
Die Sage von der Barbarossa-Kapelle
(24) St. III, 25f.: “Nach M. Grimm und B. Kaißer”. Michael Grimm: Geschichte der ehemaligen Reichsstadt Gmünd (1867) 38; Kaißer:Vergangenheit, 65f. (oder andere Schriften von Kaißer). Vgl. K. 86; Harald Drös: Die Inschriften des Landkreises Göppingen (1997) 258-260.
Die Riesen in den Heidenlöchern
(25) St. III, 26f: “Nach E. Meier”. M. 279. Vgl. K. 92. Zum unterirdischen Gang im Schauppenwald vgl. St. II, 67; Die Staufer und Schwäbisch Gmünd (1977) 123 Anm. 65 (Gerhard M. Kolb). Zu weiteren unterirdischen Gängen vgl. Graf: Chroniken, 165f.
Eine Untat der Riesen
(26) St. III, 27: “Nach E. Meier”. M. 279f. Vgl. K. 82; Graf: Sagen rund um Stuttgart, 112.
Der Staufergeist
(27) St. III, 27f.: “Aus der Gedichtssammlung von Pfletschinger”. Deutsches Declamatorium für Elementarschüler, gesammelt von Joh. Pfletschinger (um 1840, Handschrift StadtAG) S. 368-370. Verfasser ist Rudolf Friedrich Heinrich Magenau: Poetische Volkssagen und Legenden (1825) 74-76. Vgl. K. 86, 88; Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 252.
[Magenau online:
http://books.google.de/books?id=oT0WAAAAYAAJ&pg=PA74 ]
Geistertanz
(28) St. III, 28f.: “Nach E. Meier”. M. 280f. Vgl. K. 90.
Geisterspuk auf dem Aasrücken
(29) St. III, 29: “Nach E. Meier”. M. 281. Vgl. K. 93.
Der Schimmelreiter
(30) St. III, 29.: “Nach E. Meier”. M. 107. Vgl. K. 92.
Die sprechenden Rinder
Der Geist auf dem Furtlepass
Warum man die Degenfelder "Huseldumme" heißt
(31)-(33) St. 57f.: “Nach dem Volksmund”. Nr. 32 auch bei Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 256. Zum Ortsnecknamen (Nr. 33) vgl. Hugo Moser: Schwäbischer Volkshumor (²1981) 279.
Sage vom Bernhardusberg
(34) Vorlage war wohl eine Schrift von Bernhard Kaißer, etwa Kaißer: Vergangenheit, 84. Vgl. K. 108, 110; Josef Seehofer: Die Geschichte der Bernharduswallfahrt (1978) 10f.; Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 255f.
Der rote Zwerg
(35) St. III, 30-38: “Nach H. Scherr”. Scherr 7-27.
Gründung der Kolomanskapelle bei Böhmenkirch
(36) St. III, 51: “Nach E. Meier und nach Stälin”. M. 318. Vgl. K. 43f. Zum Kolomanskult vgl. einhorn-Jb. 1983, 187-203 (Peter Spranger).
Das wilde Heer im Kolomanswald
(37) St. III, 51f.: “Nach E. Meier”. Irrtum, Quelle ist B. 30. Vgl. K. 44-46.
Der Raubritter vom Rosenstein
(38) St. III, 38-46: “Nach H. Scherr”. Scherr 87-112. Nacherzählung in Schüleraufsatz 1945 abgebildet bei Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 262f. Zu den Rosensteinsagen vgl. unter anderem Friedrich Gottschalck: Die Ritterburgen und Bergschlösser Deutschlands 6 (1825) 197-226 (Ferdinand Ludwig Immanuel Dillenius); Franz Keller: Sonderschrift über den Rosenstein (1938) 20-25; Heubach und die Burg Rosenstein (1984) 324-326 (Gerhard M. Kolb).
[Gottschalck online:
http://books.google.com/books?id=9uEFAAAAQAAJ&pg=PA197 ]
Die Erbauung der Beiswanger Kapelle
(39) Unmittelbare Vorlage nicht ermittelt. Friedrich der Freidige dürfte über den Ritterroman [S. 94] “Friedrich mit der gebissenen Wange” (1787/88) von Friedrich Schlenkert in die Sage gelangt sein, vgl. Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 262.
Die Beiswanger Kapelle
(40) St. III, 46-48: “Nach der Gedichtsammlung von Pfletschinger”. Declamatorium (wie Nr. 27) S. 58-61. Verfasser ist Gustav Schwab, siehe dessen: Die Neckarseite der Schwäbischen Alb (1823) 237f.
[Schwab-Gedicht online:
http://de.wikisource.org/wiki/Die_Bei%C3%9Fwanger_Kapelle ]
Das weiße Fräulein
(41) St. III, 38f.: “Nach E. Meier”. M. 39.
Der feurige Jäger auf dem Rosenstein
(42) St. III, 49: “Nach E. Meier”. M. 120.
Die niesende Schlange
(43) St. III, 49: “Nach E. Meier”. M. 209f.
Der Hahn in der Christnacht
(44) St. III, 49f.: “Nach E. Meier und B. Kaißer”. M. 316.
Die Stadt auf dem Hochberg
(45) St. III, 50: “Nach E. Meier und Fr. Keller”. M. 163; Franz Keller: Heubach am Rosenstein als Sommeraufenthalt (1903) 57. Vgl. Martin Crusius: Schwäbische Chronick 2 (1733) 427.
Die lederne Brücke
(46) St. III, 50: “Nach E. Meier”. M. 163.
Die Herrgottstritte
(47) St. III, 50: “Nach Crusius und E. Meier”. Martin Crusius: Schwäbische Chronick 2 (1733) 428; M. 161f. Vgl. einhorn-Jb. 1999, 123-134 (Gerhard M. Kolb); Graf: Sagen der Schwäbischen Alb, 257-262.
Eine Sage von Schloss Lauterburg
(48) St. III, 21f.: “Nach G. Schwab und dem Wöllwarthschen Familien-Archiv”. Gedicht von Gustav Schwab: Die Neckarseite der Schwäbischen Alb (1823) 245f.
[Schwab-Gedicht online:
http://de.wikisource.org/wiki/Sage_von_Schlo%C3%9F_Lauterburg ]
Die Freistatt im "Adler" zu Bargau
(49) St. II, 209f. (wohl mündlich überliefert).
Der Grubenholzmann
(50) St. III, 19f.: “Nach Birlinger und nach dem Volksmund”. B. 19.
Der Burgstallreiter von Herlikofen
(51) St. III, 20f.: “Nach Birlinger”. B. 26f.
Die Gründung Lindachs
(52) St. II, 94 (wohl mündlich überliefert).
Der letzte Ritter von Waldau
(53) St. III, 16-19: “Nach Neuber” (siehe oben zu Nr. 2). Vgl. Der letzte Ritter von Waldau, eine längst vergessene Sage; nach der Neuber’schen Chronik frei erzählt von Georg Stütz. In: RZ Nr. 262 vom 11.11.1922. Zur Burg Waldau vgl. einhorn-Jahrbuch 1980, 212 (Klaus Graf).
Der Weckenklingenreiter
(54) Quelle nicht ermittelt (vermutlich mündlich überliefert). Den Wettenklingenreiter erwähnt St. III, 62.
Das Holgenoferle
Der Schimmelreiter
Im Geisterbann
(55)-(57) St. III, 58-60: “Nach dem Volksmund”.
Der Spatzentannjäger
(58) Erster Teil St. II, 147f.; zweiter Teil D. 45f. Vgl. M. 120; OAB 236.
Die Sagen um Tanau
(59) D. 42f.
Die Tanauer Kirche
(60) D. 43f.
Das Tanauer Kerkerhaus
(61) D. 44f.
Sagen von Zimmerbach und Umgebung
(62) D. 46-50. Die Nummern 62 bis 67 [Druckfehler, richtig: 68] entfielen in der Ausgabe 1981.
Der Hexentanz auf der Schönhardter Heide
(63) St. III, 61f.: “Nach dem Volksmund”.
Der Hagmann
(64) Zweiter Teil nach Bernhard Kaißer: Geschichte und Beschreibung der Marktflecken Hohenstadt und Schechingen (1867) 12. Vgl. J. F.: Der Hagmann. In: Der Spion von Aalen 1927, 81-87.
Der Spion von Aalen
(65) St. II, 279f. Vgl. mit wichtigen Nachweisen Wikisource: Der Spion von Aalen. Online:
http://de.wikisource.org/wiki/Der_Spion_von_Aalen
Geistersagen
(66) St. III, 62f.: “Nach dem Volksmund”. Es finden sich aber auch Hinweise in schriftlichen Quellen, z.B. OAB 460, 394; Anton Birlinger: Aus Schwaben 1 (1874) 97; Gaugele 110-116.
Kreuzstein-Sagen
(67) St. III, 64-69: “Nach dem Volksmund”. Vgl. das Inventar von Bernhard Losch: Sühne und Gedenken (1981).
Sagenhafte Siedlungen und Anlagen
(68) St. III, 69-71: “Teilweise nach dem Volksmund”. Überwiegend aber nach schriftlichen Quellen. Zu den Burgen Etzelburg, Etzelwang und Wolfstal vgl. Graf: Chroniken, 141f. Sagenhaftes Dorf Buidingen: vgl. Blätter des Schwäbischen Albvereins 41 (1929) 286 (Isidor Fischer). Airlighofen und Edelweiler bei Iggingen: OAB 174. Laurentiuskapelle bei Hürbelsbach: Joseph Alois Rink: Beschreibung des ... Oberamts Geißlingen (1823) 117f. Kritik an der Annahme römischer Verschanzungen bezieht sich auf: OAB 167.
(D)
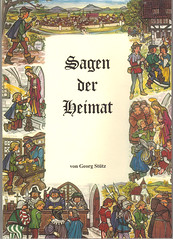
KlausGraf - am Freitag, 22. April 2011, 21:51 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://etheses.whiterose.ac.uk/1430/1/Ralph_Moffat_PhD_2010.pdf
In the Royal Armouries collection is a codex comprising three fifteenth-century manuscripts in French [codex RAR.0035(I.35), KG]. The codex is not only unpublished, it has never been transcribed or translated. The content is a primary source for the study of the medieval tournament as well as many other aspects of the elite culture of late-medieval Burgundy, England, and France. It is composed of fourteen different texts called items. This edition comprises a transcription of over 50,000 words of text in three different hands and a translation from the medieval French into English.
(RSS)
In the Royal Armouries collection is a codex comprising three fifteenth-century manuscripts in French [codex RAR.0035(I.35), KG]. The codex is not only unpublished, it has never been transcribed or translated. The content is a primary source for the study of the medieval tournament as well as many other aspects of the elite culture of late-medieval Burgundy, England, and France. It is composed of fourteen different texts called items. This edition comprises a transcription of over 50,000 words of text in three different hands and a translation from the medieval French into English.
(RSS)
KlausGraf - am Freitag, 22. April 2011, 16:18 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Mir ging es zunächst nur darum, auf das Phaenomen hinzuweisen, dass blogger die nichtkommerziell bloggen von kommerziell orientierten Webplattformen angeworben werden. Was ist davon zu halten ?
Es erscheint mir rechtlich unbedenklich, trotzdem nein danke.
Warum nein danke ?
Vor zwei Tagen kamen wir aus Kalifornien zurück. Carmel, Yosemite, Lake Tahoe. Jet lag. Madrid im April ist einzigartig. Heute meine gewohnte Radtour durch die Stadt. Menschenleer. Beim Radfahren liess ich mir die wikio-Geschichte noch mal durch den Kopf gehen.
Wikios Einnahmen stammen von der Zugriffserhöhung auf den websites ihrer Kunden. Ein gängiges Geschäft, das ich gut kenne.
Wikio verkauft Beiträge von sogenannten Experten. Stopp, stimmt nicht ganz. Wikio verkauft Zugriffe. "Experten" schreiben zu einem Thema und lassen hier und da Hinweise fallen die letztendlich dazu führen, dass bestimmte Kundenwebsites angeklickt werden. Monatlich werden die clicks abgerechnet. Dabei werden teilweise grosse Summen fakturiert. Spanische Banken lieben es, wenn Kunden sich für Darlehen interesserien. Also ein Artikel zu einer Hypothek und der Kunde landet zum Beispiel bei Banco San.....der usw. Kommt es zum Abschluss gibt es noch mehr Geld.
Auf der Einkaufsseite gilt es, Experten (ohne Anführungszeichen) billig einzukaufen. Wie wäre es mit einem Rechtsanwalt ? 15 € für einen Beitrag ? Der Chefeinkäufer bei wikio ist sehr clever. Wie erhöhe ich den kommerziellen Wert des beitragenden "Experten" oder Experten ? Wie erhöhe ich wikios Rendite ? Ich veröffentliche ein Listing der phänomenalsten weblogs. Archivalia auf Patz 3 der wissenschaftlichen Blogs. Sorry, das ist Unfug. Oder sollte man es Manipulation nennen ? Interessante Frage. Täuschung des Lesers über die Wertigkeit des Experten ? Er mag ja wirklich ein Experte sein, aber, prüft das jemand nach ? Nein. Geprüft werden Zugrifsszahlen. Also wikio schaut sich die Liste der meistgelesenen Beiträge in archivalia an und sagt sich: Oh, Herr vom Hofe und Herr Dr. Graf wurden zigtausendmal angeklickt. Interessant für uns. Worüber schreiben die eigentlich ? Sch---egal.
15 euro für einen Expertenbeitrag ? Das sind die cleveren Deutschen die es schaffen, dass Experten einen Bogen um Deutschland machen.
FAZ zur Frage warum die Inmigration nach Deutschland ausbleibt
http://goo.gl/jmC1C
Dann kommt ja noch das Wetter hinzu und das fehlende Licht von November bis Mai. Und die wikio Schlaumeier freuen sich über das brummende Geschäft mit den Zugriffszahlen. Der Inhalt von archivalia ist ihnen wurscht. Sie wollen Zugriffszahlen. That´s all. Also aus meiner Sicht, Finger weg von wikio und das Listing kann ich getrost vergessen. Und solche Praktiken machen die Deutschen unbeliebt, nicht die Deutschen auf Mallorca, oder der euro in Spanien, der es den Spaniern so schwer macht über die Runden zu kommen, oder die von deutschen Banken mit angefachte Immobilienblase usw. Das ist ein anderes Thema*.
Für diesen Beitrag berechne ich nichts.
Wer diesen Beitrag bei wikio anklickt landet bei La......ter.
Lan......ter zahlt sicherlich mehr als 15 euro.
http://www.wikio.de/ausland/europa/spanien/madrid
Ich gehe einen Schritt weiter:
wikio klaut den Inhalt von archivalia um mittels archivalia Zugriffe auf eine Kosmetikfirmenwebsite zu forcieren und dafür zu kassieren.
Gebauchpinselt werden die blogger mit dem listing der top Blogs. Ein bisschen "Deutschland sucht den Superblog" ?
Ganz schön clever.
* update : auch in Los Angeles machen sich Deutsche nicht immer beliebt. Staatsanwaltschaft wirft der Deutschen (!!) Bank unter anderem rüde Zwangsräumungen in der US-Metropole vor und spricht von Ausbeuterei
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,760724,00.html
DIe schlauen Praktiken werden in wenigen Jahren den Deutschen mehr als Antipathien bescheren, vor allen Dingen in Südeuropa. Vorsicht.
Ich weiss, ich weiss, solche Kommentare haben hier nichts zu suchen......
Vierprinzen
(E)
Es erscheint mir rechtlich unbedenklich, trotzdem nein danke.
Warum nein danke ?
Vor zwei Tagen kamen wir aus Kalifornien zurück. Carmel, Yosemite, Lake Tahoe. Jet lag. Madrid im April ist einzigartig. Heute meine gewohnte Radtour durch die Stadt. Menschenleer. Beim Radfahren liess ich mir die wikio-Geschichte noch mal durch den Kopf gehen.
Wikios Einnahmen stammen von der Zugriffserhöhung auf den websites ihrer Kunden. Ein gängiges Geschäft, das ich gut kenne.
Wikio verkauft Beiträge von sogenannten Experten. Stopp, stimmt nicht ganz. Wikio verkauft Zugriffe. "Experten" schreiben zu einem Thema und lassen hier und da Hinweise fallen die letztendlich dazu führen, dass bestimmte Kundenwebsites angeklickt werden. Monatlich werden die clicks abgerechnet. Dabei werden teilweise grosse Summen fakturiert. Spanische Banken lieben es, wenn Kunden sich für Darlehen interesserien. Also ein Artikel zu einer Hypothek und der Kunde landet zum Beispiel bei Banco San.....der usw. Kommt es zum Abschluss gibt es noch mehr Geld.
Auf der Einkaufsseite gilt es, Experten (ohne Anführungszeichen) billig einzukaufen. Wie wäre es mit einem Rechtsanwalt ? 15 € für einen Beitrag ? Der Chefeinkäufer bei wikio ist sehr clever. Wie erhöhe ich den kommerziellen Wert des beitragenden "Experten" oder Experten ? Wie erhöhe ich wikios Rendite ? Ich veröffentliche ein Listing der phänomenalsten weblogs. Archivalia auf Patz 3 der wissenschaftlichen Blogs. Sorry, das ist Unfug. Oder sollte man es Manipulation nennen ? Interessante Frage. Täuschung des Lesers über die Wertigkeit des Experten ? Er mag ja wirklich ein Experte sein, aber, prüft das jemand nach ? Nein. Geprüft werden Zugrifsszahlen. Also wikio schaut sich die Liste der meistgelesenen Beiträge in archivalia an und sagt sich: Oh, Herr vom Hofe und Herr Dr. Graf wurden zigtausendmal angeklickt. Interessant für uns. Worüber schreiben die eigentlich ? Sch---egal.
15 euro für einen Expertenbeitrag ? Das sind die cleveren Deutschen die es schaffen, dass Experten einen Bogen um Deutschland machen.
FAZ zur Frage warum die Inmigration nach Deutschland ausbleibt
http://goo.gl/jmC1C
Dann kommt ja noch das Wetter hinzu und das fehlende Licht von November bis Mai. Und die wikio Schlaumeier freuen sich über das brummende Geschäft mit den Zugriffszahlen. Der Inhalt von archivalia ist ihnen wurscht. Sie wollen Zugriffszahlen. That´s all. Also aus meiner Sicht, Finger weg von wikio und das Listing kann ich getrost vergessen. Und solche Praktiken machen die Deutschen unbeliebt, nicht die Deutschen auf Mallorca, oder der euro in Spanien, der es den Spaniern so schwer macht über die Runden zu kommen, oder die von deutschen Banken mit angefachte Immobilienblase usw. Das ist ein anderes Thema*.
Für diesen Beitrag berechne ich nichts.
Wer diesen Beitrag bei wikio anklickt landet bei La......ter.
Lan......ter zahlt sicherlich mehr als 15 euro.
http://www.wikio.de/ausland/europa/spanien/madrid
Ich gehe einen Schritt weiter:
wikio klaut den Inhalt von archivalia um mittels archivalia Zugriffe auf eine Kosmetikfirmenwebsite zu forcieren und dafür zu kassieren.
Gebauchpinselt werden die blogger mit dem listing der top Blogs. Ein bisschen "Deutschland sucht den Superblog" ?
Ganz schön clever.
* update : auch in Los Angeles machen sich Deutsche nicht immer beliebt. Staatsanwaltschaft wirft der Deutschen (!!) Bank unter anderem rüde Zwangsräumungen in der US-Metropole vor und spricht von Ausbeuterei
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,760724,00.html
DIe schlauen Praktiken werden in wenigen Jahren den Deutschen mehr als Antipathien bescheren, vor allen Dingen in Südeuropa. Vorsicht.
Ich weiss, ich weiss, solche Kommentare haben hier nichts zu suchen......
Vierprinzen
(E)
Digitalisierung und Erschließung einer hebraica-Sammlung. Via URN kommt man auf Münchner Digitalisate, während der Server der FH Köln zu langsam ist und der Viewer fehleranfällig.
http://hebraica.fh-koeln.de:8180/hebraica-server-war/viewbooks
(W)
http://hebraica.fh-koeln.de:8180/hebraica-server-war/viewbooks
(W)
KlausGraf - am Freitag, 22. April 2011, 01:47 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bis auf die letzten beiden Ausgaben Open Access einsehbar:
http://rbm.acrl.org/content/by/year
Allerdings ist auch die Frühjahrsausgabe von 2010 bereits einsehbar, nur die Artikel des letzten Hefts sind noch für die Allgemeinheit gesperrt.
(ML)
http://rbm.acrl.org/content/by/year
Allerdings ist auch die Frühjahrsausgabe von 2010 bereits einsehbar, nur die Artikel des letzten Hefts sind noch für die Allgemeinheit gesperrt.
(ML)
KlausGraf - am Freitag, 22. April 2011, 00:24 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen