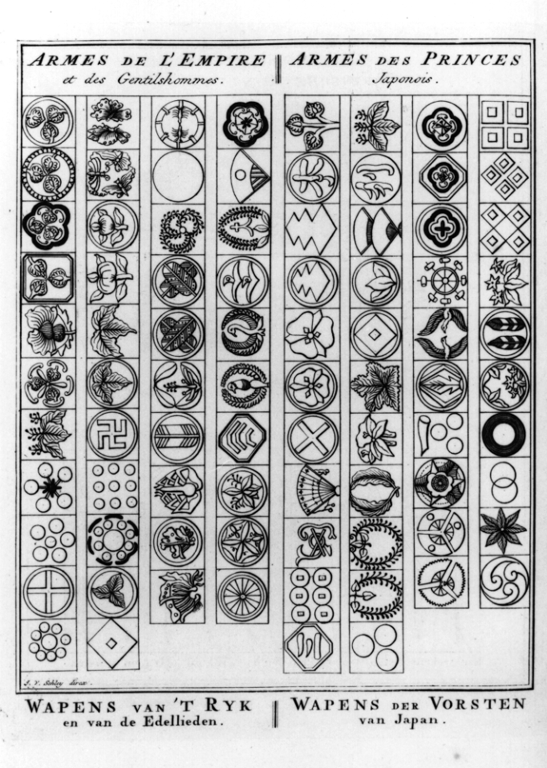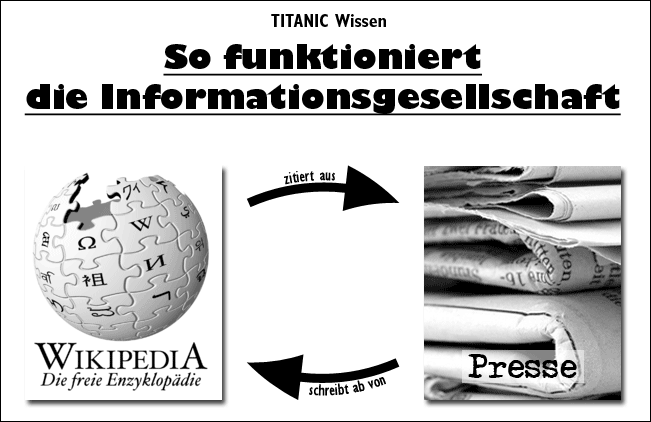http://retro.seals.ch/digbib/vollist?UID=szg-006
Via
http://weblog.histnet.ch/archives/2115
(Ebenso Geschichte und Informatik sowie Geographische Zeitschriften, die älteren Vorgängerzeitschriften sind offenbar erst in Vorbereitung:
http://retro.seals.ch/digbib/collectionsHome4 )
E guets wihnachtsgschänk!
Lesetipp:
http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=szg-006:1984:34::553
Via
http://weblog.histnet.ch/archives/2115
(Ebenso Geschichte und Informatik sowie Geographische Zeitschriften, die älteren Vorgängerzeitschriften sind offenbar erst in Vorbereitung:
http://retro.seals.ch/digbib/collectionsHome4 )
E guets wihnachtsgschänk!
Lesetipp:
http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=szg-006:1984:34::553
KlausGraf - am Freitag, 19. Dezember 2008, 23:55 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.dilibri.de/ubtr/content/titleinfo/31050
Ein Grundlagenwerk der Trierer Geschichte (1670).

Ein Grundlagenwerk der Trierer Geschichte (1670).
KlausGraf - am Freitag, 19. Dezember 2008, 23:44
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Kramer wirft dem Militärhistoriker R.-D. müller "Geschichtsfälschung im Dienst der Politik" vor. Ein von Müller als Beispiel herangezogenes Urteil gegen den General Edgar Feuchtinger lässt sich nicht auffinden:
" ..... Wie in einem Kriminalfall kam die Wahrheit erst nach und nach ans Licht: Von mir um eine Kopie des Urteils oder wenigstens um die Angabe eines Aktenzeichens oder einer Archiv-Signatur gebeten, verwies Müller mich wortkarg an das Militärarchiv in Freiburg. Rechnete er vielleicht damit, daß der so abgespeiste Anfrager resignieren würde? Ich ließ im Militärarchiv recherchieren und erhielt die Auskunft, ein solches Urteil sei dort nicht bekannt. Also wiederholte ich meine Bitte an Müller, nun etwas nachdrücklicher. Aus der von ihm jetzt endlich genannten Quelle, nämlich einer Stellungnahme eines ehemaligen Richters am Reichskriegsgericht, Dr. Block, ergibt sich, daß Feuchtinger wegen Wehrkraftzersetzung, also nicht wegen Kriegsverrat, verurteilt worden ist. Das hätte Müller übrigens schon dem nicht nur Militärhistorikern wohlbekannten Buch von Otto Peter Schweling: »Die deutsche Militärjustiz in der Zeit des Nationalsozialismus« (herausgegeben von Erich Schwinge) entnehmen können. Übrigens ist Feuchtinger bereits aufgrund des Unrechtsbeseitigungsgesetzes von 1998 rehabilitiert worden, im Unterschied zu den vielen Soldaten, die das Reichskriegsgericht in absoluter Willkürrechtsprechung als Kriegsverräter verurteilt hat. ...."
Quelle: Ossietzky 23/2008 (Link)
" ..... Wie in einem Kriminalfall kam die Wahrheit erst nach und nach ans Licht: Von mir um eine Kopie des Urteils oder wenigstens um die Angabe eines Aktenzeichens oder einer Archiv-Signatur gebeten, verwies Müller mich wortkarg an das Militärarchiv in Freiburg. Rechnete er vielleicht damit, daß der so abgespeiste Anfrager resignieren würde? Ich ließ im Militärarchiv recherchieren und erhielt die Auskunft, ein solches Urteil sei dort nicht bekannt. Also wiederholte ich meine Bitte an Müller, nun etwas nachdrücklicher. Aus der von ihm jetzt endlich genannten Quelle, nämlich einer Stellungnahme eines ehemaligen Richters am Reichskriegsgericht, Dr. Block, ergibt sich, daß Feuchtinger wegen Wehrkraftzersetzung, also nicht wegen Kriegsverrat, verurteilt worden ist. Das hätte Müller übrigens schon dem nicht nur Militärhistorikern wohlbekannten Buch von Otto Peter Schweling: »Die deutsche Militärjustiz in der Zeit des Nationalsozialismus« (herausgegeben von Erich Schwinge) entnehmen können. Übrigens ist Feuchtinger bereits aufgrund des Unrechtsbeseitigungsgesetzes von 1998 rehabilitiert worden, im Unterschied zu den vielen Soldaten, die das Reichskriegsgericht in absoluter Willkürrechtsprechung als Kriegsverräter verurteilt hat. ...."
Quelle: Ossietzky 23/2008 (Link)
Wolf Thomas - am Freitag, 19. Dezember 2008, 20:20 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"[V]om Standesamt befürchtet, von mir erhofft" so umschreibt Tim Begler, Stadtarchiv Lüdenscheid, die Gefühlslage in den NRW-Kommunen
Quelle: Link
Quelle: Link
Wolf Thomas - am Freitag, 19. Dezember 2008, 20:19 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
„Wenn der Leser die Techniken aus diesem Buch erst einmal versteht und anwendet, wird er in der Lage sein, über seinen so genannten Archivar jede bereits vergangene Lebenssituationen aufs Neue zu durchleben”
Wolfgang Rademacher.
Zwei Fragen bleiben:
1) Ist es wirklich wünschenswert sich an jede Lebenssituation zu erinnern ?
2) Archivare erinnern wohl kaum an wirklich jede Situation ?
Quelle:
http://www.firmenpresse.de/pressinfo68530.html
Wolfgang Rademacher.
Zwei Fragen bleiben:
1) Ist es wirklich wünschenswert sich an jede Lebenssituation zu erinnern ?
2) Archivare erinnern wohl kaum an wirklich jede Situation ?
Quelle:
http://www.firmenpresse.de/pressinfo68530.html
Wolf Thomas - am Freitag, 19. Dezember 2008, 20:18 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
«Es gibt zwei gute Fälle für ein Archiv. Entweder es wird zu uns nach Aachen ausgelagert, um es wenigstens vor dem Verfall zu bewahren. Oder, wie hier geschehen, Pfarrer und Kirchenvorstand werden initiativ, gewinnen fachkundige Ehrenamtler und schaffen entsprechende Lagermöglichkeiten»Professor Dieter Wynands, Leiter des Aachener Diözesanarchivs, in der Aachener Zeitung (Link)
Wolf Thomas - am Freitag, 19. Dezember 2008, 20:16 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Schon deprimierend, dass an unserer Umfrage (für registrierte Nutzer) ganze 4 Leute teilgenommen haben:
http://archiv.twoday.net/polls/7273/results
http://archiv.twoday.net/polls/7273/results
KlausGraf - am Freitag, 19. Dezember 2008, 19:47 - Rubrik: Allgemeines
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nach Ausweis der Referrers kamen in den letzten 24 Stunden mindestens 57 Leute hierher, die einfach nur nach YouTube auf österreichischen Websites suchten. Da ist derzeit Archivalia nämlich Treffer #1:
http://www.google.at/search?hl=de&q=youtube&btnG=Google-Suche&meta=cr%3DcountryAT
Twoday.net ist ein österreichischer Webloghoster.
http://www.google.at/search?hl=de&q=youtube&btnG=Google-Suche&meta=cr%3DcountryAT
Twoday.net ist ein österreichischer Webloghoster.
KlausGraf - am Freitag, 19. Dezember 2008, 19:43 - Rubrik: Allgemeines
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 19. Dezember 2008, 19:18 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 19. Dezember 2008, 11:10
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
1495: Württemberg wird Herzogtum. Dokumente aus dem Hauptstaatsarchiv Stuttgart zu einem epochalen Ereignis, bearb. von Stephan Molitor, Stuttgart 1995
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6152/
Die anerkennende Besprechung von Holger Kruse (auf Französisch) in der Francia 23/1, 1996 ist ebenfalls im Internet greifbar.
Mein Beitrag widmete sich dem Erhebungsakt auf dem Wormser Reichstag 1495, seiner Vorgeschichte und dem Verhältnis von Württemberg und Schwaben (Zusammenfassung). Petra Schön behandelte den Wappenwechsel, Stephan Molitor hat den Band redigiert und wichtige Dokumente ediert: außer dem Herzogsbrief unter anderem das Testament des Herrschers und die erste württembergische Landesordnung.

Mein Dank gilt dem Hauptstaatsarchiv Stuttgart für die Genehmigung der Online-Veröffentlichung, Stephan Molitor und Petra Schön für die Erlaubnis, ihre Beiträge aufzunehmen, sowie der Universitätsbibliothek Freiburg, die freundlicherweise die qualitätvolle Digitalisierung leistete.

Jörg Rugens (= Georg Rüxners) Aufzeichnung zum Quaternionensystem (wohl 1495) ist bei Molitor ediert, aber auch in Wikisource transkribiert:
http://de.wikisource.org/wiki/Aufzeichnung_%FCber_die_Gliederung_des_Reichs_%28Rugen%29
KlausGraf - am Freitag, 19. Dezember 2008, 02:38 - Rubrik: Landesgeschichte
" ... Als Ament [Jeff Ament, der Bassist von Pearl Jam] auf der Suche nach Material für die Special Editions sein Band-Archiv durchstöberte, stieß er auf eine alte Cassette. “Momma-Son” stand auf dem Tape – es handelte sich also tatsächlich um das sagenumwobene erste Demo von Pearl Jam! Ament hatte damals mit den Gitarristen Stone Gossard und Mike McCready die instrumentalen Spuren eingespielt und sich damit auf die Suche nach einem geeigneten Sänger für die neu formierte Band gemacht. Jeff Irons, ein gemeinsamer Freund, der damals bei den Red Hot Chili Peppers an den Drums saß, schlug vor, es an einen gewissen Eddie Vedder zu schicken. Einen Sänger, den damals kaum jemand kannte und der seine Zeit beim Surfen in San Diego verbrachte. .....
“Es ist ein paar Wochen her, als Ed oder ich eine dieser alten Kisten öffneten. Ich wusste, dass “Momma-Son” irgendwo rumliegen musste, hatte das Ding aber 17, 18 oder 19 Jahre nicht mehr gehört. Es war cool, sich das Tape mit Ed anzuhören und seine Reaktion zu beobachten. Und tatsächlich: die Songs klingen fast zu 90% exakt wie die späteren Album-Versionen. Viele Elemente waren identisch. 1991 war offenbar eine Menge Energie unterwegs. Genug, um die Strecke von Seattle bis San Diego zu überwinden. Und das sind immerhin knapp 1300 Meilen...”
Quelle: Link
“Es ist ein paar Wochen her, als Ed oder ich eine dieser alten Kisten öffneten. Ich wusste, dass “Momma-Son” irgendwo rumliegen musste, hatte das Ding aber 17, 18 oder 19 Jahre nicht mehr gehört. Es war cool, sich das Tape mit Ed anzuhören und seine Reaktion zu beobachten. Und tatsächlich: die Songs klingen fast zu 90% exakt wie die späteren Album-Versionen. Viele Elemente waren identisch. 1991 war offenbar eine Menge Energie unterwegs. Genug, um die Strecke von Seattle bis San Diego zu überwinden. Und das sind immerhin knapp 1300 Meilen...”
Quelle: Link
Wolf Thomas - am Donnerstag, 18. Dezember 2008, 20:01 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" 20 Jahre war Franz Schmitzhofer SPÖ-Bürgermeister in Bruckneudorf, bei der Wahl 2007 hat er nicht mehr kandidiert, im kommenden März feiert er seinen 60. Geburtstag. Jetzt holt ihn seine kommunalpolitische Vergangenheit ein. Die Volksanwaltschaft ist nach einem von FPÖ-Gemeinderat Gerhard Kovasits angestrengten Prüfverfahren zum Schluss gekommen, dass der frühere Ortschef von 1997 bis 2001 aus seiner Tätigkeit einen "Übergenuss" erhalten habe. Nun muss er den Betrag zurückzahlen. "Netto sind es rund 18.000 Euro", sagt Schmitzhofer ....
Um den offenen Betrag abzustottern, möchte Schmitzhofer in der Gemeinde stundenweise unentgeltlich als Archivar arbeiten. Gute vier Jahre müsste er dafür werken, schätzt er. .....Er wolle Schmitzhofer auch nicht schaden, es könne aber nicht sein, dass jetzt eigens ein Posten geschaffen werde, damit der Ex-Ortschef die "Schulden" bezahlen könne. ...."
Quelle:
http://www.kurier.at/nachrichten/burgenland/281048.php
Um den offenen Betrag abzustottern, möchte Schmitzhofer in der Gemeinde stundenweise unentgeltlich als Archivar arbeiten. Gute vier Jahre müsste er dafür werken, schätzt er. .....Er wolle Schmitzhofer auch nicht schaden, es könne aber nicht sein, dass jetzt eigens ein Posten geschaffen werde, damit der Ex-Ortschef die "Schulden" bezahlen könne. ...."
Quelle:
http://www.kurier.at/nachrichten/burgenland/281048.php
Wolf Thomas - am Donnerstag, 18. Dezember 2008, 19:59 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... In der Bardowicker Feldstraße 15 ruhen auf 200 Quadratmetern nach Angaben des Vereins allein 500 Bücher und Bildbände, alle Ausgaben von "Stern" und "Spiegel" der 1960er- bis 1980er-Jahre sowie unzählige Mineralien, Fossilien und andere Ausstellungsstücke. .... Man habe eine "ideale Zusammenführung von Museum, Archiv und Bibliothek geschaffen" ..... "Nachdem am Aufbau des Archivs seit neun Jahren gearbeitet wurde, wäre ein Zerschlagen des Gesamtensembles bedauerlich und ein Übergang des Hauses an ungewollte Eigentümer verheerend" .... "Sollte bis zum 20. Januar 2009 kein tragfähiges Konzept zur Erhaltung des Standortes vorliegen, müssen die Exponate, Bücher und Videos verkauft und das Archiv erforderlichenfalls vernichtet werden, falls ein Hauskäufer sie nicht übernimmt."
Quelle:
http://www.abendblatt.de/daten/2008/12/18/993120.html
Quelle:
http://www.abendblatt.de/daten/2008/12/18/993120.html
Wolf Thomas - am Donnerstag, 18. Dezember 2008, 19:57 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Der Papst ermutigte abschließend das CTV dazu, vertrauensvoll der institutionellen Aufgabe entgegenzutreten, die darin bestehe, Archiv der aufgenommenen Bilder der letzten Jahre zu sein. Es handle sich dabei um eine wertvolle Ressource, dies nicht nur zur Produktion von Fernsehprogrammen, sondern für die Geschichte des Heiligen Stuhles und der Kirche. ...." (1)
" .... Das Archiv des vatikanischen Fernsehzentrums umfasst 10.000 Videokassetten mit etwa 4.000 Aufnahmestunden. ...." (2)
Quelle:
(1) http://www.zenit.org/article-16684?l=german
(2) http://www.kathnews.de/content/index.php/2008/12/18/25-jahre-vatikan-fernsehen/
" .... Das Archiv des vatikanischen Fernsehzentrums umfasst 10.000 Videokassetten mit etwa 4.000 Aufnahmestunden. ...." (2)
Quelle:
(1) http://www.zenit.org/article-16684?l=german
(2) http://www.kathnews.de/content/index.php/2008/12/18/25-jahre-vatikan-fernsehen/
Wolf Thomas - am Donnerstag, 18. Dezember 2008, 19:56 - Rubrik: Medienarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 18. Dezember 2008, 18:35 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 18. Dezember 2008, 18:16 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Online-Sammlungen dieses Museums (einschließlich der Fraktur-Collections) kamen bei der Auswahl der Adventskalender-Beiträge in die weitere Wahl.


KlausGraf - am Donnerstag, 18. Dezember 2008, 14:09 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 18. Dezember 2008, 01:46 - Rubrik: English Corner
KlausGraf - am Donnerstag, 18. Dezember 2008, 01:22 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus dem Gedichtband Die Harfenjule (Berlin 1927) von Klabund, entnehmen wir ein besinnliches Weihnachgedicht "Bürgerliches Weihnachtsidyll", das Kurt Tucholsky in der Weltbühne vom 12. Juli 1927 "sehr schön" nannte. Transkribiert ist es bei Wikisource:
http://tinyurl.com/56watd

Roger Stein hat es in seinem Buch über Dirnenlieder 2006 berücksichtigt. Eine kleine Sammlung gemeinfreier Dirnenlieder bietet Wikisource.
Klabund hieß eigentlich Alfred Henschke. Er wurde am 4. November 1890 in Crossen an der Oder geboren. Der Autor, der auch gern fürs Kabarett schrieb, starb an seiner Lungenkrankheit bereits mit 37 Jahren am 14. August 1928 in einem Davoser Sanatorium. Mehrere Werke von ihm stehen gescannt im Internet zur Verfügung:
http://de.wikisource.org/wiki/Klabund

KlausGraf - am Donnerstag, 18. Dezember 2008, 00:19 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Heute ist das unerschöpfliche Archiv von Gucci ihre [Frida Giannini, Chefdesignerin von Gucci] wahre Inspirationsquelle. ....."
Quelle:
http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/458572
Weitere "modische" Archivalia-Einträge:
http://archiv.twoday.net/stories/5366637/
http://archiv.twoday.net/stories/5238987/
http://archiv.twoday.net/stories/4969223/
http://archiv.twoday.net/stories/4889444/
http://archiv.twoday.net/stories/4795803/
http://archiv.twoday.net/stories/4370617/
Quelle:
http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/458572
Weitere "modische" Archivalia-Einträge:
http://archiv.twoday.net/stories/5366637/
http://archiv.twoday.net/stories/5238987/
http://archiv.twoday.net/stories/4969223/
http://archiv.twoday.net/stories/4889444/
http://archiv.twoday.net/stories/4795803/
http://archiv.twoday.net/stories/4370617/
Wolf Thomas - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 19:55 - Rubrik: Wirtschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Wir sind hier vorübergehend seit 1996 untergebracht"
Christian Brenk, Stadtarchiv Bernburg
Quelle: Mitteldeutsche Zeitung
Christian Brenk, Stadtarchiv Bernburg
Quelle: Mitteldeutsche Zeitung
Wolf Thomas - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 19:40 - Rubrik: Wahrnehmung
"Aida steht in diesem Fall für "Antifaschistische Informations-, Dokumentations- und Archivstelle". Der Verein dokumentiert und sammelt all das, was Rechtsextreme in München so tun und an Druckprodukten erzeugen. Seit 1990 tut Aida das, es haben sich unzählige Regalmeter angehäuft.....Man arbeitet im Stillen und liefert mit den Materialien den anderen Organisationen, die sich gegen Rechts engagieren, sozusagen das Basiswissen. .... Wo sich das Archiv befindet, erfährt auch erst mal niemand - der Verein gibt nur eine Postfachadresse an. .... Wer das Archiv besuchen will, muss sich also via E-Mail oder Brief anmelden. ...."
Quelle:
http://www.sueddeutsche.de/657387/010/2682657/Die-Braunen-im-Visier.html
s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/126758/
Quelle:
http://www.sueddeutsche.de/657387/010/2682657/Die-Braunen-im-Visier.html
s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/126758/
Wolf Thomas - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 19:39 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 19:25 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://manuscripts.cmrs.ucla.edu/index.php
Darf man eigentlich nicht erwarten, dass man die von mir
seit Jahren zusammengetragenen Links ueber "grosse" (>10)
Handschriftendigitalisierungsprojekte zur Kenntnis nimmt?
http://wiki.netbib.de/coma/DigitaleHandschriften
Einzelstücke:
http://delicious.com/Klausgraf/manuscripts
http://www.handschriftencensus.de/hssabbildungen
Absolut unzulängliche Metadaten:
Manuscript Attributes
Date s. xv 3/4
Provenance country Germany
Provenance city Nuremberg
Shelfmark Cgm 714
Language German
Fully Digitized Yes
Site link
Repository
Country Germany
City Munich
Location Bayerische Staatsbibliothek
Kein Wiki, keine Weiternutzung via OAI!
Ein verdammt aermliches Angebot, wie man es so nur in den
USA realisieren konnte.
Darf man eigentlich nicht erwarten, dass man die von mir
seit Jahren zusammengetragenen Links ueber "grosse" (>10)
Handschriftendigitalisierungsprojekte zur Kenntnis nimmt?
http://wiki.netbib.de/coma/DigitaleHandschriften
Einzelstücke:
http://delicious.com/Klausgraf/manuscripts
http://www.handschriftencensus.de/hssabbildungen
Absolut unzulängliche Metadaten:
Manuscript Attributes
Date s. xv 3/4
Provenance country Germany
Provenance city Nuremberg
Shelfmark Cgm 714
Language German
Fully Digitized Yes
Site link
Repository
Country Germany
City Munich
Location Bayerische Staatsbibliothek
Kein Wiki, keine Weiternutzung via OAI!
Ein verdammt aermliches Angebot, wie man es so nur in den
USA realisieren konnte.
KlausGraf - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 18:09 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 17:04 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://meta.wikimedia.org/wiki/Licensing_update/Questions_and_Answers
Leider fehlt noch die Frage, die für die Praxis am wichtigsten ist: Wie soll die künftige Attribution gemäß CC-BY-SA aussehen? Eric Moeller hat bereits in Foundation-L klargestellt, dass es nicht darauf hinauslaufen wird, als Quelle lediglich die Wikipedia anzugeben.
Bisher hat die Foundation es vermieden, sich darauf festzulegen, ob die Versionsgeschichte der Wikipedia die geforderte Section History der GNU FDL ist (siehe hier). In den neuen FAQ steht dazu aber bezeichnenderweise:
It is also worth pointing out that a literal interpretation of the attribution requirement of the GFDL requires complete duplication of the "history" section of the article with every derivative work (not just the author names -- the entire section). For an article with thousands of revisions, this is obviously highly onerous, but even with just a smaller number of revisions, it is a significant amount of text.
Damit ist das sogenannte Gentlemen Agreement (GA) auch für die englischsprachige Wikipedia geschwächt. Dieses wird in der deutschsprachigen Wikipedia zunehmend skeptisch betrachtet. Es besagt, dass es bei Online-Nutzungen der Wikipedia genügt, die GNU FDL lokal zu speichern, auf die Wikipedia als Quelle hinzuweisen und auf die Autorenliste zu verlinken.
Zum GA:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Lizenzbestimmungen&action=history
Leider fehlt noch die Frage, die für die Praxis am wichtigsten ist: Wie soll die künftige Attribution gemäß CC-BY-SA aussehen? Eric Moeller hat bereits in Foundation-L klargestellt, dass es nicht darauf hinauslaufen wird, als Quelle lediglich die Wikipedia anzugeben.
Bisher hat die Foundation es vermieden, sich darauf festzulegen, ob die Versionsgeschichte der Wikipedia die geforderte Section History der GNU FDL ist (siehe hier). In den neuen FAQ steht dazu aber bezeichnenderweise:
It is also worth pointing out that a literal interpretation of the attribution requirement of the GFDL requires complete duplication of the "history" section of the article with every derivative work (not just the author names -- the entire section). For an article with thousands of revisions, this is obviously highly onerous, but even with just a smaller number of revisions, it is a significant amount of text.
Damit ist das sogenannte Gentlemen Agreement (GA) auch für die englischsprachige Wikipedia geschwächt. Dieses wird in der deutschsprachigen Wikipedia zunehmend skeptisch betrachtet. Es besagt, dass es bei Online-Nutzungen der Wikipedia genügt, die GNU FDL lokal zu speichern, auf die Wikipedia als Quelle hinzuweisen und auf die Autorenliste zu verlinken.
Zum GA:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Lizenzbestimmungen&action=history
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Drei Bach-Handschriften aus den Jahren 1743, 1745 und 1748 förderte Andreas Glöckner vom Bach-Archiv Leipzig bei Recherchen zur Musikpflege an der Universitätskirche St. Pauli im Universitätsarchiv zu Tage. Dabei handele es sich, wie das Leipziger Bach-Archiv mitteilt, um Zeugnisse, die Johann Sebastian Bach für drei seiner Präfekten eigenhändig ausgestellt habe. Zudem wurde ein bislang unbekanntes Protokoll mit Informationen zu Bachs Todesjahr unter den Universitätsakten aufgefunden.
http://www.boersenblatt.net/296979/

http://www.boersenblatt.net/296979/

KlausGraf - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 16:14 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://go.footnote.com/wwii_documents/
Die Fotos entstammen der NARA und sind ebenso wie die Dokumente wohl überwiegend Public Domain in den USA, da von Bediensteten von Bundesbehörden (hier dem Militär) in Erfüllung ihrer Dienstpflichten geschaffen. Die re-use unterbindenden terms of use sind nach deutschem Recht nicht wirksam als AGB einbezogen; außerdem kann man anonym auf Wikimedia Commons Public-Domain-Bilder unabhängig von einer eventuell nach US-Recht bestehenden vertraglichen Bindung hochladen. Es ist ein starkes Stück, dass NARA die vertragliche "Einmauerung" der Public Domain zulässt.

Die Fotos entstammen der NARA und sind ebenso wie die Dokumente wohl überwiegend Public Domain in den USA, da von Bediensteten von Bundesbehörden (hier dem Militär) in Erfüllung ihrer Dienstpflichten geschaffen. Die re-use unterbindenden terms of use sind nach deutschem Recht nicht wirksam als AGB einbezogen; außerdem kann man anonym auf Wikimedia Commons Public-Domain-Bilder unabhängig von einer eventuell nach US-Recht bestehenden vertraglichen Bindung hochladen. Es ist ein starkes Stück, dass NARA die vertragliche "Einmauerung" der Public Domain zulässt.

KlausGraf - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 15:56 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Vorschläge werden erbeten unter
http://www.wissenschafts-cafe.net/2008/12/auslese-2008-suche-nach-den-besten-wissenschaftlichen-blogartikeln-des-jahres/
http://www.wissenschafts-cafe.net/2008/12/auslese-2008-suche-nach-den-besten-wissenschaftlichen-blogartikeln-des-jahres/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Google hat wohl eines der besten Bildarchive der Gegenwart und nahen Vergangenheit digitalisiert. Millionen von Bildern des LIFE-Magazines wurden eingescannt und online gestellt. Wirklich klasse! So sind uns Bilder von den 1750ern bis heute für uns kostenlos parat und dazu sogar in meist hoher Auflösung. Wer nicht über die Sammelseite gehen will, kann auch einfach bei der normalen Google-Bildersuche den Tag "source:life" hinten anstellen, um im besagten Archiv zu suchen. Bei gefundenen Bildern wird zudem immer Fotograf, Ort, Jahreszahl und eine kurze Beschreibung genannt.
Danke. Denn so werden Perlen gefunden, wie dieser Computerwissenschaftler von 1970.
Admin: Danke für den Beitrag! Zum Hintergrund:
http://www.der-hollemann.de/experimentierlich/blogwichteln-08/
Danke. Denn so werden Perlen gefunden, wie dieser Computerwissenschaftler von 1970.
Admin: Danke für den Beitrag! Zum Hintergrund:
http://www.der-hollemann.de/experimentierlich/blogwichteln-08/
KlausGraf - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 14:52 - Rubrik: Fotoueberlieferung
Weitere Kritik aus der Sicht der Bibliotheken:
http://www.libraryjournal.com/article/CA6618842.html?industryid=47109
http://www.libraryjournal.com/article/CA6618842.html?industryid=47109
KlausGraf - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 04:51 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der zur Herder Gruppe gehörende Josef Knecht-Verlag bietet seine Romane ab sofort als E-Book an. Wie der Verlag weiter mitteilt, können alle 17 lieferbaren Kirchenkrimis und historischen Romane gratis unter www.herdershop24.de oder www.knecht-verlag.de heruntergeladen werden.
Damit ist Knecht nach eigenen Angaben der erste Verlag in Deutschland, der sich zu diesem Schritt entschieden hat. Die Aktion sei nicht befristet, heißt es auf Nachfrage. Man wolle den Gratis-Download auch nutzen, um mehr Aufmerksamkeit für die Titel dieses Programmsegments zu erzeugen und neue Leserschichten anzusprechen.
Geschäftsführer Lukas Trabert begründet die Entscheidung so: „Wir wollen neue Leser erreichen. E-Books bieten eine einzigartige Chance, Bücher dem breiten Publikum vorzustellen.“ Eine Kannibalisierung des gedruckten Buches befürchtet er nicht: „E-Book-Lesegeräte, die ein komfortables Lesen von E-Books ermöglichen, sind noch nicht verbreitet. Kunden, die unsere Kirchenkrimis oder historische Romane lesen wollen, werden zum allergrößten Teil doch lieber ein gedrucktes Buch kaufen“.
http://www.boersenblatt.net/296955/
Das stimmt ganz zu den von mir gesammelten empirischen Befunden vornehmlich aus den USA, die in die gleiche Richtung gehen:
http://delicious.com/Klausgraf/monograph_open_access
Der Kampf gegen Gratis-Inhalte ist somit eher ideologisch als ökonomisch begründet.
Für die Erscheinungsjahre zwischen 2000 und 2008 findet die folgende Suche
http://books.google.com/books?lr=lang_de&q=date:2000-2008&num=100&as_brr=1&as_pt=ALLTYPES&hl=de&sa=N&start=100
166 deutschsprachige Bücher, die komplett in Google Books einsehbar sind.
Die Bücher des Knecht-Verlags, historische Kirchenkrimis (naja), können nach Registrierung (wie wenn man ein kostenpflichtiges Buch bestellen würde) heruntergeladen werden, es kommt sofort per Mail ein Download-Link für das PDF. Die Blättermöglichkeit (hier: zu Zähringerblut) umfasst nur 10 Seiten:
http://www.herdershop24.de/out/1/html/0/dyn_images/blaetter_pdfs/978-3-7820-3010-6/blaetterkatalog/index.html
Damit ist Knecht nach eigenen Angaben der erste Verlag in Deutschland, der sich zu diesem Schritt entschieden hat. Die Aktion sei nicht befristet, heißt es auf Nachfrage. Man wolle den Gratis-Download auch nutzen, um mehr Aufmerksamkeit für die Titel dieses Programmsegments zu erzeugen und neue Leserschichten anzusprechen.
Geschäftsführer Lukas Trabert begründet die Entscheidung so: „Wir wollen neue Leser erreichen. E-Books bieten eine einzigartige Chance, Bücher dem breiten Publikum vorzustellen.“ Eine Kannibalisierung des gedruckten Buches befürchtet er nicht: „E-Book-Lesegeräte, die ein komfortables Lesen von E-Books ermöglichen, sind noch nicht verbreitet. Kunden, die unsere Kirchenkrimis oder historische Romane lesen wollen, werden zum allergrößten Teil doch lieber ein gedrucktes Buch kaufen“.
http://www.boersenblatt.net/296955/
Das stimmt ganz zu den von mir gesammelten empirischen Befunden vornehmlich aus den USA, die in die gleiche Richtung gehen:
http://delicious.com/Klausgraf/monograph_open_access
Der Kampf gegen Gratis-Inhalte ist somit eher ideologisch als ökonomisch begründet.
Für die Erscheinungsjahre zwischen 2000 und 2008 findet die folgende Suche
http://books.google.com/books?lr=lang_de&q=date:2000-2008&num=100&as_brr=1&as_pt=ALLTYPES&hl=de&sa=N&start=100
166 deutschsprachige Bücher, die komplett in Google Books einsehbar sind.
Die Bücher des Knecht-Verlags, historische Kirchenkrimis (naja), können nach Registrierung (wie wenn man ein kostenpflichtiges Buch bestellen würde) heruntergeladen werden, es kommt sofort per Mail ein Download-Link für das PDF. Die Blättermöglichkeit (hier: zu Zähringerblut) umfasst nur 10 Seiten:
http://www.herdershop24.de/out/1/html/0/dyn_images/blaetter_pdfs/978-3-7820-3010-6/blaetterkatalog/index.html
KlausGraf - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 04:03 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Auf Altverträge, die vor Inkrafttreten des Urheberrechtsgesetzes abgeschlossen wurden, ist der inzwischen gestrichene § 31 Abs. 4 UrhG über unbekannte Nutzungsarten und damit auch die Übergangsregelung § 137 l UrhG nicht anwendbar.
Wandtke/Bullinger, Urheberrecht 3. Aufl. 2009 (bereits online) verweisen zu § 137 l in Rn. 5 darauf, dass auf die Altverträge die Zweckübertragungsregel anwendbar ist, derzufolge die Rechteeinräumung von vor dem 1.1.1966 unbekannten Nutzungsarten im Zweifel nicht umfasst war. Belegt wird dies mit BGH GRUR 1988, 296, 299 GEMA-Vermutung IV, wo es heißt:
"Schließlich wird das BerG in diesem Fall zu beachten haben, daß die Bestimmung des § 31 Abs. 4 UrhG auf Berechtigungsverträge, die vor dem Inkrafttreten des Urheberrechtsgesetzes am 1.1.1966 abgeschlossen worden sind, keine Anwendung findet (vgl. § 132 UrhG; BGH in GRUR 1986, 62 , 66 GEMA-Vermutung I 1, insoweit nicht in BGHZ 95, 274); bei solchen Altverträgen ist gegebenenfalls zu prüfen, ob der Verwertungsgesellschaft die Rechte der - damals noch nicht bekannten - Videozweitauswertung wirksam eingeräumt worden sind; dabei wäre zu berücksichtigen, daß auch nach früherem Recht der Zweckübertragungsgedanke (jetzt § 31 Abs. 5 UrhG) der Einräumung von Rechten an einer noch nicht bekannten Nutzungsart an sich regelmäßig entgegenstand (vgl. RGZ 118, 282, 285 ff. - Musikantenmädel; 123, 312, 317 - Wilhelm Busch 3; BGHZ 11, 135, 143 f. - Schallplatten-Lautsprecherübertragung 4; von Gamm, UrhG, § 31 Rdn. 15), daß aber in diesem Zusammenhang den Besonderheiten des Verhältnisses zwischen Urheber und Verwertungsgesellschaft - anders als bei der an sich zwingenden Regelung des § 31 Abs. 4 UrhG - Rechnung getragen werden kann (vgl. auch BGH in GRUR 1986, 62 , 66 GEMA-Vermutung I, insoweit nicht in BGHZ 95, 274). "
BGHZ 11, 135 = GRUR 1954, 216. Auszug:
"Das RG ist in ständiger Rechtsprechung von dem Ausnahmecharakter des § 22a LUG ausgegangen und hat hieraus gefolgert, daß diese Gesetzesvorschrift wie alle Ausnahmebestimmungen grundsätzlich eng auszulegen sei (RGZ 153, 1 ff. [23]; 140, 239; 128, 102 ff.). Dem schließt sich der Senat an. Eine enge Auslegung der durch § 22a geschaffenen Befugnislücke in der umfassenden Urheberbefugnis des § 11 LUG ist schon nach dem das ganze Urheberrecht beherrschenden Leitgedanken geboten, den Urheber tunlichst an dem wirtschaftlichen Nutzen zu beteiligen, der aus seinem Werk gezogen wird (RGZ 118, 285; 122, 68; 123, 312; 128, 113; 130, 206; 134, 201; 153, 22).
Auf diesem Grundsatz beruht auch die Rechtsprechung des RG, wonach selbst bei einer uneingeschränkten Übertragung des Urheberrechts die Ausnutzung neuer Verwertungsmöglichkeiten, die die Parteien nach dem Stand der Technik im Zeitpunkt der Übertragung nicht in Rechnung gestellt haben, dem Werkschöpfer vorbehalten bleiben (RGZ 118, 285 [Verfilmung]; RGZ 123, 312 [Rundfunksendung] ). Aus dem gleichen Rechtsgedanken hat das RG in seiner für die Schallplattenwiedergabe durch den Rundfunk grundlegenden Entscheidung vom 14. November 1936 (RGZ 153, 1 ff.) den Umfang der durch § 22a LUG gewährten Aufführungsfreiheit nach den Verwertungsmöglichkeiten von Schallvorrichtungen beurteilt, wie sie bei Erlaß der Novelle von 1910 gegeben oder doch nach dem damaligen Stand der Technik voraussehbar waren. Das RG führt hierzu u. a. aus: "In welchem Umfang die Ausnahme bezweckt wurde, läßt sich bloß nach den technischen Möglichkeiten beurteilen, welche bei Erlaß des Gesetzes von 1910 vorlagen. Diese bestanden damals nur in der regelmäßigen, einfachen, erstmaligen, auf dem Grammophon zum unmittelbaren Hören bestimmten Wiedergabe (Elster, Archiv für Urheberrecht 1932, 116 ff., GRUR 1935, 210). Eine beträchtlich weitergehende Wiedergabeart und eine Erstreckung des Ausnahmebereichs auf sie lagen nicht in Zweck und Absicht des Gesetzes." Von dieser grundsätzlichen Auffassung aus hat sich das RG die Frage gestellt, ob die Rundfunksendung "in ihren tatsächlichen Wirkungen den Verhältnissen gleichzusetzen sei, die das Gesetz bei Schaffung des § 22a vor Augen hatte und die daher nach dem Zweck der Vorschrift eine Beschränkung der urheberrechtlichen Befugnis rechtfertigen können". Das RG hat diese Frage für die rundfunkmäßige Sendung von Schallplatten verneint und die Zustimmung sowohl des Komponisten sowie des Inhabers des Schutzrechtes an der Schallplatte (§ 2 Abs. 2) für diese neue Verwertungsart des Urheberrechtsgutes als erforderlich erachtet.
Soweit das RG dieses Ergebnis unter Anknüpfung an seinen in früheren Entscheidungen für die Rundfunksendung entwickelten erweiterten Verbreitungsbegriff (RGZ 113, 413; 123, 312; 136, 381) auch darauf stützt, daß die Wiedergabe eines Werkes durch den Rundfunk in den außerhalb des Kreises der "öffentlichen Aufführung" liegenden Teilbereich der "Verbreitung" falle, der durch § 22a nicht freigegeben sei, vermag der Senat dieser Begründung nicht zu folgen. Der Senat geht vielmehr davon aus, daß der Verbreitungsbegriff sich nur auf die Verbreitung körperlicher Werkexemplare beschränkt und auf die unkörperliche Wiedergabe des Werkes nicht zu erstrecken ist. Der Senat folgt dagegen der weiteren, die Entscheidung tragenden Begründung des RG, wonach dem Begriff der "öffentlichen Aufführung" in der Ausnahmevorschrift des § 22a nur die enge Bedeutung zukommt, die der Gesetzgeber im Jahre 1910 nach dem damaligen Entwicklungsstand der Technik im Auge haben konnte. Die Entscheidung des Rechtsstreits hängt hiernach davon ab, ob die Lautsprecherwiedergabe von Schallplatten mittels moderner Plattenspielapparate in ihren Wirkungen den bei Schaffung des § 22a bekannten Wiedergabemöglichkeiten mechanischer Musik gleichzusetzen ist...
Im Jahre 1910 geschah die Tonaufnahme der Schallplatte in der Weise, daß durch eine mit einer Membran festverbundene Nadel die mechanischen Bewegungen fortlaufend aufgezeichnet wurden, die die Nadel unter dem Impuls der Schallschwingungen ausführte. Die Wiedergabe stellte eine Umkehr dieses mechanischen Aufnahmevorganges dar. Durch die Drehung der Platte wurde eine in ihrer Tonspur entlanggeführte Nadel zu der Wiederholung der mechanischen Schwingungen gezwungen, die zur Bildung der Tonspur geführt hatten. Diese Schwingungen wurden - durch Hebelwirkung vergrößert - auf eine Membran übertragen, die den mechanisch-akustischen Wandler darstellte. Die akustischen Schwingungen wurden durch einen Schalltrichter verstärkt und damit für das menschliche Ohr hörbar gemacht. Die Umformung der auf der Schallplatte festgelegten Töne erfolgte somit durch ein ausschließlich mechanisch-akustisches Verfahren, wobei die Wirksamkeit der in sich geschlossenen Apparatur von den beschränkten mechanischen Möglichkeiten abhängig war. Die auf diese Weise erzeugten Schallwellen waren nur sehr begrenzt weiterleitungsf.ähig und nur einer beschränkten Verstärkung zugänglich. Der Tonqualität waren dadurch, daß größere Massen in Schwingungen versetzt werden mußten, enge Grenzen gesetzt. Um die notwendige Lautstärke zu erreichen, mußte der Nadeldruck verhältnismäßig stark sein, was die Lebensdauer der Platte sowie die Klangreinheit der Wiedergabe herabsetzte.
Die Wiedergabe einer Schallplatte durch einen modernen Plattenspieler mit elektro-akustischem Lautsprecher beruht auf einem völlig anderen Prinzip. Bei diesem Verfahren wird als Wandler ein sog. Tonabnehmer benutzt, der die mechanischen Schwingungen nicht in akustische, sondern in elektrische Schwingungen umwandelt. Diese elektrischen Schwingungen werden sodann durch den Lautsprecher in Schallwellen umgeformt. Der Hörer vernimmt somit Schallwellen, die erst durch eine Verwandlung elektrischer Wellen entstehen, die wiederum auf eine Umformung der zunächst erzeugten mechanischen Schwingungen der Nadel zurückgehen. Diese der Rundfunktechnik entnommene Wiedergabeart mit der ihr eigentümlichen beliebig steigerungsfähigen Verstärkung kleinster elektrischer Impulse ermöglicht es, die mechanischen Bewegung der Nadel auf ein Minimum zu beschränken, was eine erhebliche Klangverbesserung gegenüber dem mechanisch-akustischen Verfahren zur Folge hat. Bei diesem Verfahren können weiterhin die mechanisch schwingenden Massen sehr gering gehalten werden, was sich gleichfalls auf die Tonqualität günstig auswirkt und zugleich die Haltbarkeit der Schallplatte wesentlich erhöht. Gewonnen aber wurde vor allem durch das elektro-akustische Verfahren eine beliebig steigerungsfähige Klangstärke und Reichweite der Schallplattenaufführung. Die in dem Tonabnehmer in elektrische Wellen kleinster Energie verwandelten Schallschwingungen können über beliebig große Verstärker oder ganze Verstärkeranlagen einer unbegrenzten Zahl von Lautsprechern zugeführt werden. Da die elektrischen Wellen auch bei längeren Zuleitungswegen keine Abschwächung erfahren, können diese auch in größerer Entfernung von der übrigen Wiedergabeapparatur aufgestellt werden, ohne daß die Klangstärke beeinträchtigt würde.
Aus dem elektro-akustischen Übertragungsweg kann nun zwar nicht gefolgert werden, das Abspielen von Schallplatten mittels moderner Plattenspieler erfülle nicht den Tatbestand einer "mechanischen Wiedergabe für das Gehör" im Sinn von § 12 Abs. 2 Ziff. 5 LUG. Denn unter diesen Begriff fallen alle nur für das Gehör bestimmten Werkwiedergaben, die nicht unmittelbar durch die Leistung eines ausübenden Künstlers bewirkt werden, sondern mit Hilfe von Vorrichtungen erfolgen, auf die das Werk festgelegt ist, mag auch deren Hörbarmachung nicht ausschließlich auf rein mechanischen Gesetzen beruhen (RGZ 153, 1 [10] ).
Entscheidend ist vielmehr allein, ob die öffentliche Wiedergabe von Schallplatten auf dem elektro-akustischen Ü bertragungsweg den urheberrechtlichen Tatbestand der öffentlichen Aufführung im Sinn der Ausnahmebestimmung des § 22a LUG erfüllt. Dies ist zu verneinen. Diese Wiedergabeart, deren Prinzip heute auch weitgehend bei der Ton aufnahme verwendet wird, war dem Gesetzgeber im Jahre 1910 völlig unbekannt und in seiner umwälzenden Bedeutung für [S. 220] die mechanische Musik nicht voraussehbar. Diese neuartige Wiedergabetechnik ermöglicht ihrer Natur nach eine ganz andersartige und weitergehende wirtschaftliche Ausbeutung von Schallvorrichtungen, als sie der Gesetzgeber bei Festlegung der Aufführungsfreiheit im § 22a in Betracht ziehen konnte. Theoretisch könnte die Reichweite der Lautsprecherwiedergabe die gleiche sein wie die einer Rundfunksendung. Der Unterschied besteht nur darin, daß die Hörbarmachung der Funksendung von einem Empfangsgerät abhängig ist, das keine Verbindung durch einen festen Leitungskörper mit dem Sendeapparat voraussetzt, während bei der Lautsprecherwiedergabe durch Plattenspieler auf diese Verbindung nicht verzichtet werden kann. Aber auch diese Wiedergabeart ist ihrem Wesen nach geeignet, in einer beliebigen Vielheit voneinander getrennter Räume eine nahezu unbegrenzte Hörerschaft zu erf.assen. Weiterhin fällt ins Gewicht, daß die Tonqualität bei dieser Wiedergabetechnik der einer unm1ttelbaren Aufführung durch ausübende Künstler fast gleichwertig ist. Die Lautsprecherwiedergabe ist deshalb, jedenfalls urheberrechtlich gesehen, nicht nur eine technische Verbesserung, sondern ähnlich wie die Rundfunksendung als ein völlig neues technisches Mittel, mechanische Musik darzubieten, zu werten, wobei vom urheberrechtlichen Blickpunkt weniger die Höhe der erfinderischen Leistung als die durch diese Wiedergabeart erschlossene neue gewerbliche Nutzungsmöglichkeit mechanischer Musik bedeutsam ist (im Ergebnis ebenso Möhring, GEMA-Festschrift 1953, S. 54; Kurtze, JR 1952, 343). Die Erwägung, die es dem Gesetzgeber um die Jahrhundertwende tragbar erscheinen ließ, den Urheberrechtsschutz nicht auf mechanische Musikinstrumente zu erstrecken, weil "das Spielen mechanischer Musikinstrumente immer nur ein notdürftiger Ersatz für wirkliche Musik bleiben werde und vornehmlich in Kreisen sich verbreiten werde, in welchen musikalische Reproduktionen schon bislang keinen Eingang gefunden haben", trifft auf die elektroakustische Wiedergabe mechanischer Musik jedenfalls nicht mehr zu. Die Qualität und Reichweite dieser Wiedergabeart hat dazu geführt, daß sie bei öffentlichen Veranstaltungen bereits weitgehend die Originalmusik verdrängt hat. Nicht nur bei öffentlichen Tanzvergnügungen und Sportdarbietungen, auch auf Ausstellungen, in Kurorten, Theatern und Lichtspielhäusern ist die Schallplattenübertragung mittels Lautsprecher vielfach an die Stelle unmittelbarer Musikdarbietungen getreten.
Es kann nicht in der Absicht der Novelle von 1910 gelegen haben, den Ausnahmebereich des § 22a auf diese gegenüber dem damaligen Stand der Technik völlig neuartige Wiedergabeart zu erstrecken, die den Musikveranstaltern weitergehende gewerbliche Auswertungsmöglichkeiten eröffnet als die damals bekannten mechanischen Musikdarbietungen. Weder erfordert es der Zweck des § 22a, durch eine den Abnehmern mechanischer Musikinstrumente eingeräumte urheberrechtliche Vorzugsstellung den Gewerbezweig der Hersteller dieser Instrumente zu begünstigen, noch erlaubt es der das gesamte Urheberrecht durchziehende Leitgedanke, den Urheber an den wirtschaftlichen Früchten seines Werkes angemessen zu beteiligen, öffentliche mechanische Musikveranstaltungen durch Lautsprecherwiedergabe der Ausnahmevorschrift des § 22a zu unterstellen und solche Veranstaltungen damit dem Schutzbereich des Urhebers zu entziehen. Bei der weittragenden Bedeutung, die der gewerblichen Auswertung mechanischer Musik infolge dieser neuen Wiedergabetechnik zukommt, würde es auf eine Aushöhlung und wirtschaftliche Entwertung des dem Urheber durch § 11 Abs. 2 LUG vorbehaltenen Aufführungrechts hinauslaufen, wenn diese Wiedergabeart in die durch § 22a gewährte Erlaubnisfreiheit einbezogen würde. Der Urheber verlöre ersatzlos die Aufführungsgebühren, die ihm bei einer öffentlichen Darbietung seines Werkes durch ausübende Künstler zufiießen würden. Wenn er auch für die Vergabe der mechanischen Vervielfältigungserlaubnis an den Erlösen aus der Schallplattenherstellung beteiligt wird. so kann hierin schon deshalb keine angemessene Entschädigung für die öffentliche Auswertung seines Werkes in der durch die Lautsprecherwiedergabe ermöglichten Art und Reichweite erblickt werden, weil der Absatz der Schallplatten sich durch diese neuen gewerblichen Verwertungsmöglichkeiten nicht in entsprechendem Maße steigert. Denn die Schallplatten werden durch diese Wiedergabetechnik, die die mechanische Musik zu einer ernsthaften Konkurrenz der lebenden Musik gemacht hat, ungleich weniger abgenutzt, was ihre Lebensdauer entsprechend verlängert.
Die Gesichtspunkte, aus denen das RG in seiner Entscheidung vom 11. Juni 1932 (RGZ 136, 377) eine Verletzung des Urheberrechts durch die Lautsprecherübertragung von geschützter, im Rundfunk gesendeter Musik zu gewerblichen Zwecken verneint hat, treffen im Streitfall nicht zu. Abgesehen davon, daß dieses Urteil sich nicht auf die Sendung von Schallplatten bezieht, hat das RG diese Entscheidung im wesentlichen darauf abgestellt, daß die Gestattung der Wiedergabe des Werkes durch Rundfunk ihrer Natur nach eine Erlaubnis zur Überm1ttlung in unbegrenzter Weite und an eine unbestimmt große Menge von Menschen bedeute. Eine dergestalt einmal freigegebene Öffentlichkeit könne durch gewerbsmäßige Lautsprecherdarbietung nicht mehr gesteigert, nicht "noch öffentlicher" gemacht werden. Dort handelte es sich somit um die Abgrenzung des Aufführungsrechts aus § 11 LUG, wenn die öffentliche Darbietung des Werkes durch den Rundfunk ausdrücklich gestattet war, während es hier um die Grenzen der gesetzlichen Zwangserlaubnis der öffentlichen Aufführung mechanischer Vorrichtungen geht. Es bedarf bei dieser Sachlage keiner Stellungnahme, ob dieser Entscheidung des RG, die im Schrifttum lebhafte Kritik gefunden hat, zu folgen ist.
Abzulehnen ist die Ansicht des Bekl., bei Herausnahme der Lautsprecherwiedergabe von Schallplatten aus dem Ausnahmebereich des § 22a müsse zwangsläufig die durch § 27 LUG freigegebene Aufführung erschienener Werke der Tonkunst der Erlaubnispflicht unterstellt werden, wenn sie mittels Lautsprecherübertragung erfolgten. Diese Ansicht verkennt, daß die Erlaubnisfreiheit gewisser nicht gewerbsmäßiger oder unentgeltlicher Aufführungen vom Gesetzgeber im Interesseder Allgemeinheit für geboten erachtet wurde. Bei § 27 handelt es sich somit um eine Anerkennung der sozialen Gebundenheit des Urheberrechts, während § 22a die Abnehmer und Hersteller mechanischer Musikinstrumente begünstigen will. Die Gründe, die eine Einschränkung des Begriffs der öffentlichen Aufführung in § 22a rechtfertigen, können deshalb nicht auf § 27 übertragen werden, der von dem umfassenden Aufführungsbegriff des § 11 Abs. 2 LUG ausgeht.
Es ist somit im Ergebnis festzustellen, daß die öffentliche Aufführung von Schallplatten mit urheberrechtlich geschützter Musik durch Plattenspieler mit Lautsprecherwiedergabe mit den sich aus § 27 LUG ergebenden Einschränkungen gemäß §§ 11, 12 Abs. 2 Ziff. 5 LUG nur mit Erlaubnis des Urhebers zulässig ist.
Dies gilt auch dann, wenn im konkreten Einzelfall die öffentliche Aufführung durch Lautsprecher nur mit einer Reichweite stattfindet, die sich von der Reichweite der 1910 bekannten mechanischen Musikinstrumente nicht unterscheidet. Maßgebend für die Frage, ob eine öffentliche Darbietung aus dem eng auszulegenden Aufführungsbegriff des § 22a herausfällt, ist nicht die Reichweite im einzelnen Anwendungsfall, sondern die Art der gewählten Wiedergabetechnik. Ermöglicht diese ihrer Natur nach die Hörbarmachung für einen fast unbegrenzten Personenkreis und die Weiterleitung der von dem Tonträger abgenommenen Töne in größere Entfernung, so liegt sie außerhalb des Ausnahmebereichs des § 22a. So wenig es für die Bindung des Senderechts an die Erlaubnis des Urhebers von Bedeutung sein kann, ob die Sendung auf ganz schwacher Welle nur im kleinen Umkreis und mit geringer Lautstärke empfangen werden kann, darf bei der öffentlichen Lautsprecherwiedergabe mechanischer Musik auf den tatsächlichen räumlichen Effekt im einzelnen Gebrauchsfall abgestellt werden (vgl. Bühnen-Oberschiedsgericht in Ufita IV, 558). Auch die elektro-akustische Schallplattenübertragung, die tatsächlich keinem größeren Hörerkreis zugänglich wird, als er durch mechanische Musikdarbietungen der 1910 bekannten Art
[S. 221] erfaßt werden konnte, stellt eine neuartige Aufführungsform dar, die durch § 22a nicht gedeckt ist. Denn die neuen gewerblichen Verwertungsmöglichkeiten mechanischer Musik, die durch das elektro-akustische Verfahren erschlossen wurden, beruhen nicht allein auf der größeren Reichweite, sondern auch auf der Vervollkommnung der Klangqualität. Diese hat es im wesentlichen erst ermöglicht, daß mechanische Musik weitgehend als gleichwertiger Ersatz lebender Musik gewertet und entsprechend verwendet wird. Da aber den Komponisten bei der unmittelbar durch lebende Musiker durchgeführten öffentlichen Aufführung seines Werkes auch dann Aufführungsgebühren zustehen, wenn diese Darbietung sich auf kleinsten Raum beschränkt, ist es ein Gebot der Gerechtigkeit den Werkschöpfern gegenüber. sie auch an dem gewerblichen Nutzen teilnehmen zu lassen, der sich bei einem Ersatz derartiger Musikdarbietungen durch eine elektro-akustische Übertragung mechanischer Musik ergibt."
Ebenso argumentieren Dreier/Schulze, Urheberrecht, 2. Aufl. 2006, § 31 Rz. 86-88: Nach früherem Recht stand der Zweckübertragungsgedanke der Einräumung von Rechten einer unbekannten Nutzungsart regelmäßig auch dann entgegen, wenn die Rechte seinerzeit unbeschränkt übertragen wurden (BGHZ 11, 135, siehe oben; RGZ 118, 282 - Musikantenmädel; zur Verfilmung BGH GRUR 1960, 197 - Keine Ferien für den lieben Gott). Hinsichtlich der Verfilmung verneinte das LG München I (GRUR 1991, 377), dass es einen generellen Erfahrungssatz gegeben habe, wonach die Urheber dem Filmproduzenten die Nutzungsrechte für unbekannte Nutzungsarten eingeräumt hätten.
Eine stillschweigende Übereinkunft zu einer solchen Einräumung wurde bei Wochenschauen aufgrund ihres Charakters ausnahmsweise bejaht (LG München I ZUM-RD 1998, 89).
Waren aber ausdrücklich auch Rechte hinsichtlich künftiger Nutzungsarten übertragen worden, ist das wirksam (LG Hamburg, ZUM-RD 1999, 134; OLG München, ZUM 2000, 61).
Was folgt daraus für die Retrodigitalisierung? Für die vor 1966 erschienenen Bücher und Zeitschriften ist nichts durch die Streichung von § 31 IV UrhG gewonnen worden. Die Rechte liegen ganz überwiegend bei den Autoren, soweit diese noch leben, oder bei ihren Rechtsnachfolgern (meist: Erben), die alle ausnahmslos einer Nutzung zustimmen müssen. Während man bei Verlagsverträgen eventuell daran denken kann, dass künftige Rechte gelegentlich angesprochen wurden, wird man bei Zeitschriftenverträgen in aller Regel annehmen müssen, dass eine Vereinbarung über künftige Nutzungsarten nicht zustandekam und daher die Rechte bei den Urhebern/Erben liegen. Solche Verträge wurden meines Wissens überwiegend konkludent nicht-schriftlich abgeschlossen: Der Autor sandte dem Herausgeber sein Manuskript und erhielt von diesem eine Zusage und dann die Korrekturfahnen und nach Erscheinen Sonderdrucke. (Bis heute schließen etwa Tageszeitungen wie die FAZ mit ihren Autoren im Vorfeld keine Verträge ab.)
Aus Open-Access-Sicht ist eine Retrodigitalisierung älterer Zeitschriftenjahrgänge, die kostenfrei eingesehen werden können, ohne jeden Zweifel wünschenswert. Die Kontaktaufnahme mit den Urhebern bzw. meistens mehreren Erben ist schlicht und einfach nicht machbar. Der (hier nicht anwendbare) § 137 l Abs. 4 UrhG sagt: "Sind mehrere Werke oder Werkbeiträge zu einer Gesamtheit zusammengefasst, die sich in der neuen Nutzungsart in angemessener Weise nur unter Verwendung sämtlicher Werke oder Werkbeiträge verwerten lässt, so kann der Urheber das Widerspruchsrecht nicht wider Treu und Glauben ausüben." Das wird von den Verlegern auf die Zeitschriftendigitalisierung bezogen, hilft ihnen bei den "Altfällen" aber auch nicht weiter.
Fazit: Um die Retrodigitalisierung rechtssicher vornehmen zu können, ist eine Nachbesserung im "dritten Korb" zwingend notwendig. Es sollte dabei auch für Dritte die Möglichkeit geschaffen werden, verwaiste Werke, deren Rechtsinhaber nicht greifbar sind, zu nutzen. Wenn sich die Rechteinhaber melden, ist ihnen unter Umständen ein Vergütungsanspruch zuzugestehen, z.B. wenn das Werk kommerziell pay-per-View von einem Verlag genutzt wird. Es wäre zu überlegen, die Verwertungsgesellschaft VG Wort im Bereich Wissenschaft zu verpflichten, falls Vergütungen bei kommerzieller Nutzung an sie entrichtet werden, Open-Access-Veröffentlichungen finanziell zu fördern. Dies würde bedeuten, dass die klandestine Praxis der VG-Wort-Druckkostenzuschüsse auf den Prüfstand müsste.
Wandtke/Bullinger, Urheberrecht 3. Aufl. 2009 (bereits online) verweisen zu § 137 l in Rn. 5 darauf, dass auf die Altverträge die Zweckübertragungsregel anwendbar ist, derzufolge die Rechteeinräumung von vor dem 1.1.1966 unbekannten Nutzungsarten im Zweifel nicht umfasst war. Belegt wird dies mit BGH GRUR 1988, 296, 299 GEMA-Vermutung IV, wo es heißt:
"Schließlich wird das BerG in diesem Fall zu beachten haben, daß die Bestimmung des § 31 Abs. 4 UrhG auf Berechtigungsverträge, die vor dem Inkrafttreten des Urheberrechtsgesetzes am 1.1.1966 abgeschlossen worden sind, keine Anwendung findet (vgl. § 132 UrhG; BGH in GRUR 1986, 62 , 66 GEMA-Vermutung I 1, insoweit nicht in BGHZ 95, 274); bei solchen Altverträgen ist gegebenenfalls zu prüfen, ob der Verwertungsgesellschaft die Rechte der - damals noch nicht bekannten - Videozweitauswertung wirksam eingeräumt worden sind; dabei wäre zu berücksichtigen, daß auch nach früherem Recht der Zweckübertragungsgedanke (jetzt § 31 Abs. 5 UrhG) der Einräumung von Rechten an einer noch nicht bekannten Nutzungsart an sich regelmäßig entgegenstand (vgl. RGZ 118, 282, 285 ff. - Musikantenmädel; 123, 312, 317 - Wilhelm Busch 3; BGHZ 11, 135, 143 f. - Schallplatten-Lautsprecherübertragung 4; von Gamm, UrhG, § 31 Rdn. 15), daß aber in diesem Zusammenhang den Besonderheiten des Verhältnisses zwischen Urheber und Verwertungsgesellschaft - anders als bei der an sich zwingenden Regelung des § 31 Abs. 4 UrhG - Rechnung getragen werden kann (vgl. auch BGH in GRUR 1986, 62 , 66 GEMA-Vermutung I, insoweit nicht in BGHZ 95, 274). "
BGHZ 11, 135 = GRUR 1954, 216. Auszug:
"Das RG ist in ständiger Rechtsprechung von dem Ausnahmecharakter des § 22a LUG ausgegangen und hat hieraus gefolgert, daß diese Gesetzesvorschrift wie alle Ausnahmebestimmungen grundsätzlich eng auszulegen sei (RGZ 153, 1 ff. [23]; 140, 239; 128, 102 ff.). Dem schließt sich der Senat an. Eine enge Auslegung der durch § 22a geschaffenen Befugnislücke in der umfassenden Urheberbefugnis des § 11 LUG ist schon nach dem das ganze Urheberrecht beherrschenden Leitgedanken geboten, den Urheber tunlichst an dem wirtschaftlichen Nutzen zu beteiligen, der aus seinem Werk gezogen wird (RGZ 118, 285; 122, 68; 123, 312; 128, 113; 130, 206; 134, 201; 153, 22).
Auf diesem Grundsatz beruht auch die Rechtsprechung des RG, wonach selbst bei einer uneingeschränkten Übertragung des Urheberrechts die Ausnutzung neuer Verwertungsmöglichkeiten, die die Parteien nach dem Stand der Technik im Zeitpunkt der Übertragung nicht in Rechnung gestellt haben, dem Werkschöpfer vorbehalten bleiben (RGZ 118, 285 [Verfilmung]; RGZ 123, 312 [Rundfunksendung] ). Aus dem gleichen Rechtsgedanken hat das RG in seiner für die Schallplattenwiedergabe durch den Rundfunk grundlegenden Entscheidung vom 14. November 1936 (RGZ 153, 1 ff.) den Umfang der durch § 22a LUG gewährten Aufführungsfreiheit nach den Verwertungsmöglichkeiten von Schallvorrichtungen beurteilt, wie sie bei Erlaß der Novelle von 1910 gegeben oder doch nach dem damaligen Stand der Technik voraussehbar waren. Das RG führt hierzu u. a. aus: "In welchem Umfang die Ausnahme bezweckt wurde, läßt sich bloß nach den technischen Möglichkeiten beurteilen, welche bei Erlaß des Gesetzes von 1910 vorlagen. Diese bestanden damals nur in der regelmäßigen, einfachen, erstmaligen, auf dem Grammophon zum unmittelbaren Hören bestimmten Wiedergabe (Elster, Archiv für Urheberrecht 1932, 116 ff., GRUR 1935, 210). Eine beträchtlich weitergehende Wiedergabeart und eine Erstreckung des Ausnahmebereichs auf sie lagen nicht in Zweck und Absicht des Gesetzes." Von dieser grundsätzlichen Auffassung aus hat sich das RG die Frage gestellt, ob die Rundfunksendung "in ihren tatsächlichen Wirkungen den Verhältnissen gleichzusetzen sei, die das Gesetz bei Schaffung des § 22a vor Augen hatte und die daher nach dem Zweck der Vorschrift eine Beschränkung der urheberrechtlichen Befugnis rechtfertigen können". Das RG hat diese Frage für die rundfunkmäßige Sendung von Schallplatten verneint und die Zustimmung sowohl des Komponisten sowie des Inhabers des Schutzrechtes an der Schallplatte (§ 2 Abs. 2) für diese neue Verwertungsart des Urheberrechtsgutes als erforderlich erachtet.
Soweit das RG dieses Ergebnis unter Anknüpfung an seinen in früheren Entscheidungen für die Rundfunksendung entwickelten erweiterten Verbreitungsbegriff (RGZ 113, 413; 123, 312; 136, 381) auch darauf stützt, daß die Wiedergabe eines Werkes durch den Rundfunk in den außerhalb des Kreises der "öffentlichen Aufführung" liegenden Teilbereich der "Verbreitung" falle, der durch § 22a nicht freigegeben sei, vermag der Senat dieser Begründung nicht zu folgen. Der Senat geht vielmehr davon aus, daß der Verbreitungsbegriff sich nur auf die Verbreitung körperlicher Werkexemplare beschränkt und auf die unkörperliche Wiedergabe des Werkes nicht zu erstrecken ist. Der Senat folgt dagegen der weiteren, die Entscheidung tragenden Begründung des RG, wonach dem Begriff der "öffentlichen Aufführung" in der Ausnahmevorschrift des § 22a nur die enge Bedeutung zukommt, die der Gesetzgeber im Jahre 1910 nach dem damaligen Entwicklungsstand der Technik im Auge haben konnte. Die Entscheidung des Rechtsstreits hängt hiernach davon ab, ob die Lautsprecherwiedergabe von Schallplatten mittels moderner Plattenspielapparate in ihren Wirkungen den bei Schaffung des § 22a bekannten Wiedergabemöglichkeiten mechanischer Musik gleichzusetzen ist...
Im Jahre 1910 geschah die Tonaufnahme der Schallplatte in der Weise, daß durch eine mit einer Membran festverbundene Nadel die mechanischen Bewegungen fortlaufend aufgezeichnet wurden, die die Nadel unter dem Impuls der Schallschwingungen ausführte. Die Wiedergabe stellte eine Umkehr dieses mechanischen Aufnahmevorganges dar. Durch die Drehung der Platte wurde eine in ihrer Tonspur entlanggeführte Nadel zu der Wiederholung der mechanischen Schwingungen gezwungen, die zur Bildung der Tonspur geführt hatten. Diese Schwingungen wurden - durch Hebelwirkung vergrößert - auf eine Membran übertragen, die den mechanisch-akustischen Wandler darstellte. Die akustischen Schwingungen wurden durch einen Schalltrichter verstärkt und damit für das menschliche Ohr hörbar gemacht. Die Umformung der auf der Schallplatte festgelegten Töne erfolgte somit durch ein ausschließlich mechanisch-akustisches Verfahren, wobei die Wirksamkeit der in sich geschlossenen Apparatur von den beschränkten mechanischen Möglichkeiten abhängig war. Die auf diese Weise erzeugten Schallwellen waren nur sehr begrenzt weiterleitungsf.ähig und nur einer beschränkten Verstärkung zugänglich. Der Tonqualität waren dadurch, daß größere Massen in Schwingungen versetzt werden mußten, enge Grenzen gesetzt. Um die notwendige Lautstärke zu erreichen, mußte der Nadeldruck verhältnismäßig stark sein, was die Lebensdauer der Platte sowie die Klangreinheit der Wiedergabe herabsetzte.
Die Wiedergabe einer Schallplatte durch einen modernen Plattenspieler mit elektro-akustischem Lautsprecher beruht auf einem völlig anderen Prinzip. Bei diesem Verfahren wird als Wandler ein sog. Tonabnehmer benutzt, der die mechanischen Schwingungen nicht in akustische, sondern in elektrische Schwingungen umwandelt. Diese elektrischen Schwingungen werden sodann durch den Lautsprecher in Schallwellen umgeformt. Der Hörer vernimmt somit Schallwellen, die erst durch eine Verwandlung elektrischer Wellen entstehen, die wiederum auf eine Umformung der zunächst erzeugten mechanischen Schwingungen der Nadel zurückgehen. Diese der Rundfunktechnik entnommene Wiedergabeart mit der ihr eigentümlichen beliebig steigerungsfähigen Verstärkung kleinster elektrischer Impulse ermöglicht es, die mechanischen Bewegung der Nadel auf ein Minimum zu beschränken, was eine erhebliche Klangverbesserung gegenüber dem mechanisch-akustischen Verfahren zur Folge hat. Bei diesem Verfahren können weiterhin die mechanisch schwingenden Massen sehr gering gehalten werden, was sich gleichfalls auf die Tonqualität günstig auswirkt und zugleich die Haltbarkeit der Schallplatte wesentlich erhöht. Gewonnen aber wurde vor allem durch das elektro-akustische Verfahren eine beliebig steigerungsfähige Klangstärke und Reichweite der Schallplattenaufführung. Die in dem Tonabnehmer in elektrische Wellen kleinster Energie verwandelten Schallschwingungen können über beliebig große Verstärker oder ganze Verstärkeranlagen einer unbegrenzten Zahl von Lautsprechern zugeführt werden. Da die elektrischen Wellen auch bei längeren Zuleitungswegen keine Abschwächung erfahren, können diese auch in größerer Entfernung von der übrigen Wiedergabeapparatur aufgestellt werden, ohne daß die Klangstärke beeinträchtigt würde.
Aus dem elektro-akustischen Übertragungsweg kann nun zwar nicht gefolgert werden, das Abspielen von Schallplatten mittels moderner Plattenspieler erfülle nicht den Tatbestand einer "mechanischen Wiedergabe für das Gehör" im Sinn von § 12 Abs. 2 Ziff. 5 LUG. Denn unter diesen Begriff fallen alle nur für das Gehör bestimmten Werkwiedergaben, die nicht unmittelbar durch die Leistung eines ausübenden Künstlers bewirkt werden, sondern mit Hilfe von Vorrichtungen erfolgen, auf die das Werk festgelegt ist, mag auch deren Hörbarmachung nicht ausschließlich auf rein mechanischen Gesetzen beruhen (RGZ 153, 1 [10] ).
Entscheidend ist vielmehr allein, ob die öffentliche Wiedergabe von Schallplatten auf dem elektro-akustischen Ü bertragungsweg den urheberrechtlichen Tatbestand der öffentlichen Aufführung im Sinn der Ausnahmebestimmung des § 22a LUG erfüllt. Dies ist zu verneinen. Diese Wiedergabeart, deren Prinzip heute auch weitgehend bei der Ton aufnahme verwendet wird, war dem Gesetzgeber im Jahre 1910 völlig unbekannt und in seiner umwälzenden Bedeutung für [S. 220] die mechanische Musik nicht voraussehbar. Diese neuartige Wiedergabetechnik ermöglicht ihrer Natur nach eine ganz andersartige und weitergehende wirtschaftliche Ausbeutung von Schallvorrichtungen, als sie der Gesetzgeber bei Festlegung der Aufführungsfreiheit im § 22a in Betracht ziehen konnte. Theoretisch könnte die Reichweite der Lautsprecherwiedergabe die gleiche sein wie die einer Rundfunksendung. Der Unterschied besteht nur darin, daß die Hörbarmachung der Funksendung von einem Empfangsgerät abhängig ist, das keine Verbindung durch einen festen Leitungskörper mit dem Sendeapparat voraussetzt, während bei der Lautsprecherwiedergabe durch Plattenspieler auf diese Verbindung nicht verzichtet werden kann. Aber auch diese Wiedergabeart ist ihrem Wesen nach geeignet, in einer beliebigen Vielheit voneinander getrennter Räume eine nahezu unbegrenzte Hörerschaft zu erf.assen. Weiterhin fällt ins Gewicht, daß die Tonqualität bei dieser Wiedergabetechnik der einer unm1ttelbaren Aufführung durch ausübende Künstler fast gleichwertig ist. Die Lautsprecherwiedergabe ist deshalb, jedenfalls urheberrechtlich gesehen, nicht nur eine technische Verbesserung, sondern ähnlich wie die Rundfunksendung als ein völlig neues technisches Mittel, mechanische Musik darzubieten, zu werten, wobei vom urheberrechtlichen Blickpunkt weniger die Höhe der erfinderischen Leistung als die durch diese Wiedergabeart erschlossene neue gewerbliche Nutzungsmöglichkeit mechanischer Musik bedeutsam ist (im Ergebnis ebenso Möhring, GEMA-Festschrift 1953, S. 54; Kurtze, JR 1952, 343). Die Erwägung, die es dem Gesetzgeber um die Jahrhundertwende tragbar erscheinen ließ, den Urheberrechtsschutz nicht auf mechanische Musikinstrumente zu erstrecken, weil "das Spielen mechanischer Musikinstrumente immer nur ein notdürftiger Ersatz für wirkliche Musik bleiben werde und vornehmlich in Kreisen sich verbreiten werde, in welchen musikalische Reproduktionen schon bislang keinen Eingang gefunden haben", trifft auf die elektroakustische Wiedergabe mechanischer Musik jedenfalls nicht mehr zu. Die Qualität und Reichweite dieser Wiedergabeart hat dazu geführt, daß sie bei öffentlichen Veranstaltungen bereits weitgehend die Originalmusik verdrängt hat. Nicht nur bei öffentlichen Tanzvergnügungen und Sportdarbietungen, auch auf Ausstellungen, in Kurorten, Theatern und Lichtspielhäusern ist die Schallplattenübertragung mittels Lautsprecher vielfach an die Stelle unmittelbarer Musikdarbietungen getreten.
Es kann nicht in der Absicht der Novelle von 1910 gelegen haben, den Ausnahmebereich des § 22a auf diese gegenüber dem damaligen Stand der Technik völlig neuartige Wiedergabeart zu erstrecken, die den Musikveranstaltern weitergehende gewerbliche Auswertungsmöglichkeiten eröffnet als die damals bekannten mechanischen Musikdarbietungen. Weder erfordert es der Zweck des § 22a, durch eine den Abnehmern mechanischer Musikinstrumente eingeräumte urheberrechtliche Vorzugsstellung den Gewerbezweig der Hersteller dieser Instrumente zu begünstigen, noch erlaubt es der das gesamte Urheberrecht durchziehende Leitgedanke, den Urheber an den wirtschaftlichen Früchten seines Werkes angemessen zu beteiligen, öffentliche mechanische Musikveranstaltungen durch Lautsprecherwiedergabe der Ausnahmevorschrift des § 22a zu unterstellen und solche Veranstaltungen damit dem Schutzbereich des Urhebers zu entziehen. Bei der weittragenden Bedeutung, die der gewerblichen Auswertung mechanischer Musik infolge dieser neuen Wiedergabetechnik zukommt, würde es auf eine Aushöhlung und wirtschaftliche Entwertung des dem Urheber durch § 11 Abs. 2 LUG vorbehaltenen Aufführungrechts hinauslaufen, wenn diese Wiedergabeart in die durch § 22a gewährte Erlaubnisfreiheit einbezogen würde. Der Urheber verlöre ersatzlos die Aufführungsgebühren, die ihm bei einer öffentlichen Darbietung seines Werkes durch ausübende Künstler zufiießen würden. Wenn er auch für die Vergabe der mechanischen Vervielfältigungserlaubnis an den Erlösen aus der Schallplattenherstellung beteiligt wird. so kann hierin schon deshalb keine angemessene Entschädigung für die öffentliche Auswertung seines Werkes in der durch die Lautsprecherwiedergabe ermöglichten Art und Reichweite erblickt werden, weil der Absatz der Schallplatten sich durch diese neuen gewerblichen Verwertungsmöglichkeiten nicht in entsprechendem Maße steigert. Denn die Schallplatten werden durch diese Wiedergabetechnik, die die mechanische Musik zu einer ernsthaften Konkurrenz der lebenden Musik gemacht hat, ungleich weniger abgenutzt, was ihre Lebensdauer entsprechend verlängert.
Die Gesichtspunkte, aus denen das RG in seiner Entscheidung vom 11. Juni 1932 (RGZ 136, 377) eine Verletzung des Urheberrechts durch die Lautsprecherübertragung von geschützter, im Rundfunk gesendeter Musik zu gewerblichen Zwecken verneint hat, treffen im Streitfall nicht zu. Abgesehen davon, daß dieses Urteil sich nicht auf die Sendung von Schallplatten bezieht, hat das RG diese Entscheidung im wesentlichen darauf abgestellt, daß die Gestattung der Wiedergabe des Werkes durch Rundfunk ihrer Natur nach eine Erlaubnis zur Überm1ttlung in unbegrenzter Weite und an eine unbestimmt große Menge von Menschen bedeute. Eine dergestalt einmal freigegebene Öffentlichkeit könne durch gewerbsmäßige Lautsprecherdarbietung nicht mehr gesteigert, nicht "noch öffentlicher" gemacht werden. Dort handelte es sich somit um die Abgrenzung des Aufführungsrechts aus § 11 LUG, wenn die öffentliche Darbietung des Werkes durch den Rundfunk ausdrücklich gestattet war, während es hier um die Grenzen der gesetzlichen Zwangserlaubnis der öffentlichen Aufführung mechanischer Vorrichtungen geht. Es bedarf bei dieser Sachlage keiner Stellungnahme, ob dieser Entscheidung des RG, die im Schrifttum lebhafte Kritik gefunden hat, zu folgen ist.
Abzulehnen ist die Ansicht des Bekl., bei Herausnahme der Lautsprecherwiedergabe von Schallplatten aus dem Ausnahmebereich des § 22a müsse zwangsläufig die durch § 27 LUG freigegebene Aufführung erschienener Werke der Tonkunst der Erlaubnispflicht unterstellt werden, wenn sie mittels Lautsprecherübertragung erfolgten. Diese Ansicht verkennt, daß die Erlaubnisfreiheit gewisser nicht gewerbsmäßiger oder unentgeltlicher Aufführungen vom Gesetzgeber im Interesseder Allgemeinheit für geboten erachtet wurde. Bei § 27 handelt es sich somit um eine Anerkennung der sozialen Gebundenheit des Urheberrechts, während § 22a die Abnehmer und Hersteller mechanischer Musikinstrumente begünstigen will. Die Gründe, die eine Einschränkung des Begriffs der öffentlichen Aufführung in § 22a rechtfertigen, können deshalb nicht auf § 27 übertragen werden, der von dem umfassenden Aufführungsbegriff des § 11 Abs. 2 LUG ausgeht.
Es ist somit im Ergebnis festzustellen, daß die öffentliche Aufführung von Schallplatten mit urheberrechtlich geschützter Musik durch Plattenspieler mit Lautsprecherwiedergabe mit den sich aus § 27 LUG ergebenden Einschränkungen gemäß §§ 11, 12 Abs. 2 Ziff. 5 LUG nur mit Erlaubnis des Urhebers zulässig ist.
Dies gilt auch dann, wenn im konkreten Einzelfall die öffentliche Aufführung durch Lautsprecher nur mit einer Reichweite stattfindet, die sich von der Reichweite der 1910 bekannten mechanischen Musikinstrumente nicht unterscheidet. Maßgebend für die Frage, ob eine öffentliche Darbietung aus dem eng auszulegenden Aufführungsbegriff des § 22a herausfällt, ist nicht die Reichweite im einzelnen Anwendungsfall, sondern die Art der gewählten Wiedergabetechnik. Ermöglicht diese ihrer Natur nach die Hörbarmachung für einen fast unbegrenzten Personenkreis und die Weiterleitung der von dem Tonträger abgenommenen Töne in größere Entfernung, so liegt sie außerhalb des Ausnahmebereichs des § 22a. So wenig es für die Bindung des Senderechts an die Erlaubnis des Urhebers von Bedeutung sein kann, ob die Sendung auf ganz schwacher Welle nur im kleinen Umkreis und mit geringer Lautstärke empfangen werden kann, darf bei der öffentlichen Lautsprecherwiedergabe mechanischer Musik auf den tatsächlichen räumlichen Effekt im einzelnen Gebrauchsfall abgestellt werden (vgl. Bühnen-Oberschiedsgericht in Ufita IV, 558). Auch die elektro-akustische Schallplattenübertragung, die tatsächlich keinem größeren Hörerkreis zugänglich wird, als er durch mechanische Musikdarbietungen der 1910 bekannten Art
[S. 221] erfaßt werden konnte, stellt eine neuartige Aufführungsform dar, die durch § 22a nicht gedeckt ist. Denn die neuen gewerblichen Verwertungsmöglichkeiten mechanischer Musik, die durch das elektro-akustische Verfahren erschlossen wurden, beruhen nicht allein auf der größeren Reichweite, sondern auch auf der Vervollkommnung der Klangqualität. Diese hat es im wesentlichen erst ermöglicht, daß mechanische Musik weitgehend als gleichwertiger Ersatz lebender Musik gewertet und entsprechend verwendet wird. Da aber den Komponisten bei der unmittelbar durch lebende Musiker durchgeführten öffentlichen Aufführung seines Werkes auch dann Aufführungsgebühren zustehen, wenn diese Darbietung sich auf kleinsten Raum beschränkt, ist es ein Gebot der Gerechtigkeit den Werkschöpfern gegenüber. sie auch an dem gewerblichen Nutzen teilnehmen zu lassen, der sich bei einem Ersatz derartiger Musikdarbietungen durch eine elektro-akustische Übertragung mechanischer Musik ergibt."
Ebenso argumentieren Dreier/Schulze, Urheberrecht, 2. Aufl. 2006, § 31 Rz. 86-88: Nach früherem Recht stand der Zweckübertragungsgedanke der Einräumung von Rechten einer unbekannten Nutzungsart regelmäßig auch dann entgegen, wenn die Rechte seinerzeit unbeschränkt übertragen wurden (BGHZ 11, 135, siehe oben; RGZ 118, 282 - Musikantenmädel; zur Verfilmung BGH GRUR 1960, 197 - Keine Ferien für den lieben Gott). Hinsichtlich der Verfilmung verneinte das LG München I (GRUR 1991, 377), dass es einen generellen Erfahrungssatz gegeben habe, wonach die Urheber dem Filmproduzenten die Nutzungsrechte für unbekannte Nutzungsarten eingeräumt hätten.
Eine stillschweigende Übereinkunft zu einer solchen Einräumung wurde bei Wochenschauen aufgrund ihres Charakters ausnahmsweise bejaht (LG München I ZUM-RD 1998, 89).
Waren aber ausdrücklich auch Rechte hinsichtlich künftiger Nutzungsarten übertragen worden, ist das wirksam (LG Hamburg, ZUM-RD 1999, 134; OLG München, ZUM 2000, 61).
Was folgt daraus für die Retrodigitalisierung? Für die vor 1966 erschienenen Bücher und Zeitschriften ist nichts durch die Streichung von § 31 IV UrhG gewonnen worden. Die Rechte liegen ganz überwiegend bei den Autoren, soweit diese noch leben, oder bei ihren Rechtsnachfolgern (meist: Erben), die alle ausnahmslos einer Nutzung zustimmen müssen. Während man bei Verlagsverträgen eventuell daran denken kann, dass künftige Rechte gelegentlich angesprochen wurden, wird man bei Zeitschriftenverträgen in aller Regel annehmen müssen, dass eine Vereinbarung über künftige Nutzungsarten nicht zustandekam und daher die Rechte bei den Urhebern/Erben liegen. Solche Verträge wurden meines Wissens überwiegend konkludent nicht-schriftlich abgeschlossen: Der Autor sandte dem Herausgeber sein Manuskript und erhielt von diesem eine Zusage und dann die Korrekturfahnen und nach Erscheinen Sonderdrucke. (Bis heute schließen etwa Tageszeitungen wie die FAZ mit ihren Autoren im Vorfeld keine Verträge ab.)
Aus Open-Access-Sicht ist eine Retrodigitalisierung älterer Zeitschriftenjahrgänge, die kostenfrei eingesehen werden können, ohne jeden Zweifel wünschenswert. Die Kontaktaufnahme mit den Urhebern bzw. meistens mehreren Erben ist schlicht und einfach nicht machbar. Der (hier nicht anwendbare) § 137 l Abs. 4 UrhG sagt: "Sind mehrere Werke oder Werkbeiträge zu einer Gesamtheit zusammengefasst, die sich in der neuen Nutzungsart in angemessener Weise nur unter Verwendung sämtlicher Werke oder Werkbeiträge verwerten lässt, so kann der Urheber das Widerspruchsrecht nicht wider Treu und Glauben ausüben." Das wird von den Verlegern auf die Zeitschriftendigitalisierung bezogen, hilft ihnen bei den "Altfällen" aber auch nicht weiter.
Fazit: Um die Retrodigitalisierung rechtssicher vornehmen zu können, ist eine Nachbesserung im "dritten Korb" zwingend notwendig. Es sollte dabei auch für Dritte die Möglichkeit geschaffen werden, verwaiste Werke, deren Rechtsinhaber nicht greifbar sind, zu nutzen. Wenn sich die Rechteinhaber melden, ist ihnen unter Umständen ein Vergütungsanspruch zuzugestehen, z.B. wenn das Werk kommerziell pay-per-View von einem Verlag genutzt wird. Es wäre zu überlegen, die Verwertungsgesellschaft VG Wort im Bereich Wissenschaft zu verpflichten, falls Vergütungen bei kommerzieller Nutzung an sie entrichtet werden, Open-Access-Veröffentlichungen finanziell zu fördern. Dies würde bedeuten, dass die klandestine Praxis der VG-Wort-Druckkostenzuschüsse auf den Prüfstand müsste.
KlausGraf - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 00:18 - Rubrik: Archivrecht
Der englische Autor und Schauspieler Stephen Fry hat in einer Dokumentation die Druckerpresse von Johannes Gutenberg rekonstruiert. Der Film ist in sechs Teilen auf YouTube zu sehen.
Teil 2
http://www.youtube.com/watch?v=v5832QlN2co
Teil 3
http://www.youtube.com/watch?v=yO1ikKZnIhA
Teil 4
http://www.youtube.com/watch?v=qwyW3y7vV34
Teil 5
http://www.youtube.com/watch?v=qQ-bvywnFJE
Teil 6
http://www.youtube.com/watch?v=n8G1xX9zqxE
Welche Gutenberg-Bibeln komplett im Internet einzusehen sind, sagt die Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gutenberg-Bibel
( http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/ hat noch zwei Einzelblatt-Digitalisate)

KlausGraf - am Mittwoch, 17. Dezember 2008, 00:09 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/hamm/j2008/4_U_157_07urteil20080226.html
Eine Fachzeitschrift ist ein urheberrechtlich geschütztes Sammelwerk i.S. von § 4 UrhG, wenn einzelne Elemente systematisch ausgewählt und nach bestimmten Kriterien angeordnet sind. Die Auswahl der Artikel mit Hilfe eines Begutachtungsverfahrens stellt eine eigene persönliche geistige Schöpfung des Herausgebers dar.
2. Durch die Übernahme des Inhalts einer Fachzeitschrift in eine Online-Datenbank wird das Urheberrecht des Herausgebers am Sammelwerk verletzt, wenn nicht nur sämtliche Beiträge der Zeitschrift übernommen werden, sondern auch das Gliederungs- und Zitiersystem nach Heft, Band und Artikel, wodurch die Auswahl der Artikel und das vom Herausgeber geschaffene Anordnungssystem zum Ausdruck kommt, und zwar erkennbar in der Form, wie er die Zusammenstellung vorgenommen hat. (Leitsätze von GRUR-RR 2008 Heft 8-9, S. 276)
OLG Hamm, Urteil vom 26. 2. 2008 - 4 U 157/07 (Online-Veröffentlichung)
Zu den Hintergründen (Mathematik-Professor der Uni Bielefeld vs. Springer Verlag) siehe die Urteils-Anmerkung von Ulrike Verch:
http://www.jurpc.de/aufsatz/20080088.htm
Die Entscheidung, die auch en passant die Open-Access-Problematik anspricht, ist im Ergebnis höchst problematisch, da sie "Herausgeber-Patriarchen" ein antiquiertes Urheberrecht nach § 4 UrhG, das 70 Jahre nach dem Tod währt, zuspricht. Weder die Auswahl noch die Anordnung der Artikel eines Zeitschriftenbandes überschreitet meines Erachtens die Grenze der "Kleinen Münze".
Herausgeber erhalten damit ein Vetorecht zugesprochen, das die freie wissenschaftliche Kommunikation und die erwünschte Retrodigitalisierung von Zeitschriftenjahrgängen behindern kann. Im entschiedenen Fall ging es darum, dass der Herausgeber offenbar in erheblichem Umfang finanziell von seiner Herausgebertätigkeit profitierte. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass der von Harnad und Suber verbreitete Open-Access-Mythos unzutreffend ist, Open Access beziehe sich nur auf "give-away"-Inhalte bzw. bei dem Zeitschriftenwesen handle es sich um solche Inhalte. Open Access muss sich auf diejenigen Inhalte beziehen, die essentiell für den aktuellen Fortschritt einer Disziplin wichtig sind. Profit-Interessen von Autoren oder Herausgebern kann dabei kein entscheidendes Veto-Recht zukommen.
Für Verlage stellt sich bei der Retrodigitalisierung die Frage, ob sie tatsächlich mit den zuständigen Herausgebern "buy-out"-Verträge abgeschlossen haben, die es ihnen ab dem 1.1.2009 ermöglichen, vom § 137 L UrhG Gebrauch zu machen. Störrische alte Männer können sich in der Tat als "Hemmschuh" bei der Online-Verbreitung erweisen. Neben der für die Verlage ärgerlichen Autoren-Front zieht womöglich auch eine Herausgeber-Front herauf.
Die Zuordnung der persönlichen geistigen Schöpfung zum alleinigen Herausgeber dürfte auch kaum die Regel sein und hat vermutlich weitgehend fiktiven Charakter. Die Anordnung der Aufsätze in einer mathematischen Zeitschrift folgt in der Regel gängigen Konventionen (z.B. einer eingeführten Gliederung nach Teilgebieten), und die Verteilung auf die einzelnen Hefte resultiert vor allem aus der Schnelligkeit der Begutachtung, da im wissenschaftlichen Publikationswesen ein möglichst rasches Erscheinen wichtig ist. Es verbleibt also allein die Entscheidung über die Aufnahme des Beitrags als "schöpferisches" Moment. Hier wird dem Beurteilungsspielraum des Herausgebers zu viel Gewicht zugemessen, denn letztlich ist der Entscheidungsprozess ein "Gemeinschaftswerk" von Herausgeber/n und Gutachtern, dessen "kreativer Gehalt" im Einzelfall nicht zu überschätzen ist. Daher geht der von GRUR-RR formulierte Leitsatz Nr. 1 zu weit.
Ganz und gar verfehlt ist die Argumentation des Gerichts mit der Übernahme der Zitation. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es bei einer Online-Datenbank (ob Open Access oder nicht) ganz und gar unverzichtbar, den ursprünglichen Druckort anzugeben. Hier hätte das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit in die Waagschale geworfen werden müssen. Selbstverständlich ist durch eine Reihe von Zitationen, etwa in einer Bibliographie, der Gesamtinhalt und die Abfolge der Aufsätze rekonstruierbar.
Es stellt sich damit die Frage, ob die Vervielfältigung des Inhaltsverzeichnisses, das ja die angebliche schöpferische Leistung des Herausgebers verkörpert, dann nicht auch konsequenterweise dem Verbotsrecht des Herausgebers/Verlags unterfallen muss. Dies wird aus guten Gründen allgemein abgelehnt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Inhaltsmitteilung#Zul.C3.A4ssigkeit_von_Inhaltsverzeichnissen
Den Ausführungen des OLG Hamm lässt sich nicht entnehmen, dass nicht bereits der einzelne Jahrgang einer wissenschaftlichen Zeitschrift als Sammelwerk geschützt ist. Für Open Access hat das die verhängnisvolle Folge, dass eine im wesentlichen vollständige Sammlung selbstarchivierter Beiträge eines Jahrgangs, die den originalen Druckort angibt, dem Verbotsrecht des Rechteinhabers unterfallen kann. Dieser könnte auch dann die Einstellung auf ein und demselben Repositorium oder womöglich auch das Harvesten von verschiedenen Repositorien als Urheberrechtsverletzung verfolgen. Üblicherweise ist der Rechteinhaber ein Verlag, der somit Open Access für einen ganzen Zeitschriftenband blockieren kann, auch wenn er die Einstellung des einzelnen Beitrags weder verhindern kann noch will.
Beispiel: Ein Zeitschriftenjahrgang besteht aus 5 Artikeln, die von den Autoren (ggf. nach Ablauf der Einjahresfrist des § 38 UrhG) unter eine CC-Lizenz gestellt und in verschiedenen Repositorien veröffentlicht werden. Der Band wird (mit Quellenangaben) auf einem Repositorium aufgrund der CC-Lizenz zusammengeführt und ist - nach der Logik des OLG Hamm - als Ganzes aufgrund der Quellenangaben rekonstruierbar. Diese Online-Zugänglichkeit griffe in das Recht der Herausgeber ein, die ihre Rechte dem Verlag übertragen haben. Nur wenn (was für deutsche Verlage keinesfalls die Regel ist) der Verlag eine generelle (positive) Aussage zu "grünem" Open Access (self-archiving) getroffen hat, kann er nicht gegen die Abbildung des Zeitschrifteninhalts vorgehen. Liegen die Herausgeberrechte nicht beim Verlag, so können diese Open Access verhindern bzw. die Verpflichtung, sie zusätzlich ins Boot zu holen, wirkt als weitere Erschwernis.
Aber um es nochmals klar zu machen: Die unerwünschten Konsequenzen für OA sind nicht der Grund, das Urteil bzw. den Leitsatz zu verwerfen. Der Grund ist die verfehlte Annahme einer persönlichen geistigen Schöpfung des Herausgebers in der von GRUR-RR gewählten Generalisierung.
Eine Fachzeitschrift ist ein urheberrechtlich geschütztes Sammelwerk i.S. von § 4 UrhG, wenn einzelne Elemente systematisch ausgewählt und nach bestimmten Kriterien angeordnet sind. Die Auswahl der Artikel mit Hilfe eines Begutachtungsverfahrens stellt eine eigene persönliche geistige Schöpfung des Herausgebers dar.
2. Durch die Übernahme des Inhalts einer Fachzeitschrift in eine Online-Datenbank wird das Urheberrecht des Herausgebers am Sammelwerk verletzt, wenn nicht nur sämtliche Beiträge der Zeitschrift übernommen werden, sondern auch das Gliederungs- und Zitiersystem nach Heft, Band und Artikel, wodurch die Auswahl der Artikel und das vom Herausgeber geschaffene Anordnungssystem zum Ausdruck kommt, und zwar erkennbar in der Form, wie er die Zusammenstellung vorgenommen hat. (Leitsätze von GRUR-RR 2008 Heft 8-9, S. 276)
OLG Hamm, Urteil vom 26. 2. 2008 - 4 U 157/07 (Online-Veröffentlichung)
Zu den Hintergründen (Mathematik-Professor der Uni Bielefeld vs. Springer Verlag) siehe die Urteils-Anmerkung von Ulrike Verch:
http://www.jurpc.de/aufsatz/20080088.htm
Die Entscheidung, die auch en passant die Open-Access-Problematik anspricht, ist im Ergebnis höchst problematisch, da sie "Herausgeber-Patriarchen" ein antiquiertes Urheberrecht nach § 4 UrhG, das 70 Jahre nach dem Tod währt, zuspricht. Weder die Auswahl noch die Anordnung der Artikel eines Zeitschriftenbandes überschreitet meines Erachtens die Grenze der "Kleinen Münze".
Herausgeber erhalten damit ein Vetorecht zugesprochen, das die freie wissenschaftliche Kommunikation und die erwünschte Retrodigitalisierung von Zeitschriftenjahrgängen behindern kann. Im entschiedenen Fall ging es darum, dass der Herausgeber offenbar in erheblichem Umfang finanziell von seiner Herausgebertätigkeit profitierte. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass der von Harnad und Suber verbreitete Open-Access-Mythos unzutreffend ist, Open Access beziehe sich nur auf "give-away"-Inhalte bzw. bei dem Zeitschriftenwesen handle es sich um solche Inhalte. Open Access muss sich auf diejenigen Inhalte beziehen, die essentiell für den aktuellen Fortschritt einer Disziplin wichtig sind. Profit-Interessen von Autoren oder Herausgebern kann dabei kein entscheidendes Veto-Recht zukommen.
Für Verlage stellt sich bei der Retrodigitalisierung die Frage, ob sie tatsächlich mit den zuständigen Herausgebern "buy-out"-Verträge abgeschlossen haben, die es ihnen ab dem 1.1.2009 ermöglichen, vom § 137 L UrhG Gebrauch zu machen. Störrische alte Männer können sich in der Tat als "Hemmschuh" bei der Online-Verbreitung erweisen. Neben der für die Verlage ärgerlichen Autoren-Front zieht womöglich auch eine Herausgeber-Front herauf.
Die Zuordnung der persönlichen geistigen Schöpfung zum alleinigen Herausgeber dürfte auch kaum die Regel sein und hat vermutlich weitgehend fiktiven Charakter. Die Anordnung der Aufsätze in einer mathematischen Zeitschrift folgt in der Regel gängigen Konventionen (z.B. einer eingeführten Gliederung nach Teilgebieten), und die Verteilung auf die einzelnen Hefte resultiert vor allem aus der Schnelligkeit der Begutachtung, da im wissenschaftlichen Publikationswesen ein möglichst rasches Erscheinen wichtig ist. Es verbleibt also allein die Entscheidung über die Aufnahme des Beitrags als "schöpferisches" Moment. Hier wird dem Beurteilungsspielraum des Herausgebers zu viel Gewicht zugemessen, denn letztlich ist der Entscheidungsprozess ein "Gemeinschaftswerk" von Herausgeber/n und Gutachtern, dessen "kreativer Gehalt" im Einzelfall nicht zu überschätzen ist. Daher geht der von GRUR-RR formulierte Leitsatz Nr. 1 zu weit.
Ganz und gar verfehlt ist die Argumentation des Gerichts mit der Übernahme der Zitation. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es bei einer Online-Datenbank (ob Open Access oder nicht) ganz und gar unverzichtbar, den ursprünglichen Druckort anzugeben. Hier hätte das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit in die Waagschale geworfen werden müssen. Selbstverständlich ist durch eine Reihe von Zitationen, etwa in einer Bibliographie, der Gesamtinhalt und die Abfolge der Aufsätze rekonstruierbar.
Es stellt sich damit die Frage, ob die Vervielfältigung des Inhaltsverzeichnisses, das ja die angebliche schöpferische Leistung des Herausgebers verkörpert, dann nicht auch konsequenterweise dem Verbotsrecht des Herausgebers/Verlags unterfallen muss. Dies wird aus guten Gründen allgemein abgelehnt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Inhaltsmitteilung#Zul.C3.A4ssigkeit_von_Inhaltsverzeichnissen
Den Ausführungen des OLG Hamm lässt sich nicht entnehmen, dass nicht bereits der einzelne Jahrgang einer wissenschaftlichen Zeitschrift als Sammelwerk geschützt ist. Für Open Access hat das die verhängnisvolle Folge, dass eine im wesentlichen vollständige Sammlung selbstarchivierter Beiträge eines Jahrgangs, die den originalen Druckort angibt, dem Verbotsrecht des Rechteinhabers unterfallen kann. Dieser könnte auch dann die Einstellung auf ein und demselben Repositorium oder womöglich auch das Harvesten von verschiedenen Repositorien als Urheberrechtsverletzung verfolgen. Üblicherweise ist der Rechteinhaber ein Verlag, der somit Open Access für einen ganzen Zeitschriftenband blockieren kann, auch wenn er die Einstellung des einzelnen Beitrags weder verhindern kann noch will.
Beispiel: Ein Zeitschriftenjahrgang besteht aus 5 Artikeln, die von den Autoren (ggf. nach Ablauf der Einjahresfrist des § 38 UrhG) unter eine CC-Lizenz gestellt und in verschiedenen Repositorien veröffentlicht werden. Der Band wird (mit Quellenangaben) auf einem Repositorium aufgrund der CC-Lizenz zusammengeführt und ist - nach der Logik des OLG Hamm - als Ganzes aufgrund der Quellenangaben rekonstruierbar. Diese Online-Zugänglichkeit griffe in das Recht der Herausgeber ein, die ihre Rechte dem Verlag übertragen haben. Nur wenn (was für deutsche Verlage keinesfalls die Regel ist) der Verlag eine generelle (positive) Aussage zu "grünem" Open Access (self-archiving) getroffen hat, kann er nicht gegen die Abbildung des Zeitschrifteninhalts vorgehen. Liegen die Herausgeberrechte nicht beim Verlag, so können diese Open Access verhindern bzw. die Verpflichtung, sie zusätzlich ins Boot zu holen, wirkt als weitere Erschwernis.
Aber um es nochmals klar zu machen: Die unerwünschten Konsequenzen für OA sind nicht der Grund, das Urteil bzw. den Leitsatz zu verwerfen. Der Grund ist die verfehlte Annahme einer persönlichen geistigen Schöpfung des Herausgebers in der von GRUR-RR gewählten Generalisierung.
KlausGraf - am Dienstag, 16. Dezember 2008, 22:12 - Rubrik: Archivrecht
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/hamm/j2008/4_U_154_07urteil20080207.html
Dass Mitbewerber keine ungeschwärzten rechtskräftigen Urteile über andere am Wettbewerb Teilnehmende veröffentlichen dürfen, schlägt der vom Gesetzgeber gewollten Öffentlichkeit in Gerichtsverfahren und der Transparenz in Sachen Verbraucherschutz ins Gesicht. Firmen, die unrechtmäßig handeln, sind nicht wie Straftäter zu behandeln, deren Rehabilitationsinteresse und Persönlichkeitsrechte hohes Gewicht haben.
Dass Mitbewerber keine ungeschwärzten rechtskräftigen Urteile über andere am Wettbewerb Teilnehmende veröffentlichen dürfen, schlägt der vom Gesetzgeber gewollten Öffentlichkeit in Gerichtsverfahren und der Transparenz in Sachen Verbraucherschutz ins Gesicht. Firmen, die unrechtmäßig handeln, sind nicht wie Straftäter zu behandeln, deren Rehabilitationsinteresse und Persönlichkeitsrechte hohes Gewicht haben.
KlausGraf - am Dienstag, 16. Dezember 2008, 21:15 - Rubrik: Archivrecht
Julia Bolton Holloway wrote in MEDTEXTL@listserv.illinois.edu:
I was visiting Simon Keynes in Cambridge today, and Tim Bolton, Sotheby's
specialist in medieval manuscripts, came for lunch. He told the few present
people about a late 14th-century English manuscript, sold 9 days ago to a
dealer on the Continent. The manuscript (for the catalogue description
follow the link below) contains inter alia a hitherto unknown version of
Encomium Emmae, a few unique prophecies and apparently the fullest version
of Gildas. [...]
http://www.sothebys.com/app/live/lot/LotDetail.jsp?sale_number=L08241&live_lot_id=31
M. O. Doherty wrote:
The MS in question, in case anyone else is interested in putting up a show of resistance, appears to be Exeter, Devon Record Office, Courtenay 1508 M Devon add/SS 11/1 . The sale comes as a very unpleasant shock; I've looked at this manuscript a couple of times over the last year or so and did not realise that it was not owned by Devon RO but (according to the sale catalogue) by the Earl of Devon. A reason (I think) that this MS is not better known is that the collection is not catalogued in any detail in an easily accessible catalogue (see the A2A record for this collection, in which this volume is not mentioned - http://www.nationalarchives.gov.uk/a2a/records.aspx?cat=027-d1508m&cid=-1 ).
This is an important MS, relevant to the locality where it is housed and is -- or has been until recently -- housed in a good archive where it is readily accessible to researchers (http://www.devon.gov.uk/record_office.htm ). To allow it to pass into private hands overseas seems very much a retrograde step.
I was visiting Simon Keynes in Cambridge today, and Tim Bolton, Sotheby's
specialist in medieval manuscripts, came for lunch. He told the few present
people about a late 14th-century English manuscript, sold 9 days ago to a
dealer on the Continent. The manuscript (for the catalogue description
follow the link below) contains inter alia a hitherto unknown version of
Encomium Emmae, a few unique prophecies and apparently the fullest version
of Gildas. [...]
http://www.sothebys.com/app/live/lot/LotDetail.jsp?sale_number=L08241&live_lot_id=31
M. O. Doherty wrote:
The MS in question, in case anyone else is interested in putting up a show of resistance, appears to be Exeter, Devon Record Office, Courtenay 1508 M Devon add/SS 11/1 . The sale comes as a very unpleasant shock; I've looked at this manuscript a couple of times over the last year or so and did not realise that it was not owned by Devon RO but (according to the sale catalogue) by the Earl of Devon. A reason (I think) that this MS is not better known is that the collection is not catalogued in any detail in an easily accessible catalogue (see the A2A record for this collection, in which this volume is not mentioned - http://www.nationalarchives.gov.uk/a2a/records.aspx?cat=027-d1508m&cid=-1 ).
This is an important MS, relevant to the locality where it is housed and is -- or has been until recently -- housed in a good archive where it is readily accessible to researchers (http://www.devon.gov.uk/record_office.htm ). To allow it to pass into private hands overseas seems very much a retrograde step.
KlausGraf - am Dienstag, 16. Dezember 2008, 19:23 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
ICA-AtoM (International Council on Archives - Access to Memory) is a free and open source platform for sharing metadata about archival collections, as well as digital objects of the archival items.
http://www.ica-atom.org/
http://www.ica-atom.org/
KlausGraf - am Dienstag, 16. Dezember 2008, 18:15 - Rubrik: English Corner
http://medinfo.netbib.de/archives/2008/12/16/2933 setzt sich mit einem Aufsatz von Krichel auseinander.
KlausGraf - am Dienstag, 16. Dezember 2008, 18:10 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Dr. Matthias Manke widmet sich im Nordkurier der Archivierung elektronischer Akten im Mecklenburg-Vorpommern.
Wolf Thomas - am Dienstag, 16. Dezember 2008, 17:00 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... So wird fanfiction.net von Spöttern "The Pit" genannt. Sie bezeichnen das Archiv als Grube, in die jeder nach Belieben Eingebungen und Empfindungen ablassen kann. ...."
Quelle:
http://www.taz.de/1/leben/medien/artikel/1/mein-homer-dein-homer/
Link zur Seite: http://www.fanfiction.net/
Quelle:
http://www.taz.de/1/leben/medien/artikel/1/mein-homer-dein-homer/
Link zur Seite: http://www.fanfiction.net/
Wolf Thomas - am Dienstag, 16. Dezember 2008, 16:57 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein ausführlicher Artikel gibt einen Überblick über Probleme und Reaktionen:
http://www.washwriter.org/FWFNew/news.html
http://www.washwriter.org/FWFNew/news.html
KlausGraf - am Dienstag, 16. Dezember 2008, 11:56 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://portraitsammlung.ub.uni-koeln.de/
Die USB Köln besitzt eine ansehnliche Sammlung von Porträts aus dem 16. bis 20. Jahrhundert. Die Porträts stammen aus den Sammlungen Oidtmann, Mevissen, Dirksen, Wolff und der ehemaligen Stadtbibliothek Köln. Es handelt sich um Kupfer- und Stahlstiche, Schabkunst, Lithografien, Radierungen und Fotografien. Die meisten der abgebildeten Personen aus den Beständen der Stadtbibliothek Köln sind auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit der Stadt und / oder dem Erzbistum Köln und dem Rheinland verbunden gewesen.
Die Porträts der Sammlungen Oidtmann und Mevissen zeigen Persönlichkeiten aus dem gesamten deutschen Reich und darüber hinaus. Das Spektrum umfasst Herrscher und Staatsmänner, Erz- und Weihbischöfe, Bischöfe, Pfarrer, Pastoren, Mönche, Äbte, Dichter, Musiker und Künstler, Wissenschaftler und Mäzene, Adelige und Feldherren.
Es gibt sogar einen RSS-Feed, und der Download der TIFF-Dateien ist möglich.

Weitere Porträt-Links in Auswahl
Die beste Linksammlung kommt von der NDB
http://www.ndb.badw-muenchen.de/eb_portraets.htm
Regensburger Porträtgalerie
http://rzbs4.bibliothek.uni-regensburg.de/tut/
Porträtsammlung Manskopf
http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/manskopf/
Virtuelles Kupferstichkabinett - Suche nach Porträt erbringt über 2300 Treffer
http://www.virtuelles-kupferstichkabinett.de/
Hans Burgkmair: Hans Baumgartner, 1512
Bildindex mit eigener Abteilung Ansichten und Porträts
http://www.bildindex.de
Atrium heroicum 1600/02
http://www.uni-mannheim.de/mateo/desbillons/eico.html
Poträtkupfer aus Rezensionszeitschriften des 18. Jahrhunderts
http://idrz18.adw-goettingen.gwdg.de/portraets.html
Naturwissenschaftler des 19. Jahrhunderts in 139 Porträts
http://www.wto-hg.com/Moeschler%20Website/index.htm
http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?idn=990767086
Ärgerlich dagegen die thumbnailgroßen Bilder der HU Berlin
http://allegro.ub.hu-berlin.de/portraet/
Update: UB Augsburg http://archiv.twoday.net/stories/5495486/
Update: Stadtmuseum München http://archiv.twoday.net/stories/6081633/
KlausGraf - am Dienstag, 16. Dezember 2008, 00:24 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
URN: urn:nbn:de:bsz:25-opus-61488
URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6148/
Graf, Klaus: Zur Frage einer Fulradzelle in Schwäbisch Gmünd, in: Gmünder Studien 2 (1979), S. 173-202
PDF mit OCR
Gab es in der Karolingerzeit eine von Abt Fulrad (gest. 784) gegründete klösterliche Niederlassung der Abtei Saint -Denis bei Paris in Schwäbisch Gmünd, wie dies die Erwähnung einer Zelle "Gamundias" in Alemannien in einer auf das Jahr 782 gefälschten Urkunde Karls des Großen (DKar. 238) nahezulegen scheint? Eine eindeutige Entscheidung der Frage ist nicht möglich ("non liquet"). Der Aufsatz argumentiert gegen die Überbetonung politischer Motive der Zellengründungen Fulrads, erörtert diplomatische Fragen und prüft - mit negativem Ergebnis - die Aussagekraft der Namen zweier spätmittelalterlicher Wüstungen "Volratsweiler" bei Untergröningen bzw. bei Böhmenkirch. Ein kurzer Exkurs behandelt "Saint-Denis und die alemannischen Fulradzellen im hohen und späten Mittelalter" (S. 180f.).
Siehe dazu:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/gdabst.htm
http://de.wikisource.org/wiki/Schwäbisch_Gmünd#Fulradzelle
URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6148/
Graf, Klaus: Zur Frage einer Fulradzelle in Schwäbisch Gmünd, in: Gmünder Studien 2 (1979), S. 173-202
PDF mit OCR
Gab es in der Karolingerzeit eine von Abt Fulrad (gest. 784) gegründete klösterliche Niederlassung der Abtei Saint -Denis bei Paris in Schwäbisch Gmünd, wie dies die Erwähnung einer Zelle "Gamundias" in Alemannien in einer auf das Jahr 782 gefälschten Urkunde Karls des Großen (DKar. 238) nahezulegen scheint? Eine eindeutige Entscheidung der Frage ist nicht möglich ("non liquet"). Der Aufsatz argumentiert gegen die Überbetonung politischer Motive der Zellengründungen Fulrads, erörtert diplomatische Fragen und prüft - mit negativem Ergebnis - die Aussagekraft der Namen zweier spätmittelalterlicher Wüstungen "Volratsweiler" bei Untergröningen bzw. bei Böhmenkirch. Ein kurzer Exkurs behandelt "Saint-Denis und die alemannischen Fulradzellen im hohen und späten Mittelalter" (S. 180f.).
Siehe dazu:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/gdabst.htm
http://de.wikisource.org/wiki/Schwäbisch_Gmünd#Fulradzelle
KlausGraf - am Montag, 15. Dezember 2008, 22:04 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://e-culture.multimedian.nl/demo/search
Via
http://archieven.blogspot.com/2008/12/e-culture-multimedian-zoekmachina.html

Via
http://archieven.blogspot.com/2008/12/e-culture-multimedian-zoekmachina.html

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Jean Claude Périsset ist seit Oktober 2007 apostolischer Nuntius in Deutschland. ..... Am 20. November war der Erzbischof zu Gast im Kolping-Bundessekretariat in Köln. .... Der Nuntius besuchte auch das Archiv des Kolpingwerkes. Hier besichtigte Erzbischof Périsset Orignialbriefe Adolph Kolpings, sein Tagebuch und sein Brevier. ..."
Quelle: Link
Quelle: Link
Wolf Thomas - am Montag, 15. Dezember 2008, 21:34 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Ich gehe in die amerikanische Geschichte ein! Über 30 Jahre habe ich Politik unterrichtet und nun wird mein Name im Archiv aufbewahrt."
Linda Gunter, demokratische US-Wahlfrau
Quelle:
http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/21/0,3672,7489621,00.html
Linda Gunter, demokratische US-Wahlfrau
Quelle:
http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/21/0,3672,7489621,00.html
Wolf Thomas - am Montag, 15. Dezember 2008, 21:32 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
„Er war einer der innovativsten Köpfe der Unterhaltungsbranche in den sechziger und siebziger Jahren. .... Vor allem die suggestive Bildsprache seiner Filmportraits diente vielen Regisseuren als Vorbild. Lange vor dem Zeitalter der Videoclips setzte Branss aufwändige Lichteffekte und schnelle Schnitte ein. "
Mehr war/ist zur Bedeutung in allen Quellen (s. u.) nicht zu entnehmen. Das Bildmaterial dokumentiert die deutsche Schlagergeschichte - Branss war Schöpfer der ZDF-Hitparade.
Quellen zu Truck Branss
http://www.netzeitung.de/kultur/328171.html
http://www.sr-online.de/dersr/117/340308-print.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Truck_Branss
Mehr war/ist zur Bedeutung in allen Quellen (s. u.) nicht zu entnehmen. Das Bildmaterial dokumentiert die deutsche Schlagergeschichte - Branss war Schöpfer der ZDF-Hitparade.
Quellen zu Truck Branss
http://www.netzeitung.de/kultur/328171.html
http://www.sr-online.de/dersr/117/340308-print.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Truck_Branss
Wolf Thomas - am Montag, 15. Dezember 2008, 21:30 - Rubrik: Medienarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/newsticker/Vor-25-Jahren-Informationelle-Selbstbestimmung-wird-Grundrecht--/meldung/120428
BVerfGE 65, 1 Volkszählungs-Urteil:
http://www.servat.unibe.ch/law/dfr/bv065001.html
BVerfGE 65, 1 Volkszählungs-Urteil:
http://www.servat.unibe.ch/law/dfr/bv065001.html
KlausGraf - am Montag, 15. Dezember 2008, 18:55 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 15. Dezember 2008, 18:54 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Verzeichnet in einem Findmittel der MGH-Bibliothek
http://www.mgh-bibliothek.de/etc/dokumente/handschriftenarchiv_borst.pdf
http://www.mgh-bibliothek.de/etc/dokumente/handschriftenarchiv_borst.pdf
KlausGraf - am Montag, 15. Dezember 2008, 18:51 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://www.uni-hohenheim.de/pressemitteilung.html?&tx_ttnews[tt_news]=2419&cHash=e027c86f82
Die akademischen Lehrer an der Universität Hohenheim 1968-2005. Bearbeitet von Ulrich Fellmeth und Kathrin Quast, in: U. Fellmeth/H. Winkel (Hg.), Sonderband der Hohenheimer Themen – Zeitschrift für kulturwissenschaftliche Themen, Stuttgart-Hohenheim 2008. ISSN-Nummer 0942-5209. 12 €
Bedauerlicherweise nicht online. Professorenkataloge außerhalb des Internets sind reichlich nutzlos. Zur normalen Verbreitung der Zeitschrift Hohenheimer Themen kann man sich das Jahr 2008 in der Zeitschriftendatenbank ausgeben lassen: Außerhalb von BW werden nur Standorte in München, Berlin und Koblenz nachgewiesen.
Die akademischen Lehrer an der Universität Hohenheim 1968-2005. Bearbeitet von Ulrich Fellmeth und Kathrin Quast, in: U. Fellmeth/H. Winkel (Hg.), Sonderband der Hohenheimer Themen – Zeitschrift für kulturwissenschaftliche Themen, Stuttgart-Hohenheim 2008. ISSN-Nummer 0942-5209. 12 €
Bedauerlicherweise nicht online. Professorenkataloge außerhalb des Internets sind reichlich nutzlos. Zur normalen Verbreitung der Zeitschrift Hohenheimer Themen kann man sich das Jahr 2008 in der Zeitschriftendatenbank ausgeben lassen: Außerhalb von BW werden nur Standorte in München, Berlin und Koblenz nachgewiesen.
KlausGraf - am Montag, 15. Dezember 2008, 18:18 - Rubrik: Universitaetsarchive
http://www.ekd.de/archive/dokumente/AEA2008.pdf
Udo Wennemuth
Überlieferung und Erinnerungskultur der französisch-reformierten Gemeinde in Mannheim
Christoph Schmider
Die Überlieferung zur Ausländerseelsorge in Archiven der Erzdiözese Freiburg – Versuch eines Überblicks als Ausgangspunkt für die aktive Überlieferungssicherung
Bettina Wischhöfer
„Heut gehn wir ins Archiv“ – Erlebniswelt Landeskirchliches Archiv Kassel
Annett Büttner
Bericht über ein Schülerprojekt der Fliedner-Kulturstiftung zum Thema „Die Kaiserswerther Diakonie im 2. Weltkrieg“ im Rahmen des Wettbewerbs „Archiv und Jugend“ der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe
Udo Wennemuth
Elektronische Aktenführung – Dokumentenmanagementsysteme – Elektronische Archivierung
Manuela Nordmeyer-Fiege
Die Fotodatenbank des Landeskirchenamts Hannover
Michael Hofferberth
Nicht ohne Worte. Hinweise zur Verwaltung von archivischen Bildersammlungen
Gabriele Stüber und Sibylle Pirrung-Stickl
Bilder zum Sprechen bringen. Das Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der Pfalz als kirchliche Bildagentur
Hannelore Schneider
Der Thüringer ‚Kirchenarchivwart’. Zur Geschichte der Kirchenarchivpflege in Thüringen
Hannelore Schneider
Das Eisenacher Modell: Zur Erschließung historischer Bestände mit anderen Methoden in einer neuen Zeit
Johannes-Michael Scholz
Kirche im Eisenacher Oberland. Zum Projekt einer mikrohistorischen Dokumentation
Udo Wennemuth
Neubau eines Magazins für Archiv und Bibliothek der Evangelischen Landeskirche in Baden
Buchbesprechungen
Udo Wennemuth
Überlieferung und Erinnerungskultur der französisch-reformierten Gemeinde in Mannheim
Christoph Schmider
Die Überlieferung zur Ausländerseelsorge in Archiven der Erzdiözese Freiburg – Versuch eines Überblicks als Ausgangspunkt für die aktive Überlieferungssicherung
Bettina Wischhöfer
„Heut gehn wir ins Archiv“ – Erlebniswelt Landeskirchliches Archiv Kassel
Annett Büttner
Bericht über ein Schülerprojekt der Fliedner-Kulturstiftung zum Thema „Die Kaiserswerther Diakonie im 2. Weltkrieg“ im Rahmen des Wettbewerbs „Archiv und Jugend“ der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe
Udo Wennemuth
Elektronische Aktenführung – Dokumentenmanagementsysteme – Elektronische Archivierung
Manuela Nordmeyer-Fiege
Die Fotodatenbank des Landeskirchenamts Hannover
Michael Hofferberth
Nicht ohne Worte. Hinweise zur Verwaltung von archivischen Bildersammlungen
Gabriele Stüber und Sibylle Pirrung-Stickl
Bilder zum Sprechen bringen. Das Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der Pfalz als kirchliche Bildagentur
Hannelore Schneider
Der Thüringer ‚Kirchenarchivwart’. Zur Geschichte der Kirchenarchivpflege in Thüringen
Hannelore Schneider
Das Eisenacher Modell: Zur Erschließung historischer Bestände mit anderen Methoden in einer neuen Zeit
Johannes-Michael Scholz
Kirche im Eisenacher Oberland. Zum Projekt einer mikrohistorischen Dokumentation
Udo Wennemuth
Neubau eines Magazins für Archiv und Bibliothek der Evangelischen Landeskirche in Baden
Buchbesprechungen
KlausGraf - am Montag, 15. Dezember 2008, 17:40 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Für die Präsentation der Manuskripte der Vorträge im Internet wurde auf Bildmaterial und Anmerkungsapparat bewusst verzichtet. Diese Angaben und die ausgearbeiteten Texte sind der Druckfassung vorbehalten."
http://www.vda.archiv.net/index.htm?ungleichheiten.htm
http://www.vda.archiv.net/index.htm?ungleichheiten.htm
KlausGraf - am Montag, 15. Dezember 2008, 17:38 - Rubrik: Archivpaedagogik
http://www.archivtag.de/index.html?referate.htm
Dr. Sebastian Barteleit M.A., Bundesarchiv
Vertikale und horizontale Bestandserhaltung – Einige Überlegungen zum nachhaltigen Umgang mit knappen Ressourcen
Dr. Stefanie Berberich, Universitätsbibliothek Heidelberg
Bibliotheken als Partner im Landesrestaurierungsprogramm Baden-Württemberg – das Beispiel der Universitätsbibliothek Heidelberg
Dr. Martin Luchterhandt, Landesarchiv Berlin
Schutzmedien im technischen Wandel – Möglichkeiten und Konsequenzen für die archivische Praxis
Dr. Sebastian Barteleit M.A., Bundesarchiv
Vertikale und horizontale Bestandserhaltung – Einige Überlegungen zum nachhaltigen Umgang mit knappen Ressourcen
Dr. Stefanie Berberich, Universitätsbibliothek Heidelberg
Bibliotheken als Partner im Landesrestaurierungsprogramm Baden-Württemberg – das Beispiel der Universitätsbibliothek Heidelberg
Dr. Martin Luchterhandt, Landesarchiv Berlin
Schutzmedien im technischen Wandel – Möglichkeiten und Konsequenzen für die archivische Praxis
KlausGraf - am Montag, 15. Dezember 2008, 17:33 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.landeshauptarchiv-brandenburg.de/FilePool/NewsletterArchiv9_2008.pdf
Wir entnehmen daraus:
Das Brandenburgische Archivportal ist umgezogen
http://www.landeshauptarchiv-brandenburg.de/netCmsFrames.aspx?PageID=58&NavIndex=04.02
Informationen zur Novellierung des Personenstandsrechts
http://www.landeshauptarchiv-brandenburg.de/netCmsFrames.aspx?PageID=348&NavIndex=07.02
Wir entnehmen daraus:
Das Brandenburgische Archivportal ist umgezogen
http://www.landeshauptarchiv-brandenburg.de/netCmsFrames.aspx?PageID=58&NavIndex=04.02
Informationen zur Novellierung des Personenstandsrechts
http://www.landeshauptarchiv-brandenburg.de/netCmsFrames.aspx?PageID=348&NavIndex=07.02
KlausGraf - am Montag, 15. Dezember 2008, 17:17 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://melvyl.cdlib.org/
Man muss schon lange suchen, bis man auf ein vollständig einsehbares Buch stößt, an dem man sich die Einbindung des Viewers in den OPAC veranschaulichen kann. (Die Einbindung des Viewers erfolgt auch bei Vorschau-Büchern.)
Riedels Codex diplomaticus zeigt, dass das Problem der mehrbändigen Werke hier ebenfalls nicht bewältigt wird.
Im Viewer wird die Anzahl der Treffer einer Suche im Buch ausgegeben, und man kann den Ausschnitt stark vergrößern.
Auch im lokalen Worldcat ist die Ansicht möglich:
http://melvyl.worldcat.org/oclc/7883573
Die Suche im Buch im OPAC-Eintrag bietet übrigens auch MIRLYN (bezogen auf die Hathi Trust-Bücher):
http://mirlyn.lib.umich.edu/F/?func=direct&doc_number=001201817&local_base=MIU01_PUB
Man muss schon lange suchen, bis man auf ein vollständig einsehbares Buch stößt, an dem man sich die Einbindung des Viewers in den OPAC veranschaulichen kann. (Die Einbindung des Viewers erfolgt auch bei Vorschau-Büchern.)
Riedels Codex diplomaticus zeigt, dass das Problem der mehrbändigen Werke hier ebenfalls nicht bewältigt wird.
Im Viewer wird die Anzahl der Treffer einer Suche im Buch ausgegeben, und man kann den Ausschnitt stark vergrößern.
Auch im lokalen Worldcat ist die Ansicht möglich:
http://melvyl.worldcat.org/oclc/7883573
Die Suche im Buch im OPAC-Eintrag bietet übrigens auch MIRLYN (bezogen auf die Hathi Trust-Bücher):
http://mirlyn.lib.umich.edu/F/?func=direct&doc_number=001201817&local_base=MIU01_PUB
KlausGraf - am Montag, 15. Dezember 2008, 03:00 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Selbstverständlich können schöne historische Archivräume nicht mit den wundervollen Bibliotheken konkurrieren, die man in diesem Beitrag des ohnehin sehenswerten Weblogs Curious Expeditions bestaunen darf, wenngleich auch eine Archivbibliothek, die des Königlichen Hausarchivs der Niederlande, abgebildet ist. Ein kleiner Schwenk durch diese Archivbibliothek ist auch im Virtuellen Archivrundgang des Koninklijk Huisarchief zu besehen.

Welche sehenswerten historischen Archivräume gibt es? Im Internet gibt es meines Wissens keine Zusammenstellung. Ich selbst würde die Stadtarchive von Lüneburg und Mühlhausen aus eigener Anschauung als besonders eindrucksvoll ansehen. Sie sind in Thomas Justs Ansichtensammlung vertreten:
http://arcana.twoday.net/stories/4823338/
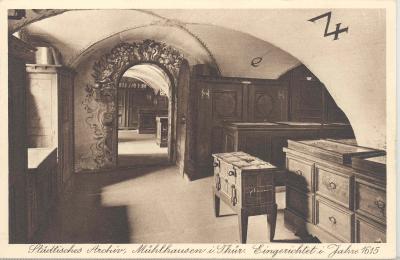 Reichsstädtisches Archiv Mühlhausen
Reichsstädtisches Archiv Mühlhausen  Modernes Farbfoto von muehlhausen.de
Modernes Farbfoto von muehlhausen.de
Von Just entdeckter Notgeldschein
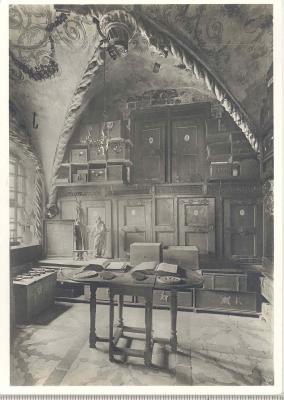 Stadtarchiv Lüneburg
Stadtarchiv LüneburgIm Dezember 2008 hat Just weitere Bilder mitgeteilt:
http://arcana.twoday.net/stories/5382336/
Wir entnehmen dem Beitrag eine Ansicht des Archivs der Abtei St. Walburg in Eichstätt
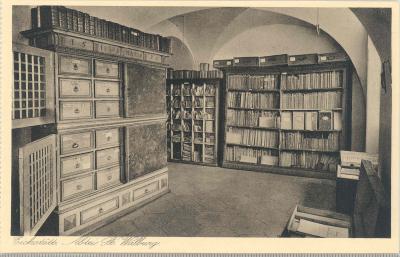
Ansonsten ist aus dem Web auf Anhieb nicht viel zu holen. Die Archivsektion auf Wikimedia Commons bietet fast nur Außenansichten. Immerhin gibt es zwei historische Ansichten von historischer Archiv-Ausstattung.

Aus Lünigs Deduktionenbibliothek 1717

Zeichnung eines Archivschranks im Staatsarchiv Würzburg
Aus dem Internet:
 Archivladen im Wiener Schottenstift
Archivladen im Wiener Schottenstift Archivraum im Staatsarchiv Luzern
Archivraum im Staatsarchiv LuzernModerne Archivbilder in Archivalia:
http://archiv.twoday.net/search?q=archivbild
Hinweis (ohne Bild) auf den spektakulären Salemer Archivraum
http://archiv.twoday.net/stories/3254173/
Wer hat weitere Hinweise?
Heute habe ich in den Tiefen meiner Bücherschränke ein sehr interessantes Büchlein von R[einhold] G[uent[h]er] Dannert, Betriebswirt, entdeckt: "Die Registratur". Erschienen 1929 bei der Organisation Verlagsgesellschaft m. b. H. S. Hirzel, Berlin, 142 Seiten.
Kennt jemand zufällig die Lebensdaten dieses Herrn? Falls das Buch gemeinfrei sein sollte, würde ich es nämlich gerne für Wikimedia Commons und/oder das Internet-Archiv scannen. DNB, GBV usw. wissen leider nichts dazu.
Inhalt:
A. Das Schriftgut
B. Die Verwaltung des Schriftgutes
1. Überlegungspunkte
a) Raum, b) Licht, c) Personal, d) Zeit, e) Kosten
2. Ordnung
a) Zweck, b) Methoden, c) Systeme
3. Registraturhilfsmittel
C. Wie richte ich meine Registratur ein?
1. Vorüberlegungen
2. Die Wahl der Hilfsmittel
3. Der Aufbau der Registratur
4. Die Behandlung
D. Schlußbetrachtung
Anhang: Literaturverzeichnis, Lieferantenverzeichnis, Schlagworte
Kennt jemand zufällig die Lebensdaten dieses Herrn? Falls das Buch gemeinfrei sein sollte, würde ich es nämlich gerne für Wikimedia Commons und/oder das Internet-Archiv scannen. DNB, GBV usw. wissen leider nichts dazu.
Inhalt:
A. Das Schriftgut
B. Die Verwaltung des Schriftgutes
1. Überlegungspunkte
a) Raum, b) Licht, c) Personal, d) Zeit, e) Kosten
2. Ordnung
a) Zweck, b) Methoden, c) Systeme
3. Registraturhilfsmittel
C. Wie richte ich meine Registratur ein?
1. Vorüberlegungen
2. Die Wahl der Hilfsmittel
3. Der Aufbau der Registratur
4. Die Behandlung
D. Schlußbetrachtung
Anhang: Literaturverzeichnis, Lieferantenverzeichnis, Schlagworte
Ladislaus - am Sonntag, 14. Dezember 2008, 23:26 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://fototeca.arhivelenationale.ro/
Über 1000 Fotos. Wer die Fotos nutzen will, muss in jedem Fall die Quelle angeben, wenn ich den Rechtevermerk recht verstehe - hieße demnach: er muss nicht um Erlaubnis fragen.

„Fototeca online a comunismului românesc”, Cota: 17/1965
Nachtrag: Die Fotos sind mit Quellenangabe frei nutzbar, siehe
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Commons:Village_pump&oldid=16968412#Romanian_National_Archives_Photos
Über 1000 Fotos. Wer die Fotos nutzen will, muss in jedem Fall die Quelle angeben, wenn ich den Rechtevermerk recht verstehe - hieße demnach: er muss nicht um Erlaubnis fragen.

„Fototeca online a comunismului românesc”, Cota: 17/1965
Nachtrag: Die Fotos sind mit Quellenangabe frei nutzbar, siehe
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Commons:Village_pump&oldid=16968412#Romanian_National_Archives_Photos
KlausGraf - am Sonntag, 14. Dezember 2008, 23:20 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://log.netbib.de/archives/2008/12/14/digitalisierung-der-medien-als-schwerpunktthema-des-kulturrates-2009/
Zitat aus der Stellungnahme des Kulturrats:
Durch die digitalen Medien und ihre weltweite Verfügbarkeit wird die Frage nach dem Wert kreativer Leistungen neu aufgeworfen. Inhalte sind vermeintlich ubiquitär verfügbar. Der Urheber der Inhalte gerät dabei oft in den Hintergrund. Der freie Zugang zu Inhalten lässt oftmals den Eindruck entstehen, dass die Angebote auch kostenfrei erstellt würden und daher gratis seien.
Forderungen nach „open access“ und der kostenfreien zur Verfügungstellung von Inhalten verstärken diese Entwicklung. Der freie Zugang zu Inhalten scheint zunächst eine demokratische Forderung zu sein, die zu mehr Teilhabe beitragen kann. Jedem Urheber steht es frei, seine Werke kostenfrei im Internet anzubieten. Letztlich ist „open access“ aber nur eine Option für diejenigen, deren Lebensunterhalt anderweitig gesichert ist und die deshalb keinen ökonomischen Nutzen aus der Verwertung ihrer Werke ziehen müssen. Urheber, die von der Verwertung ihrer Werke leben, haben Anspruch auf eine angemessene Vergütung.
http://www.kulturrat.de/detail.php?detail=1453&rubrik=4
Seit wann zahlen die an einem restriktiven Urheberrecht hauptsächlich interessierten Verwerter denn den Urhebern anständige Vergütungen? Die unsägliche Position des Kulturrats in Sachen Urheberrecht war schon des öfteren zu beobachten, zuletzt bei der Abschaffung der Panoramafreiheit.
Zitat aus der Stellungnahme des Kulturrats:
Durch die digitalen Medien und ihre weltweite Verfügbarkeit wird die Frage nach dem Wert kreativer Leistungen neu aufgeworfen. Inhalte sind vermeintlich ubiquitär verfügbar. Der Urheber der Inhalte gerät dabei oft in den Hintergrund. Der freie Zugang zu Inhalten lässt oftmals den Eindruck entstehen, dass die Angebote auch kostenfrei erstellt würden und daher gratis seien.
Forderungen nach „open access“ und der kostenfreien zur Verfügungstellung von Inhalten verstärken diese Entwicklung. Der freie Zugang zu Inhalten scheint zunächst eine demokratische Forderung zu sein, die zu mehr Teilhabe beitragen kann. Jedem Urheber steht es frei, seine Werke kostenfrei im Internet anzubieten. Letztlich ist „open access“ aber nur eine Option für diejenigen, deren Lebensunterhalt anderweitig gesichert ist und die deshalb keinen ökonomischen Nutzen aus der Verwertung ihrer Werke ziehen müssen. Urheber, die von der Verwertung ihrer Werke leben, haben Anspruch auf eine angemessene Vergütung.
http://www.kulturrat.de/detail.php?detail=1453&rubrik=4
Seit wann zahlen die an einem restriktiven Urheberrecht hauptsächlich interessierten Verwerter denn den Urhebern anständige Vergütungen? Die unsägliche Position des Kulturrats in Sachen Urheberrecht war schon des öfteren zu beobachten, zuletzt bei der Abschaffung der Panoramafreiheit.
KlausGraf - am Sonntag, 14. Dezember 2008, 23:11 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Diese Geschichte, die bislang als gesichert galt, wird seit einiger Zeit von einem Tübinger Stadtarchivar angezweifelt. Die Protagonisten der ersten Jahrhunderthälfte sind allerdings längst verstorben und so existieren für die Tübinger Variante nur mündlich überlieferte Erinnerungen Dritter. In einem Tübinger Café hat laut Recherchen des Archivars ein Konditor namens Erwin Hildenbrand 1930 die erste Schwarzwälder Kirschtorte gebacken. Der Zeuge ist ein damaliger Kollege. In Radolfzell weist man diese Geschichte jedoch weit von sich: Das dortige Stadtmuseum archiviert das Rezept von 1915 und verweist auch die Tübinger Geschichte ins Reich der Legenden. ....."
Quelle: Planet-Wissen (SWR)
Quelle: Planet-Wissen (SWR)
Wolf Thomas - am Sonntag, 14. Dezember 2008, 21:06 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Mein Vater war Unternehmensmakler in Düsseldorf. Seine Firma hatte ein eigenes Archiv, in dem ich einmal in den Ferien gearbeitet habe. Das war schon interessant. Man bekam mit, wie der Verkauf eines Unternehmens abläuft, und man konnte, wenn man Zeit hatte, in den Bilanzen lesen. ....."
Maximilian Zimmerer (50), seit 2006 Chef der Allianz, in der Tagesspiegelserie "mein erstes Geld"
Quelle:
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/;art271,2684925
Maximilian Zimmerer (50), seit 2006 Chef der Allianz, in der Tagesspiegelserie "mein erstes Geld"
Quelle:
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/;art271,2684925
Wolf Thomas - am Sonntag, 14. Dezember 2008, 20:40 - Rubrik: Wirtschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... 180 Kilometer Bohrstrecke lagern seit dem in Halle und werden seit 15 Jahren regelmäßig auch genutzt. „Der älteste Kern stammt aus der Zeit um 1930, das Gros wurde zwischen 1960 und 1980 erbohrt und der tiefste stammt aus 5 242 Metern“, erklärt Karl-Heinz Friedel, Leiter des Lagers. Wollte man diese landesbedeutsamen Bohrungen heute noch einmal durchführen, müsste man eine ganze Milliarde Euro aufwänden.
Eigentlich hauptsächlich Steine, die in Ein-Meter-Kisten verpackt ordentlich in Regalen sortiert sind, in 20 Reihen bis zu 50 Meter lang. Doch an dem Gebäude nagte der Zahn der Zeit und deshalb wurde es in den vergangenen Monaten für 517 000 Euro rekonstruiert. Dach, Elektrik, Heizung, Tore und die Brandschutzanlagen standen auf der Sanierungsliste, um die Visitenkarte des geologischen Untergrundes von Sachsen-Anhalt wieder „schmuck“ zu machen.
Die Kerne lagern aber nicht nur dort, sondern werden in einem Bohrarchiv auch beschrieben. Insgesamt 187 166 Bohrungen sind in Sachsen-Anhalt bekannt und weil sie auch wichtig für Baugrunduntersuchungen sind, gibt es eine Bohrdatenbank, die im Internet für jeden zugänglich ist. ...."
Quelle: Link
Eigentlich hauptsächlich Steine, die in Ein-Meter-Kisten verpackt ordentlich in Regalen sortiert sind, in 20 Reihen bis zu 50 Meter lang. Doch an dem Gebäude nagte der Zahn der Zeit und deshalb wurde es in den vergangenen Monaten für 517 000 Euro rekonstruiert. Dach, Elektrik, Heizung, Tore und die Brandschutzanlagen standen auf der Sanierungsliste, um die Visitenkarte des geologischen Untergrundes von Sachsen-Anhalt wieder „schmuck“ zu machen.
Die Kerne lagern aber nicht nur dort, sondern werden in einem Bohrarchiv auch beschrieben. Insgesamt 187 166 Bohrungen sind in Sachsen-Anhalt bekannt und weil sie auch wichtig für Baugrunduntersuchungen sind, gibt es eine Bohrdatenbank, die im Internet für jeden zugänglich ist. ...."
Quelle: Link
Wolf Thomas - am Sonntag, 14. Dezember 2008, 20:38 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Am 22. November hat ein nicht registrierter Benutzer ("IP") unsinnige Änderungen am Artikel über den Mainzer "Hof zum Gutenberg" vorgenommen, die vor mir niemand aufgefallen sind:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hof_zum_Gutenberg&diff=53293527&oldid=40969139
Den Artikel hat auch bisher niemand "gesichtet". Gerade bei kleinen und unbedeutenden Themen ist die Gefahr groß, dass ein solcher inhaltlicher Vandalismus stehen bleibt und Benutzer in die Irre führt.
Nachtrag: Felistoria hat entweder WP:FZW oder diesen Eintrag gelesen, denn nun ist es wieder richtig:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hof_zum_Gutenberg&action=history
Nachtrag:
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Church_of_emacs/gesichtete_Versionen/ohne
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hof_zum_Gutenberg&diff=53293527&oldid=40969139
Den Artikel hat auch bisher niemand "gesichtet". Gerade bei kleinen und unbedeutenden Themen ist die Gefahr groß, dass ein solcher inhaltlicher Vandalismus stehen bleibt und Benutzer in die Irre führt.
Nachtrag: Felistoria hat entweder WP:FZW oder diesen Eintrag gelesen, denn nun ist es wieder richtig:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hof_zum_Gutenberg&action=history
Nachtrag:
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Church_of_emacs/gesichtete_Versionen/ohne
Zu den größten Verlusten der Herzogin Anna Amalia Bibliothek (HAAB) <32> in
Weimar beim Brand vor vier Jahren gehörte die Musikaliensammlung der
Herzogin und der Großherzogin Maria Pawlowna: Über zweitausend Drucke und
siebenhundert Musikhandschriften sind neben den rund fünfzigtausend
Druckschriften den Flammen zum Opfer gefallen. Sechshundert der verbrannten
Musikalien, mehr als 20 % der ehemaligen Sammlung, stehen seit September 2008
wieder auf der Internet-Seite „Monographien Digital“ der Klassik Stiftung Weimar
zur Verfügung ( http://ora-web.klassik-stiftung.de/digimo_online/digimo.entry ). Die
Digitalisierung der wertvollen Stücke stützt sich auf die Mikrofilme, die in der Zeit vor
dem Brand bei der Bibliothek in Auftrag gegeben worden waren. Eine vollständige
und systematische Verfilmung der Musikaliensammlung konnte allerdings nicht mehr
rechtzeitig vor dem Brand realisiert werden (nach FAZ vom 16.09.2008).
Quelle: BSZW-Dialog
Weimar beim Brand vor vier Jahren gehörte die Musikaliensammlung der
Herzogin und der Großherzogin Maria Pawlowna: Über zweitausend Drucke und
siebenhundert Musikhandschriften sind neben den rund fünfzigtausend
Druckschriften den Flammen zum Opfer gefallen. Sechshundert der verbrannten
Musikalien, mehr als 20 % der ehemaligen Sammlung, stehen seit September 2008
wieder auf der Internet-Seite „Monographien Digital“ der Klassik Stiftung Weimar
zur Verfügung ( http://ora-web.klassik-stiftung.de/digimo_online/digimo.entry ). Die
Digitalisierung der wertvollen Stücke stützt sich auf die Mikrofilme, die in der Zeit vor
dem Brand bei der Bibliothek in Auftrag gegeben worden waren. Eine vollständige
und systematische Verfilmung der Musikaliensammlung konnte allerdings nicht mehr
rechtzeitig vor dem Brand realisiert werden (nach FAZ vom 16.09.2008).
Quelle: BSZW-Dialog
KlausGraf - am Sonntag, 14. Dezember 2008, 06:20 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Stadtarchiv und das Museum der Stadt Weinheim haben unter dem Titel
„Jüdische Spuren in Weinheim“ eine Datenbank mit Informationen über das
jüdische Leben in der Stadt und ihrer Umgebung im 20. Jahrhundert ins Internet
gestellt ( http://www.juden-in-weinheim.de ). Sie enthält u. a. die Namen von mehr als
1000 früheren jüdischen Bewohnern Weinheims, von denen viele im
Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Dazu kommen Hinweise auf
jüdische Vereine und Einrichtungen in der Stadt, Aufsätze und wissenschaftliche
Darstellungen der Geschichte der Weinheimer Juden sowie zahlreiche Fotos.
Via
http://opus.bsz-bw.de/swop/volltexte/2008/462/pdf//zkdial59.pdf
„Jüdische Spuren in Weinheim“ eine Datenbank mit Informationen über das
jüdische Leben in der Stadt und ihrer Umgebung im 20. Jahrhundert ins Internet
gestellt ( http://www.juden-in-weinheim.de ). Sie enthält u. a. die Namen von mehr als
1000 früheren jüdischen Bewohnern Weinheims, von denen viele im
Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Dazu kommen Hinweise auf
jüdische Vereine und Einrichtungen in der Stadt, Aufsätze und wissenschaftliche
Darstellungen der Geschichte der Weinheimer Juden sowie zahlreiche Fotos.
Via
http://opus.bsz-bw.de/swop/volltexte/2008/462/pdf//zkdial59.pdf
KlausGraf - am Sonntag, 14. Dezember 2008, 06:17 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.von-zeit-zu-zeit.de/
Gemeinsame Virtuelle Geschichtswerkstatt (vor allem Fotos) von Stuttgarter Zeitung und Stadtarchiv Stuttgart.

Gemeinsame Virtuelle Geschichtswerkstatt (vor allem Fotos) von Stuttgarter Zeitung und Stadtarchiv Stuttgart.

KlausGraf - am Sonntag, 14. Dezember 2008, 06:14 - Rubrik: Kommunalarchive
PDF aus dem Bibliotheksforum Bayern Juli 2008
KlausGraf - am Sonntag, 14. Dezember 2008, 06:04 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bei den Arbeiten zur Generalsanierung der sog. Gozzoburg in Krems/Donau (Niederösterreich) 2006/2007 kamen Fragmente eines Wandmalerei-Zyklus aus dem 13. Jahrhundert zum Vorschein, die von Gertrud Blaschitz (Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) als Szenen aus der 'Barlaam und Josaphat'-Erzählung identifiziert wurden.
http://www.handschriftencensus.de/news
http://www.oeaw.ac.at/shared/news/2008/press_inf_20080620.html
http://www.imareal.oeaw.ac.at/seiten/texte/barlaam.pdf

http://www.handschriftencensus.de/news
http://www.oeaw.ac.at/shared/news/2008/press_inf_20080620.html
http://www.imareal.oeaw.ac.at/seiten/texte/barlaam.pdf

KlausGraf - am Sonntag, 14. Dezember 2008, 05:10 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 14. Dezember 2008, 03:22 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.nichibun.ac.jp/graphicversion/dbase/database_e.html
42 Titel in europäischen Sprachen über Japan sind digitalisiert
1.
Montanus, Arnoldus. Atlas Japannensis. 1670.
2.
Montanus, Arnoldus. Ambassades mémorables de la Compagnie des Indes Orientales des provinces unies, vers les empereurs du Japon. 1680.
3.
Meister, George. Der orientalisch-indianische Kunst- und Lust-Gärtner. 1692.
4.
Pinto, Fernao Mendes. The voyages and adventures of Ferdinand Mendez Pinto. 1692.
5.
Kaempfer, Engelbert. The history of Japan. 2vols. 1727.
6.
Valentijn, François. Oud en nieuw Oost-Indiën. Vol. 1. 1727.
7.
Kaempfer, Engelbert. The history of Japan. 2vols. 1728.
8.
Kaempfer, Engelbert. De beschryving van Japan. 1729.
9.
Salmon, Thomas. Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del mondo. Vol. 2. 1734.
10.
Salmon, Thomas. Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren. Vol. 1. 1736.
11.
Crasset, Jean. Außführliche Geschicht der in dem äussersten Welt-Theil gelegenen japonesischen Kirch. 1738.
12.
Thunberg, Carl Peter. Travels in Europe, Africa, and Asia. Vol.3. 1776.
13.
Langsdorff, G. H. von. Voyages and travels in various parts of the world. 2vols. 1813-1814.
14.
Titsingh, Isaac. Illustrations of Japan. 1822.
15.
Fisscher, J. F. van, Overmeer. Bijdrage tot de kennis van het japansche rijk. 1833.
16.
MacFarlane, Charles. Japan. 1852.
17.
Siebold, Philipp Franz von. Nippon. 1852.
18.
Benyowsky, Maurice. Auguste, comte de. Memoirs and travels of Mauritius Augustus Count de Benyowsky. 2vols. 1790..
19.
Langsdorff, G. H. von. Bemerkungen auf einer Reise um die Welt in den Jahren 1803 bis 1807. 2vols. 1812.
20.
Hall, Basil. Account of a voyage of discovery to the west coast of Corea, and the Great Loo-Choo Island.. 1818.
21.
Taylor, Isaac. Scenes in Asia.. 1826.
22.
Pinto, Mendez. The voyages and adventures of Ferdinand Mendez Ponto. 1653.
23.
Caron, François. A ture description of the mighty kinddoms of Japan and Siam. 1671.
24.
Kaempfer, Engelbert. Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V. 1712.
25.
Anson, George. A voyage round the world in the years MDCCXL, I, II, III, IV. 14th ed. 1769.
26.
Thunberg, Carl Peter. Travels in Europe, Africa, and Asia, made between the years 1770 and 1779. 3rd ed. 4vols. 1796.
27.
Doeff, Hendrik. Herinneringen uit Japan. 1833.
28.
Anonymous, . Diversi avisi particolari dall'Indie di Portogallo.. 1558.
.
Anonymous, . Nvovi avisi dell'Indie di Portogallo. 1559.
29.
Anonymous, . Epistolae Indicae et Japanicae. 1570.
30.
Valignano, Alessandro. Novveavx advis de l'estat dv christianisme es pays et royavlmes des Indes Orientales & Iappon. 1582.
31.
Maffei, Giovanni Pietro. De vita et morib. Ignatii Loiolae. 1585.
32.
Maffei, Giovanni Pietro. Kurtze Verzeichnusz und historische Beschreibung. 1586.
33.
Maffei, Giovanni Pietro. Selectarvm Epistolarvm ex India libri qvatvor. 1588.
.
Maffei, Giovanni Pietro. Io Petri Maffeiigomatis e Societate Iesv historiarvm Indicarvm libri xvi. 1589.
34.
Maffei, Giovanni Pietro. Le historie delle Indie orientali. 1589.
35.
Maffei, Giovanni Pietro. Le istorie delle Indie orientali. 1589.
36.
Francis Xavier, Saint. Francisci Xaverii epistolarvm, libri qvatvor. 1600.
37.
Kaempfer, Engelbert. Geschichte und Beschreibung von Japan. 1777. vol1.. 1777.
38.
Kaempfer, Engelbert. Geschichte und Beschreibung von Japan. 1779. vol2.. 1779.
39.
Kruzenshtern, Ivan Fedorovich. Voyage round the world. 2 vols. 1813.. 1813.
40.
Marini, Gio. Filippo de. Historia et relatione del Tunchino e del Giappone. 1665.. 1665.
41.
Rodrigues Giram, Joäo. Lettera annva del Giappone. 1615.. 1615.
42.
Thunberg, Carl Peter.. Flora Japonica. 1784.. 1784.
42 Titel in europäischen Sprachen über Japan sind digitalisiert
1.
Montanus, Arnoldus. Atlas Japannensis. 1670.
2.
Montanus, Arnoldus. Ambassades mémorables de la Compagnie des Indes Orientales des provinces unies, vers les empereurs du Japon. 1680.
3.
Meister, George. Der orientalisch-indianische Kunst- und Lust-Gärtner. 1692.
4.
Pinto, Fernao Mendes. The voyages and adventures of Ferdinand Mendez Pinto. 1692.
5.
Kaempfer, Engelbert. The history of Japan. 2vols. 1727.
6.
Valentijn, François. Oud en nieuw Oost-Indiën. Vol. 1. 1727.
7.
Kaempfer, Engelbert. The history of Japan. 2vols. 1728.
8.
Kaempfer, Engelbert. De beschryving van Japan. 1729.
9.
Salmon, Thomas. Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del mondo. Vol. 2. 1734.
10.
Salmon, Thomas. Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren. Vol. 1. 1736.
11.
Crasset, Jean. Außführliche Geschicht der in dem äussersten Welt-Theil gelegenen japonesischen Kirch. 1738.
12.
Thunberg, Carl Peter. Travels in Europe, Africa, and Asia. Vol.3. 1776.
13.
Langsdorff, G. H. von. Voyages and travels in various parts of the world. 2vols. 1813-1814.
14.
Titsingh, Isaac. Illustrations of Japan. 1822.
15.
Fisscher, J. F. van, Overmeer. Bijdrage tot de kennis van het japansche rijk. 1833.
16.
MacFarlane, Charles. Japan. 1852.
17.
Siebold, Philipp Franz von. Nippon. 1852.
18.
Benyowsky, Maurice. Auguste, comte de. Memoirs and travels of Mauritius Augustus Count de Benyowsky. 2vols. 1790..
19.
Langsdorff, G. H. von. Bemerkungen auf einer Reise um die Welt in den Jahren 1803 bis 1807. 2vols. 1812.
20.
Hall, Basil. Account of a voyage of discovery to the west coast of Corea, and the Great Loo-Choo Island.. 1818.
21.
Taylor, Isaac. Scenes in Asia.. 1826.
22.
Pinto, Mendez. The voyages and adventures of Ferdinand Mendez Ponto. 1653.
23.
Caron, François. A ture description of the mighty kinddoms of Japan and Siam. 1671.
24.
Kaempfer, Engelbert. Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V. 1712.
25.
Anson, George. A voyage round the world in the years MDCCXL, I, II, III, IV. 14th ed. 1769.
26.
Thunberg, Carl Peter. Travels in Europe, Africa, and Asia, made between the years 1770 and 1779. 3rd ed. 4vols. 1796.
27.
Doeff, Hendrik. Herinneringen uit Japan. 1833.
28.
Anonymous, . Diversi avisi particolari dall'Indie di Portogallo.. 1558.
.
Anonymous, . Nvovi avisi dell'Indie di Portogallo. 1559.
29.
Anonymous, . Epistolae Indicae et Japanicae. 1570.
30.
Valignano, Alessandro. Novveavx advis de l'estat dv christianisme es pays et royavlmes des Indes Orientales & Iappon. 1582.
31.
Maffei, Giovanni Pietro. De vita et morib. Ignatii Loiolae. 1585.
32.
Maffei, Giovanni Pietro. Kurtze Verzeichnusz und historische Beschreibung. 1586.
33.
Maffei, Giovanni Pietro. Selectarvm Epistolarvm ex India libri qvatvor. 1588.
.
Maffei, Giovanni Pietro. Io Petri Maffeiigomatis e Societate Iesv historiarvm Indicarvm libri xvi. 1589.
34.
Maffei, Giovanni Pietro. Le historie delle Indie orientali. 1589.
35.
Maffei, Giovanni Pietro. Le istorie delle Indie orientali. 1589.
36.
Francis Xavier, Saint. Francisci Xaverii epistolarvm, libri qvatvor. 1600.
37.
Kaempfer, Engelbert. Geschichte und Beschreibung von Japan. 1777. vol1.. 1777.
38.
Kaempfer, Engelbert. Geschichte und Beschreibung von Japan. 1779. vol2.. 1779.
39.
Kruzenshtern, Ivan Fedorovich. Voyage round the world. 2 vols. 1813.. 1813.
40.
Marini, Gio. Filippo de. Historia et relatione del Tunchino e del Giappone. 1665.. 1665.
41.
Rodrigues Giram, Joäo. Lettera annva del Giappone. 1615.. 1615.
42.
Thunberg, Carl Peter.. Flora Japonica. 1784.. 1784.
KlausGraf - am Sonntag, 14. Dezember 2008, 03:02 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.otaru-uc.ac.jp/htosyo1/siryo/yosho/Y-tyr2.htm
Darunter auch ein Druck von Johann Georg Leib 1708:
http://www.otaru-uc.ac.jp/htosyo1/siryo/yosho/pdf/YR030005_1.pdf
Zu weiteren japanischen digitalen Sammlungen siehe
http://archiv.twoday.net/stories/4575784/
Darunter auch ein Druck von Johann Georg Leib 1708:
http://www.otaru-uc.ac.jp/htosyo1/siryo/yosho/pdf/YR030005_1.pdf
Zu weiteren japanischen digitalen Sammlungen siehe
http://archiv.twoday.net/stories/4575784/
KlausGraf - am Sonntag, 14. Dezember 2008, 02:52 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Update to http://archiv.twoday.net/search?q=cardiff
Received from the Cardiff Heritage Friends:
A number of people have been asking what has happened regarding the proposed sale of Cardiff Public Library’s rare-books collections. The following is an update on the situation as of 13 December 2008.
Following intense public and political pressure, Cardiff Council agreed in late September to enter ‘round-table’ discussions regarding the future of the special collections of rare books it was going to sell. The discussions were to be chaired by CyMAL (the Welsh Assembly Government’s museums, archives and libraries division), and to include representatives from Cardiff University, the National Library of Wales and Glamorgan Record Office.
The first meeting of that group was held on 7 October, when all parties agreed (according to a press release issued by the Welsh Assembly Government on 8 October) to “work together to identify which items from the collection should be recommended to be retained in Wales”.
The Cardiff Heritage Friends have produced a statement responding to that press release, welcoming the ‘round-table’ discussions and emphasising the importance of retaining these special collections intact as collections in Cardiff, rather than ‘cherry-picking’ individual items.
As a result of that ‘round-table’ meeting of 7 October, the first auction of books, scheduled for 4 November at Bonhams, London, was postponed, and Councillor Nigel Howells (the Executive Member of Cardiff Council responsible for libraries) informed a Council meeting on 16 October that the 'round-table' parties had “agreed to meet again shortly to discuss the proposals in greater detail. Until this process has been finalised and implemented it has been agreed that no books will be sold."
Despite agreeing “to meet again shortly”, there have been no further formal meetings to date. The next meeting is to be held on Monday, 15 December. There are, therefore, at present no definite proposals in the public domain to which to respond.
The perception among the public at large – judging from comments in the press and those received from individuals – is that Cardiff Council has ‘seen reason’ and that the books have been 'saved'. This is far from being the case as yet! Indeed, as far as one can gather, it still seems to be the Council’s intention to sell a substantial number of these rare books as soon as possible.
It appears, from what one hears down the grape-vine, that Council officials are actively planning to auction the first batch of books at Bonhams in February/March 2009. The reason seems to be that they need to raise the monies allocated in this year’s Council budget from the sale of the books in order to meet the Public Library’s current financial commitments (and this despite the fact that Cardiff Council, according to the Western Mail of 25 October 2008, has £40 million in reserve funds, and almost £10 million of that unallocated!).
Much will depend on the outcome of the second ‘round-table’ meeting on 15 December, but as things are developing at present, it is quite possible there will be need for a second round of campaigning early in the new year – which will be a particularly unfortunate time for Cardiff Council to attract further bad publicity, since a spring auction in Bonhams will coincide quite closely with the opening of Cardiff’s new Central Library building!
***
Statement by Cardiff Heritage Friends in response to the ‘way ahead’ announced following round-table discussions on 7 October 2008
regarding the Cardiff City Library’s Special Collections
Cardiff Heritage Friends warmly welcomes the decision of Cardiff Council to enter round-table discussions with CyMAL (the Welsh Assembly Government’s museums, archives and libraries division), Cardiff University, the National Library of Wales and Glamorgan Record Office regarding the future of its special collections of rare books, and to postpone the sale of these books while discussions are in progress.
We wish to take this opportunity to thank all those who have helped bring about this encouraging development, including politicians from all parties. We are particularly grateful to the hundreds of Cardiff citizens who have contacted the Council and their elected representatives to express their opposition to the sale, and to the numerous individuals and organisations across Wales, and indeed much further afield, who have raised their voice in protest at the proposed destruction of a heritage collection of national and international significance.
While welcoming the current round-table discussions, there is one matter of concern arising from the press release of 8 October 2008 which announced the ‘way ahead’ that was agreed at the first round-table meeting.
The emphasis in that press release seems to be upon collaborating to ensure that ‘items’ of national and cultural significance are retained in Wales, rather than on ensuring that these important collections are retained intact in Cardiff.
The vast majority of the rare books in question were obtained by Cardiff Central Library, not as individual items but either:
(a) as part of a collection donated to the Library by a prominent figure in the life of Cardiff/Wales; or else:
(b) purchased through public subscription in order to build up specialist collections (e.g., the collection of representative items from rare Continental presses; the collection of early printed Bibles, etc.).
If, as the press release seems to suggest, the importance of individual items will be the paramount factor in deciding their fate, such cherry-picking of items will destroy the Library’s special collections as collections, with all the prestige, ‘critical mass’ and research potential such collections afford.
More and more emphasis is being placed in our day on the importance of ‘collections’, and on the way a book which may be fairly unimportant in and of itself, gains considerably in significance because of its place within a collection.
It is interesting to see, for example, the British Library’s website making this point forcibly:
“Determining the previous history of a particular item now in the British Library is becoming increasingly important to researchers, for example when attempting to reconstruct the library of an historical figure or identify the authorship of manuscript annotations.”
Neither is it without significance that an auctioneer such as Bonhams includes details of provenance in the descriptions of volumes in its sale catalogues.
We would, therefore, encourage the round-table partners, together with the experts that are brought in to advise them, to take full account in their deliberations of the importance of Cardiff Central Library’s rare books collection as a collection and of its significance as a collection in the cultural history of Wales.
In this context it is important to emphasise that all the books in question are ‘Welsh’, whatever their content or authorship, since they form part of the historical national heritage collection of the Welsh capital’s Library, most of them donated by Welsh/local benefactors or purchased through public subscriptions.
Cardiff Central Library’s special collections include, among others:
almost 200 incunabula from the early printing presses of Europe,
an extensive collection of early printed Bibles
over 800 volumes of 17th century Restoration drama
over 300 atlases published between 1590 and 1850
a fine collection of Civil War tracts
the 5,000 volume collection of D. L. Wooding (1828–91), the important book collector from Beulah near Builth, which includes significant Shakespearian items
a wide-ranging collection of illustrated books from the 16th to the 19th century, including Emblem books and 400 volumes and 300 prints illustrated by the major 19th century caricaturist, George Cruikshank
collections of theological books from Pontypool Baptist College and Llandaff Cathedral
a cross-section of volumes illustrating English and Continental bookbinding from the 16th to the 19th centuries
a major collections of limited editions of volumes printed and finely bound by private presses of the late 19th and early 20th centuries
In our opinion such collections are of national and international significance as collections, and should be retained intact. These special collections were carefully built up in Cardiff Central Library over many decades. Dispersing them would destroy an important heritage collection and significantly deplete the nation’s intellectual resources.
We, therefore, urge the round-table partners to take full consideration of the following in their discussions:
that the vast majority of the special collections in Cardiff Central Library were donated by benefactors for the long-term cultural and educational benefit of Cardiff and the nation; it was not their intention that their donations be sold and the collections dispersed.
that a key element in the value and importance of these books is their combined prestige and research potential as part of a carefully-formulated national heritage collection.
that full consideration be afforded to the importance of a collection as a collection; of the enhanced significance of individual items through their being part of a collection; and of the ‘uniqueness’ of many of the items because of the nature of early printing and binding, their previous ownership, marginalia and other manuscript additions, etc., etc.
that there are strong arguments for retaining all Cardiff Central Library’s special collections intact in Cardiff and in the public domain. If the Council is not in a position to house them at the new Central Library building, it would seem to us that Cardiff University’s offer to care for them, free of charge on long-term loan, offers the opportunity for this to happen at no cost to Cardiff council-tax payers.
that all the special collections – including the Welsh books, the manuscript collections, the prints and maps, etc. – should be adequately catalogued and curated (including the appointment of an archivist and a rare books specialist to look after such books and manuscripts).
that these special collections should be regularly promoted by way of thematic exhibitions (in the new Cardiff Museum?), through displays on the internet, etc., in the same way as city libraries such as Birmingham, Manchester and Glasgow exploit their special rare-books collections for educational and visitor-attraction purposes.
The world-wide publicity given to the proposed sale has brought much attention to the special collections at Cardiff Central Library, with many realising, for the very first time, the wealth and importance of the collections at Cardiff. Although the publicity has been adverse to date, ironically – if the decision to sell them is reversed and these collections are retained intact in Cardiff – the current spotlight on Cardiff’s rich library holdings offers a golden opportunity to promote these collections and Cardiff’s place as an international city of learning.
CARDIFF HERITAGE FRIENDS
http://www.cardiffheritagefriends.org/contact.htm
Received from the Cardiff Heritage Friends:
A number of people have been asking what has happened regarding the proposed sale of Cardiff Public Library’s rare-books collections. The following is an update on the situation as of 13 December 2008.
Following intense public and political pressure, Cardiff Council agreed in late September to enter ‘round-table’ discussions regarding the future of the special collections of rare books it was going to sell. The discussions were to be chaired by CyMAL (the Welsh Assembly Government’s museums, archives and libraries division), and to include representatives from Cardiff University, the National Library of Wales and Glamorgan Record Office.
The first meeting of that group was held on 7 October, when all parties agreed (according to a press release issued by the Welsh Assembly Government on 8 October) to “work together to identify which items from the collection should be recommended to be retained in Wales”.
The Cardiff Heritage Friends have produced a statement responding to that press release, welcoming the ‘round-table’ discussions and emphasising the importance of retaining these special collections intact as collections in Cardiff, rather than ‘cherry-picking’ individual items.
As a result of that ‘round-table’ meeting of 7 October, the first auction of books, scheduled for 4 November at Bonhams, London, was postponed, and Councillor Nigel Howells (the Executive Member of Cardiff Council responsible for libraries) informed a Council meeting on 16 October that the 'round-table' parties had “agreed to meet again shortly to discuss the proposals in greater detail. Until this process has been finalised and implemented it has been agreed that no books will be sold."
Despite agreeing “to meet again shortly”, there have been no further formal meetings to date. The next meeting is to be held on Monday, 15 December. There are, therefore, at present no definite proposals in the public domain to which to respond.
The perception among the public at large – judging from comments in the press and those received from individuals – is that Cardiff Council has ‘seen reason’ and that the books have been 'saved'. This is far from being the case as yet! Indeed, as far as one can gather, it still seems to be the Council’s intention to sell a substantial number of these rare books as soon as possible.
It appears, from what one hears down the grape-vine, that Council officials are actively planning to auction the first batch of books at Bonhams in February/March 2009. The reason seems to be that they need to raise the monies allocated in this year’s Council budget from the sale of the books in order to meet the Public Library’s current financial commitments (and this despite the fact that Cardiff Council, according to the Western Mail of 25 October 2008, has £40 million in reserve funds, and almost £10 million of that unallocated!).
Much will depend on the outcome of the second ‘round-table’ meeting on 15 December, but as things are developing at present, it is quite possible there will be need for a second round of campaigning early in the new year – which will be a particularly unfortunate time for Cardiff Council to attract further bad publicity, since a spring auction in Bonhams will coincide quite closely with the opening of Cardiff’s new Central Library building!
***
Statement by Cardiff Heritage Friends in response to the ‘way ahead’ announced following round-table discussions on 7 October 2008
regarding the Cardiff City Library’s Special Collections
Cardiff Heritage Friends warmly welcomes the decision of Cardiff Council to enter round-table discussions with CyMAL (the Welsh Assembly Government’s museums, archives and libraries division), Cardiff University, the National Library of Wales and Glamorgan Record Office regarding the future of its special collections of rare books, and to postpone the sale of these books while discussions are in progress.
We wish to take this opportunity to thank all those who have helped bring about this encouraging development, including politicians from all parties. We are particularly grateful to the hundreds of Cardiff citizens who have contacted the Council and their elected representatives to express their opposition to the sale, and to the numerous individuals and organisations across Wales, and indeed much further afield, who have raised their voice in protest at the proposed destruction of a heritage collection of national and international significance.
While welcoming the current round-table discussions, there is one matter of concern arising from the press release of 8 October 2008 which announced the ‘way ahead’ that was agreed at the first round-table meeting.
The emphasis in that press release seems to be upon collaborating to ensure that ‘items’ of national and cultural significance are retained in Wales, rather than on ensuring that these important collections are retained intact in Cardiff.
The vast majority of the rare books in question were obtained by Cardiff Central Library, not as individual items but either:
(a) as part of a collection donated to the Library by a prominent figure in the life of Cardiff/Wales; or else:
(b) purchased through public subscription in order to build up specialist collections (e.g., the collection of representative items from rare Continental presses; the collection of early printed Bibles, etc.).
If, as the press release seems to suggest, the importance of individual items will be the paramount factor in deciding their fate, such cherry-picking of items will destroy the Library’s special collections as collections, with all the prestige, ‘critical mass’ and research potential such collections afford.
More and more emphasis is being placed in our day on the importance of ‘collections’, and on the way a book which may be fairly unimportant in and of itself, gains considerably in significance because of its place within a collection.
It is interesting to see, for example, the British Library’s website making this point forcibly:
“Determining the previous history of a particular item now in the British Library is becoming increasingly important to researchers, for example when attempting to reconstruct the library of an historical figure or identify the authorship of manuscript annotations.”
Neither is it without significance that an auctioneer such as Bonhams includes details of provenance in the descriptions of volumes in its sale catalogues.
We would, therefore, encourage the round-table partners, together with the experts that are brought in to advise them, to take full account in their deliberations of the importance of Cardiff Central Library’s rare books collection as a collection and of its significance as a collection in the cultural history of Wales.
In this context it is important to emphasise that all the books in question are ‘Welsh’, whatever their content or authorship, since they form part of the historical national heritage collection of the Welsh capital’s Library, most of them donated by Welsh/local benefactors or purchased through public subscriptions.
Cardiff Central Library’s special collections include, among others:
almost 200 incunabula from the early printing presses of Europe,
an extensive collection of early printed Bibles
over 800 volumes of 17th century Restoration drama
over 300 atlases published between 1590 and 1850
a fine collection of Civil War tracts
the 5,000 volume collection of D. L. Wooding (1828–91), the important book collector from Beulah near Builth, which includes significant Shakespearian items
a wide-ranging collection of illustrated books from the 16th to the 19th century, including Emblem books and 400 volumes and 300 prints illustrated by the major 19th century caricaturist, George Cruikshank
collections of theological books from Pontypool Baptist College and Llandaff Cathedral
a cross-section of volumes illustrating English and Continental bookbinding from the 16th to the 19th centuries
a major collections of limited editions of volumes printed and finely bound by private presses of the late 19th and early 20th centuries
In our opinion such collections are of national and international significance as collections, and should be retained intact. These special collections were carefully built up in Cardiff Central Library over many decades. Dispersing them would destroy an important heritage collection and significantly deplete the nation’s intellectual resources.
We, therefore, urge the round-table partners to take full consideration of the following in their discussions:
that the vast majority of the special collections in Cardiff Central Library were donated by benefactors for the long-term cultural and educational benefit of Cardiff and the nation; it was not their intention that their donations be sold and the collections dispersed.
that a key element in the value and importance of these books is their combined prestige and research potential as part of a carefully-formulated national heritage collection.
that full consideration be afforded to the importance of a collection as a collection; of the enhanced significance of individual items through their being part of a collection; and of the ‘uniqueness’ of many of the items because of the nature of early printing and binding, their previous ownership, marginalia and other manuscript additions, etc., etc.
that there are strong arguments for retaining all Cardiff Central Library’s special collections intact in Cardiff and in the public domain. If the Council is not in a position to house them at the new Central Library building, it would seem to us that Cardiff University’s offer to care for them, free of charge on long-term loan, offers the opportunity for this to happen at no cost to Cardiff council-tax payers.
that all the special collections – including the Welsh books, the manuscript collections, the prints and maps, etc. – should be adequately catalogued and curated (including the appointment of an archivist and a rare books specialist to look after such books and manuscripts).
that these special collections should be regularly promoted by way of thematic exhibitions (in the new Cardiff Museum?), through displays on the internet, etc., in the same way as city libraries such as Birmingham, Manchester and Glasgow exploit their special rare-books collections for educational and visitor-attraction purposes.
The world-wide publicity given to the proposed sale has brought much attention to the special collections at Cardiff Central Library, with many realising, for the very first time, the wealth and importance of the collections at Cardiff. Although the publicity has been adverse to date, ironically – if the decision to sell them is reversed and these collections are retained intact in Cardiff – the current spotlight on Cardiff’s rich library holdings offers a golden opportunity to promote these collections and Cardiff’s place as an international city of learning.
CARDIFF HERITAGE FRIENDS
http://www.cardiffheritagefriends.org/contact.htm
KlausGraf - am Sonntag, 14. Dezember 2008, 02:05 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Am 9. Dezember 1968 demonstrierte der Computerpionier Douglas C. Engelbart erstmals eine Erfindung auf einer Konferenz in San Francisco: die Computermaus.
KlausGraf - am Sonntag, 14. Dezember 2008, 00:35 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine Suche mit Google in den Elektronic Resources ist möglich. Die Treffer beziehen sich anscheinend nur auf die Bestände der Lane Medical Library.
http://jenson.stanford.edu/
http://jenson.stanford.edu/
KlausGraf - am Samstag, 13. Dezember 2008, 23:59 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://opac.nebis.ch/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/7H6MKUH5CBBV5BBHVJ2GE859N7IN8C.pdf
Bärtschi, Marianne
Titel Das Habsburger Urbar : vom Urbar-Rodel zum Traditionscodex / vorgelegt von Marianne Bärtschi
Impressum Zürich, 2008
Umfang 284 S.
Hochschulschrift Diss. Univ. Zürich, 2006. - Ref.: Roger Sablonier ; Korref.: Martina Stercken
Bärtschi, Marianne
Titel Das Habsburger Urbar : vom Urbar-Rodel zum Traditionscodex / vorgelegt von Marianne Bärtschi
Impressum Zürich, 2008
Umfang 284 S.
Hochschulschrift Diss. Univ. Zürich, 2006. - Ref.: Roger Sablonier ; Korref.: Martina Stercken
KlausGraf - am Samstag, 13. Dezember 2008, 23:47 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://libcat.smu.edu/
Suche nach "image"
Beispiel:
Main Author: John Chrysostom, Saint, d. 407.
Uniform Title: [Epistola ad Theodorum]
Title: De reparatione lapsi.
Published: [Cologne : Ulrich Zel, 1467-72.]
Description: 40 leaves : 199 x 138 mm.
Format: BookOther Author(s): Zell, Ulrich, d. 1503, printer.
Links: Image of folio 1r
Image of inscribed contents of this work and others bound together
References: Goff J294 -- ISTC ij00294000 -- Hain (Copinger) 5051 -- BMC I 182 (IA.2749).
Notes: FORMAT: Chancery quarto.
COLLATION: [1-5⁸]. Folios 1/1 and 4/6 blank. Complete.
TYPES: 96(109)G.
TYPE AREA: 148 x 83 mm. Single column, 28 lines.
PRINTING FEATURES: Blank spaces for initials. Six pinholes (occasionally present).
HAND DECORATION: Rubricated in red ink, with elaborate divided red and blue initial Q with green infill and red and purple extensions on folio 1/2r. Foliated in red ink. Manuscript table of contents for a dispersed Sammelband including this work on 1/1r (blank).
BINDING: Modern brown calf, with "Keulen / 1467" gilt on spine; final leaf has remains of leather tab on fore edge.
PROVENANCE: 1. Konigstein, Germany, Church of St. Mary, early Sammelband, inscription on 1/1r. 2. Bronnbach (cloister?) library, inscription on 1/1r. 3. Casparo Spenglero, inscription on 1/1r. 1644. 4. U. Proost, no. 412, modern bookplate. 5. Christie's (London), 20 November 2002, lot 100. 6. Bridwell Library, 20 November 2002.
MISCELLANEOUS: Blank folio 1/1r bears a manuscript table of contents for the former Sammelband of early Cologne imprints that began with this work and continued for 168 additional leaves. It included Goff J282 (78 ff.), Goff J298 (30 ff.), Goff T291 (36 ff.), Goff A1303 (8 ff.), and Goff D147 (16 ff.).
BIBLIOGRAPHY (on Bridwell copy): See item folder.
Nachtrag: Liste der Inkunabeln mit Links zu den Schlüsselseiten
http://smu.edu/bridwell/specialcollections/IncunabulaList1.htm

Suche nach "image"
Beispiel:
Main Author: John Chrysostom, Saint, d. 407.
Uniform Title: [Epistola ad Theodorum]
Title: De reparatione lapsi.
Published: [Cologne : Ulrich Zel, 1467-72.]
Description: 40 leaves : 199 x 138 mm.
Format: BookOther Author(s): Zell, Ulrich, d. 1503, printer.
Links: Image of folio 1r
Image of inscribed contents of this work and others bound together
References: Goff J294 -- ISTC ij00294000 -- Hain (Copinger) 5051 -- BMC I 182 (IA.2749).
Notes: FORMAT: Chancery quarto.
COLLATION: [1-5⁸]. Folios 1/1 and 4/6 blank. Complete.
TYPES: 96(109)G.
TYPE AREA: 148 x 83 mm. Single column, 28 lines.
PRINTING FEATURES: Blank spaces for initials. Six pinholes (occasionally present).
HAND DECORATION: Rubricated in red ink, with elaborate divided red and blue initial Q with green infill and red and purple extensions on folio 1/2r. Foliated in red ink. Manuscript table of contents for a dispersed Sammelband including this work on 1/1r (blank).
BINDING: Modern brown calf, with "Keulen / 1467" gilt on spine; final leaf has remains of leather tab on fore edge.
PROVENANCE: 1. Konigstein, Germany, Church of St. Mary, early Sammelband, inscription on 1/1r. 2. Bronnbach (cloister?) library, inscription on 1/1r. 3. Casparo Spenglero, inscription on 1/1r. 1644. 4. U. Proost, no. 412, modern bookplate. 5. Christie's (London), 20 November 2002, lot 100. 6. Bridwell Library, 20 November 2002.
MISCELLANEOUS: Blank folio 1/1r bears a manuscript table of contents for the former Sammelband of early Cologne imprints that began with this work and continued for 168 additional leaves. It included Goff J282 (78 ff.), Goff J298 (30 ff.), Goff T291 (36 ff.), Goff A1303 (8 ff.), and Goff D147 (16 ff.).
BIBLIOGRAPHY (on Bridwell copy): See item folder.
Nachtrag: Liste der Inkunabeln mit Links zu den Schlüsselseiten
http://smu.edu/bridwell/specialcollections/IncunabulaList1.htm

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 13. Dezember 2008, 22:34 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 13. Dezember 2008, 20:47 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Interview vom 01.12.2008 mit dem Leiter des Stuttgarter Stadtarchivs, Dr. Roland Müller, ist hierals mp3 zu hören
Wolf Thomas - am Samstag, 13. Dezember 2008, 18:22 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 13. Dezember 2008, 16:14 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Landkartenprojekt OpenStreetMap hat zusammen mit dem Bayerischen Landesamt für Vermessung und Geoinformation (LVG) ein Pilotprojekt zur Erfassung des Regierungsbezirks Oberpfalz gestartet. Dabei stellt das LVG Luftbilder des fast 10 000 Quadratkilometer großen Gebiets mit einer Auflösung von zwei Metern für drei Monate zu Verfügung. Von diesen übernehmen die Mitglieder von OpenStreetMap (OSM) durch Abzeichnen das Straßen- und Bahnnetz, aber auch den Verlauf von Gewässern und Stromleitungen sowie weiterer Geodaten. Die gewonnenen Vektorinformationen können anschließend im OSM-Projekt frei verwendet werden.
http://www.heise.de/newsticker/Bayern-versorgt-OpenStreetMap-mit-Luftbildern--/meldung/120382
Das ist der falsche Weg. Wer garantiert, dass die Projektmitarbeiter korrekt gearbeitet haben, wenn die Luftbilder nach 3 Monaten wieder unfrei werden? Wir brauchen offene Geodaten auf Dauer!
Siehe http://archiv.twoday.net/search?q=geodat
http://www.heise.de/newsticker/Bayern-versorgt-OpenStreetMap-mit-Luftbildern--/meldung/120382
Das ist der falsche Weg. Wer garantiert, dass die Projektmitarbeiter korrekt gearbeitet haben, wenn die Luftbilder nach 3 Monaten wieder unfrei werden? Wir brauchen offene Geodaten auf Dauer!
Siehe http://archiv.twoday.net/search?q=geodat
KlausGraf - am Samstag, 13. Dezember 2008, 15:45 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Ars Electronica verfügt über eines der weltweit umfangreichsten Archive zur digitalen Medienkunst der letzten 25 Jahre. Es umfasst das Katalog-Archiv und die Dokumentationen zum Festival Ars Electronica (ab 1979), das Archiv des Prix Ars Electronica (ab 1987), Materialien zu Ars-Electronica-Projekten sowie Biografien der daran beteiligten Künstler und Theoretiker."
Quelle: Verzeichnis der österreichischen Wissenschaftsarchive
Link zum Ars-Elektronica-Archiv: http://www.aec.at/de/archives/navigator.asp
Quelle: Verzeichnis der österreichischen Wissenschaftsarchive
Link zum Ars-Elektronica-Archiv: http://www.aec.at/de/archives/navigator.asp
Wolf Thomas - am Samstag, 13. Dezember 2008, 14:45 - Rubrik: Medienarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Den Kern des Peter-Cornelius-Archivs bildet der Nachlass des Mainzer Dichters und Komponisten Peter Cornelius (1824-1874), den die Stadt Mainz im Jahre 1950 erworben hat. Der durch den Sohn und Biographen Carl Maria Cornelius ausgebaute Nachlass wurde durch jahrzehntelange antiquarische Ankäufe seitens der Mainzer Stadtbibliothek systematisch erweitert. Eine der spektakulärsten Ergänzungen erfolgte 1999 durch die Überlassung des letzten großen Bestands an Musikmanuskripten von Peter Cornelius aus der Sammlung Joseph Standthartner, die die Sparkasse Mainz 1987 antiquarisch erworben hatte.
Die Mainzer Stadtbibliothek besitzt mit dem Peter-Cornelius-Archiv die international bedeutendste Sammlung von Eigenschriften des Künstlers. Es umfasst
Musikmanuskripte als Autographen und in Abschriften
Musikdrucke - häufig in Erstausgaben -
Gedichte von Peter Cornelius
Briefe von und an Peter Cornelius sowie Korrespondenz der Familie
Notiz- und Tagebücher
Bilder und verschiedene Gegenstände im Zusammenhang mit Peter Cornelius
Der Bestand ist durch konventionelle Zettelkataloge u. a. der Briefsammlung und der Gedichthandschriften zum Teil intensiv erschlossen.
Neben den Autographen aus der Sammlung Moyat und dem Peter-Cornelius-Archiv befinden sich in der Autographensammlung der Stadtbibliothek 30 Briefe Beethovens an den Musikverlag Schott, 88 Autographen aus der Sammlung der Mainzer Liedertafel und etwa 75 weitere Autographen (Briefe und Musikhandschriften) von Personen mit Bezug zum Mainzer Kulturleben (z. B. Wilhelm Heinse, Georg Forster, Carl Zuckmayer und Hans Gál). Derzeit wird mit der Online-Erschließung der autographen Bestände in der zentralen Datenbank für Autographen und Nachlässe Kalliope begonnen. Die Liedertafel-Autographen sowie die Briefe der Sammlung Moyat sind bereits erschlossen; weitere Bestände folgen.
Anfragen und Benutzungswünsche
zu den Sondersammlungen, Autographen und Nachlässen richten Sie bitte an Frau Silja Geisler-Baum M. A.
silja.geisler-baum@stadt.mainz.de "
Quelle:
http://www.mainz.de/WGAPublisher/online/html/default/MKUZ-5UZDUJ.DE.0
Wikipedia-Eintrag: http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Cornelius_(Komponist)
Die Mainzer Stadtbibliothek besitzt mit dem Peter-Cornelius-Archiv die international bedeutendste Sammlung von Eigenschriften des Künstlers. Es umfasst
Musikmanuskripte als Autographen und in Abschriften
Musikdrucke - häufig in Erstausgaben -
Gedichte von Peter Cornelius
Briefe von und an Peter Cornelius sowie Korrespondenz der Familie
Notiz- und Tagebücher
Bilder und verschiedene Gegenstände im Zusammenhang mit Peter Cornelius
Der Bestand ist durch konventionelle Zettelkataloge u. a. der Briefsammlung und der Gedichthandschriften zum Teil intensiv erschlossen.
Neben den Autographen aus der Sammlung Moyat und dem Peter-Cornelius-Archiv befinden sich in der Autographensammlung der Stadtbibliothek 30 Briefe Beethovens an den Musikverlag Schott, 88 Autographen aus der Sammlung der Mainzer Liedertafel und etwa 75 weitere Autographen (Briefe und Musikhandschriften) von Personen mit Bezug zum Mainzer Kulturleben (z. B. Wilhelm Heinse, Georg Forster, Carl Zuckmayer und Hans Gál). Derzeit wird mit der Online-Erschließung der autographen Bestände in der zentralen Datenbank für Autographen und Nachlässe Kalliope begonnen. Die Liedertafel-Autographen sowie die Briefe der Sammlung Moyat sind bereits erschlossen; weitere Bestände folgen.
Anfragen und Benutzungswünsche
zu den Sondersammlungen, Autographen und Nachlässen richten Sie bitte an Frau Silja Geisler-Baum M. A.
silja.geisler-baum@stadt.mainz.de "
Quelle:
http://www.mainz.de/WGAPublisher/online/html/default/MKUZ-5UZDUJ.DE.0
Wikipedia-Eintrag: http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Cornelius_(Komponist)
Wolf Thomas - am Samstag, 13. Dezember 2008, 14:36 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Matrikel des Collegium Carolinum und der Technischen Hochschule Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, 1745 - 1900 / bearb. von Peter Düsterdieck. - (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen ; 9,5)
Signatur: 2810-9695 ; WH R 307 ; DE A 601 / 103
Autor: Düsterdieck, Peter
Verlag: Hildesheim : Lax, 1983
Eingestellt am: 2008-06-12
Dokumente:
PDF-Dokument
MatrikelbuchOCR.pdf (18651 kB)
Zitierfähige URL: http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00022660
URN (NBN): urn:nbn:de:gbv:084-19158
Signatur: 2810-9695 ; WH R 307 ; DE A 601 / 103
Autor: Düsterdieck, Peter
Verlag: Hildesheim : Lax, 1983
Eingestellt am: 2008-06-12
Dokumente:
PDF-Dokument
MatrikelbuchOCR.pdf (18651 kB)
Zitierfähige URL: http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00022660
URN (NBN): urn:nbn:de:gbv:084-19158
KlausGraf - am Samstag, 13. Dezember 2008, 01:31 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Überraschung ist ja ein Grundprinzip des Adventskalenders. Da bereits seit gestern bekannt war, was heute der offizielle Inhalt des Türchens ist, gibt es einen kleinen Bonus.
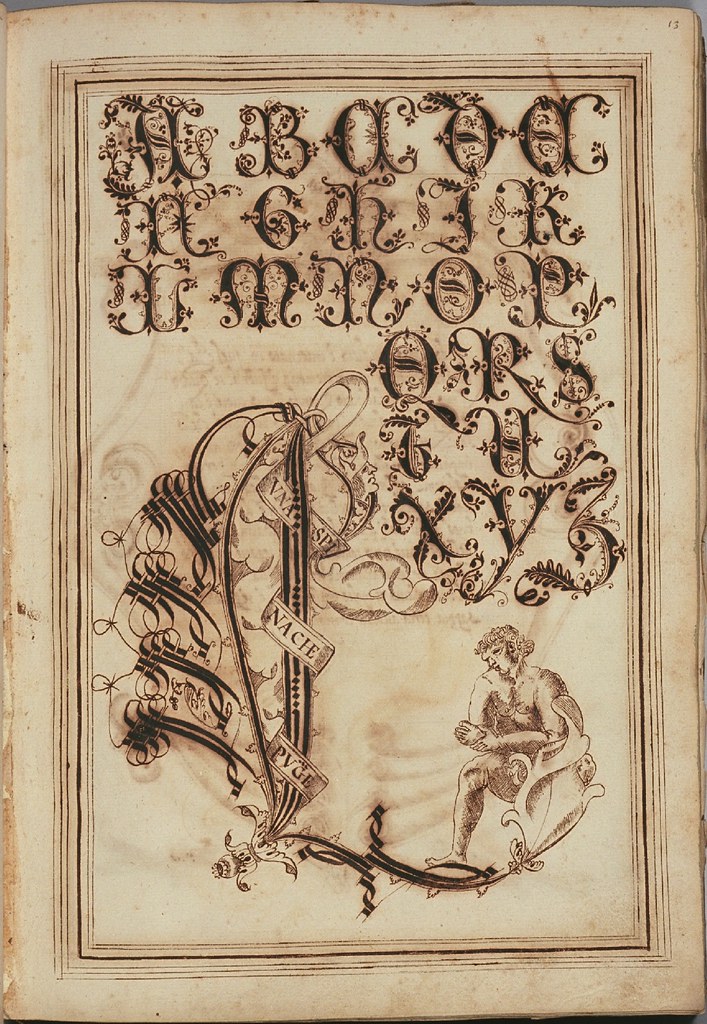
BibliOdyssey hat einen hübschen Eintrag über ein italienisches Kalligraphiebuch aus dem beginnenden 17. Jahrhundert (heute in der Columbia Universität in New York), dessen Bilder im Digital Scriptorium abrufbar sind. Wichtig auch der Hinweis auf eine umfangreiche Linkliste zum Thema Kalligraphie.
Zum Schreibmusterbuch des Ochsenhausener Mönchs Gregor Bock (online in Yale) siehe
http://archiv.twoday.net/stories/4895844/
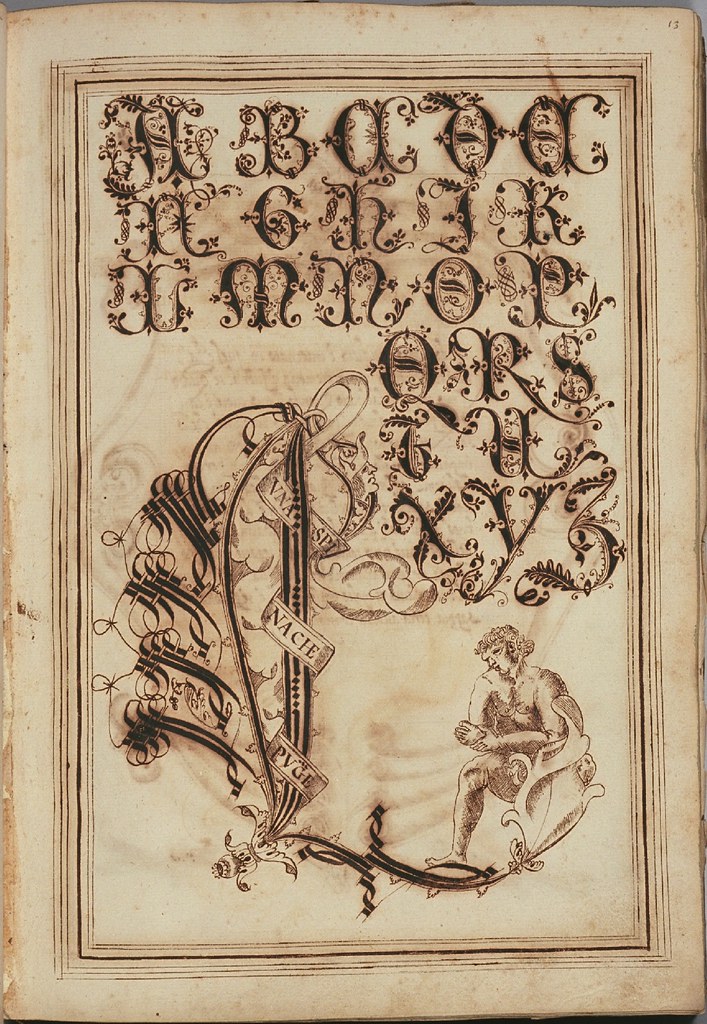
BibliOdyssey hat einen hübschen Eintrag über ein italienisches Kalligraphiebuch aus dem beginnenden 17. Jahrhundert (heute in der Columbia Universität in New York), dessen Bilder im Digital Scriptorium abrufbar sind. Wichtig auch der Hinweis auf eine umfangreiche Linkliste zum Thema Kalligraphie.
Zum Schreibmusterbuch des Ochsenhausener Mönchs Gregor Bock (online in Yale) siehe
http://archiv.twoday.net/stories/4895844/
KlausGraf - am Samstag, 13. Dezember 2008, 00:50 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Schreger, Odilo: Odilo Schregers lustiger und nützlicher Zeitvertreiber [...]. Eilfte, vermehrte und verbesserte Auflage, Augsburg: Ignaz Veith und Michael Rieger, 1802, S. 15-38.
Laxiren, den Leib öffnen.
Lamentiren, klagen.
Legend, Lebensbeschreibung der Heiligen.
Laborant, Goldmacher.
Labyrinth, große Verwirrung.
Libertiner, der glaubt und lebet, wie er will.
Liga, eine Bündniß, wenn sich Einige wider Andere verbinden.
Liquid, klar, richtig, gewiß.
Liturgia, vorgeschriebene Ceremonien des Gottesdienstes, sonderlich der heiligen Messe.
Loge, Behausung, Zimmer, Kämmerlein.
Logement, eine Herberge.
Lotterie, Glückshafen, worein man Geld auf Gewinn leget.
Lyceum ist eine Schule, wo man die Facultäten entweder alle, oder doch die Philosophia Jus Canonicum, und Etwas von der Theologia lehret, aber keine Gradus austheilet.
Maculatur, Papier zum Einwickeln.
Magazin ein Ort, wo Kriegsvorrath aufbehalten wird.
Maitresse, Kebsweib, Hure.
Maladie, Krankheit; malade, krank.
Malcontent, übel zufrieden.
Mameluck, sieh Renegat.
Manquiren, mangeln, abgehen.
Manufacturen, allerhand Handwerkswaaren.
Manuteniren, vertheidigen, behaupten.
Mariage, Heirath.
Mediator, Mittler, der zu einem Bunde Mittel und Wege machet.
Menagiren, genau hausen, sparen.
Merenda, Abendmahlzeit.
Mesure, Absicht, Maaß.
Metamorphosis, Veränderung der Gestalt.
Melancholicus, der immer traurig ist; und dieses kömmt her von der schwarzen Galle, oder schwarzem Geblüte.
Methode, Manier, Ordnung, Anweisung.
Million, zehnmal hundert tausend.
Moral, Sittenlehre; moralisiren Lebensregeln geben.
Moraliter impossibile, menschlicher Weise kaum möglich.
Mortificiren, abtödten, plagen, peinigen.
Moscheen, türkische Kirchen.
Mufti, der oberste Lehrer bey den Türken.
Münster, eine Domkirche.
Mumien, einbalsamirte Todtenkörper.
Munition, Kriegsvorrath.
Musæum, Studierzimmer.
Nativität stellen, ausschänden, ausfilzen.
Naturalien, Besoldung, die man an Lebensmitteln giebt, nicht an Geld.
Naturalisiren, einen Fremden unter die in einem Lande gebohrnen Einwohner aufnehmen, und ihm alle Freyheiten derselben verstatten.
Naturel, die Geschicklichkeit von Natur zu einem Dinge.
Natürliche Kinder, die nicht in rechtmäßiger Ehe gebohren worden.
Negative, mit Nein antworten, abschlagen.
Negative sich halten, nicht Ja, nicht Nein dazu sagen.
Neutral, wenn mans mit keiner Partey hält.
Nepotismus, wenn man seinen Befreundten zu viel anhängt.
Noblesse, der Adel.
Nolens, volens, er mags gerne, oder nicht gerne thun.
Notiren, aufzeichnen, merken.
Numeriren, zählen.
Notorium, überall bekannt.
Nota bene, NB. merks wohl.
Novellen, neue Zeitung.
Nutriment, Nahrung.
Objection, Einwurf, Einwendung, Widerrede.
Objectum, Gegenwurf, das ist, ein Ding, mit dem man umzugehen und zu thun hat.
Objiciren, vorwerfen.
Observiren, beobachten.
Obscur, dunkel, hart zu verstehen.
Observatorium, ein hohes Gebäude, worauf man den Himmelslauf beobachten kann.
Obstinat, hartnäckig, eigensinnig.
Occasionliter, gähling.
Occultiren, verhöhlen.
Ad oculum demonstriren, augenscheinlich beweisen.
Oeconomia, eine Haushaltung.
Offensive, verletzlich.
Offerten, Anerbiethungen, Versprechungen.
Ombrage machen, bey Andern eine Furcht, Mistrauen und Nachdenken erwecken.
Omen, Vorbedeutung.
Ominiren, muthmaßen.
Opera, eine musikalische Komödie, Schauspiel.
Opponiren, widersetzen.
Optica, Sehekunst, oder Wissenschaft der Dinge und Figuren, die zum Gesichte gehören.
Oraculum, Ausspruch, Weissagung; item, unfehlbare Wahrheit.
Oratorium, Ort zu bethen, oder eine kleine Kirche.
Ordonance, Befehl, Anordnung.
Ordre, Befehl, Anordnung.
Orthographia, die Kunst, recht zu schreiben.
Oval, länglichtrund, wie ein Ey.
Palinodia, Widerrufung seiner Reden oder Schriften.
Pallium, eine weiße wollene, mit schwarzen Kreuzen besetzte Gürtel um die Schultern, welche an hohen Festtagen der Pabst, die Patriarchen, Erzbischöfe, und etliche Bischöfe tragen.
Panacea, eine Universalarzney wider alle Krankheiten.
Panegyricus, eine Lobrede.
Paquet, ein Bündlein Briefe.
Parade, Aufzug, Pracht.
Paradoxum, eine Lehre, so wider die allgemeine Meynung ist.
Paragraphus, ein Theil der Rede.
Pardon, Verzeihung, Gnade. Pardoniren, verzeihen; item. das Leben schenken.
Par force, mit Gewalt.
Pariren, gehorsamen.
Parliren, reden.
Parole, Versprechen, Zusage.
Paroxismus, wenn Einen die Krankheit eben anfällt.
Pasquill, eine Schmähschrift.
Passeport, ein sicherer Geleitsbrief.
Perfect, vollkommen, durchaus gut.
Permission, Erlaubniß.
Peroriren, eine öffentliche Rede halten.
Perplex, verwirrt, bestürzt.
Philosophus, ein Weltweiser.
Phlegmaticus, der feuchter Natur ist.
Physiognomia, die Kunst, aus der Gestalt des Angesichts zu wahrsagen.
Piano, gemach, sachte.
Plaisir, Gefallen, Lust.
Polit seyn, manierlich, artig.
Poltron, fauler, nichtswerther Tropf.
Portiren, geneigt seyn, Einem hold seyn, ihm helfen etc.
Portrait, Kontrafait, Abbildung.
Porto, Postgeld für die Briefe.
Posthumus, der nach des Vaters Tode gebohren ist.
Practiquen, Schwänke, List, Betrug.
Præbende, Pfründ, Einkommen, den geistlichen Personen gewidmet.
Præcedenz,, Vorzug, Vorsitz.
Præcise, just, gewiß, nett.
Prædicat, Ehrentitel.
Prædominiren, die Oberhand haben, vordringen.
Prægustus, Vorgeschmack, vorhergehende Wissenschaft.
Præjudicium, Schaden, Nachtheil.
che selbst kömmt.
Præpostere, das Hinterste zu vörderst.
Prærogativ, Vorzug, besseres Recht vor einem Andern.
Præsent, Schankung.
Præservativ, eine Arzney, dadurch man einer bevorstehender Krankheit vorkömmt.
Pressuren, schwere Auflagen.
Presto, eilends, bald, geschwind.
Privatim, in der Stille, allein.
Privative, für sich selbst, einzig und allein.
Proceduren, das Verfahren, wie man mit Einem umgeht.
In procinctu, bereit, fertig.
Pro etc. contra, auf beyden Seiten; dafür und darwider.
Profit, Gewinn, Nutz, Vortheil.
Profitiren, gewinnen, zu Nutzen machen.
Pro forma, auf den Schein.
Prognosticon, Vorbedeutung aus dem Gestirne, den Elementen etc.
Progressen, Fortgang, Glück.
Projectiren, einen Anschlag machen, sein Bedenken sagen.
Promessen, Versprechungen.
Promotion, Erhebung zu einem Amte, oder einer Würde; item, wenn man graduirte Personen machet.
Propre, nett, sauber. Propre Mensch, der sich nett und sauber hält.
Provision, Vorrath, Vorsehung.
Provinz, eine Landschaft.
Puissance, mächtiger Herr, oder Potentat; item, Macht, Gewalt, Vollmacht.
Qualificiren, geschickt machen.
Qualitæten, Gaben, Tugenden, Geschicklichkeit etc.
Quarantaine, sieh. Contumace.
Quartal, ein Vierteljahr. Quartaliter, alle Vierteljahre, Vierteljahrweise.
Quasi vero, diese zwey Wörter werden gemeiniglich zum Spotte gebraucht, und heißen: Gerade, als wenns also wäre.
Quid ad te? Was gehts dich an?
Quid Consilii? Was Raths?
Quid faciendum? Was ist zu thun?
Quid pro quo, Etwas für Alles; Weniger, als sich gebührt, geben.
Quintessenz, der Auszug, Ausbund, Kern.
Quodlibet, ein Mischmasch, allerhand unter einander.
Radiren, auskratzen.
Raffinirt, abgewixt, wohl abgerichtet.
Raison, Ursache, Vernunft, Manier.
Raisonabel, vernünftig, billig, recht.
Raisoniren, von einer Sache klug reden.
Rappelliren, zurückerufen.
Rapport, Nachricht.
Raptim, in Eile.
Rasiren, eine Stadt, Festung etc. schleifen, niederreißen, der Erde gleich machen.
Reciprocé entgegen, auch dergleichen.
Reciprociren, Gleiches erweisen, entgegen thun.
Recognosciren, ausspähen, besichtigen.
Recruten, neugeworbene Völker.
Recrutiren, die Armee mit Recruten wieder ergänzen.
Recurs, Zuflucht.
Recusiren, abschlagen.
Rejiciren, verwerfen.
Redoute, ein Ort, wo sich die Leute Kurzweile, Tanzens und Spiels halber hinbegeben.
Reduciren, wieder in Ordnung bringen; item, Offiziere abdanken, und die Gemeinen in andere Regimenter unterstecken.
Refundiren, wieder erstatten.
Refutiren, widerlegen.
Regal, Verehrung.
Regaliren, beschenken.
Regard, Absicht; Regard machen, hoch schätzen.
Regress suchen, seinen erlittenen Schaden wieder hereinbringen.
Remittiren, nachlassen.
Remonstriren, vorstellen, beweisen.
Renegat, Einer, der aus einem Christen ein Türk wird.
Renomée, Ruhm, Ansehen.
Renten, jährliche Einkünfte.
Renunciren, absagen, sein Recht aufgeben.
Repartition, ordentliche Austheilung.
Repoussiren, zurücketreiben.
Reprimande, Verweis, Ausscheltung.
Repudium, eine Ehescheidung.
Repulsa, Abschlagung, Verweigerung.
Requisita, was zu einem Dinge nöthig ist.
Resarciren, erstatten, wieder ersetzen.
Reserviren, ausdingen, vorbehalten.
Resigniren, ein Amt aufgeben, aufkündigen.
Resolut, herzhaft, der sich nicht lang besinnet.
Restituiren, wieder zurückgeben.
Resentiren, ahnden, empfinden, für eine Schmach aufnehmen.
Restringiren, einschränken.
Retirade, ein Ort, wo man sich allein aufhalten kann.
Retorquiren, eben Das, was Einem ist vorgeworfen worden, dem Andern entgegen vorwerfen.
Retour, Zurückkunft.
Retourniren, zurückkommen.
Retractiren, widerrufen, vernichten.
Revalesciren, wieder gesund werden.
Revange, Rache.
Revangiren, sich rächen.
Revociren, widerrufen.
Revolte, Aufruhr.
Romanz, ein Gedicht, so meistens von Liebeshändeln handelt.
Rumor, Zeitung; item, Tumult.
Salvaguardia, zum Schutze gegebene Soldaten.
Salva venia, mit Ehren zu reden.
Salvus Conductus, freyer Durchzug, sicheres Geleit.
Satyra, satyrische Schrift, worinn die Leute durch die Hechel gezogen werden.
Schaltjahr, allezeit das vierte Jahr, in welchem nach dem 24. Februarius noch ein Tag eingeschaltet, oder eingestecket wird, daß also ein solches Jahr nicht 365, sondern 366 Tage hat.
Scrutinium, bey Erwählungen, ist, wenn man die Vota oder Stimmen heimlich oder geschriebener einsammelt.
Sæculum, eine Zeit von 100 Jahren.
Sæcularisiren, einen geistlichen Ort weltlich machen, und dessen Einkommen zu weltlichen Dingen widmen.
Secundiren, helfen, beystehen.
Sede vacante heißt, wenn ein Papst, Bischof, oder anderer Prälat abgeht, bis wieder ein anderer erwählt wird.
Sentiment, Meynung, Urtheil.
Serenade, eine nächtliche Musik.
Signalisiren, sich meisterlich halten.
Simuliren, sich stellen, dergleichen thun.
Sopiren, stillen, ruhig machen.
Souverain, frey, Niemanden unterthan seyn.
Spargement, ausgesprengte Zeitung.
In specie, insonderheitlich, ausdrücklich.
Spediren, abfertigen.
Spendiren, verehren. Item, Etwas darauf wenden.
Spion, Ausspäher, Kundschafter.
Specification, ein Verzeichniß.
Spesen, Unkosten.
Stafetta, ein Postillion, der außer der ordentlichen Zeit abgeschickt wird.
Stante pede, gleich auf der Stelle.
Stranguliren, erdrosseln.
Strapaze, schwere Arbeit, Plage.
Strapaziren, sich sehr bemühen.
Stipendium, Besoldung armer Studenten.
Stylo veteri, nach dem alten Kalender.
Suborniren, heimlich bestellen; it. anhetzen.
Subsidiengelder, sind jene, die ein Potentat einem andern giebt, daß derselbe für ihn muß Kriegsvolk unterhalten, oder neutral bleiben etc.
Success, glücklicher Fortgang.
Succession, Nachfolge, Erbfolge.
Suite, Gefolg, Begleitschaft.
Summa Summarum, die ganze Sache, Alles in Allem.
Suspendiren auf eine Zeitlang aufheben, oder einstellen. Item, Einen in eine solche Lage setzen, daß er nicht wisse, wo die Sache hinaus wolle.
Sustentation, Unterhalt, Ernährung.
Sympathia, natürlicher Trieb und Neigung gegen Etwas.
Synagog, Judenschule.
Synopsis, kurzer Begriff, Inhalt.
Tacite, heimlich.
Talentum ist so viel, als Qualität, oder Verstand.
Tax, Preis, Werth.
Taxiren, schätzen.
Temperament, Natursbeschaffenheit nach der Hitze, Kälte, Feuchte, und Trockene; nämlich Phlegmaticum, flüßig; Sanguineum, blutreich; Melancholicum, trocken, schwarz, galligt; Cholericum, hitzig.
Tempo, die rechte, bequeme Zeit.
Tentiren, wagen, versuchen.
Theologus, ein Gottesgelehrter.
Tomus, ein Theil eines Buchs.
Tortur, Folterung, Peitschung etc. bey Halsgerichten.
Torquiren, plagen.
Tour, eine Reise, Gang.
Vaciren, ledig seyn.
Vagiren, hin und her laufen.
Vagant, ein Landstreicher.
Ventiliren, erwägen.
Versirt, erfahren in einem Dinge.
Viaticum, Wegzehrung.
Vicarius, der eines Andern Stelle vertritt.
Vice-Regent, der Statthalter eines Königes in einem solchen Lande, welches sonst für sich selbst ein Königreich gewesen, oder noch ist.
Vices vertreten, anstatt eines Andern thun.
Vindiciren, rächen, ahnden.
Victualien, Lebensmittel.
Visite, Besuchung.
Vivres, allerhand Lebensmittel.
Voviren, geloben.
Volontair, der freywillig und auf eigene Kosten im Kriege dienet.
Volumen, ein Buch, so einen Band ausmachet.
Urgiren, antreiben.
***
Und als Bonus der Hinweis auf ein anderes Buch des Ensdorfer Benediktiners:
http://blog.trauerfreuart.de/2007/07/odilo-schreger-studiosus-jovialis.html
KlausGraf - am Samstag, 13. Dezember 2008, 00:34 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Beispiel:
http://books.google.com/books/ucm?lr=&q=deutschland&prstct=1&as_brr=0&hl=es&sa=N&start=30
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/25403.php
Die neue Suche ermöglicht ist, den bei GBS vorhandenen Bestand des Madrider Bibliothekspartners zu durchsuchen (die erste mir bekannte solche Suchmöglichkeit nach Büchern eines Partners). Leider ist eine Verknüpfung mit den anderen Bänden eines mehrbändigen Werks oder einer Zeitschrift nicht möglich ("andere Ausgaben"). Auch führt der Complutense-OPAC-Link stets zu ein- und demselben Titel.
Gemäß http://busal.wordpress.com/2008/12/09/264/ sind es 25.000 Bücher vor 1860.
Übrigens gibt es in der erweiterten Suche einen neuen Suchfilter für Magazine (ungenau in der deutschen Suche: "Zeitschriften")
Beispiel
http://books.google.com/books/ucm?lr=&q=deutschland&prstct=1&as_brr=0&hl=es&sa=N&start=30
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/25403.php
Die neue Suche ermöglicht ist, den bei GBS vorhandenen Bestand des Madrider Bibliothekspartners zu durchsuchen (die erste mir bekannte solche Suchmöglichkeit nach Büchern eines Partners). Leider ist eine Verknüpfung mit den anderen Bänden eines mehrbändigen Werks oder einer Zeitschrift nicht möglich ("andere Ausgaben"). Auch führt der Complutense-OPAC-Link stets zu ein- und demselben Titel.
Gemäß http://busal.wordpress.com/2008/12/09/264/ sind es 25.000 Bücher vor 1860.
Übrigens gibt es in der erweiterten Suche einen neuen Suchfilter für Magazine (ungenau in der deutschen Suche: "Zeitschriften")
Beispiel
KlausGraf - am Samstag, 13. Dezember 2008, 00:26 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
http://www.opencontentalliance.org/2008/12/06/a-raw-deal-for-libraries/#more-270
Excerpt:
Libraries have made huge investments in the books that Google is digitizing. Not only did they purchase, process, shelve and care for the books, over many years, but they continue to carry significant overhead costs for their continued use (including Google’s use!). Much of this investment has been made with taxpayer dollars. And yet libraries receive 0% in this proposed settlement while Google gets 37%. What kind of partnership is this? Taxpayers should be alarmed that their money has gone to provide a service that Google is exploiting on its own terms, in its own interests, with no monetary and little other return to the libraries.
Excerpt:
Libraries have made huge investments in the books that Google is digitizing. Not only did they purchase, process, shelve and care for the books, over many years, but they continue to carry significant overhead costs for their continued use (including Google’s use!). Much of this investment has been made with taxpayer dollars. And yet libraries receive 0% in this proposed settlement while Google gets 37%. What kind of partnership is this? Taxpayers should be alarmed that their money has gone to provide a service that Google is exploiting on its own terms, in its own interests, with no monetary and little other return to the libraries.
KlausGraf - am Samstag, 13. Dezember 2008, 00:16 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 13. Dezember 2008, 00:04 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen