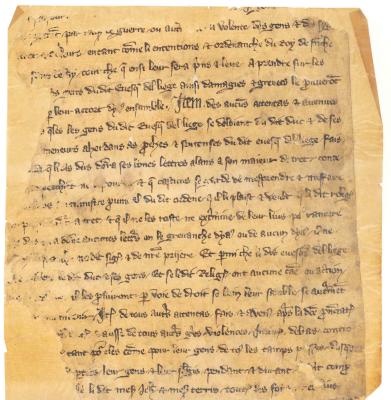http://www.artdaily.com/section/lastweek/index.asp?int_sec=11&int_new=27836&int_modo=2
"The sale of Properties of Royal and Noble Families, held at Sotheby’s Amsterdam on 17 December captivated the imagination of art collectors worldwide. Bidding was truly international. The auction of 415 lots comprised selected paintings, furniture, works of art and silver, all consigned from Royal and Noble Houses in Germany, Austria, England, Russia and The Netherlands."
LOT 258
AN UNUSUAL AND INTERESTING GERMAN ARMORIAL ELEPHANT'S TUSK MOUNTED IN GOLD
PROBABLY 19TH CENTURY
20,000—30,000 EUR
Lot Sold. Hammer Price with Buyer's Premium: 48,750 EUR
bearing the date 1536, engraved and heightened in black ink with scenes from the Passion of Christ, the Madonna and Child, Saints Gregory, Burchard, Mauritz, Andrew and Kilian and an inscription in German, the wide end with four armorial devices including those of Thuengen and Steinruck, the rim and hinged cover of gold, engraved and enamelled in blue, black and white with finely scrolling foliage and applied with facetted glass beads, a cameo and a 16th century bezel of rock crystal engraved and foiled with the arms of Von Thuengen, the crest flanked by the initials E.V.T., the hinged cover applied with a very small pair of antlers attached to section of skull, inside inscribed with donor's names and applied with allied armorial shields, the narrow end of the tusk also mounted in gold enamelled in black and applied with two intaglios in Ancient style and a turquoise; together with a protecting sleeve of red felt
CATALOGUE NOTE
The text engraved on this tusk* recounts the extraordinary event of finding this supposed 'Eingehvrn' (unicorn) tusk, still attached to the animal deep under a barn that had burnt along with other buildings in the year 1536 in Thüngen near Würzburg. Members of the noble von Thüngen family occupied during the Renaissance important positions in the church, military, politics and commerce. Many supported Hans Thomas von Absberg in the so-called 'Fränkischer Krieg', a war that took place in 1523. The whole story of the finding of the tusk most probably is a myth, created to add further importance and ancestry at the object itself (and therefore also at the family who owned it). There is no known record of an eventful fire in Thüngen in 1536 and furthermore it is highly unlikely that a complete elephant -if so only a mammoth could be theoretically possible- could have been found under a building site in Thüngen at the time.
*This text herewith reproduced reads as follows:
ANNO.1536.AN.S.MARX TAG.25.APRILIS IST DER HOF ZV THVNGEN NEBEN NOCH.44.TACHEN ABGEBRANT.VND DARDVRCH DER ERWIRDIGVND EDEL HERR ANDREAS VON THVNGEN THVMHER ZV WIRTZB:VND PROBST ZV.S.BVRCHARD DOSELBST VERVRSACHT WORDEN.DEN SELBEN SEINEN BRVEDERN.VND ERBEN ZV EHREN WIDER VON GRVND VND AVF SEINEN EIGNEN CHOSTEN BAVEN ZV LASSEN VND IST .IM AVFBAVEN VNDER DER SCHEVRN DIS EINGEHVRN MIT SAMBT DEM THIER.SO GAR VERWESEN.XXIIII.WERCK SCHVCH TIEF.VNDER DER ERDEN.
Dr. Peter Volk and Dr. Lorenz Seelig of the Bayerisches Nationalmuseum in Munich, after studying this tusk in 1999, pointed out that the scenes from the passion of Christ are based on those by Albrecht Dürer, the so-called 'Kleine Kupferstichpassion'. The engraved text further specifically elaborates on the word 'Eingehvrn' -appropriately translated as Einhorn (unicorn)- and also terminates with a stylised representation of the twisted form of a unicorn tusk. A well kept secret especially known by apothecaries of the period was the fact the fabled unicorn did not exist and that every so called "unicorn" tusk actually came from a narwhal. It is easy to assume that -parallel to the story/myth of this tusk- a recipient of such a marine animal might have decided to bury the same until the tooth was needed to grind up into miraculous potions.
The tusk formerly was in the collection of the Duke of Trachenberg, Prince of Hatzfeldt of the Trachenberg Castle in Silesia (according to family tradition at least since the late 19th century). An identification of the present tusk with the so called Hatzfeldt'sche 'Einhorn' mentioned in the Hatzfeldt family inventories since 1743 however appealing seems to be very questionable.
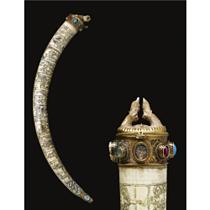
"The sale of Properties of Royal and Noble Families, held at Sotheby’s Amsterdam on 17 December captivated the imagination of art collectors worldwide. Bidding was truly international. The auction of 415 lots comprised selected paintings, furniture, works of art and silver, all consigned from Royal and Noble Houses in Germany, Austria, England, Russia and The Netherlands."
LOT 258
AN UNUSUAL AND INTERESTING GERMAN ARMORIAL ELEPHANT'S TUSK MOUNTED IN GOLD
PROBABLY 19TH CENTURY
20,000—30,000 EUR
Lot Sold. Hammer Price with Buyer's Premium: 48,750 EUR
bearing the date 1536, engraved and heightened in black ink with scenes from the Passion of Christ, the Madonna and Child, Saints Gregory, Burchard, Mauritz, Andrew and Kilian and an inscription in German, the wide end with four armorial devices including those of Thuengen and Steinruck, the rim and hinged cover of gold, engraved and enamelled in blue, black and white with finely scrolling foliage and applied with facetted glass beads, a cameo and a 16th century bezel of rock crystal engraved and foiled with the arms of Von Thuengen, the crest flanked by the initials E.V.T., the hinged cover applied with a very small pair of antlers attached to section of skull, inside inscribed with donor's names and applied with allied armorial shields, the narrow end of the tusk also mounted in gold enamelled in black and applied with two intaglios in Ancient style and a turquoise; together with a protecting sleeve of red felt
CATALOGUE NOTE
The text engraved on this tusk* recounts the extraordinary event of finding this supposed 'Eingehvrn' (unicorn) tusk, still attached to the animal deep under a barn that had burnt along with other buildings in the year 1536 in Thüngen near Würzburg. Members of the noble von Thüngen family occupied during the Renaissance important positions in the church, military, politics and commerce. Many supported Hans Thomas von Absberg in the so-called 'Fränkischer Krieg', a war that took place in 1523. The whole story of the finding of the tusk most probably is a myth, created to add further importance and ancestry at the object itself (and therefore also at the family who owned it). There is no known record of an eventful fire in Thüngen in 1536 and furthermore it is highly unlikely that a complete elephant -if so only a mammoth could be theoretically possible- could have been found under a building site in Thüngen at the time.
*This text herewith reproduced reads as follows:
ANNO.1536.AN.S.MARX TAG.25.APRILIS IST DER HOF ZV THVNGEN NEBEN NOCH.44.TACHEN ABGEBRANT.VND DARDVRCH DER ERWIRDIGVND EDEL HERR ANDREAS VON THVNGEN THVMHER ZV WIRTZB:VND PROBST ZV.S.BVRCHARD DOSELBST VERVRSACHT WORDEN.DEN SELBEN SEINEN BRVEDERN.VND ERBEN ZV EHREN WIDER VON GRVND VND AVF SEINEN EIGNEN CHOSTEN BAVEN ZV LASSEN VND IST .IM AVFBAVEN VNDER DER SCHEVRN DIS EINGEHVRN MIT SAMBT DEM THIER.SO GAR VERWESEN.XXIIII.WERCK SCHVCH TIEF.VNDER DER ERDEN.
Dr. Peter Volk and Dr. Lorenz Seelig of the Bayerisches Nationalmuseum in Munich, after studying this tusk in 1999, pointed out that the scenes from the passion of Christ are based on those by Albrecht Dürer, the so-called 'Kleine Kupferstichpassion'. The engraved text further specifically elaborates on the word 'Eingehvrn' -appropriately translated as Einhorn (unicorn)- and also terminates with a stylised representation of the twisted form of a unicorn tusk. A well kept secret especially known by apothecaries of the period was the fact the fabled unicorn did not exist and that every so called "unicorn" tusk actually came from a narwhal. It is easy to assume that -parallel to the story/myth of this tusk- a recipient of such a marine animal might have decided to bury the same until the tooth was needed to grind up into miraculous potions.
The tusk formerly was in the collection of the Duke of Trachenberg, Prince of Hatzfeldt of the Trachenberg Castle in Silesia (according to family tradition at least since the late 19th century). An identification of the present tusk with the so called Hatzfeldt'sche 'Einhorn' mentioned in the Hatzfeldt family inventories since 1743 however appealing seems to be very questionable.
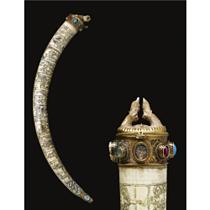
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 26. Dezember 2008, 22:10 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 26. Dezember 2008, 21:25 - Rubrik: Archivrecht
Wer nicht will, dass sein Vertragspartner seine Werke auf Arten nutzt, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch gar nicht bekannt waren, muss die „Nutzungsrechte für unbekannte Nutzungsarten“ bis zum 31.12.2008 zurückrufen. Das ergibt sich aus dem neuen § 137l des Urheberrechtsgesetzes, der seit Anfang 2008 in Kraft ist.
Bis Anfang 2008 waren Urheberrechtsverträge, mit denen Rechte auf „unbekannte Nutzungsarten“ eingeräumt wurden, schlicht verboten. Mit der Folge, dass die Verlage die Rechte zur Verbreitung z.B. von Büchern, Filmen, Musik, Hörspielen oder Illustrationen auf CD, DVD oder im Internet erst einmal erwerben mussten. Um ihnen dieses in ihren Augen viel zu mühselige Geschäft nicht noch einmal zuzumuten, wurde das Verbot der Einräumung von Rechten auf unbekannte Nutzungsarten mit der letzten Novelle des UrhG kurzerhand gestrichen. Und schlimmer noch: Mit der in § 137l fixierten Übergangsregelung erhalten die Verwerter diese Rechte automatisch rückwirkend für alle Verträge, die seit dem 1.1.1966 geschlossen wurden und „alle wesentlichen Nutzungsrechte ausschließlich sowie räumlich und zeitlich unbegrenzt“ einräumten (was z.B. bei Buchverträgen üblich ist). Einzige Chance, dem zu entkommen: Man muss noch im Jahre 2008 der Nutzung auf „unbekannte Nutzungsarten“ widersprechen.
Das ist allen zu empfehlen, die in der Vergangenheit Nutzungsverträge über etwas langlebigere Werke abgeschlossen haben. Hat man mit einem Verlag mehrere Verträge abgeschlossen, so genügt es, mit einem Brief formlos zu erklären: „Ich widerspreche hiermit der Nutzung aller meiner in Ihrem Verlag erschienenen Werke auf zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses unbekannte Nutzungarten“. Dann muss der Verlag vorher fragen.
Geht ein solcher Brief jedoch nicht mehr im alten Jahr beim Vertragspartner ein, so kann dieser jederzeit z.B. eine Hörbuch-CD eines bereits Ende der sechziger Jahre erschienenen Buches auflegen. Er muss den Autor nicht einmal davon informieren – es sei denn, die neue Nutzungsart wird erst nach dem 1.1.2008 bekannt – wie etwa ein mögliches Handy-Fernsehen. Aber auch dann muss der Verwerter den Autor lediglich “unter der ihm zuletzt bekannten Anschrift“ über das Vorhaben unterrichten. Die angemessene Vergütung, die dann fällig wird, kann nur über die Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden. Ein Verfahren hierzu gibt es freilich noch nicht.
Dieser Beitrag von
http://www.mediafon.net/meldung_volltext.php3?id=494e37a05335f&akt=news_recht
stellt korrekt und allgemeinverständlich die Sachlage dar.
Zum juristischen Hintergrund siehe die Materialien unter
http://archiv.twoday.net/stories/5408482/
Die Widerspruchsregelung ist eine Chance für Open Access, die es zu nutzen gilt, denn schlimmstenfalls können ab 1.1.2009 die Verlage eine Open-Access-Veröffentlichung aufgrund des ihnen zugewachsenen ausschließlichen Nutzungsrechts verhindern.
Im folgenden gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Eine ältere Fragensammlung auf Open-Access.net beantwortet speziellere Fragen:
http://open-access.net/de/allgemeines/rechtsfragen/urheberrechtsreform/aktuelle_fragen_zur_rechteuebertragung_in_bezug_auf_137l/
In welcher Form kann ich bis zum 31.12.2008 rechtswirksam widersprechen?
Für ein Einschreiben kann es knapp werden, denn der Widerspruch muss dem Verlag bis 31.12.2008 zugehen. Empfehlenswert ist ein Fax an den Verlag, wobei man die Absendung durch Sendeprotokoll oder Zeugen dokumentieren sollte.
Gibt es einen Musterwiderspruch?
Nicht nur einen. Siehe schon
http://archiv.twoday.net/stories/4637947/
Empfehlung des Urheberrechtsbündnisses:
http://www.urheberrechtsbuendnis.de/newsletter/docs/137.pdf
Gut gefällt mir das Göttinger Muster:
http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_2/2_aeltere_pub.html.de#anc_veroeffentl
Von mir abgewandelt:
[Betreff]: Widerspruch gegen die Übertragung der Online-Nutzungsrechte nach §137 l Urheberrechtsgesetz
[Text]: "Hiermit widerspreche ich der Übertragung ausschließlicher Nutzungsrechte zur Onlinebereitstellung meiner Publikationen
[Falls eine Rechteeinräumung an einen Schriftenserver erfolgte:
Der ... habe ich ein einfaches Nutzungsrecht zur Onlinebereitstellung eingeräumt. ]
Sind Sie daran interessiert, meine Publikationen online zu verbreiten oder über andere Dienste (z.B. Google Booksearch) anzubieten, so bitte ich um Information und bin gerne bereit, Ihnen ebenfalls ein einfaches Nutzungsrecht zu übertragen.
Alternativ könnte man formulieren:
"Hiermit widerspreche ich gemäß § 137 l der Übertragung der Online-Nutzungsrechte für alle meine Publikationen in Ihrem Verlag, soweit mich die Übertragungsfiktion nach dem 1.1.2009 daran hindert, selbst einfache Nutzungsrechte an den Publikationen zu vergeben. Sie erhalten also lediglich ein einfaches Online-Nutzungsrecht."
In diesem Fall hätte der Verlag ein ausschließliches Nutzungsrecht, aus dem das Online-Nutzungsrecht ausgeschnitten ist. Der Verlag hätte ein einfaches Nutzungsrecht, der Urheber könnte aber einem oder mehreren Repositorien Nutzungsrechte erteilen (die Möglichkeit, mehrere Male Nutzungsrechte an Repositorien vergeben zu dürfen kann in Betracht kommen, wenn ein Repositorium "dichtmacht" oder den Beitrag löscht).
Muss ich auch bei Aufsätzen widersprechen?
Das ist mit Blick auf § 38 UrhG in der Regel entbehrlich und nur dann nötig, wenn ein schriftlicher Verlagsvertrag geschlossen wurde, der dem Verlag die ausschließlichen Nutzungsrechte unbefristet übertrug. Bei Zeitschriftenaufsätzen und unvergüteten Festschriften- und Sammelbandbeiträgen kann kein ausschließliches Nutzungsrecht des verlags zum 1.1.2009 entstehen. (Teile des juristischen Schrifttums gehen davon aus, dass die Verlage einfache Nutzungsrechte für die Online-Veröffentlichung auch für die § 38-Fälle erhalten, was mir nicht einleuchtet.)
Auf jeden Fall widersprechen sollte man bei Büchern.
Ich bin Mitautor - müssen die anderen Autoren auch alle widersprechen?
Das ist umstritten. Steinhauer sagt: nein
http://bibliotheksrecht.blog.de/2007/12/04/s_137_l_urhg_und_mehrere_autoren~3394433
Wandtke/Bullinger 2007 § 137 l Rn. 78 sagen: ja. "Als Teil des
Urheberrechts unterliegt auch das Widerspruchsrecht der
gesamthänderischen Bindung (dazu § 8 Rn. 22 ff.) und die Ausübung des Widerspruchsrechts bedarf daher bereits gem. § 8 der Einwilligung aller Urheber."
Falls man die anderen Autoren nicht mehr kontaktieren kann, sollte man den Widerruf für sich allein absenden - wenn man Glück hat, akzeptiert der Verlag ihn.
Ich hab nix gewusst oder es nicht geschafft und wir haben 2009 - sind damit alle Chancen verpasst?
Nein, es besteht ja die Möglichkeit, dass die Verfassungsbeschwerde gegen § 137 l Erfolg hat oder die Gerichte bei der Auslegung zum Schluss kommen, dass die Verlage durch die Übertragungsfiktion nur ein einfaches Nutzungsrecht erhalten. Eine "Open Access"-Veröffentlichung wäre dann möglich.
Außerdem kann man, falls der Verlag nicht an ein Online-Angebot denkt, das betreffende Nutzungsrecht gemäß § 41 UrhG zurückrufen. Näheres unter
http://archiv.twoday.net/stories/4069056/
Alle Wissenschaftler sollten sicherheitshalber sich durch den fristgerechten Widerspruch zum 31.12.2008 die Möglichkeit sichern, ihre Fachbeträge (v.a. Bücher) ohne Zustimmung des Verlags "Open Access" zugänglich machen zu dürfen.
Bis Anfang 2008 waren Urheberrechtsverträge, mit denen Rechte auf „unbekannte Nutzungsarten“ eingeräumt wurden, schlicht verboten. Mit der Folge, dass die Verlage die Rechte zur Verbreitung z.B. von Büchern, Filmen, Musik, Hörspielen oder Illustrationen auf CD, DVD oder im Internet erst einmal erwerben mussten. Um ihnen dieses in ihren Augen viel zu mühselige Geschäft nicht noch einmal zuzumuten, wurde das Verbot der Einräumung von Rechten auf unbekannte Nutzungsarten mit der letzten Novelle des UrhG kurzerhand gestrichen. Und schlimmer noch: Mit der in § 137l fixierten Übergangsregelung erhalten die Verwerter diese Rechte automatisch rückwirkend für alle Verträge, die seit dem 1.1.1966 geschlossen wurden und „alle wesentlichen Nutzungsrechte ausschließlich sowie räumlich und zeitlich unbegrenzt“ einräumten (was z.B. bei Buchverträgen üblich ist). Einzige Chance, dem zu entkommen: Man muss noch im Jahre 2008 der Nutzung auf „unbekannte Nutzungsarten“ widersprechen.
Das ist allen zu empfehlen, die in der Vergangenheit Nutzungsverträge über etwas langlebigere Werke abgeschlossen haben. Hat man mit einem Verlag mehrere Verträge abgeschlossen, so genügt es, mit einem Brief formlos zu erklären: „Ich widerspreche hiermit der Nutzung aller meiner in Ihrem Verlag erschienenen Werke auf zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses unbekannte Nutzungarten“. Dann muss der Verlag vorher fragen.
Geht ein solcher Brief jedoch nicht mehr im alten Jahr beim Vertragspartner ein, so kann dieser jederzeit z.B. eine Hörbuch-CD eines bereits Ende der sechziger Jahre erschienenen Buches auflegen. Er muss den Autor nicht einmal davon informieren – es sei denn, die neue Nutzungsart wird erst nach dem 1.1.2008 bekannt – wie etwa ein mögliches Handy-Fernsehen. Aber auch dann muss der Verwerter den Autor lediglich “unter der ihm zuletzt bekannten Anschrift“ über das Vorhaben unterrichten. Die angemessene Vergütung, die dann fällig wird, kann nur über die Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden. Ein Verfahren hierzu gibt es freilich noch nicht.
Dieser Beitrag von
http://www.mediafon.net/meldung_volltext.php3?id=494e37a05335f&akt=news_recht
stellt korrekt und allgemeinverständlich die Sachlage dar.
Zum juristischen Hintergrund siehe die Materialien unter
http://archiv.twoday.net/stories/5408482/
Die Widerspruchsregelung ist eine Chance für Open Access, die es zu nutzen gilt, denn schlimmstenfalls können ab 1.1.2009 die Verlage eine Open-Access-Veröffentlichung aufgrund des ihnen zugewachsenen ausschließlichen Nutzungsrechts verhindern.
Im folgenden gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Eine ältere Fragensammlung auf Open-Access.net beantwortet speziellere Fragen:
http://open-access.net/de/allgemeines/rechtsfragen/urheberrechtsreform/aktuelle_fragen_zur_rechteuebertragung_in_bezug_auf_137l/
In welcher Form kann ich bis zum 31.12.2008 rechtswirksam widersprechen?
Für ein Einschreiben kann es knapp werden, denn der Widerspruch muss dem Verlag bis 31.12.2008 zugehen. Empfehlenswert ist ein Fax an den Verlag, wobei man die Absendung durch Sendeprotokoll oder Zeugen dokumentieren sollte.
Gibt es einen Musterwiderspruch?
Nicht nur einen. Siehe schon
http://archiv.twoday.net/stories/4637947/
Empfehlung des Urheberrechtsbündnisses:
http://www.urheberrechtsbuendnis.de/newsletter/docs/137.pdf
Gut gefällt mir das Göttinger Muster:
http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_2/2_aeltere_pub.html.de#anc_veroeffentl
Von mir abgewandelt:
[Betreff]: Widerspruch gegen die Übertragung der Online-Nutzungsrechte nach §137 l Urheberrechtsgesetz
[Text]: "Hiermit widerspreche ich der Übertragung ausschließlicher Nutzungsrechte zur Onlinebereitstellung meiner Publikationen
[Falls eine Rechteeinräumung an einen Schriftenserver erfolgte:
Der ... habe ich ein einfaches Nutzungsrecht zur Onlinebereitstellung eingeräumt. ]
Sind Sie daran interessiert, meine Publikationen online zu verbreiten oder über andere Dienste (z.B. Google Booksearch) anzubieten, so bitte ich um Information und bin gerne bereit, Ihnen ebenfalls ein einfaches Nutzungsrecht zu übertragen.
Alternativ könnte man formulieren:
"Hiermit widerspreche ich gemäß § 137 l der Übertragung der Online-Nutzungsrechte für alle meine Publikationen in Ihrem Verlag, soweit mich die Übertragungsfiktion nach dem 1.1.2009 daran hindert, selbst einfache Nutzungsrechte an den Publikationen zu vergeben. Sie erhalten also lediglich ein einfaches Online-Nutzungsrecht."
In diesem Fall hätte der Verlag ein ausschließliches Nutzungsrecht, aus dem das Online-Nutzungsrecht ausgeschnitten ist. Der Verlag hätte ein einfaches Nutzungsrecht, der Urheber könnte aber einem oder mehreren Repositorien Nutzungsrechte erteilen (die Möglichkeit, mehrere Male Nutzungsrechte an Repositorien vergeben zu dürfen kann in Betracht kommen, wenn ein Repositorium "dichtmacht" oder den Beitrag löscht).
Muss ich auch bei Aufsätzen widersprechen?
Das ist mit Blick auf § 38 UrhG in der Regel entbehrlich und nur dann nötig, wenn ein schriftlicher Verlagsvertrag geschlossen wurde, der dem Verlag die ausschließlichen Nutzungsrechte unbefristet übertrug. Bei Zeitschriftenaufsätzen und unvergüteten Festschriften- und Sammelbandbeiträgen kann kein ausschließliches Nutzungsrecht des verlags zum 1.1.2009 entstehen. (Teile des juristischen Schrifttums gehen davon aus, dass die Verlage einfache Nutzungsrechte für die Online-Veröffentlichung auch für die § 38-Fälle erhalten, was mir nicht einleuchtet.)
Auf jeden Fall widersprechen sollte man bei Büchern.
Ich bin Mitautor - müssen die anderen Autoren auch alle widersprechen?
Das ist umstritten. Steinhauer sagt: nein
http://bibliotheksrecht.blog.de/2007/12/04/s_137_l_urhg_und_mehrere_autoren~3394433
Wandtke/Bullinger 2007 § 137 l Rn. 78 sagen: ja. "Als Teil des
Urheberrechts unterliegt auch das Widerspruchsrecht der
gesamthänderischen Bindung (dazu § 8 Rn. 22 ff.) und die Ausübung des Widerspruchsrechts bedarf daher bereits gem. § 8 der Einwilligung aller Urheber."
Falls man die anderen Autoren nicht mehr kontaktieren kann, sollte man den Widerruf für sich allein absenden - wenn man Glück hat, akzeptiert der Verlag ihn.
Ich hab nix gewusst oder es nicht geschafft und wir haben 2009 - sind damit alle Chancen verpasst?
Nein, es besteht ja die Möglichkeit, dass die Verfassungsbeschwerde gegen § 137 l Erfolg hat oder die Gerichte bei der Auslegung zum Schluss kommen, dass die Verlage durch die Übertragungsfiktion nur ein einfaches Nutzungsrecht erhalten. Eine "Open Access"-Veröffentlichung wäre dann möglich.
Außerdem kann man, falls der Verlag nicht an ein Online-Angebot denkt, das betreffende Nutzungsrecht gemäß § 41 UrhG zurückrufen. Näheres unter
http://archiv.twoday.net/stories/4069056/
Alle Wissenschaftler sollten sicherheitshalber sich durch den fristgerechten Widerspruch zum 31.12.2008 die Möglichkeit sichern, ihre Fachbeträge (v.a. Bücher) ohne Zustimmung des Verlags "Open Access" zugänglich machen zu dürfen.
KlausGraf - am Freitag, 26. Dezember 2008, 03:34 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.grur.de/cms/upload/pdf/stellungnahmen/2008/2008-11-25_GRUR_Stn_Gruenbuch_wissensbestimmte_Wirtschaft.pdf
Die Stellungnahme zum Problem der verwaisten Werke verkennt die riesige Bedeutung des Problems auch in Deutschland. § 137 l UrhG hat entgegen der Ansicht der Vereinigung, die im übrigen strikt die Position der Verwerterlobby gegen Archive und Bibliotheken vertritt, keine wesentliche Verbesserung gebracht. Wiederholt wird der längst widerlegte Irrtum, dass die Dreimonatsfrist auch für 2008 Gültigkeit hat.
Siehe nur Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, 3. Aufl. 2009 § 137 l Rn. 53: "Der Verwerter kann in Bezug auf bereits bekannte Nutzungsarten die Frist nicht auf drei Monate verkürzen, indem er dem Urheber die beabsichtigte Nutzung mitteilt (a. A.
Mestmäcker/Schulze/Scholz § 137 l Rn. 38; Kreile ZUM 2007, 682, 686; Bauer/ v. Einem MMR 2006, 698, 701)."
Siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/5408482/
Nachtrag: Auch Wikimedia Deutschland hat eine Stellungnahme abgegeben, die in eine ganz andere Richtung geht:
http://blog.wikimedia.de/2008/12/13/stellungnahme-grunbuch/
Die Stellungnahme zum Problem der verwaisten Werke verkennt die riesige Bedeutung des Problems auch in Deutschland. § 137 l UrhG hat entgegen der Ansicht der Vereinigung, die im übrigen strikt die Position der Verwerterlobby gegen Archive und Bibliotheken vertritt, keine wesentliche Verbesserung gebracht. Wiederholt wird der längst widerlegte Irrtum, dass die Dreimonatsfrist auch für 2008 Gültigkeit hat.
Siehe nur Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, 3. Aufl. 2009 § 137 l Rn. 53: "Der Verwerter kann in Bezug auf bereits bekannte Nutzungsarten die Frist nicht auf drei Monate verkürzen, indem er dem Urheber die beabsichtigte Nutzung mitteilt (a. A.
Mestmäcker/Schulze/Scholz § 137 l Rn. 38; Kreile ZUM 2007, 682, 686; Bauer/ v. Einem MMR 2006, 698, 701)."
Siehe auch http://archiv.twoday.net/stories/5408482/
Nachtrag: Auch Wikimedia Deutschland hat eine Stellungnahme abgegeben, die in eine ganz andere Richtung geht:
http://blog.wikimedia.de/2008/12/13/stellungnahme-grunbuch/
KlausGraf - am Freitag, 26. Dezember 2008, 03:01 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Am 31.12.2008 läuft die einjährige Widerspruchsfrist nach § 137 l UrhG (Altverträge 1966-2007) aus. Die Stellungnahmen dazu sind zahlreich, die wichtigsten werden im folgenden zusammengetragen, wobei freie Volltexte und Zusammenfassungen/Kommentare im Internet vermerkt werden, soweit mir bekannt geworden.
[Wer noch reagieren will, kann zunächst
http://archiv.twoday.net/stories/5408494/ lesen.]
Gedruckte Aufsätze und Monographien
(aus Wandtke/Bullinger 2009 mit Ergänzungen: Heckmann, ZfBB 2007; Graf, Kunstchronik 2007)
Bauer/v. Einem, Handy-TV – Lizenzierung von Urheberrechten
unter Berücksichtigung des „2. Korbes", MMR 2007, 698
Berger, Verträge über unbekannte Nutzungsarten nach dem „Zweiten Korb", GRUR 2005, 907
Siehe
http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/07/01/berger-zu-unbekannten-nutzungsarten-4388779
Breinersdorfer, Thesen zum Problem der Behandlung
unbekannter Nutzungsarten für urheberrechtlich geschützte Werke aus Sicht von Autoren und Produzenten, ZUM 2007, 700;
Castendyk/Kirchherr, Das Verbot der Übertragung von Rechten an nicht bekannten Nutzungsarten – Erste Überlegungen für eine Reform des § 31 Abs. 4 UrhG, ZUM 2003, 751
Czychowski, „Wenn der dritte Korb aufgemacht wird
. . ." – Das zweite Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der
Informationsgesellschaft, GRUR 2008, 586
Ehmann/Fischer, Zweitverwertung rechtswissenschaftlicher Texte im Internet, GRUR Int. 2008, 284
Siehe
http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/06/10/aufsatz-zur-zweitveraouml-ffentlichung-w-4296282
Flechsig, Der Zweite Korb zur Verbesserung der Urheber- und
Leistungsschutzrechte, ZRP 2006, 145
Frey/Rudolf, Verfügungen über
unbekannte Nutzungsarten: Anmerkungen zum Regierungsentwurf des Zweiten Korbs, ZUM 2007, 13
Siehe
http://bibliotheksrecht.blog.de/2007/02/22/unbekannte_nutzungsart_im_zweiten_korb~1786322
Graf, Neues Urheberrecht: Autoren müssen reagieren, Kunstchronik 60 (2007), 530-523
Online:
http://archiv.twoday.net/stories/4477889/
Grohmann, Die Übertragungsfiktion für unbekannte Nutzungsrechte nach dem Zweiten Korb am Beispiel des Musikverlagsvertrags, GRUR 2008, S. 1056-1061 [Nachtrag, siehe
http://archiv.twoday.net/stories/5450910/ ]
Heckmann, Das Widerrufsrecht des Urhebers gem. § 137 l Abs. 1 UrhG in der Praxis, ZfBB 54 (2007), 315-321
Siehe
http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/01/15/der_widerspruch_bei_s_137l_urhg~3581544
http://archiv.twoday.net/stories/4637947/
Hilty, Urheberrecht und Wissenschaft in
Sieber, Hoeren (Hg.) Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft, Bonn 2005, 174 ff.
Online:
http://www.dini.de/fileadmin/docs/HRK-Publikation_Urheberrecht_04-2005.pdf
Hoeren, Der 2. Korb der Urheberrechtsreform – eine
Stellungnahme aus der Sicht der Wissenschaft, ZUM 2004, 885
Online:
http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/INHALTE/publikationen/zum_2004_12.pdf
Hoeren, Der Zweite Korb – Eine Übersicht zu den geplanten Änderungen im Urheberrechtsgesetz, MMR 2007, 615
Online:
http://128.176.101.170/hoeren_veroeffentlichungen/der_zweite_korb.pdf
Hucko, Zweiter Korb – Das
Urheberrecht in der Informationsgesellschaft, München 2007
Inhaltsverzeichnis:
http://www.ulb.tu-darmstadt.de/tocs/194129837.pdf
Initiative Urheberrecht, Stellungnahme zum Regierungsentwurf für ein Zweites Gesetz zur Regelung des Urheberrecht in der Informationsgesellschaft vom 3. 11. 2006
Online:
http://www.urheber.info/Neue_Dateien/Stellungnahme%20Initiative%20Urheberrecht.pdf
Jani, Der Buy-out-Vertrag im Urheberrecht, Berlin
2003
Jani, Urheberrechtspolitik in der 14. und 15. Legislaturperiode
des Deutschen Bundestags, UFITA 2006/II, 511
Klickermann, Sendearchive im Fokus unbekannter Nutzungsarten, MMR 2007, 221
Klöhn, Unbekannte Nutzungsarten nach dem „Zweiten Korb" der
Urheberrechtsreform, K&R 2008, 77
Siehe
http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/05/07/aufsatz-von-klohn-uber-unbekannte-nutzun-4142277
Kreile, Neue Nutzungsarten – Neue
Organisation der Rechteverwaltung? Zur Neuregelung des § 31 Abs. 4
UrhG, ZUM 2007, 682
Langhoff/Oberndörfer/Jani, Der „Zweite Korb" der
Urheberrechtsreform – ein Überblick über die Änderungen des
Urheberrechts nach der zweiten und dritten Lesung im Bundestag, ZUM 2007, 593
Nordemann, J. B./Nordemann, W., Für eine Abschaffung des §
31 IV UrhG im Filmbereich, GRUR 2003, 947
Schaefer, Vom Nutzen neuer
Nutzungsarten, FS Nordemann 2004, 227
Schulze, Die Einräumung
unbekannter Nutzungsrechte nach neuem Urheberrecht, UFITA 2007/III, 641
Spindler, Reform des Urheberrechts im „Zweiten Korb", NJW 2008,
9
Siehe
http://archiv.twoday.net/stories/4643243/
http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/01/25/spindler_zum_zweiten_korb~3629529
Spindler/Heckmann, Der rückwirkende Entfall unbekannter
Nutzungsrechte (§ 137 l UrhG-E) Schließt die Archive?, ZUM 2006, 620
Online
http://lehrstuhl-spindler.uni-goettingen.de/pub/web/fileadmin/ZUM_8_2006.pdf
Siehe
http://bibliotheksrecht.blog.de/2006/09/15/unbekannte_nutzungsrechte_in_korb_zwei~1127500
Spindler/Heckmann, Retrodigitalisierung verwaister Printpublikationen – Die Nutzungsmöglichkeiten von „orphan works" de lege lata und ferenda, GRUR Int. 2008, 271
Siehe
http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/06/02/zur-digitalisierung-verwaister-werke-4258245
Sprang/Ackermann, Der „Zweite Korb" aus
Sicht der (Wissenschafts-)Verlage, K&R 2008, 7
Siehe
http://archiv.twoday.net/stories/4708522/
http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/01/23/sprang_und_ackermann_zum_zweiten_korb_ei~3621672
Staudt, Die Rechtsübertragung in Berechtigungsvertrag der GEMA, Berlin 2006
Wandtke, Aufstieg und Fall des § 31 Abs. 4 UrhG?, FS Nordemann 2004, 267
Weber, Neue Nutzungsarten – Neue Organisation der
Rechteverwaltung? – Die Sicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks,
ZUM 2007, 688
Kommentare
Dreier/Schulze, Urheberrecht, 3. Aufl. 2008 (nicht verwertet)
Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 10. Aufl. 2008
Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, 3. Aufl. 2009 [bereits erschienen, online im "großen Beck"]
Materialien im Netz
Börsenverein, [Handreichung für Verlage], Dez. 2007
http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/976/Merkblatt%20unbekannte%20Nutzungsarten%2020071212.pdf
Siehe dazu
http://archiv.twoday.net/stories/4552355/
Deutsche Physikalische Gesellschaft [Information über Widerspruchsrecht 26.6.2008]
http://www.dpg-physik.de/gliederung/ak/aki/dokumente/DPGNovellierungUrheberrecht.pdf
DFN-Infobrief, Januar 2008
http://www.dfn.de/fileadmin/3Beratung/Recht/1infobriefearchiv/Infobrief_01_08.pdf
Fälsch, Verträge über unbekannte Nutzungsarten
http://www.bibliotheksverband.de/ko-recht/dokumente/137_l_%20UrhG.pdf
bzw. Bibliotheksdienst 42 (2008), 409-419:
http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/heftinhalte2008/Recht010408BD.pdf
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/volltexte/2008/8565/
Siehe kritisch dazu
http://archiv.twoday.net/stories/4784896/
http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/03/14/dbv-rechtskommission-zu-den-unbekannten--3875019
Graf, Urheberrechtsnovelle - Jetzt noch Nutzungsrechte sichern!. In: H-Soz-u-Kult, 14.12.2007,
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/type=diskussionen&id=956
GRUR [Stellungnahme zum Grünbuch], 25.11.2008
http://www.grur.de/cms/upload/pdf/stellungnahmen/2008/2008-11-25_GRUR_Stn_Gruenbuch_wissensbestimmte_Wirtschaft.pdf
Kritisch dazu
http://archiv.twoday.net/stories/5408481/
Herb, Das Aussterben einer unbekannten Nutzungsart, Telepolis 31.12.2007
http://scidok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2008/1416/
Hoeren, Internetrecht, Skript Sept. 2008, S. 183 ff.
http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/Skript/Skript_September2008.pdf
Klostermann-Verlag [Stellungnahme zu den Widersprüchen]
http://www.klostermann.de/verlegen/vek_8.htm
Max-Planck-Gesellschaft [FAQ zu § 137 l UrhG]
http://colab.mpdl.mpg.de/mediawiki/Open_Access_Copyright_de_137l
Siehe kritisch dazu
http://archiv.twoday.net/stories/4638822/
Open-Access.net [FAQ zu § 137 l]
http://open-access.net/de/allgemeines/rechtsfragen/urheberrechtsreform/aktuelle_fragen_zur_rechteuebertragung_in_bezug_auf_137l/
Steinhauer, § 137 l nach dem 1. Januar 2008
http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/01/06/s137_l_urhg_nach_dem_1_januar~3537639
Siehe dazu
http://archiv.twoday.net/stories/4589065/
UB Heidelberg [Linksammlung]
http://www.ub.uni-heidelberg.de/allg/profil/jurbasics/urheberrecht.html
Urheberrechtsbündnis [Newsletter, undatiert, vermutlich November 2008]
http://www.urheberrechtsbuendnis.de/newsletter/docs/137.pdf
Verch, Urteilsanmerkung
http://www.jurpc.de/aufsatz/20080088.htm
Beiträge in Archivalia in Auswahl
Soweit oben nicht bereits angeführt.
[Antwort auf die Zurückweisung meiner Vorwürfe in Infobib]
http://archiv.twoday.net/stories/5417109/
Siehe
http://infobib.de/blog/2008/12/30/klaus-graf-vs-das-bibliothekswesen-open-access/
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg37920.html
Letzte Chance: Unbekannte Nutzungsrechte zurückrufen!
http://archiv.twoday.net/stories/5408494/
Altverträge vor dem 1.1.1966
http://archiv.twoday.net/stories/5393192/
Verfassungsbeschwerde gegen § 137 l UrhG
http://archiv.twoday.net/stories/4673960/
[Zusammenfassende Stellungnahme Jan. 2008]
http://archiv.twoday.net/stories/4589065/
Musterbriefe zum Widerspruch
http://archiv.twoday.net/stories/4637947/
Siehe dazu auch den Textvorschlag von anwalt.de und wichtiger derjenige der SUB Göttingen:
http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_2/2_aeltere_pub.html.de
[Fristendiskussion 31.12.2007]
http://archiv.twoday.net/stories/4572178/
[Wer informierte 2007 über die Widerrufsmöglichkeit?]
http://archiv.twoday.net/stories/4535435/
[Rückrufrecht nach § 41 UrhG]
http://archiv.twoday.net/stories/4069056/
[Wer noch reagieren will, kann zunächst
http://archiv.twoday.net/stories/5408494/ lesen.]
Gedruckte Aufsätze und Monographien
(aus Wandtke/Bullinger 2009 mit Ergänzungen: Heckmann, ZfBB 2007; Graf, Kunstchronik 2007)
Bauer/v. Einem, Handy-TV – Lizenzierung von Urheberrechten
unter Berücksichtigung des „2. Korbes", MMR 2007, 698
Berger, Verträge über unbekannte Nutzungsarten nach dem „Zweiten Korb", GRUR 2005, 907
Siehe
http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/07/01/berger-zu-unbekannten-nutzungsarten-4388779
Breinersdorfer, Thesen zum Problem der Behandlung
unbekannter Nutzungsarten für urheberrechtlich geschützte Werke aus Sicht von Autoren und Produzenten, ZUM 2007, 700;
Castendyk/Kirchherr, Das Verbot der Übertragung von Rechten an nicht bekannten Nutzungsarten – Erste Überlegungen für eine Reform des § 31 Abs. 4 UrhG, ZUM 2003, 751
Czychowski, „Wenn der dritte Korb aufgemacht wird
. . ." – Das zweite Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der
Informationsgesellschaft, GRUR 2008, 586
Ehmann/Fischer, Zweitverwertung rechtswissenschaftlicher Texte im Internet, GRUR Int. 2008, 284
Siehe
http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/06/10/aufsatz-zur-zweitveraouml-ffentlichung-w-4296282
Flechsig, Der Zweite Korb zur Verbesserung der Urheber- und
Leistungsschutzrechte, ZRP 2006, 145
Frey/Rudolf, Verfügungen über
unbekannte Nutzungsarten: Anmerkungen zum Regierungsentwurf des Zweiten Korbs, ZUM 2007, 13
Siehe
http://bibliotheksrecht.blog.de/2007/02/22/unbekannte_nutzungsart_im_zweiten_korb~1786322
Graf, Neues Urheberrecht: Autoren müssen reagieren, Kunstchronik 60 (2007), 530-523
Online:
http://archiv.twoday.net/stories/4477889/
Grohmann, Die Übertragungsfiktion für unbekannte Nutzungsrechte nach dem Zweiten Korb am Beispiel des Musikverlagsvertrags, GRUR 2008, S. 1056-1061 [Nachtrag, siehe
http://archiv.twoday.net/stories/5450910/ ]
Heckmann, Das Widerrufsrecht des Urhebers gem. § 137 l Abs. 1 UrhG in der Praxis, ZfBB 54 (2007), 315-321
Siehe
http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/01/15/der_widerspruch_bei_s_137l_urhg~3581544
http://archiv.twoday.net/stories/4637947/
Hilty, Urheberrecht und Wissenschaft in
Sieber, Hoeren (Hg.) Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft, Bonn 2005, 174 ff.
Online:
http://www.dini.de/fileadmin/docs/HRK-Publikation_Urheberrecht_04-2005.pdf
Hoeren, Der 2. Korb der Urheberrechtsreform – eine
Stellungnahme aus der Sicht der Wissenschaft, ZUM 2004, 885
Online:
http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/INHALTE/publikationen/zum_2004_12.pdf
Hoeren, Der Zweite Korb – Eine Übersicht zu den geplanten Änderungen im Urheberrechtsgesetz, MMR 2007, 615
Online:
http://128.176.101.170/hoeren_veroeffentlichungen/der_zweite_korb.pdf
Hucko, Zweiter Korb – Das
Urheberrecht in der Informationsgesellschaft, München 2007
Inhaltsverzeichnis:
http://www.ulb.tu-darmstadt.de/tocs/194129837.pdf
Initiative Urheberrecht, Stellungnahme zum Regierungsentwurf für ein Zweites Gesetz zur Regelung des Urheberrecht in der Informationsgesellschaft vom 3. 11. 2006
Online:
http://www.urheber.info/Neue_Dateien/Stellungnahme%20Initiative%20Urheberrecht.pdf
Jani, Der Buy-out-Vertrag im Urheberrecht, Berlin
2003
Jani, Urheberrechtspolitik in der 14. und 15. Legislaturperiode
des Deutschen Bundestags, UFITA 2006/II, 511
Klickermann, Sendearchive im Fokus unbekannter Nutzungsarten, MMR 2007, 221
Klöhn, Unbekannte Nutzungsarten nach dem „Zweiten Korb" der
Urheberrechtsreform, K&R 2008, 77
Siehe
http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/05/07/aufsatz-von-klohn-uber-unbekannte-nutzun-4142277
Kreile, Neue Nutzungsarten – Neue
Organisation der Rechteverwaltung? Zur Neuregelung des § 31 Abs. 4
UrhG, ZUM 2007, 682
Langhoff/Oberndörfer/Jani, Der „Zweite Korb" der
Urheberrechtsreform – ein Überblick über die Änderungen des
Urheberrechts nach der zweiten und dritten Lesung im Bundestag, ZUM 2007, 593
Nordemann, J. B./Nordemann, W., Für eine Abschaffung des §
31 IV UrhG im Filmbereich, GRUR 2003, 947
Schaefer, Vom Nutzen neuer
Nutzungsarten, FS Nordemann 2004, 227
Schulze, Die Einräumung
unbekannter Nutzungsrechte nach neuem Urheberrecht, UFITA 2007/III, 641
Spindler, Reform des Urheberrechts im „Zweiten Korb", NJW 2008,
9
Siehe
http://archiv.twoday.net/stories/4643243/
http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/01/25/spindler_zum_zweiten_korb~3629529
Spindler/Heckmann, Der rückwirkende Entfall unbekannter
Nutzungsrechte (§ 137 l UrhG-E) Schließt die Archive?, ZUM 2006, 620
Online
http://lehrstuhl-spindler.uni-goettingen.de/pub/web/fileadmin/ZUM_8_2006.pdf
Siehe
http://bibliotheksrecht.blog.de/2006/09/15/unbekannte_nutzungsrechte_in_korb_zwei~1127500
Spindler/Heckmann, Retrodigitalisierung verwaister Printpublikationen – Die Nutzungsmöglichkeiten von „orphan works" de lege lata und ferenda, GRUR Int. 2008, 271
Siehe
http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/06/02/zur-digitalisierung-verwaister-werke-4258245
Sprang/Ackermann, Der „Zweite Korb" aus
Sicht der (Wissenschafts-)Verlage, K&R 2008, 7
Siehe
http://archiv.twoday.net/stories/4708522/
http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/01/23/sprang_und_ackermann_zum_zweiten_korb_ei~3621672
Staudt, Die Rechtsübertragung in Berechtigungsvertrag der GEMA, Berlin 2006
Wandtke, Aufstieg und Fall des § 31 Abs. 4 UrhG?, FS Nordemann 2004, 267
Weber, Neue Nutzungsarten – Neue Organisation der
Rechteverwaltung? – Die Sicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks,
ZUM 2007, 688
Kommentare
Dreier/Schulze, Urheberrecht, 3. Aufl. 2008 (nicht verwertet)
Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 10. Aufl. 2008
Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, 3. Aufl. 2009 [bereits erschienen, online im "großen Beck"]
Materialien im Netz
Börsenverein, [Handreichung für Verlage], Dez. 2007
http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/976/Merkblatt%20unbekannte%20Nutzungsarten%2020071212.pdf
Siehe dazu
http://archiv.twoday.net/stories/4552355/
Deutsche Physikalische Gesellschaft [Information über Widerspruchsrecht 26.6.2008]
http://www.dpg-physik.de/gliederung/ak/aki/dokumente/DPGNovellierungUrheberrecht.pdf
DFN-Infobrief, Januar 2008
http://www.dfn.de/fileadmin/3Beratung/Recht/1infobriefearchiv/Infobrief_01_08.pdf
Fälsch, Verträge über unbekannte Nutzungsarten
http://www.bibliotheksverband.de/ko-recht/dokumente/137_l_%20UrhG.pdf
bzw. Bibliotheksdienst 42 (2008), 409-419:
http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/heftinhalte2008/Recht010408BD.pdf
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/volltexte/2008/8565/
Siehe kritisch dazu
http://archiv.twoday.net/stories/4784896/
http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/03/14/dbv-rechtskommission-zu-den-unbekannten--3875019
Graf, Urheberrechtsnovelle - Jetzt noch Nutzungsrechte sichern!. In: H-Soz-u-Kult, 14.12.2007,
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/type=diskussionen&id=956
GRUR [Stellungnahme zum Grünbuch], 25.11.2008
http://www.grur.de/cms/upload/pdf/stellungnahmen/2008/2008-11-25_GRUR_Stn_Gruenbuch_wissensbestimmte_Wirtschaft.pdf
Kritisch dazu
http://archiv.twoday.net/stories/5408481/
Herb, Das Aussterben einer unbekannten Nutzungsart, Telepolis 31.12.2007
http://scidok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2008/1416/
Hoeren, Internetrecht, Skript Sept. 2008, S. 183 ff.
http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/Skript/Skript_September2008.pdf
Klostermann-Verlag [Stellungnahme zu den Widersprüchen]
http://www.klostermann.de/verlegen/vek_8.htm
Max-Planck-Gesellschaft [FAQ zu § 137 l UrhG]
http://colab.mpdl.mpg.de/mediawiki/Open_Access_Copyright_de_137l
Siehe kritisch dazu
http://archiv.twoday.net/stories/4638822/
Open-Access.net [FAQ zu § 137 l]
http://open-access.net/de/allgemeines/rechtsfragen/urheberrechtsreform/aktuelle_fragen_zur_rechteuebertragung_in_bezug_auf_137l/
Steinhauer, § 137 l nach dem 1. Januar 2008
http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/01/06/s137_l_urhg_nach_dem_1_januar~3537639
Siehe dazu
http://archiv.twoday.net/stories/4589065/
UB Heidelberg [Linksammlung]
http://www.ub.uni-heidelberg.de/allg/profil/jurbasics/urheberrecht.html
Urheberrechtsbündnis [Newsletter, undatiert, vermutlich November 2008]
http://www.urheberrechtsbuendnis.de/newsletter/docs/137.pdf
Verch, Urteilsanmerkung
http://www.jurpc.de/aufsatz/20080088.htm
Beiträge in Archivalia in Auswahl
Soweit oben nicht bereits angeführt.
[Antwort auf die Zurückweisung meiner Vorwürfe in Infobib]
http://archiv.twoday.net/stories/5417109/
Siehe
http://infobib.de/blog/2008/12/30/klaus-graf-vs-das-bibliothekswesen-open-access/
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg37920.html
Letzte Chance: Unbekannte Nutzungsrechte zurückrufen!
http://archiv.twoday.net/stories/5408494/
Altverträge vor dem 1.1.1966
http://archiv.twoday.net/stories/5393192/
Verfassungsbeschwerde gegen § 137 l UrhG
http://archiv.twoday.net/stories/4673960/
[Zusammenfassende Stellungnahme Jan. 2008]
http://archiv.twoday.net/stories/4589065/
Musterbriefe zum Widerspruch
http://archiv.twoday.net/stories/4637947/
Siehe dazu auch den Textvorschlag von anwalt.de und wichtiger derjenige der SUB Göttingen:
http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_2/2_aeltere_pub.html.de
[Fristendiskussion 31.12.2007]
http://archiv.twoday.net/stories/4572178/
[Wer informierte 2007 über die Widerrufsmöglichkeit?]
http://archiv.twoday.net/stories/4535435/
[Rückrufrecht nach § 41 UrhG]
http://archiv.twoday.net/stories/4069056/
KlausGraf - am Freitag, 26. Dezember 2008, 00:18 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Kurze Interpretation dieses raffinierten Gemäldes im Weblog Lines and Colors:
http://www.linesandcolors.com/
Auf Wikimedia Commons ist eine manipulierte Version ohne den Rahmen zu sehen, obwohl er das Bemerkenswerteste am Bild ist:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petrus_Christus_002.jpg
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kurier#Digitale_Regalmeter_f.C3.BCr_lange_Winterabende
http://de.wikisource.org/wiki/Allgemeine_Deutsche_Biographie
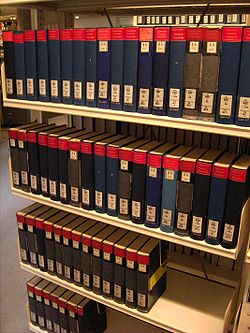
http://de.wikisource.org/wiki/Allgemeine_Deutsche_Biographie
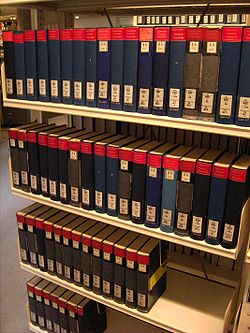
KlausGraf - am Donnerstag, 25. Dezember 2008, 20:29 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://catalogue.wellcome.ac.uk/record=b1657942
KlausGraf - am Donnerstag, 25. Dezember 2008, 20:17 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die neue Version von Europeana http://www.europeana.eu weist erhebliche Fortschritte auf:
* Die Datenbasis wurde erheblich erweitert
* Die falsche Anzeige der Metadaten ist korrigiert, es wird nun der komplette Titel angezeigt
Es bleibt jedoch noch genügend zu kritisieren.
Aktennotiz von Direktor Dr. Dr. Miller über die Zustimmung des Hauses Württemberg zu den Wappenentwürfen des Staatsarchivs Stuttgart
1952
Provider: Landesarchiv Baden-Württemberg
Language: de
Format: Sachakten
Source: Landesarchiv Baden-Württemberg: Hauptstaatsarchiv Stuttgart
http://www.landesarchiv-bw.de/hstas
More
Less
Subject: Württemberg, Albrecht Eugen, Herzog, Württemberg, Philipp Albrecht, Herzog, Württemberg; Albrecht Eugen Herzog von, Württemberg; Philipp Albrecht Herzog von, Lindach, Schwäbisch Gmünd, AA; Schloss, Stuttgart, S; Württembergische Archivdirektion, Landesflagge, Landeswappen
Date: 1952-01-01/1952-12-31
Relations: https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olb/struktur.php?archiv=1&sprungId=4710
https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=4710&sprungId=32131&letztesLimit=suchen
Vorentwürfe für das baden-württembergische Landeswappen
Hier fehlt das Entscheidende, nämlich die Signatur des Archivales:
Hauptstaatsarchiv Stuttgart EA 99/002 Nr. 31
Dass der Klick auf das Bild nicht zu einer vergrößerbaren Ansicht führt, sondern zu einem unbrauchbaren nicht vergrößerbaren Thumbnail ist auch bei anderen Anbietern zu beobachten. Problematisch ist auch, wenn man über den Anbieterlink oder den Klick auf das Bild zu einer Bildpräsentation ohne Metadaten gelangt:
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:IISG01:30051000757614
Das ist dann hochproblematisch, wenn die Europeana Metadaten spärlich oder lückenhaft sind, da die Chancen dann gering sind, ohne spezielle Vorkenntnisse über die Suchfunktion des Anbieters die Metadaten des Anbieters aufzufinden!
Große Anbieter, für D ist vor allem die Fotothek in Dresden zu nennen, haben Probleme, Thumbnails zu generieren. Die Vorschau zeigt also nur den Typ an.

Dabei ergeben sich sehr häufig falsche Zuordnungen. Bei der Suche nach Schwäbisch Gmünd wird nur ein einziges Bild gefunden, obwohl die 34 Treffer der Saxon State Library (= Fotothek) alle Bilder sind.
Die Trefferliste mit den Vorschaubildern enthält zu wenige Informationen, der Bildtitel ist zu wenig aussagekräftig. Sehr oft dind die Daten irreführend (Digitalisierungsdatum statt Entstehungsdatum).
Nicht selten rätselt man, woher ein gefundener Begriff stammt, den man in den Metadaten vermisst. Bei der Suche nach Schwäbisch Gmünd wird
http://www.museen-sh.de/ml/inst.php?inst=35
gefunden. Auf dem zu kleinen Bild kann man vielleicht den Schriftzug Gmünd erahnen, die Suche im lokalen Angebot fördert aber das Objekt nicht zutage. Der Schluss liegt nahe, dass Europeana auf einen internen Metadatensatz zugreifen kann.
Von einer vollständigen Wiedergabe der Metadaten kann nicht die Rede sein:
Verherrlichung Mariens
1752
Creator: Wannenmacher, Joseph
Description: Wannenmacher, Joseph, Verherrlichung Mariens
Provider: Saxon State Library - Dresden State and University Library (SLUB)
Language: de
Format: text/html
Source: SLUB/Deutsche Fotothek
Rights: SLUB/Deutsche Fotothek
More
Less
Subject: Deckenmalerei
Date: 1752
Publisher: SLUB/Deutsche Fotothek
Spatial: Schwäbisch Gmünd
Type: text
So die Europeana. Und nun die Fotothek:
Objektdokument 70702026
Verherrlichung Mariens
Wannenmacher, Joseph (Maler)
1752
Standort: Schwäbisch Gmünd, Stadtpfarrkirche Sankt Franziskus, Chor
Mitwirkung: Weyhing, Jakob, Autor, Verfasser des ikonographischen Programms
Material und Technik: Freskomalerei
Ikonographie: Immaculata, Purisima: Maria, in der Regel auf einer Mondsichel stehend, steigt vom Himmel herab und befreit die Menschheit von der Erbsünde, manchmal indem sie eine Schlange zertritt
Schlagwort Ikonographie: Immaculata & Purisima & Mond & zunehmender Mond & herabsteigen & hinabsteigen & absteigen & Himmel & Mond & mit Füßen treten & Schlange & Luft (in der)
Sachschlagworte: Zyklus, Deckenmalerei
Deutsche Fotothek, Nr. df_wm_0018313, Schmidt-Glassner, Helga, 1943/1945
Ausschnitt: Die Hoffnung
Die Hoffnung trügt, dass die ausführlichen Metadaten wenigstens für die Suche zur Verfügung stehen, trügt in diesem Fall. Die Suche nach weyhing in Europeana findet nichts.
Die Europeana erfasst nur einen kleinen Teil der digitalisierten Sammlungen Europas. Das gilt sogar für die Partner. Vom MDZ sind anscheinend nur kleine Teile (Karten) vertreten.
Die Suche nach urkundenbuch findet NICHTS, obwohl z.B. das Calenberger Urkundenbuch beim GDZ verfügbar ist.
Ursprünglich sollte die Europeana auch eine Volltextsuche in den Büchern ermöglichen. Davon ist nichts übrig geblieben. Siehe
http://palimpsest.stanford.edu/byform/mailing-lists/exlibris/2007/04/msg00062.html
http://archiv.twoday.net/stories/3444918/
Fazit: Ein attraktives und benutzerfreundliches Angebot ist die Europeana noch lange nicht.
* Die Datenbasis wurde erheblich erweitert
* Die falsche Anzeige der Metadaten ist korrigiert, es wird nun der komplette Titel angezeigt
Es bleibt jedoch noch genügend zu kritisieren.
Aktennotiz von Direktor Dr. Dr. Miller über die Zustimmung des Hauses Württemberg zu den Wappenentwürfen des Staatsarchivs Stuttgart
1952
Provider: Landesarchiv Baden-Württemberg
Language: de
Format: Sachakten
Source: Landesarchiv Baden-Württemberg: Hauptstaatsarchiv Stuttgart
http://www.landesarchiv-bw.de/hstas
More
Less
Subject: Württemberg, Albrecht Eugen, Herzog, Württemberg, Philipp Albrecht, Herzog, Württemberg; Albrecht Eugen Herzog von, Württemberg; Philipp Albrecht Herzog von, Lindach, Schwäbisch Gmünd, AA; Schloss, Stuttgart, S; Württembergische Archivdirektion, Landesflagge, Landeswappen
Date: 1952-01-01/1952-12-31
Relations: https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olb/struktur.php?archiv=1&sprungId=4710
https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=4710&sprungId=32131&letztesLimit=suchen
Vorentwürfe für das baden-württembergische Landeswappen
Hier fehlt das Entscheidende, nämlich die Signatur des Archivales:
Hauptstaatsarchiv Stuttgart EA 99/002 Nr. 31
Dass der Klick auf das Bild nicht zu einer vergrößerbaren Ansicht führt, sondern zu einem unbrauchbaren nicht vergrößerbaren Thumbnail ist auch bei anderen Anbietern zu beobachten. Problematisch ist auch, wenn man über den Anbieterlink oder den Klick auf das Bild zu einer Bildpräsentation ohne Metadaten gelangt:
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:IISG01:30051000757614
Das ist dann hochproblematisch, wenn die Europeana Metadaten spärlich oder lückenhaft sind, da die Chancen dann gering sind, ohne spezielle Vorkenntnisse über die Suchfunktion des Anbieters die Metadaten des Anbieters aufzufinden!
Große Anbieter, für D ist vor allem die Fotothek in Dresden zu nennen, haben Probleme, Thumbnails zu generieren. Die Vorschau zeigt also nur den Typ an.

Dabei ergeben sich sehr häufig falsche Zuordnungen. Bei der Suche nach Schwäbisch Gmünd wird nur ein einziges Bild gefunden, obwohl die 34 Treffer der Saxon State Library (= Fotothek) alle Bilder sind.
Die Trefferliste mit den Vorschaubildern enthält zu wenige Informationen, der Bildtitel ist zu wenig aussagekräftig. Sehr oft dind die Daten irreführend (Digitalisierungsdatum statt Entstehungsdatum).
Nicht selten rätselt man, woher ein gefundener Begriff stammt, den man in den Metadaten vermisst. Bei der Suche nach Schwäbisch Gmünd wird
http://www.museen-sh.de/ml/inst.php?inst=35
gefunden. Auf dem zu kleinen Bild kann man vielleicht den Schriftzug Gmünd erahnen, die Suche im lokalen Angebot fördert aber das Objekt nicht zutage. Der Schluss liegt nahe, dass Europeana auf einen internen Metadatensatz zugreifen kann.
Von einer vollständigen Wiedergabe der Metadaten kann nicht die Rede sein:
Verherrlichung Mariens
1752
Creator: Wannenmacher, Joseph
Description: Wannenmacher, Joseph, Verherrlichung Mariens
Provider: Saxon State Library - Dresden State and University Library (SLUB)
Language: de
Format: text/html
Source: SLUB/Deutsche Fotothek
Rights: SLUB/Deutsche Fotothek
More
Less
Subject: Deckenmalerei
Date: 1752
Publisher: SLUB/Deutsche Fotothek
Spatial: Schwäbisch Gmünd
Type: text
So die Europeana. Und nun die Fotothek:
Objektdokument 70702026
Verherrlichung Mariens
Wannenmacher, Joseph (Maler)
1752
Standort: Schwäbisch Gmünd, Stadtpfarrkirche Sankt Franziskus, Chor
Mitwirkung: Weyhing, Jakob, Autor, Verfasser des ikonographischen Programms
Material und Technik: Freskomalerei
Ikonographie: Immaculata, Purisima: Maria, in der Regel auf einer Mondsichel stehend, steigt vom Himmel herab und befreit die Menschheit von der Erbsünde, manchmal indem sie eine Schlange zertritt
Schlagwort Ikonographie: Immaculata & Purisima & Mond & zunehmender Mond & herabsteigen & hinabsteigen & absteigen & Himmel & Mond & mit Füßen treten & Schlange & Luft (in der)
Sachschlagworte: Zyklus, Deckenmalerei
Deutsche Fotothek, Nr. df_wm_0018313, Schmidt-Glassner, Helga, 1943/1945
Ausschnitt: Die Hoffnung
Die Hoffnung trügt, dass die ausführlichen Metadaten wenigstens für die Suche zur Verfügung stehen, trügt in diesem Fall. Die Suche nach weyhing in Europeana findet nichts.
Die Europeana erfasst nur einen kleinen Teil der digitalisierten Sammlungen Europas. Das gilt sogar für die Partner. Vom MDZ sind anscheinend nur kleine Teile (Karten) vertreten.
Die Suche nach urkundenbuch findet NICHTS, obwohl z.B. das Calenberger Urkundenbuch beim GDZ verfügbar ist.
Ursprünglich sollte die Europeana auch eine Volltextsuche in den Büchern ermöglichen. Davon ist nichts übrig geblieben. Siehe
http://palimpsest.stanford.edu/byform/mailing-lists/exlibris/2007/04/msg00062.html
http://archiv.twoday.net/stories/3444918/
Fazit: Ein attraktives und benutzerfreundliches Angebot ist die Europeana noch lange nicht.
KlausGraf - am Donnerstag, 25. Dezember 2008, 20:14 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Blick auf die Anbieter:
http://www.heise.de/newsticker/Buchdruck-fuer-Jedermann--/meldung/120908
http://www.heise.de/newsticker/Buchdruck-fuer-Jedermann--/meldung/120908
KlausGraf - am Donnerstag, 25. Dezember 2008, 18:40 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Gericht: KG Berlin 9. Zivilsenat
Entscheidungsdatum: 31.10.2008
Aktenzeichen: 9 W 152/06
Dokumenttyp: Beschluss
Auszug
1. Die Veröffentlichung eines Zitates aus einem anwaltlichen Schriftsatz kann das in Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich gewährleistete allgemeine Persönlichkeitsrecht des Rechtsanwaltes in seiner Ausprägung als Selbstbestimmungsrecht, in bestimmtem Umfang darüber zu entscheiden, ob und wie die Persönlichkeit für öffentlich verbreitete Darstellungen benutzt wird, beeinträchtigen. Jede sprachliche Festlegung eines bestimmten Gedankeninhalts ist Ausfluss der Persönlichkeit des Verfassers. Deshalb steht grundsätzlich allein dem Verfasser die Befugnis zu, darüber zu entscheiden, ob und in welcher Form eine sprachliche Gedankenfestlegung seiner Person der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. (vgl. BGH NJW 1954, 1404; BVerfG NJW 1980, 2070)
Auch dieses Recht ist allerdings nicht schrankenlos gewährleistet. Ob eine Verletzung dieses Rechts vorliegt, ist jeweils anhand des zu beurteilenden Einzelfalls festzustellen; denn wegen der Eigenart des Persönlichkeitsrechts als eines Rahmenrechts liegt seine Reichweite nicht absolut fest, sondern muss grundsätzlich erst durch eine Güterabwägung mit den schutzwürdigen Interessen der anderen Seite, hier insbesondere mit der ebenfalls verfassungsrechtlich gewährleisteten Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG) sowie der Meinungsfreiheit des Antragsgegners (Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG), bestimmt werden (BGH NJW 1991, 1532). So hat der Senat schon in seinem Urteil vom 03. März 2006 (9 U 117/05) darauf hingewiesen, dass es ein generelles Verbot, aus Schriftsätzen von Rechtsanwälten zu zitieren, nicht gibt (vgl. auch BVerfG NJW 2000, 2416).
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE229132008&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10
Völlig überzogen erscheint die Begründung, dass jegliche Äußerung als Persönlichkeits-Ausfluss gesehen wird. Eine intensivere Auseinandersetzung mit der am Schluss zitierten BVerfG-Entscheidung
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk19991217_1bvr161199.html
wäre sinnvoll gewesen. Der Abdruck eines ganzen Anwaltsschriftsatzes wurde dort als datenschutzrechtlich irrelevant und nicht dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht unterliegend angesehen: "Durch die wörtliche Wiedergabe der Berufungsschrift werden über den Beschwerdeführer keine anderen personenbezogenen Daten preisgegeben als die Tatsache, daß er als Verteidiger Havemanns Verfasser dieses Schriftsatzes ist. Inwiefern durch die Veröffentlichung allein dieser Information das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Beschwerdeführers verletzt sein könnte, ist nicht erkennbar."
Die Rechtsprechung zur Veröffentlichung von Zitaten aus Korrespondenz hat erhebliche praktische Bedeutung für die Archive.
Wenn Benutzer Zitate aus Archivgut veröffentlichen, das sie nach Ablauf der Sperrfristen oder aufgrund einer Ausnahmegenehmigung rechtmäßig einsehen durften, scheidet eine Haftung des Archivs aus.
Anders verhält es sich, wenn ein Archiv Archivgut digitalisiert und frei zugänglich ins Internet einstellt. Soweit es noch lebende Personen betrifft, müsste bei jedem einzelnen Schriftstück (so gut wie alle Schriftstücke sind Persönlichkeits-Ausfluss im Sinn des KG) eine Güterabwägung vorgenommen oder anonymisiert werden. Dies betrifft selbstverständlich auch alles dienstliche Handeln von Amtsträgern, denn auch Beamte sind keine seelenlosen Maschinen (auch wenn sie auf die Betroffenen oft so wirken).
Entscheidungsdatum: 31.10.2008
Aktenzeichen: 9 W 152/06
Dokumenttyp: Beschluss
Auszug
1. Die Veröffentlichung eines Zitates aus einem anwaltlichen Schriftsatz kann das in Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich gewährleistete allgemeine Persönlichkeitsrecht des Rechtsanwaltes in seiner Ausprägung als Selbstbestimmungsrecht, in bestimmtem Umfang darüber zu entscheiden, ob und wie die Persönlichkeit für öffentlich verbreitete Darstellungen benutzt wird, beeinträchtigen. Jede sprachliche Festlegung eines bestimmten Gedankeninhalts ist Ausfluss der Persönlichkeit des Verfassers. Deshalb steht grundsätzlich allein dem Verfasser die Befugnis zu, darüber zu entscheiden, ob und in welcher Form eine sprachliche Gedankenfestlegung seiner Person der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. (vgl. BGH NJW 1954, 1404; BVerfG NJW 1980, 2070)
Auch dieses Recht ist allerdings nicht schrankenlos gewährleistet. Ob eine Verletzung dieses Rechts vorliegt, ist jeweils anhand des zu beurteilenden Einzelfalls festzustellen; denn wegen der Eigenart des Persönlichkeitsrechts als eines Rahmenrechts liegt seine Reichweite nicht absolut fest, sondern muss grundsätzlich erst durch eine Güterabwägung mit den schutzwürdigen Interessen der anderen Seite, hier insbesondere mit der ebenfalls verfassungsrechtlich gewährleisteten Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG) sowie der Meinungsfreiheit des Antragsgegners (Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG), bestimmt werden (BGH NJW 1991, 1532). So hat der Senat schon in seinem Urteil vom 03. März 2006 (9 U 117/05) darauf hingewiesen, dass es ein generelles Verbot, aus Schriftsätzen von Rechtsanwälten zu zitieren, nicht gibt (vgl. auch BVerfG NJW 2000, 2416).
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE229132008&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10
Völlig überzogen erscheint die Begründung, dass jegliche Äußerung als Persönlichkeits-Ausfluss gesehen wird. Eine intensivere Auseinandersetzung mit der am Schluss zitierten BVerfG-Entscheidung
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk19991217_1bvr161199.html
wäre sinnvoll gewesen. Der Abdruck eines ganzen Anwaltsschriftsatzes wurde dort als datenschutzrechtlich irrelevant und nicht dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht unterliegend angesehen: "Durch die wörtliche Wiedergabe der Berufungsschrift werden über den Beschwerdeführer keine anderen personenbezogenen Daten preisgegeben als die Tatsache, daß er als Verteidiger Havemanns Verfasser dieses Schriftsatzes ist. Inwiefern durch die Veröffentlichung allein dieser Information das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Beschwerdeführers verletzt sein könnte, ist nicht erkennbar."
Die Rechtsprechung zur Veröffentlichung von Zitaten aus Korrespondenz hat erhebliche praktische Bedeutung für die Archive.
Wenn Benutzer Zitate aus Archivgut veröffentlichen, das sie nach Ablauf der Sperrfristen oder aufgrund einer Ausnahmegenehmigung rechtmäßig einsehen durften, scheidet eine Haftung des Archivs aus.
Anders verhält es sich, wenn ein Archiv Archivgut digitalisiert und frei zugänglich ins Internet einstellt. Soweit es noch lebende Personen betrifft, müsste bei jedem einzelnen Schriftstück (so gut wie alle Schriftstücke sind Persönlichkeits-Ausfluss im Sinn des KG) eine Güterabwägung vorgenommen oder anonymisiert werden. Dies betrifft selbstverständlich auch alles dienstliche Handeln von Amtsträgern, denn auch Beamte sind keine seelenlosen Maschinen (auch wenn sie auf die Betroffenen oft so wirken).
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 22:48 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Ziko/BA-Bilder

"Tsingtau, deutsches Konsulat, 1867" mit Hakenkreuzfahne
Nachtrag:
Da es wenig ergiebig ist, nenne ich das belanglose Interview mit dem nicht weniger belanglosen M. Schindler hier:
http://netzpolitik.org/2008/interview-kooperation-von-bundesarchiv-und-wikimedia/

"Tsingtau, deutsches Konsulat, 1867" mit Hakenkreuzfahne
Nachtrag:
Da es wenig ergiebig ist, nenne ich das belanglose Interview mit dem nicht weniger belanglosen M. Schindler hier:
http://netzpolitik.org/2008/interview-kooperation-von-bundesarchiv-und-wikimedia/
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 22:40 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.flickr.com/photos/julio-claudians/
Joe Geranio macht viele seiner Bilder erfreulicherweise unter CC-BY zugänglich.

Joe Geranio macht viele seiner Bilder erfreulicherweise unter CC-BY zugänglich.

KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 20:08 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://lunacommons.org/
"New centralised dbase of all the Luna InsightBrowser sites -- incredible array of material available [eg. 13000+ photographs; 13000+ prints; 12000+ maps etc etc] from a wide variety of repostories (mostly university-type institutions). I have not played around much but this makes accessing the material really really easy compared to normal." (peacay on delicious, thanks for the alert)

"New centralised dbase of all the Luna InsightBrowser sites -- incredible array of material available [eg. 13000+ photographs; 13000+ prints; 12000+ maps etc etc] from a wide variety of repostories (mostly university-type institutions). I have not played around much but this makes accessing the material really really easy compared to normal." (peacay on delicious, thanks for the alert)

KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 17:45 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 17:21 - Rubrik: Frauenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 17:19 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 17:17 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der 31-jähhrige Berkley-Student, Mathematiker und manhua-Zeichner legt sein drittes Album "Bookhunter" vor. Eine actionreiche Suche nach gestohlenen wertvollen Büchern.
Ein Tipp, um geschenktes Geld sinnvoll anzulegen, oder für einen gewinnbringenden Umtausch.
Quelle:
http://www.arte.tv/de/Buecher_2FComics/1193094,CmC=1972546.html
Homepage des Künstlers:
http://www.shigabooks.com/
Ein Tipp, um geschenktes Geld sinnvoll anzulegen, oder für einen gewinnbringenden Umtausch.
Quelle:
http://www.arte.tv/de/Buecher_2FComics/1193094,CmC=1972546.html
Homepage des Künstlers:
http://www.shigabooks.com/
Wolf Thomas - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 13:49 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In der Liste des Berliner Tagesspiegels findet sich auch: " ..... DER AUSWENDIG-SINGER. Sie gelten als wandelndes Gesangbuch. Verse, die Ihr Leben begleitet haben, wurden von Ihnen internalisiert; als Speicherplatz dafür vorhanden war. Heute reagieren Sie manchmal nervös: wann immer aus unvorteilhaft gekürzten Gesangbuchversionen ein paar modisch frisierte Strophen alter Lieder rausgepickt werden. In Ihrem Langzeitgedächtnis überwintert das Original. Ihr Original! Eine Fülle unsingbarer, naja altmodischer, blumig kraftvoller, inbrünstiger Verse, die vorzeiten rauf- und runtergeschmettert wurden – und einst, mit Ihnen, im Orkus des Vergessens zu versinken drohen. Aber noch erinnern Sie sich, ohne Ansehen der Qualität. Wie ein Archiv. Wenn Sie singen, singt es in Ihnen. ....."
Egal zu welcher Kategorie die geneigten Blogleserinnen und -leser auch gehören, so wünsche ich Ihnen angenehe Feiertage.
Quelle:
http://www.tagesspiegel.de/kultur/;art772,2691491
Egal zu welcher Kategorie die geneigten Blogleserinnen und -leser auch gehören, so wünsche ich Ihnen angenehe Feiertage.
Quelle:
http://www.tagesspiegel.de/kultur/;art772,2691491
Wolf Thomas - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 11:32 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
RIHA Resolution on Copyright
As agreed at the RIHA General Assembly, Rome, 8 November 2008
1. Statement
“Copyright seeks to protect the rights of authorship while securing the dissemination of knowledge. It protects the form of expression of ideas, but not the ideas, information or concepts expressed (…) A regime which is unduly protective of the interest of existing rights holders may therefore inhibit, or even stifle, the development of original material.”
British Academy, Copyright and Research in the Humanities and Social Sciences, 2006
RIHA, the International Association of Research Institutes in the History of Art, is concerned that recent developments in technology, legislation and practice have meant that the various copyright exemptions that exist to promote the advance of creative and scholarly work are not being applied to achieve their intended effect. RIHA strongly believes that neither copyright nor licensing rules should inhibit the development and diffusion of original scholarly research, regardless of the way in which it is published or otherwise disseminated.
RIHA calls upon copyright holders and other stakeholders including publishers, galleries, museums, and collecting societies, when dealing with scholarly research, to:
Subscribe to the definition of scholarly research as stated in section 2 of this document
Apply the existing copyright exemptions in keeping with their intended purpose
Refrain from demanding or refusing unnecessary permissions, or granting these permissions on unreasonable terms.
RIHA further calls upon collecting societies and monopoly copyright holders, when charging for the use and reproduction of images in scholarly publications, to charge solely the marginal cost to the institution of making the specific reproduction for delivery to the researcher, rather than the costs of creating and maintaining a collection of images or of making provision for a profit margin on transactions.
2. Definitions of research
For the purpose of clarity, RIHA proposes the following definitions of research:*
Scholarly research
A type of non-commercial research whose principal objective is public benefit rather than private profit and/or the recovery of the costs of the research. Scholarly research may include the initial stages of collecting material as well as subsequent stages which involve the analysis and publication of the results. The presentation of the results will be without charge to the recipients or will be at a charge which can only be expected to cover the reasonable costs of production and distribution, including the reasonable profits of a commercial publisher.
Commercial research
Research whose principal objective is profit rather than public benefit. Commercial research normally includes a charge to the user that covers the cost of the research as well as its dissemination, and includes a profit margin.
3. Recommendations
RIHA urges copyright holders and other stakeholders to respect of the following British Academy recommendations (paraphrased):
Recommendation 1
Copyright must provide reasonably broad and practically effective exemptions for research and private study, and for criticism or review.
Recommendation 2
With regard to the exception for research and private study under the 1988 Copyright Act:
a) ‘Research’ should be treated as distinct from ‘private study’ and should not only encompass the intial stages of an academic project but also subsequent analysis and publication
b) Research should be treated as non-commercial where the taking of copyright material is fair, and where any charge to the user would only cover production and distribution of a publication (including reasonable profit of a commercial publisher)
c) Research funded by a research council or charity is by definition non-commercial
d) In the case of commercial research, charges should be reasonable and abuse should be restrained.
* The definitions of research are based on the findings and recommendations of the British Academy report Copyright and Research in the Humanities and Social Sciences (2006) and the Guidelines on Copyright and Academic Research, issued as a supplement to the report. RIHA also notes that the Joint Guidelines on Copyright and Academic Research (2008), published jointly by the British Academy and the Publishers Association, offers valuable clarification of some of the issues touched on in the 2006 report. All three documents can be accessed and downloaded at http://www.britac.ac.uk/reports/copyright
http://www.riha-institutes.org/resolutioncopyright.html
COMMENT
This is a step in the right direction! The rising costs for the image permissions are a big problem for art history publishing. Dee below the links for similar statements on this topic.
Note that fortunately the definition of non-commercial in this appeal is broader that in the Creative Commons context ("NC"). Publishing in a scholarly journal of a commercial publisher or in a publisher's database is regarded as incompatible with "NC".
Links on the art history image permission crisis
Appeal of the leading Paleographical Society CIPL 2002 against reproduction fees
http://web.archive.org/web/20020403204522/http://www.wlb-stuttgart.de/archive/repro_fees.html
http://la.boa-bw.de/archive/frei/653/0/www.wlb-stuttgart.de/archive/repro-gebuehren.html
K. Hamma: Public Domain Art, in D-Lib 2005
http://www.dlib.org/dlib/november05/hamma/11hamma.html
J. Howard: Picture Imperfect, in CHE 2006
http://chronicle.com/free/v52/i48/48a01201.htm
See http://archiv.twoday.net/stories/2484031/
Ballon/Westermann report, 2006
http://cnx.org/content/col10376/latest especially
http://cnx.org/content/m13940/latest/
http://cnx.org/content/m13952/latest/
Susan Bielstein: Permissions, A Survival Guide, 2006
See
http://archiv.twoday.net/stories/5405846/
http://archiv.twoday.net/stories/2484031/
Bielstein article
http://www.courtauld.ac.uk/researchforum/news/bielstein-copyright.pdf
Best Practices for Access to Images: Recommendations for Scholarly Use and Publishing, 2008
http://www.arhv.lhivic.org/index.php/2008/08/22/790-best-practices-for-access-to-images-recommendations-for-scholarly-use-and-publishing
More on the "French connection":
Le droit aux images à l'ère de la publication électronique, 2007
http://www.arhv.lhivic.org/index.php/2007/01/17/272-le-droit-aux-images-a-l-ere-de-la-publication-electronique
See the German coverage
http://archiv.twoday.net/stories/4075812/
http://archiv.twoday.net/stories/5220894/
Materials in German
http://archiv.twoday.net/stories/3440388/ with more links
See also my "Kulturgut muss frei sein!" 2007
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2008/529/
http://archiv.twoday.net/stories/4477824/
Update: My Comment on the RIHA resolution published in Kunstchronik:
http://archiv.twoday.net/stories/5672187/ (German)
Update: Cornell's Public Domain Policy
http://archiv.twoday.net/stories/5696036/
Update: British Library
http://archiv.twoday.net/stories/219045004/
As agreed at the RIHA General Assembly, Rome, 8 November 2008
1. Statement
“Copyright seeks to protect the rights of authorship while securing the dissemination of knowledge. It protects the form of expression of ideas, but not the ideas, information or concepts expressed (…) A regime which is unduly protective of the interest of existing rights holders may therefore inhibit, or even stifle, the development of original material.”
British Academy, Copyright and Research in the Humanities and Social Sciences, 2006
RIHA, the International Association of Research Institutes in the History of Art, is concerned that recent developments in technology, legislation and practice have meant that the various copyright exemptions that exist to promote the advance of creative and scholarly work are not being applied to achieve their intended effect. RIHA strongly believes that neither copyright nor licensing rules should inhibit the development and diffusion of original scholarly research, regardless of the way in which it is published or otherwise disseminated.
RIHA calls upon copyright holders and other stakeholders including publishers, galleries, museums, and collecting societies, when dealing with scholarly research, to:
Subscribe to the definition of scholarly research as stated in section 2 of this document
Apply the existing copyright exemptions in keeping with their intended purpose
Refrain from demanding or refusing unnecessary permissions, or granting these permissions on unreasonable terms.
RIHA further calls upon collecting societies and monopoly copyright holders, when charging for the use and reproduction of images in scholarly publications, to charge solely the marginal cost to the institution of making the specific reproduction for delivery to the researcher, rather than the costs of creating and maintaining a collection of images or of making provision for a profit margin on transactions.
2. Definitions of research
For the purpose of clarity, RIHA proposes the following definitions of research:*
Scholarly research
A type of non-commercial research whose principal objective is public benefit rather than private profit and/or the recovery of the costs of the research. Scholarly research may include the initial stages of collecting material as well as subsequent stages which involve the analysis and publication of the results. The presentation of the results will be without charge to the recipients or will be at a charge which can only be expected to cover the reasonable costs of production and distribution, including the reasonable profits of a commercial publisher.
Commercial research
Research whose principal objective is profit rather than public benefit. Commercial research normally includes a charge to the user that covers the cost of the research as well as its dissemination, and includes a profit margin.
3. Recommendations
RIHA urges copyright holders and other stakeholders to respect of the following British Academy recommendations (paraphrased):
Recommendation 1
Copyright must provide reasonably broad and practically effective exemptions for research and private study, and for criticism or review.
Recommendation 2
With regard to the exception for research and private study under the 1988 Copyright Act:
a) ‘Research’ should be treated as distinct from ‘private study’ and should not only encompass the intial stages of an academic project but also subsequent analysis and publication
b) Research should be treated as non-commercial where the taking of copyright material is fair, and where any charge to the user would only cover production and distribution of a publication (including reasonable profit of a commercial publisher)
c) Research funded by a research council or charity is by definition non-commercial
d) In the case of commercial research, charges should be reasonable and abuse should be restrained.
* The definitions of research are based on the findings and recommendations of the British Academy report Copyright and Research in the Humanities and Social Sciences (2006) and the Guidelines on Copyright and Academic Research, issued as a supplement to the report. RIHA also notes that the Joint Guidelines on Copyright and Academic Research (2008), published jointly by the British Academy and the Publishers Association, offers valuable clarification of some of the issues touched on in the 2006 report. All three documents can be accessed and downloaded at http://www.britac.ac.uk/reports/copyright
http://www.riha-institutes.org/resolutioncopyright.html
COMMENT
This is a step in the right direction! The rising costs for the image permissions are a big problem for art history publishing. Dee below the links for similar statements on this topic.
Note that fortunately the definition of non-commercial in this appeal is broader that in the Creative Commons context ("NC"). Publishing in a scholarly journal of a commercial publisher or in a publisher's database is regarded as incompatible with "NC".
Links on the art history image permission crisis
Appeal of the leading Paleographical Society CIPL 2002 against reproduction fees
http://web.archive.org/web/20020403204522/http://www.wlb-stuttgart.de/archive/repro_fees.html
http://la.boa-bw.de/archive/frei/653/0/www.wlb-stuttgart.de/archive/repro-gebuehren.html
K. Hamma: Public Domain Art, in D-Lib 2005
http://www.dlib.org/dlib/november05/hamma/11hamma.html
J. Howard: Picture Imperfect, in CHE 2006
http://chronicle.com/free/v52/i48/48a01201.htm
See http://archiv.twoday.net/stories/2484031/
Ballon/Westermann report, 2006
http://cnx.org/content/col10376/latest especially
http://cnx.org/content/m13940/latest/
http://cnx.org/content/m13952/latest/
Susan Bielstein: Permissions, A Survival Guide, 2006
See
http://archiv.twoday.net/stories/5405846/
http://archiv.twoday.net/stories/2484031/
Bielstein article
http://www.courtauld.ac.uk/researchforum/news/bielstein-copyright.pdf
Best Practices for Access to Images: Recommendations for Scholarly Use and Publishing, 2008
http://www.arhv.lhivic.org/index.php/2008/08/22/790-best-practices-for-access-to-images-recommendations-for-scholarly-use-and-publishing
More on the "French connection":
Le droit aux images à l'ère de la publication électronique, 2007
http://www.arhv.lhivic.org/index.php/2007/01/17/272-le-droit-aux-images-a-l-ere-de-la-publication-electronique
See the German coverage
http://archiv.twoday.net/stories/4075812/
http://archiv.twoday.net/stories/5220894/
Materials in German
http://archiv.twoday.net/stories/3440388/ with more links
See also my "Kulturgut muss frei sein!" 2007
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2008/529/
http://archiv.twoday.net/stories/4477824/
Update: My Comment on the RIHA resolution published in Kunstchronik:
http://archiv.twoday.net/stories/5672187/ (German)
Update: Cornell's Public Domain Policy
http://archiv.twoday.net/stories/5696036/
Update: British Library
http://archiv.twoday.net/stories/219045004/
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 05:27 - Rubrik: English Corner
Asking permission [of a rights holder] zealously and unnecessarily also catches you up in a mentality of acquiescence. Acquiescence is a wasting disease rooted in anxiety and ignorance, and it helps propel the all-consuming permissions culture . . . in the quotidian world of intellectual property, acquiescence operates far beneath the beacon eye of statute or treaty, and capitalizing on it is not good for anyone’s health. It wastes time, it wastes money, and it produces a compliant society vulnerable to abuse and wholesale ideological shifts in the law. (10-11)
From Susan Bielstein’s Permissions, A Survival Guide: Blunt Talk about Art as Intellectual Property quoted at
http://www.ischools.org/oc/conference08/pc/PA2-3_iconf08.doc
See a preview of Bielstein's book:
http://books.google.com/books?id=6y-QVFerLTMC
From Susan Bielstein’s Permissions, A Survival Guide: Blunt Talk about Art as Intellectual Property quoted at
http://www.ischools.org/oc/conference08/pc/PA2-3_iconf08.doc
See a preview of Bielstein's book:
http://books.google.com/books?id=6y-QVFerLTMC
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 05:05 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.flickr.com/photos/brbl/with/3119260228/
See also
http://beineckeearlymodern.wordpress.com/2008/12/20/the-paleographical-commons/
http://www.earlham.edu/~peters/fos/2008/12/rare-books-and-manuscripts-from-yale-on.html

See also
http://beineckeearlymodern.wordpress.com/2008/12/20/the-paleographical-commons/
http://www.earlham.edu/~peters/fos/2008/12/rare-books-and-manuscripts-from-yale-on.html

KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 04:21 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In der ZGO 156, 2008, musste aufgrund eines "im Zuge der Fahnenkorrekturen nicht mehr feststellbaren Konvertierungsfehlers" die gesamte Edition des ältesten Säckinger Urbars - http://archiv.twoday.net/stories/3952377/ - nochmals abgedruckt werden: S. 591-665
Druckveröffentlichungen sind bei Einsatz nicht hinreichend ausgereifter Satztechnik verletzbar. In einem Online-Beitrag könnte man den Beitrag ersetzen oder wenigstens einen Berichtigungs-Link in den Metadaten angeben. Ich möchte nicht wissen, wieviele Wissenschaftler nach der falschen Version zitieren werden.
Druckveröffentlichungen sind bei Einsatz nicht hinreichend ausgereifter Satztechnik verletzbar. In einem Online-Beitrag könnte man den Beitrag ersetzen oder wenigstens einen Berichtigungs-Link in den Metadaten angeben. Ich möchte nicht wissen, wieviele Wissenschaftler nach der falschen Version zitieren werden.
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 03:12 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Heute weisen wir auf den reichen Bildfundus von Pictura Paedagocica Online hin. Allein zum Suchwort Weihnachten sind 120 Treffer zu finden.
Allen Leserinnen und Lesern von Archivalia wünschen wir schöne Weihnachtstage!

Adventskalender-Einträge und weitere Adventbilder- und -materialien finden sich unter
http://archiv.twoday.net/search?q=advent
Es folgt eine Liste der Adventskalender-Einträge 2008 mit kurzem Stichwort:
24 Pictura Paedagogica Online
http://archiv.twoday.net/stories/5401746/
23 Lebkuchen
http://archiv.twoday.net/stories/5401828/
22 Kuriose Bücher
http://archiv.twoday.net/stories/5401727/
21 Harald Schmidt rezitiert Uhland (Video)
http://archiv.twoday.net/stories/5400267/
20 Leuchttürme
http://archiv.twoday.net/stories/5396690/
19 1495: Württemberg wird Herzogtum als Volltext
http://archiv.twoday.net/stories/5395239/
18 Klabund: Bürgerliches Weihnachtsidyll
http://archiv.twoday.net/stories/5390077/
17 Rekonstruktion der Gutenberg-Presse (Video)
http://archiv.twoday.net/stories/5387564/
16 Porträtsammlungen im Netz (Köln u.a.)
http://archiv.twoday.net/stories/5386851/
15 Schöne alte Archivräume
http://archiv.twoday.net/stories/5384884/

14 Erfindung der Computermaus 1968 (Video)
http://archiv.twoday.net/stories/5375009/
13 Fremdwörterlexikon 1802 Teil 2
http://archiv.twoday.net/stories/5370996/
Bonus: Kalligraphie
http://archiv.twoday.net/stories/5385227/
12 Fremdwörterlexikon 1802 Teil 1
http://archiv.twoday.net/stories/5370989/
11 Lied gegen Fremdwörter 1642
http://archiv.twoday.net/stories/5370868/

10 Rheinansichten von John Kinder in Neuseeland
http://archiv.twoday.net/stories/5370648/
9 Niederbayerische Volltexte
http://archiv.twoday.net/stories/5370772/
8 Holiday Monster
http://archiv.twoday.net/stories/5369273/
7 Tucholksy: Ein deutsches Volkslied (1922)
http://archiv.twoday.net/stories/5362315/
6 Links zu St. Nikolaus
http://archiv.twoday.net/stories/5362321/

5 Tierstimmen
http://archiv.twoday.net/stories/5362298/
4 e-Codices aus Genf
http://archiv.twoday.net/stories/5362291/
3 Monteverdi: Orfeo (Video)
http://archiv.twoday.net/stories/5359949/
2 Handzeichnungen der UB Salzburg
http://archiv.twoday.net/stories/5359785/
1 Zukunftsvorstellungen
http://archiv.twoday.net/stories/5357850/
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 02:57 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://archieven.blogspot.com/2008/12/naaktfoto-beeldbank-nationaal-archief.html
http://sportgeschiedenis.nl/2007/09/25/de-match-van-het-jaar-1947-bep-van-klaveren-tegen-luc-van-dam.aspx
Die spinnen, die Niederländer. Als ob etwas anstößig daran ist, wenn man einen Boxer nackt unter der Dusche sieht. Auch wenns mein Opa wäre.
http://sportgeschiedenis.nl/2007/09/25/de-match-van-het-jaar-1947-bep-van-klaveren-tegen-luc-van-dam.aspx
Die spinnen, die Niederländer. Als ob etwas anstößig daran ist, wenn man einen Boxer nackt unter der Dusche sieht. Auch wenns mein Opa wäre.
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 02:45 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 02:21 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
George Oates, the architect of the Commons on Flickr (and former designer behind Flickr), was laid off by Yahoo.

http://www.foundhistory.org/2008/12/22/tragedy-at-the-commons/
http://people.ischool.berkeley.edu/~ryanshaw/wordpress/2008/12/12/dont-leave-stewardship-to-the-companies/
http://www.powerhousemuseum.com/dmsblog/index.php/2008/12/12/vale-george-oates/
http://www.flickr.com/photos/george/sets/72157609306608548/
http://archief20.ning.com/profiles/blogs/george-oates-weg-bij-flickr
http://valleywag.gawker.com/5108583/flickr-layoffs-could-spell-a-photo-finish
Excerpt from her personal blog at
http://george08.blogspot.com/
After giving the opening keynote at the National Digital Forum in Auckland on November 27, then presenting at the Powerhouse Museum and the National Library of Australia, visiting with Commons members the State Library of New South Wales and the Australian War Memorial, I headed to Taipei for an exciting Culturemondo Roundtable event I was invited to attend. This Wednesday, I shook the hand of the Vice President of Taiwan, who was at the opening.
The next day I presented with Seb Chan, about our take on "Search & Find." That evening we all went to a lovely dinner at one of the best Taiwanese joints in Taipei. (Thanks to Tien Sing, Shadiral, Christina and Aleksandra for being such entertaining dinner conversation.) Then off for a wander in one of the massive night markets. I decided to jump in a cab back to the hotel with Jackie from NZ Live and Jock from Te Ara. It took a slightly long way home, we suspected.
When I got up to my room, I saw a text message from my manager, asking if he could call me on Friday at 9am. I wrote back to say I was going to be on a bus full of people at that time, and that I was awake now if he wanted to call. The phone rang.
"I'll just get straight to the point. You've been affected by the layoffs."
He told me he was reading from a script he was required to follow, and that he needed an address to send some sort of "Agreement" to me in Australia, and needed it sent back by December 19. Before I'd even finished the call, I twittered (to my private account):
"Wow. I just got fired." I was immediately distressed.
I stayed up until about 2:30am that night, chain smoking and talking to friends who saw my tweet and had responded - THANK YOU. I sent a formal request for time to transition The Commons program to whoever is to take it over: "A week should do it," I said. It was denied.
Worth to read more.
http://www.zeldman.com/2008/12/16/laying-off-george/
"George Oates is the last person a sane company would lay off."
UPDATE:
http://hurstassociates.blogspot.com/2008/12/ms-george-oates-and-flickr-commons.html

http://www.foundhistory.org/2008/12/22/tragedy-at-the-commons/
http://people.ischool.berkeley.edu/~ryanshaw/wordpress/2008/12/12/dont-leave-stewardship-to-the-companies/
http://www.powerhousemuseum.com/dmsblog/index.php/2008/12/12/vale-george-oates/
http://www.flickr.com/photos/george/sets/72157609306608548/
http://archief20.ning.com/profiles/blogs/george-oates-weg-bij-flickr
http://valleywag.gawker.com/5108583/flickr-layoffs-could-spell-a-photo-finish
Excerpt from her personal blog at
http://george08.blogspot.com/
After giving the opening keynote at the National Digital Forum in Auckland on November 27, then presenting at the Powerhouse Museum and the National Library of Australia, visiting with Commons members the State Library of New South Wales and the Australian War Memorial, I headed to Taipei for an exciting Culturemondo Roundtable event I was invited to attend. This Wednesday, I shook the hand of the Vice President of Taiwan, who was at the opening.
The next day I presented with Seb Chan, about our take on "Search & Find." That evening we all went to a lovely dinner at one of the best Taiwanese joints in Taipei. (Thanks to Tien Sing, Shadiral, Christina and Aleksandra for being such entertaining dinner conversation.) Then off for a wander in one of the massive night markets. I decided to jump in a cab back to the hotel with Jackie from NZ Live and Jock from Te Ara. It took a slightly long way home, we suspected.
When I got up to my room, I saw a text message from my manager, asking if he could call me on Friday at 9am. I wrote back to say I was going to be on a bus full of people at that time, and that I was awake now if he wanted to call. The phone rang.
"I'll just get straight to the point. You've been affected by the layoffs."
He told me he was reading from a script he was required to follow, and that he needed an address to send some sort of "Agreement" to me in Australia, and needed it sent back by December 19. Before I'd even finished the call, I twittered (to my private account):
"Wow. I just got fired." I was immediately distressed.
I stayed up until about 2:30am that night, chain smoking and talking to friends who saw my tweet and had responded - THANK YOU. I sent a formal request for time to transition The Commons program to whoever is to take it over: "A week should do it," I said. It was denied.
Worth to read more.
http://www.zeldman.com/2008/12/16/laying-off-george/
"George Oates is the last person a sane company would lay off."
UPDATE:
http://hurstassociates.blogspot.com/2008/12/ms-george-oates-and-flickr-commons.html
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 02:15 - Rubrik: English Corner
http://www.taz.de/1/leben/medien/artikel/1/die-uni-schweigt/
Zum Thema:
http://de.wikipedia.org/wiki/Auskunftsanspruch_(Presserecht)
Zum Thema:
http://de.wikipedia.org/wiki/Auskunftsanspruch_(Presserecht)
KlausGraf - am Mittwoch, 24. Dezember 2008, 01:56 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Neues (3sat) widmete sich dem "Urheberrecht - recht absurd"
Diese Sendung kann als Podcast geladen werden:
http://podfiles.zdf.de/podcast/3sat_podcasts/081102_sendung_neues_p.mp4
Diese Sendung kann als Podcast geladen werden:
http://podfiles.zdf.de/podcast/3sat_podcasts/081102_sendung_neues_p.mp4
Wolf Thomas - am Dienstag, 23. Dezember 2008, 19:12 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Pressemitteilung der Darmstädter Polizei (Link): "Sollte es stimmen, dass in Archiven so manch archiviertes Etwas seit Jahren oder gar Jahrzehnten unberührt und wohlbehütet aufbewahrt wird, dann müsste es ein idealer Ort für ein sicheres Versteck sein - dachte sich ein 52-jähriger Mann und tat genau dies. Per Haftbefehl gesucht und der ewigen Flucht müde, ließ er sich in der Herrentoilette des wehrten Hauses einschließen und hoffte auf eine ruhige Zeit. Nur wunderte sich der Nachtwächter über die verdächtigen Töne aus dem "stillen Örtchen". So schlief und schnarchte der sich auf diese Art "Selbstarchivierte" friedlich vor sich hin, während der Wachmann die Polizei verständigte. Die konnte den wegen Diebstahls gesuchten Schwetzinger widerstandslos festnehmen. Es muss in dieser weihnachtlichen Zeit auch dafür Platz sein... Träume von einem ruhigen und sicheren Versteck."
s. a. http://www.echo-online.de/suedhessen/template_detail.php3?id=695151
s. a. http://www.echo-online.de/suedhessen/template_detail.php3?id=695151
Wolf Thomas - am Dienstag, 23. Dezember 2008, 17:04 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus der Besprechung des Falters (Link):" .... Müsste der Wiener Filmemacher und Schriftsteller Rudi Palla, 67, eine Umschreibung für jenen Bereich finden, der in seinem Fall das schwierige Gleichgewicht von Normalität und Narretei am ehesten kennzeichnete, so lautete die Antwort: Opfer manischer Sammelleidenschaft.
In einem Archiv als Behausung lebt und arbeitet Palla in der Schleifmühlgasse, die diversen Materialanhäufungen münden häufig in Literaturprojekte ......
In unbeobachteten Augenblicken, so ist der Autor überzeugt, widmen sich die zwischen den Aktendeckeln archivierten Exzentriker geisterhaftem Treiben. „Sie unterhalten sich“, sagt Rudi Palla. „Sie lachen sich zu Tode.“ ...."
In einem Archiv als Behausung lebt und arbeitet Palla in der Schleifmühlgasse, die diversen Materialanhäufungen münden häufig in Literaturprojekte ......
In unbeobachteten Augenblicken, so ist der Autor überzeugt, widmen sich die zwischen den Aktendeckeln archivierten Exzentriker geisterhaftem Treiben. „Sie unterhalten sich“, sagt Rudi Palla. „Sie lachen sich zu Tode.“ ...."
Wolf Thomas - am Dienstag, 23. Dezember 2008, 17:02 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Oliver Hengst berichtet in der Ahlener Zeitung (Link): " .... Der ist als Archivar tätig und als solcher ein Bücherwurm. Die Schmöker beanspruchen viel Platz, allein die Spiegelausgaben ab 1959 füllen ein ganzes Regal. ...."
Sollte dies zum Trend werden, stehen uns sicher einige interessante Berichte über die Heimstätten von Kolleginnen und Kollegen bevor. :-)
Sollte dies zum Trend werden, stehen uns sicher einige interessante Berichte über die Heimstätten von Kolleginnen und Kollegen bevor. :-)
Wolf Thomas - am Dienstag, 23. Dezember 2008, 17:00 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Ein großes Geschenk hat die Stadt Löbejün in Sachsen-Anhalt dieses Jahr von einem Schotten bekommen. Der 81-jährige Ian Lilburn schenkte aber der Stadt seine Sammlung an Tonträgern des Balladen-Komponisten Carl Loewe. Und die ist die umfangreichste, die es weltweit gibt. Die Forschungs- und Gedenkstätte für Carl Loewe will die Sammlung nun bis zum Frühjahr digitalisieren und der Öffentlichkeit zugänglich machen. ....
Andreas Porsche, der Vorsitzende der Internationalen Carl-Loewe-Gesellschaft: .... "In diesem Geburtshaus ist einerseits ein kleines Museum zu Leben und kompositorischem Werk, ein Carl-Loewe-Archiv und ein Kammermusiksaal. Hier finden verschiedene Veranstaltungsreihen statt ... " ...."
Quelle:
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/kulturheute/895489/
Link zur Gesellschaft:
http://www.carl-loewe-gesellschaft.de
Andreas Porsche, der Vorsitzende der Internationalen Carl-Loewe-Gesellschaft: .... "In diesem Geburtshaus ist einerseits ein kleines Museum zu Leben und kompositorischem Werk, ein Carl-Loewe-Archiv und ein Kammermusiksaal. Hier finden verschiedene Veranstaltungsreihen statt ... " ...."
Quelle:
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/kulturheute/895489/
Link zur Gesellschaft:
http://www.carl-loewe-gesellschaft.de
Wolf Thomas - am Dienstag, 23. Dezember 2008, 16:58 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 23. Dezember 2008, 11:29 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Archivalia nimmt mit seiner Rubrik Archivrecht an http://www.jurablogs.de teil. Heute hat es Archivalia sogar mit 2 Beiträgen in die Liste der Top-Beiträge geschafft: die bodenlose Unverschämtheit erreichte dort 157 Leser (Platz 2). 107 Leser riefen "Wenn Sie fotografieren ist die Kamera weg" auf (Platz 7). Eine besonders griffige oder "reißerische" Überschrift/Textbeginn und ein kontroverser Inhalt in Archivrecht wirken sich in der Regel auf die Referrer aus.
KlausGraf - am Dienstag, 23. Dezember 2008, 10:39 - Rubrik: Allgemeines
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.schott.franconica.de/
Drei Drucke und einige Zeichnungen des in Würzburg wirkenden Gelehrten als Digitalisate.
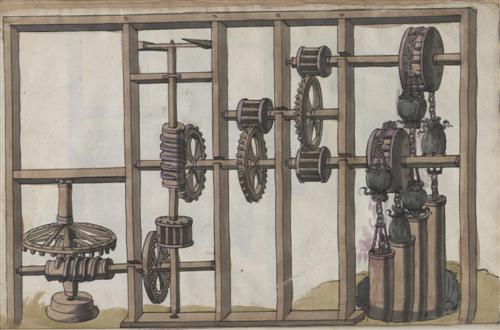
Drei Drucke und einige Zeichnungen des in Würzburg wirkenden Gelehrten als Digitalisate.
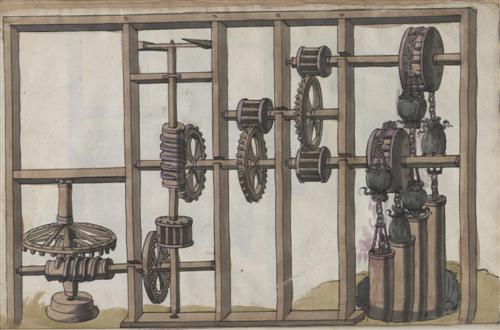
KlausGraf - am Dienstag, 23. Dezember 2008, 00:59 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein experimentelles Nachkochen von drei Lebkuchenrezepten aus dem Kochbuch der Sabina Welserin, Augsburg 1553 bietet ein englischsprachiges Dossier:
http://www.curiousfrau.com/Downloads/Welserin_3_Lebkuchen_recipes.pdf
Ein modernes Rezept für Nürnberger Lebkuchen auf Deutsch offeriert Wikibooks:
http://de.wikibooks.org/wiki/Kochbuch/_Nürnberger_Lebkuchen

Nürnberger Lebküchner um 1520, Darstellung aus dem Landauer-Hausbuch
Ausgewählte Kochbuch-Links
http://de.wikisource.org/wiki/Kochbücher
Linkliste (mit etlichen Überschneidungen zur folgenden Liste)
http://www.google.com/Top/Home/Cooking/World_Cuisines/Historic/
Linksammlung
http://www.kookhistorie.nl/
Linksammlung
http://www.thousandeggs.com/cookbooks.html
Linksammlung (vor allem E-Texte, engl. Übersetzungen)
http://www.uni-giessen.de/gloning/kobu.htm
Thomas Glonings Monumenta Culinaria sind an Materialreichtum unübertroffen (überwiegend E-Texte, kaum Digitalisate)
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/imatges/llibres/grewe.htm
Fons Grewe in Barcelona - über 40 Kochbücher aus dem 16.-18. Jahrhundert in diversen Sprachen
http://130.243.103.139:8080/cgi-bin/library?site=localhost&a=p&p=about&c=unicoo&ct=0&l=sv&w=utf-8
Diverse Kochbücher (15.-20. Jahrhundert), in Schweden digitalisiert. Anbieter ist die schwedische Örebro-Universität, die Bücher stammen aus einer Bibliothek in Grythyttan, wohl aus dem dortigen Kochbuchmuseum.
http://digital.lib.msu.edu/projects/cookbooks/html/browse.html
Feeding America - englische Bücher 19./20. Jh.
http://www.alteskochbuch.at/rezeptdatenbank.html
Die Rezeptdatenbank der Bibliothek der Oberösterreichischen Landesmuseen enthält Originalrezepte aus den handgeschriebenen Kochbüchern ihrer Sammlung von 1646 bis ins 20. Jahrhundert.
Siehe http://archiv.twoday.net/stories/5263165/
http://ub.uni-graz.at/sosa/druckschriften/dergedeckteTisch/index.php
Der gedeckte Tisch - Materialien (E-Texte und Digitalisate) aus der UB Graz
http://alo.uibk.ac.at/webinterface/library/COLLECTION_V01?objid=12438
22 Kochbücher, überwiegend aus Österreich, bei ALO
Darunter auch eine Handschrift "Kuchenmeisterey" aus dem 16. Jahrhundert
ALO
http://de.wikisource.org/wiki/Praktisches_Kochbuch_für_die_Deutschen_in_Amerika
Henriette Davidis: Kochbuch (1879)
http://www.kochrezepte.org/
Zwei Kochbücher des 19. Jh. als E-Text und (schlechtes) Faksimile
Einzelne Digitalisate deutschsprachiger Kochbücher:
http://diglib.hab.de/inkunabeln/179-2-quod-3/start.htm
Kuchemeisterey, Speyer 1487
http://diglib.hab.de/inkunabeln/276-quod-2/start.htm
Kuchemaistrey, [Nürnberg ca. 1490]
http://www.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00022997/images/
B. Platina, Von allen Speisen und Gerichten, Koch und Kellerey, 1530
Zum Autor: http://weinbaugeschichte.zadi.de/index.cfm (Bibliographie zu Küchenmeistereien)
http://www.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00025344/images/
B. Platina, Von allen Speysen unnd Gerichten, 1542
http://www.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00025628/images/
Koch- und Kellerey von allen Speisen, 1544
http://mdz1.bib-bvb.de/~db/0001/bsb00015958/images/
Kocherey und Kellermeisterey von allen Speisen und Getrenken, 1557
http://www.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00028737/images/
Anna Wecker: Ein Köstlich new Kochbuch Von allerhand Speisen, 1598
http://diglib.hab.de/drucke/142-17-pol/start.htm
G. P. Harsdörffer: Trincir-Buch, 1657 (gewidmet Maximilian Willibald Graf zu Wolfegg)
http://diglib.hab.de/drucke/6-oec/start.htm
Susanna Maria Endter: Der aus dem Parnasso ehmals entlauffenen vortrefflichen Köchin/ Welche bey denen Göttinnen Ceres, Diana und Pomona viel Jahre gedienet/ Hinterlassene und bißhero/ Bey unterschiedlichen der Löbl. Koch-Kunst beflissenen Frauen zu Nürnberg/ zerstreuet und in grosser Geheim gehalten gewesene Gemerck-Zettul : Woraus zu erlernen/ Wie man über anderthalb Tausend/ so wol gemeine/ als rare Speisen ... zu zubereiten und zu kochen ..., 1691
http://diglib.hab.de/drucke/oe-561/start.htm
Der wohl-unterwiesenen Köchinn Zufälliger Confect-Tisch, 1700
Frauenzimmer-Lexicon, 1715 (mit komplettem Kochbuch)
http://diglib.hab.de/drucke/ae-12/start.htm
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00022327
Braunschweigisches Kochbuch, 1800
http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN572737866
Köchin und Küche, 1844
http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN529826518
Der Küchen-Kalender, 1874
http://diglib.hab.de/drucke/ed000009/start.htm
Illustrirtes Haushaltungs-Lexicon, 1884 (mit Kochbuch)
http://diglib.hab.de/drucke/ed000008-1/start.htm
http://diglib.hab.de/drucke/ed000008-2/start.htm
Universal-Lexikon der Kochkunst, 1-2, 1886
http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN572766424
Alfred Seefeld: Einfachstes Kochbuch, 1895
http://books.google.com/books?q=intitle:kochbuch&hl=de&as_brr=3
Google-Digitalisate (mehr mit US-Proxy)
http://tinyurl.com/7rvlaw
Weitere Digitalisate via OAIster (Heidelberger Handschriften: 9
Kochbücher, archive.org, Harvard)

KlausGraf - am Dienstag, 23. Dezember 2008, 00:59 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/895062/
Das wird den Verlegern gar nicht gefallen.
§ 52b UrhG lautet: "Zulässig ist, veröffentlichte Werke aus dem Bestand öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Museen oder Archive, die keinen unmittelbar oder mittelbar wirtschaftlichen oder Erwerbszweck verfolgen, ausschließlich in den Räumen der jeweiligen Einrichtung an eigens dafür eingerichteten elektronischen Leseplätzen zur Forschung und für private Studien zugänglich zu machen, soweit dem keine vertraglichen Regelungen entgegenstehen. 2Es dürfen grundsätzlich nicht mehr Exemplare eines Werkes an den eingerichteten elektronischen Leseplätzen gleichzeitig zugänglich gemacht werden, als der Bestand der Einrichtung umfasst. 3Für die Zugänglichmachung ist eine angemessene Vergütung zu zahlen. 4Der Anspruch kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden."
Sind z.B. vom Palandt 45 Exemplare in der Lehrbuchsammlung vorhanden, dürfen 45 Studierende an den Bibliotheks-PCs gleichzeitig auf das Buch zugreifen.
Die verschiedentlich thematisierte Annex-Vervielfältigung ist für Fromm/Nordemann, UrhR 10. Aufl. 2008, § 52b Rn. 10f. kein Thema (gegen Berger GRUR 2007, 756). Die Befugnis gelte auch, wenn der Verlag das Werk in digitaler Form anbietet, ein diesbezüglicher Kontrahierungszwang bestehe nicht: kein Vorrang digitaler Verlagsangebote (so auch Hoeren, MMR 2007, 615).
Update:
http://bibliothekarisch.de/blog/2008/12/23/ein-trend-zum-e-book/
Das wird den Verlegern gar nicht gefallen.
§ 52b UrhG lautet: "Zulässig ist, veröffentlichte Werke aus dem Bestand öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Museen oder Archive, die keinen unmittelbar oder mittelbar wirtschaftlichen oder Erwerbszweck verfolgen, ausschließlich in den Räumen der jeweiligen Einrichtung an eigens dafür eingerichteten elektronischen Leseplätzen zur Forschung und für private Studien zugänglich zu machen, soweit dem keine vertraglichen Regelungen entgegenstehen. 2Es dürfen grundsätzlich nicht mehr Exemplare eines Werkes an den eingerichteten elektronischen Leseplätzen gleichzeitig zugänglich gemacht werden, als der Bestand der Einrichtung umfasst. 3Für die Zugänglichmachung ist eine angemessene Vergütung zu zahlen. 4Der Anspruch kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden."
Sind z.B. vom Palandt 45 Exemplare in der Lehrbuchsammlung vorhanden, dürfen 45 Studierende an den Bibliotheks-PCs gleichzeitig auf das Buch zugreifen.
Die verschiedentlich thematisierte Annex-Vervielfältigung ist für Fromm/Nordemann, UrhR 10. Aufl. 2008, § 52b Rn. 10f. kein Thema (gegen Berger GRUR 2007, 756). Die Befugnis gelte auch, wenn der Verlag das Werk in digitaler Form anbietet, ein diesbezüglicher Kontrahierungszwang bestehe nicht: kein Vorrang digitaler Verlagsangebote (so auch Hoeren, MMR 2007, 615).
Update:
http://bibliothekarisch.de/blog/2008/12/23/ein-trend-zum-e-book/
KlausGraf - am Dienstag, 23. Dezember 2008, 00:51 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Neue Leiterin der Badischen Landesbibliothek wird Freifrau Hiller von Gaertringen, nachdem Vorgänger Ehrle aus Verärgerung über die Behandlung der Causa Karlsruhe vom Rechnungshof geforderte Stellenkürzungen (28,1 von 91,5 Stellen sollten eingespart werden, was inzwischen auf 13,9 reduziert wurde) sich in den Ruhestand verabschiedet hatte. Ludger Syré, Peter Michael Ehrle war 14 Jahre lang Direktor der Badischen Landesbibliothek, in: Badische Heimat 88 (2008), S. 217-223 würdigt die Leistung Ehrles.
"Dr. Julia Freifrau Hiller von Gaertringen, promovierte Literaturwissenschaftlerin, absolvierte ihre bibliothekarische Ausbildung an der Universitäts- und Landesbibliothek und an den Stadtbüchereien Düsseldorf und arbeitet heute als Wissenschaftliche Bibliothekarin an der Lippischen Landesbibliothek Detmold.
Veröffentlichungen: Meine Liebe zu Griechenland stammt aus dem Krieg. Studien zum literarischen Werk Erhart Kästners (1994), Herausgeberin: Was die Seele braucht. Erhart Kästner über Bücher und Autoren (1994)."
http://www.grupello.de/verlag/autoren/autor/Dr.%20Julia%20Freifrau%20Hiller%20von%20Gaertringen/session/ident/
Zu den militaristischen Vorfahren:
http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Hiller_von_Gaertringen
Die dort angegebene Herkunft der Familie aus Graubünden ist Kappes. Stammvater ist der bürgerliche Bayer Hans Martin Hiller (gest. 1594), die Familie erhielt den Adelsstand erst 1628 und gehörte später zur Reichsritterschaft wegen Gärtringen (seit 1640 Besitz der Familie), siehe Adelslexikon 5 (1984); S. 218f. Schnipsel
Via
http://log.netbib.de/archives/2008/12/20/wurttembergische-landesbibliothek-stuttgart-mit-benutzungsgebuhren-im-jahr-2009/

http://www.adv-boeblingen.de/zrbb/gaert/gaert/grenz4gr.htm
"Dr. Julia Freifrau Hiller von Gaertringen, promovierte Literaturwissenschaftlerin, absolvierte ihre bibliothekarische Ausbildung an der Universitäts- und Landesbibliothek und an den Stadtbüchereien Düsseldorf und arbeitet heute als Wissenschaftliche Bibliothekarin an der Lippischen Landesbibliothek Detmold.
Veröffentlichungen: Meine Liebe zu Griechenland stammt aus dem Krieg. Studien zum literarischen Werk Erhart Kästners (1994), Herausgeberin: Was die Seele braucht. Erhart Kästner über Bücher und Autoren (1994)."
http://www.grupello.de/verlag/autoren/autor/Dr.%20Julia%20Freifrau%20Hiller%20von%20Gaertringen/session/ident/
Zu den militaristischen Vorfahren:
http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Hiller_von_Gaertringen
Die dort angegebene Herkunft der Familie aus Graubünden ist Kappes. Stammvater ist der bürgerliche Bayer Hans Martin Hiller (gest. 1594), die Familie erhielt den Adelsstand erst 1628 und gehörte später zur Reichsritterschaft wegen Gärtringen (seit 1640 Besitz der Familie), siehe Adelslexikon 5 (1984); S. 218f. Schnipsel
Via
http://log.netbib.de/archives/2008/12/20/wurttembergische-landesbibliothek-stuttgart-mit-benutzungsgebuhren-im-jahr-2009/

http://www.adv-boeblingen.de/zrbb/gaert/gaert/grenz4gr.htm
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sieht mau aus.
http://www2.gender.hu-berlin.de/genderbib/2008/12/22-dezember-open-access-freier-zugang-zur-frauen-und-geschlechterforschung/
Archivalia wird erwähnt.
http://www2.gender.hu-berlin.de/genderbib/2008/12/22-dezember-open-access-freier-zugang-zur-frauen-und-geschlechterforschung/
Archivalia wird erwähnt.
KlausGraf - am Dienstag, 23. Dezember 2008, 00:36 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.telemedicus.info/article/1096-Wie-wehrt-man-sich-gegen-Persoenlichkeitsverletzungen-auf-Wikipedia.html
M. Schindler tut so, als gäbe es gar kein Problem. Schönfärberei vom Feinsten.
M. Schindler tut so, als gäbe es gar kein Problem. Schönfärberei vom Feinsten.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Das wurde auch nach Veröffentlichung des neuen Diözesanhaushaltes besonders deutlich, der für die Renovierung des Bischöflichen Palais, für Um- und Neubauten rund 36,5 Millionen Euro veranschlagt. Damit soll nicht nur das barocke Gebäude gesichert, sondern die Verwaltung modern und zent- ral untergebracht werden. Auch das Archiv, das im Keller vor sich hinschimmelt, so dass die Mitarbeiter bei ihren Recherchearbeiten eigentlich Gesichtsmasken tragen müssten, gehört saniert. Alle sparsamen Schwaben, die von der Dringlichkeit der Maßnahmen nach über 50-jähriger Renovierungsabstinenz noch nicht überzeugt sind, hofft Fürst durch ein Argument zu besänftigen: "Das ist unser Investitionsprogramm. Wir sichern damit auch Arbeitsplätze", erklärt Fürst und kann dabei beruhigt auf eine solide Finanzierung verweisen. ......." (1) Für den Neubau des Archivs ohne Lesesall (?) sind 7.750.000 € im Haushaltsplans veranschlagt - lt. Pressemitteilung des Diözese.(2)
Quellen:
(1) http://www.szon.de/news/wirimsueden/land/200812220650.html
(2) http://www.drs.de/index.php?id=8566&tx_ttnews[backPid]=93&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=9513&cHash=044bffe93d
Quellen:
(1) http://www.szon.de/news/wirimsueden/land/200812220650.html
(2) http://www.drs.de/index.php?id=8566&tx_ttnews[backPid]=93&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=9513&cHash=044bffe93d
Wolf Thomas - am Montag, 22. Dezember 2008, 16:51 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Kempf stammt gebürtig zwar aus Singen, hat aber über seinen Vater, ein Inneringer, schon von Kind auf Kontakt zu Hohenzollern. Nach dem Studium der Geschichte, der Philosophie, der Politik und des Buchwesens sowie verschiedener Tätigkeiten war Kempf von 1974 bis 1981 zunächst im Staatsarchiv in Sigmaringen beschäftigt und - als Vorgänger von Dr. Otto Becker - zuständig für das Fürstliche Haus- und Domänenarchiv. 1981 bot Fürst Friedrich Wilhelm dem damals 37-Jährigen die Stelle im Schloss an. "Man braucht eine solide humanistische Grundlage", sagt Kempf, "und Diskretion und Loyalität zur fürstlichen Familie". Diese Voraussetzungen hat Kempf, der von 1982 bis 1987 zusätzlich zur Bibliothek die Schlossverwaltung geleitet hat und noch heute als Redakteur die jährlichen "Hofkammer-Mitteilungen" erstellt, zur vollsten Zufriedenheit erfüllt. Und Kempf betont: "Die Arbeit in einer privaten Bibliothek ist nicht mit der in einer öffentlichen zu vergleichen. Ich bin dem Fürsten und Erbprinzen sehr dankbar, dass ich frei und selbstständig arbeiten konnte und einen Beitrag zum Erhalt der Kunstschätze und zu ihrer öffentlichen Nutzung leisten durfte."
Die Wiedereröffnung des Schlossmuseums im vergangenen Jahr war einer der Höhepunkte in der langen Laufbahn Kempfs. "Mit der Organisation des Museums und der Hofbibliothek habe ich etwas mitgestalten können, das Bestand hat und auf dem man aufbauen kann", sagt Kempf. Leider nicht abgeschlossen sei die Katalogisierung der Sammlung historischer Fotos. Diese Arbeit will Kempf in den nächsten Monaten weiterführen. "Ich hätte vor meinem Ruhestand auch gerne erreicht, dass im Schloss Räume für Wechselausstellungen zur Verfügung stehen. Es gibt schönes Porzellan, alte Münzen, Bucheinbände, künstlerische Nachlässe, das auf diesem Weg zugänglich gemacht werden könnte." ..."
Quelle: Schwäbische Zeitung
Die Wiedereröffnung des Schlossmuseums im vergangenen Jahr war einer der Höhepunkte in der langen Laufbahn Kempfs. "Mit der Organisation des Museums und der Hofbibliothek habe ich etwas mitgestalten können, das Bestand hat und auf dem man aufbauen kann", sagt Kempf. Leider nicht abgeschlossen sei die Katalogisierung der Sammlung historischer Fotos. Diese Arbeit will Kempf in den nächsten Monaten weiterführen. "Ich hätte vor meinem Ruhestand auch gerne erreicht, dass im Schloss Räume für Wechselausstellungen zur Verfügung stehen. Es gibt schönes Porzellan, alte Münzen, Bucheinbände, künstlerische Nachlässe, das auf diesem Weg zugänglich gemacht werden könnte." ..."
Quelle: Schwäbische Zeitung
Wolf Thomas - am Montag, 22. Dezember 2008, 16:47 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Die beiden Ereignisse [u. a. Verkauf der Firma Bally an amerikanische Eigentümer] rüttelten auf, und es stellten sich Fragen. Was konnte man tun, um trotz des Verlustes der Fabrik wenigstens das historische Gedächtnis zu bewahren? Welche Sammlungen, Archive oder Quellen gab es? Wo befanden sie sich und wem gehörten sie? Verschiedene Aktivitäten und Gespräche führten im folgenden Jahr zur Gründung des Ballyana-Archivs und der Stiftung für Bally Familien- und Firmengeschichte als dessen Trägerin.
Das Ballyana-Archiv sollte die zahlreichen, weit verstreuten mobilen Hinterlassenschaften der Industriegeschichte sammeln, erhalten und Interessierten zugänglich machen. Dabei sollte alles einbezogen sein, was mit der Vergangenheit der Industrie in einem Zusammenhang steht: Schuhe, Schuhschachteln, Werbegrafik und -gegenstände, Leisten, Werkzeug, Jubiläumsgeschenke für Mitarbeiter, Hauszeitungen, Fotos und Bilder etc. ...."
Quelle:
http://www.oltnertagblatt.ch/?srv=ops&pg=detail&id=340258
Link zum Archiv:
http://www.ballyana.ch (mit Online-Beständebeschreibungen)
Das Ballyana-Archiv sollte die zahlreichen, weit verstreuten mobilen Hinterlassenschaften der Industriegeschichte sammeln, erhalten und Interessierten zugänglich machen. Dabei sollte alles einbezogen sein, was mit der Vergangenheit der Industrie in einem Zusammenhang steht: Schuhe, Schuhschachteln, Werbegrafik und -gegenstände, Leisten, Werkzeug, Jubiläumsgeschenke für Mitarbeiter, Hauszeitungen, Fotos und Bilder etc. ...."
Quelle:
http://www.oltnertagblatt.ch/?srv=ops&pg=detail&id=340258
Link zum Archiv:
http://www.ballyana.ch (mit Online-Beständebeschreibungen)
Wolf Thomas - am Montag, 22. Dezember 2008, 16:45 - Rubrik: Wirtschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Auf die aktuelle Bericherstattung in den Kommentaren zu
http://archiv.twoday.net/stories/5353032/
sei hingewiesen.
http://archiv.twoday.net/stories/5353032/
sei hingewiesen.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Immer wieder stoße ich auf Hinweise auf Digitalisate der hessischen Staatsarchive, z.B. hier.
Leider fehlen mir die intellektuellen Fähigkeiten, HADIS zu benutzen. Ich habe also noch kein Digitalisat jemals zu Gesicht bekommen. Vielleicht kann ein hessischer Leser dieses Weblogs in den Kommentaren Entwicklungshilfe leisten?
http://www.hadis.hessen.de/scripts/hadis.dll/direct?link=1213901
"Im Internet sind ebenso die digitalen Urkundenabbildungen der allgemeinen Abteilung (s. Klassifikation Urkunden/Allgemein) sowie die betreffenden Stammtafeln der Althessischen Ritterschaft (s. Klassifikation Akten/Familienarchiv/Familiengeschichte/Stammbäume) verfügbar."
Nur wo?
Nachtrag: Zufällig sah ich jetzt beim hilflosen Umherirren in HADIS eine Fuldaer Urkunde.
Leider fehlen mir die intellektuellen Fähigkeiten, HADIS zu benutzen. Ich habe also noch kein Digitalisat jemals zu Gesicht bekommen. Vielleicht kann ein hessischer Leser dieses Weblogs in den Kommentaren Entwicklungshilfe leisten?
http://www.hadis.hessen.de/scripts/hadis.dll/direct?link=1213901
"Im Internet sind ebenso die digitalen Urkundenabbildungen der allgemeinen Abteilung (s. Klassifikation Urkunden/Allgemein) sowie die betreffenden Stammtafeln der Althessischen Ritterschaft (s. Klassifikation Akten/Familienarchiv/Familiengeschichte/Stammbäume) verfügbar."
Nur wo?
Nachtrag: Zufällig sah ich jetzt beim hilflosen Umherirren in HADIS eine Fuldaer Urkunde.
KlausGraf - am Montag, 22. Dezember 2008, 12:26 - Rubrik: Staatsarchive
KlausGraf - am Montag, 22. Dezember 2008, 12:11 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 22. Dezember 2008, 11:59 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://digital.bibliothek.uni-halle.de/hd/nav/history
Zu den seit 28.8.2008 online gestellten historischen Drucken gibt es auch einen RSS-Feed:
http://digital.bibliothek.uni-halle.de/rss/

Eine Karte Gadners von Württemberg:
http://digital.bibliothek.uni-halle.de/hd/content/pageview/35298
Zu den seit 28.8.2008 online gestellten historischen Drucken gibt es auch einen RSS-Feed:
http://digital.bibliothek.uni-halle.de/rss/

Eine Karte Gadners von Württemberg:
http://digital.bibliothek.uni-halle.de/hd/content/pageview/35298
KlausGraf - am Montag, 22. Dezember 2008, 11:38 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.antiquaria-ludwigsburg.de/katalog/Antiquaria2009.pdf
Antiquariat Joachim Lührs:
Herzog von Sachsen-Teschen. – Abschließende Erfassung
des Finanzvermögens 1828. Handschriftlicher Überschlag
der Hofzahlamtsausgaben 1828 in 24 Punkten, darunter
Hofjagddepartment, Militäretat und Beiträge des Hoftheaters.
1.500,–
Im Anhang eines Dresdner Schreibe-Calenders auf das Jahr 1829. Dresden,
J. G. J. Albrecht 1829. 35 bedruckte und 28 hs. paginierte, beschriebene Bll.
Kl.-8vo. OLdr. Mit reicher Goldprägung sowie Ganz-Goldschnitt.
Zum Thema Schreibkalender:
http://archiv.twoday.net/search?q=schreibkalend
Antiquariat Joachim Lührs:
Herzog von Sachsen-Teschen. – Abschließende Erfassung
des Finanzvermögens 1828. Handschriftlicher Überschlag
der Hofzahlamtsausgaben 1828 in 24 Punkten, darunter
Hofjagddepartment, Militäretat und Beiträge des Hoftheaters.
1.500,–
Im Anhang eines Dresdner Schreibe-Calenders auf das Jahr 1829. Dresden,
J. G. J. Albrecht 1829. 35 bedruckte und 28 hs. paginierte, beschriebene Bll.
Kl.-8vo. OLdr. Mit reicher Goldprägung sowie Ganz-Goldschnitt.
Zum Thema Schreibkalender:
http://archiv.twoday.net/search?q=schreibkalend
KlausGraf - am Montag, 22. Dezember 2008, 11:28 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.arendt-art.de/deutsch/Evelyn%20Hecht-Galinski/LG%20Berlin,%20Urteil%2026.11.08-%2027%20O%20672.08.htm
Lesenswerte Ausführungen des LG Berlin zu Art. 5 GG.
Lesenswerte Ausführungen des LG Berlin zu Art. 5 GG.
KlausGraf - am Montag, 22. Dezember 2008, 11:13 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Instruktiver 3sat-Beitrag
http://wstreaming.zdf.de/zdf/veryhigh/081012_sendung_nes.asx
http://www.semapedia.org/
Immer noch duldet die Wikipedia den Semapedia-Artikel nicht im "Enzyklopädie-Namensraum", sondern nur auf den Community-Seiten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Enzyklopädie/Semapedia


http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Tagging
http://wstreaming.zdf.de/zdf/veryhigh/081012_sendung_nes.asx
http://www.semapedia.org/
Immer noch duldet die Wikipedia den Semapedia-Artikel nicht im "Enzyklopädie-Namensraum", sondern nur auf den Community-Seiten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Enzyklopädie/Semapedia


http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Tagging
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.amazon.de/Sagen-Schwäbischen-Alb-Klaus-Graf/dp/3871810312
Sagen der Schwäbischen Alb, hrsg. und kommentiert von Klaus Graf, Leinfelden-Echterdingen: DRW Verlag 2008. 304 Seiten mit 44 SW-Abbildungen und einer Karte der Schauplätze. 16,90 Euro.
ISBN 978-3-87181-031-2
Wer mich und meine Arbeit unterstützen will, kann dies durch den Erwerb des Buches tun :-)

Als Kostprobe gibt es die Einleitung in meiner Preprint-Fassung.
„Eine Gegend ist romantisch, wo Geister wandeln; mögen sie uns an vergangene Zeiten mahnen oder sonst in geheimer Geschäftigkeit sich um uns her bewegen. Wir stehn noch außer dem Reigen der luftigen Elfen, die nach der nordischen Sage nur der sieht, der innerhalb ihres Kreises steht; aber wir fühlen ihre wehende Bewegung, wir hören ihre flüsternden Stimmen“. Ludwig Uhland: Über das Romantische, 1807
„Mehr und mehr wissen wir heute, daß dieses ‚Volksgut’ nur vielfach gefiltert zu uns gelangt ist, gemahlen durch die Denkmühlen bürgerlichen Bewußtseins und neu gekocht oder gebacken für ein Publikum, dessen Interessen nur selten identisch waren mit denen des Volkes.“ Rudolf Schenda: Volkserzählung und nationale Identität: Deutsche Sagen im Vormärz (1830-48). In: Fabula 25 (1984), S. 302
Eine einfache Definition der Sage könnte lauten: Sagen sind das, was man in Büchern, die Sagenbücher heißen, vorfindet. Im Jahr 1800 erschien die erste moderne Sagensammlung, Johann Carl Christoph Nachtigals Volcks-Sagen, aber ohne die umfangreichen zweibändigen Deutschen Sagen der Brüder Grimm (1816/18) hätte das Sagensammeln wohl kaum zu der Flut von Sagenbüchern geführt, die im deutschsprachigen Raum im 19. und 20. Jahrhundert erschienen sind. Die romantische Begeisterung für die „Volkspoesie“ hat die literarische Gattung Sage wesentlich geformt. Gleichzeitig haben romantische Klischees unausrottbare Irrtümer über das vermeintliche „Wesen“ von Sagen in die Welt gesetzt.
Sagen sind keine Botschaften aus uralter Zeit, die mündlich von Generation zu Generation getreu weitergegeben wurden. Sie sind keine Quellen für die „Geisteswelt der vorchristlichen Menschheitsgeschichte“, wie man noch in einem Buch Sagen und Bräuche im Kreis Esslingen aus dem Jahr 1985 lesen kann. Es sind keine Überbleibsel aus grauer Vorzeit, sondern zuallererst literarische und volkskundliche Dokumente ihrer Zeit, nämlich der Zeit, in der sie aufgeschrieben wurden, also des 19. und 20. Jahrhunderts.
Der Sagenbestand eines Raums ist immer das Ergebnis einer komplexen Wechselwirkung zwischen Erzählern (und Erzählerinnen) auf der einen Seite und den Sammlern auf der anderen Seite. Ohne die Erzähler gäbe es keine Sagen, ohne die Sammler aber auch nicht. Sagen spiegeln die subjektiven Vorlieben, den literarischen Geschmack, das Weltbild und die sozialen Verhältnisse ihrer Erzähler. Sie spiegeln aber auch die Vorurteile und Neigungen der gelehrten Sammler, deren gedruckte Sagenbücher alles andere als ein unverfälschtes Abbild vergangener Erzählkultur bieten. Die Sammler waren auf der Suche nach „echter“ Volkspoesie, sie ließen weg, was ihnen zu unscheinbar oder anstößig erschien, und sie redigierten und schrieben die Texte um, damit sie möglichst dem von den Brüdern Grimm erfundenen „Sagenton“ entsprachen. Steuerungs- und Ausblendungsprozesse schufen das trügerische Bild einer „zauberhaften Sagenheimat“. Sagenfassungen in Gedichtform kamen zunehmend aus der Mode: Volkskundlerinnen und Volkskundler schätzen heute nur die nüchterne Prosasage, den authentischen „Ethnotext“, der sozialgeschichtlich interpretierbar ist. Um Sagengedichte machen Volkskundler einen großen Bogen und Germanisten ebenfalls, es sei denn, sie stammen aus der Feder berühmter Autoren.
Sagensammler brauchten ein gerüttelt Maß an Glück und Findigkeit, mussten sie doch das Vertrauen ihrer Gewährsleute erwerben. Gern verschwieg man Geister- und Hexengeschichten, um nicht als abergläubisch und rückständig zu gelten. Als der Tübinger Professor Ernst Meier, der 1852 die erste wichtige gedruckte Sammlung schwäbischer Sagen veröffentlichte, sorgfältig aufschrieb, was ihm ein Schäfer an „altem Gesag“ berichtete, fragte ihn der Erzähler: „Aber Herr, glaubet denn Sia so Lumpesächle no?“ Man durfte auch nicht mit der Tür ins Haus fallen und etwa fragen: „Gibts keine Sagen hier?“ Auf so plumpe Fragen, wusste Meier, „wird man ein einfaches Nein zur Antwort bekommen; oder das Volk antwortet wie jene Bäckerfrau auf die nämliche Frage etwa so: ‚noi, Sagen hent mer koine, aber Wecken!’“
Sagen sind „geglaubte Tradition“, liest man oft in der volkskundlichen Fachliteratur. Ohne Frage lassen viele Albsagen die Angst vor einer harten und unbarmherzigen Natur erkennen, in der tückische Geister den Menschen Schaden zufügen. Die grausamen, Tod und Verderben bringenden Spukgestalten scheinen nichts gemein zu haben mit jenen romantischen Wesen, mit denen Uhland die Landschaft beseelt sah. Wenn man aber Kinder mit Schreckgestalten wie dem Hakenmann, der unaufmerksame Kinder in die Donau zieht, vor Gefahren warnte, wird man bezweifeln dürfen, dass alle Erwachsenen felsenfest von der Existenz der Dämonen überzeugt waren. Neben dem Sagenglauben gab es immer auch den Sagenzweifel. Nicht selten nahm man nicht einfach für bare Münze, was erzählt wurde, sondern prüfte nach. So heißt es über das Pfullinger „Nachtfräuleinloch“ bei Ernst Meier: „Vor einigen 20 Jahren hat man dieß Loch untersucht und weiter darin nachgegraben“. Viele Sagen waren einfach nur unterhaltsame Geschichten, an die man nicht oder nur halb geglaubt hat. Viel zu wenig weiß man über die sogenannten „Anti-Sagen“, die den Sagenglauben angreifen und entlarven. Beispiel: Ein geheimnisvolles Licht entpuppt sich als phosphoreszierender Baumstamm. Solche eher lustigen Geschichten, die natürliche Erklärungen für angeblich Übernatürliches anboten, findet man kaum in den gedruckten Sammlungen. Aber Anti-Sagen waren ebenso wie die Sagen Elemente einer reichhaltigen und vielgestaltigen mündlichen Erzählkultur, in der sich mündliche Überlieferungen und Angelesenes untrennbar vermischten.
Die Sammler mündlichen Erzählguts wählten nach ihren Vorlieben aus, und viele Geschichten bekamen sie überhaupt nicht zu hören. Fixiert auf das romantische Vorurteil uralter Überlieferung verkannten sie die Abhängigkeit der „Volkssagen“ von zeitgenössischen Lesestoffen. Die vielen romantischen Burgensagen und die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts in der deutschen Literaturgeschichte greifbare Begeisterung für (meist triviale) Rittergeschichten gehören zusammen. Die mündliche Volkskultur und die Welt der Bücher verband ein ständiger intensiver Austausch, der von den volkskundlichen Gralshütern der „echten Volkssage“ bis heute entschieden unterschätzt wird.
Die Vielfalt mündlichen Erzählens kann kein Sagenband wiedergeben. Dörfer und Städte waren erfüllt von Geschichten. Es gab viele Gelegenheiten zum Erzählen: Geschichten waren im Wirtshaus ebenso zu hören wie im Heimatkundeunterricht der Schule. Es konnten lustige, traurige, fromme oder unheimliche Geschichten sein, wahre, halbwahre und erfundene. Nur ein winziger Bruchteil von ihnen hat Eingang in die bewahrende Schriftlichkeit gefunden.
Natürlich erzählt man auch heute noch Sagen. Dies gilt auch, wenn man die sogenannten „modernen Sagen“ à la Die Spinne in der Yucca-Palme ausklammert. Die mündlichen Albsagen der Gegenwart sind vor allem aus Heimatbüchern und Sagenbänden geläufig. Unbekannte Geschichten über Riesen und Zwerge voller stiller Poesie, wie sie vor über 150 Jahre Ernst Meier notieren konnte, gibt es sicher nicht mehr aufzuspüren. Aber bei geduldiger Suche würde man auf der Alb noch viele einfache Geistergeschichten und dutzende Angaben über vermeintliche unterirdische Gänge vorfinden. Schon Ludwig Uhland klagte um 1830, die Zeit, Sagen zu sammeln, sei vorbei. Rund zwanzig Jahre später bewies ihm Ernst Meier, der sein Buch Uhland widmete, das Gegenteil.
Die Maßstäbe für das Sammeln von Sagen auf der Schwäbischen Alb setzte 1823 ein Freund Uhlands. Dem Stuttgarter Gymnasiallehrer Gustav Schwab (1792-1850), heute noch bekannt durch seine Sagen des klassischen Altertums, gelang 1823 mit seinem Reiseführer Die Neckarseite der Schwäbischen Alb ein Beststeller. Schwab gab eine Reihe von Sagen, die er vor Ort aufschnappte oder aus gelehrten Werken exzerpierte, in Prosa wieder, daneben bearbeitete er Sagenstoffe auch in Form von Gedichten („Romanzen“). Dieses Buch hat großen Einfluss auf spätere Sammlungen ausgeübt – und auch auf das mündliche Erzählen. Schwab war damals nicht der einzige, der Sagenballaden schrieb. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren Sagengedichte weitaus beliebter als Prosa-Sagen. So ist es denn kein Zufall, dass der Hermaringer Pfarrer Rudolf Magenau zwei Jahre später das erste gedruckte schwäbische Sagenbuch (Poetische Volks-Sagen und Legenden größtentheils aus Schwaben, 1825) als Gedichtband herausbrachte.
Bei den Sagengedichten dominierten die „historischen Sagen“. Die Brüder Grimm hatten die „Ortssagen“ mit ihren dämonischen Gestalten, die man heute in der Volkskunde „dämonologische Sagen“ nennt, auf der einen Seite und die historischen Traditionen auf der anderen Seite in einen Topf geworfen und beide „Sage“ genannt. Weggelassen wurden aus der Volksüberlieferung die Märchen (als nicht ortsgebunden, obwohl es durchaus ortsgebundene Märchen gibt), die lustigen Geschichten („Schwänke“) und die frommen Legenden. Die Verbindung von Spukgeschichten und Geschichte unter dem gemeinsamen Etikett „Sage“ hat bis heute Bestand.
Historische Sagen begriff man im Vormärz als „vaterländische Altertümer“, wobei Vaterland natürlich das jeweilige Territorium meinte. Der Löwenanteil der Alb war württembergisch, altwürttembergisch-protestantisch, auch wenn nach 1802 vor allem vorderösterreichische katholische Gebiete das Königreich von Napoleons Gnaden vergrößert hatten. Dann gab es Hohenzollern, also die kleinen Fürstentümer Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen, die 1850 preußisch wurden. Und auf der Westalb waren etliche Orte großherzoglich badisch.
Vaterländische Sagen sollten den auf die jeweilige Monarchie bezogenen Patriotismus fördern, sie wurden als erhebender und poetischer Schmuck in Geschichtsdarstellungen aufgenommen. Es ging um die „Heimat im Prachtgewande des Alterthumes“ (Ludwig Egler, Aus der Vorzeit Hohenzollerns, 1861). Wilhelm Hauffs württembergische „Kunstsage“ Lichtenstein über die Flucht Herzog Ulrichs (1826), die Sagen-Anregungen aus Schwabs Neckarseite aufgriff, hat nicht nur zu dem Bau des neugotischen „Märchenschlosses“ Lichtenstein geführt, sondern auch die mündliche Sagenbildung merklich inspiriert. Sagen müssen als Teil der ausgeprägten Erinnerungs- und Geschichtskultur des 19. Jahrhunderts begriffen werden, also des Ensembles aus Denkmälern, Historienbildern, Schauspielen, Festzügen usw., mit denen man sich mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzte. Sage und Geschichte galten als Schwestern. Dies verdeutlicht auch die Darstellung der allegorischen Figuren Sage und Geschichte als Quellen für Kunst und Wissenschaft durch den Maler Wilhelm Peters auf der in der Mitte des 19. Jahrhunderts historistisch „rekonstruierten“ Burg Hohenzollern.
Mit Jacob Grimms Deutscher Mythologie (1835) rückten die dämonologischen Sagen in den Vordergrund. Aus ihnen erhoffte man sich Aufschlüsse über den einstigen germanischen Götterglauben. Inzwischen weiß man: Es war ein wissenschaftlicher Irrweg. Rudolf Schenda: „Die Parallelisierung von Mythen- und Sagenfiguren wurde zum Steckenpferd der deutschen Lehrerschaft. Wotan/Donar war allgegenwärtig, Frauengestalten, inklusive die Gottesmutter Maria, wurden mit Freya/Frouwa identifiziert, die Holden und Unholden trabten omnipräsent durch Berg und Tal“ (Mären von Deutschen Sagen. In: Geschichte und Gesellschaft 9, 1983, S. 37).
Eine umfassende Sammlung schwäbischer Volkssagen bereitete der Stuttgarter Gymnasiallehrer Albert Schott der Jüngere (1809-1847) vor. Das Material trugen vor allem seine Schüler zusammen, die mündliche Sagen ihrer Heimat aufschreiben mussten. Schotts früher Tod verhinderte die Publikation, die mythologische Kommentare enthalten sollte, doch blieben die Materialien in Form einer zweibändigen Handschrift erhalten (heute in der Stuttgarter Landesbibliothek). 1850 bekamen die Seminaristen am Nürtinger Lehrerseminar von ihrem Rektor Theodor Eisenlohr (1805-1869) die gleiche Aufgabe gestellt. Sie sollten in ihren Ferien ebenfalls Sagen aufschreiben. Wolfram Haderthauer hat diese beiden und weitere frühe handschriftliche Sagensammlungen Württembergs in seiner Eichstätter Dissertation (2001) gewürdigt. Unglücklicherweise ist diese verdienstvolle Arbeit, deren Editionsteil nicht weniger als 376 Texte enthält, als in nur wenigen Bibliotheken einsehbare Mikrofiche-Ausgabe eher versteckt denn veröffentlicht.
Schüler- und Seminaristensammlungen bereiten Volkskundlern Sorgen, denn die Authentizität der Texte ist alles andere als sichergestellt. Der österreichische Volkskundler Richard Wolfram traf im Ultental eine alte Lehrerin, die sich daran erinnerte, wie die Lehramtskandidaten dem Tiroler Sagensammler Johann Adolf Heyl Sagen bringen mussten: „Er hat die Kandidaten sehr gequält und es hat auch schlechte Noten gegeben, wenn man ihm nichts Gutes gebracht hat. Ein Teil der Sagen bei Heyl ist deshalb derstunken und derlogen“. Von dem Aargauer Sagensammler und Lehrer Ernst Ludwig Rochholz wird Ähnliches berichtet: Er sei durch Sagen sehr zu erfreuen gewesen. Die Schüler erzählten Geschichten, die sie von Ehemaligen gehört hatten, und fabulierten einiges hinzu, was der Lehrer dann als Variante betrachtete. Im Fall der Sammlung Schotts ist ein schlüssiger Beweis, dass eine Geschichte von dem Schüler erfunden wurde, nicht möglich, auch wenn nicht wenige sich sehr „verdächtig“ lesen. Nimmt man die Sagen aber als literarische Texte, in denen Mündliches und Schriftliches sich durchdringen, verschwindet das Problem.
Die vielen sonst nicht bekannten Sagen in den frühen handschriftlichen Sammlungen können aber nicht alle auf individuelle Erfindungen („Fakelore“) zurückgeführt werden. Offenbar muss die romantische Vorstellung revidiert werden, die im 19. und 20. Jahrhundert aufgezeichneten Sagen seien die Reste eines umfassenderen, sehr alten Bestandes. Vielmehr hat man mit einem ständigen Wandel und Austausch des mündlichen Erzählguts vor Ort zu rechnen, also mit einer vergleichsweise hohen Fluktuation. Sagen bildeten sich häufig neu und verschwanden ebenso rasch wieder. Daneben gab es besonders populäre Geschichten, die sich länger halten konnten und in vielen Varianten kursierten, auch wenn sie zusätzlich in gedruckter Form eine Verfestigung erfahren hatten. Dies ist etwa der Fall bei den Erzählungen über die Pfullinger Urschel (dem besonders reichen Pfullinger Sagenbestand ist ein eigenes Kapitel gewidmet) oder die Sibylle von der Teck. Auch hier kann man eine deutliche Wechselwirkung zwischen schriftlichen und mündlichen Versionen feststellen.
Die beiden wichtigsten Autoren gedruckter schwäbischer Sagensammlungen im 19. Jahrhundert sammelten selber: der Tübinger Orientalistik-Professor Ernst Meier (1813-1866), dessen Deutsche Sagen, Sitten und Gebräuche aus Schwaben 1852 erschienen, und der katholische Geistliche und Germanistik-Hochschullehrer Anton Birlinger (1834-1891). Birlinger wurde bei seinem Sagenbuch Volksthümliches aus Schwaben (1861) von dem Arzt und Dialektautor Michael Buck aus Ertingen (1832-1888) unterstützt. Eine Nachlese Aus Schwaben verantwortete Birlinger 1874 allein. Beide Professoren, Meier und Birlinger, standen ganz im Bann der mythologischen Sagendeutung.
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts erschienen mehr und mehr „Heimatbücher“, die, häufig von Lehrern verfasst, Sagen einen Ehrenplatz einräumten. Die zivilisationskritische „Heimatbewegung“ pflegte bewusst das alte Volksgut, zu dem man auch die Sagen zählte. Zugleich etablierte sich die Volkskunde als eigenes Fach, getragen zunächst einmal nicht von akademischen Kreisen, sondern von vielen heimatbegeisterten Laien vor Ort, die in die volkskundlichen Vereine eintraten. Eine großangelegte Erhebung „volkstümlicher Überlieferungen“ fand 1899/1900 statt, als die württembergischen Volksschullehrer im Rahmen der Bezirkslehrerkonferenz Aufsätze nach einem vorgegebenen Fragebogen einreichen mussten (die sogenannten Konferenzaufsätze). Erwähnung verdient aber auch der 1888 gegründete Schwäbische Albverein, in dessen Vereinszeitschrift viele Sagen Eingang fanden.
Kein Berufsstand hat Sagen eifriger zusammengetragen als die Pädagogen. Die Lehrer lasen die Texte nicht nur mythologisierend und als Dokumente der Heimatgeschichte, sie waren auch sehr angetan von der moralischen Haltung der Sage und ihren sittlichen Werten. Sagen, in denen Frevler göttlicher Strafe anheim fielen, eigneten sich bestens für das erzieherische Projekt der „Volksveredelung“. Den Schulmeistern gefiel der erhobene Zeigefinger.
In Tuttlingen dokumentierte der Lehrer Dr. Paul Dold (1886-1934) die örtliche Sagenüberlieferung vermeintlich getreu, doch bei näherem Hinsehen stellen sich Zweifel ein. Wie viele Lehrer hat er vorgefundene Erzählungen, deren Gewährsleute er immerhin jeweils vermerkte, literarisiert und sprachlich gefälliger dargeboten. In Heimatbüchern und Sammlungen der Zwischenkriegszeit, etwa dem Sagenkränzlein (1924) des Oberlehrers Evarist Rebholz (1870-1932), trifft man regelmäßig süßlichen Sagen-Kitsch an. Ganz anders verhält es sich mit den 1935 bis 1939 zusammengetragenen, aber erst 1987 von dem Arzt Karl Keller (1914-1987) publizierten Sagen aus dem Lonetal. Auch wenn sie leider ins Hochdeutsche übersetzt sind, vermitteln diese meist sehr kurzen Erzählungen ein anschauliches Bild von den dominanten Themen der mündlichen Überlieferung. Kellers Ein-Satz-Sagen sind ungleich näher am „Volk“ als die schwülstige Sagenprosa der Heimatbücher jener Zeit.
Keller hätte seine Sammlung 1939 ohne weiteres veröffentlichen können, doch musste er befürchten, dass sie von NS-Ideologen aufgegriffen worden wäre. Die Suche nach den germanischen Glaubenskernen der Sagen hatte damals Hochkonjunktur. Die Volkssagen führen „zu den Wurzeln unserer volklichen Existenz hinab: zur lebendigen mütterlich-bewahrenden Seele unseres Volkes“, schrieb 1943 in der NS-Propagandazeitschrift Germanien ein Germanist, der nach 1945 ein hoch angesehener Hochschullehrer in Innsbruck werden sollte. Der Arzt und spätere SS-Brigadeführer Wilhelm Kinkelin war in seinem tiefbraunen Pfullinger Heimatbuch von 1937 besonders stolz auf die geschlossene Zusammenstellung der Pfullinger Sagen. Von der ideologischen Belastung der Sagenforschung in der NS-Zeit erfährt man jedoch in den Einleitungen der auf den schnellen Absatz berechneten Sagenbücher nichts. Die aus den sattsam bekannten Quellen entnommenen und modernisierten Sagen werden unverdrossen mit der traditionellen Heimat-Rhetorik als uraltes Volksgut dargestellt, und weil man sie gern mit der Aura des „Zeitlosen“ umgibt, verdrängt man, dass die Beschäftigung mit ihr oft sehr zeitgebundene Formen angenommen hat.
Wenn man Sagen als historische Dokumente ihrer Zeit (und nicht einer grauen Vorzeit) ernst nimmt, muss man davon absehen, sie gefällig nachzuerzählen und in modernisierter Form dem Publikum darzubieten. Um sie geschichtlich einordnen zu können, bedürfen sie nicht selten der ausführlichen Kommentierung. Daher finden sich im Folgenden häufig Hinweise auf die Herkunft der Geschichten, auf weitere Fassungen und ihr Weiterleben in der Gegenwart (etwa wenn Sagengestalten zu Namenspaten von Fasnetszünften geworden sind).
Aufgenommen wurden Sagen von der Westalb bis zur Ostalb, also von Möhringen an der Donau und der Gegend um Tuttlingen bis zum Härtsfeld rund um Neresheim. Einbezogen wurden etliche Orte des unmittelbaren Albvorlands auf der Nordseite der Alb, das mit Blick auf die Sagen ergiebiger ist als die Albhochfläche.
Aus Umfangsgründen konnte nur eine kleine Auswahl aus dem großen Sagenbestand des Albgebiets berücksichtigt werden. Auch wenn die Sagenforschung dazu neigt, Sagen-Landschaften ein unverwechselbares Profil zuzuschreiben, ohne dies hinreichend absichern zu können, steht außer Zweifel, dass ein Teil der Sagen durchaus „albtypisch“ ist. Es sind dies die Natur-Sagen, die sich mit den naturräumlichen Eigenheiten der Alb auseinandersetzen, mit den Felsen und dem Wasser. Die bizarren Felsgebilde sind bis heute „Erzähl-Male“ geblieben, an denen sich Erklärungs-Geschichten („ätiologische Sagen“) festmachten. Gern hat man die steinernen Überbleibsel des Jurameers – etwa das „Steinerne Weib“ bei Wiesensteig oder die „Steinernen Jungfrauen“ im Brenztal - als zur Strafe für Frevel erstarrte Menschen gedeutet. Sagenbildend haben auch die Karstphänomene gewirkt: Dolinen und Erdfälle, Karstquellen (wie der Blautopf), vor allem aber die Höhlen. Bezeichnenderweise ist die frühestbezeugte Sage dieses Bandes (aus der Zeit um 1500) eine typische, im 19. und 20. Jahrhundert weit verbreitete Höhlensage: Ein Tier (meist eine Ente oder eine Gans) verschwindet in der Höhle und kommt weit entfernt wieder zum Vorschein. Immer wieder wurden und werden Schätze in Höhlen vermutet, bewacht von dämonischen Gestalten. Schatzgraben mittels magischer Hilfsmittel war eine verbreitete reale Praxis in der frühen Neuzeit und im 19. Jahrhundert. Der sozialgeschichtliche Hintergrund liegt auf der Hand: Armut und harte Lebensbedingungen, denen man so entfliehen wollte.
Angestrebt ist eine möglichst abwechslungsreiche, unterhaltsame und lehrreiche Mischung aus bekannten und unbekannten Texten vorwiegend aus dem 19. Jahrhundert. Sagen begegnen – auch das soll die Auswahl zeigen - in den unterschiedlichsten Medien: in den gedruckten Sagenbüchern ebenso wie in handschriftlichen Aufzeichnungen. Eine Reihe handschriftlich überlieferter Sagen wird in diesem Band erstmals veröffentlicht. Sagen wurden in Tageszeitungen ebenso wie in Heimatbüchern und Ortschroniken abgedruckt. Und sie sind inzwischen in stattlicher Zahl im Internet präsent, das bei der Erstellung dieses Bandes und der Kommentierung der Sagen unschätzbare Dienste geleistet hat. Man sieht: Sagen sind immer noch ausgesprochen lebendig.
***
Aus dem Anhang, der die jeweiligen Vorlage und gelegentlich Varianten exakt nachweist:
(Literaturverzeichnis und Quellenabkürzungen)
Binder = Hans Binder, Die volkstümliche Überlieferungen um Höhlen und Quellen, in: Karst und Höhle 1993, S. 25-44
Birlinger I = Anton Birlinger/Michael Buck, Volksthümliches aus Schwaben, Bd. 1, 1861
Birlinger II = Anton Birlinger, Aus Schwaben, Bd. 1, 1874
BllSAV = Blätter des Schwäbischen Albvereins
Dold = Paul Dold, Die Sagenwelt Tuttlingens und seiner Umgebung, 1940
Egler = Ludwig Egler, Mythologie, Sage und Geschichte der Hohenzollernschen Lande, 1894
EM = Enzyklopädie des Märchens, Bd. 1ff., 1977ff.
Götz = Rolf Götz, Die Sibylle von der Teck, 1999
Graf, Kirchheim = Klaus Graf, Sagen - Kritische Gedanken zu Erzählungen aus dem Kirchheimer Raum, in: Schriftenreihe des Stadtarchivs Kirchheim unter Teck 22 (1998), S. 143-164
Graf, Schwabensagen = Klaus Graf, Schwabensagen. Zur Beschäftigung mit Sagen im 19. und 20. Jahrhundert. Erweiterte Internetpublikation 2007 von dem in: Schwabenspiegel, Bd. 2.1, 2006, S. 279-309 erschienenen Aufsatz. Online
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3459/
Graf, Stuttgart = Klaus Graf, Sagen rund um Stuttgart, 1995
Haderthauer = Wolfram Haderthauer, Sagen aus Württemberg. Unveröffentlichte Sammlungen des 19. Jahrhunderts, Diss. Eichstätt 2001 (auf Mikrofiche)
HDA = Handwörterbuch des deutschen Aberlaubens, Bd. 1-10, 1927-1942 Nachdruck 2000
Heim = Ines Heim, Sagen von der Schwäbischen Alb, 1992
KA = Konferenzaufsatz, Württembergische Landesstelle für Volkskunde Stuttgart (siehe auch www.schwaben-kultur.de, Transkriptionen von Reinhard Caspers)
Kapff = Rudolf Kapff, Schwäbische Sagen, 1926
Keller = Karl Keller, Sagen aus dem Lonetal, 1987
Kettenmann = Jürgen Kettenmann, Sagen im Kreis Göppingen, 3. Aufl. 1989
Meier = Ernst Meier, Deutsche Sagen, Sitten und Gebräuche aus Schwaben, 1852
OAB = Beschreibung des Oberamts
Rebholz = Evarist Rebholz, Sagenkränzlein. Erweiterte Ausgabe, 1924
Schneider = Fritz Schneider, Die Ostalb erzählt, 4. Aufl. 1991
Schott = Albert Schott der Jüngere, Schwäbische Volkssagen, Bd. I-II, 1847, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod. poet. et phil. 4° 134
Schwab = Gustav Schwab, Die Neckarseite der Schwäbischen Alb. Neudruck hrsg. von Hans Widmann,1960
Seminaraufsatz = Seminaraufsatz für Rektor Theodor Eisenlohr in Nürtingen 1850, Württembergische Landesstelle für Volkskunde Stuttgart, N Volkskunde-Verein C/1
Setzen = Florian Henning Setzen, Geheimnisvolles Christental, 1994
Stehle = Bruno Stehle, Volkstümliches aus Hohenzollern, in: Alemannia 12 (1884), S. 1-12
Zimmerische Chronik = Zimmerische Chronik, hrsg. von Karl August Barack, Bd. 1-4, 2. Aufl. 1881
Hinweise für weiterführende Lektüre
Eine empfehlenswerte Einführung zum neueren Forschungsstand der Erzähl- und Sagenforschung ist im Buchhandel derzeit nicht erhältlich. Hingewiesen sei allerdings auf die lesenswerte zusammenfassende Darstellung zur mündlichen Erzählüberlieferung Europas: Rudolf Schenda, Von Mund zu Ohr, 1993. In Bibliotheken einsehbar ist die Enzyklopädie des Märchens, in der Hans-Jörg Uther und Lutz Röhrich in Bd. 11 2004 den umfangreichen Artikel Sage (Sp. 1017-1041) mit vielen Literaturangaben verfasst haben. Weiterführende Hinweise liefert auch der bequem online konsultierbare Beitrag Graf, Schwabensagen (2007). Zu gedruckten Sagensammlungen des 19. und 20. Jahrhunderts: Hannelore Jeske, Sammler und Sammlungen von Volkserzählungen in Schleswig-Holstein, 2002.
Nachweise zur Einleitung bieten die Aufsätze Graf, Kirchheim und Graf, Schwabensagen. Ergänzungen: Zur Problematik der Schüler-Fakelore vgl. Richard Wolfram, Sorgen mit Sagen, in: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 34 (1980), S. 243-245 (Heyl); Martin Heule, in: Sagenerzähler und Sagensammler der Schweiz, 1988, S. 267 (Rochholz).
[Weitere Online-Arbeiten zum Thema Sagen von mir:
http://archiv.twoday.net/stories/4990762/ ]
[ http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind0812&L=hexenforschung&O=D&P=1143 Heuberg-Sage mit Kommentar und Nachweisen aus dem Buch]
[ http://archiv.twoday.net/stories/5581930/ Lichtenstein-Sage]
[ http://archiv.twoday.net/stories/5984813/ 2 Sagen aus Schwabs Neckarseite]
[Kostenlose Leseprobe "Auf der rauhen Alb", 24 Seiten:
http://www.drw-verlag.de/buch/download/sagenderschwalb/Leseprobe.pdf ]
[Sage Der höllische Schuss, Hechingen: http://archiv.twoday.net/stories/6251236/ ]
[Kapitel: Im Sagenreich der Pfullinger Urschel
http://archiv.twoday.net/stories/64956428/ ]
Rezeption:
Ein sehr interessantes Buch mit tollen Geschichten.
http://www.fachbuchkritik.de/html/sagen_der_schwabischen_alb.html
[Rezension in der Hohenzollerischen Heimat 2009:
http://www.hohenzollerischer-geschichtsverein.de/userfiles/files/HZ-Heimat/HH_059_2009_ocr.pdf ]
Sagen der Schwäbischen Alb, hrsg. und kommentiert von Klaus Graf, Leinfelden-Echterdingen: DRW Verlag 2008. 304 Seiten mit 44 SW-Abbildungen und einer Karte der Schauplätze. 16,90 Euro.
ISBN 978-3-87181-031-2
Wer mich und meine Arbeit unterstützen will, kann dies durch den Erwerb des Buches tun :-)

Als Kostprobe gibt es die Einleitung in meiner Preprint-Fassung.
„Eine Gegend ist romantisch, wo Geister wandeln; mögen sie uns an vergangene Zeiten mahnen oder sonst in geheimer Geschäftigkeit sich um uns her bewegen. Wir stehn noch außer dem Reigen der luftigen Elfen, die nach der nordischen Sage nur der sieht, der innerhalb ihres Kreises steht; aber wir fühlen ihre wehende Bewegung, wir hören ihre flüsternden Stimmen“. Ludwig Uhland: Über das Romantische, 1807
„Mehr und mehr wissen wir heute, daß dieses ‚Volksgut’ nur vielfach gefiltert zu uns gelangt ist, gemahlen durch die Denkmühlen bürgerlichen Bewußtseins und neu gekocht oder gebacken für ein Publikum, dessen Interessen nur selten identisch waren mit denen des Volkes.“ Rudolf Schenda: Volkserzählung und nationale Identität: Deutsche Sagen im Vormärz (1830-48). In: Fabula 25 (1984), S. 302
Eine einfache Definition der Sage könnte lauten: Sagen sind das, was man in Büchern, die Sagenbücher heißen, vorfindet. Im Jahr 1800 erschien die erste moderne Sagensammlung, Johann Carl Christoph Nachtigals Volcks-Sagen, aber ohne die umfangreichen zweibändigen Deutschen Sagen der Brüder Grimm (1816/18) hätte das Sagensammeln wohl kaum zu der Flut von Sagenbüchern geführt, die im deutschsprachigen Raum im 19. und 20. Jahrhundert erschienen sind. Die romantische Begeisterung für die „Volkspoesie“ hat die literarische Gattung Sage wesentlich geformt. Gleichzeitig haben romantische Klischees unausrottbare Irrtümer über das vermeintliche „Wesen“ von Sagen in die Welt gesetzt.
Sagen sind keine Botschaften aus uralter Zeit, die mündlich von Generation zu Generation getreu weitergegeben wurden. Sie sind keine Quellen für die „Geisteswelt der vorchristlichen Menschheitsgeschichte“, wie man noch in einem Buch Sagen und Bräuche im Kreis Esslingen aus dem Jahr 1985 lesen kann. Es sind keine Überbleibsel aus grauer Vorzeit, sondern zuallererst literarische und volkskundliche Dokumente ihrer Zeit, nämlich der Zeit, in der sie aufgeschrieben wurden, also des 19. und 20. Jahrhunderts.
Der Sagenbestand eines Raums ist immer das Ergebnis einer komplexen Wechselwirkung zwischen Erzählern (und Erzählerinnen) auf der einen Seite und den Sammlern auf der anderen Seite. Ohne die Erzähler gäbe es keine Sagen, ohne die Sammler aber auch nicht. Sagen spiegeln die subjektiven Vorlieben, den literarischen Geschmack, das Weltbild und die sozialen Verhältnisse ihrer Erzähler. Sie spiegeln aber auch die Vorurteile und Neigungen der gelehrten Sammler, deren gedruckte Sagenbücher alles andere als ein unverfälschtes Abbild vergangener Erzählkultur bieten. Die Sammler waren auf der Suche nach „echter“ Volkspoesie, sie ließen weg, was ihnen zu unscheinbar oder anstößig erschien, und sie redigierten und schrieben die Texte um, damit sie möglichst dem von den Brüdern Grimm erfundenen „Sagenton“ entsprachen. Steuerungs- und Ausblendungsprozesse schufen das trügerische Bild einer „zauberhaften Sagenheimat“. Sagenfassungen in Gedichtform kamen zunehmend aus der Mode: Volkskundlerinnen und Volkskundler schätzen heute nur die nüchterne Prosasage, den authentischen „Ethnotext“, der sozialgeschichtlich interpretierbar ist. Um Sagengedichte machen Volkskundler einen großen Bogen und Germanisten ebenfalls, es sei denn, sie stammen aus der Feder berühmter Autoren.
Sagensammler brauchten ein gerüttelt Maß an Glück und Findigkeit, mussten sie doch das Vertrauen ihrer Gewährsleute erwerben. Gern verschwieg man Geister- und Hexengeschichten, um nicht als abergläubisch und rückständig zu gelten. Als der Tübinger Professor Ernst Meier, der 1852 die erste wichtige gedruckte Sammlung schwäbischer Sagen veröffentlichte, sorgfältig aufschrieb, was ihm ein Schäfer an „altem Gesag“ berichtete, fragte ihn der Erzähler: „Aber Herr, glaubet denn Sia so Lumpesächle no?“ Man durfte auch nicht mit der Tür ins Haus fallen und etwa fragen: „Gibts keine Sagen hier?“ Auf so plumpe Fragen, wusste Meier, „wird man ein einfaches Nein zur Antwort bekommen; oder das Volk antwortet wie jene Bäckerfrau auf die nämliche Frage etwa so: ‚noi, Sagen hent mer koine, aber Wecken!’“
Sagen sind „geglaubte Tradition“, liest man oft in der volkskundlichen Fachliteratur. Ohne Frage lassen viele Albsagen die Angst vor einer harten und unbarmherzigen Natur erkennen, in der tückische Geister den Menschen Schaden zufügen. Die grausamen, Tod und Verderben bringenden Spukgestalten scheinen nichts gemein zu haben mit jenen romantischen Wesen, mit denen Uhland die Landschaft beseelt sah. Wenn man aber Kinder mit Schreckgestalten wie dem Hakenmann, der unaufmerksame Kinder in die Donau zieht, vor Gefahren warnte, wird man bezweifeln dürfen, dass alle Erwachsenen felsenfest von der Existenz der Dämonen überzeugt waren. Neben dem Sagenglauben gab es immer auch den Sagenzweifel. Nicht selten nahm man nicht einfach für bare Münze, was erzählt wurde, sondern prüfte nach. So heißt es über das Pfullinger „Nachtfräuleinloch“ bei Ernst Meier: „Vor einigen 20 Jahren hat man dieß Loch untersucht und weiter darin nachgegraben“. Viele Sagen waren einfach nur unterhaltsame Geschichten, an die man nicht oder nur halb geglaubt hat. Viel zu wenig weiß man über die sogenannten „Anti-Sagen“, die den Sagenglauben angreifen und entlarven. Beispiel: Ein geheimnisvolles Licht entpuppt sich als phosphoreszierender Baumstamm. Solche eher lustigen Geschichten, die natürliche Erklärungen für angeblich Übernatürliches anboten, findet man kaum in den gedruckten Sammlungen. Aber Anti-Sagen waren ebenso wie die Sagen Elemente einer reichhaltigen und vielgestaltigen mündlichen Erzählkultur, in der sich mündliche Überlieferungen und Angelesenes untrennbar vermischten.
Die Sammler mündlichen Erzählguts wählten nach ihren Vorlieben aus, und viele Geschichten bekamen sie überhaupt nicht zu hören. Fixiert auf das romantische Vorurteil uralter Überlieferung verkannten sie die Abhängigkeit der „Volkssagen“ von zeitgenössischen Lesestoffen. Die vielen romantischen Burgensagen und die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts in der deutschen Literaturgeschichte greifbare Begeisterung für (meist triviale) Rittergeschichten gehören zusammen. Die mündliche Volkskultur und die Welt der Bücher verband ein ständiger intensiver Austausch, der von den volkskundlichen Gralshütern der „echten Volkssage“ bis heute entschieden unterschätzt wird.
Die Vielfalt mündlichen Erzählens kann kein Sagenband wiedergeben. Dörfer und Städte waren erfüllt von Geschichten. Es gab viele Gelegenheiten zum Erzählen: Geschichten waren im Wirtshaus ebenso zu hören wie im Heimatkundeunterricht der Schule. Es konnten lustige, traurige, fromme oder unheimliche Geschichten sein, wahre, halbwahre und erfundene. Nur ein winziger Bruchteil von ihnen hat Eingang in die bewahrende Schriftlichkeit gefunden.
Natürlich erzählt man auch heute noch Sagen. Dies gilt auch, wenn man die sogenannten „modernen Sagen“ à la Die Spinne in der Yucca-Palme ausklammert. Die mündlichen Albsagen der Gegenwart sind vor allem aus Heimatbüchern und Sagenbänden geläufig. Unbekannte Geschichten über Riesen und Zwerge voller stiller Poesie, wie sie vor über 150 Jahre Ernst Meier notieren konnte, gibt es sicher nicht mehr aufzuspüren. Aber bei geduldiger Suche würde man auf der Alb noch viele einfache Geistergeschichten und dutzende Angaben über vermeintliche unterirdische Gänge vorfinden. Schon Ludwig Uhland klagte um 1830, die Zeit, Sagen zu sammeln, sei vorbei. Rund zwanzig Jahre später bewies ihm Ernst Meier, der sein Buch Uhland widmete, das Gegenteil.
Die Maßstäbe für das Sammeln von Sagen auf der Schwäbischen Alb setzte 1823 ein Freund Uhlands. Dem Stuttgarter Gymnasiallehrer Gustav Schwab (1792-1850), heute noch bekannt durch seine Sagen des klassischen Altertums, gelang 1823 mit seinem Reiseführer Die Neckarseite der Schwäbischen Alb ein Beststeller. Schwab gab eine Reihe von Sagen, die er vor Ort aufschnappte oder aus gelehrten Werken exzerpierte, in Prosa wieder, daneben bearbeitete er Sagenstoffe auch in Form von Gedichten („Romanzen“). Dieses Buch hat großen Einfluss auf spätere Sammlungen ausgeübt – und auch auf das mündliche Erzählen. Schwab war damals nicht der einzige, der Sagenballaden schrieb. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren Sagengedichte weitaus beliebter als Prosa-Sagen. So ist es denn kein Zufall, dass der Hermaringer Pfarrer Rudolf Magenau zwei Jahre später das erste gedruckte schwäbische Sagenbuch (Poetische Volks-Sagen und Legenden größtentheils aus Schwaben, 1825) als Gedichtband herausbrachte.
Bei den Sagengedichten dominierten die „historischen Sagen“. Die Brüder Grimm hatten die „Ortssagen“ mit ihren dämonischen Gestalten, die man heute in der Volkskunde „dämonologische Sagen“ nennt, auf der einen Seite und die historischen Traditionen auf der anderen Seite in einen Topf geworfen und beide „Sage“ genannt. Weggelassen wurden aus der Volksüberlieferung die Märchen (als nicht ortsgebunden, obwohl es durchaus ortsgebundene Märchen gibt), die lustigen Geschichten („Schwänke“) und die frommen Legenden. Die Verbindung von Spukgeschichten und Geschichte unter dem gemeinsamen Etikett „Sage“ hat bis heute Bestand.
Historische Sagen begriff man im Vormärz als „vaterländische Altertümer“, wobei Vaterland natürlich das jeweilige Territorium meinte. Der Löwenanteil der Alb war württembergisch, altwürttembergisch-protestantisch, auch wenn nach 1802 vor allem vorderösterreichische katholische Gebiete das Königreich von Napoleons Gnaden vergrößert hatten. Dann gab es Hohenzollern, also die kleinen Fürstentümer Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen, die 1850 preußisch wurden. Und auf der Westalb waren etliche Orte großherzoglich badisch.
Vaterländische Sagen sollten den auf die jeweilige Monarchie bezogenen Patriotismus fördern, sie wurden als erhebender und poetischer Schmuck in Geschichtsdarstellungen aufgenommen. Es ging um die „Heimat im Prachtgewande des Alterthumes“ (Ludwig Egler, Aus der Vorzeit Hohenzollerns, 1861). Wilhelm Hauffs württembergische „Kunstsage“ Lichtenstein über die Flucht Herzog Ulrichs (1826), die Sagen-Anregungen aus Schwabs Neckarseite aufgriff, hat nicht nur zu dem Bau des neugotischen „Märchenschlosses“ Lichtenstein geführt, sondern auch die mündliche Sagenbildung merklich inspiriert. Sagen müssen als Teil der ausgeprägten Erinnerungs- und Geschichtskultur des 19. Jahrhunderts begriffen werden, also des Ensembles aus Denkmälern, Historienbildern, Schauspielen, Festzügen usw., mit denen man sich mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzte. Sage und Geschichte galten als Schwestern. Dies verdeutlicht auch die Darstellung der allegorischen Figuren Sage und Geschichte als Quellen für Kunst und Wissenschaft durch den Maler Wilhelm Peters auf der in der Mitte des 19. Jahrhunderts historistisch „rekonstruierten“ Burg Hohenzollern.
Mit Jacob Grimms Deutscher Mythologie (1835) rückten die dämonologischen Sagen in den Vordergrund. Aus ihnen erhoffte man sich Aufschlüsse über den einstigen germanischen Götterglauben. Inzwischen weiß man: Es war ein wissenschaftlicher Irrweg. Rudolf Schenda: „Die Parallelisierung von Mythen- und Sagenfiguren wurde zum Steckenpferd der deutschen Lehrerschaft. Wotan/Donar war allgegenwärtig, Frauengestalten, inklusive die Gottesmutter Maria, wurden mit Freya/Frouwa identifiziert, die Holden und Unholden trabten omnipräsent durch Berg und Tal“ (Mären von Deutschen Sagen. In: Geschichte und Gesellschaft 9, 1983, S. 37).
Eine umfassende Sammlung schwäbischer Volkssagen bereitete der Stuttgarter Gymnasiallehrer Albert Schott der Jüngere (1809-1847) vor. Das Material trugen vor allem seine Schüler zusammen, die mündliche Sagen ihrer Heimat aufschreiben mussten. Schotts früher Tod verhinderte die Publikation, die mythologische Kommentare enthalten sollte, doch blieben die Materialien in Form einer zweibändigen Handschrift erhalten (heute in der Stuttgarter Landesbibliothek). 1850 bekamen die Seminaristen am Nürtinger Lehrerseminar von ihrem Rektor Theodor Eisenlohr (1805-1869) die gleiche Aufgabe gestellt. Sie sollten in ihren Ferien ebenfalls Sagen aufschreiben. Wolfram Haderthauer hat diese beiden und weitere frühe handschriftliche Sagensammlungen Württembergs in seiner Eichstätter Dissertation (2001) gewürdigt. Unglücklicherweise ist diese verdienstvolle Arbeit, deren Editionsteil nicht weniger als 376 Texte enthält, als in nur wenigen Bibliotheken einsehbare Mikrofiche-Ausgabe eher versteckt denn veröffentlicht.
Schüler- und Seminaristensammlungen bereiten Volkskundlern Sorgen, denn die Authentizität der Texte ist alles andere als sichergestellt. Der österreichische Volkskundler Richard Wolfram traf im Ultental eine alte Lehrerin, die sich daran erinnerte, wie die Lehramtskandidaten dem Tiroler Sagensammler Johann Adolf Heyl Sagen bringen mussten: „Er hat die Kandidaten sehr gequält und es hat auch schlechte Noten gegeben, wenn man ihm nichts Gutes gebracht hat. Ein Teil der Sagen bei Heyl ist deshalb derstunken und derlogen“. Von dem Aargauer Sagensammler und Lehrer Ernst Ludwig Rochholz wird Ähnliches berichtet: Er sei durch Sagen sehr zu erfreuen gewesen. Die Schüler erzählten Geschichten, die sie von Ehemaligen gehört hatten, und fabulierten einiges hinzu, was der Lehrer dann als Variante betrachtete. Im Fall der Sammlung Schotts ist ein schlüssiger Beweis, dass eine Geschichte von dem Schüler erfunden wurde, nicht möglich, auch wenn nicht wenige sich sehr „verdächtig“ lesen. Nimmt man die Sagen aber als literarische Texte, in denen Mündliches und Schriftliches sich durchdringen, verschwindet das Problem.
Die vielen sonst nicht bekannten Sagen in den frühen handschriftlichen Sammlungen können aber nicht alle auf individuelle Erfindungen („Fakelore“) zurückgeführt werden. Offenbar muss die romantische Vorstellung revidiert werden, die im 19. und 20. Jahrhundert aufgezeichneten Sagen seien die Reste eines umfassenderen, sehr alten Bestandes. Vielmehr hat man mit einem ständigen Wandel und Austausch des mündlichen Erzählguts vor Ort zu rechnen, also mit einer vergleichsweise hohen Fluktuation. Sagen bildeten sich häufig neu und verschwanden ebenso rasch wieder. Daneben gab es besonders populäre Geschichten, die sich länger halten konnten und in vielen Varianten kursierten, auch wenn sie zusätzlich in gedruckter Form eine Verfestigung erfahren hatten. Dies ist etwa der Fall bei den Erzählungen über die Pfullinger Urschel (dem besonders reichen Pfullinger Sagenbestand ist ein eigenes Kapitel gewidmet) oder die Sibylle von der Teck. Auch hier kann man eine deutliche Wechselwirkung zwischen schriftlichen und mündlichen Versionen feststellen.
Die beiden wichtigsten Autoren gedruckter schwäbischer Sagensammlungen im 19. Jahrhundert sammelten selber: der Tübinger Orientalistik-Professor Ernst Meier (1813-1866), dessen Deutsche Sagen, Sitten und Gebräuche aus Schwaben 1852 erschienen, und der katholische Geistliche und Germanistik-Hochschullehrer Anton Birlinger (1834-1891). Birlinger wurde bei seinem Sagenbuch Volksthümliches aus Schwaben (1861) von dem Arzt und Dialektautor Michael Buck aus Ertingen (1832-1888) unterstützt. Eine Nachlese Aus Schwaben verantwortete Birlinger 1874 allein. Beide Professoren, Meier und Birlinger, standen ganz im Bann der mythologischen Sagendeutung.
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts erschienen mehr und mehr „Heimatbücher“, die, häufig von Lehrern verfasst, Sagen einen Ehrenplatz einräumten. Die zivilisationskritische „Heimatbewegung“ pflegte bewusst das alte Volksgut, zu dem man auch die Sagen zählte. Zugleich etablierte sich die Volkskunde als eigenes Fach, getragen zunächst einmal nicht von akademischen Kreisen, sondern von vielen heimatbegeisterten Laien vor Ort, die in die volkskundlichen Vereine eintraten. Eine großangelegte Erhebung „volkstümlicher Überlieferungen“ fand 1899/1900 statt, als die württembergischen Volksschullehrer im Rahmen der Bezirkslehrerkonferenz Aufsätze nach einem vorgegebenen Fragebogen einreichen mussten (die sogenannten Konferenzaufsätze). Erwähnung verdient aber auch der 1888 gegründete Schwäbische Albverein, in dessen Vereinszeitschrift viele Sagen Eingang fanden.
Kein Berufsstand hat Sagen eifriger zusammengetragen als die Pädagogen. Die Lehrer lasen die Texte nicht nur mythologisierend und als Dokumente der Heimatgeschichte, sie waren auch sehr angetan von der moralischen Haltung der Sage und ihren sittlichen Werten. Sagen, in denen Frevler göttlicher Strafe anheim fielen, eigneten sich bestens für das erzieherische Projekt der „Volksveredelung“. Den Schulmeistern gefiel der erhobene Zeigefinger.
In Tuttlingen dokumentierte der Lehrer Dr. Paul Dold (1886-1934) die örtliche Sagenüberlieferung vermeintlich getreu, doch bei näherem Hinsehen stellen sich Zweifel ein. Wie viele Lehrer hat er vorgefundene Erzählungen, deren Gewährsleute er immerhin jeweils vermerkte, literarisiert und sprachlich gefälliger dargeboten. In Heimatbüchern und Sammlungen der Zwischenkriegszeit, etwa dem Sagenkränzlein (1924) des Oberlehrers Evarist Rebholz (1870-1932), trifft man regelmäßig süßlichen Sagen-Kitsch an. Ganz anders verhält es sich mit den 1935 bis 1939 zusammengetragenen, aber erst 1987 von dem Arzt Karl Keller (1914-1987) publizierten Sagen aus dem Lonetal. Auch wenn sie leider ins Hochdeutsche übersetzt sind, vermitteln diese meist sehr kurzen Erzählungen ein anschauliches Bild von den dominanten Themen der mündlichen Überlieferung. Kellers Ein-Satz-Sagen sind ungleich näher am „Volk“ als die schwülstige Sagenprosa der Heimatbücher jener Zeit.
Keller hätte seine Sammlung 1939 ohne weiteres veröffentlichen können, doch musste er befürchten, dass sie von NS-Ideologen aufgegriffen worden wäre. Die Suche nach den germanischen Glaubenskernen der Sagen hatte damals Hochkonjunktur. Die Volkssagen führen „zu den Wurzeln unserer volklichen Existenz hinab: zur lebendigen mütterlich-bewahrenden Seele unseres Volkes“, schrieb 1943 in der NS-Propagandazeitschrift Germanien ein Germanist, der nach 1945 ein hoch angesehener Hochschullehrer in Innsbruck werden sollte. Der Arzt und spätere SS-Brigadeführer Wilhelm Kinkelin war in seinem tiefbraunen Pfullinger Heimatbuch von 1937 besonders stolz auf die geschlossene Zusammenstellung der Pfullinger Sagen. Von der ideologischen Belastung der Sagenforschung in der NS-Zeit erfährt man jedoch in den Einleitungen der auf den schnellen Absatz berechneten Sagenbücher nichts. Die aus den sattsam bekannten Quellen entnommenen und modernisierten Sagen werden unverdrossen mit der traditionellen Heimat-Rhetorik als uraltes Volksgut dargestellt, und weil man sie gern mit der Aura des „Zeitlosen“ umgibt, verdrängt man, dass die Beschäftigung mit ihr oft sehr zeitgebundene Formen angenommen hat.
Wenn man Sagen als historische Dokumente ihrer Zeit (und nicht einer grauen Vorzeit) ernst nimmt, muss man davon absehen, sie gefällig nachzuerzählen und in modernisierter Form dem Publikum darzubieten. Um sie geschichtlich einordnen zu können, bedürfen sie nicht selten der ausführlichen Kommentierung. Daher finden sich im Folgenden häufig Hinweise auf die Herkunft der Geschichten, auf weitere Fassungen und ihr Weiterleben in der Gegenwart (etwa wenn Sagengestalten zu Namenspaten von Fasnetszünften geworden sind).
Aufgenommen wurden Sagen von der Westalb bis zur Ostalb, also von Möhringen an der Donau und der Gegend um Tuttlingen bis zum Härtsfeld rund um Neresheim. Einbezogen wurden etliche Orte des unmittelbaren Albvorlands auf der Nordseite der Alb, das mit Blick auf die Sagen ergiebiger ist als die Albhochfläche.
Aus Umfangsgründen konnte nur eine kleine Auswahl aus dem großen Sagenbestand des Albgebiets berücksichtigt werden. Auch wenn die Sagenforschung dazu neigt, Sagen-Landschaften ein unverwechselbares Profil zuzuschreiben, ohne dies hinreichend absichern zu können, steht außer Zweifel, dass ein Teil der Sagen durchaus „albtypisch“ ist. Es sind dies die Natur-Sagen, die sich mit den naturräumlichen Eigenheiten der Alb auseinandersetzen, mit den Felsen und dem Wasser. Die bizarren Felsgebilde sind bis heute „Erzähl-Male“ geblieben, an denen sich Erklärungs-Geschichten („ätiologische Sagen“) festmachten. Gern hat man die steinernen Überbleibsel des Jurameers – etwa das „Steinerne Weib“ bei Wiesensteig oder die „Steinernen Jungfrauen“ im Brenztal - als zur Strafe für Frevel erstarrte Menschen gedeutet. Sagenbildend haben auch die Karstphänomene gewirkt: Dolinen und Erdfälle, Karstquellen (wie der Blautopf), vor allem aber die Höhlen. Bezeichnenderweise ist die frühestbezeugte Sage dieses Bandes (aus der Zeit um 1500) eine typische, im 19. und 20. Jahrhundert weit verbreitete Höhlensage: Ein Tier (meist eine Ente oder eine Gans) verschwindet in der Höhle und kommt weit entfernt wieder zum Vorschein. Immer wieder wurden und werden Schätze in Höhlen vermutet, bewacht von dämonischen Gestalten. Schatzgraben mittels magischer Hilfsmittel war eine verbreitete reale Praxis in der frühen Neuzeit und im 19. Jahrhundert. Der sozialgeschichtliche Hintergrund liegt auf der Hand: Armut und harte Lebensbedingungen, denen man so entfliehen wollte.
Angestrebt ist eine möglichst abwechslungsreiche, unterhaltsame und lehrreiche Mischung aus bekannten und unbekannten Texten vorwiegend aus dem 19. Jahrhundert. Sagen begegnen – auch das soll die Auswahl zeigen - in den unterschiedlichsten Medien: in den gedruckten Sagenbüchern ebenso wie in handschriftlichen Aufzeichnungen. Eine Reihe handschriftlich überlieferter Sagen wird in diesem Band erstmals veröffentlicht. Sagen wurden in Tageszeitungen ebenso wie in Heimatbüchern und Ortschroniken abgedruckt. Und sie sind inzwischen in stattlicher Zahl im Internet präsent, das bei der Erstellung dieses Bandes und der Kommentierung der Sagen unschätzbare Dienste geleistet hat. Man sieht: Sagen sind immer noch ausgesprochen lebendig.
***
Aus dem Anhang, der die jeweiligen Vorlage und gelegentlich Varianten exakt nachweist:
(Literaturverzeichnis und Quellenabkürzungen)
Binder = Hans Binder, Die volkstümliche Überlieferungen um Höhlen und Quellen, in: Karst und Höhle 1993, S. 25-44
Birlinger I = Anton Birlinger/Michael Buck, Volksthümliches aus Schwaben, Bd. 1, 1861
Birlinger II = Anton Birlinger, Aus Schwaben, Bd. 1, 1874
BllSAV = Blätter des Schwäbischen Albvereins
Dold = Paul Dold, Die Sagenwelt Tuttlingens und seiner Umgebung, 1940
Egler = Ludwig Egler, Mythologie, Sage und Geschichte der Hohenzollernschen Lande, 1894
EM = Enzyklopädie des Märchens, Bd. 1ff., 1977ff.
Götz = Rolf Götz, Die Sibylle von der Teck, 1999
Graf, Kirchheim = Klaus Graf, Sagen - Kritische Gedanken zu Erzählungen aus dem Kirchheimer Raum, in: Schriftenreihe des Stadtarchivs Kirchheim unter Teck 22 (1998), S. 143-164
Graf, Schwabensagen = Klaus Graf, Schwabensagen. Zur Beschäftigung mit Sagen im 19. und 20. Jahrhundert. Erweiterte Internetpublikation 2007 von dem in: Schwabenspiegel, Bd. 2.1, 2006, S. 279-309 erschienenen Aufsatz. Online
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3459/
Graf, Stuttgart = Klaus Graf, Sagen rund um Stuttgart, 1995
Haderthauer = Wolfram Haderthauer, Sagen aus Württemberg. Unveröffentlichte Sammlungen des 19. Jahrhunderts, Diss. Eichstätt 2001 (auf Mikrofiche)
HDA = Handwörterbuch des deutschen Aberlaubens, Bd. 1-10, 1927-1942 Nachdruck 2000
Heim = Ines Heim, Sagen von der Schwäbischen Alb, 1992
KA = Konferenzaufsatz, Württembergische Landesstelle für Volkskunde Stuttgart (siehe auch www.schwaben-kultur.de, Transkriptionen von Reinhard Caspers)
Kapff = Rudolf Kapff, Schwäbische Sagen, 1926
Keller = Karl Keller, Sagen aus dem Lonetal, 1987
Kettenmann = Jürgen Kettenmann, Sagen im Kreis Göppingen, 3. Aufl. 1989
Meier = Ernst Meier, Deutsche Sagen, Sitten und Gebräuche aus Schwaben, 1852
OAB = Beschreibung des Oberamts
Rebholz = Evarist Rebholz, Sagenkränzlein. Erweiterte Ausgabe, 1924
Schneider = Fritz Schneider, Die Ostalb erzählt, 4. Aufl. 1991
Schott = Albert Schott der Jüngere, Schwäbische Volkssagen, Bd. I-II, 1847, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod. poet. et phil. 4° 134
Schwab = Gustav Schwab, Die Neckarseite der Schwäbischen Alb. Neudruck hrsg. von Hans Widmann,1960
Seminaraufsatz = Seminaraufsatz für Rektor Theodor Eisenlohr in Nürtingen 1850, Württembergische Landesstelle für Volkskunde Stuttgart, N Volkskunde-Verein C/1
Setzen = Florian Henning Setzen, Geheimnisvolles Christental, 1994
Stehle = Bruno Stehle, Volkstümliches aus Hohenzollern, in: Alemannia 12 (1884), S. 1-12
Zimmerische Chronik = Zimmerische Chronik, hrsg. von Karl August Barack, Bd. 1-4, 2. Aufl. 1881
Hinweise für weiterführende Lektüre
Eine empfehlenswerte Einführung zum neueren Forschungsstand der Erzähl- und Sagenforschung ist im Buchhandel derzeit nicht erhältlich. Hingewiesen sei allerdings auf die lesenswerte zusammenfassende Darstellung zur mündlichen Erzählüberlieferung Europas: Rudolf Schenda, Von Mund zu Ohr, 1993. In Bibliotheken einsehbar ist die Enzyklopädie des Märchens, in der Hans-Jörg Uther und Lutz Röhrich in Bd. 11 2004 den umfangreichen Artikel Sage (Sp. 1017-1041) mit vielen Literaturangaben verfasst haben. Weiterführende Hinweise liefert auch der bequem online konsultierbare Beitrag Graf, Schwabensagen (2007). Zu gedruckten Sagensammlungen des 19. und 20. Jahrhunderts: Hannelore Jeske, Sammler und Sammlungen von Volkserzählungen in Schleswig-Holstein, 2002.
Nachweise zur Einleitung bieten die Aufsätze Graf, Kirchheim und Graf, Schwabensagen. Ergänzungen: Zur Problematik der Schüler-Fakelore vgl. Richard Wolfram, Sorgen mit Sagen, in: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 34 (1980), S. 243-245 (Heyl); Martin Heule, in: Sagenerzähler und Sagensammler der Schweiz, 1988, S. 267 (Rochholz).
[Weitere Online-Arbeiten zum Thema Sagen von mir:
http://archiv.twoday.net/stories/4990762/ ]
[ http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind0812&L=hexenforschung&O=D&P=1143 Heuberg-Sage mit Kommentar und Nachweisen aus dem Buch]
[ http://archiv.twoday.net/stories/5581930/ Lichtenstein-Sage]
[ http://archiv.twoday.net/stories/5984813/ 2 Sagen aus Schwabs Neckarseite]
[Kostenlose Leseprobe "Auf der rauhen Alb", 24 Seiten:
http://www.drw-verlag.de/buch/download/sagenderschwalb/Leseprobe.pdf ]
[Sage Der höllische Schuss, Hechingen: http://archiv.twoday.net/stories/6251236/ ]
[Kapitel: Im Sagenreich der Pfullinger Urschel
http://archiv.twoday.net/stories/64956428/ ]
Rezeption:
Ein sehr interessantes Buch mit tollen Geschichten.
http://www.fachbuchkritik.de/html/sagen_der_schwabischen_alb.html
[Rezension in der Hohenzollerischen Heimat 2009:
http://www.hohenzollerischer-geschichtsverein.de/userfiles/files/HZ-Heimat/HH_059_2009_ocr.pdf ]
KlausGraf - am Montag, 22. Dezember 2008, 03:25 - Rubrik: Landesgeschichte
Das geht Sie gar nix an, meint der Präsident des OLG Köln, wenn man ihn nach der Rechtsgrundlage des (rechtswidrigen) Rechtevorbehalts bei kommerzieller Nutzung der Justizdatenbank NRW fragt. Ein vorbildlicher Umgang mit dem Bürger! Und die mutigen Juristen bei Telemedicus zensieren natürlich die Namensangaben weg:
http://www.telemedicus.info/article/1065-NRW-Justizdatenbank-mit-seltsamem-Copyright-Hinweis.html (Kommentare)
http://www.telemedicus.info/article/1065-NRW-Justizdatenbank-mit-seltsamem-Copyright-Hinweis.html (Kommentare)
KlausGraf - am Montag, 22. Dezember 2008, 03:06 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das VG Stuttgart hält nicht allzuviel von der Pressefreiheit:
http://www.dr-bahr.com/news_det_20081221145137.html
http://www.dr-bahr.com/news_det_20081221145137.html
KlausGraf - am Montag, 22. Dezember 2008, 02:58 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 22. Dezember 2008, 01:48 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Im Beitrag vom 19. Dezember 2008 geht es um illuminierte Handschriften und merkwürdige Bücher:
http://www.darkroastedblend.com/2008/12/amazing-books-illuminated-manuscripts.html
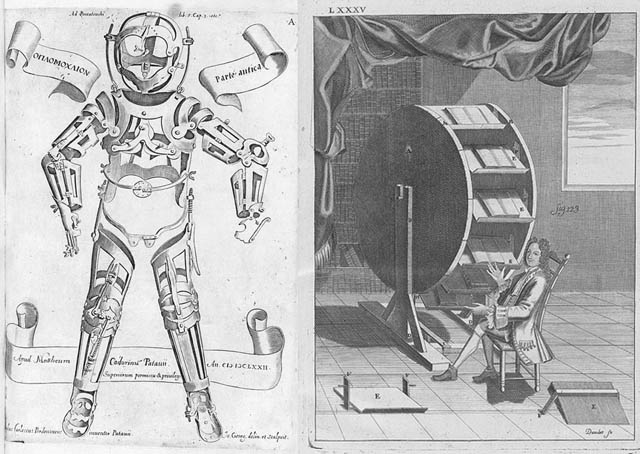
Unter anderem erfährt man etwas über das größte Buch der Welt in Burma.
Am 17. August 2007 wurden ungewöhnliche Bücher und Buchskulpturen vorgestellt:
http://www.darkroastedblend.com/2007/08/unusual-books.html
 Voynich-Ms.
Voynich-Ms.Die bittersüße Kunst des Bücherzerlegens, um neue kreative Werke daraus zu schaffen, beleuchtet der dritte Beitrag vom September 2008:
http://www.darkroastedblend.com/2008/09/bittersweet-art-of-cutting-up-books.html

KlausGraf - am Montag, 22. Dezember 2008, 00:34 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 21. Dezember 2008, 22:06 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 21. Dezember 2008, 22:02 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 21. Dezember 2008, 22:00 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 21. Dezember 2008, 21:56 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 21. Dezember 2008, 21:50 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 21. Dezember 2008, 21:39 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 21. Dezember 2008, 21:32 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In der kanadisch-deutsch-amerikanischen Koprokution aus dem Jahr 2000 wird der letzte Lebensabschnitt Dietrich Bonhoeffers filmisch in Szene gesetzt. Einige Szenen spielen im so bezeichneten "Abwehrarchiv" (offensichtlich das Archiv des deutschen Geheimdienstes). Aus dem Abspann ging leider nicht hervor in welchen Archivräumen gedreht wurde.
Presseheft der Produktionsfirma zum Film:
http://www.nfp.de/cms/upload/Verleih_Archiv/Bonhoeffer/pressemappe.pdf
Informationen zum Film:
http://www.imdb.com/title/tt0250264/
Presseheft der Produktionsfirma zum Film:
http://www.nfp.de/cms/upload/Verleih_Archiv/Bonhoeffer/pressemappe.pdf
Informationen zum Film:
http://www.imdb.com/title/tt0250264/
Wolf Thomas - am Sonntag, 21. Dezember 2008, 19:11 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Spon berichtet u. a.: " ....Fast 14.000 Seiten umfasst das gesamte Archiv. Sämtliche E-Mails, Berichte und Stellungnahmen zum Massaker, das der 23-jährige Cho Seung Hui im April an der Virginia Tech anrichtete hat die Universität digital zusammengetragen. Am 16. Dezember waren die Dokumente den Familien der Opfer sowie Überlebenden des Massakers zur Verfügung gestellt worden. Bis zum 1. Februar 2009 sollten sie Zeit haben, das Archiv zu sichten, um "sicherzustellen, dass sie zufriedengestellt sind und darin keinerlei schützenswerte Informationen enthalten sind", wie es in einer Mitteilung heißt. Nur wenige Tage später aber sind die Dokumente auf einer Universitäts-Web-Seite aufgetaucht. .....
Neben zahlreichen E-Mails an und von Cho befinden sich in dem digitalen Archiv, das jetzt online abrufbar ist, auch Dokumente die zeigen, wie Behörden und Universitätsleitung auf das Massaker reagierten. Darunter Polizeiberichte und interne Vorgaben der Universität, wie das Massaker aus Sicht der PR-Abteilung zu handhaben und wie mit Spenden umzugehen sei. Sogar ein Plan, wie die Norris Hall, das Gebäude, in dem sich die Bluttat am 16. April 2007 ereignete, gereinigt werden sollte. 310.000 Dollar war der Universitätsleitung die 14-tägige Komplettreinigung wert.
Den Aufbaudes digitalen Archivs hat sich die Universität Grants Angaben zufolge nun 400.000 Dollar kosten lassen. ....."
Neben zahlreichen E-Mails an und von Cho befinden sich in dem digitalen Archiv, das jetzt online abrufbar ist, auch Dokumente die zeigen, wie Behörden und Universitätsleitung auf das Massaker reagierten. Darunter Polizeiberichte und interne Vorgaben der Universität, wie das Massaker aus Sicht der PR-Abteilung zu handhaben und wie mit Spenden umzugehen sei. Sogar ein Plan, wie die Norris Hall, das Gebäude, in dem sich die Bluttat am 16. April 2007 ereignete, gereinigt werden sollte. 310.000 Dollar war der Universitätsleitung die 14-tägige Komplettreinigung wert.
Den Aufbaudes digitalen Archivs hat sich die Universität Grants Angaben zufolge nun 400.000 Dollar kosten lassen. ....."
Wolf Thomas - am Sonntag, 21. Dezember 2008, 19:09 - Rubrik: Digitale Unterlagen
"Ankershagen ist .... Sitz der Schliemann-Gesellschaft mit mehr als 200 Mitglieder in 13 Ländern. In ihrem Archiv sind unter anderem 34 000 digitalisierte Briefe einzusehen, die Schliemann im Laufe seines Lebens erhielt und aufbewahrte. Die Originalbriefe lagern in der Gennadios-Bibliothek in Athen ....."
" .....Mit maßgeblicher Unterstützung der Schliemann-Gesellschaft konnte in den letzten Jahren die Sammlung von Schliemanndokumenten erweitert und eine Präsenzbibliothek des Museums aufgebaut werden. Außerdem wurden die technischen und personellen Voraussetzungen für die elektronische Archivierung von Schliemanns schriftlichem Nachlass geschaffen und Hilfestellungen bei der museumspädagogischen Arbeit gegeben. ...." (2)
"Autographenarchivierung. Die archivalischen Bemühungen des Heinrich-Schliemann-Museums zielen vor allem darauf ab, Autographen Heinrich Schliemanns zu sammeln, zu erhalten, elektronisch zu archivieren und aufzubereiten. Zu diesem Zweck werden alle erreichbaren Originale eingescannt, um mit der digitalen Version weiterarbeiten zu können.
Der Grundstein für das Autographenarchiv wurde 1987 gelegt, als Martin Karsten (ein Enkel von Schliemanns Schwester Louise) dem Museum 71 Originalbriefe schenkte, die aus der Feder Heinrich Schliemanns, seines Vaters Ernst Schliemann, seiner Ehefrauen Ekaterina und Sophia sowie seiner Kinder Sergej und Andromache stammen. Durch weitere Schenkungen und gezielte Ankäufe konnte der Bestand deutlich erweitert werden.
Mitte der neunziger Jahre konnten die technischen Voraussetzungen für die optoelektronische Datenerfassung gelegt werden, indem geeignete Computertechnik einschließlich der benötigten Software angeschafft wurde. Im Herbst 1996 begannen die Arbeiten zur Autographenarchivierung.
Die im Besitz des Museums befindlichen Autographen wurden bis 1997 vollständig elektronisch erfasst. Es wird nun daran gearbeitet, weitere Originale, die sich in Privatbesitz befinden, dem Museum aber zur Erfassung und Auswertung zur Verfügung stehen, in die elektronische Datei zu übertragen.
Seit 2005 befinden sich 35.274 Autographen der "Serie B (B) Correspondences" der Gennadius-Library (Amerikanische Schule für Klassische Studien) in Athen als Faksimiles im Archivbestand des Musems. Diese sind über eine Namensliste erschlossen. Nach einem Antrag bei der Gennadius-Library können sie als Kopie (gegen eine Gebühr) für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt werden.
Zielstellung der Archivierung:
optoelektronische Erfassung durch Scanner und Digitalkamera
Speicherung der Autographen als Faksimile sowie der transkribierten Texte in Datenbanken (Archivierungssystem MegaStore und Datenbanksoftware askSam)
Rechercheanwendung, die eine Suche sowohl nach Suchbegriffen als auch deren Kombination bis hin zum Volltext gestattet
Bereitstellung der Faksimiles durch Ausdruck und durch Übertragung auf elektronische Speichermedien
Die sowohl nach den Regeln der alphabetischen Katalogisierung (RAK) als auch nach den Regeln zur Erschließung von Nachlässen und Autographen (RNA) strukturierte Datei ist so konzipiert, dass sie in die Zentraldatei der Autographen (ZDA) bei der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin eingebunden werden kann." (3)
Quellen:
(1) http://www.szon.de/news/kultur/aktuell/200812210408.html
(2) http://www.schliemann-museum.de/hsg/anliegen.html
(3) http://www.schliemann-museum.de/hsm/archiv.html
" .....Mit maßgeblicher Unterstützung der Schliemann-Gesellschaft konnte in den letzten Jahren die Sammlung von Schliemanndokumenten erweitert und eine Präsenzbibliothek des Museums aufgebaut werden. Außerdem wurden die technischen und personellen Voraussetzungen für die elektronische Archivierung von Schliemanns schriftlichem Nachlass geschaffen und Hilfestellungen bei der museumspädagogischen Arbeit gegeben. ...." (2)
"Autographenarchivierung. Die archivalischen Bemühungen des Heinrich-Schliemann-Museums zielen vor allem darauf ab, Autographen Heinrich Schliemanns zu sammeln, zu erhalten, elektronisch zu archivieren und aufzubereiten. Zu diesem Zweck werden alle erreichbaren Originale eingescannt, um mit der digitalen Version weiterarbeiten zu können.
Der Grundstein für das Autographenarchiv wurde 1987 gelegt, als Martin Karsten (ein Enkel von Schliemanns Schwester Louise) dem Museum 71 Originalbriefe schenkte, die aus der Feder Heinrich Schliemanns, seines Vaters Ernst Schliemann, seiner Ehefrauen Ekaterina und Sophia sowie seiner Kinder Sergej und Andromache stammen. Durch weitere Schenkungen und gezielte Ankäufe konnte der Bestand deutlich erweitert werden.
Mitte der neunziger Jahre konnten die technischen Voraussetzungen für die optoelektronische Datenerfassung gelegt werden, indem geeignete Computertechnik einschließlich der benötigten Software angeschafft wurde. Im Herbst 1996 begannen die Arbeiten zur Autographenarchivierung.
Die im Besitz des Museums befindlichen Autographen wurden bis 1997 vollständig elektronisch erfasst. Es wird nun daran gearbeitet, weitere Originale, die sich in Privatbesitz befinden, dem Museum aber zur Erfassung und Auswertung zur Verfügung stehen, in die elektronische Datei zu übertragen.
Seit 2005 befinden sich 35.274 Autographen der "Serie B (B) Correspondences" der Gennadius-Library (Amerikanische Schule für Klassische Studien) in Athen als Faksimiles im Archivbestand des Musems. Diese sind über eine Namensliste erschlossen. Nach einem Antrag bei der Gennadius-Library können sie als Kopie (gegen eine Gebühr) für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt werden.
Zielstellung der Archivierung:
optoelektronische Erfassung durch Scanner und Digitalkamera
Speicherung der Autographen als Faksimile sowie der transkribierten Texte in Datenbanken (Archivierungssystem MegaStore und Datenbanksoftware askSam)
Rechercheanwendung, die eine Suche sowohl nach Suchbegriffen als auch deren Kombination bis hin zum Volltext gestattet
Bereitstellung der Faksimiles durch Ausdruck und durch Übertragung auf elektronische Speichermedien
Die sowohl nach den Regeln der alphabetischen Katalogisierung (RAK) als auch nach den Regeln zur Erschließung von Nachlässen und Autographen (RNA) strukturierte Datei ist so konzipiert, dass sie in die Zentraldatei der Autographen (ZDA) bei der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin eingebunden werden kann." (3)
Quellen:
(1) http://www.szon.de/news/kultur/aktuell/200812210408.html
(2) http://www.schliemann-museum.de/hsg/anliegen.html
(3) http://www.schliemann-museum.de/hsm/archiv.html
Wolf Thomas - am Sonntag, 21. Dezember 2008, 19:08 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Wir haben in Sydney ein kulturgeschichtliches Museum, das "Powerhouse", ähnlich wie das Victoria&Albert-Museum in London. Ich habe dafür gesorgt, dass sie die Kostüme von "Strictly Ballroom", "Romeo und Julia" und "Moulin Rouge" bekamen. Ich möchte, dass sie auch die Kostüme von "Australia" erhalten. So können wir ein Archiv anlegen, in dem sich Studenten und junge Designer umsehen und sich inspirieren lassen können."
Kostüm- und Setdesignerin Catherine Martin
Quelle: Welt am Sonntag
Kostüm- und Setdesignerin Catherine Martin
Quelle: Welt am Sonntag
Wolf Thomas - am Sonntag, 21. Dezember 2008, 19:02 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Das eventerprobte Symphonieorchester Il Novecento um den belgischen Dirigenten Robert Groslot ist seit Jahren das Herz dieser aufwendigen und üppig illuminierten Show, die für ihren Jahrgang 2008 wieder ganz tief im Archiv des verblassten Ruhms gewühlt hat und einige der größten Namen von einst für dieses extravagante Ereignis zu Tage gefördert hat. ...."
Quelle: Morgenpost
Quelle: Morgenpost
Wolf Thomas - am Sonntag, 21. Dezember 2008, 18:59 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Gottlieb Sänger, ein biederer Archivar bei der Zeitschrift "Zeitblick", liebt die Natur. Höhepunkt des Jahres ist daher für ihn der Urlaub, der nun bald wieder bevorsteht. ..... Etwas unfreiwillig wird der vertrauenerweckende ältere Herr unterwegs zum Aufpasser für eine junge Dame, Kiki genannt, die ins Pensionat nach Genf zurückreisen soll. ....."
Quelle:
http://www.cinefacts.de/tv/details.php?id=krkbe2000000000000060802
s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/3452791/
Quelle:
http://www.cinefacts.de/tv/details.php?id=krkbe2000000000000060802
s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/3452791/
Wolf Thomas - am Sonntag, 21. Dezember 2008, 18:58 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.mainz.de/WGAPublisher/online/html/default/MKUZ-5T8NK7.DE.0
Es umfasst insgesamt ca. 18.000 Stücke. Sein Kernbestand fußt auf dem 1784 gegründeten Universitätsmünzkabinett, das Napoleon 1805 in den Besitz der Stadt überführte.

#numismatik
Es umfasst insgesamt ca. 18.000 Stücke. Sein Kernbestand fußt auf dem 1784 gegründeten Universitätsmünzkabinett, das Napoleon 1805 in den Besitz der Stadt überführte.
#numismatik
KlausGraf - am Sonntag, 21. Dezember 2008, 18:12 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 21. Dezember 2008, 17:48 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der SPIEGEL 51/2008 S. 20 berichtet, dass 332 VS-Akten der Bundesregierung spurlos verschwunden seien. Das Innenministerium bestätigte zugleich, dass seit Beginn dieser Legislaturperiode 3200 geheime Akten vernichtet wurden - statt sie der zuständigen Registratur zu übergeben und später dem Bundesarchiv anzubieten.
http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/0,1518,596235,00.html
http://www.volker-wissing.de/
PDF
Siehe dazu auch
http://archiv.twoday.net/stories/5341239/
http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/0,1518,596235,00.html
http://www.volker-wissing.de/
Siehe dazu auch
http://archiv.twoday.net/stories/5341239/
KlausGraf - am Sonntag, 21. Dezember 2008, 01:44 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Text von "Der wackere Schwabe" findet sich unter anderem bei zeno.org. Digitalisate zu Uhlands Werken weist nach:
http://de.wikisource.org/wiki/Ludwig_Uhland
Uhland, Sohn eines Juristen, der in Tübingen als Universitätssekretär wirkte, nahm 1801 in seiner Heimatstadt ein juristisches Studium auf, das er 1808 mit dem Advokatenexamen und 1810 mit der juristischen Promotion beendete. Er fand Anschluss an einen romantisch gesinnten Studentenzirkel, der von altdeutscher und “volkstümlicher” Literatur fasziniert war. Die engste Freundschaft verband ihn in diesem Kreis mit dem Medizinstudenten Justinus Kerner. In Paris sollte Uhland eigentlich das französische Recht kennen lernen, doch fesselten ihn die altfranzösischen und altdeutschen Bücherschätze der Nationalbibliothek weit mehr. Die ungeliebte Advokatentätigkeit in Tübingen und Stuttgart, unterbrochen von dem vergeblichen Versuch, im Staatsdienst Fuß zu fassen, gewährte nur karge Einkünfte. Von 1819 bis 1826 vertrat Uhland das Oberamt Tübingen in der württembergischen Ständeversammlung.1820 endeten die Geldsorgen durch die Heirat mit Emilie Vischer. Ende 1829 wurde Uhland in Tübingen zum außerordentlichen Professor für deutsche Sprache und Literatur berufen. Die lange ersehnte akademische Laufbahn wurde freilich ein Opfer der Repression, als die Regierung ihm 1833 den für die Wahrnehmung des Stuttgarter Abgeordnetenmandats erforderlichen Urlaub verweigerte. Uhland reichte sein Entlassungsgesuch ein, das König Wilhelm mit gehässiger Randbemerkung gern bewilligte. Bis 1838 blieb Uhland als Angehöriger der liberalen Opposition im Landtag. Das Tübinger Leben als Privatgelehrter wurde noch einmal unterbrochen, als er sich 1848 zum Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung wählen ließ. Er kämpfte für demokratische und großdeutsche Ideale und harrte bis zur gewaltsamen Auflösung des Stuttgarter Rumpfparlaments im Juni 1849 aus.
Uhlands phänomenaler Ruhm im 19. Jh. beruhte auf seinen Gedichten, die erstmals 1815 bei Cotta erschienen und bis 1884 64 Auflagen erlebten. Zahlreiche Übersetzungen (und Vertonungen) belegen eine außerordentlich breite internationale Rezeption.
Uhlands Stern ist in der zweiten Hälfte des 20. Jh.s erheblich verblasst. An seiner herausragenden wissenschaftsgeschichtlichen Bedeutung als romantisch geprägter Literaturhistoriker, Sagen- und Volksliedforscher kann jedoch kein Zweifel bestehen. Der gefeierte Dichter Uhland, nach Schiller der populärste im 19. Jh. und um 1870 so etwas wie ein bürgerlicher “Nationalheld”, hat mit seiner Begeisterung für das “Volk” viele andere mitgerissen, auch was volkskundliche Studien betraf (z.B. von Wilhelm Hertz oder Albert Schott). Kurz nach 1945 ermöglichte Uhlands guter Name in Frankreich den Fortbestand des NS-kompromittierten Tübinger Volkskundeinstituts als Ludwig-Uhland-Institut.
KlausGraf - am Sonntag, 21. Dezember 2008, 01:20 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Der Archivar Reginald ist ein einsamer Mensch: was kümmert ihn da sein zu hoher Blutdruck! Regelmäßig tauscht er das fade Diät-Essen gegen ungesunde Leckereien. Da tritt der streunende Hund Penelope in sein Leben, der nicht nur dankbarer Abnehmer der Krankenhaus-Kost ist, sondern auch bald Reginalds bester Freund... "
Quelle:
http://www.cinefacts.de/tv/details.php?id=krkbe2000000000000295044
Quelle:
http://www.cinefacts.de/tv/details.php?id=krkbe2000000000000295044
Wolf Thomas - am Samstag, 20. Dezember 2008, 16:28 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Anton Kuh, osterreichischer Feuilletonist (1891-1941), schreibt im Simplicissimus, Jahrgang/Band: XXXI, 2 Heft: 39 v. 27.12.1926, weshalb ein "Marine-Archiv" auch in Alpennähe Freunde findet.
Link zuz Digitalisat " Das Marine-Archiv" der Herzogin Anna Amalia Bibliothek:
http://www.rockborn.de/source/files/31/39/526/original.jpg
Wikipedia-Artikel zu Anton Kuh
http://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Kuh
Audio:
1988 CD Qualtinger liest Anton Kuh. Folge 1
2005 Hörbuch Anton Kuh Sprecher: Miguel Herz-Kestranek
Link zuz Digitalisat " Das Marine-Archiv" der Herzogin Anna Amalia Bibliothek:
http://www.rockborn.de/source/files/31/39/526/original.jpg
Wikipedia-Artikel zu Anton Kuh
http://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Kuh
Audio:
1988 CD Qualtinger liest Anton Kuh. Folge 1
2005 Hörbuch Anton Kuh Sprecher: Miguel Herz-Kestranek
Wolf Thomas - am Samstag, 20. Dezember 2008, 16:27 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Unsere letzte Meldung über Burchard von Ursberg war wenig erfreulich:
http://archiv.twoday.net/stories/73845/
Der Landesbibliothek Stuttgart gelang es nicht, die landesgeschichtlich bedeutsame ehemals Petroneller Handschrift der Chronik des Burchard von Ursberg zu erwerben.
Wenig bekannt ist, dass die SLUB Dresden eine deutsche Übersetzung der Augsburger Inkunabel der Historia Friderici, einer gekürzten Fassung des Burchard, verwahrt: Mscr.Dresd.H.171.
Sie ist seit neuestem online einsehbar:
http://digital.slub-dresden.de/sammlungen/titeldaten/284648787/
Im Serapeum 1854 hat Archival Herschel die Handschrift kurz angezeigt:
http://resolver.sub.uni-goettingen.de/PURL?GDZPPN001279661
1982 erörterte Wolfgang Wulz die Übersetzung und konnte eine Interpolation aus Steinhöwels Boccaccio-Übersetzung 1473 nachweisen. Ich selbst stellte fest, dass der Vorspann 1r-3v mit der Redaktion der Lorcher Vorlage durch den Augsburger Schreiber Konrad Bollstatter im Cgm 735 übereinstimmt. 1995 publizierte ich meine Vermutung, dass Bollstatter der Urheber der Übersetzung ist:
K. Graf, Staufer-Überlieferungen aus Kloster Lorch, in: Von
Schwaben bis Jerusalem, 1995, S. 209-240, hier S. 231.
Online: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5266/
Erwähnt auch bei K. Graf, Ordensreform und Literatur in Augsburg, in: Literarisches Leben in Augsburg während des 15. Jahrhunderts, hrsg. von Johannes Janota und Werner Williams-Krapp (= Studia Augustana 7), Tübingen 1995 [erschienen 1996], S. 100-159, hier S. 146 Anm. 194
Online: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5242/
Zustimmend übernommen von Jürgen Wolf, Konrad Bollstatter und die Augsburger Geschichtsschreibung. Die letzte Schaffensperiode, in: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 125 (1996), S. 51-86, hier S. 61f.
Die Handschrift stammt aus der Sammlung des Altdorfer Professors Christian Gottlieb Schwarz (1675-1751).

Der ursprünglich separat foliierte zweite Teil des Bandes enthält von anderer, späterer Hand des 16. Jahrhunderts geschrieben:
Bl. 100r-176v Pseudo-Albertus Magnus: Secreta mulierum deutsch
Die Hs. wurde mit 1-181 durchfoliiert. Nach einem Vergleich des Incipits von Halle Zb 1 (Schwaben um 1470) bei Pfeil S. 271 unterliegt es keinem Zweifel, dass es sich um eine Überlieferung der anonymen süddeutschen Übersetzung mit integrierter deutscher Glosse handelt (²VL 8, Sp. 990).
Siehe auch:
http://www.handschriftencensus.de/18808
Update: Beschreibung
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31600964
#forschung
http://archiv.twoday.net/stories/73845/
Der Landesbibliothek Stuttgart gelang es nicht, die landesgeschichtlich bedeutsame ehemals Petroneller Handschrift der Chronik des Burchard von Ursberg zu erwerben.
Wenig bekannt ist, dass die SLUB Dresden eine deutsche Übersetzung der Augsburger Inkunabel der Historia Friderici, einer gekürzten Fassung des Burchard, verwahrt: Mscr.Dresd.H.171.
Sie ist seit neuestem online einsehbar:
http://digital.slub-dresden.de/sammlungen/titeldaten/284648787/
Im Serapeum 1854 hat Archival Herschel die Handschrift kurz angezeigt:
http://resolver.sub.uni-goettingen.de/PURL?GDZPPN001279661
1982 erörterte Wolfgang Wulz die Übersetzung und konnte eine Interpolation aus Steinhöwels Boccaccio-Übersetzung 1473 nachweisen. Ich selbst stellte fest, dass der Vorspann 1r-3v mit der Redaktion der Lorcher Vorlage durch den Augsburger Schreiber Konrad Bollstatter im Cgm 735 übereinstimmt. 1995 publizierte ich meine Vermutung, dass Bollstatter der Urheber der Übersetzung ist:
K. Graf, Staufer-Überlieferungen aus Kloster Lorch, in: Von
Schwaben bis Jerusalem, 1995, S. 209-240, hier S. 231.
Online: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5266/
Erwähnt auch bei K. Graf, Ordensreform und Literatur in Augsburg, in: Literarisches Leben in Augsburg während des 15. Jahrhunderts, hrsg. von Johannes Janota und Werner Williams-Krapp (= Studia Augustana 7), Tübingen 1995 [erschienen 1996], S. 100-159, hier S. 146 Anm. 194
Online: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5242/
Zustimmend übernommen von Jürgen Wolf, Konrad Bollstatter und die Augsburger Geschichtsschreibung. Die letzte Schaffensperiode, in: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 125 (1996), S. 51-86, hier S. 61f.
Die Handschrift stammt aus der Sammlung des Altdorfer Professors Christian Gottlieb Schwarz (1675-1751).

Der ursprünglich separat foliierte zweite Teil des Bandes enthält von anderer, späterer Hand des 16. Jahrhunderts geschrieben:
Bl. 100r-176v Pseudo-Albertus Magnus: Secreta mulierum deutsch
Die Hs. wurde mit 1-181 durchfoliiert. Nach einem Vergleich des Incipits von Halle Zb 1 (Schwaben um 1470) bei Pfeil S. 271 unterliegt es keinem Zweifel, dass es sich um eine Überlieferung der anonymen süddeutschen Übersetzung mit integrierter deutscher Glosse handelt (²VL 8, Sp. 990).
Siehe auch:
http://www.handschriftencensus.de/18808
Update: Beschreibung
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31600964
#forschung
KlausGraf - am Samstag, 20. Dezember 2008, 15:09 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
The former archivist at The Mariners' Museum who stole thousands of museum documents and sold them on the Internet was sentenced Wednesday to four years in prison.
Lester F. Weber, of Newport News, sold at least 3,500 documents — from collections he was supposed to oversee — on eBay under his wife's name. The items included everything from brochures and boarding passes for old ships to a lawsuit against the company that owned the Titanic.
Weber made $172,357 on the fraudulent sales between 2002 and 2006, according to court filings. But the museum estimates the worth of the stolen items at more than $500,000.
"You broke the trust of the public," said U.S. District Judge Rebecca Beach Smith, saying the public has an interest in preservation of historical artifacts.
As an archivist, Weber helped oversee a museum collection containing more than a million documents. Testimony revealed he had access to documents that many other museum employees didn't have, and changed an archiving system to make it appear that some of the stolen documents never existed.
http://www.dailypress.com/news/dp-local_museum_1218dec18,0,6554694.story
Lester F. Weber, of Newport News, sold at least 3,500 documents — from collections he was supposed to oversee — on eBay under his wife's name. The items included everything from brochures and boarding passes for old ships to a lawsuit against the company that owned the Titanic.
Weber made $172,357 on the fraudulent sales between 2002 and 2006, according to court filings. But the museum estimates the worth of the stolen items at more than $500,000.
"You broke the trust of the public," said U.S. District Judge Rebecca Beach Smith, saying the public has an interest in preservation of historical artifacts.
As an archivist, Weber helped oversee a museum collection containing more than a million documents. Testimony revealed he had access to documents that many other museum employees didn't have, and changed an archiving system to make it appear that some of the stolen documents never existed.
http://www.dailypress.com/news/dp-local_museum_1218dec18,0,6554694.story
KlausGraf - am Samstag, 20. Dezember 2008, 14:30 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zum berühmtesten antiken Leuchtturm, dem Pharos von Alexandria, hat auch die Life-Fotosammlung eine historische Darstellung.

Baudelaires Gedicht "Die Leuchttürme" ist in der Übersetzung von Stefan George bei Wikisource nachlesbar:
http://de.wikisource.org/wiki/Die_Leuchttürme?match=fr
KlausGraf - am Samstag, 20. Dezember 2008, 00:29 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen