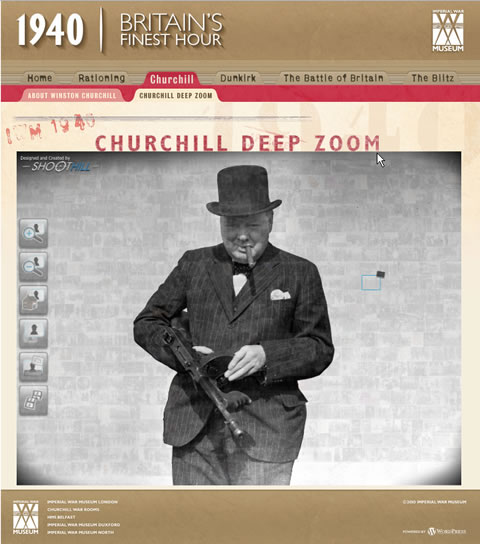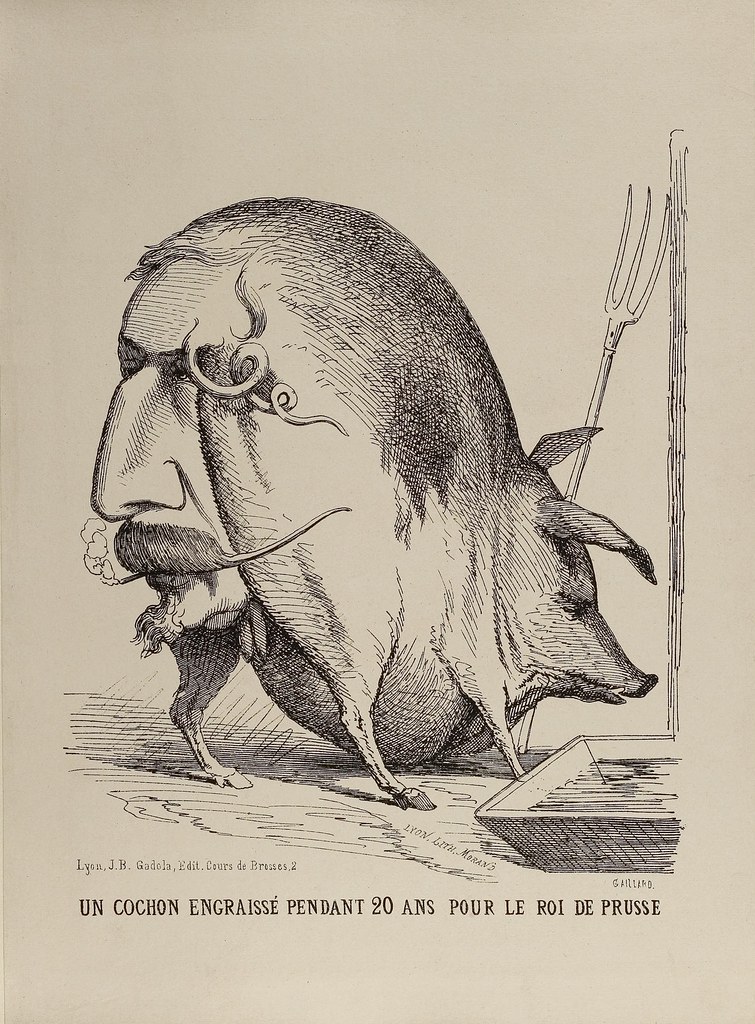Wikisource hat alle Ausgaben zu Lebzeiten der Brüder Grimm fertig transkribiert (bis auf Bd. 2 der seltenen Ausgabe von 1837, der gerade in Arbeit ist).
http://de.wikisource.org/wiki/Kinder-_und_Hausm%C3%A4rchen
Textprobe:
98.
Doctor Allwissend.
Es war einmal ein armer Bauer Namens Krebs, der fuhr mit zwei Ochsen ein Fuder Holz in die Stadt, und verkaufte es für zwei Thaler an einen Doctor. Wie ihm nun das Geld ausbezahlt wurde, saß der Doctor gerade zu Tisch, da sah der Bauer was er schön aß und trank, und das Herz gieng ihm danach auf, und er wäre auch gern ein Doctor gewesen. Also blieb er noch ein Weilchen stehen, und fragte endlich ob er nicht auch könnte ein Doctor werden. „O ja,“ sagte der Doctor, „das ist bald geschehen. Erstlich kauf dir ein Abcbuch, so eins, wo vorne ein Göckelhahn drin ist; zweitens mache deinen Wagen und deine zwei Ochsen zu Geld, und schaffe dir damit Kleider an, und was sonst zur Doctorei gehört; drittens laß dir ein Schild malen mit den Worten, ich bin der Doctor Allwissend, und laß das oben über deine Hausthür nageln.“ Der Bauer that alles wies ihm geheißen war. Als er nun ein wenig gedoctert hatte, aber noch nicht viel, ward einem reichen großen Herrn Geld gestohlen. Da ward ihm von dem Doctor Allwissend gesagt, der in dem und dem Dorfe wohnte, und auch wissen müßte wo das Geld hingekommen wäre. Also ließ der Herr seinen Wagen anspannen, fuhr hinaus ins Dorf, und fragte bei ihm an ob er der Doctor [82] Allwissend wäre? „Ja, der wär er.“ „So sollte er mitgehen und das gestohlene Geld wieder schaffen.“ „O ja, aber die Grethe, seine Frau, müßte auch mit.“ Der Herr war das zufrieden, ließ sie beide in dem Wagen sitzen, und sie fuhren zusammen fort. Als sie auf den adlichen Hof kamen, war der Tisch gedeckt, da sollte er erst mitessen. „Ja, aber seine Frau, die Grethe, auch“ sagte er, und setzte sich mit ihr hinter den Tisch. Wie nun der erste Bediente mit einer Schüssel schönem Essen kam, stieß der Bauer seine Frau an und sagte „Grethe, das war der erste,“ und meinte es wäre derjenige, welcher das erste Essen brächte. Der Bediente aber meinte er hätte damit sagen wollen „das ist der erste Dieb,“ und weil ers nun wirklich war, ward ihm angst, und er sagte draußen zu seinen Cameraden „der Doctor weiß alles, wir kommen übel an, er hat gesagt ich wäre der erste.“ Der zweite wollte gar nicht herein, er mußte aber doch. Wie er nun mit seiner Schüssel herein kam, stieß der Bauer seine Frau an, „Grethe, das ist der zweite.“ Dem Bedienten ward ebenfalls angst, und er machte daß er hinaus kam. Dem dritten giengs nicht besser, der Bauer sagte wieder „Grethe, das ist der dritte.“. Der vierte mußte eine verdeckte Schüssel hereintragen, und der Herr sprach zum Doctor er sollte seine Kunst zeigen, und rathen was darunter läge; es waren aber Krebse. Der Bauer sah die Schüssel an, wußte nicht wie er sich helfen sollte, und sprach „ach, ich armer Krebs!“ Wie der Herr das hörte, rief er „da, er weiß es, nun weiß er auch wer das Geld hat.“
[83] Dem Bedienten aber ward gewaltig angst, und er blinzelte den Doctor an, er möchte einmal herauskommen. Wie er nun hinauskam, gestanden sie ihm alle vier sie hätten das Geld gestohlen; sie wolltens ja gerne heraus geben, und ihm eine schwere Summe dazu, wenn er sie nicht verrathen wollte: es gieng ihnen sonst an den Hals. Sie führten ihn auch hin, wo das Geld versteckt lag. Damit war der Doctor zufrieden, gieng wieder hinein, und sprach „Herr, nun will ich in meinem Buch suchen, wo das Geld steckt.“ Der fünfte Bediente aber kroch in den Ofen, und wollte hören ob der Doctor noch mehr wüßte. Der saß aber, und schlug sein Abcbuch auf, blätterte hin und her, und suchte den Göckelhahn. Weil er ihn nun nicht gleich finden konnte, sprach er „du bist doch darin, und mußt auch heraus.“ Da meinte der im Ofen er wäre gemeint, sprang voller Schrecken heraus, und rief „der Mann weiß alles.“ Nun zeigte der Doctor Allwissend dem Herrn wo das Geld lag, sagte aber nicht wers gestohlen hatte, bekam von beiden Seiten viel Geld zur Belohnung, und ward ein berühmter Mann.
http://de.wikisource.org/wiki/Kinder-_und_Hausm%C3%A4rchen
Textprobe:
98.
Doctor Allwissend.
Es war einmal ein armer Bauer Namens Krebs, der fuhr mit zwei Ochsen ein Fuder Holz in die Stadt, und verkaufte es für zwei Thaler an einen Doctor. Wie ihm nun das Geld ausbezahlt wurde, saß der Doctor gerade zu Tisch, da sah der Bauer was er schön aß und trank, und das Herz gieng ihm danach auf, und er wäre auch gern ein Doctor gewesen. Also blieb er noch ein Weilchen stehen, und fragte endlich ob er nicht auch könnte ein Doctor werden. „O ja,“ sagte der Doctor, „das ist bald geschehen. Erstlich kauf dir ein Abcbuch, so eins, wo vorne ein Göckelhahn drin ist; zweitens mache deinen Wagen und deine zwei Ochsen zu Geld, und schaffe dir damit Kleider an, und was sonst zur Doctorei gehört; drittens laß dir ein Schild malen mit den Worten, ich bin der Doctor Allwissend, und laß das oben über deine Hausthür nageln.“ Der Bauer that alles wies ihm geheißen war. Als er nun ein wenig gedoctert hatte, aber noch nicht viel, ward einem reichen großen Herrn Geld gestohlen. Da ward ihm von dem Doctor Allwissend gesagt, der in dem und dem Dorfe wohnte, und auch wissen müßte wo das Geld hingekommen wäre. Also ließ der Herr seinen Wagen anspannen, fuhr hinaus ins Dorf, und fragte bei ihm an ob er der Doctor [82] Allwissend wäre? „Ja, der wär er.“ „So sollte er mitgehen und das gestohlene Geld wieder schaffen.“ „O ja, aber die Grethe, seine Frau, müßte auch mit.“ Der Herr war das zufrieden, ließ sie beide in dem Wagen sitzen, und sie fuhren zusammen fort. Als sie auf den adlichen Hof kamen, war der Tisch gedeckt, da sollte er erst mitessen. „Ja, aber seine Frau, die Grethe, auch“ sagte er, und setzte sich mit ihr hinter den Tisch. Wie nun der erste Bediente mit einer Schüssel schönem Essen kam, stieß der Bauer seine Frau an und sagte „Grethe, das war der erste,“ und meinte es wäre derjenige, welcher das erste Essen brächte. Der Bediente aber meinte er hätte damit sagen wollen „das ist der erste Dieb,“ und weil ers nun wirklich war, ward ihm angst, und er sagte draußen zu seinen Cameraden „der Doctor weiß alles, wir kommen übel an, er hat gesagt ich wäre der erste.“ Der zweite wollte gar nicht herein, er mußte aber doch. Wie er nun mit seiner Schüssel herein kam, stieß der Bauer seine Frau an, „Grethe, das ist der zweite.“ Dem Bedienten ward ebenfalls angst, und er machte daß er hinaus kam. Dem dritten giengs nicht besser, der Bauer sagte wieder „Grethe, das ist der dritte.“. Der vierte mußte eine verdeckte Schüssel hereintragen, und der Herr sprach zum Doctor er sollte seine Kunst zeigen, und rathen was darunter läge; es waren aber Krebse. Der Bauer sah die Schüssel an, wußte nicht wie er sich helfen sollte, und sprach „ach, ich armer Krebs!“ Wie der Herr das hörte, rief er „da, er weiß es, nun weiß er auch wer das Geld hat.“
[83] Dem Bedienten aber ward gewaltig angst, und er blinzelte den Doctor an, er möchte einmal herauskommen. Wie er nun hinauskam, gestanden sie ihm alle vier sie hätten das Geld gestohlen; sie wolltens ja gerne heraus geben, und ihm eine schwere Summe dazu, wenn er sie nicht verrathen wollte: es gieng ihnen sonst an den Hals. Sie führten ihn auch hin, wo das Geld versteckt lag. Damit war der Doctor zufrieden, gieng wieder hinein, und sprach „Herr, nun will ich in meinem Buch suchen, wo das Geld steckt.“ Der fünfte Bediente aber kroch in den Ofen, und wollte hören ob der Doctor noch mehr wüßte. Der saß aber, und schlug sein Abcbuch auf, blätterte hin und her, und suchte den Göckelhahn. Weil er ihn nun nicht gleich finden konnte, sprach er „du bist doch darin, und mußt auch heraus.“ Da meinte der im Ofen er wäre gemeint, sprang voller Schrecken heraus, und rief „der Mann weiß alles.“ Nun zeigte der Doctor Allwissend dem Herrn wo das Geld lag, sagte aber nicht wers gestohlen hatte, bekam von beiden Seiten viel Geld zur Belohnung, und ward ein berühmter Mann.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 20:31 - Rubrik: Medienarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 20:30 - Rubrik: Unterhaltung

Verlagstetxt: "Giovanni Astegno fristet ein beschauliches Dasein als Archivar und Familienvater. Die Geburt seiner Tochter Stella, die am Down-Syndrom leidet, stellt seine Ehe mit der erfolgreichen Geschäftsfrau Giulia und den Zusammenhalt der Familie, zu der auch der 20-jährige Sohn Lorenzo zählt, auf die Probe.
Als Giulia, Stella und Lorenzo nach Amerika fahren, beginnt Giovanni sich als Vater und Ehemann zu hinterfragen. Er nutzt die Tage, um die Orte seiner Jugend zu besuchen. In dem alten Ferienhaus der Familie hat er die fixe Idee, bei der Telefonnummer seiner Kindheit anzurufen. Ab hier inszeniert Walter Veltroni furios die fantastische Begegnung mit der eigenen Kindheit und dem rätselhaften Verschwinden seines Vaters. Es beginnt eine spannende Entdeckungsreise mit verblüffendem Ausgang."
Link
VELTRONI, WALTER: Die Entdeckung des Sonnenaufgangs. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2010. 155 S., 17,90 €.
Wikipedia-Artikel zu Walter Veltroni
Wolf Thomas - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 20:06 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
International congress about the importance of archives for human rights, good governance, formation of the nation state and national identity
Archives as silent witnesses for the Australian Aboriginals. The role archives play in a federal state: the case of Flanders. Archives and national identity in Indonesia. A selection from the topics up for discussion during the international archival conference at the Peace Palace in The Hague, The Netherlands, August 30-31, 2010. This congress focuses on the importance of archives for good governance in an international context. In the globalizing information society, the significance of archives increasingly transcends national boundaries.
The congress focuses on four themes:
• Archives as 'silent witnesses'. Archives particular relevance in international areas where human rights are at stake.
• Archives of international tribunals like the Yugoslavia Tribunal, or of international or supranational organizations like the European Commission and the Red Cross, transcend national boundaries. What happens to these archives, which are not subject to international archival laws?
• Archives play an important role in the development of a national identity and national states. Archival management is, for example, indispensable to land registry or the Right to Information of citizens. Conversely, the growth and the management of archives are directly influenced by the formation of states.
• How do archival professionals provide support to their colleagues in other parts of the world? Is there international archival solidarity?
Key note speakers are:
• Luc Huyse, sociologist of law, Catholic University of Louvain, Belgium, and international authority on commissions of reconciliation and truth.
• Gabriela Salazar, president of the Mexican professional organization of archivists, member of the Section of Records Management and Archival Professional Organizations of the International Council on Archives, and an expert on archives and human rights.
• Antonio Gonzalez Quintana, Spanish expert in the field of archives, human rights and international organizations.
• Trudy Huskamp Peterson, former Archivist of the United States, current Chair of the Human Rights Working Group of the International Council on Archives.
• Eric Ketelaar, emeritus professor of Archivistics, University of Amsterdam.
Additional speakers come from but not limited to, Australia, Bangladesh, Belgium, Germany, the United Kingdom, Indonesia, Italy, Morocco, The Netherlands, Spain, the United States of America and Switzerland.
Some of the papers on the programme are:
• The archives of the Khmer Rouge: justice and truth in Cambodia
• Documenting torture and truth in El Salvador after the civil war
• Managing the archives of international organizations
• The role of archives in the parliamentary investigation concerning Lumumba (Belgium)
The international congress is organised by KVAN, the Dutch association for archivists, and VVBAD, the Flemish association for archivists and librarians. The conference is supported by the Section of Professional Associations of the International Council on Archives (ICA/SPA) and the National Archives in The Hague, The Netherlands The congress commemorates the first international archives conference, which took place in Brussels a century ago in 1910.
More details concerning the congress and the programme is available at: http://www.archiveswithoutborders.org .
via Archivliste!
s.a. http://archiv.twoday.net/stories/6089996/
Archives as silent witnesses for the Australian Aboriginals. The role archives play in a federal state: the case of Flanders. Archives and national identity in Indonesia. A selection from the topics up for discussion during the international archival conference at the Peace Palace in The Hague, The Netherlands, August 30-31, 2010. This congress focuses on the importance of archives for good governance in an international context. In the globalizing information society, the significance of archives increasingly transcends national boundaries.
The congress focuses on four themes:
• Archives as 'silent witnesses'. Archives particular relevance in international areas where human rights are at stake.
• Archives of international tribunals like the Yugoslavia Tribunal, or of international or supranational organizations like the European Commission and the Red Cross, transcend national boundaries. What happens to these archives, which are not subject to international archival laws?
• Archives play an important role in the development of a national identity and national states. Archival management is, for example, indispensable to land registry or the Right to Information of citizens. Conversely, the growth and the management of archives are directly influenced by the formation of states.
• How do archival professionals provide support to their colleagues in other parts of the world? Is there international archival solidarity?
Key note speakers are:
• Luc Huyse, sociologist of law, Catholic University of Louvain, Belgium, and international authority on commissions of reconciliation and truth.
• Gabriela Salazar, president of the Mexican professional organization of archivists, member of the Section of Records Management and Archival Professional Organizations of the International Council on Archives, and an expert on archives and human rights.
• Antonio Gonzalez Quintana, Spanish expert in the field of archives, human rights and international organizations.
• Trudy Huskamp Peterson, former Archivist of the United States, current Chair of the Human Rights Working Group of the International Council on Archives.
• Eric Ketelaar, emeritus professor of Archivistics, University of Amsterdam.
Additional speakers come from but not limited to, Australia, Bangladesh, Belgium, Germany, the United Kingdom, Indonesia, Italy, Morocco, The Netherlands, Spain, the United States of America and Switzerland.
Some of the papers on the programme are:
• The archives of the Khmer Rouge: justice and truth in Cambodia
• Documenting torture and truth in El Salvador after the civil war
• Managing the archives of international organizations
• The role of archives in the parliamentary investigation concerning Lumumba (Belgium)
The international congress is organised by KVAN, the Dutch association for archivists, and VVBAD, the Flemish association for archivists and librarians. The conference is supported by the Section of Professional Associations of the International Council on Archives (ICA/SPA) and the National Archives in The Hague, The Netherlands The congress commemorates the first international archives conference, which took place in Brussels a century ago in 1910.
More details concerning the congress and the programme is available at: http://www.archiveswithoutborders.org .
via Archivliste!
s.a. http://archiv.twoday.net/stories/6089996/
Wolf Thomas - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 20:01 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lustige_Naturgeschichte_oder_Zoologia_comica.djvu
Zum Autor:
http://de.wikisource.org/wiki/Franz_Bonn

Zum Autor:
http://de.wikisource.org/wiki/Franz_Bonn

KlausGraf - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 18:50 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Regesten der Mainzer Erzbischöfe von Böhmer/Will wurden von Google digitalisiert, sind bei Google aber nur mit US-Proxy einsehbar. Es gibt jedoch auch für uns zugängliche Spiegel:
Bd. 1, 1877
http://www.mgh-bibliothek.de/etc/google/b017428+0001.pdf
Bd. 2, 1886 (bis 1288)
http://www.archive.org/details/RegestaArchiepiscoporumMaguntinensium2
Bd. 1, 1877
http://www.mgh-bibliothek.de/etc/google/b017428+0001.pdf
Bd. 2, 1886 (bis 1288)
http://www.archive.org/details/RegestaArchiepiscoporumMaguntinensium2
KlausGraf - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 18:37 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Hochschulbibliothek der RWTH Aachen stellt im Sinne des Open-Access-Gedankens ab dem 21.6.2010 in Kooperation mit dem Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz) ihre bibliographischen Daten für die Öffentlichkeit uneingeschränkt zur Verfügung.
http://www.bth.rwth-aachen.de/offbibdat.html
http://www.bth.rwth-aachen.de/offbibdat.html
KlausGraf - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 16:59 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 16:47 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 16:45 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 16:34 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Über die Ausstellung mit dem Titel "Das Gesicht des Gettos. Bilder jüdischer Photographen aus dem Getto Litzmannstadt 1940-1944" berichtet die Berliner Zeitung vom 23.06.2010:
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2010/0623/feuilleton/0010/index.html
Weitere Informationen zur Ausstellung, die vom 23.06. bis 03.10.2010 zu sehen ist, gibt die Homepage der Stiftung:
http://www.topographie.de/topographie-des-terrors/ausstellungen/sonderausstellungen/
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2010/0623/feuilleton/0010/index.html
Weitere Informationen zur Ausstellung, die vom 23.06. bis 03.10.2010 zu sehen ist, gibt die Homepage der Stiftung:
http://www.topographie.de/topographie-des-terrors/ausstellungen/sonderausstellungen/
ingobobingo - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 16:01 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Seit heute wird ein neuer, kostenfreier Online-Katalog zur Musik unter
http://opac.rism.info angeboten. Etwa 700.000 Nachweise von meist
handschriftlichen Quellen werden in dieser Datenbank ausfuehrlich nach
wissenschaftlichen Kriterien katalogisiert angeboten. Die
Handschriften
werden heute in Hunderten von Bibliotheken und Archiven weltweit
aufbewahrt.
In ihnen sind musikalische Werke von 30.000 Komponisten ueberliefert.
Der Katalog wurde ermoeglicht durch eine Kooperation zwischen dem
Internationalen Quellenlexikon der Musik (Repertoire International des
Sources Musicales, kurz RISM), der Bayerischen Staatsbibliothek und
der
Staatsbibliothek zu Berlin.
Besonders aktuell scheint der Datenbestand nicht zu sein, wenn ich mir
http://opac.rism.info/search?documentid=450018404
anschaue. Die Donaueschinger Musikhandschriften sind doch schon seit Jahren in der BLB Karlsruhe! Die Information
Ansetzungsform: Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliothek, Donaueschingen
Land: XA-DE
Adresse: 78166
URL: http://www.blb-karlsruhe.de/
ist aus meiner Sicht nicht gerade unmissverständlich.
Bei Komponisten ist die PND angegeben.
http://opac.rism.info angeboten. Etwa 700.000 Nachweise von meist
handschriftlichen Quellen werden in dieser Datenbank ausfuehrlich nach
wissenschaftlichen Kriterien katalogisiert angeboten. Die
Handschriften
werden heute in Hunderten von Bibliotheken und Archiven weltweit
aufbewahrt.
In ihnen sind musikalische Werke von 30.000 Komponisten ueberliefert.
Der Katalog wurde ermoeglicht durch eine Kooperation zwischen dem
Internationalen Quellenlexikon der Musik (Repertoire International des
Sources Musicales, kurz RISM), der Bayerischen Staatsbibliothek und
der
Staatsbibliothek zu Berlin.
Besonders aktuell scheint der Datenbestand nicht zu sein, wenn ich mir
http://opac.rism.info/search?documentid=450018404
anschaue. Die Donaueschinger Musikhandschriften sind doch schon seit Jahren in der BLB Karlsruhe! Die Information
Ansetzungsform: Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliothek, Donaueschingen
Land: XA-DE
Adresse: 78166
URL: http://www.blb-karlsruhe.de/
ist aus meiner Sicht nicht gerade unmissverständlich.
Bei Komponisten ist die PND angegeben.
KlausGraf - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 15:45 - Rubrik: Kodikologie
http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/das_gesetz_der_guten_nachbarschaft_1.6217520.html
Update zu: http://archiv.twoday.net/stories/6322564/
Update zu: http://archiv.twoday.net/stories/6322564/
KlausGraf - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 15:29 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 14:47 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 13:49 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das hier abgebildete Gebäude, das Krönchen-Center, beherbergt das Siegener Stadtarchiv in der 3. Etage.
Wolf Thomas - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 13:45 - Rubrik: Kommunalarchive
Wolf Thomas - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 08:40 - Rubrik: Unterhaltung
Zahlreiche italienische Einrichtungen der Wissenschaft und Kultur
kämpfen derzeit um ihre Existenz. Art. 7, Abs. 24, der kürzlich im
italienischen Gesetzblatt unter dem Titel "Sofortmaßnahmen zur
Finanzstabilisierung und wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit"
veröffentlichten und noch vom Parlament zu beschließenden Eilverordnung bestimmt:
"Mit Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzesdekretes werden die
Haushaltsmittel für die entsprechenden Kapitel in den Voranschlägen der zuständigen Ministerien bezüglich der staatlichen Beihilfe für Körperschaften, Institute, Stiftungen und andere Organisationen um 50% gegenüber dem Jahr 2009 gekürzt. Zum Zwecke der Rationalisierung und Neuordnung der Modalitäten, unter denen der Staat zur Finanzierung der vorgenannten Einrichtungen beiträgt, setzen die zuständigen Ministerien
innerhalb einer Frist von 60 Tagen nach Inkrafttreten des vorliegenden Dekretes die Aufteilung der verfügbaren Mittel fest."
Auf Initiative des Staatspräsidenten Giorgio Napolitano wurde ein Anhang (vgl. die Liste unter
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/index.asp?pn=texte&id=1315 ), bestehend aus einer Liste von 232 Kulturinstituten und -einrichtungen, aus dem Dekret vorerst herausgenommen und damit ein regelrechtes "Massensterben" von Einrichtungen der Wissenschaft und der Kultur verhindert, für die jegliche staatliche Beihilfe gestrichen werden sollte. Die Neufassung von Abs. 24 bietet allerdings keinerlei Sicherheit, insbesondere für die nichtwirtschaftlichen öffentlichen Körperschaften wie das Istituto storico italiano per il medio evo (ISIME), das der Kontrolle des Ministeriums für Kulturgüter und kulturelle Aktivitäten unterliegt. Dieses Ministerium muss nach den
Bestimmungen des Gesetzesdekretes eine Kürzung des entsprechenden Haushaltskapitels um 50% vornehmen, was weit über den von den Sofortmaßnahmen vorgesehenen Mittelwert von 10% hinausgeht.
Die wichtigsten Historikervereinigungen Italiens haben hierzu kürzlich wie folgt Stellung genommen:
"Die scientific community der italienischen Historiker sieht in der
unterschiedslosen Streichung der Zuwendungen für die Einrichtungen, die wissenschaftliche Bestände, Quellen, Archive und Bibliotheken verwalten, welche für die europäische Geschichte und Kultur von grundlegender Bedeutung sind, ein schweres Symptom der Unkultur und kultureller Armut.
Unter Bedingungen, die sich seit Jahren äußerst schwierig gestalten, und dank des Einsatzes von Hunderten von Wissenschaftlern, die oftmals ehrenamtlich arbeiten, fördern die italienischen Kultureinrichtungen Forschungen, Studien und Initiativen, die der Weiterentwicklung und der Vermittlung des Fachwissens und der Fachkenntnisse dienen und dabei auch über die Grenzen der fachwissenschaftlichen Kreise hinausgreifen. Ins
Auge fällt das äußerst geringe Gewicht, das die Höhe der gestrichenen Gelder im Gesamtrahmen des Haushaltsmanövers besitzt; an sich von bescheidener Größe, sind die Summen jedoch wesentlich für die Entwicklung der italienischen Kultur auch im internationalen Zusammenhang - einer Kultur, die auf diese Weise schwer getroffen wird, während man sich anschickt, ihre Bedeutung im Rahmen der Feiern zur einhundertfünfzigjährigen Gründung des Einheitsstaates herauszustellen.
Ins Auge fällt auch die unterschiedslose Unbestimmtheit einer Maßnahme, während man gleichzeitig die Wichtigkeit von Evaluierung und Leistung betont. Unsere Verbände fordern und hoffen deshalb, dass das Parlament und die politischen Kräfte diesen Haushaltsposten wiederaufnehmen und allenfalls für die Zukunft die Einführung von Beurteilungskriterien vorsehen, welche den Instituten und Stiftungen die Finanzierung für herausragende Forschungsprojekte sicherstellen, die von wissenschaftlicher Seite a priori und a posteriori der Prüfung durch kompetente Fachleute unterliegen. Nicht akzeptiert werden kann der Plan, die Verteilung der verbleibenden Geldmittel zukünftig der Entscheidung des Schatzministers und des Ministerpräsidentenbüros zu überlassen. Der Grundsatz der Fachkompetenz, dieses sichere Fundament für jegliche wissenschaftliche Unternehmung, verlangt, dass die Beurteilung in vollkommen transparenter Weise durch das Ministerium für kulturelle Güter unter Heranziehung der wichtigsten italienischen Fachleute aus den jeweils betroffenen Disziplinen erfolgt."
Der Präsident des ISIME, Prof. Massimo Miglio, erklärt: "Wir sind uns der schwierigen Wirtschaftslage durchaus bewusst, doch die Probleme werden nicht dadurch gelöst, dass man Stätten der Arbeit und Produktion zur Schließung zwingt, die den Nachwuchs ausbilden und die man weltweit für italienische Spitzeneinrichtungen hält. Kürzungen und Streichungen kann und muss man in den unproduktiven Sektoren vornehmen. Eine aufmerksame, vom Ministerium aus dieser Perspektive vorgenommene Prüfung böte auch die Möglichkeit einer organischen, effektiven Neuordnung, die wir alle wünschen; aus diesem Grund streben wir eine Unterredung mit den Verantwortlichen aus dem Ministerium für Kulturgüter und kulturelle Aktivitäten an. [...] Das Institut kann wie andere vergleichbare Einrichtungen eine positive Bilanz vorweisen: Es initiiert zahlreiche ehrenamtliche Aktivitäten, gibt den Nachwuchsforschern Arbeit und fördert deren berufliche Kompetenzen, veröffentlicht jährlich ungefähr 15 Werke von hoher wissenschaftlicher Qualität, verfügt über eine Spezialbibliothek und ein bedeutsames historisches Archiv, die frei zugänglich sind, bildet als Träger der Scuola Storica Nazionale di Studi medioevali und der Scuola per l'edizione delle fonti junge Nachwuchswissenschaftler aus und organisiert zahlreiche Seminare und Tagungen."
Das Deutsche Historische Institut arbeitet seit über 100 Jahren mit
zahlreichen, von massiven Kürzungen bzw. Schließung bedrohten
italienischen Einrichtungen zusammen. Die Nutzung beispielsweise von deren Bibliotheken und Archiven ist für die internationale Community unverzichtbar, auch der bestehende Zeitschriftenaustausch darf nicht gefährdet werden.
Namens des Deutschen Historischen Instituts in Rom und seiner
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter protestieren wir mit Nachdruck gegen den geplanten Kahlschlag, welcher bestehende internationale
Kooperationen bedroht.
Wir bitten Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, ihre Solidarität zu bekunden, sich diesem Protest anzuschließen und entsprechende Schreiben an folgende, in Auswahl genannte Anschriften zu senden (bitte lassen Sie Kopien der Schreiben dem DHI in Rom zukommen, damit sie ggf. gezielt in die laufenden parlamentarischen Beratungen eingebracht werden können):
Associazione Nazionale Archivistica Italiana: http://www.anai.org
Società Italiana degli Storici medievisti: http://cisadu2.let.uniroma1.it/sismed/
Società Italiana delle Storiche: http://www.societadellestoriche.it
Società italiana per gli Studi di Storia delle Istituzioni: http://www.storiadelleistituzioni.it
Società Italiana per la Storia dell'Età moderna: http://www.stmoderna.it
Società Italiana per lo Studio della Storia contemporanea: http://www.sissco.it
Associazione delle istituzioni di cultura italiane: http://www.aici.it
Istituto storico italiano per il medio evo: http://www.isime.it
Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia: <http://www.italia-liberazione.it
Fondazione Lelio e Lisli Basso: http://www.fondazionebasso.it
Fondazione Accademia Musicale Chigiana: http://www.chigiana.it
Fondazione Claudio Monteverdi: http://www.fondazionemonteverdi.it
Fondazione Gioacchino Rossini: http://www.fondazionerossini.org
Fondazione Istituto Nazionale di Studi Verdiani: http://www.fondazione-internazionale-giuseppe-verdi.org
Rom, 17.6.2010
Für das Deutsche Historische Institut in Rom:
Prof. Dr. Michael Matheus http://www.dhi-roma.it
kruse@dhi-roma.it
via Archivliste
kämpfen derzeit um ihre Existenz. Art. 7, Abs. 24, der kürzlich im
italienischen Gesetzblatt unter dem Titel "Sofortmaßnahmen zur
Finanzstabilisierung und wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit"
veröffentlichten und noch vom Parlament zu beschließenden Eilverordnung bestimmt:
"Mit Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzesdekretes werden die
Haushaltsmittel für die entsprechenden Kapitel in den Voranschlägen der zuständigen Ministerien bezüglich der staatlichen Beihilfe für Körperschaften, Institute, Stiftungen und andere Organisationen um 50% gegenüber dem Jahr 2009 gekürzt. Zum Zwecke der Rationalisierung und Neuordnung der Modalitäten, unter denen der Staat zur Finanzierung der vorgenannten Einrichtungen beiträgt, setzen die zuständigen Ministerien
innerhalb einer Frist von 60 Tagen nach Inkrafttreten des vorliegenden Dekretes die Aufteilung der verfügbaren Mittel fest."
Auf Initiative des Staatspräsidenten Giorgio Napolitano wurde ein Anhang (vgl. die Liste unter
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/index.asp?pn=texte&id=1315 ), bestehend aus einer Liste von 232 Kulturinstituten und -einrichtungen, aus dem Dekret vorerst herausgenommen und damit ein regelrechtes "Massensterben" von Einrichtungen der Wissenschaft und der Kultur verhindert, für die jegliche staatliche Beihilfe gestrichen werden sollte. Die Neufassung von Abs. 24 bietet allerdings keinerlei Sicherheit, insbesondere für die nichtwirtschaftlichen öffentlichen Körperschaften wie das Istituto storico italiano per il medio evo (ISIME), das der Kontrolle des Ministeriums für Kulturgüter und kulturelle Aktivitäten unterliegt. Dieses Ministerium muss nach den
Bestimmungen des Gesetzesdekretes eine Kürzung des entsprechenden Haushaltskapitels um 50% vornehmen, was weit über den von den Sofortmaßnahmen vorgesehenen Mittelwert von 10% hinausgeht.
Die wichtigsten Historikervereinigungen Italiens haben hierzu kürzlich wie folgt Stellung genommen:
"Die scientific community der italienischen Historiker sieht in der
unterschiedslosen Streichung der Zuwendungen für die Einrichtungen, die wissenschaftliche Bestände, Quellen, Archive und Bibliotheken verwalten, welche für die europäische Geschichte und Kultur von grundlegender Bedeutung sind, ein schweres Symptom der Unkultur und kultureller Armut.
Unter Bedingungen, die sich seit Jahren äußerst schwierig gestalten, und dank des Einsatzes von Hunderten von Wissenschaftlern, die oftmals ehrenamtlich arbeiten, fördern die italienischen Kultureinrichtungen Forschungen, Studien und Initiativen, die der Weiterentwicklung und der Vermittlung des Fachwissens und der Fachkenntnisse dienen und dabei auch über die Grenzen der fachwissenschaftlichen Kreise hinausgreifen. Ins
Auge fällt das äußerst geringe Gewicht, das die Höhe der gestrichenen Gelder im Gesamtrahmen des Haushaltsmanövers besitzt; an sich von bescheidener Größe, sind die Summen jedoch wesentlich für die Entwicklung der italienischen Kultur auch im internationalen Zusammenhang - einer Kultur, die auf diese Weise schwer getroffen wird, während man sich anschickt, ihre Bedeutung im Rahmen der Feiern zur einhundertfünfzigjährigen Gründung des Einheitsstaates herauszustellen.
Ins Auge fällt auch die unterschiedslose Unbestimmtheit einer Maßnahme, während man gleichzeitig die Wichtigkeit von Evaluierung und Leistung betont. Unsere Verbände fordern und hoffen deshalb, dass das Parlament und die politischen Kräfte diesen Haushaltsposten wiederaufnehmen und allenfalls für die Zukunft die Einführung von Beurteilungskriterien vorsehen, welche den Instituten und Stiftungen die Finanzierung für herausragende Forschungsprojekte sicherstellen, die von wissenschaftlicher Seite a priori und a posteriori der Prüfung durch kompetente Fachleute unterliegen. Nicht akzeptiert werden kann der Plan, die Verteilung der verbleibenden Geldmittel zukünftig der Entscheidung des Schatzministers und des Ministerpräsidentenbüros zu überlassen. Der Grundsatz der Fachkompetenz, dieses sichere Fundament für jegliche wissenschaftliche Unternehmung, verlangt, dass die Beurteilung in vollkommen transparenter Weise durch das Ministerium für kulturelle Güter unter Heranziehung der wichtigsten italienischen Fachleute aus den jeweils betroffenen Disziplinen erfolgt."
Der Präsident des ISIME, Prof. Massimo Miglio, erklärt: "Wir sind uns der schwierigen Wirtschaftslage durchaus bewusst, doch die Probleme werden nicht dadurch gelöst, dass man Stätten der Arbeit und Produktion zur Schließung zwingt, die den Nachwuchs ausbilden und die man weltweit für italienische Spitzeneinrichtungen hält. Kürzungen und Streichungen kann und muss man in den unproduktiven Sektoren vornehmen. Eine aufmerksame, vom Ministerium aus dieser Perspektive vorgenommene Prüfung böte auch die Möglichkeit einer organischen, effektiven Neuordnung, die wir alle wünschen; aus diesem Grund streben wir eine Unterredung mit den Verantwortlichen aus dem Ministerium für Kulturgüter und kulturelle Aktivitäten an. [...] Das Institut kann wie andere vergleichbare Einrichtungen eine positive Bilanz vorweisen: Es initiiert zahlreiche ehrenamtliche Aktivitäten, gibt den Nachwuchsforschern Arbeit und fördert deren berufliche Kompetenzen, veröffentlicht jährlich ungefähr 15 Werke von hoher wissenschaftlicher Qualität, verfügt über eine Spezialbibliothek und ein bedeutsames historisches Archiv, die frei zugänglich sind, bildet als Träger der Scuola Storica Nazionale di Studi medioevali und der Scuola per l'edizione delle fonti junge Nachwuchswissenschaftler aus und organisiert zahlreiche Seminare und Tagungen."
Das Deutsche Historische Institut arbeitet seit über 100 Jahren mit
zahlreichen, von massiven Kürzungen bzw. Schließung bedrohten
italienischen Einrichtungen zusammen. Die Nutzung beispielsweise von deren Bibliotheken und Archiven ist für die internationale Community unverzichtbar, auch der bestehende Zeitschriftenaustausch darf nicht gefährdet werden.
Namens des Deutschen Historischen Instituts in Rom und seiner
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter protestieren wir mit Nachdruck gegen den geplanten Kahlschlag, welcher bestehende internationale
Kooperationen bedroht.
Wir bitten Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, ihre Solidarität zu bekunden, sich diesem Protest anzuschließen und entsprechende Schreiben an folgende, in Auswahl genannte Anschriften zu senden (bitte lassen Sie Kopien der Schreiben dem DHI in Rom zukommen, damit sie ggf. gezielt in die laufenden parlamentarischen Beratungen eingebracht werden können):
Associazione Nazionale Archivistica Italiana: http://www.anai.org
Società Italiana degli Storici medievisti: http://cisadu2.let.uniroma1.it/sismed/
Società Italiana delle Storiche: http://www.societadellestoriche.it
Società italiana per gli Studi di Storia delle Istituzioni: http://www.storiadelleistituzioni.it
Società Italiana per la Storia dell'Età moderna: http://www.stmoderna.it
Società Italiana per lo Studio della Storia contemporanea: http://www.sissco.it
Associazione delle istituzioni di cultura italiane: http://www.aici.it
Istituto storico italiano per il medio evo: http://www.isime.it
Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia: <http://www.italia-liberazione.it
Fondazione Lelio e Lisli Basso: http://www.fondazionebasso.it
Fondazione Accademia Musicale Chigiana: http://www.chigiana.it
Fondazione Claudio Monteverdi: http://www.fondazionemonteverdi.it
Fondazione Gioacchino Rossini: http://www.fondazionerossini.org
Fondazione Istituto Nazionale di Studi Verdiani: http://www.fondazione-internazionale-giuseppe-verdi.org
Rom, 17.6.2010
Für das Deutsche Historische Institut in Rom:
Prof. Dr. Michael Matheus http://www.dhi-roma.it
kruse@dhi-roma.it
via Archivliste
Wolf Thomas - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 08:06 - Rubrik: Internationale Aspekte
KlausGraf - am Mittwoch, 23. Juni 2010, 01:08 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 22. Juni 2010, 22:29 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Vor allem aus der Rubrik Hilfswissenschaften wurden einschlägige Beiträge ausgegliedert.
http://archiv.twoday.net/topics/Kodikologie/
Wie bei allen Rubriken gibt es auch für die Beiträge zur Handschriftenkunde einen eigenen RSS-Feed:
http://archiv.twoday.net/topics/Kodikologie/index.rdf
http://archiv.twoday.net/topics/Kodikologie/
Wie bei allen Rubriken gibt es auch für die Beiträge zur Handschriftenkunde einen eigenen RSS-Feed:
http://archiv.twoday.net/topics/Kodikologie/index.rdf
KlausGraf - am Dienstag, 22. Juni 2010, 22:08 - Rubrik: Allgemeines
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bei einer Probefahrt mit dem Nachbau der „Elektrischen Viktoria“ - der Replik eines historischen Fahrzeugs - kam der Erlanger Uni-Professor Wilfried Feldenkirchen - bei Hinterzarten - ums Leben. Vier Studenten wurden verletzt.
Der 62-jährige Experte für Wirtschaftsgeschichte und vier Studenten waren mit dem Oldtimernachbau nahe Hinterzarten im Hoch-Schwarzwald unterwegs. Auf einer abschüssigen Strecke kam der offene Oldtimer in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen eine Böschung. Wilfried Feldenkirchen wurde aus dem Wagen geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle. Ein 25-Jähriger aus Nürnberg kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Freiburg. Drei weitere Studenten wurden leicht verletzt.
Quelle: Abendzeitung
"Trauer in Erlangen und München
Unterdessen haben die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Siemens-Konzern ihre Trauer über den Tod des Professors bekundet. "Wilfried Feldenkirchen war ein angesehener Professor. Der Verlust des geschätzten Kollegen macht mich persönlich betroffen", sagte Uni-Rektor Karl-Dieter Grüske. Siemens-Chef Peter Löscher würdigte die Verdienste Feldenkirchens: "Er hat den Weg des Unternehmens in mehr als 25 Jahren eng begleitet. Wir verdanken ihm viel. Er hat sich um Siemens verdient gemacht", sagte Löscher.
Hintergrund
Wilfried Feldenkirchen war Professor für Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte an der Universität Erlangen-Nürnberg und arbeitete freiberuflich für Siemens als Archivar und Historiker. Er war Projektleiter für den Nachbau der "Elektrischen Viktoria", das erste Elektroauto, das Siemens 1905 baute. Anfang Mai war Feldenkirchen mit dem Auto beim Elektromobilitätsgipfel in Berlin und stellte es Bundeskanzlerin Angela Merkel vor. In dieser Woche sollte es nach Südafrika transportiert werden.
Ein Toter, vier Verletzte
Wie die Freiburger Polizei mitteilte, fuhr der 62-jährige Feldenkirchen mit dem Wagen auf einer abschüssigen Strecke. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung. Feldenkirchen wurde dabei aus dem offenen Gefährt geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Ein 25-jähriger Student aus Nürnberg, der mitfuhr, wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Freiburger Krankenhaus gebracht werden musste. Die drei anderen Studenten aus Nürnberg und Ipsheim erlitten leichte Verletzungen.
Höchstgeschwindigkeit: 30 Stundenkilometer
Die Elektrische Viktoria, die für den Straßenverkehr zugelassen ist, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und ein Sachverständiger hinzugezogen. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden mehr als 100.000 Euro."
Quelle: Bayr. Fernsehen, Studio Franken
Der 62-jährige Experte für Wirtschaftsgeschichte und vier Studenten waren mit dem Oldtimernachbau nahe Hinterzarten im Hoch-Schwarzwald unterwegs. Auf einer abschüssigen Strecke kam der offene Oldtimer in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen eine Böschung. Wilfried Feldenkirchen wurde aus dem Wagen geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle. Ein 25-Jähriger aus Nürnberg kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Freiburg. Drei weitere Studenten wurden leicht verletzt.
Quelle: Abendzeitung
"Trauer in Erlangen und München
Unterdessen haben die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Siemens-Konzern ihre Trauer über den Tod des Professors bekundet. "Wilfried Feldenkirchen war ein angesehener Professor. Der Verlust des geschätzten Kollegen macht mich persönlich betroffen", sagte Uni-Rektor Karl-Dieter Grüske. Siemens-Chef Peter Löscher würdigte die Verdienste Feldenkirchens: "Er hat den Weg des Unternehmens in mehr als 25 Jahren eng begleitet. Wir verdanken ihm viel. Er hat sich um Siemens verdient gemacht", sagte Löscher.
Hintergrund
Wilfried Feldenkirchen war Professor für Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte an der Universität Erlangen-Nürnberg und arbeitete freiberuflich für Siemens als Archivar und Historiker. Er war Projektleiter für den Nachbau der "Elektrischen Viktoria", das erste Elektroauto, das Siemens 1905 baute. Anfang Mai war Feldenkirchen mit dem Auto beim Elektromobilitätsgipfel in Berlin und stellte es Bundeskanzlerin Angela Merkel vor. In dieser Woche sollte es nach Südafrika transportiert werden.
Ein Toter, vier Verletzte
Wie die Freiburger Polizei mitteilte, fuhr der 62-jährige Feldenkirchen mit dem Wagen auf einer abschüssigen Strecke. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung. Feldenkirchen wurde dabei aus dem offenen Gefährt geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Ein 25-jähriger Student aus Nürnberg, der mitfuhr, wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Freiburger Krankenhaus gebracht werden musste. Die drei anderen Studenten aus Nürnberg und Ipsheim erlitten leichte Verletzungen.
Höchstgeschwindigkeit: 30 Stundenkilometer
Die Elektrische Viktoria, die für den Straßenverkehr zugelassen ist, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und ein Sachverständiger hinzugezogen. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden mehr als 100.000 Euro."
Quelle: Bayr. Fernsehen, Studio Franken
Wolf Thomas - am Dienstag, 22. Juni 2010, 20:09 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zum Start der neuen Rubrik "Kodikologie", die sich vorzugsweise der Erforschung von und den Neuigkeiten über abendländische Handschriften aus Mittelalter und Renaissance widmet, folgt hier eine Liste von Beiträgen, bei denen es untunlich schien, sie umzusortieren.
***
[NL: Wappenbuch Beyeren digitalisiert]
http://archiv.twoday.net/stories/6386887/
Jägermeister-Stiftung kauft Handschriften aus Adelsbibliothek Nostitz für HAB Wolfenbüttel
http://archiv.twoday.net/stories/6365652/
Lauber-Handschriften in Brüssel digitalisiert
http://archiv.twoday.net/stories/6370437/
Pariser Handschriftenschätze zum Durchblättern
http://archiv.twoday.net/stories/6355412/
Digitalisierte mittelalterliche Handschriften der Mount Angel Abbey, Oregon
http://archiv.twoday.net/stories/6355393/
27 kostbare Handschriften in Austin online
http://archiv.twoday.net/stories/6346131/
http://archiv.twoday.net/stories/6322630/
Nürnberger Chronik in Iowa online
http://archiv.twoday.net/stories/6336893/
Scriptorium: Medieval and Early Modern Manuscripts Online
http://archiv.twoday.net/stories/6336802/
Digitalisierte Handschriften-Mikrofilme des Kölner Stadtarchivs im Digitalen Historischen Archiv
http://archiv.twoday.net/stories/6308795/
European Digital Library of Written Cultural Heritage
http://archiv.twoday.net/stories/6273586/
Weingartner Liederhandschrift online
http://archiv.twoday.net/stories/6261533/
Weitere deutschsprachige Handschrift der UPenn online
http://archiv.twoday.net/stories/6256976/
Gallica hat ein flotteres Outfit
http://archiv.twoday.net/stories/6201404/
Darthmouth Digital Collections
http://archiv.twoday.net/stories/6176034/
Digitalisate der Schlettstädter Humanistenbibliothek
http://archiv.twoday.net/stories/6168535/
Sehr viele Harvard-Handschriften digitalisiert
http://archiv.twoday.net/stories/6129633/
Nachrichten von der historischen Commission bei der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1859-1865
http://archiv.twoday.net/stories/6111950/
Ausgewertet zurück bis Ende 2009, siehe
http://archiv.twoday.net/search?q=handschrift&start=90
***
[NL: Wappenbuch Beyeren digitalisiert]
http://archiv.twoday.net/stories/6386887/
Jägermeister-Stiftung kauft Handschriften aus Adelsbibliothek Nostitz für HAB Wolfenbüttel
http://archiv.twoday.net/stories/6365652/
Lauber-Handschriften in Brüssel digitalisiert
http://archiv.twoday.net/stories/6370437/
Pariser Handschriftenschätze zum Durchblättern
http://archiv.twoday.net/stories/6355412/
Digitalisierte mittelalterliche Handschriften der Mount Angel Abbey, Oregon
http://archiv.twoday.net/stories/6355393/
27 kostbare Handschriften in Austin online
http://archiv.twoday.net/stories/6346131/
http://archiv.twoday.net/stories/6322630/
Nürnberger Chronik in Iowa online
http://archiv.twoday.net/stories/6336893/
Scriptorium: Medieval and Early Modern Manuscripts Online
http://archiv.twoday.net/stories/6336802/
Digitalisierte Handschriften-Mikrofilme des Kölner Stadtarchivs im Digitalen Historischen Archiv
http://archiv.twoday.net/stories/6308795/
European Digital Library of Written Cultural Heritage
http://archiv.twoday.net/stories/6273586/
Weingartner Liederhandschrift online
http://archiv.twoday.net/stories/6261533/
Weitere deutschsprachige Handschrift der UPenn online
http://archiv.twoday.net/stories/6256976/
Gallica hat ein flotteres Outfit
http://archiv.twoday.net/stories/6201404/
Darthmouth Digital Collections
http://archiv.twoday.net/stories/6176034/
Digitalisate der Schlettstädter Humanistenbibliothek
http://archiv.twoday.net/stories/6168535/
Sehr viele Harvard-Handschriften digitalisiert
http://archiv.twoday.net/stories/6129633/
Nachrichten von der historischen Commission bei der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1859-1865
http://archiv.twoday.net/stories/6111950/
Ausgewertet zurück bis Ende 2009, siehe
http://archiv.twoday.net/search?q=handschrift&start=90
KlausGraf - am Dienstag, 22. Juni 2010, 20:07 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Dienstag, 22. Juni 2010, 19:14 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine Ausstellung im Museum Kurhaus Kleve vom 14.11.2010 – 20.03.2011
"Konrad Fischer (1939-1996) hat mit seiner 1967 in Düsseldorf eröffneten Galerie international Kunstgeschichte geschrieben, insbesondere als früher Förderer der minimalistischen und konzeptuellen Kunst. Zahlreiche Künstler, die heute Weltgeltung besitzen, hat er „entdeckt“ und zu ihrer ersten Einzelausstellung in seine Galerie eingeladen. Seine Galerie war in Europa der entscheidende Ort für die Entwicklung der Kunst.
Erstmals wird mit dieser Ausstellung ein zentrales Kapitel der Kunstgeschichte des Rheinlands im 20. Jahrhundert beleuchtet. Sie zeigt die enorme Lebensleistung von Konrad Fischer anhand der Sammlung, die er gemeinsam mit seiner Frau Dorothee parallel zur Galeriearbeit aufgebaut hat und die in ihrer Gesamtheit bisher nicht bekannt ist. Sie umfasst eindrucksvolle Werkgruppen hochrangiger internationaler Künstler, u.a. von Carl Andre, Bernd und Hilla Becher, Hanne Darboven, On Kawara, Richard Long, Sol LeWitt, Mario Merz, Bruce Nauman, Robert Ryman, Gregor Schneider und Thomas Schütte.
Die Ausstellung wird organisiert in Kooperation mit dem Museu d’Art Contemporani de Barcelona ....."
Quelle: Ausstellungsvorschau Museum Kurhaus Kleve
"Konrad Fischer (1939-1996) hat mit seiner 1967 in Düsseldorf eröffneten Galerie international Kunstgeschichte geschrieben, insbesondere als früher Förderer der minimalistischen und konzeptuellen Kunst. Zahlreiche Künstler, die heute Weltgeltung besitzen, hat er „entdeckt“ und zu ihrer ersten Einzelausstellung in seine Galerie eingeladen. Seine Galerie war in Europa der entscheidende Ort für die Entwicklung der Kunst.
Erstmals wird mit dieser Ausstellung ein zentrales Kapitel der Kunstgeschichte des Rheinlands im 20. Jahrhundert beleuchtet. Sie zeigt die enorme Lebensleistung von Konrad Fischer anhand der Sammlung, die er gemeinsam mit seiner Frau Dorothee parallel zur Galeriearbeit aufgebaut hat und die in ihrer Gesamtheit bisher nicht bekannt ist. Sie umfasst eindrucksvolle Werkgruppen hochrangiger internationaler Künstler, u.a. von Carl Andre, Bernd und Hilla Becher, Hanne Darboven, On Kawara, Richard Long, Sol LeWitt, Mario Merz, Bruce Nauman, Robert Ryman, Gregor Schneider und Thomas Schütte.
Die Ausstellung wird organisiert in Kooperation mit dem Museu d’Art Contemporani de Barcelona ....."
Quelle: Ausstellungsvorschau Museum Kurhaus Kleve
"With a Probability of Being Seen. Dorothee and Konrad Fischer. Archives of an attitude". Notes by Friedrich Meschede, curator from MACBA on Vimeo.
Wolf Thomas - am Dienstag, 22. Juni 2010, 18:45 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
FAZ online vom 22.6.2010:
Internet
Thomas de Maizière hat in einer Grundsatzrede skizziert, wie er sich eine deutsche „Netzpolitik“ vorstellt. Dem Internet müsse in bestimmten Bereichen das Vergessen beigebracht werden. Zudem müsse für das Netz etwas Ähnliches wie der presserechtliche Anspruch auf Gegendarstellung geschaffen werden."
Thesen hier:
http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1099988/publicationFile/88667/thesen_netzpolitik.pdf
http://soundcloud.com/carta/demaiziere-netzpolitik
Empirische Studie von Google:
http://archiv.twoday.net/stories/8359944/
Noch mehr Radiergummi ?
Internet
Thomas de Maizière hat in einer Grundsatzrede skizziert, wie er sich eine deutsche „Netzpolitik“ vorstellt. Dem Internet müsse in bestimmten Bereichen das Vergessen beigebracht werden. Zudem müsse für das Netz etwas Ähnliches wie der presserechtliche Anspruch auf Gegendarstellung geschaffen werden."
Thesen hier:
http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/1099988/publicationFile/88667/thesen_netzpolitik.pdf
http://soundcloud.com/carta/demaiziere-netzpolitik
Empirische Studie von Google:
http://archiv.twoday.net/stories/8359944/
Noch mehr Radiergummi ?
vom hofe - am Dienstag, 22. Juni 2010, 17:05 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 22. Juni 2010, 15:37 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
2000 Barockdrucke des 17. Jahrhunderts aus der Nürnberger Stadtbibliothek seien bereits digitalisiert und im Internet einsehbar, meldet dpa:
http://www.nn-online.de/artikel.asp?art=1246826&kat=10&man=3
Auf der Website der Stadtbibliothek findet man wie zu erwarten nichts.
http://www.franken-tv.de/default.aspx?ID=458&showNews=756479 nennt die zutreffende Adresse http://www.vd17.de
Man wird allerdings Probleme haben, die angeblich vorhandenen 2000 Drucke in der Datenbank zu lokalisieren, da das sonst übliche Schlagwort Volldigitalisat nicht Verwendung findet und das VD17 keinen Online-Filter anbietet.
Über 1800 Treffer erhält man, wenn man nach Volltext mit der Sucheinschränkung StadtB Nürnberg sucht, darunter:
http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/75:707155D_001,800,600
Wieso ist es nicht möglich, den natürlich und selbstverständlichen Wunsch von Benutzern zu befriedigen, die ausschließlich vollständig online einsehbare Drucke benutzen und nicht die Nadel im Heuhaufen suchen möchten?
http://www.nn-online.de/artikel.asp?art=1246826&kat=10&man=3
Auf der Website der Stadtbibliothek findet man wie zu erwarten nichts.
http://www.franken-tv.de/default.aspx?ID=458&showNews=756479 nennt die zutreffende Adresse http://www.vd17.de
Man wird allerdings Probleme haben, die angeblich vorhandenen 2000 Drucke in der Datenbank zu lokalisieren, da das sonst übliche Schlagwort Volldigitalisat nicht Verwendung findet und das VD17 keinen Online-Filter anbietet.
Über 1800 Treffer erhält man, wenn man nach Volltext mit der Sucheinschränkung StadtB Nürnberg sucht, darunter:
http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/75:707155D_001,800,600
Wieso ist es nicht möglich, den natürlich und selbstverständlichen Wunsch von Benutzern zu befriedigen, die ausschließlich vollständig online einsehbare Drucke benutzen und nicht die Nadel im Heuhaufen suchen möchten?
KlausGraf - am Dienstag, 22. Juni 2010, 15:11 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Ausgestrahlt am 20. Juni 2010 im Sat.1
"In der Humanprobenbank in Münster ist es eisig kalt. Die enormen Minusgrade sind nötig, denn sie bewahren einen ganz besonderen Schatz vor dem Verfall. Die Kostbarkeiten der Humanprobenbank stammen vom Menschen - seit Jahrzehnten werden hier Haare, Blut, Urin und Speichel konserviert. Mit jedem Jahr werden die Proben wertvoller, denn sie sind ein Spiegel der Vergangenheit. Forscher vergleichen alte Proben mit denen von heute, und können so fest stellen, wie sich Umweltgifte verändert haben. PLANETOPIA begleitet einen Forscher beim Einsammeln einer Probe und bei seinem eisigen Gang in die Kältekammer.
Das Urheberrecht (©) unterliegt:
NEWS AND PICTURES Fernsehen GmbH & Co. KG "
Wolf Thomas - am Dienstag, 22. Juni 2010, 10:27 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Personalakten werden seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts angelegt und begleiten eine Person ihr gesamtes Berufsleben hindurch. Sie enthalten zahlreiche Dokumente, die interessante Schlaglichter auf die Biografie einer Person werfen: Fotos, Zeugnisse, Lebensläufe, Beurteilungen - und manchmal sogar Disziplinarsachen. Das Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen greift die für Familienforscher hochinteressante Quellengruppe in seiner Vortragsreihe "Genealogie im Archiv" auf. Am 24. Juni 2010 um 19 Uhr wird Dr. Annette Hennigs im Vortragssaal des Dienstgebäudes Bohlweg 2 die Möglichkeiten und Grenzen der genealogischen Analyse von Personalakten aufzeigen. Besucher sind herzlich willkommen, die Veranstaltung ist kostenfrei.
INFO
Veranstaltungsdaten:
Vortragsreihe Genealogie im Archiv: Personalakten als
genealogische Quelle
Datum: 24.06.2010
Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
Bohlweg 2
48147 Münster
Tel.: 0251 / 4885-0
Fax: 0251 / 4885-100
E-Mail: westfalen@lav.nrw.de
URL:
http://www.archive.nrw.de/LandesarchivNRW/abteilungWestfalen/index.html "
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
INFO
Veranstaltungsdaten:
Vortragsreihe Genealogie im Archiv: Personalakten als
genealogische Quelle
Datum: 24.06.2010
Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
Bohlweg 2
48147 Münster
Tel.: 0251 / 4885-0
Fax: 0251 / 4885-100
E-Mail: westfalen@lav.nrw.de
URL:
http://www.archive.nrw.de/LandesarchivNRW/abteilungWestfalen/index.html "
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Wolf Thomas - am Montag, 21. Juni 2010, 12:02 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Fachbereich Medienpädagogik, hat einen Werbefilm über das Landesarchiv NRW Abteilung Ostwestfalen-Lippe und das Kreisarchiv Lippe in Detmold gedreht. Sie finden diesen Film jetzt auf YouTube.
Andreas Pilger - am Montag, 21. Juni 2010, 11:34 - Rubrik: Web 2.0
Wolf Thomas - am Montag, 21. Juni 2010, 08:46 - Rubrik: Unterhaltung
Wolf Thomas - am Sonntag, 20. Juni 2010, 20:56 - Rubrik: Medienarchive
"Archiv – das klingt langweilig, oder? Wir assoziieren es mit staubigen Akten, die kein Mensch mehr braucht. Aber: Es gibt Archive, die werden von quicklebendigen Leuten höchst dynamisch gehandhabt.
Erst mal zum Wort: Archiv hat die gleiche Wurzel wie der 2. Teil in Matriarchat oder Patriarchat: arché „Ursprung, das Erste”.
Was ist ein Archiv im Patriarchat?
Der Ausdruck – lat. archivum, grch. archeion – wird ursprünglich auf den Wohnsitz eines Archonten angewendet, wo unter dessen Autorität wichtige offizielle Staatsdokumente gelagert werden. Archonten waren im alten Athen die neun aus dem Adel gewählten, an der Spitze des Staates stehenden Beamte.
Die Archivierung des im Hause eines Archon aufbewahrten Archivguts ist an Regeln wie Unveränderbarkeit und langfristige Wiederauffindbarkeit gebunden. Archive sind beispielsweise in Museums-, Finanz-, Bibliotheks-, oder Justizgebäuden zu finden.
Die gesamte Geschichte der Bundesrepublik Deutschlands ist im Barbarastollen archiviert. Na ja, nicht die ganze Geschichte. Nur das Kulturgut das als archivierungswürdig gilt. Ein paar „Experten” wählen das aus und zu patriarchalen Archiven hat auch nicht jeder Zugang – es gibt einen besonderen Berufsstand: Archivar/in – diese Leute dürfen ein Archiv betreten und sorgen dafür, dass alles unverändert an seinem Platz bleibt und „Unbefugte” draußen bleiben.
Immer dann, wenn es heißt „Kein Zutritt für Unbefugte” haben wir es mit einem Herrschaftsinstrument zu tun.
Da der Begriff “Archiv” nicht geschützt ist, könnte man meinen, dass das Wort im Internet beliebig verwendet wird. So ist es aber nicht.
Was ist ein Archiv im Web 2.0?
Es gibt Internetarchive, die schon vor der Web2.0-Technologie aufgebaut wurden und sich in zwei wesentlichen Merkmalen von patriarchalen Archiven unterscheiden:
1. sie wurden als Wissensdatenbanken für zukünftige Generationen konzipiert
2. sie sind allen zugänglich
Ein Beispiel:
Webcitation.org – Zunehmend werden in Print- oder Online-Publikationen Websites als Quellen angegeben. Also auch in Fachbüchern, Forschungsberichten, Dissertationen usw. Während eine gedruckte Quelle auffindbar bleibt (die Angabe „Walter Schmidt, 1984, S. 34″ kann als Buchseite gefunden werden), verändern sich Websites und die Quellenangabe führt möglicherweise als Fehler 404 „ins Leere”. Hier kommt webcitation.org ins Spiel: Ich melde die Adresse der Webpage, die ich in meinem Buch zitiere, dort an, Webcitation archiviert die Seite und zukünftige Leser können permanent auf die Quelle zugreifen, auch wenn die ursprüngliche Seite vom Besitzer nicht mehr betrieben wird. Typisch Web 2.0: der Dienst ist kostenlos.
Viele weitere Beispiele für derartige Archivierung und Verwendungsmöglichkeiten für die Allgemeinheit sind in der Wikipedia beschrieben. Ich empfehle die englische Version, denn der deutschen Wikipatria gelingt es regelmäßig den sozialen Geist des Internets an sich, und des Web 2.0 im Besonderen, abzutöten.
Archivierung im täglichen Gebrauch des Web 2.0
Jeder mit einem Google-Email-Konto weiß die Archivierungsfunktion zu schätzen. Die Firma Google setzt Web 2.0-Technologie um, wo immer möglich, deshalb ist sie erfolgreich. Wie bei jeder anderen Email-Software kann man Emails filtern, in Ordner schieben oder löschen. Die Archivierung versieht dagegen eingehende Emails mit bestimmten Labels (tags, Stichworten) und legt sie unter diesem Label ab, ohne den Posteingangsordner voll zu stopfen. Das eignet sich z.B. für abonnierte Newsletter oder Alerts zu bestimmten Themen, auf die man zugreift – sie sind durchsuchbar -, wenn sie benötigt werden.
Blog-Archiv
Blogbeiträge werden von der Blogsoftware ebenfalls archiviert. Wiederum Web 2.0: denn sie sind für alle zugänglich und werden von Bloggern im Laufe der Zeit verändert! Das geschieht durch inhaltliche Ergänzungen in Artikeln, deren komplette Überarbeitung, einer Neu-Kategorisierung oder dem Löschen überholter Beiträge.
Manche Blogs archivieren unter der Jahreszahl und/oder dem Monat, was nur bedingt Sinn macht, denn man kann an der Archivgliederung nicht erkennen, welche Inhalte sie enthält. Mein Blog ist in Kategorien archiviert (siehe ganz unten). Ein Blogarchiv ist nicht statisch. Es spiegelt zwar wie ein patriarchales Staatsarchiv Geschichte – beim Blog die der bloggenden Person. Aber während ein Staatsarchiv auf Unveränderbarkeit ausgerichtet ist, reflektiert das Blogarchiv die ‘historische’ Veränderung, d.h. die Entwicklung der Bloggerin.
Matriarchales Archiv
Haben Naturvölker und Stammesgesellschaften Archive? Sie haben! Ihr Überleben hängt davon ab. Das Archiv befindet sich aber nicht in einem festen verschlossenen Gebäude, sondern in den Köpfen von Personen, die ein besonders gutes Gedächtnis haben.
Diese Mitglieder matriarchaler Gemeinschaften sind die HüterInnen der politischen Kontinuität ihres Stammes. Sie wissen alles auswendig: Die Linie ihrer Vorfahren, mythologische Ereignisse, heilige Plätze wie Grabstätten oder Schreine, die weit entfernt auseinander liegen können. Ihr trainiertes Gedächtnis speichert unzählige Sprichwörter, Chiffren, Tänze, Liedtexte und Melodien. Die Schamanen unter ihnen finden Kräuter und kennen medizinische Techniken, wissen um deren Wirkung und können effizient damit heilen.
Um das Wissen einer solchen Gemeinschaft zu bewahren, wird es an Begabte von Generation zu Generation weiter gegeben. Es dauert Jahrzehnte, bis alles memoriert ist. Aber es gibt Hilfen für Lernende: Das Bild links zeigt ein afrikanisches Memorialbrett der Luba, ein Bantuvolk im Südosten der Demokratischen Republik Kongo. Die Perlen und Kerben bedeuten signifikante Plätze, Personen, Ereignisse und Ideen.
Die Veränderungen im Stamm und in dessen Umwelt fließen beständig in neu zu erstellende Gedächtnisbretter und damit in die Köpfe der „Archiv-WächterInnen” ein. Das naturwidrige Konzept von unveränderlicher Archivierung hat hier keinen Platz. Dies wird noch deutlicher bei den nordamerikanischen Newspaper Rocks der Indianer. Die sind nämlich Wind und Wetter ausgesetzt.
Aber das beste Beispiel und die perfekte Analogie der matriarchalen Memorialbretter zum Web 2.0 sind die Wikis. Das bekannteste ist die Wikipedia, dazu es gibt unzählige kleinere und ganz kleine Wikis zu allen nur denkbaren Themen. Sie werden angepasst, wie die Bretter der Luba, wenn die Zeit es verlangt.
Archiv ist also nicht gleich Archiv. Entlarvend ist immer die Einstellung, die geistige Haltung, die hinter einer Handlung steht, nicht die Aktion selbst."
Quelle: Beitrag in der Reihe "Matriachat und Web 2.0" für den Blog "Rette sich wer kann v. Hannelore Vonier
Erst mal zum Wort: Archiv hat die gleiche Wurzel wie der 2. Teil in Matriarchat oder Patriarchat: arché „Ursprung, das Erste”.
Was ist ein Archiv im Patriarchat?
Der Ausdruck – lat. archivum, grch. archeion – wird ursprünglich auf den Wohnsitz eines Archonten angewendet, wo unter dessen Autorität wichtige offizielle Staatsdokumente gelagert werden. Archonten waren im alten Athen die neun aus dem Adel gewählten, an der Spitze des Staates stehenden Beamte.
Die Archivierung des im Hause eines Archon aufbewahrten Archivguts ist an Regeln wie Unveränderbarkeit und langfristige Wiederauffindbarkeit gebunden. Archive sind beispielsweise in Museums-, Finanz-, Bibliotheks-, oder Justizgebäuden zu finden.
Die gesamte Geschichte der Bundesrepublik Deutschlands ist im Barbarastollen archiviert. Na ja, nicht die ganze Geschichte. Nur das Kulturgut das als archivierungswürdig gilt. Ein paar „Experten” wählen das aus und zu patriarchalen Archiven hat auch nicht jeder Zugang – es gibt einen besonderen Berufsstand: Archivar/in – diese Leute dürfen ein Archiv betreten und sorgen dafür, dass alles unverändert an seinem Platz bleibt und „Unbefugte” draußen bleiben.
Immer dann, wenn es heißt „Kein Zutritt für Unbefugte” haben wir es mit einem Herrschaftsinstrument zu tun.
Da der Begriff “Archiv” nicht geschützt ist, könnte man meinen, dass das Wort im Internet beliebig verwendet wird. So ist es aber nicht.
Was ist ein Archiv im Web 2.0?
Es gibt Internetarchive, die schon vor der Web2.0-Technologie aufgebaut wurden und sich in zwei wesentlichen Merkmalen von patriarchalen Archiven unterscheiden:
1. sie wurden als Wissensdatenbanken für zukünftige Generationen konzipiert
2. sie sind allen zugänglich
Ein Beispiel:
Webcitation.org – Zunehmend werden in Print- oder Online-Publikationen Websites als Quellen angegeben. Also auch in Fachbüchern, Forschungsberichten, Dissertationen usw. Während eine gedruckte Quelle auffindbar bleibt (die Angabe „Walter Schmidt, 1984, S. 34″ kann als Buchseite gefunden werden), verändern sich Websites und die Quellenangabe führt möglicherweise als Fehler 404 „ins Leere”. Hier kommt webcitation.org ins Spiel: Ich melde die Adresse der Webpage, die ich in meinem Buch zitiere, dort an, Webcitation archiviert die Seite und zukünftige Leser können permanent auf die Quelle zugreifen, auch wenn die ursprüngliche Seite vom Besitzer nicht mehr betrieben wird. Typisch Web 2.0: der Dienst ist kostenlos.
Viele weitere Beispiele für derartige Archivierung und Verwendungsmöglichkeiten für die Allgemeinheit sind in der Wikipedia beschrieben. Ich empfehle die englische Version, denn der deutschen Wikipatria gelingt es regelmäßig den sozialen Geist des Internets an sich, und des Web 2.0 im Besonderen, abzutöten.
Archivierung im täglichen Gebrauch des Web 2.0
Jeder mit einem Google-Email-Konto weiß die Archivierungsfunktion zu schätzen. Die Firma Google setzt Web 2.0-Technologie um, wo immer möglich, deshalb ist sie erfolgreich. Wie bei jeder anderen Email-Software kann man Emails filtern, in Ordner schieben oder löschen. Die Archivierung versieht dagegen eingehende Emails mit bestimmten Labels (tags, Stichworten) und legt sie unter diesem Label ab, ohne den Posteingangsordner voll zu stopfen. Das eignet sich z.B. für abonnierte Newsletter oder Alerts zu bestimmten Themen, auf die man zugreift – sie sind durchsuchbar -, wenn sie benötigt werden.
Blog-Archiv
Blogbeiträge werden von der Blogsoftware ebenfalls archiviert. Wiederum Web 2.0: denn sie sind für alle zugänglich und werden von Bloggern im Laufe der Zeit verändert! Das geschieht durch inhaltliche Ergänzungen in Artikeln, deren komplette Überarbeitung, einer Neu-Kategorisierung oder dem Löschen überholter Beiträge.
Manche Blogs archivieren unter der Jahreszahl und/oder dem Monat, was nur bedingt Sinn macht, denn man kann an der Archivgliederung nicht erkennen, welche Inhalte sie enthält. Mein Blog ist in Kategorien archiviert (siehe ganz unten). Ein Blogarchiv ist nicht statisch. Es spiegelt zwar wie ein patriarchales Staatsarchiv Geschichte – beim Blog die der bloggenden Person. Aber während ein Staatsarchiv auf Unveränderbarkeit ausgerichtet ist, reflektiert das Blogarchiv die ‘historische’ Veränderung, d.h. die Entwicklung der Bloggerin.
Matriarchales Archiv
Haben Naturvölker und Stammesgesellschaften Archive? Sie haben! Ihr Überleben hängt davon ab. Das Archiv befindet sich aber nicht in einem festen verschlossenen Gebäude, sondern in den Köpfen von Personen, die ein besonders gutes Gedächtnis haben.
Diese Mitglieder matriarchaler Gemeinschaften sind die HüterInnen der politischen Kontinuität ihres Stammes. Sie wissen alles auswendig: Die Linie ihrer Vorfahren, mythologische Ereignisse, heilige Plätze wie Grabstätten oder Schreine, die weit entfernt auseinander liegen können. Ihr trainiertes Gedächtnis speichert unzählige Sprichwörter, Chiffren, Tänze, Liedtexte und Melodien. Die Schamanen unter ihnen finden Kräuter und kennen medizinische Techniken, wissen um deren Wirkung und können effizient damit heilen.
Um das Wissen einer solchen Gemeinschaft zu bewahren, wird es an Begabte von Generation zu Generation weiter gegeben. Es dauert Jahrzehnte, bis alles memoriert ist. Aber es gibt Hilfen für Lernende: Das Bild links zeigt ein afrikanisches Memorialbrett der Luba, ein Bantuvolk im Südosten der Demokratischen Republik Kongo. Die Perlen und Kerben bedeuten signifikante Plätze, Personen, Ereignisse und Ideen.
Die Veränderungen im Stamm und in dessen Umwelt fließen beständig in neu zu erstellende Gedächtnisbretter und damit in die Köpfe der „Archiv-WächterInnen” ein. Das naturwidrige Konzept von unveränderlicher Archivierung hat hier keinen Platz. Dies wird noch deutlicher bei den nordamerikanischen Newspaper Rocks der Indianer. Die sind nämlich Wind und Wetter ausgesetzt.
Aber das beste Beispiel und die perfekte Analogie der matriarchalen Memorialbretter zum Web 2.0 sind die Wikis. Das bekannteste ist die Wikipedia, dazu es gibt unzählige kleinere und ganz kleine Wikis zu allen nur denkbaren Themen. Sie werden angepasst, wie die Bretter der Luba, wenn die Zeit es verlangt.
Archiv ist also nicht gleich Archiv. Entlarvend ist immer die Einstellung, die geistige Haltung, die hinter einer Handlung steht, nicht die Aktion selbst."
Quelle: Beitrag in der Reihe "Matriachat und Web 2.0" für den Blog "Rette sich wer kann v. Hannelore Vonier
Wolf Thomas - am Sonntag, 20. Juni 2010, 11:09 - Rubrik: Wahrnehmung
Link zur Seite.
Wolf Thomas - am Sonntag, 20. Juni 2010, 11:06 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Göttinger Institut Wissen und Medien gGmbH (IWF) beherbergt eine der weltweit größten Sammlungen an wissenschaftlichen Filmen.
Zu den besonderen Schätzen der Einrichtung gehören zahlreiche Filme der weltberühmten Verhaltensforscher Konrad Lorenz und Irenäus Eibl-Eibesfeldt sowie Aufnahmen mit den Nobelpreisträgern Otto Hahn und Werner Heisenberg. Die Zukunft dieser Kostbarkeiten ist allerdings ungewiss.
Ende 2007 ist die Bund-Länder-Förderung ausgelaufen, seitdem befindet sich das Institut in der Abwicklung. Diese soll bis Ende 2010 abgeschlossen sein. Zehn Monate vor Ablauf der Frist hat das Wissenschaftsministerium in Hannover jedoch noch keine Entscheidung getroffen, was mit den Filmen und den 50 Arbeitsplätzen geschehen soll.
Die Göttinger SPD-Landtagsabgeordnete Gabriele Andretta hat deshalb jetzt eine Anfrage im Landtag gestellt. „Die Zeit drängt, wir brauchen endlich eine Lösung“, sagt die wissenschaftspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Die Landesregierung habe zugesagt, die Bestände des Instituts zugänglich zu halten und die Medienkompetenz am Standort Göttingen zu erhalten. Jetzt müsse sie erklären, wie sie diese Zusage einlösen wolle.
Das Wissenschaftsministerium favorisiert bislang eine Angliederung an die Technische Informationsbibliothek Hannover (TIB). Diese hat ein Konzept erarbeitet, das unter anderem ein Medienzentrum am Standort Göttingen vorsieht. Inzwischen ist dieses Konzept auch geprüft worden. Die Ergebnisse lägen allerdings noch nicht vor, sagte Ministeriumssprecher Kurt Neubert.
Andretta will von der Landesregierung wissen, ob sie einen „Plan B“ hat, falls sich die Angliederung an die TIB nicht umsetzen lässt. Mögliche Alternativen seien eine Anbindung an die Universitätsbibliothek in Göttingen oder das Landesarchiv. Nach ihrer Ansicht muss auch deshalb schnell eine Entscheidung fallen, weil Ende April der Aufsichtsrat der IWF tagt. Sollte sich bis dahin keine Lösung gefunden haben, drohe das endgültige Aus für die 50 Arbeitsplätze.
Das 1956 gegründete IWF ist seit Jahren in seiner Existenz bedroht. Schon Mitte der 1990-er Jahre empfahl der Wissenschaftsrat, das Institut aus der Förderung durch Bund und Länder zu streichen. Das IWF legte daraufhin ein Umstrukturierungskonzept vor und bekam eine neue Chance. Obwohl Gutachter die Neuausrichtung als Mediendienstleister befürworteten, empfahl Ende 2005 der Senat der Leibniz Gemeinschaft, die Einrichtung nicht weiter zu fördern."
Quelle: hna.de, 4.3.2010
s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/5441129/
Zu den besonderen Schätzen der Einrichtung gehören zahlreiche Filme der weltberühmten Verhaltensforscher Konrad Lorenz und Irenäus Eibl-Eibesfeldt sowie Aufnahmen mit den Nobelpreisträgern Otto Hahn und Werner Heisenberg. Die Zukunft dieser Kostbarkeiten ist allerdings ungewiss.
Ende 2007 ist die Bund-Länder-Förderung ausgelaufen, seitdem befindet sich das Institut in der Abwicklung. Diese soll bis Ende 2010 abgeschlossen sein. Zehn Monate vor Ablauf der Frist hat das Wissenschaftsministerium in Hannover jedoch noch keine Entscheidung getroffen, was mit den Filmen und den 50 Arbeitsplätzen geschehen soll.
Die Göttinger SPD-Landtagsabgeordnete Gabriele Andretta hat deshalb jetzt eine Anfrage im Landtag gestellt. „Die Zeit drängt, wir brauchen endlich eine Lösung“, sagt die wissenschaftspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Die Landesregierung habe zugesagt, die Bestände des Instituts zugänglich zu halten und die Medienkompetenz am Standort Göttingen zu erhalten. Jetzt müsse sie erklären, wie sie diese Zusage einlösen wolle.
Das Wissenschaftsministerium favorisiert bislang eine Angliederung an die Technische Informationsbibliothek Hannover (TIB). Diese hat ein Konzept erarbeitet, das unter anderem ein Medienzentrum am Standort Göttingen vorsieht. Inzwischen ist dieses Konzept auch geprüft worden. Die Ergebnisse lägen allerdings noch nicht vor, sagte Ministeriumssprecher Kurt Neubert.
Andretta will von der Landesregierung wissen, ob sie einen „Plan B“ hat, falls sich die Angliederung an die TIB nicht umsetzen lässt. Mögliche Alternativen seien eine Anbindung an die Universitätsbibliothek in Göttingen oder das Landesarchiv. Nach ihrer Ansicht muss auch deshalb schnell eine Entscheidung fallen, weil Ende April der Aufsichtsrat der IWF tagt. Sollte sich bis dahin keine Lösung gefunden haben, drohe das endgültige Aus für die 50 Arbeitsplätze.
Das 1956 gegründete IWF ist seit Jahren in seiner Existenz bedroht. Schon Mitte der 1990-er Jahre empfahl der Wissenschaftsrat, das Institut aus der Förderung durch Bund und Länder zu streichen. Das IWF legte daraufhin ein Umstrukturierungskonzept vor und bekam eine neue Chance. Obwohl Gutachter die Neuausrichtung als Mediendienstleister befürworteten, empfahl Ende 2005 der Senat der Leibniz Gemeinschaft, die Einrichtung nicht weiter zu fördern."
Quelle: hna.de, 4.3.2010
s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/5441129/
Wolf Thomas - am Sonntag, 20. Juni 2010, 10:56 - Rubrik: Filmarchive
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:L%C3%B6schkandidaten/19._Juni_2010&oldid=75766416
Bildungsanstalten sind ebenso relevant wie Bahnhöfe, nur leider haben männliche junge Wikipedia Benutzer mehr "Ick vasteh nur Bahnhof" im Kopf als Bildung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Bahnhof_in_Wuppertal
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Gesamtschule_in_Nordrhein-Westfalen
 Foto: Atamari http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Foto: Atamari http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Bildungsanstalten sind ebenso relevant wie Bahnhöfe, nur leider haben männliche junge Wikipedia Benutzer mehr "Ick vasteh nur Bahnhof" im Kopf als Bildung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Bahnhof_in_Wuppertal
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Gesamtschule_in_Nordrhein-Westfalen
 Foto: Atamari http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Foto: Atamari http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.dehttp://www.tagesspiegel.de/kultur/sternzeichen-plaudertasche/1855646.html
Siehe auch
http://de.favstar.fm/tweets/popular
Ihr Leben läuft nicht so, wie sie wollen. Wie reagieren Sie?
A) Moklauf
B) Schwerdebrief
C) Ter und Mordio
D) Pression
@formschub
Siehe auch
http://de.favstar.fm/tweets/popular
Ihr Leben läuft nicht so, wie sie wollen. Wie reagieren Sie?
A) Moklauf
B) Schwerdebrief
C) Ter und Mordio
D) Pression
@formschub
KlausGraf - am Samstag, 19. Juni 2010, 19:47 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://studium.campus.de/sixcms/media.php/274/Opitz_Quellen_Internet.pdf
Gut 30 Seiten Quellensammlung als Online-Beigabe zu dem neuen Buch von Claudia Opitz-Belakhal (2010):
http://studium.campus.de/geschichte/historische-einfuehrungen/Geschlechtergeschichte.94571.html
Auch die Auswahlbibliografie ist einsehbar:
http://studium.campus.de/sixcms/media.php/274/Opitz_Bibliografie_Internet.pdf
Gut 30 Seiten Quellensammlung als Online-Beigabe zu dem neuen Buch von Claudia Opitz-Belakhal (2010):
http://studium.campus.de/geschichte/historische-einfuehrungen/Geschlechtergeschichte.94571.html
Auch die Auswahlbibliografie ist einsehbar:
http://studium.campus.de/sixcms/media.php/274/Opitz_Bibliografie_Internet.pdf
KlausGraf - am Samstag, 19. Juni 2010, 19:31 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Historiker-Bund-haelt-7-5-Millionen-Akten-geheim-1025712.html
In den Ministerien und Archiven des Bundes lagern nach Berechnungen eines Historikers mehr als 7,5 Millionen Geheimakten. Allein im Bundeskanzleramt und im Bundesinnenministerium würden über 3,5 Millionen als Verschlusssache gestempelte Dokumente liegen, errechnete der Freiburger Historiker Josef Foschepoth nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Diese seien in aller Regel der zeitgeschichtlichen Forschung entzogen.
Siehe auch
http://www.dernewsticker.de/news.php?id=190075&i=ppcrjb
In den Ministerien und Archiven des Bundes lagern nach Berechnungen eines Historikers mehr als 7,5 Millionen Geheimakten. Allein im Bundeskanzleramt und im Bundesinnenministerium würden über 3,5 Millionen als Verschlusssache gestempelte Dokumente liegen, errechnete der Freiburger Historiker Josef Foschepoth nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Diese seien in aller Regel der zeitgeschichtlichen Forschung entzogen.
Siehe auch
http://www.dernewsticker.de/news.php?id=190075&i=ppcrjb
KlausGraf - am Samstag, 19. Juni 2010, 18:50 - Rubrik: Staatsarchive
Dass die Bearbeiter der PND die erforderliche Sorgfalt in eklatantem Ausmaß vermissen lassen, habe ich schon mehrfach gezeigt.
Ein neues Beispiel der überaus schlampigen Arbeitsweise:
http://d-nb.info/gnd/133935906
Person Sander, Ferdinand (männlich)
Andere Namen Sander, Karl Heinrich Philipp Ferdinand
Quelle DbA (WBIS);Parlamentarisches Handbuch für den Deutschen Reichstag und den Preußischen Landtag
Lebensdaten 1840-1920
Beruf(e) Politiker
Abgeordneter
Unternehmer
Schulrat
Ferdinand Sander war Abgeordneter und Unternehmer:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Sander
Karl Heinrich Philipp Ferdinand Sander war der Schulrat:
http://de.wikisource.org/wiki/Diskussion:Ferdinand_Sander
Konsequenz: Im GBV sind alle Publikationen des Pädagogen via PND dem falschen Sander zugewiesen.
Ein neues Beispiel der überaus schlampigen Arbeitsweise:
http://d-nb.info/gnd/133935906
Person Sander, Ferdinand (männlich)
Andere Namen Sander, Karl Heinrich Philipp Ferdinand
Quelle DbA (WBIS);Parlamentarisches Handbuch für den Deutschen Reichstag und den Preußischen Landtag
Lebensdaten 1840-1920
Beruf(e) Politiker
Abgeordneter
Unternehmer
Schulrat
Ferdinand Sander war Abgeordneter und Unternehmer:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Sander
Karl Heinrich Philipp Ferdinand Sander war der Schulrat:
http://de.wikisource.org/wiki/Diskussion:Ferdinand_Sander
Konsequenz: Im GBV sind alle Publikationen des Pädagogen via PND dem falschen Sander zugewiesen.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.lto.de
Ein deutschsprachiger Ableger des SPIEGEL zum Thema Recht. Gefesselt wurde ich nicht.
 Symbolbild
Symbolbild
Ein deutschsprachiger Ableger des SPIEGEL zum Thema Recht. Gefesselt wurde ich nicht.
 Symbolbild
SymbolbildKlausGraf - am Samstag, 19. Juni 2010, 15:36 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blog.kooptech.de/2010/06/verleger-wollen-auch-satzteile-schuetzen-lassen/
http://www.netzpiloten.de/2010/06/18/leistungsschutzrecht-das/
http://www.netzpiloten.de/2010/06/18/leistungsschutzrecht-das/
KlausGraf - am Samstag, 19. Juni 2010, 15:22 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 19. Juni 2010, 15:21 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 19. Juni 2010, 15:13 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 19. Juni 2010, 15:01 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Samstag, 19. Juni 2010, 08:47 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Beim "Expert Day" auf Burg Forchtenstein am Samstag, dem 26. Juni 2010, geben "die wissenschaftlichen Experten der Esterházy Privatstiftung interessierten Besuchern detaillierte Einblicke in die reichhaltigen Sammlungen, die Burg Forchtenstein beherbergt. Sehen Sie Burg Forchtenstein aus dem Blickwinkel eines Wissenschaftlers: erfahren Sie Interessantes aus der Welt der kunsthistorischen Forschung, Wissenswertes zu einzelnen Exponaten und besichtigen Sie Bereiche der Burg, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind".
.....
Fürstliches Archiv der Burg Forchtenstein - Dr. Gottfried Holzschuh. Beginn: 11.15 und 13.15 Uhr
....."
Dank an Monika Bargmann für diesen Hinweis.
.....
Fürstliches Archiv der Burg Forchtenstein - Dr. Gottfried Holzschuh. Beginn: 11.15 und 13.15 Uhr
....."
Dank an Monika Bargmann für diesen Hinweis.
Wolf Thomas - am Samstag, 19. Juni 2010, 08:27 - Rubrik: Herrschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Pariser Diplomaten: "Deutschland hat seine Geheimarchive geöffnet. Da müssen wir unsere um so stärker verschließen."
Persistente URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ulk1922/0093
Dank an Andreas Praefcke!
Wolf Thomas - am Freitag, 18. Juni 2010, 19:32 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Freitag, 18. Juni 2010, 19:30 - Rubrik: Archivpaedagogik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Freitag, 18. Juni 2010, 19:29 - Rubrik: Archivpaedagogik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Archives and education
View more presentations from Arkivformidling.
Wolf Thomas - am Freitag, 18. Juni 2010, 19:26 - Rubrik: Archivpaedagogik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wapenboek Beyeren gedigitaliseerd
De KB heeft een bijzonder middeleeuws handschrift gedigitaliseerd. Het Wapenboek Beyeren bevat meer dan duizend tekeningen van wapenschilden en kan worden gezien als een Who's Who van de middeleeuwen. Het boek is geschreven door Claes Heynenzoon die rond 1400 een van de belangrijkste diplomaten van de Nederlanden was. De auteur legde zijn kennis van de internationale ridderschap vast in dit wapenboek. Het handschrift is rond 1405 geschreven in Den Haag.
http://www.kb.nl/galerie/wapenboek/index.html
De KB heeft een bijzonder middeleeuws handschrift gedigitaliseerd. Het Wapenboek Beyeren bevat meer dan duizend tekeningen van wapenschilden en kan worden gezien als een Who's Who van de middeleeuwen. Het boek is geschreven door Claes Heynenzoon die rond 1400 een van de belangrijkste diplomaten van de Nederlanden was. De auteur legde zijn kennis van de internationale ridderschap vast in dit wapenboek. Het handschrift is rond 1405 geschreven in Den Haag.
http://www.kb.nl/galerie/wapenboek/index.html
KlausGraf - am Freitag, 18. Juni 2010, 15:32 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Freitag, 18. Juni 2010, 12:33 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Freitag, 18. Juni 2010, 12:27 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Quelle: VdA
"Vom 3. bis 5. Juni 2010 fand in Kooperation mit dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv in der FH Potsdam und im Deutschen Rundfunkarchiv Potsdam-Babelsberg die 24. Archivpädagogenkonferenz zu dem Thema „Bewegte Bilder − Filme als historische Quellen“ statt.
Die Tagung stieß auf außergewöhnlich große Resonanz. Es nahmen insgesamt 60 Archivar/innen und Vertreter/innen der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit sowie Studierende der FH Potsdam teil.
Die Bandbreite der Themen am ersten Tagungstag reichte von den Einsatzmöglichkeiten einer filmischen Stasi-Quelle in der Bildungsarbeit (Dr. Axel Janowitz / BStU Berlin), der Nutzung von Amateurfilmen in der Kulturarbeit (Gabriele Konsor / Atelier Havelblick Strodehne), der archiv- und museumspädagogischen Arbeit im Filmmuseum Potsdam (Beate Rabe) bis zu einem Praxisbericht zur Geschichte im Film (Dr. Peter Schweinhardt / Filmgymnasium Potsdam-Babelsberg). Am zweiten Tagungstag stellte Angelika Hörth das Deutsche Rundfunkarchiv Potsdam-Babelsberg vor. Dr. Jörg-Uwe Fischer referierte über die Magazinsendung „Prisma“ des DDR-Fernsehens als Quelle der Alltags- und Konsumgeschichte der DDR und Alexandra Luther informierte über das Onlineangebot „Wendezeiten 1989/90“. Mit der anschließenden Hausführung und der Abschlussdiskussion wurde das umfassende Tagungsprogramm am Samstag um 13.30 Uhr beendet.
Der intensive interdisziplinäre Austausch gab neue Impulse für die Historische Bildungsarbeit und Archivpädagogik, die Filme künftig auf unterschiedlichen Ebenen als Vermittlungsmedium stärker in den Blick nehmen wird. Ein ausführlicher Tagungsbericht folgt in Kürze."
Quelle: VdA, Aktuelles v. 11.06.2010
Wolf Thomas - am Freitag, 18. Juni 2010, 10:00 - Rubrik: Archivpaedagogik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Erstmals wurde im Rahmen der Thüringer Archivtage der Thüringer Archivpreis der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen in Verbindung mit dem Thüringer Archivarverband ausgelobt. Der in Folge alle zwei Jahre verliehene Preis soll herausragende Leistungen Thüringer Archive prämieren. Mit der Auszeichnung ist ein Preisgeld von 5.000,00 Euro verbunden. Das Preisgeld soll dazu
dienen, besondere Aufgaben der Archive zu realisieren und darf nicht zur Kürzung öffentlicher Zuschüsse führen.
Vergeben wird der Preis für kreative und innovative Projekte, den Neuaufbau, die Modernisierung oder auch Übernahme eines Archivs, herausragende wissenschaftliche Publikationen zum Archivwesen und zur Archivgeschichte Thüringens und sowie den Einsatz und die Weiterentwicklung neuer Technologien und Methoden in der Archivpraxis.
Die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen institutionalisiert damit ihr langfristiges Engagement im Bereich des Thüringer Archivwesens, das bis in die 1990er Jahre zurückreicht.
Möglich sind eigene Bewerbungen ebenso wie Vorschläge für die Vergabe des ersten Archivpreises 2011 bis zum 31. Januar 2011 an den Thüringer Archivarverband, c/o Stadtarchiv Weimar, Kleine Teichgasse 6, 99423 Weimar, email: stadtarchiv@stadtweimar.de. Unter www.vda.lvthueringen.archiv.net kann ein entsprechendes
Vorschlagsformular abgerufen werden.
Die Auswahl erfolgt durch eine Fachjury. Bekannt gegeben wird der Preisträger auf dem Thüringischen Archivtag 2011. Die Preisverleihung soll im Rahmen einer Veranstaltung am Ort des Preisträgers stattfinden. Damit soll der besondere Stellenwert des ausgezeichneten Archivs gegenüber der Öffentlichkeit und dem Archivträger deutlich gemacht werden. Im Freistaat Thüringen existieren ca. 170 Archive unterschiedlicher Trägerschaft."
Quelle: Pressemitteilung der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen v. 10.06.2010
dienen, besondere Aufgaben der Archive zu realisieren und darf nicht zur Kürzung öffentlicher Zuschüsse führen.
Vergeben wird der Preis für kreative und innovative Projekte, den Neuaufbau, die Modernisierung oder auch Übernahme eines Archivs, herausragende wissenschaftliche Publikationen zum Archivwesen und zur Archivgeschichte Thüringens und sowie den Einsatz und die Weiterentwicklung neuer Technologien und Methoden in der Archivpraxis.
Die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen institutionalisiert damit ihr langfristiges Engagement im Bereich des Thüringer Archivwesens, das bis in die 1990er Jahre zurückreicht.
Möglich sind eigene Bewerbungen ebenso wie Vorschläge für die Vergabe des ersten Archivpreises 2011 bis zum 31. Januar 2011 an den Thüringer Archivarverband, c/o Stadtarchiv Weimar, Kleine Teichgasse 6, 99423 Weimar, email: stadtarchiv@stadtweimar.de. Unter www.vda.lvthueringen.archiv.net kann ein entsprechendes
Vorschlagsformular abgerufen werden.
Die Auswahl erfolgt durch eine Fachjury. Bekannt gegeben wird der Preisträger auf dem Thüringischen Archivtag 2011. Die Preisverleihung soll im Rahmen einer Veranstaltung am Ort des Preisträgers stattfinden. Damit soll der besondere Stellenwert des ausgezeichneten Archivs gegenüber der Öffentlichkeit und dem Archivträger deutlich gemacht werden. Im Freistaat Thüringen existieren ca. 170 Archive unterschiedlicher Trägerschaft."
Quelle: Pressemitteilung der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen v. 10.06.2010
Wolf Thomas - am Freitag, 18. Juni 2010, 09:54 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Dr. Jens Heckl, Wolfgang Stetter, Dr. Karsten Uhde, Dr. Bodo Uhl, Dr. Christian Keitel, Dr. Holger Berwinkel (v.l.n.r.). Foto: VdA
Der Arbeitskreis Aktenkunde des 20. und 21. Jahrhunderts im VdA ist am 14. Juni 2010 zu seiner 4. Sitzung in der VdA-Geschäftsstelle zusammen gekommen.
Zum Arbeitsprogramm gehörten u.a. die Weiterentwicklung des Terminologielexikons, ein erster Entwurf für die Gliederung des Schlusswerkes und Überlegungen zur weiteren Vorgehensweise.
Die nächste Sitzung wird am 17. November 2010 in der Geschäftsstelle statt finden.
Quelle: VdA, Aktuelles v. 14.06.2010
Wolf Thomas - am Freitag, 18. Juni 2010, 09:43 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Auf Einladung von VdA und BDS - Bundesverband deutscher Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V. trafen sich am 16. Juni 2010 Kolleginnen und Kollegen aus Archiven und Standesämtern im Tagungszentrum des ITZ in Fulda zu einem gemeinsamen Workshop zum Thema Die Personenstandsreform und ihre Auswirkungen - eine Standortbestimmung.
Nach den Begrüßungen durch den VdA-Vorsitzenden Dr. Michael Diefenbacher bzw. den Beauftragten des BDS für die Zusammenarbeit mit dem VdA Jürgen Rast folgten zwei einführende Vorträge zur Fachdiskussion am Nachmittag.
Dr. Robert Zink vom Stadtarchiv Bamberg präsentierte den Zuhörern einen Überblick über die archivischen Zuständigkeiten für die Personenstandsunterlagen in den einzelnen Bundesländern. Jürgen Rast und Frank Müsken gaben einen Einblick in "Grauzonen - Standesämter übernehmen die Archivfunktion".
Im Rahmen der dreistündigen Nachmittagssitzung wurden intensiv archivsparten- und länderübergreifende Fachkonzepte diskutiert:
Themenschwerpunkte waren u.a.:
* Bewertung von Sammelakten
* Nutzung von Personenstandsunterlagen
* Bestandserhaltung
* Übernahmen aus elektronischer Registerführung
Die Leitung und die Moderation der Fachdiskussion übernahm die stellvertretende VdA-Vorsitzende Katharina Tiemann aus Münster, welche die Veranstaltung auch inhaltlich konzipiert hat.
Am Workshop nahmen insgesamt über 40 Personen teil. Archivarische Fachvertreter aus 14 Bundesländern repräsentierten regionale Verbände und kommunale Arbeitsgemeinschaften. Die Teilnehmer des Workshops finden Sie in Teil 3.
Der VdA plant, einen ausführlichen Tagungsbericht sowie Fachkonzepte aus einzelnen Bundesländern auf seiner Homepage zu veröffentlichen.
Beide Verbände sprachen sich dafür aus, den Dialog zwischen StandesbeamtInnen und ArchivarInnen auch künftig fortzusetzen. Ein weiterer Workshop ist für 2011 vorgesehen.
Quelle: VdA, Aktuelles v. 17.06.2010
Nach den Begrüßungen durch den VdA-Vorsitzenden Dr. Michael Diefenbacher bzw. den Beauftragten des BDS für die Zusammenarbeit mit dem VdA Jürgen Rast folgten zwei einführende Vorträge zur Fachdiskussion am Nachmittag.
Dr. Robert Zink vom Stadtarchiv Bamberg präsentierte den Zuhörern einen Überblick über die archivischen Zuständigkeiten für die Personenstandsunterlagen in den einzelnen Bundesländern. Jürgen Rast und Frank Müsken gaben einen Einblick in "Grauzonen - Standesämter übernehmen die Archivfunktion".
Im Rahmen der dreistündigen Nachmittagssitzung wurden intensiv archivsparten- und länderübergreifende Fachkonzepte diskutiert:
Themenschwerpunkte waren u.a.:
* Bewertung von Sammelakten
* Nutzung von Personenstandsunterlagen
* Bestandserhaltung
* Übernahmen aus elektronischer Registerführung
Die Leitung und die Moderation der Fachdiskussion übernahm die stellvertretende VdA-Vorsitzende Katharina Tiemann aus Münster, welche die Veranstaltung auch inhaltlich konzipiert hat.
Am Workshop nahmen insgesamt über 40 Personen teil. Archivarische Fachvertreter aus 14 Bundesländern repräsentierten regionale Verbände und kommunale Arbeitsgemeinschaften. Die Teilnehmer des Workshops finden Sie in Teil 3.
Der VdA plant, einen ausführlichen Tagungsbericht sowie Fachkonzepte aus einzelnen Bundesländern auf seiner Homepage zu veröffentlichen.
Beide Verbände sprachen sich dafür aus, den Dialog zwischen StandesbeamtInnen und ArchivarInnen auch künftig fortzusetzen. Ein weiterer Workshop ist für 2011 vorgesehen.
Quelle: VdA, Aktuelles v. 17.06.2010
Wolf Thomas - am Freitag, 18. Juni 2010, 09:36 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Freitag, 18. Juni 2010, 09:33 - Rubrik: Personalia
"Dresdner Spuren" - Thomas Kübler (Direktor des Dresdner Stadtarchivs)
zeigt seine Lieblingsstücke. Dazu zählt die älteste erhaltene Urkunde Dresdens aus dem Jahr 1260. Er präsentiert eine Ablassbrief der Kreuzkirche aus dem Jahr 1319 und historische Stadtbücher, in denen 600 Jahre Dresdner Stadtgeschichte bewahrt ist. Thomas Kübler zeigt in diesem Beitrag abschließend eine Rarität, über die nur wenige Städte verfügen: Wachstafeln aus dem 15. Jahrhundert.
Die Edition "Die drei ältesten Stadtbücher Dresdens" (1404 - 1476) ist im Buchhandel erhältlich und kann im Stadtarchiv eingesehen werden.
Link zum Videobeitrag
""Dresdner Spuren" - Thomas Kübler (Direktor des Dresdner Stadtarchivs)
präsentiert einen besonderen Schatz seines Hauses: die originalen Pläne von George Bähr zum Bau der Frauenkirche. Thomas Kübler erläutert, welchen historischen Wert die Pläne darstellen; gleichzeitig sind sie von unschätzbarem praktischen Nutzen, denn der Wiederaufbau der Frauenkirche wäre ohne diese Pläne des Stadtarchives kaum möglich gewesen."
Link zum Videobeitrag
zeigt seine Lieblingsstücke. Dazu zählt die älteste erhaltene Urkunde Dresdens aus dem Jahr 1260. Er präsentiert eine Ablassbrief der Kreuzkirche aus dem Jahr 1319 und historische Stadtbücher, in denen 600 Jahre Dresdner Stadtgeschichte bewahrt ist. Thomas Kübler zeigt in diesem Beitrag abschließend eine Rarität, über die nur wenige Städte verfügen: Wachstafeln aus dem 15. Jahrhundert.
Die Edition "Die drei ältesten Stadtbücher Dresdens" (1404 - 1476) ist im Buchhandel erhältlich und kann im Stadtarchiv eingesehen werden.
Link zum Videobeitrag
""Dresdner Spuren" - Thomas Kübler (Direktor des Dresdner Stadtarchivs)
präsentiert einen besonderen Schatz seines Hauses: die originalen Pläne von George Bähr zum Bau der Frauenkirche. Thomas Kübler erläutert, welchen historischen Wert die Pläne darstellen; gleichzeitig sind sie von unschätzbarem praktischen Nutzen, denn der Wiederaufbau der Frauenkirche wäre ohne diese Pläne des Stadtarchives kaum möglich gewesen."
Link zum Videobeitrag
Wolf Thomas - am Freitag, 18. Juni 2010, 07:50 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Lokman, ein libanesischer Intellektueller, der in den 90er Jahren das Verlagshaus Dar al Jadeed gründete, und seine Frau Monika, eine freiberufliche deutsche Journalistin, lassen sich 2004 am südlichen Stadtrand von Beirut nieder. Sie beginnen mit Recherchen für einen Dokumentarfilm über Kriegsverbrecher, stellen jedoch fest, dass es kaum Archive über den Libanonkrieg gibt. Also sammeln sie zunächst einmal Unterlagen mit dem Ziel, einen Fundus an Archivmaterial zu aufzubauen. 2005 restaurieren sie eine alte Halle, die sie zum Kulturzentrum „The Hangar“ umfunktionieren. Hier finden Vorträge, Diskussionsrunden, Foto- und Kunstausstellungen sowie Filmvorführungen wider das Vergessen statt. Die Archive sind nunmehr der Öffentlichkeit zugänglich. „Metropolis“ spricht mit den Initiatoren und porträtiert diesen einmaligen Ort in Beirut, der Kunst und Geschichte unter einem Dach beherbergt. ...."
Quelle: arte.tv
s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=Libanon
Homepage "The Hangar"
Quelle: arte.tv
s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=Libanon
Homepage "The Hangar"
Wolf Thomas - am Freitag, 18. Juni 2010, 05:06 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Drei Beispiele zur Berichterstattung über die Bergungsarbeiten am Kölner Archivgut fielen mir u. a. bei der Durchsicht des Archivs der Mailingliste "Westfälische Geschichte" (2009/11, 2009/12) auf:
1) J. Winkel: Amtshilfe der besonderen Art. Kreis- und Stadtarchivar von Olpe eine Woche lang im Hilfseinsatz für das Historische Archiv der Stadt Köln, in: Südsauerland - Heimatstimmen aus dem Kreis Olpe, Heft 2/2009
2) D. Borghoff: Aus Trümmern werden Schätze. Paderborner Archivare leisteten Hilfestellung nach Einsturz des Kölner Stadtarchivs, in: Die Warte. Heimatzeitschrift für die Kreise Paderborn und Höxter. Heft 143/2009.
3) G. Brüning: Alles "Streng geheim!". Unser Beitrag zur Rettung des Kölner Archivs, in: Heimatjahrbuch Kreis Gütersloh 2010, Gütersloh 2009, S. 118-122
Falls es weitere Beispiele gibt, bitte als Kommentare posten. Danke!
1) J. Winkel: Amtshilfe der besonderen Art. Kreis- und Stadtarchivar von Olpe eine Woche lang im Hilfseinsatz für das Historische Archiv der Stadt Köln, in: Südsauerland - Heimatstimmen aus dem Kreis Olpe, Heft 2/2009
2) D. Borghoff: Aus Trümmern werden Schätze. Paderborner Archivare leisteten Hilfestellung nach Einsturz des Kölner Stadtarchivs, in: Die Warte. Heimatzeitschrift für die Kreise Paderborn und Höxter. Heft 143/2009.
3) G. Brüning: Alles "Streng geheim!". Unser Beitrag zur Rettung des Kölner Archivs, in: Heimatjahrbuch Kreis Gütersloh 2010, Gütersloh 2009, S. 118-122
Falls es weitere Beispiele gibt, bitte als Kommentare posten. Danke!
Wolf Thomas - am Freitag, 18. Juni 2010, 04:34 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Freitag, 18. Juni 2010, 04:10 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Rezensions-Portal ZBLG-ONLINE macht ausgewählte aktuelle Rezensionen
der Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte unmittelbar nach ihrer
Fertigstellung verfügbar, bevor sie in der gewohnten gedruckten Form
erscheinen.
http://www.zblg-online.de
Folgende neue Rezensionen sind über ZBLG-ONLINE verfügbar:
Johannes Burkhardt/Thomas Max Safley/Sabine Ullmann (Hg.), Geschichte
in Räumen. Festschrift für Rolf Kießling zum 65. Geburtstag, Konstanz
2006, UVK Verlagsgesellschaft, 378 Seiten.
Rezensiert von Enno Bünz
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_360.html
Christoph Nonn, Geschichte Nordrhein-Westfalens (Beck’sche Reihe 261),
München 2009, C.H. Beck, 128 Seiten, 2 Karten.
Rezensiert von Karl-Ulrich Gelberg
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1721.html
Martin Scheutz/Andrea Sommerlechner/Herwig Weigl/Alfred Stefan
Weiss (Hg.), Europäisches Spitalwesen. Institutionelle Fürsorge
in Mittelalter und Früher Neuzeit. Hospitals and Institutional
Care in Medieval and Early Modern Europe (Mitteilungen des
Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 51),
Wien/München 2008, Oldenbourg, 477 Seiten.
Rezensiert von Rudolf Neumaier
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1279.html
Gerhard Fouquet (Hg.), Die Reise eines niederadeligen Anonymus ins
Heilige Land im Jahre 1494 (Kieler Werkstücke, Reihe E: Beiträge zur
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 5), Frankfurt a. M. 2007, Peter Lang,
311 Seiten.
Rezensiert von Enno Bünz
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1251.html
Maria-Elisabeth Brunert (Bearb.), Acta Pacis Westphalicae, Serie III A:
Protokolle. Bd. 3: Die Beratungen des Fürstenrates in Osnabrück. Teilbd.
6: Juni–Juli 1648, Münster 2009, Aschendorff, XCIII, 573 Seiten.
Rezensiert von Andreea Badea
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1598.html
Karsten Harries, Die bayerische Rokokokirche. Das Irrationale und das
Sakrale, Dorfen 2009, Hawel-Verlag, 429 Seiten, zahlr. Abbildungen.
Rezensiert von Lothar Altmann
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1785.html
Helle Köpfe. Die Geschichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
1759–2009 (Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive Bayerns 51),
Regensburg 2009, Pustet, 299 Seiten, zahlr. Abbildungen.
Rezensiert von Karsten Jedlitschka
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1591.html
Marita Krauss, Die königlich bayerischen Hoflieferanten, München 2009,
Volk, 335 Seiten, zahlr. Abbildungen.
Rezensiert von Dirk Götschmann
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1509.html
Jörg H. Lampe, „Freyheit und Ordnung“. Die Januarereignisse von 1831
und der Durchbruch zum Verfassungsstaat im Königreich Hannover
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen
und Bremen 250), Hannover 2009, Hahnsche Buchhandlung, 838 Seiten.
Rezensiert von Hans-Christof Kraus
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1664.html
Elmar Schwinger, Von Kitzingen nach Izbica. Aufstieg und Katastrophe
der mainfränkischen Israelitischen Kultusgemeinde Kitzingen
(Schriften des Stadtarchivs Kitzingen 9), Kitzingen 2009, Dieter
Sauerbrey, 671 Seiten, zahlr. Abbildungen.
Rezensiert von Marcus Mühlnikel
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1543.html
Bernhard Taubenberger, Erich Kohlrausch 1899–1960. Ein deutsches
Leben, München 2010, Osterhofener Verlag, 272 Seiten, 40 Abbildungen.
Rezensiert von Christian Kuchler
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1836.html
Andreas Wirsching (Hg.), Das Jahr 1933. Die nationalsozialistische
Machteroberung und die deutsche Gesellschaft (Dachauer Symposien zur
Zeitgeschichte 9), Göttingen 2009, Wallstein, 284 Seiten.
Rezensiert von Winfried Becker
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1663.html
der Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte unmittelbar nach ihrer
Fertigstellung verfügbar, bevor sie in der gewohnten gedruckten Form
erscheinen.
http://www.zblg-online.de
Folgende neue Rezensionen sind über ZBLG-ONLINE verfügbar:
Johannes Burkhardt/Thomas Max Safley/Sabine Ullmann (Hg.), Geschichte
in Räumen. Festschrift für Rolf Kießling zum 65. Geburtstag, Konstanz
2006, UVK Verlagsgesellschaft, 378 Seiten.
Rezensiert von Enno Bünz
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_360.html
Christoph Nonn, Geschichte Nordrhein-Westfalens (Beck’sche Reihe 261),
München 2009, C.H. Beck, 128 Seiten, 2 Karten.
Rezensiert von Karl-Ulrich Gelberg
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1721.html
Martin Scheutz/Andrea Sommerlechner/Herwig Weigl/Alfred Stefan
Weiss (Hg.), Europäisches Spitalwesen. Institutionelle Fürsorge
in Mittelalter und Früher Neuzeit. Hospitals and Institutional
Care in Medieval and Early Modern Europe (Mitteilungen des
Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 51),
Wien/München 2008, Oldenbourg, 477 Seiten.
Rezensiert von Rudolf Neumaier
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1279.html
Gerhard Fouquet (Hg.), Die Reise eines niederadeligen Anonymus ins
Heilige Land im Jahre 1494 (Kieler Werkstücke, Reihe E: Beiträge zur
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 5), Frankfurt a. M. 2007, Peter Lang,
311 Seiten.
Rezensiert von Enno Bünz
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1251.html
Maria-Elisabeth Brunert (Bearb.), Acta Pacis Westphalicae, Serie III A:
Protokolle. Bd. 3: Die Beratungen des Fürstenrates in Osnabrück. Teilbd.
6: Juni–Juli 1648, Münster 2009, Aschendorff, XCIII, 573 Seiten.
Rezensiert von Andreea Badea
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1598.html
Karsten Harries, Die bayerische Rokokokirche. Das Irrationale und das
Sakrale, Dorfen 2009, Hawel-Verlag, 429 Seiten, zahlr. Abbildungen.
Rezensiert von Lothar Altmann
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1785.html
Helle Köpfe. Die Geschichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
1759–2009 (Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive Bayerns 51),
Regensburg 2009, Pustet, 299 Seiten, zahlr. Abbildungen.
Rezensiert von Karsten Jedlitschka
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1591.html
Marita Krauss, Die königlich bayerischen Hoflieferanten, München 2009,
Volk, 335 Seiten, zahlr. Abbildungen.
Rezensiert von Dirk Götschmann
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1509.html
Jörg H. Lampe, „Freyheit und Ordnung“. Die Januarereignisse von 1831
und der Durchbruch zum Verfassungsstaat im Königreich Hannover
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen
und Bremen 250), Hannover 2009, Hahnsche Buchhandlung, 838 Seiten.
Rezensiert von Hans-Christof Kraus
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1664.html
Elmar Schwinger, Von Kitzingen nach Izbica. Aufstieg und Katastrophe
der mainfränkischen Israelitischen Kultusgemeinde Kitzingen
(Schriften des Stadtarchivs Kitzingen 9), Kitzingen 2009, Dieter
Sauerbrey, 671 Seiten, zahlr. Abbildungen.
Rezensiert von Marcus Mühlnikel
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1543.html
Bernhard Taubenberger, Erich Kohlrausch 1899–1960. Ein deutsches
Leben, München 2010, Osterhofener Verlag, 272 Seiten, 40 Abbildungen.
Rezensiert von Christian Kuchler
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1836.html
Andreas Wirsching (Hg.), Das Jahr 1933. Die nationalsozialistische
Machteroberung und die deutsche Gesellschaft (Dachauer Symposien zur
Zeitgeschichte 9), Göttingen 2009, Wallstein, 284 Seiten.
Rezensiert von Winfried Becker
http://www.kbl.badw.de/zblg-online/rezension_1663.html
KlausGraf - am Freitag, 18. Juni 2010, 02:45 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zu diesem Thema gibt es neben meiner eigenen Linksammlung
http://delicious.com/Klausgraf/monograph_open_access
nun auch eine im Rahmen des OATP auf Connotea:
http://www.connotea.org/tag/oa.books.sales?num=100
http://delicious.com/Klausgraf/monograph_open_access
nun auch eine im Rahmen des OATP auf Connotea:
http://www.connotea.org/tag/oa.books.sales?num=100
KlausGraf - am Freitag, 18. Juni 2010, 00:45 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Im Heft 2010/2 von "Sauerland", S. 88f.
http://www.sauerlandmundart.de/
Mit Publikationsreihe im PDF-Format, aber leider mit dem unvermeidlichen Copyfraud. Ein für allemal: Ihr kleinen Homepagebastler, die ihr euch großtut mit eurer Leistung, ein paar alte Texte erfasst zu haben, nehmt gefälligst zur Kenntnis, dass euch weder moralisch noch rechtlich ein Recht daran zusteht, z.B. die kommerzielle Nutzung gemeinfreier Texte zu untersagen.
http://www.sauerlandmundart.de/
Mit Publikationsreihe im PDF-Format, aber leider mit dem unvermeidlichen Copyfraud. Ein für allemal: Ihr kleinen Homepagebastler, die ihr euch großtut mit eurer Leistung, ein paar alte Texte erfasst zu haben, nehmt gefälligst zur Kenntnis, dass euch weder moralisch noch rechtlich ein Recht daran zusteht, z.B. die kommerzielle Nutzung gemeinfreier Texte zu untersagen.
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 22:22 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Nach einem NRZ-Bericht vom 29. Mai sind nunmehr das Rechtsamt und das Dezernat Stadtentwicklung derzeit um „eine juristische Bewertung“ der in dem Bericht vorgetragenen Fakten und Details bemüht. Besonders ein bei der Staatsanwaltschaft eingereichter Strafantrag auf Einleitung eines Ermittlungsverfahrens hat die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung hellhörig werden lassen.
Formal geht es in diesem Strafantrag gegen Unbekannt um den Verdacht des Betruges zum Nachteil des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt Duisburg. Konkret geht es darum: Die Projektkosten des am Innenhafen im Bau befindlichen neuen Landesarchivs von Nordrhein-Westfalen sollen sich durch eine Indiskretion im Januar 2007 um mindestens 10 Millionen Euro verteuert haben.
Strategischen Vorteil aus dieser Indiskretion soll der Essener Projektentwickler Kölbl und Kruse gezogen haben. Hierdurch sei es dem Unternehmen möglich gemacht worden, ein Grundstück am Innenhafen samt denkmalgeschütztem Speicher dem Land vor der Nase weg zu kaufen. Später hätten diese Unternehmer dem Land das Objekt zu einem Vielfachen des Einkaufspreises weiterverkauft. Der mutmaßliche Schaden für den Steuerzahler: Zwischen 10 und 20 Millionen Euro.
Bei der Stadt ist man derzeit irritiert darüber, über die NRZ zu erfahren, dass eine bestehende Selbstverpflichtung der Essener Projektentwickler gegenüber der Stadt, den Speicher am Duisburger Innenhafen nur für den „Einkaufspreis“ von 3,9 Millionen Euro an das Land zwecks Errichtung des geplanten Landesarchiv weiterzuverkaufen, offenbar missachtet worden ist. Die Stadt habe dann im weiteren Verlauf und im Gegenzug für den Verzicht auf einen Spekulationsgewinn ihrerseits auf ein bestehendes Vorkaufsrecht für diese Immobilie verzichtet.
Wie berichtet, hatten die Bau- und Liegenschaftsbetriebe des Landes NRW dem Essener Unternehmen den Speicher für einen Kaufpreis von 21,6 Mio. Euro abgekauft. Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft, ob ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eröffnet werden muss. "
Quelle: derwesten.de, 9.6.2010
Formal geht es in diesem Strafantrag gegen Unbekannt um den Verdacht des Betruges zum Nachteil des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt Duisburg. Konkret geht es darum: Die Projektkosten des am Innenhafen im Bau befindlichen neuen Landesarchivs von Nordrhein-Westfalen sollen sich durch eine Indiskretion im Januar 2007 um mindestens 10 Millionen Euro verteuert haben.
Strategischen Vorteil aus dieser Indiskretion soll der Essener Projektentwickler Kölbl und Kruse gezogen haben. Hierdurch sei es dem Unternehmen möglich gemacht worden, ein Grundstück am Innenhafen samt denkmalgeschütztem Speicher dem Land vor der Nase weg zu kaufen. Später hätten diese Unternehmer dem Land das Objekt zu einem Vielfachen des Einkaufspreises weiterverkauft. Der mutmaßliche Schaden für den Steuerzahler: Zwischen 10 und 20 Millionen Euro.
Bei der Stadt ist man derzeit irritiert darüber, über die NRZ zu erfahren, dass eine bestehende Selbstverpflichtung der Essener Projektentwickler gegenüber der Stadt, den Speicher am Duisburger Innenhafen nur für den „Einkaufspreis“ von 3,9 Millionen Euro an das Land zwecks Errichtung des geplanten Landesarchiv weiterzuverkaufen, offenbar missachtet worden ist. Die Stadt habe dann im weiteren Verlauf und im Gegenzug für den Verzicht auf einen Spekulationsgewinn ihrerseits auf ein bestehendes Vorkaufsrecht für diese Immobilie verzichtet.
Wie berichtet, hatten die Bau- und Liegenschaftsbetriebe des Landes NRW dem Essener Unternehmen den Speicher für einen Kaufpreis von 21,6 Mio. Euro abgekauft. Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft, ob ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eröffnet werden muss. "
Quelle: derwesten.de, 9.6.2010
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 22:16 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Kasseler Stadtarchiv dümpelt seit Monaten führungslos vor sich hin. Schon wieder ist ein Kandidat für die Leitung abgesprungen. Zwei Mitarbeiterinnen halten den Betrieb so gut es geht aufrecht. Seit Frank-Roland Klaube Ende 2008 in den Ruhestand verabschiedet wurde, ist die Personalpolitik von Pleiten und Pech gekennzeichnet.
Klaube leitete das Archiv, das auch als Gedächtnis der Stadt bezeichnet wird, vier Jahrzehnte lang. Seine Nachfolgerin, Dr. Sigrid Schieber, blieb nur elf Monate. Dann wechselte sie ins Hessische Hauptstaatsarchiv nach Wiesbaden. Sie gab damals private Gründe an. Ihr Ehemann arbeitet in Frankfurt. Bis zum Frühjahr 2010 sollte die Nachfolge im Stadtarchiv geregelt sein. Doch daraus wurde nichts.
Die Stadt fand zwar einen geeigneten Bewerber, doch der sagte kurz vor Toresschluss ab. Alles nur Pech oder ist die Stelle nicht attraktiv genug? „Daran kann es nicht liegen, dafür hatten wir zu viele Bewerber“, sagt Dorothée Rhiemeier, die Leiterin des Kulturamtes. Sowohl bei Sigrid Schieber als auch bei dem nächsten Wunschkandidaten habe es sich um hoch qualifizierte Fachleute gehandelt. Das Risiko, dass die auch für andere Institutionen interessant seien, könne man nie ausschließen. Im jüngsten Fall sei der Arbeitsvertrag zum 1. Juli schon unterschrieben gewesen. Dann habe es doch noch kurzfristig eine Absage gegeben.
Anzeigen im Internet
Jetzt geht die Hängepartie also weiter. Um den Bewerbungsprozess zu beschleunigen, habe man Anzeigen auf zwei Internetportalen geschaltet, die auf das Archivwesen spezialisiert sind. Die Hoffnung: Bis zum Herbst soll eine geeignete Leitung gefunden werden.
Zu tun gäbe es genug. Bei den Vorbereitungen für die 1100-Jahr-Feier Kassels zum Beispiel. Auch beim Henschel-Sommer ab Ende Juni wäre das Archiv eigentlich ein Ansprechpartner für die 200-jährige Firmengeschichte. Die Digitalisierung des Bestandes sowie neuer Akten ist längst überfällig. Täglich gibt es Anfragen. Mal geht es um Ahnenforschung, dann hat jemand ein altes Foto entdeckt und will wissen, wo es aufgenommen wurde. In schwierigen Fällen springt Pensionär Frank-Roland Klaube noch einmal ein. Er ist dienstags und donnerstags jeweils drei Stunden am Vormittag ansprechbar. ..."
Quelle: hna.de, 9.6.2010
Klaube leitete das Archiv, das auch als Gedächtnis der Stadt bezeichnet wird, vier Jahrzehnte lang. Seine Nachfolgerin, Dr. Sigrid Schieber, blieb nur elf Monate. Dann wechselte sie ins Hessische Hauptstaatsarchiv nach Wiesbaden. Sie gab damals private Gründe an. Ihr Ehemann arbeitet in Frankfurt. Bis zum Frühjahr 2010 sollte die Nachfolge im Stadtarchiv geregelt sein. Doch daraus wurde nichts.
Die Stadt fand zwar einen geeigneten Bewerber, doch der sagte kurz vor Toresschluss ab. Alles nur Pech oder ist die Stelle nicht attraktiv genug? „Daran kann es nicht liegen, dafür hatten wir zu viele Bewerber“, sagt Dorothée Rhiemeier, die Leiterin des Kulturamtes. Sowohl bei Sigrid Schieber als auch bei dem nächsten Wunschkandidaten habe es sich um hoch qualifizierte Fachleute gehandelt. Das Risiko, dass die auch für andere Institutionen interessant seien, könne man nie ausschließen. Im jüngsten Fall sei der Arbeitsvertrag zum 1. Juli schon unterschrieben gewesen. Dann habe es doch noch kurzfristig eine Absage gegeben.
Anzeigen im Internet
Jetzt geht die Hängepartie also weiter. Um den Bewerbungsprozess zu beschleunigen, habe man Anzeigen auf zwei Internetportalen geschaltet, die auf das Archivwesen spezialisiert sind. Die Hoffnung: Bis zum Herbst soll eine geeignete Leitung gefunden werden.
Zu tun gäbe es genug. Bei den Vorbereitungen für die 1100-Jahr-Feier Kassels zum Beispiel. Auch beim Henschel-Sommer ab Ende Juni wäre das Archiv eigentlich ein Ansprechpartner für die 200-jährige Firmengeschichte. Die Digitalisierung des Bestandes sowie neuer Akten ist längst überfällig. Täglich gibt es Anfragen. Mal geht es um Ahnenforschung, dann hat jemand ein altes Foto entdeckt und will wissen, wo es aufgenommen wurde. In schwierigen Fällen springt Pensionär Frank-Roland Klaube noch einmal ein. Er ist dienstags und donnerstags jeweils drei Stunden am Vormittag ansprechbar. ..."
Quelle: hna.de, 9.6.2010
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 22:13 - Rubrik: Kommunalarchive
An introduction to the DIAMA/IsumaTV and the Inuit Culture Education was made to the principal and teachers of Ataguttaaluk Elementary School and High School in Igloolik. Two classes at the Elementary school and two classes of the High School had the chance to use the Inuit Culture Education website.
Link
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 22:09 - Rubrik: Archivpaedagogik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Human societies have created records for more than four millennia. The shape and form of records and archives, methods for creating them and approaches to keeping and using them have always been determined by currently available technologies, and are inevitably affected by changes in technology over time.
Yet, while technological change has often brought innovation in the creation and management of records and archives and facilitated new ways of using them, it has also given rise to challenges for those seeking to preserve and maintain access to records; challenges that are particularly acute in our own era as a result of the digital revolution.
I-CHORA 5, organised by The National Archives of England, Wales and the United Kingdom, the Liverpool University Centre for Archive Studies and the Department of Information Studies at University College London, will address the subject of 'Records, archives and technology: interdependence over time'. The conference will explore this subject from a historical perspective, but will interpret it as broadly as possible.
It will consider the evolving interrelationships between records, archives and any technology, not just the digital technology of our own time; and will embrace any kind of interdependence, including the role, challenges or opportunities of technology in creating, maintaining or using records. It will provide an opportunity to examine these topics from the standpoint of different disciplines, including philosophy, sociology, anthropology, archaeology, history, archival science, computer science, law and literary and cultural studies.
The conference will build on the success of the previous I-CHORA
conferences in Toronto (2003), Amsterdam (2005), Boston (2007) and Perth (2008). It will be held in London from Thursday 1 to Saturday 3 July 2010, immediately before the FARMER-NAET conference in Oxford.
Thursday 1 July 2010
10.45 am – 1.00 pm
Welcome: Professor Colin Jones, President of the Royal Historical Society
Keynote paper: Tying the Archive in Knots: recordkeeping in ancient Peru – Gary Urton (Department of Anthropology, Harvard University)
• A Historical Review of the Telegraph’s Impacts on Communication and Recordkeeping in Colonial Administration: the case of Britain and Hong Kong - Yui-tat Cheng (Chinese University of Hong Kong)
• Plus Ca Change … the salutary tale of the telephone and its implications for archival thinking about the digital revolution – Valerie Johnson (The National Archives)
1.00 pm – 2.00 pm Lunch
2.00 pm – 3.30 pm
• Medieval Commonplace Books: rhetorical devices, information technologies or merely sites of storage – Bethany Sinclair (Public Record Office of Northern Ireland)
• The Private Political Archives of the Venetian Patriciate: storing, retrieving and record keeping in the fifteenth to eighteenth centuries – Dorit Raines (Universita Ca’ Foscari, Venice)
• Maps as Recordkeeping Technology – Andrew Janes (The National Archives)
3.30 pm – 4.00 pm Tea
4.00 pm – 5.30 pm
• Narratives of Technology and Bureaucracy: contemporary images of office environments 1870-1940 – Barbara Craig and Heather MacNeil (University of Toronto)
• The Role of Furniture as a Personal Record Keeping Technology in the Late 19th Century – Heather Dean and Jennifer Meehan (Yale University)
• The Archives Reading Room: past, present and future – Sigrid McCausland (Charles Sturt University, Australia)
Friday 2 July 2010
9.00 am – 10.45 am
Keynote paper: Documents in Practice: supporting collaboration with material artefacts – Paul Luff and Christian Heath (Kings College, University of London)
• Making and Keeping: the function of psychiatric records between hospital administration and scientific knowledge – Volker Hess and Sophie Ledebur (Institute for the History of Medicine at the Charite Berlin)
Abstract:
The presentation focuses on how hospital records were invented in relation to the development of bureaucratic techniques. Such techniques, diffused from the writing desk of the hospital administration into the wards, and from there into the daily practice of the attending physicians. We will enfold this argument with a case study presenting the development of the hospital records at the Charité in Berlin, the largest hospital in Prussia in the eighteenth and nineteenth century.
First we will follow the administrative techniques using forms and schemata for regulation of the hospital infrastructure (treating fees, food and diet, admission and discharge etc) from the early 18th century up to early 20th century. Second, we will elaborate on the interrelation between these administrative techniques and the development of patient record keeping. Following the development of the record schemes we will present the first forms from the early 19th century and focus then on the psychiatric records archived subsequently into the 1880s allowing us to gain a detailed perspective on the development of the files. A special aspect will be the fact that all medical records at the Charité existed in duplicate up to the First World War. The original – the archived version – stayed at the ward, and a copy was kept by the registration office. Third, we will look at the impact resulting from the schematizing of the patient history, as well as at the information used for treatment, teaching and knowledge production. All three points will help to understand the crucial function of hospital records as technology in administration and in knowledge.
• Management and Technology of Recordkeeping in the Archives of the GDR State Security Service () – Karsten Jedlitschka and Ralf Blum (Die Bundesbeauftragte fur die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR)
Abstract:
The Office of the Federal Commissioner (Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, BStU) preserves the records of the former State Security Service of the German Democratic Republic (Ministerium für Staatssicherheit, MfS) and makes them available for various purposes. Its headquarters are in Berlin and it has branch offices with their own archives in the former capitals of the districts of the GDR.
The heart of the office are the archives with the Stasi legacy. They reveal the methods of the regime of the former Communist party and mirror the power and the knowledge of its secret police.
It is one of the largest archives in Germany with a total of more than 100 km of records. In addition to the written legacy, the MfS documents also include numerous audio-visual data media, such as photos, slides, videos, films and sound recordings.
On the one hand, the Stasi legacy consists of files already archived at the time of the MfS and on the other hand those materials, which the service units were working on up to the peaceful revolution of 1989/90.
In the four decades of existence the MfS archive division developed a sophisticated system to manage and store its records. The permanent growth of tasks and bureaucracy generated a steady urgency for further improvement of this system. The core of the Stasi archives administration was the card indexes. To make them more efficient, the archive division started in the 1960s to introduce new technical devices. Great hope was put on the new electronic data processing, starting in the 1970s.
10.45 am – 11.15 am Coffee
11.15 am – 12.45 pm
• Responding to Change through Technology: a case study from the National Monuments Record showing how technological innovation has changed the nature of the record itself – Martin Newman (English Heritage National Monuments Record)
• History and Continuity: the UK Government’s response to the challenges of the World Wide Web – Amanda Spencer (The National Archives)
• Making Sense of the Modern Email Archive: recordkeeping strategies and technological challenges – Jason R. Baron (US National Archives and Records Administration) and Simon J. Attfield (University College London Interaction Centre)
1.30 pm – 3.00 pm
• A Flip Side of Technological Advancement: the negative impact of technology on the preservation of the history of Queen’s University – Deirdre Bryden (Queen’s University Kingston)
• Machine Methods and the Development of the Student Information System: Two Canadian Universities, 1959-1965 – Tom Belton (University of Western Ontario) and Jim Suderman (City of Toronto)
• ‘These are My Records.’ The effect of technology on the changing relationship of the creator with institutional records – Heather Briston (University of Oregon)
3.00 pm – 3.30 pm Tea / Walk to the British Library
3.30 pm – 5.00 pm Talks at the British Library
7.00 pm - Drinks reception and conference dinner, UCL
Afternoon venue B: The National Archives (places limited to 47)
12.45 pm Travel to The National Archives by coach
1.30 pm – 2.15 pm Lunch at The National Archives
2.15 pm Welcome: Oliver Morley, Acting Chief Executive of The National Archives
2.25 pm – 3.55 pm
• Dismantling Bureaucracies and Technological Change: impacts on recordkeeping and the influence of organizational culture – Gillian C. Oliver (Victoria University of Wellington, New Zealand) and Kurmo Konsa (University of Tartu, Estonia)
• Introduction of Electronic Registration in Danish Central Government Administration – Else Hansen (Danish National Archives)
• Drivers and Cars (1898-2009): traffic records management in Spain over time and procedures automation. Archival implications and consequences – Rosana de Andrés Diaz and Luis Casado de Otaola (Ministerio del Interior, Spain)
Saturday 3 July 2010
9.00 am –10.45 am
Keynote paper: Mapping the Terrain of the File: machines, methods, and notions of modernity in the British Civil Service, 1890-1956 (abstract) – Barbara Craig (University of Toronto)
• Printing the Archives: Oxford Archives c.1850-1950 (abstract) – Michael Riordan (St John’s and The Queen’s Colleges, Oxford)
• Towards a History of Recording Technologies: the damp-press copying process (abstract) – Michael Cook (Centre for Archive Studies, University of Liverpool)
10.45 am – 11.15 am Coffee
11.15 am – 12.25 pm
• Persistent Identifiers, the Docquet System and a Tudor Revolution in Government – James Currall and Michael Moss (HATII, University of Glasgow)
• Reflections on the Contributions of Historical Ideas about Metadata to Recordkeeping in a Global, Digital World – Anne Gilliland (Department of Information Studies, UCLA)
12.25 pm Summing up and close"
More Information
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 21:53 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 21:48 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Link zur PDF der gleichlautenden Präsentation
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 21:31 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen



"A great campaign by Museum of London using Augmented Reality. And a great interaction between mobile marketing and out of home communication.
“The app leads you to various locations around London using either the map or GPS. Once you’re there, click the “3D View” button, and the app will recognize the location and overlay the historical photograph over the live video feed of the real world, giving you a brief glimpse into how the past looked.”...."
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 21:27 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"June 2-July 2, 2010 /
Opening remarks:
István Rév, Director, OSA Archivum
John Shattuck, President and Rector, Central European University
Csaba Szilágyi, Curator, OSA Archivum
OSA Archivum / http://www.osaarchivum.org
Arany János u. 32.
H-1051 Budapest
Hungary
"In a criminal investigation it is the forensic stuff that tells the story so compellingly... the science in it is frankly quite spectacular." (Louise Arbour, former Chief Prosecutor, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia)
In the period of July 11-18, 1995, the Bosnian Serb Army massacred over 7,000 Muslim men and boys in and around the small Eastern Bosnian town of Srebrenica, a "safe area" under UN protection. The bodies were first dumped into mass graves; these were later reopened and the commingled remains reburied in secondary mass graves to make their identification more difficult. During the nearly 15 years of investigation, however, more than six thousand victims from 80 mass graves have been identified. The massacre was condemned as genocide by the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) in a precedent trial, but many still refuse to recognize it as such despite the collected evidence.
The true scale, the military architecture, and the predetermined and careful organization of the genocide are best revealed in the documents which have been produced as the result of an enormous amount of meticulous investigative work. The map of war crimes created with the help of these "exhibits" provides compelling evidence as to the identity of the perpetrators and serves as a basis for their indictment. A clinically precise yet somewhat detached analysis of documents and data, however, reveals that it is as important for the victims, who, stripped of their identities, were shot down, blindfolded, hands tied behind their backs, into unmarked mass graves, and then were given only identification codes and numbers in the various exhumation records, to regain their identities and have a proper burial and final rest.
OSA's reconstruction builds primarily on records collected during forensic investigations, exhumations of mass graves and the identification of human remains. Military maps, site sketches and photos, aerial images produced by spy satellites, forensic reports, testimonies by survivors and excerpts from films will be presented partly in traditional forms and partly in computer installations in a reconstructed model of a mass grave, created with the tools of land art. In the gallery's two aisles adjacent to the main installation, additional archival sources describing the wider context of the story will be available: documents, books and audiovisual materials from OSA's extensive relevant collections will be displayed for consultation in the research room, and documentaries will be screened in the movie hall. Thus, visitors who wish to continue the exhumation by doing their own archival research become part of the exhibition themselves.
Our cooperating partners in this exhibition are one-time investigators, forensic anthropologists, journalists and photographers, as well as the Sense News Agency in The Hague, the International Commission on Missing Persons and the Missing Persons Institute in Sarajevo.
Warning! The documents on display are of a disturbing nature: the exhibition is recommended only for persons above the age of 16.
Download your own invitation
http://www.osaarchivum.org/images/sto...
Srebrenica exhumation -- Film program
http://www.osaarchivum.org/images/sto...
The film program features documentaries about the massacres, the criminal investigations, as well as the mass grave exhumations and identification procedures in the region. Court recordings, interviews with victims, investigators and perpetrators, as well as rare amateur footage provide perspective on the events, their orchestrators, and repercussions."
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 21:23 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"The Kuratorium Unteilbares Deutschland (or KUD) was a West German organization that campaigned for reunification of Germany during the existence of the East German socialist state. This collection of photographs documents the activities of the KUD and features images of the construction of the Berlin Wall and the response of West German citizens, including campaigns, memorials, and exhibitions; it nicely compliments our East German Poster collection. The work of the KUD focused particularly on Berlin because the organization wanted the West German capital to move from Bonn to Berlin in order to more directly confront the Soviet sphere of influence. The KUD’s influence diminished with the advent of Willy Brandt’s Ostpolitik in which the two-state status quo was accepted as a fact and basis for a policy of détente in the late 1960s. In 1991 the KUD ceased to exist."
Link
More Information about the collection
Link
More Information about the collection
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 21:14 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Präsentation des Bundesarchivs zum Thema "Korea in der deutschen Geschichte 1945-1990"
"Vom 01. bis 06. Juni 2010 fand in Seoul, Korea, die "International Archival Culture Exhibition 2010" (IACE 2010) statt. Auch das Bundesarchiv wurde dort vorgestellt und zeigte eine kleine Präsentation zum Thema „Korea in der deutschen Geschichte 1945-1990“ mit Fotos und Dokumenten aus seinen Beständen. In einem eigenen Ausstellungsteil zum UNESCO-Weltkulturerbe rundeten der Film „Metropolis“, die Gutenbergbibel aus der Staatsbibliothek zu Berlin und die Installation der Bayerischen Staatsbibliothek München zum berüh-rungsfreien Blättern in digitalen Büchern das Bild von Deutschland ab. Es gab daneben mehrere Stände an denen Kinder Holzschnitte drucken oder Papier aus der Rinde vom Maulbeerbaum herstellen konnten. Zusätzlich wurde eine kommerzielle Ausstellung veranstaltet, in der auch deutsche Firmen vertreten waren. Der große Andrang, vor allem von jungen Leuten und ganzen Familien war beeindruckend.
Auf der begleitenden, zweitätigen Konferenz unter dem Motto „Documentary Heritage, Archives and Technology“, zu der etwa 500 Teilnehmer, vorwiegend aus den asiatischen Ländern, dazu Mitglieder des geschäfts-führenden Ausschusses des ICA sowie von ESTICA angereist waren, sprach Frau Vizepräsidentin Prof. Dr. Angelika Menne-Haritz über den derzeitigen Stand und die strategischen Ziele des Bundesarchiv. Auf besonderes Interesse der koreanischen Teilnehmer stießen Erfahrungen mit der deutschen Einigung. Außerdem traf die Vizepräsidentin mit Studenten der Archivwissenschaft an der Hankuk Universität für ausländische Studien zusammen, die sie um einen Vortrag über archivische Bewertung gebeten hatten. "
Quelle: Bundesarchiv, Pressemeldung
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 21:10 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Außerdem schauen wir nach Köln - Im März 2009 war dort das Stadtarchiv eingestürzt. Das Unglück kostete zwei Menschen das Leben, unzählige wertvolle Dokumente wurden verschüttet. Und bis heute ist nicht alles geborgen, weil die Grabungsarbeiten lange unterbrochen waren. Wir berichten über die aktuelle Situation. ...."
Quelle: Deutsche Welle, Kultur 16.6.2010
mp3-Download der gesamten Sendung
Quelle: Deutsche Welle, Kultur 16.6.2010
mp3-Download der gesamten Sendung
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 21:04 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 (Click to enlarge!)
(Click to enlarge!)We here at Prologue’s Pieces of History understand that history can be a very solemn study. Understanding past conflicts and pouring over the details of a battle, while exhilarating, can also be a trying, somber process.
But for all the wars and historic events that are cataloged in the National Archives, one thing is true: they often result in really funny photos, especially when pulled out of context.
And that’s why we want all you hard-working researchers and history aficionados to take a quick break and exercise your funny bone. We’ve compiled a growing number of awkward, strange, silly, and downright weird still images from our collection, and we’d like you to come up with funny captions for them.
Post your captions in the comment box below, and then our expert panel of judges (with occasional special guest judges) will announce who won the contest when we post a new photo next Thursday. Every winner will get 30% off a one-time purchase from the National Archives e-Store, too.
UPDATE: Our first guest judge is the Archivist, David S. Ferriero!
Link
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 20:59 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 20:14 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://etat.geneve.ch/dt/actualites.rss?sId=WA40
Habe ich eine deutschsprachige Seite bislang übersehen? Ich kenne keine. Die Genfer Seite ist ja französisch.
Habe ich eine deutschsprachige Seite bislang übersehen? Ich kenne keine. Die Genfer Seite ist ja französisch.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" Das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv (BBWA) übernimmt vom Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena das Forschungsarchiv Flick. Es ist aus dem Forschungsprojekt „Flick im 20. Jahrhundert“ hervorgegangen, das von Dagmar Ottmann, einer Enkelin von Friedrich Flick, ermöglicht und von Prof. Dr. Norbert Frei mit einem Team von Mitarbeitern bearbeitet wurde. Der Jenaer Historiker stellt diese einzigartige Sammlung zur Wirtschafts- und Zeitgeschichte dem BBWA zur Verfügung, weil Berlin bis 1945 Sitz der Flick-Konzernzentrale war. Das Archiv bildete die Grundlage für das im vergangenen Jahr erschienene Buch von Norbert Frei/Ralf Ahrens/Jörg Osterloh/Tim Schanetzky „Flick. Der Konzern, die Familie, die Macht“ und die zweiteilige Fernsehdokumentation „Flick“, die kürzlich von arte und der ARD ausgestrahlt worden ist.
Der „Mythos Flick“
Friedrich Flick (1883-1972) verkörpert das Drama der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Die Karriere des ebenso genialen wie skrupellosen Unternehmers war immer „tief verwoben mit der großen Politik“, so Frei – während des Ersten Weltkrieges, in der Weimarer Republik, in den Jahren des Nationalsozialismus und auch in der Bundesrepublik. Spätestens mit der Verurteilung im Nürnberger Flick-Prozess entstand ein unheilvoller Mythos. Schon früh galt Flick etwa der DDR-Propaganda als wichtigster „Exponent eines verhassten Kapitalismus“ (Frei). In der Bundesrepublik noch in den sechziger Jahren als genialer Unternehmer verehrt, kehrte sich das Bild von Flick dort endgültig ins Negative, als in den achtziger Jahren die Details des Parteispendenskandals die Öffentlichkeit erregten.
Ereignisse…
In den Unterlagen des Flick-Archivs spiegeln sich fast alle zentralen Ereignisse und Entwicklungen von wirtschaftspolitischer Bedeutung. Es umfasst die Zeit von 1916 bis 2005 und reicht damit bis in die jüngste Vergangenheit, als über die Friedrich-Christian Flick Collection und die Entschädigung von Zwangsarbeitern debattiert wurde. Stichworte genügen, um das thematische Spektrum der Dokumente zu ermessen: Hyperinflation, Weltwirtschaftskrise, „Polonisierung“ Ostoberschlesiens, Freundeskreis des Reichsführers SS Heinrich Himmler, Rüstungsgespräche, Rohstoffersatzwirtschaft, „Arisierung“, Zwangsarbeit, Nürnberger Prozess, Entflechtung der Schwerindustrie, Daimler-Verkauf, Spendenskandal.
…und Personen
Die Namen, die in den Akten auftauchen, lesen sich wie ein Who’s who deutscher Unternehmer und Politiker. Von Konrad Adenauer über Eberhard von Brauchitsch, Odilo Burkart, Ernst Buskühl, Thomas Dehler, Hermann Dietrich, Hermann Göring, Otto Andreas Friedrich, Konrad Kaletsch, Wilhelm Keppler, Rudolf Münemann, Paul Pleiger, Wolfgang Pohle, Familie Quandt, Hermann Röchling, Walter Scheel, Hanns Martin Schleyer, Willy Schlieker, Paul Silverberg, Otto Steinbrinck, Franz Josef Strauß, Robert Tillmanns bis Albert Vögler.
Das Forschungsarchiv Flick mit Foto-Album vom Nürnberger Prozess
Das Archiv umfasst ca. 100 laufende Meter, darunter
- Originalakten und Kopien aus der Registratur der Maxhütte im oberpfälzischen Sulzbach-Rosenberg, Unterlagen von Privatpersonen aus dem Unternehmen Flick sowie der Familie, darunter private Fotoalben aus der Flick KG nach 1945 aus dem Nachlass einer Sekretärin;
- Fremdarchivalien aus über 60 Archiven in Kopien bzw. mit Standortverweisen der Originalquellen;
- die Benjamin B. Ferencz Collection zu den Nürnberger Prozessen, Wiedergutmachungsverhandlungen und Zwangsarbeiterklagen mit Mikrofiches der Originale aus dem United States Holocaust Memorial Museum in Washington/D.C.;
- Unterlagen des Industriefinanzierers Rudolf Münemann;
- Rollfilme der Dokumente und Protokolle des Nürnberger Flick-Prozesses sowie Verfilmungen der ursprünglich von den USA beschlagnahmten Akten.
Von besonderem dokumentarischem Wert ist das Nürnberger Fotoalbum, von dem es insgesamt nur drei Exemplare gibt. Es wurde von Odilo Burkart, dem Chef der Maxhütte, angelegt und dokumentiert den Flick-Prozess aus Sicht der Angeklagten. Die kurzen Kommentare zu jedem Foto verdeutlichen, dass sich Flick und seine Mitarbeiter als Opfer der Siegerjustiz verstanden und sich zum Beispiel für den Zwangsarbeitereinsatz nicht verantwortlich oder schuldig fühlten. Das Fotoalbum war eine wichtige Quelle für die Flick-Fernsehdokumentation.
Die Bedeutung des Forschungsarchivs Flick im BBWA
Das Forschungsarchiv Flick im Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv macht Unterlagen des Unternehmers Friedrich Flick und seines Konzerns an einem Ort zugänglich, die aus weltweit über 60 Archive stammen. Es steht ab sofort für die wirtschafts- und zeithistorische Forschung offen.
Kontakt:
Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte
Historisches Institut der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fürstengraben 13, 07743 Jena
Tel.: 03641 / 944450
E-Mail: Sekretariat.Frei[at]uni-jena.de
Herr Berghausen
Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e. V.
Eichborndamm 167, Haus 42
13403 Berlin
Tel.: 0174 331 79 77
E-Mail mail[at]bb-wa.de
Fotos zum Download: http://www.bb-wa.de
Weitere Informationen:
http://www.bb-wa.de
http://www.uni-jena.de
http://www.nng.uni-jena.de/Forschungsprojekte/Flick+im+20_+Jahrhundert.html
http://www.randomhouse.de/book/edition.jsp?edi=283139
http://www.daserste.de/doku/allroundbeitrag_dyn~uid,03s9xmnrn7zo3cdc~cm.asp"
Quelle: IDW 17.06.2010, 17.06.2010
Zum Flick-Archiv s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/5049289/
Der „Mythos Flick“
Friedrich Flick (1883-1972) verkörpert das Drama der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Die Karriere des ebenso genialen wie skrupellosen Unternehmers war immer „tief verwoben mit der großen Politik“, so Frei – während des Ersten Weltkrieges, in der Weimarer Republik, in den Jahren des Nationalsozialismus und auch in der Bundesrepublik. Spätestens mit der Verurteilung im Nürnberger Flick-Prozess entstand ein unheilvoller Mythos. Schon früh galt Flick etwa der DDR-Propaganda als wichtigster „Exponent eines verhassten Kapitalismus“ (Frei). In der Bundesrepublik noch in den sechziger Jahren als genialer Unternehmer verehrt, kehrte sich das Bild von Flick dort endgültig ins Negative, als in den achtziger Jahren die Details des Parteispendenskandals die Öffentlichkeit erregten.
Ereignisse…
In den Unterlagen des Flick-Archivs spiegeln sich fast alle zentralen Ereignisse und Entwicklungen von wirtschaftspolitischer Bedeutung. Es umfasst die Zeit von 1916 bis 2005 und reicht damit bis in die jüngste Vergangenheit, als über die Friedrich-Christian Flick Collection und die Entschädigung von Zwangsarbeitern debattiert wurde. Stichworte genügen, um das thematische Spektrum der Dokumente zu ermessen: Hyperinflation, Weltwirtschaftskrise, „Polonisierung“ Ostoberschlesiens, Freundeskreis des Reichsführers SS Heinrich Himmler, Rüstungsgespräche, Rohstoffersatzwirtschaft, „Arisierung“, Zwangsarbeit, Nürnberger Prozess, Entflechtung der Schwerindustrie, Daimler-Verkauf, Spendenskandal.
…und Personen
Die Namen, die in den Akten auftauchen, lesen sich wie ein Who’s who deutscher Unternehmer und Politiker. Von Konrad Adenauer über Eberhard von Brauchitsch, Odilo Burkart, Ernst Buskühl, Thomas Dehler, Hermann Dietrich, Hermann Göring, Otto Andreas Friedrich, Konrad Kaletsch, Wilhelm Keppler, Rudolf Münemann, Paul Pleiger, Wolfgang Pohle, Familie Quandt, Hermann Röchling, Walter Scheel, Hanns Martin Schleyer, Willy Schlieker, Paul Silverberg, Otto Steinbrinck, Franz Josef Strauß, Robert Tillmanns bis Albert Vögler.
Das Forschungsarchiv Flick mit Foto-Album vom Nürnberger Prozess
Das Archiv umfasst ca. 100 laufende Meter, darunter
- Originalakten und Kopien aus der Registratur der Maxhütte im oberpfälzischen Sulzbach-Rosenberg, Unterlagen von Privatpersonen aus dem Unternehmen Flick sowie der Familie, darunter private Fotoalben aus der Flick KG nach 1945 aus dem Nachlass einer Sekretärin;
- Fremdarchivalien aus über 60 Archiven in Kopien bzw. mit Standortverweisen der Originalquellen;
- die Benjamin B. Ferencz Collection zu den Nürnberger Prozessen, Wiedergutmachungsverhandlungen und Zwangsarbeiterklagen mit Mikrofiches der Originale aus dem United States Holocaust Memorial Museum in Washington/D.C.;
- Unterlagen des Industriefinanzierers Rudolf Münemann;
- Rollfilme der Dokumente und Protokolle des Nürnberger Flick-Prozesses sowie Verfilmungen der ursprünglich von den USA beschlagnahmten Akten.
Von besonderem dokumentarischem Wert ist das Nürnberger Fotoalbum, von dem es insgesamt nur drei Exemplare gibt. Es wurde von Odilo Burkart, dem Chef der Maxhütte, angelegt und dokumentiert den Flick-Prozess aus Sicht der Angeklagten. Die kurzen Kommentare zu jedem Foto verdeutlichen, dass sich Flick und seine Mitarbeiter als Opfer der Siegerjustiz verstanden und sich zum Beispiel für den Zwangsarbeitereinsatz nicht verantwortlich oder schuldig fühlten. Das Fotoalbum war eine wichtige Quelle für die Flick-Fernsehdokumentation.
Die Bedeutung des Forschungsarchivs Flick im BBWA
Das Forschungsarchiv Flick im Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv macht Unterlagen des Unternehmers Friedrich Flick und seines Konzerns an einem Ort zugänglich, die aus weltweit über 60 Archive stammen. Es steht ab sofort für die wirtschafts- und zeithistorische Forschung offen.
Kontakt:
Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte
Historisches Institut der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fürstengraben 13, 07743 Jena
Tel.: 03641 / 944450
E-Mail: Sekretariat.Frei[at]uni-jena.de
Herr Berghausen
Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e. V.
Eichborndamm 167, Haus 42
13403 Berlin
Tel.: 0174 331 79 77
E-Mail mail[at]bb-wa.de
Fotos zum Download: http://www.bb-wa.de
Weitere Informationen:
http://www.bb-wa.de
http://www.uni-jena.de
http://www.nng.uni-jena.de/Forschungsprojekte/Flick+im+20_+Jahrhundert.html
http://www.randomhouse.de/book/edition.jsp?edi=283139
http://www.daserste.de/doku/allroundbeitrag_dyn~uid,03s9xmnrn7zo3cdc~cm.asp"
Quelle: IDW 17.06.2010, 17.06.2010
Zum Flick-Archiv s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/5049289/
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 18:53 - Rubrik: Wirtschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 18:43 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine im Jahr 1927 von Hermann Menhardt im Handschriftenverzeichnis der Kärntner Bibliotheken (Bd. 1, S. 262) beschriebene Handschrift, die sich damals in Klagenfurt im Privatbesitz von Ernst Urbas befand, wird nach Auskunft von Ulrike Bodemann (München) am 10. Juli 2010 bei Christie's in London versteigert (Sale 7911, Lot 43). Der im alemannischen Sprachraum im Jahr 1499 entstandene und von Petrus Brack de Minderdorff geschriebene Codex ist reichhaltig illustriert und überliefert u.a. die sog. 'Kemptener Chronik' des Johannes Birk. Meldet der Handschriftencensus.
http://www.handschriftencensus.de/14741
Dort fehlt der Hinweis auf den früheren Verkauf bei Sotheby's:
http://dla.library.upenn.edu/cocoon/dla/schoenberg/record.html?id=SCHOENBERG_730
Der Eintrag bei Christie's lautet:
JOHANNES BIRK, Stifftung des Gotzhaus Kempten und Sant Hyltgarten Leben, The monastic foundation at Kempten and the Life of St Hildegard, in German, DECORATED MANUSCRIPT ON PAPER
[Kempten Abbey, Swabia], dated 1499
303 x 202mm. 147 leaves, including ii flyleaves and blanks ff.22-3, 93-146r and two pages later 16th-century additions (f.146v-147), contemporary foliation in ink (A-C, F-H, J-M, N-T, V-W, 1-15, 17-70), modern pencil foliation beginning on first flyleaf and followed here, paper overlay with contemporary correction on one calendar leaf, bull's head watermarks indicating two paperstocks, 27-28 lines written in brown ink in a cursiva libraria, the first section (ff.13-21) in a different hand, between two horizontals and verticals ruled in brown, justification: 205 x 133mm, capitals touched red, rubrics in red, large opening initials in red, some flourished, three computational tables in red and brown ink, two large circular diagrams with yellow and black wash and once with volvelles, FIFTY-NINE LARGE DRAWINGS in ink and coloured washes (apparently lacking two leaves after f.5 and a leaf after f.38, light wear and surface soiling throughout, mainly to margins, edges brittle with losses at lower inner margin of many leaves, some repaired tears, mostly marginal, several affecting text or drawings). ?Original wooden boards rebound in 20th-century calf retaining possibly original upper cover in light brown calf stamped and ruled in blind, divided by single and double diagonal fillets into lozenge-shaped compartments containing tools including a standing saint, fleur de lys, foliage, scroll inscribed ?Maria and rosette in a roundel, metal catch (upper cover worn with loss at edges).
A RARE COPY OF JOHANNES BIRK'S HISTORY OF THE ABBEY OF KEMPTEN AND LIFE OF ST HILDEGARD IN GERMAN, SIGNED AND DATED BY THE SCRIBE
PROVENANCE:
1. Presumably made for the Benedictine Abbey of Kempten in the diocese of Constance, in present day Allgaü, south-west Bavaria. St Hildegard, Charlemagne and their son, Louis the Pious, were revered as benefactors and founders of the Abbey in the 8th century. Eleven volumes are known to have survived from its library (see S. Krämer, Handschriftenerbe des Deutschen Mittelalters, I, 1989, this manuscript cited p.392). The manuscript is signed and dated on f.92 by the scribe, Peter Brack of Minderdorff on Thursday before the Purification of the Virgin (2 February), 1499: 'Diss biechlin ist volendet und geschriben am dornstag vor unser lieben frowen tag irer rainigung zuo liechtmess Anno dni.Mo cccco lxxxxviiijno per me petrum brack von minderdorff'. The death of the father of Petrus Brack of Oberminderdorff is added beside 22 November in the calendar, which includes saints revered in Augsburg and Constance.
2. The list of contents in Latin added to the verso of f.ii in a 17th-century hand suggests the volume was still at Kempten where it probably remained until the abbey was suppressed in 1802.
3. In 1927 the manuscript was in the private collection of Ernst Urbas of Klagenfurt, Austria, where it had been described by Hermann Menhardt in 1924 (H. Menhardt, Handschriftenverzeichnis der Kärntner Bibliotheken, Bd.1, Vienna, 1927, S.262, see notes reproduced on www.bbaw.de, Handschriftenarchiv).
CONTENT:
Calendar, each month with accompanying notes on astrology, on determining auspicious times for taking cold water baths, advice on which food, drink and medicines to be consumed according to the season, and medical dictums from the classical world including those of Aristotle, Galen, Seneca, Albumasar and Hippocrates ff.3-12v; 'Nach Volget Unnd ist ze mercken dyew aigenschafft aines yedlichen Mensch[e]n', on the nature of man (including, for example, 'Item. Dye forcht ligt dem mensch[e]n Inn Dem Hertzen') f.13; circular diagram and explanatory notes on the planets and days of the week, a list of zodiac signs with computational tables, ff.13v-15; '... wann es gut od[e]r bös zu der Aderlassen sey', on bloodletting, with a list of zodiac signs and their influence, computational tables for the years 1500-1577, circular diagram and explanations on the planets relating to the seasons, elements and the bodily humours ff.15v-21; Stifftung des gotzhaus kempt[e]n un[d] sant hyltgart[e]n leben ff.24-92, an account of the building and endowing of the abbey, a list of its relics which include a part of Aaron's rod, Noah's Ark and St Peter's Cross, manna and St Michael Archangel's footprint ff.36v-39, accounts of patron saints Gordian and Epimachus ff.39v-47v, indulgences given for the altar of St Hildegard at Kempten and for the chapel at Burghalde castle ff.47v-49v, of the twelve kings and noblemen who came to Kempten with St Hildegard ff.50-57v, God's miraculous deeds at Kempten carried out through St Hildegard and Louis the Pious ff.58-80v, the miracles performed by Charlemagne ff.81-81v, a record of important historical events until 1494 ff.82-87, 'Zu dem letsten des biechlins merck ein klain history von dem loblich[e]n un[d] vest[e]n ritter hainrich[e]n von kempt[en]', a history of the knight, Heinrich of Kempten detailing his four knightly deeds (ff.87-92); colophon f.92; added instructions on how to grow trees in a garden ff.146v-147.
This is a rare copy of the text in German, with only three other manuscripts apparently recorded: a copy bound with a chronicle of Augsburg by Sigismund Meisterlin, Universitätsbibliothek, Würzburg (U.B. cod. M.ch.f.97, ff.124-230v), with Birk's text dated after 1483, and Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, 2° Cod 249, written in 1582 by the scribe Jeremias Lentzer of Wettenhausen, copied from an earlier text signed and dated 1506 by the scribe Johannes Kreler.
[Christie's übersieht die Krälersche Handschrift von 1506 Cgm 9280: http://www.handschriftencensus.de/14744 ohne Nennung des Schreibers Johann Kräler]
Johannes Birk of Biberach, who studied in Vienna and Heidelberg and from the late 1460s until 1494 ran the Abbey school at Kempten, originally wrote three distinct works, in Latin; the lives of St Hildegard, of Charlemagne, and a history of Kempten, elaborating earlier sources such as Gottfried of Marsilia and Pseudo Turpin. He followed with this simplified combination of all three in the vernacular.
ILLUSTRATION:
Colour-washed drawings were especially favoured in southern Germany for providing effective illustrations quickly and economically. The resulting economy of style encouraged a telling use of assured line, with colour as an attractive adjunct that could, however, be crucial for clarifying figures and details. The convention of unframed pictures with minimal settings meant the artist had to focus on essentials to convey the subject through a frieze of figures strikingly isolated against the page.
The subjects of the drawings are as follows:
f.24 The Virgin and Child in a mandorla beside the Abbey of Kempten
f.24v St Hildegard and Charlemagne holding a model of the Abbey
f.26 St Hildegard and Louis the Pious with a young girl, illustrating the chapter on St Hildegard's descendants
f.27v St Hildegard overseeing the building of the Abbey
f.29 Two labourers carrying a large stone
f.30 The castle of Hylemont or Burghalde
f.32 Pope Adrian I asperging the Abbey, accompanied by a Cardinal, before St Hildegard and Charlemagne.
f.33v A monk and the Abbey's first Abbot, Audegarius, before the Abbey receiving its charter from Charlemagne
f.34v Two monks with Audegarius
f.36 Four reliquaries from the Abbey, supported on a wooden frame
f.39v Saints Gordian and Epimachus, Kempten's patron saints, beside the Virgin and Child in a mandorla
f.44 St Epimachus of Alexandria, holding his instrument of martyrdom,
a lime kiln
f.45v St Marina, the wife of St Gordian
f.47v Pope Adrian I giving the abbot of Kempten an indulgence for the altar of St Hildegard
f.49 Burghalde castle, illustrating the text relating to an indulgence for its chapel
f.51 Regimundus of Greece, with armorial
f.51v Duke Excelsus, with armorial
f.52 Marsilius, King of Spain, with armorial
f.52v Ferninus of Orleans, with armorial
f.53 Prince Rugaberchtus of the Nabodeans, with armorial
f.53v King Rosso of Africa, with armorial
f.54 Erphonus, king or governor of Persia, with armorial
f.54v Delsmotus of Egypt, with armorial
f.55 Duke Leonarius of the Chaldeans, with armorial
f.55v Dolganus, king of the Franks, with armorial
f.56 Duke Bero of Madion, with armorial
f.56v Count Decretarius of Ethiopia, with armorial
f.57v Five coats of arms, of Kempten and its patrons, the duchies
of Bavaria, of Saxony, Wüttemberg and Vorarlberg
f.58 Standing figure of St Hildegard, wearing the imperial crown
f.62 The hand of God above St Hildegard and her son Louis the Pious
f.63 The altar and grave of St Hildegard in Kempten Abbey
f.63v A child brought back to life on the altar of St Hildegard, the saint and Louis the Pious looking on, the hand of God above
f.64v A boy who drowned in the Iller river; St Hildegard kneeling at the bank with Louis, the hand of God above
f.65 A leper, shown with his clappers, is cured; with St Hildegard and Louis, the hand of God above
f.66 A cripple is healed; St Hildegard and Louis, the hand of God above f.66v A man with hydropsy is healed; St Hildegard and Louis at
the foot of his bed, the hand of God above
f.67v Evil spirits, shown as two black birds, are expelled from
an old woman; St Hildegard and Louis, the hand of God above
f.68v The blacksmith Conrad of Kempten Abbey working at his forge
f.69 Two women chained in stocks
f.70 A woman with hydropsy is cured; hand of God above
f.70v Conrad von Füssen, a young lame boy, is cured, hand of God above
f.71 A blind monk from Reitenbach Abbey is given back his sight, the
hand of God above
f.72 A deaf woman from Gerisried hears again, the hand of God above
f.72v A lame woman on crutches, Hyltgart Felberin of Ostrach, is cured, the hand of God above
f.73 Sabina Lesslarius of Echingen in prayer, cured of the 'fluss der
frowen oder blumen', the hand of God above
f.73v An evil spirit is expelled from the preacher Wernher Lindberger of Walse, kneeling before St Hildegard and Louis, the hand of God above f.74v Peter Birck of St Gall covered in boils, is cured, the hand of God above
f.75 An old woman from Stouffen is healed, the hand of God above
f.75v A young man, Heinrich Aichelberg of Altheim, lying in bed cured
from a serious illness
f.76 Berchtold Kramer of Echingen, a mute boy, being cured, the hand of God above
f.77 Margaretha Stentnerin of Krügzell is cured of St Vitus' Dance,
the hand of God above
f.77v A girl Gütta Schnyderin of Kempten with 'bad' eyes is cured, the hand of God above
f.78 Two sextons digging the graves of St Hildegard and Louis the Pious f.79v The monks of Kempten Abbey digging up the tomb of Louis
f.81 An angel bringing Charlemagne his sword, spurs and orb
f.87 The knight Heinrich von Kempten, in full armour, with banner
f.88v The knight Heinrich holding a club
f.89 The knight Heinrich holding a lance
f.89v The knight Heinrich holding a halberd, representing 'his manliest knightly fight'
http://tinyurl.com/3xyx448
Nach wir vor maßgeblich der Aufsatz von Baumann:
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00009125/image_11
Zu Birk siehe auch: http://archiv.twoday.net/stories/3118097
Leider dürfte der Preis für eine deutsche Institution viel zu hoch sein :-( (Ebenso wie beim Processionale aus Stift Nonnberg in Salzburg, Lot 44).
Update: Price realized $183,209
Erworben für die BSB
http://archiv.twoday.net/stories/6418517/

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Johannes_Birk
http://www.handschriftencensus.de/14741
Dort fehlt der Hinweis auf den früheren Verkauf bei Sotheby's:
http://dla.library.upenn.edu/cocoon/dla/schoenberg/record.html?id=SCHOENBERG_730
Der Eintrag bei Christie's lautet:
JOHANNES BIRK, Stifftung des Gotzhaus Kempten und Sant Hyltgarten Leben, The monastic foundation at Kempten and the Life of St Hildegard, in German, DECORATED MANUSCRIPT ON PAPER
[Kempten Abbey, Swabia], dated 1499
303 x 202mm. 147 leaves, including ii flyleaves and blanks ff.22-3, 93-146r and two pages later 16th-century additions (f.146v-147), contemporary foliation in ink (A-C, F-H, J-M, N-T, V-W, 1-15, 17-70), modern pencil foliation beginning on first flyleaf and followed here, paper overlay with contemporary correction on one calendar leaf, bull's head watermarks indicating two paperstocks, 27-28 lines written in brown ink in a cursiva libraria, the first section (ff.13-21) in a different hand, between two horizontals and verticals ruled in brown, justification: 205 x 133mm, capitals touched red, rubrics in red, large opening initials in red, some flourished, three computational tables in red and brown ink, two large circular diagrams with yellow and black wash and once with volvelles, FIFTY-NINE LARGE DRAWINGS in ink and coloured washes (apparently lacking two leaves after f.5 and a leaf after f.38, light wear and surface soiling throughout, mainly to margins, edges brittle with losses at lower inner margin of many leaves, some repaired tears, mostly marginal, several affecting text or drawings). ?Original wooden boards rebound in 20th-century calf retaining possibly original upper cover in light brown calf stamped and ruled in blind, divided by single and double diagonal fillets into lozenge-shaped compartments containing tools including a standing saint, fleur de lys, foliage, scroll inscribed ?Maria and rosette in a roundel, metal catch (upper cover worn with loss at edges).
A RARE COPY OF JOHANNES BIRK'S HISTORY OF THE ABBEY OF KEMPTEN AND LIFE OF ST HILDEGARD IN GERMAN, SIGNED AND DATED BY THE SCRIBE
PROVENANCE:
1. Presumably made for the Benedictine Abbey of Kempten in the diocese of Constance, in present day Allgaü, south-west Bavaria. St Hildegard, Charlemagne and their son, Louis the Pious, were revered as benefactors and founders of the Abbey in the 8th century. Eleven volumes are known to have survived from its library (see S. Krämer, Handschriftenerbe des Deutschen Mittelalters, I, 1989, this manuscript cited p.392). The manuscript is signed and dated on f.92 by the scribe, Peter Brack of Minderdorff on Thursday before the Purification of the Virgin (2 February), 1499: 'Diss biechlin ist volendet und geschriben am dornstag vor unser lieben frowen tag irer rainigung zuo liechtmess Anno dni.Mo cccco lxxxxviiijno per me petrum brack von minderdorff'. The death of the father of Petrus Brack of Oberminderdorff is added beside 22 November in the calendar, which includes saints revered in Augsburg and Constance.
2. The list of contents in Latin added to the verso of f.ii in a 17th-century hand suggests the volume was still at Kempten where it probably remained until the abbey was suppressed in 1802.
3. In 1927 the manuscript was in the private collection of Ernst Urbas of Klagenfurt, Austria, where it had been described by Hermann Menhardt in 1924 (H. Menhardt, Handschriftenverzeichnis der Kärntner Bibliotheken, Bd.1, Vienna, 1927, S.262, see notes reproduced on www.bbaw.de, Handschriftenarchiv).
CONTENT:
Calendar, each month with accompanying notes on astrology, on determining auspicious times for taking cold water baths, advice on which food, drink and medicines to be consumed according to the season, and medical dictums from the classical world including those of Aristotle, Galen, Seneca, Albumasar and Hippocrates ff.3-12v; 'Nach Volget Unnd ist ze mercken dyew aigenschafft aines yedlichen Mensch[e]n', on the nature of man (including, for example, 'Item. Dye forcht ligt dem mensch[e]n Inn Dem Hertzen') f.13; circular diagram and explanatory notes on the planets and days of the week, a list of zodiac signs with computational tables, ff.13v-15; '... wann es gut od[e]r bös zu der Aderlassen sey', on bloodletting, with a list of zodiac signs and their influence, computational tables for the years 1500-1577, circular diagram and explanations on the planets relating to the seasons, elements and the bodily humours ff.15v-21; Stifftung des gotzhaus kempt[e]n un[d] sant hyltgart[e]n leben ff.24-92, an account of the building and endowing of the abbey, a list of its relics which include a part of Aaron's rod, Noah's Ark and St Peter's Cross, manna and St Michael Archangel's footprint ff.36v-39, accounts of patron saints Gordian and Epimachus ff.39v-47v, indulgences given for the altar of St Hildegard at Kempten and for the chapel at Burghalde castle ff.47v-49v, of the twelve kings and noblemen who came to Kempten with St Hildegard ff.50-57v, God's miraculous deeds at Kempten carried out through St Hildegard and Louis the Pious ff.58-80v, the miracles performed by Charlemagne ff.81-81v, a record of important historical events until 1494 ff.82-87, 'Zu dem letsten des biechlins merck ein klain history von dem loblich[e]n un[d] vest[e]n ritter hainrich[e]n von kempt[en]', a history of the knight, Heinrich of Kempten detailing his four knightly deeds (ff.87-92); colophon f.92; added instructions on how to grow trees in a garden ff.146v-147.
This is a rare copy of the text in German, with only three other manuscripts apparently recorded: a copy bound with a chronicle of Augsburg by Sigismund Meisterlin, Universitätsbibliothek, Würzburg (U.B. cod. M.ch.f.97, ff.124-230v), with Birk's text dated after 1483, and Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, 2° Cod 249, written in 1582 by the scribe Jeremias Lentzer of Wettenhausen, copied from an earlier text signed and dated 1506 by the scribe Johannes Kreler.
[Christie's übersieht die Krälersche Handschrift von 1506 Cgm 9280: http://www.handschriftencensus.de/14744 ohne Nennung des Schreibers Johann Kräler]
Johannes Birk of Biberach, who studied in Vienna and Heidelberg and from the late 1460s until 1494 ran the Abbey school at Kempten, originally wrote three distinct works, in Latin; the lives of St Hildegard, of Charlemagne, and a history of Kempten, elaborating earlier sources such as Gottfried of Marsilia and Pseudo Turpin. He followed with this simplified combination of all three in the vernacular.
ILLUSTRATION:
Colour-washed drawings were especially favoured in southern Germany for providing effective illustrations quickly and economically. The resulting economy of style encouraged a telling use of assured line, with colour as an attractive adjunct that could, however, be crucial for clarifying figures and details. The convention of unframed pictures with minimal settings meant the artist had to focus on essentials to convey the subject through a frieze of figures strikingly isolated against the page.
The subjects of the drawings are as follows:
f.24 The Virgin and Child in a mandorla beside the Abbey of Kempten
f.24v St Hildegard and Charlemagne holding a model of the Abbey
f.26 St Hildegard and Louis the Pious with a young girl, illustrating the chapter on St Hildegard's descendants
f.27v St Hildegard overseeing the building of the Abbey
f.29 Two labourers carrying a large stone
f.30 The castle of Hylemont or Burghalde
f.32 Pope Adrian I asperging the Abbey, accompanied by a Cardinal, before St Hildegard and Charlemagne.
f.33v A monk and the Abbey's first Abbot, Audegarius, before the Abbey receiving its charter from Charlemagne
f.34v Two monks with Audegarius
f.36 Four reliquaries from the Abbey, supported on a wooden frame
f.39v Saints Gordian and Epimachus, Kempten's patron saints, beside the Virgin and Child in a mandorla
f.44 St Epimachus of Alexandria, holding his instrument of martyrdom,
a lime kiln
f.45v St Marina, the wife of St Gordian
f.47v Pope Adrian I giving the abbot of Kempten an indulgence for the altar of St Hildegard
f.49 Burghalde castle, illustrating the text relating to an indulgence for its chapel
f.51 Regimundus of Greece, with armorial
f.51v Duke Excelsus, with armorial
f.52 Marsilius, King of Spain, with armorial
f.52v Ferninus of Orleans, with armorial
f.53 Prince Rugaberchtus of the Nabodeans, with armorial
f.53v King Rosso of Africa, with armorial
f.54 Erphonus, king or governor of Persia, with armorial
f.54v Delsmotus of Egypt, with armorial
f.55 Duke Leonarius of the Chaldeans, with armorial
f.55v Dolganus, king of the Franks, with armorial
f.56 Duke Bero of Madion, with armorial
f.56v Count Decretarius of Ethiopia, with armorial
f.57v Five coats of arms, of Kempten and its patrons, the duchies
of Bavaria, of Saxony, Wüttemberg and Vorarlberg
f.58 Standing figure of St Hildegard, wearing the imperial crown
f.62 The hand of God above St Hildegard and her son Louis the Pious
f.63 The altar and grave of St Hildegard in Kempten Abbey
f.63v A child brought back to life on the altar of St Hildegard, the saint and Louis the Pious looking on, the hand of God above
f.64v A boy who drowned in the Iller river; St Hildegard kneeling at the bank with Louis, the hand of God above
f.65 A leper, shown with his clappers, is cured; with St Hildegard and Louis, the hand of God above
f.66 A cripple is healed; St Hildegard and Louis, the hand of God above f.66v A man with hydropsy is healed; St Hildegard and Louis at
the foot of his bed, the hand of God above
f.67v Evil spirits, shown as two black birds, are expelled from
an old woman; St Hildegard and Louis, the hand of God above
f.68v The blacksmith Conrad of Kempten Abbey working at his forge
f.69 Two women chained in stocks
f.70 A woman with hydropsy is cured; hand of God above
f.70v Conrad von Füssen, a young lame boy, is cured, hand of God above
f.71 A blind monk from Reitenbach Abbey is given back his sight, the
hand of God above
f.72 A deaf woman from Gerisried hears again, the hand of God above
f.72v A lame woman on crutches, Hyltgart Felberin of Ostrach, is cured, the hand of God above
f.73 Sabina Lesslarius of Echingen in prayer, cured of the 'fluss der
frowen oder blumen', the hand of God above
f.73v An evil spirit is expelled from the preacher Wernher Lindberger of Walse, kneeling before St Hildegard and Louis, the hand of God above f.74v Peter Birck of St Gall covered in boils, is cured, the hand of God above
f.75 An old woman from Stouffen is healed, the hand of God above
f.75v A young man, Heinrich Aichelberg of Altheim, lying in bed cured
from a serious illness
f.76 Berchtold Kramer of Echingen, a mute boy, being cured, the hand of God above
f.77 Margaretha Stentnerin of Krügzell is cured of St Vitus' Dance,
the hand of God above
f.77v A girl Gütta Schnyderin of Kempten with 'bad' eyes is cured, the hand of God above
f.78 Two sextons digging the graves of St Hildegard and Louis the Pious f.79v The monks of Kempten Abbey digging up the tomb of Louis
f.81 An angel bringing Charlemagne his sword, spurs and orb
f.87 The knight Heinrich von Kempten, in full armour, with banner
f.88v The knight Heinrich holding a club
f.89 The knight Heinrich holding a lance
f.89v The knight Heinrich holding a halberd, representing 'his manliest knightly fight'
http://tinyurl.com/3xyx448
Nach wir vor maßgeblich der Aufsatz von Baumann:
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00009125/image_11
Zu Birk siehe auch: http://archiv.twoday.net/stories/3118097
Leider dürfte der Preis für eine deutsche Institution viel zu hoch sein :-( (Ebenso wie beim Processionale aus Stift Nonnberg in Salzburg, Lot 44).
Update: Price realized $183,209
Erworben für die BSB
http://archiv.twoday.net/stories/6418517/

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Johannes_Birk
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 18:01 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.bibliotheksrecht.de/2010/06/17/bibliotheksgesetz-sachsen-anhalt-verabschiedet-8822031/
Siehe auch
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/intra/landtag3/ltpapier/drs/5/d2591vbe_5.pdf
Steinhauer bemängelt das Fehlen einer Belegexemplarklausel. Ich begrüße dieses Fehlen ausdrücklich, da die Ablieferung von Belegexemplaren nichts in einem Gesetz zu suchen hat, sondern ein freiwilliger Service des Benutzers sein sollte. Wichtigeres Desiderat ist eine (von Steinhauer nicht thematisierte) Datenschutzregelung analog zu Thüringen.
Siehe auch
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/intra/landtag3/ltpapier/drs/5/d2591vbe_5.pdf
Steinhauer bemängelt das Fehlen einer Belegexemplarklausel. Ich begrüße dieses Fehlen ausdrücklich, da die Ablieferung von Belegexemplaren nichts in einem Gesetz zu suchen hat, sondern ein freiwilliger Service des Benutzers sein sollte. Wichtigeres Desiderat ist eine (von Steinhauer nicht thematisierte) Datenschutzregelung analog zu Thüringen.
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 17:10 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Neuzugang in meiner delicious-Linkliste von über 100 Museums-Datenbanken:
http://delicious.com/Klausgraf/museum_database
http://delicious.com/Klausgraf/museum_database
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 16:52 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 16:48 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blog.culture-to-go.com/2010/06/16/1001-stories-daenemark-kultur-social-media-portal/
Mit dem Portal “1001 Stories of Denmark” bietet die dänische Denkmalbehörde KULTURARV einen ganz neuen Zugang zu den Sehenswürdigkeiten des Landes. Die Seite sammelt “Geschichten” zu kulturell interessanten Orten in Dänemark. Natürlich sind Highlights wie das ehemalige Königsschloss Christiansborg in Kopenhagen dabei, aber auch kleinere Kirchen, viele Industriedenkmäler oder auch ein einfaches Steinkreuz am Wegesrand. Zu den Cultural Heritage Sites bekommt man in der Regel ein Bild, einen Text (meist ein klassischer Kommentar zur Geschichte des Objekts) und die Vertonung des Textes durch professionelle Sprecher. Ein Großteil der Seite ist auch in einer englischen Sprachversion verfügbar.
Zwei Aspekte heben dieses Kulturreiseportal von vergleichbaren Angeboten ab: Die Vielfalt der Zugänge und die Öffnung für die Nutzer im Sinne eines Social-Media-Portals.
http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/en_GB
Mit dem Portal “1001 Stories of Denmark” bietet die dänische Denkmalbehörde KULTURARV einen ganz neuen Zugang zu den Sehenswürdigkeiten des Landes. Die Seite sammelt “Geschichten” zu kulturell interessanten Orten in Dänemark. Natürlich sind Highlights wie das ehemalige Königsschloss Christiansborg in Kopenhagen dabei, aber auch kleinere Kirchen, viele Industriedenkmäler oder auch ein einfaches Steinkreuz am Wegesrand. Zu den Cultural Heritage Sites bekommt man in der Regel ein Bild, einen Text (meist ein klassischer Kommentar zur Geschichte des Objekts) und die Vertonung des Textes durch professionelle Sprecher. Ein Großteil der Seite ist auch in einer englischen Sprachversion verfügbar.
Zwei Aspekte heben dieses Kulturreiseportal von vergleichbaren Angeboten ab: Die Vielfalt der Zugänge und die Öffnung für die Nutzer im Sinne eines Social-Media-Portals.
http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/en_GB
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 16:42 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://opuscula.synergiesprairies.ca/ojs/index.php/opuscula
Opuscula: Short Texts of the Middle Ages and Renaissance is a peer-reviewed, on-line journal/text series published by Classical, Medieval and Renaissance Studies at the University of Saskatchewan, specializing in short texts of the Middle Ages and Renaissance. We seek single-witness editions of a broad range of pre-modern texts including but not limited to literary and philosophical works, letters, charters, court documents, and notebooks.
The goal of the journal is to establish open access to a substantial body of small but complete texts in scholarly editions to researchers and educators. Our first issue will be published in 2011.
Opuscula: Short Texts of the Middle Ages and Renaissance is a peer-reviewed, on-line journal/text series published by Classical, Medieval and Renaissance Studies at the University of Saskatchewan, specializing in short texts of the Middle Ages and Renaissance. We seek single-witness editions of a broad range of pre-modern texts including but not limited to literary and philosophical works, letters, charters, court documents, and notebooks.
The goal of the journal is to establish open access to a substantial body of small but complete texts in scholarly editions to researchers and educators. Our first issue will be published in 2011.
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 16:38 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 16:33 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 16:22 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 15:57 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Von Martina Knichel (Dissertation bei Eugen Ewig) online:
http://www.dilibri.de/urn/urn:nbn:de:0128-1-15449
http://www.dilibri.de/urn/urn:nbn:de:0128-1-15449
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 15:53 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 15:45 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.rambow.de/teutscher-reichsadel.html
Zum Thema Ahnenproben siehe besser:
http://archiv.twoday.net/search?q=ahnenprobe
Zum Thema Ahnenproben siehe besser:
http://archiv.twoday.net/search?q=ahnenprobe
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 15:43 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://lesewolke.wordpress.com/
Siehe auch:
http://infobib.de/blog/2010/06/16/biblioblogistische-lesewolken-bibliothekarischer-perlentaucher/
Siehe auch:
http://infobib.de/blog/2010/06/16/biblioblogistische-lesewolken-bibliothekarischer-perlentaucher/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=6172
"Die beeindruckende Menge von 216.000 Dissertationen, davon der Großteil aus Deutschland, wurde in den letzten zweieinhalb Jahren gescannt und auf den Servern der Universität gespeichert. Das sind immerhin rund 40% aller in Deutschland zwischen 1925 und 1988 verfassten Dissertationen."
Wie bei ORBI Lüttich, dem Heidelberger oder Karlsruher Bildserver usw. gilt auch hier: Projekte, die Digitalisate den Angehörigen der eigenen Hochschule vorbehalten, schaffen einen unfairen wissenschaftlichen Wettbewerbsvorteil. (Das gilt natürlich auch für das Bildarchiv Prometheus, in dem zehntausendfach Urheberrechtsverletzungen begangen werden.)
Zudem sind sie nach meiner Auffassung auch nach EU-Recht illegal, da der große Personenkreis einer Universität in jedem Fall das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung tangiert. Wer ohne die Urheber zu fragen, Dissertationen digitalisiert, macht nichts anderes als Google Book Search.
Der einzige richtige Weg wäre, entweder die Dissertationen auf Risiko der Allgemeinheit zu öffnen, nachdem man versucht hat, die Urheber ausfindig zu machen, oder aber die Gesetzgebung in Sachen verwaister Werke entschieden voranzutreiben.
"Die beeindruckende Menge von 216.000 Dissertationen, davon der Großteil aus Deutschland, wurde in den letzten zweieinhalb Jahren gescannt und auf den Servern der Universität gespeichert. Das sind immerhin rund 40% aller in Deutschland zwischen 1925 und 1988 verfassten Dissertationen."
Wie bei ORBI Lüttich, dem Heidelberger oder Karlsruher Bildserver usw. gilt auch hier: Projekte, die Digitalisate den Angehörigen der eigenen Hochschule vorbehalten, schaffen einen unfairen wissenschaftlichen Wettbewerbsvorteil. (Das gilt natürlich auch für das Bildarchiv Prometheus, in dem zehntausendfach Urheberrechtsverletzungen begangen werden.)
Zudem sind sie nach meiner Auffassung auch nach EU-Recht illegal, da der große Personenkreis einer Universität in jedem Fall das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung tangiert. Wer ohne die Urheber zu fragen, Dissertationen digitalisiert, macht nichts anderes als Google Book Search.
Der einzige richtige Weg wäre, entweder die Dissertationen auf Risiko der Allgemeinheit zu öffnen, nachdem man versucht hat, die Urheber ausfindig zu machen, oder aber die Gesetzgebung in Sachen verwaister Werke entschieden voranzutreiben.
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 15:26 - Rubrik: Archivrecht
Josef Pauser hat einen Sammelbeitrag für seine diversen ungemein verdienstvollen Einträge zur Vereinbarung, dass Google die urheberrechtsfreien Werke der ÖNB Wien digitalisieren darf (auf Googles Kosten), spendiert:
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=6165
Seinem Kommentar zum Brief der IG Autoren, die sich gegen die Kooperation wenden, ist zuzustimmen:
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=6187
Allerdings ist die Forderung nach Offenlegung des Vertrags nur zu berechtigt. Dazu sagt der Jurist Pauser leider nichts. Es ist schändlich, dass diverse US-Verträge Googles und der mit Lyon im Netz zugänglich sind, der Münchner aber nicht. Nach unendlich langer Wartezeit hat vor wenigen Monaten der bayerische Landtag meine Petition, den Vertrag offenzulegen, zurückgewiesen. Wenn Pauser sich zur Offenlegungs-Forderung nicht äußert, muss er sich den Vorwurf gefallen lassen, gegen die im Staatswesen dringend nötige Transparenz und das Konzept der Informationsfreiheitsgesetze zu stehen.
Wenn die Bibliothekspartner den Vertrag z.B. aufgrund gesetzlicher Vorgaben offenlegen, stellt Google sich dem nicht entgegen.
Grundsätzlich gilt bei Public-Private-Partnerships, dass es nicht angehen kann, diesen Bereich den Transparenzvorschriften und der presserechtlichen Auskunftspflicht (die es so natürlich im benachbarten Alpenland nicht gibt, das ja in vielem extrem verknöchert noch auf dem Stand der KuK-Monarchie verharrt) zu entziehen. Wenn der Staat mit Privatunternehmen paktiert, ist dies ein staatliches Tätigkeitsfeld, das in besonderem Maß der Transparenz bedarf, damit Steuergelder nicht verschwendet und Bürgerrechte nicht mit Füßen getreten werden.
Zum Lyon-Vertrag:
http://archiv.twoday.net/stories/6069908/
http://scinfolex.wordpress.com/2009/12/13/contrat-googlebibliotheque-de-lyon-lombre-dun-doute/
Münchner Vertrag geheim:
http://archiv.twoday.net/stories/3484352/
Meine Klage gegen die ThULB Jena muss erst abgeschlossen sein, bevor ich kostenträchtige weitere Klagen erwägen kann ;-)
http://archiv.twoday.net/stories/5755033/
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=6165
Seinem Kommentar zum Brief der IG Autoren, die sich gegen die Kooperation wenden, ist zuzustimmen:
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=6187
Allerdings ist die Forderung nach Offenlegung des Vertrags nur zu berechtigt. Dazu sagt der Jurist Pauser leider nichts. Es ist schändlich, dass diverse US-Verträge Googles und der mit Lyon im Netz zugänglich sind, der Münchner aber nicht. Nach unendlich langer Wartezeit hat vor wenigen Monaten der bayerische Landtag meine Petition, den Vertrag offenzulegen, zurückgewiesen. Wenn Pauser sich zur Offenlegungs-Forderung nicht äußert, muss er sich den Vorwurf gefallen lassen, gegen die im Staatswesen dringend nötige Transparenz und das Konzept der Informationsfreiheitsgesetze zu stehen.
Wenn die Bibliothekspartner den Vertrag z.B. aufgrund gesetzlicher Vorgaben offenlegen, stellt Google sich dem nicht entgegen.
Grundsätzlich gilt bei Public-Private-Partnerships, dass es nicht angehen kann, diesen Bereich den Transparenzvorschriften und der presserechtlichen Auskunftspflicht (die es so natürlich im benachbarten Alpenland nicht gibt, das ja in vielem extrem verknöchert noch auf dem Stand der KuK-Monarchie verharrt) zu entziehen. Wenn der Staat mit Privatunternehmen paktiert, ist dies ein staatliches Tätigkeitsfeld, das in besonderem Maß der Transparenz bedarf, damit Steuergelder nicht verschwendet und Bürgerrechte nicht mit Füßen getreten werden.
Zum Lyon-Vertrag:
http://archiv.twoday.net/stories/6069908/
http://scinfolex.wordpress.com/2009/12/13/contrat-googlebibliotheque-de-lyon-lombre-dun-doute/
Münchner Vertrag geheim:
http://archiv.twoday.net/stories/3484352/
Meine Klage gegen die ThULB Jena muss erst abgeschlossen sein, bevor ich kostenträchtige weitere Klagen erwägen kann ;-)
http://archiv.twoday.net/stories/5755033/
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 14:55 - Rubrik: Archivrecht
KlausGraf - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 14:46 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 13:59 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Virtual Worlds Best Practices in Education (VWBPE) Conference Talk
View more webinars from 01archivist.
Archives In Second Life
View more presentations from 01archivist.
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 13:50 - Rubrik: Web 2.0
"In diesem Monat endet Düsseldorfs Hilfe für das Kölner Stadtarchiv. Über ein Jahr lang konnten Kölner Mitarbeiter die geborgenen Dokumente im Düsseldorfer Archiv sichten und neu erfassen. Das Kölner Stadtarchiv war im vergangenen Jahr eingestürzt. Mehr als einen Kilometer Regalfläche und Hunderte Paletten mit Plakaten und Plänen wurden nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs in Düsseldorf gelagert. Kölner Mitarbeiter haben diese hier mit Barcodes versehen und auf ihren Zustand hin überprüft. Mit dem Umzug des Düsseldorfer Stadtarchivs in die Worringer Str werden die Schriften nun unter anderem in Essen zwischengelagert, um sie dann wenn nötig zu restaurieren."
Quelle: Antenne Düsseldorf, NAchrichten v. 17.06.2010 - 09:14
Quelle: Antenne Düsseldorf, NAchrichten v. 17.06.2010 - 09:14
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 11:35 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 10:18 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Donnerstag, 17. Juni 2010, 08:58 - Rubrik: Wikis
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen