Es dürfte zu den Skurrilitäten der Forschung gehören, dass ich jahrzehntelang kein einziges Rennewart-Fragment fand, das in der einschlägigen Forschung (nun: im Handschriftencensus) fehlt, nun aber innerhalb von wenigen Tagen sogar zwei.
Fund 1: http://archiv.twoday.net/stories/59204071/
Von der altgermanistischen Forschung (und auch sonst) anscheinend völlig übersehen veröffentlichte in den jüngst digitalisierten Bayerischen Blättern für Volkskunde 7 (1920), S. 48-57 H. Clauß: Der Schutzbrief des Ritters Christof Fürer. Ein Nürnberger Wolfram v. Eschenbach-Kuriosum.
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00011255/image_55
Das Fragment diente als Einband eines "Zauberbüchleins", das ein "Joann: Faber" für einen Christoph Fürer ("Furer"), offenbar einen Angehörigen der Nürnberger Patrizierfamilie, schrieb. Genannt werden die Daten des 5. Mai und des 28. November 1554. Die winzige Papierhandschrift im Format 6 x 4 cm war in ein Pergamentfragment eingebunden, das Clauß ins 14. Jahrhundert datiert und für das er die Maße 23 x 6 cm gibt. Als Zeilenzahl darf 40 angenommen werden.
Aus welchem Familienbesitz das inzwischen wohl wieder verschollene Stück stammt, ist nicht explizit angegeben, doch darf nach dem Untertitel und der Vermutung Nürnberger Ursprungs von Nürnberger Familienbesitz ausgegangen werden. Es wäre also im Handschriftencensus als Nürnberg, Privatbesitz [verschollen] anzusetzen.
Bereits Clauß identifizierte das Fragment als aus dem Rennewart stammend. Er druckte den Text S. 52f. ab und ergänzte drei durch den Bruch verlöschte Zeilen (22531-22533) aus dem Cpg 404, Bl. 208v (Digitalisat).
Mittels Google und der Begriffsdatenbank konnte ich den Abdruck mit den Versen 22515-22554 der Ausgabe Hübners identifizieren (dort S. 330f.).
Fragmente mit 40 Zeilen sind nicht ganz selten:
Berlin mgq 1251,3 http://www.handschriftencensus.de/1780
Dillingen http://www.handschriftencensus.de/23753 (2011 entdeckt, Publikation durch Elisabeth Wunderle in der ZfdA angekündigt)
Graz u.a. http://www.handschriftencensus.de/1781
Klosterneuburg http://www.handschriftencensus.de/1130
München Cgm 5249/7k http://www.handschriftencensus.de/1774
Næstved (Dänemark), 39-40 http://www.handschriftencensus.de/1776
Prag http://www.handschriftencensus.de/1668
Ob das Fragment einem bisher nicht bekannten Discissus angehört oder einer dieser Handschriften zuzuweisen ist, lässt sich nicht sagen. Vom Versbestand her kann man wohl keine ausschließen. Das Nürnberger Stück ist demnach auch nicht identisch mit einem bereits bekannten Fragment.
Nachtrag: Bertold von Haller verdanke ich die folgenden Auskünfte: Der Aufsatz ist in der Fränkischen Bibliographie und in der Bibliographie des Nürnberger Patriziats (von Gunther Friedrich, 1994) verzeichnet, doch jeweils nur als Sonderdruck ohne Kenntnis des Abdrucks in den Bayerischen Heften für Volkskunde.
Bei dem Adressaten der Widmung handelt es sich um Christoph II. Fürer (1517-1561), einen Sohn des bekannten Christoph I. (1479-1537, vgl. Fränkische Lebensbilder 10/1982, S. 67-96), der wieder einen Sohn Christoph III. (1541-1610) hatte, der u.a. nach Palästina fuhr (vgl. Christophori Füreri ab Haimendorf ... itinerarium Aegypti, Arabiae, Palaestinae, Syriae ..., Nürnberg 1621; "mit angefügter Leichenrede und Darstellung der Vorfahren").
Zu Christoph II. s. Peter Fleischmann: Rat und Patriziat in Nürnberg (Nbg. Forschungen 31, Neustadt/A. 2008), S. 386. Außerdem gibt es einen Beitrag von August Sieghardt: Ein Fürer von Haimendorf im Ansbacher Stadtmuseum, in: Alt-Lauf 2 (1934), S. 183-184, der sich auf ihn beziehen soll. Zu Johann Faber konnte nichts gefunden werden.
Ein Nachruf auf den Vf. H[ermann]. Clauß steht in der ZBLG 9/1936, S. 502f, mit Hinweisen auf seine Wirkungsorte und historischen Veröffentlichungen:
http://periodika.digitale-sammlungen.de/zblg/seite/zblg09_0519
#forschung
Fund 1: http://archiv.twoday.net/stories/59204071/
Von der altgermanistischen Forschung (und auch sonst) anscheinend völlig übersehen veröffentlichte in den jüngst digitalisierten Bayerischen Blättern für Volkskunde 7 (1920), S. 48-57 H. Clauß: Der Schutzbrief des Ritters Christof Fürer. Ein Nürnberger Wolfram v. Eschenbach-Kuriosum.
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00011255/image_55
Das Fragment diente als Einband eines "Zauberbüchleins", das ein "Joann: Faber" für einen Christoph Fürer ("Furer"), offenbar einen Angehörigen der Nürnberger Patrizierfamilie, schrieb. Genannt werden die Daten des 5. Mai und des 28. November 1554. Die winzige Papierhandschrift im Format 6 x 4 cm war in ein Pergamentfragment eingebunden, das Clauß ins 14. Jahrhundert datiert und für das er die Maße 23 x 6 cm gibt. Als Zeilenzahl darf 40 angenommen werden.
Aus welchem Familienbesitz das inzwischen wohl wieder verschollene Stück stammt, ist nicht explizit angegeben, doch darf nach dem Untertitel und der Vermutung Nürnberger Ursprungs von Nürnberger Familienbesitz ausgegangen werden. Es wäre also im Handschriftencensus als Nürnberg, Privatbesitz [verschollen] anzusetzen.
Bereits Clauß identifizierte das Fragment als aus dem Rennewart stammend. Er druckte den Text S. 52f. ab und ergänzte drei durch den Bruch verlöschte Zeilen (22531-22533) aus dem Cpg 404, Bl. 208v (Digitalisat).
Mittels Google und der Begriffsdatenbank konnte ich den Abdruck mit den Versen 22515-22554 der Ausgabe Hübners identifizieren (dort S. 330f.).
Fragmente mit 40 Zeilen sind nicht ganz selten:
Berlin mgq 1251,3 http://www.handschriftencensus.de/1780
Dillingen http://www.handschriftencensus.de/23753 (2011 entdeckt, Publikation durch Elisabeth Wunderle in der ZfdA angekündigt)
Graz u.a. http://www.handschriftencensus.de/1781
Klosterneuburg http://www.handschriftencensus.de/1130
München Cgm 5249/7k http://www.handschriftencensus.de/1774
Næstved (Dänemark), 39-40 http://www.handschriftencensus.de/1776
Prag http://www.handschriftencensus.de/1668
Ob das Fragment einem bisher nicht bekannten Discissus angehört oder einer dieser Handschriften zuzuweisen ist, lässt sich nicht sagen. Vom Versbestand her kann man wohl keine ausschließen. Das Nürnberger Stück ist demnach auch nicht identisch mit einem bereits bekannten Fragment.
Nachtrag: Bertold von Haller verdanke ich die folgenden Auskünfte: Der Aufsatz ist in der Fränkischen Bibliographie und in der Bibliographie des Nürnberger Patriziats (von Gunther Friedrich, 1994) verzeichnet, doch jeweils nur als Sonderdruck ohne Kenntnis des Abdrucks in den Bayerischen Heften für Volkskunde.
Bei dem Adressaten der Widmung handelt es sich um Christoph II. Fürer (1517-1561), einen Sohn des bekannten Christoph I. (1479-1537, vgl. Fränkische Lebensbilder 10/1982, S. 67-96), der wieder einen Sohn Christoph III. (1541-1610) hatte, der u.a. nach Palästina fuhr (vgl. Christophori Füreri ab Haimendorf ... itinerarium Aegypti, Arabiae, Palaestinae, Syriae ..., Nürnberg 1621; "mit angefügter Leichenrede und Darstellung der Vorfahren").
Zu Christoph II. s. Peter Fleischmann: Rat und Patriziat in Nürnberg (Nbg. Forschungen 31, Neustadt/A. 2008), S. 386. Außerdem gibt es einen Beitrag von August Sieghardt: Ein Fürer von Haimendorf im Ansbacher Stadtmuseum, in: Alt-Lauf 2 (1934), S. 183-184, der sich auf ihn beziehen soll. Zu Johann Faber konnte nichts gefunden werden.
Ein Nachruf auf den Vf. H[ermann]. Clauß steht in der ZBLG 9/1936, S. 502f, mit Hinweisen auf seine Wirkungsorte und historischen Veröffentlichungen:
http://periodika.digitale-sammlungen.de/zblg/seite/zblg09_0519
#forschung
KlausGraf - am Freitag, 16. Dezember 2011, 18:26 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://digipress.digitale-sammlungen.de/de/fs1/calendar/1958-02-21.42554-0/bsb00039728_00425.html
Die Passauer Neue Presse steht seit Dezember 2011 zunächst mit den Jahrgängen 1946-1963 auf digiPress, der im Aufbau befindlichen Plattform für die Präsentation digitalisierter Zeitungen an der Bayerischen Staatsbibliothek, bereit.
Die Passauer Neue Presse steht seit Dezember 2011 zunächst mit den Jahrgängen 1946-1963 auf digiPress, der im Aufbau befindlichen Plattform für die Präsentation digitalisierter Zeitungen an der Bayerischen Staatsbibliothek, bereit.
KlausGraf - am Freitag, 16. Dezember 2011, 17:51 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 16. Dezember 2011, 12:23 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 Nicht wenige deutschsprachige Bücher enthält die digitale Bibliothek Sloweniens. Zwar könnte manchmal (insbesondere bei alten Postkarten) die Auflösung besser sein, aber man findet hier eine Menge aufschlussreicher Digitalisate. Vor allem im Rahmen des Projekts Europeana Travel wurden rare Reisebücher und Ansichten in guter Qualität digitalisiert.
Nicht wenige deutschsprachige Bücher enthält die digitale Bibliothek Sloweniens. Zwar könnte manchmal (insbesondere bei alten Postkarten) die Auflösung besser sein, aber man findet hier eine Menge aufschlussreicher Digitalisate. Vor allem im Rahmen des Projekts Europeana Travel wurden rare Reisebücher und Ansichten in guter Qualität digitalisiert.Carl Reicherts (1836-1918) Vedute von 1863/65 zeigt Radmannsdorf = Radovljica (heutige Fotos auf Wikimedia Commons).
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:IMG-YV1Y2S9U
Alle Türchen 2011

KlausGraf - am Freitag, 16. Dezember 2011, 00:05 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Donnerstag, 15. Dezember 2011, 21:10 - Rubrik: Unterhaltung
Als Ergänzung zu http://archiv.twoday.net/stories/59204071/
teilt mir Falk Eisermann freundlicherweise mit:
Die kursorische Durchsicht von monasterium.net hat bisher Digitalisate von 20 Inkunabel-Einblattdrucken aus den beteiligten Archiven erbracht. Dies ist an sich keine besonders bemerkenswerte Zahl, jedoch waren nicht nur die meisten hier verzeichneten Exemplare bisher nicht bekannt, auch sind nicht weniger als fünf dieser Drucke bislang bibliographisch noch überhaupt nicht bekannt gewesen. Es handelt sich um folgende neue GW-Nummern:
0954615N Eysenflam, Johann Ulrich: Ablassbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken. 1482. Formular für Männer. [Nürnberg: Drucker der Rochuslegende (H 13928)]. Hauptstaatsarchiv München.
M2198250 Maximilian I.: Bescheinigung über empfangene Vorschüsse auf den Gemeinen Pfennig. Donauwörth, 12.III.1496. Formular für besondere Fälle. [Augsburg: Erhard Ratdolt, nicht vor 12.III.1496]. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien.
M3078120 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Memmingen: Albrecht Kunne, nicht nach 9.IV.1489]. Landesarchiv Bregenz.
M3074620 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Ingolstadt: Drucker des Lescherius, nicht nach 9.IV.1490]. Landesarchiv Brno.
M4449450 Summarium tertiae bullae indulgentiarum pro tuitione fidei et insulae Rhodi concessarum. [Augsburg: Hermann Kästlin, nicht vor 4.V.1480]. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien.
Vollständige Beschreibungen unter www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de. Weitere Inkunabel-Funde in monasterium.net gerne an mich.
teilt mir Falk Eisermann freundlicherweise mit:
Die kursorische Durchsicht von monasterium.net hat bisher Digitalisate von 20 Inkunabel-Einblattdrucken aus den beteiligten Archiven erbracht. Dies ist an sich keine besonders bemerkenswerte Zahl, jedoch waren nicht nur die meisten hier verzeichneten Exemplare bisher nicht bekannt, auch sind nicht weniger als fünf dieser Drucke bislang bibliographisch noch überhaupt nicht bekannt gewesen. Es handelt sich um folgende neue GW-Nummern:
0954615N Eysenflam, Johann Ulrich: Ablassbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken. 1482. Formular für Männer. [Nürnberg: Drucker der Rochuslegende (H 13928)]. Hauptstaatsarchiv München.
M2198250 Maximilian I.: Bescheinigung über empfangene Vorschüsse auf den Gemeinen Pfennig. Donauwörth, 12.III.1496. Formular für besondere Fälle. [Augsburg: Erhard Ratdolt, nicht vor 12.III.1496]. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien.
M3078120 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Memmingen: Albrecht Kunne, nicht nach 9.IV.1489]. Landesarchiv Bregenz.
M3074620 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Ingolstadt: Drucker des Lescherius, nicht nach 9.IV.1490]. Landesarchiv Brno.
M4449450 Summarium tertiae bullae indulgentiarum pro tuitione fidei et insulae Rhodi concessarum. [Augsburg: Hermann Kästlin, nicht vor 4.V.1480]. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien.
Vollständige Beschreibungen unter www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de. Weitere Inkunabel-Funde in monasterium.net gerne an mich.
KlausGraf - am Donnerstag, 15. Dezember 2011, 19:13 - Rubrik: Hilfswissenschaften
Monika Lehner schreibt:
Die von +Klaus Graf thematisierte RSS-Ignoranz lässt sich noch steigern. Die Universitätsbibliothek Wien ( http://bibliothek.univie.ac.at ) versteckt die im Rahmen des EOD Services diigtalisierten Bücher/Objekte in den Tiefen von PHAIDRA ( https://phaidra.univie.ac.at/ ) *)
Dort finden sich auch Schätze wie:
Gaius Plinius Secundus: Historia naturalis : libri XXXVII (Venetis : Spira Ioannes 1469) http://phaidra.univie.ac.at/o:19958 - ohne brauchbare Metadaten (die allerdings auch im Bibliothekskatalog fehlen - vgl.http://tiny.cc/w58we ).
Weiterlesen auf G+
https://plus.google.com/u/0/108642235016882389621/posts/CwhDxvkHVFE
Die von +Klaus Graf thematisierte RSS-Ignoranz lässt sich noch steigern. Die Universitätsbibliothek Wien ( http://bibliothek.univie.ac.at ) versteckt die im Rahmen des EOD Services diigtalisierten Bücher/Objekte in den Tiefen von PHAIDRA ( https://phaidra.univie.ac.at/ ) *)
Dort finden sich auch Schätze wie:
Gaius Plinius Secundus: Historia naturalis : libri XXXVII (Venetis : Spira Ioannes 1469) http://phaidra.univie.ac.at/o:19958 - ohne brauchbare Metadaten (die allerdings auch im Bibliothekskatalog fehlen - vgl.http://tiny.cc/w58we ).
Weiterlesen auf G+
https://plus.google.com/u/0/108642235016882389621/posts/CwhDxvkHVFE
KlausGraf - am Donnerstag, 15. Dezember 2011, 19:02 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://nachrichten.lvz-online.de/kultur/news/saechsisches-staatsarchiv-erhaelt-historisch-wertvolle-briefe-darunter-25-goethe-originale/r-news-a-117518.html
„Die Übernahme eines solchen Schatzes gehört zu den Sternstunden eines Archivars“, sagt Abteilungsleiter Volker Jäger in heller Begeisterung. Die Briefbände, allesamt an oder von den großherzoglichen Staatsmännern Jakob Friedrich von Fritsch und seinem Sohn Karl Wilhelm gesendet, würden sich wie ein „Who-is-Who der Weimarer Klassik“ lesen: Wieland, Herder, Humboldt, Hufeland, Goethe und andere Persönlichkeiten sind als Absender verzeichnet, auch ein Fragment von Schillers „Wilhelm Tell“ ist darunter.
Formell gehören die Schriftstücke zum Archiv des ehemaligen Ritterguts Seerhausen bei Oschatz, dessen Besitzer die besagten Freiherrn waren. 800 solcher Rittergutsarchive verwahrt das Sächsische Staatsarchiv, 270 davon in seiner Leipziger Außenstelle. Dass hier nun die Sammlung ergänzt werden kann, darüber ist die Freude groß. Gerade die nicht-amtlichen Schriftwechsel seien es, die staatliche Überlieferungen in allen Bereichen ergänzen könnten, erklärt Referentin Birgit Richter. „Rittergutsarchive sind Quellen der Geschichte unserer Region. Der Schlüssel zu diesen Schätzen liegt aber oft in privatem Nachlass.“
So ist es ein glücklicher Zufall, dass die Erbengemeinschaft der Von-Fritsch-Briefe im Herbst 2010 die Internetseite des Archivs durchsuchte und dabei die lückenhaften Seerhausener Aktenbände entdeckte. „Sie ist dann auf uns zugegangen mit dem Angebot, uns die Schriften zu überlassen“, erinnert sich Jäger. „Gegen eine symbolische Aufwandsentschädigung, die dem Verkaufswert der Briefe nicht ansatzweise nahe kommt.“ Wie die Briefe in die Hände der Erbengemeinschaft gelangt sind, lasse sich leider nicht mehr nachvollziehen, so Jäger.
„Die Übernahme eines solchen Schatzes gehört zu den Sternstunden eines Archivars“, sagt Abteilungsleiter Volker Jäger in heller Begeisterung. Die Briefbände, allesamt an oder von den großherzoglichen Staatsmännern Jakob Friedrich von Fritsch und seinem Sohn Karl Wilhelm gesendet, würden sich wie ein „Who-is-Who der Weimarer Klassik“ lesen: Wieland, Herder, Humboldt, Hufeland, Goethe und andere Persönlichkeiten sind als Absender verzeichnet, auch ein Fragment von Schillers „Wilhelm Tell“ ist darunter.
Formell gehören die Schriftstücke zum Archiv des ehemaligen Ritterguts Seerhausen bei Oschatz, dessen Besitzer die besagten Freiherrn waren. 800 solcher Rittergutsarchive verwahrt das Sächsische Staatsarchiv, 270 davon in seiner Leipziger Außenstelle. Dass hier nun die Sammlung ergänzt werden kann, darüber ist die Freude groß. Gerade die nicht-amtlichen Schriftwechsel seien es, die staatliche Überlieferungen in allen Bereichen ergänzen könnten, erklärt Referentin Birgit Richter. „Rittergutsarchive sind Quellen der Geschichte unserer Region. Der Schlüssel zu diesen Schätzen liegt aber oft in privatem Nachlass.“
So ist es ein glücklicher Zufall, dass die Erbengemeinschaft der Von-Fritsch-Briefe im Herbst 2010 die Internetseite des Archivs durchsuchte und dabei die lückenhaften Seerhausener Aktenbände entdeckte. „Sie ist dann auf uns zugegangen mit dem Angebot, uns die Schriften zu überlassen“, erinnert sich Jäger. „Gegen eine symbolische Aufwandsentschädigung, die dem Verkaufswert der Briefe nicht ansatzweise nahe kommt.“ Wie die Briefe in die Hände der Erbengemeinschaft gelangt sind, lasse sich leider nicht mehr nachvollziehen, so Jäger.
KlausGraf - am Donnerstag, 15. Dezember 2011, 18:59 - Rubrik: Herrschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blog.wikimedia.de/2011/12/15/wissenswert-2011-wir-gratulieren-den-fuenf-gewinnern/
Daniel Mietchen: Open-Access-Medienimporter für Wikimedia Commons
Ein stetig wachsender Anteil wissenschaftlicher Artikel wird unter einer CC BY-Lizenz veröffentlicht, welche eine Nachnutzung der Materialien auf Wikimedia-Projekten zulässt. Viele dieser Artikel beinhalten Abbildungen oder Multimedia-Dateien, die sich zur Illustration enzyklopädischer Inhalte eignen. Bisher wird davon selten Gebrauch gemacht. In diesem Projekt soll daher Software entwickelt werden, welche die Artikel in Open-Access-Zeitschriften systematisch nach Multimedia-Dateien durchsucht, diese dann herunterlädt, in freie Formate konvertiert und auf Wikimedia Commons hochlädt.
Benutzer:Eschenmoser schreibt über das Projekt:
“Der Open-Access-Medienimporter für Wikimedia Commons sichtet freie wissenschaftliche Literatur automatisiert nach geeigneten Dateien und stellt diese für den Transfer nach Commons bereit. Er erschließt dabei nicht nur ein junges, der Öffentlichkeit weitgehend verborgenes Gebiet freier Inhalte einem breiteren Nutzerkreis, sondern bündelt auch Dateien aus der aktuellen Forschung im etablierten Commons-Archiv, welche dort bislang unterrepräsentiert sind. Neben den Vorteilen der vereinfachten Recherchierbarkeit freier, aktueller Forschungsinhalte und deren Bereitstellung für die Wikipedia und ihre Schwesterprojekte, wird die Aufmerksamkeit auf die zu Grunde liegende Literatur gelenkt. Daraus resultierende steigende Zugriffszahlen bieten einen weiteren Anreiz zur Publikation wissenschaftlicher Inhalte unter freien Lizenzen.”
Daniel Mietchen: Open-Access-Medienimporter für Wikimedia Commons
Ein stetig wachsender Anteil wissenschaftlicher Artikel wird unter einer CC BY-Lizenz veröffentlicht, welche eine Nachnutzung der Materialien auf Wikimedia-Projekten zulässt. Viele dieser Artikel beinhalten Abbildungen oder Multimedia-Dateien, die sich zur Illustration enzyklopädischer Inhalte eignen. Bisher wird davon selten Gebrauch gemacht. In diesem Projekt soll daher Software entwickelt werden, welche die Artikel in Open-Access-Zeitschriften systematisch nach Multimedia-Dateien durchsucht, diese dann herunterlädt, in freie Formate konvertiert und auf Wikimedia Commons hochlädt.
Benutzer:Eschenmoser schreibt über das Projekt:
“Der Open-Access-Medienimporter für Wikimedia Commons sichtet freie wissenschaftliche Literatur automatisiert nach geeigneten Dateien und stellt diese für den Transfer nach Commons bereit. Er erschließt dabei nicht nur ein junges, der Öffentlichkeit weitgehend verborgenes Gebiet freier Inhalte einem breiteren Nutzerkreis, sondern bündelt auch Dateien aus der aktuellen Forschung im etablierten Commons-Archiv, welche dort bislang unterrepräsentiert sind. Neben den Vorteilen der vereinfachten Recherchierbarkeit freier, aktueller Forschungsinhalte und deren Bereitstellung für die Wikipedia und ihre Schwesterprojekte, wird die Aufmerksamkeit auf die zu Grunde liegende Literatur gelenkt. Daraus resultierende steigende Zugriffszahlen bieten einen weiteren Anreiz zur Publikation wissenschaftlicher Inhalte unter freien Lizenzen.”
KlausGraf - am Donnerstag, 15. Dezember 2011, 18:49 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eigentlich sollte das Aufsetzen eines RSS-Feeds bei Digitalen Sammlungen zu den leichteren Übungen gehören, aber weit gefehlt. Web 2.0 in dieser Variante ist zwar weltweit bei Bibliotheken angekommen, aber einige hinterwäldlerische Institutionen weigern sich hartnäckig, ihren Nutzern entsprechend entgegenzukommen. Wir dokumentierten hier die Ablehnung der UB Marburg im März 2011:
http://archiv.twoday.net/stories/14868178/
Im April 2011 beschied mich die Direktion der WLB Stuttgart:
Ein RSS-Feed kann angeboten werden, wenn die neue Präsentationsschicht von Goobi dies ermögicht.
Nun reiht sich die UB Tübingen in die Gruppe der Bibliotheken, die nix kapiert haben, ein:
Wir können in dieser Funktion keine Nutzen erkennen, der es rechtfertigen würde, Resourcen aus anderen Aufgaben abzuziehen.
Dr. Ingo Rohlfs
Universitaetsbibliothek Tuebingen
Die Frage lautete:
Wieso schafft es die UB Tübingen nicht, einen RSS-Feed für ihre Digitalen Sammlungen, die nach dem Muster von Heidelberg, Darmstadt und nun auch Giessen funktionieren, anzubieten, wenn doch die genannten Vorbilder das problemlos realisieren können?
Wenn Bibliotheken im Rahmen des baden-württembergischen LEO-Programms dicke fette Fördergelder für die Digitalisierung absahnen - sollte man nicht auch auf ein Mindestmaß an Nutzerfreundlichkeit achten, wozu mindestens ein RSS-Feed (gern auch mehrere) gehört?
Update: http://archiv.twoday.net/stories/232601393/
http://archiv.twoday.net/stories/14868178/
Im April 2011 beschied mich die Direktion der WLB Stuttgart:
Ein RSS-Feed kann angeboten werden, wenn die neue Präsentationsschicht von Goobi dies ermögicht.
Nun reiht sich die UB Tübingen in die Gruppe der Bibliotheken, die nix kapiert haben, ein:
Wir können in dieser Funktion keine Nutzen erkennen, der es rechtfertigen würde, Resourcen aus anderen Aufgaben abzuziehen.
Dr. Ingo Rohlfs
Universitaetsbibliothek Tuebingen
Die Frage lautete:
Wieso schafft es die UB Tübingen nicht, einen RSS-Feed für ihre Digitalen Sammlungen, die nach dem Muster von Heidelberg, Darmstadt und nun auch Giessen funktionieren, anzubieten, wenn doch die genannten Vorbilder das problemlos realisieren können?
Wenn Bibliotheken im Rahmen des baden-württembergischen LEO-Programms dicke fette Fördergelder für die Digitalisierung absahnen - sollte man nicht auch auf ein Mindestmaß an Nutzerfreundlichkeit achten, wozu mindestens ein RSS-Feed (gern auch mehrere) gehört?
Update: http://archiv.twoday.net/stories/232601393/
KlausGraf - am Donnerstag, 15. Dezember 2011, 14:36 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Zar Nikolaus an seinen Lehrer:
Es grüsst Sie der den Sie Esel nannten, Nikolaus.
http://goo.gl/e9kjt
Es grüsst Sie der den Sie Esel nannten, Nikolaus.
http://goo.gl/e9kjt
vom hofe - am Donnerstag, 15. Dezember 2011, 14:15 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Hier der Link zur Rezension des Buchs "Der Geschmack des Archivs" von Arlette Farge auf H-Soz-U-Kult:
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/type=rezbuecher&id=16789
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/type=rezbuecher&id=16789
rhwinter - am Donnerstag, 15. Dezember 2011, 09:10 - Rubrik: Wahrnehmung
 Wie schon im letzten Jahr präsentieren wir auch heuer ein im aktuell einsehbaren Handschriftencensus noch nicht verzeichnetes Handschriftenfragment eines renommierten mittelhochdeutschen Textes - in der Hoffnung, dass uns wenigstens dieses Jahr das "Ick bün allhier" von Klaus Klein erspart bleiben möge. Die Identifizierungsarbeit letztes Jahr leistete Beatrix Knoll, heuer war erst einmal herauszubekommen, welcher Text, in dem Willehalm Protagonist ist, vorliegt. Stammte letztes Jahr das Fragment aus der Vorgeschichte der Willehalm-Trilogie aus der Arabel, Wolframs Willehalm und dem Rennewart, so gehört es heuer der Fortsetzung, also Ulrichs von Türheim 'Rennewart', an.
Wie schon im letzten Jahr präsentieren wir auch heuer ein im aktuell einsehbaren Handschriftencensus noch nicht verzeichnetes Handschriftenfragment eines renommierten mittelhochdeutschen Textes - in der Hoffnung, dass uns wenigstens dieses Jahr das "Ick bün allhier" von Klaus Klein erspart bleiben möge. Die Identifizierungsarbeit letztes Jahr leistete Beatrix Knoll, heuer war erst einmal herauszubekommen, welcher Text, in dem Willehalm Protagonist ist, vorliegt. Stammte letztes Jahr das Fragment aus der Vorgeschichte der Willehalm-Trilogie aus der Arabel, Wolframs Willehalm und dem Rennewart, so gehört es heuer der Fortsetzung, also Ulrichs von Türheim 'Rennewart', an.[Nachtrag: Zu einem weiteren Rennewart-Fragment:
http://archiv.twoday.net/stories/59205764/ ]
Doch zunächst einige Worte zur digitalen Sammlung, in der man ein solches Stück ganz und gar nicht erwartet: Monasterium.net. Am besten steigt man bei Monasterium.net über die Fonds-Seite (sinnigerweise auf der Hauptseite nicht verlinkt) ein:
http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/fonds
Kürzlich habe ich eine Wikisource-Seite zu digitalen Sammlungen von Archiven (mit deutschsprachigen Schriftdokumenten) begonnen, aus der bereits jetzt vor allem eines deutlich hervorgeht: Ohne das Engagement der Macher von Monasterium (man darf wohl auch sagen: ohne Thomas Aigner) sähe es hinsichtlich der Digitalisierung von Archivalien bzw. ihrer Bereitstellung Open Access im deutschsprachigen Raum noch viel schwärzer aus. Erstaunlich viele vor allem kirchliche Institutionen ließen sich überzeugen, ihre Urkundenschätze durch Digitalisierung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir haben daher Monasterium in diesem Weblog schon oft erwähnt. Über 250.000 Dokumente sind bis jetzt online, darunter die Urkunden aus dem Stiftsarchiv St. Gallen ab dem Jahr 1000. Im Mitteleuropäischen Raum ist keine andere Archivaliengattung durch Digitalisierungsprojekte (und das heißt bislang vor allem: Monasterium) so gut abgedeckt wie die mittelalterlichen Urkunden.
[Nachtrag: GW findet unbekannte Einblattdrucke in Monasterium:
http://archiv.twoday.net/stories/59204737/ ]
In Monasterium findet man auch folgende Sammlung: Die Professur für Historische Grundwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität besitzt eine Sammlung von Urkunden [und] Handschriftenfragmenten aus der Zeit von 1181 bis ins 19. Jahrhundert. Die zu Lehrzwecken aufgebaute Sammlung enthält vorwiegend kassierte und später als Bucheinband verwendete Pergamentstücke. Mehr als Gedicht; Fragment einer Willehalm-Handschrift erfährt man zu Nr. 198 nicht:
http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/DE-LMUHGW/Urkunden/198/charter
Im Grunde genommen ist es nur ärgerlich, dass kein separat durchsuch- und einsehbares Corpus der wichtigen mittelhochdeutschen Texte zur Verfügung steht, obwohl die DFG dafür nicht wenig Geld ausgegeben hatte. Das Trierer Projekt präsentiert sich als Torso, die ergänzende Textsammlung der Universität Virginia wurde eingestellt. Die Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank war offline, als ich nach dem Text suchte, da ich nicht einfach ins Regal greifen und die Ausgaben der Arabel, von Wolframs Willehalm und des Rennewart herausziehen konnte. Glücklicherweise hatte jemand in PBB einen Vers aus dem Fragment mit Stellenangabe zitiert, Google hat also wieder einmal entscheidend geholfen.
Üblicherweise identifiziert man den Autor Ulrich von Türheim mit einem Zeugen in zwei Augsburger Urkunden von 1236 und 1244. Die Ministerialenfamilie von Türheim nannte sich nach dem Ort im Zusamtal, heute Oberthürheim und Unterthürheim in der Gemeinde Buttenwiesen, wo eine Schule "Ulrich von Thürheim" im Namen führt (²VL). Der Wikipedia-Artikel Buttenwiesen nennt den Epiker Minnesänger, der Adelsartikel "Thürheimer" ist (wie viele andere Adelsartikel der Wikipedia) einfach unsäglich.
Der Textbestand des Münchner Fragments findet sich in der Ausgabe von Alfred Hübner, Ulrich von Türheim: Rennewart. Aus der Berliner und Heidelberger Handschrift (Deutsche Texte des Mittelalters 39), Berlin 1938 auf S. 496f. (beide Seiten auf Commons).
Die Vorderseite reicht von
33405 so mu+oz michz got beno+eten
und mit gewalte to+eten
bis
33446 sich beginnent aber die heiden
(übergeschriebene Buchstaben mit + codiert)
Die Rückseite von
33447 vaste su+ochen mit ir her
bis
33488 weistu, herre, daz er sprach:
Wer die Stelle in einer Handschrift des 14. Jahrhunderts nachlesen möchte und nicht in einer modernen Ausgabe, sei auf das Digitalisat des Cpg 404, Bl. 257r verwiesen.
Nun galt es festzustellen, ob das Fragment einem bereits bisher bekannten Codex discissus (einer in mehreren Fragmenten vorliegenden zerschnittenen Handschrift) angehört. Dazu musste ich vor allem die Zeilen zählen: 42 und auf die Maße achten. Als Mitglied der Wolfram-Gesellschaft nenne ich Klaus Klein, Neues Gesamtverzeichnis der Handschriften des 'Rennewart' Ulrichs von Türheim, in: Wolfram-Studien XV (1998), S. 451-493 mein eigen, aber die meisten relevanten Angaben wurden in den Handschriftencensus übernommen. Bei 42 Zeilen kam eigentlich nur das Regensburger Fragment in Betracht, da das verschollene Mittler'sche Fragment (mit ebenfalls 42 Zeilen) ganz anders eingerichtet ist.
Kleins Fragment 6 (S. 465) ist in bairischer Schreibsprache verfasst und stammt aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts:
http://www.handschriftencensus.de/1783
"Anfangsbuchstaben der ungeraden Verse, Majuskeln auf eigene Linie ausgerückt . dreizeilige, abwechselnd rote und blaue bzw. grüne Abschnittsinitalen", schreibt Klein. Das passt nun exakt auf das Münchner Fragment. Auch die Maße stimmen in etwa überein: Höhe des Schriftraums ca. 23,6 cm (Regensburg: 24 cm), Höhe des Fragments ca. 33,2 cm (Regensburg 33,5-34 cm).
Das Regensburger Fragment - Bibliothek des Historischen Vereins im Stadtarchiv Regensburg Ms. Misc. 62 - wurde 1856 von Karl Roth in der Vereinszeitschrift publiziert (Separatausgabe bei Google Books, Nachweis des Zeitschriftendigitalisats im Handschriftencensus). Es hat in der Ausgabe Hübners die Sigle G und steht dem Textzeugen K nahe (Hübners Stemma S. XLIV ist auf Commons verfügbar), was sich in den Varianten des Fragments bestätigt, das in Vers 33467 wie K und Z Karitat hat und damit gegen BDHMVZa steht.
Das Stadtarchiv Regensburg wollte nicht helfen, aber ein Schriftvergleich mit SW-Kopien bestätigte, dass das Münchner Stück tatsächlich aus dem Codex stammt, dem das Regensburger Stück angehört. Aussagekräftig sind insbesondere die Majuskeln am Zeilenanfang, und auch die anderen Buchstabenformen stimmen überein (wenngleich die Verteilung der beiden z-Formen in beiden Fragmenten differiert). Damit sind immer noch 41 Handschriften bekannt, da das Fragment einem Codex discissus angehört, der bisher nur vom Regensburger Stück vertreten wurde. Allerdings hat sich die Anzahl der bekannten Rennewart-Fragmente um eins erhöht.
Nicht erklären kann ich die Beschriftung auf der Rückseiteseite des Münchner Fragments von einer Hand des 19. oder frühen 20. Jahrhunderts: 12,380 Liechtenberg.
Alle Türchen 2011
#forschung
 LMU-Fragment (ohne Maßstab)
LMU-Fragment (ohne Maßstab) Regensburger Fragment
Regensburger FragmentKlausGraf - am Donnerstag, 15. Dezember 2011, 00:01 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
The Association of Academic Museums and Galleries is deeply disappointed in the recent ruling by the Tennessee Appeals Court, of November 29, 2011, that allows Fisk University to sell fifty percent of its Stieglitz collection to the Crystal Bridges Museum to raise funds for the university’s operating budget. We believe that this action irrevocably damages the public’s trust in the university and its art galleries.
According to the best standards of the museum profession, as delineated by the American Association of Museums, works from a museum’s permanent collection may be deaccessioned following a thoughtful, written procedure, but all funds from the sale of deaccessioned work may only be used to acquire new works or for direct care (including conserving other works in the collection). Such funds may not be used neither to support the museum’s general operations, nor may they be used to fund the operations of a parent institution. Museum supporters, including donors of works of art, are unlikely to continue their support of a museum that has no control over its professional practices.
Further, such disposal of work undermines the mission of the academic museum, whose collections directly support pedagogical programs and the appreciation of art for the general public.
The AAMG, which has more than 400 members across the country, joins the Association of Art Museum Directors (AAMD) in its statement of December 8, 2011, in condemning the ruling and proposed partial sale of the Stieglitz collection. The proposed use of the deaccession funds stands in opposition to the ethical and professional standards established by the museum field and threatens the integrity of all university collections.
Jill Hartz, Executive Director
President, Association of Academic Museums and Galleries
Jordan Schnitzer Museum of Art
1223 University of Oregon
Eugene, OR 97403-1223
Tel: 541.346.0972
Fax: 541.346.0976
Cell: 541.868.4138
--
Kris Anderson
Jacob Lawrence Gallery
School of Art
University of Washington
------------
Vice President of Communications
Association of Academic Museums and Galleries
Via AAMG-L
AAMD-Statement
http://www.aamd.org/newsroom/documents/2011_12_8_11FinalAAMDStatementRegardingStieglitzCollectionatFiskUniversity.doc
According to the best standards of the museum profession, as delineated by the American Association of Museums, works from a museum’s permanent collection may be deaccessioned following a thoughtful, written procedure, but all funds from the sale of deaccessioned work may only be used to acquire new works or for direct care (including conserving other works in the collection). Such funds may not be used neither to support the museum’s general operations, nor may they be used to fund the operations of a parent institution. Museum supporters, including donors of works of art, are unlikely to continue their support of a museum that has no control over its professional practices.
Further, such disposal of work undermines the mission of the academic museum, whose collections directly support pedagogical programs and the appreciation of art for the general public.
The AAMG, which has more than 400 members across the country, joins the Association of Art Museum Directors (AAMD) in its statement of December 8, 2011, in condemning the ruling and proposed partial sale of the Stieglitz collection. The proposed use of the deaccession funds stands in opposition to the ethical and professional standards established by the museum field and threatens the integrity of all university collections.
Jill Hartz, Executive Director
President, Association of Academic Museums and Galleries
Jordan Schnitzer Museum of Art
1223 University of Oregon
Eugene, OR 97403-1223
Tel: 541.346.0972
Fax: 541.346.0976
Cell: 541.868.4138
--
Kris Anderson
Jacob Lawrence Gallery
School of Art
University of Washington
------------
Vice President of Communications
Association of Academic Museums and Galleries
Via AAMG-L
AAMD-Statement
http://www.aamd.org/newsroom/documents/2011_12_8_11FinalAAMDStatementRegardingStieglitzCollectionatFiskUniversity.doc
KlausGraf - am Mittwoch, 14. Dezember 2011, 21:23 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Weder in Googlemail noch im Reader finden die Designänderungen meine Zustimmung. Ich bin außerordentlich verärgert, dass in Chrome keine Navigationspfeile mehr zur Verfügung stehen, ich mich extrem umgewöhnen muss und alles viel zu blass geraten ist.
Leider wurde auch an GBS herumgeschraubt. Schwachsinnig ist das verschwinden der Möglichkeit, durch Eingabe einer Seitenzahl bei Büchern in Vollansicht eine Seite direkt anzusteuern. Wenn man nicht in der URL navigieren will, muss man das Zahnrad mit den Einstellungen (und zwar das untere, wenn man in Google eingeloggt ist) aufrufen und dort zur Textansicht gehen. Dort findet man das gewohne Eingabefeld. Von der Textansicht kann man dann wieder zum Faksimile wechseln. Unter den Einstellungen ist nun auch der PDF-Download abzurufen, den viele schon vermisst haben dürften.
 Mit der Schere kann man einen Clip ausschneiden.
Mit der Schere kann man einen Clip ausschneiden.
Leider wurde auch an GBS herumgeschraubt. Schwachsinnig ist das verschwinden der Möglichkeit, durch Eingabe einer Seitenzahl bei Büchern in Vollansicht eine Seite direkt anzusteuern. Wenn man nicht in der URL navigieren will, muss man das Zahnrad mit den Einstellungen (und zwar das untere, wenn man in Google eingeloggt ist) aufrufen und dort zur Textansicht gehen. Dort findet man das gewohne Eingabefeld. Von der Textansicht kann man dann wieder zum Faksimile wechseln. Unter den Einstellungen ist nun auch der PDF-Download abzurufen, den viele schon vermisst haben dürften.
KlausGraf - am Mittwoch, 14. Dezember 2011, 21:06 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die EU-Kommission hat massiv Partei für Open Data ergriffen. Mehr dazu unter
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=19238
Die Kommission schlägt vor, die Richtlinie von 2003 über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors wie folgt zu ändern:
Grundsätzlich sollen alle Dokumente, die von öffentlichen Stellen zugänglich gemacht werden, auch zu beliebigen – gewerblichen wie nicht-gewerblichen – Zwecken weiterverwendet werden können, soweit sie nicht durch Urheberrechte Dritter geschützt sind.
Festlegung des Grundsatzes, dass öffentliche Stellen dafür keine Gebühren verlangen dürfen, die über den durch die jeweilige Einzelanforderung verursachten Mehrkosten („Zusatzkosten“) liegen; in der Praxis bedeutet dies, dass die meisten Daten kostenlos oder so gut wie kostenlos bereitgestellt werden, soweit die Erhebung von Gebühren nicht ordnungsgemäß begründet wird.
Einführung einer Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten in üblichen, maschinenlesbaren Formaten, damit die Daten effektiv weiterverwendet werden können.
Schaffung einer behördlichen Aufsicht zur Durchsetzung dieser Grundsätze.
Massive Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Richtlinie, nämlich zum ersten Mal auch auf Bibliotheken, Museen und Archive; die bestehenden Vorschriften von 2003 werden dann auch für Daten aus solchen Einrichtungen gelten.
Darüber hinaus wird die Kommission ihre eigenen Daten über ein neues „Datenportal“ öffentlich zugänglich machen. Hierfür hat sie bereits einen Vertrag geschlossen. Dieses Portal befindet sich gegenwärtig noch in der „Beta-Version“ (Entwicklungs- und Testphase) und soll im Frühjahr 2012 an den Start gehen. (Hervorhebung original)
Das ist der richtige Schritt. Dass unter anderem die Archive von der Weiterverwendungsrichtlinie ausgenommen waren, habe ich nie eingesehen.
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/64967767/
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=19238
Die Kommission schlägt vor, die Richtlinie von 2003 über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors wie folgt zu ändern:
Grundsätzlich sollen alle Dokumente, die von öffentlichen Stellen zugänglich gemacht werden, auch zu beliebigen – gewerblichen wie nicht-gewerblichen – Zwecken weiterverwendet werden können, soweit sie nicht durch Urheberrechte Dritter geschützt sind.
Festlegung des Grundsatzes, dass öffentliche Stellen dafür keine Gebühren verlangen dürfen, die über den durch die jeweilige Einzelanforderung verursachten Mehrkosten („Zusatzkosten“) liegen; in der Praxis bedeutet dies, dass die meisten Daten kostenlos oder so gut wie kostenlos bereitgestellt werden, soweit die Erhebung von Gebühren nicht ordnungsgemäß begründet wird.
Einführung einer Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten in üblichen, maschinenlesbaren Formaten, damit die Daten effektiv weiterverwendet werden können.
Schaffung einer behördlichen Aufsicht zur Durchsetzung dieser Grundsätze.
Massive Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Richtlinie, nämlich zum ersten Mal auch auf Bibliotheken, Museen und Archive; die bestehenden Vorschriften von 2003 werden dann auch für Daten aus solchen Einrichtungen gelten.
Darüber hinaus wird die Kommission ihre eigenen Daten über ein neues „Datenportal“ öffentlich zugänglich machen. Hierfür hat sie bereits einen Vertrag geschlossen. Dieses Portal befindet sich gegenwärtig noch in der „Beta-Version“ (Entwicklungs- und Testphase) und soll im Frühjahr 2012 an den Start gehen. (Hervorhebung original)
Das ist der richtige Schritt. Dass unter anderem die Archive von der Weiterverwendungsrichtlinie ausgenommen waren, habe ich nie eingesehen.
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/64967767/
KlausGraf - am Mittwoch, 14. Dezember 2011, 20:26 - Rubrik: E-Government
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blog.wikimedia.de/2011/12/14/visuellen-editor-fur-wikipedia-erster-prototyp-veroffentlicht/
Testen möglich unter
http://www.mediawiki.org/wiki/Special:VisualEditorSandbox
Testen möglich unter
http://www.mediawiki.org/wiki/Special:VisualEditorSandbox
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das sind gute Nachrichten:
http://listserver.sigmaxi.org/sc/wa.exe?A2=ind11&L=american-scientist-open-access-forum&D=1&O=D&F=l&P=38672
http://listserver.sigmaxi.org/sc/wa.exe?A2=ind11&L=american-scientist-open-access-forum&D=1&O=D&F=l&P=38672
KlausGraf - am Mittwoch, 14. Dezember 2011, 20:19 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Link: http://www.dwud.lwl.org
Wer sich bisher einen Überblick über historische Urkunden verschaffen wollte, war gezwungen, viele Orte aufzusuchen. Denn die archivische Überlieferung in Westfalen-Lippe aus dem Mittelalter und der Frühneuzeit ist aufgrund der vielen Kleinstaaten, die sich in der Region seit dem Mittelalter herausgebildet hatten, außerordentlich zerstreut. Im Rahmen des Kooperationsprojekts "Digitale Westfälische Urkunden-Datenbank" (DWUD) machen das LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte und das LWL-Archivamt für Westfalen - in Kooperation mit der Stiftung Westfalen-Initiative - die heute auf viele staatliche, kommunale, private und kirchliche Archive verteilten Quellen nun online unter der Webadresse http://www.dwud.lwl.org öffentlich zugänglich.
Bereits in den 1930er Jahren war von Archivaren der Plan entwickelt
worden, über die Archiv- und Bestandsgrenzen hinweg einen Gesamtnachweis aller westfälischen Urkunden zu schaffen. Auf Karteikarten wurden seitdem von den Mitarbeitern der Vorläufereinrichtung des heutigen LWL-Archivamts für Westfalen so genannte Regesten verfasst, die inhaltliche Zusammenfassungen der Urkunden enthalten, die im Rahmen von Betreuungs- oder Erschließungsarbeiten in die Hand genommen worden waren. Auf diese Weise kamen bis in die 1970er Jahre rund 65.000 chronologisch geordnete Karteikarten aus über 250 Archivbeständen aus ganz Westfalen-Lippe zusammen. "Eine Menge, die man mit traditionellen Mitteln nicht mehr beherrschen konnte. Dies bedeutete das Ende der Arbeiten, und so ruhte dieser große kulturelle Schatz Westfalens seitdem in den Magazinräumen des Archivs", erklärt Projektleiter Dr. Marcus Weidner vom LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte.
Als neues Modul des Internet-Portals "Westfälische Geschichte", das
Service- und Informationsangebote rund um die Geschichte Westfalens bietet, können Interessierte auf viele dieser Regesten nun über das Internet zugreifen. "Der besondere Vorteil liegt darin, dass Interessierte nun gleichzeitig alle in DWUD verfügbaren Archivbestände durchsuchen können - jederzeit und von zuhause aus", so Weidner. DWUD bietet aber nicht nur die digitalisierten Karteikarten, die nach Datum und Archiv aufrufbar sind, sondern darüber hinaus auch zehntausende Urkundenregesten, deren Textinhalte im vollen Wortlaut durchsucht werden können.
Zahlreiche staatliche, kommunale, kirchliche oder private Archive haben hierfür ihre Urkundenregesten zur Verfügung gestellt, darunter die Mitglieder der Vereinigten Westfälischen Adelsarchive e.V. und das Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen. Doch Dr. Peter Worm vom LWL-Archivamt, der für das Projekt aus archivfachlicher Sicht verantwortlich ist, möchte mehr: "Langfristiges Ziel ist es, eine speziell auf die Quellengattung 'Urkunde' ausgerichtete Internetpräsenz
zu schaffen, in die alle Einrichtungen, die über Urkunden aus Westfalen-Lippe verfügen, ihre Regesten einspeisen können. Zudem soll das Angebot ständig erweitert werden."
Mit über 85.000 Regesten, die nun freigeschaltet worden sind, ist hierfür der Grundstein gelegt. Die beiden LWL-Einrichtungen versprechen sich von dem Projekt, in das auch Drittmittel der Westfalen-Initiative und des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes eingeflossen sind, vielfältige Impulse für die Beschäftigung mit westfälischer Geschichte. "Heimat- und Familienforscher können besonders davon profitieren, da über eine
spezielle Suche, die nicht exakt die Buchstaben, sondern deren Laut
analysiert, nach Orts- und Personennamen gesucht werden kann, die von der heutigen Schreibung abweichen. Da hat es schon Aha-Erlebnisse von Testern gegeben, die nach ihren Ahnen gesucht haben", sagt Weidner.
Digitale Westfälische Urkunden-Datenbank
URL: http://www.dwud.lwl.org
Gesamtprojektleitung, Konzept
Dr. Marcus Weidner
LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte
Karlstraße 33 I 48147 Münster
Tel. 0251 591-5691 I Fax 0251 591-3282
E-Mail: marcus.weidner@lwl.org
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org
(Internet-Portal)
URL: http://www.lwl-regionalgeschichte.de (Institut)
URL: http://www.dwud.lwl.org (DWUD)
Projektleitung Archiv
Dr. Peter Worm
LWL-Archivamt für Westfalen
Jahnstraße 26 I 48147 Münster
Tel. 0251 591-4030 I Fax 0251 591-269
E-Mail: peter.worm@lwl.org
URL: http://www.lwl-archivamt.de
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Wer sich bisher einen Überblick über historische Urkunden verschaffen wollte, war gezwungen, viele Orte aufzusuchen. Denn die archivische Überlieferung in Westfalen-Lippe aus dem Mittelalter und der Frühneuzeit ist aufgrund der vielen Kleinstaaten, die sich in der Region seit dem Mittelalter herausgebildet hatten, außerordentlich zerstreut. Im Rahmen des Kooperationsprojekts "Digitale Westfälische Urkunden-Datenbank" (DWUD) machen das LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte und das LWL-Archivamt für Westfalen - in Kooperation mit der Stiftung Westfalen-Initiative - die heute auf viele staatliche, kommunale, private und kirchliche Archive verteilten Quellen nun online unter der Webadresse http://www.dwud.lwl.org öffentlich zugänglich.
Bereits in den 1930er Jahren war von Archivaren der Plan entwickelt
worden, über die Archiv- und Bestandsgrenzen hinweg einen Gesamtnachweis aller westfälischen Urkunden zu schaffen. Auf Karteikarten wurden seitdem von den Mitarbeitern der Vorläufereinrichtung des heutigen LWL-Archivamts für Westfalen so genannte Regesten verfasst, die inhaltliche Zusammenfassungen der Urkunden enthalten, die im Rahmen von Betreuungs- oder Erschließungsarbeiten in die Hand genommen worden waren. Auf diese Weise kamen bis in die 1970er Jahre rund 65.000 chronologisch geordnete Karteikarten aus über 250 Archivbeständen aus ganz Westfalen-Lippe zusammen. "Eine Menge, die man mit traditionellen Mitteln nicht mehr beherrschen konnte. Dies bedeutete das Ende der Arbeiten, und so ruhte dieser große kulturelle Schatz Westfalens seitdem in den Magazinräumen des Archivs", erklärt Projektleiter Dr. Marcus Weidner vom LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte.
Als neues Modul des Internet-Portals "Westfälische Geschichte", das
Service- und Informationsangebote rund um die Geschichte Westfalens bietet, können Interessierte auf viele dieser Regesten nun über das Internet zugreifen. "Der besondere Vorteil liegt darin, dass Interessierte nun gleichzeitig alle in DWUD verfügbaren Archivbestände durchsuchen können - jederzeit und von zuhause aus", so Weidner. DWUD bietet aber nicht nur die digitalisierten Karteikarten, die nach Datum und Archiv aufrufbar sind, sondern darüber hinaus auch zehntausende Urkundenregesten, deren Textinhalte im vollen Wortlaut durchsucht werden können.
Zahlreiche staatliche, kommunale, kirchliche oder private Archive haben hierfür ihre Urkundenregesten zur Verfügung gestellt, darunter die Mitglieder der Vereinigten Westfälischen Adelsarchive e.V. und das Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen. Doch Dr. Peter Worm vom LWL-Archivamt, der für das Projekt aus archivfachlicher Sicht verantwortlich ist, möchte mehr: "Langfristiges Ziel ist es, eine speziell auf die Quellengattung 'Urkunde' ausgerichtete Internetpräsenz
zu schaffen, in die alle Einrichtungen, die über Urkunden aus Westfalen-Lippe verfügen, ihre Regesten einspeisen können. Zudem soll das Angebot ständig erweitert werden."
Mit über 85.000 Regesten, die nun freigeschaltet worden sind, ist hierfür der Grundstein gelegt. Die beiden LWL-Einrichtungen versprechen sich von dem Projekt, in das auch Drittmittel der Westfalen-Initiative und des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes eingeflossen sind, vielfältige Impulse für die Beschäftigung mit westfälischer Geschichte. "Heimat- und Familienforscher können besonders davon profitieren, da über eine
spezielle Suche, die nicht exakt die Buchstaben, sondern deren Laut
analysiert, nach Orts- und Personennamen gesucht werden kann, die von der heutigen Schreibung abweichen. Da hat es schon Aha-Erlebnisse von Testern gegeben, die nach ihren Ahnen gesucht haben", sagt Weidner.
Digitale Westfälische Urkunden-Datenbank
URL: http://www.dwud.lwl.org
Gesamtprojektleitung, Konzept
Dr. Marcus Weidner
LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte
Karlstraße 33 I 48147 Münster
Tel. 0251 591-5691 I Fax 0251 591-3282
E-Mail: marcus.weidner@lwl.org
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org
(Internet-Portal)
URL: http://www.lwl-regionalgeschichte.de (Institut)
URL: http://www.dwud.lwl.org (DWUD)
Projektleitung Archiv
Dr. Peter Worm
LWL-Archivamt für Westfalen
Jahnstraße 26 I 48147 Münster
Tel. 0251 591-4030 I Fax 0251 591-269
E-Mail: peter.worm@lwl.org
URL: http://www.lwl-archivamt.de
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Wolf Thomas - am Mittwoch, 14. Dezember 2011, 12:12 - Rubrik: Kooperationsmodelle
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 Das vielleicht skurrilste europäische Digitalisierungsprojekt ist das der Universitätsbibliothek"Mykhailo Maksymovych" der Kyiv National Taras Shevchenko University (KNTSU) in Kiew. Ich habe mich dazu schon 2008 und 2009 geäußert:
Das vielleicht skurrilste europäische Digitalisierungsprojekt ist das der Universitätsbibliothek"Mykhailo Maksymovych" der Kyiv National Taras Shevchenko University (KNTSU) in Kiew. Ich habe mich dazu schon 2008 und 2009 geäußert:http://archiv.twoday.net/stories/5817353/
Die Sammlung umfasst derzeit 1001 beschriebene und 2056 unbeschriebene, also nicht mit Metadaten versehene Bücher:
http://www.rarelib.undp.org.ua/eng/index.php3
Nach wie vor ist völlig rätselhaft, wieso die ukrainische Bibliothek um Hilfe bittet. Wieso sollte es Bibliothekaren, die weltweit ausländische Literatur auch ohne vertiefte Sprachkenntnisse katalogisieren, nicht möglich sein, die Titel zu erfassen? Nach wie vor nimmt das englischsprachige Formular "Add comment" keine Einträge an. Ich hatte seinerzeit vergeblich versucht, mit den Betreibern zu kommunizieren, auch unter Einschaltung Sprachkundiger, was scheiterte. Fast sollte man meinen, Kiew liege nicht am Rande Europas, sondern auf dem Mars!
Über 2000 Buchdigitalisate ohne Metadaten klingt nach einer Wundertüte, aber leider ist es eher ein Müllhaufen. Ich gehe nicht auf die Titel in kyrillischer Schrift ein, die ich nur mühsam entziffern kann. Was die westlichen Titel betrifft, so gibt es zuhauf mehrbändige eher bedeutungslose französische Werke, die entweder nicht komplett sind oder bei denen man sich die einzelnen Bände zusammensuchen muss. Raritäten sind rar, vieles ist auch schon bei Google zu finden.
Nachdem ich über 230 Titelseiten durchgesehen hatte, stieß ich unter den unbeschriebenen Drucken dann aber doch noch auf eine kleine Perle:
http://www.rarelib.undp.org.ua/eng/showbook/showbook.php3?0160324r
Für die Wissenschaftsgeschichte ist die seltene Erstausgabe der "Essais sur les Machines Hydrauliques" (1777) des französischen Ingenieurs Charles Louis Ducrest (1747-1824) durchaus von Interesse. Das Buch ist laut KVK in Deutschland nur in Berlin, Gotha und Göttingen vorhanden. Ein Digitalisat habe ich außer in Kiew nirgends gefunden.
Da es keinen Download des gesamten Werks gibt, wäre es sinnvoll, brauchbare Bücher herunterzuladen und ins Internet Archive einzustellen, wo sie erheblich besser gefunden werden als in dem obskuren ukrainischen Repositorium, das zudem öfter mal offline ist.
Alle Türchen 2011
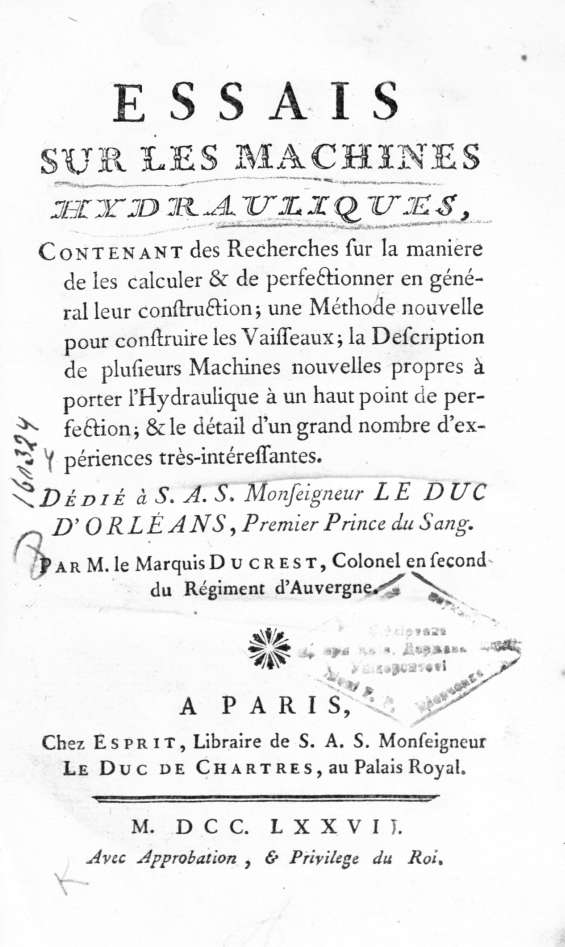
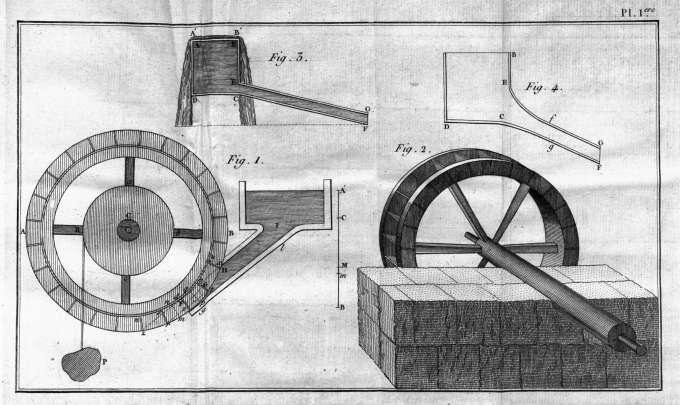
KlausGraf - am Mittwoch, 14. Dezember 2011, 00:06 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Nachgetragen sei der Bericht am 3. Dezember 2011 der Allgemeinen Zeitung über die Sitzung des Kulturausschusses. Vor der Sitzung Vor der übergaben Magdalena Bork und Thomas Busch von der Mainzer Bibliotheksgesellschaft eine Petition mit 5283 Unterschriften zum Erhalt der Stadtbibliothek an Kulturdezernentin Marianne Grosse. Vor allem die CDU war wütend darüber, dass vor allem die Kultur bluten muss.
„Bei allem Verständnis trifft es die Kultur in unverhältnismäßiger Härte - die Ampel scheint kein Freund der Kultur zu sein“, klagte Dr. Walter Konrad (CDU). „Es muss eine Möglichkeit geben, aus dem unerträglich geschrumpften Etat der Stadtbibliothek wenigstens die wichtigsten Anschaffungen vorzunehmen - sonst kann man in drei, vier Jahren abschließen. Dann ist das ein Mausoleum, aber keine lebendige Bibliothek mehr.“ CDU-Fraktionsvorsitzende Dr. Andrea Litzenburger sprach von einem „einmaligen Vorgang, den wir hier erleben“. [...] Litzenburger: „Die Stadtbibliothek wird zwar nicht totgeschlagen, aber sie überlebt als Krüppel.“
http://www.allgemeine-zeitung.de/region/mainz/meldungen/11431064.htm
Die Bildersammlung zur Stadtbibliothek auf Wikimedia Commons ist weiter gewachsen. Es sind nun 61 in der allgemeinen Kategorie und 16 Handschriftenabbildungen.
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stadtbibliothek_Mainz
Zum Thema
http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbibliothek+mainz
Update 19.12.2011: Annelen Otterman in der Provenienz-ML: "Die entscheidende Stadtratssitzung hat am 14.12. stattgefunden, Mainz ist dem Entschuldungsfonds des Landes beigetreten.
Für uns bedeutet das im Klartext eine Reduzierung von jetzt 33 auf 13 Stellen und bestenfalles eine Halbierung des Erwerbungsetats. Wir werden künftig zwei "Leuchttürme" mit niedriger Wattzahl erhellen - denjenigen der Altbestände und Handschriften und den der Regionalia. Zumindest zu diesen beiden Schwerpunkten hoffen wir, noch vereinzelte Forschungsliteratur kaufen zu können."

„Bei allem Verständnis trifft es die Kultur in unverhältnismäßiger Härte - die Ampel scheint kein Freund der Kultur zu sein“, klagte Dr. Walter Konrad (CDU). „Es muss eine Möglichkeit geben, aus dem unerträglich geschrumpften Etat der Stadtbibliothek wenigstens die wichtigsten Anschaffungen vorzunehmen - sonst kann man in drei, vier Jahren abschließen. Dann ist das ein Mausoleum, aber keine lebendige Bibliothek mehr.“ CDU-Fraktionsvorsitzende Dr. Andrea Litzenburger sprach von einem „einmaligen Vorgang, den wir hier erleben“. [...] Litzenburger: „Die Stadtbibliothek wird zwar nicht totgeschlagen, aber sie überlebt als Krüppel.“
http://www.allgemeine-zeitung.de/region/mainz/meldungen/11431064.htm
Die Bildersammlung zur Stadtbibliothek auf Wikimedia Commons ist weiter gewachsen. Es sind nun 61 in der allgemeinen Kategorie und 16 Handschriftenabbildungen.
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stadtbibliothek_Mainz
Zum Thema
http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbibliothek+mainz
Update 19.12.2011: Annelen Otterman in der Provenienz-ML: "Die entscheidende Stadtratssitzung hat am 14.12. stattgefunden, Mainz ist dem Entschuldungsfonds des Landes beigetreten.
Für uns bedeutet das im Klartext eine Reduzierung von jetzt 33 auf 13 Stellen und bestenfalles eine Halbierung des Erwerbungsetats. Wir werden künftig zwei "Leuchttürme" mit niedriger Wattzahl erhellen - denjenigen der Altbestände und Handschriften und den der Regionalia. Zumindest zu diesen beiden Schwerpunkten hoffen wir, noch vereinzelte Forschungsliteratur kaufen zu können."

KlausGraf - am Dienstag, 13. Dezember 2011, 22:51 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Stereotype? OMG :) Any other opinions? Please...
Quelle: Facebook-Seite Pokrajinski Arhiv Maribor
Wolf Thomas - am Dienstag, 13. Dezember 2011, 21:08 - Rubrik: Wahrnehmung
Das Google-Books-Settlement ist mit der Klage tot. Möglicherweise gibt es aber noch eine Vereinbarung Googles mit den Verlegern.
http://www.boersenblatt.net/466273/
Siehe auch
http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/digital/content-and-e-books/article/49843-authors-guild-files-for-class-certification-in-google-case.html
http://www.boersenblatt.net/466273/
Siehe auch
http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/digital/content-and-e-books/article/49843-authors-guild-files-for-class-certification-in-google-case.html
KlausGraf - am Dienstag, 13. Dezember 2011, 20:01 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Nach der Besetzung Albaniens durch die Deutschen im Jahr
1943 weigerte sich die Bevölkerung Albaniens in einem außergewöhnlichen
Akt, die Anweisungen der Besatzer zu befolgen
und ihnen Listen mit den Namen der Juden auszuhändigen, die
unter ihnen lebten. Darüber hinaus versorgten verschiedene
staatliche Einrichtungen viele jüdische Familien mit gefälschten
Papieren, mit denen sie sich unter die Lokalbevölkerung mischen
konnten. Die Albaner schützten nicht nur ihre eigenen jüdischen
Bürger, sondern gewährten auch jenen Flüchtlingen Zuflucht, die
nach Albanien gekommen waren, als es noch unter italienischer
Herrschaft stand, und die nun in der ständigen Gefahr lebten, in
Konzentrationslager deportiert zu werden.
Die bemerkenswerte Unterstützung, die den Juden entgegengebracht
wurde, war begründet in dem Ehrenkodex Besa, der noch
heute in Albanien als der höchste ethische Wert gilt. Besa heißt
wörtlich „ein Versprechen halten“. Jemand, der nach dem Prinzip
Besa handelt, ist jemand, der sein Wort hält, jemand, dem man
sein eigenes Leben und das seiner Familie anvertrauen kann.
Die Hilfe, die Juden und Nicht-Juden gewährt wurde, kann als
Angelegenheit nationaler Ehre verstanden werden. Die Albaner
scheuten keine Mühe, um zu helfen, ja sie konkurrierten sogar
untereinander um das Privileg, Juden zu retten. Sie handelten
aus Mitleid, menschlicher Güte und dem Bedürfnis, Menschen in
Not zu helfen, sogar denen, die einen anderen Glauben oder
eine andere Herkunft hatten als sie.
Albanien, ein europäischer Staat mit einer muslimischen Mehrheitsgesellschaft,
brachte zuwege, woran andere europäische
Länder scheiterten. Alle Juden, die während der deutschen Besatzung
innerhalb der Staatsgrenzen Albaniens lebten, und zwar
albanische Staatsbürger ebenso wie Flüchtlinge, wurden – bis
auf einige Mitglieder einer einzigen Familie – gerettet. Es ist eine
beeindruckende Tatsache, dass in Albanien am Ende des Krieges
mehr Juden lebten als zuvor."
War mir völlig unbekannt. Aus dem als PDF im Netz verfügbaren aktuellen Ausstellungkatalog
http://www.millisegal.at/besa/index.php
1943 weigerte sich die Bevölkerung Albaniens in einem außergewöhnlichen
Akt, die Anweisungen der Besatzer zu befolgen
und ihnen Listen mit den Namen der Juden auszuhändigen, die
unter ihnen lebten. Darüber hinaus versorgten verschiedene
staatliche Einrichtungen viele jüdische Familien mit gefälschten
Papieren, mit denen sie sich unter die Lokalbevölkerung mischen
konnten. Die Albaner schützten nicht nur ihre eigenen jüdischen
Bürger, sondern gewährten auch jenen Flüchtlingen Zuflucht, die
nach Albanien gekommen waren, als es noch unter italienischer
Herrschaft stand, und die nun in der ständigen Gefahr lebten, in
Konzentrationslager deportiert zu werden.
Die bemerkenswerte Unterstützung, die den Juden entgegengebracht
wurde, war begründet in dem Ehrenkodex Besa, der noch
heute in Albanien als der höchste ethische Wert gilt. Besa heißt
wörtlich „ein Versprechen halten“. Jemand, der nach dem Prinzip
Besa handelt, ist jemand, der sein Wort hält, jemand, dem man
sein eigenes Leben und das seiner Familie anvertrauen kann.
Die Hilfe, die Juden und Nicht-Juden gewährt wurde, kann als
Angelegenheit nationaler Ehre verstanden werden. Die Albaner
scheuten keine Mühe, um zu helfen, ja sie konkurrierten sogar
untereinander um das Privileg, Juden zu retten. Sie handelten
aus Mitleid, menschlicher Güte und dem Bedürfnis, Menschen in
Not zu helfen, sogar denen, die einen anderen Glauben oder
eine andere Herkunft hatten als sie.
Albanien, ein europäischer Staat mit einer muslimischen Mehrheitsgesellschaft,
brachte zuwege, woran andere europäische
Länder scheiterten. Alle Juden, die während der deutschen Besatzung
innerhalb der Staatsgrenzen Albaniens lebten, und zwar
albanische Staatsbürger ebenso wie Flüchtlinge, wurden – bis
auf einige Mitglieder einer einzigen Familie – gerettet. Es ist eine
beeindruckende Tatsache, dass in Albanien am Ende des Krieges
mehr Juden lebten als zuvor."
War mir völlig unbekannt. Aus dem als PDF im Netz verfügbaren aktuellen Ausstellungkatalog
http://www.millisegal.at/besa/index.php
KlausGraf - am Dienstag, 13. Dezember 2011, 19:41 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sagt das OLG Düsseldorf:
"Der Beklagte zu 1. verlinkte die streitgegenständigen Fotos des Klägers auf der Seite der Beklagten zu 2. mit dem Namen “…” in der Weise, dass diese auf der oben genannten Seite vollständig abgebildet waren, ohne vorher auf dem Server der Beklagten zu 2. zwischengespeichert zu sein. Anders, als das erstinstanzliche Gericht und Literaturstimmen meinen (Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. AUfl.,§ 19a Rn. 46; Ott, Haftung für Embedded Videos von YouTube und anderen Videoplattformen im Internet, ZUM 2008, 556,559), ist der hier vorliegende Fall eines sogenannten Embedded Content anders zu beurteilen als das urheberrechtlich unproblematische Setzen eines einfachen Hyperlinks (ähnlich auch LG München I ZUM 2007, 224 ff. LG OLG Düsseldorf ZUM 2008, 338; Üllrich, Webradioportale, Embedded Videos & Co. - Inline-linking und Framing als Grundlage urheberrechtlich relevanter (Anschluss-)Wiedergaben, ZUM 2010, 853, 861). Derjenige, der einen Hyperlink auf eine vom Berechtigten öffentlich zugänglich gemachte Webseite mit einem urheberrechtlich geschützten Werk setzt, hält das geschützte Werk weder selbst öffentlich zum Abruf bereit, noch übermittelt er es selbst auf Abruf an Dritte. Er verweist damit lediglich auf das Werk in einer Weise, die Nutzern den bereits eröffneten Zugang erleichtert (BGHZ 156, 1, 12, 14 - Paperboy). Bei dem “Embedded Content” dagegen wird das geschützte Werk durch den Linksetzenden öffentlich zum Abruf bereitgehalten.
Durch die Veröffentlichung der betreffenden Fotos hat der Kläger im Streitfall zwar den Nutzern den Zugang selbst eröffnet. Der Zugang zu den gegenständlichen Bildern sollte jedoch nach dem erkennbaren Willen des Klägers nur auf dem von ihm vorgesehenen Weg über seine Webseite erfolgen. Um die Bilder zu sehen, müssen die Internetnutzer zwangsläufig seine Webseite aufsuchen und zur Kenntnis nehmen. Trotz der Unentgeltlichkeit des Zugriffes ist das Betreiben der Webseite darauf ausgerichtet, die Aufmerksamkeit der kommerziellen Nutzer mit dem Zweck des Abschlusses von Lizenzverträgen zu gewinnen und die Attraktivität der Webseite für die Platzierung von Bannerwerbung zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund bedient sich der Linksetzende der Werke des Berechtigten, um eigene Inhalte oder die Website eines Dritten attraktiver zu gestalten."
http://www.damm-legal.de/olg-duesseldorf-nutzung-fremder-bilder-als-embedded-content-ist-urheberrechtswidrig
Via RA Seidlitz in Netlaw-L
"Der Beklagte zu 1. verlinkte die streitgegenständigen Fotos des Klägers auf der Seite der Beklagten zu 2. mit dem Namen “…” in der Weise, dass diese auf der oben genannten Seite vollständig abgebildet waren, ohne vorher auf dem Server der Beklagten zu 2. zwischengespeichert zu sein. Anders, als das erstinstanzliche Gericht und Literaturstimmen meinen (Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. AUfl.,§ 19a Rn. 46; Ott, Haftung für Embedded Videos von YouTube und anderen Videoplattformen im Internet, ZUM 2008, 556,559), ist der hier vorliegende Fall eines sogenannten Embedded Content anders zu beurteilen als das urheberrechtlich unproblematische Setzen eines einfachen Hyperlinks (ähnlich auch LG München I ZUM 2007, 224 ff. LG OLG Düsseldorf ZUM 2008, 338; Üllrich, Webradioportale, Embedded Videos & Co. - Inline-linking und Framing als Grundlage urheberrechtlich relevanter (Anschluss-)Wiedergaben, ZUM 2010, 853, 861). Derjenige, der einen Hyperlink auf eine vom Berechtigten öffentlich zugänglich gemachte Webseite mit einem urheberrechtlich geschützten Werk setzt, hält das geschützte Werk weder selbst öffentlich zum Abruf bereit, noch übermittelt er es selbst auf Abruf an Dritte. Er verweist damit lediglich auf das Werk in einer Weise, die Nutzern den bereits eröffneten Zugang erleichtert (BGHZ 156, 1, 12, 14 - Paperboy). Bei dem “Embedded Content” dagegen wird das geschützte Werk durch den Linksetzenden öffentlich zum Abruf bereitgehalten.
Durch die Veröffentlichung der betreffenden Fotos hat der Kläger im Streitfall zwar den Nutzern den Zugang selbst eröffnet. Der Zugang zu den gegenständlichen Bildern sollte jedoch nach dem erkennbaren Willen des Klägers nur auf dem von ihm vorgesehenen Weg über seine Webseite erfolgen. Um die Bilder zu sehen, müssen die Internetnutzer zwangsläufig seine Webseite aufsuchen und zur Kenntnis nehmen. Trotz der Unentgeltlichkeit des Zugriffes ist das Betreiben der Webseite darauf ausgerichtet, die Aufmerksamkeit der kommerziellen Nutzer mit dem Zweck des Abschlusses von Lizenzverträgen zu gewinnen und die Attraktivität der Webseite für die Platzierung von Bannerwerbung zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund bedient sich der Linksetzende der Werke des Berechtigten, um eigene Inhalte oder die Website eines Dritten attraktiver zu gestalten."
http://www.damm-legal.de/olg-duesseldorf-nutzung-fremder-bilder-als-embedded-content-ist-urheberrechtswidrig
Via RA Seidlitz in Netlaw-L
KlausGraf - am Dienstag, 13. Dezember 2011, 12:51 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Dietmar Bartz - am Dienstag, 13. Dezember 2011, 11:39 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Netz 2.0 erreicht langsam auch diejenigen, die sich berufsmäßig mit der Vergangenheit beschäftigen: Historiker. Einige nutzen offensiv das Internet, andere sind skeptisch.
Der Riss geht auch durch das Seminar zur Digitalen Geschichtswissenschaft an der TU Bergakademie Freiberg. Über das Verhältnis von Historikern zum Netz 2.0 diskutieren
Denise Roßberg, Franz Richter, Anke Geier, Franco Lehmann und Bertram Triebel.
Wolf Thomas - am Dienstag, 13. Dezember 2011, 11:04 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 Nun ist es Zeit für etwas Leichteres.
Nun ist es Zeit für etwas Leichteres. Zucker Springerl
Nimm 6 Loth schönes Mehl, 7 Loth feinen Zucker [012r] Lemonischallerl, Muskatnuß und Gewürznägl und mit recht dick pflaumichten Eyerklar den Teig abgemacht, nicht zu weich in Modl ausgedruckt, ein Blatl mit Wachs angeschmiert, daraufgelegt, und kühl gebachen, daß so hübsch licht färbig sind, man kann es mit wenig Wasser und Eyerklar bestreichen wenn man es glänzend haben will.
Das Springerle-Rezept stammt aus dem Kochbuch der Theresia Müller in Wien vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Transkription von Hans Zotter findet sich im Grazer Portal Kultur des Alltags: Der gedeckte Tisch – das bestellte Haus: Historische Koch-, Haushalts- und Gartenbücher, das zu den Handschriften der UB Graz auch die Faksimiles mitliefert, während bei dem Stück aus dem Steiermärkischen Landesarchiv leider keine Image-Files beigegeben sind.
http://www.uni-graz.at/ubwww/ub-sosa/ub-sosa-druckschriften-kochbuecher.htm
***
Ein paralleles Angebot aus Salzburg Lucullarium (mit Faksimiles):
http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/lucullarium.htm
In der Rezeptdatenbank der oberösterreichischen Landesmuseen gibt es nicht wenige Digitalisate ganzer Kochbuchhandschriften:
http://www.alteskochbuch.at/rezeptdatenbank.html
430 digitalisierte Bücher "Bibliotheca Gastronomica" der SLUB Dresden:
http://www.slub-dresden.de/sammlungen/digitale-sammlungen/listenansicht/?type=class%25252525253Dl
Erwähnung verdient auch die digitale Sammlung des schwedischen Kochbuchmuseums, da dort auch deutsche Kochbücher dabei sind:
http://www.oru.se/ub/Filialer/Restaurang--och-hotellhogskolan---Grythytte-Akademi/Digitaliserade-rariteter-fran-kokboksmuseet/
Umfangreicher Nachweis von Kochbuch-Digitalisaten bei Wikisource
http://de.wikisource.org/wiki/Kochbücher
Kochbuchlinks 2008
http://archiv.twoday.net/stories/5401828/
Alle Türchen 2011



Springerle-Foto Andreas Bauerle CC-BY-SA
KlausGraf - am Dienstag, 13. Dezember 2011, 02:15 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wenn es ein Thema des Jahres 2011 gab, das Archivalia besonders geprägt hat, dann war das Karl Theodor zu Guttenberg und sein Plagiieren.
http://archiv.twoday.net/search?q=guttenberg
Dass sich Karl-Theodor zu Guttenberg nun im Auftrag der EU um Internetfreiheit kümmern soll, sorgt für reichlich Häme.
„Bock als Gärtner“: Wie das Netz über Internetberater Guttenberg spottet - weiter lesen auf FOCUS Online: http://www.focus.de/digital/internet/bock-als-gaertner-das-netz-spottet-ueber-internetberater-guttenberg_aid_693415.html
 Fotomontage "extra 3"
Fotomontage "extra 3"
http://archiv.twoday.net/search?q=guttenberg
Dass sich Karl-Theodor zu Guttenberg nun im Auftrag der EU um Internetfreiheit kümmern soll, sorgt für reichlich Häme.
„Bock als Gärtner“: Wie das Netz über Internetberater Guttenberg spottet - weiter lesen auf FOCUS Online: http://www.focus.de/digital/internet/bock-als-gaertner-das-netz-spottet-ueber-internetberater-guttenberg_aid_693415.html
 Fotomontage "extra 3"
Fotomontage "extra 3"KlausGraf - am Dienstag, 13. Dezember 2011, 01:09 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
 Foto Taysio, http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de
Foto Taysio, http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.deDeppen sterben nicht aus:
Andreas Praefcke ist zu Recht aufgebracht: I resent the common notion among MediaWiki developpers and in the discussion here that the uploaders were at fault here. Nothing in the JPG standard mentions these supid EXIF data, and when uploading this stuff years ago, no one ever mentioned that these EXIF information would ever be used to alter the displaying of the image. I feel betrayed by the Commons, and I think it is an unprecedented assault on the stability of the website's behaviour. If someone uses my images on a Wikimedia project, or, even worse, somewhere outside the Wikimedia universe, this person will not be alerted that the thumbnails are now different from a couple of weeks ago. MediaWiki 1.18 makes Commons looking like a joke, just after we had gradually developped into a site that could be taken seriously. --AndreasPraefcke (Diskussion) 20:09, 8 December 2011 (UTC)
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User_talk:Rotatebot&oldid=63791853#Rotation_on_Wikipedia (mit weiteren Links zur Diskussion)

".... Nach dreijähriger Bauzeit wird am 12. Dezember 2011 der Erweiterungsbau des Generallandesarchivs Karlsruhe in einem Festakt der Öffentlichkeit übergeben.
In dem markanten Gebäude finden die Besucher künftig in den neuen Lesesälen optimale Arbeitsbedingungen. Das Erdgeschoss bietet Raum für Ausstellungen und Veranstaltungen. Die Magazine haben Platz für 14 Regalkilometer Archivgut. Das Generallandesarchiv ist mit dem Neubau gut für die Zukunft gerüstet.
Am Samstag 28. Januar 2012, 10.30 – 17.00 Uhr, präsentiert sich das Haus an einem „Tag der offenen Tür“ der Öffentlichkeit. In Führungen und Kurzvorträgen bieten die Archivarinnen und Archivare den Besuchern Einblicke in die Arbeit des Generallandesarchivs. "
Quelle: Landesarchiv Baden-Württemberg, Pressemitteilung, 12.12.11
Wolf Thomas - am Montag, 12. Dezember 2011, 23:12 - Rubrik: Archivbau
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Albrecht Diem (Associate Professor an der Maxwell School der Syracuse University) hat mich über das Netbib-Wiki (!) kontaktiert. Er hat nicht offenbar so den Durchblick, was das Europäische angeht. Er weist auf eine Reihe mehr oder weniger sinnvoller Projekte hin, die er betreibt.
Wer sich für frühmittelalterliches Klosterwesen interessiert, kann sich auf academia.edu vernetzen oder Diem kontaktieren:
http://albrechtdiem.org/research/Network-Early-Medieval-Monasticism.html
Gegen seine Bibliographie ist wenig einzuwenden - außer dass die Zukunft Open Data gehört und solche Alleingänge auf Dauer nicht sinnvoll sind (gilt auch für die anderen Bereiche):
http://albrechtdiem.org/research/bibliographymonasticism.htm
Für Handschriftenforscher von besonderem Wert ist das Monastic Manuscript Project, das Handschriften mit Texten zum frühmittelalterlichen Klosterwesen dokumentiert. Hier wäre ein "echtes" Wiki vorzuziehen gewesen (und vor allem eine freie Lizenz). Zu wenig Aufmerksamkeit wird den Provenienzen und Schreiborten der Handschriften gewidmet.
http://albrechtdiem.org/research/mmp/mmphome.html
Nicht wirklich vertraut mit europäischen digitalen Sammlungen ist die Liste:
http://albrechtdiem.org/research/mmp/listoflinks.html#Digital
Siehe etwa ergänzend http://archiv.twoday.net/stories/19452751/
Diem scheint auch dieses Weblog nicht zu lesen, was ich prinzipiell übel nehme.
Den Handschriftencensus, der ja nun doch wohl Maßstäbe setzt, bei solchen Vorhaben, scheint Diem gar nicht zu kennen.
Besonders ärgerlich wird es, wenn jemand das Rad neu erfindet:
http://albrechtdiem.org/research/mmp/Catalogues-of-Latin-Manuscripts.html
Da Frau Pfeil eine solche Liste pflegt und auch der Handschriftencensus die digitalisierten Handschriftenkataloge auflistet, besteht nun wirklich kein Bedarf, dass auch Albrecht Diem sich daran versucht.
Liste Pfeils:
http://www.uni-erfurt.de/amploniana/handschriftenkatalogeonline/
Zu Prag hat Diem nur einen Nachweis im Internet Archive, während Pfeil drei Nachweise hat. Besseres bietet der Handschriftencensus:
http://www.handschriftencensus.de/forschungsliteratur/kataloge#P
Wenn es bei London ''London, British Library, Additions (copyright in Europe?)'' heißt, zeigt das, wie wenig Ahnung Diem hat. Seit ca. 2004 weisen wir in diesem Weblog auf die Notwendigkeit von US-Proxys hin. Dass Google uns bei Büchern nach 1870 (nächstes Jahr hoffentlich 1871) aussperrt, hat nichts mit konkretem Urheberrecht zu tun, sondern mit einer übervorsichtigen Haltung.
Wir wünschen den Projekten Diems alles Gute, würden uns aber wünschen, dass er wenigstens die unsinnige weitere (sehr viel schlechtere) Liste der digitalisierten Handschriftenkataloge wieder aufgibt und sich bemüht, mehr von europäischen Dingen mitzubekommen.
Wer sich für frühmittelalterliches Klosterwesen interessiert, kann sich auf academia.edu vernetzen oder Diem kontaktieren:
http://albrechtdiem.org/research/Network-Early-Medieval-Monasticism.html
Gegen seine Bibliographie ist wenig einzuwenden - außer dass die Zukunft Open Data gehört und solche Alleingänge auf Dauer nicht sinnvoll sind (gilt auch für die anderen Bereiche):
http://albrechtdiem.org/research/bibliographymonasticism.htm
Für Handschriftenforscher von besonderem Wert ist das Monastic Manuscript Project, das Handschriften mit Texten zum frühmittelalterlichen Klosterwesen dokumentiert. Hier wäre ein "echtes" Wiki vorzuziehen gewesen (und vor allem eine freie Lizenz). Zu wenig Aufmerksamkeit wird den Provenienzen und Schreiborten der Handschriften gewidmet.
http://albrechtdiem.org/research/mmp/mmphome.html
Nicht wirklich vertraut mit europäischen digitalen Sammlungen ist die Liste:
http://albrechtdiem.org/research/mmp/listoflinks.html#Digital
Siehe etwa ergänzend http://archiv.twoday.net/stories/19452751/
Diem scheint auch dieses Weblog nicht zu lesen, was ich prinzipiell übel nehme.
Den Handschriftencensus, der ja nun doch wohl Maßstäbe setzt, bei solchen Vorhaben, scheint Diem gar nicht zu kennen.
Besonders ärgerlich wird es, wenn jemand das Rad neu erfindet:
http://albrechtdiem.org/research/mmp/Catalogues-of-Latin-Manuscripts.html
Da Frau Pfeil eine solche Liste pflegt und auch der Handschriftencensus die digitalisierten Handschriftenkataloge auflistet, besteht nun wirklich kein Bedarf, dass auch Albrecht Diem sich daran versucht.
Liste Pfeils:
http://www.uni-erfurt.de/amploniana/handschriftenkatalogeonline/
Zu Prag hat Diem nur einen Nachweis im Internet Archive, während Pfeil drei Nachweise hat. Besseres bietet der Handschriftencensus:
http://www.handschriftencensus.de/forschungsliteratur/kataloge#P
Wenn es bei London ''London, British Library, Additions (copyright in Europe?)'' heißt, zeigt das, wie wenig Ahnung Diem hat. Seit ca. 2004 weisen wir in diesem Weblog auf die Notwendigkeit von US-Proxys hin. Dass Google uns bei Büchern nach 1870 (nächstes Jahr hoffentlich 1871) aussperrt, hat nichts mit konkretem Urheberrecht zu tun, sondern mit einer übervorsichtigen Haltung.
Wir wünschen den Projekten Diems alles Gute, würden uns aber wünschen, dass er wenigstens die unsinnige weitere (sehr viel schlechtere) Liste der digitalisierten Handschriftenkataloge wieder aufgibt und sich bemüht, mehr von europäischen Dingen mitzubekommen.
KlausGraf - am Montag, 12. Dezember 2011, 22:52 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Montag, 12. Dezember 2011, 20:23 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 Noch ist es nicht das spät, das zwölfte Türchen zu öffnen. Nicht aus Gründen der Gleichbehandlung mit der Badischen Landesbibliothek (Türchen VIII) stellen wir heute die Württembergische Landesbibliothek in Stuttgart mit ihrer Digitalen Sammlung vor. Nachdem diese mit tollen Altbeständen gesegnete Bibliothek lange Zeit so gut wie desinteressiert an Digitalisierung war, ist doch inzwischen ihre Sammlung von Digitalisaten an Umfang und Qualität respektabel zu nennen. Es gibt 82 Handschriftendigitalisate (im April waren es "nur" 45, siehe Liste) und 180 alte und wertvolle Drucke, darunter etliche rare oder unikale Inkunabeln. Die Auflösung ist brauchbar, wenngleich man beim prachtvollen Schweickher-Atlas in der Vergrößerungsstufe die Ortsnamen nicht lesen kann (Klosteramt Lorch) - bei Kartendigitalisierung das wichtigste Kriterium! Außerdem ist der DFG-Viewer (kein Download!) gegenüber der Karlsruher VirtualLibrary-Anwendung schon recht rückständig. Die Auswahl eines Bildes fiel schwer: Das hochmittelalterliche Reichenbacher Schenkungsbuch mit dem berühmten Bild Wilhelms von Hirsau vielleicht? Aber aus Gründen der Ausgewogenheit war anders zu entscheiden, damit auch die Literaturarchive zu ihrem Recht kommen. (Das Marbacher Literaturarchiv digitalisiert bekanntlich nicht.)
Noch ist es nicht das spät, das zwölfte Türchen zu öffnen. Nicht aus Gründen der Gleichbehandlung mit der Badischen Landesbibliothek (Türchen VIII) stellen wir heute die Württembergische Landesbibliothek in Stuttgart mit ihrer Digitalen Sammlung vor. Nachdem diese mit tollen Altbeständen gesegnete Bibliothek lange Zeit so gut wie desinteressiert an Digitalisierung war, ist doch inzwischen ihre Sammlung von Digitalisaten an Umfang und Qualität respektabel zu nennen. Es gibt 82 Handschriftendigitalisate (im April waren es "nur" 45, siehe Liste) und 180 alte und wertvolle Drucke, darunter etliche rare oder unikale Inkunabeln. Die Auflösung ist brauchbar, wenngleich man beim prachtvollen Schweickher-Atlas in der Vergrößerungsstufe die Ortsnamen nicht lesen kann (Klosteramt Lorch) - bei Kartendigitalisierung das wichtigste Kriterium! Außerdem ist der DFG-Viewer (kein Download!) gegenüber der Karlsruher VirtualLibrary-Anwendung schon recht rückständig. Die Auswahl eines Bildes fiel schwer: Das hochmittelalterliche Reichenbacher Schenkungsbuch mit dem berühmten Bild Wilhelms von Hirsau vielleicht? Aber aus Gründen der Ausgewogenheit war anders zu entscheiden, damit auch die Literaturarchive zu ihrem Recht kommen. (Das Marbacher Literaturarchiv digitalisiert bekanntlich nicht.)Die geradezu sensationelle Stuttgarter digitale Hölderlinsammlung (über 280 Digitalisate) enthält unter anderem das "Bundesbuch" (1790) von Magenau, Neuffer und Hölderlin. Ein nicht identifizierter Präzeptor Schönlin zeichnete einen Stiftler am Pult. Im Bücherregal verweist "Hymni. Holz" auf Hölderlin.
Außerdem gibt es auch die große Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe online. Schon allein deshalb lohnt der Besuch der Digitalen Sammlung.
http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz340091207
Alle Türchen 2011

KlausGraf - am Montag, 12. Dezember 2011, 20:16 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Quelle:: Villa Hügel, Ausstellungen
"Sechs Monate lang hatte die Krupp-Stiftung rund 400 Fotografien aus zwei Jahrhunderten gezeigt. Sie waren aus zwei Millionen Aufnahmen ausgewählt und in der Villa Hügel in Essen ausgestellt worden, dem ehemaligen Wohnhaus der Familie Krupp.
Mit der Fotografie-Ausstellung ging am Sonntag auch das Jubiläumsjahr «200 Jahre Krupp» zu Ende. «Mit einem solchen Interesse hatten wir nicht gerechnet», räumte Archivleiter Prof. Ralf Stremmel am Sonntag ein.
Friedrich Krupp (1787-1826) hatte am 20. November 1811 in Essen eine Gussstahlfabrik gegründet, aus der sich schließlich der Weltkonzern entwickelte. Die Mitglieder der Industriellen-Dynastie Krupp galten als begeisterte Foto-Pioniere.
Erstmals hatte das älteste deutsche Firmenarchiv seine Schatzkammern für eine große Fotoausstellung geöffnet. Die meisten Aufnahmen waren noch nie öffentlich im Original ausgestellt worden.
Die Schau «Krupp. Fotografien aus zwei Jahrhunderten» zeigte monumentale Werksansichten mit winzigen Arbeitern im Ameisenformat und private Schnappschüsse aus den Fotoalben der berühmten Essener Familie."
Quelle: Monopol-Magazin, 11.12.11
".... "Mit einem solchen Interesse hatten wir nicht gerechnet", kommentiert Prof. Dr. Ralf Stremmel, Leiter des Historischen Archivs Krupp und Kurator, das erfreuliche Ergebnis. "Besucherzahlen in dieser Höhe sind für Fotografie-Ausstellungen höchst ungewöhnlich."
Fast 900 Gruppen aus ganz Deutschland ließen sich durch die 15 Ausstellungsräume führen und mehr als 8.800 Besucher nutzten den Audio-Guide. Gut besucht waren auch die vier Vortragsveranstaltungen des Rahmenprogramms. Sie beschäftigten sich mit der Faszination von Familienporträts, mit der frühen fototechnischen Praxis, der Inszenierung der Fabrik in der Fotografie und den Industrie-Erfahrungen des renommierten Fotokünstlers Timm Rautert. ...."
Quelle: Villa Hügel, Pressemitteilung, 30.11.11
4 Anmerkungen:
1) Chapeau!
2) Typisches Siegener Understatement des Kollegen Stremmel. ;-)
3) Damit wäre das Krupp-Archiv wohl heißer Anwärter auf den Titel "Archiv des Jahres".
4) Gab es eine vergleichbar erfolgreiche Archivausstellung?
Wolf Thomas - am Montag, 12. Dezember 2011, 19:40 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein extrem ärmlicher Start für ein groß angekündigtes Projekt, nur ein paar Newton-Handschriften:
http://cudl.lib.cam.ac.uk/
Nicht integriert der bescheidene bisherige Open-Access-Bestand:
http://www.lib.cam.ac.uk/digital_image_collections/
(Sehr viel mehr ist z.B. in EEBO zugänglich - für zahlende Kunden.)
Weder die geplanten Sanskrit-Handschriften noch die Board of Longitude papers reißen mich vom Hocker. Zum Vergleich:
http://digital.bodleian.ox.ac.uk/
http://cudl.lib.cam.ac.uk/
Nicht integriert der bescheidene bisherige Open-Access-Bestand:
http://www.lib.cam.ac.uk/digital_image_collections/
(Sehr viel mehr ist z.B. in EEBO zugänglich - für zahlende Kunden.)
Weder die geplanten Sanskrit-Handschriften noch die Board of Longitude papers reißen mich vom Hocker. Zum Vergleich:
http://digital.bodleian.ox.ac.uk/
KlausGraf - am Montag, 12. Dezember 2011, 16:05 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Tussen 1969 en 1994 verscheen Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, het standaardwerk over de bezettingsperiode, geschreven door dr. Loe de Jong (1914-2005). Deze 14-delige serie, met reacties en register, is nu digitaal te raadplegen; waar en wanneer je maar wilt.
http://www.niod.knaw.nl/koninkrijk/
http://www.niod.knaw.nl/koninkrijk/
KlausGraf - am Montag, 12. Dezember 2011, 15:49 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Selbstbeschreibung
Der Arbeitskreis "Collegium Res Nobilis Austriae - CoResNo.com / AustroArchiv.com" - beschäftigt sich mit erbländisch- und kaiserlich-österreichischen Gnadenakten und deren Wappenverleihungen. Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt in der Indexierung der seit Mitte des 19. Jahrhunderts publizierten Literatur.
CoResNo.com ist keine Adelsvereinigung und gehört zu keinem Adelsverband. Wir führen keine Legitimierungen oder Nichtbeanstandungen durch.
Der Arbeitskreis "Collegium Res Nobilis Austriae - CoResNo.com / AustroArchiv.com" - beschäftigt sich mit erbländisch- und kaiserlich-österreichischen Gnadenakten und deren Wappenverleihungen. Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt in der Indexierung der seit Mitte des 19. Jahrhunderts publizierten Literatur.
CoResNo.com ist keine Adelsvereinigung und gehört zu keinem Adelsverband. Wir führen keine Legitimierungen oder Nichtbeanstandungen durch.
vierprinzen - am Montag, 12. Dezember 2011, 09:47 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
David Prosser in Liblicense:
The UK Government has just published its Innovation and Research
Strategy for Growth, outlining how it will support research and
development through the UK's universities:
http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/innovation/docs/i/11-1387-innovation-and-research-strategy-for-growth.pdf
Of particular interest to readers of this list will be section 6.6
onwards which deal with access to research outputs. To quote:
"The Government, in line with our overarching commitment to
transparency and open data, is committed to ensuring that
publicly-funded research should be accessible free of charge. Free and
open access to taxpayer-funded research offers significant social and
economic benefits by spreading knowledge, raising the prestige of UK
research and encouraging technology transfer. At the moment, such
research is often difficult to find and expensive to access. This can
defeat the original purpose of taxpayer-funded academic research and
limits understanding and innovation. ... But we need to go much
further if, as a nation, we are to gain the full potential benefits of
publicly-funded research."
Taken together with the UK's Science Minister's recent interview in
the Guardian:
http://www.guardian.co.uk/science/2011/dec/08/publicly-funded-research-open-access
this signifies the strongest commitment to open access we have seen
from the UK Government.
The UK Government has just published its Innovation and Research
Strategy for Growth, outlining how it will support research and
development through the UK's universities:
http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/innovation/docs/i/11-1387-innovation-and-research-strategy-for-growth.pdf
Of particular interest to readers of this list will be section 6.6
onwards which deal with access to research outputs. To quote:
"The Government, in line with our overarching commitment to
transparency and open data, is committed to ensuring that
publicly-funded research should be accessible free of charge. Free and
open access to taxpayer-funded research offers significant social and
economic benefits by spreading knowledge, raising the prestige of UK
research and encouraging technology transfer. At the moment, such
research is often difficult to find and expensive to access. This can
defeat the original purpose of taxpayer-funded academic research and
limits understanding and innovation. ... But we need to go much
further if, as a nation, we are to gain the full potential benefits of
publicly-funded research."
Taken together with the UK's Science Minister's recent interview in
the Guardian:
http://www.guardian.co.uk/science/2011/dec/08/publicly-funded-research-open-access
this signifies the strongest commitment to open access we have seen
from the UK Government.
KlausGraf - am Montag, 12. Dezember 2011, 03:06 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Was ist das denn für ein Text?
Aufbewahrungsort Straßburg, National- und Universitätsbibl., ms. 2323 (früher L germ. 348.4°)
Codex 10 Blätter
Beschreibstoff Papier
Entstehungszeit 15. Jh. (Becker S. 24)
Abbildung Farb-Abbildung des Codex
Literatur
(Hinweis)
Adolf Becker, Die deutschen Handschriften der Kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliothek zu Straßburg (Katalog der Kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliothek in Straßburg 6), Straßburg 1914, S. 24. [online]
Ernest Wickersheimer, Strasbourg (Catalogue Général des Manuscrits des Bibliothèques Publiques de France, Départements 47), Paris 1923, S. 458. [online]
http://www.handschriftencensus.de/3582
Der Handschriftencensus wartet schon mal mit einem dicken fetten Fehler auf. Bei Wickersheimer ist es die S. 485, nicht 458. [Ist korrigiert.]
http://www.archive.org/stream/cataloguegnr47fran#page/484/mode/2up
Nach den Strassburger Katalogen ist es ein Tauler zugeschriebener Text mit dem Textbeginn "Es ist ein hoher Berg".
Das Explicit der Strassburger Hs. gibt Becker:
http://www.archive.org/stream/HandschriftenDerUlbStrassburg/DieHandschriftenDerUlbStrassburg#page/n43/mode/2up
Die Straßburger Handschrift bricht mitten im Wort ab, das vom Salzburger Katalog gegebene Textende vermochte ich nicht zu entdecken.
Textbeginn im Faksimile:
http://w1.bnu.fr/Bibliotheque%20Virtuelle/MS/cgi-bin/include/showimage.asp?image=/msrhenane_image/MS.2323/2323_003.jpg
Während Google Books unersetzlich ist, wenn man Online-only sucht, ist die Leistung der Incipit-Verzeichnisse von manuscripta.at und ManuMed erbärmlich. Berlin hat nur mgo 69, die Textanfänge der Salzburger UB-Handschriften sind bei manuscripta.at nicht ausgewertet.
Natürlich darf man nicht erwarten, dass bei einem solchen bescheidenen Kurztext der Handschriftencensus ihn nachweist.
An Sekundärliteratur finde ich:
Paul-Gerhard Völker, Die deutschen Schriften des Franziskaners Konrad Bömlin. Teil 1: Überlieferung und Untersuchung (MTU 8), München 1964, S. 111 (siehe unten bei Berlin und Hamburg)
Philipp Strauch, Zu Taulers Predigten, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 44 (1920), S. 1-26, hier S. 15: Hinweis auf Denifle und Hamburger Hs., komme für Predigten nicht in Betracht
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Zu_Taulers_Predigten.pdf
Heinrich Denifle, Taulers Bekehrung. Strassburg/London 1879, S. 10
[ http://www.archive.org/stream/taulersbekehrung00deni#page/10/mode/2up ]
http://books.google.de/books?id=oYpBAAAAYAAJ&pg=RA4-PA10 (US)
Nennt den Traktat nach seinem Anfang "Es ist ein hoher Berg" und gibt als Überlieferung: Strassburg (noch nicht signiert), mgq 149, mgo 69, Sang. 955
R. M. Werner in der Rezension eines Denifle-Buchs in: Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 29 (1878), S. 638f.
[ http://www.archive.org/details/ZeitschriftFuerDieOesterreichischenGymnasien_29_1878 ]
http://books.google.de/books?id=dWoKAAAAIAAJ&pg=PA638 (US)
Anscheinend von der späteren Forschung und auch zur Strassburger Handschrift übersehen. Stellt unter Bezugnahme auf die Stelle Bl. 6r der von Barack angekauften Strassburger Handschrift klar, dass es kein Tauler-Text ist und gibt kurze Auszüge.
Die Handschriften:
Berlin, mgo 69 (von 1391), Bl. 112r-135r und nochmals Bl. 222r-225v (fragmentarisch), aber (nach Hornung) nur teilweise übereinstimmend
http://www.handschriftencensus.de/9197
http://pik.ku-eichstaett.de/4531/ (im Handschriftencensus nicht vermerkt), als "Anleitung zum frommen Leben", was viel zu unspezifisch ist: http://pik.ku-eichstaett.de/4535/
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0590_e206_jpg.htm (Hornung, Sudermann)
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31253114,T
http://books.google.de/books?id=K3QlAQAAIAAJ&&q=es+ist+ein+hoher+berg (Völker, Bömlin)
Incipit für Bl. 112r: "Es ist ein hoher berg vnd vmb den berg ist es tief"
[Mitteilung von Kurt Heydeck, dem ich dafür und für etliche weitere Auskünfte sehr danke: Es ist ein hoher berg vnd vmb den berg ist es tief vnd mu+orehte, vnd ie neher man dem berge kummet ist je herter vnd scho+ener der weg ...
Am Rand von Sudermann: hierin ist vil gutes. lesz nit allein den anfang sondern auch das ende.]
Incipit für Bl. 222r: Es ist ein hoher berg. vmb den berg ist es tief vnd mürchte, vnd ie noher dem berge, ie herter vnd ie schönre weg
[Textschlüsse: 134verso: ... Das wir nun hie also wandelen mu+essent den weg der nehsten worheit in dirre zit. Also das wir die ewige wor- (135recto) heit die got selber ist noch dirre zit dort in ewigkeit eweclich werdent niessen. Das helffe vns got. Amen.
225verso: ... So ist dem sloffe reht, bist du aber trege vnd trurig so ist dem sloffe vnreht. So hest du gesloffen vf diner naturen. (= mgo 69, 123verso) ]
[NICHT in] Berlin, SB, mgq 149
http://www.handschriftencensus.de/11815
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31251465,T
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0590_e219_jpg.htm
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0603b_b025_jpg.htm
Welchen Text mag Denifle gemeint haben? Aufgrund des online zugänglichen Materials kann man nur mutmassen, dass es Bl. 232r-242r Tauler: Von den drei Wegen, die zu Gott führen sein könnte. Allerdings geht es im Text der Strassburger Handschrift um 2 Wege, wenngleich auch das Berliner Stück mit "des dauwelers lere" überschrieben ist
[Nach freundlicher Mitteilung von Kurt Heydeck ist der Text nicht enthalten. 232r ist es sicher nicht:
"232recto: >Des dauwelers lere.< Gut wilger M(ensch?) bist du vil zites vnd vil jor (über der Zeile eingeschoben: vmb) geloffen in dinen sunden vnd in dinen gudunckenden eigenwillen vnd du suchest alles den herren vssenn mit maniger hande wise vnd du vinde(?) nut dz du do meindest ... (232verso) ... vnd sint doch die drie wege alles ein weg ... (233verso, m.E. zumindest ein Abschnittsende:) ... so habe keine sorge er hilffet dir vsser aller not. Amen. (Darauf ein neuer Abschnitt mit roter I-Initiale) In vnserme lieben herre, Ihesu Christo vnd in sinre heilge gegenwertigen fruhtbere zukunft so sint gegrusset ir lieben vzerwelten gotzkinder ... - ... Dez helffe vns die vetterliche mugenheit vnd in leit vns sine gotliche vnsheit vnd hie inne bestetige vns die vngemessene minne dez heilgen geistes. Amen.
Jetzt ohne übergeschriebene Buchstaben/Zeichen." (Heydeck)
"In unserem Exemplar von Denifles Taulers Bekehrung (Yc 7586-36) ist die 149 in der Signatur "ms. germ. Berol. 149. 4°" mit Bleistift unterstrichen, und am Rand ist ein schräger - wie ausstreichender - Bleistiftstrich, den man freilich interpretieren kann, wie man will. Aber vielleicht soll er tatsächlich heißen: Nee, is nich." (Heydeck)]
Hamburg, UB, Ms. theol. 1885 (17. Jh., eine von Sudermann veranlasste Abschrift - von mgo 69?), S. 279-307
http://books.google.de/books?id=sEvgAAAAMAAJ&q=%22es+ist+ein+hoher+berg%22
[Der Text im HH-Katalog (Krüger 3 [! nicht 4, wie Google sagt], S. 42) lautet so:
S. 279-307 [Anleitung zu frommem Leben.] Eß ist ein hoher berg vnd vmb den berg ist es tief vnd murecht ... Überlieferung: Völker, S. 111; nennt diese Hs versehentlich als theol. 1890. - Ms. germ. oct. 69, 112r-135r. ]
http://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22veranla%C3%9Fte+Abschrift+in+Hamburg+Cod.+theol.+*%22 (Völker: Bömlin)
http://books.google.de/books?id=38rXCZGTF3EC&pg=PA235 (Mayer, Vulgata-Fassung: folgt hinsichtlich der Tauler-Predigten mgo 69!)
http://www.handschriftencensus.de/4875
Aus welchen Gründen die Hamburger Kataloge aus dem ManuMed-Programm ausgeklammert wurden, ist unerfindlich.
[Mainz, Stadtbibliothek, Hs. I 128 (hier 1. V. 15. Jh. aus der Laienbrüderbibliothek der Mainzer Kartause), Bl. 139r-147v
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0088_a230_jpg.htm
Freundlicher Hinweis von Kurt Heydeck aus ManuMed; ich hätte mit Trunkierung berg* suchen müssen!
http://www.handschriftencensus.de/12611
Fotos des Textschlusses verdanke ich Annelen Ottermann und Martin Steinmetz:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mainz_Hs_I_128_Blatt_147r.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mainz_Hs_I_128_Blatt_147v.jpg
vnder einer glicheit vndernaherbildunge [147v] des lebinß vnd des lidens vnserß herren Jhesu Christi. Amen.
Keine Überlappung mit dem Textschluss der digitalisierten Strassburger Handschrift.
]
Salzburg, UB, Cod. M I 476 (scr. Jörg Gartner 1441 im badischen Lahr), Bl. 121r-122v
http://books.google.de/books?id=jzsXAQAAIAAJ&q=%22es+ist+ein+hoher+berg%22 (Anna Jungreithmayr unter Mitarbeit von Josef Feldner und Peter H. Pascher, Die deutschen Handschriften des Mittelalters der Universitätsbibliothek Salzburg (Österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Denkschriften 196; Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters III,2), Wien 1988, S. 88)
http://www.handschriftencensus.de/6997
[Explicit: Das dis die nechste warheit ist da ich uch in dirre zeit zu+o gewisen kann vnd der helffe uns got. amen ]
St. Gallen, StiftsB, Cod. 955 (1. H. 15. Jh.), [S. 211-250]
http://www.handschriftencensus.de/16358
Eine detaillierte moderne Handschriftenbeschreibung ist nicht online, daher muss es offen bleiben, wo das Stück zu finden ist.
[Freundliche Mitteilung von Franziska Schnoor, Stiftsbibliothek St. Gallen, Mail vom 14.12.2011:
Inc.: [E]s ist ein hoher berg vnd vmb den berg ist ein [sic!] tief vnd mu+orechte vnd je neher man dem berg ist je herter vnd je schoner der weg ist …
Expl.: … also dz wir die ewige worheit die got selber ist noch dir zit do+ert in ewikeit ewichlich werdent niessen dz helf vns got amen ]
[Zusammenfassung: Der in der Strassburger Handschrift Tauler zugeschriebene, aber sicher nicht von ihm stammende ungedruckte Text 'Es ist ein hoher Berg' ist in fünf mittelalterlichen und einer Handschrift des 17. Jahrhunderts überliefert. Für eine Textwiedergabe würde sich wohl die älteste Handschrift von 1391 mgo 69 anbieten. Der abweisende Textschluss der Mainzer Handschrift lässt eine gewisse textuelle Varianz vermuten.]
 Mainz Bl. 147r
Mainz Bl. 147r
#forschung
Aufbewahrungsort Straßburg, National- und Universitätsbibl., ms. 2323 (früher L germ. 348.4°)
Codex 10 Blätter
Beschreibstoff Papier
Entstehungszeit 15. Jh. (Becker S. 24)
Abbildung Farb-Abbildung des Codex
Literatur
(Hinweis)
Adolf Becker, Die deutschen Handschriften der Kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliothek zu Straßburg (Katalog der Kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliothek in Straßburg 6), Straßburg 1914, S. 24. [online]
Ernest Wickersheimer, Strasbourg (Catalogue Général des Manuscrits des Bibliothèques Publiques de France, Départements 47), Paris 1923, S. 458. [online]
http://www.handschriftencensus.de/3582
Der Handschriftencensus wartet schon mal mit einem dicken fetten Fehler auf. Bei Wickersheimer ist es die S. 485, nicht 458. [Ist korrigiert.]
http://www.archive.org/stream/cataloguegnr47fran#page/484/mode/2up
Nach den Strassburger Katalogen ist es ein Tauler zugeschriebener Text mit dem Textbeginn "Es ist ein hoher Berg".
Das Explicit der Strassburger Hs. gibt Becker:
http://www.archive.org/stream/HandschriftenDerUlbStrassburg/DieHandschriftenDerUlbStrassburg#page/n43/mode/2up
Die Straßburger Handschrift bricht mitten im Wort ab, das vom Salzburger Katalog gegebene Textende vermochte ich nicht zu entdecken.
Textbeginn im Faksimile:
http://w1.bnu.fr/Bibliotheque%20Virtuelle/MS/cgi-bin/include/showimage.asp?image=/msrhenane_image/MS.2323/2323_003.jpg
Während Google Books unersetzlich ist, wenn man Online-only sucht, ist die Leistung der Incipit-Verzeichnisse von manuscripta.at und ManuMed erbärmlich. Berlin hat nur mgo 69, die Textanfänge der Salzburger UB-Handschriften sind bei manuscripta.at nicht ausgewertet.
Natürlich darf man nicht erwarten, dass bei einem solchen bescheidenen Kurztext der Handschriftencensus ihn nachweist.
An Sekundärliteratur finde ich:
Paul-Gerhard Völker, Die deutschen Schriften des Franziskaners Konrad Bömlin. Teil 1: Überlieferung und Untersuchung (MTU 8), München 1964, S. 111 (siehe unten bei Berlin und Hamburg)
Philipp Strauch, Zu Taulers Predigten, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 44 (1920), S. 1-26, hier S. 15: Hinweis auf Denifle und Hamburger Hs., komme für Predigten nicht in Betracht
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Zu_Taulers_Predigten.pdf
Heinrich Denifle, Taulers Bekehrung. Strassburg/London 1879, S. 10
[ http://www.archive.org/stream/taulersbekehrung00deni#page/10/mode/2up ]
http://books.google.de/books?id=oYpBAAAAYAAJ&pg=RA4-PA10 (US)
Nennt den Traktat nach seinem Anfang "Es ist ein hoher Berg" und gibt als Überlieferung: Strassburg (noch nicht signiert), mgq 149, mgo 69, Sang. 955
R. M. Werner in der Rezension eines Denifle-Buchs in: Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 29 (1878), S. 638f.
[ http://www.archive.org/details/ZeitschriftFuerDieOesterreichischenGymnasien_29_1878 ]
http://books.google.de/books?id=dWoKAAAAIAAJ&pg=PA638 (US)
Anscheinend von der späteren Forschung und auch zur Strassburger Handschrift übersehen. Stellt unter Bezugnahme auf die Stelle Bl. 6r der von Barack angekauften Strassburger Handschrift klar, dass es kein Tauler-Text ist und gibt kurze Auszüge.
Die Handschriften:
Berlin, mgo 69 (von 1391), Bl. 112r-135r und nochmals Bl. 222r-225v (fragmentarisch), aber (nach Hornung) nur teilweise übereinstimmend
http://www.handschriftencensus.de/9197
http://pik.ku-eichstaett.de/4531/ (im Handschriftencensus nicht vermerkt), als "Anleitung zum frommen Leben", was viel zu unspezifisch ist: http://pik.ku-eichstaett.de/4535/
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0590_e206_jpg.htm (Hornung, Sudermann)
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31253114,T
http://books.google.de/books?id=K3QlAQAAIAAJ&&q=es+ist+ein+hoher+berg (Völker, Bömlin)
Incipit für Bl. 112r: "Es ist ein hoher berg vnd vmb den berg ist es tief"
[Mitteilung von Kurt Heydeck, dem ich dafür und für etliche weitere Auskünfte sehr danke: Es ist ein hoher berg vnd vmb den berg ist es tief vnd mu+orehte, vnd ie neher man dem berge kummet ist je herter vnd scho+ener der weg ...
Am Rand von Sudermann: hierin ist vil gutes. lesz nit allein den anfang sondern auch das ende.]
Incipit für Bl. 222r: Es ist ein hoher berg. vmb den berg ist es tief vnd mürchte, vnd ie noher dem berge, ie herter vnd ie schönre weg
[Textschlüsse: 134verso: ... Das wir nun hie also wandelen mu+essent den weg der nehsten worheit in dirre zit. Also das wir die ewige wor- (135recto) heit die got selber ist noch dirre zit dort in ewigkeit eweclich werdent niessen. Das helffe vns got. Amen.
225verso: ... So ist dem sloffe reht, bist du aber trege vnd trurig so ist dem sloffe vnreht. So hest du gesloffen vf diner naturen. (= mgo 69, 123verso) ]
[NICHT in] Berlin, SB, mgq 149
http://www.handschriftencensus.de/11815
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31251465,T
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0590_e219_jpg.htm
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0603b_b025_jpg.htm
Welchen Text mag Denifle gemeint haben? Aufgrund des online zugänglichen Materials kann man nur mutmassen, dass es Bl. 232r-242r Tauler: Von den drei Wegen, die zu Gott führen sein könnte. Allerdings geht es im Text der Strassburger Handschrift um 2 Wege, wenngleich auch das Berliner Stück mit "des dauwelers lere" überschrieben ist
[Nach freundlicher Mitteilung von Kurt Heydeck ist der Text nicht enthalten. 232r ist es sicher nicht:
"232recto: >Des dauwelers lere.< Gut wilger M(ensch?) bist du vil zites vnd vil jor (über der Zeile eingeschoben: vmb) geloffen in dinen sunden vnd in dinen gudunckenden eigenwillen vnd du suchest alles den herren vssenn mit maniger hande wise vnd du vinde(?) nut dz du do meindest ... (232verso) ... vnd sint doch die drie wege alles ein weg ... (233verso, m.E. zumindest ein Abschnittsende:) ... so habe keine sorge er hilffet dir vsser aller not. Amen. (Darauf ein neuer Abschnitt mit roter I-Initiale) In vnserme lieben herre, Ihesu Christo vnd in sinre heilge gegenwertigen fruhtbere zukunft so sint gegrusset ir lieben vzerwelten gotzkinder ... - ... Dez helffe vns die vetterliche mugenheit vnd in leit vns sine gotliche vnsheit vnd hie inne bestetige vns die vngemessene minne dez heilgen geistes. Amen.
Jetzt ohne übergeschriebene Buchstaben/Zeichen." (Heydeck)
"In unserem Exemplar von Denifles Taulers Bekehrung (Yc 7586-36) ist die 149 in der Signatur "ms. germ. Berol. 149. 4°" mit Bleistift unterstrichen, und am Rand ist ein schräger - wie ausstreichender - Bleistiftstrich, den man freilich interpretieren kann, wie man will. Aber vielleicht soll er tatsächlich heißen: Nee, is nich." (Heydeck)]
Hamburg, UB, Ms. theol. 1885 (17. Jh., eine von Sudermann veranlasste Abschrift - von mgo 69?), S. 279-307
http://books.google.de/books?id=sEvgAAAAMAAJ&q=%22es+ist+ein+hoher+berg%22
[Der Text im HH-Katalog (Krüger 3 [! nicht 4, wie Google sagt], S. 42) lautet so:
S. 279-307 [Anleitung zu frommem Leben.] Eß ist ein hoher berg vnd vmb den berg ist es tief vnd murecht ... Überlieferung: Völker, S. 111; nennt diese Hs versehentlich als theol. 1890. - Ms. germ. oct. 69, 112r-135r. ]
http://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22veranla%C3%9Fte+Abschrift+in+Hamburg+Cod.+theol.+*%22 (Völker: Bömlin)
http://books.google.de/books?id=38rXCZGTF3EC&pg=PA235 (Mayer, Vulgata-Fassung: folgt hinsichtlich der Tauler-Predigten mgo 69!)
http://www.handschriftencensus.de/4875
Aus welchen Gründen die Hamburger Kataloge aus dem ManuMed-Programm ausgeklammert wurden, ist unerfindlich.
[Mainz, Stadtbibliothek, Hs. I 128 (hier 1. V. 15. Jh. aus der Laienbrüderbibliothek der Mainzer Kartause), Bl. 139r-147v
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0088_a230_jpg.htm
Freundlicher Hinweis von Kurt Heydeck aus ManuMed; ich hätte mit Trunkierung berg* suchen müssen!
http://www.handschriftencensus.de/12611
Fotos des Textschlusses verdanke ich Annelen Ottermann und Martin Steinmetz:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mainz_Hs_I_128_Blatt_147r.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mainz_Hs_I_128_Blatt_147v.jpg
vnder einer glicheit vndernaherbildunge [147v] des lebinß vnd des lidens vnserß herren Jhesu Christi. Amen.
Keine Überlappung mit dem Textschluss der digitalisierten Strassburger Handschrift.
]
Salzburg, UB, Cod. M I 476 (scr. Jörg Gartner 1441 im badischen Lahr), Bl. 121r-122v
http://books.google.de/books?id=jzsXAQAAIAAJ&q=%22es+ist+ein+hoher+berg%22 (Anna Jungreithmayr unter Mitarbeit von Josef Feldner und Peter H. Pascher, Die deutschen Handschriften des Mittelalters der Universitätsbibliothek Salzburg (Österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Denkschriften 196; Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters III,2), Wien 1988, S. 88)
http://www.handschriftencensus.de/6997
[Explicit: Das dis die nechste warheit ist da ich uch in dirre zeit zu+o gewisen kann vnd der helffe uns got. amen ]
St. Gallen, StiftsB, Cod. 955 (1. H. 15. Jh.), [S. 211-250]
http://www.handschriftencensus.de/16358
Eine detaillierte moderne Handschriftenbeschreibung ist nicht online, daher muss es offen bleiben, wo das Stück zu finden ist.
[Freundliche Mitteilung von Franziska Schnoor, Stiftsbibliothek St. Gallen, Mail vom 14.12.2011:
Inc.: [E]s ist ein hoher berg vnd vmb den berg ist ein [sic!] tief vnd mu+orechte vnd je neher man dem berg ist je herter vnd je schoner der weg ist …
Expl.: … also dz wir die ewige worheit die got selber ist noch dir zit do+ert in ewikeit ewichlich werdent niessen dz helf vns got amen ]
[Zusammenfassung: Der in der Strassburger Handschrift Tauler zugeschriebene, aber sicher nicht von ihm stammende ungedruckte Text 'Es ist ein hoher Berg' ist in fünf mittelalterlichen und einer Handschrift des 17. Jahrhunderts überliefert. Für eine Textwiedergabe würde sich wohl die älteste Handschrift von 1391 mgo 69 anbieten. Der abweisende Textschluss der Mainzer Handschrift lässt eine gewisse textuelle Varianz vermuten.]
 Mainz Bl. 147r
Mainz Bl. 147r#forschung
KlausGraf - am Sonntag, 11. Dezember 2011, 23:17 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bücher, die in den USA (erschienen vor 1923) und/oder Europa gemeinfrei sind, sollten ins Internet Archive hochgeladen werden.
Das gilt insbesondere für Bücher, die in Google Book Search nur mit Proxy zur Verfügung stehen.
Anleitung:
1. Buch-PDF bei Google herunterladen.
2. Registrieren beim Internet Archive.
Achtung: Die Mailadresse bleibt ständig in den XML-Metadaten stehen und fängt sich gern Spam ein. Also nach Möglichkeit nicht die Hauptmailadresse wählen!
3. Ausfüllen des Hochladeformulars
Wichtig ist die Angabe der Google-ID.
Das Hochladen kann je nach Internetverbindung recht lange dauern. Es wird zunächst eine vorläufige Seite erstellt, später wird eine OCR hinzugefügt und weitere Dateiformate. Bis zum Erstellen dieser Seite, was etwa einen Tag dauert, ist ein korrigierender Zugriff auf die Metadaten nicht möglich.
4. Eintragen des Buchs in der Wikipedia oder auf Wikisource.
Beispiel:
http://de.wikisource.org/wiki/Georg_Dehio
Weitere Hinweise:
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Internet_Archive
NACHTRÄGE
Die eigenen Uploads findet man unter
http://www.archive.org/contribute.php (eingeloggt)
Eine gute Auffindbarkeit sicherzustellen, ist schwer. Am besten sollte man Umlaute in den gesamten Metadaten vermeiden.
http://www.archive.org/details/ZeitschriftFuerDieOesterreichischenGymnasien_29_1878
wird bei der Suche nach zeitschrift gymnasien NICHT gefunden.

Das gilt insbesondere für Bücher, die in Google Book Search nur mit Proxy zur Verfügung stehen.
Anleitung:
1. Buch-PDF bei Google herunterladen.
2. Registrieren beim Internet Archive.
Achtung: Die Mailadresse bleibt ständig in den XML-Metadaten stehen und fängt sich gern Spam ein. Also nach Möglichkeit nicht die Hauptmailadresse wählen!
3. Ausfüllen des Hochladeformulars
Wichtig ist die Angabe der Google-ID.
Das Hochladen kann je nach Internetverbindung recht lange dauern. Es wird zunächst eine vorläufige Seite erstellt, später wird eine OCR hinzugefügt und weitere Dateiformate. Bis zum Erstellen dieser Seite, was etwa einen Tag dauert, ist ein korrigierender Zugriff auf die Metadaten nicht möglich.
4. Eintragen des Buchs in der Wikipedia oder auf Wikisource.
Beispiel:
http://de.wikisource.org/wiki/Georg_Dehio
Weitere Hinweise:
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Internet_Archive
NACHTRÄGE
Die eigenen Uploads findet man unter
http://www.archive.org/contribute.php (eingeloggt)
Eine gute Auffindbarkeit sicherzustellen, ist schwer. Am besten sollte man Umlaute in den gesamten Metadaten vermeiden.
http://www.archive.org/details/ZeitschriftFuerDieOesterreichischenGymnasien_29_1878
wird bei der Suche nach zeitschrift gymnasien NICHT gefunden.

KlausGraf - am Sonntag, 11. Dezember 2011, 20:17 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 Dieses hübsche Bild stammt aus dem Adventskalender der UB Heidelberg.
Dieses hübsche Bild stammt aus dem Adventskalender der UB Heidelberg.http://www.ub.uni-heidelberg.de/advent/kalender2011.php
KlausGraf - am Sonntag, 11. Dezember 2011, 19:32 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Deutschlandradio sprach mit dem Leiter Karl Peter Ellerbrock aus Anlass des 70jährigen Bestehens seines Archivs:
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/thema/1623858/
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/thema/1623858/
KlausGraf - am Sonntag, 11. Dezember 2011, 15:00 - Rubrik: Wirtschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bis einschließlich Jahrgang 1908 via Google bzw. Internet Archive einsehbar. Die Jahrgänge 1909-1922 sind nur mit US-Proxy in HathiTrust zugänglich.
http://de.wikisource.org/wiki/Zeitschrift_f%C3%BCr_die_Geschichte_des_Oberrheins
http://de.wikisource.org/wiki/Zeitschrift_f%C3%BCr_die_Geschichte_des_Oberrheins
KlausGraf - am Sonntag, 11. Dezember 2011, 01:50 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 Wer sich wissenschaftlich mit Mündlichkeit beschäftigt hat oder mit Erzählforschung, dem ist sicher die Oral-formulaic-Theorie von Milman Parry (1902-1935) und Albert Lord (1912-1991) begegnet. Lords einflussreiches Buch The Singer of Tales erschien 1960. Über Parry unterrichtet der Artikel der Enzyklopädie des Märchens (einsehbar über die Suche im Buch bei Amazon).
Wer sich wissenschaftlich mit Mündlichkeit beschäftigt hat oder mit Erzählforschung, dem ist sicher die Oral-formulaic-Theorie von Milman Parry (1902-1935) und Albert Lord (1912-1991) begegnet. Lords einflussreiches Buch The Singer of Tales erschien 1960. Über Parry unterrichtet der Artikel der Enzyklopädie des Märchens (einsehbar über die Suche im Buch bei Amazon).Die Harvard-Universität hat einen Teil des Nachlasses von Parry digitalisiert (wir wiesen schon 2008 darauf hin): The largest single repository of South Slavic heroic song in the world, the Milman Parry Collection of Oral Literature gives scholars access to two valuable resources: the heroic songs, conversations, and stories in the Parry Collection, and the entire contents of the Lord Collection. The selection of items in this digital collection was based on Albert B. Lord's seminal book, "The Singer of Tales," which is now considered a standard text in folklore studies. This selection of songs referred to in Lord's book created a resource of immediate benefit to multiple audiences, from first-time readers to scholars who have long used the text.
http://hcl.harvard.edu/collections/digital_collections/milman_parry.cfm
Eine ganze Reihe von Aufzeichnungen südslawischer Heldengesänge ist auch mit Audio-Dateien versehen, die leider nur mit dem RealPlayer abspielbar sind (streikt dieser aus irgendwelchen Gründen, hat man Pech gehabt). Zwar steht keine Quelle dabei, aber ziemlich sicher stammen Töne und Bilder des verlinkten Youtube-Videos aus der Harvard-Sammlung. Die Musik stammt von Guslas.
Hier noch einige Hinweise zu den reichen digitalen Sammlungen der Harvard-Universität.
In unregelmäßigen Abständen informiert das Houghton Library Blog über neu digitalisierte Stücke:
http://blogs.law.harvard.edu/houghton/category/digitization/
Übersicht digitaler Sammlungen:
http://hcl.harvard.edu/collections/digital_collections/explore.cfm
Umfangreich sind die digitalen Sammlungen der "Open Collections":
http://ocp.hul.harvard.edu/
Alle Digitalisate sollte man aber durch Suche im Bibliothekskatalog HOLLIS finden (unter Digital Resources). Eher ein Geheimtipp ist die Möglichkeit der Vollextsuche in allen OCR-erfassten Dokumenten des sogenannten Page Delivery Service:
http://fts.lib.harvard.edu/fts/search
Hier kann man auch nach deutschsprachigen Begriffen recherchieren.
Für die Bildüberlieferung ist VIA zuständig, eine riesige Bilddatenbank:
http://via.lib.harvard.edu/
Alle Türchen 2011
KlausGraf - am Sonntag, 11. Dezember 2011, 00:31 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Von befreundeter Seite wurde im September 2011 CyberGhost für mich getestet und zwar die Prepaid-Version für 1 Monat zum Preis von 6,99 Euro:
http://cyberghostvpn.com/de/produkt/kaufen.html
Dabei wurden insbesondere Bücher aus HathiTrust (Einzelseiten mit HathiHelper) heruntergeladen.
Nach Bezahlung erhält man den Link zur Vollversion, die sich unkompliziert installieren lasst und jeweils angeschaltet werden muss, wenn man surfen will. Es stehen 69 Server zur Verfügung, darunter 9 US-Server, die stets erreichbar waren.
Hat man die zur Verfügung gestellten 20 GB an Traffic aufgebraucht, verringert sich die Mindestgeschwindigkeit von 2 000 kBit/s auf 512 kbit/s. Nach drei Wochen intensivsten Testens waren aber nur 4,3 GB verbraucht.
Das Herunterladen von Büchern mit dem HT-helper dauert bei ca. 250 Seiten ungefähr 12 Minuten. Will man sofort erneut etwas herunterladen, erzwingt HT eine Pause, weil zu viele Anfragen bisher erfolgten; im Schnitt waren das 5-15 Minuten. Die Wartezeit kann man aber durch Wechsel des US-Servers umgehen.
Fazit: Wer das Geld hat und sich nervige Werbebanner oder Ärger mit nicht funktionierenden US-Proxys ersparen will, für den ist CyberGhost eine empfehlenswerte Alternative zu den kostenlosen Angeboten.
Update: Funktioniert nicht mehr bei HathiTrust
http://archiv.twoday.net/stories/75243644/

http://cyberghostvpn.com/de/produkt/kaufen.html
Dabei wurden insbesondere Bücher aus HathiTrust (Einzelseiten mit HathiHelper) heruntergeladen.
Nach Bezahlung erhält man den Link zur Vollversion, die sich unkompliziert installieren lasst und jeweils angeschaltet werden muss, wenn man surfen will. Es stehen 69 Server zur Verfügung, darunter 9 US-Server, die stets erreichbar waren.
Hat man die zur Verfügung gestellten 20 GB an Traffic aufgebraucht, verringert sich die Mindestgeschwindigkeit von 2 000 kBit/s auf 512 kbit/s. Nach drei Wochen intensivsten Testens waren aber nur 4,3 GB verbraucht.
Das Herunterladen von Büchern mit dem HT-helper dauert bei ca. 250 Seiten ungefähr 12 Minuten. Will man sofort erneut etwas herunterladen, erzwingt HT eine Pause, weil zu viele Anfragen bisher erfolgten; im Schnitt waren das 5-15 Minuten. Die Wartezeit kann man aber durch Wechsel des US-Servers umgehen.
Fazit: Wer das Geld hat und sich nervige Werbebanner oder Ärger mit nicht funktionierenden US-Proxys ersparen will, für den ist CyberGhost eine empfehlenswerte Alternative zu den kostenlosen Angeboten.
Update: Funktioniert nicht mehr bei HathiTrust
http://archiv.twoday.net/stories/75243644/

KlausGraf - am Samstag, 10. Dezember 2011, 23:16 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Liebe Archivalia Leser und Beiträger,
es würde mich freuen, wenn jemand helfen könnte.
Im Jahr 1936 erstellte das Büro Alfred Meyers einen Vermerk.
Gestorben waren bei einem Flugzeugabsturz Adolf Fürst zu Schaumburg-Lippe und Elisabeth (Ellen) zu Schaumburg-Lippe, geborene Bischoff-Korthaus.
In diesem vermerk wird erwähnt, dass Ellen nicht "arisch" gewesen sei (nach Aussage Friedrich Christians, "Adjutant von Goebbels und Schwager Ellens).
Seit längerer Zeit gehe ich der Frage nach, ob Ellen jüdischer Abstammung war. Wäre dies der Fall, so könnte ich mir "einiges" erklären.
Ich kann in der Heiratsurkunde unten zwei Wörter nicht lesen. Kann jemand aushelfen ? Welche Rolle spielt Karl Korthaus bei der Eheschliessung ?
Das Problem besteht in folgendem: In der Gestapoakte wurde vermerkt, dass Ellen Tochter eines Münchner Kunstmalers war (sein Alter 41 Jahre). Es ist somit Carl Adolf Korthaus, ein aus meiner Sicht guter Landschaftsmaler.
In der Heiratsurkunde auf Blatt 2 heisst es, dass der standesamtlichen Trauung Stephan Kekule von Stradonitz
http://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kekulé_von_Stradonitz
und der Münchner Kunstmaler Kurt Korthaus beiwohnten.
Also wird Carl Adolf Korthaus in der Heiratsurkunde einmal auf Seite 1 unten erwähnt (kann aber nicht lesen in welcher Eigenschaft) und auf Seite 2 neben Kekule von Stradonitz.
Auf Seite 1 der Heiratsurkunde heisst es unten, dass Ellen Tochter von Franz Bischoff und Wilhelmina Hofmihlen ist, ersterer Sohn von Heinrich und Emilia Reitschuh. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist Ellen nicht Tochter des Münchner Kunstmalers, sondern Tochter von Franz Bischoff, geboren in Zwenkau und Fabrikbesitzer in Leipzig.
Mich irritiert, dass der Nachname der Grossmutter väterlicherseits erst Breitschuh und dann Reitschuh lautete.
Ferner kann ich nicht verstehen, wieso Ellens Vater Franz Bischoff hiess, die Gestapo aber sagt, sie sei Tochter des Kunstmalers (gemeint ist Carl Adolf Korthaus).
Ferner verstehe ich den Randvermerk in der Liste der Kinder nicht. Ein Randvermerk bei Ellen scheint "legitimiert" zu sagen. Was hiesse das ?
Ich stelle mir somit folgende Fragen:
1. War Franz Bischoff nicht Vater Ellens ?
2. Wurde sie adoptiert von Carl Adolf Korthaus ?
3. Wieso der Doppelname Bischoff-Korthaus ?
4. Wieso erst Breitschuh dann Reitschuh ?
Ich weiss, es sind viele Fragen, aber vielleicht kann jemand einen Tipp geben. Mir würde schon sehr helfen, wenn jemand die Eintragung unten in der Heiratsurkunde entziffern könnte. Danke.
HABE DAS ENTSPRECHENDE DOKUMENT IM BLOG VERGRÖSSERT
http://www.vierprinzen.com/2013/01/blog-post.html
ANTWORT BITTE WAHLWEISE HIER ODER AN:
alexander@vierprinzen.com
Alexander vom Hofe
es würde mich freuen, wenn jemand helfen könnte.
Im Jahr 1936 erstellte das Büro Alfred Meyers einen Vermerk.
Gestorben waren bei einem Flugzeugabsturz Adolf Fürst zu Schaumburg-Lippe und Elisabeth (Ellen) zu Schaumburg-Lippe, geborene Bischoff-Korthaus.
In diesem vermerk wird erwähnt, dass Ellen nicht "arisch" gewesen sei (nach Aussage Friedrich Christians, "Adjutant von Goebbels und Schwager Ellens).
Seit längerer Zeit gehe ich der Frage nach, ob Ellen jüdischer Abstammung war. Wäre dies der Fall, so könnte ich mir "einiges" erklären.
Ich kann in der Heiratsurkunde unten zwei Wörter nicht lesen. Kann jemand aushelfen ? Welche Rolle spielt Karl Korthaus bei der Eheschliessung ?
Das Problem besteht in folgendem: In der Gestapoakte wurde vermerkt, dass Ellen Tochter eines Münchner Kunstmalers war (sein Alter 41 Jahre). Es ist somit Carl Adolf Korthaus, ein aus meiner Sicht guter Landschaftsmaler.
In der Heiratsurkunde auf Blatt 2 heisst es, dass der standesamtlichen Trauung Stephan Kekule von Stradonitz
http://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kekulé_von_Stradonitz
und der Münchner Kunstmaler Kurt Korthaus beiwohnten.
Also wird Carl Adolf Korthaus in der Heiratsurkunde einmal auf Seite 1 unten erwähnt (kann aber nicht lesen in welcher Eigenschaft) und auf Seite 2 neben Kekule von Stradonitz.
Auf Seite 1 der Heiratsurkunde heisst es unten, dass Ellen Tochter von Franz Bischoff und Wilhelmina Hofmihlen ist, ersterer Sohn von Heinrich und Emilia Reitschuh. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist Ellen nicht Tochter des Münchner Kunstmalers, sondern Tochter von Franz Bischoff, geboren in Zwenkau und Fabrikbesitzer in Leipzig.
Mich irritiert, dass der Nachname der Grossmutter väterlicherseits erst Breitschuh und dann Reitschuh lautete.
Ferner kann ich nicht verstehen, wieso Ellens Vater Franz Bischoff hiess, die Gestapo aber sagt, sie sei Tochter des Kunstmalers (gemeint ist Carl Adolf Korthaus).
Ferner verstehe ich den Randvermerk in der Liste der Kinder nicht. Ein Randvermerk bei Ellen scheint "legitimiert" zu sagen. Was hiesse das ?
Ich stelle mir somit folgende Fragen:
1. War Franz Bischoff nicht Vater Ellens ?
2. Wurde sie adoptiert von Carl Adolf Korthaus ?
3. Wieso der Doppelname Bischoff-Korthaus ?
4. Wieso erst Breitschuh dann Reitschuh ?
Ich weiss, es sind viele Fragen, aber vielleicht kann jemand einen Tipp geben. Mir würde schon sehr helfen, wenn jemand die Eintragung unten in der Heiratsurkunde entziffern könnte. Danke.
HABE DAS ENTSPRECHENDE DOKUMENT IM BLOG VERGRÖSSERT
http://www.vierprinzen.com/2013/01/blog-post.html
ANTWORT BITTE WAHLWEISE HIER ODER AN:
alexander@vierprinzen.com
Alexander vom Hofe
vom hofe - am Samstag, 10. Dezember 2011, 22:04 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
Der Artikel auf http://redaktionsblog.hypotheses.org/40 steht unter
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Er darf nachgenutzt werden, wenn die Namen der Urheber (und die Lizenz!) genannt werden.
Zitierempfehlung: Klaus Graf/Mareike König: Entwicklungsfähige Blogosphäre - ein Blick auf deutschsprachige Geschichtsblogs. In: Redaktionsblog de.hyptheses.org vom 9. Dezember 2011. Online:
http://redaktionsblog.hypotheses.org/40 (Ergänzen Sie, falls Sie möchten, noch das Datum der Einsichtnahme: Abgerufen am o.ä.)
 von Klaus Graf und Mareike König
von Klaus Graf und Mareike König
Nachdem vor kurzem bei Archivalia die französische Blogosphäre im Bereich der Geschichtswissenschaften vorgestellt wurde, wollen wir mit diesem Artikel den umgekehrten Blick auf die deutschsprachigen Geschichtsblogs werfen.
Anders als in Frankreich (( Siehe Mareike König, Blogging tricolore: geisteswissenschaftliche Blogs in Frankreich, in: Archivalia, 11.08.2011, http://archiv.twoday.net/stories/38743431/)) ist die deutschsprachige Blogsphäre im Bereich der Geschichtswissenschaften derzeit klein und überschaubar. Das mag zum einen daran liegen, dass wissenschaftliches Bloggen auf dieser Seite des Rheins oftmals mit Geringschätzung geachtet wird. Solange Peer-Review-Artikel im Lebenslauf ungleich höher gehandelt werden als ein Wissenschaftsblog, stecken viele Historiker/innen ihre Energien lieber in “traditionelle” Veröffentlichungen. Dabei müsste das eine das andere gar nicht ausschließen ((Siehe Pierre Mounier, Die Werkstatt des Historikers öffnen. Soziale Medien und Wissenschaftsblogs, in: Digital Humanities am DHI, 4.11.2011 http://dhdhi.hypotheses.org/591)) . Zum anderen fehlen in Deutschland bisher Strukturen, die geisteswissenschaftliche Blogs zentral an einer Stelle bündeln und so für eine erhöhte Sichtbarkeit, für Qualität und für die Langzeitarchivierung sorgen. Mit dem gerade eröffneten deutschsprachigen Blogportal de.hypotheses.org soll sich das nun ändern und eine vernetzte deutschsprachige, bloggende Fachcommunity entstehen, die den Kontakt mit Kollegen und Öffentlichkeit über dieses Medium nicht scheut ((Mareike König, Ein deutschsprachiges Blogportal für die Geisteswissenschaften: de.hypotheses.org, in: Digital Humanities am DHI, 2.12.2011 http://dhdhi.hypotheses.org/610)).
Betrachtet man die gegenwärtige deutschsprachige historische Blogsphäre, so fällt im Vergleich zu Frankreich zunächst auf, dass es kaum thematisch eng geführte Blogs von Forschergruppen gibt. Die meisten Geschichtsblogs sind eher themenübergreifend. Auch findet man bisher wenige öffentlich zugängliche Blogs, die ein Seminar an der Universität begleiten. Ebenso sind die in Frankreich beliebten Ausgrabungsblogs von Archäologen in Deutschland inexistent, genau wie Institutsblogs und Blogs, die eine Publikation begleiten. Folglich gibt es bisher auch nur wenige deutschsprachige Blogs, die selbständige Forschungsbeiträge bzw. Mitteilungen zu neuen Forschungsergebnissen publizieren. Einen eigenen wissenschaftlichen Rezensionsteil, der über die bloße Ankündigung von Neuerscheinungen hinausgeht, führt derzeit ausschließlich Archivalia. Dagegen existieren vereinzelt Aggregatoren, die Beiträge aus verschiedenen Geschichtsblogs in einer Übersicht anbieten, wie z.B. “Planet Clio”, sowie Blogs, die im Zusammenhang mit Geschichtsportalen entstehen, wie z.B. infoclio.ch.
Im Folgenden werden die aus unserer subjektiven Sicht derzeit wichtigsten deutschsprachigen Geschichtsblogs in alphabetischer Reihenfolge kurz vorgestellt. Im Anhang findet sich eine Liste mit weiteren Blogs als Vorarbeit zu einer möglichst vollständigen “Blogroll” der deutschsprachigen Geschichtsblogosphäre. Weitere Wertungen und Informationen für viele der genannten Blogs finden sich in weblog.histnet.ch, das zeitweilig monatlich ein Geschichtsblog auszeichnete ((http://www.hist.net/forschung-praxis/geschichtsblogs/)). Aufschlussreich ist darüber hinaus auch die Momentaufnahme der Geschichtsblogosphäre aus dem Jahre 2006 von Sabine Büttner in der GWU ((Büttner, Sabine: Eintritt in die Blogosphäre, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 57.2006/9, S. 540f. Online nur im Internet-Archive: http://web.archive.org/web/20080609081049/http://konzeptkomfort.de/arbeitsproben/detail8.htm)).
Adresscomptoir
http://adresscomptoir.twoday.net/
Das von dem Wiener Historiker Dr. Anton Tantner betriebene Blog besteht seit Ende Juni 2005 und enthält überwiegend kurze Hinweise auf neue Internetlinks oder Literatur. Daneben finden sich Materialien aus seinen Forschungsinteressen, etwa Fotos historischer Hausnummerierungen oder ein Auszug aus einem wissenschaftlichen Aufsatz. Tantner unterhält außerdem ein lehrveranstaltungsbegleitendes Blog “Digitale Medien in der Geschichtswissenschaft”.
Einen lesenswerten Erfahrungsbericht über seine Blogpraxis gab Tantner 2011 in medienimpulse.at.
Anzahl der im Blog publizierten Einträge im Oktober 2011: 29, im September 2011: 21.
Antike und Abendland
http://faz-community.faz.net/blogs/antike/default.aspx
Der Bielefelder Professor Dr. Uwe Walter schreibt für die FAZ eher eine Feuilleton-Kolumne zu Themen der Alten Geschichte bzw. zu ihrer Relevanz für die Gegenwart als ein Blog. Er betrachte sich auch selbst nicht als Blogger, wie Walter in einem L.I.S.A.-Interview erklärte. Ob Blog oder nicht, seine Beiträge sind kurzweilig, die Bezüge zum tagesaktuellen Geschehen zumeist interessant, so z.B. der Beitrag “Trojaner zu Unrecht gescholten”, in dem er den mythologische Hintergrund der Debatte um den “Bundestrojaner” analysiert.
Anzahl der im Blog publizierten Einträge: Oktober 2011: 5, September 2011: 5.
Arbeitsgemeinschaft Frühe Neuzeit
http://agfnz.historikerverband.de/
Im Herbst 2010 gestartet, wird das Weblog der AGFNZ nach dem Willen der Verantwortlichen Ende 2011 aus der Webpräsenz der Arbeitsgemeinschaft wieder verschwinden. Eine bedauerliche Entscheidung, denn als eines der wenigen Blogs findet man hier eigenständige kurze Forschungsbeiträge sowie die praktischen monatlichen Rezensions-Digests. Hoffnung besteht sicherlich nicht zuletzt für die 185 Freunde bei Facebook, dass das Blog von der Aachener Frühneuzeitprofessur (Christine Roll) weitergeführt wird und zu de.hypotheses.org umzieht.
Anzahl der im Blog publizierten Einträge: Oktober 2011: 1, September 2011: 2.
Archaeologik
http://archaeologik.blogspot.com/
“Archaeologik ist ein wissenschaftlich orientiertes Blog zu Themen aus den Feldern Archäologie und Denkmalpflege. Das Augenmerk gilt weniger sensationellen Neufunden, sondern grundsätzlichen methodisch-theoretischen und wissenschaftspolitischen Aspekten der Archäologie”, beschreibt Dr. Rainer Schreg, wissenschaftlicher Archäologe am RGMZ, die Ausrichtung seines Projekts. Neben kulturpolitischen Beiträgen zum Kulturgutschutz soll eine kleine Artikelserie zu Chancen der Luftbildarchäologie bei der Erforschung von Altfluren hervorgehoben werden.
Anzahl der im Blog publizierten Einträge: Oktober 2011: 13, September 2011: 13.
Archivalia
http://archiv.twoday.net
Denkt man an Geschichtsblogs im deutschsprachigen Raum, so kommt einem als erstes Archivalia in den Sinn. Von Klaus Graf im Jahr 2003 als Gemeinschaftsblog gegründet, hat sich Archivalia seine herausragende Stellung durch zahlreiche hochwertige Forschungsbeiträge sowie einen wissenschaftlichen Rezensionsteil verdient. Flankiert durch die Veröffentlichung zahlreicher relevanter Links erreicht Archivalia eine Publikationsfrequenz, die einen schwindelig machen kann. Eine “ausgesprochene Buntheit” und ein Interesse an vielfältigen Themen wurde Archivalia schon 2004 in einer Rezension bei H-Soz-u-Kult bescheinigt. Einen Namen hat sich Archivalia darüber hinaus als “Sturmgeschütz, das für Open Access kämpft” gemacht ((http://archiv.twoday.net/stories/29751181/)). Klaus Graf setzt sich mit diesem Blog außerdem für die Renaissance von Miszellen, Splitterveröffentlichungen und Textfragmenten ein, wie aus seinem Vortrag am DHI Paris deutlich wird. Die Art und Weise, in der Archivalia die Community mit Information versorgt, ist sowohl qualitativ wie auch quantitativ einmalig.
Anzahl der im Blog publizierten Einträge: Oktober 2011: 274, September 2011: 378.
Digitale Regionalgeschichte
http://digireg.twoday.net/
Von den hier porträtierten Blogs wird – neben Antike und Abendland von Uwe Walter – nur noch dieses von einem Professor verantwortet: Karl Heinz Schneider, Universität Hannover, publiziert hier sporadisch vorwiegend kurze Mitteilungen. Mitunter berichtet Schneider aus der Werkstatt des Regionalhistorikers, so z.B. im Beitrag “Vom Nutzen des Internet für die transnationale Geschichte”, in dem es um ein Projekt über die Briefe der 1858 von Niedersachsen nach Kalifornien mit ihrem Mann ausgewanderten Sophie Meinecke geht.
Anzahl der im Blog publizierten Einträge: Oktober 2011: 1, September 2011: 2.
Kritische Geschichte
http://kritischegeschichte.wordpress.com
Es handelt sich um ein von Dr. Richard Heigl betriebenes Gemeinschaftsblog, das dem Konzept einer (linken) “Kritischen Geschichte” verpflichtet ist. Neben der Besprechung von Neuigkeiten gibt es selten auch längere Beiträge programmatischen Charakters, wie z.B. “Kritik einer Kapitalismuskritik” über einen Vortrag von Jürgen Kocka , den dieser Anfang Dezember 2011 gehalten hat.
Zur Selbsteinschätzung und den Abrufzahlen des Blogs siehe den Beitrag zur Blogstatistik.
Anzahl der im Blog publizierten Einträge: Oktober 2011: 6, September 2011: 3.
Medien im Geschichtsunterricht
http://geschichtsunterricht.wordpress.com/
“Der Blog soll Gelegenheit dazu geben, methodische und didaktische Überlegungen zum Einsatz und Umgang mit Medien im Geschichtsunterricht auszutauschen und zu diskutieren.” So Daniel Bernsen, der sowohl als Gymnasiallehrer unterrichtet als auch am Pädagogischen Landesinstitut (Standort Koblenz) tätig ist. Da vergleichsweise häufig in Bernsens Blog kommentiert wird, leistet es, was es verspricht. Für Lehrende mit Netzaffinität eine wichtige Adresse, weil in den Beiträgen nicht nur verschiedene Medien und Web 2.0-Anwendungen vorgestellt, sondern auch einzelne Unterrichtseinheiten beschrieben werden (z.B. Unterrichtseinheit Karl der Große in zwei Teilen).
Anzahl der im Blog publizierten Einträge: Oktober 2011: 13, September 2011: 14.
weblog.hist.net
weblog.hist.net
Die Schweizer Historiker Peter Haber und Jan Hodel publizieren auf diesem Blog seit 2005 über Geschichte und digitale Medien. Das Blog zeichnet sich durch anregende Links sowie durch seine eigenständigen, gut geschriebenen Kurzartikel aus, die mitunter auch von Gastautoren stammen. Die Themenbreite reicht “von Open Access bis e-Learning, von Google bis Urheberrecht, von Bibliographierhilfsmitteln bis Werkzeugen zum kollaborativen Schreiben, von digitalen Karten bis digitalisierten Handschriften, von web 1.0 bis web 3.0”, so ist in der Selbstbeschreibung zu lesen. Für digital historians und für alle, die es werden wollen, ist weblog.hist.net ein Muss.
Anzahl der im Blog publizierten Einträge: Oktober 2011: 9: September 2011: 23.
Weitere Blogs
Die folgende Liste ist eine Vorarbeit zu einer möglichst vollständigen “Blogroll” der deutschsprachigen Geschichtsblogosphäre, wobei natürlich die aufgelisteten Internetangebote aus “historischer Perspektive” zu ergänzen wären durch aufgegebene Projekte, die noch online oder im Internet Archive dokumentiert sind.
Arbeitskreis Policey/Polizei im vormodernen Europa
http://www.univie.ac.at/policey-ak/
Brennpunkt Geschichte
http://www.brennpunkt-geschichte.de/
burgerbe-blog
http://burgerbe.wordpress.com/
Digitaler Widerstand
http://digitalerwiderstand.wordpress.com/
Docupedia-Blog
http://docupedia.de/zg/Blog
einsichten
http://www.einsichten-online.de/
geschichte.quelle.lektüre
http://arcana.twoday.net/
Geschichtsblog
http://geschichts-blog.blogspot.com/
Geschichtsblog
http://www.geschichtsinfos.de/
GeschichtsPuls
http://geschichtspuls.de/
Geschichtsweberei
http://geschichtsweberei.blogspot.com/
Gewerkschaftsgeschichte - der Geschichtsblog von ver.di
http://verdiarchiv.blogspot.com/
Hamburgische Geschichten
http://hamburgische-geschichten.de/
Historikerkraus.de
http://historikerkraus.de/blog/
Historisch Denken Lernen
http://koerber2005.erzwiss.uni-hamburg.de/wordpress-mu/historischdenkenlernen/
infoclio.ch
http://www.infoclio.ch/de/blog?uid=
Klio surft
http://kliosurft.wordpress.com/
Oberschwäbische Mannigfaltigkeiten
http://mannigfaltigkeiten.twoday.net/
RambowGenealogie ((Zu Genealogieblogs siehe auch http://www.rambow.de/genealogieblogs))
http://www.rambow.de/
Schmalenstroer.net
http://schmalenstroer.net/blog/
Tribur.de
http://www.tribur.de/blog/
Weblog zu Netz und Geschichte
http://netzgeschichte.wordpress.com/
Zeittaucher
http://www.scienceblogs.de/zeittaucher/
Zwerge auf den Schultern von Riesen
http://zwergenblick.wordpress.com
=================================
ANHANG Archivalia
Weitere Blogs siehe in den Kommentaren auf de.hypotheses.org
Update: Französische Übersetzung des Beitrags
http://dhiha.hypotheses.org/425
Illustration: Screenshot Planet Clio

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Er darf nachgenutzt werden, wenn die Namen der Urheber (und die Lizenz!) genannt werden.
Zitierempfehlung: Klaus Graf/Mareike König: Entwicklungsfähige Blogosphäre - ein Blick auf deutschsprachige Geschichtsblogs. In: Redaktionsblog de.hyptheses.org vom 9. Dezember 2011. Online:
http://redaktionsblog.hypotheses.org/40 (Ergänzen Sie, falls Sie möchten, noch das Datum der Einsichtnahme: Abgerufen am o.ä.)
 von Klaus Graf und Mareike König
von Klaus Graf und Mareike KönigNachdem vor kurzem bei Archivalia die französische Blogosphäre im Bereich der Geschichtswissenschaften vorgestellt wurde, wollen wir mit diesem Artikel den umgekehrten Blick auf die deutschsprachigen Geschichtsblogs werfen.
Anders als in Frankreich (( Siehe Mareike König, Blogging tricolore: geisteswissenschaftliche Blogs in Frankreich, in: Archivalia, 11.08.2011, http://archiv.twoday.net/stories/38743431/)) ist die deutschsprachige Blogsphäre im Bereich der Geschichtswissenschaften derzeit klein und überschaubar. Das mag zum einen daran liegen, dass wissenschaftliches Bloggen auf dieser Seite des Rheins oftmals mit Geringschätzung geachtet wird. Solange Peer-Review-Artikel im Lebenslauf ungleich höher gehandelt werden als ein Wissenschaftsblog, stecken viele Historiker/innen ihre Energien lieber in “traditionelle” Veröffentlichungen. Dabei müsste das eine das andere gar nicht ausschließen ((Siehe Pierre Mounier, Die Werkstatt des Historikers öffnen. Soziale Medien und Wissenschaftsblogs, in: Digital Humanities am DHI, 4.11.2011 http://dhdhi.hypotheses.org/591)) . Zum anderen fehlen in Deutschland bisher Strukturen, die geisteswissenschaftliche Blogs zentral an einer Stelle bündeln und so für eine erhöhte Sichtbarkeit, für Qualität und für die Langzeitarchivierung sorgen. Mit dem gerade eröffneten deutschsprachigen Blogportal de.hypotheses.org soll sich das nun ändern und eine vernetzte deutschsprachige, bloggende Fachcommunity entstehen, die den Kontakt mit Kollegen und Öffentlichkeit über dieses Medium nicht scheut ((Mareike König, Ein deutschsprachiges Blogportal für die Geisteswissenschaften: de.hypotheses.org, in: Digital Humanities am DHI, 2.12.2011 http://dhdhi.hypotheses.org/610)).
Betrachtet man die gegenwärtige deutschsprachige historische Blogsphäre, so fällt im Vergleich zu Frankreich zunächst auf, dass es kaum thematisch eng geführte Blogs von Forschergruppen gibt. Die meisten Geschichtsblogs sind eher themenübergreifend. Auch findet man bisher wenige öffentlich zugängliche Blogs, die ein Seminar an der Universität begleiten. Ebenso sind die in Frankreich beliebten Ausgrabungsblogs von Archäologen in Deutschland inexistent, genau wie Institutsblogs und Blogs, die eine Publikation begleiten. Folglich gibt es bisher auch nur wenige deutschsprachige Blogs, die selbständige Forschungsbeiträge bzw. Mitteilungen zu neuen Forschungsergebnissen publizieren. Einen eigenen wissenschaftlichen Rezensionsteil, der über die bloße Ankündigung von Neuerscheinungen hinausgeht, führt derzeit ausschließlich Archivalia. Dagegen existieren vereinzelt Aggregatoren, die Beiträge aus verschiedenen Geschichtsblogs in einer Übersicht anbieten, wie z.B. “Planet Clio”, sowie Blogs, die im Zusammenhang mit Geschichtsportalen entstehen, wie z.B. infoclio.ch.
Im Folgenden werden die aus unserer subjektiven Sicht derzeit wichtigsten deutschsprachigen Geschichtsblogs in alphabetischer Reihenfolge kurz vorgestellt. Im Anhang findet sich eine Liste mit weiteren Blogs als Vorarbeit zu einer möglichst vollständigen “Blogroll” der deutschsprachigen Geschichtsblogosphäre. Weitere Wertungen und Informationen für viele der genannten Blogs finden sich in weblog.histnet.ch, das zeitweilig monatlich ein Geschichtsblog auszeichnete ((http://www.hist.net/forschung-praxis/geschichtsblogs/)). Aufschlussreich ist darüber hinaus auch die Momentaufnahme der Geschichtsblogosphäre aus dem Jahre 2006 von Sabine Büttner in der GWU ((Büttner, Sabine: Eintritt in die Blogosphäre, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 57.2006/9, S. 540f. Online nur im Internet-Archive: http://web.archive.org/web/20080609081049/http://konzeptkomfort.de/arbeitsproben/detail8.htm)).
Adresscomptoir
http://adresscomptoir.twoday.net/
Das von dem Wiener Historiker Dr. Anton Tantner betriebene Blog besteht seit Ende Juni 2005 und enthält überwiegend kurze Hinweise auf neue Internetlinks oder Literatur. Daneben finden sich Materialien aus seinen Forschungsinteressen, etwa Fotos historischer Hausnummerierungen oder ein Auszug aus einem wissenschaftlichen Aufsatz. Tantner unterhält außerdem ein lehrveranstaltungsbegleitendes Blog “Digitale Medien in der Geschichtswissenschaft”.
Einen lesenswerten Erfahrungsbericht über seine Blogpraxis gab Tantner 2011 in medienimpulse.at.
Anzahl der im Blog publizierten Einträge im Oktober 2011: 29, im September 2011: 21.
Antike und Abendland
http://faz-community.faz.net/blogs/antike/default.aspx
Der Bielefelder Professor Dr. Uwe Walter schreibt für die FAZ eher eine Feuilleton-Kolumne zu Themen der Alten Geschichte bzw. zu ihrer Relevanz für die Gegenwart als ein Blog. Er betrachte sich auch selbst nicht als Blogger, wie Walter in einem L.I.S.A.-Interview erklärte. Ob Blog oder nicht, seine Beiträge sind kurzweilig, die Bezüge zum tagesaktuellen Geschehen zumeist interessant, so z.B. der Beitrag “Trojaner zu Unrecht gescholten”, in dem er den mythologische Hintergrund der Debatte um den “Bundestrojaner” analysiert.
Anzahl der im Blog publizierten Einträge: Oktober 2011: 5, September 2011: 5.
Arbeitsgemeinschaft Frühe Neuzeit
http://agfnz.historikerverband.de/
Im Herbst 2010 gestartet, wird das Weblog der AGFNZ nach dem Willen der Verantwortlichen Ende 2011 aus der Webpräsenz der Arbeitsgemeinschaft wieder verschwinden. Eine bedauerliche Entscheidung, denn als eines der wenigen Blogs findet man hier eigenständige kurze Forschungsbeiträge sowie die praktischen monatlichen Rezensions-Digests. Hoffnung besteht sicherlich nicht zuletzt für die 185 Freunde bei Facebook, dass das Blog von der Aachener Frühneuzeitprofessur (Christine Roll) weitergeführt wird und zu de.hypotheses.org umzieht.
Anzahl der im Blog publizierten Einträge: Oktober 2011: 1, September 2011: 2.
Archaeologik
http://archaeologik.blogspot.com/
“Archaeologik ist ein wissenschaftlich orientiertes Blog zu Themen aus den Feldern Archäologie und Denkmalpflege. Das Augenmerk gilt weniger sensationellen Neufunden, sondern grundsätzlichen methodisch-theoretischen und wissenschaftspolitischen Aspekten der Archäologie”, beschreibt Dr. Rainer Schreg, wissenschaftlicher Archäologe am RGMZ, die Ausrichtung seines Projekts. Neben kulturpolitischen Beiträgen zum Kulturgutschutz soll eine kleine Artikelserie zu Chancen der Luftbildarchäologie bei der Erforschung von Altfluren hervorgehoben werden.
Anzahl der im Blog publizierten Einträge: Oktober 2011: 13, September 2011: 13.
Archivalia
http://archiv.twoday.net
Denkt man an Geschichtsblogs im deutschsprachigen Raum, so kommt einem als erstes Archivalia in den Sinn. Von Klaus Graf im Jahr 2003 als Gemeinschaftsblog gegründet, hat sich Archivalia seine herausragende Stellung durch zahlreiche hochwertige Forschungsbeiträge sowie einen wissenschaftlichen Rezensionsteil verdient. Flankiert durch die Veröffentlichung zahlreicher relevanter Links erreicht Archivalia eine Publikationsfrequenz, die einen schwindelig machen kann. Eine “ausgesprochene Buntheit” und ein Interesse an vielfältigen Themen wurde Archivalia schon 2004 in einer Rezension bei H-Soz-u-Kult bescheinigt. Einen Namen hat sich Archivalia darüber hinaus als “Sturmgeschütz, das für Open Access kämpft” gemacht ((http://archiv.twoday.net/stories/29751181/)). Klaus Graf setzt sich mit diesem Blog außerdem für die Renaissance von Miszellen, Splitterveröffentlichungen und Textfragmenten ein, wie aus seinem Vortrag am DHI Paris deutlich wird. Die Art und Weise, in der Archivalia die Community mit Information versorgt, ist sowohl qualitativ wie auch quantitativ einmalig.
Anzahl der im Blog publizierten Einträge: Oktober 2011: 274, September 2011: 378.
Digitale Regionalgeschichte
http://digireg.twoday.net/
Von den hier porträtierten Blogs wird – neben Antike und Abendland von Uwe Walter – nur noch dieses von einem Professor verantwortet: Karl Heinz Schneider, Universität Hannover, publiziert hier sporadisch vorwiegend kurze Mitteilungen. Mitunter berichtet Schneider aus der Werkstatt des Regionalhistorikers, so z.B. im Beitrag “Vom Nutzen des Internet für die transnationale Geschichte”, in dem es um ein Projekt über die Briefe der 1858 von Niedersachsen nach Kalifornien mit ihrem Mann ausgewanderten Sophie Meinecke geht.
Anzahl der im Blog publizierten Einträge: Oktober 2011: 1, September 2011: 2.
Kritische Geschichte
http://kritischegeschichte.wordpress.com
Es handelt sich um ein von Dr. Richard Heigl betriebenes Gemeinschaftsblog, das dem Konzept einer (linken) “Kritischen Geschichte” verpflichtet ist. Neben der Besprechung von Neuigkeiten gibt es selten auch längere Beiträge programmatischen Charakters, wie z.B. “Kritik einer Kapitalismuskritik” über einen Vortrag von Jürgen Kocka , den dieser Anfang Dezember 2011 gehalten hat.
Zur Selbsteinschätzung und den Abrufzahlen des Blogs siehe den Beitrag zur Blogstatistik.
Anzahl der im Blog publizierten Einträge: Oktober 2011: 6, September 2011: 3.
Medien im Geschichtsunterricht
http://geschichtsunterricht.wordpress.com/
“Der Blog soll Gelegenheit dazu geben, methodische und didaktische Überlegungen zum Einsatz und Umgang mit Medien im Geschichtsunterricht auszutauschen und zu diskutieren.” So Daniel Bernsen, der sowohl als Gymnasiallehrer unterrichtet als auch am Pädagogischen Landesinstitut (Standort Koblenz) tätig ist. Da vergleichsweise häufig in Bernsens Blog kommentiert wird, leistet es, was es verspricht. Für Lehrende mit Netzaffinität eine wichtige Adresse, weil in den Beiträgen nicht nur verschiedene Medien und Web 2.0-Anwendungen vorgestellt, sondern auch einzelne Unterrichtseinheiten beschrieben werden (z.B. Unterrichtseinheit Karl der Große in zwei Teilen).
Anzahl der im Blog publizierten Einträge: Oktober 2011: 13, September 2011: 14.
weblog.hist.net
weblog.hist.net
Die Schweizer Historiker Peter Haber und Jan Hodel publizieren auf diesem Blog seit 2005 über Geschichte und digitale Medien. Das Blog zeichnet sich durch anregende Links sowie durch seine eigenständigen, gut geschriebenen Kurzartikel aus, die mitunter auch von Gastautoren stammen. Die Themenbreite reicht “von Open Access bis e-Learning, von Google bis Urheberrecht, von Bibliographierhilfsmitteln bis Werkzeugen zum kollaborativen Schreiben, von digitalen Karten bis digitalisierten Handschriften, von web 1.0 bis web 3.0”, so ist in der Selbstbeschreibung zu lesen. Für digital historians und für alle, die es werden wollen, ist weblog.hist.net ein Muss.
Anzahl der im Blog publizierten Einträge: Oktober 2011: 9: September 2011: 23.
Weitere Blogs
Die folgende Liste ist eine Vorarbeit zu einer möglichst vollständigen “Blogroll” der deutschsprachigen Geschichtsblogosphäre, wobei natürlich die aufgelisteten Internetangebote aus “historischer Perspektive” zu ergänzen wären durch aufgegebene Projekte, die noch online oder im Internet Archive dokumentiert sind.
Arbeitskreis Policey/Polizei im vormodernen Europa
http://www.univie.ac.at/policey-ak/
Brennpunkt Geschichte
http://www.brennpunkt-geschichte.de/
burgerbe-blog
http://burgerbe.wordpress.com/
Digitaler Widerstand
http://digitalerwiderstand.wordpress.com/
Docupedia-Blog
http://docupedia.de/zg/Blog
einsichten
http://www.einsichten-online.de/
geschichte.quelle.lektüre
http://arcana.twoday.net/
Geschichtsblog
http://geschichts-blog.blogspot.com/
Geschichtsblog
http://www.geschichtsinfos.de/
GeschichtsPuls
http://geschichtspuls.de/
Geschichtsweberei
http://geschichtsweberei.blogspot.com/
Gewerkschaftsgeschichte - der Geschichtsblog von ver.di
http://verdiarchiv.blogspot.com/
Hamburgische Geschichten
http://hamburgische-geschichten.de/
Historikerkraus.de
http://historikerkraus.de/blog/
Historisch Denken Lernen
http://koerber2005.erzwiss.uni-hamburg.de/wordpress-mu/historischdenkenlernen/
infoclio.ch
http://www.infoclio.ch/de/blog?uid=
Klio surft
http://kliosurft.wordpress.com/
Oberschwäbische Mannigfaltigkeiten
http://mannigfaltigkeiten.twoday.net/
RambowGenealogie ((Zu Genealogieblogs siehe auch http://www.rambow.de/genealogieblogs))
http://www.rambow.de/
Schmalenstroer.net
http://schmalenstroer.net/blog/
Tribur.de
http://www.tribur.de/blog/
Weblog zu Netz und Geschichte
http://netzgeschichte.wordpress.com/
Zeittaucher
http://www.scienceblogs.de/zeittaucher/
Zwerge auf den Schultern von Riesen
http://zwergenblick.wordpress.com
=================================
ANHANG Archivalia
Weitere Blogs siehe in den Kommentaren auf de.hypotheses.org
Update: Französische Übersetzung des Beitrags
http://dhiha.hypotheses.org/425
Illustration: Screenshot Planet Clio

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://agfnz.historikerverband.de/?p=902
Ich dokumentiere meinen Beitrag auch hier:
Dies ist der letzte Beitrag in diesem Blog. Ein Update wird unterrichten, wenn der Umzug der Inhalte auf de.hypotheses.org, wo das Blog unter dem Namen Frühneuzeit-Blog der RWTH weitergeführt werden wird, realisiert wurde. Wie bereits auf Facebook und Twitter bekanntgegeben, wird das Blog als Publikation der AGFNZ nicht weitergeführt.
Die offizielle Begründung lautet: „Ab Mitte Dezember wird das agfnz-Webblog vom Internet-Auftritt der agfnz herunter genommen. Bei der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft in Marburg im September dieses Jahres zeigte sich kein Interesse an der Weiterführung. Doch die Inhalte des Blogs werden in das neue Blog in Hypothese.org importiert und als „Frühneuzeitblog der RWTH Aachen“ weitergeführt. Facebook- und Twitterauftritt werden gelöscht, aber ebenfalls durch Angebote der Aachener Frühen Neuzeit ersetzt.“
Netzaffine Historiker/innen haben das mit Bedauern zur Kenntnis genommen (Diskussionen in Google+ und auf Facebook). Von einem "Armutszeugnis für die deutsche HistorikerInnen-Zunft" sprach Anton Tantner. Was soll man dazu noch schreiben, fragte Michael Schmalenstroer.
Da im wesentlichen ich die meiste Arbeit mit dem AGFNZ-Blog und Facebook/Twitter-Auftritt der AGFNZ hatte, erscheint es mir sinnvoll, die Anonymität der Autorenbezeichnung "Redaktion" für diesen letzten Beitrag zu verlassen. Ich sehe es nicht als meine Aufgabe an, die Entscheidung der AGFNZ in diesem Blog der AGFNZ zu kommentieren, aber ich möchte einen kurzen Rückblick auf die Web 2.0-Aktivitäten der AGFNZ, also Blog, Facebook und Twitter, bieten.
1. Das Weblog
Am 23. September 2010 war programmatisch hier unter dem Titel "Meldungen & Meinungen" zu lesen:
"Was soll ein Weblog zur Frühen Neuzeit?
Zuallererst: nicht langweilen. Ein lebendiges und buntes (ja: bebildertes) Kaleidoskop des Fachs ist nichts, wofür man sich schämen müsste.
Sodann: Dieses Weblog versteht sich als Teil des Web 2.0. Es ist als Gemeinschaftsweblog konzipiert und für AutorInnen offen, die dieses Format im thematischen Rahmen der Frühen Neuzeit nutzen wollen. Wir freuen uns natürlich auch über sachliche und kluge Kommentare.
Digitales wird einen besonders hohen Stellenwert in diesem Blog haben. Wir wollen keine Buchbesprechungen und kommerzielle Werbung, weisen aber gern auf (seriöse) kostenlose Online-Publikationen hin.
Wir wollen nicht das Rad neu erfinden: Was H-SOZ-U-KULT besser leistet, etwa das Ankündigen von Veranstaltungen und die Mitteilung der Tagungsberichte, wollen wir nicht kopieren. Was dort fehlt, beispielsweise Hinweise zu neuen Ausstellungen oder zu einem Frühneuzeit-Video auf Youtube, ist schon eher für uns relevant.
Neben den Meldungen soll es auch Raum für Meinungen geben, für subjektive Wertungen. Frühneuzeitler sollten zu Fehlentwicklungen etwa im Bereich der Hochschulpolitik oder des Wissenschaftsbetriebs nicht schweigen, wenn diese unmittelbare Auswirkungen auf das Fach hat.
Wir sind gespannt, wie unser Experiment in Sachen Web 2.0 ankommt."
Geradezu euphorisch begrüßte Wenke Bönisch im Oktober 2010 das neue Blog: "Es ist einfach eine schöne Nachricht, die ein Zeichen von Offenheit, Aufgeschlossenheit und Mut setzt, daß ich nicht so ohne weiteres der Geschichtswissenschaft zugetraut hätte. Die Arbeitsgemeinschaft der Frühen Neuzeit ist im Web 2.0 angekommen!"
Im November 2010 verlieh uns weblog.hist.net die Auszeichnung Geschichtsblog des Monats. Die damalige kritische Würdigung ist noch heute lesenswert.
Insgesamt wurden 119 Artikel geschrieben (am meisten in den Monaten Oktober 2010 und Januar 2011, je 22). Christine Roll hat dieses Projekt jederzeit voll und ganz unterstützt und steuerte einen Beitrag zur Gefährdung des Altonaer Museums bei. Seit März 2011 hat Maike Schwaffertz zuverlässig jeden Monat die Online-Rezensionsjournale für den Rezensions-Digest ausgewertet. Jörg Riemenschneider kümmerte sich um die Technik, Pirkko Gohlke verfasste einen Ausstellungshinweis. Frank Pohle zeigte mit zwei Nachträgen zum Nordrheinischen Klosterbuch, dass Wissenschaftsbloggen durchaus auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse vermitteln kann. Der erste Artikel betraf das Jesuitenkolleg Münstereifel, der zweite Beitrag zu einer übersehenen Aachener Klosterchronik lieferte Anregungen für eine niederländische Forscherin, wie den Kommentaren zu entnehmen ist. Außerdem berichtete Pohle über den Verlust des barocken Hochaltars in der Aachener Kirche St. Nikolaus. Soweit die Mitarbeiter aus dem Lehr- und Forschungsgebiet Frühe Neuzeit der RWTH Aachen, geleitet von Christine Roll. Den Wert historischer Schulbibliotheken unterstrich Felicitas Noeske, Bibliotheksleiterin des Hamburger Gymnasiums Christianeum: Historische Schulbibliotheken sind wertvolles Kulturgut. Mareike König vom DHI Paris erlaubte gern die Wiederveröffentlichung ihres Überblicks zur beeindruckenden französischen geisteswissenschaftlichen Blogosphäre, der ursprünglich in Archivalia erschienen war. Von meinen namentlich gekennzeichneten Beiträgen darf ich den Forschungsbeitrag zu Erhard von Pappenheim hervorheben sowie zwei Beiträge, die sich neben etlichen Notizen zu digitalen Sammlungen der Vermittlung von Recherchekompetenz in Sachen Digitalisaten widmeten: GW, VD 16-18 und Digitalisate sowie eine Anleitung, wie man im Internet Texte zum Aachener Frieden aufspürt, die Otto Vervaart zu zwei höchst profunden Blogbeiträgen über Digitalisate frühneuzeitlicher Friedensverträge inspirierte.
[Noch ein Wort zu den Kommentaren: Es waren kaum substantielle dabei. Das Spamproblem war riesig: Von den 618 Kommentaren konnten nur 43 genehmigt werden, weitere 1023 Spamkommentare fing der Spamfilter ab.]
Da es abgesehen vom Rezensions-Digest keine kontinuierliche Unterstützung durch andere Autoren gab, wurden die Notizen im März 2011 nach Facebook verlagert. Am 19. März 2011 hieß es:
"Dieses Blog soll längere Beiträge aufnehmen und besonders wichtige Neuigkeiten kurz melden. Jeder Blogeintrag wird manuell auf Facebook angezeigt. Alles, was auf Facebook geschrieben wird, wandert automatisch nach Twitter.
Kürzere Notizen (knappe Zusammenfassung plus Link) z.B. zu Ausstellungen, die früher hier zu lesen waren, sind jetzt auf Facebook zu finden - das ist weniger aufwändig, als einen Blogeintrag zu schreiben. In der Regel gibt es täglich etwas Neues auf Facebook, darunter meist auch ein interessantes aktuell ins Netz gestelltes Digitalisat, subjektiv aus den RSS-Feeds von Digitalisierungsprojekten gefischt. Hauptquellen dieser kurzen Notizen sind RSS-Feeds: neben Blogs wie Archivalia insbesondere der Nachrichtendienst für Historiker, DAMALS und die Links von schmalenstroer.net. Außerdem wird Twitter ausgewertet.
Nur auf Twitter gibt es alle paar Tage thematisch für die frühe Neuzeit einschlägige Weiterleitungen (RTs) aus anderen Twitter-Accounts, wie auf Facebook ergänzt durch einzelne Hinweise zu übergreifenden historischen Aspekten oder zum Wissenschaftsbetrieb.
Bei Twitter fließt also zusammen, was im Blog und auf Facebook publiziert wird. Es ist nicht erforderlich, sich in Twitter (oder auf Facebook) anzumelden, um die AGFNZ-Meldungen zu lesen. Empfehlenswert ist es, den RSS-Feed der AGFNZ auf Twitter zu beziehen. (Wie man RSS nutzt und was das ist, wird beispielsweise hier erklärt.)"
Danach wurde es eher still im Blog. Im Juni und Juli 2011 erschien sogar nur der Rezensions-Digest. Im Überblick zu den deutschen Geschichtsblogs von Mareike König und mir, veröffentlicht am 9. Dezember 2011, wurde uns (von Mareike König) ein wohlwollender kurzer Nachruf gewidmet:
"Im Herbst 2010 gestartet, wird das Weblog der AGFNZ nach dem Willen der Verantwortlichen Ende 2011 aus der Webpräsenz der Arbeitsgemeinschaft wieder verschwinden. Eine bedauerliche Entscheidung, denn als eines der wenigen Blogs findet man hier eigenständige kurze Forschungsbeiträge sowie die praktischen monatlichen Rezensions-Digests."
2. Twitter
Auf Twitter wurden 1736 Tweets abgesetzt. Die AGFNZ hatte 165 Follower und folgte 105 Personen. Ganz überwiegend, in den letzten Monaten ausschließlich, wurde Twitter von den automatisch weitergeleiteten Facebook-Meldungen gespeist. Da ich mich eher sporadisch in den Account einloggte, war eine lebendige Interaktion nicht möglich. Zeitweilig habe ich mittels Weiterleitungen aus den verfolgten anderen Twitter-Präsenzen das Facebook-Gerüst angereichert. Dass ich das nicht häufiger praktizierte, war Zeit- und Bequemlichkeitsgründen (separates Einloggen mit AGFNZ-Account) geschuldet.
3. Facebook
Der Schwerpunkt der Aktivitäten lag zuletzt eindeutig auf Facebook. Es gab zuletzt 186 Fans, die eigentlich fast täglich mindestens ein Like bei den Beiträgen spendierten. Nach der am 19. März hier angezeigten Umstellung (siehe oben) wurde so gut wie täglich ein "Digitalisat des Tages" mitgeteilt (zuletzt am 3. November 2011), ergänzt häufig durch Neuigkeiten zur Frühen Neuzeit aus meinen RSS-Feeds und anderen Informationsquellen. Beispielsweise veröffentlichte ich in den acht Tagen vom 23. bis 30. September 23 Meldungen, die 13 Likes einsammeln konnten. Die Likes und sporadische Kommentare wie auch die stetige Aufwärtsentwicklung der Zahl der Fans sprechen dafür, dass zumindest der Facebook-Auftritt als durchaus erfolgreich bezeichnet werden darf.
4. Wie geht es weiter?
Dieses Blog wird gelöscht, die Inhalte ziehen zu de.hyptheses.org um. Da auf Facebook bei Seiten mit mehr als 100 Fans eine Namensänderung nicht möglich ist, muss auch der Facebook-Auftritt gelöscht werden (und auch der verknüpfte Twitter-Auftritt).
Auf Wiedersehen im Frühneuzeit-Blog der RWTH auf de.hypotheses.org!
 Design: Jens Peterhoff
Design: Jens Peterhoff
Ich dokumentiere meinen Beitrag auch hier:
Dies ist der letzte Beitrag in diesem Blog. Ein Update wird unterrichten, wenn der Umzug der Inhalte auf de.hypotheses.org, wo das Blog unter dem Namen Frühneuzeit-Blog der RWTH weitergeführt werden wird, realisiert wurde. Wie bereits auf Facebook und Twitter bekanntgegeben, wird das Blog als Publikation der AGFNZ nicht weitergeführt.
Die offizielle Begründung lautet: „Ab Mitte Dezember wird das agfnz-Webblog vom Internet-Auftritt der agfnz herunter genommen. Bei der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft in Marburg im September dieses Jahres zeigte sich kein Interesse an der Weiterführung. Doch die Inhalte des Blogs werden in das neue Blog in Hypothese.org importiert und als „Frühneuzeitblog der RWTH Aachen“ weitergeführt. Facebook- und Twitterauftritt werden gelöscht, aber ebenfalls durch Angebote der Aachener Frühen Neuzeit ersetzt.“
Netzaffine Historiker/innen haben das mit Bedauern zur Kenntnis genommen (Diskussionen in Google+ und auf Facebook). Von einem "Armutszeugnis für die deutsche HistorikerInnen-Zunft" sprach Anton Tantner. Was soll man dazu noch schreiben, fragte Michael Schmalenstroer.
Da im wesentlichen ich die meiste Arbeit mit dem AGFNZ-Blog und Facebook/Twitter-Auftritt der AGFNZ hatte, erscheint es mir sinnvoll, die Anonymität der Autorenbezeichnung "Redaktion" für diesen letzten Beitrag zu verlassen. Ich sehe es nicht als meine Aufgabe an, die Entscheidung der AGFNZ in diesem Blog der AGFNZ zu kommentieren, aber ich möchte einen kurzen Rückblick auf die Web 2.0-Aktivitäten der AGFNZ, also Blog, Facebook und Twitter, bieten.
1. Das Weblog
Am 23. September 2010 war programmatisch hier unter dem Titel "Meldungen & Meinungen" zu lesen:
"Was soll ein Weblog zur Frühen Neuzeit?
Zuallererst: nicht langweilen. Ein lebendiges und buntes (ja: bebildertes) Kaleidoskop des Fachs ist nichts, wofür man sich schämen müsste.
Sodann: Dieses Weblog versteht sich als Teil des Web 2.0. Es ist als Gemeinschaftsweblog konzipiert und für AutorInnen offen, die dieses Format im thematischen Rahmen der Frühen Neuzeit nutzen wollen. Wir freuen uns natürlich auch über sachliche und kluge Kommentare.
Digitales wird einen besonders hohen Stellenwert in diesem Blog haben. Wir wollen keine Buchbesprechungen und kommerzielle Werbung, weisen aber gern auf (seriöse) kostenlose Online-Publikationen hin.
Wir wollen nicht das Rad neu erfinden: Was H-SOZ-U-KULT besser leistet, etwa das Ankündigen von Veranstaltungen und die Mitteilung der Tagungsberichte, wollen wir nicht kopieren. Was dort fehlt, beispielsweise Hinweise zu neuen Ausstellungen oder zu einem Frühneuzeit-Video auf Youtube, ist schon eher für uns relevant.
Neben den Meldungen soll es auch Raum für Meinungen geben, für subjektive Wertungen. Frühneuzeitler sollten zu Fehlentwicklungen etwa im Bereich der Hochschulpolitik oder des Wissenschaftsbetriebs nicht schweigen, wenn diese unmittelbare Auswirkungen auf das Fach hat.
Wir sind gespannt, wie unser Experiment in Sachen Web 2.0 ankommt."
Geradezu euphorisch begrüßte Wenke Bönisch im Oktober 2010 das neue Blog: "Es ist einfach eine schöne Nachricht, die ein Zeichen von Offenheit, Aufgeschlossenheit und Mut setzt, daß ich nicht so ohne weiteres der Geschichtswissenschaft zugetraut hätte. Die Arbeitsgemeinschaft der Frühen Neuzeit ist im Web 2.0 angekommen!"
Im November 2010 verlieh uns weblog.hist.net die Auszeichnung Geschichtsblog des Monats. Die damalige kritische Würdigung ist noch heute lesenswert.
Insgesamt wurden 119 Artikel geschrieben (am meisten in den Monaten Oktober 2010 und Januar 2011, je 22). Christine Roll hat dieses Projekt jederzeit voll und ganz unterstützt und steuerte einen Beitrag zur Gefährdung des Altonaer Museums bei. Seit März 2011 hat Maike Schwaffertz zuverlässig jeden Monat die Online-Rezensionsjournale für den Rezensions-Digest ausgewertet. Jörg Riemenschneider kümmerte sich um die Technik, Pirkko Gohlke verfasste einen Ausstellungshinweis. Frank Pohle zeigte mit zwei Nachträgen zum Nordrheinischen Klosterbuch, dass Wissenschaftsbloggen durchaus auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse vermitteln kann. Der erste Artikel betraf das Jesuitenkolleg Münstereifel, der zweite Beitrag zu einer übersehenen Aachener Klosterchronik lieferte Anregungen für eine niederländische Forscherin, wie den Kommentaren zu entnehmen ist. Außerdem berichtete Pohle über den Verlust des barocken Hochaltars in der Aachener Kirche St. Nikolaus. Soweit die Mitarbeiter aus dem Lehr- und Forschungsgebiet Frühe Neuzeit der RWTH Aachen, geleitet von Christine Roll. Den Wert historischer Schulbibliotheken unterstrich Felicitas Noeske, Bibliotheksleiterin des Hamburger Gymnasiums Christianeum: Historische Schulbibliotheken sind wertvolles Kulturgut. Mareike König vom DHI Paris erlaubte gern die Wiederveröffentlichung ihres Überblicks zur beeindruckenden französischen geisteswissenschaftlichen Blogosphäre, der ursprünglich in Archivalia erschienen war. Von meinen namentlich gekennzeichneten Beiträgen darf ich den Forschungsbeitrag zu Erhard von Pappenheim hervorheben sowie zwei Beiträge, die sich neben etlichen Notizen zu digitalen Sammlungen der Vermittlung von Recherchekompetenz in Sachen Digitalisaten widmeten: GW, VD 16-18 und Digitalisate sowie eine Anleitung, wie man im Internet Texte zum Aachener Frieden aufspürt, die Otto Vervaart zu zwei höchst profunden Blogbeiträgen über Digitalisate frühneuzeitlicher Friedensverträge inspirierte.
[Noch ein Wort zu den Kommentaren: Es waren kaum substantielle dabei. Das Spamproblem war riesig: Von den 618 Kommentaren konnten nur 43 genehmigt werden, weitere 1023 Spamkommentare fing der Spamfilter ab.]
Da es abgesehen vom Rezensions-Digest keine kontinuierliche Unterstützung durch andere Autoren gab, wurden die Notizen im März 2011 nach Facebook verlagert. Am 19. März 2011 hieß es:
"Dieses Blog soll längere Beiträge aufnehmen und besonders wichtige Neuigkeiten kurz melden. Jeder Blogeintrag wird manuell auf Facebook angezeigt. Alles, was auf Facebook geschrieben wird, wandert automatisch nach Twitter.
Kürzere Notizen (knappe Zusammenfassung plus Link) z.B. zu Ausstellungen, die früher hier zu lesen waren, sind jetzt auf Facebook zu finden - das ist weniger aufwändig, als einen Blogeintrag zu schreiben. In der Regel gibt es täglich etwas Neues auf Facebook, darunter meist auch ein interessantes aktuell ins Netz gestelltes Digitalisat, subjektiv aus den RSS-Feeds von Digitalisierungsprojekten gefischt. Hauptquellen dieser kurzen Notizen sind RSS-Feeds: neben Blogs wie Archivalia insbesondere der Nachrichtendienst für Historiker, DAMALS und die Links von schmalenstroer.net. Außerdem wird Twitter ausgewertet.
Nur auf Twitter gibt es alle paar Tage thematisch für die frühe Neuzeit einschlägige Weiterleitungen (RTs) aus anderen Twitter-Accounts, wie auf Facebook ergänzt durch einzelne Hinweise zu übergreifenden historischen Aspekten oder zum Wissenschaftsbetrieb.
Bei Twitter fließt also zusammen, was im Blog und auf Facebook publiziert wird. Es ist nicht erforderlich, sich in Twitter (oder auf Facebook) anzumelden, um die AGFNZ-Meldungen zu lesen. Empfehlenswert ist es, den RSS-Feed der AGFNZ auf Twitter zu beziehen. (Wie man RSS nutzt und was das ist, wird beispielsweise hier erklärt.)"
Danach wurde es eher still im Blog. Im Juni und Juli 2011 erschien sogar nur der Rezensions-Digest. Im Überblick zu den deutschen Geschichtsblogs von Mareike König und mir, veröffentlicht am 9. Dezember 2011, wurde uns (von Mareike König) ein wohlwollender kurzer Nachruf gewidmet:
"Im Herbst 2010 gestartet, wird das Weblog der AGFNZ nach dem Willen der Verantwortlichen Ende 2011 aus der Webpräsenz der Arbeitsgemeinschaft wieder verschwinden. Eine bedauerliche Entscheidung, denn als eines der wenigen Blogs findet man hier eigenständige kurze Forschungsbeiträge sowie die praktischen monatlichen Rezensions-Digests."
2. Twitter
Auf Twitter wurden 1736 Tweets abgesetzt. Die AGFNZ hatte 165 Follower und folgte 105 Personen. Ganz überwiegend, in den letzten Monaten ausschließlich, wurde Twitter von den automatisch weitergeleiteten Facebook-Meldungen gespeist. Da ich mich eher sporadisch in den Account einloggte, war eine lebendige Interaktion nicht möglich. Zeitweilig habe ich mittels Weiterleitungen aus den verfolgten anderen Twitter-Präsenzen das Facebook-Gerüst angereichert. Dass ich das nicht häufiger praktizierte, war Zeit- und Bequemlichkeitsgründen (separates Einloggen mit AGFNZ-Account) geschuldet.
3. Facebook
Der Schwerpunkt der Aktivitäten lag zuletzt eindeutig auf Facebook. Es gab zuletzt 186 Fans, die eigentlich fast täglich mindestens ein Like bei den Beiträgen spendierten. Nach der am 19. März hier angezeigten Umstellung (siehe oben) wurde so gut wie täglich ein "Digitalisat des Tages" mitgeteilt (zuletzt am 3. November 2011), ergänzt häufig durch Neuigkeiten zur Frühen Neuzeit aus meinen RSS-Feeds und anderen Informationsquellen. Beispielsweise veröffentlichte ich in den acht Tagen vom 23. bis 30. September 23 Meldungen, die 13 Likes einsammeln konnten. Die Likes und sporadische Kommentare wie auch die stetige Aufwärtsentwicklung der Zahl der Fans sprechen dafür, dass zumindest der Facebook-Auftritt als durchaus erfolgreich bezeichnet werden darf.
4. Wie geht es weiter?
Dieses Blog wird gelöscht, die Inhalte ziehen zu de.hyptheses.org um. Da auf Facebook bei Seiten mit mehr als 100 Fans eine Namensänderung nicht möglich ist, muss auch der Facebook-Auftritt gelöscht werden (und auch der verknüpfte Twitter-Auftritt).
Auf Wiedersehen im Frühneuzeit-Blog der RWTH auf de.hypotheses.org!
 Design: Jens Peterhoff
Design: Jens Peterhoffnoch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Anlässlich des Kommentars
http://archiv.twoday.net/stories/38838536/#55776540
habe ich mal wieder einen Blick auf die Europeana und die dortigen Rechteangaben geworfen. Ich glaub es kaum: Die BSB München, die mich mit einer Strafanzeige überzog, weil ich sie des Copyfraud beschuldigte (was ich immer noch tue), hat ihre Digitalisate als "Public Domain" gekennzeichnet!
Nicht etwa als Public Domain "Public Domain Mark"
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
Sondern als CC0
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Leider wirft die Europeana das bei dem Copyright-Filter auf der linken Seite durcheinander, obwohl zwei getrennte Schubladen bestehen.
In der lokalen Münchner Präsentation sieht das natürlich anders aus. Da gilt immer noch der allgemeine Rechtevorbehalt:
http://mdz.bib-bvb.de/copyright.htm
Bei den Bavarica (Google-Digitalisate) heißt es:
"Die Dateien werden Ihnen nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke zur Verfügung gestellt."
Und wer ein PDF möchte, muss bescheinigen:
"Ich versichere, die heruntergeladene Datei ausschliesslich für private oder wissenschaftliche Zwecke zu verwenden."
Private oder wissenschaftliche Zwecke ist im übrigen keineswegs deckungsgleich mit persönliche, nichtkommerzielle Zwecke. Kommerzielle Auftragsforschung darf das PDF, aber nicht "die Dateien" nutzen. Eine berufliche nichtkommerzielle Nutzung (z.B. für den Schulunterricht) ist beim PDF nicht möglich, wohl aber bei den Dateien, wenn man "persönlich" sehr weitgehend auslegt.
Widersprüchliche Geschäftsbedingungen gehen zu Lasten des Anbieters. Niemand muss sich an den altbekannten Copyfraud der BSB halten.
Das Darmstädter Copyfraud CC-BY-ND (dem jüngst die UB Giessen folgte) ist zwar genauso unbeachtlich, wirft aber die Frage auf, worauf sich das ND bezieht. Stünde das ganze Buch unter ND, wäre es unmöglich, eine einzelne Seite als Auszug zu veröffentlichen, da eine solche Kürzung immer eine Bearbeitung darstellt.
http://archiv.twoday.net/stories/38838536/#55776540
habe ich mal wieder einen Blick auf die Europeana und die dortigen Rechteangaben geworfen. Ich glaub es kaum: Die BSB München, die mich mit einer Strafanzeige überzog, weil ich sie des Copyfraud beschuldigte (was ich immer noch tue), hat ihre Digitalisate als "Public Domain" gekennzeichnet!
Nicht etwa als Public Domain "Public Domain Mark"
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
Sondern als CC0
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Leider wirft die Europeana das bei dem Copyright-Filter auf der linken Seite durcheinander, obwohl zwei getrennte Schubladen bestehen.
In der lokalen Münchner Präsentation sieht das natürlich anders aus. Da gilt immer noch der allgemeine Rechtevorbehalt:
http://mdz.bib-bvb.de/copyright.htm
Bei den Bavarica (Google-Digitalisate) heißt es:
"Die Dateien werden Ihnen nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke zur Verfügung gestellt."
Und wer ein PDF möchte, muss bescheinigen:
"Ich versichere, die heruntergeladene Datei ausschliesslich für private oder wissenschaftliche Zwecke zu verwenden."
Private oder wissenschaftliche Zwecke ist im übrigen keineswegs deckungsgleich mit persönliche, nichtkommerzielle Zwecke. Kommerzielle Auftragsforschung darf das PDF, aber nicht "die Dateien" nutzen. Eine berufliche nichtkommerzielle Nutzung (z.B. für den Schulunterricht) ist beim PDF nicht möglich, wohl aber bei den Dateien, wenn man "persönlich" sehr weitgehend auslegt.
Widersprüchliche Geschäftsbedingungen gehen zu Lasten des Anbieters. Niemand muss sich an den altbekannten Copyfraud der BSB halten.
Das Darmstädter Copyfraud CC-BY-ND (dem jüngst die UB Giessen folgte) ist zwar genauso unbeachtlich, wirft aber die Frage auf, worauf sich das ND bezieht. Stünde das ganze Buch unter ND, wäre es unmöglich, eine einzelne Seite als Auszug zu veröffentlichen, da eine solche Kürzung immer eine Bearbeitung darstellt.
KlausGraf - am Samstag, 10. Dezember 2011, 16:28 - Rubrik: Open Access
IFI Archive / Preservation Fund from Run Robot / David Blake on Vimeo.
I edited this film in Piranha Bar on Avid Mediacomposer. Saoirse Ronan is digitally transported into a century of Irish films to launch the IFI Irish Film Archive Preservation Fund – a major new initiative to secure the future of Ireland’s film heritage.Wolf Thomas - am Samstag, 10. Dezember 2011, 11:50 - Rubrik: Filmarchive
DID YOU HAVE ANY IDEA? with Cassie FINDLAY from CaTV on Vimeo.
"My name is Cassie Findlay and I am an archivist, working primarily with digital records.When I saw what Julian Assange and WikiLeaks achieved with the releases last year it gave me renewed excitement about my work - a kind of ‘jolt’ – back to the core principles of our profession - that without access to documentary evidence of what our governments are doing in our names we cannot possibly have a sensible basis on which to make decisions in a healthy democracy.
What WikiLeaks has done also has been to show what I believe is a serious disconnect between current rules and practices around access to records and the tremendous shift we have seen in people’s expectations for access to information, and recognition of the great power it has to promote reform, particularly when it is shared rapidly and widely online. In Australia and in many other western countries we have lip service paid to greater openness while we know from many studies that it is more difficult than ever to succeed with applications under Freedom of Information - that efforts in the United States to declassify government information have been painfully slow - and that here in Australia we still have archives laws which apply blanket 20 or 30 year closure rules for general access to public records.
By contrast, WikiLeaks shows us how an archive can be formed directly from the affairs the records document – whether in a war zone or an embassy - and immediately serve an incredibly powerful purpose in society. It’s about turning the gatekeeper-controlled drips of information from powerful institutions to the people that we see now into a freely flowing, world transforming wave of evidence.
And amongst my peers in the archives and library world I am certainly not alone in supporting the work of WikiLeaks. I have spoken with many other archivists and librarians working here and in Europe and the United States – including senior practitioners working in universities, government and the private sector. We all support free speech, free press, and openness and accountability of government as crucial for a democratic society - and our great concern is that the struggle for these principles may be set back for years, or even decades, if the alleged whistleblower Bradley Manning is convicted or if the U.S. successfully prosecutes Julian Assange and WikiLeaks under trumped up espionage charges.
As an Australian, I find the persecution and threats specifically against Julian Assange and the abandonment of him by our government to be completely at odds with what I expect them to do for a citizen of this country - in particular one who has shown great courage and resilience in the face of forces that would crush many of us. Here we have the publisher and editor in chief of a free press organisation that has done nothing more than keep the promise that WikiLeaks makes to whistleblowers to achieve maximum impact for their material – and who continues to honour that promise. He should be defended and protected, not thrown under a bus in case we get in the way of the United States’ need for revenge.
I hope that what Julian Assange and WikiLeaks have done will trigger a new way for all of us to see the power and value of information to expose injustices and bring reform. And I hope very much that we in Australia will not allow our government to be complicit with the United States in punishing Julian Assange for opening up the archives. Thank you. "
Wolf Thomas - am Samstag, 10. Dezember 2011, 11:45 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wenn Du einen Kater hast, sieht jede Stadt wie Köln aus (5:48) from Rheinische Rebellen on Vimeo.
"Der Rebellenwohnwagen namens »Chargesheimer« zieht weiter durch die Stadt. Er funktioniert wie ein Magnet für Erzählungen und diese häufen sich zunehmend an. Wie ein Archiv wollen sie sortiert, bearbeitet und gespielt werden. Eine Gruppe von Forschern versucht aus ihrer Sammlung von Zeitungsausschnitten, Fotos, Bildern und Heften voller Notizen die Geschichte Kölns neu zu erzählen. Es scheint ihnen gar nicht einzufallen, sie einer Hierarchie unterzuordnen und ihnen eine enzyklopädische Bedeutung zu geben, stattdessen gehen sie ihren persönlichen Vorlieben nach und erklären die Geschichte der Stadt zur Geschichte ihres Ichs, ihrer Erregungen, ihrer Leidenschaften, ihres Kummers und ihrer Wünsche. Es geht alles von vorne los, alle auf Anfang, keine Gefangenen: Nach »Bau mir ein Haus aus den Knochen von Chargesheimer« ist »Wenn Du einen Kater hast, sieht jede Stadt wie Köln aus« die zweite Arbeit der Rebellen zur Stadt Köln.Von und mit den Rheinischen Rebellen:
Katharina Louise Meyer / Hannah Kleinen / Lisa Altmeier / Eva Bode / Fabian Ringel / Luan Gummich / Marie Josefin Stute / Benjamin Kelm / Jens Eschert / Isabel Iracema Antz
und von:
Linda Hofmann / Jakob Lorenz / Andreas Wisskirchen / Roland Werning
Regie: Anna Horn / Bühne: Lena Thelen / Kostüme: Maria Beitz / Dramaturgie: Götz Leineweber und Lucie Ortmann "
Wolf Thomas - am Samstag, 10. Dezember 2011, 11:41 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Tape Reconstruction for Nixon & Haldeman, 2005 from Allan Hughes on Vimeo.
The transcription of conversation number 342-16 in the public archives of the White House tape recordings between President Richard Nixon and his Chief of Staff H.R. Haldeman documents only the 18 1/2 minute silence on this mysteriously erased tape. There is no reference to any conversation before or after the erasure. Audio specialists hope, one day, to electronically recover the conversation from the master tapes. The B-roll style production footage conspires to reconstruct a space between concealment and revelation, silence and speech.Wolf Thomas - am Samstag, 10. Dezember 2011, 11:36 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 Mittelalterliche Handschriften sind toll, aber dieser Adventskalender kann nicht nur aus ihnen bestehen. Unter den recht reich bestückten Digital Collections der Duke University fällt AdAccess ins Auge, über 7000 Werbeanzeigen zu den Themen Beauty and Hygiene, Radio, Television, Transportation, and World War II propaganda (Laufzeit 1911-1955).
Mittelalterliche Handschriften sind toll, aber dieser Adventskalender kann nicht nur aus ihnen bestehen. Unter den recht reich bestückten Digital Collections der Duke University fällt AdAccess ins Auge, über 7000 Werbeanzeigen zu den Themen Beauty and Hygiene, Radio, Television, Transportation, and World War II propaganda (Laufzeit 1911-1955).http://library.duke.edu/digitalcollections/adaccess/
Die abgebildete Rasiercreme-Werbung stammt aus dem Jahr 1944.
Einige weitere Links zu sehenswerten digitalen Sammlungen zum Thema Werbung hat die Yale-Bibliothek zusammengestellt. Es lohnt aber auch die Eingabe des Suchbegriffs Werbung bei arthistoricum.net.
Alle Türchen 2011

KlausGraf - am Samstag, 10. Dezember 2011, 03:18 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
