"Dreieinhalb Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs wird der Platz für die restaurierten Dokumente eng. Je länger sich der Neubau des Archivs nach hinten verschiebt desto prekärer wird die Lage, so Archivdirektorin Bettina Schmidt-Czaia. Bis voraussichtlich kommenden Mai solle die Hälfte der verschütteten Akten, Bücher und Handschriften erfasst sein. Dann sei nur noch für zwei Regalkilometer Platz. Eigentlich sollte das neue Archiv 2015 öffnen. Der Termin wurde aber um zwei Jahre verschoben.'"
Quelle: WDR, Lokalzeit Köln, 2.10.2012
Mehr Information hier:
1) http://www.report-k.de/Politik/Lokales/Koelner-Stadtarchiv-droht-Platzmangel-11946
2) http://www.ksta.de/innenstadt/restaurierung-kein-platz-fuer-archivalien,15187556,20076440.html
Quelle: WDR, Lokalzeit Köln, 2.10.2012
Mehr Information hier:
1) http://www.report-k.de/Politik/Lokales/Koelner-Stadtarchiv-droht-Platzmangel-11946
2) http://www.ksta.de/innenstadt/restaurierung-kein-platz-fuer-archivalien,15187556,20076440.html
Wolf Thomas - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 20:04 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Darf ein Blogger auf einer wissenschaftlichen Konferenz fotografieren und die Bilder der Teilnehmenden dann in seinem Blog veröffentlichen?
Blogger sind keine Paparazzi. Daher sind die meisten Urteile, die sich mit dem Recht der Presse befassen, Bilder von Prominenten oder Straftätern zu veröffentlichen, für sie nicht einschlägig. Das betreffende Rechtsgebiet nennt sich "Recht am eigenen Bild" (siehe etwa Wikipedia) und ist im "Kunsturheberrechtsgesetz" (KG) aus dem Jahr 1907 geregelt, dessen Paragraphen 22, 23, 24 und 33 weiterhin gelten, während der Rest des Gesetzes durch das geltende Urheberrechtsgesetz ersetzt wurde.
Auch ohne Rechtskenntnisse dürfte klar sein, was in § 22 KUG unmissverständlich formuliert wird: "Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden." Dies gilt auch noch bis 10 Jahre nach dem Tod des Abgebildeten.
Das Anfertigen von Bildern in der Öffentlichkeit ist nur in Ausnahmefällen verboten. (Seit 2004 untersagt § 201a Strafgesetzbuch das unbefugte Fotografieren in geschützten Räumen.) Ein Forscher darf also für wissenschaftliche Zwecke Personenfotos ohne Zustimmung der Fotografierten erstellen, doch für ihre Veröffentlichung braucht er die Genehmigung der so Porträtierten.
Daher gilt als Faustregel: Konflikte lassen sich vermeiden, wenn man sich die geplante Veröffentlichung vom Abgebildeten genehmigen lässt.
Fotografieren bei einer Tagung Pressefotografen und Blogger einen Referenten, hat der Blogger wenig zu befürchten, da dem Referenten klar sein muss, dass Fotos von ihm veröffentlicht werden. Duldet er das Fotografieren, erteilt er implizit die Veröffentlichungserlaubnis.
Neben dem sogenanten "Beiwerk" (z.B. Personen als unwesentlicher Teil des Stadtbilds oder einer Landschaft) ist vor allem die Ausnahme für "Versammlungen" hier relevant. Private Veranstaltungen sind zwar nicht erfasst, aber auch kleinere wissenschaftliche Tagungen darf man als öffentlich ansehen. Gruppenfotos und Fotos vom Auditorium sind also, wenn nicht gezielt eine einzelne Person in den Blick genommen wird, unproblematisch.
Wie sieht es mit den Referenten aus? Wenn man die Tagung als "Ereignis der Zeitgeschichte" ansieht, darf man auch die Referenten ablichten. Die Bildberichterstattung der Presse darf "grundsätzlich alle Geschehnisse von gesellschaftlicher Relevanz" erfassen (Dreier in: Dreier/Schulze 3. Aufl. 2008, S. 1854). Die frühere Unterscheidung zwischen "absoluten Personen der Zeitgeschichte" (vulgo A-Promis) und "relevativen Personen der Zeitgeschichte", die nur vorübergehend vom Scheinwerfer der Öffentlichkeit erfasst werden (z.B. Täter oder Opfer eines spektakulären Verbrechens), wurde von der Rechtsprechung aufgegeben.
In jedem Fall ist das Interesse der Öffentlichkeit an der Bildberichterstattung mit dem Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten abzuwägen. Respektvolle Fotos von öffentlichen Veranstaltungen sind daher kaum riskant. Kann ein seriöses Informationsinteresse der Öffentlichkeit zum Thema bejaht werden, darf man auch Personenbilder ohne Zustimmung veröffentlichen, die nicht in der ersten Reihe der gesellschaftlichen Leistungssträger stehen. Ist die Person in der Wikipedia seit längerem mit einem Foto vertreten oder hat sie Fotos von sich auf Facebook usw. veröffentlicht, kann sie sich gegen eine Bildberichterstattung schlecht wehren, auch wenn es um eine kritische Auseinandersetzung geht.
Wer sich auf brisantem Terrain wie der Stasi-Geschichte bewegt, sollte sich über juristischen Gegenwind nicht wundern, wenn er ehemalige Stasi-Mitarbeiter outet oder sogar abbildet. Bei einem eindeutigen zeithistorischen Dokument musste das Oberlandesgericht München im Dezember 2010 für Rechtssicherheit sorgen: Ein ehemaliger IM war neben einem Militärstaatsanwalt bei der Versiegelung der Räumlichkeiten des MfS 1989 zu sehen. Die Internetseite stasi-in-erfurt.de durfte ihn zeigen (ich empfehle die Lektüre des Urteils (PDF)). Bemerkenswert ist, dass das Gericht dem Anbieter dieser Seite, der eine ernsthafte Auseindersetzung mit dem Thema attestiert wurde, das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 GG) neben der Informations- und Meinungsfreiheit zugute kommen ließ.
Wer seriös wissenschaftlich berichtet, braucht sich bei der Veröffentlichung von Bildern lebender oder noch nicht 10 Jahre toter Personen also auch dann nur wenig Sorgen zu machen, wenn das Bild keine herausragende Persönlichkeit betrifft.
Das Risiko, dass ein Wissenschaftsblogger Ärger wegen des "Rechts am eigenen Bild" bekommt, schätze ich als eher gering ein.
Es gibt zum Recht am eigenen Bild unzählige Gerichtsentscheidungen, Literatur und Internetquellen. Daher sollte es sich von selbst verstehen, dass dieser Beitrag keine Rechtsberatung leisten und das Thema nur allzu holzschnitthaft in den Blick nehmen kann. Hoffentlich überflüssiger Hinweis: Wer ein fremdes Foto benutzt, braucht immer auch die Zustimmung des Rechteinhabers nach dem Urheberrechtsgesetz. Aber das ist ein anderes Thema.
***
Tipp: Instruktive Bildergalerie auf Wikiversity von Ralf Roletschek:
http://de.wikiversity.org/wiki/Kurs:Urheberrecht_im_Internet/Recht_am_eigenen_Bild
Fortsetzung Blog&Recht: http://archiv.twoday.net/stories/156272358/
 Viele Urteile zum Recht am eigenen Bild erstritt Caroline von Monaco (hier bei einem öffentlichen Vortrag) . Foto: simone.brunozzi CC-BY-SA
Viele Urteile zum Recht am eigenen Bild erstritt Caroline von Monaco (hier bei einem öffentlichen Vortrag) . Foto: simone.brunozzi CC-BY-SA
Blogger sind keine Paparazzi. Daher sind die meisten Urteile, die sich mit dem Recht der Presse befassen, Bilder von Prominenten oder Straftätern zu veröffentlichen, für sie nicht einschlägig. Das betreffende Rechtsgebiet nennt sich "Recht am eigenen Bild" (siehe etwa Wikipedia) und ist im "Kunsturheberrechtsgesetz" (KG) aus dem Jahr 1907 geregelt, dessen Paragraphen 22, 23, 24 und 33 weiterhin gelten, während der Rest des Gesetzes durch das geltende Urheberrechtsgesetz ersetzt wurde.
Auch ohne Rechtskenntnisse dürfte klar sein, was in § 22 KUG unmissverständlich formuliert wird: "Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden." Dies gilt auch noch bis 10 Jahre nach dem Tod des Abgebildeten.
Das Anfertigen von Bildern in der Öffentlichkeit ist nur in Ausnahmefällen verboten. (Seit 2004 untersagt § 201a Strafgesetzbuch das unbefugte Fotografieren in geschützten Räumen.) Ein Forscher darf also für wissenschaftliche Zwecke Personenfotos ohne Zustimmung der Fotografierten erstellen, doch für ihre Veröffentlichung braucht er die Genehmigung der so Porträtierten.
Daher gilt als Faustregel: Konflikte lassen sich vermeiden, wenn man sich die geplante Veröffentlichung vom Abgebildeten genehmigen lässt.
Fotografieren bei einer Tagung Pressefotografen und Blogger einen Referenten, hat der Blogger wenig zu befürchten, da dem Referenten klar sein muss, dass Fotos von ihm veröffentlicht werden. Duldet er das Fotografieren, erteilt er implizit die Veröffentlichungserlaubnis.
Neben dem sogenanten "Beiwerk" (z.B. Personen als unwesentlicher Teil des Stadtbilds oder einer Landschaft) ist vor allem die Ausnahme für "Versammlungen" hier relevant. Private Veranstaltungen sind zwar nicht erfasst, aber auch kleinere wissenschaftliche Tagungen darf man als öffentlich ansehen. Gruppenfotos und Fotos vom Auditorium sind also, wenn nicht gezielt eine einzelne Person in den Blick genommen wird, unproblematisch.
Wie sieht es mit den Referenten aus? Wenn man die Tagung als "Ereignis der Zeitgeschichte" ansieht, darf man auch die Referenten ablichten. Die Bildberichterstattung der Presse darf "grundsätzlich alle Geschehnisse von gesellschaftlicher Relevanz" erfassen (Dreier in: Dreier/Schulze 3. Aufl. 2008, S. 1854). Die frühere Unterscheidung zwischen "absoluten Personen der Zeitgeschichte" (vulgo A-Promis) und "relevativen Personen der Zeitgeschichte", die nur vorübergehend vom Scheinwerfer der Öffentlichkeit erfasst werden (z.B. Täter oder Opfer eines spektakulären Verbrechens), wurde von der Rechtsprechung aufgegeben.
In jedem Fall ist das Interesse der Öffentlichkeit an der Bildberichterstattung mit dem Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten abzuwägen. Respektvolle Fotos von öffentlichen Veranstaltungen sind daher kaum riskant. Kann ein seriöses Informationsinteresse der Öffentlichkeit zum Thema bejaht werden, darf man auch Personenbilder ohne Zustimmung veröffentlichen, die nicht in der ersten Reihe der gesellschaftlichen Leistungssträger stehen. Ist die Person in der Wikipedia seit längerem mit einem Foto vertreten oder hat sie Fotos von sich auf Facebook usw. veröffentlicht, kann sie sich gegen eine Bildberichterstattung schlecht wehren, auch wenn es um eine kritische Auseinandersetzung geht.
Wer sich auf brisantem Terrain wie der Stasi-Geschichte bewegt, sollte sich über juristischen Gegenwind nicht wundern, wenn er ehemalige Stasi-Mitarbeiter outet oder sogar abbildet. Bei einem eindeutigen zeithistorischen Dokument musste das Oberlandesgericht München im Dezember 2010 für Rechtssicherheit sorgen: Ein ehemaliger IM war neben einem Militärstaatsanwalt bei der Versiegelung der Räumlichkeiten des MfS 1989 zu sehen. Die Internetseite stasi-in-erfurt.de durfte ihn zeigen (ich empfehle die Lektüre des Urteils (PDF)). Bemerkenswert ist, dass das Gericht dem Anbieter dieser Seite, der eine ernsthafte Auseindersetzung mit dem Thema attestiert wurde, das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 GG) neben der Informations- und Meinungsfreiheit zugute kommen ließ.
Wer seriös wissenschaftlich berichtet, braucht sich bei der Veröffentlichung von Bildern lebender oder noch nicht 10 Jahre toter Personen also auch dann nur wenig Sorgen zu machen, wenn das Bild keine herausragende Persönlichkeit betrifft.
Das Risiko, dass ein Wissenschaftsblogger Ärger wegen des "Rechts am eigenen Bild" bekommt, schätze ich als eher gering ein.
Es gibt zum Recht am eigenen Bild unzählige Gerichtsentscheidungen, Literatur und Internetquellen. Daher sollte es sich von selbst verstehen, dass dieser Beitrag keine Rechtsberatung leisten und das Thema nur allzu holzschnitthaft in den Blick nehmen kann. Hoffentlich überflüssiger Hinweis: Wer ein fremdes Foto benutzt, braucht immer auch die Zustimmung des Rechteinhabers nach dem Urheberrechtsgesetz. Aber das ist ein anderes Thema.
***
Tipp: Instruktive Bildergalerie auf Wikiversity von Ralf Roletschek:
http://de.wikiversity.org/wiki/Kurs:Urheberrecht_im_Internet/Recht_am_eigenen_Bild
Fortsetzung Blog&Recht: http://archiv.twoday.net/stories/156272358/
 Viele Urteile zum Recht am eigenen Bild erstritt Caroline von Monaco (hier bei einem öffentlichen Vortrag) . Foto: simone.brunozzi CC-BY-SA
Viele Urteile zum Recht am eigenen Bild erstritt Caroline von Monaco (hier bei einem öffentlichen Vortrag) . Foto: simone.brunozzi CC-BY-SAKlausGraf - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 18:34 - Rubrik: Archivrecht
Am 6. Juli dieses Jahres schleimte Dr. Julia Schreiner vom Oldenbourg-Verlag per Mail:
Sie hatten als Themen-Vorschlag "Zitierfähigkeit von Blogs" eingereicht. Wir würden gerne einen Aspekt Ihres abstracts herausgreifen: die urheberrechtlichen Fragen - und diesen Aspekt weiterentwickeln. Könnten Sie sich vorstellen, für das Projekt einen Überblick zu verfassen über die rechtlichen Fragen, die mit dem Medium Blog/Weblog verknüpft sind? Was müssen Blogger beachten? Was sind die rechtlichen Grundlagen? Gelten für das Medium Blog besondere Regeln - auch hinsichtlich Urheberrecht? ...
Es wäre großartig das Thema im historyblogosphere Projekt dabei zu haben. Und Sie sind sicherlich der einzige Experte, der diese wichtigen Fragen behandeln könnte.
Wenn Sie sich mit unserem Vorschlag anfreunden könnten, würden wir Sie um einen Beitrag von bis zu 16.000 Zeichen bitten (inklusive Leerzeichen und - knappen - Literaturangaben).
Ich war nicht überzeugt und hakte nach. Dr. Julia Schreiner lud am 9. Juli 2012 daraufhin reichlich Schleim nach:
Die Frage der Zitierfähigkeit klingt in einigen anderen Beiträgen an - wir freuen uns, wenn Sie sich dazu kräftig im Open Peer Review äußern.
Die Rechtsthematik wäre im Band hingegen nicht abgedeckt, was eine große Lücke lassen würde. Uns wäre es daher wichtig, mit Ihnen DEN Experten zum unverzichtbaren Thema Urheberrecht zu gewinnen.
So umworben war ich doch etwas überrascht, dass dieselbe Lektorin mir dann am 19. September schrieb:
Sehr geehrter Herr Graf,
nach Ihrem Angriff auf Herrn Peter Haber in Ihrem Blog Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/142784574/
werden Sie voraussichtlich selbst wenig Interesse daran haben, Autor im von Herrn Haber zusammen mit Eva Pfanzelter herausgegebenen Projekt "historyblogosphere" http://historyblogosphere.org/ zu sein.
Herausgeber und Verlag nehmen ebenso einhellig davon Abstand, einen Text von Ihnen im Buchprojekt "historyblogosphere" zu veröffentlichen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Julia Schreiner
Oldenbourg Verlag München
Priv.-Doz. Dr. Peter Haber
hist.net | Plattform für Digitale Geschichtswissenschaft
Ass.Prof. Dr. Eva Pfanzelter
Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck
Aus meiner Sicht hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Der OIdenbourg-Verlag hat durch konkludentes Handeln einen Verlagsvertrag mit mir geschlossen, den er ohne wichtigen Grund gekündigt hat. Mein Rechtsanwalt prüft.
Die Thematik des Beitrags werde ich in einzelnen Beiträgen in Archivalia beleuchten.
Update:
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/156272066/
Sie hatten als Themen-Vorschlag "Zitierfähigkeit von Blogs" eingereicht. Wir würden gerne einen Aspekt Ihres abstracts herausgreifen: die urheberrechtlichen Fragen - und diesen Aspekt weiterentwickeln. Könnten Sie sich vorstellen, für das Projekt einen Überblick zu verfassen über die rechtlichen Fragen, die mit dem Medium Blog/Weblog verknüpft sind? Was müssen Blogger beachten? Was sind die rechtlichen Grundlagen? Gelten für das Medium Blog besondere Regeln - auch hinsichtlich Urheberrecht? ...
Es wäre großartig das Thema im historyblogosphere Projekt dabei zu haben. Und Sie sind sicherlich der einzige Experte, der diese wichtigen Fragen behandeln könnte.
Wenn Sie sich mit unserem Vorschlag anfreunden könnten, würden wir Sie um einen Beitrag von bis zu 16.000 Zeichen bitten (inklusive Leerzeichen und - knappen - Literaturangaben).
Ich war nicht überzeugt und hakte nach. Dr. Julia Schreiner lud am 9. Juli 2012 daraufhin reichlich Schleim nach:
Die Frage der Zitierfähigkeit klingt in einigen anderen Beiträgen an - wir freuen uns, wenn Sie sich dazu kräftig im Open Peer Review äußern.
Die Rechtsthematik wäre im Band hingegen nicht abgedeckt, was eine große Lücke lassen würde. Uns wäre es daher wichtig, mit Ihnen DEN Experten zum unverzichtbaren Thema Urheberrecht zu gewinnen.
So umworben war ich doch etwas überrascht, dass dieselbe Lektorin mir dann am 19. September schrieb:
Sehr geehrter Herr Graf,
nach Ihrem Angriff auf Herrn Peter Haber in Ihrem Blog Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/142784574/
werden Sie voraussichtlich selbst wenig Interesse daran haben, Autor im von Herrn Haber zusammen mit Eva Pfanzelter herausgegebenen Projekt "historyblogosphere" http://historyblogosphere.org/ zu sein.
Herausgeber und Verlag nehmen ebenso einhellig davon Abstand, einen Text von Ihnen im Buchprojekt "historyblogosphere" zu veröffentlichen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Julia Schreiner
Oldenbourg Verlag München
Priv.-Doz. Dr. Peter Haber
hist.net | Plattform für Digitale Geschichtswissenschaft
Ass.Prof. Dr. Eva Pfanzelter
Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck
Aus meiner Sicht hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Der OIdenbourg-Verlag hat durch konkludentes Handeln einen Verlagsvertrag mit mir geschlossen, den er ohne wichtigen Grund gekündigt hat. Mein Rechtsanwalt prüft.
Die Thematik des Beitrags werde ich in einzelnen Beiträgen in Archivalia beleuchten.
Update:
http://adresscomptoir.twoday.net/stories/156272066/
http://historiana.eu/
Historiana - Your Portal to the Past“ ist eine digitale Plattfom, die Lehrern ab sofort unter http://historiana.eu multiperspektivisches und vergleichendes Unterrichtsmaterial zur europäischen Geschichte zur Verfügung stellt. Ins Leben gerufen wurde das Projekt vom Europäischen Geschichtslehrerverband EUROCLIO unter Beteiligung des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung und vielen anderen Partnern.
http://idw-online.de/pages/de/news499543
Was ist das nur für ein Schrott! Was fängt man denn bitteschön als Lehrer mit einem kleinen Schwarzweissbildchen von Lech Walesa an, das nur durch das Geburtsdatum erläutert wird?
http://historiana.eu/people/person/lech-walesa
Keinerlei Link zu weiterführenden Materialien im Netz - schon daher im Ansatz verfehlt. Hat aber gewisslich gewaltig Geld verschlungen ...
Fertig ist es auch nicht, gähnend leer ist etwa die Rubrik Cartoons:
http://historiana.eu/sources/filter/cartoons/
Und Nachnutzbarkeit - Fehlanzeige? Wer ein Foto einer bemalten Wand aus Belfast in seiner Vorlesung nutzen will, kann das nicht ohne Erlaubnis des angegebenen Copyright-Inhabers, obwohl das eigentlich im Interesse des Portals sein sollte.
Wie schon tausendfach zuvor kreißte der Berg ...

Historiana - Your Portal to the Past“ ist eine digitale Plattfom, die Lehrern ab sofort unter http://historiana.eu multiperspektivisches und vergleichendes Unterrichtsmaterial zur europäischen Geschichte zur Verfügung stellt. Ins Leben gerufen wurde das Projekt vom Europäischen Geschichtslehrerverband EUROCLIO unter Beteiligung des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung und vielen anderen Partnern.
http://idw-online.de/pages/de/news499543
Was ist das nur für ein Schrott! Was fängt man denn bitteschön als Lehrer mit einem kleinen Schwarzweissbildchen von Lech Walesa an, das nur durch das Geburtsdatum erläutert wird?
http://historiana.eu/people/person/lech-walesa
Keinerlei Link zu weiterführenden Materialien im Netz - schon daher im Ansatz verfehlt. Hat aber gewisslich gewaltig Geld verschlungen ...
Fertig ist es auch nicht, gähnend leer ist etwa die Rubrik Cartoons:
http://historiana.eu/sources/filter/cartoons/
Und Nachnutzbarkeit - Fehlanzeige? Wer ein Foto einer bemalten Wand aus Belfast in seiner Vorlesung nutzen will, kann das nicht ohne Erlaubnis des angegebenen Copyright-Inhabers, obwohl das eigentlich im Interesse des Portals sein sollte.
Wie schon tausendfach zuvor kreißte der Berg ...
KlausGraf - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 17:27 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.pr.uni-freiburg.de/pm/2012/pm.2012-07-30.205
Der Historiker Kurt Andermann ist Referatsleiter für die Altbestände am Generallandesarchiv Karlsruhe und leitet seit Anfang 2012 zusätzlich das Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein. Er wurde 1982 an der Universität Mannheim promoviert und arbeitete anschließend bis 2010 in der baden-württembergischen Landes- und Kreisbeschreibung, seit 1994 als Leiter von deren Karlsruher Außenstelle. Seit 2000 ist er Lehrbeauftragter am Historischen Seminar der Universität Freiburg. Andermann ist ein ausgewiesener Kenner der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte Südwestdeutschlands unter Einschluss der Pfalz und Frankens und gilt als herausragender Ansprechpartner für Forschungen zum Adel. Sein Schriftenverzeichnis umfasst neun selbstständige Monografien, etwa 160 wissenschaftliche Aufsätze und eine Vielzahl von Lexikonartikeln und Rezensionen. Der Historiker ist unter anderem Mitglied der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. Andermann wird an der Philosophischen Fakultät Lehrveranstaltungen im Fach Mittelalterliche Geschichte / Frühe Neuzeit mit besonderer Berücksichtigung der Landesgeschichte halten. Eine enge wissenschaftliche Kooperation mit dem Landesarchiv Baden-Württemberg wird angestrebt.
Der Historiker Kurt Andermann ist Referatsleiter für die Altbestände am Generallandesarchiv Karlsruhe und leitet seit Anfang 2012 zusätzlich das Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein. Er wurde 1982 an der Universität Mannheim promoviert und arbeitete anschließend bis 2010 in der baden-württembergischen Landes- und Kreisbeschreibung, seit 1994 als Leiter von deren Karlsruher Außenstelle. Seit 2000 ist er Lehrbeauftragter am Historischen Seminar der Universität Freiburg. Andermann ist ein ausgewiesener Kenner der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte Südwestdeutschlands unter Einschluss der Pfalz und Frankens und gilt als herausragender Ansprechpartner für Forschungen zum Adel. Sein Schriftenverzeichnis umfasst neun selbstständige Monografien, etwa 160 wissenschaftliche Aufsätze und eine Vielzahl von Lexikonartikeln und Rezensionen. Der Historiker ist unter anderem Mitglied der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. Andermann wird an der Philosophischen Fakultät Lehrveranstaltungen im Fach Mittelalterliche Geschichte / Frühe Neuzeit mit besonderer Berücksichtigung der Landesgeschichte halten. Eine enge wissenschaftliche Kooperation mit dem Landesarchiv Baden-Württemberg wird angestrebt.
KlausGraf - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 16:29 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bislang klammerten die deutschen Rechtsschutzversicherer in ihren Bedingungen Medienrecht aus, sodass insbesondere Streitigkeiten mit Bezug zum Persönlichkeitsrecht oder irrtümlichen Urheberrechtsverstößen stets aus eigener Tasche finanziert werden mussten. Nunmehr will die ARAG für Privatleute diese Lücke schließen und bietet als erster Versicherer ein umfangreiches Paket an Übernahme-Leistungen an. [...] Für Blogger, Twitterer und Forennutzer besonders interessant ist der Rechtsschutz gegen den Vorwurf rechtswidriger Äußerungen, bei denen man schnell einen kostspieligen Termin z.B. am Landgericht Hamburg erhält. Derartige Streitigkeiten sollen allerdings nur im privaten Bereich übernommen werden, politisch kontroverse Blogger veröffentlichen also auch nach wie vor auf eigenes Risiko.
http://www.heise.de/tp/blogs/6/152899
http://www.heise.de/tp/blogs/6/152899
KlausGraf - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 15:16 - Rubrik: Archivrecht
Gemälde, Zeichnungen und ergänzende Dokumente sind im Fernzugriff abrufbar, meldet das VÖBBLOG:
http://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado

http://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado

KlausGraf - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 15:00 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Ausstellung zur Geschichte der Universität Salzburg ist auch virtuell zu bewundern:
http://www.uni-salzburg.at/portal/page?_pageid=147,1181515&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.uni-salzburg.at/portal/page?_pageid=147,1181515&_dad=portal&_schema=PORTAL
KlausGraf - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 14:37 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Test!
KlausGraf - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 12:49 - Rubrik: Fotoueberlieferung
http://www.youtube.com/watch?v=xkzcE5PnDgc
"Zwangsarbeiter im Dritten Reich . damit ihre Geschichten nicht in Vergessenheit geraten, gibt es das Online-Archiv "Zwangsarbeit 1939-1945. Erinnerungen und Geschichte". Zeitzeugen aus 26 Ländern berichten, rund 2000 Gesprächsstunden bilden die Grundlage des Archivs. Dahinter stehen die Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" und das Center für Digitale Systeme an der FU Berlin."
Hinweis: Diesen Beitrag habe ich angelegt, um die Einbettung von Youtube-Videos zu testen.
siehe: http://archiv.twoday.net/stories/156270465/
"Zwangsarbeiter im Dritten Reich . damit ihre Geschichten nicht in Vergessenheit geraten, gibt es das Online-Archiv "Zwangsarbeit 1939-1945. Erinnerungen und Geschichte". Zeitzeugen aus 26 Ländern berichten, rund 2000 Gesprächsstunden bilden die Grundlage des Archivs. Dahinter stehen die Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" und das Center für Digitale Systeme an der FU Berlin."
Hinweis: Diesen Beitrag habe ich angelegt, um die Einbettung von Youtube-Videos zu testen.
siehe: http://archiv.twoday.net/stories/156270465/
SW - am Dienstag, 2. Oktober 2012, 09:50 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Patrick Sahle beobachtete die Digital-Humanities-Sektion des Historikertags:
http://dhd-blog.org/?p=915
Aus der Sektion ging die AG Digitale Geschichtswissenschaft hervor, über die man auf der Homepage (!) und im Newsletter des VHD (!!) dereinst mehr erfahren wird:
http://idw-online.de/pages/de/news499237
http://dhd-blog.org/?p=915
Aus der Sektion ging die AG Digitale Geschichtswissenschaft hervor, über die man auf der Homepage (!) und im Newsletter des VHD (!!) dereinst mehr erfahren wird:
http://idw-online.de/pages/de/news499237
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Geneva 1 October 2012. Representatives from the science funding agencies and library communities of 29 countries are meeting at CERN1 today to launch the SCOAP32 Open Access initiative. Open Access revolutionizes the traditional scientific publishing model with scientific papers being made freely available to all, and publishers paid directly for their indispensable peer-review services to the community.
“It is gratifying to see how the model of international collaboration in particle physics has been applied to addressing the important societal issue of open access to scientific information,” said CERN Director General Rolf Heuer. “I am proud that CERN has contributed to exploring win-win solutions to this issue, which is important to both scientists and science policy makers the world over.”
“It has been very much like working on a CERN experiment,” added Salvatore Mele, head of Open Access at CERN, who has coordinated the initiative so far, “amazing collaboration from experts from all over the world, both volunteers from libraries and partners in the publishing industry, bringing together their different expertise and working together to build something never tried before.”
The objective of SCOAP3 is to grant unrestricted access to scientific articles appearing in scientific journals in the field of particle physics, which so far have only been available to scientists through certain university libraries, and generally unavailable to a wider public. Open dissemination of preliminary information, in the form of pre-peer review articles known as preprints, has been the norm in particle physics for two decades. SCOAP3 now brings the vital peer review service provided by journals into the Open Access world.
In the SCOAP3 model, libraries and funding agencies pool resources currently used to subscribe to journal content and use them to support the peer-review system directly instead. Journal publishers then make their articles Open Access, which means that anyone can read them. Authors retain the copyright, and generous licenses for re-use are used.
Publishers of 12 journals, accounting for the vast majority of articles in the field, have been identified for participation in SCOAP3 through an open and competitive process, and the SCOAP3 initiative looks forward to establishing more partnerships with key institutions in Europe, America and Asia as it moves through the technical steps of organizing the re-direction of funds from the current subscription model to a common internationally coordinated fund.
SCOAP3 expects to be operational for articles published as of 2014. (http://press.web.cern.ch/)
“It is gratifying to see how the model of international collaboration in particle physics has been applied to addressing the important societal issue of open access to scientific information,” said CERN Director General Rolf Heuer. “I am proud that CERN has contributed to exploring win-win solutions to this issue, which is important to both scientists and science policy makers the world over.”
“It has been very much like working on a CERN experiment,” added Salvatore Mele, head of Open Access at CERN, who has coordinated the initiative so far, “amazing collaboration from experts from all over the world, both volunteers from libraries and partners in the publishing industry, bringing together their different expertise and working together to build something never tried before.”
The objective of SCOAP3 is to grant unrestricted access to scientific articles appearing in scientific journals in the field of particle physics, which so far have only been available to scientists through certain university libraries, and generally unavailable to a wider public. Open dissemination of preliminary information, in the form of pre-peer review articles known as preprints, has been the norm in particle physics for two decades. SCOAP3 now brings the vital peer review service provided by journals into the Open Access world.
In the SCOAP3 model, libraries and funding agencies pool resources currently used to subscribe to journal content and use them to support the peer-review system directly instead. Journal publishers then make their articles Open Access, which means that anyone can read them. Authors retain the copyright, and generous licenses for re-use are used.
Publishers of 12 journals, accounting for the vast majority of articles in the field, have been identified for participation in SCOAP3 through an open and competitive process, and the SCOAP3 initiative looks forward to establishing more partnerships with key institutions in Europe, America and Asia as it moves through the technical steps of organizing the re-direction of funds from the current subscription model to a common internationally coordinated fund.
SCOAP3 expects to be operational for articles published as of 2014. (http://press.web.cern.ch/)
KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 23:06 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nachrufe:
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/nachruf-auf-britischen-historiker-eric-hobsbawm-a-858999.html
http://www.guardian.co.uk/books/2012/oct/01/eric-hobsbawm-died-aged-95
Update: http://archiv.twoday.net/stories/158961357/
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/nachruf-auf-britischen-historiker-eric-hobsbawm-a-858999.html
http://www.guardian.co.uk/books/2012/oct/01/eric-hobsbawm-died-aged-95
Update: http://archiv.twoday.net/stories/158961357/
KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 23:02 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Teilnehmer haben Tolles geleistet (nämlich die Ausbeute mehr als verdoppelt - 2011: 168.208 Bilder), während die Öffentlichkeitsarbeit noch mieser als 2011 war. Es gibt auf
http://www.wikilovesmonuments.org/
keine abschließende Erfolgsmeldung, von einer Pressemitteilung ganz zu schweigen.
http://www.wikilovesmonuments.de/ ist eine Ruine (und zeigt nicht nur eine, nämlich eine Klosterruine auf freiem Feld in der Nähe von Crailsheim, das deutsche Siegerbild 2011)
Siehe zum Wettbewerb 2012 hier:
http://archiv.twoday.net/stories/156263500/
http://archiv.twoday.net/stories/142783530/
Bei den deutschen Hochladern stehe ich mit 445 Fotos auf Platz 13:
http://toolserver.org/~superzerocool/wlm/?pais=germany
http://toolserver.org/~superzerocool/wlm/usuario.php?pais=germany&usuario=Historiograf
 Eigenes Foto von Burg Hohengeroldseck
Eigenes Foto von Burg Hohengeroldseck
http://www.wikilovesmonuments.org/
keine abschließende Erfolgsmeldung, von einer Pressemitteilung ganz zu schweigen.
http://www.wikilovesmonuments.de/ ist eine Ruine (und zeigt nicht nur eine, nämlich eine Klosterruine auf freiem Feld in der Nähe von Crailsheim, das deutsche Siegerbild 2011)
Siehe zum Wettbewerb 2012 hier:
http://archiv.twoday.net/stories/156263500/
http://archiv.twoday.net/stories/142783530/
Bei den deutschen Hochladern stehe ich mit 445 Fotos auf Platz 13:
http://toolserver.org/~superzerocool/wlm/?pais=germany
http://toolserver.org/~superzerocool/wlm/usuario.php?pais=germany&usuario=Historiograf
 Eigenes Foto von Burg Hohengeroldseck
Eigenes Foto von Burg HohengeroldseckDer ehemalige Handelsblatt-Redakteur Doener zeigt die irreführende Berichterstattung seines einstigen Arbeitgebers in Sachen "geistiges Eigentum" detailliert auf:
http://doener.blogage.de/entries/2012/9/30/Missverstaendnisse-zum-Urheberrecht-in-der-Presse
http://doener.blogage.de/entries/2012/9/30/Missverstaendnisse-zum-Urheberrecht-in-der-Presse
KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 22:29 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://bildungundgutesleben.wordpress.com/2012/09/26/jemand-macht-geld-mit-google-books-ist-das-schlimm/
Gleich im ersten Fachbeitrag der aktuellen B.I.T. Online behauptet Clemens Alexander Wimmer, dass sich die Bibliotheken, welche mit Google Books zusammenarbeiten, abschaffen würden. (Wimmer, Clemens Alexander (2012) / Die Bibliothek schafft sich ab oder wie Goole books zu Geld werden. In: B.I.T. Online 15 (2012) 4, 315-328) Das ist eine gerne einmal aufgestellte Behauptung, die sich trotzdem bislang nicht bewahrheitet hat. Bei diesem speziellen Artikel scheint mir aber zudem auch ein Unverständnis im Bezug auf Freie Daten vorzuherrschen.
Bibliothekswissenschaftler Karsten Schuldt unterzieht den Text einer detaillierten Kritik, der zuzustimmen ist.
Zitat:
Insoweit scheint mir im Artikel von Wimmer eine interessante Beschreibung von Geschäftsprozessen rund um Google Books vorzuliegen, aber die angebrachte Kritik am Handeln von Bibliotheken auf einer Vorstellung zu beruhen, dass einmal gemeinfreie Werke, die in Bibliotheken angekommen sind, keinen kommerziellen Interessen dienen dürften. Das ist nicht richtig. (Gemein)frei Daten können selbstverständlich auch zur Produktion von Gewinn (Wenn er den überhaupt eintritt. Wir wissen nicht, wie viel die Nachdruckverlage verdienen, nur dass sie, wie Wimmer richtig bemerkt, noch nicht eingegangen sind, sondern vielmehr immer mehr Produkte auf den Markt werfen.) genutzt werden. Wem das nicht passt, der oder die muss die Gesellschaft sehr radikal ändern, aber – nochmal – darum scheint es Wimmer nicht zu gehen.
Archivalia wird in dem Beitrag Wimmers zitiert, aber die einleitenden Ausführungen zur Rechtslage sind daneben und lassen keinerlei Einsicht in die Problemlage erkennen.
Zu einer früheren Wimmeriade über Google Books:
http://archiv.twoday.net/stories/75224454/
Gleich im ersten Fachbeitrag der aktuellen B.I.T. Online behauptet Clemens Alexander Wimmer, dass sich die Bibliotheken, welche mit Google Books zusammenarbeiten, abschaffen würden. (Wimmer, Clemens Alexander (2012) / Die Bibliothek schafft sich ab oder wie Goole books zu Geld werden. In: B.I.T. Online 15 (2012) 4, 315-328) Das ist eine gerne einmal aufgestellte Behauptung, die sich trotzdem bislang nicht bewahrheitet hat. Bei diesem speziellen Artikel scheint mir aber zudem auch ein Unverständnis im Bezug auf Freie Daten vorzuherrschen.
Bibliothekswissenschaftler Karsten Schuldt unterzieht den Text einer detaillierten Kritik, der zuzustimmen ist.
Zitat:
Insoweit scheint mir im Artikel von Wimmer eine interessante Beschreibung von Geschäftsprozessen rund um Google Books vorzuliegen, aber die angebrachte Kritik am Handeln von Bibliotheken auf einer Vorstellung zu beruhen, dass einmal gemeinfreie Werke, die in Bibliotheken angekommen sind, keinen kommerziellen Interessen dienen dürften. Das ist nicht richtig. (Gemein)frei Daten können selbstverständlich auch zur Produktion von Gewinn (Wenn er den überhaupt eintritt. Wir wissen nicht, wie viel die Nachdruckverlage verdienen, nur dass sie, wie Wimmer richtig bemerkt, noch nicht eingegangen sind, sondern vielmehr immer mehr Produkte auf den Markt werfen.) genutzt werden. Wem das nicht passt, der oder die muss die Gesellschaft sehr radikal ändern, aber – nochmal – darum scheint es Wimmer nicht zu gehen.
Archivalia wird in dem Beitrag Wimmers zitiert, aber die einleitenden Ausführungen zur Rechtslage sind daneben und lassen keinerlei Einsicht in die Problemlage erkennen.
Zu einer früheren Wimmeriade über Google Books:
http://archiv.twoday.net/stories/75224454/
KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 22:21 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
URN: urn:nbn:de:bsz:25-opus-87679
URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8767/
Graf, Klaus: Gottfried Wilhelm Leibniz, Ladislaus Sunthaim und die süddeutsche Welfen-Historiographie
Kurzfassung in Deutsch:
In Band 1 der Scriptores rerum Brunsvicensium von 1707 druckte Leibniz auf sechs Seiten als Nr. 58 die 1511 datierte genealogische Ausarbeitung zur Geschichte der Welfen des aus Ravensburg gebürtigen Wiener Kanonikers Ladislaus Sunthaim - Hofhistoriograph Maximilians I. und einer der Väter der modernen Genealogie. Der Beitrag würdigt Sunthaim als Vorläufer des "Genealogen" Leibniz und erwägt, ob die anonyme "Summula de Guelfis", das wichtigste Zeugnis der süddeutschen Welfen-Historiographie um 1500, aus Sunthaims Feder stammen könnte. S. 39 Anm. 25 wird ein wichtiger Neufund zur Überlieferung der Werke Sunthaims mitgeteilt: Zwei bislang unidentifizierte Sammelbände Sunthayms verwahrt als Handschriften Nr. 189 und 193 des Schlüsselberg-Archivs das Oberösterreichische Landesarchiv.
SWD-Schlagwörter: Sunthaym, Ladislaus , Leibniz, Gottfried Wilhelm , Welfen
Freie Schlagwörter (deutsch): Wissenschaftsgeschichte der Genealogie
Freie Schlagwörter (englisch): genealogy
Institut: Historisches Seminar
DDC-Sachgruppe: Geschichte
Dokumentart: Aufsatz
Quelle: Leibniz als Sammler und Herausgeber historischer Quellen, hrsg. von Nora Gädeke (Wolfenbütteler Forschungen 129), Wiesbaden 2012, S. 33-47
Sprache: Deutsch
Erstellungsjahr: 2012
Publikationsdatum: 01.10.2012
Bemerkung: Verlags-PDF. Preprint mit Links: Archivalia vom 14. Oktober 2007: http://archiv.twoday.net/stories/4349225/ bzw. Archivversion http://www.webcitation.org/5xQyrF4hi
***
Passend dazu teile ich den von mir für die NDB geschriebenen Artikel über Sunthaim mit (in der von mir eingereichten, nicht redigierten Fassung):
Sunthaym, Ladislaus, Historiograph, Genealoge und Geograph
* um 1440 in Ravensburg
+ wohl um den 1. Februar 1513 in Wien
Der aus einer Ravensburger Bürgersfamilie stammende S. begegnet
erstmals 1460 in der Wiener Universitätsmatrikel. 1465 Baccalaureus geworden, schlug er in Wien eine Klerikerlaufbahn ein. Bevor er 1504 ein Kanonikat am Stephansdom erhielt, versorgten ihn drei Messpfründen an der gleichen Kirche. Seit 1500 erhielt er finanzielle Zuwendungen als Historiograph und "cronickmaister" Maximilians I.
Aufgrund seiner fundierten genealogischen Forschungen war S. zunächst der führende Kopf des Gelehrtenkreises, der gemeinsam mit dem Herrscher das singuläre Ruhmes- und Erinnerungswerk Maximilians konzipierte. Ab 1505 verdrängte ihn der für kühnere genealogische Konstruktionen aufgeschlossenere Jurist Jakob Mennel aus dieser Position. Zwei große Interessensgebiete bestimmten S.s Studien: die landesbeschreibende Geographie und die Genealogie des Adels. Wenn es an Geld und Schreibern nicht fehle, schrieb er 1503 an Matthäus Lang, wolle er sich beeilen, sein Wissen in zwei Büchern zusammenzufassen, das eine vom Adel, das andere von Ländern, Städten, Klöstern und Flüssen.
S.s Werke liegen vor allem in mehreren Sammelhandschriften vor. Die wohl weitgehend auf ausgedehnten eigenen Reisen fußende Beschreibung oberdeutscher Regionen (um 1500) in den Stuttgarter Codices hist. 2° 250 und 249 liefern überwiegend nüchterne topographisch-statistische Notizen, die aber immer wieder mit reizvollen Beobachtungen angereichert werden. Sie waren für Sebastian Münsters Kosmographie (Erstausgabe 1544) eine
wichtige Quelle. Die geographischen Arbeiten S.s, zu denen auch eine auf seine Materialien zurückgehende Beschreibung Österreichs gezählt werden darf, sind zu sehen vor dem Hintergrund der
kosmographisch-ethnographischen Darstellungen des Humanismus und des ambitionierten Plans von Konrad Celtis einer "Germania illustrata". Mit dem Poeten Celtis verband S. ein enges, wenn auch
nicht immer konfliktfreies Verhältnis.
Wie Mennel und Matthäus Marschalk von Pappenheim kann S. als Pionier der "modernen" Genealogie gelten. In einer Zeit, die noch keine genealogischen Nachschlagewerke kannte, war es eine große Leistung, Ordnung in die Stammfolgen mitteleuropäischer Dynastien zu bringen (neben den Habsburgern dokumentieren die Sammelbände z.B. auch die Welfen, Wittelsbacher und Württemberger). Bereits die anlässlich der Heiligsprechung des Babenbergerherzogs Leopold 1485 für das Stift
Klosterneuburg verfasste Babenberger-Genealogie "Tabulae
Claustroneoburgenses" (1491 anonym in Basel gedruckt) demonstrieren S.s Kennerschaft im Umgang mit der hochmittelalterlichen Quellenüberlieferung.
S. gehörte zum neuen Typ des "reisenden Historikers" (F. Eheim), der insbesondere in klösterlichen Bibliotheken und Archiven auf
Quellensuche ging. Integriert in die Wiener humanistische Sodalitas,
kann S. doch nicht als Humanist betrachtet werden, wählt man den
programmatischen Bezug auf die Antike als Kriterium. Seine
historischen Studien ordnen ihn vielmehr den ausgeprägten
retrospektiven Strömungen der Zeit um 1500 zu, wie sie damals nicht nur am deutschen Königshof gepflegt wurden, sondern auch im
"monastischen Historismus" reformierter Benediktinerklöster (mit
Johannes Trithemius an der Spitze) und im Kontext der ritterlichen
Altertümern nachspürenden "Ritter-Renaissance" (z.B. im Wappenbuch Konrad Grünenbergs).
Werke: A. F. Oefele, Rerum Boicarum Scriptores, Bd. 2, 1763, S.
557-644; K. Uhde, Ladislaus Sunthayms geographisches Werk und seine Rezeption durch Sebastian Münster. 1-2. 1993
Literatur: ADB; ²VL (W. Stelzer); F. Eheim, Ladislaus Sunthaym. Leben und Werk. masch. Diss. Wien 1949, Ders., Ladislaus Sunthaym. Ein Historiker aus dem Gelehrtenkreis um Maximilian I., in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 67 (1959), S. 54-91; R. Perger: Sunthaym-Beiträge, in: Adler 10 (1974/76), S. 224-239; R. Götz,
Wege und Irrwege frühneuzeitlicher Historiographie,
2007, S. 25-32; K. Graf, Gottfried Wilhelm Leibniz, Ladislaus Sunthaim und die süddeutsche Welfen-Historiographie, in: Leibniz als Sammler und Herausgeber historischer Quellen (in Vorb.)
[Druckfassung: Neue Deutsche Biographie 25 (2013), S. 706f.]
 Markgräfin Agnes (aus Sunthaims Klosterneuburger Stammbaum)
Markgräfin Agnes (aus Sunthaims Klosterneuburger Stammbaum)
URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8767/
Graf, Klaus: Gottfried Wilhelm Leibniz, Ladislaus Sunthaim und die süddeutsche Welfen-Historiographie
Kurzfassung in Deutsch:
In Band 1 der Scriptores rerum Brunsvicensium von 1707 druckte Leibniz auf sechs Seiten als Nr. 58 die 1511 datierte genealogische Ausarbeitung zur Geschichte der Welfen des aus Ravensburg gebürtigen Wiener Kanonikers Ladislaus Sunthaim - Hofhistoriograph Maximilians I. und einer der Väter der modernen Genealogie. Der Beitrag würdigt Sunthaim als Vorläufer des "Genealogen" Leibniz und erwägt, ob die anonyme "Summula de Guelfis", das wichtigste Zeugnis der süddeutschen Welfen-Historiographie um 1500, aus Sunthaims Feder stammen könnte. S. 39 Anm. 25 wird ein wichtiger Neufund zur Überlieferung der Werke Sunthaims mitgeteilt: Zwei bislang unidentifizierte Sammelbände Sunthayms verwahrt als Handschriften Nr. 189 und 193 des Schlüsselberg-Archivs das Oberösterreichische Landesarchiv.
SWD-Schlagwörter: Sunthaym, Ladislaus , Leibniz, Gottfried Wilhelm , Welfen
Freie Schlagwörter (deutsch): Wissenschaftsgeschichte der Genealogie
Freie Schlagwörter (englisch): genealogy
Institut: Historisches Seminar
DDC-Sachgruppe: Geschichte
Dokumentart: Aufsatz
Quelle: Leibniz als Sammler und Herausgeber historischer Quellen, hrsg. von Nora Gädeke (Wolfenbütteler Forschungen 129), Wiesbaden 2012, S. 33-47
Sprache: Deutsch
Erstellungsjahr: 2012
Publikationsdatum: 01.10.2012
Bemerkung: Verlags-PDF. Preprint mit Links: Archivalia vom 14. Oktober 2007: http://archiv.twoday.net/stories/4349225/ bzw. Archivversion http://www.webcitation.org/5xQyrF4hi
***
Passend dazu teile ich den von mir für die NDB geschriebenen Artikel über Sunthaim mit (in der von mir eingereichten, nicht redigierten Fassung):
Sunthaym, Ladislaus, Historiograph, Genealoge und Geograph
* um 1440 in Ravensburg
+ wohl um den 1. Februar 1513 in Wien
Der aus einer Ravensburger Bürgersfamilie stammende S. begegnet
erstmals 1460 in der Wiener Universitätsmatrikel. 1465 Baccalaureus geworden, schlug er in Wien eine Klerikerlaufbahn ein. Bevor er 1504 ein Kanonikat am Stephansdom erhielt, versorgten ihn drei Messpfründen an der gleichen Kirche. Seit 1500 erhielt er finanzielle Zuwendungen als Historiograph und "cronickmaister" Maximilians I.
Aufgrund seiner fundierten genealogischen Forschungen war S. zunächst der führende Kopf des Gelehrtenkreises, der gemeinsam mit dem Herrscher das singuläre Ruhmes- und Erinnerungswerk Maximilians konzipierte. Ab 1505 verdrängte ihn der für kühnere genealogische Konstruktionen aufgeschlossenere Jurist Jakob Mennel aus dieser Position. Zwei große Interessensgebiete bestimmten S.s Studien: die landesbeschreibende Geographie und die Genealogie des Adels. Wenn es an Geld und Schreibern nicht fehle, schrieb er 1503 an Matthäus Lang, wolle er sich beeilen, sein Wissen in zwei Büchern zusammenzufassen, das eine vom Adel, das andere von Ländern, Städten, Klöstern und Flüssen.
S.s Werke liegen vor allem in mehreren Sammelhandschriften vor. Die wohl weitgehend auf ausgedehnten eigenen Reisen fußende Beschreibung oberdeutscher Regionen (um 1500) in den Stuttgarter Codices hist. 2° 250 und 249 liefern überwiegend nüchterne topographisch-statistische Notizen, die aber immer wieder mit reizvollen Beobachtungen angereichert werden. Sie waren für Sebastian Münsters Kosmographie (Erstausgabe 1544) eine
wichtige Quelle. Die geographischen Arbeiten S.s, zu denen auch eine auf seine Materialien zurückgehende Beschreibung Österreichs gezählt werden darf, sind zu sehen vor dem Hintergrund der
kosmographisch-ethnographischen Darstellungen des Humanismus und des ambitionierten Plans von Konrad Celtis einer "Germania illustrata". Mit dem Poeten Celtis verband S. ein enges, wenn auch
nicht immer konfliktfreies Verhältnis.
Wie Mennel und Matthäus Marschalk von Pappenheim kann S. als Pionier der "modernen" Genealogie gelten. In einer Zeit, die noch keine genealogischen Nachschlagewerke kannte, war es eine große Leistung, Ordnung in die Stammfolgen mitteleuropäischer Dynastien zu bringen (neben den Habsburgern dokumentieren die Sammelbände z.B. auch die Welfen, Wittelsbacher und Württemberger). Bereits die anlässlich der Heiligsprechung des Babenbergerherzogs Leopold 1485 für das Stift
Klosterneuburg verfasste Babenberger-Genealogie "Tabulae
Claustroneoburgenses" (1491 anonym in Basel gedruckt) demonstrieren S.s Kennerschaft im Umgang mit der hochmittelalterlichen Quellenüberlieferung.
S. gehörte zum neuen Typ des "reisenden Historikers" (F. Eheim), der insbesondere in klösterlichen Bibliotheken und Archiven auf
Quellensuche ging. Integriert in die Wiener humanistische Sodalitas,
kann S. doch nicht als Humanist betrachtet werden, wählt man den
programmatischen Bezug auf die Antike als Kriterium. Seine
historischen Studien ordnen ihn vielmehr den ausgeprägten
retrospektiven Strömungen der Zeit um 1500 zu, wie sie damals nicht nur am deutschen Königshof gepflegt wurden, sondern auch im
"monastischen Historismus" reformierter Benediktinerklöster (mit
Johannes Trithemius an der Spitze) und im Kontext der ritterlichen
Altertümern nachspürenden "Ritter-Renaissance" (z.B. im Wappenbuch Konrad Grünenbergs).
Werke: A. F. Oefele, Rerum Boicarum Scriptores, Bd. 2, 1763, S.
557-644; K. Uhde, Ladislaus Sunthayms geographisches Werk und seine Rezeption durch Sebastian Münster. 1-2. 1993
Literatur: ADB; ²VL (W. Stelzer); F. Eheim, Ladislaus Sunthaym. Leben und Werk. masch. Diss. Wien 1949, Ders., Ladislaus Sunthaym. Ein Historiker aus dem Gelehrtenkreis um Maximilian I., in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 67 (1959), S. 54-91; R. Perger: Sunthaym-Beiträge, in: Adler 10 (1974/76), S. 224-239; R. Götz,
Wege und Irrwege frühneuzeitlicher Historiographie,
2007, S. 25-32; K. Graf, Gottfried Wilhelm Leibniz, Ladislaus Sunthaim und die süddeutsche Welfen-Historiographie, in: Leibniz als Sammler und Herausgeber historischer Quellen (in Vorb.)
[Druckfassung: Neue Deutsche Biographie 25 (2013), S. 706f.]
 Markgräfin Agnes (aus Sunthaims Klosterneuburger Stammbaum)
Markgräfin Agnes (aus Sunthaims Klosterneuburger Stammbaum)KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 21:41 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die von Abt Peter Gremmelsbach kurz vor 1500 angelegte Handschrift (heute Karlsruhe St. Peter perg. 86) wurde von Dieter Mertens ausführlich analysiert:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2804/
Interessant ist der Fall von St. Peter deshalb, weil die Handschrift zwar für den (von mir sogenannten) "monastischen Historismus" um 1500 steht, St. Peter sich aber von den Reformbewegungen des Benediktinerordens im deutschen Südwesten (Bursfelder und Melker Reform) fernhielt. Mertens zieht vergleichend meine Studien zu Lorch heran und verweist auch auf meine Überlegungen zu Augsburg.
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=ordensreform
Die Texte der Handschrift sind, wie Mertens zeigte, sehr unglücklich ediert. Nun ist der ursprüngliche Überlieferungszusammenhang anhand des Digitalisats auch ohne Einsichtnahme in das Original rekonstruierbar:
http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-28021
Update: Ausführlicher mein Eintrag in:
http://ordensgeschichte.hypotheses.org/315

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2804/
Interessant ist der Fall von St. Peter deshalb, weil die Handschrift zwar für den (von mir sogenannten) "monastischen Historismus" um 1500 steht, St. Peter sich aber von den Reformbewegungen des Benediktinerordens im deutschen Südwesten (Bursfelder und Melker Reform) fernhielt. Mertens zieht vergleichend meine Studien zu Lorch heran und verweist auch auf meine Überlegungen zu Augsburg.
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=ordensreform
Die Texte der Handschrift sind, wie Mertens zeigte, sehr unglücklich ediert. Nun ist der ursprüngliche Überlieferungszusammenhang anhand des Digitalisats auch ohne Einsichtnahme in das Original rekonstruierbar:
http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-28021
Update: Ausführlicher mein Eintrag in:
http://ordensgeschichte.hypotheses.org/315

KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 21:06 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Bibliographie ist anscheinend bereits seit 2003 im Netz, war mir aber bislang entgangen:
http://www.sfn.historicum-archiv.net/materialien/muenchnerdrucke/
Via
http://www.aussichten-online.net/2012/09/2950/
http://www.sfn.historicum-archiv.net/materialien/muenchnerdrucke/
Via
http://www.aussichten-online.net/2012/09/2950/
KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 20:59 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Buch des Monats der UB Salzburg ist ein Rundenbuch aus dem 15. Jahrhundert (ja Rundenbuch ist ein Neologismus von mir).
http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/bdm/bdm1012.htm

http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/bdm/bdm1012.htm

KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 20:56 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/tp/artikel/37/37734/1.html
Telepolis macht auf eine Veranstaltung zum Mainzer Historikertag aufmerksam:
In der Podiumsdiskussion "Zeitgeschichte ohne Ressourcen? Probleme der Nutzung audiovisueller Quellen" kam unter anderem zur Sprache, dass die umfassende Aufbewahrung des aus Gebühren der Bürger bezahlten Materials keineswegs gesichert ist. Tatsächlich prahlten Medienarchivare des ZDF noch in den Nuller Jahren auf Fortbildungsveranstaltungen damit, wie viel ihre Anstalt wegwerfen würde. Und zu dem Material, das sie aufheben, geben die Sender Historikern nur sehr bedingt Zugang. Das hängt auch damit zusammen, dass nur ein winziger Bruchteil des Rundfunkgebührenaufkommens in Höhe von jährlich siebeneinhalb Milliarden Euro in ihre Archive fließt und sich ein großer Teil des dortigen Personals eher als Abwimmler von Bittstellern, denn als Dienstleister versteht. Ob etwas eingesehen werden kann oder nicht, hängt deshalb oft von persönlichen Beziehungen ab.
Solch ein Gebaren ist auch deshalb möglich, weil es der Staat den Sendern bislang erlaubt, den Zugang zu den Archiven nach Gutsherrenart zu gewähren oder zu versagen.
Telepolis macht auf eine Veranstaltung zum Mainzer Historikertag aufmerksam:
In der Podiumsdiskussion "Zeitgeschichte ohne Ressourcen? Probleme der Nutzung audiovisueller Quellen" kam unter anderem zur Sprache, dass die umfassende Aufbewahrung des aus Gebühren der Bürger bezahlten Materials keineswegs gesichert ist. Tatsächlich prahlten Medienarchivare des ZDF noch in den Nuller Jahren auf Fortbildungsveranstaltungen damit, wie viel ihre Anstalt wegwerfen würde. Und zu dem Material, das sie aufheben, geben die Sender Historikern nur sehr bedingt Zugang. Das hängt auch damit zusammen, dass nur ein winziger Bruchteil des Rundfunkgebührenaufkommens in Höhe von jährlich siebeneinhalb Milliarden Euro in ihre Archive fließt und sich ein großer Teil des dortigen Personals eher als Abwimmler von Bittstellern, denn als Dienstleister versteht. Ob etwas eingesehen werden kann oder nicht, hängt deshalb oft von persönlichen Beziehungen ab.
Solch ein Gebaren ist auch deshalb möglich, weil es der Staat den Sendern bislang erlaubt, den Zugang zu den Archiven nach Gutsherrenart zu gewähren oder zu versagen.
KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 20:51 - Rubrik: Medienarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
https://netzpolitik.org/2012/exklusiv-wir-veroffentlichen-das-geheime-gutachten-das-strengere-gesetze-gegen-abgeordnetenbestechung-fordert/
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/64980315/
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/64980315/
KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 20:45 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Gibt es Literatur zum Archivar des Politischen Archivs des Auswärtigen Amtes Werner Frauendienst, später Professor an der Universität Halle? Finde irgendwie nix. Siehe http://www.catalogus-professorum-halensis.de/frauendienstwerner.html
ThomasJust - am Montag, 1. Oktober 2012, 20:37 - Rubrik: Archivgeschichte
http://www.youtube.com/watch?v=ZTXu2S8HCqo
YouTube bietet anscheinend den bislang hier allein funktionierenden alten Einbettungscode nicht mehr an, es können also nicht mehr YouTube-Videos in Archivalia eingebettet werden :-( Falls jemand das Problem lösen kann, Hinweise sind willkommen.
Via
http://www.philipvickersfithian.com/2012/09/a-song-about-archives.html
YouTube bietet anscheinend den bislang hier allein funktionierenden alten Einbettungscode nicht mehr an, es können also nicht mehr YouTube-Videos in Archivalia eingebettet werden :-( Falls jemand das Problem lösen kann, Hinweise sind willkommen.
Via
http://www.philipvickersfithian.com/2012/09/a-song-about-archives.html
KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 17:26 - Rubrik: Unterhaltung
Seit mehr als 125 Jahren bietet das Stadtarchiv Karlsruhe Platz für Dokumente. Doch in letzter Zeit wurde es etwas eng im Archiv. Zeit für eine Erweiterung. Präsentiert von Videovalis
s. a. http://www.karlsruhe.de/b1/stadtgeschichte/stadtarchiv/presse/aufbaubnn2012.de
Wolf Thomas - am Montag, 1. Oktober 2012, 12:00 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die PPT-Folien des "Praxisberichts" stehen ab heute online zum Nachlesen zur Verfügung:
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Verzeichnung, Personal
Die Ordnung und Erschließung ist seit dem Umzug von 2008 nicht zum Abschluss gebracht worden. Die physische Archivierung wurde offenbar bislang durch Studenten während der Sommersemesterferien vorgenommen. Wegen der noch ausstehenden Erschließungsarbeiten ist das Archiv weiterhin nur auf Anfrage zugänglich; man scheint allgemein hilfsbereit zu sein. Steigende Nachfrage sei vor allem durch Studenten zu bemerken, die, wenn sie sich nun auf Stipendien im Ausland bewerben, offenbar mehr mit Primärquellen arbeiten, als das früher der Fall war. Während der Kämpfe von 2011 blieb das Archiv ganz geschlossen; seither hat kein ausländischer Forscher die Bestände benutzt.
Unter den insgesamt zehn Beschäftigten der Archivabteilung verfügt niemand über eine Fachausbildung. Von einer Person, die sich zu diesem Zweck seit 2010 in Italien aufhält, ist unsicher, ob sie nach Libyen und in den Beruf zurückkehrt, hieß es. Maßgeblich sind auch Probleme mit den insgesamt fünf Verwaltungssprachen der letzten drei Jahrhunderte. Zur Zeit der Karamanli-Dynastie (1711–1835) wurde französisch und türkisch ("osmanisch") geschrieben, mit der osmanischen Wiederbesetzung des Landes 1835 wurde Türkisch Verwaltungssprache, dann folgten Italienisch, Englisch und Arabisch. Im Archiv spricht niemand Türkisch; zuletzt ordnete ein türkischer Archivar 2010 in zwei zweimonatigen Missionen entsprechendes Schriftgut.
Zwei Fälle jüdischen Schriftguts
Das Archiv befindet sich im Besitz von etwa 80 Pergamenten mit Texten in hebräischer Sprache unbekannten Inhalts, ferner einiger Tora-Rollen. Sie wurden aus der Burg übernommen. Ihr Erhaltungszustand ist schlecht, viele sind eingefaltet oder geknautscht und können ohne Bruchgefahr nicht geglättet werden. Sie liegen in einem eigenen Schrank in einigen Stapeln aufeinander und werden derzeit nicht bewegt, um weitere Beschädigungen zu vermeiden. Es gibt keinerlei Hilfsmittel für eine angemessene konservatorische Behandlung. Außer für die bereits beschriebenen 30 lfdm beschädigten Papierschriftguts herrscht auch hier Handlungsbedarf.
Als das Archiv 2008 in das Gebäude des Zentrums zog, fand sich dort die schriftliche Überlieferung der jüdischen Gemeinde von Tripolis, deren letzte 6000 Mitglieder 1967, nach dem Sechstagekrieg in Israel und antisemitischen Ausschreitungen in Tripoli, das Land Richtung Italien verließen. Diese Archivalien sind in ungefähr 200 Schachteln verpackt, die gegen Entnahmen mit Plastikband verklebt sind; der Umfang mag 75 lfdm entsprechen. Der Inhalt ist vollständig unbekannt; es ist auch unklar, ob es sich um das Schriftgut einer jüdischen Institution oder um hinterlassene Papiere aus Privatbesitz handelt. Gleichfalls gibt es keine Information darüber, ob in diesem Bestand (Bezeichnung: IB für ibraico) je geforscht worden ist.
Weitere Abteilungen des Zentrums
Zwei Abteilungen des Zentrums beschäftigen sich mit Libyana in auswärtigen Archiven. So werden z. B. Gesandtschaftsberichte, Unterlagen militärischer Dienststellen und Schifffahrtsakten gesucht. Eine Abteilung ist für europäische Archive zuständig, die andere für arabische. Es liegen je über eine Million Blatt vor, teils auf Mikrofilm, teils als Fotokopie. Die Übersetzungs- und Veröffentlichungstätigkeit ist rege; so erschienen 1991 ein und 2005 zwei deutsch-arabische Bände mit deutschen Archivalien von 1911-1917, also aus der Zeit der italienischen Eroberung und des Ersten Weltkriegs. Die beiden Bände von 2005, ISBN 9959-23-097-X und 9959-23-098-8, sind via KVK und Worldcat nicht nachweisbar, also zumindest in den großen Bibliotheken des deutschen Sprachraums wohl nicht vorhanden.
Das Fotoarchiv verfügt über 100.000 Aufnahmen seit 1911 als Negative und Positive. Sie werden seit den 1980er Jahren gesammelt. Die konservatorisch-technische Ausstattung ist nach Aussage der dort Tätigen unzureichend; 70 Prozent des Bestandes ist gescannt.
Die Abteilung für mündliche Überlieferung hat mehr als 8000 Tonband-Cassetten mit Interviews gesammelt. Ab 1979 auf Erinnerungen an den Widerstand gegen die italienische Kolonialmacht fokussiert, sind die Interviews nun thematisch breiter angelegt, doch hat dieser Forschungszweig stark an Intensität verloren. Beim Besuch wurde gerade der einzige neue Eingang der Woche erfasst, die Erinnerungen eines alten Mannes an die französische Besatzung in der südlibyschen Stadt Ghat ab 1943. Mehr als die Hälfte der Interviews liegen in fast 50 Bänden ediert vor, der Bestand ist komplett auf CD gesichert.
Die Handschriftenabteilung verfügt über 10.000 Manuskripte ab dem 14. Jahrhundert, alle mikroverfilmt, meist religiöse Literatur im Original oder in Abschrift. Es handelt sich zu 99 Prozent um arabische Texte, einige wenige osmanische und hebräische. Der 4. Band des Bestandskataloges befindet sich in Druck. Die Unterbringung in lackbehandelten Holzregalen hinter einer Art Plastikfurnier ist prekär.
Die Bibliothek hat 28.000 Bände in arabischer Sprache und 14.000 in anderen Sprachen. Es werden 750 arabischsprachige Zeitschriften und weitere in anderen Sprachen gehalten.
Schlussbemerkung
Vorstehendes Material ist Ergebnis zweier jeweils dreistündiger Besuche. Der Autor ist besonders der Archivleiterin Fatma Baghni für ihre Auskunftsbereitschaft und seinem Übersetzer Ali Arajshi für dessen Geduld verpflichtet. Es wäre erstaunlich, wenn nicht wenigstens in der italienischen Fachliteratur Weiteres über das Archiv in Erfahrung zu bringen wäre. Ergänzungen und Kommentierungen von Lesern werden also begrüßt.
Dietmar Bartz, Tripolis, 1. Oktober 2012
Die Ordnung und Erschließung ist seit dem Umzug von 2008 nicht zum Abschluss gebracht worden. Die physische Archivierung wurde offenbar bislang durch Studenten während der Sommersemesterferien vorgenommen. Wegen der noch ausstehenden Erschließungsarbeiten ist das Archiv weiterhin nur auf Anfrage zugänglich; man scheint allgemein hilfsbereit zu sein. Steigende Nachfrage sei vor allem durch Studenten zu bemerken, die, wenn sie sich nun auf Stipendien im Ausland bewerben, offenbar mehr mit Primärquellen arbeiten, als das früher der Fall war. Während der Kämpfe von 2011 blieb das Archiv ganz geschlossen; seither hat kein ausländischer Forscher die Bestände benutzt.
Unter den insgesamt zehn Beschäftigten der Archivabteilung verfügt niemand über eine Fachausbildung. Von einer Person, die sich zu diesem Zweck seit 2010 in Italien aufhält, ist unsicher, ob sie nach Libyen und in den Beruf zurückkehrt, hieß es. Maßgeblich sind auch Probleme mit den insgesamt fünf Verwaltungssprachen der letzten drei Jahrhunderte. Zur Zeit der Karamanli-Dynastie (1711–1835) wurde französisch und türkisch ("osmanisch") geschrieben, mit der osmanischen Wiederbesetzung des Landes 1835 wurde Türkisch Verwaltungssprache, dann folgten Italienisch, Englisch und Arabisch. Im Archiv spricht niemand Türkisch; zuletzt ordnete ein türkischer Archivar 2010 in zwei zweimonatigen Missionen entsprechendes Schriftgut.
Zwei Fälle jüdischen Schriftguts
Das Archiv befindet sich im Besitz von etwa 80 Pergamenten mit Texten in hebräischer Sprache unbekannten Inhalts, ferner einiger Tora-Rollen. Sie wurden aus der Burg übernommen. Ihr Erhaltungszustand ist schlecht, viele sind eingefaltet oder geknautscht und können ohne Bruchgefahr nicht geglättet werden. Sie liegen in einem eigenen Schrank in einigen Stapeln aufeinander und werden derzeit nicht bewegt, um weitere Beschädigungen zu vermeiden. Es gibt keinerlei Hilfsmittel für eine angemessene konservatorische Behandlung. Außer für die bereits beschriebenen 30 lfdm beschädigten Papierschriftguts herrscht auch hier Handlungsbedarf.
Als das Archiv 2008 in das Gebäude des Zentrums zog, fand sich dort die schriftliche Überlieferung der jüdischen Gemeinde von Tripolis, deren letzte 6000 Mitglieder 1967, nach dem Sechstagekrieg in Israel und antisemitischen Ausschreitungen in Tripoli, das Land Richtung Italien verließen. Diese Archivalien sind in ungefähr 200 Schachteln verpackt, die gegen Entnahmen mit Plastikband verklebt sind; der Umfang mag 75 lfdm entsprechen. Der Inhalt ist vollständig unbekannt; es ist auch unklar, ob es sich um das Schriftgut einer jüdischen Institution oder um hinterlassene Papiere aus Privatbesitz handelt. Gleichfalls gibt es keine Information darüber, ob in diesem Bestand (Bezeichnung: IB für ibraico) je geforscht worden ist.
Weitere Abteilungen des Zentrums
Zwei Abteilungen des Zentrums beschäftigen sich mit Libyana in auswärtigen Archiven. So werden z. B. Gesandtschaftsberichte, Unterlagen militärischer Dienststellen und Schifffahrtsakten gesucht. Eine Abteilung ist für europäische Archive zuständig, die andere für arabische. Es liegen je über eine Million Blatt vor, teils auf Mikrofilm, teils als Fotokopie. Die Übersetzungs- und Veröffentlichungstätigkeit ist rege; so erschienen 1991 ein und 2005 zwei deutsch-arabische Bände mit deutschen Archivalien von 1911-1917, also aus der Zeit der italienischen Eroberung und des Ersten Weltkriegs. Die beiden Bände von 2005, ISBN 9959-23-097-X und 9959-23-098-8, sind via KVK und Worldcat nicht nachweisbar, also zumindest in den großen Bibliotheken des deutschen Sprachraums wohl nicht vorhanden.
Das Fotoarchiv verfügt über 100.000 Aufnahmen seit 1911 als Negative und Positive. Sie werden seit den 1980er Jahren gesammelt. Die konservatorisch-technische Ausstattung ist nach Aussage der dort Tätigen unzureichend; 70 Prozent des Bestandes ist gescannt.
Die Abteilung für mündliche Überlieferung hat mehr als 8000 Tonband-Cassetten mit Interviews gesammelt. Ab 1979 auf Erinnerungen an den Widerstand gegen die italienische Kolonialmacht fokussiert, sind die Interviews nun thematisch breiter angelegt, doch hat dieser Forschungszweig stark an Intensität verloren. Beim Besuch wurde gerade der einzige neue Eingang der Woche erfasst, die Erinnerungen eines alten Mannes an die französische Besatzung in der südlibyschen Stadt Ghat ab 1943. Mehr als die Hälfte der Interviews liegen in fast 50 Bänden ediert vor, der Bestand ist komplett auf CD gesichert.
Die Handschriftenabteilung verfügt über 10.000 Manuskripte ab dem 14. Jahrhundert, alle mikroverfilmt, meist religiöse Literatur im Original oder in Abschrift. Es handelt sich zu 99 Prozent um arabische Texte, einige wenige osmanische und hebräische. Der 4. Band des Bestandskataloges befindet sich in Druck. Die Unterbringung in lackbehandelten Holzregalen hinter einer Art Plastikfurnier ist prekär.
Die Bibliothek hat 28.000 Bände in arabischer Sprache und 14.000 in anderen Sprachen. Es werden 750 arabischsprachige Zeitschriften und weitere in anderen Sprachen gehalten.
Schlussbemerkung
Vorstehendes Material ist Ergebnis zweier jeweils dreistündiger Besuche. Der Autor ist besonders der Archivleiterin Fatma Baghni für ihre Auskunftsbereitschaft und seinem Übersetzer Ali Arajshi für dessen Geduld verpflichtet. Es wäre erstaunlich, wenn nicht wenigstens in der italienischen Fachliteratur Weiteres über das Archiv in Erfahrung zu bringen wäre. Ergänzungen und Kommentierungen von Lesern werden also begrüßt.
Dietmar Bartz, Tripolis, 1. Oktober 2012
Dietmar Bartz - am Montag, 1. Oktober 2012, 08:38 - Rubrik: Internationale Aspekte
In den letzten Tagen ergab sich die Gelegenheit zu zwei kurzfristig organisierbaren Besuchen im libyschen Nationalarchiv in Tripolis. Auch wenn die mitgeteilten Fakten nur auf Interviews beruhen und nicht gegengecheckt wurden, mögen sie ein Bild der Lage dieses nur wenigen Kollegen bekannten Archives zeichnen. Es wurde auch keine Literatur aus europäischen Fachveröffentlichungen über das Nationalarchiv herangezogen – nach Auskunft von libyscher Seite gibt es keine.
Es herrschte Fotografierverbot auch hinsichtlich banaler Motive wie Archivboxen oder Urkunden, obwohl im Mai noch Filmaufnahmen für den Fernsehsender al-Jazira im Magazin möglich waren (s. u.). Der Besucher ist geneigt, dies im Zusammenhang mit der neuerlichen Schließung aller Museen in Libyen zu sehen. Beim derzeitigen Machtkampf zwischen Regierung und Milizen wird befürchtet, dass Unruhen zu gezielten Diebstählen in Gedächtniseinrichtungen genutzt werden können. Aus diesem Grund werden hier auch keine Sicherheitseinrichtungen des Archivs erörtert.
Zur Terminologie: Die Bezeichnung für den Krieg von 2011, mit dem die Libyer das mehr als 40 Jahre andauernde Regime des Machthabers Gaddafi stürzten, lautet allgemein "die Revolution". Die Bezeichnung ist hier übernommen.
Archivgeschichte
Das Nationalarchiv gehörte bis 2008 institutionell zum Libyschen Nationalmuseum mit seiner reichen archäologischen Überlieferung und einem großem Interesse von Forschern und touristischen Besuchern. In einem Nebenbereich der alten Burg untergebracht, die das Museum beherbergt, ist das Archiv vernachlässigt worden. Ein Raum mit historischem Schriftgut existierte dort offenbar schon 1928, als die neue italienische Kolonialmacht das Museum einrichtete. Eine etwa zehnseitige Bestandsübersicht des "historischen Archivs" mit Tabellen über die Umfänge von allgemeinem Schriftgut sowie Gerichts- und Steuerakten, wie er sie 2008 vorfand, veröffentlichte der libysche Historiker Mohamed Altaher Arebi im Rahmen einer Einführung in die Archivkunde, die 2010 in Bengasi erschien (196 S.); der Verfasser starb 2011. Zum "historischen Archiv" aus der Burg sind nach dem Umzug nur wenige neue Bestände hinzugekommen.
Institutionelle Einbindung
Ein zunehmendes Interesse an landesgeschichtlichen Fragen führte zu einer Änderung der Zuständigkeit. Ende 2008 zog das Archiv physisch und organisatorisch um. Es ist seither eine Abteilung des zum Kulturministerium gehörenden "Center for National Archives and Historical Studies". Diese Geschichtseinrichtung ging nach der Revolution aus einer 1978 gegründeten Forschungseinrichtung über den "Libyschen Djihad", den Kampf gegen die italienischen Kolonialherren ab 1911, hervor. Sie ist die zentrale Instanz für die historische Forschung und die Veröffentlichung historiografischer Literatur. Das Zentrum bemüht sich jetzt sehr, dem Eindruck entgegenzutreten, es habe Auftragsforschung im Interesse des Regimes betrieben.
Eine umfangreiche Veröffentlichung zum 25-jährigen Jubiläum (2003) des Zentrums liegt in arabischer Sprache vor (330 S., 27 Abb.); allerdings war es zu dieser Zeit noch nicht für das Archiv zuständig. Eine in Veröffentlichungen des Zentrums gelegentlich zu lesende Internet-Adresse "http://www.libsc.org" ist falsch, richtig ist http://www.libsc.org.ly. Die Webpräsenz ist nur auf Arabisch verfasst, automatisierte Sprachübersetzung ins Deutsche, Englische und zahlreiche andere Sprachen ist anwählbar und begrenzt hilfreich. Dort ist auch ein Youtube-Video über das Zentrum verlinkt, das ein arabischsprachiges Fernsehporträt des Senders Al Jazira vom Mai 2012 zeigt. Angemerkt sei, dass 80 Prozent meiner Gesprächspartner(innen) weiblich waren, während im Video keine Frau zu Wort kommt.
Umfang, Lagerung, Erhaltungszustand
Der Umfang des Archivs wird mit 1508 Regalmetern angegeben; das älteste bisher aufgefundene Dokument datiert von 1727. Die Bestände sind einerseits zeitlich geordnet: präkolonial (bis 1835), osmanisch (bis 1911), italienisch (bis 1943), britische Militärverwaltung (bis 1951), Königreich (bis 1969) und Dschamahirija (nur kleine Bestände); der Bestand Königreich trägt die Bezeichnung ID für König Idris, eine Sympathiebezeugung für den Monarchen. Große gesonderte Gruppen bestehen aus über zeitgenössische Registerbücher erschlossene Gerichts- und Steuerakten. Die einzige vom Umfang her nennenswerte Ablieferung nach dem Umzug erfolgte durch den Gerichtshof in Tripoli.
Ein großer Teil der Archivalien wird in Halbkompaktusanlagen in stabilen Archivklappboxen italienischer Provenienz überwiegend stehend aufbewahrt. Die Archivalien selbst zeigten sich, soweit willkürlich um die Öffnung solcher Boxen gebeten wurde, entmetallisiert, in Pappen eingeschlagen, teils mit Baumwoll-, teils mit Plastikbändern verknotet (es wurde extra auf den Mangel an Baumwollbändern hingewiesen) und beschriftet. Das Magazin ist klimatisiert. Die Arbeiten zur Errichtung weiterer Halbkompaktusanlagen mit einer Kapazitätserweiterung um 20 Prozent wurden mit dem Beginn des Aufstandes gegen Gaddafi im Februar 2011 abgebrochen, als die Monteure Tripolis verließen. Die Arbeiten ruhen seither, die Bauteile liegen bereit.
Etwa 30 Regalmeter beträgt der Umfang von stark und sehr stark beschädigten Archivalien, die in solchen Boxen – gleichfalls in problematischer Stehendaufbewahrung – stabilisiert sind. Die betroffenen Schriftstücke reichen vom 18. Jahrhundert bis nach 1950. Die Schäden gehen überwiegend auf Feuchtigkeit zurück. Es gibt im Archiv keinerlei Gerätschaft, auch kein Hygrometer, und keinerlei Kenntnis im konservatorischen Umgang mit den Schäden.
Über Schriftgutverluste im 20. Jahrhundert innerhalb des Archives wurde nichts mitgeteilt. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Archiv offenbar unbeschädigt, ebenso die militärischen Auseinandersetzungen des Jahres 2011. Über Verluste archivreifen Schriftguts in Behördenregistraturen des 20. Jahrhunderts scheint kein Überblick zu bestehen; über Verluste durch die Kämpfe während der Revolution und über die Vernichtung von Akten der Repressionsorgane konnte nichts in Erfahrung gebracht werden. Alles Verwaltungsschriftgut bis 1969 unterliegt der Abgabepflicht an das Archiv; für die Ablieferungen ist ein Ausschuss zuständig. 2010 fand mit Unterstützung aus Italien ein fünftägiger Kurs statt, in dem Verantwortliche für die Registraturen in den Ministerien geschult wurden. Es scheint seit dem Sturz Gaddafis ein Problem damit zu geben, Behörden zur Abgabe von Akten zu bewegen, weil durch den Zutritt zu Registraturen eine Verschleierung von Schandtaten des alten Regimes befürchtet wird.
Der TV-Sender Al Jazira porträtierte im Mai 2012 das libysche Nationalarchiv und andere Abteilungen des Center for National Archives and Historical Studies:
http://www.youtube.com/watch?v=A67IZTbUOVU
Es herrschte Fotografierverbot auch hinsichtlich banaler Motive wie Archivboxen oder Urkunden, obwohl im Mai noch Filmaufnahmen für den Fernsehsender al-Jazira im Magazin möglich waren (s. u.). Der Besucher ist geneigt, dies im Zusammenhang mit der neuerlichen Schließung aller Museen in Libyen zu sehen. Beim derzeitigen Machtkampf zwischen Regierung und Milizen wird befürchtet, dass Unruhen zu gezielten Diebstählen in Gedächtniseinrichtungen genutzt werden können. Aus diesem Grund werden hier auch keine Sicherheitseinrichtungen des Archivs erörtert.
Zur Terminologie: Die Bezeichnung für den Krieg von 2011, mit dem die Libyer das mehr als 40 Jahre andauernde Regime des Machthabers Gaddafi stürzten, lautet allgemein "die Revolution". Die Bezeichnung ist hier übernommen.
Archivgeschichte
Das Nationalarchiv gehörte bis 2008 institutionell zum Libyschen Nationalmuseum mit seiner reichen archäologischen Überlieferung und einem großem Interesse von Forschern und touristischen Besuchern. In einem Nebenbereich der alten Burg untergebracht, die das Museum beherbergt, ist das Archiv vernachlässigt worden. Ein Raum mit historischem Schriftgut existierte dort offenbar schon 1928, als die neue italienische Kolonialmacht das Museum einrichtete. Eine etwa zehnseitige Bestandsübersicht des "historischen Archivs" mit Tabellen über die Umfänge von allgemeinem Schriftgut sowie Gerichts- und Steuerakten, wie er sie 2008 vorfand, veröffentlichte der libysche Historiker Mohamed Altaher Arebi im Rahmen einer Einführung in die Archivkunde, die 2010 in Bengasi erschien (196 S.); der Verfasser starb 2011. Zum "historischen Archiv" aus der Burg sind nach dem Umzug nur wenige neue Bestände hinzugekommen.
Institutionelle Einbindung
Ein zunehmendes Interesse an landesgeschichtlichen Fragen führte zu einer Änderung der Zuständigkeit. Ende 2008 zog das Archiv physisch und organisatorisch um. Es ist seither eine Abteilung des zum Kulturministerium gehörenden "Center for National Archives and Historical Studies". Diese Geschichtseinrichtung ging nach der Revolution aus einer 1978 gegründeten Forschungseinrichtung über den "Libyschen Djihad", den Kampf gegen die italienischen Kolonialherren ab 1911, hervor. Sie ist die zentrale Instanz für die historische Forschung und die Veröffentlichung historiografischer Literatur. Das Zentrum bemüht sich jetzt sehr, dem Eindruck entgegenzutreten, es habe Auftragsforschung im Interesse des Regimes betrieben.
Eine umfangreiche Veröffentlichung zum 25-jährigen Jubiläum (2003) des Zentrums liegt in arabischer Sprache vor (330 S., 27 Abb.); allerdings war es zu dieser Zeit noch nicht für das Archiv zuständig. Eine in Veröffentlichungen des Zentrums gelegentlich zu lesende Internet-Adresse "http://www.libsc.org" ist falsch, richtig ist http://www.libsc.org.ly. Die Webpräsenz ist nur auf Arabisch verfasst, automatisierte Sprachübersetzung ins Deutsche, Englische und zahlreiche andere Sprachen ist anwählbar und begrenzt hilfreich. Dort ist auch ein Youtube-Video über das Zentrum verlinkt, das ein arabischsprachiges Fernsehporträt des Senders Al Jazira vom Mai 2012 zeigt. Angemerkt sei, dass 80 Prozent meiner Gesprächspartner(innen) weiblich waren, während im Video keine Frau zu Wort kommt.
Umfang, Lagerung, Erhaltungszustand
Der Umfang des Archivs wird mit 1508 Regalmetern angegeben; das älteste bisher aufgefundene Dokument datiert von 1727. Die Bestände sind einerseits zeitlich geordnet: präkolonial (bis 1835), osmanisch (bis 1911), italienisch (bis 1943), britische Militärverwaltung (bis 1951), Königreich (bis 1969) und Dschamahirija (nur kleine Bestände); der Bestand Königreich trägt die Bezeichnung ID für König Idris, eine Sympathiebezeugung für den Monarchen. Große gesonderte Gruppen bestehen aus über zeitgenössische Registerbücher erschlossene Gerichts- und Steuerakten. Die einzige vom Umfang her nennenswerte Ablieferung nach dem Umzug erfolgte durch den Gerichtshof in Tripoli.
Ein großer Teil der Archivalien wird in Halbkompaktusanlagen in stabilen Archivklappboxen italienischer Provenienz überwiegend stehend aufbewahrt. Die Archivalien selbst zeigten sich, soweit willkürlich um die Öffnung solcher Boxen gebeten wurde, entmetallisiert, in Pappen eingeschlagen, teils mit Baumwoll-, teils mit Plastikbändern verknotet (es wurde extra auf den Mangel an Baumwollbändern hingewiesen) und beschriftet. Das Magazin ist klimatisiert. Die Arbeiten zur Errichtung weiterer Halbkompaktusanlagen mit einer Kapazitätserweiterung um 20 Prozent wurden mit dem Beginn des Aufstandes gegen Gaddafi im Februar 2011 abgebrochen, als die Monteure Tripolis verließen. Die Arbeiten ruhen seither, die Bauteile liegen bereit.
Etwa 30 Regalmeter beträgt der Umfang von stark und sehr stark beschädigten Archivalien, die in solchen Boxen – gleichfalls in problematischer Stehendaufbewahrung – stabilisiert sind. Die betroffenen Schriftstücke reichen vom 18. Jahrhundert bis nach 1950. Die Schäden gehen überwiegend auf Feuchtigkeit zurück. Es gibt im Archiv keinerlei Gerätschaft, auch kein Hygrometer, und keinerlei Kenntnis im konservatorischen Umgang mit den Schäden.
Über Schriftgutverluste im 20. Jahrhundert innerhalb des Archives wurde nichts mitgeteilt. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Archiv offenbar unbeschädigt, ebenso die militärischen Auseinandersetzungen des Jahres 2011. Über Verluste archivreifen Schriftguts in Behördenregistraturen des 20. Jahrhunderts scheint kein Überblick zu bestehen; über Verluste durch die Kämpfe während der Revolution und über die Vernichtung von Akten der Repressionsorgane konnte nichts in Erfahrung gebracht werden. Alles Verwaltungsschriftgut bis 1969 unterliegt der Abgabepflicht an das Archiv; für die Ablieferungen ist ein Ausschuss zuständig. 2010 fand mit Unterstützung aus Italien ein fünftägiger Kurs statt, in dem Verantwortliche für die Registraturen in den Ministerien geschult wurden. Es scheint seit dem Sturz Gaddafis ein Problem damit zu geben, Behörden zur Abgabe von Akten zu bewegen, weil durch den Zutritt zu Registraturen eine Verschleierung von Schandtaten des alten Regimes befürchtet wird.
Der TV-Sender Al Jazira porträtierte im Mai 2012 das libysche Nationalarchiv und andere Abteilungen des Center for National Archives and Historical Studies:
http://www.youtube.com/watch?v=A67IZTbUOVU
Dietmar Bartz - am Montag, 1. Oktober 2012, 00:10 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Aus der Liste EXLIBRIS:
May I encourage members of the list to drawn the attention of their contacts to the appeal for donations that has been launched to help the French State acquire the manuscripts of Émilie Du Châtelet and Voltaire that will be sold at auction in Paris by Christie's on 29 October?
The appeal, undertaken with the approval of the Archives de France and the Bibliothèque nationale de France, aims to assist public libraries and archives in France to preempt at the sale. All contributions received will be made over to the public bodies able to make purchases on 29 October. Payments made will not be banked until after the sale.
Substantial tax credits are available to those paying tax in France and all donors may appear, if they wish, on the published list of donors.
Donations play a double role, financial and moral. All contributions, at whatever level, support the decisions that must soon be taken by those who will determine the public funding available.
Donations can be made by French cheque, Visa or Mastercard, bank transfer (all charges at the expense of the donor, please) and by Pay Pal.
These links may be useful:
– Presentation of the appeal and of the discovery of the manuscripts : http://fonds-voltaire.org/index.php/patrimoine/cirey
– Make a donation : http://fonds-voltaire.org/edc1
– An article on the history of the manuscripts, due to appear on 12 October in the "Cahiers Voltaire" 11 : http://fonds-voltaire.org/edc1/cv11-brown.pdf
– PDF of the appeal (colour or mono) to be distributed or printed : http://fonds-voltaire.org/index.php/patrimoine/cirey/edc-doc
– Banners for your web site linking to the appeal : http://fonds-voltaire.org/index.php/patrimoine/cirey/edc-doc
– The sale catalogue should soon be available at http://christies.com
With thanks for all that you can do to pass the word.
Andrew Brown
Président
Fonds de dotation Voltaire
26 Grand'rue, F-01210 Ferney-Voltaire
In der Tat eine sensationelle Entdeckung, denn Émilie Du Châtelet war eine der wichtigsten Wissenschaftlerinnen des 18. Jahrhunderts. Das Schlossarchiv Cirey ist im Departementalarchiv in Chaumont gelandet, über die ebenfalls wieder aufgetauchte Bibliothek erfährt man aus den oben verlinkten Quellen nichts.
Katalog der Versteigerung:
http://fonds-voltaire.org/images/edc-catalogue.pdf
Es ist ein Unding, dass diese miesen Verscherbeler (sei es Eigentümer, sei es Christie's) den Nachlass in Einzelstücken versteigern wollen. Man kann nur hoffen, dass genügend Geld zusammenkommt für einen Erwerb en bloc.
Wozu gibt es eigentlich einen Denkmalschutz?

May I encourage members of the list to drawn the attention of their contacts to the appeal for donations that has been launched to help the French State acquire the manuscripts of Émilie Du Châtelet and Voltaire that will be sold at auction in Paris by Christie's on 29 October?
The appeal, undertaken with the approval of the Archives de France and the Bibliothèque nationale de France, aims to assist public libraries and archives in France to preempt at the sale. All contributions received will be made over to the public bodies able to make purchases on 29 October. Payments made will not be banked until after the sale.
Substantial tax credits are available to those paying tax in France and all donors may appear, if they wish, on the published list of donors.
Donations play a double role, financial and moral. All contributions, at whatever level, support the decisions that must soon be taken by those who will determine the public funding available.
Donations can be made by French cheque, Visa or Mastercard, bank transfer (all charges at the expense of the donor, please) and by Pay Pal.
These links may be useful:
– Presentation of the appeal and of the discovery of the manuscripts : http://fonds-voltaire.org/index.php/patrimoine/cirey
– Make a donation : http://fonds-voltaire.org/edc1
– An article on the history of the manuscripts, due to appear on 12 October in the "Cahiers Voltaire" 11 : http://fonds-voltaire.org/edc1/cv11-brown.pdf
– PDF of the appeal (colour or mono) to be distributed or printed : http://fonds-voltaire.org/index.php/patrimoine/cirey/edc-doc
– Banners for your web site linking to the appeal : http://fonds-voltaire.org/index.php/patrimoine/cirey/edc-doc
– The sale catalogue should soon be available at http://christies.com
With thanks for all that you can do to pass the word.
Andrew Brown
Président
Fonds de dotation Voltaire
26 Grand'rue, F-01210 Ferney-Voltaire
In der Tat eine sensationelle Entdeckung, denn Émilie Du Châtelet war eine der wichtigsten Wissenschaftlerinnen des 18. Jahrhunderts. Das Schlossarchiv Cirey ist im Departementalarchiv in Chaumont gelandet, über die ebenfalls wieder aufgetauchte Bibliothek erfährt man aus den oben verlinkten Quellen nichts.
Katalog der Versteigerung:
http://fonds-voltaire.org/images/edc-catalogue.pdf
Es ist ein Unding, dass diese miesen Verscherbeler (sei es Eigentümer, sei es Christie's) den Nachlass in Einzelstücken versteigern wollen. Man kann nur hoffen, dass genügend Geld zusammenkommt für einen Erwerb en bloc.
Wozu gibt es eigentlich einen Denkmalschutz?

http://www.spiegel.de/politik/ausland/buergerkrieg-in-syrien-basar-von-aleppo-geht-in-flammen-auf-a-858756.html
"Der Kampf um die syrische Handelsstadt Aleppo tobt seit Wochen, Hunderte Menschen sind dabei bereits umgekommen. Nun verwüstet ein Feuer das historische Kleinod der Stadt, den weltberühmten Basar. Anwohner versuchen verzweifelt, die Flammen zu löschen.
[...]
Aktivist Rahman sagte, alle historischen Gebäude von Aleppo würden nach und nach beschädigt oder sogar zerstört. Besonders heftig umkämpft ist die alte Zitadelle über der Stadt, in der sich laut Vertretern der Rebellen Scharfschützen der Regierungstruppen verschanzt haben.
Die Schäden sind nicht auf Aleppo begrenzt. Laut Unesco besteht ein "extrem hohes" Risiko, dass die bekannten Kulturschätze des Landes zerstört oder geplündert werden. Der britischen Archäologin Emma Cunliffe zufolge haben alle sechs Weltkulturerbestätten in Syrien "potentiell irreversible" Schäden erlitten. "Aus archäologischer Sicht ist Syrien ein Katastrophengebiet", sagte Cunliffe kürzlich.
Schwere Schäden werden unter anderem auch gemeldet aus:
der historischen Altstadt von Homs, die von Regierungstruppen mit Artillerie und Bomben angegriffen wurde
dem Krak des Chevaliers, einer ehemaligen Kreuzritterburg in der Nähe von Homs; sie wurde von Rebellen besetzt und ist deshalb regelmäßigen Artillerieangriffen ausgesetzt
der Oasenstadt Palmyra; ihre Ruinen wurden vom Regime zum Truppenstandort gemacht, immer wieder wird dort auch der Vorwurf von Plünderungen laut
Bosra, einer Stadt im Südwesten von Syrien, die unter anderem für ihr römisches Amphitheater bekannt ist
Am Montag wollen Experten in Kairo diskutieren, wie man die Zerstörung historischer Stätten in Syrien eindämmen kann. An der Tagung nehmen nach Angaben der ägyptischen Antikenverwaltung auch Diplomaten aus Kuwait, Syrien, Katar und Saudi-Arabien teil."
Update:
http://archaeologik.blogspot.de/2012/10/neue-meldungen-zu-syrien-september.html
"Der Kampf um die syrische Handelsstadt Aleppo tobt seit Wochen, Hunderte Menschen sind dabei bereits umgekommen. Nun verwüstet ein Feuer das historische Kleinod der Stadt, den weltberühmten Basar. Anwohner versuchen verzweifelt, die Flammen zu löschen.
[...]
Aktivist Rahman sagte, alle historischen Gebäude von Aleppo würden nach und nach beschädigt oder sogar zerstört. Besonders heftig umkämpft ist die alte Zitadelle über der Stadt, in der sich laut Vertretern der Rebellen Scharfschützen der Regierungstruppen verschanzt haben.
Die Schäden sind nicht auf Aleppo begrenzt. Laut Unesco besteht ein "extrem hohes" Risiko, dass die bekannten Kulturschätze des Landes zerstört oder geplündert werden. Der britischen Archäologin Emma Cunliffe zufolge haben alle sechs Weltkulturerbestätten in Syrien "potentiell irreversible" Schäden erlitten. "Aus archäologischer Sicht ist Syrien ein Katastrophengebiet", sagte Cunliffe kürzlich.
Schwere Schäden werden unter anderem auch gemeldet aus:
der historischen Altstadt von Homs, die von Regierungstruppen mit Artillerie und Bomben angegriffen wurde
dem Krak des Chevaliers, einer ehemaligen Kreuzritterburg in der Nähe von Homs; sie wurde von Rebellen besetzt und ist deshalb regelmäßigen Artillerieangriffen ausgesetzt
der Oasenstadt Palmyra; ihre Ruinen wurden vom Regime zum Truppenstandort gemacht, immer wieder wird dort auch der Vorwurf von Plünderungen laut
Bosra, einer Stadt im Südwesten von Syrien, die unter anderem für ihr römisches Amphitheater bekannt ist
Am Montag wollen Experten in Kairo diskutieren, wie man die Zerstörung historischer Stätten in Syrien eindämmen kann. An der Tagung nehmen nach Angaben der ägyptischen Antikenverwaltung auch Diplomaten aus Kuwait, Syrien, Katar und Saudi-Arabien teil."
Update:
http://archaeologik.blogspot.de/2012/10/neue-meldungen-zu-syrien-september.html
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Erhard, Andreas (2009): Untersuchungen zum Besitz- und Gebrauchsinteresse an deutschsprachigen Handschriften im 15. Jahrhundert nach den Beständen der Bayerischen Staatsbibliothek München. Dissertation, LMU München: Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften
Online erst seit März 2012
http://edoc.ub.uni-muenchen.de/14147/
Vom Handschriftencensus bislang nicht verwertet!
Ein Schwerpunkt sind die Handschriften Ortolfs des Jüngeren von Trenbach, Sigismund Gossembrots und der Rebdorfer Chorherren.
Update: Eine brave Arbeit, die ein bißchen zu sehr an den Vorlagen klebt und die Sekundärliteratur recht breit referiert, also durchaus nützlich ist. Dass der Handschriftencensus nicht zitiert wird, ist freilich ausgesprochen ärgerlich.
Update: Die Ausführungen zum Buchbestand der Trenbacher und insbesondere Ortolfs des Jüngeren folgen Weitemeier 2006, siehe http://archiv.twoday.net/stories/11509590/ Die Wiener Inkunabel 13 F. 23 dürfte nach
http://books.google.de/books?id=lOwaAQAAMAAJ&q=trenbach+inkunabel
ÖNB-Ink B-696 sein. Ausgesprochen ärgerlich ist, dass die ausführlichen Beschreibungen von ÖNB-Ink im alten Wiener OPAC aus dem Netz verschwunden sind, siehe http://archiv.twoday.net/stories/97059708/. Ebenso ärgerlich, dass weder ISTC noch GW eine Veranlassung sahen, bislang ÖNB-Ink-Nummern zu vermerken! Und noch viel ärgerlicher: Was sich ÖNB-Ink-OPAC nennt und auch der Inkunabelcensus Österreich verzichten auf die Nummern aus der gedruckten Ausgabe von ÖNB-Ink. Ich sehe also im Augenblick keine Möglichkeit, online zu verifizieren, ob die Breydenbach-Inkunabel tatsächlich ÖNB-Ink B-696 ist. Was soll dieses ungeheuerliche Versagen der Inkunabelbibliographien? Ist der superteure Wiener Inkunabelkatalog erst in ein paar hundert Jahren zitierbar, wenn er fertig vorliegt? Ob Falk Eisermann sich dazu hier äußert?
Das Wiener Provenienz-PDF http://www.onb.ac.at/sammlungen/hschrift/kataloge/bick_personen.pdf habe ich ergebnislos gesichtet, desgleichen INKA und BSB-Ink, was Trenbach-Bücher angeht. Weshalb ich trotzdem etwas hier schreibe: Needhams IPI hat einen Hinweis auf eine deutschsprachige Augsburger Inkunabel (heute in Washington, Rosenwald-Collection Nr. 63), die offenbar Ortolf dem Jüngeren gehörte und bei weiteren - nicht nur germanistischen - Studien zur Trenbach-Bibliothek beachtet werden sollte (sie fehlt bei Erhard und offenbar auch bei Weitemeier, den ich jetzt nicht zur Hand habe).
Katalog der Rosenwald-Collection:
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2007rosecatpage.db&recNum=41
Online erst seit März 2012
http://edoc.ub.uni-muenchen.de/14147/
Vom Handschriftencensus bislang nicht verwertet!
Ein Schwerpunkt sind die Handschriften Ortolfs des Jüngeren von Trenbach, Sigismund Gossembrots und der Rebdorfer Chorherren.
Update: Eine brave Arbeit, die ein bißchen zu sehr an den Vorlagen klebt und die Sekundärliteratur recht breit referiert, also durchaus nützlich ist. Dass der Handschriftencensus nicht zitiert wird, ist freilich ausgesprochen ärgerlich.
Update: Die Ausführungen zum Buchbestand der Trenbacher und insbesondere Ortolfs des Jüngeren folgen Weitemeier 2006, siehe http://archiv.twoday.net/stories/11509590/ Die Wiener Inkunabel 13 F. 23 dürfte nach
http://books.google.de/books?id=lOwaAQAAMAAJ&q=trenbach+inkunabel
ÖNB-Ink B-696 sein. Ausgesprochen ärgerlich ist, dass die ausführlichen Beschreibungen von ÖNB-Ink im alten Wiener OPAC aus dem Netz verschwunden sind, siehe http://archiv.twoday.net/stories/97059708/. Ebenso ärgerlich, dass weder ISTC noch GW eine Veranlassung sahen, bislang ÖNB-Ink-Nummern zu vermerken! Und noch viel ärgerlicher: Was sich ÖNB-Ink-OPAC nennt und auch der Inkunabelcensus Österreich verzichten auf die Nummern aus der gedruckten Ausgabe von ÖNB-Ink. Ich sehe also im Augenblick keine Möglichkeit, online zu verifizieren, ob die Breydenbach-Inkunabel tatsächlich ÖNB-Ink B-696 ist. Was soll dieses ungeheuerliche Versagen der Inkunabelbibliographien? Ist der superteure Wiener Inkunabelkatalog erst in ein paar hundert Jahren zitierbar, wenn er fertig vorliegt? Ob Falk Eisermann sich dazu hier äußert?
Das Wiener Provenienz-PDF http://www.onb.ac.at/sammlungen/hschrift/kataloge/bick_personen.pdf habe ich ergebnislos gesichtet, desgleichen INKA und BSB-Ink, was Trenbach-Bücher angeht. Weshalb ich trotzdem etwas hier schreibe: Needhams IPI hat einen Hinweis auf eine deutschsprachige Augsburger Inkunabel (heute in Washington, Rosenwald-Collection Nr. 63), die offenbar Ortolf dem Jüngeren gehörte und bei weiteren - nicht nur germanistischen - Studien zur Trenbach-Bibliothek beachtet werden sollte (sie fehlt bei Erhard und offenbar auch bei Weitemeier, den ich jetzt nicht zur Hand habe).
Katalog der Rosenwald-Collection:
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2007rosecatpage.db&recNum=41
KlausGraf - am Samstag, 29. September 2012, 20:55 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die "International Medieval Bibliography" (kostenpflichtig bei Brepols - DBIS) soll die "leading interdisciplinary bibliography of the Middle Ages" sein, hat aber bei der Ermittlung deutschsprachiger Titel (erfasst sind nur Aufsätze) unbestreitbare Schwächen. Die Erfassung meiner eigenen Publikationen ist völlig unbefriedigend. Nicht nur fehlen die Online-Nachweise (von den 19 Titeln sind bis auf das mit anderen verfasste Schriftenverzeichnis Klaus Schreiner alle online), es sind auch unverzeihliche Lücken in der Liste, siehe die Publikationsliste
http://archiv.twoday.net/stories/4974627/
So fehlt der einflussreiche Aufsatz zum Schlachtengedenken von 1989, und vom Kloster Lorch gibt es gar nichts in der Bibliographie.
Einen groben Anhaltspunkt zur Wirkmächtigkeit meiner Publikationen gibt Google Scholar:
http://scholar.google.com/citations?user=SDK7cLoAAAAJ&hl=en
In einem Fall ist die Erläuterung der IMB unpräzise: "Untersucht insbesondere das Dominikanerinnenkloster St. Katharina und das Karmeliterkloster St. Anna". Mein Aufsatz zur Ordensreform gilt aber insbesondere auch dem Kloster St. Ulrich und Afra!
GRAF, Klaus Maria als Stadtpatronin in deutschen Städten des Mittelalters und der frühen Neuzeit. 2002
2 GRAF, Klaus Zur Biographie des Thomas Finck. 1999
3 GRAF, Klaus Souabe: identité régionale à la fin du Moyen Age et à l'époque moderne. 1997
4 GRAF, Klaus Retrospektive Tendenzen in der bildenden Kunst vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. Kritische Überlegungen aus der Perspektive des Historikers. 1996
5 GRAF, Klaus
LENTZ, Matthias
RUMPF, Marianne Schriftenverzeichnis Klaus Schreiner 1964-1994. 1996
6 GRAF, Klaus Ordensreform und Literatur in Augsburg während des 15. Jahrhunderts. 1995
7 GRAF, Klaus Der Kraichgau. Bemerkungen zur historischen Identität einer Region. 1993
8 GRAF, Klaus Feindbild und Vorbild. Bemerkung zur städtischen Wahrnehmung des Adels. 1993
9 GRAF, Klaus Geschichtsschreibung und Landesdiskurs im Umkreis Graf Eberhards im Bart von Württemberg (1459-1496). 1993
10 GRAF, Klaus Literatur als adelige Hausüberlieferung? 1993
11 GRAF, Klaus Das "Land" Schwaben im späten Mittelalter. 1992
12 GRAF, Klaus Schlachtengedenken im Spätmittelalter. Riten und Medien der Präsentation kollektiver Identität. 1991
13 GRAF, Klaus Hohengeroldsecker Akten. Ein Beitrag zur badischen Archivgeschichte. 1990
14 GRAF, Klaus Nikolaus vom Schwert (um 1400), ein Sohn des Schwäbisch Gmünder Arztes Peter von Grünenberg. 1990
15 GRAF, Klaus Die Weimarer Handschrift Q 127 als Überlieferung historiographischer, prophetischer und erbaulicher Texte. 1989
16 GRAF, Klaus Genealogisches Herkommen bei Konrad von Würzburg und im Friedrich von Schwaben. 1989
17 GRAF, Klaus Aspekte zum Regionalismus in Schwaben und am Oberrhein im Spätmittelalter. 1988
18 GRAF, Klaus Ein verlorenes Mandat Friedrichs II. zugunsten von Kloster Adelberg. 1984
19 GRAF, Klaus Bischof Heinrich III. von Schönegg und Schwäbisch Gmünd. 1981
http://archiv.twoday.net/stories/4974627/
So fehlt der einflussreiche Aufsatz zum Schlachtengedenken von 1989, und vom Kloster Lorch gibt es gar nichts in der Bibliographie.
Einen groben Anhaltspunkt zur Wirkmächtigkeit meiner Publikationen gibt Google Scholar:
http://scholar.google.com/citations?user=SDK7cLoAAAAJ&hl=en
In einem Fall ist die Erläuterung der IMB unpräzise: "Untersucht insbesondere das Dominikanerinnenkloster St. Katharina und das Karmeliterkloster St. Anna". Mein Aufsatz zur Ordensreform gilt aber insbesondere auch dem Kloster St. Ulrich und Afra!
GRAF, Klaus Maria als Stadtpatronin in deutschen Städten des Mittelalters und der frühen Neuzeit. 2002
2 GRAF, Klaus Zur Biographie des Thomas Finck. 1999
3 GRAF, Klaus Souabe: identité régionale à la fin du Moyen Age et à l'époque moderne. 1997
4 GRAF, Klaus Retrospektive Tendenzen in der bildenden Kunst vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. Kritische Überlegungen aus der Perspektive des Historikers. 1996
5 GRAF, Klaus
LENTZ, Matthias
RUMPF, Marianne Schriftenverzeichnis Klaus Schreiner 1964-1994. 1996
6 GRAF, Klaus Ordensreform und Literatur in Augsburg während des 15. Jahrhunderts. 1995
7 GRAF, Klaus Der Kraichgau. Bemerkungen zur historischen Identität einer Region. 1993
8 GRAF, Klaus Feindbild und Vorbild. Bemerkung zur städtischen Wahrnehmung des Adels. 1993
9 GRAF, Klaus Geschichtsschreibung und Landesdiskurs im Umkreis Graf Eberhards im Bart von Württemberg (1459-1496). 1993
10 GRAF, Klaus Literatur als adelige Hausüberlieferung? 1993
11 GRAF, Klaus Das "Land" Schwaben im späten Mittelalter. 1992
12 GRAF, Klaus Schlachtengedenken im Spätmittelalter. Riten und Medien der Präsentation kollektiver Identität. 1991
13 GRAF, Klaus Hohengeroldsecker Akten. Ein Beitrag zur badischen Archivgeschichte. 1990
14 GRAF, Klaus Nikolaus vom Schwert (um 1400), ein Sohn des Schwäbisch Gmünder Arztes Peter von Grünenberg. 1990
15 GRAF, Klaus Die Weimarer Handschrift Q 127 als Überlieferung historiographischer, prophetischer und erbaulicher Texte. 1989
16 GRAF, Klaus Genealogisches Herkommen bei Konrad von Würzburg und im Friedrich von Schwaben. 1989
17 GRAF, Klaus Aspekte zum Regionalismus in Schwaben und am Oberrhein im Spätmittelalter. 1988
18 GRAF, Klaus Ein verlorenes Mandat Friedrichs II. zugunsten von Kloster Adelberg. 1984
19 GRAF, Klaus Bischof Heinrich III. von Schönegg und Schwäbisch Gmünd. 1981
KlausGraf - am Samstag, 29. September 2012, 20:20 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
Anfang der Woche habe ich den neu erschienen Aufsatz über Sunthaim und Leibniz http://archiv.twoday.net/stories/156263991/, von dem ich einen elektronischen Sonderdruck erhalten hatte (also das Verlags-PDF), bei Freidok hochgeladen, wo er aber bis jetzt nicht freigeschaltet wurde. Er steht daher bei ResearchGate zur Verfügung:
https://www.researchgate.net/publication/231315689_Gottfried_Wilhelm_Leibniz_Ladislaus_Sunthaim_und_die_sddeutsche_Welfen-Historiographie
Update: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8767/
https://www.researchgate.net/publication/231315689_Gottfried_Wilhelm_Leibniz_Ladislaus_Sunthaim_und_die_sddeutsche_Welfen-Historiographie
Update: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8767/
KlausGraf - am Samstag, 29. September 2012, 20:10 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Berliner Staatsbibliothek bietet nun die Möglichkeit, abgelaufene Bibliotheksausweise (es gibt solche für einen Monat oder ein Jahr, letzteres zum Preis von 25 Euro) online zu verlängern, vorausgesetzt die Nutzergebühr wird innerhalb von 7 Tagen gezahlt:
http://staatsbibliothek-berlin.de/service/anmeldung/#tab2
Attraktiv ist das, weil die SB Berlin eine stattliche Anzahl wichtiger Datenbanken für registrierte Benutzer im Fernzugriff anbietet (z.B. DigiZeitschriften, Project Muse mit knapp 500 Titeln).
Eine persönliche Anmeldung vor Ort ist leider immer noch erforderlich.
http://staatsbibliothek-berlin.de/service/anmeldung/#tab2
Attraktiv ist das, weil die SB Berlin eine stattliche Anzahl wichtiger Datenbanken für registrierte Benutzer im Fernzugriff anbietet (z.B. DigiZeitschriften, Project Muse mit knapp 500 Titeln).
Eine persönliche Anmeldung vor Ort ist leider immer noch erforderlich.
KlausGraf - am Samstag, 29. September 2012, 19:10 - Rubrik: Bibliothekswesen
"Shyama and I therefore propose to create an Academic Failblog, as it were, a place for any and all of us to post our scholarly missteps for all and sundry to read and learn from. These might be related to research, teaching, job searching or any other aspect of the academic world."
http://www.inthemedievalmiddle.com/2012/09/academic-failblog.html
Ich betreibe Archivalia durchaus mit einem gewissen ethischen Anspruch. Archivalia hat keine Versionierung, aber ich achte darauf, dass außer bei Änderungen, die ich subjektiv als geringfügig einstufe, ursprünglicher und aktualisierter Eintrag unterschieden werden können. Da es auch bei mir Pleiten, Pech und Pannen gibt, ist Archivalia schon zu Teilen ein Failblog, wenn auch, wie ich hoffe, zu sehr kleinen Teilen. Ich erinnere mich nicht an alle peinlichen Richtigstellungen, aber zwei fallen mir im Bereich der Forschungsbeiträge spontan ein:
Kurt Gärtner berichtigt meine Annahme, eine verschollene Handschrift von Wernhers Marienleben gefunden zu haben:
http://archiv.twoday.net/stories/97046205/
Peter Schmid weist meine Vermutung zurück, Bollstatter habe eine Edinburger Handschrift geschrieben:
http://archiv.twoday.net/stories/6461507/
Update: Das Failblog ist online als FUMBLR unter
http://academicfailblog.blogspot.com/
http://www.inthemedievalmiddle.com/2012/09/academic-failblog.html
Ich betreibe Archivalia durchaus mit einem gewissen ethischen Anspruch. Archivalia hat keine Versionierung, aber ich achte darauf, dass außer bei Änderungen, die ich subjektiv als geringfügig einstufe, ursprünglicher und aktualisierter Eintrag unterschieden werden können. Da es auch bei mir Pleiten, Pech und Pannen gibt, ist Archivalia schon zu Teilen ein Failblog, wenn auch, wie ich hoffe, zu sehr kleinen Teilen. Ich erinnere mich nicht an alle peinlichen Richtigstellungen, aber zwei fallen mir im Bereich der Forschungsbeiträge spontan ein:
Kurt Gärtner berichtigt meine Annahme, eine verschollene Handschrift von Wernhers Marienleben gefunden zu haben:
http://archiv.twoday.net/stories/97046205/
Peter Schmid weist meine Vermutung zurück, Bollstatter habe eine Edinburger Handschrift geschrieben:
http://archiv.twoday.net/stories/6461507/
Update: Das Failblog ist online als FUMBLR unter
http://academicfailblog.blogspot.com/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Pläne der Nationalbibliothek (ÖNB), Neuerwerbungen künftig nur mehr in digitaler Form Books zu erwerben, stoßen auf erheblichen Widerstand: Der Vorstand der IG Autorinnen Autoren befürchtet massive Einbußen bei der dauerhaften Verlässlichkeit und Zugänglichkeit - und fordert den Rücktritt von ÖNB-Generaldirektorin Johanna Rachinger."
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wissen/geschichte/490436_Digitale-Archivierung-empoert-Autoren.html
Zur ÖNB-Vision 2025 und den Autorenprotesten:
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=23700
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=23685
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=23645
Cartoon:
http://images.derstandard.at/2012/09/28/1348308733175.jpg
Meine Position: Solange es gedruckte Bücher gibt, sollten die nationalen und regionalen Pflichtexemplarbibliotheken oder die Bibliotheken, die diese Funktion de facto wahrnehmen, mindestens ein Exemplar des gedruckten Werks für die Ewigkeit archivieren. Wenn es in Wien Platzprobleme gibt, kann das kein Grund sein, die abendländische Buchkultur zu verabschieden. Wir Archivare sehen ja ohnehin - oft mit guten Gründen - eine Ersatzdigitalisierung skeptisch.
Update: Lesenswert Anton Tantner
http://science.orf.at/stories/1706297/

ÖNB-Prunksaal-Foto: Politikaner http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wissen/geschichte/490436_Digitale-Archivierung-empoert-Autoren.html
Zur ÖNB-Vision 2025 und den Autorenprotesten:
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=23700
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=23685
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=23645
Cartoon:
http://images.derstandard.at/2012/09/28/1348308733175.jpg
Meine Position: Solange es gedruckte Bücher gibt, sollten die nationalen und regionalen Pflichtexemplarbibliotheken oder die Bibliotheken, die diese Funktion de facto wahrnehmen, mindestens ein Exemplar des gedruckten Werks für die Ewigkeit archivieren. Wenn es in Wien Platzprobleme gibt, kann das kein Grund sein, die abendländische Buchkultur zu verabschieden. Wir Archivare sehen ja ohnehin - oft mit guten Gründen - eine Ersatzdigitalisierung skeptisch.
Update: Lesenswert Anton Tantner
http://science.orf.at/stories/1706297/

ÖNB-Prunksaal-Foto: Politikaner http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
KlausGraf - am Samstag, 29. September 2012, 18:05 - Rubrik: Bibliothekswesen
http://www.heise.de/newsticker/meldung/EnBW-Untersuchung-Streit-um-Mappus-Mails-1720437.html
"Über den Umgang mit Mails aus der Regierungszeit von Stefan Mappus ist ein Streit zwischen dem ehemaligen CDU-Ministerpräsidenten und der gegenwärtigen rot-grünen Landesregierung in Baden-Württemberg entbrannt. Mappus besteht auf Löschung dieser Daten und will das notfalls durch seine Anwälte auch gerichtlich durchsetzen lassen. Die Staatskanzlei ist dagegen, da sie darin auch dienstlichen Mailverkehr vermutet."
Siehe hier
http://archiv.twoday.net/search?q=mappus
"Über den Umgang mit Mails aus der Regierungszeit von Stefan Mappus ist ein Streit zwischen dem ehemaligen CDU-Ministerpräsidenten und der gegenwärtigen rot-grünen Landesregierung in Baden-Württemberg entbrannt. Mappus besteht auf Löschung dieser Daten und will das notfalls durch seine Anwälte auch gerichtlich durchsetzen lassen. Die Staatskanzlei ist dagegen, da sie darin auch dienstlichen Mailverkehr vermutet."
Siehe hier
http://archiv.twoday.net/search?q=mappus
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Fotoimpressionen vom 28.09.2012
Wolf Thomas - am Samstag, 29. September 2012, 11:32 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 28. September 2012, 23:29 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Kaum eine Stimme erhebt sich gegen dieses abscheuliche und schändliche Vorgehen, mit der hochrangige Werke der Öffentlichkeit entzogen werden. Vielleicht am klarsten kritisiert diese Mode Donn Zaretsky:
http://theartlawblog.blogspot.de/2012/09/tell-me-again-about-public-trust-usual.html
http://theartlawblog.blogspot.de/2012/09/tell-me-again-about-public-trust-usual.html
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 28. September 2012, 23:05 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In California, Governor Jerry Brown has signed two bills (SB 1052 and SB 1053) that will provide for the creation of free, openly licensed digital textbooks for the 50 most popular lower-division college courses offered by California colleges. The legislation was introduced by Senate President pro Tem Darrell Steinberg and passed by the California Senate and Assembly in late August.
A crucial component of the California legislation is that the textbooks developed will be made available under the Creative Commons Attribution license (CC BY)
http://creativecommons.org/weblog/entry/34288
A crucial component of the California legislation is that the textbooks developed will be made available under the Creative Commons Attribution license (CC BY)
http://creativecommons.org/weblog/entry/34288
KlausGraf - am Freitag, 28. September 2012, 23:01 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/id/1337364
Sie erschien 1951 bis 2004 und wurde jetzt digitalisiert.
Sie erschien 1951 bis 2004 und wurde jetzt digitalisiert.
KlausGraf - am Freitag, 28. September 2012, 22:58 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.landesarchiv-bw.de/web/54345
Durch eine Eheschließung im Jahr 1782 erwarben die Fürsten zu Hohenlohe-Ingelfingen, seit 1805 Hohenlohe-Oehringen, das Rittergut Oppurg in Thüringen. Zentrum der Gutsherrschaft war das Anfang des 18. Jahrhunderts errichtete Barockschloss Oppurg, das die Gemeinde bis heute beherrscht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Besitz enteignet, die Archivalien kamen schließlich ins Hauptstaatsarchiv Weimar. Nach der Wiedervereinigung wurde das Rittergut Oppurg dem Fürsten zu Hohenlohe-Oehringen restituiert – inklusive des Archivs.
Mitarbeiter des Hohenlohe-Zentralarchivs Neuenstein und der fürstlichen Verwaltung überführten im Sommer 2012 die 42 Laufmeter Archivalien des Ritterguts von Weimar nach Neuenstein und nahmen den Bestand in die Reihe der Hohenloher Archivalien auf (Bestand Oe 222). Neben dem neuen Oppurger Bestand befinden sich mit der Obergrafschaft Gleichen bereits Unterlagen aus thüringischer Provenienz in Neuenstein (Bestände GL 30, 35 und 40).
Nach der Einlieferung der Oppurger Archivalien wurde das Weimarer Findmittel überarbeitet, im Findmittelsystem des Landesarchivs erfasst und online gestellt, so dass künftig Nutzer aus Hohenlohe und Thüringen einen gleichermaßen guten Zugriff auf die Erschließungsinformationen zu den knapp 4.000 Archivalieneinheiten haben.
Benutzer aus Thüringen werden überglücklich sein, dass sie nun über 330 km weiter zu den Archivalien fahren dürfen.
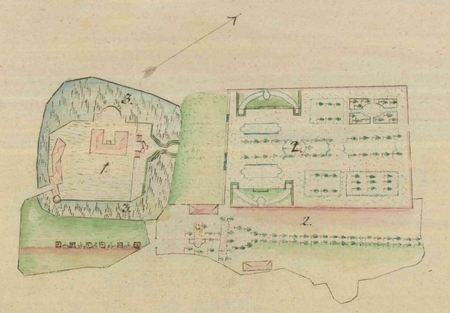
Durch eine Eheschließung im Jahr 1782 erwarben die Fürsten zu Hohenlohe-Ingelfingen, seit 1805 Hohenlohe-Oehringen, das Rittergut Oppurg in Thüringen. Zentrum der Gutsherrschaft war das Anfang des 18. Jahrhunderts errichtete Barockschloss Oppurg, das die Gemeinde bis heute beherrscht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Besitz enteignet, die Archivalien kamen schließlich ins Hauptstaatsarchiv Weimar. Nach der Wiedervereinigung wurde das Rittergut Oppurg dem Fürsten zu Hohenlohe-Oehringen restituiert – inklusive des Archivs.
Mitarbeiter des Hohenlohe-Zentralarchivs Neuenstein und der fürstlichen Verwaltung überführten im Sommer 2012 die 42 Laufmeter Archivalien des Ritterguts von Weimar nach Neuenstein und nahmen den Bestand in die Reihe der Hohenloher Archivalien auf (Bestand Oe 222). Neben dem neuen Oppurger Bestand befinden sich mit der Obergrafschaft Gleichen bereits Unterlagen aus thüringischer Provenienz in Neuenstein (Bestände GL 30, 35 und 40).
Nach der Einlieferung der Oppurger Archivalien wurde das Weimarer Findmittel überarbeitet, im Findmittelsystem des Landesarchivs erfasst und online gestellt, so dass künftig Nutzer aus Hohenlohe und Thüringen einen gleichermaßen guten Zugriff auf die Erschließungsinformationen zu den knapp 4.000 Archivalieneinheiten haben.
Benutzer aus Thüringen werden überglücklich sein, dass sie nun über 330 km weiter zu den Archivalien fahren dürfen.
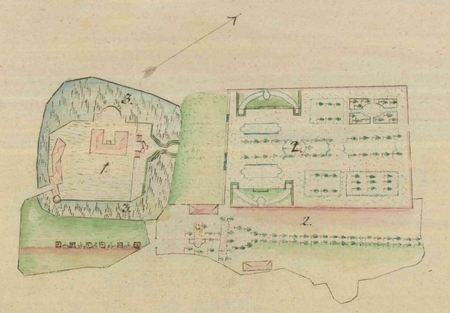
KlausGraf - am Freitag, 28. September 2012, 22:14 - Rubrik: Herrschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Archiv Demokratischer Sozialismus (ADS) hat die Aufgabe, die Quellen zur Entwicklung der Partei DIE LINKE und ihrer beiden Quell-Organisationen, der Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) und der Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (WASG), zu sammeln, zu erschließen, zu bewahren und der Öffentlichkeit (insbesondere für die Forschung) zugänglich zu machen. Entsprechend seiner Zielstellung übernimmt die Stiftung in das Archiv auch Nachlässe und Deposita. Das Archiv entwickelt sich somit zum kollektiven Gedächtnis der Partei DIE LINKE. Das ADS stellt Dokumente für Publikationen, für Ausstellungen und für Veranstaltungen der politischen Bildung sowie für Funk und Fernsehen bereit.
In der Reihe Findbücher ist mit der Nummer 12 jenes zum Bestand: WASG (2004 bis 2007) erschienen. Es ist hier als PDF abrufbar.
In der Reihe Findbücher ist mit der Nummer 12 jenes zum Bestand: WASG (2004 bis 2007) erschienen. Es ist hier als PDF abrufbar.
Bernd Hüttner - am Freitag, 28. September 2012, 14:24 - Rubrik: Parteiarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Mecklenburg-Vorpommern/Dorfkirche_der_Woche

Foto der Kirche in Toitin: Erell http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Foto der Kirche in Toitin: Erell http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Des Universitätsbibliothekars Heinrich Knodts Moguntia litterata (1749/51) ist aufgrund des gravierenden Quellenverlusts in der Zeit um 1800 eine wichtige Primärquelle. Der Stadtbibliothek Mainz habe ich sehr zu danken, dass sie dieses Werk vergleichsweise kurzfristig ins Netz gestellt hat:
http://www.dilibri.de/stbmz/content/titleinfo/946050

http://www.dilibri.de/stbmz/content/titleinfo/946050

KlausGraf - am Donnerstag, 27. September 2012, 16:40 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.golem.de/news/storage-technik-glas-als-datenspeicher-fuer-die-ewigkeit-1209-94767.html
https://www.facebook.com/notes/afp-news-agency-agence-france-presse/data-that-lives-forever-is-possible-japans-hitachi-reveals/406393692747622
https://www.facebook.com/notes/afp-news-agency-agence-france-presse/data-that-lives-forever-is-possible-japans-hitachi-reveals/406393692747622
KlausGraf - am Mittwoch, 26. September 2012, 23:39 - Rubrik: Digitale Unterlagen
Einige vorläufige Hinweise unter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Michaeliskonvent#Guter_Artikel.2C_aber_...
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/176831619/
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Michaeliskonvent#Guter_Artikel.2C_aber_...
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/176831619/
KlausGraf - am Mittwoch, 26. September 2012, 17:29 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Einige Impressionen (Aussteller/Archive/Rheinland-Pfalz-Stand)

Link (Flickr-Album): http://www.flickr.com/photos/stadtarchiv_speyer/sets/72157631620201977/

Link (Flickr-Album): http://www.flickr.com/photos/stadtarchiv_speyer/sets/72157631620201977/
J. Kemper - am Mittwoch, 26. September 2012, 16:42 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Georg Wilhelm Justin Wagners zweibändiges Standardwerk zu den "darmhessischen" Klöstern (1873-1878) wurde freundlicherweise von der ULB Düsseldorf ins Netz gestellt:
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/4250235
Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Nachschlagewerke_Kl%C3%B6ster
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/4250235
Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Nachschlagewerke_Kl%C3%B6ster
KlausGraf - am Mittwoch, 26. September 2012, 15:00 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Enthält vor allem:
- Veranstaltungshinweise.
http://www.blha.de/FilePool/Newsletter_Archiv_7_1_2012.pdf
- Veranstaltungshinweise.
http://www.blha.de/FilePool/Newsletter_Archiv_7_1_2012.pdf
KlausGraf - am Mittwoch, 26. September 2012, 14:56 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Kosten für alle Rundgänge 6,- € / 4,- € ermäßigt.
So., 30. September, 15 Uhr
80 Jahre Altonaer Blutsonntag, Juli 1932
Zum Gedenken an die Opfer und die politische Bedeutung des
Nazimarsches durch Altonas Arbeiterquartiere wird historischen
und aktuellen Spuren gefolgt
Treff: Louise-Schroeder-Straße/ Ecke Unzerstraße
So., 7. Oktober, 14 Uhr
Ehemaliges jüdisches Leben in Altona I: Die Gemeinde
in Kooperation mit dem Eduard-Duckesz-Haus
Treff: Grünanlage Ecke Breite Straße/Kirchenstraße
So., 21. Oktober 11 Uhr
Das kommt mir dänisch vor:
Ottensen 1640 – 1864
Treff: Altonaer Rathaus/ Platz der Republik
So., 18. November, 14 Uhr
Ehemaliges jüdisches Leben in Altona III:
Nachbarschaften - jüdische und katholische Polen
in Kooperation mit dem Eduard-Duckesz-Haus
Treff: vor dem "Wohlers", Thadenstraße/Ecke Wohlersallee
So., 2. Dezember, 15 Uhr
„Vom Draht zum Nagel ...“ -
Die Ottensener Drahtstifte-Fabrikmacht Nägel mit Köpfen.
Die letzte Führung in diesem Jahr mit einem Glas Punsch (auch alkoholfrei)
Treff: Stadtteilarchiv Ottensen, Zeißstraße 28
http://www.stadtteilarchiv-ottensen.de/pages/stadtteilrundgaenge/termine.php
via Kulturenergiebunker Altona:
http://kulturenergiebunker.blogspot.de/
So., 30. September, 15 Uhr
80 Jahre Altonaer Blutsonntag, Juli 1932
Zum Gedenken an die Opfer und die politische Bedeutung des
Nazimarsches durch Altonas Arbeiterquartiere wird historischen
und aktuellen Spuren gefolgt
Treff: Louise-Schroeder-Straße/ Ecke Unzerstraße
So., 7. Oktober, 14 Uhr
Ehemaliges jüdisches Leben in Altona I: Die Gemeinde
in Kooperation mit dem Eduard-Duckesz-Haus
Treff: Grünanlage Ecke Breite Straße/Kirchenstraße
So., 21. Oktober 11 Uhr
Das kommt mir dänisch vor:
Ottensen 1640 – 1864
Treff: Altonaer Rathaus/ Platz der Republik
So., 18. November, 14 Uhr
Ehemaliges jüdisches Leben in Altona III:
Nachbarschaften - jüdische und katholische Polen
in Kooperation mit dem Eduard-Duckesz-Haus
Treff: vor dem "Wohlers", Thadenstraße/Ecke Wohlersallee
So., 2. Dezember, 15 Uhr
„Vom Draht zum Nagel ...“ -
Die Ottensener Drahtstifte-Fabrikmacht Nägel mit Köpfen.
Die letzte Führung in diesem Jahr mit einem Glas Punsch (auch alkoholfrei)
Treff: Stadtteilarchiv Ottensen, Zeißstraße 28
http://www.stadtteilarchiv-ottensen.de/pages/stadtteilrundgaenge/termine.php
via Kulturenergiebunker Altona:
http://kulturenergiebunker.blogspot.de/
SW - am Mittwoch, 26. September 2012, 13:58 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Präsentation von Daniel Bernsen, Koblenz, gehalten am 26.9.2012 auf dem Mainzer Historikertag
s. a.
1) http://geschichtsunterricht.wordpress.com/2012/08/29/historisches-lernen-goes-mobile-uberlegungen-zu-einer-didaktik-mobilen-geschichtslernen-teil-1/#comment-1018
2) http://geschichtsunterricht.wordpress.com/2012/09/25/historisches-lernen-goes-mobile-teil-2-1-annaherung-an-den-begriff-historischer-lernort-im-mobilen-geschichtslernen/
s. a.
1) http://geschichtsunterricht.wordpress.com/2012/08/29/historisches-lernen-goes-mobile-uberlegungen-zu-einer-didaktik-mobilen-geschichtslernen-teil-1/#comment-1018
2) http://geschichtsunterricht.wordpress.com/2012/09/25/historisches-lernen-goes-mobile-teil-2-1-annaherung-an-den-begriff-historischer-lernort-im-mobilen-geschichtslernen/
Wolf Thomas - am Mittwoch, 26. September 2012, 13:17 - Rubrik: Archivpaedagogik
eine nette Mitmachidee von KollegInnen aus den Niederlanden und Dänemark zum Welttierschutztag am 4. Oktober. Weitere Informationen finden sich hier: http://askarchivists.wordpress.com/2012/09/07/beasts-in-your-collections/#comment-1368
Wolf Thomas - am Mittwoch, 26. September 2012, 09:53 - Rubrik: Web 2.0
