Über die Arbeit im Erstversorgungszentrum, in dem die Archivalien des eingestürzten Historischen Archivs der Stadt Köln behandelt werden:
„Das wird noch Oktober“
Wenn Rechnen tröstet: Von Quantität und Qualität der Katastrophe
[...] Die vielen Schachteln mit Kölnflocken und Einzelblättern, zerknautschten Stehordnern und aufgequollenen Bücher haben die Bestände des Stadtarchivs ziemlich aufgeplustert, um zwanzig Prozent, schätze ich. Aber eine Plastikwanne enthält auch rund zwanzig Prozent mehr Material, als auf einen Regalmeter geht. Das mag sich ausgleichen. Grob kalkuliert also: Ein Wanneninhalt entspricht einem Regalmeter in der alten, kompakten Lagerung des Stadtarchivs. 27 Regalkilometer hatte das Archiv. An den Packtischen sind wir gerade bei Wanne 3000, also Kilometer drei. Dann kommen noch 24.000 Wannen. Hoffentlich. Jede Wanne weniger würde für acht Kartons Totalverlust stehen.
[...] In den Abläufen habe ich auch nur ein einziges Problem entdeckt. Die Archivalien werden auf einem Zettel notiert, wenn sie gesäubert in die Wannen gelegt werden. Aus den Wannen werden zehn Kartons. Um später etwas zu finden, müssen im schlechtesten Fall alle zehn Kartons geöffnet werden. Würde der Inhalt erst an unseren Packtischen erfasst, wäre er genau einer Schachtel zuzuordnen. Das dürfte den geordneten Rückfluss der Archivalien in die Magazine des neuen Stadtarchivs sehr erleichtern.
[...] Noch eine Rechnung. 27 Regalkilometer enthielt das Archiv. Nach wochenlanger Zeitungslektüre, vielen Gesprächen, eigener Beobachtung im EVZ und einer Presseführung über die Einsturzstelle scheint mir, dass drei Viertel der Bestände kaum oder nur mäßig (bis zum Knicken, aber noch ohne Reißen) beschädigt sind. Auffällig gut sind dabei die älteren Bestände davongekommen, die liegend und in Kartons aufbewahrt wurden. Die Wasserschäden sind zwar ärgerlich, aber Tinte war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wasserfest und verläuft nicht. Schlimmer sind die Pilze, die sich von der Zellulose des Papiers ernähren wollen.
Das restliche Viertel des Kölner Schriftguts wird wohl schwer beschädigt - gerissen, zerrissen, zerquetscht, zerrieben - oder vernichtet sein. Die größten Schäden haben die vielen Regalkilometer Ordner mit Verwaltungsakten nach 1945 erlitten. Sie waren noch nicht endgültig archiviert und standen aufrecht in den Regalen, als die Decken herunter kamen.
Die Schäden an Substanz und Aura sind aber nur ein Teil der Verlustbilanz. Ein anderer Teil betrifft die Leistung der Archivare von Köln, die über ein Jahrhundert lang ihre Bestände geordnet und erschlossen haben. Diese Struktur wiederherzustellen dauert vermutlich ebenso lang wie der Neubau des Archivs. Die Ordnung der Akten ab 1945? Fragezeichen. „Zehn Stellen zusätzlich, insgesamt. Aber gehen Sie damit mal zu einem Stadtkämmerer“, meinte der Chef eines Hauptstaatsarchivs, den ich deswegen anrief.
Und die Restaurierung? „Zehn Leute, gute Werkstätten, zwanzig Hilfskräfte, dann sind die in zehn Jahren damit durch“, schätzt ein mit dem Zustand der nassen Kölner Archivalien vertrauter Fachmann am Telefon. Aber noch ist überhaupt nicht zu erkennen, dass die Stadt hinreichend Personal für die Beseitigung der Folgen des Unglücks bewilligt, das sie zu verantworten hat. Gerade zwei Stellen des gehobenen Archivdienstes, Teilzeit „gerne“, sind frisch ausgeschrieben.
[...] Über den Slogan der Wohlmeinenden, dass Köln mit dem Einsturz „sein Gedächtnis verloren“ habe, schütteln hier viele den Kopf. Wir tragen zusammen: Erstens ist längst nicht alles vernichtet. Zweitens: Es gibt in Köln auch andere Archive. Drittens: Die Akten wichtiger Behörden gehen auch an andere Stellen. So gibt der Regierungspräsident von Köln an das Landesarchiv in Düsseldorf ab; das soll übrigens demnächst in einen Bau im Duisburger Hafen ziehen und gegen Rheinhochwasser geschützt sein, hm. Viertens: Zum „Gedächtnis Kölns“ gehören auch die hiesigen Bibliotheken und Museen, selbst die Baudenkmäler und der Grundriss der Stadt. Und fünftens wird kein Archivar ernsthaft abstreiten, dass die Akten, die er betreut, höchstens fünf Prozent der Lebenswirklichkeit in seinem Zuständigkeitszeitraum ausmachen.
[...] Rechnung Nummer drei: Sechshundert Wannen in vier Tagen, das entspricht 150 Wannen oder 150 Regalmetern pro Tag. 27 Kilometer Archivalien hatten sie im Archivgebäude, das bedeutet: 180 Werktage im EVZ. Ein Monat ist schon weg; meine Berechnung passt zu dem, was der Archivar vom Dienst im Vorbeilaufen ruft: „Das wird noch Oktober!“
Sechs Wochen, bis die letzten Archivalien aus den Trümmern gezogen sind. Sechs Monate, bis die Erstversorgung abgeschlossen ist. Sechs Jahre, bis das neue Stadtarchiv voll benutzbar ist. Für die Restauratoren, bleiben wir realistisch, Arbeit bis ans Ende aller Tage.
[...] Ich bin nicht enttäuscht, nach den vier Tagen nur mit einem freundlichen Blick über die Maske hinweg verabschiedet worden zu sein. Mehr kann man von den Kölnern doch nicht verlangen. Die Belastung durch die Wucht des Ereignisses, durch den Aufbau eines funktionierenden Workflows aus dem Nichts und durch den Dreischichtbetrieb der ersten zehn Tage hat ihnen eine enorme Kraft abverlangt. Dann wochenlang immer neuen Gesichtern hinter Schutzmasken Anerkennung zu zollen, und es geht ja noch Monate so weiter? Eine psychologische Überforderung für beamtete Stadtarchivare des höheren und gehobenen Dienstes, die dafür nun wirklich nicht ausgebildet sind.
Ihnen kein explizites Lob abzufordern ist sogar professionell, weil ein solcher Verzicht zeigt, dass man ihre Lage nachvollzieht. Es drückt ein kollegiales Kompliment für ihre Arbeit aus. Zuständig für unsere formelle und informelle Belohnung wäre die Stadt Köln. Der nützt unsere Arbeit schließlich am Meisten. [...]
Tag 1: http://www.taz.de/1/leben/buch/artikel/1/%5Cwir-lesen-nicht%5C/
Tag 2: http://www.taz.de/1/leben/buch/artikel/1/koeln-contra-koeln/
Tag 3: http://www.taz.de/1/leben/buch/artikel/1/schimmelalarm/
Tag 4: http://www.taz.de/1/leben/buch/artikel/1/das-wird-noch-oktober/
„Das wird noch Oktober“
Wenn Rechnen tröstet: Von Quantität und Qualität der Katastrophe
[...] Die vielen Schachteln mit Kölnflocken und Einzelblättern, zerknautschten Stehordnern und aufgequollenen Bücher haben die Bestände des Stadtarchivs ziemlich aufgeplustert, um zwanzig Prozent, schätze ich. Aber eine Plastikwanne enthält auch rund zwanzig Prozent mehr Material, als auf einen Regalmeter geht. Das mag sich ausgleichen. Grob kalkuliert also: Ein Wanneninhalt entspricht einem Regalmeter in der alten, kompakten Lagerung des Stadtarchivs. 27 Regalkilometer hatte das Archiv. An den Packtischen sind wir gerade bei Wanne 3000, also Kilometer drei. Dann kommen noch 24.000 Wannen. Hoffentlich. Jede Wanne weniger würde für acht Kartons Totalverlust stehen.
[...] In den Abläufen habe ich auch nur ein einziges Problem entdeckt. Die Archivalien werden auf einem Zettel notiert, wenn sie gesäubert in die Wannen gelegt werden. Aus den Wannen werden zehn Kartons. Um später etwas zu finden, müssen im schlechtesten Fall alle zehn Kartons geöffnet werden. Würde der Inhalt erst an unseren Packtischen erfasst, wäre er genau einer Schachtel zuzuordnen. Das dürfte den geordneten Rückfluss der Archivalien in die Magazine des neuen Stadtarchivs sehr erleichtern.
[...] Noch eine Rechnung. 27 Regalkilometer enthielt das Archiv. Nach wochenlanger Zeitungslektüre, vielen Gesprächen, eigener Beobachtung im EVZ und einer Presseführung über die Einsturzstelle scheint mir, dass drei Viertel der Bestände kaum oder nur mäßig (bis zum Knicken, aber noch ohne Reißen) beschädigt sind. Auffällig gut sind dabei die älteren Bestände davongekommen, die liegend und in Kartons aufbewahrt wurden. Die Wasserschäden sind zwar ärgerlich, aber Tinte war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wasserfest und verläuft nicht. Schlimmer sind die Pilze, die sich von der Zellulose des Papiers ernähren wollen.
Das restliche Viertel des Kölner Schriftguts wird wohl schwer beschädigt - gerissen, zerrissen, zerquetscht, zerrieben - oder vernichtet sein. Die größten Schäden haben die vielen Regalkilometer Ordner mit Verwaltungsakten nach 1945 erlitten. Sie waren noch nicht endgültig archiviert und standen aufrecht in den Regalen, als die Decken herunter kamen.
Die Schäden an Substanz und Aura sind aber nur ein Teil der Verlustbilanz. Ein anderer Teil betrifft die Leistung der Archivare von Köln, die über ein Jahrhundert lang ihre Bestände geordnet und erschlossen haben. Diese Struktur wiederherzustellen dauert vermutlich ebenso lang wie der Neubau des Archivs. Die Ordnung der Akten ab 1945? Fragezeichen. „Zehn Stellen zusätzlich, insgesamt. Aber gehen Sie damit mal zu einem Stadtkämmerer“, meinte der Chef eines Hauptstaatsarchivs, den ich deswegen anrief.
Und die Restaurierung? „Zehn Leute, gute Werkstätten, zwanzig Hilfskräfte, dann sind die in zehn Jahren damit durch“, schätzt ein mit dem Zustand der nassen Kölner Archivalien vertrauter Fachmann am Telefon. Aber noch ist überhaupt nicht zu erkennen, dass die Stadt hinreichend Personal für die Beseitigung der Folgen des Unglücks bewilligt, das sie zu verantworten hat. Gerade zwei Stellen des gehobenen Archivdienstes, Teilzeit „gerne“, sind frisch ausgeschrieben.
[...] Über den Slogan der Wohlmeinenden, dass Köln mit dem Einsturz „sein Gedächtnis verloren“ habe, schütteln hier viele den Kopf. Wir tragen zusammen: Erstens ist längst nicht alles vernichtet. Zweitens: Es gibt in Köln auch andere Archive. Drittens: Die Akten wichtiger Behörden gehen auch an andere Stellen. So gibt der Regierungspräsident von Köln an das Landesarchiv in Düsseldorf ab; das soll übrigens demnächst in einen Bau im Duisburger Hafen ziehen und gegen Rheinhochwasser geschützt sein, hm. Viertens: Zum „Gedächtnis Kölns“ gehören auch die hiesigen Bibliotheken und Museen, selbst die Baudenkmäler und der Grundriss der Stadt. Und fünftens wird kein Archivar ernsthaft abstreiten, dass die Akten, die er betreut, höchstens fünf Prozent der Lebenswirklichkeit in seinem Zuständigkeitszeitraum ausmachen.
[...] Rechnung Nummer drei: Sechshundert Wannen in vier Tagen, das entspricht 150 Wannen oder 150 Regalmetern pro Tag. 27 Kilometer Archivalien hatten sie im Archivgebäude, das bedeutet: 180 Werktage im EVZ. Ein Monat ist schon weg; meine Berechnung passt zu dem, was der Archivar vom Dienst im Vorbeilaufen ruft: „Das wird noch Oktober!“
Sechs Wochen, bis die letzten Archivalien aus den Trümmern gezogen sind. Sechs Monate, bis die Erstversorgung abgeschlossen ist. Sechs Jahre, bis das neue Stadtarchiv voll benutzbar ist. Für die Restauratoren, bleiben wir realistisch, Arbeit bis ans Ende aller Tage.
[...] Ich bin nicht enttäuscht, nach den vier Tagen nur mit einem freundlichen Blick über die Maske hinweg verabschiedet worden zu sein. Mehr kann man von den Kölnern doch nicht verlangen. Die Belastung durch die Wucht des Ereignisses, durch den Aufbau eines funktionierenden Workflows aus dem Nichts und durch den Dreischichtbetrieb der ersten zehn Tage hat ihnen eine enorme Kraft abverlangt. Dann wochenlang immer neuen Gesichtern hinter Schutzmasken Anerkennung zu zollen, und es geht ja noch Monate so weiter? Eine psychologische Überforderung für beamtete Stadtarchivare des höheren und gehobenen Dienstes, die dafür nun wirklich nicht ausgebildet sind.
Ihnen kein explizites Lob abzufordern ist sogar professionell, weil ein solcher Verzicht zeigt, dass man ihre Lage nachvollzieht. Es drückt ein kollegiales Kompliment für ihre Arbeit aus. Zuständig für unsere formelle und informelle Belohnung wäre die Stadt Köln. Der nützt unsere Arbeit schließlich am Meisten. [...]
Tag 1: http://www.taz.de/1/leben/buch/artikel/1/%5Cwir-lesen-nicht%5C/
Tag 2: http://www.taz.de/1/leben/buch/artikel/1/koeln-contra-koeln/
Tag 3: http://www.taz.de/1/leben/buch/artikel/1/schimmelalarm/
Tag 4: http://www.taz.de/1/leben/buch/artikel/1/das-wird-noch-oktober/
Dietmar Bartz - am Sonntag, 19. April 2009, 19:36 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
published on Salon Jewish Studies Blog ( http://board-js.blogspot.com/2009/04/summary-cologne-archives-collapse-xiv.html)
Invitation for all donors of private collections (KStA via Archivalia)
The City of Cologne will invite all donors of private collections and depositaries to the Piazetta in the City Hall on May 11th. The head of the department, Gisela Fleckenstein explains the late date with the task to organize 10 (shelf) m of contracts to find out what the archive holds (held) and who are the depositaries. Fleckenstein says: „In case we forgot somebody, please feel invited.“
Recovery process already finished at the end of May? (KstA via Archivalia)
After a short Easter break, the fire department Cologne and the Federal Agency for Technical Relief continue their work at the collapsed building in Severinstraße. This week the volunteer fire department Aachen is helping. The mountain of rubble decreases every day. “It could be possible that we will be finished at the end of May” notes the speaker of the fire department, Günter Weber, but he also limits: “We do not know exactly how further it goes into the depth.”
A special driller, that transports rock specimens from up to 50 m depth, was used to examine the condition of the ground. “This way you can find out if there is more rubble in the depth“, reports Weber. In the meantime, exvacators pull down the backside of the former CHA building, remains of the reading room and the offices.
Nearly half of the former 30 (shelf) km have been recovered in different conditions. “It will take years to restore and sort the documents“, said Gisela Fleckenstein. “Die several papers and collections are one big mess.“
What do we learn from Cologne Historical Archive's collapse? (Die Welt via Archivalia)
" ..... that we must deal with our history more careful. This is not about a building in Cologne that collapsed but about our historical memory. Therefore this collapse is a societal problem, in which the politics has got more involved. Knowledge and concepts exist, only financing is missing. In general, we need a wider awareness of our archives, for they store our history and make it researchable…” , said Jochen Hermel (Institute for History, University of Bonn; Hermel works on his PhD thesis about integration of migrants to the City of Cologne in the 16th and the beginning 17th century)
Invitation for all donors of private collections (KStA via Archivalia)
The City of Cologne will invite all donors of private collections and depositaries to the Piazetta in the City Hall on May 11th. The head of the department, Gisela Fleckenstein explains the late date with the task to organize 10 (shelf) m of contracts to find out what the archive holds (held) and who are the depositaries. Fleckenstein says: „In case we forgot somebody, please feel invited.“
Recovery process already finished at the end of May? (KstA via Archivalia)
After a short Easter break, the fire department Cologne and the Federal Agency for Technical Relief continue their work at the collapsed building in Severinstraße. This week the volunteer fire department Aachen is helping. The mountain of rubble decreases every day. “It could be possible that we will be finished at the end of May” notes the speaker of the fire department, Günter Weber, but he also limits: “We do not know exactly how further it goes into the depth.”
A special driller, that transports rock specimens from up to 50 m depth, was used to examine the condition of the ground. “This way you can find out if there is more rubble in the depth“, reports Weber. In the meantime, exvacators pull down the backside of the former CHA building, remains of the reading room and the offices.
Nearly half of the former 30 (shelf) km have been recovered in different conditions. “It will take years to restore and sort the documents“, said Gisela Fleckenstein. “Die several papers and collections are one big mess.“
What do we learn from Cologne Historical Archive's collapse? (Die Welt via Archivalia)
" ..... that we must deal with our history more careful. This is not about a building in Cologne that collapsed but about our historical memory. Therefore this collapse is a societal problem, in which the politics has got more involved. Knowledge and concepts exist, only financing is missing. In general, we need a wider awareness of our archives, for they store our history and make it researchable…” , said Jochen Hermel (Institute for History, University of Bonn; Hermel works on his PhD thesis about integration of migrants to the City of Cologne in the 16th and the beginning 17th century)
Frank.Schloeffel - am Sonntag, 19. April 2009, 19:14 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.wdl.org/en/item/2828/
Die derzeit sichtbaren 9 Bücher der Brown Library sind, soweit ersichtlich, nicht auf der Bibliothekswebsite einsehbar.
Die derzeit sichtbaren 9 Bücher der Brown Library sind, soweit ersichtlich, nicht auf der Bibliothekswebsite einsehbar.
KlausGraf - am Sonntag, 19. April 2009, 18:14 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://kitlv.pictura-dp.nl/
Die Bilder sind vergrößerbar, aber der angebotene Download bietet nur eine sehr kleine Ansicht.

Die Bilder sind vergrößerbar, aber der angebotene Download bietet nur eine sehr kleine Ansicht.

KlausGraf - am Sonntag, 19. April 2009, 17:39 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://bibliodyssey.blogspot.com/2009/04/world-digital-library.html
http://www.wdl.org/en/
Aber bereits heute sind Teile des Inhalts sichtbar. Appetithappen bietet in einem wie immer wunderbaren Eintrag Peacay.
Der Viewer erlaubt ein Zoomen. Download eines TIFs, das in der Größe reduziert ist (3 MB), ist z.B: bei der Karte des belgischen Kongo möglich:
http://www.wdl.org/en/item/59/zoom.html

http://www.wdl.org/en/
Aber bereits heute sind Teile des Inhalts sichtbar. Appetithappen bietet in einem wie immer wunderbaren Eintrag Peacay.
Der Viewer erlaubt ein Zoomen. Download eines TIFs, das in der Größe reduziert ist (3 MB), ist z.B: bei der Karte des belgischen Kongo möglich:
http://www.wdl.org/en/item/59/zoom.html

KlausGraf - am Sonntag, 19. April 2009, 16:43 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
http://www.europeana.eu/portal/
Gibt man Gmünd ein und wählt man als Provider das Landesarchiv Baden-Württemberg, kommt man zu Patentanmeldungen. Sowohl bei dem Klick ufs Bild als auch bei dem (sonst hilfreichen) Klick auf "View in original Kontext" kommt man nur auf ein unbrauchbares Thumbnail:

Originalgröße!
Wenn man die in den Metadaten angegebene URL http://tinyurl.com/c3dqbs kopiert und aufruft, kommt man auch nicht auf das Archivale, dessen Signatur sich erst bei einem Klick auf more in dem sog. "Identifier" enthüllt: E 170 a Bü 863
Und da Wochenende ist, funktioniert auch die Findbuchdatenbank des Landesarchivs nicht. Man kann also das Stück nicht aufrufen, um es in brauchbarer Größe anzusehen.
Danke liebes Landesarchiv, dass du alle meine Vorurteile gegen Europeana und Deinen eigenen Pfusch bestätigst!
http://archiv.twoday.net/search?q=europeana
Gibt man Gmünd ein und wählt man als Provider das Landesarchiv Baden-Württemberg, kommt man zu Patentanmeldungen. Sowohl bei dem Klick ufs Bild als auch bei dem (sonst hilfreichen) Klick auf "View in original Kontext" kommt man nur auf ein unbrauchbares Thumbnail:
Originalgröße!
Wenn man die in den Metadaten angegebene URL http://tinyurl.com/c3dqbs kopiert und aufruft, kommt man auch nicht auf das Archivale, dessen Signatur sich erst bei einem Klick auf more in dem sog. "Identifier" enthüllt: E 170 a Bü 863
Und da Wochenende ist, funktioniert auch die Findbuchdatenbank des Landesarchivs nicht. Man kann also das Stück nicht aufrufen, um es in brauchbarer Größe anzusehen.
Danke liebes Landesarchiv, dass du alle meine Vorurteile gegen Europeana und Deinen eigenen Pfusch bestätigst!
http://archiv.twoday.net/search?q=europeana
KlausGraf - am Sonntag, 19. April 2009, 16:29 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/detail.php?template=hp_artikel&id=48359&id2=&sprache=de
5. Aktionstag für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts am 5. September 2009 in Ludwigsburg
Der Einsturz des bedeutenden Historischen Archivs der Stadt Köln am 3. März 2009 und der Brand der berühmten Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar am 2. September 2004 haben in dramatischer Weise offenbart, dass einmaliges Kulturgut unwiederbringlich verloren gehen kann.
Angestoßen durch den Brand 2004 veranstalten die deutschen Archive und Bibliotheken jährlich Anfang September einen bundesweiten Aktionstag, um für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts zu werben. An diesem Tag wurde deutlich, wie gefährdet unser schriftliches Kulturerbe ist. Die Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksguts erfordert immense Anstrengungen.
In diesem Jahr wird der Aktionstag vom Landesarchiv Baden-Württemberg ausgerichtet. Am Samstag, den 5. September werden von 11.00 bis 17.00 Uhr auf dem Gelände der beiden Landesarchiv-Abteilungen in Ludwigsburg (Institut für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut und Staatsarchiv Ludwigsburg) eindrucksvolle Projekte der Bestandserhaltung vorgestellt. Veranstaltet wird der Aktionstag von der Allianz zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts unter dem Vorsitz der Staatsbibliothek zu Berlin. Mitwirken werden zahlreiche Archive und Bibliotheken aus ganz Deutschland.
5. Aktionstag für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts am 5. September 2009 in Ludwigsburg
Der Einsturz des bedeutenden Historischen Archivs der Stadt Köln am 3. März 2009 und der Brand der berühmten Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar am 2. September 2004 haben in dramatischer Weise offenbart, dass einmaliges Kulturgut unwiederbringlich verloren gehen kann.
Angestoßen durch den Brand 2004 veranstalten die deutschen Archive und Bibliotheken jährlich Anfang September einen bundesweiten Aktionstag, um für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts zu werben. An diesem Tag wurde deutlich, wie gefährdet unser schriftliches Kulturerbe ist. Die Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksguts erfordert immense Anstrengungen.
In diesem Jahr wird der Aktionstag vom Landesarchiv Baden-Württemberg ausgerichtet. Am Samstag, den 5. September werden von 11.00 bis 17.00 Uhr auf dem Gelände der beiden Landesarchiv-Abteilungen in Ludwigsburg (Institut für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut und Staatsarchiv Ludwigsburg) eindrucksvolle Projekte der Bestandserhaltung vorgestellt. Veranstaltet wird der Aktionstag von der Allianz zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts unter dem Vorsitz der Staatsbibliothek zu Berlin. Mitwirken werden zahlreiche Archive und Bibliotheken aus ganz Deutschland.
KlausGraf - am Sonntag, 19. April 2009, 16:25 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.pgdp.org/ols//tools/biblio.php?id=42a225d446b65
Title: Der Dunkelgraf
Author: Bechstein, Ludwig
Subject:
Image Source: Austrian Lit
Number of Pages: 476
Available Formats: Display of images from this source has not been permitted.
Bei den Distributed Proofreadern des US-Projekts Gutenberg kann man in der Regel inzwischen die Scans der korrekturgelesenen Bücher einsehen. Im Fall von Bechsteins Dunkelgraf aber nicht, was an Heuchelei gemahnt, denn das US-Projekt schert sich überhaupt nicht um europäische Urheberrechte und macht hierzulande noch geschützte Werke z.B. von Thomas Mann öffentlich zugänglich. In den USA aber hundertprozentig schutzlose Scans aber werden der Öffentlichkeit vorenthalten.
Man muss also ALO selbst aufsuchen:
http://alo.uibk.ac.at/webinterface/library/ALO-BOOK_V01?objid=12294
Title: Der Dunkelgraf
Author: Bechstein, Ludwig
Subject:
Image Source: Austrian Lit
Number of Pages: 476
Available Formats: Display of images from this source has not been permitted.
Bei den Distributed Proofreadern des US-Projekts Gutenberg kann man in der Regel inzwischen die Scans der korrekturgelesenen Bücher einsehen. Im Fall von Bechsteins Dunkelgraf aber nicht, was an Heuchelei gemahnt, denn das US-Projekt schert sich überhaupt nicht um europäische Urheberrechte und macht hierzulande noch geschützte Werke z.B. von Thomas Mann öffentlich zugänglich. In den USA aber hundertprozentig schutzlose Scans aber werden der Öffentlichkeit vorenthalten.
Man muss also ALO selbst aufsuchen:
http://alo.uibk.ac.at/webinterface/library/ALO-BOOK_V01?objid=12294
KlausGraf - am Sonntag, 19. April 2009, 15:29 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://romeyn.dpc.uba.uva.nl/
Zahlreiche Bücher wurden digitalisiert und stehen mit Zoomify-Funktion zur Ansicht bereit, darunter auch ein deutschsprachiger Titel von 1702: "Sterben und Erben" (Theologie nicht Recht):
http://romeyn.dpc.uba.uva.nl/rdh/id/rdh.214743616

Zu vergleichbaren Angeboten in den Niederlanden:
http://wiki.netbib.de/coma/DigiWesten
Zahlreiche Bücher wurden digitalisiert und stehen mit Zoomify-Funktion zur Ansicht bereit, darunter auch ein deutschsprachiger Titel von 1702: "Sterben und Erben" (Theologie nicht Recht):
http://romeyn.dpc.uba.uva.nl/rdh/id/rdh.214743616

Zu vergleichbaren Angeboten in den Niederlanden:
http://wiki.netbib.de/coma/DigiWesten
KlausGraf - am Sonntag, 19. April 2009, 15:00 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://digitalearchivaris.blogspot.com/2009/04/brabantse-kaarten-online.html
Bilddatenbank Historische Karten von Brabant
http://www.brabantinkaart.nl/
Die Bilder sind mit Zoomify sehr stark vergrößerbar.

Bilddatenbank Historische Karten von Brabant
http://www.brabantinkaart.nl/
Die Bilder sind mit Zoomify sehr stark vergrößerbar.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Bauforschungslager des Dessauer Bauhausarchivs kann nun im Rahmen von Führungen besichtigt werden:
http://www.art-magazin.de/newsticker/index.html?news_id=3223
http://www.bauhaus-dessau.de/index.php?bauforschungsarchiv
http://www.art-magazin.de/newsticker/index.html?news_id=3223
http://www.bauhaus-dessau.de/index.php?bauforschungsarchiv
KlausGraf - am Sonntag, 19. April 2009, 14:27 - Rubrik: Architekturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wide Screen, ein filmwissenschaftliches Open-Access-Journal liegt jetzt in der ersten Ausgabe vor. Die einzelnen Beiträge (HTML und PDF) stehen unter CC-by-3.0-Lizenz.
[via filmtagebuch]
[via filmtagebuch]
Clemens Radl - am Sonntag, 19. April 2009, 13:35 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Im Kölner Stadtanzeiger vom 18.4.2009 sucht das Amt für Informationsverarbeitung der Stadt Köln ab sofort eine/n DV-Systemtechniker/in für die Infrastrukturplanung/ Historisches Archiv
Laut dieser Stellenausschreibung umfasst das Aufgabengebiet im Wesentlichen:
- Entwicklung und Fortschreibung einer Konzeption für die IT-Architektur des neu aufzubauenden historischen Archivs unter Finbindung der Fachanwendungen
- Weiterentwicklung und Betreuung der Arbeitsplatz- und Fach-IT-Infrastruktur für das Historische Archiv
Aufgrund der besonderen Gegebenheiten fallen noch folgende Tätigkeiten an:
- Bewertung von angebotenen IT-Infrastrukturvorschlägen zur Unterstützung der anstehenden Restaurierungs- und Digitalisierungsarbeiten
- Anwendung und Betreuung der eingesetzten Großformat-Scanner und der eingesetzten Erschließungssoftware "ActaPro"
Vorausgesetzt wird ein abgeschlossenes (Fach)Hochschulstudium bevorzugt in den Fachrichtungen Informatik bzw. Wirtschaftsinformatik oder eine entsprechende Tätigkeit als sonstiger Angestellter/sonstige Angestellte mit mehrjähriger Berufserfahrung.
Wünschenswert sind neben einem hohen Interesse an den Aufgaben eines Historischen Archivs Kenntnisse und Erfahrungen im Betrieb von Dokumenten-, Vorgangsmanagement- und Archivierungssystemen, Kenntnisse in XML, Adobe Acrobat sowie PDF und PDF/a und mindestens eine Programmiersprache, Kenntnisse über die Erschließungssoftware "ActaPro", das OAIS-Referenzmodell. Elektronische Kommunikationssysteme sowie Kenntnisse über die Konzepte "DOMEA" und "ArchiSig".
Über die Vergütung werden keine Angaben gemacht.
Als Ansprechpartner wird Herr Brühl, Tel. 0221 - 221 - 26858, genannt.
Laut dieser Stellenausschreibung umfasst das Aufgabengebiet im Wesentlichen:
- Entwicklung und Fortschreibung einer Konzeption für die IT-Architektur des neu aufzubauenden historischen Archivs unter Finbindung der Fachanwendungen
- Weiterentwicklung und Betreuung der Arbeitsplatz- und Fach-IT-Infrastruktur für das Historische Archiv
Aufgrund der besonderen Gegebenheiten fallen noch folgende Tätigkeiten an:
- Bewertung von angebotenen IT-Infrastrukturvorschlägen zur Unterstützung der anstehenden Restaurierungs- und Digitalisierungsarbeiten
- Anwendung und Betreuung der eingesetzten Großformat-Scanner und der eingesetzten Erschließungssoftware "ActaPro"
Vorausgesetzt wird ein abgeschlossenes (Fach)Hochschulstudium bevorzugt in den Fachrichtungen Informatik bzw. Wirtschaftsinformatik oder eine entsprechende Tätigkeit als sonstiger Angestellter/sonstige Angestellte mit mehrjähriger Berufserfahrung.
Wünschenswert sind neben einem hohen Interesse an den Aufgaben eines Historischen Archivs Kenntnisse und Erfahrungen im Betrieb von Dokumenten-, Vorgangsmanagement- und Archivierungssystemen, Kenntnisse in XML, Adobe Acrobat sowie PDF und PDF/a und mindestens eine Programmiersprache, Kenntnisse über die Erschließungssoftware "ActaPro", das OAIS-Referenzmodell. Elektronische Kommunikationssysteme sowie Kenntnisse über die Konzepte "DOMEA" und "ArchiSig".
Über die Vergütung werden keine Angaben gemacht.
Als Ansprechpartner wird Herr Brühl, Tel. 0221 - 221 - 26858, genannt.
genea - am Sonntag, 19. April 2009, 11:32 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://plus7.arte.tv/de/detailPage/1697660,CmC=2572770,scheduleId=2539148.html
1752 wurde in Herculaneum, dem heutigen Ercolano, eine antike Bibliothek gefunden, die im Jahr 79 nach Christus beim historischen Ausbruch des Vesuvs unter heißer Asche begraben worden war. Überraschenderweise waren an die 2.000 Papyrusrollen - wenn auch zum Teil verkohlt - erhalten geblieben. Aus diesen Funden konnten seitdem verschiedene philosophische Texte entschlüsselt und veröffentlicht werden. Doch eine große Zahl der "Papyri" ist noch immer ungelesen.
"Vom Vesuv verschüttet" zeigt die seit 250 Jahren unternommenen Anstrengungen, diese kostbaren Manuskripte aufzurollen und zu entziffern. Dank fortgeschrittener Technologien, insbesondere der multispektralen Bildgebung, können heute sogar verkohlte Manuskripte lesbar gemacht werden, ohne dass sie zerstört werden.
Die Sendung steht nur 7 Tage online.
1752 wurde in Herculaneum, dem heutigen Ercolano, eine antike Bibliothek gefunden, die im Jahr 79 nach Christus beim historischen Ausbruch des Vesuvs unter heißer Asche begraben worden war. Überraschenderweise waren an die 2.000 Papyrusrollen - wenn auch zum Teil verkohlt - erhalten geblieben. Aus diesen Funden konnten seitdem verschiedene philosophische Texte entschlüsselt und veröffentlicht werden. Doch eine große Zahl der "Papyri" ist noch immer ungelesen.
"Vom Vesuv verschüttet" zeigt die seit 250 Jahren unternommenen Anstrengungen, diese kostbaren Manuskripte aufzurollen und zu entziffern. Dank fortgeschrittener Technologien, insbesondere der multispektralen Bildgebung, können heute sogar verkohlte Manuskripte lesbar gemacht werden, ohne dass sie zerstört werden.
Die Sendung steht nur 7 Tage online.
KlausGraf - am Sonntag, 19. April 2009, 03:38 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der unbekannte Einsender, der in Pahls neuer Nationalchronik 1823 auf die Erfurter Parallele zum Aalener Spion aufmerksam machte, gibt als Zitat: Geßner in seinen von Niklas herausgegebenen Vorlesungen über seine Isagoge in eruditionem universam II. 611, während Bauer im Aalener Jahrbuch 1990, S. 243 einen Anhang zu Johann Matthias Gesners "Einführung in die allgemeine Bildung", hervorgegangen aus Vorlesungen des Johann Nicolaus Niclas, Bd. 2, Leipzig 1775 nennt. Letzteres Zitat ist natürlich falsch: Es gibt nur eine lateinische Ausgabe von Gesners Werk, über den die Wikipedia einen Artikel hat:
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Matthias_Gesner
Niclas war der Herausgeber dieses Werks. Man findet die Ausgabe von 1775 im GBV:
Titel:
Io. Matthi. Gesneri Primae Lineae Isagoges In Ervditionem Vniversalem, Nominatim Philologiam, Historiam Et Philosophiam In Vsvm Praelectionvm Dvctae / Accedvnt Nvnc Praelectiones Ipsae Per Io. Nicolavm Niclas
Teil:
Tomvs II
Verfasser:
Gesner, Johann Matthias *1691-1761*
Sonst. Personen:
Niclas, Johann Nicolaus *1733-1808*
Wense, Ernst August Wilhelm von der [Widmungsempfänger]
Erschienen:
Lipsiae Svmptibvs Caspari Fritsch, 1775
Drucker:
Fritsch, Kaspar
Umfang:
[8] Bl., 674 S., [35] Bl. ; 8°
Fingerprint:
ate- o-r- i-re arsu 3 1775R 2
Anmerkung:
Schlüsselseiten nach dem Exemplar der FB Gotha: Phil 8° 01883/04 (02)
Die Seitenangabe II.611 kann sich nicht auf die in Mannheim digitalisierte Ausgabe von 1784 beziehen, denn dort findet sich im zweiten Band auf S. 611 nicht die gesuchte Anekdote. Das ganze Buch durchlesen kam nicht in Frage, im Register ist zum Lemma Erfurt nichts zu finden. Was tun?
Die Seitenzählung der Ausgabe 1784 endet mit 644, die der von 1775 mit 674. Dreisatz: Angenommen, in der Ausgabe 1775 ist S. 611 richtig, dann müsste die Stelle in der Ausgabe 1784 etwa auf der Seite x = 644*611/674= 583 stehen (ich benutze immer den Taschenrechner von Google im PC). Und wo steht sie? Auf S. 584:
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/gesner2/t2/jpg/s584.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Matthias_Gesner
Niclas war der Herausgeber dieses Werks. Man findet die Ausgabe von 1775 im GBV:
Titel:
Io. Matthi. Gesneri Primae Lineae Isagoges In Ervditionem Vniversalem, Nominatim Philologiam, Historiam Et Philosophiam In Vsvm Praelectionvm Dvctae / Accedvnt Nvnc Praelectiones Ipsae Per Io. Nicolavm Niclas
Teil:
Tomvs II
Verfasser:
Gesner, Johann Matthias *1691-1761*
Sonst. Personen:
Niclas, Johann Nicolaus *1733-1808*
Wense, Ernst August Wilhelm von der [Widmungsempfänger]
Erschienen:
Lipsiae Svmptibvs Caspari Fritsch, 1775
Drucker:
Fritsch, Kaspar
Umfang:
[8] Bl., 674 S., [35] Bl. ; 8°
Fingerprint:
ate- o-r- i-re arsu 3 1775R 2
Anmerkung:
Schlüsselseiten nach dem Exemplar der FB Gotha: Phil 8° 01883/04 (02)
Die Seitenangabe II.611 kann sich nicht auf die in Mannheim digitalisierte Ausgabe von 1784 beziehen, denn dort findet sich im zweiten Band auf S. 611 nicht die gesuchte Anekdote. Das ganze Buch durchlesen kam nicht in Frage, im Register ist zum Lemma Erfurt nichts zu finden. Was tun?
Die Seitenzählung der Ausgabe 1784 endet mit 644, die der von 1775 mit 674. Dreisatz: Angenommen, in der Ausgabe 1775 ist S. 611 richtig, dann müsste die Stelle in der Ausgabe 1784 etwa auf der Seite x = 644*611/674= 583 stehen (ich benutze immer den Taschenrechner von Google im PC). Und wo steht sie? Auf S. 584:
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/gesner2/t2/jpg/s584.html

KlausGraf - am Samstag, 18. April 2009, 23:37 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 18. April 2009, 20:45 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sehr häufig sind bei den Münchner Google-Digitalisaten gravierende Scanfehler, wie man etwa an der Bauer'schen Geschichte Aalens von 1852 sieht:
http://books.google.com/books?id=XF0AAAAAcAAJ&pgis=1
Sie ist nur mit US-Proxy abrufbar, obwohl normalerweise Bücher bis 1867 in Vollanzeige präsentiert werden. Die Scans sind unbrauchbar, so gut wie alle Scans sind von geringer Qualität, viele Seiten sind unleserlich.

http://books.google.com/books?id=XF0AAAAAcAAJ&pgis=1
Sie ist nur mit US-Proxy abrufbar, obwohl normalerweise Bücher bis 1867 in Vollanzeige präsentiert werden. Die Scans sind unbrauchbar, so gut wie alle Scans sind von geringer Qualität, viele Seiten sind unleserlich.

KlausGraf - am Samstag, 18. April 2009, 17:15 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
http://medienkulturblog.de/2009/04/18/das-kunstwerk-im-zeitalter-seiner-digitalen-reproduzierbarkeit/
Ein Aufbäumen gegen die voranschreitende Digitalisierung der Kunstprodukte, wie es momentan bei den Pirate Bay-Betreibern mittels Haftstrafen versucht wird, ist hoffnungslos und rechtlich zumindest inkonsequent. Solcherart Netzwerke scheinen wie eine Hydra gebaut: Schlägt man einen Betreiber zu Boden, kommen sofort zwei neue nach – wie Marcel Weiss zu diesem Fall richtigerweise schreibt.
Welche Auswege für digitale Kunst und vor allem ihre Schöpfer gibt es? Die Idee, die aufgeworfen wurde, ist die monetäre Freigabe des Kunstwerks. Simplifiziert ausgedrückt: Art for free! Die Kunst selber wird zum Preis von Null Euro an jeden Interessierten abgegeben – ganz so wie es momentan illegalerweise in Filesharingnetzen oder legalerweiser vom Künstler selbst auf Plattformen wie myspace stattfindet. Macel Weiss begründet diese Vorgangsweise mit den variablen Grenzkosten der Produktion – da das Grenzkostenprinzip hier (aus rein theoretischer Perspektivierung) an seine eigenen Grenzen zu stoßen scheint, werde ich nur von den Fixkosten sprechen, also den Kosten der Produktion des Kunstwerks an sich. Das können unter anderem Zeit, Material, Schaffenskraft, technische Hilfsmittel und ähnliches sein. Die Kosten der digitalen Reproduzierung des Werks (sozusagen die variablen Grenzkosten) gehen gegen Null.
Wie nun sollte der Künstler es aber schaffen, dass die Fixkosten gedeckt werden? Wovon soll der arme Mann oder die arme Frau leben, wenn das einzig habhafte das Werk selber ist? Die Autoren gehen hier sinnigerweise von einer Umwegrentabilität des kostenlosen Kunstangebots aus. Während nämlich das Kunstwerk selber keine direkten Einnahmen mehr erzielt, werden diese Einnahmen durch andere Formen der Refinanzierung hereingeholt. Abgesehen von staatlichen oder öffentlich-rechtlichen Mischfinanzierungen wie Kulturförderung oder Kulturflatrate – die hier einmal aus Gründen der Einfachheit außen vor gelassen und als on-top betrachtet werden – gibt es alternative Möglichkeiten der Einnahmenlukrierung: In der Musik sind dies nach Marcel Weiss u.a. Live-Auftritte (Konzerte, DJ-Drehtellerabende), Merchandising, Spenden, phyische Sondereditionen der Tonträger sowie kostenpflichtigen Zugang (man könnte auch Aufmerksamkeit sagen) zum Künstler selbst. Auf den Buchmarkt umgelegt sieht es bei Leander Wattig ähnlich aus: Live-Auftritte wie Lesungen, Spezialausgaben, wiederum Spenden und ebenso Merchandisigng wären hier die strukurell ähnlichen Einnahmepotentiale.
Der Filmmarkt hat hier interessanterweise schon einiges vorweggenommen, wobei sich eine besondere Genreabhängigkeit abzeichnet: So ist mit Georg Lucas das Merchandising an den Rand der Pervertierung perfektioniert worden. Sondereditionen gibt es in großer Vielzahl, dies vor allem auch im Bereich des Autorenfilms (und ähnlicher ‚Kunstfilme’), wo ein nettes Booklet weiterführende Informationen und Einordnungen in die Filmgeschichte bereithält und sich bestimmte Verpackungen (siehe beispielsweise die Aluminiumausgabe von Quentin Tarantinos Death Proof) sehr gut im Regal der häuslichen Wohnung machen (bedenke: Distinktionsgewinne!). Auch ist und bleibt es vorerst ein Unterschied, einen Film im gut ausgestatteten Filmpalast oder im Heimkino zu bestaunen – wobei dies nur noch eine Möglichkeit der Rezeption darstellt. Zugang zum Künstler gibt es wiederum vor allem im Science-Ficition Bereich durch die bekannten Conventions, welche sich zum Teil durch Eintrittsgelder finanzieren. Spenden sind hier bisher eher institutionalisert durch private und öffentliche Preisgelder sowie (v.a. staatliche) Produktionszuschüsse zur Senkung der Kosten vorhanden. Im Medium Film kann man also schon lange nicht mehr von einer reinen Finanzierung qua Werksverkauf sprechen.
Ein Aufbäumen gegen die voranschreitende Digitalisierung der Kunstprodukte, wie es momentan bei den Pirate Bay-Betreibern mittels Haftstrafen versucht wird, ist hoffnungslos und rechtlich zumindest inkonsequent. Solcherart Netzwerke scheinen wie eine Hydra gebaut: Schlägt man einen Betreiber zu Boden, kommen sofort zwei neue nach – wie Marcel Weiss zu diesem Fall richtigerweise schreibt.
Welche Auswege für digitale Kunst und vor allem ihre Schöpfer gibt es? Die Idee, die aufgeworfen wurde, ist die monetäre Freigabe des Kunstwerks. Simplifiziert ausgedrückt: Art for free! Die Kunst selber wird zum Preis von Null Euro an jeden Interessierten abgegeben – ganz so wie es momentan illegalerweise in Filesharingnetzen oder legalerweiser vom Künstler selbst auf Plattformen wie myspace stattfindet. Macel Weiss begründet diese Vorgangsweise mit den variablen Grenzkosten der Produktion – da das Grenzkostenprinzip hier (aus rein theoretischer Perspektivierung) an seine eigenen Grenzen zu stoßen scheint, werde ich nur von den Fixkosten sprechen, also den Kosten der Produktion des Kunstwerks an sich. Das können unter anderem Zeit, Material, Schaffenskraft, technische Hilfsmittel und ähnliches sein. Die Kosten der digitalen Reproduzierung des Werks (sozusagen die variablen Grenzkosten) gehen gegen Null.
Wie nun sollte der Künstler es aber schaffen, dass die Fixkosten gedeckt werden? Wovon soll der arme Mann oder die arme Frau leben, wenn das einzig habhafte das Werk selber ist? Die Autoren gehen hier sinnigerweise von einer Umwegrentabilität des kostenlosen Kunstangebots aus. Während nämlich das Kunstwerk selber keine direkten Einnahmen mehr erzielt, werden diese Einnahmen durch andere Formen der Refinanzierung hereingeholt. Abgesehen von staatlichen oder öffentlich-rechtlichen Mischfinanzierungen wie Kulturförderung oder Kulturflatrate – die hier einmal aus Gründen der Einfachheit außen vor gelassen und als on-top betrachtet werden – gibt es alternative Möglichkeiten der Einnahmenlukrierung: In der Musik sind dies nach Marcel Weiss u.a. Live-Auftritte (Konzerte, DJ-Drehtellerabende), Merchandising, Spenden, phyische Sondereditionen der Tonträger sowie kostenpflichtigen Zugang (man könnte auch Aufmerksamkeit sagen) zum Künstler selbst. Auf den Buchmarkt umgelegt sieht es bei Leander Wattig ähnlich aus: Live-Auftritte wie Lesungen, Spezialausgaben, wiederum Spenden und ebenso Merchandisigng wären hier die strukurell ähnlichen Einnahmepotentiale.
Der Filmmarkt hat hier interessanterweise schon einiges vorweggenommen, wobei sich eine besondere Genreabhängigkeit abzeichnet: So ist mit Georg Lucas das Merchandising an den Rand der Pervertierung perfektioniert worden. Sondereditionen gibt es in großer Vielzahl, dies vor allem auch im Bereich des Autorenfilms (und ähnlicher ‚Kunstfilme’), wo ein nettes Booklet weiterführende Informationen und Einordnungen in die Filmgeschichte bereithält und sich bestimmte Verpackungen (siehe beispielsweise die Aluminiumausgabe von Quentin Tarantinos Death Proof) sehr gut im Regal der häuslichen Wohnung machen (bedenke: Distinktionsgewinne!). Auch ist und bleibt es vorerst ein Unterschied, einen Film im gut ausgestatteten Filmpalast oder im Heimkino zu bestaunen – wobei dies nur noch eine Möglichkeit der Rezeption darstellt. Zugang zum Künstler gibt es wiederum vor allem im Science-Ficition Bereich durch die bekannten Conventions, welche sich zum Teil durch Eintrittsgelder finanzieren. Spenden sind hier bisher eher institutionalisert durch private und öffentliche Preisgelder sowie (v.a. staatliche) Produktionszuschüsse zur Senkung der Kosten vorhanden. Im Medium Film kann man also schon lange nicht mehr von einer reinen Finanzierung qua Werksverkauf sprechen.
KlausGraf - am Samstag, 18. April 2009, 17:00 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://delicious.com/cvanderven/twitterendearchivaris
http://liswiki.org/wiki/Microblogs
http://twittgroups.com/group/archives
http://liswiki.org/wiki/Microblogs
http://twittgroups.com/group/archives
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 18. April 2009, 14:15 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 18. April 2009, 13:13 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das VÖB Blog macht auf einen Werbeartikel für den Wiener Phaidra Viewer aufmerksam:
http://comment.univie.ac.at/09-1/13/
Was soll man von einem Angebot halten, bei dem die Blätter- und Suchfunktion offensichtlich gerade nicht funktioniert und das verlinkte Beispiel für eine Einzelseite kein Bild zeigt? Zudem sind andere Viewer schneller und unkomplizierter. Das ist der Technologiestandort Österreich!
http://comment.univie.ac.at/09-1/13/
Was soll man von einem Angebot halten, bei dem die Blätter- und Suchfunktion offensichtlich gerade nicht funktioniert und das verlinkte Beispiel für eine Einzelseite kein Bild zeigt? Zudem sind andere Viewer schneller und unkomplizierter. Das ist der Technologiestandort Österreich!
KlausGraf - am Samstag, 18. April 2009, 13:04 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Update zu:
http://archiv.twoday.net/search?q=Settlement
Wiss. Abhandlung
The Google Book Search Settlement: A New Orphan-Works Monopoly?
Randal C. Picker
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1387582
Wiss. Abhandlung von James Grimmelmann
http://www.acslaw.org/files/Grimmelmann%20Issue%20Brief.pdf
Überblick über die jüngsten Entwicklungen
http://bits.blogs.nytimes.com/2009/04/17/opposition-to-google-books-settlement/
Intervention des Internetarchivs
http://www.scribd.com/doc/14308286/Internet-Archive-Intervention-Google-Book-Search-
Pamela Samuelson hebt auch auf das Monopol Googles hinsichtlich der verwaisten Werke ab:
http://radar.oreilly.com/2009/04/legally-speaking-the-dead-soul.html
Zitat: If asked, the authors of orphan books in major research libraries might well prefer for their books to be available under Creative Commons licenses or put in the public domain so that fellow researchers could have greater access to them. The BRR will have an institutional bias against encouraging this or considering what terms of access most authors of books in the corpus would want.
Interview mit Wolfgang Schimmel (VG Wort) von Schulzki-Haddouti
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30120/1.html
(Zu CC-Lizenzen heißt es: "Denn wenn ich jede nichtkommerzielle Nutzung erlaube, kann es sein, dass ich damit auch beliebiges Kopieren erlaube. Entsprechend der BGH-Druckerentscheidung vom 6. Dezember 2007 (Az. I ZR 94/05) kommt dann die urheberrechtliche Schranke nicht mehr zu Tragen. Aber das ist juristisch höchst umstritten und liegt derzeit beim Bundesverfassungsgericht zur Prüfung." Ich kann einen solchen Schluss aus der Druckerentscheidung beim besten Willen nicht nachvollziehen. Wer Werke unter freier Lizenz freigibt, verzichtet damit nicht auf Vergütungsansprüche, die ihm gesetzlich zustehen und die er nur über eine VG geltend machen kann.)
http://archiv.twoday.net/search?q=Settlement
Wiss. Abhandlung
The Google Book Search Settlement: A New Orphan-Works Monopoly?
Randal C. Picker
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1387582
Wiss. Abhandlung von James Grimmelmann
http://www.acslaw.org/files/Grimmelmann%20Issue%20Brief.pdf
Überblick über die jüngsten Entwicklungen
http://bits.blogs.nytimes.com/2009/04/17/opposition-to-google-books-settlement/
Intervention des Internetarchivs
http://www.scribd.com/doc/14308286/Internet-Archive-Intervention-Google-Book-Search-
Pamela Samuelson hebt auch auf das Monopol Googles hinsichtlich der verwaisten Werke ab:
http://radar.oreilly.com/2009/04/legally-speaking-the-dead-soul.html
Zitat: If asked, the authors of orphan books in major research libraries might well prefer for their books to be available under Creative Commons licenses or put in the public domain so that fellow researchers could have greater access to them. The BRR will have an institutional bias against encouraging this or considering what terms of access most authors of books in the corpus would want.
Interview mit Wolfgang Schimmel (VG Wort) von Schulzki-Haddouti
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30120/1.html
(Zu CC-Lizenzen heißt es: "Denn wenn ich jede nichtkommerzielle Nutzung erlaube, kann es sein, dass ich damit auch beliebiges Kopieren erlaube. Entsprechend der BGH-Druckerentscheidung vom 6. Dezember 2007 (Az. I ZR 94/05) kommt dann die urheberrechtliche Schranke nicht mehr zu Tragen. Aber das ist juristisch höchst umstritten und liegt derzeit beim Bundesverfassungsgericht zur Prüfung." Ich kann einen solchen Schluss aus der Druckerentscheidung beim besten Willen nicht nachvollziehen. Wer Werke unter freier Lizenz freigibt, verzichtet damit nicht auf Vergütungsansprüche, die ihm gesetzlich zustehen und die er nur über eine VG geltend machen kann.)
KlausGraf - am Samstag, 18. April 2009, 00:51 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 17. April 2009, 22:12 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://bovary.univ-rouen.fr/
Leider sind die Bilder zu klein. Zoomen kann, man wenn man auf manuscrit klickt, danke an
http://twitter.com/v_i_o_l_a/status/1545421470
Trotzdem könnten sie noch größer sein.
http://twitter.com/v_i_o_l_a/status/1545421470
Trotzdem könnten sie noch größer sein.
KlausGraf - am Freitag, 17. April 2009, 22:11 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Sehr guter Beitrag dazu
http://bibliothekarisch.de/blog/2009/04/17/hilfetipps-zur-onlinerecherche/
Leider werden meine eigenen goldenen Regeln dort ignoriert:
http://archiv.twoday.net/stories/3379542/
http://bibliothekarisch.de/blog/2009/04/17/hilfetipps-zur-onlinerecherche/
Leider werden meine eigenen goldenen Regeln dort ignoriert:
http://archiv.twoday.net/stories/3379542/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.hartung-hartung.de/
20 Erthal. - Inventarium. Inventarium über die Verlassenschaft weiland des Hochwürdigen... Herrn Carl Fridrich Wilhelm Freyherrn von Erthal zu Leutzendorf... Domstiftern zu Bamberg und Würzburg Kapitularn... so, wie sich solche dahier zu Würzburg vorzufinden hat. Deutsche Handschrift auf Papier. Ca. 1780. 365:215 mm. 1 Bl., 198 SS., 1 Bl. Hpgt. d. Zt.
Schätzpreis: (600,- €) / (792,- $)
Von einer Hand in sauberer Schrift mit brauner Tinte geschrieben. Interessantes, ausführliches Iventar der Besitztümer des Würzburger Domherren u. Geheimen Rates Karl Friedrich Wilhelm v. Erthal (1717-1780). Sorgfältig aufgelistet u. mit Schätz- u. Verkaufspreisen versehen sind: "An liegenden Güttern. An baarem Geld. An Activschulden. An Pretiosis" (Münzen, dabei: eine Sammlung des Königs Gustav Adolph v. Schweden, zahlr. Medaillen), "An Wein im großen Keller", Kirchensilber, Zinn, Tafelsilber, Porzellan, Fayencen, Skulpturen, Möbel, "An Chor und anderen Kleidern dann Leib=weißzeug, Damastzeuch", Waffen u. Jagdzubehör, "Mahlereyen", Bücher, nach Formaten geordnet (SS. 161-197). - Innen kaum fleckig, Einband leicht berieben.
***
21 Erthal. - Inventarium. Inventarium über die von der Verlassenschaft des Hochwohlgebohrnen Reichs Freyherrn Herrn Georg Philipp Valentin von Ehrthal, zu Würzburg noch vorfindliche, als auch die von dem Herrn Vicario Generali Freyherrn von Ehrthal neuerlich angeschafte Mobilien. Deutsche Handschrift auf Papier. Vermutl. Würzb. ca. 1770. Ca. 360:220 mm. 61 SS. Hpgt. d. Zt. mit hs. Vorderdeckelschildchen.
Schätzpreis: (400,- €) / (528,- $)
Von einer Hand in sauberer Schrift mit brauner Tinte geschrieben. - Es handelt sich hierbei um das Verzeichnis des Nachlasses des jüngeren Bruders von Carl Fridrich Wilhelm Freiherr von Erthal (siehe vorangehende Nr. im Katalog). Er war Fürstl. Würzburger Geh. Rat u. Ober-Schultheiß sowie Oberamtmann zu Trimberg. Verzeichnet sind die "Mobilien" aus Würzburg, jeweils mit Schätz- bzw. Verkaufspreisen: Silber (Kaffe-, Tee- u. Milchkannen, Saucieren usw.), Porzellan u. Fayencen, Tapeten, Spiegel, eingelegte Möbel, Schränke, Tische, Stühle, Sessel, Vorhänge, Wäsche, Lüster, das Inventar der verschiedenen Zimmer der Dienstleute (Köchin, Kutscher, Gouvernante, Kammerjungfer usw.), Kutschen u. Wagen, ferner 5 Bll. Inventar "An Mahlereyen zu Wirzburg". - Das Todesjahr von Gg. Ph. Valentin v. Erthal konnten wir nicht feststellen. - Meist sauber. SS. 46-49 oben gebräunt. Deckel beschabt, Rücken unten lädiert.
***
40 Romsthal/Oberhessen. - Hutten'sches Rittergut zu Romsthal. Rechnung über das Hochfreiherrlich Von Hutten Ritter Gut zu Romsthal - Romsthaler Amts-Rechnung 1744, 1761, 1787, 1794-95 u. 1816/17, 5 Bde. Nebst: "Schein und Beilagen zur Romsthaler Amts-Rechnung" 1784, u. 1787, 2 Bde., zus. 7 Bde. Deutsche Handschriften auf Papier. Romsthal 1744-1817. Fol. Hldr. d. Zt. mit Vorderdeckelschildchen (6), ein Bd. ungebunden.
Schätzpreis: (400,- €) / (528,- $)
Rechnungsbücher der Familie von Hutten aus dem Zweig vom Stolzenberg aus dem 18. Jhdt. bis 1817, teilweise mit den Originalbelegen in zwei separaten Bänden. Die Bücher sind teilw. von den Rechnungsführern unterschrieben: 1744 Franz Thomas Meisner, 1787 u. 1795 Franz Kaspar Hofmann, 1816/17 Franz Anton Neuwirth. - Gering fleckig. Die Rechnung vom Jahr 1761 ohne die SS. 1-16. Die Rechnung aus dem Jahr 1794-95 ohne Einband. Die Einbde. teilw. mit hübschem Buntpapierbezug (Kleisterpapier, Kattunpapier), mit Gebrauchsspuren. - Beiliegt: Belege zur Hochfreiherrlich Tannischen Lehns- u. Jurisdictions Geld-Rechnung 1787-89. Deutsche Handschrift auf Papier. O. O. 1789. Fol. 52 num. Bll. Hldr. d. Zt. mit Vorderdeckelschildchen. - Rücken lädiert.
***
1 Ackermann, Johannes. Directorium legentium. Lateinische Handschrift auf Papier. Blaubeuren 1500. 214:154 mm. 164 (st. 168) Bll. (1. u. le. 3 w.). Holzdeckelbd. d. Zt. mit blindgepr. Schafsldrbez. u. 2 Schl. (Schließbänder fehlen).
Schätzpreis: *R (4.000,- €) / (5.280,- $)
Ca. 35 Z., sorgfältige, stark abbreviierte Kursive, rubriziert u. mit roten Hervorhebungen, zahlreiche große Ordnungsbuchstaben in Rot, teilweise mit weiß ausgespartem Dekor, die 14 Zwölferlagen jeweils mit Numerierung auf dem ersten u. rot verzierter Kustode auf dem letzten Bl. - Die Handschrift beginnt Fol. 2r: "P(ro)logus in Directoriu(m) legentiu(m) fratris Joannis ackerman(n) ordinis S(an)cti Benedicti Monasterji Blaubur(e)ns(is) professi. 1500...", im Kolophon auf Fol. 165r werden Verfassernamen u. Jahreszahl wiederholt u. von dem Hinweis begleitet: "Sub regimine Vena(n)di pr(ior)is et d(o)m(ini) Gregorij abbatis... Numerus anno(rum) scribe(n)tis 68". Demnach war der Blaubeurer Benediktiner Johannes Ackermann wohl 1432 geboren. Weiteres ist über ihn nicht bekannt. Eine Zweit- oder Abschrift seines Wörterbuchs scheint sich im Nachlaß der Gebrüder Pez auf der Stiftsbibliothek Melk zu befinden. Mit "Gregorius abbas" ist der 1524 gestorbene Gregor Rösch gemeint, 1495-1522 Abt v. Blaubeuren. Ihm verdankte das im 14. u. 15. Jahrhundert heruntergekommene Kloster die Wiederherstellung eines geordneten Haushalts (siehe J. D. G. v. Memminger, Beschreibung des Oberamts Blaubeuren, 1830, SS. 114f.). Über einen Prior Venantius konnten wir nichts ermitteln.
Es fehlen die beschriebenen Bll. 12, 95, 156 u. 157. Das ursprünglich leere Anfangsbl. wurde auf den vorderen Innendeckel geleimt u. v. zeitgenössischer Hand mit stark abbreviierten Notizen versehen. Die 3 leeren Schlußbll. tragen Federproben v. alter Hand, vom vorletzten ist ein Großteil abgerissen, das letzte wurde auf den hinteren Innendeckel geleimt. Breitrandig u. kaum gebräunt oder fleckig, jedoch besonders zu Beginn u. am Schluß wurmstichig, Bindung teilweise gelockert, einige Bll. lose u. mit geringen Randmängeln. Der originale Blaubeurer Klostereinband (Streicheisenlinien, kl. Rosette im Rund, Granatapfel rhombisch) stark beschabt u. wurmst., oberes Kapital defekt, untere äußere Ecke des hinteren Holzdeckels durch Wurmfraß zerstört, die beiden Schließbänder fehlen. Beiliegt ein älterer Zettel mit dem Hinweis: "Das Stück stammt aus den im Jahr 1928 an die Landesbibliothek abgegebenen Resten der ehemaligen Benediktinerbibliothek und wurde als Erinnerungsstück zurückgegeben. (Altes Verzeichnis Nr. 38) - >Wir haben hier eine Art Lexikon vor uns<."
[Demnach dürfte die Handschrift von der Landesbibliothek Stuttgart an das Blaubeurer Seminar zurückgegeben worden sein, denn 1928 erfolgte in Maulbronn und Blaubeuren bei der Trennung von Staats- und Kirchenvermögen eine Abgabe historischer Buchbestände an die Landesbibliothek:
http://www.b2i.de/fabian?Evangelisch-Theologisches_Seminas
Nachtrag. Das Stück wird von Klaus Schreiner als in Stuttgart nicht nachweisbare Handschrift aus dem Restbestand der Blaubeurer Klosterbibliothek unter Berufung auf die Mittelalterlichen Bibliothekskataloge 1, 1918, S. 14 erwähnt. Blaubeuren, Sigmaringen 1986, S. 128 (auch zu weiteren Handschriften des 1507 gestorbenen Ackermann), S. 160 Anm. 194.
2. Nachtrag. Ein klarer Bild über die in Blaubeuren nach 1928 vorhandenen Bestände ist aus der Literatur nicht zu gewinnen. Glaubt man der regelmäßig unzuverlässigen Krämer, Handschriftenerbe, 1989, Bd. 1, S. 89 befanden sich damals noch 26 Handschriften in Blaubeuren, nämlich die von den Mittelalterlichen Bibliothekskatalogen I, S. 14f. aufgelisteten 27 Handschriften abzüglich II.C.88 = LB Stuttgart Cod. theol. et phil. 4°617, von der es ausdrücklich heißt, sie sei bis 1928 im Seminar von Blaubeuren gewesen. Ob Kaeppeli IV, 107 die Seminarhs. III.1.17 nach Autopsie oder in anderer Weise verlässlich lokalisieren konnte? Leuze schreibt im ZfBB 1929, S. 522 38 Handschriften und 94 Druckschriftenbände, darunter auch 20 in Stuttgart vorher nicht vorhandene Inkunabeln, seien in die Landesbibliothek gekommen, was mich an der Zahl von 26 in Blaubeuren verbliebenen Hss. zweifeln lässt. In Tübinger Inkunabelkatalog INKA erscheinen viele 1928 aus der Seminarbibliothek von Stuttgart übernommene Inkunabeln. Von einem Restbestand des Altbestands spricht Immo Eberl in seinem Beitrag zur Germania Benedictina 1975. Schreiner 1986 hat aus den vermutlich damals angelegten Cod. theol. et phil. Signaturen 614 ff. nur ganz wenige benutzt.
3. Nachtrag. Nach freundlicher Auskunft der LB Stuttgart wurde nur dieses eine Stück als "Andenken" an das Seminar zurückgegeben; die anderen bei Krämer aufgeführten Handschriften sind in Stuttgart, eine Liste/Konkordanz ist mir zugesagt.
4. Nachtrag: die Liste findet sich unter
http://archiv.twoday.net/stories/5664362/
5. Nachtrag: Die Handschrift wurde aus der Auktion genommen und der Landeskirche zurückgegeben:
http://archiv.twoday.net/stories/5707073/ ]
***
51 (Württembergische Chronik). Deutsche Handschrift auf Papier. Um 1605. 160:100 mm. 133 (st. ?) Bll. Pp. d. 18. Jhdts.
Schätzpreis: (240,- €) / (317,- $)
Inhalt: 1r-17v: Alphabetische Auflistung der wichtigsten Städte, jeweils mit mehreren dazu gehörigen Ortschaften. 19r-21r: "Praelaten Desz Hertzogthumbs Württemberg: Ordinis S. Benedicti. Ordinis S. Bernhardi". 21v-22v: "Sequitur Catalogus Abbatium In Bebenhausen" (bis 1570). 23r-98r: "Beschreybung Vihler Stätt Wie dieselben an Würthemberg komen". 98v-104: leer. 105r-134v: "Extract. Gemeiner Landtschafft In Württemberg Freyheitten vnnd Landtags Abschiede." Das späteste im Text genannte Jahr ist 1605. - Bl. 18 (vermutlich leer) fehlt, Gegenbl. 7 lose u. ausgefranst; am Fuß v. Bl. 134 bricht der Text ab. Leicht gebräunt u. wasserfl. Einbd. stark berieben u. bestoßen, Rücken defekt.
***
120 URKUNDEN. - Tengen/Baden-Württemberg. Register Des Einkommens beder gottsheuser unser lieben frowen pfarrkirchen zue Thengen und sant Catharinen in der stat welchen sant Anthoni capel uf der Steig incorporiert. - Compendium Des ganzen Einkommens unser lieben frauwen pfahrkirchen zo Tengen und dero einverleibten capellen sant Catharinae in der stat Keiserstuol... 2 deutsche Handschriften auf Papier. 1630-56. Ca. 330:105 mm. 68 SS.; 1 Bl., 59 SS., 1 Bl. Ohne Einbd. bzw. in Ms.-Pgt.-Umschl. (Missale um 1400).
Schätzpreis: *R (200,- €) / (264,- $)
Die erste Handschr. mit kl. naiver Federzeichnung der Tengener Marienkirche auf der 1. Seite. - Etwas fleckig u. abgegriffen, die jeweils ersten u. le. SS. stärker angeschmutzt, die ersten Bll. der ersten Handschr. an der oberen äußeren Ecke beschäd. (geringer Textverlust). In der zweiten Handschr. liegt ein Nachtrag v. 1657 bei (1 Faltbl. mit aufgedr. Siegel).
***
96 URKUNDEN. - Eisenberg, Thür. Deutsche Handschrift. Ca. 1520. Fol. 2 SS. Mit papiergedecktem Siegel.
Schätzpreis: (80,- €) / (106,- $)
Ungeltabrechnung der Stadt für Wein und Bier, gegliedert nach namentlich genannten 7 Wirten. - Aus Slg. Otto Hupp.
und andere mehr.
Dazu "280 Werke in 1660 Bänden aus einer süddeutschen Schloßbibliothek (mit einer Slg. "Cazinaden" > Kat.-Nrn. 2126-2176)"
Bei Nr. 2126 steht: Aus einer bayerischen Schloßbibliothek stammt die im folgenden angebotene Sammlung von 337 dekorativ gebundenen und wohlerhaltenen Bändchen aus der Produktion des Pariser Buchhändlers Hubert Martin Cazin (geboren 1724 zu Reims, ermordet 1795 zu Paris) und seiner Epigonen, aufgeteilt in 51 Lots. Die sogenannten "Cazinaden", zierliche und schön ausgestattete Büchlein meist galanten oder erotischen Inhalts im Klein-Oktav-Format, erfreuten sich großer Beliebtheit, wurden häufig gesammelt und von anderen Verlagen imitiert; die ganze Reihe umfaßt 437 Bände, von denen schon viele selten geworden sind.
Die vorliegenden Bändchen sind allesamt zeitgenössisch in hell- bis olivbraunem Kalbsleder gebunden, meist marmoriert, gefleckt oder gesprenkelt, mit dekorativer Rückenvergoldung, meist auch mit (teils mehrfachen) goldgeprägten Deckel- u. Stehkantenfileten, schmaler goldgeprägter Innenkantenleiste, Rückenschildchen, Goldschnitt und Marmor-, Kattun- oder anderem Buntpapiervorsatz. Teilweise scheint es sich um originale Verlagseinbände zu handeln. Der Erhaltungszustand der Bücher läßt - sowohl innen wie auch außen - kaum zu wünschen übrig.
Und ein Stück aus der Bibliothek des Staatsarchivs Bamberg:
162 Aventinus (Thurmair), Joh. Annalivm Boiorvm libri septem. Ingolst., Al. u. Sam. Weissenhorn, Dez. 1554. Fol. 30 Bll., 835 SS., mit Holzschn.-Portr. d. Verf. v. Hans Lautensack. Holzdeckelbd. d. Zt. mit Schweinsldrbez. mit reicher Deckelblindpr., 2 Schl.
Schätzpreis: (2.400,- €) / (3.168,- $)
Adams A 2308; Ebert 1433; Schmitt, Lautensack 69/70, 13 u. Abb. 8; Stalla 312; nicht b. Lentner u. Pfister. - Erste Ausgabe des berühmten, großangelegten Geschichtswerkes, mit dem schönen posthumen Porträt Aventins. - Auf kräftigem Papier, recht breitrandig. Teils etwas stockfl. oder gebräunt. Vereinzelt Unterstreichungen in feinem Tintenstrich u. wenige Marginalien mit brauner Tinte von alter Hand. Von den vereinzelten Stockflecken abgesehen Traumexemplar; ehemals im Eigentum des Staatsarchivs Bamberg: Tit. mit Besitzverm. aus dem 17. Jhdt. und unten mit zwei Bibl.-Stempeln sowie hs. Bibl.-Vermerk des Staatsarchivs vom 13.IV.1932: "Als überzählig abgegeben...". Der schöne zeitgenöss. Einbd. leicht beschabt, ob. Kapital mit geklebtem Einriß. Beide Deckel mit reicher Blindpr., u.a. unter Verwendung von drei verschiedenen Rollenstempeln mit Porträts u. Ornamenten.
#fnzhss
20 Erthal. - Inventarium. Inventarium über die Verlassenschaft weiland des Hochwürdigen... Herrn Carl Fridrich Wilhelm Freyherrn von Erthal zu Leutzendorf... Domstiftern zu Bamberg und Würzburg Kapitularn... so, wie sich solche dahier zu Würzburg vorzufinden hat. Deutsche Handschrift auf Papier. Ca. 1780. 365:215 mm. 1 Bl., 198 SS., 1 Bl. Hpgt. d. Zt.
Schätzpreis: (600,- €) / (792,- $)
Von einer Hand in sauberer Schrift mit brauner Tinte geschrieben. Interessantes, ausführliches Iventar der Besitztümer des Würzburger Domherren u. Geheimen Rates Karl Friedrich Wilhelm v. Erthal (1717-1780). Sorgfältig aufgelistet u. mit Schätz- u. Verkaufspreisen versehen sind: "An liegenden Güttern. An baarem Geld. An Activschulden. An Pretiosis" (Münzen, dabei: eine Sammlung des Königs Gustav Adolph v. Schweden, zahlr. Medaillen), "An Wein im großen Keller", Kirchensilber, Zinn, Tafelsilber, Porzellan, Fayencen, Skulpturen, Möbel, "An Chor und anderen Kleidern dann Leib=weißzeug, Damastzeuch", Waffen u. Jagdzubehör, "Mahlereyen", Bücher, nach Formaten geordnet (SS. 161-197). - Innen kaum fleckig, Einband leicht berieben.
***
21 Erthal. - Inventarium. Inventarium über die von der Verlassenschaft des Hochwohlgebohrnen Reichs Freyherrn Herrn Georg Philipp Valentin von Ehrthal, zu Würzburg noch vorfindliche, als auch die von dem Herrn Vicario Generali Freyherrn von Ehrthal neuerlich angeschafte Mobilien. Deutsche Handschrift auf Papier. Vermutl. Würzb. ca. 1770. Ca. 360:220 mm. 61 SS. Hpgt. d. Zt. mit hs. Vorderdeckelschildchen.
Schätzpreis: (400,- €) / (528,- $)
Von einer Hand in sauberer Schrift mit brauner Tinte geschrieben. - Es handelt sich hierbei um das Verzeichnis des Nachlasses des jüngeren Bruders von Carl Fridrich Wilhelm Freiherr von Erthal (siehe vorangehende Nr. im Katalog). Er war Fürstl. Würzburger Geh. Rat u. Ober-Schultheiß sowie Oberamtmann zu Trimberg. Verzeichnet sind die "Mobilien" aus Würzburg, jeweils mit Schätz- bzw. Verkaufspreisen: Silber (Kaffe-, Tee- u. Milchkannen, Saucieren usw.), Porzellan u. Fayencen, Tapeten, Spiegel, eingelegte Möbel, Schränke, Tische, Stühle, Sessel, Vorhänge, Wäsche, Lüster, das Inventar der verschiedenen Zimmer der Dienstleute (Köchin, Kutscher, Gouvernante, Kammerjungfer usw.), Kutschen u. Wagen, ferner 5 Bll. Inventar "An Mahlereyen zu Wirzburg". - Das Todesjahr von Gg. Ph. Valentin v. Erthal konnten wir nicht feststellen. - Meist sauber. SS. 46-49 oben gebräunt. Deckel beschabt, Rücken unten lädiert.
***
40 Romsthal/Oberhessen. - Hutten'sches Rittergut zu Romsthal. Rechnung über das Hochfreiherrlich Von Hutten Ritter Gut zu Romsthal - Romsthaler Amts-Rechnung 1744, 1761, 1787, 1794-95 u. 1816/17, 5 Bde. Nebst: "Schein und Beilagen zur Romsthaler Amts-Rechnung" 1784, u. 1787, 2 Bde., zus. 7 Bde. Deutsche Handschriften auf Papier. Romsthal 1744-1817. Fol. Hldr. d. Zt. mit Vorderdeckelschildchen (6), ein Bd. ungebunden.
Schätzpreis: (400,- €) / (528,- $)
Rechnungsbücher der Familie von Hutten aus dem Zweig vom Stolzenberg aus dem 18. Jhdt. bis 1817, teilweise mit den Originalbelegen in zwei separaten Bänden. Die Bücher sind teilw. von den Rechnungsführern unterschrieben: 1744 Franz Thomas Meisner, 1787 u. 1795 Franz Kaspar Hofmann, 1816/17 Franz Anton Neuwirth. - Gering fleckig. Die Rechnung vom Jahr 1761 ohne die SS. 1-16. Die Rechnung aus dem Jahr 1794-95 ohne Einband. Die Einbde. teilw. mit hübschem Buntpapierbezug (Kleisterpapier, Kattunpapier), mit Gebrauchsspuren. - Beiliegt: Belege zur Hochfreiherrlich Tannischen Lehns- u. Jurisdictions Geld-Rechnung 1787-89. Deutsche Handschrift auf Papier. O. O. 1789. Fol. 52 num. Bll. Hldr. d. Zt. mit Vorderdeckelschildchen. - Rücken lädiert.
***
1 Ackermann, Johannes. Directorium legentium. Lateinische Handschrift auf Papier. Blaubeuren 1500. 214:154 mm. 164 (st. 168) Bll. (1. u. le. 3 w.). Holzdeckelbd. d. Zt. mit blindgepr. Schafsldrbez. u. 2 Schl. (Schließbänder fehlen).
Schätzpreis: *R (4.000,- €) / (5.280,- $)
Ca. 35 Z., sorgfältige, stark abbreviierte Kursive, rubriziert u. mit roten Hervorhebungen, zahlreiche große Ordnungsbuchstaben in Rot, teilweise mit weiß ausgespartem Dekor, die 14 Zwölferlagen jeweils mit Numerierung auf dem ersten u. rot verzierter Kustode auf dem letzten Bl. - Die Handschrift beginnt Fol. 2r: "P(ro)logus in Directoriu(m) legentiu(m) fratris Joannis ackerman(n) ordinis S(an)cti Benedicti Monasterji Blaubur(e)ns(is) professi. 1500...", im Kolophon auf Fol. 165r werden Verfassernamen u. Jahreszahl wiederholt u. von dem Hinweis begleitet: "Sub regimine Vena(n)di pr(ior)is et d(o)m(ini) Gregorij abbatis... Numerus anno(rum) scribe(n)tis 68". Demnach war der Blaubeurer Benediktiner Johannes Ackermann wohl 1432 geboren. Weiteres ist über ihn nicht bekannt. Eine Zweit- oder Abschrift seines Wörterbuchs scheint sich im Nachlaß der Gebrüder Pez auf der Stiftsbibliothek Melk zu befinden. Mit "Gregorius abbas" ist der 1524 gestorbene Gregor Rösch gemeint, 1495-1522 Abt v. Blaubeuren. Ihm verdankte das im 14. u. 15. Jahrhundert heruntergekommene Kloster die Wiederherstellung eines geordneten Haushalts (siehe J. D. G. v. Memminger, Beschreibung des Oberamts Blaubeuren, 1830, SS. 114f.). Über einen Prior Venantius konnten wir nichts ermitteln.
Es fehlen die beschriebenen Bll. 12, 95, 156 u. 157. Das ursprünglich leere Anfangsbl. wurde auf den vorderen Innendeckel geleimt u. v. zeitgenössischer Hand mit stark abbreviierten Notizen versehen. Die 3 leeren Schlußbll. tragen Federproben v. alter Hand, vom vorletzten ist ein Großteil abgerissen, das letzte wurde auf den hinteren Innendeckel geleimt. Breitrandig u. kaum gebräunt oder fleckig, jedoch besonders zu Beginn u. am Schluß wurmstichig, Bindung teilweise gelockert, einige Bll. lose u. mit geringen Randmängeln. Der originale Blaubeurer Klostereinband (Streicheisenlinien, kl. Rosette im Rund, Granatapfel rhombisch) stark beschabt u. wurmst., oberes Kapital defekt, untere äußere Ecke des hinteren Holzdeckels durch Wurmfraß zerstört, die beiden Schließbänder fehlen. Beiliegt ein älterer Zettel mit dem Hinweis: "Das Stück stammt aus den im Jahr 1928 an die Landesbibliothek abgegebenen Resten der ehemaligen Benediktinerbibliothek und wurde als Erinnerungsstück zurückgegeben. (Altes Verzeichnis Nr. 38) - >Wir haben hier eine Art Lexikon vor uns<."
[Demnach dürfte die Handschrift von der Landesbibliothek Stuttgart an das Blaubeurer Seminar zurückgegeben worden sein, denn 1928 erfolgte in Maulbronn und Blaubeuren bei der Trennung von Staats- und Kirchenvermögen eine Abgabe historischer Buchbestände an die Landesbibliothek:
http://www.b2i.de/fabian?Evangelisch-Theologisches_Seminas
Nachtrag. Das Stück wird von Klaus Schreiner als in Stuttgart nicht nachweisbare Handschrift aus dem Restbestand der Blaubeurer Klosterbibliothek unter Berufung auf die Mittelalterlichen Bibliothekskataloge 1, 1918, S. 14 erwähnt. Blaubeuren, Sigmaringen 1986, S. 128 (auch zu weiteren Handschriften des 1507 gestorbenen Ackermann), S. 160 Anm. 194.
2. Nachtrag. Ein klarer Bild über die in Blaubeuren nach 1928 vorhandenen Bestände ist aus der Literatur nicht zu gewinnen. Glaubt man der regelmäßig unzuverlässigen Krämer, Handschriftenerbe, 1989, Bd. 1, S. 89 befanden sich damals noch 26 Handschriften in Blaubeuren, nämlich die von den Mittelalterlichen Bibliothekskatalogen I, S. 14f. aufgelisteten 27 Handschriften abzüglich II.C.88 = LB Stuttgart Cod. theol. et phil. 4°617, von der es ausdrücklich heißt, sie sei bis 1928 im Seminar von Blaubeuren gewesen. Ob Kaeppeli IV, 107 die Seminarhs. III.1.17 nach Autopsie oder in anderer Weise verlässlich lokalisieren konnte? Leuze schreibt im ZfBB 1929, S. 522 38 Handschriften und 94 Druckschriftenbände, darunter auch 20 in Stuttgart vorher nicht vorhandene Inkunabeln, seien in die Landesbibliothek gekommen, was mich an der Zahl von 26 in Blaubeuren verbliebenen Hss. zweifeln lässt. In Tübinger Inkunabelkatalog INKA erscheinen viele 1928 aus der Seminarbibliothek von Stuttgart übernommene Inkunabeln. Von einem Restbestand des Altbestands spricht Immo Eberl in seinem Beitrag zur Germania Benedictina 1975. Schreiner 1986 hat aus den vermutlich damals angelegten Cod. theol. et phil. Signaturen 614 ff. nur ganz wenige benutzt.
3. Nachtrag. Nach freundlicher Auskunft der LB Stuttgart wurde nur dieses eine Stück als "Andenken" an das Seminar zurückgegeben; die anderen bei Krämer aufgeführten Handschriften sind in Stuttgart, eine Liste/Konkordanz ist mir zugesagt.
4. Nachtrag: die Liste findet sich unter
http://archiv.twoday.net/stories/5664362/
5. Nachtrag: Die Handschrift wurde aus der Auktion genommen und der Landeskirche zurückgegeben:
http://archiv.twoday.net/stories/5707073/ ]
***
51 (Württembergische Chronik). Deutsche Handschrift auf Papier. Um 1605. 160:100 mm. 133 (st. ?) Bll. Pp. d. 18. Jhdts.
Schätzpreis: (240,- €) / (317,- $)
Inhalt: 1r-17v: Alphabetische Auflistung der wichtigsten Städte, jeweils mit mehreren dazu gehörigen Ortschaften. 19r-21r: "Praelaten Desz Hertzogthumbs Württemberg: Ordinis S. Benedicti. Ordinis S. Bernhardi". 21v-22v: "Sequitur Catalogus Abbatium In Bebenhausen" (bis 1570). 23r-98r: "Beschreybung Vihler Stätt Wie dieselben an Würthemberg komen". 98v-104: leer. 105r-134v: "Extract. Gemeiner Landtschafft In Württemberg Freyheitten vnnd Landtags Abschiede." Das späteste im Text genannte Jahr ist 1605. - Bl. 18 (vermutlich leer) fehlt, Gegenbl. 7 lose u. ausgefranst; am Fuß v. Bl. 134 bricht der Text ab. Leicht gebräunt u. wasserfl. Einbd. stark berieben u. bestoßen, Rücken defekt.
***
120 URKUNDEN. - Tengen/Baden-Württemberg. Register Des Einkommens beder gottsheuser unser lieben frowen pfarrkirchen zue Thengen und sant Catharinen in der stat welchen sant Anthoni capel uf der Steig incorporiert. - Compendium Des ganzen Einkommens unser lieben frauwen pfahrkirchen zo Tengen und dero einverleibten capellen sant Catharinae in der stat Keiserstuol... 2 deutsche Handschriften auf Papier. 1630-56. Ca. 330:105 mm. 68 SS.; 1 Bl., 59 SS., 1 Bl. Ohne Einbd. bzw. in Ms.-Pgt.-Umschl. (Missale um 1400).
Schätzpreis: *R (200,- €) / (264,- $)
Die erste Handschr. mit kl. naiver Federzeichnung der Tengener Marienkirche auf der 1. Seite. - Etwas fleckig u. abgegriffen, die jeweils ersten u. le. SS. stärker angeschmutzt, die ersten Bll. der ersten Handschr. an der oberen äußeren Ecke beschäd. (geringer Textverlust). In der zweiten Handschr. liegt ein Nachtrag v. 1657 bei (1 Faltbl. mit aufgedr. Siegel).
***
96 URKUNDEN. - Eisenberg, Thür. Deutsche Handschrift. Ca. 1520. Fol. 2 SS. Mit papiergedecktem Siegel.
Schätzpreis: (80,- €) / (106,- $)
Ungeltabrechnung der Stadt für Wein und Bier, gegliedert nach namentlich genannten 7 Wirten. - Aus Slg. Otto Hupp.
und andere mehr.
Dazu "280 Werke in 1660 Bänden aus einer süddeutschen Schloßbibliothek (mit einer Slg. "Cazinaden" > Kat.-Nrn. 2126-2176)"
Bei Nr. 2126 steht: Aus einer bayerischen Schloßbibliothek stammt die im folgenden angebotene Sammlung von 337 dekorativ gebundenen und wohlerhaltenen Bändchen aus der Produktion des Pariser Buchhändlers Hubert Martin Cazin (geboren 1724 zu Reims, ermordet 1795 zu Paris) und seiner Epigonen, aufgeteilt in 51 Lots. Die sogenannten "Cazinaden", zierliche und schön ausgestattete Büchlein meist galanten oder erotischen Inhalts im Klein-Oktav-Format, erfreuten sich großer Beliebtheit, wurden häufig gesammelt und von anderen Verlagen imitiert; die ganze Reihe umfaßt 437 Bände, von denen schon viele selten geworden sind.
Die vorliegenden Bändchen sind allesamt zeitgenössisch in hell- bis olivbraunem Kalbsleder gebunden, meist marmoriert, gefleckt oder gesprenkelt, mit dekorativer Rückenvergoldung, meist auch mit (teils mehrfachen) goldgeprägten Deckel- u. Stehkantenfileten, schmaler goldgeprägter Innenkantenleiste, Rückenschildchen, Goldschnitt und Marmor-, Kattun- oder anderem Buntpapiervorsatz. Teilweise scheint es sich um originale Verlagseinbände zu handeln. Der Erhaltungszustand der Bücher läßt - sowohl innen wie auch außen - kaum zu wünschen übrig.
Und ein Stück aus der Bibliothek des Staatsarchivs Bamberg:
162 Aventinus (Thurmair), Joh. Annalivm Boiorvm libri septem. Ingolst., Al. u. Sam. Weissenhorn, Dez. 1554. Fol. 30 Bll., 835 SS., mit Holzschn.-Portr. d. Verf. v. Hans Lautensack. Holzdeckelbd. d. Zt. mit Schweinsldrbez. mit reicher Deckelblindpr., 2 Schl.
Schätzpreis: (2.400,- €) / (3.168,- $)
Adams A 2308; Ebert 1433; Schmitt, Lautensack 69/70, 13 u. Abb. 8; Stalla 312; nicht b. Lentner u. Pfister. - Erste Ausgabe des berühmten, großangelegten Geschichtswerkes, mit dem schönen posthumen Porträt Aventins. - Auf kräftigem Papier, recht breitrandig. Teils etwas stockfl. oder gebräunt. Vereinzelt Unterstreichungen in feinem Tintenstrich u. wenige Marginalien mit brauner Tinte von alter Hand. Von den vereinzelten Stockflecken abgesehen Traumexemplar; ehemals im Eigentum des Staatsarchivs Bamberg: Tit. mit Besitzverm. aus dem 17. Jhdt. und unten mit zwei Bibl.-Stempeln sowie hs. Bibl.-Vermerk des Staatsarchivs vom 13.IV.1932: "Als überzählig abgegeben...". Der schöne zeitgenöss. Einbd. leicht beschabt, ob. Kapital mit geklebtem Einriß. Beide Deckel mit reicher Blindpr., u.a. unter Verwendung von drei verschiedenen Rollenstempeln mit Porträts u. Ornamenten.
#fnzhss
http://openjur.de/u/30772-2_u_47-08.html Volltext
Zum Hintergrund: http://archiv.twoday.net/stories/5318805/
Das Urteil des LG Stuttgart stieß nicht nur in K&R auf Kritik.
Anmerkung von Prof. Dr. Thomas Hoeren/wiss. Mitarb. Eva Schröder, ITM - zivilrechtliche Abt., Münster, in: MMR 2008, S. 553 ff.
Letztlich bleibt festzuhalten, dass selbst unter Berücksichtung des „Hausrechts“ der Vereine sich das Betreiben der Seite nicht als unlautere Wettbewerbshandlung darstellt. Der BGH hat in mehreren Entscheidungen zu Liveübertragungen von Sportveranstaltungen das Recht des Hausrechtinhabers bejaht, zu bestimmen, wer zu welchen Konditionen eine Liveübertragung durchführen darf. Daraus zu schließen, es liege durch das Betreiben der Website hartplatzhelden.de automatisch eine unlautere Wettbewerbshandlung vor, wäre ein Fehlschluss. Es ist streng zwischen der Ordnungsfunktion des Hausrechts und den Veranstaltungsvermarktungsrechten zu unterscheiden. Das Hausrecht beruht auf dem Grundstückseigentum oder -besitz und dient zur Wahrung der äußeren Ordnung in dem Gebäude oder der Örtlichkeit. Ist eine Privatperson berechtigterweise in eine Sportstätte gelangt und wurde dort die Anfertigung von Videoaufnahmen nicht untersagt, hat das Hausrecht sich in Bezug auf diese Handlung erschöpft. Es kann nicht nachträglich dazu herangezogen werden, die Verwertung dieser Aufnahmen zu untersagen. Das Hausrecht würde ansonsten entgegen seinem Zweck als Abwehrrecht zu einem echten Leistungsschutzrecht, begrenzt auf den Schutz vor Sportberichterstattung. Eine Zutrittsbeschränkung bzw. ein Verbot der Hobbyfilm-Aufnahmen will der WFV vorliegend gerade nicht erreichen.
Das LG überträgt fälschlicherweise die Ausgangssituation hinsichtlich der Rechtevermarktung an Fußball(live)bildern von Bundesliga- oder Championsleaguespielen auf den vorliegenden Fall und hat damit die Besonderheiten des Amateurfußballs verkannt. Abzuwarten bleibt, ob das Berufungsgericht mehr Licht ins Dunkel bringt und vertretbare rechtliche Rahmenbedingungen für die Verwertung von Film- und Fernsehaufnahmen im (Amateur-)Sport schaffen wird. Sollte das Urteil in seiner jetzigen Form Bestand haben, so wird dies weitreichende Konsequenzen für die Grundsatzfrage haben, wer Spielmitschnitte und anderen User Generated Content von beliebigen Veranstaltungen im Internet verbreiten darf.
Philipp Maume, Der Amateurfußball in den Fängen des Wettbewerbsrechts, in: MMR 2008, S. 797 ff.
Zu bedenken ist, dass solche Portale zwar von Seiten des Betreibers einen kommerziellen Zweck verfolgen können. Ihre Hauptfunktion liegt aus Sicht der Nutzer aber im nichtkommerziellen Bereich. Sie dienen der gegenseitigen Zugänglichmachung von besonders sehenswerten oder kuriosen Szenen und damit dem Informationsaustausch. Der Sport ist nach Ansicht des BVerfG Anknüpfungspunkt für eine breite Kommunikation in der Bevölkerung. Ein Informationsaustausch hierüber dürfe nicht durch eine Monopolbildung unterbunden werden. Würde man einen ergänzenden Leistungsschutz auch im Amateurbereich bejahen und sogar auf Web 2.0-Plattformen übertragen, so geriete dies in Konflikt mit den Feststellungen des BVerfG. Auf Grund der zumindest theoretischen Wirkung eines Internetportals auf die Vermarktung auf Verbandsseite würde der Leistungsschutz gegenüber jedem Onlineportal greifen, das zumindest auch für den Amateurfußball geschaffen wurde. Hieraus resultiert faktisch eine Sperre jeglichen öffentlichen Austauschs über Amateurfußball in audiovisueller Form. Amateurspielern bliebe - wenn überhaupt - lediglich die Möglichkeit, ihre Videos auf eigenen rein privaten Seiten oder den Seiten des Vereins einzustellen. Der Gedanke des kanalisierten Austauschs bliebe dabei aber auf der Strecke. Daher dürfen Portale des Web 2.0 erst recht nicht in einen ergänzenden Leistungsschutz mit einbezogen werden.
V. Ergebnis
Veranstalter von Sportereignissen erwerben keine absoluten Leistungsschutzrechte, sondern müssen ihre Rechte über schuldrechtliche Konstruktionen sowie das Hausrecht absichern. Im Profifußball kann auf Grund der Besonderheiten bei der Vermarktung ausnahmsweise ein ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz angenommen werden. Diese Besonderheiten sind im Amateurfußball nicht gegeben, ein ergänzender Leistungsschutz entfällt. Aus grundrechtlichen Erwägungen muss ein ergänzender Leistungsschutz gegenüber Web 2.0-Portalen generell entfallen.
Das OLG Stuttgart hat sich davon nicht beeindrucken lassen, sondern die Fehler der Vorinstanz wiederholt.
Eine gute Besprechung der neuen Entscheidung bietet:
http://www.telemedicus.info/article/1255-OLG-Stuttgart-Hartplatzhelden-Urteil-im-Volltext.html
Es bleibt zu hoffen, dass die Revision beim BGH die Dinge zurechtrückt.
Web 2.0 Portale stehen unter dem Schutz der Meinungs- und Pressefreiheit (Art. 5 GG), das kann man nicht wie das OLG Stuttgart mit kurzem Hinweis auf eine nicht relevante BGH-Entscheidung http://lexetius.com/2005,2703 , die sich auf die Hörfunkberichterstattung vom Profifussball bezieht, vom Tisch wischen:
Auch können sich die Beklagten nicht darauf berufen, der Kläger sei aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2, 12 Abs. 1 GG oder aus kartellrechtlichen Erwägungen (die die Beklagten nur unschlüssig ins Feld führen) verpflichtet, die entgeltlose Nutzung von Bildern der von ihm mitveranstalteten Fußballspiele zu dulden (vgl. unter ausführlicher grundrechtlicher Abwägung im Hinblick auf Rundfunkbetreiber BGHZ 165, 62, 70 ff. = GRUR 2006, 249 ff. - [Hörfunkrechte] m.w.N. und BGHZ 110, 371, 380 - [Programmbeschaffungsvertrag der Rundfunkanstalten]).
Die grundrechtliche Abwägung des BGH hat mit der hier verhandelten Sache eigentlich nichts zu tun, da sie sich auf die Rundfunkfreiheit bezog, die hier nicht zur Rede steht.
Bezeichnend sind auch die weitgehend kenntnislosen Ausführungen zur Rechtswidrigkeit der ja von den Vereinen überhaupt nicht mittels Hausrechts untersagten Videoaufnahmen der Laien, die Videos hochladen:
Solche Aufzeichnungen sind nach der Rechtsprechung des BGH (BGHZ 39, 352, 354 ff. - [Vortragsabend]) schon dann unlauter, wenn sie ohne Erlaubnis erfolgen. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist also weder darauf abzustellen, dass der ausrichtende Verein solche Aufnahmen nicht ausdrücklich untersagt hat, noch muss der Senat darauf eingehen, dass durch solche Aufnahmen im Amateurbereich häufig schon an sich und noch stärker durch deren Weiterverbreitung bzw. Veröffentlichung auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Grundrecht auf Ehrenschutz der Spieler und Zuschauer nicht nur berührt, sondern häufig auch verletzt wird, indem sie ungefragt und oft in unvorteilhaften Posen oder Szenen aufgenommen und zur Schau gestellt werden.
Hier ist festzuhalten:
(1) Was nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt. Wenn der Verein die Aufnahmen nicht verbietet, sind sie erlaubt.
(2) Völlig absurd ist es, das Persönlichkeitsrecht und den Ehrenschutz der Zuschauer zu bemühen. Wenn ein Zuschauer gezielt beim Nasebohren gefilmt wird, ist § 23 Abs. 1 Nr. 3 KUG sicher nicht relevant, ansonsten greift diese Schranke des Rechts am eigenen Bild.
(3) Ob das Recht am eigenen Bild der als "Hartplatzhelden" herausgestellten Spieler verletzt ist, haben einzig und allein diese zu entscheiden. Zu berücksichtigen ist, dass es sich nicht um professionelle Nahaufnahmen handelt, sondern meist um möglicherweise verwackelte Aufnahmen aus größerer Distanz, die einen Spieler nur im Rahmen des Spielgeschehens wiedergeben, was von § 23 Abs. 1 Nr. 3 gedeckt ist.
Zum Thema Hausrecht und Fotografie beachte man auch meine Rezension von Lehment:
http://archiv.twoday.net/stories/5333018/
Zum Hintergrund: http://archiv.twoday.net/stories/5318805/
Das Urteil des LG Stuttgart stieß nicht nur in K&R auf Kritik.
Anmerkung von Prof. Dr. Thomas Hoeren/wiss. Mitarb. Eva Schröder, ITM - zivilrechtliche Abt., Münster, in: MMR 2008, S. 553 ff.
Letztlich bleibt festzuhalten, dass selbst unter Berücksichtung des „Hausrechts“ der Vereine sich das Betreiben der Seite nicht als unlautere Wettbewerbshandlung darstellt. Der BGH hat in mehreren Entscheidungen zu Liveübertragungen von Sportveranstaltungen das Recht des Hausrechtinhabers bejaht, zu bestimmen, wer zu welchen Konditionen eine Liveübertragung durchführen darf. Daraus zu schließen, es liege durch das Betreiben der Website hartplatzhelden.de automatisch eine unlautere Wettbewerbshandlung vor, wäre ein Fehlschluss. Es ist streng zwischen der Ordnungsfunktion des Hausrechts und den Veranstaltungsvermarktungsrechten zu unterscheiden. Das Hausrecht beruht auf dem Grundstückseigentum oder -besitz und dient zur Wahrung der äußeren Ordnung in dem Gebäude oder der Örtlichkeit. Ist eine Privatperson berechtigterweise in eine Sportstätte gelangt und wurde dort die Anfertigung von Videoaufnahmen nicht untersagt, hat das Hausrecht sich in Bezug auf diese Handlung erschöpft. Es kann nicht nachträglich dazu herangezogen werden, die Verwertung dieser Aufnahmen zu untersagen. Das Hausrecht würde ansonsten entgegen seinem Zweck als Abwehrrecht zu einem echten Leistungsschutzrecht, begrenzt auf den Schutz vor Sportberichterstattung. Eine Zutrittsbeschränkung bzw. ein Verbot der Hobbyfilm-Aufnahmen will der WFV vorliegend gerade nicht erreichen.
Das LG überträgt fälschlicherweise die Ausgangssituation hinsichtlich der Rechtevermarktung an Fußball(live)bildern von Bundesliga- oder Championsleaguespielen auf den vorliegenden Fall und hat damit die Besonderheiten des Amateurfußballs verkannt. Abzuwarten bleibt, ob das Berufungsgericht mehr Licht ins Dunkel bringt und vertretbare rechtliche Rahmenbedingungen für die Verwertung von Film- und Fernsehaufnahmen im (Amateur-)Sport schaffen wird. Sollte das Urteil in seiner jetzigen Form Bestand haben, so wird dies weitreichende Konsequenzen für die Grundsatzfrage haben, wer Spielmitschnitte und anderen User Generated Content von beliebigen Veranstaltungen im Internet verbreiten darf.
Philipp Maume, Der Amateurfußball in den Fängen des Wettbewerbsrechts, in: MMR 2008, S. 797 ff.
Zu bedenken ist, dass solche Portale zwar von Seiten des Betreibers einen kommerziellen Zweck verfolgen können. Ihre Hauptfunktion liegt aus Sicht der Nutzer aber im nichtkommerziellen Bereich. Sie dienen der gegenseitigen Zugänglichmachung von besonders sehenswerten oder kuriosen Szenen und damit dem Informationsaustausch. Der Sport ist nach Ansicht des BVerfG Anknüpfungspunkt für eine breite Kommunikation in der Bevölkerung. Ein Informationsaustausch hierüber dürfe nicht durch eine Monopolbildung unterbunden werden. Würde man einen ergänzenden Leistungsschutz auch im Amateurbereich bejahen und sogar auf Web 2.0-Plattformen übertragen, so geriete dies in Konflikt mit den Feststellungen des BVerfG. Auf Grund der zumindest theoretischen Wirkung eines Internetportals auf die Vermarktung auf Verbandsseite würde der Leistungsschutz gegenüber jedem Onlineportal greifen, das zumindest auch für den Amateurfußball geschaffen wurde. Hieraus resultiert faktisch eine Sperre jeglichen öffentlichen Austauschs über Amateurfußball in audiovisueller Form. Amateurspielern bliebe - wenn überhaupt - lediglich die Möglichkeit, ihre Videos auf eigenen rein privaten Seiten oder den Seiten des Vereins einzustellen. Der Gedanke des kanalisierten Austauschs bliebe dabei aber auf der Strecke. Daher dürfen Portale des Web 2.0 erst recht nicht in einen ergänzenden Leistungsschutz mit einbezogen werden.
V. Ergebnis
Veranstalter von Sportereignissen erwerben keine absoluten Leistungsschutzrechte, sondern müssen ihre Rechte über schuldrechtliche Konstruktionen sowie das Hausrecht absichern. Im Profifußball kann auf Grund der Besonderheiten bei der Vermarktung ausnahmsweise ein ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz angenommen werden. Diese Besonderheiten sind im Amateurfußball nicht gegeben, ein ergänzender Leistungsschutz entfällt. Aus grundrechtlichen Erwägungen muss ein ergänzender Leistungsschutz gegenüber Web 2.0-Portalen generell entfallen.
Das OLG Stuttgart hat sich davon nicht beeindrucken lassen, sondern die Fehler der Vorinstanz wiederholt.
Eine gute Besprechung der neuen Entscheidung bietet:
http://www.telemedicus.info/article/1255-OLG-Stuttgart-Hartplatzhelden-Urteil-im-Volltext.html
Es bleibt zu hoffen, dass die Revision beim BGH die Dinge zurechtrückt.
Web 2.0 Portale stehen unter dem Schutz der Meinungs- und Pressefreiheit (Art. 5 GG), das kann man nicht wie das OLG Stuttgart mit kurzem Hinweis auf eine nicht relevante BGH-Entscheidung http://lexetius.com/2005,2703 , die sich auf die Hörfunkberichterstattung vom Profifussball bezieht, vom Tisch wischen:
Auch können sich die Beklagten nicht darauf berufen, der Kläger sei aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2, 12 Abs. 1 GG oder aus kartellrechtlichen Erwägungen (die die Beklagten nur unschlüssig ins Feld führen) verpflichtet, die entgeltlose Nutzung von Bildern der von ihm mitveranstalteten Fußballspiele zu dulden (vgl. unter ausführlicher grundrechtlicher Abwägung im Hinblick auf Rundfunkbetreiber BGHZ 165, 62, 70 ff. = GRUR 2006, 249 ff. - [Hörfunkrechte] m.w.N. und BGHZ 110, 371, 380 - [Programmbeschaffungsvertrag der Rundfunkanstalten]).
Die grundrechtliche Abwägung des BGH hat mit der hier verhandelten Sache eigentlich nichts zu tun, da sie sich auf die Rundfunkfreiheit bezog, die hier nicht zur Rede steht.
Bezeichnend sind auch die weitgehend kenntnislosen Ausführungen zur Rechtswidrigkeit der ja von den Vereinen überhaupt nicht mittels Hausrechts untersagten Videoaufnahmen der Laien, die Videos hochladen:
Solche Aufzeichnungen sind nach der Rechtsprechung des BGH (BGHZ 39, 352, 354 ff. - [Vortragsabend]) schon dann unlauter, wenn sie ohne Erlaubnis erfolgen. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist also weder darauf abzustellen, dass der ausrichtende Verein solche Aufnahmen nicht ausdrücklich untersagt hat, noch muss der Senat darauf eingehen, dass durch solche Aufnahmen im Amateurbereich häufig schon an sich und noch stärker durch deren Weiterverbreitung bzw. Veröffentlichung auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Grundrecht auf Ehrenschutz der Spieler und Zuschauer nicht nur berührt, sondern häufig auch verletzt wird, indem sie ungefragt und oft in unvorteilhaften Posen oder Szenen aufgenommen und zur Schau gestellt werden.
Hier ist festzuhalten:
(1) Was nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt. Wenn der Verein die Aufnahmen nicht verbietet, sind sie erlaubt.
(2) Völlig absurd ist es, das Persönlichkeitsrecht und den Ehrenschutz der Zuschauer zu bemühen. Wenn ein Zuschauer gezielt beim Nasebohren gefilmt wird, ist § 23 Abs. 1 Nr. 3 KUG sicher nicht relevant, ansonsten greift diese Schranke des Rechts am eigenen Bild.
(3) Ob das Recht am eigenen Bild der als "Hartplatzhelden" herausgestellten Spieler verletzt ist, haben einzig und allein diese zu entscheiden. Zu berücksichtigen ist, dass es sich nicht um professionelle Nahaufnahmen handelt, sondern meist um möglicherweise verwackelte Aufnahmen aus größerer Distanz, die einen Spieler nur im Rahmen des Spielgeschehens wiedergeben, was von § 23 Abs. 1 Nr. 3 gedeckt ist.
Zum Thema Hausrecht und Fotografie beachte man auch meine Rezension von Lehment:
http://archiv.twoday.net/stories/5333018/
KlausGraf - am Freitag, 17. April 2009, 20:01 - Rubrik: Archivrecht
„Das würden wir wieder machen“, sagen Stephanie Goethals und Ines Wagemann, Stadtarchivarinnen in Pfungstadt und Griesheim nach ihrer Rückkehr dem ECHO. Die beiden Fachfrauen hatten sich freiwillig zum Einsatz in Köln gemeldet, wo sie in der Erstversorgungszentrale (EVZ) Materialien aus der Unglücksstelle für die Weiterbehandlung sichteten.
„Es ist erstaunlich, was alles aus diesen Kartons auf den Tisch kommt; neben Papierschnipseln liegt zum Beispiel eine fast intakte mittelalterliche Handschrift“, berichtet Wagemann.
Goethals erzählt von zwei Aktenordnern, die sich durch den Druck beim Einsturz so ineinander verheddert hatten, dass es schwierig gewesen sei, zu unterscheiden, was wozu gehörte. Nasses oder schimmeliges Archivgut wird eingefroren, um es vor weiterer Zerstörung zu schützen, bis es gefriergetrocknet und aufbereitet werden kann.
Trockenes Material bringen die Helfer in Kammern unter, wo es bei 24 Grad und 30 Prozent Luftfeuchtigkeit weiter ausgetrocknet wird, bevor es zur vorübergehenden Lagerung in anderen Archiven in säurefreie Umschläge verschweißt werden kann.
Mit anderen Helfern haben die beiden Archivarinnen Schriftgut früherer Jahrhunderte behandelt, haben dabei Pläne, Fotos, Bücher, Karten und Nachlässe gerettet. „Die Kölner Kollegen konnten das gefundene Material teilweise den einzelnen Stockwerken des eingestürzten Gebäudes zuordnen und freuten sich, wenn sie Funde identifizieren konnten“, berichten sie.
„Alle Sachen waren mit Schutt, Staub oder Ziegelresten verschmutzt“, berichten Goethals und Wagemann. Mit einem speziellen Besen aus Ziegenhaar haben sie diese Seiten vor der weiteren Behandlung gefegt. ..."
Quelle:
http://www.echo-online.de/suedhessen/template_detail.php3?id=737150
„Es ist erstaunlich, was alles aus diesen Kartons auf den Tisch kommt; neben Papierschnipseln liegt zum Beispiel eine fast intakte mittelalterliche Handschrift“, berichtet Wagemann.
Goethals erzählt von zwei Aktenordnern, die sich durch den Druck beim Einsturz so ineinander verheddert hatten, dass es schwierig gewesen sei, zu unterscheiden, was wozu gehörte. Nasses oder schimmeliges Archivgut wird eingefroren, um es vor weiterer Zerstörung zu schützen, bis es gefriergetrocknet und aufbereitet werden kann.
Trockenes Material bringen die Helfer in Kammern unter, wo es bei 24 Grad und 30 Prozent Luftfeuchtigkeit weiter ausgetrocknet wird, bevor es zur vorübergehenden Lagerung in anderen Archiven in säurefreie Umschläge verschweißt werden kann.
Mit anderen Helfern haben die beiden Archivarinnen Schriftgut früherer Jahrhunderte behandelt, haben dabei Pläne, Fotos, Bücher, Karten und Nachlässe gerettet. „Die Kölner Kollegen konnten das gefundene Material teilweise den einzelnen Stockwerken des eingestürzten Gebäudes zuordnen und freuten sich, wenn sie Funde identifizieren konnten“, berichten sie.
„Alle Sachen waren mit Schutt, Staub oder Ziegelresten verschmutzt“, berichten Goethals und Wagemann. Mit einem speziellen Besen aus Ziegenhaar haben sie diese Seiten vor der weiteren Behandlung gefegt. ..."
Quelle:
http://www.echo-online.de/suedhessen/template_detail.php3?id=737150
Wolf Thomas - am Freitag, 17. April 2009, 17:57 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Als die Bilder vom eingestürzten Kölner Stadtarchiv die Runde machen, ist auch Christian Wermert tief betroffen. „Das hat mir in der Seele weh getan“, sagt Wermert, der als Gemeindearchivar bei der Nottulner Gemeindeverwaltung beschäftigt ist.
Wermert kennt das Kölner Stadtarchiv gut, schließlich hat er in Köln erfolgreich sein Geschichtsstudium und die Fachausbildung zum Kommunal- und Kirchenarchivar absolviert. ....
Als beim jüngsten NRW-Archivtag ein Hilferuf des Kölner Stadtarchivs bekannt wurde, besprach Wermert die Angelegenheit mit Bürgermeister Peter Amadeus Schneider. Der zögerte nicht lange: „Ich habe ihm dafür Sonderurlaub genehmigt, da ich es für eine Selbstverständlichkeit halte, bei der Bewältigung derartiger Katastrophen solidarische Amtshilfe zu geben“, erklärt Schneider.
Insgesamt sechs Tage lang wird nun Christian Wermert unentgeltlich in Köln im Einsatz sein. Was genau ihn dort erwartet, weiß er noch nicht. ....
Der Nottulner Gemeindearchivar macht deutlich, dass es auch im Interesse der westfälischen Kommunen ist, dass möglichst viele Dokumente des Kölner Stadtarchivs gerettet werden. „Die Region Westfalen ist im Kölner Archiv massiv vertreten.“
Wermert betrachtet den Hilfseinsatz aber auch als effektive Weiterbildungschance. Das Zusammentreffen mit so vielen Kollegen bereichert. Vor allem kann der Nottulner Gemeindearchivar in Köln studieren, wie man mit so einem Notfall umgeht. Schließlich kann ja auch einmal im Nottulner Gemeindearchiv ein großer Notfall eintreten. ...."
Quelle: Westfälische Nachrichten
Wermert kennt das Kölner Stadtarchiv gut, schließlich hat er in Köln erfolgreich sein Geschichtsstudium und die Fachausbildung zum Kommunal- und Kirchenarchivar absolviert. ....
Als beim jüngsten NRW-Archivtag ein Hilferuf des Kölner Stadtarchivs bekannt wurde, besprach Wermert die Angelegenheit mit Bürgermeister Peter Amadeus Schneider. Der zögerte nicht lange: „Ich habe ihm dafür Sonderurlaub genehmigt, da ich es für eine Selbstverständlichkeit halte, bei der Bewältigung derartiger Katastrophen solidarische Amtshilfe zu geben“, erklärt Schneider.
Insgesamt sechs Tage lang wird nun Christian Wermert unentgeltlich in Köln im Einsatz sein. Was genau ihn dort erwartet, weiß er noch nicht. ....
Der Nottulner Gemeindearchivar macht deutlich, dass es auch im Interesse der westfälischen Kommunen ist, dass möglichst viele Dokumente des Kölner Stadtarchivs gerettet werden. „Die Region Westfalen ist im Kölner Archiv massiv vertreten.“
Wermert betrachtet den Hilfseinsatz aber auch als effektive Weiterbildungschance. Das Zusammentreffen mit so vielen Kollegen bereichert. Vor allem kann der Nottulner Gemeindearchivar in Köln studieren, wie man mit so einem Notfall umgeht. Schließlich kann ja auch einmal im Nottulner Gemeindearchiv ein großer Notfall eintreten. ...."
Quelle: Westfälische Nachrichten
Wolf Thomas - am Freitag, 17. April 2009, 17:55 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ....Der Zustand der Dokumente sei ganz unterschiedlich, sagte Fischer [stv. Archivleiter]. „Manche Handschriften sind halbiert, oft fehlen die Einbände.“ Unter den geborgenen Stücken sind auch die besonders wertvollen Verbundbriefe von 1396. Dabei handelt es sich um eine Art Verfassung der Stadt Köln, die 400 Jahre gültig blieb. Die zahlreichen Siegel, die unten an den Briefen hingen, sind jedoch fast alle zerstört worden. Von den Urkunden konnten 90 Prozent unbeschadet geborgen werden, weil sie in Kellern und Anbauten lagerten.
„Für mich persönlich war es ein großer Moment, als die ersten Ratsprotokolle rausgeholt wurden“, sagte Fischer. Als das Archiv noch stand, konnte man sich vor eine Wand stellen und hatte die gesamten Ratsprotokolle der Stadt Köln vom 14. Jahrhundert bis zur Franzosenzeit um 1800 vor sich. „Ich habe immer noch diesen Alptraum: Ich sehe die vollständige Wand und denke: Was fehlt davon?“, erzählte Fischer.
können. Unsere Stücke werden weiter die Narben dieses 3. März tragen, und das werden wir auch nicht mehr ändern können.“ Je weiter unten im Gebäude die Sachen gelegen hätten, desto größer sei das Ausmaß der Zerstörung. „Aber wir erleben eben auch immer wieder Wunder so wie vorgestern mit der Nobelpreisurkunde von (Heinrich) Böll.“
Aus ganz Europa, ja bis aus Australien kämen jetzt Archivare, um die Kölner zu unterstützen. Die Hilfsbereitschaft sei überwältigend und „einfach traumhaft“, sagte Fischer. Auf die Frage, wie lange man für die Restaurierungsarbeiten brauchen werde, sagte der 38-Jährige: „Ich habe ungefähr noch 30 Jahre im Dienst der Stadt Köln, und ich hoffe, dass ich am Ende sagen kann: Wir sind auf einem guten Weg.“
Quelle:
http://www.welt.de/kultur/article3573659/Drei-Viertel-alter-Koelner-Handschriften-geborgen.html
„Für mich persönlich war es ein großer Moment, als die ersten Ratsprotokolle rausgeholt wurden“, sagte Fischer. Als das Archiv noch stand, konnte man sich vor eine Wand stellen und hatte die gesamten Ratsprotokolle der Stadt Köln vom 14. Jahrhundert bis zur Franzosenzeit um 1800 vor sich. „Ich habe immer noch diesen Alptraum: Ich sehe die vollständige Wand und denke: Was fehlt davon?“, erzählte Fischer.
können. Unsere Stücke werden weiter die Narben dieses 3. März tragen, und das werden wir auch nicht mehr ändern können.“ Je weiter unten im Gebäude die Sachen gelegen hätten, desto größer sei das Ausmaß der Zerstörung. „Aber wir erleben eben auch immer wieder Wunder so wie vorgestern mit der Nobelpreisurkunde von (Heinrich) Böll.“
Aus ganz Europa, ja bis aus Australien kämen jetzt Archivare, um die Kölner zu unterstützen. Die Hilfsbereitschaft sei überwältigend und „einfach traumhaft“, sagte Fischer. Auf die Frage, wie lange man für die Restaurierungsarbeiten brauchen werde, sagte der 38-Jährige: „Ich habe ungefähr noch 30 Jahre im Dienst der Stadt Köln, und ich hoffe, dass ich am Ende sagen kann: Wir sind auf einem guten Weg.“
Quelle:
http://www.welt.de/kultur/article3573659/Drei-Viertel-alter-Koelner-Handschriften-geborgen.html
Wolf Thomas - am Freitag, 17. April 2009, 17:53 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"LA MEMORIA storica della tragedia del Vajont aveva una "casa" a L'Aquila, ma è scampata al terremoto. Il palazzo dell'Archivio di Stato del capoluogo abruzzese, che custodiva le carte del processo per il disastro dell'inondazione della vallata del Vajont avvenuta il 9 ottobre del '63, è in parte crollato sotto i colpi del sisma, eppure tutti i documenti conservati sono stati recuperati e portati in salvo nella sede dell'archivio di Sulmona.
A ufficializzare la notizia è il direttore generale per i beni archivistici del ministero per i Beni culturali Luciano Scala: "L'operazione non è stata semplice, perché una parte dell'edificio è inagibile - dice Scala - si è riusciti ad entrare solo dalla parte posteriore dello stabile e con molta difficoltà. Ma il recupero del materiale è stato quasi totale". Fu proprio il tribunale del capoluogo abruzzese ad ospitare dal 1969 al '71 le fasi salienti del processo: "La storia del Vajont a L'Aquila iniziò col processo per legittima suspicione - racconta Agostino Attanasio direttore uscente dell'Archivio di Stato de L'Aquila - la sede naturale, ossia Venezia, non era il contesto idoneo per un corretto e sereno svolgimento del processo dove il coinvolgimento emotivo poteva rendere difficoltoso il giudizio imparziale dei fatti. Così venne spostato in Abruzzo".
E oggi, la memoria processuale del Vajont, quella che ha sancito responsabilità e colpe, quella che può essere idealmente riassunta nel famigerato registro della sentenza che per tradizione viene portato da L'Aquila a Longarone nell'anniversario della catastrofe, è andata incontro ad un singolare destino di salvezza: "Tutta la documentazione cartacea del processo, circa 240 faldoni, è rimasta ancora nei locali terremotati dell'Archivio, chiusa in circa sette armadi blindati e quindi tutelata da polveri e calcinacci - dichiara Agostino Attanasio - Degli atti del processo fanno parte anche gli elaborati progettuali del Vajont, ossia i progetti architettonici fuori misura che non entravano negli armadi e che venivano conservati su scaffali a parte. Questi li abbiamo subito recuperati e portati a Sulmona".
L'operazione di recupero, durata complessivamente tre giorni dal sopralluogo del 9 aprile e che ha coinvolto tutto il patrimonio storico dell'Archivio, comprese le pergamene del 1193 e i codici del '400 e '500 che hanno scritto la grande storia de L'Aquila, è stata condotta dai vigili del fuoco sotto il coordinamento dell'ingegner Claudio Fortucci: "Il problema attuale dell'Archivio - avverte Attanasio - è la messa in sicurezza delle strutture murarie per almeno l'80% del palazzo, con una parte di locali completamente inagibili. Tant'è che durante il recupero il rischio è stato costante. Si avvertivano altre scosse sismiche e i vigili erano costretti ad uscire velocemente".
Quegli armadi blindati per la memoria del Vajont si sono rivelati oggi una scelta conveniente, ma nascono da un altro capitolo importante di questa singolare storia aquilana. "La documentazione prodotta durante il processo si custodiva nell'archivio del tribunale fin dal '71 - prosegue Attanasio - la nostra legge prevede che le carte siano consegnate ad un archivio di Stato solo dopo 40 anni dal processo, quindi noi le avremmo dovute ricevere solo nel 2011. Invece, anche in virtù delle pressioni esercitate da parte dei sindaci di Longarone e Castel Lavazzo che premevano per poter disporre degli atti processuali, abbiamo siglato una convenzione con il tribunale per una consegna anticipata, finalizzata ad un grande progetto di tutela e valorizzazione di questo patrimonio storico. Un'inventariazione analitica degli atti e una loro riproduzione digitalizzata da mettere a disposizione del pubblico e soprattutto delle comunità di Longarone e Castel Lavazzo su internet".
Un obiettivo in parte raggiunto, perché l'inventario analitico è stato recentemente ultimato grazie al lavoro di Daniela Nardecchia e di Giovanna Lippi, quest'ultima purtroppo rimasta vittima nella terribile scossa sismica del 6 aprile. Un inventario che è stato anche già trasmesso al professor Reberschack a Venezia, lo storico della tragedia del Vajont che lavora in continuo contatto con le autorità di Longarone. "Questo traguardo sarebbe stato il primo passo per il recupero pieno della fruibilità di questo patrimonio che ci vede in accordo anche con l'Archivio e la Prefettura di Belluno - conclude Attanasio - nella drammaticità del terremoto che ha sconvolto L'Aquila mi sento di dire che il progetto per la memoria del Vajont paradossalmente può uscirne rafforzato, trovando ancora di più oggi la forza e l'energia di portarlo avanti. Col cuore sempre a L'Aquila". "
Quelle:
http://www.repubblica.it/2009/04/sezioni/cronaca/sisma-aquila-7/archivio-vajont/archivio-vajont.html
A ufficializzare la notizia è il direttore generale per i beni archivistici del ministero per i Beni culturali Luciano Scala: "L'operazione non è stata semplice, perché una parte dell'edificio è inagibile - dice Scala - si è riusciti ad entrare solo dalla parte posteriore dello stabile e con molta difficoltà. Ma il recupero del materiale è stato quasi totale". Fu proprio il tribunale del capoluogo abruzzese ad ospitare dal 1969 al '71 le fasi salienti del processo: "La storia del Vajont a L'Aquila iniziò col processo per legittima suspicione - racconta Agostino Attanasio direttore uscente dell'Archivio di Stato de L'Aquila - la sede naturale, ossia Venezia, non era il contesto idoneo per un corretto e sereno svolgimento del processo dove il coinvolgimento emotivo poteva rendere difficoltoso il giudizio imparziale dei fatti. Così venne spostato in Abruzzo".
E oggi, la memoria processuale del Vajont, quella che ha sancito responsabilità e colpe, quella che può essere idealmente riassunta nel famigerato registro della sentenza che per tradizione viene portato da L'Aquila a Longarone nell'anniversario della catastrofe, è andata incontro ad un singolare destino di salvezza: "Tutta la documentazione cartacea del processo, circa 240 faldoni, è rimasta ancora nei locali terremotati dell'Archivio, chiusa in circa sette armadi blindati e quindi tutelata da polveri e calcinacci - dichiara Agostino Attanasio - Degli atti del processo fanno parte anche gli elaborati progettuali del Vajont, ossia i progetti architettonici fuori misura che non entravano negli armadi e che venivano conservati su scaffali a parte. Questi li abbiamo subito recuperati e portati a Sulmona".
L'operazione di recupero, durata complessivamente tre giorni dal sopralluogo del 9 aprile e che ha coinvolto tutto il patrimonio storico dell'Archivio, comprese le pergamene del 1193 e i codici del '400 e '500 che hanno scritto la grande storia de L'Aquila, è stata condotta dai vigili del fuoco sotto il coordinamento dell'ingegner Claudio Fortucci: "Il problema attuale dell'Archivio - avverte Attanasio - è la messa in sicurezza delle strutture murarie per almeno l'80% del palazzo, con una parte di locali completamente inagibili. Tant'è che durante il recupero il rischio è stato costante. Si avvertivano altre scosse sismiche e i vigili erano costretti ad uscire velocemente".
Quegli armadi blindati per la memoria del Vajont si sono rivelati oggi una scelta conveniente, ma nascono da un altro capitolo importante di questa singolare storia aquilana. "La documentazione prodotta durante il processo si custodiva nell'archivio del tribunale fin dal '71 - prosegue Attanasio - la nostra legge prevede che le carte siano consegnate ad un archivio di Stato solo dopo 40 anni dal processo, quindi noi le avremmo dovute ricevere solo nel 2011. Invece, anche in virtù delle pressioni esercitate da parte dei sindaci di Longarone e Castel Lavazzo che premevano per poter disporre degli atti processuali, abbiamo siglato una convenzione con il tribunale per una consegna anticipata, finalizzata ad un grande progetto di tutela e valorizzazione di questo patrimonio storico. Un'inventariazione analitica degli atti e una loro riproduzione digitalizzata da mettere a disposizione del pubblico e soprattutto delle comunità di Longarone e Castel Lavazzo su internet".
Un obiettivo in parte raggiunto, perché l'inventario analitico è stato recentemente ultimato grazie al lavoro di Daniela Nardecchia e di Giovanna Lippi, quest'ultima purtroppo rimasta vittima nella terribile scossa sismica del 6 aprile. Un inventario che è stato anche già trasmesso al professor Reberschack a Venezia, lo storico della tragedia del Vajont che lavora in continuo contatto con le autorità di Longarone. "Questo traguardo sarebbe stato il primo passo per il recupero pieno della fruibilità di questo patrimonio che ci vede in accordo anche con l'Archivio e la Prefettura di Belluno - conclude Attanasio - nella drammaticità del terremoto che ha sconvolto L'Aquila mi sento di dire che il progetto per la memoria del Vajont paradossalmente può uscirne rafforzato, trovando ancora di più oggi la forza e l'energia di portarlo avanti. Col cuore sempre a L'Aquila". "
Quelle:
http://www.repubblica.it/2009/04/sezioni/cronaca/sisma-aquila-7/archivio-vajont/archivio-vajont.html
Wolf Thomas - am Freitag, 17. April 2009, 16:34 - Rubrik: Internationale Aspekte
"Das Bauforschungslager der Stiftung Bauhaus Dessau, ist in die alte Brauerei der Stadt gezogen und kann nun besichtigt werden. 26 000 Objekte befinden sich im Fundus, darunter Arbeiten von Walter Gropius, Paul Klee, Wassily Kandinsky und Lyonel Feininger. Das Material, überwiegend aus den Jahren 1925 bis 1932, ist so umfangreich, dass nicht alles in einer Ausstellung gezeigt werden kann. "
Quelle:
http://www.shortnews.de/start.cfm?id=760587
Quelle:
http://www.shortnews.de/start.cfm?id=760587
Wolf Thomas - am Freitag, 17. April 2009, 16:33 - Rubrik: Architekturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
An der Technischen Universität Dortmund ist in der Universitätsbibliothek im Hochschularchiv zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle füreine/n Diplomarchivar/inzu besetzen. Es handelt sich um eine Ganztagsstelle, die für ein Jahr befristet ist.
Die Entgeltzahlung erfolgt entsprechend den tarifrechtlichen Regelungen nach Entgeltgruppe 9 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst - Länder (TV-L) bzw. gegebenenfalls nach dem Übergangsrecht (TVÜ-Länder). Die Stelle ist grundsätzlich auch für Teilzeitkräfte geeignet.
Anforderungsprofil:
* Laufbahnbefähigung für den gehobenen Archivdienst bzw. eine vergleichbare abgeschlossene archivarische Fachhochschulausbildung oder gleichwertige Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen,
* Erfahrungen im Archivaufbau,
* Gute EDV-Kenntnisse zur Erschließung von Archivgut sowie gute Kenntnisse der üblichen Archiv-Software,
* Kooperation und Teamfähigkeit sowie benutzerorientierte Arbeitsweise,
* Engagiertes und zielorientiertes Arbeiten sowie die Aufgeschlossenheit für neue Herausforderungen.
Aufgabenbereich:
* Verzeichnung und Erschließung von Archivgut
* Bewertung und Übernahme von Archivgut nach Maßgabe der Archivleitung
* Mitarbeit bei der Aussonderung von Schriftgut der Fakultäten und Einrichtungen der Hochschule
* Mitwirkung bei Grundsatzfragen der Bestandserhaltung und Restaurierung
* Mitarbeit bei der Neukonzeption des Hochschularchivs
* Mitarbeit bei der Bearbeitung von Recherchen
* Nach Bedarf Beratung und Unterstützung von Benutzerinnen und Benutzern in archivarischen Fragen
Es wird darauf hingewiesen, dass die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter erwünscht ist.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte innerhalb von drei Wochen nach Veröffentlichung an:
Kommissarischer Leiter
der Universitätsbibliothek Dortmund
Vogelpothsweg 76
44227 Dortmund
Für telefonische Rücksprachen steht zur Verfügung:
Frau Katja Laube, Tel. 0231 / 755 5071
Dortmund, 09.04.2009
http://www.ub.uni-dortmund.de/ubblog/stellenausschreibung-diplomarchivar
Die Entgeltzahlung erfolgt entsprechend den tarifrechtlichen Regelungen nach Entgeltgruppe 9 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst - Länder (TV-L) bzw. gegebenenfalls nach dem Übergangsrecht (TVÜ-Länder). Die Stelle ist grundsätzlich auch für Teilzeitkräfte geeignet.
Anforderungsprofil:
* Laufbahnbefähigung für den gehobenen Archivdienst bzw. eine vergleichbare abgeschlossene archivarische Fachhochschulausbildung oder gleichwertige Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen,
* Erfahrungen im Archivaufbau,
* Gute EDV-Kenntnisse zur Erschließung von Archivgut sowie gute Kenntnisse der üblichen Archiv-Software,
* Kooperation und Teamfähigkeit sowie benutzerorientierte Arbeitsweise,
* Engagiertes und zielorientiertes Arbeiten sowie die Aufgeschlossenheit für neue Herausforderungen.
Aufgabenbereich:
* Verzeichnung und Erschließung von Archivgut
* Bewertung und Übernahme von Archivgut nach Maßgabe der Archivleitung
* Mitarbeit bei der Aussonderung von Schriftgut der Fakultäten und Einrichtungen der Hochschule
* Mitwirkung bei Grundsatzfragen der Bestandserhaltung und Restaurierung
* Mitarbeit bei der Neukonzeption des Hochschularchivs
* Mitarbeit bei der Bearbeitung von Recherchen
* Nach Bedarf Beratung und Unterstützung von Benutzerinnen und Benutzern in archivarischen Fragen
Es wird darauf hingewiesen, dass die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter erwünscht ist.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte innerhalb von drei Wochen nach Veröffentlichung an:
Kommissarischer Leiter
der Universitätsbibliothek Dortmund
Vogelpothsweg 76
44227 Dortmund
Für telefonische Rücksprachen steht zur Verfügung:
Frau Katja Laube, Tel. 0231 / 755 5071
Dortmund, 09.04.2009
http://www.ub.uni-dortmund.de/ubblog/stellenausschreibung-diplomarchivar
KlausGraf - am Freitag, 17. April 2009, 14:55 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.earlham.edu/~peters/fos/2009/04/open-access-tracking-project-oatp.html
http://www.connotea.org/tag/oa.new
I do not have a Connotea account - I tagged Open Access developments in Delicious and was content with this choice. I think my collection of 40+ links on the advantages of Open Access for monographs (supporting sales) is unique:
http://delicious.com/Klausgraf/monograph_open_access
Like the OAD Wiki http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page for OA related lists the colloborative bookmarking project Suber has started now is a step in the right (Web 2.0) direction.
Delicious has much more "impact" outside the scholarly world. It would be nice if a service could be established that weblinks with a certain tag (e.g. oa.news) in Delicious would also saved at Connotea (and vice versa).
Unfortunately, Suber's "Open Access News" has only ONE tag, i.e.. "hot". Finding earlyer blog entries with Google's full text search seems easy only for the Suber/Baker team. Tagging the single blog entries would bring more precision. Thus it would be helpful all OAN entries would also be tagged at Connotea.
The new project has a clear advantage for the non-English OA community. Suber does a great and excellent work but there is a bulk of new developments or other news (like the German Reuß/OA debate with a lot of statements) outside the English speaking world he isn't able to blog (due information overflow or language reasons). I would think there are some German people who are willing to tag German OA news. This could be no substitution for Suber's amazing summaries/excerpts and his lucid commentaries I admire every day but may be it could become a German OA "news chronicle" which lacks until now. Neither Open Access.net nor Archivalia can do this job.
I do not use Zotero until now but I think it would be a good idea to connect the tracking project with Zotero. (it could he helpful to establish a tag for formal categories like blog entry or peer reviewed publikation on OA).
In short: This is not only "hot" (Suber's tag) but also a "big" opportunity. Good luck!
http://www.connotea.org/tag/oa.new
I do not have a Connotea account - I tagged Open Access developments in Delicious and was content with this choice. I think my collection of 40+ links on the advantages of Open Access for monographs (supporting sales) is unique:
http://delicious.com/Klausgraf/monograph_open_access
Like the OAD Wiki http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page for OA related lists the colloborative bookmarking project Suber has started now is a step in the right (Web 2.0) direction.
Delicious has much more "impact" outside the scholarly world. It would be nice if a service could be established that weblinks with a certain tag (e.g. oa.news) in Delicious would also saved at Connotea (and vice versa).
Unfortunately, Suber's "Open Access News" has only ONE tag, i.e.. "hot". Finding earlyer blog entries with Google's full text search seems easy only for the Suber/Baker team. Tagging the single blog entries would bring more precision. Thus it would be helpful all OAN entries would also be tagged at Connotea.
The new project has a clear advantage for the non-English OA community. Suber does a great and excellent work but there is a bulk of new developments or other news (like the German Reuß/OA debate with a lot of statements) outside the English speaking world he isn't able to blog (due information overflow or language reasons). I would think there are some German people who are willing to tag German OA news. This could be no substitution for Suber's amazing summaries/excerpts and his lucid commentaries I admire every day but may be it could become a German OA "news chronicle" which lacks until now. Neither Open Access.net nor Archivalia can do this job.
I do not use Zotero until now but I think it would be a good idea to connect the tracking project with Zotero. (it could he helpful to establish a tag for formal categories like blog entry or peer reviewed publikation on OA).
In short: This is not only "hot" (Suber's tag) but also a "big" opportunity. Good luck!
KlausGraf - am Freitag, 17. April 2009, 00:10 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

So sieht es bisweilen aus, wenn man einen Artikel aufrufen will, dessen Zugänglichkeit "Open Access" mit dem Sponsor, der MGH, vereinbart wurde. DigiZeitschriften ist weit davon entfernt, ein deutsches JSTOR zu sein. Für die vielen Fehler und häufigen technischen Unzulänglichkeiten müssten die Bibliotheken, die teure Lizenzen kaufen, eigentlich Schmerzensgeld verlangen dürfen.
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2009, 23:09 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Fragen vom 02.04.2009:
" .... als Archivar habe ich mit großer Betroffenheit den Einsturz des Kölner Stadtarchivs mitverfolgt. Obwohl ich mich, so glaube ich sagen zu dürfen, eingehend informiert habe, sind mir Stellungnahmen europäischer Institutionen nicht bekannt.
Daher meine Fragen:
1) Liegen solche Äußerungen vor? Falls nein:
2) Warum hat sich der Kulturausschuss bis jetzt noch nicht mit dieser europäischen, kulturellen Katastrophe auseinandergesetzt ?
3) Wie ist Ihre Meinung zu diesem Ereignis ?
4) Teilen Sie die Einschätzung Ihrer Ausschusskollgein Ruth Hieronymi, dass der Einsturz des größten Kommunalarchivs nördlich der Alpen "eindeutig .... in die lokale und regionale Zuständigkeit fällt"?"
Antwort vom 16.04.2009:
" ..... auch ich bin sehr bestürzt über den Einsturz des Kölner Stadtarchivs und den Tod zweier junger Menschen. Der mit dem Unglück verbundene Verlust einer Vielzahl kultureller Schätze ist ein tragischer und weitreichender Rückschlag bei der Bewahrung historischer Dokumente. Ich hoffe, dass es gelingen wird, weitere Teile des Archivs zu bergen und zu rekonstruieren.
In Bezug auf die Zuständigkeiten kann ich mich jedoch leider nur meiner Ausschusskollegin anschließen und darauf hinweisen, dass die Kompetenzen hier klar in Deutschland und nicht bei der EU liegen. ....."
Quelle: http://www.abgeordnetenwatch.de/frage-651-12387--f174614.html
s. a.bei Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/5609908/ (Teil 1: Ruth Hieronymi, MdEP)
http://archiv.twoday.net/stories/5625276/ (Teil 2: Dr. Stefan Eisel, MdB)
http://archiv.twoday.net/stories/5626427/ (Teil 3: Doris Pack, MdEP)
http://archiv.twoday.net/stories/5629585/ (Teil 4: Dr. Günter Krings, MdB)
" .... als Archivar habe ich mit großer Betroffenheit den Einsturz des Kölner Stadtarchivs mitverfolgt. Obwohl ich mich, so glaube ich sagen zu dürfen, eingehend informiert habe, sind mir Stellungnahmen europäischer Institutionen nicht bekannt.
Daher meine Fragen:
1) Liegen solche Äußerungen vor? Falls nein:
2) Warum hat sich der Kulturausschuss bis jetzt noch nicht mit dieser europäischen, kulturellen Katastrophe auseinandergesetzt ?
3) Wie ist Ihre Meinung zu diesem Ereignis ?
4) Teilen Sie die Einschätzung Ihrer Ausschusskollgein Ruth Hieronymi, dass der Einsturz des größten Kommunalarchivs nördlich der Alpen "eindeutig .... in die lokale und regionale Zuständigkeit fällt"?"
Antwort vom 16.04.2009:
" ..... auch ich bin sehr bestürzt über den Einsturz des Kölner Stadtarchivs und den Tod zweier junger Menschen. Der mit dem Unglück verbundene Verlust einer Vielzahl kultureller Schätze ist ein tragischer und weitreichender Rückschlag bei der Bewahrung historischer Dokumente. Ich hoffe, dass es gelingen wird, weitere Teile des Archivs zu bergen und zu rekonstruieren.
In Bezug auf die Zuständigkeiten kann ich mich jedoch leider nur meiner Ausschusskollegin anschließen und darauf hinweisen, dass die Kompetenzen hier klar in Deutschland und nicht bei der EU liegen. ....."
Quelle: http://www.abgeordnetenwatch.de/frage-651-12387--f174614.html
s. a.bei Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/5609908/ (Teil 1: Ruth Hieronymi, MdEP)
http://archiv.twoday.net/stories/5625276/ (Teil 2: Dr. Stefan Eisel, MdB)
http://archiv.twoday.net/stories/5626427/ (Teil 3: Doris Pack, MdEP)
http://archiv.twoday.net/stories/5629585/ (Teil 4: Dr. Günter Krings, MdB)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 16. April 2009, 22:09 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Bereits seit 1991 widmet sich das Thüringer Archiv für Zeitgeschichte „Matthias Domaschk” der Sammlung und Archivierung privater Bestände zu Opposition, Widerstand und Zivilcourage in der DDR. Bis Ende 2008 saß die Einrichtung im ehemaligem Wohnhaus von Domaschk Am Rähmen 3. Jetzt hat das Archiv ein neues Domizil bezogen. Am Abend werden die neuen Räume feierlich eingeweiht."
Quelle:
http://www.jenapolis.de/2009/04/16/thueringer-archiv-fuer-zeitgeschichte-jetzt-in-jena-am-camsdorfer-ufer/
Quelle:
http://www.jenapolis.de/2009/04/16/thueringer-archiv-fuer-zeitgeschichte-jetzt-in-jena-am-camsdorfer-ufer/
Wolf Thomas - am Donnerstag, 16. April 2009, 19:36 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Dietmar Bartz - am Donnerstag, 16. April 2009, 19:19 - Rubrik: Kommunalarchive
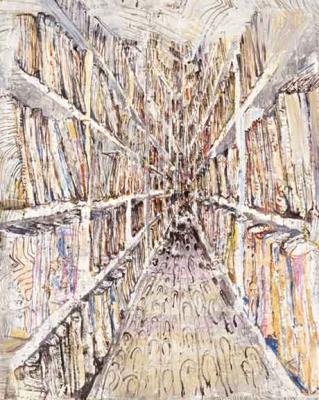
Archiv
160 x 200 cm
Ölfarbe auf Leinwand
2000 - 2006

Ordnung
160 x 200 cm
Ölfarbe auf Leinwand
2006
Homepage des Künstlers:
http://www.hartmann-thomas.de
Wolf Thomas - am Donnerstag, 16. April 2009, 18:38 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Dann wird ein rotes, abgegriffenes Fotoalbum aus einer Tonne gezogen:
"Das stammt wohl aus der Privatsammlung von Heinrich Böll“, sagt
Schaab. Darin: Porträts des Literatur-Nobelpreisträgers. Auch
Kontaktabzüge und Bilder des Fotopapstes Fritz L. Gruber wurden
geborgen. "Das bestärkt uns nur in unserer Arbeit“, freut sich Dr.
Gisela Fleckenstein, Archivarin des Historischen Archivs. ...."
Quelle:
http://www.express.de/nachrichten/region/koeln/fotos-von-boell-und-gruber-aus-truemmern-geborgen_artikel_1235811517350.html
Mit Video der neuen Kölner "Nachlassverwalterin" Dr. Gisela Fleckenstein
"Das stammt wohl aus der Privatsammlung von Heinrich Böll“, sagt
Schaab. Darin: Porträts des Literatur-Nobelpreisträgers. Auch
Kontaktabzüge und Bilder des Fotopapstes Fritz L. Gruber wurden
geborgen. "Das bestärkt uns nur in unserer Arbeit“, freut sich Dr.
Gisela Fleckenstein, Archivarin des Historischen Archivs. ...."
Quelle:
http://www.express.de/nachrichten/region/koeln/fotos-von-boell-und-gruber-aus-truemmern-geborgen_artikel_1235811517350.html
Mit Video der neuen Kölner "Nachlassverwalterin" Dr. Gisela Fleckenstein
Wolf Thomas - am Donnerstag, 16. April 2009, 18:32 - Rubrik: Kommunalarchive
nternational Blue Shield mission: 27 APRIL TO 1 MAY
Wednesday, 15 April 2009 09:09
[ http://tinyurl.com/cbwq8s ]
EVERY ARCHIVIST, RESTORER OR HERITAGE PROFESSIONAL WHO IS WILLING TO PARTICIPATE IN THIS MISSION IS KINDLY BUT URGENTLY REQUESTED TO RESPOND AS QUICKLY AS POSSIBLE BY SENDING A REPLY EMAIL TO CONTACT@ANCBS.ORGThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it WITH THE CONTACT DETAILS REQUESTED BELOW.
International Blue Shield mission: 27 APRIL TO 1 MAY
Dear Colleagues,
The new Blue Shield international coordination center in The Hague received a request for support from Cologne, which we distributed among our relations and Dutch Archive institutes and professionals. We have received many responses from those who want to help.
Together with the National Archive and the Dutch Branch organization of Archive institutes (BRAIN) we made an inventory of people and institutes willing to help. Their offers keep coming in. We have received many responses from The Netherlands, but also from Belgium, France, the United States and the Czech Republic. In the first week of April a delegation went to Cologne to see how best to coordinate offers of assistance. The staff in Cologne gave us a warm welcome and we obtained detailed information and a thorough impression of the work that is in progress.
The delegation was very much impressed by the work that has been done so far. The process of searching and finding the material is taking place under extremely dangerous and difficult circumstances. It is therefore a tremendous achievement to have made such progress. It has not only surprised us it has also surprised the staff and volunteers of the Archive. The planning has been revised several times and has greatly progressed. The prognoses are that the first phase of the recovery process (separating material, storage, registration, first aid to the objects like cleaning and drying or preparing for further treatment) needs one more month, so this will end even before the summer holidays.
The delegation was also very impressed by the determination and the motivation of everyone at work. After a month of stress and extremely long working hours spirits seem unbroken, though the fatigue is showing. Firemen are still the only ones working on the slope, because of the dangerous conditions. They have a whole team working day in day out and they will stay until the slope is gone.
A coordinated mission is needed as soon as possible. It will be most helpful in this first phase of the recovery process if several teams work at the same time and on the same location. In accordance with the staff in Cologne we therefore decided to reschule schedule our mission for 27 APRIL TO 1 MAY. A coordinated mission will save time and energy for the Archive staff,who must make the necessary arrangements for each individual volunteer, including booking the accommodation, introduction, transport, etc.)
To prepare the mission we needed some time. We are fully aware that all professionals who indicated their willingness to help will need some time too and may have difficulty matching a busy agenda with this unforeseen early departure. Because of this we hereby call on every professional, whether they have already indicated their interest to join us or are deciding to do so, to support our hardworking colleagues of Cologne and make this first international Blue Shield mission a success.
International Blue Shield mission: 27 APRIL TO 1 MAYApplication:
send a completed (see below) reply email to the Blue Shield coordination Center in The Hague: contact@ancbs.orgThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Date: Monday, 27 April to 1 May (Note: 1 May is a holiday).
Tasks: Sorting material (rubble/collection), select dry and wet materials, clean, register, dry partly wet material and prepare other material for freeze-drying at other locations.
Transport to Cologne: A touring car will depart from The Hague on Monday morning, the 27th of April and will return on the 1st of May. All participants are welcome to join us, since there will be no charge for this. This service will not be beneficial to all participants (f.e. from other countries), whom we regret must arrange and pay for their own transport.
Transport within Cologne: Transport by shuttle bus from accomodation to the work locations will be arranged free of charge by the city of Cologne.
Accommodation: The city of Cologne offers all volunteers free accomodation, food, and beverages. May 1st is a holiday for the Archive. The touring car will return to The Hague in the afternoon to enable participants to visit Cologne.
Insurance: The city of Cologne has provided the Archive with insurance for all volunteers.More information: Please visit our website http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.ancbs.org or attend our presentations (see below), in which we will provide you with more info about the actual situation in Cologne, the working conditions, tasks and facilities for the volunteers.
Monday April 20: The Hague, Nationaal Archief, Auditorium, 16.00 - 17.30 hrs.
Tuesday April 21: Nijmegen, Regionaal Archief Nijmegen,16.00 -17.30 hrs.
Saturday April 25 :s Hertogenbosch, Restauratiebeurs, 12.00 -13.00 hrs. the big theater----------------------------------------------------------------
Please fill in and send by return email to contact@ancbs.orgThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
YES / NO / NOT SURE Participate in the Blue Shield mission of Monday 27 April to Friday 1 May.
YES / NO Participate in the Blue Shield meeting at the Nationaal Archief
YES / NO Participate in the Blue Shield meeting at the Regionaal Archief Nijmegen
YES / NO Participate in the Blue Shield meeting at the Restauration fair in 's HertogenboschInstitution
Institution (Please send only one application form with all the names, if several members of your institute will join the mission):
.....................................................................
(Name(s): 1. .............................
2.................................
Etc. ...........................
Contact details: .........................................................................................................
Phonenumber (06 / direct).........................................
EACH PERSON OR INSTITUTE WHICH HAS ALREADY INDICATED THEIR WILLINGNESS TO HELP BUT IS UNABLE TO JOIN OUR MISSION DURING THIS PARTICULAR PERIOD IS ALSO KINDLY REQUESTED TO FILL IN THE NEW INFORMATION AND RETURN THIS EMAIL.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On behalf of BRAIN, Nationaal Archief en Blue Shield,
Marjan Otter
Secretary ANCBS
00 31 (0)20 4632342
Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS)
Postal address:
ANCBS Office,
Laan van Meerdervoort 70
2517 AN The Hague,
The Netherlands
E mail address: contact@ancbs.orgThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web address: http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.ancbs.org
Telephone: 00 31 (0)70-3466161
Fax: 00 31 (0)70-3467232
Wednesday, 15 April 2009 09:09
[ http://tinyurl.com/cbwq8s ]
EVERY ARCHIVIST, RESTORER OR HERITAGE PROFESSIONAL WHO IS WILLING TO PARTICIPATE IN THIS MISSION IS KINDLY BUT URGENTLY REQUESTED TO RESPOND AS QUICKLY AS POSSIBLE BY SENDING A REPLY EMAIL TO CONTACT@ANCBS.ORGThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it WITH THE CONTACT DETAILS REQUESTED BELOW.
International Blue Shield mission: 27 APRIL TO 1 MAY
Dear Colleagues,
The new Blue Shield international coordination center in The Hague received a request for support from Cologne, which we distributed among our relations and Dutch Archive institutes and professionals. We have received many responses from those who want to help.
Together with the National Archive and the Dutch Branch organization of Archive institutes (BRAIN) we made an inventory of people and institutes willing to help. Their offers keep coming in. We have received many responses from The Netherlands, but also from Belgium, France, the United States and the Czech Republic. In the first week of April a delegation went to Cologne to see how best to coordinate offers of assistance. The staff in Cologne gave us a warm welcome and we obtained detailed information and a thorough impression of the work that is in progress.
The delegation was very much impressed by the work that has been done so far. The process of searching and finding the material is taking place under extremely dangerous and difficult circumstances. It is therefore a tremendous achievement to have made such progress. It has not only surprised us it has also surprised the staff and volunteers of the Archive. The planning has been revised several times and has greatly progressed. The prognoses are that the first phase of the recovery process (separating material, storage, registration, first aid to the objects like cleaning and drying or preparing for further treatment) needs one more month, so this will end even before the summer holidays.
The delegation was also very impressed by the determination and the motivation of everyone at work. After a month of stress and extremely long working hours spirits seem unbroken, though the fatigue is showing. Firemen are still the only ones working on the slope, because of the dangerous conditions. They have a whole team working day in day out and they will stay until the slope is gone.
A coordinated mission is needed as soon as possible. It will be most helpful in this first phase of the recovery process if several teams work at the same time and on the same location. In accordance with the staff in Cologne we therefore decided to reschule schedule our mission for 27 APRIL TO 1 MAY. A coordinated mission will save time and energy for the Archive staff,who must make the necessary arrangements for each individual volunteer, including booking the accommodation, introduction, transport, etc.)
To prepare the mission we needed some time. We are fully aware that all professionals who indicated their willingness to help will need some time too and may have difficulty matching a busy agenda with this unforeseen early departure. Because of this we hereby call on every professional, whether they have already indicated their interest to join us or are deciding to do so, to support our hardworking colleagues of Cologne and make this first international Blue Shield mission a success.
International Blue Shield mission: 27 APRIL TO 1 MAYApplication:
send a completed (see below) reply email to the Blue Shield coordination Center in The Hague: contact@ancbs.orgThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Date: Monday, 27 April to 1 May (Note: 1 May is a holiday).
Tasks: Sorting material (rubble/collection), select dry and wet materials, clean, register, dry partly wet material and prepare other material for freeze-drying at other locations.
Transport to Cologne: A touring car will depart from The Hague on Monday morning, the 27th of April and will return on the 1st of May. All participants are welcome to join us, since there will be no charge for this. This service will not be beneficial to all participants (f.e. from other countries), whom we regret must arrange and pay for their own transport.
Transport within Cologne: Transport by shuttle bus from accomodation to the work locations will be arranged free of charge by the city of Cologne.
Accommodation: The city of Cologne offers all volunteers free accomodation, food, and beverages. May 1st is a holiday for the Archive. The touring car will return to The Hague in the afternoon to enable participants to visit Cologne.
Insurance: The city of Cologne has provided the Archive with insurance for all volunteers.More information: Please visit our website http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.ancbs.org or attend our presentations (see below), in which we will provide you with more info about the actual situation in Cologne, the working conditions, tasks and facilities for the volunteers.
Monday April 20: The Hague, Nationaal Archief, Auditorium, 16.00 - 17.30 hrs.
Tuesday April 21: Nijmegen, Regionaal Archief Nijmegen,16.00 -17.30 hrs.
Saturday April 25 :s Hertogenbosch, Restauratiebeurs, 12.00 -13.00 hrs. the big theater----------------------------------------------------------------
Please fill in and send by return email to contact@ancbs.orgThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
YES / NO / NOT SURE Participate in the Blue Shield mission of Monday 27 April to Friday 1 May.
YES / NO Participate in the Blue Shield meeting at the Nationaal Archief
YES / NO Participate in the Blue Shield meeting at the Regionaal Archief Nijmegen
YES / NO Participate in the Blue Shield meeting at the Restauration fair in 's HertogenboschInstitution
Institution (Please send only one application form with all the names, if several members of your institute will join the mission):
.....................................................................
(Name(s): 1. .............................
2.................................
Etc. ...........................
Contact details: .........................................................................................................
Phonenumber (06 / direct).........................................
EACH PERSON OR INSTITUTE WHICH HAS ALREADY INDICATED THEIR WILLINGNESS TO HELP BUT IS UNABLE TO JOIN OUR MISSION DURING THIS PARTICULAR PERIOD IS ALSO KINDLY REQUESTED TO FILL IN THE NEW INFORMATION AND RETURN THIS EMAIL.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On behalf of BRAIN, Nationaal Archief en Blue Shield,
Marjan Otter
Secretary ANCBS
00 31 (0)20 4632342
Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS)
Postal address:
ANCBS Office,
Laan van Meerdervoort 70
2517 AN The Hague,
The Netherlands
E mail address: contact@ancbs.orgThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web address: http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.ancbs.org
Telephone: 00 31 (0)70-3466161
Fax: 00 31 (0)70-3467232
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2009, 17:07 - Rubrik: English Corner
http://archiv.twoday.net/stories/5566219/
Sollte etwas nicht mehr aktuell sein, bitte ich um Korrektur (Hinweis in den Kommentaren).
Sollte etwas nicht mehr aktuell sein, bitte ich um Korrektur (Hinweis in den Kommentaren).
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2009, 16:31 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Appel aux partenaires en France
Le Comité français du Bouclier Bleu recherche actuellement des partenaires désirant participer à l'envoi de bénévoles à Cologne (Allemagne) pour aider nos collègues archivistes. Leur bâtiment s'est effondré début mars et des volontaires fouillent encore les décombres pour sauver les collections qui peuvent encore l'être.
La ville de Cologne a lancé un appel aux volontaires, que vous retrouverez sur le site du Bouclier Bleu international http://www.facebook.com/l.php?u=http://%28http%3A%2F%2Fwww.ancbs.org%29. Si vous souhaitez envoyer des bénévoles, participer à l'organisation de cette mission commune à plusieurs institutions / associations, de façon pécuniaire ou matérielle, n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
Les bénévoles devront se rendre en mission à Cologne vers la fin du mois d'avril, emmenant avec eux leur propre petit matériel. Nous recherchons donc des matériels, des offres d'aide à l'organisation d'une formation destinée aux bénévoles, ainsi que des financements éventuels pour le défraiement de ces bénévoles (frais de transport et de logement sur place).
Contactez le secrétariat du CFBB : secretariat@bouclier-bleu.fr
Le Comité français du Bouclier Bleu recherche actuellement des partenaires désirant participer à l'envoi de bénévoles à Cologne (Allemagne) pour aider nos collègues archivistes. Leur bâtiment s'est effondré début mars et des volontaires fouillent encore les décombres pour sauver les collections qui peuvent encore l'être.
La ville de Cologne a lancé un appel aux volontaires, que vous retrouverez sur le site du Bouclier Bleu international http://www.facebook.com/l.php?u=http://%28http%3A%2F%2Fwww.ancbs.org%29. Si vous souhaitez envoyer des bénévoles, participer à l'organisation de cette mission commune à plusieurs institutions / associations, de façon pécuniaire ou matérielle, n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
Les bénévoles devront se rendre en mission à Cologne vers la fin du mois d'avril, emmenant avec eux leur propre petit matériel. Nous recherchons donc des matériels, des offres d'aide à l'organisation d'une formation destinée aux bénévoles, ainsi que des financements éventuels pour le défraiement de ces bénévoles (frais de transport et de logement sur place).
Contactez le secrétariat du CFBB : secretariat@bouclier-bleu.fr
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2009, 16:21 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2009, 15:31 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.taz.de/1/leben/buch/artikel/1/schimmelalarm
Zum 1. Tagesbericht: http://archiv.twoday.net/stories/5643191/
Zum 2. Tagesbericht: http://archiv.twoday.net/stories/5645870/
[Parallel zum 3. Tagesbericht: http://archiv.twoday.net/stories/5647173/ ]
Heute: Im Kampf gegen Staub und Sporen und: Kleckern und Klotzen bei der Digitalisierung.
Es geht u.a. um Schimmelbefall, die neuen Schutzvorschriften und das digitale historische Archiv:
In den Tagen nach dem Einsturz, als manche Chaoten behaupteten, alles sei vernichtet, bildete sich eine kleine Initiative, um ein Digitales Stadtarchiv zu gründen. Sie forderte die Besitzer von Kopien kölnischer Archivalien auf, sie auf einer Website ins Internet einzustellen.
Nur – das ist Geklecker. Mehr als 10 Millionen Aufnahmen aus dem Stadtarchiv existieren auf Mikrofilm, darunter die nahezu gesamte Überlieferung vor 1815. Mehr als 6000 Filme, um deren sichere Aufbewahrung im berühmten Barbarastollen im Schwarzwald in den letzten Wochen viel Aufhebens gemacht wurde. Völlig unnötig, die Filme jetzt dort herauszuholen: Ein kompletter Satz liegt in Köln an einem sicheren Ort. Die verschütteten Exemplare, die wir manchmal entstauben, sind nur Arbeitskopien davon.
Das sind doch Informationen, die auf eine städtische Webseite gehören! Die Kaffeetrinker haben das erst von mir erfahren.
[...]
Die Mikrofilme ebenfalls online zu stellen – das wäre was. Aber dafür braucht man als Datenspeicher ein ganzes Rechenzentrum, eine Software mit passender Benutzeroberfläche, Lupen- und Diashow-Funktion. Nur eine Million Euro würden es kosten, zehn Millionen Bilder zu digitalisieren. Aber Programme und Infrastruktur brauchen viel mehr Zeit und Geld. Und dennoch hat die Idee Charme. Sie braucht ja nicht in Köln umgesetzt zu werden, weil die Archivare hier ja andere Sorgen haben ... „Hörn’Se auf“, bremst mich einer, „die haben schon genug Probleme mit ihrer Autonomie. Denen redet doch jetzt jeder rein.“
Hier werden die Kosten der Digitalisierung übertrieben. Brauchbare Navigations- und Viewer-Software gibt es teilweise als Open-Source. Ganzes Rechenzentrum: in welcher Zeit lebt der Autor?
Interessant sind die Hinweise auf frühere Archivkatastrophen nach 1945:
*1946 Leine-Überschwemmung schädigte Hauptstaatsarchiv Hannover
*1961 Brand von Burg Trausnitz (Staatsarchiv für Niederbayern)
* 1966 Arno-Flut schädigte Staatsarchiv Florenz
Auch ich wurde beobachtet:
Achtköpfig ist die Gruppe vom Uni-Archiv Aachen. Inmitten seiner Studierenden verdrückt Geschäftsführer Klaus Graf schweigend seine Brote. Er ist das Enfant terrible der deutschen Archivszene, ein Querulant und Eiferer, der sich ständig im Ton vergreift. Aber sein Blog „Archivalia“ ist die einzige brauchbare Quelle für Nachrichten über den Einsturz, in diesen Tagen Pflichtlektüre. Auch die Nachrichten aus L’Aquila am Ende dieser Protokolle stammen von dort. Aber wer Grafs Beiträge kommentiert, muss mit Antworten wie „Einfach mal die Fresse halten“ oder „Geschreibsel“ rechnen.
Zum 1. Tagesbericht: http://archiv.twoday.net/stories/5643191/
Zum 2. Tagesbericht: http://archiv.twoday.net/stories/5645870/
[Parallel zum 3. Tagesbericht: http://archiv.twoday.net/stories/5647173/ ]
Heute: Im Kampf gegen Staub und Sporen und: Kleckern und Klotzen bei der Digitalisierung.
Es geht u.a. um Schimmelbefall, die neuen Schutzvorschriften und das digitale historische Archiv:
In den Tagen nach dem Einsturz, als manche Chaoten behaupteten, alles sei vernichtet, bildete sich eine kleine Initiative, um ein Digitales Stadtarchiv zu gründen. Sie forderte die Besitzer von Kopien kölnischer Archivalien auf, sie auf einer Website ins Internet einzustellen.
Nur – das ist Geklecker. Mehr als 10 Millionen Aufnahmen aus dem Stadtarchiv existieren auf Mikrofilm, darunter die nahezu gesamte Überlieferung vor 1815. Mehr als 6000 Filme, um deren sichere Aufbewahrung im berühmten Barbarastollen im Schwarzwald in den letzten Wochen viel Aufhebens gemacht wurde. Völlig unnötig, die Filme jetzt dort herauszuholen: Ein kompletter Satz liegt in Köln an einem sicheren Ort. Die verschütteten Exemplare, die wir manchmal entstauben, sind nur Arbeitskopien davon.
Das sind doch Informationen, die auf eine städtische Webseite gehören! Die Kaffeetrinker haben das erst von mir erfahren.
[...]
Die Mikrofilme ebenfalls online zu stellen – das wäre was. Aber dafür braucht man als Datenspeicher ein ganzes Rechenzentrum, eine Software mit passender Benutzeroberfläche, Lupen- und Diashow-Funktion. Nur eine Million Euro würden es kosten, zehn Millionen Bilder zu digitalisieren. Aber Programme und Infrastruktur brauchen viel mehr Zeit und Geld. Und dennoch hat die Idee Charme. Sie braucht ja nicht in Köln umgesetzt zu werden, weil die Archivare hier ja andere Sorgen haben ... „Hörn’Se auf“, bremst mich einer, „die haben schon genug Probleme mit ihrer Autonomie. Denen redet doch jetzt jeder rein.“
Hier werden die Kosten der Digitalisierung übertrieben. Brauchbare Navigations- und Viewer-Software gibt es teilweise als Open-Source. Ganzes Rechenzentrum: in welcher Zeit lebt der Autor?
Interessant sind die Hinweise auf frühere Archivkatastrophen nach 1945:
*1946 Leine-Überschwemmung schädigte Hauptstaatsarchiv Hannover
*1961 Brand von Burg Trausnitz (Staatsarchiv für Niederbayern)
* 1966 Arno-Flut schädigte Staatsarchiv Florenz
Auch ich wurde beobachtet:
Achtköpfig ist die Gruppe vom Uni-Archiv Aachen. Inmitten seiner Studierenden verdrückt Geschäftsführer Klaus Graf schweigend seine Brote. Er ist das Enfant terrible der deutschen Archivszene, ein Querulant und Eiferer, der sich ständig im Ton vergreift. Aber sein Blog „Archivalia“ ist die einzige brauchbare Quelle für Nachrichten über den Einsturz, in diesen Tagen Pflichtlektüre. Auch die Nachrichten aus L’Aquila am Ende dieser Protokolle stammen von dort. Aber wer Grafs Beiträge kommentiert, muss mit Antworten wie „Einfach mal die Fresse halten“ oder „Geschreibsel“ rechnen.
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2009, 14:10 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zum 1. Tagesbericht: http://archiv.twoday.net/stories/5643191/
Zum 2. Tagesbericht: http://archiv.twoday.net/stories/5645870/
" ..... Im Kölner Stadt-Anzeiger hat heute die Stadtarchivarin von Siegburg kritisiert, dass mit dem Arbeitsschutz zu lax umgegangen wird: schlecht sitzende Atemmasken, schlechte Durchlüftung. Dabei können die Pilze auf dem Schriftgut Allergien und Krebs auslösen. „Eine Unverschämtheit,“ sagt sie.
Die Kritik von der rechten Rheinseite sitzt. Ab sofort müssen wir die Schutzanzüge vor jeder Mahlzeit ausziehen, Trinkflaschen dürfen nicht mehr in die Halle mitgenommen werden, das Tragen der Mundschutze wird auch in Bereichen ohne Pilzverdacht kontrolliert. „Das ist eine politische Entscheidung. Sieben Werktage lang wird eine Schimmelprüfung veranstaltet, dann sehen wir weiter,“ erklärt der Archivar vom Dienst im roten T-Shirt. Er gibt zu erkennen, dass er das für überflüssig hält. .....Nur ist die Stadt nicht von selbst darauf gekommen, fortlaufend die Staub- und Sporenbelastung zu messen. Hätte sie das getan, könnten wir uns die ganze Aufregung sparen. Wenigstens wird die heutige Aufregung künftig ein paar Dummies vor sich selbst schützen. Öfters haben Leute ganz ohne Mundschutz gearbeitet. Eine trug einen schicken dunkelblauen Stoff-Overall, die langen roten Haare frei darüber. Leider verschwindet jetzt auch die farbige Funktionswäsche der Kölner unter den weißen Schutzanzügen. .....
Quelle:
http://www.taz.de/1/leben/buch/artikel/1/schimmelalarm
[Beitrag gekürzt, weitere Zitate unter http://archiv.twoday.net/stories/5647201/ KG]
Zum 2. Tagesbericht: http://archiv.twoday.net/stories/5645870/
" ..... Im Kölner Stadt-Anzeiger hat heute die Stadtarchivarin von Siegburg kritisiert, dass mit dem Arbeitsschutz zu lax umgegangen wird: schlecht sitzende Atemmasken, schlechte Durchlüftung. Dabei können die Pilze auf dem Schriftgut Allergien und Krebs auslösen. „Eine Unverschämtheit,“ sagt sie.
Die Kritik von der rechten Rheinseite sitzt. Ab sofort müssen wir die Schutzanzüge vor jeder Mahlzeit ausziehen, Trinkflaschen dürfen nicht mehr in die Halle mitgenommen werden, das Tragen der Mundschutze wird auch in Bereichen ohne Pilzverdacht kontrolliert. „Das ist eine politische Entscheidung. Sieben Werktage lang wird eine Schimmelprüfung veranstaltet, dann sehen wir weiter,“ erklärt der Archivar vom Dienst im roten T-Shirt. Er gibt zu erkennen, dass er das für überflüssig hält. .....Nur ist die Stadt nicht von selbst darauf gekommen, fortlaufend die Staub- und Sporenbelastung zu messen. Hätte sie das getan, könnten wir uns die ganze Aufregung sparen. Wenigstens wird die heutige Aufregung künftig ein paar Dummies vor sich selbst schützen. Öfters haben Leute ganz ohne Mundschutz gearbeitet. Eine trug einen schicken dunkelblauen Stoff-Overall, die langen roten Haare frei darüber. Leider verschwindet jetzt auch die farbige Funktionswäsche der Kölner unter den weißen Schutzanzügen. .....
Quelle:
http://www.taz.de/1/leben/buch/artikel/1/schimmelalarm
[Beitrag gekürzt, weitere Zitate unter http://archiv.twoday.net/stories/5647201/ KG]
Wolf Thomas - am Donnerstag, 16. April 2009, 14:09 - Rubrik: Kommunalarchive
http://www.lexilogos.com/suisse_alemanique_dictionnaire.htm
Mit Links zum "Schweizerischen Idiotikon" beim Internet Archiv.
Mit Links zum "Schweizerischen Idiotikon" beim Internet Archiv.
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2009, 13:37 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2009, 05:43 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/dmg/
Die im Jahre 1845 gegründete Deutsche Morgenländische Gesellschaft (DMG) gibt seit 1847 eine eigene, alle Teilgebiete der Orientalistik berührende Zeitschrift heraus. Die Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG) gehört bis in die Gegenwart auch über den deutschschsprachigen Raum hinaus zu den bedeutendsten orientalistischen Fachperiodika. Darüber hinaus publizierte die DMG im Ergebnis einer deutlicheren Differenzierung einschlägiger Fachdisziplinen zeitlich begrenzt drei weitere Zeitschriften. Die Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete erschien von 1886 bis 1938, die Zeitschrift für Indologie und Iranistik von 1922 bis 1936 und die Zeitschrift für Semitistik und verwandte Gebiete von 1922 bis 1935. Die in den genannten Zeitschriften veröffentlichten Beiträge repräsentieren für die genannten Publikationszeiträume den Kenntnissstand der auf den Orient fokussierten Wissenschaften und sind daher eine wertvolle Quelle sowohl für die Rekonstruktion des wissenschaftlichen Diskurses wie auch für die aktuelle Forschung.
Das Projekt
Im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts werden die von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft publizierten Periodika in einem Umfang von ca. 132.000 Seiten digitalisiert und für die Suche in den Inhaltsverzeichnissen der Bände wie auch in den Volltexten der enthaltenen Beiträge erschlossen. Die entstehende Sammlung ist frei zugänglich. Der Nachweis der Zeitschrifteninhalte erfolgt auch in der Zeitschrifteninhaltsdatenbank der Virtuellen Fachbibliothek Vorderer Orient MENALIB - MENAcontents. Die Digitalisate werden bei der Deutschen Nationalbibliothek (DNB), im Zentralen Verzeichnis digitalisierter Drucke (zvdd) und im Portal DigiZeitschriften nachgewiesen.
Die im Jahre 1845 gegründete Deutsche Morgenländische Gesellschaft (DMG) gibt seit 1847 eine eigene, alle Teilgebiete der Orientalistik berührende Zeitschrift heraus. Die Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG) gehört bis in die Gegenwart auch über den deutschschsprachigen Raum hinaus zu den bedeutendsten orientalistischen Fachperiodika. Darüber hinaus publizierte die DMG im Ergebnis einer deutlicheren Differenzierung einschlägiger Fachdisziplinen zeitlich begrenzt drei weitere Zeitschriften. Die Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete erschien von 1886 bis 1938, die Zeitschrift für Indologie und Iranistik von 1922 bis 1936 und die Zeitschrift für Semitistik und verwandte Gebiete von 1922 bis 1935. Die in den genannten Zeitschriften veröffentlichten Beiträge repräsentieren für die genannten Publikationszeiträume den Kenntnissstand der auf den Orient fokussierten Wissenschaften und sind daher eine wertvolle Quelle sowohl für die Rekonstruktion des wissenschaftlichen Diskurses wie auch für die aktuelle Forschung.
Das Projekt
Im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts werden die von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft publizierten Periodika in einem Umfang von ca. 132.000 Seiten digitalisiert und für die Suche in den Inhaltsverzeichnissen der Bände wie auch in den Volltexten der enthaltenen Beiträge erschlossen. Die entstehende Sammlung ist frei zugänglich. Der Nachweis der Zeitschrifteninhalte erfolgt auch in der Zeitschrifteninhaltsdatenbank der Virtuellen Fachbibliothek Vorderer Orient MENALIB - MENAcontents. Die Digitalisate werden bei der Deutschen Nationalbibliothek (DNB), im Zentralen Verzeichnis digitalisierter Drucke (zvdd) und im Portal DigiZeitschriften nachgewiesen.
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2009, 05:19 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2009, 04:51 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1287365
How Adopting the Lex Originis Rule Can Impede the Flow of Illicit Cultural Property
Derek Fincham
Loyola University New Orleans College of Law
Columbia Journal of Law and the Arts, Vol. 32, p. 111, 2008
Abstract:
The International trade and transfer of art and antiquities faces problems because nations have erected very different rules with respect to movable property. All nations forbid theft, however most cultural property disputes involve an original owner and a subsequent good faith possessor. Different jurisdictions have chosen to allocate rights and responsibilities between these two relative innocents in very different ways. Disharmony in the law is seldom a good thing, but in the realm of cultural property it can be particularly damaging to the interests of nations, museums, individuals, and our collective cultural heritage. The lack of harmony ensures no overarching policy choices will be furthered, which prevents parties from anticipating legal outcomes and giving substance to policies.
This article explores the default conflict of law rules which are applied to cultural property, and shows how the lex situs rule exploits the various legal rules which apply to art and antiquities. It challenges the lofty position enjoyed by the lex situs rule and proposes a radical reform of the default choice of law analysis. By employing the law of the Nation of Origin or lex originis courts can ensure the jurisdiction with the most tangible connection to an object enjoys the benefit of applying its legal rules to a given dispute. This will not only ensure the security of art and antiquities transactions, but impart much-needed transparency into the cultural property trade, and finally will decrease the theft and illegal excavation of art and antiquities.
The article begins by presenting some examples of recent disputes, and the problems they present for the law and cultural heritage policy. Section II describes the fundamental difficulty of adjudicating claims between two relative innocents, and the disharmony which has resulted as different jurisdictions have resolved this conundrum in very different ways. Section III lays out the ways in which private international law impacts art and antiquities disputes. Section IV analyzes the 1995 UNIDROIT Convention, the most recent attempt to harmonize the law affecting cultural property. Section V proposes a radical reform of the choice of law enquiry taken by courts.
How Adopting the Lex Originis Rule Can Impede the Flow of Illicit Cultural Property
Derek Fincham
Loyola University New Orleans College of Law
Columbia Journal of Law and the Arts, Vol. 32, p. 111, 2008
Abstract:
The International trade and transfer of art and antiquities faces problems because nations have erected very different rules with respect to movable property. All nations forbid theft, however most cultural property disputes involve an original owner and a subsequent good faith possessor. Different jurisdictions have chosen to allocate rights and responsibilities between these two relative innocents in very different ways. Disharmony in the law is seldom a good thing, but in the realm of cultural property it can be particularly damaging to the interests of nations, museums, individuals, and our collective cultural heritage. The lack of harmony ensures no overarching policy choices will be furthered, which prevents parties from anticipating legal outcomes and giving substance to policies.
This article explores the default conflict of law rules which are applied to cultural property, and shows how the lex situs rule exploits the various legal rules which apply to art and antiquities. It challenges the lofty position enjoyed by the lex situs rule and proposes a radical reform of the default choice of law analysis. By employing the law of the Nation of Origin or lex originis courts can ensure the jurisdiction with the most tangible connection to an object enjoys the benefit of applying its legal rules to a given dispute. This will not only ensure the security of art and antiquities transactions, but impart much-needed transparency into the cultural property trade, and finally will decrease the theft and illegal excavation of art and antiquities.
The article begins by presenting some examples of recent disputes, and the problems they present for the law and cultural heritage policy. Section II describes the fundamental difficulty of adjudicating claims between two relative innocents, and the disharmony which has resulted as different jurisdictions have resolved this conundrum in very different ways. Section III lays out the ways in which private international law impacts art and antiquities disputes. Section IV analyzes the 1995 UNIDROIT Convention, the most recent attempt to harmonize the law affecting cultural property. Section V proposes a radical reform of the choice of law enquiry taken by courts.
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2009, 04:47 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Dillingen, Studienbibliothek
28 Fragmente, alle:
http://www.digitale-sammlungen.de/~db/ausgaben/uni_ausgabe.html?projekt=1154506193&ordnung=sig&recherche=ja
Düsseldorf, ULB
http://www.ub.uni-duesseldorf.de/home/ueber_uns/projekte/abgeschlossene_projekte/fragmente/vorbemerkung
Karlsruhe, Badische LB
Reichenauer Pergamentfragmente, alle
http://www.blb-karlsruhe.de/virt_bib/fragmenta_augiensia/
Marburg, Staatsarchiv
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/hs-online.htm
München, Staatsbibliothek
Cgm und Clm
http://www.digitale-sammlungen.de/~db/ausgaben/uni_ausgabe.html?projekt=1137508549&ordnung=sig&recherche=ja
Zahlreiche einzelne Abbildungen deutschsprachiger Fragmente weist nach:
http://www.handschriftencensus.de/hssabbildungen
In der Digitalen Bibliothek Thüringen
http://www.db-thueringen.de/servlets/MCRSearchServlet?mode=results&id=gst2srxvmxojftkrpeqf&numPerPage=7
findet man nicht nur einige deutschsprachige Handschriftenfragmente aus Jena, sondern auch - leider nicht für die Öffentlichkeit freigegebene - Fragmente aus dem Schlossmuseum Sondershausen

28 Fragmente, alle:
http://www.digitale-sammlungen.de/~db/ausgaben/uni_ausgabe.html?projekt=1154506193&ordnung=sig&recherche=ja
Düsseldorf, ULB
http://www.ub.uni-duesseldorf.de/home/ueber_uns/projekte/abgeschlossene_projekte/fragmente/vorbemerkung
Karlsruhe, Badische LB
Reichenauer Pergamentfragmente, alle
http://www.blb-karlsruhe.de/virt_bib/fragmenta_augiensia/
Marburg, Staatsarchiv
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/hs-online.htm
München, Staatsbibliothek
Cgm und Clm
http://www.digitale-sammlungen.de/~db/ausgaben/uni_ausgabe.html?projekt=1137508549&ordnung=sig&recherche=ja
Zahlreiche einzelne Abbildungen deutschsprachiger Fragmente weist nach:
http://www.handschriftencensus.de/hssabbildungen
In der Digitalen Bibliothek Thüringen
http://www.db-thueringen.de/servlets/MCRSearchServlet?mode=results&id=gst2srxvmxojftkrpeqf&numPerPage=7
findet man nicht nur einige deutschsprachige Handschriftenfragmente aus Jena, sondern auch - leider nicht für die Öffentlichkeit freigegebene - Fragmente aus dem Schlossmuseum Sondershausen

KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2009, 03:05 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.textkritik.de/digitalia/kosten_dvjs.pdf
Uwe Jochum will am Beispiel der "Deutschen Vierteljahrsschrift" zeigen, dass Open Access erheblich mehr kostet als wir Open-Access-Anhänger zugeben. Er vergleicht dabei, BCK bemerkte dies in Twitter richtig, Äpfel mit Birnen.
Es ist schon ganz und gar verfehlt, von einem "Autor bezahlt"-Modell auszugehen, denn wie Peter Suber nicht müde wird zu betonen, erhebt etwas mehr als die Hälfte aller Open Access Zeitschriften keine Artikel-Gebühren, wird also anderweitig finanziert.
Sodann ist es natürlich ein unverzeihlicher Fehler, ein STM-Organ wie die PLoS, die mit Hochpreisprodukten wie Nature oder Science konkurrieren muss, mit einer im Vergleich dazu spottbilligen geisteswissenschaftlichen Zeitschrift zu vergleichen. Die DVjs kostet mit Versandkosten 116 Euro im Jahr. Wegen der DVjs gäbe es ganz sicher keine Zeitschriftenkrise und also auch keine Open-Access-Bewegung.
Schauen wir aber doch einmal genauer hin. Die Homepage der zeitschrift liegt auf dem Server der Uni Konstanz, der Redakteur wird vermutlich ebenfalls von der Uni Konstanz und nicht vom Metzler-Verlag bezahlt, desgleichen das Sekretariat und das Layout:
http://www.uni-konstanz.de/dvjs/editorial.htm
Man legt viel Wert darauf, dass die Autoren druckreife Manuskripte einreichen und gibt sogar Details der Formatierung vor:
http://www.uni-konstanz.de/dvjs/Manuskriptneu.pdf
Wenn nicht alles täuscht, lagert der Verlag die entscheidenden Verlagsleistungen, den Verlags-Mehrwert wie Lektorat/Redaktion, aus: Die Uni Konstanz zahlt vermutlich dafür.
Ein eigenes Online-Angebot gibt es gar nicht, ältere Jahrgänge sind in PAO und DigiZeitschriften zugänglich (dort bis 2002, das Autoren-Merkblatt spricht von einer moving wall von 3 Jahren).
Dass man auch mit einem Low Budget eine Open-Access-Zeitschrift herausgeben kann, zeigt die unter
http://archiv.twoday.net/stories/5545057/
dokumentierte Fallstudie aus Italien.
Spendiert eine Uni den Netzplatz (eventuell kann man auch die Repositorien-Software nutzen), wird das Peer Review von Freiwilligen organisiert und vielleicht auch die Redaktion, so kann man eine elektronische Zeitschrift mit einem sehr geringen Etat finanzieren. Es müssen nicht dutzende Verlagsangestellte bezahlt werden, die Miete fürs noble Verlagsgebäude mit der erlesenen Lobby entfällt, desgleichen die Kosten fürs Lagern der Bücher und ihren physischen Transport zum Kunden.
Milchmädchen würden sich schämen, so eine Rechnung wie die Jochums vorzulegen!
Update: Siehe auch den Kommentar. Wenn die aufwändige Redaktionstätigkeit von einer Uni bezahlt wird, muss man keine hohen Artikelgebühren nehmen. Zu Kritik am Preis-Leistungs-Verhältnis bei OA-Journals:
http://gunther-eysenbach.blogspot.com/2008/11/article-processing-fees-and-open-access.html
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/5773340/ Mehr zu Jochum
Uwe Jochum will am Beispiel der "Deutschen Vierteljahrsschrift" zeigen, dass Open Access erheblich mehr kostet als wir Open-Access-Anhänger zugeben. Er vergleicht dabei, BCK bemerkte dies in Twitter richtig, Äpfel mit Birnen.
Es ist schon ganz und gar verfehlt, von einem "Autor bezahlt"-Modell auszugehen, denn wie Peter Suber nicht müde wird zu betonen, erhebt etwas mehr als die Hälfte aller Open Access Zeitschriften keine Artikel-Gebühren, wird also anderweitig finanziert.
Sodann ist es natürlich ein unverzeihlicher Fehler, ein STM-Organ wie die PLoS, die mit Hochpreisprodukten wie Nature oder Science konkurrieren muss, mit einer im Vergleich dazu spottbilligen geisteswissenschaftlichen Zeitschrift zu vergleichen. Die DVjs kostet mit Versandkosten 116 Euro im Jahr. Wegen der DVjs gäbe es ganz sicher keine Zeitschriftenkrise und also auch keine Open-Access-Bewegung.
Schauen wir aber doch einmal genauer hin. Die Homepage der zeitschrift liegt auf dem Server der Uni Konstanz, der Redakteur wird vermutlich ebenfalls von der Uni Konstanz und nicht vom Metzler-Verlag bezahlt, desgleichen das Sekretariat und das Layout:
http://www.uni-konstanz.de/dvjs/editorial.htm
Man legt viel Wert darauf, dass die Autoren druckreife Manuskripte einreichen und gibt sogar Details der Formatierung vor:
http://www.uni-konstanz.de/dvjs/Manuskriptneu.pdf
Wenn nicht alles täuscht, lagert der Verlag die entscheidenden Verlagsleistungen, den Verlags-Mehrwert wie Lektorat/Redaktion, aus: Die Uni Konstanz zahlt vermutlich dafür.
Ein eigenes Online-Angebot gibt es gar nicht, ältere Jahrgänge sind in PAO und DigiZeitschriften zugänglich (dort bis 2002, das Autoren-Merkblatt spricht von einer moving wall von 3 Jahren).
Dass man auch mit einem Low Budget eine Open-Access-Zeitschrift herausgeben kann, zeigt die unter
http://archiv.twoday.net/stories/5545057/
dokumentierte Fallstudie aus Italien.
Spendiert eine Uni den Netzplatz (eventuell kann man auch die Repositorien-Software nutzen), wird das Peer Review von Freiwilligen organisiert und vielleicht auch die Redaktion, so kann man eine elektronische Zeitschrift mit einem sehr geringen Etat finanzieren. Es müssen nicht dutzende Verlagsangestellte bezahlt werden, die Miete fürs noble Verlagsgebäude mit der erlesenen Lobby entfällt, desgleichen die Kosten fürs Lagern der Bücher und ihren physischen Transport zum Kunden.
Milchmädchen würden sich schämen, so eine Rechnung wie die Jochums vorzulegen!
Update: Siehe auch den Kommentar. Wenn die aufwändige Redaktionstätigkeit von einer Uni bezahlt wird, muss man keine hohen Artikelgebühren nehmen. Zu Kritik am Preis-Leistungs-Verhältnis bei OA-Journals:
http://gunther-eysenbach.blogspot.com/2008/11/article-processing-fees-and-open-access.html
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/5773340/ Mehr zu Jochum
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2009, 01:42 - Rubrik: Open Access
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2009, 01:31 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Update zu http://archiv.twoday.net/stories/5646154/
Ralf Roletschek hat mir freundlicherweise eine Mail zu seinen
Erfahrungen mit unbefugter Nutzung gesendet, deren Informationen ich mit seiner Zustimmung verwenden darf.
Mail an einen Webmaster eines nichtkommerziellen Projekts.
"Hallo,
auf ... verwenden sie ein Bild von mir aus der Wikipedia. Bitte
bedenken sie, daß eine derartige Verwendung eine
Urheberrechtsverletzung darstellt, wenn die Lizenz (GNU-FDL) nicht
genannt und verlinkt wird sowie der Autor nicht genannt ist. In meinem speziellen Fall brauchen sie nichts tun, es gibt aber
Wikipedia-Benutzer, die das strenger sehen. Da kommt es schnell zu
deutlich dreistelligen Forderungen. Falls sie also andere Bilder aus
der Wikipedia benutzen... ;)
Wenn sie weitere Bilder aus Eberswalde wünschen, kann ich gern bei
besserem Wetter kostenlos welche anfertigen."
Im weiteren Text der Mail ging es um sachliche Verbesserungsvorschläge zur Internetseite.
"Ich habe ein Buch hier: ... - falls ich da was nachschlagen soll,
können Sie Bescheid geben."
Darauf kam die Mail des Betreibers mit Entschuldigung: "Ich bitte ich sehr um Entschuldigung, dass ich Ihr Foto nicht korrekt nachgewiesen habe. Dies habe ich schlicht bei der Erstellung der Seite vergessen, wobei ich mich sonst immer bemühe, die Nachweise präzise zu machen".
Mittlerweile steht Ralf Roletschek mit ihm in Kontakt und versorgt ihn mit kostenlosen Fotos.
"Es ist mitnichten so, daß wir arme Schüler abmahnen - aber wenn ein Reisebüro mit meinen Helsinki-Bildern Reisen bewirbt und weder Lizenz noch Urheber nennen mag, bekommen sie eine Rechnung. Eine andere, fast lustige Geschichte ... da hat ein kleiner privater Webmaster ein Foto von mir von einem Motor aus der WP "geklaut", ich habe ihn angemahnt (270 Euro Rechnung), 2 Stunden später kam ein völlig verstörter Anruf und die Entschuldigung. Ergebnis: Wir treffen uns zu einer von mir organisierten Fahrradtour und er wirbt auf seiner Seite für mich: ... - ich nehme natürlich kein Geld. Wenn aber jemand WP-Mirrors betreibt und seit 1,5 Jahren nicht auf Mails reagiert, dann gibt es eine Rechnung und das endet dann so: [Link auf eingestelltes Wiki, auf dessen Internetpräsenz jetzt steht, dass die Inhalte dieser Seite vollständig entfernt wurden]"
Ralf Roletschek hat mir freundlicherweise eine Mail zu seinen
Erfahrungen mit unbefugter Nutzung gesendet, deren Informationen ich mit seiner Zustimmung verwenden darf.
Mail an einen Webmaster eines nichtkommerziellen Projekts.
"Hallo,
auf ... verwenden sie ein Bild von mir aus der Wikipedia. Bitte
bedenken sie, daß eine derartige Verwendung eine
Urheberrechtsverletzung darstellt, wenn die Lizenz (GNU-FDL) nicht
genannt und verlinkt wird sowie der Autor nicht genannt ist. In meinem speziellen Fall brauchen sie nichts tun, es gibt aber
Wikipedia-Benutzer, die das strenger sehen. Da kommt es schnell zu
deutlich dreistelligen Forderungen. Falls sie also andere Bilder aus
der Wikipedia benutzen... ;)
Wenn sie weitere Bilder aus Eberswalde wünschen, kann ich gern bei
besserem Wetter kostenlos welche anfertigen."
Im weiteren Text der Mail ging es um sachliche Verbesserungsvorschläge zur Internetseite.
"Ich habe ein Buch hier: ... - falls ich da was nachschlagen soll,
können Sie Bescheid geben."
Darauf kam die Mail des Betreibers mit Entschuldigung: "Ich bitte ich sehr um Entschuldigung, dass ich Ihr Foto nicht korrekt nachgewiesen habe. Dies habe ich schlicht bei der Erstellung der Seite vergessen, wobei ich mich sonst immer bemühe, die Nachweise präzise zu machen".
Mittlerweile steht Ralf Roletschek mit ihm in Kontakt und versorgt ihn mit kostenlosen Fotos.
"Es ist mitnichten so, daß wir arme Schüler abmahnen - aber wenn ein Reisebüro mit meinen Helsinki-Bildern Reisen bewirbt und weder Lizenz noch Urheber nennen mag, bekommen sie eine Rechnung. Eine andere, fast lustige Geschichte ... da hat ein kleiner privater Webmaster ein Foto von mir von einem Motor aus der WP "geklaut", ich habe ihn angemahnt (270 Euro Rechnung), 2 Stunden später kam ein völlig verstörter Anruf und die Entschuldigung. Ergebnis: Wir treffen uns zu einer von mir organisierten Fahrradtour und er wirbt auf seiner Seite für mich: ... - ich nehme natürlich kein Geld. Wenn aber jemand WP-Mirrors betreibt und seit 1,5 Jahren nicht auf Mails reagiert, dann gibt es eine Rechnung und das endet dann so: [Link auf eingestelltes Wiki, auf dessen Internetpräsenz jetzt steht, dass die Inhalte dieser Seite vollständig entfernt wurden]"
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2009, 01:02 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

It asks for identifications of the books.
http://www.flickr.com/photos/37244113@N08/sets/72157616462881853/
KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2009, 00:59 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Sarnen OW, Verwaltungsgebäude. Mundart-Rocker Polo Hofer und «Edelmais»-Komiker René Rindlisbacher liegen sich in den Haaren. «Gahts no», ruft Rindlisbacher. «Dann bleibt wieder alles an mir hängen», wehrt sich Polo. Cut. Das Publikum klatscht. Eine weitere Szene ist im Kasten.
Zum ersten Mal stehen die bühnenerprobten Schweizer gemeinsam vor der Kamera. Für «Nagelprobe», einen Mystery-Heimatfilm von Regisseur Luke Gasser. Polo spielt den Archivar Aschwanden, der mit dem Wirtschaftshai Bertschi (Rindlisbacher) ein Folterinstrument aus dem Mittelalter verschwinden lässt.
Vor der Kamera ist Polo souverän. Der bünzlige Staatsangestellte gelingt ihm gut. «Ich bin halt im Herzen auch ein Beamter», erklärt der Rocker. Und im Mittelalter wäre er am liebsten Gessler gewesen. «Tell war ja ein Terrorist», meint er mit Schalk in den Augen. ....."
Quelle:
http://www.blick.ch/people/polo-im-herzen-ein-beamter-116828
Zum ersten Mal stehen die bühnenerprobten Schweizer gemeinsam vor der Kamera. Für «Nagelprobe», einen Mystery-Heimatfilm von Regisseur Luke Gasser. Polo spielt den Archivar Aschwanden, der mit dem Wirtschaftshai Bertschi (Rindlisbacher) ein Folterinstrument aus dem Mittelalter verschwinden lässt.
Vor der Kamera ist Polo souverän. Der bünzlige Staatsangestellte gelingt ihm gut. «Ich bin halt im Herzen auch ein Beamter», erklärt der Rocker. Und im Mittelalter wäre er am liebsten Gessler gewesen. «Tell war ja ein Terrorist», meint er mit Schalk in den Augen. ....."
Quelle:
http://www.blick.ch/people/polo-im-herzen-ein-beamter-116828
Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. April 2009, 22:11 - Rubrik: Wahrnehmung
" .....Die Suche nach der Ursache der Hebungen, mit der das 7800-Einwohner-Städtchen in der Nähe von Freiburg in den vergangenen Jahren mehrfach bundesweit Schlagzeilen gemacht hatte, blieb zunächst buchstäblich im Boden stecken. Auslöser der Erdbewegungen sollen Bohrungen gewesen sein. Dies hatte die Stadt im September 2007 veranlasst, um im Rathaus eine Erdwärmeheizung zu installieren. Seitdem ist Staufen schon fast 15 Zentimeter gewachsen, sozusagen - in die Höhe.
Nach Erkenntnissen des extra eingerichteten Arbeitskreises Hebungsrisse wurden die Hebungen sehr wahrscheinlich durch Quellvorgänge in einer Erdschicht, der sogenannten Gips-Keuper-Schicht, als Folge der Erdwärmebohrungen hervorgerufen. Die Schäden an fast 170 Gebäuden sind inzwischen so groß geworden, dass manche bereits abgestützt werden müssen. Besonders betroffen sind ausgerechnet das Rathaus und das Stadtarchiv - zwei Gebäude, die eigentlich von den Erdwärmebohrungen profitieren sollten. Erste Akten wurden sicherheitshalber schon ausgelagert. Jetzt bereitet der Bürgermeister die Evakuierung der gesamten Stadtverwaltung vor ..."
Quelle:
http://nachrichten.t-online.de/c/18/46/86/00/18468600.html
Nach Erkenntnissen des extra eingerichteten Arbeitskreises Hebungsrisse wurden die Hebungen sehr wahrscheinlich durch Quellvorgänge in einer Erdschicht, der sogenannten Gips-Keuper-Schicht, als Folge der Erdwärmebohrungen hervorgerufen. Die Schäden an fast 170 Gebäuden sind inzwischen so groß geworden, dass manche bereits abgestützt werden müssen. Besonders betroffen sind ausgerechnet das Rathaus und das Stadtarchiv - zwei Gebäude, die eigentlich von den Erdwärmebohrungen profitieren sollten. Erste Akten wurden sicherheitshalber schon ausgelagert. Jetzt bereitet der Bürgermeister die Evakuierung der gesamten Stadtverwaltung vor ..."
Quelle:
http://nachrichten.t-online.de/c/18/46/86/00/18468600.html
Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. April 2009, 22:10 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Mit einer ungewöhnlichen Vorlesungsreihe möchte die Universität zu Köln ihre Verbundenheit mit dem Kölner Stadtarchiv ausdrücken. Nach dem Einsturz des bedeutenden Historischen Archivs werden in dieser vom Historischen Seminar I veranstalteten Ringvorlesung Studierende, Historiker und Archivare für Kölner Bürger Aspekte der Stadtgeschichte behandeln, über die Bestände des Archivs informieren. Sie werden aktuell auf den Stand der Aufräumarbeiten eingehen und die Perspektiven für die Zukunft beschreiben.
Folgende öffentliche Termine sind geplant:
22. April: Dr. Bettina Schmidt-Czaia (Historisches Archiv Stadt Köln): Zum Stand der Rettung des Historischen Archivs der Stadt Köln/ Dr. Ulrich Soénius (Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv), Die Kölner Archive - Quellen für die Forschung
6. Mai: Prof. Dr. Gerd Schwerhoff (Technische Universität Dresden). Kölner Kriminalgeschichte(n). Verbrechen und Strafen vom 15. bis zum 18. Jahrhundert.
20. Mai: Prof. Dr. Werner Eck (Universität zu Köln), Das Projekt "Die Geschichte der Stadt Köln" nach der Katastrophe.
10. Juni: (anderer Ort, andere Zeit) Hörsaal XXIV Hauptgebäude, 18.30 - 20.00 Uhr: Prof. Dr. Ralph Jessen (Universität zu Köln) und Studierende, Köln - eine Großstadt in der Moderne nach 1945. Lehrerfahrungen und Forschungsperspektiven zur Zeitgeschichte
17. Juni (anderer Ort) Hörsaal II Hauptgebäude Prof. Dr. Eberhard Isenmann (Universität zu Köln), Demokratie oder Oligarchie?
Die Neuordnung der Kölner Stadtverfassung im Spätmittelalter: Verbundbrief (1396) und Transfixbrief (1513) .
24.Juni Dr. Gerald Mayer (Landesarchiv Baden-Württemberg, Stuttgart),
Digitalisierung - Zukunft des Archivs?
Vortrag und Podiumsdiskussion
8. Juli Dr. Maren Möhring (Universität zu Köln), Ausländische Gastronomie in Köln nach 1945. Die Internationalisierung der Ernährung.
Alle Vorlesungen, bis auf die gesondert ausgewiesenen, finden statt:
Mittwochs 18.15- 19.45 Uhr im Hörsaal A 2
Quelle:
http://www.idw-online.de/pages/de/news309832
Folgende öffentliche Termine sind geplant:
22. April: Dr. Bettina Schmidt-Czaia (Historisches Archiv Stadt Köln): Zum Stand der Rettung des Historischen Archivs der Stadt Köln/ Dr. Ulrich Soénius (Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv), Die Kölner Archive - Quellen für die Forschung
6. Mai: Prof. Dr. Gerd Schwerhoff (Technische Universität Dresden). Kölner Kriminalgeschichte(n). Verbrechen und Strafen vom 15. bis zum 18. Jahrhundert.
20. Mai: Prof. Dr. Werner Eck (Universität zu Köln), Das Projekt "Die Geschichte der Stadt Köln" nach der Katastrophe.
10. Juni: (anderer Ort, andere Zeit) Hörsaal XXIV Hauptgebäude, 18.30 - 20.00 Uhr: Prof. Dr. Ralph Jessen (Universität zu Köln) und Studierende, Köln - eine Großstadt in der Moderne nach 1945. Lehrerfahrungen und Forschungsperspektiven zur Zeitgeschichte
17. Juni (anderer Ort) Hörsaal II Hauptgebäude Prof. Dr. Eberhard Isenmann (Universität zu Köln), Demokratie oder Oligarchie?
Die Neuordnung der Kölner Stadtverfassung im Spätmittelalter: Verbundbrief (1396) und Transfixbrief (1513) .
24.Juni Dr. Gerald Mayer (Landesarchiv Baden-Württemberg, Stuttgart),
Digitalisierung - Zukunft des Archivs?
Vortrag und Podiumsdiskussion
8. Juli Dr. Maren Möhring (Universität zu Köln), Ausländische Gastronomie in Köln nach 1945. Die Internationalisierung der Ernährung.
Alle Vorlesungen, bis auf die gesondert ausgewiesenen, finden statt:
Mittwochs 18.15- 19.45 Uhr im Hörsaal A 2
Quelle:
http://www.idw-online.de/pages/de/news309832
Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. April 2009, 22:08 - Rubrik: Kommunalarchive
" .... Der Einsturz des Kölner Stadtarchivs hat auch die Sozialistische Selbsthilfe Mülheim (SSM) getroffen. Mehr als 300 Plakate und kistenweise andere Unterlagen waren dort als Dauerleihgabe zu Forschungszwecken gelagert. .....
„Unser Archiv umfasste Dokumente aus 40 Jahren sozialer Kämpfe in unserer Stadt“, so SSM-Vorstand Rainer Kippe. Zu den vermissten Stücken gehörten unter anderem Kurt Holls seltenes Buch „68 am Rhein“, Plakate zu diversen Affären und Skandalen in der Kölner Lokalpolitik oder Unterlagen zur Vereinsgeschichte. „Darunter befanden sich auch Papiere der 1969 gegründeten Sozialistischen Selbsthilfe Köln, von der wir uns 1986 abspalteten, sowie befreundeter Initiativen aus Dortmund, Wuppertal, Bensberg und anderen Städten“, berichtet Mitarbeiter Heinz Weinhausen, der die Ausstellung organisiert.
Kippe gewinnt der kulturellen Katastrophe an der Severinstraße aber auch etwas Positives ab: „So ein Einsturz kann natürlich auch etwas Gutes haben - die Menschen merkten dadurch, wie wertvoll historische Dokumente sind.“ ...."
Quelle:
http://www.ksta.de/html/artikel/1238966813540.shtml
Link:
http://www.ssm-koeln.org
„Unser Archiv umfasste Dokumente aus 40 Jahren sozialer Kämpfe in unserer Stadt“, so SSM-Vorstand Rainer Kippe. Zu den vermissten Stücken gehörten unter anderem Kurt Holls seltenes Buch „68 am Rhein“, Plakate zu diversen Affären und Skandalen in der Kölner Lokalpolitik oder Unterlagen zur Vereinsgeschichte. „Darunter befanden sich auch Papiere der 1969 gegründeten Sozialistischen Selbsthilfe Köln, von der wir uns 1986 abspalteten, sowie befreundeter Initiativen aus Dortmund, Wuppertal, Bensberg und anderen Städten“, berichtet Mitarbeiter Heinz Weinhausen, der die Ausstellung organisiert.
Kippe gewinnt der kulturellen Katastrophe an der Severinstraße aber auch etwas Positives ab: „So ein Einsturz kann natürlich auch etwas Gutes haben - die Menschen merkten dadurch, wie wertvoll historische Dokumente sind.“ ...."
Quelle:
http://www.ksta.de/html/artikel/1238966813540.shtml
Link:
http://www.ssm-koeln.org
Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. April 2009, 22:06 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wenn man mir blöd kommt.
Vor einigen Tagen war das Geheul groß, als eine Wikipedianerin einem Nachnutzer, der ihre Bilder nicht lizenzkonform nutzte, eine Abmahnung sandte:
http://archiv.twoday.net/stories/5634338/
RA Stadler äußerte sich weitgehend kenntnisfrei zu dem Fall und beschwerte sich anschließend per Mail bei mir, dass ich - wie meistens bei Artikeln über die Wikipedia - keine Kommentare erlaubt hatte.
Täglich laufen auf
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Weiternutzung/Mängel
Meldungen über nicht lizenzkonforme Nachnutzung auf, sowohl was Texte als auch was Bilder angeht. Immer wieder verstoßen auch etablierte Medien gegen die unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen
hinlänglich erklärten Lizenzbestimmungen.
Inhalte unter Freien Lizenzen sind keine Public Domain. Wer die Spielregeln nicht strikt einhält, muss die Folgen tragen.
Aus der Tatsache, dass der Kampf gegen nicht lizenzkonforme Nutzungen dem Kampf gegen Windmühlenflügel gleicht (wobei im Rahmen der Wikipedia-Seite nur höfliche Mails versandt werden, die Lizenzbestimmungen doch bitte einzuhalten), folgt nicht, dass betroffene Urheber alles zu dulden haben, was Nachnutzern und ihren windigen Rechtsanwälten so einfällt.
Auch auf ein vergleichsweises faires Angebot erhält man eine vergleichsweise unverschämte Anwaltsmail:
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Historiograf/Sonderangebot
Spricht man die schwarze Schafe unter den Nachnutzern unter Bezugnahme auf die eigenen Bilder an, werden diese zwar auf lizenzkonforme Nutzung umgestellt, aber die anderen nicht lizenzkonform aus der Wikipedia und Wikimedia geklauten Bilder bleiben vielfach Urheberrechtsverletzungen. Und einen Unterlassungsanspruch kann man immer nur für die eigenen Bilder geltend machen.
Alternative für die schwarzen Schafe: Vereinbarung einer verschwiegenheitsverpflichtung. Diese ist, wie ich weiß, durchaus nicht selten. Man entschädigt dann recht großzügig, möchte aber nicht, dass das eigene Treiben publik wird (und Trittbrett-Abmahner auf den Plan treten). Beispiel: Für eine nicht lizenzkonforme Offline Text-Nutzung erhielt ich neulich 750 Euro, musste aber Verschwiegenheit zusichern.
Ich stehe inzwischen auf dem Standpunkt: Wer professionelle Internetprojekte betreibt, sei es ein Landesumweltministerium, eine Firma oder eine alternative Tageszeitung, hatte seit Aufkommen freier Lizenzen und der Wikipedia genügend Zeit, sich zu informieren, wie man freie Inhalte korrekt nutzt.
Besonders kompliziert ist das nicht. Aber wenn man sich nicht an eine bestimmte Lizenzbedingung halten möchte, hat man ja häufig die Möglichkeit, den Urheber wegen Sonderkonditionen zu kontaktieren. Vor einiger Zeit wurde ich wegen einiger hübscher Bilder über Ladenburg von einer Firma kontaktiert, die sie für ein Projekt im Rahmen eines Flyers nutzen wollte. Ich erklärte der Dame am Telefon sicher eine halbe Stunde lang, wie das mit den freien Lizenzen funktioniert. Nach einer Weile kam ihr Kollege auf mich zu und fragte wegen den gleichen Bildern hinsichtlich der Nutzung in einem "Image-Film". Da ich keine Lust auf den gleichen Sermon hatte, habe ich mit ihm ein Honorar von 100 Euro für beliebige Nutzung vereinbart, d.h. Namens- und Lizenznennung entfielen. Das war für ihn absolut in Ordnung.
Als ich sah, dass die taz eines meiner EVZ-Bilder mit meinem Namen, aber ohne die erforderliche Lizenzangabe (Link auf die CC-Lizenz, aber auch bei "Lizenz: CC-BY" als Text hätte ich die Sache auf sich beruhen lassen) in ihrer Online-Ausgabe nutzt, habe ich mich einerseits gefreut, andererseits muss die Nutzung stets lizenzkonform sein, schon deshalb, weil sonst der Werbeeffekt für die CC-Lizenz/freie Inhalte entfällt.
Na, ich erklärs denen kurz, dachte ich denkbar naiv, die ändern das, nutzen künftig lizenzkonform, und die Sache ist gegessen. Da ich keine passende Mail auf der Website fand, rief ich taz-Justiziar Scheibe an. Da kam ich aber an den falschen. "Ich möchte Sie bitten, ein Bild von mir lizenzkonform zu nutzen", hub ich an. Er (unbeeindruckt patzig): "Wieso sollten wir das tun?". Ich: "Weil Sie bereits ein Bild von mir nicht lizenzkonform nutzen". "Schicken Sie mir eine Mail, ich habe keine Zeit" Mein Einwand, dass ich es gern telefonisch klären würde, fruchtete nichts. Nach weiterem kurzen Wortwechsel legte taz-Justiziar Scheibe einfach auf.
Ich habe die Sache daher meinem Anwalt mit der Bitte, eine Unterlassungserklärung und Schadensersatz zu fordern, übergeben. Nun zahlt die taz - wie ganz viele andere Zeitungen auch - grauenhaft schlechte Bildhonorare http://tinyurl.com/ckphlm 2006 gabs laut MFM-Empfehlungen bei Online-Zeitungen/Online-Zeitschriften (nicht kostenpflichtig) für 1 Tag: 30 Euro, der aktuelle Tarif wird wohl nicht viel höher sein. Schadensersatz nach der Lizenzanalogie ist also bei einem Bild nicht den Aufwand wert, aber hier geht es ja um den "erzieherischen Wert" der Maßnahme (und das von der Gegenseite zu zahlende Anwaltshonorar ist um einiges höher).
Dass bei Online-Medien eine korrekte Lizenzierung von Bildern unter freien Lizenzen wirklich kein Hexenwerk ist, zeigen die folgenden Beispiele, die ich als lizenzkonform ansehe.
 Foto: Klaus Graf, Lizenz: CC-BY
Foto: Klaus Graf, Lizenz: CC-BY
 Foto: Klaus Graf, Lizenz
Foto: Klaus Graf, Lizenz
 Foto: Klaus Graf, (c)
Foto: Klaus Graf, (c)
Namensnennung, Link auf die Lizenz - fertig!
Bei Printmedien hätte niemand, der nicht böswillig ist, etwas gegen "Klaus Graf, CC-BY 3.0 www.creativecommons.org" klein am Bildrand einzuwenden, wenn man nicht
"Klaus Graf, http://creativecommons.org/licenses/by/3.0 " schreiben will. Da es aber unterschiedliche Lizenzversionen und nationale Fassungen der CC-Lizenzen gibt (die Bilder oben stehen unter der "unported"-Lizenz), ist es sinnvoll, den vollständigen Link zum gültigen Lizenztext anzugeben.
Update: http://archiv.twoday.net/stories/5646250/
Update: Vermutlich hat taz-Mitarbeiter Bartz, der mich mit so schmeichelhaften Worten bedachte, nach Lektüre dieses Beitrags rasch Bescheid gegeben. Die taz hat die CC-Lizenz als (nicht anklickbaren) Link hinzugesetzt, damit ist die Nutzung nun lizenzkonform. Da eine Wiederholungsgefahr eher fraglich ist (hoffentlich hat sie die Lektion gelernt), lasse ich nach Rücksprache mit meinem Anwalt nun doch nicht abmahnen.
Vor einigen Tagen war das Geheul groß, als eine Wikipedianerin einem Nachnutzer, der ihre Bilder nicht lizenzkonform nutzte, eine Abmahnung sandte:
http://archiv.twoday.net/stories/5634338/
RA Stadler äußerte sich weitgehend kenntnisfrei zu dem Fall und beschwerte sich anschließend per Mail bei mir, dass ich - wie meistens bei Artikeln über die Wikipedia - keine Kommentare erlaubt hatte.
Täglich laufen auf
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Weiternutzung/Mängel
Meldungen über nicht lizenzkonforme Nachnutzung auf, sowohl was Texte als auch was Bilder angeht. Immer wieder verstoßen auch etablierte Medien gegen die unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen
hinlänglich erklärten Lizenzbestimmungen.
Inhalte unter Freien Lizenzen sind keine Public Domain. Wer die Spielregeln nicht strikt einhält, muss die Folgen tragen.
Aus der Tatsache, dass der Kampf gegen nicht lizenzkonforme Nutzungen dem Kampf gegen Windmühlenflügel gleicht (wobei im Rahmen der Wikipedia-Seite nur höfliche Mails versandt werden, die Lizenzbestimmungen doch bitte einzuhalten), folgt nicht, dass betroffene Urheber alles zu dulden haben, was Nachnutzern und ihren windigen Rechtsanwälten so einfällt.
Auch auf ein vergleichsweises faires Angebot erhält man eine vergleichsweise unverschämte Anwaltsmail:
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Historiograf/Sonderangebot
Spricht man die schwarze Schafe unter den Nachnutzern unter Bezugnahme auf die eigenen Bilder an, werden diese zwar auf lizenzkonforme Nutzung umgestellt, aber die anderen nicht lizenzkonform aus der Wikipedia und Wikimedia geklauten Bilder bleiben vielfach Urheberrechtsverletzungen. Und einen Unterlassungsanspruch kann man immer nur für die eigenen Bilder geltend machen.
Alternative für die schwarzen Schafe: Vereinbarung einer verschwiegenheitsverpflichtung. Diese ist, wie ich weiß, durchaus nicht selten. Man entschädigt dann recht großzügig, möchte aber nicht, dass das eigene Treiben publik wird (und Trittbrett-Abmahner auf den Plan treten). Beispiel: Für eine nicht lizenzkonforme Offline Text-Nutzung erhielt ich neulich 750 Euro, musste aber Verschwiegenheit zusichern.
Ich stehe inzwischen auf dem Standpunkt: Wer professionelle Internetprojekte betreibt, sei es ein Landesumweltministerium, eine Firma oder eine alternative Tageszeitung, hatte seit Aufkommen freier Lizenzen und der Wikipedia genügend Zeit, sich zu informieren, wie man freie Inhalte korrekt nutzt.
Besonders kompliziert ist das nicht. Aber wenn man sich nicht an eine bestimmte Lizenzbedingung halten möchte, hat man ja häufig die Möglichkeit, den Urheber wegen Sonderkonditionen zu kontaktieren. Vor einiger Zeit wurde ich wegen einiger hübscher Bilder über Ladenburg von einer Firma kontaktiert, die sie für ein Projekt im Rahmen eines Flyers nutzen wollte. Ich erklärte der Dame am Telefon sicher eine halbe Stunde lang, wie das mit den freien Lizenzen funktioniert. Nach einer Weile kam ihr Kollege auf mich zu und fragte wegen den gleichen Bildern hinsichtlich der Nutzung in einem "Image-Film". Da ich keine Lust auf den gleichen Sermon hatte, habe ich mit ihm ein Honorar von 100 Euro für beliebige Nutzung vereinbart, d.h. Namens- und Lizenznennung entfielen. Das war für ihn absolut in Ordnung.
Als ich sah, dass die taz eines meiner EVZ-Bilder mit meinem Namen, aber ohne die erforderliche Lizenzangabe (Link auf die CC-Lizenz, aber auch bei "Lizenz: CC-BY" als Text hätte ich die Sache auf sich beruhen lassen) in ihrer Online-Ausgabe nutzt, habe ich mich einerseits gefreut, andererseits muss die Nutzung stets lizenzkonform sein, schon deshalb, weil sonst der Werbeeffekt für die CC-Lizenz/freie Inhalte entfällt.
Na, ich erklärs denen kurz, dachte ich denkbar naiv, die ändern das, nutzen künftig lizenzkonform, und die Sache ist gegessen. Da ich keine passende Mail auf der Website fand, rief ich taz-Justiziar Scheibe an. Da kam ich aber an den falschen. "Ich möchte Sie bitten, ein Bild von mir lizenzkonform zu nutzen", hub ich an. Er (unbeeindruckt patzig): "Wieso sollten wir das tun?". Ich: "Weil Sie bereits ein Bild von mir nicht lizenzkonform nutzen". "Schicken Sie mir eine Mail, ich habe keine Zeit" Mein Einwand, dass ich es gern telefonisch klären würde, fruchtete nichts. Nach weiterem kurzen Wortwechsel legte taz-Justiziar Scheibe einfach auf.
Ich habe die Sache daher meinem Anwalt mit der Bitte, eine Unterlassungserklärung und Schadensersatz zu fordern, übergeben. Nun zahlt die taz - wie ganz viele andere Zeitungen auch - grauenhaft schlechte Bildhonorare http://tinyurl.com/ckphlm 2006 gabs laut MFM-Empfehlungen bei Online-Zeitungen/Online-Zeitschriften (nicht kostenpflichtig) für 1 Tag: 30 Euro, der aktuelle Tarif wird wohl nicht viel höher sein. Schadensersatz nach der Lizenzanalogie ist also bei einem Bild nicht den Aufwand wert, aber hier geht es ja um den "erzieherischen Wert" der Maßnahme (und das von der Gegenseite zu zahlende Anwaltshonorar ist um einiges höher).
Dass bei Online-Medien eine korrekte Lizenzierung von Bildern unter freien Lizenzen wirklich kein Hexenwerk ist, zeigen die folgenden Beispiele, die ich als lizenzkonform ansehe.
 Foto: Klaus Graf, Lizenz: CC-BY
Foto: Klaus Graf, Lizenz: CC-BY Foto: Klaus Graf, Lizenz
Foto: Klaus Graf, Lizenz Foto: Klaus Graf, (c)
Foto: Klaus Graf, (c)Namensnennung, Link auf die Lizenz - fertig!
Bei Printmedien hätte niemand, der nicht böswillig ist, etwas gegen "Klaus Graf, CC-BY 3.0 www.creativecommons.org" klein am Bildrand einzuwenden, wenn man nicht
"Klaus Graf, http://creativecommons.org/licenses/by/3.0 " schreiben will. Da es aber unterschiedliche Lizenzversionen und nationale Fassungen der CC-Lizenzen gibt (die Bilder oben stehen unter der "unported"-Lizenz), ist es sinnvoll, den vollständigen Link zum gültigen Lizenztext anzugeben.
Update: http://archiv.twoday.net/stories/5646250/
Update: Vermutlich hat taz-Mitarbeiter Bartz, der mich mit so schmeichelhaften Worten bedachte, nach Lektüre dieses Beitrags rasch Bescheid gegeben. Die taz hat die CC-Lizenz als (nicht anklickbaren) Link hinzugesetzt, damit ist die Nutzung nun lizenzkonform. Da eine Wiederholungsgefahr eher fraglich ist (hoffentlich hat sie die Lektion gelernt), lasse ich nach Rücksprache mit meinem Anwalt nun doch nicht abmahnen.
KlausGraf - am Mittwoch, 15. April 2009, 21:40 - Rubrik: Archivrecht
" .... Nach Fertigstellung des Magazinneubaus und der Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude wird das Bundesarchiv die Berliner Bereiche des Archivs in der Bundeshauptstadt präsentieren und für die Öffentlichkeit zugänglich sein.
Ziel eines städtebaulichen und landschaftsarchitektonischen Wettbewerbs für Arbeitsgemeinschaften aus Landschaftsarchitekten und Architekten bzw. Stadtplanern ist es, einen Masterplan als flexiblen und fortschreibungsfähigen Leitfaden für alle mittel- und langfristigen liegenschaftsbezogenen Vorhaben des Bundesarchivs zu entwickeln, der sowohl der Geschichte des Ortes als auch seiner derzeitigen und zukünftigen Nutzung sowie der geschichtspolitischen Bedeutung des Bundesarchivs gerecht wird.
Dabei ist es Aufgabe in interdisziplinärer Zusammenarbeit ein Konzept zu erarbeiten, das die maximal für die Liegenschaft verträglichen Baumassen in einer starken freiraumplanerischen Struktur positioniert und Aussagen u.a. zur externen und internen Erschließung, zur Adressbildung zum Umgang mit dem historischem Erbe, zur Integration von Infrastrukturen sowie zum Regenwassermanagement macht und darüber hinaus sinnvolle Bauabschnitte vorschlägt. ...."
Quelle:
http://www.competitionline.de/3016426
Link zur Bekanntmachung
Ziel eines städtebaulichen und landschaftsarchitektonischen Wettbewerbs für Arbeitsgemeinschaften aus Landschaftsarchitekten und Architekten bzw. Stadtplanern ist es, einen Masterplan als flexiblen und fortschreibungsfähigen Leitfaden für alle mittel- und langfristigen liegenschaftsbezogenen Vorhaben des Bundesarchivs zu entwickeln, der sowohl der Geschichte des Ortes als auch seiner derzeitigen und zukünftigen Nutzung sowie der geschichtspolitischen Bedeutung des Bundesarchivs gerecht wird.
Dabei ist es Aufgabe in interdisziplinärer Zusammenarbeit ein Konzept zu erarbeiten, das die maximal für die Liegenschaft verträglichen Baumassen in einer starken freiraumplanerischen Struktur positioniert und Aussagen u.a. zur externen und internen Erschließung, zur Adressbildung zum Umgang mit dem historischem Erbe, zur Integration von Infrastrukturen sowie zum Regenwassermanagement macht und darüber hinaus sinnvolle Bauabschnitte vorschlägt. ...."
Quelle:
http://www.competitionline.de/3016426
Link zur Bekanntmachung
Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. April 2009, 21:32 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://immateriblog.de/?p=496
Wir erinnern in diesem Zusammenhang auch an den "Raubleser" Dr. Jur. Steinhauer:
http://skriptorium.blog.de/2009/03/13/raubleser-verbrecher-5747917/
Wir erinnern in diesem Zusammenhang auch an den "Raubleser" Dr. Jur. Steinhauer:
http://skriptorium.blog.de/2009/03/13/raubleser-verbrecher-5747917/
KlausGraf - am Mittwoch, 15. April 2009, 21:31 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Das Museum Folkwang greift dem Kölner Stadtarchiv unter die Arme: 10.000 Plakate, die aus den Trümmern geborgen wurden, werden in Essen eingelagert. Für einige Exponate kommt wahrscheinlich jede Hilfe zu spät.
Der Anblick schmerzt die Archivare: Eingeschweißt in Plastik rollen die Kunstwerke - oder das was davon übrig ist - auf 15 Paletten an. In den Räumen des Plakatmuseums im Folkwang finden sie eine vorübergehende Heimat.
René Grohnert, Leiter des Deutschen Plakat Museums: "Wir haben den Kollegen in Köln sofort nach dem Unglück unsere Hilfe angeboten. Die Plakate werden in unseren Depoträumen, die den klimatischen und sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen, Platz finden."
Alle Plakate wurden noch in Köln gereinigt, getrocknet, grob vorsortiert und verpackt. Einige Plakate sind unversehrt, andere nur noch als Fragmente zu erkennen. Ebenfalls aufgenommen wurden großformatige Fotografien und Baupläne. Unter den geborgenen Werken sind unter anderem Plakate aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, Plakate zu Regional- und Landtagswahlen sowie zu kulturellen Veranstaltungen im Kölner Raum bis in die 1990er-Jahre. ....."
Quelle:
http://www.derwesten.de/nachrichten/kultur/2009/4/15/news-117183864/detail.html
Der Anblick schmerzt die Archivare: Eingeschweißt in Plastik rollen die Kunstwerke - oder das was davon übrig ist - auf 15 Paletten an. In den Räumen des Plakatmuseums im Folkwang finden sie eine vorübergehende Heimat.
René Grohnert, Leiter des Deutschen Plakat Museums: "Wir haben den Kollegen in Köln sofort nach dem Unglück unsere Hilfe angeboten. Die Plakate werden in unseren Depoträumen, die den klimatischen und sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen, Platz finden."
Alle Plakate wurden noch in Köln gereinigt, getrocknet, grob vorsortiert und verpackt. Einige Plakate sind unversehrt, andere nur noch als Fragmente zu erkennen. Ebenfalls aufgenommen wurden großformatige Fotografien und Baupläne. Unter den geborgenen Werken sind unter anderem Plakate aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, Plakate zu Regional- und Landtagswahlen sowie zu kulturellen Veranstaltungen im Kölner Raum bis in die 1990er-Jahre. ....."
Quelle:
http://www.derwesten.de/nachrichten/kultur/2009/4/15/news-117183864/detail.html
Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. April 2009, 21:31 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Kulturstiftung der Länder ermöglicht für das Land Niedersachsen den Ankauf von drei herausragenden Goldpokalen des 17. Jahrhunderts aus der Sammlung von Yves Saint Laurent und Pierre Bergé. Alle drei Pokale stammen ursprünglich aus dem Residenzschloss von Celle.
http://www.kulturstiftung.de/aktuelles/meldungen/detail/rueckkehr-der-goldpokale/
11 kostbare Pokale kehren NICHT nach Celle zurück - dank der Gier der Welfen.
Bezeichnend, dass ohne Beleg in der Mitteilung der Kulturstiftung die Rede davon ist, dass die Pokale vermutlich im 19. Jahrhundert ins Ausland gekommen sind, während in von uns zitierten früheren Presseveröffentlichungen die Rede davon war, sie seien wohl kurz nach 1945 verkauft worden bzw. dass sie "indirekt" aus dem Haus Hannover vor mehr als zehn Jahren an die Händler Kugel kamen.
Zum Hintergrund:
http://archiv.twoday.net/stories/5594739/

http://www.kulturstiftung.de/aktuelles/meldungen/detail/rueckkehr-der-goldpokale/
11 kostbare Pokale kehren NICHT nach Celle zurück - dank der Gier der Welfen.
Bezeichnend, dass ohne Beleg in der Mitteilung der Kulturstiftung die Rede davon ist, dass die Pokale vermutlich im 19. Jahrhundert ins Ausland gekommen sind, während in von uns zitierten früheren Presseveröffentlichungen die Rede davon war, sie seien wohl kurz nach 1945 verkauft worden bzw. dass sie "indirekt" aus dem Haus Hannover vor mehr als zehn Jahren an die Händler Kugel kamen.
Zum Hintergrund:
http://archiv.twoday.net/stories/5594739/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zum 1. Tagesbericht: http://archiv.twoday.net/stories/5643191/
http://www.taz.de/1/leben/buch/artikel/1/koeln-contra-koeln/
Auszüge:
13.20 Uhr. Im Shuttlebus erzählt eine Archivarin, der Busfahrer sei heute zu früh von der Unterkunft losgefahren. Einige müssen nun per S-Bahn und Linienbus nachkommen. [...]
Dasselbe im Kleinen: Mindestens der Kulturdezernent hätte die vielen Nachlassgeber vertrösten müssen, die noch immer nicht wissen, was aus ihren Schenkungen, Leihgaben oder Verkäufen an das Stadtarchiv geworden ist. Schon zwei Wochen nach dem Einsturz, als der Unmut sich zu regen begann, hätte die Stadt zur großen Krisensitzung laden müssen, um öffentlich zu erklären, warum sie noch nichts erklären kann. Dann eine Fragestunde, in der die Betroffenen ihr Herz ausschütten. So wäre Zeit gewonnen gewesen. Doch die Stadt schwieg.
Erst in vier Wochen soll nun eine Konferenz mit den Gebern stattfinden. Offenbar von den geplagten Stadtarchivaren ausgerichtet, nicht von der Stadtspitze. Da ist sie wieder, diese Unverantwortlichkeit. Ob der OB hinkommt? Kein Wunder, dass auch auf den KVB-Bus kein Verlass ist.
15.30 Uhr. Vor mir liegt eine Akte mit der Signatur KcK, "Köln contra Köln." Unter diesem Titel haben Archivare aus allen möglichen Aktenbeständen Schriftstücke herausgelöst, die die Streitigkeiten zwischen Stadt und Erzbischof darstellten. KcK gehört zu den berüchtigten Kölner "Pertinenzbeständen".
Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein bildeten Archivare aus altem Schriftgut neue Sachgruppen. Wo etwas zu zwei oder drei neuen Themen passte, wurde es abgeschrieben und eine Kopie zum neuen Betreff gelegt. Nur notierten die Archivare nicht, woher sie ihre Texte nahmen. Auch "Köln contra Köln" ist deswegen ein gewaltiges Durcheinander. Deswegen sorgen Archivare heutzutage dafür, dass Schriftgut gleicher Herkunft zusammenbleibt.
Hier zeigt sich die skurrilste Folge des Einsturzes: Zahllose Aktenordner sind nun in einzelne Blätter zerlegt. Diesen Massen werden wir nicht anders beikommen, als aus ihnen Themengruppen zu bilden. In der Katastrophe feiert das Pertinenzprinzip seinen letzten Triumph.
http://www.taz.de/1/leben/buch/artikel/1/koeln-contra-koeln/
Auszüge:
13.20 Uhr. Im Shuttlebus erzählt eine Archivarin, der Busfahrer sei heute zu früh von der Unterkunft losgefahren. Einige müssen nun per S-Bahn und Linienbus nachkommen. [...]
Dasselbe im Kleinen: Mindestens der Kulturdezernent hätte die vielen Nachlassgeber vertrösten müssen, die noch immer nicht wissen, was aus ihren Schenkungen, Leihgaben oder Verkäufen an das Stadtarchiv geworden ist. Schon zwei Wochen nach dem Einsturz, als der Unmut sich zu regen begann, hätte die Stadt zur großen Krisensitzung laden müssen, um öffentlich zu erklären, warum sie noch nichts erklären kann. Dann eine Fragestunde, in der die Betroffenen ihr Herz ausschütten. So wäre Zeit gewonnen gewesen. Doch die Stadt schwieg.
Erst in vier Wochen soll nun eine Konferenz mit den Gebern stattfinden. Offenbar von den geplagten Stadtarchivaren ausgerichtet, nicht von der Stadtspitze. Da ist sie wieder, diese Unverantwortlichkeit. Ob der OB hinkommt? Kein Wunder, dass auch auf den KVB-Bus kein Verlass ist.
15.30 Uhr. Vor mir liegt eine Akte mit der Signatur KcK, "Köln contra Köln." Unter diesem Titel haben Archivare aus allen möglichen Aktenbeständen Schriftstücke herausgelöst, die die Streitigkeiten zwischen Stadt und Erzbischof darstellten. KcK gehört zu den berüchtigten Kölner "Pertinenzbeständen".
Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein bildeten Archivare aus altem Schriftgut neue Sachgruppen. Wo etwas zu zwei oder drei neuen Themen passte, wurde es abgeschrieben und eine Kopie zum neuen Betreff gelegt. Nur notierten die Archivare nicht, woher sie ihre Texte nahmen. Auch "Köln contra Köln" ist deswegen ein gewaltiges Durcheinander. Deswegen sorgen Archivare heutzutage dafür, dass Schriftgut gleicher Herkunft zusammenbleibt.
Hier zeigt sich die skurrilste Folge des Einsturzes: Zahllose Aktenordner sind nun in einzelne Blätter zerlegt. Diesen Massen werden wir nicht anders beikommen, als aus ihnen Themengruppen zu bilden. In der Katastrophe feiert das Pertinenzprinzip seinen letzten Triumph.
KlausGraf - am Mittwoch, 15. April 2009, 21:10 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Um eine erforderliche Kontinuität herzustellen, beabsichtigt die Stadt Köln die mehrmonatigen Einsatz geeigneter 1-€-Kräften bei der Erstversorgung des Archivguts.
Quelle:
http://www.express.de/nachrichten/region/koeln/jetzt-muessen-ein-euro-jobber-am-stadtarchiv-ran_artikel_1235811516623.html
Quelle:
http://www.express.de/nachrichten/region/koeln/jetzt-muessen-ein-euro-jobber-am-stadtarchiv-ran_artikel_1235811516623.html
Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. April 2009, 20:57 - Rubrik: Kommunalarchive
Die spanischsprachigen Bibeltexte stehen transkribiert und als Faksimile (der einzelnen Stellen) zur Verfügung, wobei es aber anscheinend keine Möglichkeit gibt, die digitalisierten Handschriften als Ganzes durchzublättern. Teilweise sind die Abbildungen zu klein für die Lektüre.
http://www.bibliamedieval.es/corpus.html

http://www.bibliamedieval.es/corpus.html

KlausGraf - am Mittwoch, 15. April 2009, 17:17
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 15. April 2009, 17:00 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 15. April 2009, 13:53 - Rubrik: Wahrnehmung
"Eine Tagung erfahrener Experten wird sich am 24. Juni 2009 in Köln mit den Konsequenzen aus dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs befassen. Nordrhein-Westfalen wird damit zu einer Diskussion um die Sicherung von Archiven als internationale Aufgabe beitragen. Rüttgers: „Die Archivalien von Köln sind europäische, sind internationale Kulturgüter. Die Dokumente aus dem Mittelalter etwa haben als abendländische universale Quellen einen unermesslichen Wert für Forscher aus aller Welt. Ein weiteres Beispiel ist der Nachlass unseres Nobelpreisträgers Heinrich Böll: Der Nachlass gehört allen Menschen, die sich mit Literatur auseinandersetzen.“ Solche Kulturgüter dürften nie wieder gefährdet werden, so Jürgen Rüttgers. Daher müssten Wissenschaft, Staat und gesellschaftliche Organisationen sich zentral mit der Frage beschäftigen, wie Archive gesichert werden können. Wie dringend diese Frage der Sicherung kultureller Überlieferung ist, hat erneut die Erdbebenkatastrophe in Mittelitalien, in alten Orten mit wertvoller historischer Substanz, gezeigt.
Die Expertenanhörung wird mit einer Rede von Ministerpräsident Jürgen Rüttgers eröffnet. Die Fachleute werden sich im Plenum und drei Arbeitsgruppen mit den Themen der besonderen Sicherheitsanforderungen an Archive, möglichen Präventionsmaßnahmen sowie der Sicherung der Quellen durch Verfilmung und Digitalisierung beschäftigen. Im Ergebnis sollen Mindestanforderungen erarbeitet werden, die jedem Archivträger zur Verfügung gestellt werden können.
Die Landesregierung befasst sich seit dem Unglück in Köln intensiv damit, die verschiedenen Hilfsaktivitäten zur Bergung und Restaurierung der Archivalien zu koordinieren sowie Maßnahmen zur Sicherung und künftige Konsequenzen zu prüfen.
Sofort nach dem Unglück hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich vorwiegend mit der Organisation von Bergung und Restaurierung des Archivguts befasst. Ihr gehören Mitarbeiter des Landesarchivs, der beiden Landschaftsverbände des Kölner Stadtarchivs und weiterer regionaler Archivverbände an. Diese Gruppe tagt regelmäßig auch mit Vertretern der Staatskanzlei.
Eine weitere Gruppe beschäftigt sich mit den Konsequenzen, die aus dem Einsturz zu ziehen sind. Diese Gruppe bereitet auch die Expertenanhörung am 24. Juni 2009 vor.
Ministerpräsident Jürgen Rüttgers wertet es als einen ersten Erfolg, dass bereits jetzt mehr als die Hälfte der verschütteten Archivalien geborgen werden konnten. Das sei nicht zuletzt den vielen Helfern aus allen Teilen Deutschland zu verdanken. Ihnen gilt der Dank nicht nur des Landes, sondern aller, denen unser kulturelles Gedächtnis, das in den vielen Archiven bewahrt wird, am Herzen liegt. Ein Großteil der Rettungsarbeiten liegt aber noch vor uns. Deshalb bittet der Ministerpräsident alle an der Rettungsaktion Beteiligten, sich weiter zu engagieren.
Ministerpräsident Rüttgers bedankt sich gleichzeitig für die Bewilligung einer Soforthilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Mit 600.000 Euro unterstützt sie die Digitalisierung von Findmitteln. Bei diesen Findmitteln handelt es sich um detailgetreue Verzeichnisse von Archivalien aus verschiedenen Jahrhunderten. Sie sind die Schlüssel zu den umfangreichen Beständen des eingestürzten Archivs.."
Quelle:
http://www.nrw.de/Presseservice/meldungen/04_2009/090415STK.php
Die Expertenanhörung wird mit einer Rede von Ministerpräsident Jürgen Rüttgers eröffnet. Die Fachleute werden sich im Plenum und drei Arbeitsgruppen mit den Themen der besonderen Sicherheitsanforderungen an Archive, möglichen Präventionsmaßnahmen sowie der Sicherung der Quellen durch Verfilmung und Digitalisierung beschäftigen. Im Ergebnis sollen Mindestanforderungen erarbeitet werden, die jedem Archivträger zur Verfügung gestellt werden können.
Die Landesregierung befasst sich seit dem Unglück in Köln intensiv damit, die verschiedenen Hilfsaktivitäten zur Bergung und Restaurierung der Archivalien zu koordinieren sowie Maßnahmen zur Sicherung und künftige Konsequenzen zu prüfen.
Sofort nach dem Unglück hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich vorwiegend mit der Organisation von Bergung und Restaurierung des Archivguts befasst. Ihr gehören Mitarbeiter des Landesarchivs, der beiden Landschaftsverbände des Kölner Stadtarchivs und weiterer regionaler Archivverbände an. Diese Gruppe tagt regelmäßig auch mit Vertretern der Staatskanzlei.
Eine weitere Gruppe beschäftigt sich mit den Konsequenzen, die aus dem Einsturz zu ziehen sind. Diese Gruppe bereitet auch die Expertenanhörung am 24. Juni 2009 vor.
Ministerpräsident Jürgen Rüttgers wertet es als einen ersten Erfolg, dass bereits jetzt mehr als die Hälfte der verschütteten Archivalien geborgen werden konnten. Das sei nicht zuletzt den vielen Helfern aus allen Teilen Deutschland zu verdanken. Ihnen gilt der Dank nicht nur des Landes, sondern aller, denen unser kulturelles Gedächtnis, das in den vielen Archiven bewahrt wird, am Herzen liegt. Ein Großteil der Rettungsarbeiten liegt aber noch vor uns. Deshalb bittet der Ministerpräsident alle an der Rettungsaktion Beteiligten, sich weiter zu engagieren.
Ministerpräsident Rüttgers bedankt sich gleichzeitig für die Bewilligung einer Soforthilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Mit 600.000 Euro unterstützt sie die Digitalisierung von Findmitteln. Bei diesen Findmitteln handelt es sich um detailgetreue Verzeichnisse von Archivalien aus verschiedenen Jahrhunderten. Sie sind die Schlüssel zu den umfangreichen Beständen des eingestürzten Archivs.."
Quelle:
http://www.nrw.de/Presseservice/meldungen/04_2009/090415STK.php
Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. April 2009, 13:29 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Katharina Corsepius sorgt dafür, dass dieser Strom nicht abreißt. Die Kunsthistorikerin und Doktorin an der Uni Bonn schätzt, dass erst zehn Prozent der verschütteten und teils durchnässten Akten gerettet werden konnten. "Es ist wirklich ganz schön, dass die Rekrutierung neuer Helfer bisher so gut nach dem Schneeballsystem funktioniert", sagt Corsepius. Sie werde auch weiter für Helfer aus der Uni trommeln. ....."
Quelle:
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,618518,00.html#ref=rss
Quelle:
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,618518,00.html#ref=rss
Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. April 2009, 10:48 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"The International Council on Archives, a founder member of the International Committee of the Blue Shield (ICBS], strongly supports the statement issued by ICBS about the tragic events in resulting from the earthquake in the Abruzzo region of Italy. A copy of the statement is attached.
Reports are still coming in, but it is clear that there has been serious damage to the State Archives in Aquila. Many members of ICA will wish to demonstrate their professional solidarity by offering help and support to their Italian colleagues at the appropriate time. It is the policy of ICA to use the Blue Shield network for the co-ordination of offers of help in situations where archives are under threat or have already been damaged. We therefore recommend that members who wish to help should follow developments on the web site of the Association of National Blue Shield Committees (ANCBS) - http://www.ancbs.org/.
In addition, members who live in a country with an established National Blue Shield Committee should ask it for advice on how they can best assist the recovery efforts. "
Link:
http://www.ica.org/en/2009/04/09/earthquake-abruzzo
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/5633415/
Reports are still coming in, but it is clear that there has been serious damage to the State Archives in Aquila. Many members of ICA will wish to demonstrate their professional solidarity by offering help and support to their Italian colleagues at the appropriate time. It is the policy of ICA to use the Blue Shield network for the co-ordination of offers of help in situations where archives are under threat or have already been damaged. We therefore recommend that members who wish to help should follow developments on the web site of the Association of National Blue Shield Committees (ANCBS) - http://www.ancbs.org/.
In addition, members who live in a country with an established National Blue Shield Committee should ask it for advice on how they can best assist the recovery efforts. "
Link:
http://www.ica.org/en/2009/04/09/earthquake-abruzzo
s. a. http://archiv.twoday.net/stories/5633415/
Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. April 2009, 08:10 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Seit langem ist klar, dass die freie Lizenz, unter der die Wikipedia steht, die GNU FDL (freie Dokumentationslizenz), einen Ballast darstellt. Ausführlich habe ich das dargelegt in meinem "GNU FDL - Highway to hell FAQ":
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Historiograf/GNU_FDL_Highway_to_Hell_-_FAQ
Die GNU FDL wurde für Softwarehandbücher geschaffen und lässt sich eher schlecht als recht auf ein Wiki übertragen. Daher ist es grundsätzlich begrüßenswert, dass durch die Free Software Foundation, von der die GNU FDL verantwortet wird, die Möglichkeit geschaffen hat, die Wikipedia und vergleichbare Wikis künftig dual zu lizenzieren. Wenn die Community zustimmt, werden noch 2009 alle Wikipedia-Texte zusätzlich unter der Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA zur Verfügung stehen.
Obwohl die Führungsgruppe der Wikimedia Foundation in der Mailingliste Foundation-l über Wochen mit Bedenken hinsichtlich der konkreten Umsetzung konfrontiert wurde, hat Erik Moeller seine Vorstellungen von "Attribution" (Urhebernennung gemäß CC) durchgesetzt. Die Community kann nicht über die verschiedenen Optionen der Attribution abstimmen, sie kann bei der jetzt angelaufenen Abstimmung nur mit ja, nein, keine Meinung abstimmen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenz%C3%A4nderung
Zu den Gegenargumenten gegen die Durchführung des Lizenzwechsels
http://meta.wikimedia.org/wiki/Licensing_update/Questions_and_Answers/Oppositional_arguments
Wer künftig einen Beitrag zur Wikipedia leistet, muss auf eine Namensnennung verzichten, es genügt ein Link:
By submitting an edit, you agree to release your contribution under the terms of the Creative Commons Attribution/Share-Alike License and the GNU Free Documentation License. Re-users will be required to credit you, at minimum, through a hyperlink or URL to the article you are contributing to, and you hereby agree that such credit is sufficient in any medium.
http://meta.wikimedia.org/wiki/Licensing_update
Es ist durchaus möglich, im Rahmen der CC-Lizenzen die Nennung eines Namens durch einen Internetlink zu ersetzen, und es ist auch möglich, dies in den Nutzungsbedingungen (Terms of Use) der Wikipedia zu tun.
Allerdings wirkt eine solche Willenswerklärung des jeweiligen Autors nur für die Zukunft, frühere Edits werden von ihr nicht erfasst.
Entgegen der Ansicht der Wikimedia Foundation war es auch bisher nicht zulässig, einfach einen Link auf die Wikipedia zu setzen, wie dies das "Gentlemen Agreement" vorsah. Wer Wikipedia-Inhalte nutzte, musste zwingend auch die Sektion History der GNU FDL beibehalten. Dabei muss es sich um die Versionsgeschichte des jeweiligen Artikels gehandelt haben (siehe den oben zitierten Highway).
Auch wenn nur eine kleine Minderheit der Wikipedianer die Attribution durch Liste aller Autoren befürwortet, bedeutet das nicht, dass man sich über die rechtlichen Garantien der GNU FDL hinwegsetzen darf.
Wer unter den Bedingungen der GNU FDL mitgearbeitet hat, hat einen Rechtsanspruch darauf, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (die GNU FDL ist ja eine AGB) nicht zu seinen Ungunsten geändert werden.
Es mag zutreffen, dass das Eröffnen der Möglichkeit, Inhalte auch unter CC-BY-SA zu nutzen, mit dem Geist der GNU FDL vereinbar ist.
Attribution nur qua Link zuzulassen ist es aber nicht.
Da sich die Vorgabe der Wikimedia Foundation bei der Abstimmung auf diese Form der Attribution festlegt, war mir keine Zustimmung zum Lizenzwechsel möglich, ich habe daher gegen ihn gestimmt.
Ob ein Urheber auf das Recht der Namensnennung im Rahmen der CC-Lizenz zugunsten eines Links verzichtet, ist seine persönliche Entscheidung und nicht die der Wikimedia Foundation - zumindest, was frühere Edits und importierten CC-Content betrifft.
Wer in einem CC-Wiki mitarbeitet oder ein Bild unter CC auf Flickr zur Verfügung stellt, stimmt damit nicht zu, dass die Wikipedia bei einem Import dieses Inhalts ihre Attribution-Regel "Link statt Namensnennung" für Nachnutzer verbindlich macht.
Wer Edits in der Wikipedia gemacht hat, stimmt einer Nutzung unter diesen Bedingungen nicht zu.
Die Attribution by link (und das "Gentlement Agreement") hat folgende gravierende Nachteile:
* Sobald die Wikipedia auch nur temporär offline ist, erlischt die Lizenz, da der Link ins Leere geht.
* Ebenso funktionieren die Links nicht, wenn Artikel gelöscht oder verschoben werden.
Bei Offline-Nutzungen setzt eine Attribution by link einen Internetzugang voraus.
Für jegliche Nutzung unter CC muss gewährleistet sein, dass die Lizenz angegeben wird (z.B. durch einen Link) und die Urhebernennung in der vom Autor gewünschten Weise erfolgt. Wenn man auf ein Bild klicken muss, um auf der Bildbeschreibungsseite der Wikipedia zu landen, wo der Name und die Lizenz stehen, ist das nie und nimmer mit den Vorgaben von CC vereinbar.
Kurzum: Die Foundation hat vielleicht die Befugnis, bei künftigen Edits die Ermöglichung der Attribution by link zu fordern, sie kann aber nicht vorgeben, mit welcher Attribution-Regel die Wikipedia zu CC "umzieht".
Letzten Endes muss gerichtlich geklärt werden, ob sich die Foundation in dieser Weise über die Rechte ihrer Autoren hinwegsetzen darf.
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Historiograf/GNU_FDL_Highway_to_Hell_-_FAQ
Die GNU FDL wurde für Softwarehandbücher geschaffen und lässt sich eher schlecht als recht auf ein Wiki übertragen. Daher ist es grundsätzlich begrüßenswert, dass durch die Free Software Foundation, von der die GNU FDL verantwortet wird, die Möglichkeit geschaffen hat, die Wikipedia und vergleichbare Wikis künftig dual zu lizenzieren. Wenn die Community zustimmt, werden noch 2009 alle Wikipedia-Texte zusätzlich unter der Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA zur Verfügung stehen.
Obwohl die Führungsgruppe der Wikimedia Foundation in der Mailingliste Foundation-l über Wochen mit Bedenken hinsichtlich der konkreten Umsetzung konfrontiert wurde, hat Erik Moeller seine Vorstellungen von "Attribution" (Urhebernennung gemäß CC) durchgesetzt. Die Community kann nicht über die verschiedenen Optionen der Attribution abstimmen, sie kann bei der jetzt angelaufenen Abstimmung nur mit ja, nein, keine Meinung abstimmen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenz%C3%A4nderung
Zu den Gegenargumenten gegen die Durchführung des Lizenzwechsels
http://meta.wikimedia.org/wiki/Licensing_update/Questions_and_Answers/Oppositional_arguments
Wer künftig einen Beitrag zur Wikipedia leistet, muss auf eine Namensnennung verzichten, es genügt ein Link:
By submitting an edit, you agree to release your contribution under the terms of the Creative Commons Attribution/Share-Alike License and the GNU Free Documentation License. Re-users will be required to credit you, at minimum, through a hyperlink or URL to the article you are contributing to, and you hereby agree that such credit is sufficient in any medium.
http://meta.wikimedia.org/wiki/Licensing_update
Es ist durchaus möglich, im Rahmen der CC-Lizenzen die Nennung eines Namens durch einen Internetlink zu ersetzen, und es ist auch möglich, dies in den Nutzungsbedingungen (Terms of Use) der Wikipedia zu tun.
Allerdings wirkt eine solche Willenswerklärung des jeweiligen Autors nur für die Zukunft, frühere Edits werden von ihr nicht erfasst.
Entgegen der Ansicht der Wikimedia Foundation war es auch bisher nicht zulässig, einfach einen Link auf die Wikipedia zu setzen, wie dies das "Gentlemen Agreement" vorsah. Wer Wikipedia-Inhalte nutzte, musste zwingend auch die Sektion History der GNU FDL beibehalten. Dabei muss es sich um die Versionsgeschichte des jeweiligen Artikels gehandelt haben (siehe den oben zitierten Highway).
Auch wenn nur eine kleine Minderheit der Wikipedianer die Attribution durch Liste aller Autoren befürwortet, bedeutet das nicht, dass man sich über die rechtlichen Garantien der GNU FDL hinwegsetzen darf.
Wer unter den Bedingungen der GNU FDL mitgearbeitet hat, hat einen Rechtsanspruch darauf, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (die GNU FDL ist ja eine AGB) nicht zu seinen Ungunsten geändert werden.
Es mag zutreffen, dass das Eröffnen der Möglichkeit, Inhalte auch unter CC-BY-SA zu nutzen, mit dem Geist der GNU FDL vereinbar ist.
Attribution nur qua Link zuzulassen ist es aber nicht.
Da sich die Vorgabe der Wikimedia Foundation bei der Abstimmung auf diese Form der Attribution festlegt, war mir keine Zustimmung zum Lizenzwechsel möglich, ich habe daher gegen ihn gestimmt.
Ob ein Urheber auf das Recht der Namensnennung im Rahmen der CC-Lizenz zugunsten eines Links verzichtet, ist seine persönliche Entscheidung und nicht die der Wikimedia Foundation - zumindest, was frühere Edits und importierten CC-Content betrifft.
Wer in einem CC-Wiki mitarbeitet oder ein Bild unter CC auf Flickr zur Verfügung stellt, stimmt damit nicht zu, dass die Wikipedia bei einem Import dieses Inhalts ihre Attribution-Regel "Link statt Namensnennung" für Nachnutzer verbindlich macht.
Wer Edits in der Wikipedia gemacht hat, stimmt einer Nutzung unter diesen Bedingungen nicht zu.
Die Attribution by link (und das "Gentlement Agreement") hat folgende gravierende Nachteile:
* Sobald die Wikipedia auch nur temporär offline ist, erlischt die Lizenz, da der Link ins Leere geht.
* Ebenso funktionieren die Links nicht, wenn Artikel gelöscht oder verschoben werden.
Bei Offline-Nutzungen setzt eine Attribution by link einen Internetzugang voraus.
Für jegliche Nutzung unter CC muss gewährleistet sein, dass die Lizenz angegeben wird (z.B. durch einen Link) und die Urhebernennung in der vom Autor gewünschten Weise erfolgt. Wenn man auf ein Bild klicken muss, um auf der Bildbeschreibungsseite der Wikipedia zu landen, wo der Name und die Lizenz stehen, ist das nie und nimmer mit den Vorgaben von CC vereinbar.
Kurzum: Die Foundation hat vielleicht die Befugnis, bei künftigen Edits die Ermöglichung der Attribution by link zu fordern, sie kann aber nicht vorgeben, mit welcher Attribution-Regel die Wikipedia zu CC "umzieht".
Letzten Endes muss gerichtlich geklärt werden, ob sich die Foundation in dieser Weise über die Rechte ihrer Autoren hinwegsetzen darf.
KlausGraf - am Dienstag, 14. April 2009, 21:16 - Rubrik: Archivrecht
" ..... Erinnerung für Erinnerung breitet der Architekt aus, aber nicht als rührselige Schlachtplatte unerfüllter Träume, sondern als Bildgeber und Archiv seiner Arbeit. ....."
Oliver Herwig über Peter Zumthor Buch "Architektur denken"
Quelle: FR
Oliver Herwig über Peter Zumthor Buch "Architektur denken"
Quelle: FR
Wolf Thomas - am Dienstag, 14. April 2009, 19:38 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Dass wir sorgfältiger mit uns und unserer Geschichte umgehen müssen. Es geht nicht um irgendein Gebäude in Köln, das zusammengefallen ist, sondern um unser historisches Gedächtnis. Dieser Einsturz ist daher ein gesellschaftliches Problem, da muss sich auch die Politik mehr engagieren. Das Know-how ist da, die Konzepte auch, es muss lediglich finanziert werden. Wir brauchen generell ein größeres Bewusstsein für unsere Archive, denn sie bewahren unsere Geschichte und machen sie erforschbar......"
Jochen Hermel (29), Institut für Geschichtswissenschaft der Universität Bonn, schreibt an Dissertation mit der Integration von Zuwanderern in der Stadt Köln im 16. und beginnenden 17. Jahrhundert.
Quelle:
http://www.welt.de/die-welt/article3551415/Resignation-kann-und-will-ich-mir-nicht-leisten.html
Jochen Hermel (29), Institut für Geschichtswissenschaft der Universität Bonn, schreibt an Dissertation mit der Integration von Zuwanderern in der Stadt Köln im 16. und beginnenden 17. Jahrhundert.
Quelle:
http://www.welt.de/die-welt/article3551415/Resignation-kann-und-will-ich-mir-nicht-leisten.html
Wolf Thomas - am Dienstag, 14. April 2009, 19:36 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.kipa-apic.ch/index.php?pw=&na=0,0,0,0,d&ki=193917
In den letzten zwei Jahren wurden über 2000 Urkunden, knapp 30 Rödel (Namenslisten) und 50 der wichtigsten Amtsbücher aufgearbeitet, digitalisiert und im Internet zugänglich gemacht.
http://www.klosterarchiv.ch

Digitalisiert liegt z.B. Tschudis "Liber Heremi" vor:
http://www.klosterarchiv.ch/e-archiv_archivalien_inhalt.php?signatur=KAE,%20A.CB.2
In den letzten zwei Jahren wurden über 2000 Urkunden, knapp 30 Rödel (Namenslisten) und 50 der wichtigsten Amtsbücher aufgearbeitet, digitalisiert und im Internet zugänglich gemacht.
http://www.klosterarchiv.ch

Digitalisiert liegt z.B. Tschudis "Liber Heremi" vor:
http://www.klosterarchiv.ch/e-archiv_archivalien_inhalt.php?signatur=KAE,%20A.CB.2
KlausGraf - am Dienstag, 14. April 2009, 18:43 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.taz.de/1/leben/buch/artikel/1/%5Cwir-lesen-nicht%5C/
Streng abgeschirmt in einer Halle werden die Urkunden und Akten aus dem eingestürzten Kölner Stadtarchiv erstversorgt. Unser Autor arbeitete vier Tage mit. Heute: Tag eins seines Protokolls. VON DIETMAR BARTZ
[...] 18 Uhr. Die Johanniter servieren Abendessen. Es gibt Wurst, Käse, Graubrot und Vollkornbrot, das nach Aromastoffen riecht. Kein Obst, kein Salat. Kalte Bockwürstchen ohne Senf. Plastikgeschirr und -besteck. Ein Behälter mit kaltem Kaffee. Kein Tee.
Am Tisch: ein Restaurator aus Uppsala, eine Uni-Archivarin aus Basel, eine Stadtarchivarin aus Arnheim, drei Tschechen aus einem sudetenländischen Regionalarchiv, drei Konservatorinnen aus Antwerpen, einige Deutsche. Vor den Ausländern schäme ich mich für dieses Essen. Eine Antwerpenerin höflich: "Its kind of basic." Der Stadtarchivar von B.: "Die Tendenz zur Kälte ist offensichtlich." Eine Professorin aus S.: "Sonst heißt es noch, wir wären wegen des guten Essens gekommen." Wir befinden uns in Woche fünf nach dem Einsturz.
[Kommentar KG: Das Essen war bei uns OK, es gab auch immer genug mehrere Getränke zur Auswahl. Einmal gabs Gulaschsuppe ohne Brötchen - so what? Der Kaffee, den ich trank, war immer heiß.]
Spekulationen über das, was auf das EVZ noch zukommt. Haben sie nicht 60 Mischerladungen Beton im Boden versenkt, um ihn zu stabilisieren? Lag da Archivgut? Und wo steht eigentlich das Grundwasser? Niemand am Tisch weiß Bescheid, alle sind schlecht informiert. Wozu hat die Stadt Köln eine Pressestelle? Warum keine brauchbare städtische Webseite, keine Onlineauskunft?
Über unsere Einsatzplanung wird am Tisch nur geseufzt. Einige Schichten waren offenbar deutlich unterbesetzt. Und auf die Mails mit Hilfsangeboten reagierte die Stadt wochenlang nicht. Dann kam die Anforderung ganz kurzfristig. Warum gibt es keinen wöchentlichen Newsletter an alle Freiwilligen? Zweitausend Fachleute haben sich gemeldet. Mit einem Computer wäre die Verwaltung unserer Adressen und unser planvoller Einsatz kein Problem gewesen.
[...] 21 Uhr. Rückfahrt. Viele auswärtige Deutsche wohnen bei Freunden. Der Rest und fast alle Ausländerinnen und Ausländer sind in einer städtischen Notunterkunft einquartiert, "Jugendherberge, aber nicht von heute, sondern wie früher", erzählt eine Schwäbin. Eng, spartanisch, am Wochenende gab es Probleme mit der Verpflegung, ich mag keine Einzelheiten mehr hören. Drei junge Archivarinnen aus W. haben ihre Chefin angerufen und das Übernachten in einer Pension durchgesetzt. Gut, dass ich das gleich so gemacht habe. [...]
Beim Sicherheitsdienst haben wir am Mittag eine Schweigeerklärung unterschrieben, nicht nur wegen des Datenschutzes: Die Stadt verbietet auch das "Verfassen eigener Presseartikel", das Fotografieren. Und alle Informationen an die Medien müssen ausdrücklich genehmigt werden.
An der Einsturzstelle führt die Feuerwehr jeden Mittag Medienvertreter herum. Das EVZ hingegen ist tabu. Die Rettung darf gezeigt werden, der Zustand des Geretteten nicht. Aus den Augen, aus dem Sinn - anders könnte die Stadtspitze wohl ihre Exkulpation nicht durchhalten,
Auch städtische Öffentlichkeitsarbeit findet praktisch nicht mehr statt. Die Archivare selbst sind blockiert: Bettina Schmitt-Czaia, die bedauernswerte Direktorin des Stadtarchivs, muss der Stadt ein neues Haus abverhandeln und ist auf ihr Wohlwollen angewiesen.
Nur: Die Strafe ist auf Jahre nicht vorbei. Sie steckt in Kartons, Plastikwannen, Gitterboxen. Und es werden immer mehr.
Streng abgeschirmt in einer Halle werden die Urkunden und Akten aus dem eingestürzten Kölner Stadtarchiv erstversorgt. Unser Autor arbeitete vier Tage mit. Heute: Tag eins seines Protokolls. VON DIETMAR BARTZ
[...] 18 Uhr. Die Johanniter servieren Abendessen. Es gibt Wurst, Käse, Graubrot und Vollkornbrot, das nach Aromastoffen riecht. Kein Obst, kein Salat. Kalte Bockwürstchen ohne Senf. Plastikgeschirr und -besteck. Ein Behälter mit kaltem Kaffee. Kein Tee.
Am Tisch: ein Restaurator aus Uppsala, eine Uni-Archivarin aus Basel, eine Stadtarchivarin aus Arnheim, drei Tschechen aus einem sudetenländischen Regionalarchiv, drei Konservatorinnen aus Antwerpen, einige Deutsche. Vor den Ausländern schäme ich mich für dieses Essen. Eine Antwerpenerin höflich: "Its kind of basic." Der Stadtarchivar von B.: "Die Tendenz zur Kälte ist offensichtlich." Eine Professorin aus S.: "Sonst heißt es noch, wir wären wegen des guten Essens gekommen." Wir befinden uns in Woche fünf nach dem Einsturz.
[Kommentar KG: Das Essen war bei uns OK, es gab auch immer genug mehrere Getränke zur Auswahl. Einmal gabs Gulaschsuppe ohne Brötchen - so what? Der Kaffee, den ich trank, war immer heiß.]
Spekulationen über das, was auf das EVZ noch zukommt. Haben sie nicht 60 Mischerladungen Beton im Boden versenkt, um ihn zu stabilisieren? Lag da Archivgut? Und wo steht eigentlich das Grundwasser? Niemand am Tisch weiß Bescheid, alle sind schlecht informiert. Wozu hat die Stadt Köln eine Pressestelle? Warum keine brauchbare städtische Webseite, keine Onlineauskunft?
Über unsere Einsatzplanung wird am Tisch nur geseufzt. Einige Schichten waren offenbar deutlich unterbesetzt. Und auf die Mails mit Hilfsangeboten reagierte die Stadt wochenlang nicht. Dann kam die Anforderung ganz kurzfristig. Warum gibt es keinen wöchentlichen Newsletter an alle Freiwilligen? Zweitausend Fachleute haben sich gemeldet. Mit einem Computer wäre die Verwaltung unserer Adressen und unser planvoller Einsatz kein Problem gewesen.
[...] 21 Uhr. Rückfahrt. Viele auswärtige Deutsche wohnen bei Freunden. Der Rest und fast alle Ausländerinnen und Ausländer sind in einer städtischen Notunterkunft einquartiert, "Jugendherberge, aber nicht von heute, sondern wie früher", erzählt eine Schwäbin. Eng, spartanisch, am Wochenende gab es Probleme mit der Verpflegung, ich mag keine Einzelheiten mehr hören. Drei junge Archivarinnen aus W. haben ihre Chefin angerufen und das Übernachten in einer Pension durchgesetzt. Gut, dass ich das gleich so gemacht habe. [...]
Beim Sicherheitsdienst haben wir am Mittag eine Schweigeerklärung unterschrieben, nicht nur wegen des Datenschutzes: Die Stadt verbietet auch das "Verfassen eigener Presseartikel", das Fotografieren. Und alle Informationen an die Medien müssen ausdrücklich genehmigt werden.
An der Einsturzstelle führt die Feuerwehr jeden Mittag Medienvertreter herum. Das EVZ hingegen ist tabu. Die Rettung darf gezeigt werden, der Zustand des Geretteten nicht. Aus den Augen, aus dem Sinn - anders könnte die Stadtspitze wohl ihre Exkulpation nicht durchhalten,
Auch städtische Öffentlichkeitsarbeit findet praktisch nicht mehr statt. Die Archivare selbst sind blockiert: Bettina Schmitt-Czaia, die bedauernswerte Direktorin des Stadtarchivs, muss der Stadt ein neues Haus abverhandeln und ist auf ihr Wohlwollen angewiesen.
Nur: Die Strafe ist auf Jahre nicht vorbei. Sie steckt in Kartons, Plastikwannen, Gitterboxen. Und es werden immer mehr.
KlausGraf - am Dienstag, 14. April 2009, 18:21 - Rubrik: Kommunalarchive
Nach einer kurzen Osterpause haben Feuerwehr und Technisches Hilfswerk die Arbeit an der Einsturzstelle in der Severinstraße wieder aufgenommen. Unterstützt werden die Helfer diese Woche von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Aachen. Der Trümmerberg wird täglich kleiner. „Es könnte sein, dass wir Ende Mai fertig sind“, sagte Feuerwehrsprecher Günter Weber, schränkte aber ein: „Wir wissen nicht genau, wie weit es noch in die Tiefe geht.“
Um die Beschaffenheit des Bodens zu klären, setzten die Arbeiter am Dienstag einen speziellen Bohrer ein, der Gesteinsproben aus 50 Metern Tiefe an die Oberfläche förderte. „So kann man zum Beispiel herausfinden, ob da unten noch Trümmerteile liegen“, berichtete Weber. Unterdessen begannen Bagger auf der Rückseite des ehemaligen Stadtarchivs, Gebäudereste des Lesesaals und des Verwaltungstraktes abzureißen.
Gisela Fleckenstein, die Leiterin der Abteilung Nachlässe und Sammlungen, zeigte sich erfreut: „Ganz ehrlich: Als ich den Trümmerberg zum ersten Mal gesehen hatte, hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel retten können. Unser Archiv lebt noch!“
Fast die Hälfte der ehemals 30 Regalkilometer Archivalien sei inzwischen geborgen, allerdings in unterschiedlicher Qualität. „Es sind auch feuchte Akten dabei, die schon Schimmel angesetzt haben“, sagte Fleckenstein. Diese Schriften werden tiefgefroren, die besser erhaltenen in eine Lagerhalle nach Porz transportiert. „Es wird wohl noch Jahre dauern, die Akten zu restaurieren und so sortieren“, sagte Fleckenstein. „Die einzelnen Bestände sind ja völlig durcheinander geraten.“
http://www.ksta.de/html/artikel/1239718856454.shtml
Um die Beschaffenheit des Bodens zu klären, setzten die Arbeiter am Dienstag einen speziellen Bohrer ein, der Gesteinsproben aus 50 Metern Tiefe an die Oberfläche förderte. „So kann man zum Beispiel herausfinden, ob da unten noch Trümmerteile liegen“, berichtete Weber. Unterdessen begannen Bagger auf der Rückseite des ehemaligen Stadtarchivs, Gebäudereste des Lesesaals und des Verwaltungstraktes abzureißen.
Gisela Fleckenstein, die Leiterin der Abteilung Nachlässe und Sammlungen, zeigte sich erfreut: „Ganz ehrlich: Als ich den Trümmerberg zum ersten Mal gesehen hatte, hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel retten können. Unser Archiv lebt noch!“
Fast die Hälfte der ehemals 30 Regalkilometer Archivalien sei inzwischen geborgen, allerdings in unterschiedlicher Qualität. „Es sind auch feuchte Akten dabei, die schon Schimmel angesetzt haben“, sagte Fleckenstein. Diese Schriften werden tiefgefroren, die besser erhaltenen in eine Lagerhalle nach Porz transportiert. „Es wird wohl noch Jahre dauern, die Akten zu restaurieren und so sortieren“, sagte Fleckenstein. „Die einzelnen Bestände sind ja völlig durcheinander geraten.“
http://www.ksta.de/html/artikel/1239718856454.shtml
KlausGraf - am Dienstag, 14. April 2009, 18:15 - Rubrik: Kommunalarchive
http://salzburg.orf.at/stories/354605/
Rund 1.200 Grundbücher lagern im Landesarchiv in Salzburg. Sie dokumentieren und klären eindeutig Besitzrechte, Dienstbarkeiten und Servitute für alle Generationen. Das Problem: Sie seien nur begrenzt haltbar, sagt Landesarchivar Fritz Koller.
"Was man im Jahr 1870 noch nicht wissen konnte, war, dass dieses Papier eine Lebensdauer von ca. 100 Jahren hat. Jetzt sind die Grundbücher natürlich schon älter, und dementsprechende schlecht ist der Zustand dieses Papiers." [...]
Daher hat man im Landesarchiv begonnen, alle Grundbücher auf Mikrofilm zu kopieren. Das ist vor allem zeitintensiv und wird laut Landesarchivar Koller noch einige Jahre dauern.
Vor gegangen wird nach einer Prioritätenliste: Je schadhafter das betreffende Grundbuch, umso schneller wird es Mikrofilm gebannt.
Danke an Josef P.
Rund 1.200 Grundbücher lagern im Landesarchiv in Salzburg. Sie dokumentieren und klären eindeutig Besitzrechte, Dienstbarkeiten und Servitute für alle Generationen. Das Problem: Sie seien nur begrenzt haltbar, sagt Landesarchivar Fritz Koller.
"Was man im Jahr 1870 noch nicht wissen konnte, war, dass dieses Papier eine Lebensdauer von ca. 100 Jahren hat. Jetzt sind die Grundbücher natürlich schon älter, und dementsprechende schlecht ist der Zustand dieses Papiers." [...]
Daher hat man im Landesarchiv begonnen, alle Grundbücher auf Mikrofilm zu kopieren. Das ist vor allem zeitintensiv und wird laut Landesarchivar Koller noch einige Jahre dauern.
Vor gegangen wird nach einer Prioritätenliste: Je schadhafter das betreffende Grundbuch, umso schneller wird es Mikrofilm gebannt.
Danke an Josef P.
KlausGraf - am Dienstag, 14. April 2009, 16:39 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 14. April 2009, 11:59 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://library.fes.de/inhalt/digital/ecozs/naturfreunde-zs.html
Teilweise extrem schlechte Qualität.
Teilweise extrem schlechte Qualität.
KlausGraf - am Dienstag, 14. April 2009, 00:46 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung schaltet Archiv für Sozialgeschichte (AfS) online
Das seit 1961 jährlich erscheinende Archiv für Sozialgeschichte ist eine der großen, international anerkannten geschichtswissenschaftlichen Fachzeitschriften. Zum "Markenzeichen" des Archivs zählen fachlich herausragende Aufsätze zu einem bestimmten Rahmenthema sowie umfangreiche Forschungsberichte und Sammelrezensionen.
In einem großen Eigenprojekt der Friedrich-Ebert-Stiftung wurde das AfS digitalisiert und mit Ausnahme der jeweils aktuellen Jahrgänge ins Netz gestellt. Kaum eine andere internationale Fachzeitschrift im Netz bietet eine so große Fülle differenzierter Sucheinstige. Neben einer Volltextsuche kann ausgefeilt in den bibliografischen Titeldaten recherchiert werden. Rezensionen sind über eine Schnellsuche und eine Expertensuche suchbar.
Das Projekt wurde in enger Kooperation mit der Thüringischen Universitäts- und Landesbibliothek Jena verwirklicht, die der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung ihre Plattform "University Multimedia Electronic Library of Jena (UrMel) zur Verfügung stellte, die ein funktionsgerechtes Publizieren, Erfassen, Erschließen, Verbinden, Präsentieren und Archivieren elektronischer und multimedialer Dokumente ermöglicht.
moving wall: drei Jahre
http://library.fes.de/afs-online/inhalt/online.htm
Das seit 1961 jährlich erscheinende Archiv für Sozialgeschichte ist eine der großen, international anerkannten geschichtswissenschaftlichen Fachzeitschriften. Zum "Markenzeichen" des Archivs zählen fachlich herausragende Aufsätze zu einem bestimmten Rahmenthema sowie umfangreiche Forschungsberichte und Sammelrezensionen.
In einem großen Eigenprojekt der Friedrich-Ebert-Stiftung wurde das AfS digitalisiert und mit Ausnahme der jeweils aktuellen Jahrgänge ins Netz gestellt. Kaum eine andere internationale Fachzeitschrift im Netz bietet eine so große Fülle differenzierter Sucheinstige. Neben einer Volltextsuche kann ausgefeilt in den bibliografischen Titeldaten recherchiert werden. Rezensionen sind über eine Schnellsuche und eine Expertensuche suchbar.
Das Projekt wurde in enger Kooperation mit der Thüringischen Universitäts- und Landesbibliothek Jena verwirklicht, die der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung ihre Plattform "University Multimedia Electronic Library of Jena (UrMel) zur Verfügung stellte, die ein funktionsgerechtes Publizieren, Erfassen, Erschließen, Verbinden, Präsentieren und Archivieren elektronischer und multimedialer Dokumente ermöglicht.
moving wall: drei Jahre
http://library.fes.de/afs-online/inhalt/online.htm
KlausGraf - am Dienstag, 14. April 2009, 00:42 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Auch zwei Jahre später ist das ANNO-Portal zu österreichischen Erstausgaben noch nicht offiziell freigegeben:
http://archiv.twoday.net/stories/3514233
Eine Liste der Werke bietet:
http://de.wikisource.org/wiki/Benutzer:Xarax/Anno
http://archiv.twoday.net/stories/3514233
Eine Liste der Werke bietet:
http://de.wikisource.org/wiki/Benutzer:Xarax/Anno
KlausGraf - am Montag, 13. April 2009, 19:42 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Andreas Rossmann besuchte die Bergungsarbeiten in Köln und berichtet in der F.A.Z., 14.04.2009, Nr. 86, Seite 27:
Zettels Trauma oder Wenn Papier um Hilfe schreit
Fetzen, Brösel, Schutt: Sechs Wochen nach dem Einsturz des Historischen Archivs entsteht außerhalb von Köln eine Notfallambulanz für Archivalien. Ein Besuch im zerstörten Gedächtnis der Stadt.
[...] In der Lagerhalle, einem monströsen Containerbau armseligster Zweckarchitektur, wurde das "Erstversorgungszentrum" eingerichtet: Hierher werden alle Schätze, die aus der Unglücksstelle geborgen werden und sich nicht mit Baumaterial oder Möbeln verklumpt haben, gebracht, um gesichtet, grob gereinigt, registriert und erstbegutachtet zu werden. Eine riesige Notfallambulanz für Archivalien, in der, was dringender Hilfe bedarf, sofort versorgt oder zum Spezialisten überwiesen wird.
Zwischenstation Niemandsland. Die Lagerhalle liegt im Kölner Süden, wo die Stadt ausfranst und sich Auto- und Möbelhäuser, Büroparks und bescheidene Siedlungen zwischen landwirtschaftlich genutzte Felder fressen. Nicht einmal die Domtürme sind noch zu erblicken, Köln sieht hier aus wie überall. "Bitte berücksichtigen Sie in Ihrer Berichterstattung, dass das Gebäude für die Öffentlichkeit weiterhin nicht auffindbar sein darf und insoweit Ihre Beschreibung des Ortes hinreichend unscharf sein muss", hatte der Pressesprecher des Kulturdezernats mit auf den Weg gegeben, an dessen Ziel "der Sicherheitsdienst Sie in Empfang nehmen" wird. Der wartet, dunkelblau uniformiert, in einem Kabuff im ersten Stock, in das eine frei stehende Metalltreppe steigt. "Absolutes Foto-Verbot!" und "Ab sofort ist aus Sicherheitsgründen mit Taschenkontrollen zu rechnen!" rufen Plakate von den Wänden. Jeder Besucher muss sich ein- und wieder austragen sowie eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. "Für Journalisten gilt das natürlich nicht", doch dürfen freiwillige Helfer nur in Anwesenheit des "Archivars im Dienst" befragt werden. Ein Security-Mitarbeiter weicht der Gruppe nicht von den Fersen.
Szenenwechsel. Der Unfallort am Waidmarkt, knapp sechs Wochen danach. Über der Stelle, wo bis zum 3. März das Archiv stand, und auf dem Straßenstück spannen sich, von einem Stahlgerüst getragen, zwei große Zeltdächer mit flachen Giebeln, um den Regen abzuhalten. In Nord-Süd-Richtung fällt das, was von dem Gebäude und seinem Inhalt übrig geblieben ist, von etwa vier Meter über dem Straßenniveau hinunter auf sechs Meter Tiefe: ein Steilhang aus Stahlbetonträgern, Zementbrocken, Ziegeln, Schutt, Erde, Sand, Rohren, Kabeln, Metallschränken, Kartons, Regalbrettern, Heizkörpern, Teppichresten und eben auch Archivalien in ganz unterschiedlichem Zustand. Archäologie der Gegenwart.
Nur Feuerwehrleute, zu ihrem eigenen Schutz angeseilt, falls der Geröllberg nachgeben sollte, dürfen Archivalien sichern. Je sechs bis acht von ihnen stehen an der obersten und untersten Stelle, wo Bagger die größten Brocken zerkleinern. Was sie mit den Händen herausholen können, legen sie in graue Pappkartons, die ihnen zugereicht werden. Diese werden beladen und nach oben getragen, wo Archivmitarbeiter sie in Empfang nehmen. Unter dem aufgeständerten Quertrakt des Friedrich- Wilhelm-Gymnasiums haben sie eine provisorische Aufnahme eingerichtet: Eine Untersuchung zur "Beförderung der Obstbauzucht" aus dem Jahr 1838 landet hier neben einer frühneuzeitlichen Urkunde, ein Leitzordner des Bundes der Vertriebenen neben Reichstagsprotokollen. Karton auf Karton wird gefüllt und auf Lastwagen gehoben, die täglich zehn, elf Ladungen ins Erstversorgungszentrum bringen.
Szenenwechsel. Was im Erstversorgungszentrum ankommt, tritt den mehr oder weniger langen Weg der Rekonvaleszenz an. Doch nicht alle Archivalien finden direkt hierher. Einzelne Stücke bleiben im Bauschutt hängen und sind zunächst so verborgen, dass sie in die Schuttsortierhalle geraten. Zwei Fußballfelder groß erstreckt sich in Grau und Braun eine Brache, auf der Materialien getrennt werden: Steine, Erde, Metall, Kunststoff, Holz werden zu Haufen geschichtet und von Archivresten befreit. Oft sind es nur einzelne Seiten, Ausschnitte, Kladden, Fotos, Fetzen, die mühsam herausgelöst werden. Staub hängt in der Luft, es riecht modrig. Die zehn, zwölf Menschen, die hier schuften, in der Mehrzahl Ein-Euro-Jobber, tragen Atemmasken und möchten nicht fotografiert werden - ein Wühlen in Trümmern und Dreck, bei dem sie wie Schatzsucher auf kleine Trouvaillen stoßen. "Nomina Discipulorum Gymnasii trium coronarum anno MDCXXXIII" heißt es auf dem Titelblatt eines kleinen Buchs, das in zierlicher Handschrift die Namen von Schülern des Dreiköniggymnasiums auflistet.
Zurück im Erstversorgungszentrum. "Warenausgabe" steht über den Laderampen der fensterlosen Halle: Wo Möbel gelagert wurden, wird nun Archivgut angeliefert. Ein Aufzug hebt die Kisten ins erste Obergeschoss, wo sie ausgepackt werden. Auf einer Teilfläche sind mehrere Tische aneinandergereiht, an denen bis zu dreißig Helfer stehen und zunächst alles, was nass geworden und akut von Schimmelfraß bedroht ist, aussortieren, in Stretchfolie hüllen und in Gitterboxen legen. Ein-, zweimal am Tag geht eine Fuhre nach Münster, wo sie in Kühlhäusern eingefroren und gefriergetrocknet werden: "Die Stretchfolie hat den Sinn, dass beim Auftauen einzelne Akten herausgenommen werden können. Ohne Folie müsste man den ganzen Block auf einmal auftauen, und solch große Gefriertrocknungsanlagen gibt es nicht", erklärt Max Plassmann, der als Schichtleiter im Erstversorgungszentrum arbeitet und bis zu fünfzig Freiwillige koordiniert. Die Helfer tragen weiße Overalls, Latex-Handschuhe und Mundschutz, der "Archivar im Dienst" ein rotes, der Restaurator ein grünes, die Mitarbeiter des Archivs blaue T-Shirts. Die meisten Dokumente haben keine oder so geringe Feuchtigkeitsschäden, dass sie am Ort getrocknet werden können. An der Wand sind, von Hand geschrieben, die Handlungsanweisungen angeschlagen: Der Oberflächenstaub wird abgefegt, die Dokumente werden in blaue Plastikwannen gelegt oder, wenn sie stärker zerstört sind, eingewickelt oder in Mappen gesteckt, numeriert und elektronisch erfasst.
"Wir schmeißen grundsätzlich nichts weg", versichert Plassmann, der zuvor das Universitätsarchiv Düsseldorf leitete und erst zwei Wochen vor dem Einsturz nach Köln gewechselt ist: "Die Frage ,Lohnt sich das überhaupt?' stellen wir nicht, das wäre in Ruhe zu überlegen, dafür haben wir keine Zeit." Nur beschädigte Kartonagen wandern in den Abfall. "Auch die Frage, was früher und was später restauriert wird, kann erst entschieden werden, wenn die erste Bergungsphase abgeschlossen ist, wir wirklich den Überblick haben und die Schadensbilder kennen: Erst dann können wir eine systematische Restaurierungsstrategie entfalten." Noch aber ist die Severinstraße nicht komplett abgegraben, bis Ende Mai dürften sich die Arbeiten dort hinziehen, und noch ist nicht bekannt, ob und wie viele Archivalien ins Grundwasser gerutscht sind.
Bis in die dritte Etage rattert der Lastenaufzug, zu einem neonbeleuchteten Raum - ein Ort weitläufiger Unwirtlichkeit, in dessen Tiefen sich Stahlregale und Gitterwagen reihen, Kartons stapeln oder nur dunkle Leere gähnt. Gleich neben dem Aufzug ist ein Zelt abgehängt, in dem ein halbes Dutzend Bautrockner rattern: Die Koletten, wie die fahrbaren Paletten heißen, sind mit Einlegebögen nachgerüstet, auf denen aufgeblätterte Bücher, deren Feuchtigkeitsschäden so gering sind, dass sie nicht in den Gefriertrockner müssen. Die Luft wird angesaugt und mit einer Feuchtigkeit von nur dreißig Prozent wieder ausgeblasen: So ist das Papier innerhalb von vierundzwanzig Stunden trocken, die Dokumente können herausgeschoben und weiterbearbeitet werden. Eine Akte des Metropolitan Water Board der City of London vom 3. April 1955, wahrscheinlich aus einem Nachlass, liegt hier neben Teilen der Sammlung Alfter, Zeitschriften, genealogischen Schriften und Katalogen.
Robert Fuchs, der an der Fachhochschule Köln das Institut für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft leitet, schaut immer wieder nach dem Fortgang der Arbeiten. "Im Moment", so schätzt er, "dürften die Kosten der Restaurierung den Wert der Materialien noch übersteigen." Doch derlei Überlegungen möchte er - "es gibt ja auch intrinsische Werte, die man nicht beziffern kann" - erst gar nicht vertiefen: "Der Restaurator denkt anders: Wenn ein Objekt um Hilfe schreit, nimmt er es sich als erstes vor; da ist es ganz egal, ob es sich um eine mittelalterliche Bibel oder eine Akte von 1945 handelt. Er sieht nur: Wenn ich warte, geht das kaputt." Abwägungsfragen dazu, was als Nächstes und womöglich zu wessen Lasten wiederhergestellt werden soll, müssen in den nächsten Jahren vieltausendmal beantwortet werden: Zu entscheiden sind sie von Archivaren und Restauratoren gemeinsam, und für Max Plassmann könnte es "ein Anknüpfungspunkt der Katastrophe sein, dass eine engere Verzahnung beider Bereiche stattfindet".
[...]
Der Weg der Archivalien durch das Erstversorgungszentrum endet in der Packstation, wo sie aus den blauen Plastikwannen geholt, noch einmal auf Feuchtigkeit überprüft und, sofern möglich, zu Einheiten zusammengestellt werden. Nur ganz wertvolle Schätze, Handschriften aus der Sammlung Wallraf, Schreinsbücher oder Pergamenturkunden, bleiben in Köln und werden dem Archiv des Erzbistums anvertraut. Alles andere wird in Kartons der richtigen Größe gepackt, die numeriert, im Computer erfasst, auf Paletten gesetzt, zum Transport freigegeben und in Archive gebracht werden, die freie Magazine zur Zwischenlagerung angeboten haben: ins Bundesarchiv nach Koblenz und St. Augustin, zur Friedrich-Ebert-Stiftung nach Bonn, ins Archivamt nach Brauweiler, in die Landesarchive in Münster und Detmold, aber auch weiter weg, bis nach Freiburg und Potsdam.
Wann was zurückkehrt und restauriert wird, wann die Bestände wieder unter einem gemeinsamen Dach sein werden und für den Bürger zugänglich sind, weiß niemand. Der Einsturz hat die Bestände durcheinandergequirlt und jede Ordnung aufgehoben. "Seriös kann noch niemand sagen, dass dieser oder jener Bestand komplett erhalten ist, bisher sind es nur einzelne Stücke oder Teile, aber wir freuen uns über jedes Exemplar, das auftaucht." So erteilt Max Plassmann voreiligen Rettungsmeldungen eine Absage. Zwanzig, womöglich dreißig Jahre, schätzt er, wird es dauern, bis das Archiv, auch wenn es viele Verluste hinnehmen musste, wieder so weit wiederhergestellt ist, dass es an die Zeit vor dem Einsturz anknüpfen kann. Erst dann wird der Kopf wieder auf dem Körper sitzen.
Text: http://tinyurl.com/c3qcgg
Zettels Trauma oder Wenn Papier um Hilfe schreit
Fetzen, Brösel, Schutt: Sechs Wochen nach dem Einsturz des Historischen Archivs entsteht außerhalb von Köln eine Notfallambulanz für Archivalien. Ein Besuch im zerstörten Gedächtnis der Stadt.
[...] In der Lagerhalle, einem monströsen Containerbau armseligster Zweckarchitektur, wurde das "Erstversorgungszentrum" eingerichtet: Hierher werden alle Schätze, die aus der Unglücksstelle geborgen werden und sich nicht mit Baumaterial oder Möbeln verklumpt haben, gebracht, um gesichtet, grob gereinigt, registriert und erstbegutachtet zu werden. Eine riesige Notfallambulanz für Archivalien, in der, was dringender Hilfe bedarf, sofort versorgt oder zum Spezialisten überwiesen wird.
Zwischenstation Niemandsland. Die Lagerhalle liegt im Kölner Süden, wo die Stadt ausfranst und sich Auto- und Möbelhäuser, Büroparks und bescheidene Siedlungen zwischen landwirtschaftlich genutzte Felder fressen. Nicht einmal die Domtürme sind noch zu erblicken, Köln sieht hier aus wie überall. "Bitte berücksichtigen Sie in Ihrer Berichterstattung, dass das Gebäude für die Öffentlichkeit weiterhin nicht auffindbar sein darf und insoweit Ihre Beschreibung des Ortes hinreichend unscharf sein muss", hatte der Pressesprecher des Kulturdezernats mit auf den Weg gegeben, an dessen Ziel "der Sicherheitsdienst Sie in Empfang nehmen" wird. Der wartet, dunkelblau uniformiert, in einem Kabuff im ersten Stock, in das eine frei stehende Metalltreppe steigt. "Absolutes Foto-Verbot!" und "Ab sofort ist aus Sicherheitsgründen mit Taschenkontrollen zu rechnen!" rufen Plakate von den Wänden. Jeder Besucher muss sich ein- und wieder austragen sowie eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. "Für Journalisten gilt das natürlich nicht", doch dürfen freiwillige Helfer nur in Anwesenheit des "Archivars im Dienst" befragt werden. Ein Security-Mitarbeiter weicht der Gruppe nicht von den Fersen.
Szenenwechsel. Der Unfallort am Waidmarkt, knapp sechs Wochen danach. Über der Stelle, wo bis zum 3. März das Archiv stand, und auf dem Straßenstück spannen sich, von einem Stahlgerüst getragen, zwei große Zeltdächer mit flachen Giebeln, um den Regen abzuhalten. In Nord-Süd-Richtung fällt das, was von dem Gebäude und seinem Inhalt übrig geblieben ist, von etwa vier Meter über dem Straßenniveau hinunter auf sechs Meter Tiefe: ein Steilhang aus Stahlbetonträgern, Zementbrocken, Ziegeln, Schutt, Erde, Sand, Rohren, Kabeln, Metallschränken, Kartons, Regalbrettern, Heizkörpern, Teppichresten und eben auch Archivalien in ganz unterschiedlichem Zustand. Archäologie der Gegenwart.
Nur Feuerwehrleute, zu ihrem eigenen Schutz angeseilt, falls der Geröllberg nachgeben sollte, dürfen Archivalien sichern. Je sechs bis acht von ihnen stehen an der obersten und untersten Stelle, wo Bagger die größten Brocken zerkleinern. Was sie mit den Händen herausholen können, legen sie in graue Pappkartons, die ihnen zugereicht werden. Diese werden beladen und nach oben getragen, wo Archivmitarbeiter sie in Empfang nehmen. Unter dem aufgeständerten Quertrakt des Friedrich- Wilhelm-Gymnasiums haben sie eine provisorische Aufnahme eingerichtet: Eine Untersuchung zur "Beförderung der Obstbauzucht" aus dem Jahr 1838 landet hier neben einer frühneuzeitlichen Urkunde, ein Leitzordner des Bundes der Vertriebenen neben Reichstagsprotokollen. Karton auf Karton wird gefüllt und auf Lastwagen gehoben, die täglich zehn, elf Ladungen ins Erstversorgungszentrum bringen.
Szenenwechsel. Was im Erstversorgungszentrum ankommt, tritt den mehr oder weniger langen Weg der Rekonvaleszenz an. Doch nicht alle Archivalien finden direkt hierher. Einzelne Stücke bleiben im Bauschutt hängen und sind zunächst so verborgen, dass sie in die Schuttsortierhalle geraten. Zwei Fußballfelder groß erstreckt sich in Grau und Braun eine Brache, auf der Materialien getrennt werden: Steine, Erde, Metall, Kunststoff, Holz werden zu Haufen geschichtet und von Archivresten befreit. Oft sind es nur einzelne Seiten, Ausschnitte, Kladden, Fotos, Fetzen, die mühsam herausgelöst werden. Staub hängt in der Luft, es riecht modrig. Die zehn, zwölf Menschen, die hier schuften, in der Mehrzahl Ein-Euro-Jobber, tragen Atemmasken und möchten nicht fotografiert werden - ein Wühlen in Trümmern und Dreck, bei dem sie wie Schatzsucher auf kleine Trouvaillen stoßen. "Nomina Discipulorum Gymnasii trium coronarum anno MDCXXXIII" heißt es auf dem Titelblatt eines kleinen Buchs, das in zierlicher Handschrift die Namen von Schülern des Dreiköniggymnasiums auflistet.
Zurück im Erstversorgungszentrum. "Warenausgabe" steht über den Laderampen der fensterlosen Halle: Wo Möbel gelagert wurden, wird nun Archivgut angeliefert. Ein Aufzug hebt die Kisten ins erste Obergeschoss, wo sie ausgepackt werden. Auf einer Teilfläche sind mehrere Tische aneinandergereiht, an denen bis zu dreißig Helfer stehen und zunächst alles, was nass geworden und akut von Schimmelfraß bedroht ist, aussortieren, in Stretchfolie hüllen und in Gitterboxen legen. Ein-, zweimal am Tag geht eine Fuhre nach Münster, wo sie in Kühlhäusern eingefroren und gefriergetrocknet werden: "Die Stretchfolie hat den Sinn, dass beim Auftauen einzelne Akten herausgenommen werden können. Ohne Folie müsste man den ganzen Block auf einmal auftauen, und solch große Gefriertrocknungsanlagen gibt es nicht", erklärt Max Plassmann, der als Schichtleiter im Erstversorgungszentrum arbeitet und bis zu fünfzig Freiwillige koordiniert. Die Helfer tragen weiße Overalls, Latex-Handschuhe und Mundschutz, der "Archivar im Dienst" ein rotes, der Restaurator ein grünes, die Mitarbeiter des Archivs blaue T-Shirts. Die meisten Dokumente haben keine oder so geringe Feuchtigkeitsschäden, dass sie am Ort getrocknet werden können. An der Wand sind, von Hand geschrieben, die Handlungsanweisungen angeschlagen: Der Oberflächenstaub wird abgefegt, die Dokumente werden in blaue Plastikwannen gelegt oder, wenn sie stärker zerstört sind, eingewickelt oder in Mappen gesteckt, numeriert und elektronisch erfasst.
"Wir schmeißen grundsätzlich nichts weg", versichert Plassmann, der zuvor das Universitätsarchiv Düsseldorf leitete und erst zwei Wochen vor dem Einsturz nach Köln gewechselt ist: "Die Frage ,Lohnt sich das überhaupt?' stellen wir nicht, das wäre in Ruhe zu überlegen, dafür haben wir keine Zeit." Nur beschädigte Kartonagen wandern in den Abfall. "Auch die Frage, was früher und was später restauriert wird, kann erst entschieden werden, wenn die erste Bergungsphase abgeschlossen ist, wir wirklich den Überblick haben und die Schadensbilder kennen: Erst dann können wir eine systematische Restaurierungsstrategie entfalten." Noch aber ist die Severinstraße nicht komplett abgegraben, bis Ende Mai dürften sich die Arbeiten dort hinziehen, und noch ist nicht bekannt, ob und wie viele Archivalien ins Grundwasser gerutscht sind.
Bis in die dritte Etage rattert der Lastenaufzug, zu einem neonbeleuchteten Raum - ein Ort weitläufiger Unwirtlichkeit, in dessen Tiefen sich Stahlregale und Gitterwagen reihen, Kartons stapeln oder nur dunkle Leere gähnt. Gleich neben dem Aufzug ist ein Zelt abgehängt, in dem ein halbes Dutzend Bautrockner rattern: Die Koletten, wie die fahrbaren Paletten heißen, sind mit Einlegebögen nachgerüstet, auf denen aufgeblätterte Bücher, deren Feuchtigkeitsschäden so gering sind, dass sie nicht in den Gefriertrockner müssen. Die Luft wird angesaugt und mit einer Feuchtigkeit von nur dreißig Prozent wieder ausgeblasen: So ist das Papier innerhalb von vierundzwanzig Stunden trocken, die Dokumente können herausgeschoben und weiterbearbeitet werden. Eine Akte des Metropolitan Water Board der City of London vom 3. April 1955, wahrscheinlich aus einem Nachlass, liegt hier neben Teilen der Sammlung Alfter, Zeitschriften, genealogischen Schriften und Katalogen.
Robert Fuchs, der an der Fachhochschule Köln das Institut für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft leitet, schaut immer wieder nach dem Fortgang der Arbeiten. "Im Moment", so schätzt er, "dürften die Kosten der Restaurierung den Wert der Materialien noch übersteigen." Doch derlei Überlegungen möchte er - "es gibt ja auch intrinsische Werte, die man nicht beziffern kann" - erst gar nicht vertiefen: "Der Restaurator denkt anders: Wenn ein Objekt um Hilfe schreit, nimmt er es sich als erstes vor; da ist es ganz egal, ob es sich um eine mittelalterliche Bibel oder eine Akte von 1945 handelt. Er sieht nur: Wenn ich warte, geht das kaputt." Abwägungsfragen dazu, was als Nächstes und womöglich zu wessen Lasten wiederhergestellt werden soll, müssen in den nächsten Jahren vieltausendmal beantwortet werden: Zu entscheiden sind sie von Archivaren und Restauratoren gemeinsam, und für Max Plassmann könnte es "ein Anknüpfungspunkt der Katastrophe sein, dass eine engere Verzahnung beider Bereiche stattfindet".
[...]
Der Weg der Archivalien durch das Erstversorgungszentrum endet in der Packstation, wo sie aus den blauen Plastikwannen geholt, noch einmal auf Feuchtigkeit überprüft und, sofern möglich, zu Einheiten zusammengestellt werden. Nur ganz wertvolle Schätze, Handschriften aus der Sammlung Wallraf, Schreinsbücher oder Pergamenturkunden, bleiben in Köln und werden dem Archiv des Erzbistums anvertraut. Alles andere wird in Kartons der richtigen Größe gepackt, die numeriert, im Computer erfasst, auf Paletten gesetzt, zum Transport freigegeben und in Archive gebracht werden, die freie Magazine zur Zwischenlagerung angeboten haben: ins Bundesarchiv nach Koblenz und St. Augustin, zur Friedrich-Ebert-Stiftung nach Bonn, ins Archivamt nach Brauweiler, in die Landesarchive in Münster und Detmold, aber auch weiter weg, bis nach Freiburg und Potsdam.
Wann was zurückkehrt und restauriert wird, wann die Bestände wieder unter einem gemeinsamen Dach sein werden und für den Bürger zugänglich sind, weiß niemand. Der Einsturz hat die Bestände durcheinandergequirlt und jede Ordnung aufgehoben. "Seriös kann noch niemand sagen, dass dieser oder jener Bestand komplett erhalten ist, bisher sind es nur einzelne Stücke oder Teile, aber wir freuen uns über jedes Exemplar, das auftaucht." So erteilt Max Plassmann voreiligen Rettungsmeldungen eine Absage. Zwanzig, womöglich dreißig Jahre, schätzt er, wird es dauern, bis das Archiv, auch wenn es viele Verluste hinnehmen musste, wieder so weit wiederhergestellt ist, dass es an die Zeit vor dem Einsturz anknüpfen kann. Erst dann wird der Kopf wieder auf dem Körper sitzen.
Text: http://tinyurl.com/c3qcgg
KlausGraf - am Montag, 13. April 2009, 19:12 - Rubrik: Kommunalarchive
http://www.justiz.sachsen.de/ovgentsch/documents/2B386_07.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Corps_Lusatia_Leipzig
Ich halte das für ein Fehlurteil. Die hier gutgeheißene Diskrimierung von Studentenverbindungen gegenüber anderen studentischen Vereinigungen begegnet nicht nur rechtlichen Bedenken.
UPDATE: Zum Setzen von Links im Hochschulbereich siehe auch das Urteil
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_minden/j2008/2_K_1834_07urteil20080828.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Corps_Lusatia_Leipzig
Ich halte das für ein Fehlurteil. Die hier gutgeheißene Diskrimierung von Studentenverbindungen gegenüber anderen studentischen Vereinigungen begegnet nicht nur rechtlichen Bedenken.
UPDATE: Zum Setzen von Links im Hochschulbereich siehe auch das Urteil
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_minden/j2008/2_K_1834_07urteil20080828.html
KlausGraf - am Montag, 13. April 2009, 17:08 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... In dem Berg befindet sich einer der sichersten Orte der Vereinigten Staaten: Der "Underground", betrieben von dem Datensicherungs-Unternehmen "Iron Mountain", ist ein aufgelassenes Kalkbergwerk, in dem die amerikanische Regierung, vor allem aber große amerikanische und internationale Firmen ihre wichtigsten Dokumente vor Diebstahl, Feuer, Naturkatastrophen und Krieg schützen. .....Gründer war ein gewisser Herman Knaust, der in einem ehemaligen Bergwerk im Bundesstaat New York viele Jahre Pilze züchtete und deshalb von seinen Nachbarn "Pilz-König" genannt wurde. Als das Geschäft nach dem Zweiten Weltkrieg schlechter lief, gab er 1951 die Pilzproduktion auf, nannte sein Pilz-Bergwerk in "Iron Mountain" ("Eiserner Berg") um und gründete eine Firma, die sich der atomsicheren Verwahrung von Dokumenten widmete.
Knaust schaffte es, den Kriegshelden General Douglas MacArthur zum Besuch seines Bunkers zu bewegen, und nutzte den damit verbundenen Rummel, um sein Geschäft weiter auszubauen. Erster Kunde Knausts war eine Bank, die Mikrofilme mit Kundendaten bei ihm lagerte. Heute ist Iron Mountain ein börsennotiertes Unternehmen mit 2,7 Milliarden Dollar Umsatz, 20.000 Mitarbeitern in 37 Ländern, darunter auch Deutschland. .....
"
Quelle:
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/253/464848/text/
Knaust schaffte es, den Kriegshelden General Douglas MacArthur zum Besuch seines Bunkers zu bewegen, und nutzte den damit verbundenen Rummel, um sein Geschäft weiter auszubauen. Erster Kunde Knausts war eine Bank, die Mikrofilme mit Kundendaten bei ihm lagerte. Heute ist Iron Mountain ein börsennotiertes Unternehmen mit 2,7 Milliarden Dollar Umsatz, 20.000 Mitarbeitern in 37 Ländern, darunter auch Deutschland. .....
"
Quelle:
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/253/464848/text/
Wolf Thomas - am Montag, 13. April 2009, 15:34 - Rubrik: Bestandserhaltung
http://news.cnet.com/8301-13578_3-10216485-38.html
See also:
http://editorialconsultant.wordpress.com/
See also:
http://editorialconsultant.wordpress.com/
KlausGraf - am Montag, 13. April 2009, 15:03 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In der Samstagausgabe der NZZ v. 11.4.09 schreibt Roman Bucheli über archivische Herausforderungen.
"Archive im Allgemeinen und Literaturarchive im Besonderen sind nicht nur gewaltige Erinnerungsmaschinen sowie auf Vorrat und in Unkenntnis von zukünftigen Erkenntnisinteressen angelegte Gedächtnisspeicher. Sie sind regelrechte Abfallvermeider und Müllverwerter."
"Die Kehrseite der verfeinerten Kultur der Aufbewahrung ist die Tabuisierung des Abfalls. Wo kein Fitzelchen der archivalischen Achtsamkeit entgeht, wird die Erinnerung dereinst am überlieferten Material ersticken."
Gefunden bei
http://jhagmann.twoday.net/stories/5640041/
"Archive im Allgemeinen und Literaturarchive im Besonderen sind nicht nur gewaltige Erinnerungsmaschinen sowie auf Vorrat und in Unkenntnis von zukünftigen Erkenntnisinteressen angelegte Gedächtnisspeicher. Sie sind regelrechte Abfallvermeider und Müllverwerter."
"Die Kehrseite der verfeinerten Kultur der Aufbewahrung ist die Tabuisierung des Abfalls. Wo kein Fitzelchen der archivalischen Achtsamkeit entgeht, wird die Erinnerung dereinst am überlieferten Material ersticken."
Gefunden bei
http://jhagmann.twoday.net/stories/5640041/
KlausGraf - am Montag, 13. April 2009, 14:23 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.zisska.de/kataloge/kat53/1/20.html
ABTEILUNGEN / HANDSCHRIFTEN
Nummer: 20
Autor/Titel: "HAGENBACH'S TOD.
(Mitgetheilt von Herrn Stahl in Paris). De anno 1477, Mentel. Arg."
Deutsche Handschrift auf Papier. (Straßburg? um 1830). 15 Bl. Pp. d.
Zt. (leicht berieben und bestoßen). (56)
Schätzpreis: 150,00 €
Beschreibung: Abschrift einer deutschen Versdichtung über den Tod des
elsässischen Adeligen und burgundischen Landvogts am Oberrhein, Peter
von Hagenbach, der 1474 in Breisach hingerichtet worden ist. Der
Abschreiber, ein Herr Stahl in Paris, hat das Gedicht offenbar aus
einem 1477 erschienenen Wiegendruck des Straßburger Verlegers Mentelin
übertragen, wahrscheinlich für den Straßburger Philologen und
Historiker Adam Walther Strobel (1792-1850, Holzstich-Exlibris
"Strobel" unterhalb einer Ansicht des Straßburger Münsters auf dem
vorderen Spiegel). Strobel, der sich zeitlebens der Erforschung von
Literatur und Geschichte des Elsasses widmete (siehe ADB XXXVII, 334),
hat Notizen und Kommentare hinzugefügt. Beide Handschriften lassen
sich deutlich unterscheiden. - Gering gebräunt.
Ich sandte dem Auktionshaus folgende Mail:
"Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte bestätigen Sie, dass es sich um eine Abschrift des Werks von
Konrad Pfettisheim handelt:
http://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege#Konrad_Pfettisheim
Der Text ist am bequemsten mit
http://de.wikisource.org/wiki/Reimchronik_über_die_Burgunderkriege_(Pfettisheim)
zu vergleichen.
Ich wäre Ihnen für einen lesbaren Scan einer der Seiten, auf der sich
(möglichst viele) Bemerkungen Strobels befinden, dankbar."
Bekommen habe ich weder den Scan noch die erbetene Bestätigung (und auch kein Dankeschön für die Identifizierung), sondern nur ein allgemeines Lamento:
wenn wir die gewünschte "Bestätigung" hätten liefern können, hätten wir das auch getan. So aber haben wir uns auf die Wörter "offenbar" und "wahrscheinlich" beschränkt. Und wenn Sie sich kurz überlegen, wieviel Aufgeld der Kunde für eine von Ihnen geforderte wissenschaftliche Handschriftenbeschreibung bei einem Schätzpreis von 150,- Euro bezahlt, dann könnte das zu der Erklärung dafür führen, daß es dem Antiquariatsbuchhandel in Deutschland zur Zeit nicht recht gut geht.
Update: Das Stück wurde vom Stadtarchiv Breisach erworben.
ABTEILUNGEN / HANDSCHRIFTEN
Nummer: 20
Autor/Titel: "HAGENBACH'S TOD.
(Mitgetheilt von Herrn Stahl in Paris). De anno 1477, Mentel. Arg."
Deutsche Handschrift auf Papier. (Straßburg? um 1830). 15 Bl. Pp. d.
Zt. (leicht berieben und bestoßen). (56)
Schätzpreis: 150,00 €
Beschreibung: Abschrift einer deutschen Versdichtung über den Tod des
elsässischen Adeligen und burgundischen Landvogts am Oberrhein, Peter
von Hagenbach, der 1474 in Breisach hingerichtet worden ist. Der
Abschreiber, ein Herr Stahl in Paris, hat das Gedicht offenbar aus
einem 1477 erschienenen Wiegendruck des Straßburger Verlegers Mentelin
übertragen, wahrscheinlich für den Straßburger Philologen und
Historiker Adam Walther Strobel (1792-1850, Holzstich-Exlibris
"Strobel" unterhalb einer Ansicht des Straßburger Münsters auf dem
vorderen Spiegel). Strobel, der sich zeitlebens der Erforschung von
Literatur und Geschichte des Elsasses widmete (siehe ADB XXXVII, 334),
hat Notizen und Kommentare hinzugefügt. Beide Handschriften lassen
sich deutlich unterscheiden. - Gering gebräunt.
Ich sandte dem Auktionshaus folgende Mail:
"Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte bestätigen Sie, dass es sich um eine Abschrift des Werks von
Konrad Pfettisheim handelt:
http://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege#Konrad_Pfettisheim
Der Text ist am bequemsten mit
http://de.wikisource.org/wiki/Reimchronik_über_die_Burgunderkriege_(Pfettisheim)
zu vergleichen.
Ich wäre Ihnen für einen lesbaren Scan einer der Seiten, auf der sich
(möglichst viele) Bemerkungen Strobels befinden, dankbar."
Bekommen habe ich weder den Scan noch die erbetene Bestätigung (und auch kein Dankeschön für die Identifizierung), sondern nur ein allgemeines Lamento:
wenn wir die gewünschte "Bestätigung" hätten liefern können, hätten wir das auch getan. So aber haben wir uns auf die Wörter "offenbar" und "wahrscheinlich" beschränkt. Und wenn Sie sich kurz überlegen, wieviel Aufgeld der Kunde für eine von Ihnen geforderte wissenschaftliche Handschriftenbeschreibung bei einem Schätzpreis von 150,- Euro bezahlt, dann könnte das zu der Erklärung dafür führen, daß es dem Antiquariatsbuchhandel in Deutschland zur Zeit nicht recht gut geht.
Update: Das Stück wurde vom Stadtarchiv Breisach erworben.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen



