http://www.universitaetsarchiv.uni-muenchen.de/georgianum/findmittel_online/urkundenregesten/regesten/index.html
Archiv des Herzoglichen Georgianums
AHG, I 8 (60/148)
1509 April 23
Johann Plümel, Prof. theol., Dietrich Reysach, Prof. jur. utr. an der Universität I., beide Dres., und Georg Swäbermair, Bac. theol., Kollegiat der genannten Universität, stiften als die bestellten gescheftiger (Testamentsvollstrecker) des Georg Zingel von Schlierstat, Dr. theol., Domherr zu Eichstätt, Vizekanzler und Professor an der genannten Universität, in das von Georg, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Nieder- und Oberbayern, gegründete Collegium der Studenten zwei Pfründen für Studenten und Kollegiaten aus der gesipten fruntschaft und Nachkommen des Georg Zingel, welche durch die sechs älteren Schöffen zu Schlierstat und durch den Bgm samt sechs Älteren des Rates zu Bucham (Buchain?) präsentiert werden sollen. Wenn aus dem Geschlecht des Stifters kein Geschickter gefunden würde, sollen zwei andere Ottenwalder, die Stud., Bak. oder MA sind, gewählt werden. Die beiden Pfründen erhalten folgende Dotation. 1. An Zinsen und Gülten: 6 lb. d Gült von Johann Wagner zu Küwbach, 3 f und 1 lb. d von Johann Zwelfer zu Schrobenried, 4 f rh von Andreas Rebel zu Möring, 1 f rh von Johann Erdinger, Schuster ebendort, 1 Schaff Korn von Johann Prawn zu Oberntolling, 1 Sack Korn und 1 Sack Hafer von Leonhard Schuttenhelm zu Einling, 3 f rh von Bertold Örtel, Fischer zu Gerlfingen, 1 Viertel Korn von Andreas Holderbach ebendort, 4 f rh von einer von Apollonia Schedlin zu Newburg erkauften Wiese, 5 f vom Rate zu I., 10 f von Georg Schober erkauft aus des Recken von Rain Hof zu Iichesham und einer Hube bei Rain, 6 f von Leonhard Strasser zu Öchselshausen, 2 f von Martin Schmid zu Möring, 4 f wenigstens von der Hube zu Rinperg im Gericht Rörbach erkauft von Johann Burger, B zu I. 2. Verschiedene Hausgeräte (Betten, Tische u.s.w.). 3. Folgende Bücher: der text sentenciarum mit dem comment Bonaventure in zwaien buchern sambt ainem register. Die wibel in grosser form. Gwilhelmum Ockam super primo sentenciarum. Plinium in naturlichen geschichten. All opera Platonis. Cornucopiam. Opera Senece. Tragedie Seneca. Quintilianum. Oraciones Ciceronis. Opera Enee Silvii. Margeritam poeticam. Epistolas Philelphi cum dialogo Luciani. Opera Baptiste Mantuani. Oraciones Philippi Beroaldi. Oracionem Hermolai Barbari ad Fridericum tercium. Ethicam Geraldi Odonis. Theologiam naturalem. Jo. [!] Sumerhart de decimis. Politicam et economiam Versoris. Vocabularium breviloquum. Vocabularium "Ex quo" predicancium et poetarum. Poetriam Foracii [!]. Zway guter betbücher sambt vil andern clainen buchlin scolasticalia, eingebunden und uneingebunden. Ferner wird ein Jahrtag in dem Collegium gestiftet, der in den achttagen der hailigen Osterfeirn zu halten ist mit 1 f ewige Gült als Präsenz aus Dettenrieders Haus zu Burckham, das jetzt Georg Frölich besitzt, und endlich wird zur Erhaltung des obigen Hausrates 1 f Ewiggeld von der Wiese zu Burckham bestimmt.
S: die drei Aussteller
Geschehen an sant Georgen des hailigen martrers tage
Originalpergament, 3 anhängende Siegel, das letzte in einer Holzkapsel
Update: http://archiv.twoday.net/stories/55768757/
Archiv des Herzoglichen Georgianums
AHG, I 8 (60/148)
1509 April 23
Johann Plümel, Prof. theol., Dietrich Reysach, Prof. jur. utr. an der Universität I., beide Dres., und Georg Swäbermair, Bac. theol., Kollegiat der genannten Universität, stiften als die bestellten gescheftiger (Testamentsvollstrecker) des Georg Zingel von Schlierstat, Dr. theol., Domherr zu Eichstätt, Vizekanzler und Professor an der genannten Universität, in das von Georg, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Nieder- und Oberbayern, gegründete Collegium der Studenten zwei Pfründen für Studenten und Kollegiaten aus der gesipten fruntschaft und Nachkommen des Georg Zingel, welche durch die sechs älteren Schöffen zu Schlierstat und durch den Bgm samt sechs Älteren des Rates zu Bucham (Buchain?) präsentiert werden sollen. Wenn aus dem Geschlecht des Stifters kein Geschickter gefunden würde, sollen zwei andere Ottenwalder, die Stud., Bak. oder MA sind, gewählt werden. Die beiden Pfründen erhalten folgende Dotation. 1. An Zinsen und Gülten: 6 lb. d Gült von Johann Wagner zu Küwbach, 3 f und 1 lb. d von Johann Zwelfer zu Schrobenried, 4 f rh von Andreas Rebel zu Möring, 1 f rh von Johann Erdinger, Schuster ebendort, 1 Schaff Korn von Johann Prawn zu Oberntolling, 1 Sack Korn und 1 Sack Hafer von Leonhard Schuttenhelm zu Einling, 3 f rh von Bertold Örtel, Fischer zu Gerlfingen, 1 Viertel Korn von Andreas Holderbach ebendort, 4 f rh von einer von Apollonia Schedlin zu Newburg erkauften Wiese, 5 f vom Rate zu I., 10 f von Georg Schober erkauft aus des Recken von Rain Hof zu Iichesham und einer Hube bei Rain, 6 f von Leonhard Strasser zu Öchselshausen, 2 f von Martin Schmid zu Möring, 4 f wenigstens von der Hube zu Rinperg im Gericht Rörbach erkauft von Johann Burger, B zu I. 2. Verschiedene Hausgeräte (Betten, Tische u.s.w.). 3. Folgende Bücher: der text sentenciarum mit dem comment Bonaventure in zwaien buchern sambt ainem register. Die wibel in grosser form. Gwilhelmum Ockam super primo sentenciarum. Plinium in naturlichen geschichten. All opera Platonis. Cornucopiam. Opera Senece. Tragedie Seneca. Quintilianum. Oraciones Ciceronis. Opera Enee Silvii. Margeritam poeticam. Epistolas Philelphi cum dialogo Luciani. Opera Baptiste Mantuani. Oraciones Philippi Beroaldi. Oracionem Hermolai Barbari ad Fridericum tercium. Ethicam Geraldi Odonis. Theologiam naturalem. Jo. [!] Sumerhart de decimis. Politicam et economiam Versoris. Vocabularium breviloquum. Vocabularium "Ex quo" predicancium et poetarum. Poetriam Foracii [!]. Zway guter betbücher sambt vil andern clainen buchlin scolasticalia, eingebunden und uneingebunden. Ferner wird ein Jahrtag in dem Collegium gestiftet, der in den achttagen der hailigen Osterfeirn zu halten ist mit 1 f ewige Gült als Präsenz aus Dettenrieders Haus zu Burckham, das jetzt Georg Frölich besitzt, und endlich wird zur Erhaltung des obigen Hausrates 1 f Ewiggeld von der Wiese zu Burckham bestimmt.
S: die drei Aussteller
Geschehen an sant Georgen des hailigen martrers tage
Originalpergament, 3 anhängende Siegel, das letzte in einer Holzkapsel
Update: http://archiv.twoday.net/stories/55768757/
KlausGraf - am Freitag, 14. August 2009, 21:50 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 14. August 2009, 21:44 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/sml/index.cgi?sml=21
Die Inkunabelsammlung der ULB umfasst mehr als 2000 Bände, von denen etwa die Hälfte in einem DFG-geförderten Projekt digitalisiert wird. Die Inkunabeln entstammen zum Teil der historischen Sammlung der Darmstädter Landgrafen in der Hofbibliothek, den größten Teil verdankt die Bibliothek jedoch dem Vermächtnis des Baron von Hüpsch, der seine Sammlung 1805 dem Landgrafen Ludwig X. schenkte. Die Auswahlkriterien für das Digitalisierungsprojekt waren vollständige Titel und deutsche Druckorte.
Natürlich nur echt mit Copyfraud.

Die Inkunabelsammlung der ULB umfasst mehr als 2000 Bände, von denen etwa die Hälfte in einem DFG-geförderten Projekt digitalisiert wird. Die Inkunabeln entstammen zum Teil der historischen Sammlung der Darmstädter Landgrafen in der Hofbibliothek, den größten Teil verdankt die Bibliothek jedoch dem Vermächtnis des Baron von Hüpsch, der seine Sammlung 1805 dem Landgrafen Ludwig X. schenkte. Die Auswahlkriterien für das Digitalisierungsprojekt waren vollständige Titel und deutsche Druckorte.
Natürlich nur echt mit Copyfraud.

KlausGraf - am Freitag, 14. August 2009, 21:36 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 14. August 2009, 16:15 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
aus der Ausstellungsrezension in der Süddeutschen Zeitung:
"Eine Schau in Braunschweig scheitert an dem Versuch, die Zeit von Otto IV. zu erklären, dem einzigen Welfen unter den mittelalterlichen Kaisern. [...]
An Otto IV. könnte man also viel zeigen. Doch das haben die Verantwortlichen in Braunschweig verpasst. In nur zwei Jahren, so gaben sie bekannt, ist die Ausstellung entstanden, die Folgen dieser Hast sieht man an allen Ecken und Enden. [...]
Zwei Jahre ist zu wenig Zeit, um Ausleihen hohen Rangs zu ermöglichen.
Es fehlen der Ausstellung aber nicht nur Exponate, die das Niveau der Zeit in der wünschenswerten Dichte zeigen könnten. Es fehlt ihr auch ein Konzept. [...]
Die Ausstellung schweigt, und auch der Katalog gibt wenig her. Neben einzelnem Guten findet man Beiträge auf dem Niveau von Kolpingsvorträgen. Im Ganzen wird er weder die Forschung voranbringen noch dem interessierten Laien einen Überblick geben. Auch der Katalog musste in zwei Jahren zusammengerührt werden. Selten hat man kulturpolitische Projektemacherei so scheitern sehen. STEPHAN SPEICHER"
http://www.sueddeutsche.de/I5v38c/3000708/Die-Ge-walt-auf-der-Strasse-und-im-Reich.html
 [Bild ergänzt KG]
[Bild ergänzt KG]
"Eine Schau in Braunschweig scheitert an dem Versuch, die Zeit von Otto IV. zu erklären, dem einzigen Welfen unter den mittelalterlichen Kaisern. [...]
An Otto IV. könnte man also viel zeigen. Doch das haben die Verantwortlichen in Braunschweig verpasst. In nur zwei Jahren, so gaben sie bekannt, ist die Ausstellung entstanden, die Folgen dieser Hast sieht man an allen Ecken und Enden. [...]
Zwei Jahre ist zu wenig Zeit, um Ausleihen hohen Rangs zu ermöglichen.
Es fehlen der Ausstellung aber nicht nur Exponate, die das Niveau der Zeit in der wünschenswerten Dichte zeigen könnten. Es fehlt ihr auch ein Konzept. [...]
Die Ausstellung schweigt, und auch der Katalog gibt wenig her. Neben einzelnem Guten findet man Beiträge auf dem Niveau von Kolpingsvorträgen. Im Ganzen wird er weder die Forschung voranbringen noch dem interessierten Laien einen Überblick geben. Auch der Katalog musste in zwei Jahren zusammengerührt werden. Selten hat man kulturpolitische Projektemacherei so scheitern sehen. STEPHAN SPEICHER"
http://www.sueddeutsche.de/I5v38c/3000708/Die-Ge-walt-auf-der-Strasse-und-im-Reich.html
 [Bild ergänzt KG]
[Bild ergänzt KG]Hermann Grote - am Freitag, 14. August 2009, 11:24 - Rubrik: Landesgeschichte
Das Bürgerbegehren zugunsten des Erhalts der alten Hauptpost ist an 114 fehlenden Unterschriften gescheitert, meldet - ohne Datumsangabe - die Schwäbische Heimat 2009/1, S. 111.
Zur Argumentation der Bürgerinitiative Alte Hauptpost siehe
http://www.schwäbisch-gmünd.net/img/Postgeb%e4ude.pdf
Zum Hintergrund:
http://www.schwäbisch-gmünd.net/landesgartenschau.html
und weitere Beiträge dieses Internetangebots.
Auf Youtube dokumentiert ein Video das Gebäude und seine Umgebung:
http://www.youtube.com/watch?v=gWeGYY759c0
(Einbetten deaktiviert)

http://www.panoramio.com/photo/14615773
Zur Argumentation der Bürgerinitiative Alte Hauptpost siehe
http://www.schwäbisch-gmünd.net/img/Postgeb%e4ude.pdf
Zum Hintergrund:
http://www.schwäbisch-gmünd.net/landesgartenschau.html
und weitere Beiträge dieses Internetangebots.
Auf Youtube dokumentiert ein Video das Gebäude und seine Umgebung:
http://www.youtube.com/watch?v=gWeGYY759c0
(Einbetten deaktiviert)

http://www.panoramio.com/photo/14615773
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/5873713/
Udo Vetter leitet die Zulässigkeit der Plakat-Remix-Aktion aus der Einwilligung seitens der CDU in eine redaktionelle Verwendung ab:
http://www.lawblog.de/index.php/archives/2009/08/12/schnell-zuruckpfeifen/
Wie weit diese im vorliegenden Fall jedenfalls gehen, lässt sich auf der Homepage der CDU nachlesen, wo es auch die Plakate zum Download gibt:
Alle Bilder auf www.bilder.cdu.de können für redaktionelle Zwecke unter Angabe des Bildnachweises (Foto: www.bilder.cdu.de) sowie des Fotografen (soweit genannt) kostenlos verwendet werden.
Die CDU räumt also das Recht ein, sämtliches Material für redaktionelle Zwecke zu verwenden. Wir müssen die Frage nicht beantworten, ob die Einschränkung auf redaktionelle Zwecke zulässig ist. Denn netzpolitik.org ist mittlerweile eine wichtige, viel beachtete und seriös geführte Online-Publikation.
Längst ist auch geklärt, dass derjenige, der Pressematerial zur Verfügung stellt, keine Einschränkungen zur inhaltlichen Verwendung machen kann. Nach dem Motto: Sie dürfen das Material nur nutzen, wenn positiv berichtet wird oder keine Veränderungen vorgenommen werden. Das ist mit der Presse- und Meinungsfreiheit nicht vereinbar.
Gern wüsste ich, wo das geklärt ist.
Gefunden habe ich ein völlig lebensfremdes Urteil des - na was wohl - Landgerichts Hamburg, das bei einer einfachen Pressemitteilung einer Anwaltskanzlei fehlerhaft die Schöpfungshöhe bejahte und einem anderen Anwalt die verwertung ohne Quellenangabe verbot:
http://www.damm-mann.de/assets/doc20070425111946.pdf
Wozu bitteschön gibt man Pressemitteilungen heraus, wenn man nicht möchte, dass diese möglichst vollständig und unverändert abgedruckt oder anderweitig veröffentlicht werden?
Die betreffende PM ist heute noch auf
OpenPR abrufbar.
Es ist absolut branchenüblich, dass Presseorgane sich nicht die Mühe machen, PMs so umzuformulieren, dass eine freie Bearbeitung (§ 24 UrhG) entsteht. PMs werden üblicherweise gekürzt bzw. etwas bearbeitet, wobei nicht selten eine Quellenangabe unterbleibt.
Wer eine Pressemitteilung verbreitet, willigt ein, dass sie ohne urheberrechtliche Einrede verbreitet werden darf. Das LG Hamburg hat Unrecht.
Längst ist auch geklärt, dass derjenige, der Pressematerial zur Verfügung stellt, keine Einschränkungen zur inhaltlichen Verwendung machen kann.
Je länger ich darüber nachdenke, um so weniger geklärt scheint mir das.
Aus urheberrechtlicher Sicht darf der Urheber bis an die Grenze des Rechtsmissbräuchlichen seine Position ausnutzen. Presseorgane müssen sich daran halten, sofern wirksame AGB/freie Lizenzen vorliegen und keine Schranke des UrhG in Betracht kommt.
Bilder zur redaktionellen Nutzung sind beispielsweise eine Teilmenge der von
http://www.buss-art.de/page.php?page_id=89
vertriebenen Bilder. Der Kunde dieser Bildagentur darf generell bei allen Bildern nicht:
"die lizenzierten Bilder in pornographischer, diffamierender oder gesetzeswidriger Weise [...] verwenden"
Es liegt auf der Hand, dass völlig unbestimmt ist, was ein Gericht bei Auslegung dieser Klausel (ob sie überhaupt wirksam ist, steht dahin) als "diffamierend" betrachten würde.
Übrigens kann sich die Verwendung zu redaktionellen Zwecken nicht auf die Flickr-Präsentation der zweckentfremdeten Fotos beziehen, sondern nur auf das Blog Netzpolitik, das in der Tat redaktionelle Berichterstattung und Meinungsbildung bietet.
Fazit: Entgegen den Angaben von Vetter ist durchaus unklar, womit ein Rechteinhaber urheberrechtlich geschützter Werke einverstanden sein muss, wenn es um ihre vergütungsfreie Nutzung geht.
http://archiv.twoday.net/stories/5873713/
Udo Vetter leitet die Zulässigkeit der Plakat-Remix-Aktion aus der Einwilligung seitens der CDU in eine redaktionelle Verwendung ab:
http://www.lawblog.de/index.php/archives/2009/08/12/schnell-zuruckpfeifen/
Wie weit diese im vorliegenden Fall jedenfalls gehen, lässt sich auf der Homepage der CDU nachlesen, wo es auch die Plakate zum Download gibt:
Alle Bilder auf www.bilder.cdu.de können für redaktionelle Zwecke unter Angabe des Bildnachweises (Foto: www.bilder.cdu.de) sowie des Fotografen (soweit genannt) kostenlos verwendet werden.
Die CDU räumt also das Recht ein, sämtliches Material für redaktionelle Zwecke zu verwenden. Wir müssen die Frage nicht beantworten, ob die Einschränkung auf redaktionelle Zwecke zulässig ist. Denn netzpolitik.org ist mittlerweile eine wichtige, viel beachtete und seriös geführte Online-Publikation.
Längst ist auch geklärt, dass derjenige, der Pressematerial zur Verfügung stellt, keine Einschränkungen zur inhaltlichen Verwendung machen kann. Nach dem Motto: Sie dürfen das Material nur nutzen, wenn positiv berichtet wird oder keine Veränderungen vorgenommen werden. Das ist mit der Presse- und Meinungsfreiheit nicht vereinbar.
Gern wüsste ich, wo das geklärt ist.
Gefunden habe ich ein völlig lebensfremdes Urteil des - na was wohl - Landgerichts Hamburg, das bei einer einfachen Pressemitteilung einer Anwaltskanzlei fehlerhaft die Schöpfungshöhe bejahte und einem anderen Anwalt die verwertung ohne Quellenangabe verbot:
http://www.damm-mann.de/assets/doc20070425111946.pdf
Wozu bitteschön gibt man Pressemitteilungen heraus, wenn man nicht möchte, dass diese möglichst vollständig und unverändert abgedruckt oder anderweitig veröffentlicht werden?
Die betreffende PM ist heute noch auf
OpenPR abrufbar.
Es ist absolut branchenüblich, dass Presseorgane sich nicht die Mühe machen, PMs so umzuformulieren, dass eine freie Bearbeitung (§ 24 UrhG) entsteht. PMs werden üblicherweise gekürzt bzw. etwas bearbeitet, wobei nicht selten eine Quellenangabe unterbleibt.
Wer eine Pressemitteilung verbreitet, willigt ein, dass sie ohne urheberrechtliche Einrede verbreitet werden darf. Das LG Hamburg hat Unrecht.
Längst ist auch geklärt, dass derjenige, der Pressematerial zur Verfügung stellt, keine Einschränkungen zur inhaltlichen Verwendung machen kann.
Je länger ich darüber nachdenke, um so weniger geklärt scheint mir das.
Aus urheberrechtlicher Sicht darf der Urheber bis an die Grenze des Rechtsmissbräuchlichen seine Position ausnutzen. Presseorgane müssen sich daran halten, sofern wirksame AGB/freie Lizenzen vorliegen und keine Schranke des UrhG in Betracht kommt.
Bilder zur redaktionellen Nutzung sind beispielsweise eine Teilmenge der von
http://www.buss-art.de/page.php?page_id=89
vertriebenen Bilder. Der Kunde dieser Bildagentur darf generell bei allen Bildern nicht:
"die lizenzierten Bilder in pornographischer, diffamierender oder gesetzeswidriger Weise [...] verwenden"
Es liegt auf der Hand, dass völlig unbestimmt ist, was ein Gericht bei Auslegung dieser Klausel (ob sie überhaupt wirksam ist, steht dahin) als "diffamierend" betrachten würde.
Übrigens kann sich die Verwendung zu redaktionellen Zwecken nicht auf die Flickr-Präsentation der zweckentfremdeten Fotos beziehen, sondern nur auf das Blog Netzpolitik, das in der Tat redaktionelle Berichterstattung und Meinungsbildung bietet.
Fazit: Entgegen den Angaben von Vetter ist durchaus unklar, womit ein Rechteinhaber urheberrechtlich geschützter Werke einverstanden sein muss, wenn es um ihre vergütungsfreie Nutzung geht.
KlausGraf - am Mittwoch, 12. August 2009, 19:10 - Rubrik: Archivrecht
http://www.presserecht-aktuell.de/?p=876
Die im Detail nicht immer korrekte (z.B. Urheberrechtsschutz des CDU-Logos) Darstellung widmet sich der Beschwerde der Fotografin des Schäuble-Porträts, zu dessen Remix das Blog Netzpolitik aufgerufen hatte.
Abgelehnt wird eine freie Benutzung (§ 24 UrhG) und stattdessen auf das Zitatrecht Bezug genommen, obwohl die Verwendung mit der bisherigen Auslegung dieser Urheberrechtsschranke nicht in Einklang steht:
"Selbstständig ist das zitierende Werk gegenüber dem zitierten Werk, wenn es für sich genommen eine schöpferische Leistung darstellt. Diese Selbstständigkeit fehlt, wenn das Zitat dergestalt im
Mittelpunkt des zitierenden Werkes steht, dass Letzteres ohne das
Zitat kein für sich existenzfähiges Werk mehr darstellen würde" (Bisges: Grenzen des Zitatrechts im Internet, GRUR 2009, 730 ff., hier 731).
Die hinzugefügten Slogans haben in der Regel keine eigene Schöpfungshöhe, das Foto wird also nicht in einem eigenständigen Werk zitiert.
Hinzu kommt, dass ein Zitat nur unverändert zulässig ist: "Gem. § 62 I UrhG dürfen Änderungen an dem zitierten Werk nicht
vorgenommen werden. Ausnahmen von diesem Grundsatz stellen nur die Übersetzung (§ 62 II UrhG) und die größen- bzw. technikbedingten Änderungen (§ 62 III UrhG) sowie nach den Grundsätzen von Treu und Glauben zulässige Änderungen (§ 63 I 2 i.V. mit § 39 II UrhG) dar." (Bisges 733).
Weder stellen die satirisch abgewandelten Plakate freie Bearbeitungen nach gängiger Lehre ("Verblassen" der Vorlage) noch zulässige Zitate dar.
Darf man das Urheberrecht so zurechtbiegen, dass ein politisch wünschenswertes Ergebnis - die im Interesse der Meinungsfreiheit zulässige Nutzung - zustandekommt? Wenn man von der herrschenden Dogmatik abweicht, die darauf verweist, dass die Schranken des UrhG abschließend sind, fällt es nicht schwer, das Urheberrecht im Licht des Grundrechts der Meinungsfreiheit zu interpretieren und - obwohl keine Schranke so richtig passt - aufgrund der überragenden Bedeutung der politischen Auseinandersetzung in Wahlkampfzeiten den Remix und seine öffentliche Präsentation für erlaubt zu halten.
Auf die Meinungsfreiheit kann übertragen werden, was das Bundesverfassungsgericht zur Kunstfreiheit schrieb:
Dabei ist grundlegend zu beachten, dass mit der Veröffentlichung ein Werk nicht mehr allein seinem Inhaber zur Verfügung steht. Vielmehr tritt es bestimmungsgemäß in den gesellschaftlichen Raum und kann damit zu einem eigenständigen, das kulturelle und geistige Bild der Zeit mitbestimmenden Faktor werden. Es löst sich mit der Zeit von der privatrechtlichen Verfügbarkeit und wird geistiges und kulturelles Allgemeingut (BVerfGE 79, 29 <42>). Dies ist einerseits die innere Rechtfertigung für die zeitliche Begrenzung des Urheberschutzes, andererseits führt dieser Umstand auch dazu, dass das Werk umso stärker als Anknüpfungspunkt für eine künstlerische Auseinandersetzung dienen kann, je mehr es seine gewünschte gesellschaftliche Rolle erfüllt. Diese gesellschaftliche Einbindung der Kunst ist damit gleichzeitig Wirkungsvoraussetzung für sie und Ursache dafür, dass die Künstler in gewissem Maß Eingriffe in ihre Urheberrechte durch andere Künstler als Teil der sich mit dem Kunstwerk auseinander setzenden Gesellschaft hinzunehmen haben. Zur Bestimmung des zulässigen Umfangs dieser Eingriffe dienen die Schrankenbestimmungen des Urheberrechts (§§ 45 ff. UrhG), die ihrerseits aber wieder im Lichte der Kunstfreiheit auszulegen sind und einen Ausgleich zwischen den verschiedenen - auch verfassungsrechtlich - geschützten Interessen schaffen müssen. Dem Interesse der Urheberrechtsinhaber vor Ausbeutung ihrer Werke ohne Genehmigung zu fremden kommerziellen Zwecken steht das durch die Kunstfreiheit geschützte Interesse anderer Künstler gegenüber, ohne die Gefahr von Eingriffen finanzieller oder inhaltlicher Art in einen künstlerischen Dialog und Schaffensprozess zu vorhandenen Werken treten zu können. (Hervorhebung KG)
http://www.telemedicus.info/urteile/Urheberrecht/605-BVerfG-Az-1-BvR-82598-Germania-3.html
Anderer Ansicht ist bekanntlich der BGH:
http://www.telemedicus.info/urteile/Presserecht/381-BGH-Az-I-ZR-11700-Verfremdung-des-Bundesadlers-Gies-Adler.html
Diese Entscheidung zu einer freien Bearbeitung des Gies-Adlers ist auch für den vorliegenden Fall einschlägig. Es fällt allerdings außerordentlich schwer, im bloßen Austauschen des Slogans eine antithematische Behandlung des Fotos zu sehen.
Fazit: Art. 5 GG rechtfertigt den Remix, das UrhG eher nicht.
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/5874016/
 http://www.flickr.com/photos/41336872@N02/
http://www.flickr.com/photos/41336872@N02/
Die im Detail nicht immer korrekte (z.B. Urheberrechtsschutz des CDU-Logos) Darstellung widmet sich der Beschwerde der Fotografin des Schäuble-Porträts, zu dessen Remix das Blog Netzpolitik aufgerufen hatte.
Abgelehnt wird eine freie Benutzung (§ 24 UrhG) und stattdessen auf das Zitatrecht Bezug genommen, obwohl die Verwendung mit der bisherigen Auslegung dieser Urheberrechtsschranke nicht in Einklang steht:
"Selbstständig ist das zitierende Werk gegenüber dem zitierten Werk, wenn es für sich genommen eine schöpferische Leistung darstellt. Diese Selbstständigkeit fehlt, wenn das Zitat dergestalt im
Mittelpunkt des zitierenden Werkes steht, dass Letzteres ohne das
Zitat kein für sich existenzfähiges Werk mehr darstellen würde" (Bisges: Grenzen des Zitatrechts im Internet, GRUR 2009, 730 ff., hier 731).
Die hinzugefügten Slogans haben in der Regel keine eigene Schöpfungshöhe, das Foto wird also nicht in einem eigenständigen Werk zitiert.
Hinzu kommt, dass ein Zitat nur unverändert zulässig ist: "Gem. § 62 I UrhG dürfen Änderungen an dem zitierten Werk nicht
vorgenommen werden. Ausnahmen von diesem Grundsatz stellen nur die Übersetzung (§ 62 II UrhG) und die größen- bzw. technikbedingten Änderungen (§ 62 III UrhG) sowie nach den Grundsätzen von Treu und Glauben zulässige Änderungen (§ 63 I 2 i.V. mit § 39 II UrhG) dar." (Bisges 733).
Weder stellen die satirisch abgewandelten Plakate freie Bearbeitungen nach gängiger Lehre ("Verblassen" der Vorlage) noch zulässige Zitate dar.
Darf man das Urheberrecht so zurechtbiegen, dass ein politisch wünschenswertes Ergebnis - die im Interesse der Meinungsfreiheit zulässige Nutzung - zustandekommt? Wenn man von der herrschenden Dogmatik abweicht, die darauf verweist, dass die Schranken des UrhG abschließend sind, fällt es nicht schwer, das Urheberrecht im Licht des Grundrechts der Meinungsfreiheit zu interpretieren und - obwohl keine Schranke so richtig passt - aufgrund der überragenden Bedeutung der politischen Auseinandersetzung in Wahlkampfzeiten den Remix und seine öffentliche Präsentation für erlaubt zu halten.
Auf die Meinungsfreiheit kann übertragen werden, was das Bundesverfassungsgericht zur Kunstfreiheit schrieb:
Dabei ist grundlegend zu beachten, dass mit der Veröffentlichung ein Werk nicht mehr allein seinem Inhaber zur Verfügung steht. Vielmehr tritt es bestimmungsgemäß in den gesellschaftlichen Raum und kann damit zu einem eigenständigen, das kulturelle und geistige Bild der Zeit mitbestimmenden Faktor werden. Es löst sich mit der Zeit von der privatrechtlichen Verfügbarkeit und wird geistiges und kulturelles Allgemeingut (BVerfGE 79, 29 <42>). Dies ist einerseits die innere Rechtfertigung für die zeitliche Begrenzung des Urheberschutzes, andererseits führt dieser Umstand auch dazu, dass das Werk umso stärker als Anknüpfungspunkt für eine künstlerische Auseinandersetzung dienen kann, je mehr es seine gewünschte gesellschaftliche Rolle erfüllt. Diese gesellschaftliche Einbindung der Kunst ist damit gleichzeitig Wirkungsvoraussetzung für sie und Ursache dafür, dass die Künstler in gewissem Maß Eingriffe in ihre Urheberrechte durch andere Künstler als Teil der sich mit dem Kunstwerk auseinander setzenden Gesellschaft hinzunehmen haben. Zur Bestimmung des zulässigen Umfangs dieser Eingriffe dienen die Schrankenbestimmungen des Urheberrechts (§§ 45 ff. UrhG), die ihrerseits aber wieder im Lichte der Kunstfreiheit auszulegen sind und einen Ausgleich zwischen den verschiedenen - auch verfassungsrechtlich - geschützten Interessen schaffen müssen. Dem Interesse der Urheberrechtsinhaber vor Ausbeutung ihrer Werke ohne Genehmigung zu fremden kommerziellen Zwecken steht das durch die Kunstfreiheit geschützte Interesse anderer Künstler gegenüber, ohne die Gefahr von Eingriffen finanzieller oder inhaltlicher Art in einen künstlerischen Dialog und Schaffensprozess zu vorhandenen Werken treten zu können. (Hervorhebung KG)
http://www.telemedicus.info/urteile/Urheberrecht/605-BVerfG-Az-1-BvR-82598-Germania-3.html
Anderer Ansicht ist bekanntlich der BGH:
http://www.telemedicus.info/urteile/Presserecht/381-BGH-Az-I-ZR-11700-Verfremdung-des-Bundesadlers-Gies-Adler.html
Diese Entscheidung zu einer freien Bearbeitung des Gies-Adlers ist auch für den vorliegenden Fall einschlägig. Es fällt allerdings außerordentlich schwer, im bloßen Austauschen des Slogans eine antithematische Behandlung des Fotos zu sehen.
Fazit: Art. 5 GG rechtfertigt den Remix, das UrhG eher nicht.
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/5874016/
 http://www.flickr.com/photos/41336872@N02/
http://www.flickr.com/photos/41336872@N02/KlausGraf - am Mittwoch, 12. August 2009, 16:42 - Rubrik: Archivrecht
Hannovers Oberbürgermeister Stephan Weil und der Generalsekretär der VolkswagenStiftung Dr. Wilhelm Krull läuten den Wiederaufbau ein.
Pressemeldungen
http://idw-online.de/pages/de/news324302
http://www.damals.de/de/8/Gruenes-Licht-fuer-den-Wiederaufbau-von-Schloss-Herrenhausen-in-Hannover.html?aid=189399&cp=6&action=showDetails
http://www.volkswagenstiftung.de/fileadmin/downloads/pressepdf_2009/20090703.pdf
Hintergrundinformationen
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://i36.tinypic.com/2le6ybt.jpg&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php%3Ft%3D669192&usg=__MaodI00VpIMFg56Gwg8ZwBBUu-k=&h=236&w=325&sz=62&hl=de&start=23&um=1&tbnid=-V6RiLplEKrDGM:&tbnh=86&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dschloss%2Bherrenhausen%26ndsp%3D20%26hl%3Dde%26rls%3Dcom.microsoft:de:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GPEA_deDE310%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
Nutzungsdiskussion
http://archiv.twoday.net/stories/5353032/#5400054
Statement Architektenkammer Niedersachsen
http://www.aknds.de/fileadmin/pdf/servicedb/303-dab_nds_02.08.pdf
Schloss Herrenhausen als Computer Animation
http://www.youtube.com/watch?v=d4k_TfmIejw
Pressemeldungen
http://idw-online.de/pages/de/news324302
http://www.damals.de/de/8/Gruenes-Licht-fuer-den-Wiederaufbau-von-Schloss-Herrenhausen-in-Hannover.html?aid=189399&cp=6&action=showDetails
http://www.volkswagenstiftung.de/fileadmin/downloads/pressepdf_2009/20090703.pdf
Hintergrundinformationen
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://i36.tinypic.com/2le6ybt.jpg&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php%3Ft%3D669192&usg=__MaodI00VpIMFg56Gwg8ZwBBUu-k=&h=236&w=325&sz=62&hl=de&start=23&um=1&tbnid=-V6RiLplEKrDGM:&tbnh=86&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dschloss%2Bherrenhausen%26ndsp%3D20%26hl%3Dde%26rls%3Dcom.microsoft:de:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GPEA_deDE310%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
Nutzungsdiskussion
http://archiv.twoday.net/stories/5353032/#5400054
Statement Architektenkammer Niedersachsen
http://www.aknds.de/fileadmin/pdf/servicedb/303-dab_nds_02.08.pdf
Schloss Herrenhausen als Computer Animation
http://www.youtube.com/watch?v=d4k_TfmIejw
Hermann Grote - am Mittwoch, 12. August 2009, 16:38 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.resourceshelf.com/2009/08/10/scanning-internet-archive-text-collection-passes-15-million-titles/
Hilfreiche Tipps zur Nutzung:
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Internet_Archive
Hilfreiche Tipps zur Nutzung:
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Internet_Archive
KlausGraf - am Mittwoch, 12. August 2009, 13:18 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.buchforschung.at/content_de/mitteilungen.php#2009-1
Lenka Veselá: Die Bibliothek der Beck von Leopoldsdorf und die mitteleuropäischen Adelsbibliotheken. Entwurf zu einem geplanten Projekt.
Der Entwurf ist leider nicht online.
Lenka Veselá: Die Bibliothek der Beck von Leopoldsdorf und die mitteleuropäischen Adelsbibliotheken. Entwurf zu einem geplanten Projekt.
Der Entwurf ist leider nicht online.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 12. August 2009, 12:52 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Im Bundesarchiv in Berlin ist ein Manuskript des Schriftstellers B. Traven aufgetaucht. Der Bochumer Literaturwissenschaftler Jan-Christoph Hauschild hat das Manuskript jetzt bei seinen Nachforschungen zum Lebenslauf B. Travens entdeckt. Die Kriminalgeschichte "Der Täter wird gesucht" war 84 Jahre lang verschollen und war auf Umwegen in das Bundesarchiv gelangt. Der Schriftsteller, der auch als Ret Marut veröffentlichte, lebte von 1882 bis 1969. Er war Schauspieler und schrieb Abenteurgeschichten und sozialkritische Romane. International bekannt wurde 1948 mit "Der Schatz der Sierra Madre", der Roman wurde mit Humphrey Bogart verfilmt."
Quelle: WDR-Kulturnachrichten v. 11.08.2009
FAZ-Rezension des Hausschild-Buches
Reaktion der Spreegurke: http://spreegurke.twoday.net/stories/5830619/
Wikipedia-Artikel zu Hausschild und Traven:
http://de.wikipedia.org/wiki/Jan-Christoph_Hauschild
http://de.wikipedia.org/wiki/B._Traven
Quelle: WDR-Kulturnachrichten v. 11.08.2009
FAZ-Rezension des Hausschild-Buches
Reaktion der Spreegurke: http://spreegurke.twoday.net/stories/5830619/
Wikipedia-Artikel zu Hausschild und Traven:
http://de.wikipedia.org/wiki/Jan-Christoph_Hauschild
http://de.wikipedia.org/wiki/B._Traven
Wolf Thomas - am Mittwoch, 12. August 2009, 07:13 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Pina Bauschs Sohn Salomon hat in Wuppertal eine Pina-Bausch-Stiftung ins Leben gerufen. Sie soll das künstlerische Vermächtnis der Choreographin verwalten und weitergeben, teilte eine Sprecherin mit. Anliegen seien vor allem Aufführung und Verbreitung von Bauschs Werken. Geplant sei zudem ein öffentlich zugängliches Archiv.
Pina Bausch, langjährige Leiterin des Tanztheaters Wuppertal, war im Juni gestorben. Sie galt als große Erneuerin des Tanztheaters und wichtigste Choreographin ihrer Zeit."
Quelle:
http://www.wdr.de/themen/kurzmeldungen/2009/08/11/pina-bausch-stiftung_ins_leben_gerufen.jhtml
zum Bausch-Archiv s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/5021869/
Pina Bausch, langjährige Leiterin des Tanztheaters Wuppertal, war im Juni gestorben. Sie galt als große Erneuerin des Tanztheaters und wichtigste Choreographin ihrer Zeit."
Quelle:
http://www.wdr.de/themen/kurzmeldungen/2009/08/11/pina-bausch-stiftung_ins_leben_gerufen.jhtml
zum Bausch-Archiv s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/5021869/
Wolf Thomas - am Mittwoch, 12. August 2009, 07:10 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
Stefan Schröder: Dess glich ich all min tag nie gesechen hab vnd ob got wil nùt mer sechen wil. Fremd- und Selbstbilder in den Pilgerberichten des Ulmer Dominikaners Falix Fabri. In: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 68 (2009), S. 41-62
Dass dieser Beitrag den unbestreitbar besten enzyklopädischen Artikel über Felix Fabri
http://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Fabri
ignoriert ist ebenso ärgerlich wie die Tatsache, dass durch gänzliches Ausblenden von Internetquellen unterschlagen wird, wieviele Werke Fabris (nicht zuletzt auf mein Betreiben hin) online inzwischen bequem verfügbar sind.
Dass dieser Beitrag den unbestreitbar besten enzyklopädischen Artikel über Felix Fabri
http://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Fabri
ignoriert ist ebenso ärgerlich wie die Tatsache, dass durch gänzliches Ausblenden von Internetquellen unterschlagen wird, wieviele Werke Fabris (nicht zuletzt auf mein Betreiben hin) online inzwischen bequem verfügbar sind.
KlausGraf - am Mittwoch, 12. August 2009, 01:49 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Brauchen wir eine Grundgesetzänderung, damit die Bundeswehr im Internet eingreifen kann?
 Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive), B 145 Bild-F073468-0023 Foto: Schambeck, Arne, CC-BY-SA
Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive), B 145 Bild-F073468-0023 Foto: Schambeck, Arne, CC-BY-SA
 Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive), B 145 Bild-F073468-0023 Foto: Schambeck, Arne, CC-BY-SA
Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive), B 145 Bild-F073468-0023 Foto: Schambeck, Arne, CC-BY-SAKlausGraf - am Mittwoch, 12. August 2009, 01:35 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zum von Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG geschützten Kommunikationsprozess kann auch die Mitteilung einer fremden Meinung oder Tatsachenbehauptung zählen, und zwar auch dann, wenn der Mitteilende sich diese weder zu eigen macht noch sie in eine eigene Stellungnahme einbindet, sondern die fremde Äußerung lediglich verbreitet. Es ist Teil des meinungsbildenden Diskussionsprozesses, dessen Schutz Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG im Sinn hat, sich und andere auch über Stellungnahmen Dritter zu informieren (vgl. BVerfGE 85, 1 <22>), etwa weil der Verbreitende sie für begrüßenswert hält, weil er ihr ablehnend gegenübersteht oder weil er sie aus sich heraus für bemerkenswert erachtet. Die Wiedergabe andernorts zuvor veröffentlichter Berichte im Rahmen einer Presseschau bzw. eines Pressespiegels ist daher selbst dann von der Meinungsfreiheit geschützt, wenn die fremde Äußerung weder kommentiert noch in anderer Weise in eine eigene Stellungnahmen eingebettet, sondern schlicht um ihrer selbst willen referiert wird.
BVerfG, 1 BvR 134/03 vom 25.6.2009, http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20090625_1bvr013403.html
Update:
http://www.telemedicus.info/article/1440-BVerfG-schraenkt-Verbreiterhaftung-ein.html
Identifizierung der Beteiligten:
http://www.kress.de/cont/story.php?id=129733
BVerfG, 1 BvR 134/03 vom 25.6.2009, http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20090625_1bvr013403.html
Update:
http://www.telemedicus.info/article/1440-BVerfG-schraenkt-Verbreiterhaftung-ein.html
Identifizierung der Beteiligten:
http://www.kress.de/cont/story.php?id=129733
KlausGraf - am Mittwoch, 12. August 2009, 01:18 - Rubrik: Archivrecht
KlausGraf - am Dienstag, 11. August 2009, 20:47 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
ca. 85 Prozent des Archivmaterials sind geborgen worden
ein Drittel davon ist schwer beschädigt
40 bis 50 Prozent der Funde weisen mittlere, der Rest leichtere Schäden auf.
6000 "Restaurateure" müssten ein Jahr lang arbeiten, um das Material instandzusetzen
400 Millionen Euro Kosten werden dafür geschätzt
Quelle: http://www.ksta.de/html/artikel/1246883770326.shtml
Kölner Zahlen (1): http://archiv.twoday.net/stories/5727782/
ein Drittel davon ist schwer beschädigt
40 bis 50 Prozent der Funde weisen mittlere, der Rest leichtere Schäden auf.
6000 "Restaurateure" müssten ein Jahr lang arbeiten, um das Material instandzusetzen
400 Millionen Euro Kosten werden dafür geschätzt
Quelle: http://www.ksta.de/html/artikel/1246883770326.shtml
Kölner Zahlen (1): http://archiv.twoday.net/stories/5727782/
Wolf Thomas - am Dienstag, 11. August 2009, 20:44 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=2216 Macht das VÖB-Blog nun Werbung oder wie darf man diesen Reklame-Beitrag verstehen?
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 11. August 2009, 20:19 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.abendblatt.de/region/lueneburg/article1132352/Die-Bibliothek-braucht-ihre-eigene-Chefstelle.html
"Archivare und Bibliothekare haben vollkommen verschiedene Aufgaben", sagt Gerhard Hopf, von 1974 bis 2001 Leiter der Ratsbücherei und in den 1960er-Jahren Mitarbeiter des Lüneburger Stadtarchivs. "Archivare sammeln, sichten und bewahren Dokumente der Stadtgeschichte. Bibliothekare müssen die Bücherei dagegen zu einem offenen Kommunikationszentrum machen, junge und ältere Menschen an eine solche Einrichtung zu binden versuchen. Sie müssen immer wieder neue Medien integrieren und Ideen entwickeln, Anstöße geben für Veränderungen."
Müllers Stelle nicht wieder mit einer bibliothekarischen Fachkraft zu besetzen, nennt Hopf eine "fatale Fehlentscheidung". Sie treffe die Einrichtung in "ihren Grundfesten". Er vermutet: "Wenn der zukünftige Leiter ein Archivar ist, wird er den Altbestand der Bücherei aus organisatorischen Gründen hinüber ins Stadtarchiv holen wollen. Damit würde eine einzigartige Bibliothek an ihrem bisherigen Standort zerstört."
Ich teile diese Bedenken. Wenn es nicht möglich ist, den großartigen wissenschaftlichen Altbestand von einem eigenen Wissenschaftler betreuen zu lassen, mag man es für vertretbar halten, einem Archivar die Leitung zu übergeben. Aber Archivare sind nun einmal nicht dafür ausgebildet, eine attraktive Stadtbücherei zu leiten. Es geht nicht darum, dem künftigen Amtsleiter seine Position nicht zu gönnen, sondern dem Lüneburger Lesepublikum die bestmögliche Versorgung zu sichern. Nicht ohne Grund werden öffentliche Bibliotheken von bibliotheksfachlich ausgebildeten Personen geführt. Wenn ein Bibliothekar das Lüneburger Stadtarchiv leiten würde, wäre das Grummeln groß. Im Hintergrund steht natürlich die Kostenfrage, aber auf Kosten von Bibliotheken zu sparen zeigt nur, dass man den Anforderungen der Zukunft nicht gerecht wird.
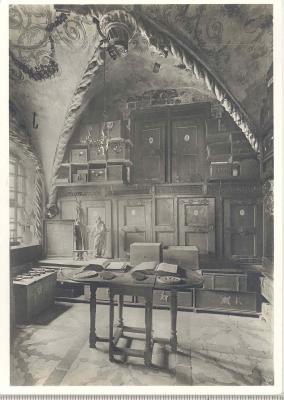
"Archivare und Bibliothekare haben vollkommen verschiedene Aufgaben", sagt Gerhard Hopf, von 1974 bis 2001 Leiter der Ratsbücherei und in den 1960er-Jahren Mitarbeiter des Lüneburger Stadtarchivs. "Archivare sammeln, sichten und bewahren Dokumente der Stadtgeschichte. Bibliothekare müssen die Bücherei dagegen zu einem offenen Kommunikationszentrum machen, junge und ältere Menschen an eine solche Einrichtung zu binden versuchen. Sie müssen immer wieder neue Medien integrieren und Ideen entwickeln, Anstöße geben für Veränderungen."
Müllers Stelle nicht wieder mit einer bibliothekarischen Fachkraft zu besetzen, nennt Hopf eine "fatale Fehlentscheidung". Sie treffe die Einrichtung in "ihren Grundfesten". Er vermutet: "Wenn der zukünftige Leiter ein Archivar ist, wird er den Altbestand der Bücherei aus organisatorischen Gründen hinüber ins Stadtarchiv holen wollen. Damit würde eine einzigartige Bibliothek an ihrem bisherigen Standort zerstört."
Ich teile diese Bedenken. Wenn es nicht möglich ist, den großartigen wissenschaftlichen Altbestand von einem eigenen Wissenschaftler betreuen zu lassen, mag man es für vertretbar halten, einem Archivar die Leitung zu übergeben. Aber Archivare sind nun einmal nicht dafür ausgebildet, eine attraktive Stadtbücherei zu leiten. Es geht nicht darum, dem künftigen Amtsleiter seine Position nicht zu gönnen, sondern dem Lüneburger Lesepublikum die bestmögliche Versorgung zu sichern. Nicht ohne Grund werden öffentliche Bibliotheken von bibliotheksfachlich ausgebildeten Personen geführt. Wenn ein Bibliothekar das Lüneburger Stadtarchiv leiten würde, wäre das Grummeln groß. Im Hintergrund steht natürlich die Kostenfrage, aber auf Kosten von Bibliotheken zu sparen zeigt nur, dass man den Anforderungen der Zukunft nicht gerecht wird.
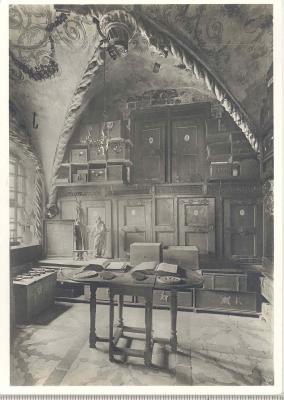
KlausGraf - am Dienstag, 11. August 2009, 18:02 - Rubrik: Personalia
http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?ressort=ku&dig=2009/08/11/a0102&cHash=8d223d05c8
Die Stadt Köln gibt sich alle Mühe, ihren Ruf zu verspielen. Nicht erst seit dem Einsturz des Stadtarchivs beflecken Fehlplanungen, Sparzwänge und Eiertänze der verantwortlichen Dezernenten das glänzende Bild der "Kulturmetropole am Rhein".
Die Stadt Köln gibt sich alle Mühe, ihren Ruf zu verspielen. Nicht erst seit dem Einsturz des Stadtarchivs beflecken Fehlplanungen, Sparzwänge und Eiertänze der verantwortlichen Dezernenten das glänzende Bild der "Kulturmetropole am Rhein".
KlausGraf - am Dienstag, 11. August 2009, 13:00 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Archive, Museen und Mediatheken haben nicht nur die Aufgabe, die ihnen anvertrauten Gegenstände für die Zukunft zu bewahren, sondern auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Doch im Umgang mit sensiblen Daten – persönlichen Unterlagen, Tagebüchern oder Fotos – stößt man schnell auf Einschränkungen. Was erwarten die Nutzer von den Archiven und welche Bedingungen werden bei der Überlassung persönlicher Zeugnisse vereinbart? Hat sich die Situation durch die Digitalisierung von Sammlungen und deren Veröffentlichung im Internet verändert? Das Symposium befasst sich mit dem Selbstverständnis öffentlicher Kulturinstitutionen im Umgang mit sensiblen Daten.
ÖFFENTLICHE ARCHIVE –»GEHEIME« INFORMATIONEN
Der Umgang mit sensiblen Daten in Filmmuseen, Archiven und Mediatheken
Symposium der Deutschen Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen
10. und 11. September 2009
Programm
10. September 2009
Veranstaltungsraum, 4. OG
10.00
Begrüßung
Dr. Rainer Rother
Künstlerischer Direktor der Deutschen Kinemathek
10.10
Grußwort
Hans-Joachim Otto, MdB
Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages
10.20
Eröffnungsvortrag
Dr. Paul Klimpel
Verwaltungsdirektor der Deutschen Kinemathek
10.40
Impulsreferat: »Offenes Netz – geschlossene Archive?«
Dr. Jan-Hinrik Schmidt
Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Universität Hamburg
11.00
Kaffeepause
JURISTISCHE GRUNDLAGEN
11.30
Einführungsreferat zum Allgemeinen Persönlichkeitsrecht
RA Prof. Dr. Peter Raue
Partner Hogan & Hartson LLP
11.50
Allgemeines Persönlichkeitsrecht und Archivgesetze
RA Dr. Bartholomäus Manegold
Fachanwalt für Medienrecht und Urheberrecht in Berlin
12.10
Allgemeines Persönlichkeitsrecht bei Nachlässen
Dr. Harald Müller
Direktor der Bibliothek des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg
12.30
Fragen und Diskussion
Moderation: Dr. Paul Klimpel
Verwaltungsdirektor der Deutschen Kinemathek
12.50
Mittagspause
KÜNSTLER UND ARCHIVE
14.00
Einleitung
Prof. Klaus Staeck
Präsident der Akademie der Künste, Berlin
14.20
Gesetz, Vertrag, Vertrauen – Marlene Dietrich und die Stiftung Deutsche Kinemathek
RA Frieder Roth
Dr. Roth und Kollegen
14.40
Vom Wert der Seelenruhe
Rainer Kirsch
Schriftsteller
15.00
Fragen und Diskussion
Moderation: Dr. Wolfgang Trautwein
Direktor des Archivs der Akademie der Künste, Berlin
15.20
Kaffeepause
KONKRETE PROBLEME BEI SAMMLUNGEN UND NACHLÄSSEN
15.40
Aus der Archivpraxis
Werner Sudendorf
Sammlungsleiter der Deutschen Kinemathek
16.00
Sperrvermerke und Archivpraxis
Karl Griep
Leiter der Abteilung Filmarchiv im Bundesarchiv Berlin
16.20
Ein Landesarchivgesetz, ein Landesfilmarchiv und die neuen Medien – Erfahrungen aus Schleswig-Holstein
Dr. Dirk Jachomowski
Leiter des Landesfilmarchivs im Landesarchiv Schleswig-Holstein
16.40
Zur Schau gestellt? Fragen zur Präsentation von Photographien in Ausstellungen.
Dr. Margret Kampmeyer-Käding
Projektleiterin Sonderausstellungen, Jüdisches Museum Berlin
17.00
Fragen und Diskussion
Moderation: Prof. Monika Hagedorn-Saupe
Stellvertretende Leiterin des Instituts für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin
17.20
Empfang
11. September 2009
Veranstaltungsraum, 4. OG
DIGITALISIERUNG
10.00
Zeitzeugen-Archive zum Holocaust und zur Zwangsarbeit
Prof. Dr. Nicolas Apostolopoulos
Leiter des Centers für Digitale Systeme (CeDiS) an der Freien Universität Berlin
10.20
Projekt: »Wir waren so frei ... Momentaufnahmen 1989/1990«
Thorsten Schilling
Leiter des Medien- und Kommunikationszentrums Berlin der Bundeszentrale für politische Bildung
10.40
Digitale Archive im Lichte widerstreitender rechtlicher Interessen
RA Dr. Till Kreutzer
i.e. – Büro für informationsrechtliche Expertise
11.00
Podiumsgespräch
Sonderregelungen für Archive?
Moderation: Prof. Dr. Gabriele Beger
Direktorin der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
11.20
Fragen und Diskussion
11.40
Kaffeepause
FERNSEHEN UND ARCHIV
12.00
Gesprächsrunde
Der Umgang mit sensiblen Daten im Fernsehen am Beispiel des Films CONTERGAN
Moderation: Peter Paul Kubitz
Programmdirektor Fernsehen der Deutschen Kinemathek
Adolf Winkelmann
Regisseur des Films CONTERGAN (WDR 2007)
RA Prof. Dr. Peter Raue
Partner Hogan & Hartson LLP
Rechtsvertreter der Filmproduktion im Fall »CONTERGAN«
Michael Souvignier
Produzent und Geschäftsführer, Zeitsprung Entertainment GmbH
13.00
Fernsehen, Archive und Recherche
Dr. Michael Crone
Leiter Dokumentation und Archive beim Hessischen Rundfunk
13.20 Mittagspause
ZWISCHEN RECHT UND MORAL – WO STEHEN WIR HEUTE?
14.00
Podiumsgespräch
Moderation: Börries von Notz
Verwaltungsleiter des Jüdischen Museums Berlin
Michael Kloft
Leiter der Abteilung Zeitgeschehen bei Spiegel TV
Dr. Jan-Hinrik Schmidt
Hans-Bredow-Institut für Medienforschung Hamburg an der Universität Hamburg
RA Dr. Till Kreutzer
i.e. – Büro für informationsrechtliche Expertise
Werner Sudendorf
Sammlungsleiter der Deutschen Kinemathek
16.00
Film CONTERGAN - Teil 1 und 2
(WDR 2007, R: Adolf Winkelmann)
Mit einem Grußwort von Stefanie Schulte Strathaus
Vorstand Arsenal – Institut für Film und Videokunst e.V.
Kino Arsenal, 2. UG
Leitung des Symposium
Dr. Paul Klimpel
Organisation
Marc Thümmler
symposium-recht(at)deutsche-kinemathek.de
T +49 (0)30 300 903-502
F +49 (0)30 300 903-13
Wegen der begrenzten Anzahl der Sitzplätze bitten wir um Anmeldung bis zum 1. September 2009.
Teilnahme frei
Programm als PDF:
Website der Deutschen Kinemathek: http://osiris22.pi-consult.de/view.php3?show=5200003770726
ÖFFENTLICHE ARCHIVE –»GEHEIME« INFORMATIONEN
Der Umgang mit sensiblen Daten in Filmmuseen, Archiven und Mediatheken
Symposium der Deutschen Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen
10. und 11. September 2009
Programm
10. September 2009
Veranstaltungsraum, 4. OG
10.00
Begrüßung
Dr. Rainer Rother
Künstlerischer Direktor der Deutschen Kinemathek
10.10
Grußwort
Hans-Joachim Otto, MdB
Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages
10.20
Eröffnungsvortrag
Dr. Paul Klimpel
Verwaltungsdirektor der Deutschen Kinemathek
10.40
Impulsreferat: »Offenes Netz – geschlossene Archive?«
Dr. Jan-Hinrik Schmidt
Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Universität Hamburg
11.00
Kaffeepause
JURISTISCHE GRUNDLAGEN
11.30
Einführungsreferat zum Allgemeinen Persönlichkeitsrecht
RA Prof. Dr. Peter Raue
Partner Hogan & Hartson LLP
11.50
Allgemeines Persönlichkeitsrecht und Archivgesetze
RA Dr. Bartholomäus Manegold
Fachanwalt für Medienrecht und Urheberrecht in Berlin
12.10
Allgemeines Persönlichkeitsrecht bei Nachlässen
Dr. Harald Müller
Direktor der Bibliothek des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg
12.30
Fragen und Diskussion
Moderation: Dr. Paul Klimpel
Verwaltungsdirektor der Deutschen Kinemathek
12.50
Mittagspause
KÜNSTLER UND ARCHIVE
14.00
Einleitung
Prof. Klaus Staeck
Präsident der Akademie der Künste, Berlin
14.20
Gesetz, Vertrag, Vertrauen – Marlene Dietrich und die Stiftung Deutsche Kinemathek
RA Frieder Roth
Dr. Roth und Kollegen
14.40
Vom Wert der Seelenruhe
Rainer Kirsch
Schriftsteller
15.00
Fragen und Diskussion
Moderation: Dr. Wolfgang Trautwein
Direktor des Archivs der Akademie der Künste, Berlin
15.20
Kaffeepause
KONKRETE PROBLEME BEI SAMMLUNGEN UND NACHLÄSSEN
15.40
Aus der Archivpraxis
Werner Sudendorf
Sammlungsleiter der Deutschen Kinemathek
16.00
Sperrvermerke und Archivpraxis
Karl Griep
Leiter der Abteilung Filmarchiv im Bundesarchiv Berlin
16.20
Ein Landesarchivgesetz, ein Landesfilmarchiv und die neuen Medien – Erfahrungen aus Schleswig-Holstein
Dr. Dirk Jachomowski
Leiter des Landesfilmarchivs im Landesarchiv Schleswig-Holstein
16.40
Zur Schau gestellt? Fragen zur Präsentation von Photographien in Ausstellungen.
Dr. Margret Kampmeyer-Käding
Projektleiterin Sonderausstellungen, Jüdisches Museum Berlin
17.00
Fragen und Diskussion
Moderation: Prof. Monika Hagedorn-Saupe
Stellvertretende Leiterin des Instituts für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin
17.20
Empfang
11. September 2009
Veranstaltungsraum, 4. OG
DIGITALISIERUNG
10.00
Zeitzeugen-Archive zum Holocaust und zur Zwangsarbeit
Prof. Dr. Nicolas Apostolopoulos
Leiter des Centers für Digitale Systeme (CeDiS) an der Freien Universität Berlin
10.20
Projekt: »Wir waren so frei ... Momentaufnahmen 1989/1990«
Thorsten Schilling
Leiter des Medien- und Kommunikationszentrums Berlin der Bundeszentrale für politische Bildung
10.40
Digitale Archive im Lichte widerstreitender rechtlicher Interessen
RA Dr. Till Kreutzer
i.e. – Büro für informationsrechtliche Expertise
11.00
Podiumsgespräch
Sonderregelungen für Archive?
Moderation: Prof. Dr. Gabriele Beger
Direktorin der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
11.20
Fragen und Diskussion
11.40
Kaffeepause
FERNSEHEN UND ARCHIV
12.00
Gesprächsrunde
Der Umgang mit sensiblen Daten im Fernsehen am Beispiel des Films CONTERGAN
Moderation: Peter Paul Kubitz
Programmdirektor Fernsehen der Deutschen Kinemathek
Adolf Winkelmann
Regisseur des Films CONTERGAN (WDR 2007)
RA Prof. Dr. Peter Raue
Partner Hogan & Hartson LLP
Rechtsvertreter der Filmproduktion im Fall »CONTERGAN«
Michael Souvignier
Produzent und Geschäftsführer, Zeitsprung Entertainment GmbH
13.00
Fernsehen, Archive und Recherche
Dr. Michael Crone
Leiter Dokumentation und Archive beim Hessischen Rundfunk
13.20 Mittagspause
ZWISCHEN RECHT UND MORAL – WO STEHEN WIR HEUTE?
14.00
Podiumsgespräch
Moderation: Börries von Notz
Verwaltungsleiter des Jüdischen Museums Berlin
Michael Kloft
Leiter der Abteilung Zeitgeschehen bei Spiegel TV
Dr. Jan-Hinrik Schmidt
Hans-Bredow-Institut für Medienforschung Hamburg an der Universität Hamburg
RA Dr. Till Kreutzer
i.e. – Büro für informationsrechtliche Expertise
Werner Sudendorf
Sammlungsleiter der Deutschen Kinemathek
16.00
Film CONTERGAN - Teil 1 und 2
(WDR 2007, R: Adolf Winkelmann)
Mit einem Grußwort von Stefanie Schulte Strathaus
Vorstand Arsenal – Institut für Film und Videokunst e.V.
Kino Arsenal, 2. UG
Leitung des Symposium
Dr. Paul Klimpel
Organisation
Marc Thümmler
symposium-recht(at)deutsche-kinemathek.de
T +49 (0)30 300 903-502
F +49 (0)30 300 903-13
Wegen der begrenzten Anzahl der Sitzplätze bitten wir um Anmeldung bis zum 1. September 2009.
Teilnahme frei
Programm als PDF:
Website der Deutschen Kinemathek: http://osiris22.pi-consult.de/view.php3?show=5200003770726
symposium_recht_sdk - am Dienstag, 11. August 2009, 11:46 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/newsticker/Niedersachsens-Gruene-wollen-Informationsfreiheitsgesetz--/meldung/143298
Die Fraktion der Grünen im niedersächsischen Landtag will mit einem Entwurf (PDF-Datei) für ein Informationsfreiheitsgesetz allen Bürgern des Landes freien Zugang zu Verwaltungsakten gewähren. [...]
Im Bayerischen Landtag hatte Mitte Juli die schwarz-gelbe Regierungskoalition Gesetzesentwürfe der SPD und der Grünen für ein Informationsfreiheitsgesetz abgelehnt. Damit scheiterte in München der dritte Versuch aus den Reihen der Opposition, ein allgemeines Akteneinsichtsrecht zu etablieren. Der inzwischen zum bayerischen Wirtschaftsminister avancierte FDP-Generalsekretär Martin Zeil hatte noch im Sommer 2008 einen eigenen Gesetzesentwurf der Liberalen zur Informationsfreiheit versprochen. Nun verwies ein FDP-Fraktionssprecher auf den Koalitionszwang. Das Bündnis für Informationsfreiheit in Bayern, das von der Bürgerrechtsorganisation Mehr Demokratie mit begründet wurde, zeigte sich enttäuscht über das Scheitern des Entwurfs.
Auch in Hessen hat die FDP ein IFG verhindert:
http://archiv.twoday.net/stories/5791414/
http://archiv.twoday.net/stories/5843561/
Die FDP, die sich gerne als Bürgerrechtspartei geriert, ist schlicht und einfach nicht wählbar, da sie willfährig die konservative IFG-Blockade mitmacht.
Die Fraktion der Grünen im niedersächsischen Landtag will mit einem Entwurf (PDF-Datei) für ein Informationsfreiheitsgesetz allen Bürgern des Landes freien Zugang zu Verwaltungsakten gewähren. [...]
Im Bayerischen Landtag hatte Mitte Juli die schwarz-gelbe Regierungskoalition Gesetzesentwürfe der SPD und der Grünen für ein Informationsfreiheitsgesetz abgelehnt. Damit scheiterte in München der dritte Versuch aus den Reihen der Opposition, ein allgemeines Akteneinsichtsrecht zu etablieren. Der inzwischen zum bayerischen Wirtschaftsminister avancierte FDP-Generalsekretär Martin Zeil hatte noch im Sommer 2008 einen eigenen Gesetzesentwurf der Liberalen zur Informationsfreiheit versprochen. Nun verwies ein FDP-Fraktionssprecher auf den Koalitionszwang. Das Bündnis für Informationsfreiheit in Bayern, das von der Bürgerrechtsorganisation Mehr Demokratie mit begründet wurde, zeigte sich enttäuscht über das Scheitern des Entwurfs.
Auch in Hessen hat die FDP ein IFG verhindert:
http://archiv.twoday.net/stories/5791414/
http://archiv.twoday.net/stories/5843561/
Die FDP, die sich gerne als Bürgerrechtspartei geriert, ist schlicht und einfach nicht wählbar, da sie willfährig die konservative IFG-Blockade mitmacht.
KlausGraf - am Dienstag, 11. August 2009, 03:18 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/projekte/id=329
DFG-Projekt „Die Fürstenbibliothek Arolsen als Kultur- und Wissensraum vom 16. bis zum frühen 19. Jahrhundert und ihre Einflüsse auf Genese, Formung und Identität des Fürstenstaats“
DFG-Projekt „Die Fürstenbibliothek Arolsen als Kultur- und Wissensraum vom 16. bis zum frühen 19. Jahrhundert und ihre Einflüsse auf Genese, Formung und Identität des Fürstenstaats“

Pfarrkirche St. Gangolf, Kluftern (Stadt Friedrichshafen) Chorfenster "Hl.Laurentius", hergestellt 1904 von Lütz & Elmpt, Konstanz, Foto: April 2008, Andreas Praefcke (Quelle: Wikimedia, CC-BY 3.0)
"Laurentius von Rom (* evtl. in Osca (Spanien) oder Laurentum ; † 10. August 258 in Rom) war römischer Diakon zur Zeit des Papstes Sixtus II. und starb als christlicher Märtyrer , weshalb er als Heiliger geführt wird. Sein Fest ist der 10. August.
Der Heilige gilt als der bekannteste Träger des Namens Laurentius. Da der Name am wahrscheinlichsten Der Mann aus Laurentum bedeutet, könnte Laurentius auch tatsächlich aus dieser Ortschaft gestammt haben, die bei Rom lag. Er ist nicht nur der Schutzpatron Spaniens, sondern auch der Bibliothekare, Archivare, Studenten sowie vieler, die mit Feuer zu tun haben, etwa der Bierbrauer, Wäscherinnen und Köche....."
Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Laurentius_von_Rom
Weiterführende Links:
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienL/Laurentius.htm
http://www.bbkl.de/l/Laurentius_v_r.shtml
Wolf Thomas - am Montag, 10. August 2009, 21:42 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-11/qd7707226frc.pdf
Französisches Handbuch.
Französisches Handbuch.
KlausGraf - am Montag, 10. August 2009, 16:59 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bei J. Van den Gheyn, e.a., Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, Bd. 7, Bruxelles 1907, S. 23
http://opteron1.kbr.be/manus/BELGICA/B001/vdg_07.pdf
wird unter Nr. 4598 das Ms. 21467 der KB Brüssel beschrieben, eine wohl 1474 oder später geschriebene deutschsprachige Handschrift (sie fehlt im Handschriftencensus!) im Umfang von 48 Blättern, die zunächst (bl. 1r-37v) eine mir unbekannte bayerische Chronik eines mir gleichfalls unbekannten Iacobus Heinrichs enthält, danach einen Brief Pfalzgraf Friedrich des Siegreichen an die Zisterzienser von Maulbronn 1474 und einen weiteren Brief desselben Herrschers aus dem gleichen Jahr:
Michael Verweij von der Königlichen Bibliothek teilte mir freundlicherweise mit:
Zur Handschrift 21467 gibt es anscheinend keine
Literatur, jedenfalls d.h., dass wir keine kennen. Auch lassen sich
keine frühere Leser oder Benutzer feststellen.
Incipit
F. 1r: Dem durchluchtem hochgebornem fürsten und herren herren
friderichen von gnad gottes pfaltzgraffen by Rine hertzoge im beyern
F. 2r: Beiern als man lyset sin von Armenia komen die sin uß gezogen mit großem here und in das land komen
Der Text fängt also an im frühesten Beginn; die letzte Notiz gilt dem Jahr 1423 mit dem Tod des Herzogen Johann in Bayern. Dann folgt noch mehr Text, aber die letzten Seiten beziehen sich auf frühere Ereignisse.
Explicit (F. 37v): fursten von beyern auch die husfrawen wo dy gestorben sind so hat man die gebein do hin gefürt etc.
Update:
http://www.handschriftencensus.de/21903
#forschung
http://opteron1.kbr.be/manus/BELGICA/B001/vdg_07.pdf
wird unter Nr. 4598 das Ms. 21467 der KB Brüssel beschrieben, eine wohl 1474 oder später geschriebene deutschsprachige Handschrift (sie fehlt im Handschriftencensus!) im Umfang von 48 Blättern, die zunächst (bl. 1r-37v) eine mir unbekannte bayerische Chronik eines mir gleichfalls unbekannten Iacobus Heinrichs enthält, danach einen Brief Pfalzgraf Friedrich des Siegreichen an die Zisterzienser von Maulbronn 1474 und einen weiteren Brief desselben Herrschers aus dem gleichen Jahr:
Michael Verweij von der Königlichen Bibliothek teilte mir freundlicherweise mit:
Zur Handschrift 21467 gibt es anscheinend keine
Literatur, jedenfalls d.h., dass wir keine kennen. Auch lassen sich
keine frühere Leser oder Benutzer feststellen.
Incipit
F. 1r: Dem durchluchtem hochgebornem fürsten und herren herren
friderichen von gnad gottes pfaltzgraffen by Rine hertzoge im beyern
F. 2r: Beiern als man lyset sin von Armenia komen die sin uß gezogen mit großem here und in das land komen
Der Text fängt also an im frühesten Beginn; die letzte Notiz gilt dem Jahr 1423 mit dem Tod des Herzogen Johann in Bayern. Dann folgt noch mehr Text, aber die letzten Seiten beziehen sich auf frühere Ereignisse.
Explicit (F. 37v): fursten von beyern auch die husfrawen wo dy gestorben sind so hat man die gebein do hin gefürt etc.
Update:
http://www.handschriftencensus.de/21903
#forschung
KlausGraf - am Montag, 10. August 2009, 16:30 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In der heutigen FAZ (10.08.09) auf S. 28 beschreibt Herr Huff den Fall, dass der Autor Brüssow einen Festschriftenbeitrag zu einer Entscheidung des EuGH schreibt, die es überhaupt nicht gibt, jedenfalls nicht im Zeitpunkt der Abfassung des Beitrags. Nach Huffs erfolgloser Suche nach einer Fundstelle zu der Entscheidung letztendlich befragt habe der Autor eingeräumt, diese Entscheidung von einem Mitarbeiter bekommen zu haben. Dieser war offensichtlich einem Fake aufgesessen, das im Rahmen einer Simulation eines Verfahrens vor dem Europäischen Gerichtshof erstellt wurde.
Jedenfalls an dieser Stelle im Internet
http://www.meuc.eu/documents/yy_akzo_urteil_final2.doc
ist aus der ersten Seite des Dokuments ersichtlich, dass "die Entscheidung" Teil der "Model European Union Conference (MEUC)" ist. Das ist ein Planspiel, bei dem Studentinnen und Studenten Sitzungen der europäischen Institutionen simulieren.
Dietrich Pannier in BIB-JUR.
Aus der FAZ:
Wie schnell man aber auf eine angeblich neue Entscheidung hereinfallen kann, zeigt ein Beispiel in der soeben erschienenen Festschrift der angesehenen Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im Deutschen Anwaltverein mit dem Thema "Strafverteidigung im Rechtsstaat" (Nomos Verlag, Baden-Baden, 2009).
Dort veröffentlicht der Kölner Strafverteidiger Rainer Brüssow einen Aufsatz zum Thema "Das Anwaltsprivileg des Syndikus im Wirtschaftsstrafverfahren - Erforderlichkeit einer Neubewertung nach der Entscheidung des EuGH vom 19. Juni 2008?".
Jedenfalls an dieser Stelle im Internet
http://www.meuc.eu/documents/yy_akzo_urteil_final2.doc
ist aus der ersten Seite des Dokuments ersichtlich, dass "die Entscheidung" Teil der "Model European Union Conference (MEUC)" ist. Das ist ein Planspiel, bei dem Studentinnen und Studenten Sitzungen der europäischen Institutionen simulieren.
Dietrich Pannier in BIB-JUR.
Aus der FAZ:
Wie schnell man aber auf eine angeblich neue Entscheidung hereinfallen kann, zeigt ein Beispiel in der soeben erschienenen Festschrift der angesehenen Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im Deutschen Anwaltverein mit dem Thema "Strafverteidigung im Rechtsstaat" (Nomos Verlag, Baden-Baden, 2009).
Dort veröffentlicht der Kölner Strafverteidiger Rainer Brüssow einen Aufsatz zum Thema "Das Anwaltsprivileg des Syndikus im Wirtschaftsstrafverfahren - Erforderlichkeit einer Neubewertung nach der Entscheidung des EuGH vom 19. Juni 2008?".
KlausGraf - am Montag, 10. August 2009, 10:49 - Rubrik: Archivrecht
KlausGraf - am Montag, 10. August 2009, 10:45 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Siegener Stadtarchiv bekommt heute Vormittag mehr als 500 Regalmeter Akten aus dem eingestürzten historischen Archiv der Stadt Köln. Das Siegener Archiv wurde erst vor rund zweieinhalb Jahren neu gebaut und bietet optimale Klimabedingungen, um die wertvollen Dokumente für etwa fünf Jahre sicher zu lagern. In der Region sind Kölner Archivakten auch in Freudenberg gelagert."
Quelle: WDR Lokalzeitnachrichten
" .... Noch könne man nicht sagen, in welchem Zustand die Archivarien [sic! - Archiv-Arien können wohl kaum gemeint sein] seien, so Ludwig Burwitz vom Siegener Stadtarchiv.Um deren Instandsetzung [sic!] würden sich Anfang nächsten Jahres Spezialisten aus Köln kümmern."
Quelle: Radio Siegen
Nachtrag 13.08.2009:

"Bürgermeister Steffen Mues, Stadträtin Birgitta Radermacher und Stadtarchivar Ludwig Burwitz (rechts) waren die ersten, die die Archivalien in Augenschein nahmen, die aktuell vom zerstörten Kölner Stadtarchiv in das Stadtarchiv Siegen gebracht wurden."(Quelle: Pressestelle Stadt Siegen)
Link zur Pressemitteilung der Stadt Siegen: http://www.siegen.de/standard/page.sys/details/eintrag_id=2614/content_id=2534/25.htm
Link zum Siegerländer Wochen-Anzeiger: http://neu.swa-wwa.de/PDF/12.08.2009/SWA.S11-A-X.12.pdf
Link zum Siegerland Kurier:
http://www.siegerlandkurier.de/asyl-fuer-historische-dokumente-index_kat145_id92351.html
Zur Diskussion um die Asylarchive auf Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/5862107/
Zum Freudenberger Asylarchiv s.:
http://archiv.twoday.net/stories/5858565/
Quelle: WDR Lokalzeitnachrichten
" .... Noch könne man nicht sagen, in welchem Zustand die Archivarien [sic! - Archiv-Arien können wohl kaum gemeint sein] seien, so Ludwig Burwitz vom Siegener Stadtarchiv.Um deren Instandsetzung [sic!] würden sich Anfang nächsten Jahres Spezialisten aus Köln kümmern."
Quelle: Radio Siegen
Nachtrag 13.08.2009:

"Bürgermeister Steffen Mues, Stadträtin Birgitta Radermacher und Stadtarchivar Ludwig Burwitz (rechts) waren die ersten, die die Archivalien in Augenschein nahmen, die aktuell vom zerstörten Kölner Stadtarchiv in das Stadtarchiv Siegen gebracht wurden."(Quelle: Pressestelle Stadt Siegen)
Link zur Pressemitteilung der Stadt Siegen: http://www.siegen.de/standard/page.sys/details/eintrag_id=2614/content_id=2534/25.htm
Link zum Siegerländer Wochen-Anzeiger: http://neu.swa-wwa.de/PDF/12.08.2009/SWA.S11-A-X.12.pdf
Link zum Siegerland Kurier:
http://www.siegerlandkurier.de/asyl-fuer-historische-dokumente-index_kat145_id92351.html
Zur Diskussion um die Asylarchive auf Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/5862107/
Zum Freudenberger Asylarchiv s.:
http://archiv.twoday.net/stories/5858565/
Wolf Thomas - am Montag, 10. August 2009, 10:12 - Rubrik: Kommunalarchive
Das OLG Köln hat in einer Fehlentscheidung die Reichweite der Kunstfreiheit verkannt, als es die Verwendung von Zitaten von Klaus Kinski in einem Theaterstück verbot:
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2009/6_U_52_09urteil20090626.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2009/6_U_52_09urteil20090626.html
KlausGraf - am Montag, 10. August 2009, 09:52 - Rubrik: Archivrecht
10. August 2009 14:00 Historisches Rathaus, Konrad-Adenauer-Saal, Raum 118
Terminankündigung
Tagesordnung (PDF)
Zur Vorberichterstattung s. http://archiv.twoday.net/stories/5864304/ (incl. Kommentare)
Terminankündigung
Tagesordnung (PDF)
Zur Vorberichterstattung s. http://archiv.twoday.net/stories/5864304/ (incl. Kommentare)
Wolf Thomas - am Montag, 10. August 2009, 08:30 - Rubrik: Kommunalarchive
Via
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/
„Ein Gespenst geht um, nicht nur in Europa: Open Access. Das Papierjournal ist ein Kind der Postkutschenära und inzwischen überteuer und extrem langsam (bei Topjournalen in der Ökonomie verstreichen fünf bis sieben Jahre zwischen Manuskripteinreichung und Druck). Warum soll das Papierjournal auf ewig das zentrale Medium formaler Wissenschaftskommunikation bleiben? Welche Nachteile haben Papierpublikationen, welche Vorteile bieten digitale Technologien in Forschungs- und Wissenschaftskommunikation oder bei der Bekämpfung von Plagiat, Betrug und Täuschung? Es gibt „goldene“ und „grüne“ Wege zu Open Access, und vieles geschieht überhaupt informell im Verborgenen: Wie informieren sich WissenschaftlerInnen wirklich? Lesen sie überhaupt wissenschaftliche Zeitschriften und Bücher in Papierform, oder besorgen sie sich alle Informationen per E-Mail-Anfrage von den AutorInnen selbst? Wie arbeiten erfolgreiche E-Journals oder E-Archive (Closed oder Open Access)? Welche Finanzierungsmodelle bieten sich an? Welche organisatorisch-technischen Möglichkeiten haben wissenschaftliche Gesellschaften zur Förderung rationaler und rationeller Kommunikation?
Inhalt:
249 EDITORIAL
Gerhard Fröhlich: Open Access
250 NACHRICHTEN
Fortbildungstage Patentarbeit in Frankfurt am Main
Europa-Premiere für TOC 250
OPEN ACCESS – GRUNDLAGEN
253 Gerhard Fröhlich: Die Wissenschaftstheorie fordert OPEN ACCESS
259 Rainer Kuhlen and Karin Ludewig: ENCES – A European Network for Copyright in support of Education and Science – one step forward to a science-friendly copyright in Europe
265 Michael Strähle: Open Access auf europäische Forschung: Der Open Access Pilot der Europäischen Kommission
271 Bruno Bauer: It’s economy stupid! – Anmerkungen zu ökonomischen Aspekten des goldenen und des grünen Weges beim Open Access Publishing
OPEN ACCESS – PROJEKTE
279 Debora Weber-Wulff: Im Anfang war das Wort … und das Chaos. Wikipedia, das unbekannte Wesen
285 Antonella De Robbio und Michael Katzmayr: Management eines internationalen Open Access-Archivs: das Beispiel E-LIS
291 Lisa Koch, Günter Mey und Katja Mruck: Erfahrungen mit Open Access – ausgewählte Ergebnisse aus der Befragung zu Nutzen und Nutzung von „Forum Qualitative Forschung / Forum: Qualitative Social Research“ (FQS)
301 Andreas Holtz: Etablierte Fachzeitschriften in hybrider Publikation: Die GIGA Journal Family in Open Access
307 Andrea Ghoneim-Rosenauer: TRANS – ein mehrsprachiges multidisziplinäres kulturwissenschaftliches E-Journal
305 INTERVIEW
Erfahrungsaustausch für junge und erfahrene Infoprofis – praxisrelevant und international
TAGUNGSBERICHTE
313 Ursula Georgy und Luzian Weisel: Information: Droge, Ware oder Commons? Wertschöpfungs- und Transformationsprozesse auf den Informationsmärkten. Bericht über die ISI 2009 und die IuK 2009
317 Helga Bergmann und Vera Münch: Wissenschaftliche Information faszinierend präsentiert. FIZ CHEMIE Berlin und TFH Wildau ziehen auf der ACHEMA 2009 mit einem innovativen Konzept für Wissenstransfer und Wissensmanagement
INFORMATIONEN
278 Zusatzausbildung Musikinformationsmanagement erneut an der HdM Stuttgart
322 Praxishandbuch Bestandserhaltung in neuer Auflage Branchenreport Medizinische Dokumentation
323 Vorprogramm Online-Tagung 2009
BUCHBESPRECHUNGEN
270 J. Sebastian Günther. Erfolgreiches Onlinemarketing mit Google. Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing verstehen und zielsicher einsetzen (Wolfgang Ratzek)
270 Jens Ornbo; Claus Sneppen; Peter F. Würtz: Experience-Based Communication. (Wolfgang Ratzek)
300 Wolfgang G. Stock, Mechtild Stock: Wissensrepräsentation – Informationen auswerten und bereitstellen (Reginald Ferber)
311 Peter Tepe, Jürgen Rauter, & Tanja Semlow: Interpretationskonflikte am Beispiel von E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann (Wolfgang G. Stock)
Die komplette Ausgabe der neuen Ausgabe „Information Wissenschaft & Praxis“ findet man hier (PDF 5 MB!):
http://www.fachbuchjournal.de/journal/sites/default/files/IWP-5_2009_kpl.pdf
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/
„Ein Gespenst geht um, nicht nur in Europa: Open Access. Das Papierjournal ist ein Kind der Postkutschenära und inzwischen überteuer und extrem langsam (bei Topjournalen in der Ökonomie verstreichen fünf bis sieben Jahre zwischen Manuskripteinreichung und Druck). Warum soll das Papierjournal auf ewig das zentrale Medium formaler Wissenschaftskommunikation bleiben? Welche Nachteile haben Papierpublikationen, welche Vorteile bieten digitale Technologien in Forschungs- und Wissenschaftskommunikation oder bei der Bekämpfung von Plagiat, Betrug und Täuschung? Es gibt „goldene“ und „grüne“ Wege zu Open Access, und vieles geschieht überhaupt informell im Verborgenen: Wie informieren sich WissenschaftlerInnen wirklich? Lesen sie überhaupt wissenschaftliche Zeitschriften und Bücher in Papierform, oder besorgen sie sich alle Informationen per E-Mail-Anfrage von den AutorInnen selbst? Wie arbeiten erfolgreiche E-Journals oder E-Archive (Closed oder Open Access)? Welche Finanzierungsmodelle bieten sich an? Welche organisatorisch-technischen Möglichkeiten haben wissenschaftliche Gesellschaften zur Förderung rationaler und rationeller Kommunikation?
Inhalt:
249 EDITORIAL
Gerhard Fröhlich: Open Access
250 NACHRICHTEN
Fortbildungstage Patentarbeit in Frankfurt am Main
Europa-Premiere für TOC 250
OPEN ACCESS – GRUNDLAGEN
253 Gerhard Fröhlich: Die Wissenschaftstheorie fordert OPEN ACCESS
259 Rainer Kuhlen and Karin Ludewig: ENCES – A European Network for Copyright in support of Education and Science – one step forward to a science-friendly copyright in Europe
265 Michael Strähle: Open Access auf europäische Forschung: Der Open Access Pilot der Europäischen Kommission
271 Bruno Bauer: It’s economy stupid! – Anmerkungen zu ökonomischen Aspekten des goldenen und des grünen Weges beim Open Access Publishing
OPEN ACCESS – PROJEKTE
279 Debora Weber-Wulff: Im Anfang war das Wort … und das Chaos. Wikipedia, das unbekannte Wesen
285 Antonella De Robbio und Michael Katzmayr: Management eines internationalen Open Access-Archivs: das Beispiel E-LIS
291 Lisa Koch, Günter Mey und Katja Mruck: Erfahrungen mit Open Access – ausgewählte Ergebnisse aus der Befragung zu Nutzen und Nutzung von „Forum Qualitative Forschung / Forum: Qualitative Social Research“ (FQS)
301 Andreas Holtz: Etablierte Fachzeitschriften in hybrider Publikation: Die GIGA Journal Family in Open Access
307 Andrea Ghoneim-Rosenauer: TRANS – ein mehrsprachiges multidisziplinäres kulturwissenschaftliches E-Journal
305 INTERVIEW
Erfahrungsaustausch für junge und erfahrene Infoprofis – praxisrelevant und international
TAGUNGSBERICHTE
313 Ursula Georgy und Luzian Weisel: Information: Droge, Ware oder Commons? Wertschöpfungs- und Transformationsprozesse auf den Informationsmärkten. Bericht über die ISI 2009 und die IuK 2009
317 Helga Bergmann und Vera Münch: Wissenschaftliche Information faszinierend präsentiert. FIZ CHEMIE Berlin und TFH Wildau ziehen auf der ACHEMA 2009 mit einem innovativen Konzept für Wissenstransfer und Wissensmanagement
INFORMATIONEN
278 Zusatzausbildung Musikinformationsmanagement erneut an der HdM Stuttgart
322 Praxishandbuch Bestandserhaltung in neuer Auflage Branchenreport Medizinische Dokumentation
323 Vorprogramm Online-Tagung 2009
BUCHBESPRECHUNGEN
270 J. Sebastian Günther. Erfolgreiches Onlinemarketing mit Google. Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing verstehen und zielsicher einsetzen (Wolfgang Ratzek)
270 Jens Ornbo; Claus Sneppen; Peter F. Würtz: Experience-Based Communication. (Wolfgang Ratzek)
300 Wolfgang G. Stock, Mechtild Stock: Wissensrepräsentation – Informationen auswerten und bereitstellen (Reginald Ferber)
311 Peter Tepe, Jürgen Rauter, & Tanja Semlow: Interpretationskonflikte am Beispiel von E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann (Wolfgang G. Stock)
Die komplette Ausgabe der neuen Ausgabe „Information Wissenschaft & Praxis“ findet man hier (PDF 5 MB!):
http://www.fachbuchjournal.de/journal/sites/default/files/IWP-5_2009_kpl.pdf
KlausGraf - am Sonntag, 9. August 2009, 22:47 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Our blog includes news and updates about our activities, such as digitization, asset management, preservation, and acqusitions, and discussion about topics we find relevant to our work: these include human rights archives, archivists and social justice, audiovisual archiving, social issue documentary, and more."
Link: http://archive.witness.org/
Link: http://archive.witness.org/
Wolf Thomas - am Sonntag, 9. August 2009, 18:30 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 (Website: witness.org)
(Website: witness.org)"The mission of the WITNESS Media Archive is to collect, document, preserve and provide access to audiovisual human rights media in the support of advocacy, prosecution of justice, truthtelling, and the historical record.
The video collection comprises over 3000 hours of video from human rights defenders around the world. Footage includes witness and victim testimonies, abuses caught on tape, interviews with key human rights defenders, evidentiary submissions, and footage of cultural events and daily life.
Most of the footage in our collection comes from the nongovernmental organizations with which we have partnered. However, WITNESS also accepts donations from vetted sources of video that will further human rights advocacy, the documentary record of human rights issues, or is in need of care and preservation because of its significance to the historical record .....
Most of our collection is housed in a climate-controlled vault at WITNESS' Brooklyn, New York, offices, with preservation copies of selected footage stored offsite. We have a dual-system (NTSC & PAL), multi-format editing and duplication facility, with ability to transfer to BetaSP, miniDV, DVcam, VHS, and DVD formats.
In 2003-2004 WITNESS undertook the monumental task of cataloging the footage acquired since its inception in 1992. This projected entailed the development of the WITNESS Media Database, a Filemaker-Pro platform database, customized internally to address WITNESS' specific content and workflow needs. The requirements of human-rights documentation are complex and demand a high level of accuracy, specificity, and nuance in content descriptions and application of metadata. All content summaries and data must be reviewed and edited for accuracy and context and, where necessary, mechanisms applied for maintaining the safety of videographers and subjects. As much as possible we employ shot-level descriptions of footage.
In-house thesauri of human-rights specific subject terms, names, and geographic locations are used to index each record. As of August 2008 approximately 90% of the collection has been fully or partially cataloged in the database. Shotlists, transcripts, or scripts are available for approximately 60% of the cataloged titles.
In 2004 the Archive received a grant via the Open Society Archives, one of the premier human rights archives in the world. With this seed funding we were able to deposit research copies of all WITNESS productions and a selection of our raw footage at the OSA at Central European University in Budapest. We were able to simultaneously duplicate this footage to Beta SP for storage in an offsite archival facility, generously donated by Corbis, Inc.
Because our raw footage originated on relatively fragile handicam formats - Video8, Hi-8, VHS-C, and miniDV - it is at risk merely from the passage of time. We are actively seeking funding to continue migrating our most valuable footage to a more stable format.
WITNESS Media Archive Facts and Figures
Number of Video Titles: 4000+
Number of items: 9000+
Formats: Hi-8, miniDV, DVcam, VHS-C, BetaSP, DigiBeta, VHS, CD, DVD, DAT, Audio, Video-8.
Standards: NTSC 70%, PAL 30%
Raw footage: 80%
WITNESS Productions: 14%
Other: 6% "
Link: Winess.org, Media archive
Link to search the archive
Wolf Thomas - am Sonntag, 9. August 2009, 18:27 - Rubrik: Archive von unten
"Amnesty International USA
http://www.amnestyusa.org/about/archives.html
This collection will be moving to the Center for Human Rights and Documentation at Columbia University in Spring 2006. (see below)
Amnesty International Online Audiovisual Archive
http://www.amnesty.org/resources/audiovisual
Click on a world map to see recent videos by country.
Amnesty International Collection at World Images
http://www.world-images.org/amnesty/
Amnesty International’s archive contains over a thousand hours of footage dating from the, and includes video news releases, features, campaign videos, and original camera tapes. (Text results only)
Open Society Archives
http://www.osa.ceu.hu/
The Open Society Archives is an archives and a center for research and education. Its collections and activities relate to the period after the Second World War, in particular the Cold War, the history of the formerly communist countries, human rights, and war crimes. The audiovisual collection includes footage and oral histories relating to the 1956 Hungarian revolution, monitoring of Iraqi and Kurdish television, materials relating to the conflict in the former Yugoslavia, and selected footage from WITNESS.
Center for Human Rights Documentation and Research (CHRDR), Columbia University
(web site forthcoming)
In 2004, Columbia University was selected to administer the Archive of Human Rights Watch, the largest US-based human rights organization. This collection will soon be joined by Archives of other leading human rights organizations, including Amnesty International USA, Human Rights First, and Physicians for Human Rights.
Milosevic Trial Public Archive
http://hague.bard.edu/
Established by the Human Rights project at Bard College. Information, news and analysis about the trial of Slobodan Milosevic at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), including up-to-date video recordings, with audio in English, for the proceedings, ( http://hague.bard.edu/video.html ). A physical archive of broadcast-quality digital video (dvcam) is being stored at Bard and will be made permanently available to researchers.
UNICEF Video
http://www.unicef.org/videoaudio/video_catalogue.html
UNICEF produces and distributes video on issues affecting child rights and welfare, including armed conflict, emergencies, healthcare, immunization, labor, poverty, and development.
East Timor (Timor-Leste) Commission for Reception, Truth and Reconciliation (CAVR)
http://www.easttimor-reconciliation.org/
Timor-Leste's Truth Commission is collecting important materials and testimony from 1974-1999. There are plans to convert the Commission's building into a human rights centre, museum and archive.
Centro Audiovisual Max Stahl Timor-Leste (CAMS Timor-Leste)
http://www.shoalhaven.net.au/~mwsmith/aatlms.html
This archive contains the award-winning footage filmed by Max Stahl and by the leadership of East Timor's resistance, during the Timorese struggle for independence. Additionally, the center holds hundreds of hours of material documenting both the struggle and re-birth of traditional communities as parts of the world's newest nation.
Martin Ennals Award for Human Rights Defenders (MEA) http://www.martinennalsaward.org/
The Martin Ennals Award for Human Rights Defenders (MEA) is named after Martin Ennals, a fiercely devoted human rights defender. The Award is granted annually by a Jury of 10 international leading human rights organisations to an individual who is at risk, in recognition of his or her commitment in defence of human rights. The main purpose of the award lies in its PROTECTION. This is mostly achieved through media attention particularly in their country of origin of the laureate. The Martin Ennals Foundation’s archive contains videos, DVDs, press releases and other key documents related to human rights defenders around the world since 1993. The latest available material is a DVD in Arabic, English, French and German containing a 20’ summary of the annual ceremony of the Martin Ennals Award. The scenes selected focus on the 2005 MEA laureate, Aktham Naisse from Syria, showing his courageous work for human rights and democracy despite imprisonment, torture and harassment. The DVD also features the handing of the award by the UN High Commissioner for Human Rights. Highlights of the ceremony were broadcast by television networks such as Euronews on 12 October 2005, while the Laureate gave many interviews to Arabic and other radio and television channels.
Human Rights Video Project
http://www.humanrightsproject.org/
The Human Rights Video Project is a national library project created to increase public awareness of human rights issues through the medium of documentary films. The core of the program is a collection of 12 documentary films selected by a panel of human rights professionals, librarians and filmmakers. The project also encourages collaborations between public libraries and human rights advocacy organizations to present film screenings and discussion programs.
National Security Archive
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/
The NSA is a non-governmental research institute and library located at George Washington University in Washington, DC. The Archive collects and publishes declassified documents obtained through the Freedom of Information Act (FOIA).
Organizations for Audiovisual Archives and Human Rights Documentation
Association of Moving Image Archivists (AMIA)
http://www.amianet.org/
The AMIA site has some good resources on video care and preservation. In the past membership base has been drawn more from North America and the UK, but is increasingly international in scope. AMIA-L is a very active and useful listserv for anyone working with moving image materials.
International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA)
http://www.iasa-web.org/
IASA was founded in 1969 to foster co-operation among archives which preserve sound and moving image collections, and draws members from around the world. The web site is accessible in English, French, German and Spanish.
Independent Media Arts Preservation (IMAP)
http://www.imappreserve.org/
IMAP is a nonprofit service, education, and advocacy organization committed to the preservation of non-commercial electronic media. A very good site for all kinds of information pertaining to AV archiving. Has some concise info on formats, preservation and care. IMAP offers a low-cost cataloging template for non-profit media organizations.
Southeast Asia-Pacific Audiovisual Archive Association (SEAPAVAA)
http://www.seapavaa.org/
SEAPAVAA, founded in 1996, is an association of organizations and individuals involved in, or interested in the development of audiovisual archiving in a particular geographic region - the countries of Southeast Asia (the ten member nations of ASEAN), Australasia (Australia and New Zealand), and the Pacific Islands (Micronesia, Melanesia, Polynesia)
Huridocs
http://www.huridocs.org/
HURIDOCS (Human Rights Information and Documentation Systems, International), established in 1982, is a global network of human rights organizations concerned with human rights information. The web site provides access to numerous tools for human rights monitoring and documentation, bibliographic standards, indexing how-to, and human rights-specific thesauri."
Any link to other human-rights-related-archives is welcome!
Link: Witness.org
http://www.amnestyusa.org/about/archives.html
This collection will be moving to the Center for Human Rights and Documentation at Columbia University in Spring 2006. (see below)
Amnesty International Online Audiovisual Archive
http://www.amnesty.org/resources/audiovisual
Click on a world map to see recent videos by country.
Amnesty International Collection at World Images
http://www.world-images.org/amnesty/
Amnesty International’s archive contains over a thousand hours of footage dating from the, and includes video news releases, features, campaign videos, and original camera tapes. (Text results only)
Open Society Archives
http://www.osa.ceu.hu/
The Open Society Archives is an archives and a center for research and education. Its collections and activities relate to the period after the Second World War, in particular the Cold War, the history of the formerly communist countries, human rights, and war crimes. The audiovisual collection includes footage and oral histories relating to the 1956 Hungarian revolution, monitoring of Iraqi and Kurdish television, materials relating to the conflict in the former Yugoslavia, and selected footage from WITNESS.
Center for Human Rights Documentation and Research (CHRDR), Columbia University
(web site forthcoming)
In 2004, Columbia University was selected to administer the Archive of Human Rights Watch, the largest US-based human rights organization. This collection will soon be joined by Archives of other leading human rights organizations, including Amnesty International USA, Human Rights First, and Physicians for Human Rights.
Milosevic Trial Public Archive
http://hague.bard.edu/
Established by the Human Rights project at Bard College. Information, news and analysis about the trial of Slobodan Milosevic at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), including up-to-date video recordings, with audio in English, for the proceedings, ( http://hague.bard.edu/video.html ). A physical archive of broadcast-quality digital video (dvcam) is being stored at Bard and will be made permanently available to researchers.
UNICEF Video
http://www.unicef.org/videoaudio/video_catalogue.html
UNICEF produces and distributes video on issues affecting child rights and welfare, including armed conflict, emergencies, healthcare, immunization, labor, poverty, and development.
East Timor (Timor-Leste) Commission for Reception, Truth and Reconciliation (CAVR)
http://www.easttimor-reconciliation.org/
Timor-Leste's Truth Commission is collecting important materials and testimony from 1974-1999. There are plans to convert the Commission's building into a human rights centre, museum and archive.
Centro Audiovisual Max Stahl Timor-Leste (CAMS Timor-Leste)
http://www.shoalhaven.net.au/~mwsmith/aatlms.html
This archive contains the award-winning footage filmed by Max Stahl and by the leadership of East Timor's resistance, during the Timorese struggle for independence. Additionally, the center holds hundreds of hours of material documenting both the struggle and re-birth of traditional communities as parts of the world's newest nation.
Martin Ennals Award for Human Rights Defenders (MEA) http://www.martinennalsaward.org/
The Martin Ennals Award for Human Rights Defenders (MEA) is named after Martin Ennals, a fiercely devoted human rights defender. The Award is granted annually by a Jury of 10 international leading human rights organisations to an individual who is at risk, in recognition of his or her commitment in defence of human rights. The main purpose of the award lies in its PROTECTION. This is mostly achieved through media attention particularly in their country of origin of the laureate. The Martin Ennals Foundation’s archive contains videos, DVDs, press releases and other key documents related to human rights defenders around the world since 1993. The latest available material is a DVD in Arabic, English, French and German containing a 20’ summary of the annual ceremony of the Martin Ennals Award. The scenes selected focus on the 2005 MEA laureate, Aktham Naisse from Syria, showing his courageous work for human rights and democracy despite imprisonment, torture and harassment. The DVD also features the handing of the award by the UN High Commissioner for Human Rights. Highlights of the ceremony were broadcast by television networks such as Euronews on 12 October 2005, while the Laureate gave many interviews to Arabic and other radio and television channels.
Human Rights Video Project
http://www.humanrightsproject.org/
The Human Rights Video Project is a national library project created to increase public awareness of human rights issues through the medium of documentary films. The core of the program is a collection of 12 documentary films selected by a panel of human rights professionals, librarians and filmmakers. The project also encourages collaborations between public libraries and human rights advocacy organizations to present film screenings and discussion programs.
National Security Archive
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/
The NSA is a non-governmental research institute and library located at George Washington University in Washington, DC. The Archive collects and publishes declassified documents obtained through the Freedom of Information Act (FOIA).
Organizations for Audiovisual Archives and Human Rights Documentation
Association of Moving Image Archivists (AMIA)
http://www.amianet.org/
The AMIA site has some good resources on video care and preservation. In the past membership base has been drawn more from North America and the UK, but is increasingly international in scope. AMIA-L is a very active and useful listserv for anyone working with moving image materials.
International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA)
http://www.iasa-web.org/
IASA was founded in 1969 to foster co-operation among archives which preserve sound and moving image collections, and draws members from around the world. The web site is accessible in English, French, German and Spanish.
Independent Media Arts Preservation (IMAP)
http://www.imappreserve.org/
IMAP is a nonprofit service, education, and advocacy organization committed to the preservation of non-commercial electronic media. A very good site for all kinds of information pertaining to AV archiving. Has some concise info on formats, preservation and care. IMAP offers a low-cost cataloging template for non-profit media organizations.
Southeast Asia-Pacific Audiovisual Archive Association (SEAPAVAA)
http://www.seapavaa.org/
SEAPAVAA, founded in 1996, is an association of organizations and individuals involved in, or interested in the development of audiovisual archiving in a particular geographic region - the countries of Southeast Asia (the ten member nations of ASEAN), Australasia (Australia and New Zealand), and the Pacific Islands (Micronesia, Melanesia, Polynesia)
Huridocs
http://www.huridocs.org/
HURIDOCS (Human Rights Information and Documentation Systems, International), established in 1982, is a global network of human rights organizations concerned with human rights information. The web site provides access to numerous tools for human rights monitoring and documentation, bibliographic standards, indexing how-to, and human rights-specific thesauri."
Any link to other human-rights-related-archives is welcome!
Link: Witness.org
Wolf Thomas - am Sonntag, 9. August 2009, 18:23 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
She "graduated from Lehman College in 1971 and then worked as an editor at Hawthorn Books for eight years and then Dell Publishing for two years, where she was senior editor of trade paperbacks, before founding her own literary agency/book packaging firm, March Tenth, Inc., in 1980. Specializing in books on popular culture and rock music eventually led to a position as art director for Bruce Springsteen, whose record albums and merchandise she has been designing since 1984. Sandra Choron has served as a member of the board of directors of the American Book Producers Association and is the author of a number of books, including ROCKTOPICON coauthored with Dave Marsh in 1984; NATIONAL LAMPOON'S CLASS REUNION (1982); ELVIS:THE LAST WORD (1991); THE BOOK OF LISTS FOR KIDS (with Harry Choron, 1985, 1995, 2002); THE BOOK OF LISTS FOR TEENS (with Harry Choron, 2002);1,OO1 TIPS FOR CAREGIVERS (with Sasha Carr, 2002). She is a founding editor of the music and politics monthly newsletter Rock & Rap Confidential, now in its eighteenth year. In 1998 she taught a course in Book Publishing at Lehman College in New York City."
Link:
http://www.publishersmarketplace.com/members/MarchTenth/
Link:
http://www.publishersmarketplace.com/members/MarchTenth/
Wolf Thomas - am Sonntag, 9. August 2009, 18:21 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
It is not often the case that our own analyses of publisher journal price increases in liblicense-l or lis-e-resources trigger a comment of the analysts at Exane BNP Paribas, one of the top brokers for European Equities.
On July 6 we published our analyses on both the Springer 2010 price list (and SCOAP3) and the Elsevier 2010 subscription price list, which got quite some feedback on Twitter, especially our added message that "#Elsevier Medical titles increase by 7.5 % on average for 2010, some by as much as 25%." ( http://twitter.com/bckaemper/status/3171066523 ), a day later BNP Paribas submitted their comment to liblicense-l. As it was distributed only now (3 hrs ago) via liblicense-l and will appear on the liblicense-l web archive only next week, we quote it here in full:
For another illustration of the growing impact of hybrid open access programs on online journals prices, this time at Oxford University Press, cf. my newest posting to liblicense-l and lis-e-resources, Disturbing spread of dyscalculia in recent publisher price lists and announcements (Aug 7, 2009)
Bernd-Christoph Kämper (@bckaemper), Stuttgart University Library
On July 6 we published our analyses on both the Springer 2010 price list (and SCOAP3) and the Elsevier 2010 subscription price list, which got quite some feedback on Twitter, especially our added message that "#Elsevier Medical titles increase by 7.5 % on average for 2010, some by as much as 25%." ( http://twitter.com/bckaemper/status/3171066523 ), a day later BNP Paribas submitted their comment to liblicense-l. As it was distributed only now (3 hrs ago) via liblicense-l and will appear on the liblicense-l web archive only next week, we quote it here in full:
From: Sami Kassab [sami.kassab@exanebnpparibas.com]What BNP Paribas fails to emphasize is that it is not open access per se that is threatening Elsevier (High Energy Physics since long have had almost 100% open access uptake, so critical mass has long been reached in this special field, quite different from other physics areas), but that they are loosing the battle for authors, possibly due to their reluctance to support SCOAP3. As I wrote, they publish now considerably less than 4 years ago (update: about 30%, for more accurate updated estimates cf. the comment below) and seem to have lost in submissions from authors for their HEP journals. With such a reduction in size, prices also had to come down. In the new open access scholarly publishing market, journals will compete for authors even more than now. SCOAP3 certainly raised the awareness for both the scientific community's expectation to fully convert these journals to OA and the unsustainable prices that had risen to absurd record prices. It is clear that subscriptions are now under even more pressure because of the global economic crisis that especially hit american libraries very hard.
Sent: Friday, August 07, 2009 3:49 AM
Subject: Reed Elsevier (-): Announces higher journal price
increases than expected
Hello, please find enclosed a comment on Reed Elsevier (-)
regarding its 2010 science journal pricing announcement:
*Reed Elsevier has announced its 2010 journal price increases
Elsevier has just published its 2010 print journal price list. We
estimate the median price increases at 5% with key titles such as
The Lancet up 9.5% and Cell Press up 4%. While these price
increases only pertain to print-only subscriptions (c 10% of
divisional revenues), we believe they suggest that Elsevier has
maintained an aggressive pricing policy despite current library
budget constraints. Its main competitor, Springer, also announced
a 5% price increase for 2010.
* More aggressive pricing than expected
Given library budget pressure, we have assumed 2010 net price
increases of 3% in our model (0% for 2010 subscription renewals
and 5% for existing contracts), resulting in -1% Elsevier's
organic revenue decline in 2010. As is the case elsewhere in
Media, listed prices increases can vary considerably from net
price increases due to significant discounts. We expect pressure
on Elsevier's discounts and renewal rates to be under pressure in
the coming months. We maintain our 2010 organic revenue growth
forecasts for Elsevier but they now look conservative.
* Open Access is putting pressure on pricing
We see Elsevier's decision to cuts prices for its nuclear physics
journals by 20% as a reflection of the progress of Open Access,
which prevails in this discipline. Should Open Access reach
critical mass in other disciplines, similar pricing pressure is
likely. With the FRPAA act likely to pass in the US, Open Access
will continue to grow.
* Cautious view maintained
We continue to believe the stock could remain 'dead money' until
further clarification of the new investment budget and 2010
top-line trends. While we would close short positions, we
continue to prefer Pearson (+) and Wolters Kluwer (-) in
publishing.
Sami Kassab
--------------------------------------------------------
Exane BNP Paribas
Office: + 44 20 7039 9448
Mobile:+ 44 7795 528 365
For another illustration of the growing impact of hybrid open access programs on online journals prices, this time at Oxford University Press, cf. my newest posting to liblicense-l and lis-e-resources, Disturbing spread of dyscalculia in recent publisher price lists and announcements (Aug 7, 2009)
Bernd-Christoph Kämper (@bckaemper), Stuttgart University Library
BCK - am Sonntag, 9. August 2009, 05:07 - Rubrik: Open Access
Mit Erstaunen sah ich in Felix Heinzers Besprechung des Bandes "Ochsenkopf und Meerjungfrau" (2006) in der ZWLG 68 (2009), S. 493-495, hier S. 494, Klaus Grafs "wichtige ... Wortmeldung" sei für die Bibliographie nachzutragen:
Klaus Graf, Vorschläge zur Wasserzeichendatierung von Handschriften, in: Gazette du livre médiéval Nr. 16, Printemps 1990, S. 8-11
Ich wähnte dieses kurze Elaborat für gänzlich vergessen.
Ich dokumentiere im folgenden den Text und füge ein Nachwort 2009 an.
VORSCHLÄGE ZUR WASSERZEICHENDATIERUNG VON HANDSCHRIFTEN
Nach:
http://www.aedph.uni-bayreuth.de/1999/0197.html
Ausgangspunkt des folgenden Diskussionspapiers sind eigene Erfahrungen
mit Wasserzeichendatierungen, zuletzt mit einer deutschsprachigen
Sammelhandschrift des 15./16. Jahrhunderts. Zwei Aussagen über die
Wasserzeichen der Handschrift aus den Jahren 1935 (Beschreibung durch
die Berliner Akademie) und 1984 stimmen darin überein, dass lediglich
zwei Typen, ein Ochsenkopf- und ein Turmwasserzeichen, vertreten seien.
Bei der Durchsicht der Handschrift wählte ich gut erhaltene
Wasserzeichen auf vier zusammengehörigen Blättern aus und bat um
Abzeichnungen auf Transparentpapier, die von Seiten der Bibliothek
freundlicherweise angefertigt wurden. Der Befund: Statt von einem, muss
von drei verschiedenen Ochsenkopf-Wasserzeichen ausgegangen werden. Die
Konsequenz: Für den ersten der drei Teile der Handschrift liegt keine
Wasserzeichendatierung vor, da die Abzeichnungen aus diesem Teil
aufgrund des Verlusts durch den Falz und der Unmöglichkeit, den Zusatz
auf der Stange des Ochsenkopfes zu identifizieren, für eine nähere
Bestimmung nicht deutlich genug waren (Details in meiner Beschreibung:
"Die Weimarer Handschrift Q 127 ...", in: Zeitschrift für deutsches
Altertum ... 1989 H. 4 oder 1990 H. 1, Anm. 9). Es handelt sich dabei um
ein Beispiel für die von Van der Horst [im gleichen Heft der Gazette, KG 2009] erwähnten praktischen
Schwierigkeiten, zu korrekten Wiedergaben zu kommen.
Das eigentliche Problem besteht jedoch in der von Van der Horst
angesprochenen Frage nach den Identitätskriterien für Wasserzeichen bzw.
Wasserzeichen-Typen. Um sicher zu gehen, dass alle Wasserzeichen-Typen
der Handschrift erfasst sind, hätte ich jedes einzelne
Wasserzeichen-Vorkommen abzeichnen bzw. mit bereits gefertigten
Abzeichnungen vergleichen müssen - ein Aufwand, den der einzelne
Forscher mit gutem Grund scheut. Verlässt man sich - wie die beiden
früheren Beschreibungen - auf Stichproben, so sollte man dies explizit
erwähnen und die gewählte Stichprobe kurz charakterisieren, damit es
nicht zu Fehlschlüssen kommt.
Je länger ich gelegentlich (d.h. ohne die Routine eines
professionellen Handschriftenbeschreibers) Wasserzeichen abpauste und zu
bestimmen versuchte (nach den Findbüchern oder anhand der
Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart), um so mehr
wuchs mein Unbehagen. In Bibliotheken und Archiven begegnete ich
Hilfsbereitschaft, freilich wiederholt gepaart mit Unkenntnis oder
Desinteresse. Wer immer die Piccardschen Bände benutzt, tut dies ohne
veröffentlichte Anleitung - mit welchen Kriterien er eine
Wasserzeichen-Abbildung für die Datierung der ihm vorliegenden
Wiedergabe heranziehen darf, bleibt offen. Mit anderen Worten: Die
Wasserzeichenkunde erscheint von aussen als "Geheimwissenschaft", deren
Jünger mit trügerischer Sicherheit handeln. Da man ungern erkennen
lassen will, dass man nicht dazugehört, gaukelt man eine Gewissheit vor,
die in Wirklichkeit nicht besteht.
Zugegeben, "Wursteln" ist oft ein effizientes Verfahren und in den
meisten Fällen dürfte man auch mit dilettantischen Methoden das
gewünschte Ziel einer ungefähren Datierung erreichen. Trotzdem ist es,
wie ich meine, an der Zeit, darüber zu diskutieren, ob nicht
Alternativen wünschenswert bzw. realisierbar sind. Dem sollen die
folgenden Vorschläge dienen, die natürlich nicht nur für die
Handschriftenabteilungen von Bibliotheken, sondern auch für Archive
gelten können.
Zunächst ist festzustellen: Wasserzeichendatierungen von solchen
undatierten Papierhandschriften, die nicht hinreichend genau inhaltlich
datiert werden können, sind für die Forschung unverzichtbar. Das
Vorliegen solcher Datierungen liegt im Interesse von Forschern und
Bibliotheken.
Das optimistisch stimmende Ergebnis des von Van der Horst
durchgeführten Vergleiches lässt ja erkennen, dass
Wasserzeichendatierungen ein zuverlässiges Hilfsmittel sein können.
Voraussetzung der Wasserzeichendatierung ist das Vorliegen einer
Wasserzeichen-Wiedergabe. Diese ist nach demjenigen Verfahren
herzustellen, das der Bibliothek unter Berücksichtung der Interessen des
Forschers aus Kosten-, Zeit- und konservatorischen Gründen vertretbar
erscheint.
Zu unterscheiden sind als Verfahren 1. die Handpause und andere
durchlichtabhängige Wiedergaben, gegen die aus konservatorischen Gründen
Bedenken anzumelden sind, 2. die Abreibung, die auch bei beschriebenen
Blättern gute Ergebnisse liefert (Wolfgang Haupt,
"Wasserzeichenwiedergabe in schwierigen Fällen", in: Maltechnik
1/Restauro 87, 1981, Januar, 38-43) sowie 3. die Beta-Radiographie als
das Verfahren mit optimalen Ergebnissen, das jedoch auch am
aufwendigsten und kostenintensivsten ist (vgl. mit weiteren Nachweisen:
Eva Ziesche/Dirk Schnitger, "Datierung des Heldenbuchs aus der
Untersuchung seiner Papiere", in: Heldenbuch, hrsg. von Joachim Heinzle,
Bd. 2, Göppingen 1987, 173-204).
Zwar könnte eine Bibliothek jegliche Wasserzeichenwiedergabe durch
den Benutzer untersagen, doch sollte stattdessen im Interesse der
Forschung ein Kompromiss gefunden werden (Beschränkung der Anzahl der
Wiedergaben, Herstellung durch die Bibliothek o.ä.).
Vorschlag: Wasserzeichen-Wiedergaben von Handschriften einer
Bibliothek sind von dieser zu verwahren, nach Typen zu erschliessen und
Benutzern zugänglich zu machen.
Gründe dieses von Johannes Janota geäusserten Vorschlags sind vor
allem die Vermeidung wissenschaftlicher Doppelarbeit und
konservatorische Rücksichten; erfreulicher Nebeneffekt wäre die
Erstellung einer wasserzeichenkundlichen Sammlung, die unaufwendig durch
eine Kartei (Datei) nach Briquet- bzw. Piccard-Typen erschlossen werden
könnte. Weshalb müssen von bestimmten oft beschriebenen Handschriften
jedesmal neu Handpausen angefertigt werden? Müssen diese oder andere
Wiedergaben - nötigenfalls mit Benutzungssperre bis zur Publikation - in
Kopie bei der Bibliothek hinterlegt werden, so können nachträglich noch
nicht bei Piccard veröffentlichte Typen datiert werden.
Dies betrifft natürlich insbesondere die aufgrund der DFG-Richtlinien
Handschriftenkatalogisierung erstellten Wasserzeichen-Wiedergaben (3.
Aufl. 1983, 9: "WASSERZEICHEN, sofern so genau bestimmbar, dass ein
Anhaltspunkt für die Datierung gewonnen werden kann"), die derzeit in
der Regel im Privateigentum des Handschriftenbeschreibers verschwinden.
Vorschlag: Die Wasserzeichen-Analyse einer Handschrift durch Forscher
oder Bibliothek ist möglichst umfassend zu dokumentieren. (Von wem
wurden wann mit welchem Verfahren welche Wasserzeichen auf welchen
Blättern der Handschrift wiedergegeben und mit welchen Quellen
bestimmt?)
Diese Dokumentation kann in einer eigenen Akte zur Handschrift
erfolgen, die Wiedergaben und ggf. Expertisen enthält. Diese Akte kann
als Beiakte zu sonstigen Unterlagen zur jeweiligen Handschrift geführt
werden (z.B. Vorarbeiten für eine Handschriftenbeschreibung, die nur
z.T. veröffentlicht werden können). Es versteht sich von selbst, dass
Wiedergaben und Bestimmungen wissenschaftliche Leistungen sind, die
redlicherweise mit Quellenangabe zu zitieren sind.
Ob zwei in einer Handschrift auftretende Wasserzeichen "identisch"
bzw. "sehr ähnlich" sind, lässt sich in vielen Fällen, wie oben bereits
festgestellt, nur entscheiden, wenn Wiedergaben vorgenommen wurden. Es
entspricht wissenschaftlicher Redlichkeit, den aufgrund von flüchtiger
Analyse (die in der Regel pragmatisch gerechtfertigt werden kann)
auftretenden Unsicherheitsfaktor zu benennen.
Als Bestimmungshilfsmittel ist die von Piccard angelegte
Wasserzeichenkartei des Hauptstaatsarchivs Stuttgart zu nennen. So kam
Jörn Reichel durch ihre Benutzung zu genaueren Ergebnissen bei der
Datierung von Rosenplüt-Handschriften (Der Spruchdichter Hans Rosenplüt,
Stuttgart 1985, 226 u.ö.). Nur in kleinerem Umfang beantwortet das
genannte Archiv auch schriftliche Anfragen. Zur Problematik der
Piccardschen Kartei und Findbücher vgl. ausser den von Van der Horst
genannten Titeln Christoph Petzsch, "Wasserzeichen und Provenienz der
'Kolmarer Liederhandschrift' (Cgm 4997)", in: Zeitschrift für deutsches
Altertum ... 99 (1988), 201-210; Otto Kresten, in: Mitteilungen des
Instituts für österr. Geschichtsforschung 96 (1988), 439-443.
NACHWORT 2009
Durch die Zugänglichkeit der Wasserzeichenkartei Piccard online ist ein Problem entschärft, das ich damals ansprach.
http://www.piccard-online.de/start.php
Die Kooperation des Bernstein-Konsortiums
http://www.bernstein.oeaw.ac.at/
zeigt, dass die Zukunft der Wasserzeichenforschung digital ist, dass also Wasserzeichenreproduktionen tunlichst im Internet veröffentlicht werden.
Dass man skrupulöser mit Wasserzeichendatierungen umgehen sollte, denke ich heute noch. Neben Großprojekten wie BERNSTEIN sollte es vernetzte Wasserzeichen-Dokumentationen geben.
Jede Abzeichnung oder andere Reproduktion, die von einem Benutzer oder einer Bibliothek erstellt wurde oder ihr vorliegt, sollte digitalisiert und im Internet zugänglich gemacht werden. Selbstverständlich ist darauf zu achten, dass Metadaten diesen Wasserzeichenbildern beigegeben werden, die eine Verknüpfung mit den zentralen Referenz-Werken (Briquet, Piccard etc.) erlauben.
Und es sollte ein Wiki geben, das - gemäß Web 2.0 - es ermöglicht, dass Forscher eigene Wasserzeichenabzeichnungen hochladen und über Datierungen diskutieren können.
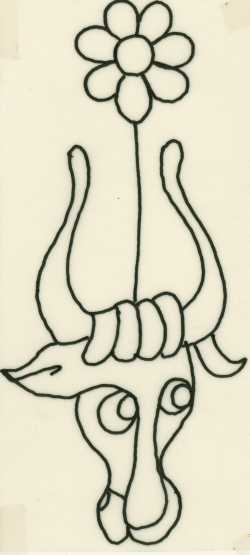
Klaus Graf, Vorschläge zur Wasserzeichendatierung von Handschriften, in: Gazette du livre médiéval Nr. 16, Printemps 1990, S. 8-11
Ich wähnte dieses kurze Elaborat für gänzlich vergessen.
Ich dokumentiere im folgenden den Text und füge ein Nachwort 2009 an.
VORSCHLÄGE ZUR WASSERZEICHENDATIERUNG VON HANDSCHRIFTEN
Nach:
http://www.aedph.uni-bayreuth.de/1999/0197.html
Ausgangspunkt des folgenden Diskussionspapiers sind eigene Erfahrungen
mit Wasserzeichendatierungen, zuletzt mit einer deutschsprachigen
Sammelhandschrift des 15./16. Jahrhunderts. Zwei Aussagen über die
Wasserzeichen der Handschrift aus den Jahren 1935 (Beschreibung durch
die Berliner Akademie) und 1984 stimmen darin überein, dass lediglich
zwei Typen, ein Ochsenkopf- und ein Turmwasserzeichen, vertreten seien.
Bei der Durchsicht der Handschrift wählte ich gut erhaltene
Wasserzeichen auf vier zusammengehörigen Blättern aus und bat um
Abzeichnungen auf Transparentpapier, die von Seiten der Bibliothek
freundlicherweise angefertigt wurden. Der Befund: Statt von einem, muss
von drei verschiedenen Ochsenkopf-Wasserzeichen ausgegangen werden. Die
Konsequenz: Für den ersten der drei Teile der Handschrift liegt keine
Wasserzeichendatierung vor, da die Abzeichnungen aus diesem Teil
aufgrund des Verlusts durch den Falz und der Unmöglichkeit, den Zusatz
auf der Stange des Ochsenkopfes zu identifizieren, für eine nähere
Bestimmung nicht deutlich genug waren (Details in meiner Beschreibung:
"Die Weimarer Handschrift Q 127 ...", in: Zeitschrift für deutsches
Altertum ... 1989 H. 4 oder 1990 H. 1, Anm. 9). Es handelt sich dabei um
ein Beispiel für die von Van der Horst [im gleichen Heft der Gazette, KG 2009] erwähnten praktischen
Schwierigkeiten, zu korrekten Wiedergaben zu kommen.
Das eigentliche Problem besteht jedoch in der von Van der Horst
angesprochenen Frage nach den Identitätskriterien für Wasserzeichen bzw.
Wasserzeichen-Typen. Um sicher zu gehen, dass alle Wasserzeichen-Typen
der Handschrift erfasst sind, hätte ich jedes einzelne
Wasserzeichen-Vorkommen abzeichnen bzw. mit bereits gefertigten
Abzeichnungen vergleichen müssen - ein Aufwand, den der einzelne
Forscher mit gutem Grund scheut. Verlässt man sich - wie die beiden
früheren Beschreibungen - auf Stichproben, so sollte man dies explizit
erwähnen und die gewählte Stichprobe kurz charakterisieren, damit es
nicht zu Fehlschlüssen kommt.
Je länger ich gelegentlich (d.h. ohne die Routine eines
professionellen Handschriftenbeschreibers) Wasserzeichen abpauste und zu
bestimmen versuchte (nach den Findbüchern oder anhand der
Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart), um so mehr
wuchs mein Unbehagen. In Bibliotheken und Archiven begegnete ich
Hilfsbereitschaft, freilich wiederholt gepaart mit Unkenntnis oder
Desinteresse. Wer immer die Piccardschen Bände benutzt, tut dies ohne
veröffentlichte Anleitung - mit welchen Kriterien er eine
Wasserzeichen-Abbildung für die Datierung der ihm vorliegenden
Wiedergabe heranziehen darf, bleibt offen. Mit anderen Worten: Die
Wasserzeichenkunde erscheint von aussen als "Geheimwissenschaft", deren
Jünger mit trügerischer Sicherheit handeln. Da man ungern erkennen
lassen will, dass man nicht dazugehört, gaukelt man eine Gewissheit vor,
die in Wirklichkeit nicht besteht.
Zugegeben, "Wursteln" ist oft ein effizientes Verfahren und in den
meisten Fällen dürfte man auch mit dilettantischen Methoden das
gewünschte Ziel einer ungefähren Datierung erreichen. Trotzdem ist es,
wie ich meine, an der Zeit, darüber zu diskutieren, ob nicht
Alternativen wünschenswert bzw. realisierbar sind. Dem sollen die
folgenden Vorschläge dienen, die natürlich nicht nur für die
Handschriftenabteilungen von Bibliotheken, sondern auch für Archive
gelten können.
Zunächst ist festzustellen: Wasserzeichendatierungen von solchen
undatierten Papierhandschriften, die nicht hinreichend genau inhaltlich
datiert werden können, sind für die Forschung unverzichtbar. Das
Vorliegen solcher Datierungen liegt im Interesse von Forschern und
Bibliotheken.
Das optimistisch stimmende Ergebnis des von Van der Horst
durchgeführten Vergleiches lässt ja erkennen, dass
Wasserzeichendatierungen ein zuverlässiges Hilfsmittel sein können.
Voraussetzung der Wasserzeichendatierung ist das Vorliegen einer
Wasserzeichen-Wiedergabe. Diese ist nach demjenigen Verfahren
herzustellen, das der Bibliothek unter Berücksichtung der Interessen des
Forschers aus Kosten-, Zeit- und konservatorischen Gründen vertretbar
erscheint.
Zu unterscheiden sind als Verfahren 1. die Handpause und andere
durchlichtabhängige Wiedergaben, gegen die aus konservatorischen Gründen
Bedenken anzumelden sind, 2. die Abreibung, die auch bei beschriebenen
Blättern gute Ergebnisse liefert (Wolfgang Haupt,
"Wasserzeichenwiedergabe in schwierigen Fällen", in: Maltechnik
1/Restauro 87, 1981, Januar, 38-43) sowie 3. die Beta-Radiographie als
das Verfahren mit optimalen Ergebnissen, das jedoch auch am
aufwendigsten und kostenintensivsten ist (vgl. mit weiteren Nachweisen:
Eva Ziesche/Dirk Schnitger, "Datierung des Heldenbuchs aus der
Untersuchung seiner Papiere", in: Heldenbuch, hrsg. von Joachim Heinzle,
Bd. 2, Göppingen 1987, 173-204).
Zwar könnte eine Bibliothek jegliche Wasserzeichenwiedergabe durch
den Benutzer untersagen, doch sollte stattdessen im Interesse der
Forschung ein Kompromiss gefunden werden (Beschränkung der Anzahl der
Wiedergaben, Herstellung durch die Bibliothek o.ä.).
Vorschlag: Wasserzeichen-Wiedergaben von Handschriften einer
Bibliothek sind von dieser zu verwahren, nach Typen zu erschliessen und
Benutzern zugänglich zu machen.
Gründe dieses von Johannes Janota geäusserten Vorschlags sind vor
allem die Vermeidung wissenschaftlicher Doppelarbeit und
konservatorische Rücksichten; erfreulicher Nebeneffekt wäre die
Erstellung einer wasserzeichenkundlichen Sammlung, die unaufwendig durch
eine Kartei (Datei) nach Briquet- bzw. Piccard-Typen erschlossen werden
könnte. Weshalb müssen von bestimmten oft beschriebenen Handschriften
jedesmal neu Handpausen angefertigt werden? Müssen diese oder andere
Wiedergaben - nötigenfalls mit Benutzungssperre bis zur Publikation - in
Kopie bei der Bibliothek hinterlegt werden, so können nachträglich noch
nicht bei Piccard veröffentlichte Typen datiert werden.
Dies betrifft natürlich insbesondere die aufgrund der DFG-Richtlinien
Handschriftenkatalogisierung erstellten Wasserzeichen-Wiedergaben (3.
Aufl. 1983, 9: "WASSERZEICHEN, sofern so genau bestimmbar, dass ein
Anhaltspunkt für die Datierung gewonnen werden kann"), die derzeit in
der Regel im Privateigentum des Handschriftenbeschreibers verschwinden.
Vorschlag: Die Wasserzeichen-Analyse einer Handschrift durch Forscher
oder Bibliothek ist möglichst umfassend zu dokumentieren. (Von wem
wurden wann mit welchem Verfahren welche Wasserzeichen auf welchen
Blättern der Handschrift wiedergegeben und mit welchen Quellen
bestimmt?)
Diese Dokumentation kann in einer eigenen Akte zur Handschrift
erfolgen, die Wiedergaben und ggf. Expertisen enthält. Diese Akte kann
als Beiakte zu sonstigen Unterlagen zur jeweiligen Handschrift geführt
werden (z.B. Vorarbeiten für eine Handschriftenbeschreibung, die nur
z.T. veröffentlicht werden können). Es versteht sich von selbst, dass
Wiedergaben und Bestimmungen wissenschaftliche Leistungen sind, die
redlicherweise mit Quellenangabe zu zitieren sind.
Ob zwei in einer Handschrift auftretende Wasserzeichen "identisch"
bzw. "sehr ähnlich" sind, lässt sich in vielen Fällen, wie oben bereits
festgestellt, nur entscheiden, wenn Wiedergaben vorgenommen wurden. Es
entspricht wissenschaftlicher Redlichkeit, den aufgrund von flüchtiger
Analyse (die in der Regel pragmatisch gerechtfertigt werden kann)
auftretenden Unsicherheitsfaktor zu benennen.
Als Bestimmungshilfsmittel ist die von Piccard angelegte
Wasserzeichenkartei des Hauptstaatsarchivs Stuttgart zu nennen. So kam
Jörn Reichel durch ihre Benutzung zu genaueren Ergebnissen bei der
Datierung von Rosenplüt-Handschriften (Der Spruchdichter Hans Rosenplüt,
Stuttgart 1985, 226 u.ö.). Nur in kleinerem Umfang beantwortet das
genannte Archiv auch schriftliche Anfragen. Zur Problematik der
Piccardschen Kartei und Findbücher vgl. ausser den von Van der Horst
genannten Titeln Christoph Petzsch, "Wasserzeichen und Provenienz der
'Kolmarer Liederhandschrift' (Cgm 4997)", in: Zeitschrift für deutsches
Altertum ... 99 (1988), 201-210; Otto Kresten, in: Mitteilungen des
Instituts für österr. Geschichtsforschung 96 (1988), 439-443.
NACHWORT 2009
Durch die Zugänglichkeit der Wasserzeichenkartei Piccard online ist ein Problem entschärft, das ich damals ansprach.
http://www.piccard-online.de/start.php
Die Kooperation des Bernstein-Konsortiums
http://www.bernstein.oeaw.ac.at/
zeigt, dass die Zukunft der Wasserzeichenforschung digital ist, dass also Wasserzeichenreproduktionen tunlichst im Internet veröffentlicht werden.
Dass man skrupulöser mit Wasserzeichendatierungen umgehen sollte, denke ich heute noch. Neben Großprojekten wie BERNSTEIN sollte es vernetzte Wasserzeichen-Dokumentationen geben.
Jede Abzeichnung oder andere Reproduktion, die von einem Benutzer oder einer Bibliothek erstellt wurde oder ihr vorliegt, sollte digitalisiert und im Internet zugänglich gemacht werden. Selbstverständlich ist darauf zu achten, dass Metadaten diesen Wasserzeichenbildern beigegeben werden, die eine Verknüpfung mit den zentralen Referenz-Werken (Briquet, Piccard etc.) erlauben.
Und es sollte ein Wiki geben, das - gemäß Web 2.0 - es ermöglicht, dass Forscher eigene Wasserzeichenabzeichnungen hochladen und über Datierungen diskutieren können.
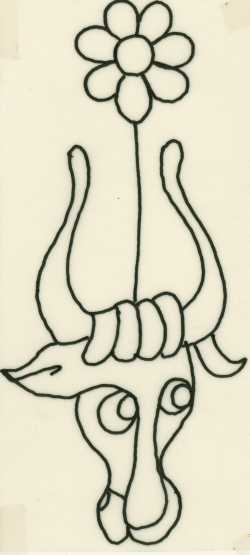
KlausGraf - am Sonntag, 9. August 2009, 04:19 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Artikel über Angehörige von Adelsfamilien in der Wikipedia sind überdurchschnittlich oft unterdurchschnittlich schlecht oder gar völlig unbrauchbar. Wenn man deutliche Worte wagt, wird
a) man gesperrt (vom Möchtegern-Diktator der Wikipedia Southpark)
b) der Löschantrag wird abgeschmettert.
Sowohl die Teilnehmer am "Review" als auch die Angehörigen der "Redaktion Geschichte" sind offenkundig ganz und gar inkompetent.
Weiteres Beispiel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Trojaburg_Calbe
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Redaktion_Geschichte/Qualitätssicherung&diff=63022550&oldid=63022392
a) man gesperrt (vom Möchtegern-Diktator der Wikipedia Southpark)
b) der Löschantrag wird abgeschmettert.
Sowohl die Teilnehmer am "Review" als auch die Angehörigen der "Redaktion Geschichte" sind offenkundig ganz und gar inkompetent.
Weiteres Beispiel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Trojaburg_Calbe
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Redaktion_Geschichte/Qualitätssicherung&diff=63022550&oldid=63022392
http://www.infoclio.ch/
Selten etwas Uninspirierteres gesehen, auch wenn es etwas über Open Access gibt und ein Blog.
Selten etwas Uninspirierteres gesehen, auch wenn es etwas über Open Access gibt und ein Blog.
http://www.abendblatt.de/vermischtes/article1129033/Ungewoehnliche-Chihuahuas-Das-Herz-als-rechter-Fleck.html
Danke an netbib.
Danke an netbib.
KlausGraf - am Sonntag, 9. August 2009, 01:14 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Beginnen wir diesen Text mit einem Kalauer: Matthew Herbert hat bisher kein Schwein gehabt. Seit der Ankündigung Ende Mai wartet der britische Musiker vergeblich auf die Geburt eines Ferkels, dessen Leben und Tod er im weiteren Verlauf akustisch einzufangen und in Albumform zu bringen gedenkt. Kein Wunder also, dass sich der derzeit unterbeschäftigte Herbert nach anderen Projekten umsieht. Ende September erfolgt der Beschäftigungstherapie erster Streich, Matthew Herbert plant eine Hommage an eine der reinsten Formen des Feierns von Musik: Herbert wird den Offenbacher Club Robert Johnson samt Publikum und Toiletten vertonen.
Die Aufnahmen werden zwischen 20 und 22 Uhr stattfinden, das gesamte Gebäude wird dann mit Mikrofonen im Innen- und Außenbereich ausgestattet sein, jeder Gast ist zur Geräuschproduktion aufgerufen. Am Ende soll ein Album entstehen, welches ausschließlich aus den mitgeschnittenen Geräuschen jenes Abends angefertigt wird. Alle Teilnehmer werden zudem – sofern gewünscht – in den Credits des Albums vermerkt, zudem soll jeder Kontributor eine kostenlose CD der Platte erhalten. Ob das Projekt in der Robert-Johnson-eigenen Veröffentlichungs-Reihe »Live at …« erscheinen wird, ist derzeit offen.
»I wanted to create a document, almost a living archive of the people and atmospheres of a modern night club«, erklärt Herbert die Idee zur Aufnahme. »I wanted to celebrate some of the great experiences and communities that exist in such a temporary way in clubs. I’m interested in the possibility sound recording has of rendering the temporary more permanent.«
Er habe das Robert Johnson gewählt, weil er an den Club – verglichen mit vielen anderen weltweit – eine weit zurückreichende Erinnerung und Verbindung habe. Und dank der traditionellen Begeisterung Deutschlands für (elektronische) Tanzmusik sei es die naheliegendste Entscheidung für dieses Projekt gewesen. Abschließend teilt Herbert mit: »I'm not entirely sure what will happen on September 30th, although I do have a plan and some microphones. All i need now is a bumping crowd. So please come down and help us make it a record to remember.«
Der einzige wahre Nachteil: bei dem 30. September handelt es sich um einen Mittwoch."
Quelle: Spex
Homepage Herberts: http://www.matthewherbert.com
Link zum "Schweine-Projekt": http://thisisapig.blogspot.com
Homepage des "Robert Johnson": http://www.robert-johnson.de
Die Aufnahmen werden zwischen 20 und 22 Uhr stattfinden, das gesamte Gebäude wird dann mit Mikrofonen im Innen- und Außenbereich ausgestattet sein, jeder Gast ist zur Geräuschproduktion aufgerufen. Am Ende soll ein Album entstehen, welches ausschließlich aus den mitgeschnittenen Geräuschen jenes Abends angefertigt wird. Alle Teilnehmer werden zudem – sofern gewünscht – in den Credits des Albums vermerkt, zudem soll jeder Kontributor eine kostenlose CD der Platte erhalten. Ob das Projekt in der Robert-Johnson-eigenen Veröffentlichungs-Reihe »Live at …« erscheinen wird, ist derzeit offen.
»I wanted to create a document, almost a living archive of the people and atmospheres of a modern night club«, erklärt Herbert die Idee zur Aufnahme. »I wanted to celebrate some of the great experiences and communities that exist in such a temporary way in clubs. I’m interested in the possibility sound recording has of rendering the temporary more permanent.«
Er habe das Robert Johnson gewählt, weil er an den Club – verglichen mit vielen anderen weltweit – eine weit zurückreichende Erinnerung und Verbindung habe. Und dank der traditionellen Begeisterung Deutschlands für (elektronische) Tanzmusik sei es die naheliegendste Entscheidung für dieses Projekt gewesen. Abschließend teilt Herbert mit: »I'm not entirely sure what will happen on September 30th, although I do have a plan and some microphones. All i need now is a bumping crowd. So please come down and help us make it a record to remember.«
Der einzige wahre Nachteil: bei dem 30. September handelt es sich um einen Mittwoch."
Quelle: Spex
Homepage Herberts: http://www.matthewherbert.com
Link zum "Schweine-Projekt": http://thisisapig.blogspot.com
Homepage des "Robert Johnson": http://www.robert-johnson.de
Wolf Thomas - am Samstag, 8. August 2009, 19:19 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Beat Mazenauer empfiehlt: "Gerhard Roths siebenbändiger Zyklus "Die Archive des Schweigens" (1980-1991) ist die politisch brisante Bestandesaufnahme eines Landes, das sich nach 1945 in Schweigen hüllte und nach aussen gerne eine harmlose Idylle vorspiegelte. Der Vielzahl der Bände entspricht die stilistische Vielfalt, mit der Roth Musils "Utopie der Exaktheit" wieder aufleben lässt als Versuch, das Unzusammenhängende zu beschreiben, um "mit der genaueren Kenntnis des Zusammenhangs" dahinter vielleicht einen Sinn zu entdecken. Roth dokumentiert, analysiert und fabuliert mit einer Subtilität und Präzision, die sich nie in ein geschlossenes Erzähl- und Erklärungsmuster eingraben. Deutlich wird dies an der Hauptfigur im zentralen Roman "Landläufiger Tod", dem genialischen, doch stummen, schizophrenen Franz Lindner. Die "Archive" werfen ein Tiefenlot hinab in verdrängte Abgründe, deren Zentrum gewissermassen die Kapuzinergruft ist, die in der brillanten "Reise ins Innere von Wien" als Endlager der Geschichte beschrieben wird.
Gerhard Roth hat mit diesem "opus magnum" eines der grossen Bücher der österreichischen Literatur der Nachkriegszeit vorgelegt."
Quelle:
http://www.readme.cc/de/buchtipps-leser/buchtipp/showbooktip/401/
s. a.
http://archiv.twoday.net/stories/4166063/
http://archiv.twoday.net/stories/4947931/
Gerhard Roth hat mit diesem "opus magnum" eines der grossen Bücher der österreichischen Literatur der Nachkriegszeit vorgelegt."
Quelle:
http://www.readme.cc/de/buchtipps-leser/buchtipp/showbooktip/401/
s. a.
http://archiv.twoday.net/stories/4166063/
http://archiv.twoday.net/stories/4947931/
Wolf Thomas - am Samstag, 8. August 2009, 19:15 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Stadtarchiv hat den vollständigen Fotonachlass des bekannten Kameramannes und Fotografen Matthias Neumann erhalten. Der Nachlass umfasst über 1000 Fotografien und dazugehörige Beschreibungen. Neumanns Bilder entstanden in den 1980er Jahren und zeigen die ungeschminkte Dresdner Welt. Besondere Aufmerksamkeit widmete er dem „Planquadrat Dresden“ mit dem Blauen Wunder. Er stieg unerkannt auf die Spitze der Brücke, um zu fotografieren. Die Aufnahmen zeigen die Enge der Elblandschaft, aber auch den Verfall der Bausubstanz.
Eine Auswahl der Fotos von Matthias Naumann wird in der Ausstellung vom 19. Januar bis 19. März 2010 im Stadtarchiv neben vielen anderen Bildern und Dokumenten zu sehen sein. Sie wird anlässlich eines Jubiläums vorbereitet: Im Januar 2010 befindet sich das Stadtarchiv Dresden seit zehn Jahren im neuen Haus auf dem Areal der Königlich-Sächsischen Heeresbäckerei. "
Übrigens scheinen Heeresbäckereien ja bevorzugte Archivstandorte zu werden - s. a. das Technische Zentrum des Landesarchivs NRW in Münster.
Quelle: Dresden Fernsehen
Bild ergänzt von BCK 08.08.2009 (Quelle: Sachsen-Fernsehen / Stadtarchiv Dresden)

Update 25.8.2009 BCK:
Biographische Notiz aus dem Bildband "Dresden im Schatten des Blauen Wunders" (München 1990, S. 144):
Eine Auswahl der Fotos von Matthias Naumann wird in der Ausstellung vom 19. Januar bis 19. März 2010 im Stadtarchiv neben vielen anderen Bildern und Dokumenten zu sehen sein. Sie wird anlässlich eines Jubiläums vorbereitet: Im Januar 2010 befindet sich das Stadtarchiv Dresden seit zehn Jahren im neuen Haus auf dem Areal der Königlich-Sächsischen Heeresbäckerei. "
Übrigens scheinen Heeresbäckereien ja bevorzugte Archivstandorte zu werden - s. a. das Technische Zentrum des Landesarchivs NRW in Münster.
Quelle: Dresden Fernsehen
Bild ergänzt von BCK 08.08.2009 (Quelle: Sachsen-Fernsehen / Stadtarchiv Dresden)
Update 25.8.2009 BCK:
Biographische Notiz aus dem Bildband "Dresden im Schatten des Blauen Wunders" (München 1990, S. 144):
Matthias Neumann (Jahrgang 1944), Dipl. Ing., in Dresden geboren, freier Fotograf, Schnittmeister, Kamera-Assistent und Kameramann, studierte an der Technischen Universität Dresden. Seit 1984 für ZDF und ARD in der Bundesrepublik tätig.Laut Mitteilung des Stadtarchivs Dresden 2008 verstorben.
Wolf Thomas - am Samstag, 8. August 2009, 17:14 - Rubrik: Fotoueberlieferung
"Zum 100. Geburtstag der Jugendherbergen hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) für das Bildarchiv in seinem LWL-Medienzentrums einen besonderen fotografischen Schatz aus der Frühzeit dieser Einrichtungen gehoben und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht: Den fotografischen Nachlass Richard Schirrmanns (1874 -1961), des Gründers der weltumspannenden Jugendherbergsbewegung, deren Wurzeln bekanntlich in Westfalen liegen.
"Der im sauerländischen Altena tätige Lehrer war ein passionierter Fotograf und Fotosammler, der sowohl die Stationen seines eigenen Lebens als auch die Entwicklung seines Lebenswerkes in zahlreichen Bildern festhielt", sagt Dr. Markus Köster, Leiter des LWL-Medienzentrums für Westfalen. Die auf diese Weise entstandene Sammlung, bestehend aus etwa 1600 Glasnegativen, über 40 Fotoalben und etlichen Kleinbildfilmen, übergab die Tochter Gudrun Schirrmann auf Vermittlung der Historikerin Prof. Dr. Barbara Stambolis vor eineinhalb Jahren zur sachgerechten Archivierung und Erschließung dem LWL-Medienzentrum. Hier sind die Bilder inzwischen gesichtet, sicher verpackt, digitalisiert und archivgerecht gelagert worden. Eine repräsentative Auswahl von ihnen steht jetzt unter http://www.bildarchiv-westfalen.de der Öffentlichkeit auch online zur Verfügung.
Neben privaten Aufnahmen der Familie Schirrmann und fotografischen Erinnerungen an Richard Schirrmanns Soldatenzeit im Ersten Weltkrieg lässt der Großteil der Fotos die Anfänge der Jugendherbergsbewegung wieder aufleben. Wandernde, rastende,
musizierende und tanzende Jugendliche finden sich neben Außen- und Innenaufnahmen von Jugendherbergen sowie Bildern von Landschaften und Städten in ganz Deutschland. Besonders prominent sind westfälische Herbergen vertreten; außer der Burg Altena zum Beispiel auch die in Neuastenberg (Winterberg/Hochsauerlandkreis), Hohensyburg (Dortmund), Brilon (Hochsauerlandkreis), Attendorn (Kreis Olpe), Sohlbach (Netphen/Kreis Siegen-Wittgenstein) und Kühhude (Bad Berleburg/Kreis Siegen-Wittgenstein).
Aufnahmen Schirrmanns von eigener Hand sind dabei ebenso überliefert wie professionelle Fotografien und ganze Foto-Alben, die ihm zu Jubiläen überreicht wurden. Der marketingbewusste Pädagoge nutzte Fotos schon früh, um angehende Herbergseltern zu schulen und öffentlich für sein Werk zu werben.
Durch die von der Hauptgeschäftsstelle des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) und dem Museum des Märkischen Kreises auf Burg Altena unterstützte Initiative des LWL-Medienzentrums steht die umfangreiche Bildsammlung rechtzeitig zum 100.
Geburtstag der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung. "Sie vermittelt spannende Einblicke in die Entstehung des Jugendherbergswerkes und auch in den jugendlichen 'Aufbruch aus grauer Städte Mauern' am Beginn des letzten Jahrhunderts", erläutert Köster den Wert des Fotonachlasses. ....."
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"

"Der im sauerländischen Altena tätige Lehrer war ein passionierter Fotograf und Fotosammler, der sowohl die Stationen seines eigenen Lebens als auch die Entwicklung seines Lebenswerkes in zahlreichen Bildern festhielt", sagt Dr. Markus Köster, Leiter des LWL-Medienzentrums für Westfalen. Die auf diese Weise entstandene Sammlung, bestehend aus etwa 1600 Glasnegativen, über 40 Fotoalben und etlichen Kleinbildfilmen, übergab die Tochter Gudrun Schirrmann auf Vermittlung der Historikerin Prof. Dr. Barbara Stambolis vor eineinhalb Jahren zur sachgerechten Archivierung und Erschließung dem LWL-Medienzentrum. Hier sind die Bilder inzwischen gesichtet, sicher verpackt, digitalisiert und archivgerecht gelagert worden. Eine repräsentative Auswahl von ihnen steht jetzt unter http://www.bildarchiv-westfalen.de der Öffentlichkeit auch online zur Verfügung.
Neben privaten Aufnahmen der Familie Schirrmann und fotografischen Erinnerungen an Richard Schirrmanns Soldatenzeit im Ersten Weltkrieg lässt der Großteil der Fotos die Anfänge der Jugendherbergsbewegung wieder aufleben. Wandernde, rastende,
musizierende und tanzende Jugendliche finden sich neben Außen- und Innenaufnahmen von Jugendherbergen sowie Bildern von Landschaften und Städten in ganz Deutschland. Besonders prominent sind westfälische Herbergen vertreten; außer der Burg Altena zum Beispiel auch die in Neuastenberg (Winterberg/Hochsauerlandkreis), Hohensyburg (Dortmund), Brilon (Hochsauerlandkreis), Attendorn (Kreis Olpe), Sohlbach (Netphen/Kreis Siegen-Wittgenstein) und Kühhude (Bad Berleburg/Kreis Siegen-Wittgenstein).
Aufnahmen Schirrmanns von eigener Hand sind dabei ebenso überliefert wie professionelle Fotografien und ganze Foto-Alben, die ihm zu Jubiläen überreicht wurden. Der marketingbewusste Pädagoge nutzte Fotos schon früh, um angehende Herbergseltern zu schulen und öffentlich für sein Werk zu werben.
Durch die von der Hauptgeschäftsstelle des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) und dem Museum des Märkischen Kreises auf Burg Altena unterstützte Initiative des LWL-Medienzentrums steht die umfangreiche Bildsammlung rechtzeitig zum 100.
Geburtstag der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung. "Sie vermittelt spannende Einblicke in die Entstehung des Jugendherbergswerkes und auch in den jugendlichen 'Aufbruch aus grauer Städte Mauern' am Beginn des letzten Jahrhunderts", erläutert Köster den Wert des Fotonachlasses. ....."
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"

Wolf Thomas - am Samstag, 8. August 2009, 16:35 - Rubrik: Fotoueberlieferung
Unter diesem Titel publizierte Dennis E. Rhodes eine Liste von Nachweisen heute noch vorhandener gedruckter Bücher des Johann Joachim Entzmüller (1600-1678) im Gutenberg-Jahrbuch 2009, S. 307-312
Sieht man davon ab, dass Rhodes die erhaltenen Handschriften der Windhagiana ausblendet und auch keinerlei neuere Sekundärliteratur zu Entzmüller anführt (Älteres bei Google Books mit US-Proxy und http://www.ooegeschichte.at/), so ist der Aufsatz ärgerlich, da er die vorhandenen Recherchemöglichkeiten nicht ansatzweise nutzt.
Es sollte bekannt sein, dass Paul Needham in seiner privaten Zusammenstellung IPI Inkunabelprovenienzen zusammengetragen hat. Needham war nach meinen Erfahrungen stets bereit, sein Wissen im Einzelfall zu teilen. Selbstverständlich enthält IPI weitere Belege zu Entzmüller-Büchern.
Bereits mit der Freitextsuche des KVK findet man ein Buch in Bern aus dieser Provenienz! Auch gehört der OPAC der Huntington-Library keinesfalls zu den entlegenen und schwer auffindbaren Quellen der Provenienzrecherche. Auch er enthält einen Druck (auffindbar mit Keyword Windhag*). Man kann den Huntington-Library-Katalog sogar via Vialibri durchsuchen:
http://www.vialibri.net/library_search.php
Selbst der ja nun hinreichend bekannte VD 17 erbringt einen Rhodes unbekannten Berliner Treffer: Supralibros: Joachim Freyher Von Windhag.
Natürlich erbringt auch die sogfältige Auswertung von Google Book Search weitere Hinweise, etwa auf zwei noch nicht im Katalog von Mazal erfasste Wiener Inkunabeln:
http://books.google.com/books?id=6nUVAAAAIAAJ&q=windhagiana+-topographia&dq=windhagiana+-topographia&lr=&num=100&as_brr=0&hl=de
Und man sollte vielleicht auch auf die Idee verfallen, das Listenarchiv von INCUNABULA-L zu sichten, wo ich 2003 zwei Mitteilungen zur Windhagiana veröffentlicht hatte:
http://www.listserv.dfn.de/archives/incunabula-l.html
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/453140081/

Sieht man davon ab, dass Rhodes die erhaltenen Handschriften der Windhagiana ausblendet und auch keinerlei neuere Sekundärliteratur zu Entzmüller anführt (Älteres bei Google Books mit US-Proxy und http://www.ooegeschichte.at/), so ist der Aufsatz ärgerlich, da er die vorhandenen Recherchemöglichkeiten nicht ansatzweise nutzt.
Es sollte bekannt sein, dass Paul Needham in seiner privaten Zusammenstellung IPI Inkunabelprovenienzen zusammengetragen hat. Needham war nach meinen Erfahrungen stets bereit, sein Wissen im Einzelfall zu teilen. Selbstverständlich enthält IPI weitere Belege zu Entzmüller-Büchern.
Bereits mit der Freitextsuche des KVK findet man ein Buch in Bern aus dieser Provenienz! Auch gehört der OPAC der Huntington-Library keinesfalls zu den entlegenen und schwer auffindbaren Quellen der Provenienzrecherche. Auch er enthält einen Druck (auffindbar mit Keyword Windhag*). Man kann den Huntington-Library-Katalog sogar via Vialibri durchsuchen:
http://www.vialibri.net/library_search.php
Selbst der ja nun hinreichend bekannte VD 17 erbringt einen Rhodes unbekannten Berliner Treffer: Supralibros: Joachim Freyher Von Windhag.
Natürlich erbringt auch die sogfältige Auswertung von Google Book Search weitere Hinweise, etwa auf zwei noch nicht im Katalog von Mazal erfasste Wiener Inkunabeln:
http://books.google.com/books?id=6nUVAAAAIAAJ&q=windhagiana+-topographia&dq=windhagiana+-topographia&lr=&num=100&as_brr=0&hl=de
Und man sollte vielleicht auch auf die Idee verfallen, das Listenarchiv von INCUNABULA-L zu sichten, wo ich 2003 zwei Mitteilungen zur Windhagiana veröffentlicht hatte:
http://www.listserv.dfn.de/archives/incunabula-l.html
Update:
http://archiv.twoday.net/stories/453140081/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://library.ttu.edu/about/collections/localdigital/goto.php
Unter den "Rare Books" sind auch gar nicht wenig deutschsprachige, auch wenn das meiste kaum zu begeistern vermag. Ganz hübsche Illustrationen hat diese Märchenausgabe:
http://collections.lib.ttu.edu/cgi-bin/showfile.exe?CISOROOT=/rbmc&CISOPTR=98&filename=153.pdf
Unter den "Rare Books" sind auch gar nicht wenig deutschsprachige, auch wenn das meiste kaum zu begeistern vermag. Ganz hübsche Illustrationen hat diese Märchenausgabe:
http://collections.lib.ttu.edu/cgi-bin/showfile.exe?CISOROOT=/rbmc&CISOPTR=98&filename=153.pdf
KlausGraf - am Samstag, 8. August 2009, 02:37 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 8. August 2009, 00:14 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nachdem Professor Hubertus Kohle im Arthistoricum-Blog bereits Werbung für das von Profi-Kunsthistorikern betreute kommerzielle neue Audioguide-Portal Pausanio gemacht hat
http://www.arthistoricum.net/blog/?p=1607
war heute die persönliche Werbemail von Holger Simon, der sich beim Digitalen Historischen Archiv der Stadt Köln große Verdienste erworben hat, im Posteingang.
Nein, mir gefällt das neue Portal ganz und gar nicht. (Ich sehe mal davon ab, dass es nur spärlich Audioguides gibt und ganz ganz selten spezifische auf ein Objekt bezogene. Meist sind es thematisch passende Hörbücher, die man mit viel gutem Willen "Audioguides" nennen kann.)
Nicht dass ich meine, alles müsste gratis sein. Aber ich mag es nicht, wenn ich für eine simple von mir ausgesuchte Hörprobe mich registrieren muss. Nach Registrierung kann ich 2 Euro verprassen, was für 6-7 Tracks zu je 0,29 Euro langt. Diese können unterschiedlich lang sein; wenn man Pech hat und sich die falschen heraussucht, ist der Willkommensbonus schon nach 10 Minuten verbraucht. Da ist selbst die von mir verabscheute Onleihe großzügiger und spendiert bei JEDEM Hörbuch eine kurze kostenlose Hörprobe (wenn ich das recht sehe, gibt es insgesamt genau 2 kostenlose Hörproben, eine von Fontane zum Kölner Dom ganze 1:30 lang und 2 Minuten zum Eiffelturm). Wenn ich so kleinlich abkassiert werde, habe ich keinerlei Lust mehr auf ein solches Bezahl-Angebot. Wer nicht begriffen hat, dass im digitalen Kontext sich nur Großzügigkeit auszahlt, kann das Geschäftemachen gleich sein lassen.
Nein Danke, Pausanio. Schieb dir deine 2 Euro sonstwohin.

http://www.arthistoricum.net/blog/?p=1607
war heute die persönliche Werbemail von Holger Simon, der sich beim Digitalen Historischen Archiv der Stadt Köln große Verdienste erworben hat, im Posteingang.
Nein, mir gefällt das neue Portal ganz und gar nicht. (Ich sehe mal davon ab, dass es nur spärlich Audioguides gibt und ganz ganz selten spezifische auf ein Objekt bezogene. Meist sind es thematisch passende Hörbücher, die man mit viel gutem Willen "Audioguides" nennen kann.)
Nicht dass ich meine, alles müsste gratis sein. Aber ich mag es nicht, wenn ich für eine simple von mir ausgesuchte Hörprobe mich registrieren muss. Nach Registrierung kann ich 2 Euro verprassen, was für 6-7 Tracks zu je 0,29 Euro langt. Diese können unterschiedlich lang sein; wenn man Pech hat und sich die falschen heraussucht, ist der Willkommensbonus schon nach 10 Minuten verbraucht. Da ist selbst die von mir verabscheute Onleihe großzügiger und spendiert bei JEDEM Hörbuch eine kurze kostenlose Hörprobe (wenn ich das recht sehe, gibt es insgesamt genau 2 kostenlose Hörproben, eine von Fontane zum Kölner Dom ganze 1:30 lang und 2 Minuten zum Eiffelturm). Wenn ich so kleinlich abkassiert werde, habe ich keinerlei Lust mehr auf ein solches Bezahl-Angebot. Wer nicht begriffen hat, dass im digitalen Kontext sich nur Großzügigkeit auszahlt, kann das Geschäftemachen gleich sein lassen.
Nein Danke, Pausanio. Schieb dir deine 2 Euro sonstwohin.

KlausGraf - am Freitag, 7. August 2009, 23:00 - Rubrik: Miscellanea

"En la madrugada del día 5 de agosto de 2009 se incendió el archivo de la Municipalidad de San Martín de los Andes, una ciudad cordillerana en la provincia de Neuquén, Argentina. Las causas se están investigando.
Eva Riquelme, archivera del municipio durante 17 años, habla en una comunicación enviada al Grupo de Archiveros Patagónicos del tiempo y empeño personal puesto en este lugar de trabajo que, con el tiempo, logró robarle el corazón y el compromiso: -”Hubo pérdidas, quizás irrecuperables. Los que realizan tareas en archivos, saben del esmero, voluntad y pasión que se le pone a este trabajo.”
Eva estuvo 17 años dedicándose con esa voluntad y pasión a la mejora del archivo histórico municipal de San Martín de los Andes: “El fuego quemó, arruinó y prácticamente ha hecho que el ámbito donde me desempeñara tanto tiempo desaparezca.”.
Es en estos casos en donde nos damos cuenta de la verdadera vocación de servicio del archivero. Eva Riquelme quería un archivo “que fuera orgullo en su ciudad y legar ese sueño a su pueblo”. ....."
Link:
http://archivistica.blogspot.com/2009/08/incendio-en-el-archivo-de-la.html
Wolf Thomas - am Freitag, 7. August 2009, 18:45 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die 6-seitige Liste, erstellt von Detmolder Studierenden der Lehrveranstaltung „Einführung in die Musikwissenschaft“ im WS 2008/09, enthält folgende Angaben (Name URL Angebot):
a) Besonders empfehlenswerte Archive
Deutsches Musikarchiv
Deutsche Nationalbibliothek, Leipzig/ Frankfurtam Main/ Berlin Deutsches Musikarchiv
Klaus-Kuhnke-Archiv für Populäre Musik Hochschule für Künste Bremen
Rock- und Pop-Archiv in Berlin
b) Weitere interessante Archive
Berliner ARCHIV DER JUGENDKULTUREN e.V.
Archiv Frau und Musik, Frankfurt/Main
Archive of Popular American Music der University of California Los Angeles
Beatles-Museum Halle
Deutsche Kinematik -Museum für Film und Fernsehen, Berlin
Deutsches Filmmuseum Frankfurt
Deutsches Kabarett-Archiv Mainz:
Deutsches Rundfunkarchiv Wiesbaden:
Deutsches Volksliedarchiv
IDEAMA (ZKM_Mediathek)
Jugendkulturarchiv der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt/Main
Nationaldiskothek der österreichischen Musik
The British Library Sound Archive
c) Internet-Datenbanken und -Archive
allmusic http://www.allmusic.com;
Deutscher Musikrat, Internet-Datenbank: http://www.miz.org
Discogs http://www.Discogs.com
Musikarchiv online http://www.musikarchivonline.de
Rock Around The World http://ratw.com
http://www.hbruchwitz.de/Pop/Popsite.htm
Link zur PDF-Datei (Stand/Abrufdatum: 03.01.2009)
a) Besonders empfehlenswerte Archive
Deutsches Musikarchiv
Deutsche Nationalbibliothek, Leipzig/ Frankfurtam Main/ Berlin Deutsches Musikarchiv
Klaus-Kuhnke-Archiv für Populäre Musik Hochschule für Künste Bremen
Rock- und Pop-Archiv in Berlin
b) Weitere interessante Archive
Berliner ARCHIV DER JUGENDKULTUREN e.V.
Archiv Frau und Musik, Frankfurt/Main
Archive of Popular American Music der University of California Los Angeles
Beatles-Museum Halle
Deutsche Kinematik -Museum für Film und Fernsehen, Berlin
Deutsches Filmmuseum Frankfurt
Deutsches Kabarett-Archiv Mainz:
Deutsches Rundfunkarchiv Wiesbaden:
Deutsches Volksliedarchiv
IDEAMA (ZKM_Mediathek)
Jugendkulturarchiv der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt/Main
Nationaldiskothek der österreichischen Musik
The British Library Sound Archive
c) Internet-Datenbanken und -Archive
allmusic http://www.allmusic.com;
Deutscher Musikrat, Internet-Datenbank: http://www.miz.org
Discogs http://www.Discogs.com
Musikarchiv online http://www.musikarchivonline.de
Rock Around The World http://ratw.com
http://www.hbruchwitz.de/Pop/Popsite.htm
Link zur PDF-Datei (Stand/Abrufdatum: 03.01.2009)
Wolf Thomas - am Freitag, 7. August 2009, 18:40 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Erste Beigeordnete Hans-Gerhard Rötters (r.) begrüßte den neuen Stadtarchivar Christoph Spilling mit einem Geschenk: das Buch „Moers – Die Geschichte der Stadt
von der Frühzeit bis zur Gegenwart“. (Foto: pst)
Quelle: Pressemitteilung der Stadt Moers
Wolf Thomas - am Freitag, 7. August 2009, 18:16 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Festung Lichtenau (Mittelfranken), Landkreis Ansbach, Hauptgebäude, Erdgeschoss (Staatsarchiv), August 2009, Photo: Andreas Praefcke (via Wikimedia, CC-BY 3.0)
Wolf Thomas - am Freitag, 7. August 2009, 18:08 - Rubrik: Wahrnehmung

Stift Göttweig, Österreich. Innenhof, 14 September 2006, Christian Jansky (via Wikimedia, CC-BY 2.5)
Das Department für Bildwissenschaften startet ab November 2009 einen neuen berufsbegleitenden Master-Lehrgang für CROSSMEDIA DESIGN & DEVELOPMENT (M.Sc.) über 4 Semester sowie ein Certified Programm über ein Semester.
CROSSMEDIA bietet eine umfassende berufliche Weiterbildung für Personen aus dem Kultur- und Medienbereich, die sich mit praxisorientierten Ansätzen und dem Verständnis und der Entwicklung von crossmedialen Strategien auseinander setzen wollen.
Führende internationale ExpertInnen demonstrieren und analysieren gemeinsam mit den Studierenden crossmediale Projektformate und User-orientierte Plattformen. Eingebettet sind die Praxismodule in Überblicksveranstaltungen zu neuen und neuesten Entwicklungen im Bereich Social Media, für die Schlagworte wie Web 2.0, Virtual Reality, Branded Entertainment, Viral Media, Videoplattformen, Visual Music, Scientific Visualisation und Mashup stehen und die eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten umfassen, Inhalte zu planen, zu produzieren und distribuieren.
Crossmedia verbindet medienübergreifend Inhalte, Produkte und technologische Anwendungen im Bereich Social und Visual Media und deren Vertrieb über unterschiedliche Kanäle. Insbesondere im Kultur- und Medienbereich setzt der Einsatz von Crossmedia Strategien im Kultur- oder Medienbereich zunehmend ein Verständnis für die gesellschaftliche Bedeutung der visuellen und partizipativen Mediennutzung voraus. Kern von Crossmedia Design & Development (M.Sc.) ist daher die Vermittlung von Digital Media Literacy in Theorie und Praxis, die zudem aus den aktuellsten Entwicklungen und Best Practice schöpft aus Bereichen wie Social Media und Konvergenzkultur, medienkonvergente Strategien, Transmedia Storytelling, Medienrecht und Cyberlaw und Crossmedia Management.
Wichtig ist die Befähigung, Potentiale und Veränderungen neuer Entwicklungen einschätzen und diese für die eigenen Ziele auch produktiv nutzen zu können. Studierende prüfen Social Media Tools und Web 2.0.-Modelle auf ihren Impact und Praxistauglichkeit. In ihrer Master-Thesis entwickeln die TeilnehmerInnen zum Beispiel eigene Crossmedia*Strategie und deren mediengerechte Umsetzung in Konzeption, Gestaltung und Vertrieb in einem Abschlussprojekt.
VORTRAGENDE/REFERENTINNEN :
Prof. Marie-Luise ANGERER (Kunsthochschule für Medien Köln), Eberhard DÜRRSCHMID (Greentube I.E.S. AG), Prof. Oliver GRAU (DUK) Stefan HEIDENREICH (Humboldt-Universität Berlin), Geoffrey LONG (MIT), Prof. Lev MANOVICH (University of California, San Diego), Barbara von RECHBACH, Ramón REICHERT (Kunstuniversität Linz), Dodo ROSCIC (ORF, Wien), Prof. Hendrik SPECK (FH Kaiserslautern), Konstanze WAGENHOFER (ORF, Styria Verlag, Wien), Prof. Michael WAGNER (DUK), Andreas WOCHENALT und viele andere.
Ein Teil des Programms findet im Zentrum für Bildwissenschaften / Stift Göttweig (UNESCO Kulturerbe) statt. Das Bauwerk aus dem 14. Jahrhundert steht unter Denkmalschutz und wurde für seine neue Bestimmung anspruchsvoll renoviert und mit moderner Technik ausgestattet.
Crossmedia Design & Development (M.Sc.) ist berufsbegleitend ausgelegt und nutzt einen Blended-Learning-Ansatz, um die Anzahl der Präsenzzeiten auf insgesamt 30 Tage - verteilt über einen Zeitraum von zwei Jahren - zu reduzieren. Jedes der 8 Lehrmodule besteht zudem i.d.R. aus einer Vor- und Nachbereitungsphase mit abschließender Leistungsfeststellung.
Weitere Informationen: http://www.donau-uni.ac.at/crossmedia
Kontakt: Andrea Haberson
Telefon: +43 (0)2732 893-2569, Fax: +43 (0)2732 893-4551
E-Mail: andrea.haberson@donau-uni.ac.at
Quelle: "Werbe-Mail" der Uni
Wolf Thomas - am Freitag, 7. August 2009, 17:43 - Rubrik: Ausbildungsfragen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bisher liegen 2 3D-Web-Präsentation vor (sehe ich es recht oder fehlen audiovisuelle Medien?):
"Kunst & Revolte 68
Mit dem Programmschwerpunkt „Kunst und Revolte“ startete 2008 erstmals das „Archivfenster“, eine interaktive Präsentation, die Einblick gibt in Sammlungen und Archive der Akademie. Sieben historische Facetten zu ’68 und den Folgen bilden den ersten Teil der Präsentation. Vorgestellt werden Dokumente aus den Archiven von Thomas Brasch, Wolf Biermann, George Tabori, Christa Wolf, Peter Weiss sowie der Filme Alma Mater und Bambule.
Akademiestreit, Die Vereinigung 1989 -1993
Die Grundlage für den zweiten, aktuellen Schwerpunkt 2009 bildet der „Akademiestreit“, die Vereinigung der beiden Akademien Ost und West von 1989 bis 1993. Nachdem der Berliner Koalitionsvertrag zwischen den regierenden Parteien 1991 die weitere Existenz zweier Akademien in Berlin ausgeschlossen hatte und ein Staatsvertrag der neuen Bundesländer zur Auflösung der Ost-Akademie auf den Weg gebracht wurde, eröffneten im Winter 1991/92 die Länder Berlin und Brandenburg, gemeinsam mit den Akademiepräsidenten Heiner Müller (Ost) und Walter Jens (West) der Akademie der Künste politisch eine neue Perspektive."
Quelle:
http://www.adk.de/de/archiv/archivfenster/index.html
"Kunst & Revolte 68
Mit dem Programmschwerpunkt „Kunst und Revolte“ startete 2008 erstmals das „Archivfenster“, eine interaktive Präsentation, die Einblick gibt in Sammlungen und Archive der Akademie. Sieben historische Facetten zu ’68 und den Folgen bilden den ersten Teil der Präsentation. Vorgestellt werden Dokumente aus den Archiven von Thomas Brasch, Wolf Biermann, George Tabori, Christa Wolf, Peter Weiss sowie der Filme Alma Mater und Bambule.
Akademiestreit, Die Vereinigung 1989 -1993
Die Grundlage für den zweiten, aktuellen Schwerpunkt 2009 bildet der „Akademiestreit“, die Vereinigung der beiden Akademien Ost und West von 1989 bis 1993. Nachdem der Berliner Koalitionsvertrag zwischen den regierenden Parteien 1991 die weitere Existenz zweier Akademien in Berlin ausgeschlossen hatte und ein Staatsvertrag der neuen Bundesländer zur Auflösung der Ost-Akademie auf den Weg gebracht wurde, eröffneten im Winter 1991/92 die Länder Berlin und Brandenburg, gemeinsam mit den Akademiepräsidenten Heiner Müller (Ost) und Walter Jens (West) der Akademie der Künste politisch eine neue Perspektive."
Quelle:
http://www.adk.de/de/archiv/archivfenster/index.html
Wolf Thomas - am Freitag, 7. August 2009, 17:40 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Offen gestanden ist KNOL auch bei mir etwas vom Radar verschwunden, was auch daran liegt, dass es in Google-Trefferlisten kaum erscheint.
So erscheint ein Vergleich Wikipedia/KNOL 2009
http://knol.google.com/k/fabian-ott/knol-versus-wikipedia/3oj8ovx0i9f17/3#
doch etwas zu sehr für KNOL eingenommen. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass Google sein Experiment fortführt.
So erscheint ein Vergleich Wikipedia/KNOL 2009
http://knol.google.com/k/fabian-ott/knol-versus-wikipedia/3oj8ovx0i9f17/3#
doch etwas zu sehr für KNOL eingenommen. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass Google sein Experiment fortführt.
http://bibliodyssey.blogspot.com/2009/08/la-caricature.html
Zu Suchmöglichkeiten nach Karikaturen als Geschichtsquellen:
http://archiv.twoday.net/stories/5312031/

Zu Suchmöglichkeiten nach Karikaturen als Geschichtsquellen:
http://archiv.twoday.net/stories/5312031/

KlausGraf - am Freitag, 7. August 2009, 12:38 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Mit einer großen Benefiz-Leseaktion präsentiert sich der neue literarische Verein "AURA 09" am 16. August ab 15 Uhr auf der Severinstraße. An diesem Sonntag erinnern 17 Kölner Autoren, Pfarrer und Politiker in Kurzlesungen an die Schriftsteller, deren Lebenswerk durch den Einsturz des Stadtarchivs verschüttet worden ist.
Zu den Mitwirkenden zählen der Vorsitzende des NRW-Kulturrates Gerhart Baum, die Kölner Kulturbürgermeisterin Angela Spizig, die Pfarrer Hans Mörtter und Johannes Quirl sowie die Autoren Martin Stankowski und Frank Überall. Sie lesen Texte von Heinrich Böll, Hans Bender, Hans Mayer, Vilma Sturm, Irmgard Keun, L. Fritz Gruber und anderen. Orte der Erinnerung sind St. Severin, die Severinstorburg, Haus Balchem und das Antiquariat Kleinsorge.
Das detaillierte Programm finden Sie hier.
Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei; Spenden für das Historische Archiv sind herzlich willkommen.
15.00 Basilika St. Severin, Im Ferkulum 29, 50678 Köln
Pfarrer Hans Mörtter: Für Kevin und Khalil
Tanya Ury: Die Seelen meiner toten Verwandten. Der Verlust des Familienarchivs Ury-Unger
Peter Jansen: Der 3. März 2009 und das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium
Martin Stankowski: Darum ist es am Rhein so schön
Angelika Hensgen: Lesung aus Hans Mayer: »Verjährung und Versöhnung«
Pfarrer Johannes Quirl: Lesung aus Briefen von Konrad Adenauer
16.30 Severinstorburg, Chlodwigplatz 2, 50677 Köln
Gerd Uhlenbruck: Kölsche und hochdeutsche Aphorismen von
Oscar Pfeiffer
Gerhart Baum: Lesung aus Arthur Joseph: »Meines Vaters Haus«
Frank Überall: Lesung aus »Der Klüngel in der politischen Kultur Kölns«
Monika Littau: Lesung aus Vilma Sturm: »Gongschläge«
Tanya Ury: Lesung aus Alfred H. Unger: »Die Geschichten um den
großen Nazarener«
Adriana Stern/ Hermann Spix: Dialog aus »Der Vorhang fällt« von Wilhelm Unger
18.00 Stadtteilbücherei Haus Balchem, Severinstraße 15, 50678 Köln
Angela Spizig: Lesung aus Heinrich Böll: »Die verlorene Ehre der
Katharina Blum«
Wolfgang Bittner: Lesung aus Aphorismen und Kurztexten von Hans Bender
Eva Weissweiler: Lesung aus Amalie Lauer: Die Frau in der Auffassung des Nationalsozialismus
Erasmus Schöfer: Lesung aus Texten von Paul Schallück
Antje Dertinger: Lesung aus Irmgard Keun: »Nach Mitternacht«
19.30 Antiquariat Kleinsorge/Kunstraum 21, Hirschgäßchen 1, 50678 Köln
Werner Peters: Lesung aus Texten von René König
Nika Bertram: Lesung aus Essays von Villem Flusser
Renate Gruber: Lesung aus Texten von L. Fritz Gruber
20.15 Abschlußlesung: Severinstorburg, Chlodwigplatz 2,
50677 Köln (mit Bewirtung)
Kölner Autoren lesen aus Texten von: Dieter Wellershoff, Anne Dorn, Hans Schmitt-Rost, Erasmus Schöfer, Albrecht Fabri, Angelika Mechtel und Jens Hagen."
Quellen:
http://www.aura09.de/
Link zum Flyer (PDF)
Wolf Thomas - am Freitag, 7. August 2009, 12:12 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Der 3-tägige Kongress wirft einen Blick in die Vergangenheit, betrachtet die Gegenwart und wagt einen Ausblick in die Zukunft der Geschichte von unten."
Aus dem Programm:
Freitag, 09.10.2009
15:00 Uhr: Didaktische Arbeitsgruppen
AG Hüter des verlorenen Schatzes (Archive: B. Hüttner, IISG Amsterdam)
"Bernd Hüttner gibt einen Überblick über die Archivszene, Lage und Bedeutung der Freien Archive. Diese spielen eine immer wichtigere Rolle und haben sich dem widerständigen Wissen um gesellschaftliche Konflikte und der Dokumentation einer "Sicht von unten" verschrieben.
Zur Unterstützung ist das Archiv IISG Amsterdam eingeladen, sich vorzustellen.
Weiterführende Informationen zur Tagung unter:
http://www.geschichtswerkstatt-oberhausen.de/default.asp?nc=7092&id=1
Wolf Thomas - am Freitag, 7. August 2009, 09:03 - Rubrik: Archive von unten

