Ergänzung zu: http://archiv.twoday.net/stories/11466449/
Heute: Ordentlich Ackerstein und Lager Buch (des Mainzer Altmünsterklosters), Abschrift des Originals 1731 mit ganzseitigem Aquarell der St. Bilhildis, Stadtarchiv Mainz Nr. 13/58. Lit.: 1300 Jahre Altmünsterkloster in Mainz. Mainz 1993, S. 31, 165. Außerdem enthält die Abschrift eine Ansicht von Bretzenheim (abgebildet S. 165, SW) und die Zeichnung eines Klosterhofs.

Siehe http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saint_Bilhildis
Heute: Ordentlich Ackerstein und Lager Buch (des Mainzer Altmünsterklosters), Abschrift des Originals 1731 mit ganzseitigem Aquarell der St. Bilhildis, Stadtarchiv Mainz Nr. 13/58. Lit.: 1300 Jahre Altmünsterkloster in Mainz. Mainz 1993, S. 31, 165. Außerdem enthält die Abschrift eine Ansicht von Bretzenheim (abgebildet S. 165, SW) und die Zeichnung eines Klosterhofs.

Siehe http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saint_Bilhildis
KlausGraf - am Sonntag, 26. Dezember 2010, 22:55 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Prora - KdF Seebad auf der Insel Rügen from Andreas Reichle on Vimeo.
Filmische Impression eines zerfallenden Bauwerks in 4 Akten (10:46)Link zum Dokumentationszentrum Prora
Wolf Thomas - am Sonntag, 26. Dezember 2010, 19:45 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Unter diesem Titel berichten die Archäologischen Ausgrabungen in Baden-Württemberg 2009, S. 220-225 über die Befunde, die man bei der Untersuchung des für den Neubau des Diözesanarchivs in Rottenburg am Neckar gemacht hat.
KlausGraf - am Sonntag, 26. Dezember 2010, 16:41 - Rubrik: Kirchenarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das neuseeländische Militär hat heute hunderte zuvor klassifizierte Berichte über unidentifizierte Flugobjekte und Begegnungen mit Außerirdischen veröffentlicht.
Die Berichte aus den Jahren 1954 bis 2009 wurden heute unter dem Informationsfreiheitsgesetz freigegeben. Zuvor hatte das neuseeländische Militär Namen und persönliche Daten von Zeugen und beteiligten Personen entfernt.
Auf rund 2.000 Seiten berichten Privatpersonen, Militärangehörige und Piloten von ihren UFO-Begegnungen. Meist handelt es sich um Sichtungen von sich bewegenden Lichtern am Himmel.
Einige der Akten umfassen Zeichnungen von 'fliegenden Untertassen' und Beispiele von angeblich außerirdischen Schriftzeichen.
Vor der Freigabe der UFO-Akten sagte Major Kavae Tamariki, die 'Neuseeländische Verteidigungsstreitkraft" (New Zealand Defence Force, NZDF) werde sich nicht zum Inhalt der Akten äußern.
"Wir sind nur eine Sammelstelle für die Informationen. Wir haben nichts untersucht oder Berichte verfasst. Wir haben keine Angaben darin bestätigt."
Die Streitkräfte würden über keine Ressourcen verfügen, um UFO-Sichtungen zu untersuchen, sagte Tamariki weiter.
Die Leiterin der Forschungsgruppe UFOCUS NZ, Suzanne Hansen, sagte, sie habe mehr als zwei Jahre lang versucht, an die Akten zu gelangen.
"Als ich mit meiner Lobbyarbeit begann sagten sie, es gäbe in absehbarer Zeit keine Möglichkeit, dass die Akten freigeben würden. Sie ließen lange auf sich warten."
Im August des letzten Jahres versuchte 'The Press' im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes Zugriff auf die Akten zu bekommen. Das NZDF sagte, der Antrag würde "einen erheblichen Aufwand an Sortierarbeit, Forschung und Beratung erfordern, um festzustellen, ob die betreffenden Informationen freigegeben werden könnten", und man sei "nicht in der Lage einen Mitarbeiter freizustellen, um diese Aufgabe zu übernehmen".
Die öffentlichen Akten über UFO-Sichtungen könnten jetzt über das Neuseeländische Staatsarchiv beantragt werden.
Frau Hansen hofft nun, dass die Akten mehr Details über einige der berühmtesten Fälle aus Neuseeland, einschließlich der Kaikoura-Sichtung vom 21. Dezember 1978, enthüllen werden.
John Cordy (77) aus Wellington war in jener Nacht im Flugsicherungsturm und beharrt darauf, dass es keine logische Erklärung für die Vorfälle in dieser Nacht gebe.
Er und sein Kollege beobachteten unerklärliche Signale auf dem Radarschirm, obwohl zu diesem Zeitpunkt kein Flugzeug in der Nähe unterwegs war.
Zur gleichen Zeit berichtete die Mannschaft einer Argosy Frachtmaschine von seltsamen Lichtern rund um ihr Flugzeug. Die Lichter verfolgten die Maschine mehr als 60 Kilometer. Es gab mehrere Theorien zu diesem Vorfall, doch Herr Cody meint, keine dieser Erklärungsversuche könne den damaligen Vorfällen gerecht werden.
"Es war kein Fischerboot, es war nicht der Planet Jupiter oder die Venus und es waren nicht die Lichter des Hafens. Was es war, weiß ich nicht."
In einem weiteren Fall, der sich zwanzig Jahre später ereignete und sich nun in den freigegebenen Akten befindet, berichtet eine Frau von einem großen, runden oder ovalem Objekt, welches rötlich geleuchtet haben soll. "Das Wetter war ruhig, trotzdem hatte die Frau ein Gefühl von 'Lichtregen' auf ihrem Arm", steht in den Dokumenten.
Die Original-Dokumente, auf welchen die heute veröffentlichten Berichte basieren, bleiben im neuseeländischen Nationalarchiv unter Verschluss; einige bis 2080."
Quelle: exonews, 22.12.2010
Warum werden eigentlich nur UFO-Akten immer mit großem Trara freigegeben?
Wolf Thomas - am Sonntag, 26. Dezember 2010, 15:28 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
Vor allem Schulschriften und insbesondere Altphilologisches wurden digitalisiert. Die Bände sind, soweit nicht nur aus urheberrechtlichen Gründen nur lokal verfügbar, wohl weitgehend über die Notation = AV 60000 im OPAC erreichbar (493 Digitalisate, darunter auch viele nicht freigegebene).
http://opac.ku-eichstaett.de
http://opac.ku-eichstaett.de
KlausGraf - am Sonntag, 26. Dezember 2010, 02:09 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://zkbw.bsz-bw.de/
https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=fl-team:info-bibliotheken:zentralkatalog:digi
Die Sigelliste:
https://wiki.bsz-bw.de/lib/exe/fetch.php?media=fl-team:info-bibliotheken:zentralkatalog:zkbw_sigelliste.pdf
50 ist die FFHB Donaueschingen - Gott hab sie selig.
http://zkbw.bsz-bw.de/Chopin/Engine/DirektSprung/DirectView.asp?KatalogID=1&RecordNum=36432&ImgNum=1895704
Zl 1 ist die Fürstlich Waldburg-Zeil'sche Bibliothek
http://zkbw.bsz-bw.de/Chopin/Engine/DirektSprung/DirectView.asp?KatalogID=1&RecordNum=55559&ImgNum=2808467
https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=fl-team:info-bibliotheken:zentralkatalog:digi
Die Sigelliste:
https://wiki.bsz-bw.de/lib/exe/fetch.php?media=fl-team:info-bibliotheken:zentralkatalog:zkbw_sigelliste.pdf
50 ist die FFHB Donaueschingen - Gott hab sie selig.
http://zkbw.bsz-bw.de/Chopin/Engine/DirektSprung/DirectView.asp?KatalogID=1&RecordNum=36432&ImgNum=1895704
Zl 1 ist die Fürstlich Waldburg-Zeil'sche Bibliothek
http://zkbw.bsz-bw.de/Chopin/Engine/DirektSprung/DirectView.asp?KatalogID=1&RecordNum=55559&ImgNum=2808467
KlausGraf - am Sonntag, 26. Dezember 2010, 00:40 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
David Heinrich Hoppe (1760-1846) zum 250. Geburtstag - UB Regensburg digitalisierte einige Schriften
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/hoppe/selbststaendig.htm
Im METS-Viewer, aber anscheinend nicht im Bayerischen Verbundkatalog.
Weitere Digitalisate der UB Regensburg, die ich im OPAC fand:
http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=862669&custom_att_2=simple_viewer
http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=1799868&custom_att_2=simple_viewer
http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=1102433&custom_att_2=simple_viewer
http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=1797704&custom_att_2=simple_viewer
Mehr z.B. über die Suche: Freie Suche: regensburg, dann eingrenzen: Digitalisat, Monographie, nach 1879. Mit der Maus rechts über Volltext fahren, die lokalen Digitalisate haben eine Adresse beginnend mit bvbm1.
Im METS-Viewer, aber anscheinend nicht im Bayerischen Verbundkatalog.
Weitere Digitalisate der UB Regensburg, die ich im OPAC fand:
http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=862669&custom_att_2=simple_viewer
http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=1799868&custom_att_2=simple_viewer
http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=1102433&custom_att_2=simple_viewer
http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=1797704&custom_att_2=simple_viewer
Mehr z.B. über die Suche: Freie Suche: regensburg, dann eingrenzen: Digitalisat, Monographie, nach 1879. Mit der Maus rechts über Volltext fahren, die lokalen Digitalisate haben eine Adresse beginnend mit bvbm1.
KlausGraf - am Sonntag, 26. Dezember 2010, 00:23 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gruetzner_Aus_dem_Stadtarchiv_in_Hall.jpg
Die Lokalisierung: http://books.google.com/books?id=8B4UAAAAYAAJ&pg=PA63 (US)
Update: Farbe
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gruetzner_stadtarchiv.jpg
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.eliechtensteinensia.li/LIVL/
Da das Fürstentum Liechenstein winzig ist, dürfte eine komplette Digitalisierung der Zeitungen dieses Kleinterritoriums keinen Riesen-Aufwand bedeuten.
Da das Fürstentum Liechenstein winzig ist, dürfte eine komplette Digitalisierung der Zeitungen dieses Kleinterritoriums keinen Riesen-Aufwand bedeuten.
KlausGraf - am Samstag, 25. Dezember 2010, 21:25 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 25. Dezember 2010, 21:22 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blog.okfn.org/2010/12/21/cultural-heritage-rights-in-the-age-of-digital-copyright/
CHI want to retain control over items and buildings that they often regard as “theirs”, but this need has to live together with the fact that millions of people want to share digital content about cultural heritage on the web. Ultimately, this fact should be regarded as a very positive thing, if the mission of institutions is to maximise the awareness of Cultural Heritage among the public and the impact it has on the social and economic life of EU citizens.
See also
http://archiv.twoday.net/stories/6128992/
CHI want to retain control over items and buildings that they often regard as “theirs”, but this need has to live together with the fact that millions of people want to share digital content about cultural heritage on the web. Ultimately, this fact should be regarded as a very positive thing, if the mission of institutions is to maximise the awareness of Cultural Heritage among the public and the impact it has on the social and economic life of EU citizens.
See also
http://archiv.twoday.net/stories/6128992/
KlausGraf - am Samstag, 25. Dezember 2010, 19:45 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Damit es nicht in den Kommentaren untergeht, sei ein eindrucksvolles Stück Archiv-Ikonographie hier abgebildet.

Skulpturengruppe am Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Foto: Andreas Praefcke http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
Größer: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_Minoritenplatz_Archiv_Inschrift.jpg

Skulpturengruppe am Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Foto: Andreas Praefcke http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
Größer: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_Minoritenplatz_Archiv_Inschrift.jpg
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Samstag, 25. Dezember 2010, 08:32 - Rubrik: Records Management
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Samstag, 25. Dezember 2010, 00:01 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
2010 erhielt das Stadtarchiv vom Bürgermeisteramt das Goldene Buch der Stadt Nürnberg, in dem sich seit 1897 hochrangige Gäste der Stadt, darunter Mitglieder des Hochadels und regierender Häuser sowie Vertreter aller Bereiche des politischen, gesellschaftlichen und künstlerischen Lebens, verewigt haben. Übernommen hat das Archiv allerdings nur den Inhalt, da die repräsentative Buchkassette, die 2010 in der GNM-Ausstellung "Mythos Burg" bewundert werden konnte, natürlich beim Bürgermeisteramt verbleibt. Da das Goldene Buch auch künftig hochkarätigen Gästen der Stadt vorgelegt werden soll, ließ das Stadtarchiv hierfür hochwertige Faksimile-Ausdrucke anfertigen.
Die 259 kallligraphisch und künstlerisch gestalteten Einzelseiten wurden im Stadtarchiv verzeichnet und digitalisiert. Verzeichnung und Digitalisate können jetzt online in der Beständedatenbank des Stadtarchivs eingesehen werden.
So die Ankündigung. Natürlich gibt es keinen Direktlink zu den angeblichen Digitalisaten, die sich als Besch*** herausstellen: sie sind zu klein und dank eines dicken Copyfraud-Vermerks absolut unbrauchbar.
Und wie immer man die Digitalisate der Postkartensammlung in der Mist-Archivdatenbank auffinden mag (einfach ist es vermutlich nur für Eingeweihte) - es steht zu erwarten, dass man in gleicher Weise betrogen wird.
http://www.stadtarchiv.nuernberg.de/
Die 259 kallligraphisch und künstlerisch gestalteten Einzelseiten wurden im Stadtarchiv verzeichnet und digitalisiert. Verzeichnung und Digitalisate können jetzt online in der Beständedatenbank des Stadtarchivs eingesehen werden.
So die Ankündigung. Natürlich gibt es keinen Direktlink zu den angeblichen Digitalisaten, die sich als Besch*** herausstellen: sie sind zu klein und dank eines dicken Copyfraud-Vermerks absolut unbrauchbar.
Und wie immer man die Digitalisate der Postkartensammlung in der Mist-Archivdatenbank auffinden mag (einfach ist es vermutlich nur für Eingeweihte) - es steht zu erwarten, dass man in gleicher Weise betrogen wird.
http://www.stadtarchiv.nuernberg.de/
KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 22:21 - Rubrik: Kommunalarchive
http://museum.zib.de/sgml_autographe/sgml_autographe.php?seite=10
Im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zunächst für die Dauer von zwei Jahren geförderten Projektes werden seit Mai 2009 aus dem Autographenbestand des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig ca. 2.350 Handschriften aus dem Bereich "Befreiungskriege" und etwa 4.000 Autographen aus dem Bereich "Musik" inhaltlich erschlossen und digitalisiert.
Zahlreiche Autographen sind bereits online.

Im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zunächst für die Dauer von zwei Jahren geförderten Projektes werden seit Mai 2009 aus dem Autographenbestand des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig ca. 2.350 Handschriften aus dem Bereich "Befreiungskriege" und etwa 4.000 Autographen aus dem Bereich "Musik" inhaltlich erschlossen und digitalisiert.
Zahlreiche Autographen sind bereits online.

KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 21:29 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.archive.org/stream/davidbaungardt_01_reel13#page/n39/mode/2up
Ein direktes Ansteuern durch Eingabe der Seitenzahlen geht nicht mehr; man muss unten den Schieberegler zur passenden Seitenzahl verschieben, was länger dauert.
Beim Blättern wählte ich intuitiv die oben prominent angebrachte Diashow-Anwendung statt der Pfeile unten. Einfacher blättert man aber mit Mausklick links (zurück) oder rechts (vor).
In FF und Chrome verdeckt in der Vergrößerungsstufe die untere Navigationsleiste die Navigation des Bildschirmfensters. Will man diese benutzen, muss man die Navigationsleiste ausschalten, hat dann aber immer noch das Problem, dass der rechte Navigationspfeil kaum zu treffen ist, weil er zu nahe an dem Pfeil für das Ausblenden der Leiste liegt.
Blättern geht in diesem Modus mit schneller Bewegung nach rechts (festgehaltene linke Maustaste) bzw. links. Setzt man ganz links oder rechts an, kann man langsam das ganze Bild erkunden. Zieht man zu schnell, blättert man. Wie man darauf von allein kommen soll, ist mir ein Rätsel.
Ebensowenig gefällt mir die grafische Anzeige der Suchergebnisse auf dem Seitenstrahl unten. Ich hätte lieber (stattdessen oder zusätzlich) eine Liste, da man bei aufeinanderfolgenden Seiten die Trefferbuttons schlecht unterscheiden kann.

Ein direktes Ansteuern durch Eingabe der Seitenzahlen geht nicht mehr; man muss unten den Schieberegler zur passenden Seitenzahl verschieben, was länger dauert.
Beim Blättern wählte ich intuitiv die oben prominent angebrachte Diashow-Anwendung statt der Pfeile unten. Einfacher blättert man aber mit Mausklick links (zurück) oder rechts (vor).
In FF und Chrome verdeckt in der Vergrößerungsstufe die untere Navigationsleiste die Navigation des Bildschirmfensters. Will man diese benutzen, muss man die Navigationsleiste ausschalten, hat dann aber immer noch das Problem, dass der rechte Navigationspfeil kaum zu treffen ist, weil er zu nahe an dem Pfeil für das Ausblenden der Leiste liegt.
Blättern geht in diesem Modus mit schneller Bewegung nach rechts (festgehaltene linke Maustaste) bzw. links. Setzt man ganz links oder rechts an, kann man langsam das ganze Bild erkunden. Zieht man zu schnell, blättert man. Wie man darauf von allein kommen soll, ist mir ein Rätsel.
Ebensowenig gefällt mir die grafische Anzeige der Suchergebnisse auf dem Seitenstrahl unten. Ich hätte lieber (stattdessen oder zusätzlich) eine Liste, da man bei aufeinanderfolgenden Seiten die Trefferbuttons schlecht unterscheiden kann.

KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 20:38 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
"Eine wertvolle Sammlung zur Familie des Komponisten Johann Sebastian Bach ist für die kommenden zehn Jahre in Leipzig. Ein New Yorker Reedereibesitzer stellt sie dem Bach-Archiv als Leihgabe zur Verfügung. Die Sammlung umfasst fast 1.000 Stücke. Darunter sind Handschriften, Briefe, Bildnisse und Noten. Einige der wertvollsten Dokumente will das Bach-Archiv im Januar vorstellen."
Quelle: WDR.de, Kulturnachrichten v. 23.12.2010
" .... Mit der Sammlung Elias N. Kulukundis findet ab Dezember 2010 eine der wertvollsten Privatsammlungen zur Bachfamilie für den Zeitraum von zehn Jahren eine neue Heimstatt im Leipziger Bach-Archiv. Die Sammlung Kulukundis beinhaltet u.a. die autographe Partitur der Oper »Zanaida« Johann Christian Bachs, die bis dato als verschollen galt. ...."
Quelle: PRESSEMITTEILUNG BACH-ARCHIV LEIPZIG, 22.12.2010
Quelle: WDR.de, Kulturnachrichten v. 23.12.2010
" .... Mit der Sammlung Elias N. Kulukundis findet ab Dezember 2010 eine der wertvollsten Privatsammlungen zur Bachfamilie für den Zeitraum von zehn Jahren eine neue Heimstatt im Leipziger Bach-Archiv. Die Sammlung Kulukundis beinhaltet u.a. die autographe Partitur der Oper »Zanaida« Johann Christian Bachs, die bis dato als verschollen galt. ...."
Quelle: PRESSEMITTEILUNG BACH-ARCHIV LEIPZIG, 22.12.2010
Wolf Thomas - am Freitag, 24. Dezember 2010, 12:53 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.manuscripta-mediaevalia.de
Wenn einen Chrome-Benutzer als erstes die Mitteilung empfängt, man habe nicht den geeigneten Browser, dann ist man schon richtig eingestimmt.
Es gibt nun Permalinks, aber nicht etwa für Bildseiten (es gibt nun viele Digitalisate, aber meist Einzel- oder Schlüsselseiten z.B. aus Berlin), sondern nur für Handschriften
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/obj31275201.html
Und was sollen solche völlig schwachsinnigen Permalinks:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/sigrefsAachen|||Bibliothek der Stadt Aachen / Stadtbibliothek|||Beis A 5.html (die hier verwendete Weblogsoftware erkennt den Link nicht!)
Die früher gut benutzbaren Handschriftenkataloge sind im neuen System sehr viel langsamer und umständlicher zu benutzen geworden. Gottseidank funktionieren noch die alten Links:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0076_b117_JPG.htm
Alte Startseite der Kataloge geht auch noch:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge-online.htm
Verlinken von Seiten ist im neuen Angebot nicht vorgesehen:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hsk0076.html
Wozu man die PDFs der einzelnen Handschriftenbeschreibungen braucht, wissen die Götter.
Die neue Übersicht zu den Handschriften ist nicht berühmt, was soll z.B. einfach der Ortsname Anholt ohne nähere Angaben?
Nur Fachleute können folgendes entschlüsseln:
Bestandsumfang (ma.): 16 (BR), 2 (HBB), 26 (VDB)
Die Inhalte der vorläufigen Beschreibungen wurden nicht aktualisiert, sie sind nach wie vor nicht suchbar.
Der Grotefend ist unter der verlinkten Adresse nicht erreichbar:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/grotefend/grotefend.htm
Ebenso die Schreibsprachenbibliographie.
Insgesamt: mehr Pfusch, als Fortschritt! Durfte man nach der ganzen Stümperei in den letzten Jahren anderes erwarten?
Wenn einen Chrome-Benutzer als erstes die Mitteilung empfängt, man habe nicht den geeigneten Browser, dann ist man schon richtig eingestimmt.
Es gibt nun Permalinks, aber nicht etwa für Bildseiten (es gibt nun viele Digitalisate, aber meist Einzel- oder Schlüsselseiten z.B. aus Berlin), sondern nur für Handschriften
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/obj31275201.html
Und was sollen solche völlig schwachsinnigen Permalinks:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/sigrefsAachen|||Bibliothek der Stadt Aachen / Stadtbibliothek|||Beis A 5.html (die hier verwendete Weblogsoftware erkennt den Link nicht!)
Die früher gut benutzbaren Handschriftenkataloge sind im neuen System sehr viel langsamer und umständlicher zu benutzen geworden. Gottseidank funktionieren noch die alten Links:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0076_b117_JPG.htm
Alte Startseite der Kataloge geht auch noch:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge-online.htm
Verlinken von Seiten ist im neuen Angebot nicht vorgesehen:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hsk0076.html
Wozu man die PDFs der einzelnen Handschriftenbeschreibungen braucht, wissen die Götter.
Die neue Übersicht zu den Handschriften ist nicht berühmt, was soll z.B. einfach der Ortsname Anholt ohne nähere Angaben?
Nur Fachleute können folgendes entschlüsseln:
Bestandsumfang (ma.): 16 (BR), 2 (HBB), 26 (VDB)
Die Inhalte der vorläufigen Beschreibungen wurden nicht aktualisiert, sie sind nach wie vor nicht suchbar.
Der Grotefend ist unter der verlinkten Adresse nicht erreichbar:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/grotefend/grotefend.htm
Ebenso die Schreibsprachenbibliographie.
Insgesamt: mehr Pfusch, als Fortschritt! Durfte man nach der ganzen Stümperei in den letzten Jahren anderes erwarten?
KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 06:01 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://digitool.bibnat.ro:8881/R
darin: 108 Inkunabeln (METS-Viewer), darunter eine deutschsprachige Schedelsche Chronik.
Es gibt auch Handschriften (141), meist aus dem Battyaneum, z.B.
(nicht mit URL verlinkbar!) "Moralia Germanica"
Während man in den Metadaten des rumänischen Angebots so gut wie nichts über den Inhalt erfährt, wird die Provenienz aus der Adelsfamilie Trenbach angegeben. Den Inhalt listet der Handschriftencensus auf
http://www.handschriftencensus.de/18047
unterschlägt aber - seinem Bestreben folgend, provenienzgeschichtliche Studien so weit wie möglich zu erschweren - die Provenienz, denn nicht jeder weiß, dass Weitemeier 2006 Bücher aus der Trenbach-Bibliothek zusammenträgt. (Trenbach-Provenienz auch das digitalisierte Ms. I 92 = http://www.handschriftencensus.de/4274 )
Wie man die Digitalisate (auch alte Drucke z.B. einer aus der Stolberg-Bibliothek in Wernigerode) zitieren soll, wird nicht gesagt.
 Erotisches Exlibris
Erotisches Exlibris
In DacoRomanica http://www.dacoromanica.ro/
http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R?RN=663157288
finde ich einen deutschsprachigen Titel:
ABC oder Namenbüchlein zum Gebrauche der Serbischen Wallachischen Jugend im Königreiche Hungarn, und den dazu gehörigen Theilen
darin: 108 Inkunabeln (METS-Viewer), darunter eine deutschsprachige Schedelsche Chronik.
Es gibt auch Handschriften (141), meist aus dem Battyaneum, z.B.
(nicht mit URL verlinkbar!) "Moralia Germanica"
Während man in den Metadaten des rumänischen Angebots so gut wie nichts über den Inhalt erfährt, wird die Provenienz aus der Adelsfamilie Trenbach angegeben. Den Inhalt listet der Handschriftencensus auf
http://www.handschriftencensus.de/18047
unterschlägt aber - seinem Bestreben folgend, provenienzgeschichtliche Studien so weit wie möglich zu erschweren - die Provenienz, denn nicht jeder weiß, dass Weitemeier 2006 Bücher aus der Trenbach-Bibliothek zusammenträgt. (Trenbach-Provenienz auch das digitalisierte Ms. I 92 = http://www.handschriftencensus.de/4274 )
Wie man die Digitalisate (auch alte Drucke z.B. einer aus der Stolberg-Bibliothek in Wernigerode) zitieren soll, wird nicht gesagt.
In DacoRomanica http://www.dacoromanica.ro/
http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R?RN=663157288
finde ich einen deutschsprachigen Titel:
ABC oder Namenbüchlein zum Gebrauche der Serbischen Wallachischen Jugend im Königreiche Hungarn, und den dazu gehörigen Theilen
KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 04:16 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://dspace.bcucluj.ro/community-list
bzw.
http://dspace.bcucluj.ro/browse?type=dateissued&sort_by=2&order=ASC&rpp=100&etal=0&submit_browse=Aktualisieren
Unter den digitalisierten Sammlungen sind auch etliche deutschsprachige Alte Drucke.
Siehe auch:
http://documente.bcucluj.ro/patrimoniu.html
bzw.
http://dspace.bcucluj.ro/browse?type=dateissued&sort_by=2&order=ASC&rpp=100&etal=0&submit_browse=Aktualisieren
Unter den digitalisierten Sammlungen sind auch etliche deutschsprachige Alte Drucke.
Siehe auch:
http://documente.bcucluj.ro/patrimoniu.html
KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 03:56 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://ignca.nic.in/asp/all.asp?projectid=rar11
Trachtenbilder aus einem Illustrationswerk.
Das Indira Gandhi-Zentrum für indische Kunst hat aber auch ganze Bücher digitalisiert, auch solche, die ganz gewiss in Europa noch geschützt sind:
http://ignca.nic.in/asp/searchBooks.asp
Beispiel:
http://asi.nic.in/asi_books/4546.pdf

Trachtenbilder aus einem Illustrationswerk.
Das Indira Gandhi-Zentrum für indische Kunst hat aber auch ganze Bücher digitalisiert, auch solche, die ganz gewiss in Europa noch geschützt sind:
http://ignca.nic.in/asp/searchBooks.asp
Beispiel:
http://asi.nic.in/asi_books/4546.pdf

KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 03:35 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://dspace.wbpublibnet.gov.in/dspace/
Wenn schon indische öffentliche Bibliotheken alte Bücher digitalisieren (hier: hauptsächlich englische Drucke des 19. Jahrhunderts) - wie erbärmlich ist da die Abstinenz der deutschen öffentlichen Bibliotheken?
Wenn schon indische öffentliche Bibliotheken alte Bücher digitalisieren (hier: hauptsächlich englische Drucke des 19. Jahrhunderts) - wie erbärmlich ist da die Abstinenz der deutschen öffentlichen Bibliotheken?
KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 03:28 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.centreculturelirlandais.com/modules/movie/scenes/home/index.php?fuseAction=manuscrits&FUSEBOX_LANG=1
Psautier flamand
Histoire des rois d’Angleterre
Heures de Notre-Dame

Psautier flamand
Histoire des rois d’Angleterre
Heures de Notre-Dame

KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 03:14 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2010/12/23/open-access-–-why-we-need-open-bibliography
Wenn alle selbstarchivierten Artikel in eine offene Bibliographie eingetragen würden, würde dies die Nachweissituation erheblich verbessern.
Wenn alle selbstarchivierten Artikel in eine offene Bibliographie eingetragen würden, würde dies die Nachweissituation erheblich verbessern.
KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 02:21 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Schwall interessanter Beiträge erfordert sofortiges Besuchen von:
http://geschichtsweberei.blogspot.com/
http://geschichtsweberei.blogspot.com/
Mehr Belege dazu bei
http://openbiomed.info/2010/12/more-predatory-evidence-intech/
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=predatory

http://openbiomed.info/2010/12/more-predatory-evidence-intech/
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=predatory

KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 02:12 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 lles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Daher ist nun auch die Zeit für das letzte Türlein dieses Jahr gekommen.
lles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Daher ist nun auch die Zeit für das letzte Türlein dieses Jahr gekommen. Allen Leserinnen und Lesern von Archivalia wünschen wir erholsame Weihachtstage!
Rückmeldungen sind willkommen: Wie hat der Adventskalender gefallen? Welches Türlein war besonders toll oder auch nicht?
Womit schließen? Mit etwas kostenloser Weihachts-Musik von Magnatune vielleicht?
Christmas Music by Magnatune Compilation
Aber da quatscht ständig jemand in den Zwischenraum zwischen den Stücken ...
Oder mit einem Link auf die hübsche Weihnachts-Dokumentation des Goethezeit-Portals?
http://www.goethezeitportal.de/index.php?id=weihnachten_2010
Was fehlte?
* Übelgrübel *
Eindeutig ein Beitrag zur wichtigsten Archivalia-Rubrik Sportarchive. Da hätte ich ein Turnbuch im Angebot.
Und natürlich Tiere!
 Löwe mit Evangelist
Löwe mit EvangelistTöne! (Unser Tonbeauftragter war leider gesundheitlich verhindert - gute Besserung!)
Schwäbisches! (via)
Und etwas zu Archivinnenräumen. Aus unserem Adventskalender 2008 entnehme ich das folgende stimmungsvolle Bild:

2010 waren wir unerträglich zahm. 2008 hatten wir wenigstens etwas von Klabund. Also schieben wir etwas Freches aus dem Simplicissimus nach:
http://simplicissimus.info/digiviewer/13/38#DV_14
Und es fehlten natürlich Rätsel!
Nichts gabs zum puzzlen.

Wem das zu niveaulos ist, kann uns helfen, das folgende auf Flickr gefundene Bild genau zu bestimmen:
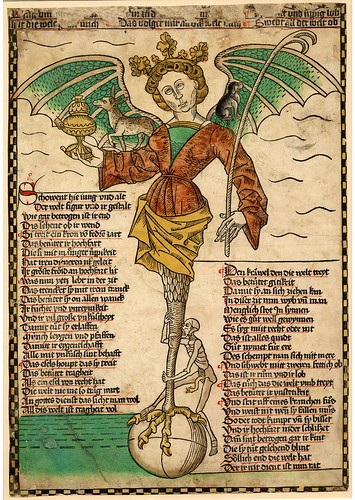
Hier Links zu allen Türlein 2010:
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein
Adventskalender (Türlein XXIII) - Digitale Weihnachtsgeschichte
Adventskalender (Türlein XXII) - Humanistenbriefwechsel
Adventskalender (Türlein XXI) - Kindheit in Russland
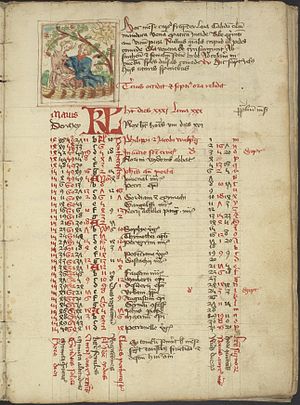
Adventskalender (Türlein XX) - Eine unbeachtete astromedizinische Sammelhandschrift
Adventskalender (Türlein XIX) - Pfenniggedicht über Archivare etc.
Adventskalender (Türlein XVIII) - Augustana
Adventskalender (Türlein XVII) - Feuerzangenbowle
Adventskalender (Türlein XVI) - Rheinburgenromantik
Adventskalender (Türlein XV) - Illuminierte Archivalien
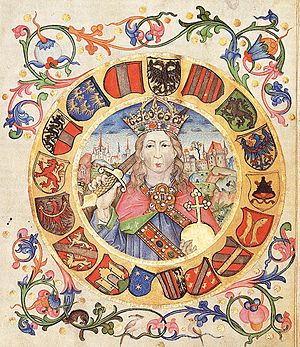
Adventskalender (Türlein XIV) - Hypnerotomachia Poliphili
Adventskalender (Türlein XIII) - Berliner Weihnachtsmarkt anno 1847<
Adventskalender (Türlein XII) - für Phreunde der Fysik
Adventskalender (Türlein XI) - Islamische Handschriften online
Adventskalender (Türlein X) - Exlibris
Adventskalender (Türlein IX) - Ulrich von dem Türlin
Adventskalender (Türlein VIII) - Stollenkunde
Adventskalender (Türlein VII) - Historische Archivbauten
Adventskalender (Türlein VI) - Kinderlieder müssen frei sein
Adventskalender (Türlein V) - Faszinierende Fotos<
Adventskalender (Türlein IV) - Wikisource-Winter-Potpourri
Adventskalender (Türlein III) - Noteboek
Adventskalender (Türlein II) - Rächdschreibung
Adventskalender (Türlein I) - Kuba pittoresk
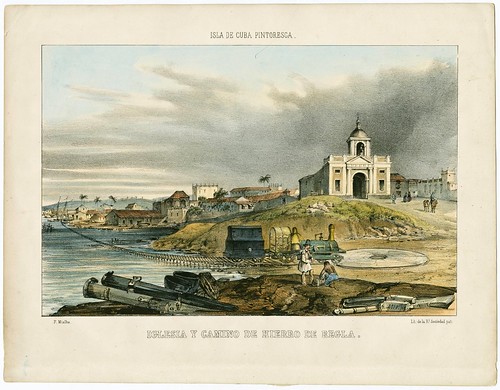
KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 00:26 - Rubrik: Unterhaltung
http://blog.zeit.de/open-data/2010/12/23/open-data-feuerwehr/
Bart van Leeuwen ist seit fünfzehn Jahren Feuerwehrmann in den Niederlanden. Aber er ist auch Programmierer und beschäftigt sich seit Jahren mit Open-Source-Software und mit dem semantischen Web. In Interview spricht van Leeuwen über den Nutzen von Open Data für Rettungskräfte und das Informationssystem “RESC.info“. Das entwickelt er für die Feuerwehr zusammen mit der Gruppe netlabs.org. Obwohl die Leitung der Amsterdamer Feuerwehr kein Interesse zeigt, setzen mittlerweile acht Feuerwehrstationen die Software ein.
Bart van Leeuwen ist seit fünfzehn Jahren Feuerwehrmann in den Niederlanden. Aber er ist auch Programmierer und beschäftigt sich seit Jahren mit Open-Source-Software und mit dem semantischen Web. In Interview spricht van Leeuwen über den Nutzen von Open Data für Rettungskräfte und das Informationssystem “RESC.info“. Das entwickelt er für die Feuerwehr zusammen mit der Gruppe netlabs.org. Obwohl die Leitung der Amsterdamer Feuerwehr kein Interesse zeigt, setzen mittlerweile acht Feuerwehrstationen die Software ein.
KlausGraf - am Freitag, 24. Dezember 2010, 03:53 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Es dauert noch ein wenig, solange betrachten wir ein wunderschönes Nitrofullerene C60


KlausGraf - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 23:47 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.eab-paderborn.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=72
Die Liste (ohne Abbildungen) ist bislang im Handschriftencensus nicht ausgewertet.
Die Liste (ohne Abbildungen) ist bislang im Handschriftencensus nicht ausgewertet.
KlausGraf - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 20:11 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Hochschularchiv der RWTH Aachen ist im denkmalgeschützten ehemaligen Regierungsgebäude untergebracht.
http://hochschularchiv-aachen.blogspot.com/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Zitieradresse ist so bescheuert wie die Metadaten:
Please use this identifier to cite or link to this item: http://pc-3.lib.uoi.gr:8080/jspui/handle/123456789/HASH0150b87d4a7dc95987020be2
Titel: De l' esprit des loix: Ou du rapport que les loix.....
Stichwörter: Law
Issue Date: 15-Jul-2009
Herausgeber: A Geneve : Chez Barrillot File
Beschreibung: 625 p.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/HASH0150b87d4a7dc95987020be2
Sonstige Kennungen: HASH0150b87d4a7dc95987020be2
Appears in Collections: Σπάνια Βιβλία
Man muss den KVK oder einen anderen OPAC bemühen (will man nicht 38 MB auf Verdacht herunterladen), um festzustellen, dass es sich um ein wohl 1748 erschienenes Buch, das Montesquieu zugeschrieben wird, handelt (vorhanden in Gales "Making of the Modern World, in Griechenland frei zugänglich).
Von wann das "Griechisch-Deutsches Worterbuch" ist, das ebenfalls sich in der Sammlung befindet, ist den Metadaten ebenfalls nicht zu entnehmen.
Please use this identifier to cite or link to this item: http://pc-3.lib.uoi.gr:8080/jspui/handle/123456789/HASH0150b87d4a7dc95987020be2
Titel: De l' esprit des loix: Ou du rapport que les loix.....
Stichwörter: Law
Issue Date: 15-Jul-2009
Herausgeber: A Geneve : Chez Barrillot File
Beschreibung: 625 p.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/HASH0150b87d4a7dc95987020be2
Sonstige Kennungen: HASH0150b87d4a7dc95987020be2
Appears in Collections: Σπάνια Βιβλία
Man muss den KVK oder einen anderen OPAC bemühen (will man nicht 38 MB auf Verdacht herunterladen), um festzustellen, dass es sich um ein wohl 1748 erschienenes Buch, das Montesquieu zugeschrieben wird, handelt (vorhanden in Gales "Making of the Modern World, in Griechenland frei zugänglich).
Von wann das "Griechisch-Deutsches Worterbuch" ist, das ebenfalls sich in der Sammlung befindet, ist den Metadaten ebenfalls nicht zu entnehmen.
KlausGraf - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 18:55 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der englischsprachige Sammelband gibt einen Überblick zu den Ländern
Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal, Spanien und zur Türkei:
http://www.accesoabierto.net/sites/accesoabierto.net/files/OASouthEurope.pdf
Der Anhang ist leider sehr uneinheitlich. Ohne Griechischkenntnisse fängt man mit den englischsprachigen Bezeichnungen der Digitalen Bibliotheken in Griechenland nichts an, da URLs fehlen. Siehe aber http://tinyurl.com/33attcy
Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal, Spanien und zur Türkei:
http://www.accesoabierto.net/sites/accesoabierto.net/files/OASouthEurope.pdf
Der Anhang ist leider sehr uneinheitlich. Ohne Griechischkenntnisse fängt man mit den englischsprachigen Bezeichnungen der Digitalen Bibliotheken in Griechenland nichts an, da URLs fehlen. Siehe aber http://tinyurl.com/33attcy
KlausGraf - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 18:40 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.ndr.de/flash/NDRPlayer.swf?id=creativecommons105
Creative-Commons-Lizenz BY-NC-ND
Was haben Barack Obama, die Band "Nine Inch Nails" und der NDR gemeinsam? Sie wollen, dass sich ihre Inhalte im Netz verbreiten. Außerdem: NDR Videos extern einbetten.
[Ich machs nicht gern, aber nachdem mein Browser Chrome wegen diesem Video wiederholt abstürzte, musste ich aus Notwehr die Einbindung deaktivieren. Der Gründer und Hauptadministrator KG]
Creative-Commons-Lizenz BY-NC-ND
Was haben Barack Obama, die Band "Nine Inch Nails" und der NDR gemeinsam? Sie wollen, dass sich ihre Inhalte im Netz verbreiten. Außerdem: NDR Videos extern einbetten.
[Ich machs nicht gern, aber nachdem mein Browser Chrome wegen diesem Video wiederholt abstürzte, musste ich aus Notwehr die Einbindung deaktivieren. Der Gründer und Hauptadministrator KG]
Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 18:34 - Rubrik: Web 2.0
Der beachtenswerte Aufsatz von Rainer Polley zur hessischen Rechtslage (mit einem Blick auf NRW) findet sich in den neuen Archivnachrichten aus Hessen, die Herr Contributor Wolf hier anzeigte:
http://archiv.twoday.net/stories/11508613/
http://archiv.twoday.net/stories/11508613/
KlausGraf - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 18:26 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen


Bildquelle: D3 architectes
"Het Franse D3 architectes heeft het ontwerp voor het nationaal archief van Frans-Guyana gepresenteerd. Het expressieve gebouw in de hoofdstad Cayenne herbergt een betonnen silo, waar de archiefstukken beschermd tegen de hoge temperaturen en vochtigheidsgraad liggen opgeslagen.
Deze zeventien meter hoge silo is vanaf de buitenkant niet of nauwelijks zichtbaar dankzij het houten exterieur. Met name het dak, dat de silo en onderbouw als een hoed bedekt, verleent het centrum een sterke identiteit. Het ontwerp is gebaseerd op dat van een ‘carbet’, een traditionele Frans-Guyaanse boshut.
Het dak is voorzien van lamellen, die horizontaal zijn geplaatst om beschutting te bieden als de zon in de middag recht boven het gebouw staat. Doordat er verloop in de lamellen zit, krijgt het gebouw een dynamisch karakter. Dit moet de ‘levendige invloed’ van de archiefstukken in de silo weerspiegelen.
De compact ontworpen silo zelf heeft een dubbele betonnen wand, die een koele en droge omgeving voor de documenten waarborgt. Rond de silo zijn de overige functies als kantoren en educatieve voorzieningen georganiseerd.
Alle programmaonderdelen zijn verbonden via een ruime gang, die qua hoogte nog een etage doorloopt. Hierdoor kan het dankzij de lamellen van het dak daglicht ontvangen. De functies op de eerste verdieping zijn verbonden via een loopbrug. Tussen de twee niveaus bevindt zich een entresol, die dient als ontmoetingsruimte en ontspanningsplaats.
D3 heeft vandaag de prijsvraag voor het ontwerp gewonnen, meldt het bureau. Wanneer het project van start gaat, is evenwel nog niet bekend. "
architectenweb.nl
Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 18:24 - Rubrik: Archivbau
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Mit einem Schwerpunkt zur Eröffnung des Grundbuch- und Personenstandsarchiv Hessen in Neustadt.
Link zur PDF
Link zur PDF
Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 18:06 - Rubrik: Genealogie
Unter den jetzt neu digitalisierten Handschriften befinden sich auch die prächtig illuminierten Basler Matrikelbände von 1460 bis 1764.
http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/all/LastUpdate/20/0
 Wappen von Hiltprand Brandenburg
Wappen von Hiltprand Brandenburg
http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/all/LastUpdate/20/0
 Wappen von Hiltprand Brandenburg
Wappen von Hiltprand BrandenburgKlausGraf - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 16:12 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Miška Mica se znajde v arhivu. Sreča duhca, ki tam živi in jo popelje v neznani svet. Otroci bodo preko zgodbe spoznali in osvojili mnoge nove besede (gotica, incialka, arhiv, arhivalije, listina, mikrofilm, pečat ...), s katerimi jih bo na zabaven duhec popeljal po Arhivu."
Wer übersetzt dieses slowenische Buch?
Quelle: Verlagswerbung
Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 15:54 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Karl Friedrich Drollinger (* 26. Dezember 1688 in Baden-Durlach (das heutige Karlsruhe-Durlach); † 1. Juni 1742 in Basel) war ein Archivar, Lyriker und Übersetzer. Er gehört zu den ersten schweizerischen Dichtern, die eine größere Bekanntheit erreicht haben.
s. a.: http://archiv.twoday.net/search?q=Drollinger
Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 10:41 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 n sich hätte ja heute die 'Speyrer Chronik' und Mitteilungen zu den Burgunderkriegen auf dem Programm gestanden, aber dann war ich von dem im VÖBBLOG gefundenen Video so begeistert, dass ich hinter dem vorletzten Türlein und nach den streng wissenschaftlichen Humanistenbriefwechseln lieber wieder etwas Unterhaltung serviere.
n sich hätte ja heute die 'Speyrer Chronik' und Mitteilungen zu den Burgunderkriegen auf dem Programm gestanden, aber dann war ich von dem im VÖBBLOG gefundenen Video so begeistert, dass ich hinter dem vorletzten Türlein und nach den streng wissenschaftlichen Humanistenbriefwechseln lieber wieder etwas Unterhaltung serviere.Alle Türlein:
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein
KlausGraf - am Donnerstag, 23. Dezember 2010, 00:50 - Rubrik: Unterhaltung
Internet Archive has announced that a publicly accessible digital copy of the complete 1930 United States Census – the largest, most detailed census released to date – is available free of charge at http://www.archive.org/details/1930_census. Previously, 1930 Census records were accessible only through microfilm, or subscription services in which select portions of data are provided for a fee.
http://blog.archive.org/2010/12/22/1790-1930-u-s-census-records-available-free/
http://blog.archive.org/2010/12/22/1790-1930-u-s-census-records-available-free/
KlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 23:19 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In der FAZ.
Die Regel, gemäß deren Geheimdossiers nur aus bereits bekanntem Material zusammengestellt werden dürfen, ist essentiell für das Vorgehen der Geheimdienste - und nicht nur in diesem Jahrhundert. Es ist dieselbe Dynamik wie in einer esoterischen Buchhandlung, in der jede Neuerscheinung (über den Gral, über Templer, über die Rosenkreuzer) exakt dasselbe wiederholt, was in den vorherigen Büchern behauptet wurde. Das liegt nicht so sehr daran, dass Autoren solcher Werke nicht gerne aus unbekanntem Material recherchieren würden (wo auch immer sie über das Nicht-Existierende forschen), sondern an den Anhängern des Okkultismus: Sie glauben nämlich nur an das, was sie bereits wissen und alles bestätigt, was sie irgendwann einmal mitbekommen haben. Nach diesem Mechanismus ist der Erfolg von Dan Brown zu erklären.
Die Regel, gemäß deren Geheimdossiers nur aus bereits bekanntem Material zusammengestellt werden dürfen, ist essentiell für das Vorgehen der Geheimdienste - und nicht nur in diesem Jahrhundert. Es ist dieselbe Dynamik wie in einer esoterischen Buchhandlung, in der jede Neuerscheinung (über den Gral, über Templer, über die Rosenkreuzer) exakt dasselbe wiederholt, was in den vorherigen Büchern behauptet wurde. Das liegt nicht so sehr daran, dass Autoren solcher Werke nicht gerne aus unbekanntem Material recherchieren würden (wo auch immer sie über das Nicht-Existierende forschen), sondern an den Anhängern des Okkultismus: Sie glauben nämlich nur an das, was sie bereits wissen und alles bestätigt, was sie irgendwann einmal mitbekommen haben. Nach diesem Mechanismus ist der Erfolg von Dan Brown zu erklären.
KlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 21:19 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Dass die Datenschutzbeauftragten nicht die hellsten in Sachen Internet sind, sieht man wieder an diesem auf http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=4696 angepriesenen neuen Angebot:
http://www.lfd.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=27356&article_id=92963&_psmand=48
Es gibt kein Browsing, sondern nur eine Suchfunktion mit Stichwortregister, und auch keinen RSS-Feed. Nun, das ist eine klare Bevormundung derjenigen, die gern sofort eingestellte Fälle zur Kenntnis nehmen wollen. Sicher fällt diesen Schlauköpfen auch eine Begründung dafür ein, wieso dies datenschutzrechtlich nicht gewollt ist. Vielleicht weil es eine "neue Qualität" bedeutet, um das allergrößte Dummwort der Datenschutzbeauftragten mal wieder zu zitieren?
http://www.lfd.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=27356&article_id=92963&_psmand=48
Es gibt kein Browsing, sondern nur eine Suchfunktion mit Stichwortregister, und auch keinen RSS-Feed. Nun, das ist eine klare Bevormundung derjenigen, die gern sofort eingestellte Fälle zur Kenntnis nehmen wollen. Sicher fällt diesen Schlauköpfen auch eine Begründung dafür ein, wieso dies datenschutzrechtlich nicht gewollt ist. Vielleicht weil es eine "neue Qualität" bedeutet, um das allergrößte Dummwort der Datenschutzbeauftragten mal wieder zu zitieren?
KlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 20:01 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.dwdl.de/story/29475/tagesschauapp_deckt_verlegerabzocke_auf/
Tagesschau-App deckt Verleger-Abzocke auf: Was man im "großen" Internet nicht schafft - die Bezahlschranke herunter zu lassen - versuchen die Verlage den Lesern ohne echten Mehrwert auf dem kleinen Screen als Mehrwert zu verkaufen. Kein Wunder, dass man bei diesem gewagten Plan Panik vor der "Tagesschau"-App hat.
Tagesschau-App deckt Verleger-Abzocke auf: Was man im "großen" Internet nicht schafft - die Bezahlschranke herunter zu lassen - versuchen die Verlage den Lesern ohne echten Mehrwert auf dem kleinen Screen als Mehrwert zu verkaufen. Kein Wunder, dass man bei diesem gewagten Plan Panik vor der "Tagesschau"-App hat.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Anregungen für Weihnachtsgrüße bietet:
http://blog.moskaliuk.com/institutionelle-weihnachtsgruesse-erraten/
http://blog.moskaliuk.com/institutionelle-weihnachtsgruesse-erraten/
KlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 19:42 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.medievalists.net/2010/12/22/breikocher-josef-the-medieval-origins-of-a-grotesque-comic-motif-in-the-german-christmas-play/ hat den falschen Link, aber wenn man schludrig sucht, denkt man, dass der Autor Joseph Breikocher hieß. In Wirklichkeit heißt er Walsh und der Aufstz über das groteske Motiv von Weihnachtsspielen findet sich hier:
http://parnaseo.uv.es/Ars/webelx/Pon%C3%A8ncies%20pdf/Walsh.pdf
 Joseph kocht Brei (Konrad von Soests Niederwildunger Altar, 1404)
Joseph kocht Brei (Konrad von Soests Niederwildunger Altar, 1404)
http://parnaseo.uv.es/Ars/webelx/Pon%C3%A8ncies%20pdf/Walsh.pdf
 Joseph kocht Brei (Konrad von Soests Niederwildunger Altar, 1404)
Joseph kocht Brei (Konrad von Soests Niederwildunger Altar, 1404)KlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 19:33 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenanalyse-entlarvt-Schummelkultur-in-medizinischen-Studien-1158102.html
Die erste umfassende Übersicht mit Fallbeispielen für die verbreitete Praxis, unangenehme Studiendaten selektiv zu verschweigen, haben Arzneimittelprüfer des Kölner Institutes für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen im Oktober 2010 veröffentlicht. "Vergleicht man die unpublizierten mit den publizierten Daten, so zeigen sich große Ergebnisunterschiede. Die publizierten Studien neigen dazu, die Wirksamkeit zu über- und die Nebenwirkungen zu unterschätzen", resümieren die Prüfer.
Gibt es die Studie auch online? (Heise möchte lieber, dass die Leute sein Technology Review vom Januar 2011 kaufen und verlinkt nur dorthin: http://www.heise.de/tr/artikel/Falsches-Spiel-1155928.html )
[Ja! Siehe Kommentar und http://de.wikipedia.org/wiki/Publikationsbias ]
Siehe auch
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/11/lies-damned-lies-and-medical-science/8269/
Zur Datentransparenz
https://www.iqwig.de/index.1175.html
https://www.iqwig.de/iqwig-gesetz-muss-publikationspflicht-fuer-alle.1133.html
Die erste umfassende Übersicht mit Fallbeispielen für die verbreitete Praxis, unangenehme Studiendaten selektiv zu verschweigen, haben Arzneimittelprüfer des Kölner Institutes für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen im Oktober 2010 veröffentlicht. "Vergleicht man die unpublizierten mit den publizierten Daten, so zeigen sich große Ergebnisunterschiede. Die publizierten Studien neigen dazu, die Wirksamkeit zu über- und die Nebenwirkungen zu unterschätzen", resümieren die Prüfer.
Gibt es die Studie auch online? (Heise möchte lieber, dass die Leute sein Technology Review vom Januar 2011 kaufen und verlinkt nur dorthin: http://www.heise.de/tr/artikel/Falsches-Spiel-1155928.html )
[Ja! Siehe Kommentar und http://de.wikipedia.org/wiki/Publikationsbias ]
Siehe auch
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/11/lies-damned-lies-and-medical-science/8269/
Zur Datentransparenz
https://www.iqwig.de/index.1175.html
https://www.iqwig.de/iqwig-gesetz-muss-publikationspflicht-fuer-alle.1133.html
KlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 19:02 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
Fragt ein Blawger http://rechtsreferendar.blogspot.com/2010/12/welcher-anwalt-braucht-schon-eine.html
 Quelle: http://www.ra-diesel.de
Quelle: http://www.ra-diesel.de
 Quelle: http://www.ra-diesel.de
Quelle: http://www.ra-diesel.deKlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 18:57 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.rechtslupe.de/zivilrecht/die-nicht-kopierfaehige-notarurkunde-324709
Die Kopierfähigkeit muss dagegen nicht zwingend erhalten bleiben. Bei Gesamturkunden kann die dauerhafte Verbindung durch Schnur und Prägesiegel nämlich leicht dazu führen, dass einzelne Teile der Urkunde zwar lesbar, nicht aber kopierfähig bleiben. Der Notar soll die Ösung sogar so im oberen Drittel des Seitenrandes anbringen, dass der Heftfaden durch eine Lochung nicht beschädigt werden kann4. Würde ihm gleichzeitig die Pflicht auferlegt, die Kopierfähigkeit der einzelnen Teile der Gesamturkunde zu erhalten, könnte die dauerhafte Zusammenfügung häufig nicht sichergestellt werden.
Die Kopierfähigkeit muss dagegen nicht zwingend erhalten bleiben. Bei Gesamturkunden kann die dauerhafte Verbindung durch Schnur und Prägesiegel nämlich leicht dazu führen, dass einzelne Teile der Urkunde zwar lesbar, nicht aber kopierfähig bleiben. Der Notar soll die Ösung sogar so im oberen Drittel des Seitenrandes anbringen, dass der Heftfaden durch eine Lochung nicht beschädigt werden kann4. Würde ihm gleichzeitig die Pflicht auferlegt, die Kopierfähigkeit der einzelnen Teile der Gesamturkunde zu erhalten, könnte die dauerhafte Zusammenfügung häufig nicht sichergestellt werden.
KlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 18:49 - Rubrik: Archivrecht
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7863/
Ohler, Norbert: Landeskunde Südwestdeutschlands: eine Auswahlbibliographie mit Schwerpunkt Geschichte unter Berücksichtigung von Anrainern und Nachbardisziplinen
Die Landeskunde Südwestdeutschlands ist über viele Jahre hinweg aus Lehrveranstaltungen des Autors zur südwestdeutschen Landesgeschichte am Historischen Seminar der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. hervorgegangen. Sie ist überregional und interdisziplinär angelegt und bietet eine ausgezeichnete Ergänzung zu Datenbanken wie der "Virtuellen Deutschen Landesbibliographie" oder der "Bodensee-Bibliographie".
Natürlich kann man an genügend Titeln und Lücken der 3000 Nummern umfassenden umfangreichen Bibliographie herummäkeln (sie ist sehr baden-lastig), aber das ändert nichts daran, dass eine solche Auswahl von großem Nutzen ist. Angesichts der Fülle vorliegender Literatur kommt es darauf an, den Weg zum Wichtigen zu weisen.
Ohler, Norbert: Landeskunde Südwestdeutschlands: eine Auswahlbibliographie mit Schwerpunkt Geschichte unter Berücksichtigung von Anrainern und Nachbardisziplinen
Die Landeskunde Südwestdeutschlands ist über viele Jahre hinweg aus Lehrveranstaltungen des Autors zur südwestdeutschen Landesgeschichte am Historischen Seminar der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. hervorgegangen. Sie ist überregional und interdisziplinär angelegt und bietet eine ausgezeichnete Ergänzung zu Datenbanken wie der "Virtuellen Deutschen Landesbibliographie" oder der "Bodensee-Bibliographie".
Natürlich kann man an genügend Titeln und Lücken der 3000 Nummern umfassenden umfangreichen Bibliographie herummäkeln (sie ist sehr baden-lastig), aber das ändert nichts daran, dass eine solche Auswahl von großem Nutzen ist. Angesichts der Fülle vorliegender Literatur kommt es darauf an, den Weg zum Wichtigen zu weisen.
KlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 17:49 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://hharp.org/
We are very pleased to announce the addition of a new database of admission records to the HHARP website: the Royal Hospital for Sick Children, Glasgow. Covering the period 1883 (when the hospital first opened) to 1903, the database offers insight into the health of the poor child in the Scottish city of Glasgow, complementing databases already available for three London hospitals: the Hospital for Sick Children at Great Ormond Street, the Evelina Hospital and the Alexandra Hospital for Children with Hip Disease.
We are very pleased to announce the addition of a new database of admission records to the HHARP website: the Royal Hospital for Sick Children, Glasgow. Covering the period 1883 (when the hospital first opened) to 1903, the database offers insight into the health of the poor child in the Scottish city of Glasgow, complementing databases already available for three London hospitals: the Hospital for Sick Children at Great Ormond Street, the Evelina Hospital and the Alexandra Hospital for Children with Hip Disease.
KlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 17:44 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://blog.beck.de/2010/12/22/loveparade-2010-fuenf-monate-danach-staatsanwaltschaftliche-ermittlungen-werden-konkretisiert
Die strafrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit diesem Ereignis sind hier im Blog mit einer Nachhaltigkeit diskutiert worden, die bisher bei keinem der hier verhandelten Themen erreicht wurde. Die drei von mir eingestellten Beiträge sind insgesamt bislang 25000 mal aufgerufen und über 1100 mal kommentiert worden. Damit wurde die Leistungsfähigkeit der Kommentarfunktion in diesem Blog mehrfach auf eine ersnthafte Probe gestellt. Dabei wird - wie nicht anders zu erwarten bei so einem komplexen Geschehen, die Diskussion nunmehr weitgehend von wenigen "Experten" geführt, die sich in den vergangenen Monaten in alle Einzelheiten des Geschehens und der im Netz verfügbaren Planungsunterlagen eingearbeitet haben. Viele der Kommenatre sind hilfreich und alle zusammen vermitteln ein realistisches Bild von den Abläufen vor und bei dieser Veranstaltung. Als Fazit lässt sich wohl festhalten: Die Katstrophe war kein unglücklicher Zufall oder einfach Pech, sondern sie war bei der mangelhaften Planung, der widerrechtlichen Genehmigung und der mangelhaften Beachtung von Sicherheitsvorkehrungen geradezu erwartbar. Die Loveparade hätte in dieser Größenordnung an diesem Ort und mit diesen Vorkehrungen nicht stattfinden dürfen.
Die strafrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit diesem Ereignis sind hier im Blog mit einer Nachhaltigkeit diskutiert worden, die bisher bei keinem der hier verhandelten Themen erreicht wurde. Die drei von mir eingestellten Beiträge sind insgesamt bislang 25000 mal aufgerufen und über 1100 mal kommentiert worden. Damit wurde die Leistungsfähigkeit der Kommentarfunktion in diesem Blog mehrfach auf eine ersnthafte Probe gestellt. Dabei wird - wie nicht anders zu erwarten bei so einem komplexen Geschehen, die Diskussion nunmehr weitgehend von wenigen "Experten" geführt, die sich in den vergangenen Monaten in alle Einzelheiten des Geschehens und der im Netz verfügbaren Planungsunterlagen eingearbeitet haben. Viele der Kommenatre sind hilfreich und alle zusammen vermitteln ein realistisches Bild von den Abläufen vor und bei dieser Veranstaltung. Als Fazit lässt sich wohl festhalten: Die Katstrophe war kein unglücklicher Zufall oder einfach Pech, sondern sie war bei der mangelhaften Planung, der widerrechtlichen Genehmigung und der mangelhaften Beachtung von Sicherheitsvorkehrungen geradezu erwartbar. Die Loveparade hätte in dieser Größenordnung an diesem Ort und mit diesen Vorkehrungen nicht stattfinden dürfen.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Bergungsarbeiten an der Einsturzstelle des Kölner Archivs werden an Weihnachten eingestellt. Die Maschinen werden abgeschaltet, um die Weihnachtsruhe für die Anwohner einzuhalten, so die Stadt. Anfang Januar sollen Taucher im Grundwasser an der Einsturzstelle nach den restlichen verschüttten Archivalien zu suchen."
Quelle: WDR.de. Studio Köln, Nachrichten, 22.12.2010
Quelle: WDR.de. Studio Köln, Nachrichten, 22.12.2010
Wolf Thomas - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 09:17 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 09:11 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 n einer Zusammenstellung von Humanistenbriefwechseln aus dem deutschsprachigen Raum arbeitend, möchte ich eine Auswahl einschlägiger Internetquellen bereits jetzt vorstellen.
n einer Zusammenstellung von Humanistenbriefwechseln aus dem deutschsprachigen Raum arbeitend, möchte ich eine Auswahl einschlägiger Internetquellen bereits jetzt vorstellen. Die ersten frühhumanistischen Bestrebungen setzen im wesentlichen nach der Mitte des 15. Jahrhunderts ein. Mit der Reformation tritt diese - in den Quellen, vor allem aber in der Forschung - in den Vordergrund und der humanistische Freundschaftsbrief in den Hintergrund. Der Einfachheit halber entschloss ich mich, das Jahr 1520 als Grenzjahr zu nehmen. "Reformatoren", von denen aus der Zeit vor 1517 wenigstens einige wenige Briefe erhalten sind, müssten also berücksichtigt werden.
Wer kann als Humanist gelten? Mit dem Eindringen klassisch geschulten Lateins in die Gelehrtenwelt fällt ein Kriterium weg, mit der man im Frühhumanismus vielleicht "Humanisten" und sonstige lateinisch schreibende Gelehrte unterscheiden könnte. Die bekannten großen vorreformatorischen Korpora (mit ganz überwiegend lateinischem Inhalt) sind jedenfalls eindeutig Humanisten gewidmet.
Eine Bibliographie zu Briefsammlungen der Reformationszeit bietet Smith 1918
http://books.google.com/books?id=oEy_3aDT61sC&pg=PA542
Zur humanistischen Briefkultur (mit Schwerpunkt auf dem Späthumanismus bzw. der frühen Neuzeit):
Almási, Gábor: Humanistic Letter-Writing, in: Europäische Geschichte Online (EGO), hg. vom Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz 03.12.2010. URL: http://www.ieg-ego.eu/almasig-2010-en URN:urn:nbn:de:0159-20101011147
***
Die Autoren sind nach ihrem Todesjahr geordnet.
Hermann Schedel (1410-1485)
Joachimsohns Ausgabe von 1893 steht im Netz (nach dem Google-US-Digitalisat):
http://www.archive.org/details/hermannschedels00joacgoog
Peter Schott der Jüngere (1459-1490)
Die maßgebliche Edition von Cowie 1963 ist nicht online, wohl aber die Quelle für den Briefwechsel, der zeitgenössische Druck der Lucubraciunculae, 1498
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/inc-ii-81
Albrecht von Bonstetten (gest. ca. 1504/05)
Das im Codex 710 der Stiftsbibliothek St. Gallen erhaltene Briefcorpus des Einsiedler Dekans edierte Albert Büchi 1893:
http://www.archive.org/details/AlbrechtVonBonstettenBriefeUndAusgewaehlteSchriften
 Celtis-Epitaph
Celtis-EpitaphKonrad Celtis (1459-1508)
Rupprichs Briefwechsel-Ausgabe von 1934 ist zwar nicht online, aber die UB München hat 18 Briefe des Erzhumanisten digitalisiert:
http://epub.ub.uni-muenchen.de/11365/
Johannes Fuchsmagen (1450-1510)
17 Briefe 1507-1509 an Abt Johann I. von Kremsmünster edierte Richard Newald 1926:
http://www.ooegeschichte.at/uploads/tx_iafbibliografiedb/JBMusver_1926_081_0153-0223.pdf
Johannes Trithemius (1462-1516)
Klaus Arnolds Trithemius-Biographie ²1991 enthält ein "Briefregister". An alten Drucken sind online
Busäus 1605 (30 Briefe)
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/pageview/1829849
Jakob Spiegels Sammlung 1536
http://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/receive/HisBest_cbu_00001431?jumpback=true&maximized=true&page=/BE_0124_0000_00.tif
Wieder in Frehers Opera historica, die dank freundlicher und rascher Erfüllung eines Digitalisierungswunsches durch Dilibri nunmehr auch online sind, hier Bd. 2:
http://www.dilibri.de/rlbdfg/content/pageview/385535
Johannes Reuchlin (1455-1522)
Ob Bd. IV der neuen Ausgabe der briefe noch erscheint? Für die Briefe ab 1517 muss man leider noch Geiger 1875 konsultieren:
http://www.archive.org/details/johannreuchlins01reucgoog
Die alten Drucke bei
http://www.philological.bham.ac.uk/bibliography/r.html
(Thallers Digitalisate-Server zur Lutherhalle Wittenberg ist seit mindestens Anfang 2010 offline; Thaller reagiert nicht mehr auf Mails dazu, letzte Mail von ihm 30. März 2010)
Konrad Mutian (1470-1526)
Beide parallel entstandenen Briefwechselausgaben sind online:
Edition Krause
http://www.archive.org/search.php?query=mutianus%20AND%20mediatype:texts
Gillert I-II
http://www.archive.org/details/derbriefwechsel00sachgoog
[ http://archiv.twoday.net/stories/342799851/ ]
Jakob Wimpfeling (1450-1528)
Eine herausragende Leistung, die auch online verfügbar ist: der von Otto Herding und Dieter Mertens bearbeitete Briefwechsel
I. http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2675/
II: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2676/
Johannes Aventin (1477-1534)
Dafür, dass in den "Sämmtlichen Werken" Bd. 1 und Bd. 6
http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/aventin
nur gut 20 Briefe dokumentiert werden konnten, werden diese sehr eingehend im Verfasserlexikon "Deutscher Humanismus" gewürdigt:
http://paperc.de/2909-deutscher-humanismus-a---k-9783110213874/pages/54
Ulrich Zasius (1461-1535)
Mit anderen Werken Josef Antons von Riegger ist auch die Ausgabe der Zasius-Briefe 1774 von der UB Freiburg digitalisiert worden:
http://digilib.ub.uni-freiburg.de/document/316214523/
 Scheurl
ScheurlChristoph Scheurl (1481-1542)
Von Soden und Knaake gaben 1867/72 in 282 Nummern aus den Handschriftenbänden im privaten Scheurl-Archiv Briefe Scheurls an Zeitgenossen heraus:
I: http://books.google.de/books?id=si5iAAAAMAAJ
II: http://books.google.de/books?id=si5iAAAAMAAJ&pg=PA173
Johannes Eck (1486-1543)
Das einzige laufende Editionsprojekt, das als Internetprojekt durchgeführt wird:
http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eck-Briefe.html
Konrad Peutinger (1465-1547)
Der von Erich König 1923 bearbeitete Briefwechsel steht in Düsseldorf zur Einsicht bereit:
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/1806887
Beatus Rhenanus (1485-1547)
Die Ausgabe des Briefwechsels von Horawitz und Hartfelder ist online:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Briefwechsel_des_Beatus_Rhenanus.pdf
http://www.archive.org/details/BriefwechselDesBeatusRhenanus2
Ein alter Aufsatz von Horawitz über die in Form von Originalen erhaltene Korrespondenz in Schlettstadt
http://www.archive.org/stream/sitzungsberichte78stuoft#page/312/mode/2up
Digitalisate bietet die Schlettstädter Humanistenbibliothek:
http://www.ville-selestat.fr/bh/index.php?page=accueil
Die Liste der 2009 digitalisierten Briefe:
http://www.ville-selestat.fr/bh/cbr_2009.pdf
Joachim Vadian (1484-1551)
Um die Ausgabe der Vadianischen Briefsammlung von Emil Arbenz bei Google zu benutzen, kann man zu einem US-Proxy greifen:
I http://books.google.com/books?id=4SwLAAAAIAAJ&pg=PA395
II http://books.google.com/books?id=Ai0LAAAAIAAJ&pg=PA191
III http://books.google.com/books?id=SSwLAAAAIAAJ&pg=PP13
IV http://books.google.com/books?id=SSwLAAAAIAAJ&pg=PA697
V http://books.google.com/books?id=kC8LAAAAIAAJ&pg=PA617
VI http://books.google.com/books?id=OSsLAAAAIAAJ&pg=PP7
VII http://books.google.com/books?id=OSsLAAAAIAAJ&pg=RA15-PA959
Oder die Bände im Internet Archive einsehen
1 http://www.archive.org/stream/mitteilungenzur03gallgoog#page/n424/mode/2up
2 http://www.archive.org/stream/mitteilungenzur05gallgoog#page/n210/mode/2up
3 http://www.archive.org/stream/mitteilungenzur01gallgoog#page/n14/mode/2up
4 http://www.archive.org/stream/mitteilungenzur01gallgoog#page/n720/mode/2up
5 http://www.archive.org/stream/mitteilungenzur04gallgoog#page/n12/mode/2up
6 http://www.archive.org/stream/mitteilungenzur00gallgoog#page/n10/mode/2up
7 http://www.archive.org/stream/mitteilungenzur00gallgoog#page/n966/mode/2up
Ambrosius Blarer (1492-1564)
Vom dreibändigen "Briefwechsel der Brüder Ambrosius und Thomas Blaurer 1509–1548" liegt der Band 1: 1509 –Juni 1538, 1908 online vor:
http://www.archive.org/details/briefwechselder00kommgoog
Alle Türlein:
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein
KlausGraf - am Mittwoch, 22. Dezember 2010, 00:27 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
Bejamin Barons Münsteraner Dissertation von 2010 (bei Thomas Hoeren) ist bei PaperC seinsehbar (und zitiert Archivalia):
http://paperc.de/12561-interessenausgleich-im-wissenschaftsurheberrecht-9783840500190/
Aus der Zusammenfassung:
Die Arbeit ist der Frage gewidmet, welchen Beitrag die wissenschaftsrelevanten urheberrechtlichen „Schrankenregelungen“ zu einem solchen Interessenausgleich leisten oder leisten können. Sie stellt neben Besonderheiten des „Wissenschaftsurheberrechts“ die internationalen, europäischen und verfassungsrechtlichen Vorgaben dar und untersucht detailliert einzelne relevante Schranken des deutschen Urheberrechts. Neben der Vervielfältigung zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch (§ 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG), der öffentlichen Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung (§ 52a UrhG) und der Schranke zugunsten elektronischer Leseplätze (52b UrhG) bezieht sie auch den im Zweiten Korb der Urheberrechtsreform kodifi zierten Kopienversand auf Bestellung (§ 53a UrhG) ein.
Update: VÖBBLOG ergänzt weitere Online-Fundstelle
http://miami.uni-muenster.de/servlets/DocumentServlet?id=5453
http://paperc.de/12561-interessenausgleich-im-wissenschaftsurheberrecht-9783840500190/
Aus der Zusammenfassung:
Die Arbeit ist der Frage gewidmet, welchen Beitrag die wissenschaftsrelevanten urheberrechtlichen „Schrankenregelungen“ zu einem solchen Interessenausgleich leisten oder leisten können. Sie stellt neben Besonderheiten des „Wissenschaftsurheberrechts“ die internationalen, europäischen und verfassungsrechtlichen Vorgaben dar und untersucht detailliert einzelne relevante Schranken des deutschen Urheberrechts. Neben der Vervielfältigung zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch (§ 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG), der öffentlichen Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung (§ 52a UrhG) und der Schranke zugunsten elektronischer Leseplätze (52b UrhG) bezieht sie auch den im Zweiten Korb der Urheberrechtsreform kodifi zierten Kopienversand auf Bestellung (§ 53a UrhG) ein.
Update: VÖBBLOG ergänzt weitere Online-Fundstelle
http://miami.uni-muenster.de/servlets/DocumentServlet?id=5453
KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 22:29 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=jep;view=text;rgn=main;idno=3336451.0013.305
Google Scholar is far easier to spam than the classic Google Search for Web pages. While Google Web Search is applying various methods to detect spam and there is lots of research on detecting spam in Web search, Google Scholar applies only very rudimentary mechanisms—if any—to detect spam.
Google Scholar is far easier to spam than the classic Google Search for Web pages. While Google Web Search is applying various methods to detect spam and there is lots of research on detecting spam in Web search, Google Scholar applies only very rudimentary mechanisms—if any—to detect spam.
KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 22:21 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Darin mein Artikel:
Klaus Graf: Johann Ludwig Uhland, in: Enzyklopädie des Märchens 13 Lief. 3 (2010), Sp. 1128-1134
Online (kostenlose Registrierung)
http://paperc.de/12311-suchen-verfuehrung-9783110237689/pages/580
Weil sich alle Naselang die URL ändert nunmehr:
http://paperc.de/12311-suchen-verfuehrung-9783110237689#!/pages/564
Klaus Graf: Johann Ludwig Uhland, in: Enzyklopädie des Märchens 13 Lief. 3 (2010), Sp. 1128-1134
Online (kostenlose Registrierung)
Weil sich alle Naselang die URL ändert nunmehr:
http://paperc.de/12311-suchen-verfuehrung-9783110237689#!/pages/564
KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 22:10 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://paperc.de/14933-der-himmel-uber-dem-rat-9783898124775/pages/99
Unter den bei PaperC neu eingestellten Titeln des Mitteldeutschen Verlags ist auch die Studie von Antje Diener-Staeckling "Der Himmel über dem Rat" 2007, die S. 99ff. St. Wenzel als Naumburger Stadtpatron und nachreformatorisches Stadtsymbol behandelt.
Unter den bei PaperC neu eingestellten Titeln des Mitteldeutschen Verlags ist auch die Studie von Antje Diener-Staeckling "Der Himmel über dem Rat" 2007, die S. 99ff. St. Wenzel als Naumburger Stadtpatron und nachreformatorisches Stadtsymbol behandelt.
KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 21:59 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://adlib.catharijneconvent.nl/
Leider lässt die Auflösung bei Vergrößerung sehr zu wünschen übrig, und ein Viewer steht auch nicht zur Verfügung (von einer zitierbaren URL ganz zu schweigen). Man kann also Blätter nicht gezielt ansteuern, sondern nur von vorne blättern. Mein Urteil: unbrauchbar!
Beispiel: Ansfriduscodex
Die Digitalisate aufzufinden ist nicht einfach (handschrift erbringt nicht die einschlägigen Resultate! Also: Expert search, Filter >1500, in den Resultaten nach object name = handschrift suchen). Meist gibt es nur Schlüsselseiten (auch bei Inkunabeln).
http://www.codart.nl/news/585/
As of now, the Museum Catharijneconvent has made available all objects in the museum's collection on its website. Items from is library are catalogued as well. For about 20 percent of the objects images are also available.
Wie man von einer bekannten Signatur, siehe etwa
http://www.handschriftencensus.de/hss/Utrecht#bib3
zu einem Eintrag kommt, habe ich nicht herausgefunden.
Fazit: Ein Schrottangebot, das verärgert statt erfreut.

Leider lässt die Auflösung bei Vergrößerung sehr zu wünschen übrig, und ein Viewer steht auch nicht zur Verfügung (von einer zitierbaren URL ganz zu schweigen). Man kann also Blätter nicht gezielt ansteuern, sondern nur von vorne blättern. Mein Urteil: unbrauchbar!
Beispiel: Ansfriduscodex
Die Digitalisate aufzufinden ist nicht einfach (handschrift erbringt nicht die einschlägigen Resultate! Also: Expert search, Filter >1500, in den Resultaten nach object name = handschrift suchen). Meist gibt es nur Schlüsselseiten (auch bei Inkunabeln).
http://www.codart.nl/news/585/
As of now, the Museum Catharijneconvent has made available all objects in the museum's collection on its website. Items from is library are catalogued as well. For about 20 percent of the objects images are also available.
Wie man von einer bekannten Signatur, siehe etwa
http://www.handschriftencensus.de/hss/Utrecht#bib3
zu einem Eintrag kommt, habe ich nicht herausgefunden.
Fazit: Ein Schrottangebot, das verärgert statt erfreut.

KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 20:18 - Rubrik: Kodikologie
Das Netzwerk Recherche, Greenpeace und die Deutsche Gesellschaft für Informationsfreiheit haben heute in Berlin einen Gesetzentwurf für umfassende Behördentransparenz vorgestellt.
Text:
http://www.netzwerkrecherche.de/Projekte/Infofreiheitsgesetz-IFG/Gesetzentwurf-Buergerinformationsgesetz/
Es ist seit langem bekannt, dass die archivrechtlichen Regelungen über den Informationszugang zu mindestens 10, meist jedoch 30 Jahre alten Verwaltungsakten und die Informationsfreiheitsgesetze im Konflikt miteinander stehen. Folgt man der überwiegenden Meinung, dass das Archivgesetz die lex specialis darstellt, so ist es weitgehend eine Frage des Zufalls, ob der Bürger Einsichtsrechte gegenüber der Verwaltung nach dem IFG hat (wenn die Unterlagen noch nicht ans Archiv abgegeben wurden) oder aufgrund der archivischen Sperrfrist mindestens 10-30 Jahre warten muss. Im Bundesarchivgesetz § 5 Abs. 4 heißt es dagegen:
"Gleiches gilt für Archivgut, soweit es vor der Übergabe an das Bundesarchiv oder die Archive der gesetzgebenden Körperschaften bereits einem Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz offen gestanden hat."
Diese Vorschrift hätte ein Bürgerinformationsgesetz klarer fassen müssen: Gemeint ist, dass die Voraussetzungen gegeben waren, nicht, dass eine konkrete Einsicht stattgefunden hat.
Ein Bürgerinformationsgesetz, das den Archivbereich ganz ausklammert, greift zu kurz!
Siehe auch:
http://archiv.twoday.net/stories/4407446/
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:82-opus-34824 S. 68ff.
Text:
http://www.netzwerkrecherche.de/Projekte/Infofreiheitsgesetz-IFG/Gesetzentwurf-Buergerinformationsgesetz/
Es ist seit langem bekannt, dass die archivrechtlichen Regelungen über den Informationszugang zu mindestens 10, meist jedoch 30 Jahre alten Verwaltungsakten und die Informationsfreiheitsgesetze im Konflikt miteinander stehen. Folgt man der überwiegenden Meinung, dass das Archivgesetz die lex specialis darstellt, so ist es weitgehend eine Frage des Zufalls, ob der Bürger Einsichtsrechte gegenüber der Verwaltung nach dem IFG hat (wenn die Unterlagen noch nicht ans Archiv abgegeben wurden) oder aufgrund der archivischen Sperrfrist mindestens 10-30 Jahre warten muss. Im Bundesarchivgesetz § 5 Abs. 4 heißt es dagegen:
"Gleiches gilt für Archivgut, soweit es vor der Übergabe an das Bundesarchiv oder die Archive der gesetzgebenden Körperschaften bereits einem Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz offen gestanden hat."
Diese Vorschrift hätte ein Bürgerinformationsgesetz klarer fassen müssen: Gemeint ist, dass die Voraussetzungen gegeben waren, nicht, dass eine konkrete Einsicht stattgefunden hat.
Ein Bürgerinformationsgesetz, das den Archivbereich ganz ausklammert, greift zu kurz!
Siehe auch:
http://archiv.twoday.net/stories/4407446/
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:82-opus-34824 S. 68ff.
KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 19:20 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Fragment 147 - http://www.handschriftencensus.de/17849 - in der alten Präsentation:
http://www.blb-karlsruhe.de/virt_bib/fragmenta_augiensia/frame.php?f=147&b=0&g=1
Und in der neuen:
http://digital.blb-karlsruhe.de/id/29835
Informationsverlust: Der Nachtrag zum Katalog ist nicht mehr verlinkt. Ist auch bei Fr. 144 so und wohl auch den anderen. Die Verantwortlichen scheinen davon auszugehen, dass es zu einer Handschrift immer nur einen Katalognachweis geben darf.
http://www.blb-karlsruhe.de/virt_bib/fragmenta_augiensia/frame.php?f=147&b=0&g=1
Und in der neuen:
http://digital.blb-karlsruhe.de/id/29835
Informationsverlust: Der Nachtrag zum Katalog ist nicht mehr verlinkt. Ist auch bei Fr. 144 so und wohl auch den anderen. Die Verantwortlichen scheinen davon auszugehen, dass es zu einer Handschrift immer nur einen Katalognachweis geben darf.
KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 18:49 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://issuu.com/scholarsbookshelf/docs
In guter Qualität vergrößerbar, unter anderem Hartmann Schedels Chronik (nach dem Exemplar einer nicht genannten Bibliothek?).
http://issuu.com/scholarsbookshelf/docs/chronicle_of_nuremberg
In guter Qualität vergrößerbar, unter anderem Hartmann Schedels Chronik (nach dem Exemplar einer nicht genannten Bibliothek?).
http://issuu.com/scholarsbookshelf/docs/chronicle_of_nuremberg
KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 17:45 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
Die American Psychological Association hat die frühere Verpflichtung, Daten für Re-Studies mit anderen Wissenschaftlern auszutauschen, erheblich abgeschwächt:
http://wicherts.socsci.uva.nl/APA02.pdf
Was meinen Wissenschaftler zu Open Access? Wenn man wie eine junge griechische Wissenschaftlerin den goldenen und grünen Weg zusammenwirft, braucht man sich über entsprechende Ergebnisse nicht zu wundern:
http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=jep;view=text;rgn=main;idno=3336451.0013.304
Repositorien sind derzeit überwiegend nicht für Primärpublikationen gedacht, daher geht die Frage nach dem Vertrauen in Repositorien in die Leere. Überhaupt scheint mir diese Untersuchung methodisch eher fragwürdig.
Generell stellt sich die Frage: Wie fördert man den Fortschritt der Wissenschaft gegen die Wissenschaftler? Dass diese am besten wissen, was für die Wissenschaft gut ist, halte ich für ein Gerücht.
Zum Thema auch:
http://archiv.twoday.net/stories/8401787/
http://wicherts.socsci.uva.nl/APA02.pdf
Was meinen Wissenschaftler zu Open Access? Wenn man wie eine junge griechische Wissenschaftlerin den goldenen und grünen Weg zusammenwirft, braucht man sich über entsprechende Ergebnisse nicht zu wundern:
http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=jep;view=text;rgn=main;idno=3336451.0013.304
Repositorien sind derzeit überwiegend nicht für Primärpublikationen gedacht, daher geht die Frage nach dem Vertrauen in Repositorien in die Leere. Überhaupt scheint mir diese Untersuchung methodisch eher fragwürdig.
Generell stellt sich die Frage: Wie fördert man den Fortschritt der Wissenschaft gegen die Wissenschaftler? Dass diese am besten wissen, was für die Wissenschaft gut ist, halte ich für ein Gerücht.
Zum Thema auch:
http://archiv.twoday.net/stories/8401787/
KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 17:30 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Als Einführung gedacht, aber für Nichtexperten eher unverständlich formuliert:
http://metadaten-twr.org/2010/12/14/oai-ore/
http://metadaten-twr.org/2010/12/14/oai-ore/
KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 17:20 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.toonworks.de/?p=765
Danke an FG
Zu Streetview
http://archiv.twoday.net/search?q=streetview
Danke an FG
Zu Streetview
http://archiv.twoday.net/search?q=streetview
KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 17:18 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 11:16 - Rubrik: Kommunalarchive
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=48037&pos=0&anz=1
Zur StreetView-Problematik ist zu beachten:
Zwar liegt die Annahme einer Persönlichkeitsrechtsverletzung regelmäßig eher fern, wenn lediglich das Fotografieren der Außenansicht eines Grundstücks von einer all-gemein zugänglichen Stelle aus und die Verbreitung solcher Fotos in Frage stehen, weil die Aufnahmen nur den ohnehin nach außen gewandten Bereich betreffen. Anderes kann jedoch gelten, wenn durch die Beiordnung des Namens der Bewohner die Anonymität eines Grundstücks aufgehoben wird, so dass die Abbildungen einer Person zugeordnet werden können und dadurch einen zusätzlichen Informationsgehalt gewinnen.
Zur StreetView-Problematik ist zu beachten:
Zwar liegt die Annahme einer Persönlichkeitsrechtsverletzung regelmäßig eher fern, wenn lediglich das Fotografieren der Außenansicht eines Grundstücks von einer all-gemein zugänglichen Stelle aus und die Verbreitung solcher Fotos in Frage stehen, weil die Aufnahmen nur den ohnehin nach außen gewandten Bereich betreffen. Anderes kann jedoch gelten, wenn durch die Beiordnung des Namens der Bewohner die Anonymität eines Grundstücks aufgehoben wird, so dass die Abbildungen einer Person zugeordnet werden können und dadurch einen zusätzlichen Informationsgehalt gewinnen.
KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 00:51 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://ub-goobi-pr.ub.uni-greifswald.de/view/27814/0/
[bzw. http://ub-goobi-pr2.ub.uni-greifswald.de/viewer/ppnresolver?id=PPNArchivHWI_Chronik_009 ]
Mit höchst kargen Metadaten:
URN: urn:nbn:de:gbv:9-g-29514
Persistente ID: PPNArchivHWI_Chronik_009
Strukturtyp: Monographie
DC: Universittsarchiv
Erscheinungsjahr: 1559-1617
Erscheinungsort: Wismar
Titel: Chronik des Barbiers Jürgen Wever
Erstellungsdatum: 20.12.10 16:57
ich vermisse mindestens die Angabe, dass es sich um eine Handschrift handelt und die Signatur des Universitätsarchivs (falls dieses tatsächlich der Eigentümer ist und nicht die Stadt Wismar).
[bzw. http://ub-goobi-pr2.ub.uni-greifswald.de/viewer/ppnresolver?id=PPNArchivHWI_Chronik_009 ]
Mit höchst kargen Metadaten:
URN: urn:nbn:de:gbv:9-g-29514
Persistente ID: PPNArchivHWI_Chronik_009
Strukturtyp: Monographie
DC: Universittsarchiv
Erscheinungsjahr: 1559-1617
Erscheinungsort: Wismar
Titel: Chronik des Barbiers Jürgen Wever
Erstellungsdatum: 20.12.10 16:57
ich vermisse mindestens die Angabe, dass es sich um eine Handschrift handelt und die Signatur des Universitätsarchivs (falls dieses tatsächlich der Eigentümer ist und nicht die Stadt Wismar).
KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 00:36 - Rubrik: Kodikologie
http://www.mgh.de/bibliothek/digitale-bibliothek/quellen/
30 bislang im Internet nicht zugängliche Titel des 17. bis 20. Jahrhunderts wurden als PDF digitalisiert, darunter Mencken, Scriptores rerum Germanicarum 1-3 und Hieronymus Pez: Scriptores rerum Austriacarum veteres ac genuini 1-3
Als Kooperationspartner ist auch Wikisource angegeben.
30 bislang im Internet nicht zugängliche Titel des 17. bis 20. Jahrhunderts wurden als PDF digitalisiert, darunter Mencken, Scriptores rerum Germanicarum 1-3 und Hieronymus Pez: Scriptores rerum Austriacarum veteres ac genuini 1-3
Als Kooperationspartner ist auch Wikisource angegeben.
KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 00:21 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2010/12/19/the-face-of-justice/
Where to find digital collections without using the omnipresent search machine that can seem to substitute further research? Even professional researchers do need some repertories, some of them well known, others an acquired taste. Portals such as MICHAEL, the Europeana portal and Intute belong to the obvious choices. Some libraries have wonderful link collections for particular subjects, but it is difficult to single out one of the world’s major libraries. On my personal list of favorite guides figures Margaret Vale’s The Digital Librarian, not only out of sheer admiration for the vast range of links on almost every subject, but also because of the useful comments. Uncommented link lists present not enough information. Some blogs have proven to be very useful even if one has to read German or Italian. The Archivalia blog of Klaus Graf in Freiburg and his NetBookWiki are very well-informed. The blogs Bibliostoria at Milan and Filosofia & Storia at Pisa often bring additional links. They give every link item its own posting, and you can search for them by category. The University of New Hampshire Library presents on its Digital Collections blog links in a similar way.
Where to find digital collections without using the omnipresent search machine that can seem to substitute further research? Even professional researchers do need some repertories, some of them well known, others an acquired taste. Portals such as MICHAEL, the Europeana portal and Intute belong to the obvious choices. Some libraries have wonderful link collections for particular subjects, but it is difficult to single out one of the world’s major libraries. On my personal list of favorite guides figures Margaret Vale’s The Digital Librarian, not only out of sheer admiration for the vast range of links on almost every subject, but also because of the useful comments. Uncommented link lists present not enough information. Some blogs have proven to be very useful even if one has to read German or Italian. The Archivalia blog of Klaus Graf in Freiburg and his NetBookWiki are very well-informed. The blogs Bibliostoria at Milan and Filosofia & Storia at Pisa often bring additional links. They give every link item its own posting, and you can search for them by category. The University of New Hampshire Library presents on its Digital Collections blog links in a similar way.
KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 00:09 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 us den 1996 beendeten unveröffentlichten Lebenserinnerungen meiner Mutter Herta Graf (1911-1996) ist seit 1997 das Kapitel Ferien auf dem Haselbuschhof online. Hier folgt nun der Anfang des Werks über die ersten Erinnerungen, die dem Aufenthalt in Moskau (ab 1915) galten.
us den 1996 beendeten unveröffentlichten Lebenserinnerungen meiner Mutter Herta Graf (1911-1996) ist seit 1997 das Kapitel Ferien auf dem Haselbuschhof online. Hier folgt nun der Anfang des Werks über die ersten Erinnerungen, die dem Aufenthalt in Moskau (ab 1915) galten.Jedesmal wenn der Zug auf einem Bahnhof hielt, setzte ein Sturm auf die Waggons ein. Zuerst erblickte man nur eine dunkle, vielköpfige Masse. Doch sobald die Räder sich nicht mehr drehten, zerbarst sie in einzelne Figuren. Bauern in kurzen Schafpelzen schleppten unhandliches Gepäck: Kisten, vollgestopfte Säcke oder was es sonst sein mochte. Frauen mit buntgemusterten Kopftüchern trugen Bündel, Spankörbe oder ein kleines Kind auf dem Arm, während die Größeren sich schreiend an den Rock der Mutter hängten. Städtisch gekleidete Leute hatten Reisetaschen oder Hutpaudeln bei sich. Ihnen folgte der Gepäckträger, den Koffer geschultert; dazwischen Soldaten, auf dem Rücken den Tornister, vom Schinelj, dem Soldatenmantel, umwunden wie von einer dicken Wurst. Juden in ihren schwarzen Kaftans. Sie alle stauten sich an den Eingängen zu den Waggons, versuchten rücksichtslos, sich an jenen vorbeizuzwängen, die ihr Reiseziel erreicht hatten oder zum Bahnhofsbüfett drängten, um heißes Wasser für den Tee zu holen. Meine Mutter stand immer Todesängste aus, ob es Vater gelingen würde, mit dem Wasser rechtzeitig in den Zug zurückzukehren; und ich bangte mit ihr. Aber bevor der Kondukteur mit der Glocke zum dritten mal schellte und sein "Tretje zvonok" rief, die Lokomotive ihren schrillen Pfiff ausstieß und die Räder zu rollen begannen, trat Vater mit einem triumphierenden Lächeln ins Abteil.
Mich hatte Vater auf das oberste Gepäckbrett gesetzt. Dort hockte ich zwischen Koffern und verschnürten Schachteln, bekam etwas Heißes, Süßes zu trinken und ließ die Beine baumeln. Einmal saß ein dicker Mann mit einer Glatze direkt unter mir. Sie glänzte zu mir herauf wie eine rosa Kugel. Ich versuchte, sie wenigstens mit einem Fuß zu erreichen. Vergebens. Meine Beine waren zu kurz. Ich war dreieinhalb Jahre alt. Von dem, was vorher war, ist mir nichts in Erinnerung geblieben.
Und weiter ratterte der Zug, stolperte über die Schwellen, kroch Anhöhen hinauf und wieder hinab, beschleunigte stellenweise die Fahrt und zuckelte erneut gemächlich dahin. Zu dem Geräusch der Räder gesellte sich das metallische Summen der Telegraphendrähte, das mir wie eine geheimnisvolle Musik in den Ohren klang. Ich fragte meine Mutter, woher das Singen käme und was es bedeute, aber sie verstand nicht, was ich meinte; und so mußte ich mich gedulden, bis ich mir selbst diese Frage beantworten konnte.
Hinter dem verstaubten Fenster dehnte sich eine grüne Weite, darüber ein hoher Himmel und wo sich Erde und Himmel berührten, kroch eine dunkelblaue, behaarte Raupe dahin. Manchmal kam sie näher und verwandelte sich in Gesträuch und Bäume. Dann entfernte sie sich wieder, ließ Gruppen von verkümmerten Birken, Kiefern, dunklen Wacholdermännlein zurück und säumte erneut den Horizont.
Ich weiß nicht mehr, wie lange diese Fahrt gedauert hat. Aber ich weiß, daß wir in Sankt Petersburg ankamen. Allerdings gerieten wir nicht in die glanzvolle Residenz des Zaren mit ihren kuppelgeschmückten Kathedralen, Kirchen und barocken Palästen, mit den dunklen Kanälen hinter gußeisernen Gittern und dem eleganten, zugepflasterten Nevskij Prospekt, wie man sie in den Werken Dostojevskijs oder auch in dem Buch Vladimir Nabokovs "Sprich Erinnerung sprich" geschildert findet. Oh nein. Ich habe die einstige Zarenmetropole auch nur erlebt im zerschlissenen Gewande ihrer proletarischen Leningrad-Ära. Damals, im Kriegssommer 1915, gelangte ich in eine grüne Wildnis auf einem Ostrov, einer der zahlreichen Vorortinseln St. Petersburgs, wo einstöckige Holzhäuser sich hinter Faulbäumen und Fliederbüschen verbargen. Dort fanden wir - Vater, Mutter, vielleicht auch Großmutter, meine viereinhalb Jahre ältere Schwester Alice und ich Aufnahme bei Tante Mila, der jüngeren Schwester meiner Mutter. Ich fand zwei Cousins vor: Adolf, ein Jahr älter als ich, und Alexander, genannt Duschka, kaum der Wiege entwachsen.
Wir Kinder spielten Verstecken zwischen den Büschen. Es muß geregnet haben, denn auf der ungepflasterten Straße hatten sich große Pfützen gebildet. Sie verleiteten Adolf und seine gleichaltrigen Spielgefährten Brunnenmännchen zu imitieren. Wer den höchsten Bogen schaffte, sollte Sieger werden. Plötzlich wurde in einem der Häuser an der Straße ein Fenster aufgestoßen. Über den Blumenstöcken reckte sich das Gesicht einer alten Frau vor. Sie drohte mit der Faust, und ein Schwall unverständlicher Worte ergoß sich aus ihrem zahnlosen Munde, worauf die Jungen erschrocken davonstoben. Ich blieb allein wie angenagelt zurück.
Die Frau schloß brummend das Fenster, äugte jedoch böse zu mir herüber, als wollte sie mich mit ihren Blicken aufspießen. Ihr bleiches Gesicht unter der grünen Haube spukte noch jahrelang durch meine Träume.
Der Besuch bei Tante Mila war nur eine Zwischenstation auf unserem Wege nach Moskau. Als das deutsche Heer sich dem Baltikum näherte, zog sich die Zarenarmee zurück. Gleichzeitig ließ die russische Regierung die wichtigsten Industrieanlagen samt allen Betriebsangehörigen und deren Familien aus Riga, in das Innere Rußlands, vor allem nach Moskau und seine Umgebung, evakuieren. Es handelte sich dabei um so große Werkanlagen wie etwa die Russisch-Baltische Waggonfabrik; die elektrotechnische Fabrik "Union"; "Privic & Co." (Maschinenbau); "Provodnik" (Gummiverarbeitung); die Werft Lange & Sohn; "Phönix/Fenikss" (Waggonfabrik); "Felser/Felzers & Co." (Eisengießerei und Maschinenbau) und andere. Rund 84 Tausend Arbeitnehmer verließen im Laufe eines Jahres Riga. Einer von diesen war mein Vater - von Beruf Schmied und Maschinenschlosser.
Tante Mila ließ es sich nicht nehmen, uns zum Bahnhof zu geleiten. Sie hatte sich über unseren Besuch gefreut. Ihr Mann befand sich schon seit Ausbruch des Krieges an der Front; so fühlte sie sich einsam. In Moskau lebten zwei weitere Schwestern meiner Mutter, auch sie ohne ihre Männer. Doch befanden sie sich nicht in der Armee, sondern in der Verbannung. Sie stammten aus der rein deutschen Bauernkolonie Hirschenhof und sprachen weder lettisch noch russisch. Als solche galten sie den Behörden als viel zu unzuverlässig, um sie beim Heranrücken des deutschen Heeres im gefährdeten Grenzgebiet zu belassen. Sie waren bei weitem nicht die einzigen, die in das asiatische Rußland deportiert wurden. Solch ein Schicksal hätte auch meinen Vater treffen können, wenn er nicht vor zehn Jahren seine deutsche Staatsangehörigkeit gegen die russische vertauscht hätte.
Jede der Tanten besaß ein einjähriges Töchterchen, also keine Spielgefährten für mich. Ich fand sie aber unter den Kindern, die im Hinterhause wohnten. Von ihnen lernte ich Russisch. Nicht lange nach unserer Ankunft zog die jüngste der Tanten, genannt Liddi, mit ihrer kleinen Margot nach Charkov, wohin ihr Mann sich abgesetzt und Arbeit und Wohnung gefunden hatte. Tante Toni blieb mit ihrem Gretchen wie wir auch während des ganzen Krieges in Moskau. Irgendwann fand sich auch Tante Tonis Mann, Onkel Ludde, ein. Er war von Beruf Schneider, so daß er sofort zum Nähen von Uniformen eingesetzt wurde. Vielleicht war dies auch der Grund, daß er seinen Verbannungsort hinter dem Ural hatte verlassen dürfen. Wir lebten nun, einschließlich Großmutter, zu acht zusammen wie eine große Familie.
Die Wohnungen lagen nebeneinander. Ein Teil der Fenster ging zur Straße, die von drei- bis vierstöckigen gemauerten Häusern gesäumt war. Geradeaus führte eine kurze Querstraße zu einem stattlichen Gebäude mit Rundbogenfenstern. Ich dachte mir, so müßten die Schlösser aussehen, bewohnt von Königen und wunderschönen Prinzessinnen wie in den Märchen, die Großmutter mir erzählte. Vorn an der Ecke befand sich eine Tschainiza, ein russisches Teehaus, wo jedoch auch gehaltvollere Getränke ausgeschenkt wurden.
Für mich war dieses Stück Straße eine Art Bühne, auf der sich ständig etwas mehr oder weniger Aufregendes, aber immer Fesselndes abspielte. Dauernd gingen Männer in Russenhemden in die Tschainiza hinein und kamen nach kürzerem oder längerem Verweilen wieder heraus. Kutschen und Lastfuhrwerke, genannt "Rasposken", ratterten durch die Straße. Selten nur geriet eine der eleganten Equipagen in diese Gegend, wenn es jedoch geschah, war dies eine Sensation für die Kinder aus dem Hinterhaus. Dann und wann brachte einer der Kutscher sein Pferd vor der Tschainiza zum Stehen. Er kletterte vom hohen Bock, band sein Pferdchen an den nächsten Laternenpfahl, hängte ihm den Hafersack über den Kopf und verschwand eilig hinter der Tür zum Teehaus. Manchmal hielt ein senfgelbes Automobil vor der Paradetür des Eckhauses. Der Chauffeur trug eine Schirmmütze und an den Waden Wickelgamaschen. Wenn er fortfahren wollte, betätigte er eine Kurbel am Vorderteil des Wagens. Darnach sprang er geschwind an das Steuer und brauste gleich darauf mit einem heftigen "Töff, "Töff" aus meinem Blickfeld.
Bäuerlich gekleidete Frauen, die Lasten auf dem Kopf trugen, kamen des Weges; zierliche Chinesinnen trippelten auf ihren verkrüppelten Füßchen vorüber; Soldaten spazierten mit ihren Mädchen auf und ab. Manche der Mädchen trugen die hübsche, ukrainische Volkstracht: weite, schwingende Röcke, bestickte Blusen und Schürzen und auf dem Kopf eine Art Krönlein oder Reifen mit langen farbigen Bändern, die über den Rücken fielen. Zuweilen geschah es, daß energische Frauen, ihre Männer oder Söhne aus dem Lokal an der Ecke holten, wenn jene das Nachhausekommen vergessen hatten - oft taumelnde, schwankende Gestalten, die handfester Unterstützung bedurften.
Einmal prügelten sich zwei angetrunkene Männer vor der Tschainiza, während einige andere ich vergebens abmühten, die Streithähne von einander zu trennen. Zu gleicher Zeit näherte sich eine Prozession mit Kirchenfahnen, geschwungenen Weihrauchfässern, Popen in vollem Ornat und der goldstrotzenden Bogorodiza, der Gottesgebärerin, im schweren, kirschbaumroten Gehäuse, an dem mehrere Männer schwer zu schleppen hatten. Als die Prozession herangekommen war, sanken die zwei, die sich geprügelt hatten, mit allen anderen in die Knie und schlugen entblößten Hauptes demütig das Kreuz. Doch sobald der fromme Zug sich genügend weit entfernt hatte, sprangen die beiden Erbosten auf die Füße und stürzten sich erneut aufeinander. Aber diesmal gelang es den Umstehenden, Frieden zu stiften. Darauf erfolgte die Versöhnung mit Umarmung und Küssen auf beiden Wangen, worauf sich der ganze Schwarm ins Innere der Tschainiza begab.
Ein anderes mal bewegte sich ein Leichenzug langsam und feierlich durch die Straße. Sechs Männer trugen den Sarg auf ihren Schultern. Er war nicht geschlossen, so daß ich vom oberen Stockwerk in den Sarg hineinblicken konnte. In ihm lag ein Mann mit wachsgelbem Gesicht und schwarzem Spitzbart. Mit seinen erstarrten Zügen glich er den strengen geheimnisvollen Bildern, die unsere russische Freundin Manja so zahlreich in ihrer Küche hängen hatte. Ikonen hießen sie, und Vater wunderte sich, daß sie überall anzutreffen waren, nicht nur in den Kirchen, Kapellen und Wohnräumen, sondern auch im Badezimmer, in den Werkstätten und Pferdeställen.
Ein tiefer, gewölbter Torbogen, über dem sich eins unserer Zimmer befand, führte durch das Haus hindurch in einen langgestreckten Hof mit Kopfsteinpflaster. Zur rechten Hand zog sich ein Quertrakt bis zum Hinterhaus, links trennte ein Bretterzaun den Hof vom Nachbargrundstück. Auch hier im Hof, den ich vom Fenster aus überblicken konnte, tat sich allerlei. Mit den Nachbarskindern hatte ich mich bald angefreundet. Von ihnen ist mir einer besonders in Erinnerung geblieben. Er hieß Nikolai genau wie der Zar, was mir irgendwie imponierte. Doch seine Schwester verwies es mir, ihn bei seinem Taufnamen zu rufen. "Ha, was ist der schon für ein Nikolai", sagte sie verächtlich. "Kolja heißt er und dabei bleibt es". Er war vielleicht zwei oder höchstens drei Jahre älter als ich, konnte aber nach meiner Ansicht schon auf der Balalaika spielen. In der warmen Jahreszeit saß er fast täglich auf den Stufen zum Hauseingang und übte die Lieder, die die Kinder im Hof und ihre Mütter in der Küche sangen, auf der Balalaika seines Vaters. Sie war fast größer als er selbst. Bis in den Traum hinein glaubte ich das melodische Geklimper und Gezirpe zu hören. Öfters kam ein tatarischer Händler in den Hof. Er ließ einen eigenartigen Ruf erschallen. Dann setzte er sich auf sein großes Warenbündel und blickte geduldig zu den Fenstern hinauf, wo hinter den Kästen mit Sonnenblumen neugierige Gesichter erschienen. Sofort war er von Kindern umringt. Kamen auch einige Frauen und junge Mädchen in den Hof, öffnete er sein Bündel und zeigte seine Schätze: bestickte Blusen, seidene Tücher, Westen aus Samt, mit Goldfäden verzierte Pantöffelchen, Haarbänder und vieles andere. Manja kaufte einmal ein gelbes Tuch mit einem Rosenmuster und langen seidigen Fransen daran.
Einmal verfolgte ich höchst interessiert eine Eifersuchtsszene, die sich vor dem Hinterhaus abspielte. Ein Mann in Uniform, mit den Händen heftig gestikulierend, redete auf ein hübsches, rotwangiges Mädchen ein, das im Hinterhause wohnte. Das Mädchen ließ sich anscheinend von den Vorhaltungen des erregten Mannes nicht beeindrucken. Es zuckte die Achseln und biß schließlich in einen Apfel, den es bisher gelangweilt hin- und hergedreht hatte. Das mochte den Mann zur Weißglut gebracht haben. Er entriß dem Mädchen den Apfel und schmetterte ihn durch das Fenster einer ebenerdig liegenden Wohnung. Das Splittern des Glases und das laute Weinen des erschrockenen Mädchens riefen die Bewohner des Vorder-, Quer- und Hinterhauses auf den Plan. Der Auftritt endete damit, daß eine Gruppe couragierter Frauen, die Partei des Mädchens ergreifend und nicht achtend auf das Fuchteln des Uniformierten mit der Pistole, den Übeltäter aus dem Hof jagten. Noch eine ganze Weile darnach glätteten sich nicht die Wogen der Erregung. Man besichtigte eingehend die Scherben auf dem Pflaster und in der Wohnung, betrachtete kopfschüttelnd den grünen Apfel, der wie ein Tennisball durch die Scheibe geschossen war, und ließ sich von dem Mädchen das Warum und die Hintergründe des Vorfalls eingehend berichten.
Zu meinem unsäglichen Erstaunen bemerkte ich einmal mehrere Frauen und Kinder, die, mit Eimern, Kübeln, Kesseln ausgestattet, über das flache Dach des Hinterhauses tappten und dann in einer Dachluke verschwanden. Auch dieses Ereignis erregte die Gemüter der Hausbewohner. Den Gesprächen in unserer großen Familie entnahm ich, daß im Querhause "Ssamagonka", selbstgebrannter Schnaps, hergestellt worden war. Irgend jemand hatte Anzeige erstattet, denn die Schnapsbrennerei war Staatsmonopol. Doch man hatte die Gesetzesübertreter rechtzeitig gewarnt, und als die Polizei bei ihnen erschien, war nichts Verdächtiges mehr zu entdecken. Niemand von den Dachbewohnern verlor ein Wort über den Spaziergang auf dem Dach. Man freute sich, daß die verhaßten "Gardevojs" mit langer Nase hatten abziehen müssen.
Aber am stärksten fesselte mich doch das, was ich jenseits des Bretterzaunes im Nachbarhof erblicken konnte. Dort besaß ein Pferdehändler seine Ställe. Ich wurde nie müde, die Pferde zu beobachten, wenn sie ihren Auslauf hatten, oder ein Pferd zum Verkauf vorgeführt wurde oder ein Reiter Galopp, Trab und Schritt eines Pferdes prüfte. Man sah Schimmel aller Schattierungen und seidig glänzende Rappen. Doch am besten gefielen mir die Isabellenfarbenen mit ihrem schlankgebogenen Hals, den feinen Fesseln und der tänzelnden Gangart. Ich plagte ständig meine Großmutter, mit mir zum 'Ploschtschadj' zu gehen. Das war ein runder Platz mit Bäumen, Bänken und Kreisverkehr. Straßenbahnen umrundeten ihn und Fahrzeuge aller Art. In Erinnerung geblieben sind mir Halbkutschen, in denen Damen mit großen Federhüten saßen und einmal gefüllt mit johlenden Studenten, die sogar die Trittbretter besetzt hatten. Zuweilen tauchte auch eine Equipage auf, vor der schöne Pferde trabten; Apfelschimmel etwa oder ein Paar prächtiger Füchse. Ihretwegen saß ich so gern auf dem Platz und bildete mir ein, sie könnten aus den Ställen im Nachbarhof stammen. Ich war unglücklich, wenn im Winter dicke Eisblumen auf den Scheiben mir den Blick über den Zaun verwehrten, und war selig, wenn die Luft mild geworden war, und ich beim geöffneten Fenster die Pferde beobachten konnte. Dabei machte ich die Entdeckung, daß sie sich in den blank geputzten Fensterscheiben widerspiegelten. Ihr gläsernes, geisterhaftes Bild faszinierte mich nicht weniger als ihr körperhaftes Sein.
Eine feinsinnige und wie ich finde sehr gelungene Würdigung erfuhr Herta Graf durch Elke Heer in dem Band "Frauen greifen zur Feder I", Schwäbisch Gmünd 2008, S. 25ff.
Alle Türlein:
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein
KlausGraf - am Dienstag, 21. Dezember 2010, 00:05 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Morgan-Library besitzt drei Exemplare. Ein schön illuminiertes einbändiges Altes Testament ist davon online:
http://www.themorgan.org/collections/works/gutenberg/default
http://www.themorgan.org/collections/works/gutenberg/default
KlausGraf - am Montag, 20. Dezember 2010, 23:55 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.thebookseller.com/news/139773-google-will-not-enforce-exclusivity-over-library-scanning.html
Partners of Google Book Search may sign agreements authorising other search engines to access automatically digital copies of books for indexing and search purposes, the Competition Authority quoted Google as saying in a letter last July 19 to Anthony Whelan, head of cabinet of European Commissioner for Digital Agenda Neelie Kroes.
Partners of Google Book Search may sign agreements authorising other search engines to access automatically digital copies of books for indexing and search purposes, the Competition Authority quoted Google as saying in a letter last July 19 to Anthony Whelan, head of cabinet of European Commissioner for Digital Agenda Neelie Kroes.
KlausGraf - am Montag, 20. Dezember 2010, 23:49 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 20. Dezember 2010, 23:44 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Institut für Dokumentologie und Editorik möchte Sie zu seinem vierten Kurs zur Digitalen Edition einladen. Die "Spring School: Digitale Edition von Archivalien und Handschriften" wird vom 14.-18.3.2011 in Wien stattfinden. Die in Zusammenarbeit mit dem International Center for Archival Research und der Österreichischen Nationalbibliothkek organisierte Veranstaltung ist offen für alle, die beabsichtigen, modernen Informationstechnologien in ihrem Projekt einer kritischen Edition einen hohen Stellenwert einzuräumen. Nähere Informationen zu Konzept und Programm der "Schule" finden Sie auf der Webseite <http://www.i-d-e.de/spring-school-2011>. Interessenten bewerben sich bitte mit einer kurzen Beschreibung des Editionsprojektes an die Mail-Adresse SpringSchool2011@icar-us.eu.
gvogeler - am Montag, 20. Dezember 2010, 20:40 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 20. Dezember 2010, 17:13 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Der heuer in den Ruhestand getretene langjährige Direktor des Wiener Stadt- und Landesarchivs, ao. Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Opll, erhielt am 16. Dezember aus den Händen von Bundesministerin Univ.-Prof. Dr. Beatrix Karl das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse.
Karl bezeichnete den Preisträger nicht nur als einen der herausragenden Archivare Österreichs, sondern auch als besonders innovativen und kreativen Historiker. Seit seiner ersten Publikation im Jahre 1976 hat er weit über 300 Veröffentlichungen vorgelegt. Zuletzt sind 2010 die Bücher "Zwang und Willkür. Leben unter städtischer Herrschaft in der Lombardei der frühen Stauferzeit" (Böhlau-Verlag), "... daz si ein recht puch solten haben ...". Kodikologische, kunsthistorische, paläographische und restauratorische Analysen zum Wiener Eisenbuch (14.-19. Jahrhundert)" (Studien-Verlag) über das bedeutendste Stadtbuch Wiens aus dem Mittelalter sowie "Wie Phönix aus der Asche. Wien von 1945 bis 1965 in Bilddokumenten" (Texte von Margit Altfahrt, Wolfgang Maderthaner, Michael Wenusch, echomedia-Verlag) erschienen."
Quelle: Wiener Rathauskorrespondenz, 20.12.2010
Karl bezeichnete den Preisträger nicht nur als einen der herausragenden Archivare Österreichs, sondern auch als besonders innovativen und kreativen Historiker. Seit seiner ersten Publikation im Jahre 1976 hat er weit über 300 Veröffentlichungen vorgelegt. Zuletzt sind 2010 die Bücher "Zwang und Willkür. Leben unter städtischer Herrschaft in der Lombardei der frühen Stauferzeit" (Böhlau-Verlag), "... daz si ein recht puch solten haben ...". Kodikologische, kunsthistorische, paläographische und restauratorische Analysen zum Wiener Eisenbuch (14.-19. Jahrhundert)" (Studien-Verlag) über das bedeutendste Stadtbuch Wiens aus dem Mittelalter sowie "Wie Phönix aus der Asche. Wien von 1945 bis 1965 in Bilddokumenten" (Texte von Margit Altfahrt, Wolfgang Maderthaner, Michael Wenusch, echomedia-Verlag) erschienen."
Quelle: Wiener Rathauskorrespondenz, 20.12.2010
Wolf Thomas - am Montag, 20. Dezember 2010, 11:02 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Wir beschreiben, bemalen, zerreißen und zerknüllen es. Wir packen Geschenke darin ein und putzen uns die Nase damit. Vom Teebeutel über den Fahrschein bis zur Gute-Nacht-Geschichte: Papier ist aus unserem Leben nicht wegzudenken. Wie aber wird Papier hergestellt? Und was macht es für uns auch in Zeiten der elektronischen Kommunikation so unersetzlich?
Unter dem Titel „Papier hat viele Seiten“ widmet sich das Museum für Kommunikation Berlin vom 14. Dezember 2010 bis zum 13. März 2011 dem vielseitigen Werkstoff. Die Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zeitungsmuseum (Wadgassen) entstanden ist, nimmt ihre Gäste mit auf eine Reise durch die Welt des Papiers. Von A wie „Altpapier“ bis Z wie „Zeitung“ präsentiert sie Wissenswertes wie Überraschendes über die Herstellung und Verwendung des Alleskönners. Was ist die „Imprimatur“? Kann man aus Telefonbüchern Sandalen herstellen? Was hat „CC“ beim E-Mail Versand mit Kohlepapier zu tun? Zahlreiche Objekte, darunter auch ein rund 200 Meter langer Fanbrief, führen den Besucherinnen und Besuchern vor Augen, wie vielseitig und zugleich unverzichtbar Papier für uns ist. Dass Papier unser Leben auch in künstlerischer Hinsicht bereichern kann, zeigen Origamifiguren, Pop-up-Bücher oder eine mit Telefonbüchern nachgebildete Großstadt.
Die Ausstellung gliedert sich in drei Themenbereiche:
1. Papierherstellung
Es hat sich viel verändert seit den Tagen, in denen der Papyrer die Blätter noch per Hand aus der Bütte schöpfte. Der Papiertechnologe von heute koordiniert die maschinelle Herstellung höchst unterschiedlicher Papierprodukte und bereitet diese für das Bedrucken, Veredeln, Verpacken und die Weiterverarbeitung vor. Rund 80 Prozent des Altpapiers in Deutschland wird heute recycelt. Schon 1774 gelang es Justus Claproth, gebrauchtes Papier mithilfe von Chemikalien zu bleichen. Dieser Ausstellungsabschnitt bietet Einblicke in die Entwicklungen des Jahrhunderte alten Handwerks der Papiermacher. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Papier aus Leinenlumpen, den so genannten Hadern, hergestellt. Auf der Suche nach alternativen Ausgangsstoffen experimentierte man auch mit Kartoffeln und Algen. Selbst Elefantendung lässt sich zu Papier verarbeiten. In der Ausstellung lädt eine Fühlstation zum Tasten unterschiedlicher Papiersorten ein.
2. Aufs Papier gebracht
Die Gutenbergsche Erfindung des Buchdrucks im Jahr 1450 revolutionierte die Vervielfältigung von Texten. Ob Jungfern oder Leichen – die Zunft der Buchdrucker entwickelte eine Fachsprache, in deren Geheimnisse dieser Ausstellungsbereich einführt. Einen beliebten Zeitvertreib des Berufstandes stellte das Quadräteln dar. Hierbei handelte es sich um ein Würfelspiel, bei dem anstatt mit herkömmlichen Würfeln mit im Bleisatz verwendeten Leerzeichen-Bleistücken, den sogenannten Gevierten, gespielt wurde. Neben historischen Zeugnissen des Druckergewerbes werden traditionelle Techniken wie zum Beispiel das Wasserzeichen oder der Holzschliff vorgestellt, die auch noch in Zeiten der industriellen Massenfertigung Verwendung finden.
3. Eine Welt aus Papier
Papier begegnet uns überall: ob als Gebrauchsgegenstand, als Träger von Information oder als Dekoration. Die Vielfältigkeit des Werkstoffes Papier und seine Bedeutung für unseren Alltag sind Thema dieser Ausstellungseinheit. Über 3000 verschiedene Papiersorten werden in Deutschland produziert, viele davon sind Wegwerfprodukte. Die Ansprüche, die an das Material gestellt werden, hängen vom jeweiligen Verwendungszweck ab. Eine Tapete muss grundlegend andere Eigenschaften besitzen als Hygienepapiere. Zeitungen, Bücher und Werbebroschüren kennen wir als gängige Kommunikationsmedien. Aber auch Reisepässe, Visiten- oder Eintrittskartenkarten haben eine kommunikative Funktion, transportieren sie doch Informationen und entscheiden über Position, Recht oder Status. Die Herstellungskosten für einen Stapel Papier sind relativ gering, doch der Wert, den wir manchem Stück beimessen, hängt erheblich von dessen Symbolgehalt ab. Ein Beispiel hierfür sind Geldscheine oder Urkunden. Dass mitunter auch der ideelle oder künstlerische Wert entscheidend sein kann, zeigen unter anderem Oskar Holwecks Buchobjekt und die aus Telefonbüchern digital generierte Fotocollage Sao Paolo III von Hermann Pitz. Wie unsere Welt ohne Papier aussähe, führt der französische Kurzfilm „Un Monde Sans Papier – Eine papierlose Welt“ vor Augen. "
Pressemitteilung des Museums für Kommunikation
Flickr-Fotoalbum des Museums zur Ausstellung
Wolf Thomas - am Montag, 20. Dezember 2010, 10:47 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Staatliche Archive werden immer dann in dramatischer Weise der Öffentlichkeit zugänglich, wenn ein politisches System in eine Existenzkrise gerät oder zusammenbricht .... Aber auch sonst ist seit den Veröffentlichungen bei Wikeleaks vieles anders geworden. Man muss nicht einmal mehr nach Peking fliegen, um das Verschwinden von Seiten unliebsamer Art aus dem Internet feststellen zu müssen. Die Angriffe gegen den Spitzenmann von Wikileaks erinnern an die Vorwürfe, mit denen in der Vergangenheit über angebliche „Devisenvergehen“ unliebsame Zeitgenossen mundtot gemacht werden sollten. Natürlich ist der Schutz der Rechtsordnung ein hoher Wert und auch hier muss dem vorgebeugt werden, durch den Zweck die Mittel heiligen zu lassen. Allerdings haben seit mehr als einem Jahrzehnt viele Menschen den Eindruck, dass die Rechtsordnung des demokratischen Staates von den Regierenden lediglich dazu benutzt wird, ihr nicht von den grundlegenden Werten bestimmtes Handeln abzuschirmen. Wikileaks macht über seine Veröffentlichungen nicht zuletzt deutlich, welche Gefahren für Frieden und Stabilität auf der Welt durch jene hervorgerufen werden, die genau diese Vokabeln im Munde führen."
Quelle: Freitag 18.12.2010
Quelle: Freitag 18.12.2010
Wolf Thomas - am Montag, 20. Dezember 2010, 10:25 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
"... Andere sammeln Kunst, ich leiste mir ein fabelhaftes Couture- und Accessoires-Archiv ..."
Victoria Beckham, madonna.oe24.at, 20.12.2010
Victoria Beckham, madonna.oe24.at, 20.12.2010
Wolf Thomas - am Montag, 20. Dezember 2010, 09:57 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 stromedizinische Sammelhandschrift, deutsch und lateinisch, illustriertes Manuskript auf Papier. Südwestdeutschland, um 1446 - so lautete die Schlagzeile zur Nr. 21 im Katalog 5: "Handschriften und Miniaturen aus dem deutschen Sprachgebiet" Dr. Jörn Günther Antiquariat Hamburg 1997 (S. 124-129). Die Handschrift war zuvor nur (ohne nähere Angaben) im Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters Bd. 1 (1991), S. 474 nach dem Katalog von Sotheby's London 22.6.1982 Los 61 erwähnt worden. Der Handschriftencensus hat das Manuskript offenbar nicht erfasst.
stromedizinische Sammelhandschrift, deutsch und lateinisch, illustriertes Manuskript auf Papier. Südwestdeutschland, um 1446 - so lautete die Schlagzeile zur Nr. 21 im Katalog 5: "Handschriften und Miniaturen aus dem deutschen Sprachgebiet" Dr. Jörn Günther Antiquariat Hamburg 1997 (S. 124-129). Die Handschrift war zuvor nur (ohne nähere Angaben) im Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters Bd. 1 (1991), S. 474 nach dem Katalog von Sotheby's London 22.6.1982 Los 61 erwähnt worden. Der Handschriftencensus hat das Manuskript offenbar nicht erfasst.Der Codex umfasst 36 Blätter (294 X 210 mm), über die 36 reizvolle lavierte Federzeichnungen verteilt sind.
Die niederalemannische Schreibsprache mit einigen rheinfränkischen Merkmalen deutet auf die Entstehung im südrheinfränkischen Gebiet.
Der enthaltene Kalender verbindet verschiedene lokale Gepflogenheiten und kann nicht zur näheren Lokalisierung herangezogen werden, aber die komputistischen Tabellen lassen den Schluss auf eine Entstehung um 1446 zu. Die Ochsenkopf-Wasserzeichen wurden von dem Günther'schen Katalog nicht nach Piccard sondern nach Briquet bestimmt (1441, 1444).
"Ex Bibliotheca Billiana" bezieht sich auf die Sammlung von Nicolas-Antoine Labbey-de-Billy (1753-1825), die in Besançon am 1. Mai 1826 verkauft wurde. Die weitere Geschichte:
Sold at auction at Ader, Picard, Tajan, 19 May 1976, lot 44.
Sold at auction at Sotheby's, 22 June 1982, lot 61.
Appeared in the catalog Illumination and the word, issued by Roth Horowitz, Ferrini & Biondi in cooperation with Jörn Günther, Jul. 26-Aug. 23, 2002, no. 6.
Appeared in a Jörn Günther catalog, 1997, no. 12. [recte: 21]
Appeared in Sam Fogg's catalog, 30 Apr. 2003; sold to Lawrence J. Schoenberg, May 2003.
Heute Cod. LJS 449 der UPenn und als solcher vor kurzem digitalisiert und ins Netz gestellt:
http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4838166
Beschreibung:
http://dla.library.upenn.edu/dla/medren/record.html?id=MEDREN_4838166&
Da diese Beschreibung nicht sehr detailliert ist, was die enthaltenen Texte angeht, halte ich mich an den Katalog Günthers.
1r Sphärenzirkel mit lat. Inschriften
1v Winddiagramm mit lat-dt. Inschriften
2r-7v Lat. Kalender u.a. mit lat. Monatsversen (Walther Carmina 5538)
8r Tabelle zur Bestimmung des Laßtagbuchstaben mit 10 dt. Versen
8v Intervalltafel von 1446-1487
9r Onomatomantisches Kreisdiagramm mit Erläuterung
9v Zwei Kreisdiagramme zur Ermittlung von Sonnen- und Mondfinsternissen
10r Kreisdiagramm zur Ermittlung des Lebensplaneten, lat.; lat. Planetenverse
10v Zwei Kreisdiagramme
11r Zwei Kreisdiagramme zur Ermittlung der Intervalle 1418-1446 und der Radices
11v Drei Kreisdiagramme
12r-18v Traktat von den Tierkreiszeichen, lat./dt.
19r-22r Traktat von den sieben Planeten, dt.
Günther gibt als Ausgabe: V. Stegemann: Aus einem ... Lehrbüchlein, 1944, 35-59 (er edierte nach der nun Augsburger Handschrift) an, es handelt sich also um den Planetentraktat im 'Iathromathematischen Korpus' = Volkskalender A, Verfasserlexikon 2. Auf. 7, Sp. 719 (Artikel Planetentraktate, zu ihnen siehe auch den kärglichen Bestand im Handschriftencensus http://www.handschriftencensus.de/werke/4863 ). Oft im Überlieferungsverbund mit dem vorhergehenden Tierkreiszeichen-Traktat.
22v-25va Harntraktat, lat., mit Harnregeln, lat., und Blutschautraktat, dt. (vgl. Thorndike-Kibre Sp. 1608). Der Traktat mit dem Blutschaukatalog gehört zur sog. Ketham-Gruppe (²VL 3, Sp. 424; 4, Sp. 1152f.).
25vb-26ra Aderlaßrezepte, dt.
26rb Schröpftraktat, dt.
26v-28r Aderlaßregeln, dt.
28va-b Verworfene Tage, lat.
28vb quer lat. Verse aus dem 'Regimen Sanitatis Salernitanum' (Walther Carmina 18083)
29ra-vb Aderlaßtraktat, lat.
30ra-32rb Weinbuch, lat. mit einigen dt. Kontextglossen (so auch in Cod. pal. lat. 1155, Bl. 154r ff.; Cod. pal. lat. 1206, Bl. 107v ff.)
32va-36va Zael: Liber sigillorum filiorum Israel quem fecerunt in deserto. Wie Paris Ms. [lat] 160204 S. 500ff.
36vb Liste von 70 Edelsteinen in Versen, dt.
Zu einzelnen Texten und zum Handschriftentyp siehe etwa die Hinweise in der Beschreibung der weitgehend volkssprachigen Handschrift Cpg 226:
http://www.ub.uni-heidelberg.de/digi-pdf-katalogisate/sammlung2/werk/pdf/cpg226.pdf
***
Die folgenden Bilder auch auf
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:UPenn_Medical_and_astronomical_miscellany
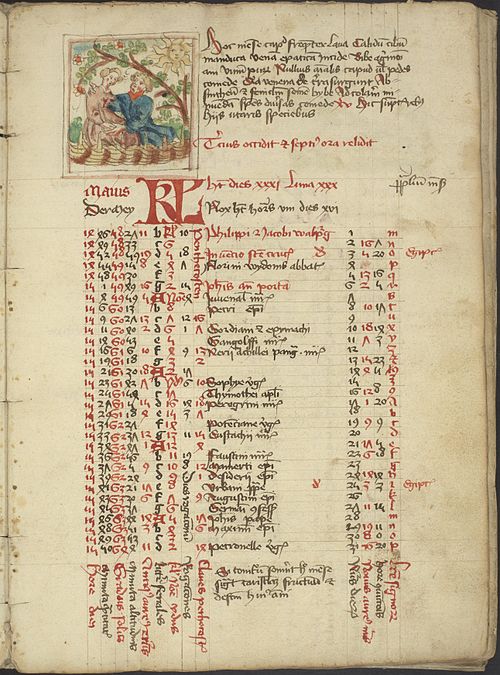 Höfische Liebe
Höfische Liebe Sternzeichen Löwe
Sternzeichen Löwe Venus und Mercurius
Venus und Mercurius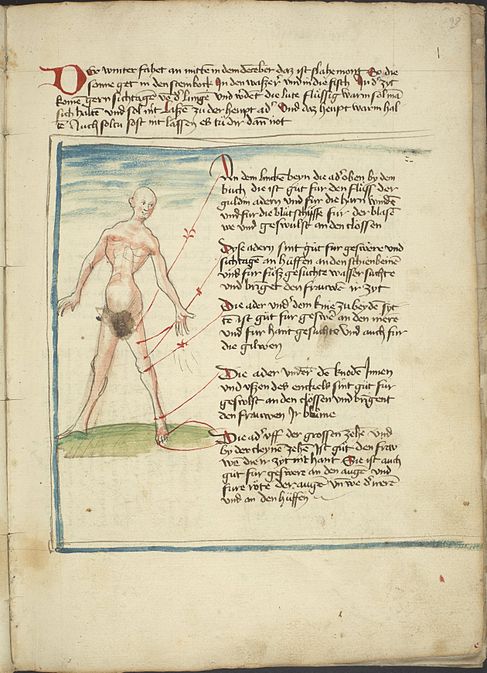 Aderlassen im Winter
Aderlassen im WinterAlle Türlein:
http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein
KlausGraf - am Montag, 20. Dezember 2010, 00:10 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

