Bundesverfassungsgericht droht ein Prozess vor einem ganz normalen Verwaltungsgericht: Der Betreiber einer Jura-Datenbank hat das Gericht mit Sitz in Karlsruhe verklagt. Dies geht aus der Klageschrift hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Der Kläger, die Firma Lexxpress, behauptet, das Verfassungsgericht habe widerrechtlich einen Vertrag mit dem Datenbankbetreiber Juris GmbH zur Vermarktung seiner eigenen Urteile geschlossen. Das Verfassungsgericht habe Juris als Dienstleister „nicht im Rahmen eines transparenten und diskriminierungsfreien Verfahrens ausgewählt“, heißt es in der Klageschrift, die beim Verwaltungsgericht Karlsruhe eingereicht wurde.
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/verlag-verklagt-verfassungsgericht-vor-dem-verwaltungsgericht/4602202.html
Siehe auch
http://www.iuwis.de/dossierbeitrag/wem-stehen-die-juris-millionen-zu
http://archiv.twoday.net/stories/38739154/
http://archiv.twoday.net/stories/16561735/
http://archiv.twoday.net/stories/16549837/
Update: Klage abgewiesen
http://archiv.twoday.net/stories/326204776/
VGH gibt Kläger Recht
http://archiv.twoday.net/stories/404097053/
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/verlag-verklagt-verfassungsgericht-vor-dem-verwaltungsgericht/4602202.html
Siehe auch
http://www.iuwis.de/dossierbeitrag/wem-stehen-die-juris-millionen-zu
http://archiv.twoday.net/stories/38739154/
http://archiv.twoday.net/stories/16561735/
http://archiv.twoday.net/stories/16549837/
Update: Klage abgewiesen
http://archiv.twoday.net/stories/326204776/
VGH gibt Kläger Recht
http://archiv.twoday.net/stories/404097053/
KlausGraf - am Mittwoch, 28. September 2011, 22:36 - Rubrik: Archivrecht
Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. September 2011, 20:08 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"... Max Von Sydow lebt ähnlich zurückgezogen, schlüpft er doch in die Rolle von Esbern, einem Archivar und Agent der Klingen, welcher nur überlebte, weil er sich versteckt hielt. Esbern wird dem Spieler in The Elder Scrolls V: Skyrim äußerst nützlich sein, hilft er ihm doch zu verstehen, wie er dem mächtigen Drachen Alduin (aka Weltenverschlinger) gegenüber treten kann. ...."
Quelle: Game trust
Quelle: Game trust
Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. September 2011, 19:57 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Archivalia ac Digitalia - a twitter-like blog with stuff from Archivalia's English corner and content in the English language plus additional stuff from elsewhere
http://archivalia.tumblr.com/
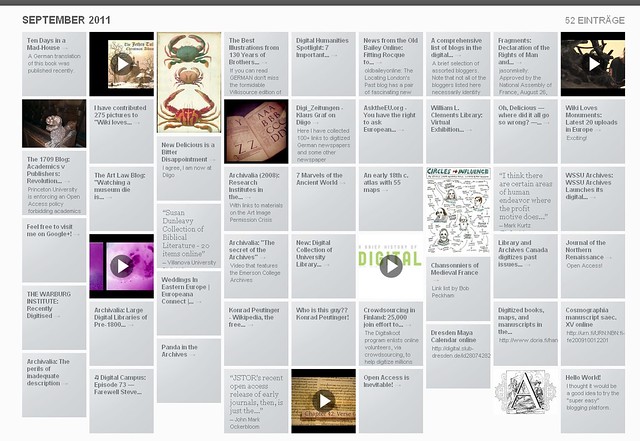 Archive page
Archive page
http://archivalia.tumblr.com/
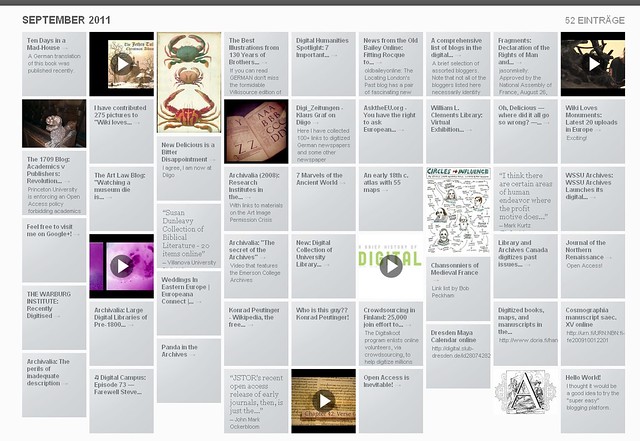 Archive page
Archive pageKlausGraf - am Mittwoch, 28. September 2011, 19:57 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wer Bilder mit solchen Wasserzeichen ins Netz stellt, braucht von mir aus gar keine Bilder ins Netz zu stellen.
http://bild.isgv.de
KlausGraf - am Mittwoch, 28. September 2011, 19:09 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.landesarchiv-bw.de/rss/rss.xml
Extrem unscheinbar auf der Seite angebracht, aber immerhin kann ich nicht mehr behaupten, dass die deutschen Archive RSS komplett ignorieren. Welches Archiv hat denn noch so was tolles Fortschrittliches? (Nebenbei: Im Bibliothekswesen waren RSS-Feeds vor 10 Jahren innovativ.)
Extrem unscheinbar auf der Seite angebracht, aber immerhin kann ich nicht mehr behaupten, dass die deutschen Archive RSS komplett ignorieren. Welches Archiv hat denn noch so was tolles Fortschrittliches? (Nebenbei: Im Bibliothekswesen waren RSS-Feeds vor 10 Jahren innovativ.)
ist das Schwerpunkthtema der Archivnachrichten des LA BW:
http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/52959/Archivnachrichten_43_36dpi.pdf
http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/52959/Archivnachrichten_43_36dpi.pdf
KlausGraf - am Mittwoch, 28. September 2011, 19:01 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die LIPPMANN+RAU-STIFTUNG unterhält das LIPPMANN+RAU-MUSIKARCHIV in den Räumen der Alten Mälzerei in Eisenach. Das 1999 gegründete Archiv widmet sich der Geschichte des Jazz und der populären Musik und gilt als eine der umfassendsten Sammlungen auf diesem Gebiet in Europa. Es umfasst mehr als 80.000 Tonträger und Filme, mehr als 60.000 Bücher und Musikzeitschriften, etwa 60.000 Fotografien, Programmhefte und Konzertplakate sowie Musikinstrumente, Rundfunkmanuskripte und Briefe.
Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. September 2011, 17:57 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
schreibt derwesten.de am 27.9.2011: "... Im kommenden Frühjahr werden nach Auskunft des landeseigenen Baubetriebes (BLB NRW) Turm und Schlange dann im Stil des alten Speichers ebenfalls rundherum rot verklinkert sein. Ein halbes Jahr später, im Herbst 2012, soll der Komplex an das Land NRW, dem Mieter, übergeben werden. Dieser wird im Januar 2013 den Archivneubau, der dann 160 Mio. Euro gekostet haben wird, in Betrieb nehmen. ..."
Zur Baugeschichte s. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+Duisburg
Zur Baugeschichte s. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+Duisburg
Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. September 2011, 17:18 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Kleintheater Luzern will seine Geschichte sicher aufbewahrt wissen. Die Kleinkunst-Bühne hat am Dienstag ihr aufgearbeitetes Archiv offiziell dem Stadtarchiv übergeben. Bei diesem Akt mit dabei war auch Emil Steinberger, der Gründer des Kleintheaters Luzern.
Bis jetzt war das Archiv des Kleintheaters Luzern ein Luftschutzkeller gefüllt mit unzähligen Ordnern, Kisten und Plakatrollen. Ein Keller, welcher zudem auch immer wieder von Wassereinbrüchen betroffen war.
Mit Hilfe von privaten Geldgebern konnte das Kleintheater nun dieses wilde Archiv aufarbeiten lassen und am Dienstag offiziell dem Stadtarchiv übergeben.
Erinnerungen von Emil Steinberger
Bei diesem Akt zugegen war auch Emil Steinberger, der Gründer des Kleintheaters Luzern. Auch er hatte Stunden im Archiv verbracht und einige seiner Erinnerungen ans Theater wieder aufleben lassen. Für ihn ist klar, dass er nun im Stadtarchiv noch weiter mit den Dokumenten im Stadtarchiv seine Erinnerungen auffrischen will."
Quelle: SR, DRS, 27.9.11
Link zum Radiobeitrag (Schweizerdeutsch)
Bis jetzt war das Archiv des Kleintheaters Luzern ein Luftschutzkeller gefüllt mit unzähligen Ordnern, Kisten und Plakatrollen. Ein Keller, welcher zudem auch immer wieder von Wassereinbrüchen betroffen war.
Mit Hilfe von privaten Geldgebern konnte das Kleintheater nun dieses wilde Archiv aufarbeiten lassen und am Dienstag offiziell dem Stadtarchiv übergeben.
Erinnerungen von Emil Steinberger
Bei diesem Akt zugegen war auch Emil Steinberger, der Gründer des Kleintheaters Luzern. Auch er hatte Stunden im Archiv verbracht und einige seiner Erinnerungen ans Theater wieder aufleben lassen. Für ihn ist klar, dass er nun im Stadtarchiv noch weiter mit den Dokumenten im Stadtarchiv seine Erinnerungen auffrischen will."
Quelle: SR, DRS, 27.9.11
Link zum Radiobeitrag (Schweizerdeutsch)
Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. September 2011, 17:03 - Rubrik: Wahrnehmung
Ich hätte nicht gedacht, dass es bei delicious so schlimm wird:
http://plan3t.info/2011/09/28/die-karawane-zieht-weiter/ (jp)
http://beweblog.wordpress.com/2011/09/28/delicious-update-gau-3-0/ (Seb. Wolf)
Es werden immer nur 10 Links angezeigt, was das Ganze nutzlos macht. Nun warte ich, da ich mich nicht mehr an mein Passwort erinnere, dass ich ein neues anfordern kann, aber das funktioniert derzeit nicht. Auf eine Mail kommt dann folgendes:
This is only an automated reply, but we wanted to confirm that
Delicious Support has received your email about an account migration
issue. Our small, dedicated team is available during pacific time
office hours, Monday to Friday but we are working extra hours to dial
everything in after our re-launch.
If you haven’t already, please make sure that your email to the
migration support team includes your Delicious username and a detailed
description of your issue, including the type of data affected. We've
been getting a ton of mail and can't respond to everyone, but are
posting the latest info about the migration our blog here:
http://www.avos.com/
In terms of login issues, the following might be helpful:
1. There was a password reset bug hitting some users trying to reset
their password. We just rolled out a fix that should resolve this
issue for most users. If you were trying to reset your password, and
were hitting a page without a valid reset link, go ahead a try again.
2. For previous Delicious users who logged in through their Yahoo!
account, you were asked to choose a new Delicious username when you
opted in to the AVOS terms of service. If you’ve forgotten the new
username you chose, use the password reset link on the sign-in page to
have a reminder sent to your Yahoo! mail account.
3. If you missed the opt-in and can’t access your old Delicious
bookmarks, unfortunately that data remains with Yahoo! since they
never got your permission to move your account. We’re investigating
methods for those users to recover those bookmarks from Yahoo!, but we
don’t have anything definitive to report at this time.
Again, sorry for the inconvenience that bugs or migration issues may
have caused. We know it can be infuriating when things don’t work like
you expect. We’re working hard over here to keep fixing things,
re-introduce familiar Delicious features, and keep the site moving
forward. Thanks for your patience.
Yours,
Team Delicious
Update: Gottseidank fiel mir das PW wieder ein. Bei Diigo ist mein Import-Request in der Schlange .....
Siehe z.B.
http://www.diigo.com/user/klausgraf/Digi_Zeitungen
http://plan3t.info/2011/09/28/die-karawane-zieht-weiter/ (jp)
http://beweblog.wordpress.com/2011/09/28/delicious-update-gau-3-0/ (Seb. Wolf)
Es werden immer nur 10 Links angezeigt, was das Ganze nutzlos macht. Nun warte ich, da ich mich nicht mehr an mein Passwort erinnere, dass ich ein neues anfordern kann, aber das funktioniert derzeit nicht. Auf eine Mail kommt dann folgendes:
This is only an automated reply, but we wanted to confirm that
Delicious Support has received your email about an account migration
issue. Our small, dedicated team is available during pacific time
office hours, Monday to Friday but we are working extra hours to dial
everything in after our re-launch.
If you haven’t already, please make sure that your email to the
migration support team includes your Delicious username and a detailed
description of your issue, including the type of data affected. We've
been getting a ton of mail and can't respond to everyone, but are
posting the latest info about the migration our blog here:
http://www.avos.com/
In terms of login issues, the following might be helpful:
1. There was a password reset bug hitting some users trying to reset
their password. We just rolled out a fix that should resolve this
issue for most users. If you were trying to reset your password, and
were hitting a page without a valid reset link, go ahead a try again.
2. For previous Delicious users who logged in through their Yahoo!
account, you were asked to choose a new Delicious username when you
opted in to the AVOS terms of service. If you’ve forgotten the new
username you chose, use the password reset link on the sign-in page to
have a reminder sent to your Yahoo! mail account.
3. If you missed the opt-in and can’t access your old Delicious
bookmarks, unfortunately that data remains with Yahoo! since they
never got your permission to move your account. We’re investigating
methods for those users to recover those bookmarks from Yahoo!, but we
don’t have anything definitive to report at this time.
Again, sorry for the inconvenience that bugs or migration issues may
have caused. We know it can be infuriating when things don’t work like
you expect. We’re working hard over here to keep fixing things,
re-introduce familiar Delicious features, and keep the site moving
forward. Thanks for your patience.
Yours,
Team Delicious
Update: Gottseidank fiel mir das PW wieder ein. Bei Diigo ist mein Import-Request in der Schlange .....
Siehe z.B.
http://www.diigo.com/user/klausgraf/Digi_Zeitungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Foto: Christoph Lubbe im ehemaligen Schlafraum des Bunkers, in dem heute wertvolles Archivgut des Kreisarchivs Kleve liegt
"Christoph Lubbe von der RWTH-Aachen ist fasziniert vom ehemaligen verbunkerten Ausweichsitz der Bezirksregierung Düsseldorf in Geldern. Gemeinsam mit der Kreisarchivarin Dr. Beate Sturm sucht er im Bunker unter dem Berufskolleg nach Überresten aus der Zeit, in der der Bunker noch als Bunker genutzt wurde. Der gemeinsame Rundgang wäre früher nicht denkbar gewesen: Der Bunker, einst Ausweichmöglichkeit für die Bezirksregierung im Katastrophen- und Kriegsfall, war streng geheim.
Lubbe und Sturm orientieren sich bei ihrem Rundgang an einem farbigen Übersichtsplan des Bunkers, der heute noch im Kreisarchiv verwahrt wird. „Der Bunker war in einzelne Räume mit bestimmter Funktion unterteilt“ so Lubbe. „Es gab eine Küche, einen Speiseraum, einen ärztlichen Behandlungsraum, verschiedene Technikräume und vieles mehr, um das Überleben unter der Erde im Ernstfall für zwei Wochen zu gewährleisten. Ein Teil der Schutzraumtechnik ist heute noch erhalten“ erklärt Lubbe weiter und zeigt auf Abluftventile, gasdichte und feuerfeste Kabeleinführungen und ein Fernmeldekabel.
Gemeinsam mit vier weiteren Autoren arbeitet Lubbe an einem Buch über ehemalige Bunkeranlagen in Deutschland. Für die Publikation, einer Mischung aus fachlicher Darstellung, Reportage und Bildband, werden mehr als 50.000 Fotos von ca. 100 deutschen Bunkeranlagen aus der Zeit des Kalten Krieges ausgewertet und in den historischen Kontext gestellt. „Wir stellen dabei beeindruckende Übereinstimmungen in der deutsch-deutschen Bunkerbaukultur fest“ verrät Lubbe.
Archivgut lagert im ehemaligen Bunker
Heute wird der Ausweichbunker der Bezirksregierung vom Kreisarchiv Kleve in Geldern genutzt. Wo früher ein Teil der Bezirksregierung im Ernstfall gearbeitet hätte liegt heute Schriftgut der Kreisverwaltung Kleve. „Der ehemalige Schlafraum ist nun unser größter Magazinraum“ berichtet Kreisarchivarin Sturm und zeigt auf den farbigen Übersichtsplan des Bunkers. Auch in anderen ehemaligen Aufenthalts- und Arbeitsräumen lagert nun wertvolles Archivgut. „Obwohl die Räume Ende der 1990er Jahre zu Archivzwecken umgebaut wurden, sind die Spuren der Vergangenheit noch deutlich sichtbar“, so Sturm. „Dies wird mir immer wieder klar, wenn ich unser Außenmagazin durch die feuerhemmende und gasdichte Schutzraumtür betrete.“
Der ehemalige Bunker kann im Rahmen von Führungen durch das Kreisarchiv Kleve besichtigt werden. Um Voranmeldung wird gebeten. Kontakt: Kreisarchiv Kleve, Boeckelter Weg 2 in Geldern, 47608 Geldern, Tel.: 02821-85-814."
Quelle: Kreis Kleve, Pressemitteilung 28.9.2011
Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. September 2011, 12:15 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. September 2011, 12:02 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Historische Kommission für Westfalen lädt in Verbindung mit
dem Landesarchiv Nordrhein-Westfalen und dem LWL-Archivamt für
Westfalen zum Workshop "Amtsbücher als Quellen der
landesgeschichtlichen Forschung" in Münster ein. Der Workshop
steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der quellenbezogenen
Grundlagenarbeit der Historischen Kommission und der Archive.
Er wendet sich einer vernachlässigten Archivaliengattung zu,
die für die landesgeschichtliche Forschung wegen ihrer Vielfalt
und ihres Quellenwerts große Bedeutung besitzt. Der zeitliche
Schwerpunkt soll auf der Zeit vom Spätmittelalter bis zum Ende
des Alten Reichs liegen.
Der Workshop befasst sich mit folgenden Leitthemen: a)
Typologische Beschreibung und Differenzierung der Amtsbücher im
Archiv. b) Welche Tiefe der Erschließung ist aus Sicht der
Benutzung erforderlich und aus Sicht der jeweiligen Archive
möglich? Die Spannbreite reicht von einer Minimal- bis zur
wünschenswerten Tiefenerschließung und im Extremfall bis zu
einer kritischen Edition mit Transkription und formenkundlichem
Apparat. Hier ist zu fragen, welche Rolle die Digitalisierung
künftig bei Erschließung und Benutzung der Amtsbücher spielen
wird. c) Welche Auswertungspotentiale haben die Amtsbücher für
die Forschung? d) Welche Möglichkeiten gibt es, der Forschung
Hilfsmittel zur Interpretation zur Verfügung zu stellen?
09.30 Uhr Anmeldung / Begrüßungskaffee
10.00 Uhr Begrüßung und Einführung in die Tagung
Prof. Dr. Wilfried Reininghaus - 1. Vorsitzender der Historischen
Kommission für Westfalen -
Dr. Marcus Stumpf - Leiter des LWL-Archivamts für Westfalen -
Dr. Stefan Pätzold, Bochum: Zwischen archivarischer Praxis und
kulturgeschichtlichem Paradigma: Jüngere Ansätze der
Amtsbuchforschung
Dr. Henning Steinführer, Braunschweig; Städtische Amtsbücher in
Archiven: Möglichkeiten und Grenzen der Erschließung bei
knappen Ressourcen
Dr. Nicolas Rügge, Osnabrück: Zur landesherrlichen Amtsbuch-
und insbesondere Protokollüberlieferung (Regierungs-, Amts- und
Gerichtsprotokolle) in Osnabrück und Lippe
12.30 Uhr Mittagspause
13.30 Uhr Dr. Stefan Gorißen, Bielefeld: Südwestfälische
kaufmännische Rechnungsbücher aus vorindustrieller Zeit. Formen,
Funktionen, Auswertungsperspektiven Dr. Matthias Kordes,
Recklinghausen: Der "Liber conventus Richlinghusani":
Archivische, methodische und regionalgeschichtliche
Erkenntnisse aus einem franziskanischen Amtsbuch des 18.
Jahrhunderts
15.00 Uhr Kaffeepause
15.30 Uhr Dr. Christian Speer, Halle (Saale): "Der Index
Librorum Civitatum (Verzeichnis der Stadtbücher des
Mittelalters und der Frühen Neuzeit) als Instrument der
historischen Grundlagenforschung"
16.00 Uhr Schlussdiskussion mit einem Impulsreferat zum Thema
"Stellenwert der Digitalisierung bei der Erschließung und
Benutzung von Amtsbüchern"
INFO
Veranstaltungsort
Die Veranstaltung findet am 13. Oktober 2011 in Münster im
Landesarchiv NRW, An den Speichern 11 statt, wo auch das
Mittagessen eingenommen werden kann (Anmeldung).
URL: http://www.lwl.org/hiko-download/Workshop%202011_Einladung.pdf
um eine anmedlung wird bis zum 30.09.2011 gebeten.
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Anfahrt vom
Hauptbahnhof Münster: Mit der Buslinie 8 in Richtung
"Kinderhaus-Schulzentrum" bis zur Haltestelle "Holtmannsweg"
oder Linie 9 in Richtung Coerde- Speicherstadt bis zur
Endhaltestelle "Speicherstadt".
Kontakt
Historische Kommission für Westfalen
Salzstr. 38 (Erbdrostenhof)
48143 Münster
Tel. 0251 591-4720
Fax 0251 591-5871
E-Mail hiko@lwl.org
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
dem Landesarchiv Nordrhein-Westfalen und dem LWL-Archivamt für
Westfalen zum Workshop "Amtsbücher als Quellen der
landesgeschichtlichen Forschung" in Münster ein. Der Workshop
steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der quellenbezogenen
Grundlagenarbeit der Historischen Kommission und der Archive.
Er wendet sich einer vernachlässigten Archivaliengattung zu,
die für die landesgeschichtliche Forschung wegen ihrer Vielfalt
und ihres Quellenwerts große Bedeutung besitzt. Der zeitliche
Schwerpunkt soll auf der Zeit vom Spätmittelalter bis zum Ende
des Alten Reichs liegen.
Der Workshop befasst sich mit folgenden Leitthemen: a)
Typologische Beschreibung und Differenzierung der Amtsbücher im
Archiv. b) Welche Tiefe der Erschließung ist aus Sicht der
Benutzung erforderlich und aus Sicht der jeweiligen Archive
möglich? Die Spannbreite reicht von einer Minimal- bis zur
wünschenswerten Tiefenerschließung und im Extremfall bis zu
einer kritischen Edition mit Transkription und formenkundlichem
Apparat. Hier ist zu fragen, welche Rolle die Digitalisierung
künftig bei Erschließung und Benutzung der Amtsbücher spielen
wird. c) Welche Auswertungspotentiale haben die Amtsbücher für
die Forschung? d) Welche Möglichkeiten gibt es, der Forschung
Hilfsmittel zur Interpretation zur Verfügung zu stellen?
09.30 Uhr Anmeldung / Begrüßungskaffee
10.00 Uhr Begrüßung und Einführung in die Tagung
Prof. Dr. Wilfried Reininghaus - 1. Vorsitzender der Historischen
Kommission für Westfalen -
Dr. Marcus Stumpf - Leiter des LWL-Archivamts für Westfalen -
Dr. Stefan Pätzold, Bochum: Zwischen archivarischer Praxis und
kulturgeschichtlichem Paradigma: Jüngere Ansätze der
Amtsbuchforschung
Dr. Henning Steinführer, Braunschweig; Städtische Amtsbücher in
Archiven: Möglichkeiten und Grenzen der Erschließung bei
knappen Ressourcen
Dr. Nicolas Rügge, Osnabrück: Zur landesherrlichen Amtsbuch-
und insbesondere Protokollüberlieferung (Regierungs-, Amts- und
Gerichtsprotokolle) in Osnabrück und Lippe
12.30 Uhr Mittagspause
13.30 Uhr Dr. Stefan Gorißen, Bielefeld: Südwestfälische
kaufmännische Rechnungsbücher aus vorindustrieller Zeit. Formen,
Funktionen, Auswertungsperspektiven Dr. Matthias Kordes,
Recklinghausen: Der "Liber conventus Richlinghusani":
Archivische, methodische und regionalgeschichtliche
Erkenntnisse aus einem franziskanischen Amtsbuch des 18.
Jahrhunderts
15.00 Uhr Kaffeepause
15.30 Uhr Dr. Christian Speer, Halle (Saale): "Der Index
Librorum Civitatum (Verzeichnis der Stadtbücher des
Mittelalters und der Frühen Neuzeit) als Instrument der
historischen Grundlagenforschung"
16.00 Uhr Schlussdiskussion mit einem Impulsreferat zum Thema
"Stellenwert der Digitalisierung bei der Erschließung und
Benutzung von Amtsbüchern"
INFO
Veranstaltungsort
Die Veranstaltung findet am 13. Oktober 2011 in Münster im
Landesarchiv NRW, An den Speichern 11 statt, wo auch das
Mittagessen eingenommen werden kann (Anmeldung).
URL: http://www.lwl.org/hiko-download/Workshop%202011_Einladung.pdf
um eine anmedlung wird bis zum 30.09.2011 gebeten.
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Anfahrt vom
Hauptbahnhof Münster: Mit der Buslinie 8 in Richtung
"Kinderhaus-Schulzentrum" bis zur Haltestelle "Holtmannsweg"
oder Linie 9 in Richtung Coerde- Speicherstadt bis zur
Endhaltestelle "Speicherstadt".
Kontakt
Historische Kommission für Westfalen
Salzstr. 38 (Erbdrostenhof)
48143 Münster
Tel. 0251 591-4720
Fax 0251 591-5871
E-Mail hiko@lwl.org
via Mailingliste "Westfälische Geschichte"
Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. September 2011, 11:50 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
A Brief History of Digital Data from Sweat & Pixels on Vimeo.
A short, informative animation with the purpose of providing general knowledge about data storage: history, devices, and facts. Or an info-graphic in motion.By Sweat & Pixels. Made in Adobe Flash CS5.
Music: Fringe Element (Shorts Like Me Edit) - Beni
Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. September 2011, 11:45 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Gabi Reinmann hat einen lesenswerten Text zu digitalen Medien in der Hochschullehre geschrieben:
http://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2011/09/Preprint_Fehler_eLearning_Sept11.pdf
http://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2011/09/Preprint_Fehler_eLearning_Sept11.pdf
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://facsimile.ub.rug.nl/cdm/
Griechische Papyri, aber auch frühneuzeitliche Gelehrtenkorrespondenzen und anderes mehr in großzügiger Auflösung.

Griechische Papyri, aber auch frühneuzeitliche Gelehrtenkorrespondenzen und anderes mehr in großzügiger Auflösung.

KlausGraf - am Mittwoch, 28. September 2011, 02:03 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
wird vorgestellt von
http://plan3t.info/2011/09/27/gesellschaftlich-relevant/
Der Beitrag beginnt mit einem Schnitzer, den ich nicht gerne lese: Das erste Archiv, dass ich kennenlernte, war gleich ein besonderes.
http://plan3t.info/2011/09/27/gesellschaftlich-relevant/
Der Beitrag beginnt mit einem Schnitzer, den ich nicht gerne lese: Das erste Archiv, dass ich kennenlernte, war gleich ein besonderes.
KlausGraf - am Mittwoch, 28. September 2011, 01:51 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE727892007&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10
Das LG Berlin stellte 2007 fest:
Es kann dahinstehen, ob durch Übergabe der Briefe an das Bundesarchiv diese der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden (§§ 6, 12 UrhG). Insbesondere kommt es nicht darauf an, wie sich die Beschränkungen des § 5 BArchG i. V. m. §§ 1, 3, 5 BArchV auf die Frage der Öffentlichkeit auswirken (vgl. insoweit für eine ähnliche Zugangsregelung OLG Zweibrücken GRUR 1997, 364, wo die Veröffentlichung verneint wurde). Jedenfalls ist unstreitig, dass nicht der Antragsteller selbst die Briefe dem Archiv übergeben hat. Mithin hat er sein Recht aus § 12 UrhG nicht ausgeübt.
Auch der Umstand, dass er die Briefe an das Bundesministerium adressiert hat - von wo sie offenbar an das Bundesarchiv gelangten - stellt keine Veröffentlichung i. S. v. § 12 UrhG dar, da der Adressat ausschließlich der Bundesminister Prof. xxx war und der Umstand, dass andere Personen des Ministeriums von dem Inhalt möglicherweise Kenntnis erlangt haben, nicht zur Annahme eines Veröffentlichungswillens führt, genauso wenig wie dies der Fall ist, wenn Schreiben an eine Redaktion, an eine größere Rechtsanwaltskanzlei oder an den Spruchkörper eines Gerichts gerichtet ist (vgl. KG NJW 1995, 3392, 3393 - Botho Strauß).
Das KG ist darauf nicht weiter eingegangen:
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE203022008&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10
Im Ergebnis überzeugen beide Entscheidungen nicht:
http://archiv.twoday.net/stories/3225515/
Das LG Berlin stellte 2007 fest:
Es kann dahinstehen, ob durch Übergabe der Briefe an das Bundesarchiv diese der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden (§§ 6, 12 UrhG). Insbesondere kommt es nicht darauf an, wie sich die Beschränkungen des § 5 BArchG i. V. m. §§ 1, 3, 5 BArchV auf die Frage der Öffentlichkeit auswirken (vgl. insoweit für eine ähnliche Zugangsregelung OLG Zweibrücken GRUR 1997, 364, wo die Veröffentlichung verneint wurde). Jedenfalls ist unstreitig, dass nicht der Antragsteller selbst die Briefe dem Archiv übergeben hat. Mithin hat er sein Recht aus § 12 UrhG nicht ausgeübt.
Auch der Umstand, dass er die Briefe an das Bundesministerium adressiert hat - von wo sie offenbar an das Bundesarchiv gelangten - stellt keine Veröffentlichung i. S. v. § 12 UrhG dar, da der Adressat ausschließlich der Bundesminister Prof. xxx war und der Umstand, dass andere Personen des Ministeriums von dem Inhalt möglicherweise Kenntnis erlangt haben, nicht zur Annahme eines Veröffentlichungswillens führt, genauso wenig wie dies der Fall ist, wenn Schreiben an eine Redaktion, an eine größere Rechtsanwaltskanzlei oder an den Spruchkörper eines Gerichts gerichtet ist (vgl. KG NJW 1995, 3392, 3393 - Botho Strauß).
Das KG ist darauf nicht weiter eingegangen:
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE203022008&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10
Im Ergebnis überzeugen beide Entscheidungen nicht:
http://archiv.twoday.net/stories/3225515/
KlausGraf - am Dienstag, 27. September 2011, 23:00 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Fassade Kunsthalle, Montage
"Vom 27.09. bis 11.11.2011 ist im Stadtarchiv Düsseldorf, Worringer Straße 140, die Ausstellung "Die Ökonomie der Bilder -die Stadt und Kunstvereine als Auftraggeber" zu sehen.
Sie ist ein eigenständiger Teil des Begleitprogramms zur Ausstellung "Weltklasse -Die Düsseldorfer Malerschule 1819-1918" des Museum Kunstpalast.
In dieser Studioausstellung wird dargestellt, wie Kunstvereine und die Stadt als Auftraggeber für Absolventen der Düsseldorfer Kunstakademie sowie andere in der Stadt tätige Maler auftraten. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die vermittelnde Rolle der Kunstvereine als Sachverständige und Sponsoren von Gemälden gerichtet. Die gezeigten Exponate (darunter Pläne, Schriftstücke, Bauzeichnungen, Fotografien) stammen fast ausschließlich aus den Beständen des Stadtarchivs und werden durch Reproduktionen verschiedener Gemälde ergänzt.
Kunstvereine
Der Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen verfolgte mit seiner Gründung 1829 das Ziel, Kunst und Künstler in Düsseldorf zu fördern und so das öffentliche Leben zu bereichern. Von Anfang an bestand eine enge Beziehung zur Kunstakademie und zu deren Studenten. Viele von ihnen waren Mitglieder, ebenso wie einige ihrer Lehrer. Die übrigen Mitglieder setzten sich zusammen aus politischen Repräsentanten der Stadt, Kaufleuten, Juristen und anderen vermögenden Privatpersonen weit über Rheinland und Westfalen hinaus bis nach Nord-Amerika.
Städte und andere Kunstvereine gehörten ebenfalls dazu. Der Verein förderte Aufträge an die Künstler der Malerschule (Ausmalung von Kirchen, Rathäusern etc.), die dadurch auch über die Grenzen Düsseldorfs hinaus Bekanntheit erlangten.
Der 1846 gegründete Verein zur Errichtung einer Gemäldegalerie vertrat als Hauptziel, den Ruf Düsseldorfs als Kunststadt durch den Aufbau einer Gemäldegalerie neu zu begründen, weil die von Kurfürst Johann Wilhelm II. Eingerichtete durch Erbfall nach München gelangt war. Außerdem sollte eine Ausstellungshalle gebaut werden. Die Mitglieder setzten sich aus den gleichen Kreisen zusammen wie beim Kunstverein, mit dem Unterschied, dass 75% aus Düsseldorf stammen mussten.
1914 löste der Verein sich auf. Da seit Juli 1913 ein Direktor für die Städtischen Kunstsammlungen bestellt worden war (Karl Koetschau), war der ursprüngliche Zweck des Vereins erfüllt. Die Gemälde gingen in städtischen Besitz über.
Kunstwerke wurden hauptsächlich erworben, sei es durch Angebote der Künstler selbst oder durch Empfehlung Dritter. Neben der Stadt als Käuferin erwarben auch Galerieverein und Kunstverein Gemälde, deren Kosten sie sich in einzelnen Fällen teilten. Es wurden auch Gemälde vom Kunstverein an den Galerieverein überwiesen. Durch Verlosungen des Kunstvereins in Besitz der Stadt gelangte Gemälde wurden der Galerie zugeführt.
Ausstellungen wurden zunächst in den Räumen der Akademie am Burgplatz (Altes Schloss) gezeigt. Die Gründung weiterer Künstlervereine (Verein zur gegenseitigen Unterstützung und Hülfe, Künstlerverein Malkasten) belebte das kulturelle Leben. Die steigende Zahl der Kunstausstellungen führte zu Terminüberschneidungen, so dass ab 1866 auch die Tonhalle an der Schadowstraße genutzt wurde, in die ein geräumiger Ausstellungssaal eingebaut worden war. Schließlich, ab Juli 1881, gab es das erste Kunstausstellungsgebäude in Düsseldorf -die Kunsthalle.
Die Stadt als Auftraggeberin
Neben dem Engagement für das neue städtische Kunsthaus, mit dem man zumindest ansatzweise den Verlust der kurfürstlichen Gemäldegalerie zu kompensieren versuchte, war insbesondere der Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen sowohl angesehener und selbstbewusster Ratgeber, als auch finanzstarker Finanzier geplanter Kunstprojekte im öffentlichen Raum. Auch die Stadtverwaltung versuchte, die hier ausgebildeten Akademieabsolventen mittels Auftragsvergabe zu unterstützen. Anhand dreier Projekte soll beispielhaft gezeigt werden, welche Kräfte an der Künstler-, manchmal auch an der Themenauswahl beteiligt waren.
Schlaglichtartig wurden Bauwerke herausgegriffen, deren Ausgestaltung mit Gemälden in städtischem Auftrag bzw. unter starker Beteiligung der Stadt entstanden, nämlich der neu erbaute Rathauskomplex, die städtische Kunsthalle und das Stadttheater.
Das in den 1880er Jahren entstandene "Neue Rathaus" hinter dem Jan-Wellem-Denkmal, ein für die sogenannte "Gründerzeit" typischer Bau, den schon die Zeitgenossen für zu überladen hielten, verlangte nach einer Ausgestaltung des Ratssaals mit Gemälden. Hier lässt sich sehr gut die Federführung des Kunstvereins erkennen, der sich seine namhafte finanzielle Beteiligung mit einer massiven Einflussnahme verknüpfte, dies notfalls auch im offenen Widerstand gegen das ebenfalls an den Kosten beteiligte Königreich Preussen. Bei der Bildauswahl blieb man patriotisch und monarchisch loyal: Darstellungen der Stadtgeschichte im engeren Sinne finden sich wenige und wenn, dann nur im Kontext der Taten des Herrscherhauses. Das 1899 fertig gestellte Projekt ließ man sich fast 90.000 Reichsmark kosten. Zum Vergleich: Eine fünfköpfige Handwerkerfamilie musste mit etwa 1200 Reichsmark im Jahr auskommen.
Qualitativ gänzlich anders verlief die Ausmalung der Decke im Zuschauerraum des Stadttheaters. Nach einem sehr teuren Vorschlag des Kunstvereins bevorzugte die Stadt die Auftragsvergabe an die örtliche Kunstgewerbeschule und veranschlagte hierfür 8000 Reichsmark. Allerdings sollte es schnell zu einem Eklat kommen, denn der beauftragte Kunstmaler zerstritt sich mit seinen beiden Gehilfen, die das entstehende Werk ihres Chefs kurzerhand übermalten. Diese sollten nun die Ausmalung weiterführen und beenden, allerdings war das Ergebnis derart unbefriedigend, dass die Künstler innerhalb kurzer Zeit ein gänzlich neues Werk abliefern sollten, insgesamt also eine dritte Fassung. Aber auch diese Variante befriedigte nicht. Einer der beiden Beteiligten zog es nicht zuletzt wegen der schlechten Kritiken vor, sein Glück in Korea zu suchen, wo sich seine Spur verliert.
Die städtische Kunsthalle schließlich war ein Geschenk Preussens an die Stadt und sollte die neu entstehende Gemäldesammlung aufnehmen. Nach einem Jahre dauernden Wettbewerb wurde der in der Stadt ansässige Künstler Carl Gehrts mit der Ausmalung des oberen Treppenhauses in Freskotechnik beauftragt und erhielt dafür fast 100.000 Reichsmark. Nach insgesamt siebenjähriger Arbeit wurde einer der größten Düsseldorfer Freskenzyklen im Jahr 1897 fertig gestellt. Wie alle bisher genannten Arbeiten im Rathaus und Stadttheater gingen auch sie im Zweiten Weltkrieg bzw. den darauffolgenden Jahren verloren.
Anders verhält es sich mit dem venezianischen Mosaik über dem Eingangsportal der Kunsthalle. Das nach einem Entwurf Fritz Roebers im Jahr 1888 fertig gestellte Kunstwerk überdauerte den Krieg, wurde Ende der 1950er Jahre abgenommen und wird heute im Depot des Museum Kunstpalast aufbewahrt. In der Ausstellung im Stadtarchiv wird eines der mehr als 150 erhaltenen gebliebenen Mosaikfresken gezeigt -erstmalig seit der Abnahme des Kunstwerks vor mehr als fünfzig Jahren.
Schließlich illustrieren einige Originalbriefe berühmter Düsseldorfer Maler (darunter etwa Emmanuel Leutze und Wilhelm von Schadow) die reichen Bestände der Handschriftensammlung des Stadtarchivs.
Ausstellungskonzeption:
Dr. Benedikt Mauer; Dr. Elisabeth Scheeben (beide Stadtarchiv Düsseldorf)
Ort:
Stadtarchiv der Landeshauptstadt Düsseldorf
Worringer Straße 140
40210 Düsseldorf
Zeitraum: 27.09.2011 bis 11.11.2011
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 8:30h bis 15:30h
Freitag: 8:30h bis 12:30h
Eintritt frei "
Quelle: Stadtarchiv Düsseldorf, Aktuelles
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 21:45 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Bilddatenbank des Bundesarchivs weist folgenden mehrdeutigen Klassifikationspunkt auf: N II "Verkehr mit Tieren" - mit folgenden Unterpunkten N II a Tragtiere und N II b Zugtiere.
Dank an die blaumeisen (Tweet v. 22.9.11)!
Dank an die blaumeisen (Tweet v. 22.9.11)!
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 21:39 - Rubrik: Erschließung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Fred van Kan berichtet in seinem Blog über den Deutschen Archivtag 2011. Niederländisch - trotzdem lesenswert!
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 21:31 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 21:28 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Der Bundestag wird am Freitag, 30. September 2011, die achte Novelle des Stasi-Unterlagen-Gesetzes in zweiter und dritter Lesung beraten und voraussichtlich verbschieden. Mit der Novelle sollen die Überprüfungsfristen bis zum 31. Dezember 2019 verlängert werden. Vorgesehen ist auch, das Recht auf Akteneinsicht zu erweitern und die Möglichkeiten für eine Überprüfung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst auszuweiten. Zudem sieht der Gesetzentwurf ein Beschäftigungsverbot für ehemalige Stasi-Mitarbeiter beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BSTU) vor. Für die Aussprache über den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP (17/5894), die um 12.20 Uhr beginnen soll, sind 60 Minuten eingeplant.
Abgeordnete verschärften Gesetzentwurf
Der ursprüngliche Gesetzentwurf war in der vergangenen Woche vom Ausschuss für Kultur und Medien noch einmal verschärft worden. Mit Hinweis auf die Ergebnisse einer öffentlichen Anhörung über die Gesetzesnovelle vor der parlamentarischen Sommerpause legten die CDU/CSU- und die FDP-Fraktion einen entsprechenden Änderungsantrag vor, den der Ausschuss gegen die Stimmen der SPD-Fraktion und der Fraktion Die Linke mehrheitlich annahm. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen enthielt sich der Stimme.
Nach dem geänderten Gesetzentwurf sollen Beschäftigte im öffentlichen Dienst auf Antrag des Dienstherrn bereits ab der Gehaltsgruppe A9/E9 auf eine frühere informelle oder hauptamtliche Stasi-Tätigkeit überprüft werden können.
Keine Ex-Stasi-Leute in der Jahn-Behörde
Die Sozialdemokraten und die Grünen, die prinzipiell für eine Novelle des Gesetzes eintreten, lehnen eine solche Überprüfungsmöglichkeit ab. Sie wollen eine Überprüfung nur in Fällen, in denen „tatsächliche Anhaltspunkte“ für eine frühere Stasi-Tätigkeit vorliegen. Die Linksfraktion lehnt den Gesetzentwurf hingegen generell ab. Sie plädiert dafür, die Stasi-Akten in das Bundesarchiv zu überführen und dort aufzuarbeiten.
Aufgenommen in den Gesetzentwurf wurde zudem ein Beschäftigungsverbot für ehemalige informelle und hauptamtliche Mitarbeiter der Staatsicherheit in der Stasi-Unterlagen-Behörde (nach dem derzeitigen Behördenleiter Roland Jahn auch Jahn-Behörde genannt).
Recht auf Einsicht in die Stasi-Akten unstrittig
Die derzeit noch in der Behörde beschäftigten Stasi-Mitarbeiter sollen innerhalb des Bundesdienstes bei gleicher Bezahlung versetzt werden. Auch diese Regelung wird von den Oppositionsfraktionen abgelehnt.
Unstrittig zwischen Union, FDP, SPD und Grünen hingegen ist das Recht auf Einsicht in die Stasi-Akten durch die Wissenschaft, die Medien sowie die Stasi-Opfer und deren Angehörige. (aw)"
Quelle: Bundestag, Textarchiv
Abgeordnete verschärften Gesetzentwurf
Der ursprüngliche Gesetzentwurf war in der vergangenen Woche vom Ausschuss für Kultur und Medien noch einmal verschärft worden. Mit Hinweis auf die Ergebnisse einer öffentlichen Anhörung über die Gesetzesnovelle vor der parlamentarischen Sommerpause legten die CDU/CSU- und die FDP-Fraktion einen entsprechenden Änderungsantrag vor, den der Ausschuss gegen die Stimmen der SPD-Fraktion und der Fraktion Die Linke mehrheitlich annahm. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen enthielt sich der Stimme.
Nach dem geänderten Gesetzentwurf sollen Beschäftigte im öffentlichen Dienst auf Antrag des Dienstherrn bereits ab der Gehaltsgruppe A9/E9 auf eine frühere informelle oder hauptamtliche Stasi-Tätigkeit überprüft werden können.
Keine Ex-Stasi-Leute in der Jahn-Behörde
Die Sozialdemokraten und die Grünen, die prinzipiell für eine Novelle des Gesetzes eintreten, lehnen eine solche Überprüfungsmöglichkeit ab. Sie wollen eine Überprüfung nur in Fällen, in denen „tatsächliche Anhaltspunkte“ für eine frühere Stasi-Tätigkeit vorliegen. Die Linksfraktion lehnt den Gesetzentwurf hingegen generell ab. Sie plädiert dafür, die Stasi-Akten in das Bundesarchiv zu überführen und dort aufzuarbeiten.
Aufgenommen in den Gesetzentwurf wurde zudem ein Beschäftigungsverbot für ehemalige informelle und hauptamtliche Mitarbeiter der Staatsicherheit in der Stasi-Unterlagen-Behörde (nach dem derzeitigen Behördenleiter Roland Jahn auch Jahn-Behörde genannt).
Recht auf Einsicht in die Stasi-Akten unstrittig
Die derzeit noch in der Behörde beschäftigten Stasi-Mitarbeiter sollen innerhalb des Bundesdienstes bei gleicher Bezahlung versetzt werden. Auch diese Regelung wird von den Oppositionsfraktionen abgelehnt.
Unstrittig zwischen Union, FDP, SPD und Grünen hingegen ist das Recht auf Einsicht in die Stasi-Akten durch die Wissenschaft, die Medien sowie die Stasi-Opfer und deren Angehörige. (aw)"
Quelle: Bundestag, Textarchiv
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 21:15 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
This was a project that features the Emerson College Archives. I produced this and also operated the camera.
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 21:09 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Joachim Scholtysek auf DeutschlandradioKultur über seine Archivarbeit, 26.9.2011:
".... Heise: Und beide Söhne und ihre Nachkommen beteiligten sich dann eben auch an dem Schweigen nach dem Zweiten Weltkrieg. Über Aufarbeitung der Nazivergangenheit der Unternehmerfamilie Quandt spreche ich mit dem Historiker Joachim Scholtyseck. Herr Scholtyseck, es gab ja eine NDR-Dokumentation aus dem Jahr 2007 und es gab auch eine Familienbiografie von Rüdiger Jungbluth, einem Wirtschaftsjournalisten, also ganz überraschend waren die Erkenntnisse, die Sie jetzt haben, ja nicht. Ihnen gegenüber hat sich diese schweigsame Familie aber ganz anders geöffnet. Welche Quellen standen Ihnen zur Verfügung?
Scholtyseck: Ich habe in diesem Fall multiarchivalisch gearbeitet. Es war schon ein sehr großer Vorteil, dass die Familie mir praktisch unbegrenzten Zutritt zu dem sogenannten Familienarchiv gewährt hat, ...
Heise: Was sie vorher noch nie gemacht hatte.
Scholtyseck: ... was sie vorher noch nie gemacht hatte, und das war auf der einen Seite wichtig, zeigt aber eben auch, dass die Familie nach dem Film umzudenken begann. Und was für mich dann noch wichtiger war, mir wurde zugesichert, dass ich diese Ergebnisse, die ja jetzt eben tatsächlich nicht sehr schön für die Familie sind, dass ich diese Ergebnisse von der Familie unredigiert veröffentlichen darf, und dass dieses sogenannte Familienarchiv dann auch in ein öffentliches Archiv überführt wird, damit die Ergebnisse, die ich vorgelegt habe, auch für die kritische Öffentlichkeit überprüfbar sind.
Heise: Also Sie hatten den Eindruck, dass die Nachkommen - das sind Stefan Quandt und seine Kusine Gabriele Quandt vor allem - dass die tatsächlich an schonungsloser Transparenz - auch schonungslos den eigenen Vätern gegenüber, denn das waren eben Herbert und Harald Quandt - ja, sie wollten wirklich schonungslose Aufklärung?
Scholtyseck: Ja, ob sie das jetzt wirklich wollten, wissen Sie, das ist immer ganz schwer zu sagen. Aber ich hatte für mich persönlich bei meinen Recherchen den Eindruck, dass es eben ihnen, der Familie auch daran gelegen war, alle Fakten auf den Tisch zu bekommen und die eben auch der Öffentlichkeit präsentieren zu können, dass man sagt: Es soll jetzt tatsächlich in vielen Archiven, in allen zugänglichen Archiven soll geforscht werden, was ist denn jetzt nun eigentlich gewesen. Und das ist eben eine Offenheit, die sich stark von dem unterschied, was jahrzehntelang eben so die Familientradition gewesen ist. .....
Heise: Die scheinen jetzt aufzuarbeiten. Was ist der Eindruck, oder aus welchem Grund kommt das jetzt zur Häufung? Ich habe beispielsweise Boss erwähnt, auch die C&A, also Brenninkmeijers, lassen in die Archive gucken.
Scholtyseck: Ja, da könnte man sogar noch andere Firmen nennen, etwa Oetker oder Boehringer. Das sind also Familienunternehmen, die jetzt stärker wirklich in den Fokus geraten und eventuell auch Interesse haben, ihre Geschichte aufzuarbeiten. Es ist natürlich immer schwieriger für ein Familienunternehmen, in die eigenen dunklen Zeiten zurückzuschauen, als für eine anonyme Aktiengesellschaft. Da kann man sagen: Ja, das waren die Manager, das waren die Betriebsleiter. Und hier sind es natürlich Familien, die eine Tradition haben, die auch eine Tradition gepflegt haben. Und wenn man da eben feststellt, der Großvater ist vielleicht gar nicht ein so toller Unternehmer gewesen - ich drücke das jetzt mal etwas salopp aus -, dann ist es für Familienunternehmen sicherlich etwas schwieriger als für Aktiengesellschaften und große Publikumsgesellschaften. Aber dieser Trend, der ist tatsächlich, wie Sie gesagt haben, Frau Heise, zu erkennen, und das wird wahrscheinlich auch nicht ausbleiben. Es ist auch gut, dass solche Dinge auf den Tisch kommen und nicht weiter solche weißen Flecken in der Geschichtswissenschaft, gerade der Geschichte des Dritten Reiches, übrigbleiben. ....."
Ob multiarchivalisch in die Archivterminologie eingehen wird?
".... Heise: Und beide Söhne und ihre Nachkommen beteiligten sich dann eben auch an dem Schweigen nach dem Zweiten Weltkrieg. Über Aufarbeitung der Nazivergangenheit der Unternehmerfamilie Quandt spreche ich mit dem Historiker Joachim Scholtyseck. Herr Scholtyseck, es gab ja eine NDR-Dokumentation aus dem Jahr 2007 und es gab auch eine Familienbiografie von Rüdiger Jungbluth, einem Wirtschaftsjournalisten, also ganz überraschend waren die Erkenntnisse, die Sie jetzt haben, ja nicht. Ihnen gegenüber hat sich diese schweigsame Familie aber ganz anders geöffnet. Welche Quellen standen Ihnen zur Verfügung?
Scholtyseck: Ich habe in diesem Fall multiarchivalisch gearbeitet. Es war schon ein sehr großer Vorteil, dass die Familie mir praktisch unbegrenzten Zutritt zu dem sogenannten Familienarchiv gewährt hat, ...
Heise: Was sie vorher noch nie gemacht hatte.
Scholtyseck: ... was sie vorher noch nie gemacht hatte, und das war auf der einen Seite wichtig, zeigt aber eben auch, dass die Familie nach dem Film umzudenken begann. Und was für mich dann noch wichtiger war, mir wurde zugesichert, dass ich diese Ergebnisse, die ja jetzt eben tatsächlich nicht sehr schön für die Familie sind, dass ich diese Ergebnisse von der Familie unredigiert veröffentlichen darf, und dass dieses sogenannte Familienarchiv dann auch in ein öffentliches Archiv überführt wird, damit die Ergebnisse, die ich vorgelegt habe, auch für die kritische Öffentlichkeit überprüfbar sind.
Heise: Also Sie hatten den Eindruck, dass die Nachkommen - das sind Stefan Quandt und seine Kusine Gabriele Quandt vor allem - dass die tatsächlich an schonungsloser Transparenz - auch schonungslos den eigenen Vätern gegenüber, denn das waren eben Herbert und Harald Quandt - ja, sie wollten wirklich schonungslose Aufklärung?
Scholtyseck: Ja, ob sie das jetzt wirklich wollten, wissen Sie, das ist immer ganz schwer zu sagen. Aber ich hatte für mich persönlich bei meinen Recherchen den Eindruck, dass es eben ihnen, der Familie auch daran gelegen war, alle Fakten auf den Tisch zu bekommen und die eben auch der Öffentlichkeit präsentieren zu können, dass man sagt: Es soll jetzt tatsächlich in vielen Archiven, in allen zugänglichen Archiven soll geforscht werden, was ist denn jetzt nun eigentlich gewesen. Und das ist eben eine Offenheit, die sich stark von dem unterschied, was jahrzehntelang eben so die Familientradition gewesen ist. .....
Heise: Die scheinen jetzt aufzuarbeiten. Was ist der Eindruck, oder aus welchem Grund kommt das jetzt zur Häufung? Ich habe beispielsweise Boss erwähnt, auch die C&A, also Brenninkmeijers, lassen in die Archive gucken.
Scholtyseck: Ja, da könnte man sogar noch andere Firmen nennen, etwa Oetker oder Boehringer. Das sind also Familienunternehmen, die jetzt stärker wirklich in den Fokus geraten und eventuell auch Interesse haben, ihre Geschichte aufzuarbeiten. Es ist natürlich immer schwieriger für ein Familienunternehmen, in die eigenen dunklen Zeiten zurückzuschauen, als für eine anonyme Aktiengesellschaft. Da kann man sagen: Ja, das waren die Manager, das waren die Betriebsleiter. Und hier sind es natürlich Familien, die eine Tradition haben, die auch eine Tradition gepflegt haben. Und wenn man da eben feststellt, der Großvater ist vielleicht gar nicht ein so toller Unternehmer gewesen - ich drücke das jetzt mal etwas salopp aus -, dann ist es für Familienunternehmen sicherlich etwas schwieriger als für Aktiengesellschaften und große Publikumsgesellschaften. Aber dieser Trend, der ist tatsächlich, wie Sie gesagt haben, Frau Heise, zu erkennen, und das wird wahrscheinlich auch nicht ausbleiben. Es ist auch gut, dass solche Dinge auf den Tisch kommen und nicht weiter solche weißen Flecken in der Geschichtswissenschaft, gerade der Geschichte des Dritten Reiches, übrigbleiben. ....."
Ob multiarchivalisch in die Archivterminologie eingehen wird?
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 21:03 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
Wuppertaler Bühnen: ROST (Trailer), Erinnerungen für die Zukunft von Anne Hirth / büro für zeit + raum from Siegersbusch on Vimeo.
℗ Filmproduktion Siegersbusch, Wuppertal 2011»Ein Mensch muss bei seinem Tod etwas dalassen. Ein Kind oder ein Buch oder ein Bild, ein Haus oder wenigstens eine Mauer, die er gebaut, oder ein Paar Schuhe, die er geschustert. Oder einen Garten, den er angelegt hat. Irgend etwas, das deine Hand anrührte, so dass deine Seele eine Bleibe hat, wenn du stirbst, und wenn die Leute den Baum oder die Blume, die du gepflanzt hast, anschauen, dann bist du da.« (Ray Bradbury, Fahrenheit 451) Was wird von uns bleiben? Was soll bleiben? Was möchten wir jenen, die irgendwann einmal nach uns kommen, über uns erzählen? Rost handelt vom Aufbewahren. Von Gegenständen, Erinnerungen, Hoffnungen, von Weitsicht ebenso wie Ratlosigkeit. Denn was soll das ultimative Archiv für die Nachwelt alles enthalten? Die Mona Lisa? Sicher. Eine Gutenberg-Bibel? Auch. Eine CD von Xavier Naidoo? Mmmh… Aber irgendwann wird auch eine Cola-Dose zum Artefakt, man muss nur lange genug warten. Man hat sich ja schon oft darüber den Kopf zerbrochen, wie und womit man sich denen, die uns nachfolgen, präsentieren will, und hat dabei nicht nur an das Menschengeschlecht gedacht: 1977 schoss man zwei Raumsonden ins All, Voyager 1 und 2, die im Handgepäck eine 500 Millionen Jahre haltbare Datenplatte mit Informationen über die Erde mit sich führten – damit kommt man ein paar Sterne weit. So eine Art interstellare Flaschenpost für extraterrestrische Lebensformen, gefüllt mit den wichtigsten Informationen über die Erde und die sie beherrschende Spezies: uns. Aber wie mache ich einem Klingonen klar, wie ein Erdbeereis schmeckt? Muss mein Urururenkel wissen, wie ein Buch riecht? Und überhaupt – wie archiviert man einen Kuss?
mit Ralf Haarmann
An Kuohn
Silvia Munzón López
Juliane Pempelfort
INSZENIERUNG Anne Hirth //// BÜHNE UND KOSTÜME Alexandra Süßmilch //// MUSIK Haarmann //// LICHT-DESIGN Arnaud Poumarat //// DRAMATURGIE Oliver Held ////
Quelle: Wuppertaler Bühnen, Produktionen
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 20:56 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Niklaus Troxler, 1977
"Seit 1975 hat Niklaus Troxler unzählige Jazz-Koryphäen an das Jazz Festival Willisau geholt. Nun übergibt er sein Archiv mit professionellen Konzertaufnahmen an die Hochschule Luzern. Die Musikbibliothek der Hochschule macht das «Troxler-Archiv» in Zusammenarbeit mit der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern und der Fonoteca Lugano der Öffentlichkeit zugänglich. Am Freitag, 23. September wird die bedeutende Schenkung gefeiert.
Fast 900 Konzerte fanden seit dem ersten Jazz Festival 1975 in Willisau statt. Unter den auftretenden Musikern waren Internationale Grössen wie die Pianisten Chick Corea und Keith
Jarrett oder der Saxophonist Ornette Coleman. Ins Leben gerufen und bis 2009 geleitet hat das Festival Niklaus Troxler. Er übergab diese Aufgabe im letzten Jahr an seinen Neffen Arno Troxler. Von Beginn an zeichnete Niklaus Troxler einen Grossteil der Konzerte auf, damit sie der Nachwelt erhalten bleiben. Dieses besondere Privat-Archiv schenkt er nun der Hochschule Luzern – Musik: «Die professionelle Archivierung meiner Aufnahmen war mir schon länger
ein Anliegen. Mir ist wichtig, dass das Tonmaterial zu Forschungszwecken genutzt werden kann. Mit der Hochschule Luzern habe ich hierfür den idealen Partner gefunden.»
Die Schenkung an die Hochschule Luzern umfasst 250 agnetbänder, 123 Digital Audio Tapes (DAT), dazu Programmhefte, Presseberichte und Plakate. Aufbewahrt werden die Originalbänder,
die Niklaus Troxler sorgfältig restaurieren liess, in der Schweizer Nationalphonotek Fonoteca in Lugano. Diese ist auf die Archivierung von Tonträgern spezialisiert. Die Fonoteca und die Hochschule Luzern möchten die Originalaufnahmen aus dem Privatarchiv von Niklaus Troxler nun der Öffentlichkeit zugänglich machen: An einer so genannten Abhörstation können Musikinteressierte akustisch auf die Willisauer Konzerte zugreifen. Aktuell gibt es solche Abhörstationen an 40 Standorten in der ganzen Schweiz. Die bisher einzige Station im Kanton Luzern steht seit 2008 in der Musikbibliothek der Hochschule Luzern. Zur feierlichen, offiziellen Übergabe des Troxler-Archivs am 23. September wird eine neue Abhörstation am Institut Jazz eingerichtet sowie eine dritte in der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (ZHB). Die ZHB wird auch die Weltformatplakate des Jazz Festivals Willisau aufbewahren.
Hämi Hämmerli, Leiter des Instituts Jazz, zeigt sich über die Schenkung sehr glücklich: «Diese Geste ist nicht nur für unsere Studierenden und Dozierenden von unschätzbarem Wert. Dank des Troxler-Archivs wird Luzern zu einem Hot Spot der Jazzforschung.»
Öffentliche Veranstaltung zur Übergabe des Troxler-Archivs
Freitag, 23. September 2011, 19.30 Uhr in der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern
Mit Redebeiträgen von Niklaus Troxler (Begründer des Jazz Festivals Willisau) sowie Meinrad Buholzer, Peter Spring und Johannes Anders (Jazzpublizisten). Moderation: Peter Bürli
(Schweizer Radio DRS 2). Demonstration der Fonoteca-Abhörstation und Ausstellung von Troxler-Plakaten.
Live-Musik von Joe McPhee (Saxofon solo) und dem Trio Pierre Favre (dr), Hämi Hämmerli (b), Peter Schärli (tp).
Website: htt://www.hslu.ch/troxler-archiv "
Quelle: Hochschule Luzern, Medienmitteilung
Hinweis via Archivbib!
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 20:44 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Organic archive from OSSIGENO on Vimeo.
An experimental video clip directed by Polish artist Przemek Skrzypek.Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 20:36 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Für das Jahr 2012 hat das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen einen Wandkalender mit historischen Luftbildern aus seinen Beständen erstellt. Die Schwarzweißfotos stammen aus den Jahren 1925 bis 1934. Sie zeigen Städte, Landschaften, Industrieanlagen, Verkehrsbauten und Sehenswürdigkeiten. Die Motive decken das gesamte Gebiet des heutigen Landes Nordrhein-Westfalen ab.
Köln, Dom und Domhof (1928/1931) ● Duisburg, Ruhrorter Häfen (1934) ● Lüdinghausen, Burg Vischering (1933) ●Düsseldorf, Rheinfront (1926) ● Henrichenburg, Schiffshebewerk (1925) ● Detmold, Kaiser-Wilhelm-Platz (1933) ●Solingen/Remscheid, Müngstener Brücke (1933) ● Dortmund, Westfalenhalle (1932) ● Wuppertal, Schwebebahn 1928) ● Königswinter/Bad Honnef, Drachenfels (1933) ● Minden, Marktplatz und Dom (1931) ●Möhnesee, Möhnetalsperre (1930)
Von Königswinter bis Minden: Historische Luftbilder aus dem Landesarchiv NRW. Hrsg. v. Landesarchiv NRW. Düsseldorf 2011 (= Veröffentlichungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen 39). ISBN 978-3-9805419-8-5. Format: 420 (B) x 297 (H) mm (A 3 quer), Spiralbindung, Schutzfolie vor dem Titelblatt, Verkaufspreis: 10,00 €.
Die Publikation kann über das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen (Mauerstraße. 55, 40476 Düsseldorf, Mail: rheinland@lav.nrw.de) und über den Buchhandel bezogen werden."
Landesarchiv NRW, Aktuelles, 20.09.2011
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 20:33 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
um vierten mal öffnete die KfW Niederlassung in Berlin ihre Pforten für Besucher. Dort bestand die Möglichkeit das über hundert Jahre alte Gebäude zu besichtigen und sich näher mit den Aufgaben der KfW zu beschäftigen.
Weitere Informationen zum Historischen Konzernarchiv der KfW unter: Link
Gebäudefotos finden Sie unter: Link
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 20:29 - Rubrik: Wirtschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
".... Als Kulturreferent ist Wolfgang Suttner heute auch für das gerade erst eröffnete Kreisarchiv ... verantwortlich..... Aber auch das ist eigentlich kein Grund, um unglücklich zu sein. ."
Quelle: derwesten.de, 27.9.2011
Quelle: derwesten.de, 27.9.2011
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 20:22 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Heute ist sie Chef-Archivarin bei der Weltbank in Washington, wo sie ein Team von mehr als 70 Menschen leitet . Die Fondazione Luigi Einaudi war für sie "ein außergewöhnliches Praktikum", an das sie sich noch mit großer Zuneigung erinnert .
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 20:16 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
2003 enthielt mein vielgelesener Beitrag "Urheberrecht im WWW" auch eine kleine Sektion von Online-Beiträgen zur spezifisch archivischen Problematik:
http://archiv.twoday.net/stories/36386/
Es ist nun an der Zeit, den Versuch zu unternehmen, die mir bekannt gewordenen - sehr zerstreuten - Beiträge zum Thema "Archive und Urheberrecht" (schwerpunktmäßig solche mit Online-Nachweisen bzw. -Informationen, soweit vorhanden) zusammenzustellen. Ergänzend sind in diesem Weblog viele Beiträge veröffentlicht worden, die ebenfalls Beachtung verdienen.
Ergänzend:
http://www.archivschule.de/service/bibliographien/fachbibliographie-archivrecht-t-2.html (bis 2006)
http://www.archivschule.de/service/bibliographien/bibliographie-zum-archivwesen-1998-ff.html (ohne Online-Nachweise!)
***
IA = Internet Archive
Reinhard Heydenreuter: Urheberrecht und Archivwesen. In: Der Archivar 41 (1988), Sp. 397-408
Klaus Graf: Zur archivischen Problematik von Prüfungsunterlagen, 1989
Online:
http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=4165
4. Die urheberrechtliche Problematik der Prüfungsarbeiten (S. 21-44: 4.1 Die Veröffentlichung von Prüfungsarbeiten über ihre Einstellung in eine öffentliche Bibliothek oder ein Archiv; 4.2 Exkurs: Urheberpersönlichkeitsrecht und archivische Praxis)
Reinhard Heydenreuter: Urheberrechtliche Probleme bei Reproduktionen im Archivbereich. In: Archive und Gesellschaft. Referate des 66. Deutschen Archivtags (Der Archivar, Beiband 1), Siegburg 1996, S. 251-262
Martha Caspers: Fotorecht - Die Nutzung von Fotografien unter rechtlichen Aspekten. In: Archivpflege in Westfalen und Lippe 47 (1998), S. 4-12
Online:
https://www.lwl.org/waa-download/archivpflege1_49/Heft_47_1998.pdf
Reinhard Heydenreuter: Das Urheberrecht im Archiv und das Recht am Bild. In: Forum Heimatforschung. Ziele-Wege-Ergebnisse 4 (1999), S. 21-35
Auszug (?) online:
heimat-bayern.de, Version von 2007 archiviert im IA
Thomas Hoeren: Online-Recht für Archive. (Protokoll von Lorenz Beck, Referendar am Staatsarchiv Münster) [Workshop Die Rolle der Archive in Online-Informationssystemen], 1999
Online:
archive.nrw.de, Version von 2001 archiviert im IA
Abschnitt 1: Urheberrecht
Gabriele Lutterbeck: Archive und die Probleme mit dem Copyright, [1999?]
Online:
www.fes.de, Version von 2002 archiviert im IA
Ob identisch mit dem Aufsatz gleichen Titels in: VdA – Mitteilungen der Fachgruppe 6 – Nr. 24/1. August 1999, S. 29-38 ?
Gerhard Pfennig: Archive und Urheberrecht. In: Archiv-Nachrichten Niedersachsen 6 (2002), S. 42-52
Online:
internet.hannover-stadt.de, Version von 2007 archiviert im IA
Rainer Polley: Rechtsfragen bei der Präsentation und Benutzung digitaler Publikationen im archivischen Kontext. In: Archivpflege in Westfalen-Lippe 63 (2005), S. 33-39
Online:
http://www.lwl.org/waa-download/archivpflege/heft63/seite033_039_polley.pdf
Ulrich Stenzel: Urheberrechte bei der Nutzung von Fotografien im Archiv. In: Mitteilungen VKA (2005), S. 16-19
[waren online, aber keine Version im IA]
Harald Müller: Rechtsfragen rund um’ s archivierte Bild. In: Unsere Archive. Mitteilungen aus den rheinland-pfälzischen und saarländischen Archiven 51 (April 2006), S. 33-38
Online:
http://www.landeshauptarchiv.de/fileadmin/download/archivePDF/Heft-51.pdf
Stellungnahme:
http://archiv.twoday.net/stories/3203578/#3268982
Kai Naumann: Verbreitung von Bildern aus öffentlich-rechtlichen Archiven. Transferarbeit Marburg [2006?]
Online:
http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/44478/TransfA_Bildverbreitung.pdf
Stellungnahmen dazu:
http://archiv.twoday.net/stories/2102658/
Hanns-Peter Frentz: Fotorecht im Archiv. Rechtsfragen bei Erwerb, Publikation und Weitergabe von Fotografien, In: Digitale Bilder und Filme im Archiv. Marketing und Vermarktung. Vorträge des 66. Südwestdeutschen Archivtags am 24. Juni 2006 in Karlsruhe-Durlach. Hrsg. von Michael Wettengel. Stuttgart 2007, S. 49-66
Online:
http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/44325/SWA66-Fotorecht%20im%20Archiv-Frentz.pdf
Rezension des Bandes:
http://archiv.twoday.net/stories/3673392/
Im Schatten der Verwertungsinteressen. Filmarchive, Filmmuseen und das Urheberrecht. Hrsg. von Paul Klimpel. Berlin 2007
Materialien der Tagung mit einschlägigen Beiträgen sind online:
https://www.kinematheksverbund.de/Symp2007-09-13/symp2007-09-13.html
Mark Steinert: Urheber- und andere Schutzrechte an Bildern im Archiv. In: Archivpflege in Westfalen-Lippe 67 (2007), S. 54-57
Online:
http://www.lwl.org/waa-download/archivpflege/heft67/Seiten54-57_Steinert.pdf
Stefan Dusil: Zwischen Benutzung und Nutzungssperre. Zum urheberrechtlichen Schutz von archivierten Fotografien. In: Archivar 61 (2008), S. 124-132
http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2008/ausgabe2/ARCHIVAR-02-2008_Internet.pdf
Zwischen technischem Können und rechtlichem Dürfen. Hrsg. von Paul Klimpel. Berlin 2008
Materialien der Tagung mit einschlägigen Beiträgen sind online:
https://www.kinematheksverbund.de/Symp2008-09-11/symp2008-09-11.html
Klaus Graf: Urheberrechtsfibel – nicht nur für Piraten. Der Text des deutschen Urheberrechtsgesetzes, erklärt und kritisch kommentiert (PiratK-UrhG). Berlin 2009
Online unter CC-BY-SA 3.0:
http://ebooks.contumax.de/02-urheberrechtsfibel.pdf
oder
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-63164
Paul Klimpel: Das Urheberrecht verursacht Depressionen. In: Museumskunde 74 (2009), S. 7-15
Online:
http://www.irights.info/?q=node/854
Klaus Graf: Die Public Domain und die Archive. In: Archive im digitalen Zeitalter. Überlieferung - Erschließung - Präsentation. 79. Deutscher Archivtag in Regensburg (= Tagungsdokumentationen zum Deutschen Archivtag 14). Fulda 2010, S. 177-185
Online:
http://archiv.twoday.net/stories/6164988/
Mark Steinert: Archiv-Bilder. 32 Fragen zum Urheberrecht In: Archive in Thüringen. Tagungsband 2010, S. 37-42
Online:
http://www.homepage-nico-thom.de/Archive_in_Thueringen.pdf
Mark Steinert: Das Problem des Urheberrechts an Bildern im Archiv. In: Brandenburgische Archive 27 (2010), S. 71-75
Online:
http://www.landeshauptarchiv-brandenburg.de/FilePool/BA_27_2010.pdf
Urheberrecht und Archive. 4. Arbeitsgespräch der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns zusammen mit dem Arbeitskreis „Stadtarchive“ beim Bayerischen Städtetag am 19. April 2010 in München. In. Archive in Bayern 6 (2010). Darin:
Nadine Klass: Die Grundlagen des Urheberrechts und des Rechts am eigenen Bild, S. 311-352
Hans-Joachim Hecker: Urheberrechtlich geschützte Werke in Archiven und unbekannte Nutzungsarten, S. 353-360
Rainer Polley: Archiv- und urheberrechtliche Aspekte der Anfertigung von Reproduktionen und der Digitalisierung S. 361-392
Knappe Zusammenfassung der Tagung online:
http://www.gda.bayern.de/publikationen/nachrichten/pdf/heft_58.pdf
Urheberrechte in Museen und Archiven. Hrsg. von Winfried Bullinger/Markus Bretzel/Jörg Schmalfuß. Mit Beiträgen von Dr. Katharina Garbers-von Boehm, LL.M., Sabine Mußotter, LL.M., Prof. Dr. Winfried Bullinger, Dr. Ole Jani. Baden-Baden 2010
Besprechung von Klaus Graf im Archivar 64 (2011), S. 241f. Online:
http://archiv.twoday.net/stories/19443003/
http://archiv.twoday.net/stories/36386/
Es ist nun an der Zeit, den Versuch zu unternehmen, die mir bekannt gewordenen - sehr zerstreuten - Beiträge zum Thema "Archive und Urheberrecht" (schwerpunktmäßig solche mit Online-Nachweisen bzw. -Informationen, soweit vorhanden) zusammenzustellen. Ergänzend sind in diesem Weblog viele Beiträge veröffentlicht worden, die ebenfalls Beachtung verdienen.
Ergänzend:
http://www.archivschule.de/service/bibliographien/fachbibliographie-archivrecht-t-2.html (bis 2006)
http://www.archivschule.de/service/bibliographien/bibliographie-zum-archivwesen-1998-ff.html (ohne Online-Nachweise!)
***
IA = Internet Archive
Reinhard Heydenreuter: Urheberrecht und Archivwesen. In: Der Archivar 41 (1988), Sp. 397-408
Klaus Graf: Zur archivischen Problematik von Prüfungsunterlagen, 1989
Online:
http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=4165
4. Die urheberrechtliche Problematik der Prüfungsarbeiten (S. 21-44: 4.1 Die Veröffentlichung von Prüfungsarbeiten über ihre Einstellung in eine öffentliche Bibliothek oder ein Archiv; 4.2 Exkurs: Urheberpersönlichkeitsrecht und archivische Praxis)
Reinhard Heydenreuter: Urheberrechtliche Probleme bei Reproduktionen im Archivbereich. In: Archive und Gesellschaft. Referate des 66. Deutschen Archivtags (Der Archivar, Beiband 1), Siegburg 1996, S. 251-262
Martha Caspers: Fotorecht - Die Nutzung von Fotografien unter rechtlichen Aspekten. In: Archivpflege in Westfalen und Lippe 47 (1998), S. 4-12
Online:
https://www.lwl.org/waa-download/archivpflege1_49/Heft_47_1998.pdf
Reinhard Heydenreuter: Das Urheberrecht im Archiv und das Recht am Bild. In: Forum Heimatforschung. Ziele-Wege-Ergebnisse 4 (1999), S. 21-35
Auszug (?) online:
heimat-bayern.de, Version von 2007 archiviert im IA
Thomas Hoeren: Online-Recht für Archive. (Protokoll von Lorenz Beck, Referendar am Staatsarchiv Münster) [Workshop Die Rolle der Archive in Online-Informationssystemen], 1999
Online:
archive.nrw.de, Version von 2001 archiviert im IA
Abschnitt 1: Urheberrecht
Gabriele Lutterbeck: Archive und die Probleme mit dem Copyright, [1999?]
Online:
www.fes.de, Version von 2002 archiviert im IA
Ob identisch mit dem Aufsatz gleichen Titels in: VdA – Mitteilungen der Fachgruppe 6 – Nr. 24/1. August 1999, S. 29-38 ?
Gerhard Pfennig: Archive und Urheberrecht. In: Archiv-Nachrichten Niedersachsen 6 (2002), S. 42-52
Online:
internet.hannover-stadt.de, Version von 2007 archiviert im IA
Rainer Polley: Rechtsfragen bei der Präsentation und Benutzung digitaler Publikationen im archivischen Kontext. In: Archivpflege in Westfalen-Lippe 63 (2005), S. 33-39
Online:
http://www.lwl.org/waa-download/archivpflege/heft63/seite033_039_polley.pdf
Ulrich Stenzel: Urheberrechte bei der Nutzung von Fotografien im Archiv. In: Mitteilungen VKA (2005), S. 16-19
[waren online, aber keine Version im IA]
Harald Müller: Rechtsfragen rund um’ s archivierte Bild. In: Unsere Archive. Mitteilungen aus den rheinland-pfälzischen und saarländischen Archiven 51 (April 2006), S. 33-38
Online:
http://www.landeshauptarchiv.de/fileadmin/download/archivePDF/Heft-51.pdf
Stellungnahme:
http://archiv.twoday.net/stories/3203578/#3268982
Kai Naumann: Verbreitung von Bildern aus öffentlich-rechtlichen Archiven. Transferarbeit Marburg [2006?]
Online:
http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/44478/TransfA_Bildverbreitung.pdf
Stellungnahmen dazu:
http://archiv.twoday.net/stories/2102658/
Hanns-Peter Frentz: Fotorecht im Archiv. Rechtsfragen bei Erwerb, Publikation und Weitergabe von Fotografien, In: Digitale Bilder und Filme im Archiv. Marketing und Vermarktung. Vorträge des 66. Südwestdeutschen Archivtags am 24. Juni 2006 in Karlsruhe-Durlach. Hrsg. von Michael Wettengel. Stuttgart 2007, S. 49-66
Online:
http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/44325/SWA66-Fotorecht%20im%20Archiv-Frentz.pdf
Rezension des Bandes:
http://archiv.twoday.net/stories/3673392/
Im Schatten der Verwertungsinteressen. Filmarchive, Filmmuseen und das Urheberrecht. Hrsg. von Paul Klimpel. Berlin 2007
Materialien der Tagung mit einschlägigen Beiträgen sind online:
https://www.kinematheksverbund.de/Symp2007-09-13/symp2007-09-13.html
Mark Steinert: Urheber- und andere Schutzrechte an Bildern im Archiv. In: Archivpflege in Westfalen-Lippe 67 (2007), S. 54-57
Online:
http://www.lwl.org/waa-download/archivpflege/heft67/Seiten54-57_Steinert.pdf
Stefan Dusil: Zwischen Benutzung und Nutzungssperre. Zum urheberrechtlichen Schutz von archivierten Fotografien. In: Archivar 61 (2008), S. 124-132
http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2008/ausgabe2/ARCHIVAR-02-2008_Internet.pdf
Zwischen technischem Können und rechtlichem Dürfen. Hrsg. von Paul Klimpel. Berlin 2008
Materialien der Tagung mit einschlägigen Beiträgen sind online:
https://www.kinematheksverbund.de/Symp2008-09-11/symp2008-09-11.html
Klaus Graf: Urheberrechtsfibel – nicht nur für Piraten. Der Text des deutschen Urheberrechtsgesetzes, erklärt und kritisch kommentiert (PiratK-UrhG). Berlin 2009
Online unter CC-BY-SA 3.0:
http://ebooks.contumax.de/02-urheberrechtsfibel.pdf
oder
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-63164
Paul Klimpel: Das Urheberrecht verursacht Depressionen. In: Museumskunde 74 (2009), S. 7-15
Online:
http://www.irights.info/?q=node/854
Klaus Graf: Die Public Domain und die Archive. In: Archive im digitalen Zeitalter. Überlieferung - Erschließung - Präsentation. 79. Deutscher Archivtag in Regensburg (= Tagungsdokumentationen zum Deutschen Archivtag 14). Fulda 2010, S. 177-185
Online:
http://archiv.twoday.net/stories/6164988/
Mark Steinert: Archiv-Bilder. 32 Fragen zum Urheberrecht In: Archive in Thüringen. Tagungsband 2010, S. 37-42
Online:
http://www.homepage-nico-thom.de/Archive_in_Thueringen.pdf
Mark Steinert: Das Problem des Urheberrechts an Bildern im Archiv. In: Brandenburgische Archive 27 (2010), S. 71-75
Online:
http://www.landeshauptarchiv-brandenburg.de/FilePool/BA_27_2010.pdf
Urheberrecht und Archive. 4. Arbeitsgespräch der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns zusammen mit dem Arbeitskreis „Stadtarchive“ beim Bayerischen Städtetag am 19. April 2010 in München. In. Archive in Bayern 6 (2010). Darin:
Nadine Klass: Die Grundlagen des Urheberrechts und des Rechts am eigenen Bild, S. 311-352
Hans-Joachim Hecker: Urheberrechtlich geschützte Werke in Archiven und unbekannte Nutzungsarten, S. 353-360
Rainer Polley: Archiv- und urheberrechtliche Aspekte der Anfertigung von Reproduktionen und der Digitalisierung S. 361-392
Knappe Zusammenfassung der Tagung online:
http://www.gda.bayern.de/publikationen/nachrichten/pdf/heft_58.pdf
Urheberrechte in Museen und Archiven. Hrsg. von Winfried Bullinger/Markus Bretzel/Jörg Schmalfuß. Mit Beiträgen von Dr. Katharina Garbers-von Boehm, LL.M., Sabine Mußotter, LL.M., Prof. Dr. Winfried Bullinger, Dr. Ole Jani. Baden-Baden 2010
Besprechung von Klaus Graf im Archivar 64 (2011), S. 241f. Online:
http://archiv.twoday.net/stories/19443003/
KlausGraf - am Dienstag, 27. September 2011, 18:59 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Wie die Verwaltung mitteilt, könnten die Architekten, deren Entwurf realisiert werden soll, derzeit nicht beauftragt werden. Grund sei eine Beschwerde eines anderen Architekten bei der Vergabekammer der Bezirksregierung. Die Stadt schätzt, dass sich der Start nun um sechs bis acht Wochen verzögern könnte - im ungünstigsten Falle drohe sogar ein Gerichtsverfahren, das noch mehr Zeit in Anspruch nehme. ...."
Quelle: WDR Text, S. 768, 27.9.11
Wäre interessant zu erfahren, wer sich beschwert hat und warum genau?
Quelle: WDR Text, S. 768, 27.9.11
Wäre interessant zu erfahren, wer sich beschwert hat und warum genau?
Wolf Thomas - am Dienstag, 27. September 2011, 17:29 - Rubrik: Kommunalarchive
Vortragsfolien (Tag der Landesgeschichte, Bremen, 24.9.2011):
http://www.slideshare.net/StadtASpeyer/das-dfgpilotprojekt-virtuelles-deutsches-urkundennetzwerk
http://www.slideshare.net/StadtASpeyer/das-dfgpilotprojekt-virtuelles-deutsches-urkundennetzwerk
J. Kemper - am Dienstag, 27. September 2011, 11:08 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Mit der Unterzeichnung einer "Vereinbarung zur gegenseitigen Unterstützung in Notfällen" haben sich elf Partner zum Schutz von Dresdner Archiven, Bibliotheken und Museen zu einem "Notfallverbund Dresden" zusammengeschlossen. Am 23. September 2011 stellte sich dieser Notfallverbund auf der Landespressekonferenz im Sächsischen Landtag vor.
Hier die Meldung auf dem Blog der SLUB:
http://blog.slub-dresden.de/beitrag/2011/09/22/vereint-aktiv-dresdner-notfallverbund-zum-kulturgutschutz-gegruendet/
Hier die PM des Sächsischen Landtages:
http://www.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/Ueber_uns/Bestandserhaltung/Webseite/Webseite_PM079-11__2_.pdf
Weitere Infos auf der SLUB-Homepage:
http://www.slub-dresden.de/ueber-uns/bestandserhaltung/notfallverbund-dresden/
Hier die Meldung auf dem Blog der SLUB:
http://blog.slub-dresden.de/beitrag/2011/09/22/vereint-aktiv-dresdner-notfallverbund-zum-kulturgutschutz-gegruendet/
Hier die PM des Sächsischen Landtages:
http://www.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/Ueber_uns/Bestandserhaltung/Webseite/Webseite_PM079-11__2_.pdf
Weitere Infos auf der SLUB-Homepage:
http://www.slub-dresden.de/ueber-uns/bestandserhaltung/notfallverbund-dresden/
ingobobingo - am Dienstag, 27. September 2011, 10:10 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Johann Baumgarts Bearbeitung der Chronik des sog. Konrad Bote ist in der Ausgabe Wittenberg 1588 online
http://bsb-mdz12-spiegel.bsb.lrz.de/~db/bsb00064414/image_1
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00064414/image_1
Was ist das nur für ein Schwachsinn, dem permanten Link, den man nun gnädigerweise mit rechter Maustaste kopieren darf, eine nicht permanente URL zu unterlegen!
Von der Ausgabe 1589 gibt es einen Reprint von 2007:
 Reprint
Reprint
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00064414/image_1
Was ist das nur für ein Schwachsinn, dem permanten Link, den man nun gnädigerweise mit rechter Maustaste kopieren darf, eine nicht permanente URL zu unterlegen!
Von der Ausgabe 1589 gibt es einen Reprint von 2007:
 Reprint
ReprintKlausGraf - am Dienstag, 27. September 2011, 02:48 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Man kann wirklich innerhalb von 5 Minuten ein Blog aufsetzen:
http://archivalia.tumblr.com/
Bei URL gibt man den Namen ein, der vor .tumblr.com stehen soll. Bisher noch nicht geschafft habe ich die Weiterleitung der Archivalia English-Corner-RSS-Feeds an das neue (Test-)Blog, das englischsprachige Beiträge aufnehmen soll.
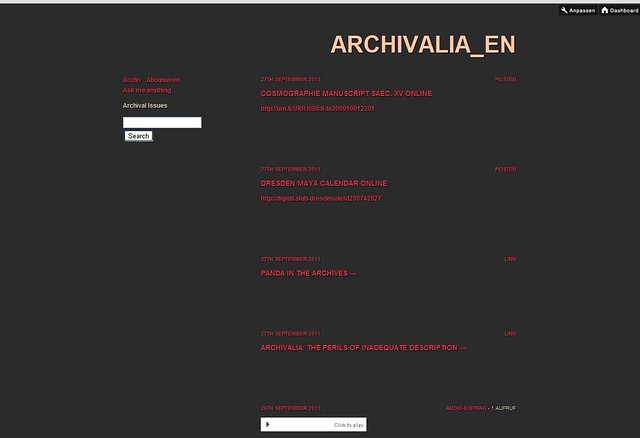
http://archivalia.tumblr.com/
Bei URL gibt man den Namen ein, der vor .tumblr.com stehen soll. Bisher noch nicht geschafft habe ich die Weiterleitung der Archivalia English-Corner-RSS-Feeds an das neue (Test-)Blog, das englischsprachige Beiträge aufnehmen soll.
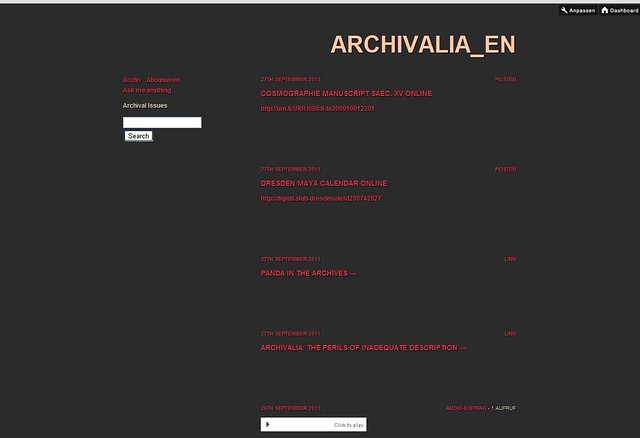
http://digital.slub-dresden.de/id280742827
Dazu: http://www.mdr.de/nachrichten/maya104_zc-e9a9d57e_zs-6c4417e7.html
Die Schrift ist nach Einschätzung der Bibliothek eine der bedeutendsten Zeugnisse vorspanischer Zeit in Amerika. Sie besteht aus 39 Blättern aus Feigenbaumrinde, die zusammen 3,50 Meter Länge erreichen. Der Codex zeigt Hieroglyphen, Bilder und Symbole, mit denen Maya-Priester ihr Wissen über Krankheiten, Erntezeiten, religiöse Handlungen, Opferungen und Astronomie der Nachwelt erhielten. Der Kalenderteil konnte Ende des 19. Jahrhunderts von dem Dresdner Bibliothekar Ernst Wilhelm Förstemann entschlüsselt werden. Bürger sagte, es gebe noch Maya-Aufzeichnungen in Madrid, Paris und Mexiko-Stadt. Allerdings enthalte nur das Dresdner Dokument einen Kalender und ein Apokalypse-Bild, auf dem eine Art Sintflut begleitet von mythischen Drachengestalten zu sehen ist.
4.000 Interessierte kommen jährlich nur wegen der Maya-Schrift
Im Jahr 1739 gelangte das Werk nach Sachsens. Damals erwarb der kurfürstlich-sächsische Hofkaplan und Bibliothekar Johann Christian Götze den Codex für die Dresdner Bibliothek aus dem Besitz eines Privatmannes in Wien, erst im 19. Jahrhundert wurde er als Handschrift der Maya erkannt. Das Original darf aus konservatorischen Gründ nicht berührt, bewegt oder transportiert werden. Es befindet sich in einem temperierten Glaskasten in der Schatzkammer der Staatsbibliothek und kann dort besichtigt werden.

Dazu: http://www.mdr.de/nachrichten/maya104_zc-e9a9d57e_zs-6c4417e7.html
Die Schrift ist nach Einschätzung der Bibliothek eine der bedeutendsten Zeugnisse vorspanischer Zeit in Amerika. Sie besteht aus 39 Blättern aus Feigenbaumrinde, die zusammen 3,50 Meter Länge erreichen. Der Codex zeigt Hieroglyphen, Bilder und Symbole, mit denen Maya-Priester ihr Wissen über Krankheiten, Erntezeiten, religiöse Handlungen, Opferungen und Astronomie der Nachwelt erhielten. Der Kalenderteil konnte Ende des 19. Jahrhunderts von dem Dresdner Bibliothekar Ernst Wilhelm Förstemann entschlüsselt werden. Bürger sagte, es gebe noch Maya-Aufzeichnungen in Madrid, Paris und Mexiko-Stadt. Allerdings enthalte nur das Dresdner Dokument einen Kalender und ein Apokalypse-Bild, auf dem eine Art Sintflut begleitet von mythischen Drachengestalten zu sehen ist.
4.000 Interessierte kommen jährlich nur wegen der Maya-Schrift
Im Jahr 1739 gelangte das Werk nach Sachsens. Damals erwarb der kurfürstlich-sächsische Hofkaplan und Bibliothekar Johann Christian Götze den Codex für die Dresdner Bibliothek aus dem Besitz eines Privatmannes in Wien, erst im 19. Jahrhundert wurde er als Handschrift der Maya erkannt. Das Original darf aus konservatorischen Gründ nicht berührt, bewegt oder transportiert werden. Es befindet sich in einem temperierten Glaskasten in der Schatzkammer der Staatsbibliothek und kann dort besichtigt werden.

KlausGraf - am Montag, 26. September 2011, 21:47 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://opac.hebib.de
Ohne Altbestand.
Update:
https://plus.google.com/117546351384071338747/posts/Upy9cMGuntV
Ohne Altbestand.
Update:
https://plus.google.com/117546351384071338747/posts/Upy9cMGuntV
KlausGraf - am Montag, 26. September 2011, 21:08 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Institutionelle Repositorien sind auch deshalb ein IRrweg, weil Wissenschaftler eine gute Volltextsuche unabhängig von Google benötigen. Diese ist erheblich einfacher in einem disziplinären Repositorium zu realisieren.
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=irrweg+repos
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/search?q=irrweg+repos
KlausGraf - am Montag, 26. September 2011, 19:28 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 26. September 2011, 19:18 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Und nicht nur die:
http://www.heise.de/newsticker/foren/S-Drogenbeauftragte-560-000-Internetsuechtige-in-Deutschland/forum-210385/list/
https://plus.google.com/u/0/s/internetsucht

http://www.heise.de/newsticker/foren/S-Drogenbeauftragte-560-000-Internetsuechtige-in-Deutschland/forum-210385/list/
https://plus.google.com/u/0/s/internetsucht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
David W. Lewis wendet das Modell von Christensen auf Open Access an und kommt zu dem Schluss, dass demnach 2021 50 % der Zeitschriftenartikel Open Access sein werden und 2025 mehr als 90 %.
Schön wärs.
http://crl.acrl.org/content/early/2011/09/21/crl-299.full.pdf+html
Schön wärs.
http://crl.acrl.org/content/early/2011/09/21/crl-299.full.pdf+html
KlausGraf - am Montag, 26. September 2011, 18:45 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Weltkirchenrat hat am Freitag die erste kostenlose Internetbibliothek für Theologie und Ökumene eröffnet. Jeder Interessierte hat Zugang zu den über 200.000 Texten, Büchern, Zeitschriften und akademischen Publikationen aus verschiedenen Ländern.
http://log.netbib.de/archives/2011/09/26/global-digital-library-on-theology-and-ecumenism/
Die Digitale Bibliothek http://www.globethics.net/gtl ist
- nur nach umfangreicher Registrierung zugänglich, auch die genuinen OA-Bestandteile
- endlosen Terms of use muss zugestimmt werden
- es gibt keine zitierfähigen Internetadressen für die Inhalte (die Identifier z.B. GALE-186270960 können offenbar nur für die Suche verwendet werden, es gibt keinen Resolver)
- bei den von GALE bereitgestellten Inhalten sind teilweise die Metadaten nicht ausreichend (aber auch bei anderen z.B. Identifier 0044-2674 = Zeitschrift für Evangelische Ethik 1972, komplett)
Die meisten Inhalte sind einfach aus OA-Repositorien zusammengesuchte Metadaten. Das Auswahlkriterium bleibt rätselhaft. Aus meinen in Freidok befindlichen Beiträgen wurden 3 ausgewählt.
http://log.netbib.de/archives/2011/09/26/global-digital-library-on-theology-and-ecumenism/
Die Digitale Bibliothek http://www.globethics.net/gtl ist
- nur nach umfangreicher Registrierung zugänglich, auch die genuinen OA-Bestandteile
- endlosen Terms of use muss zugestimmt werden
- es gibt keine zitierfähigen Internetadressen für die Inhalte (die Identifier z.B. GALE-186270960 können offenbar nur für die Suche verwendet werden, es gibt keinen Resolver)
- bei den von GALE bereitgestellten Inhalten sind teilweise die Metadaten nicht ausreichend (aber auch bei anderen z.B. Identifier 0044-2674 = Zeitschrift für Evangelische Ethik 1972, komplett)
Die meisten Inhalte sind einfach aus OA-Repositorien zusammengesuchte Metadaten. Das Auswahlkriterium bleibt rätselhaft. Aus meinen in Freidok befindlichen Beiträgen wurden 3 ausgewählt.
KlausGraf - am Montag, 26. September 2011, 17:11 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Beobachtungen von J. M. Ockerblom
http://everybodyslibraries.com/2011/09/23/early-journals-from-jstor-and-others/
http://everybodyslibraries.com/2011/09/23/early-journals-from-jstor-and-others/
KlausGraf - am Montag, 26. September 2011, 15:53 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://dss.collections.imj.org.il/
http://googleblog.blogspot.com/2011/09/from-desert-to-web-bringing-dead-sea.html
Update:
http://google-produkt-kompass.blogspot.com/2011/09/aus-der-wuste-ins-internet-die.htm (German)
KlausGraf - am Montag, 26. September 2011, 15:29 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Digitalisierung der beiden wichtigsten Musikhandschriften des Mittelalters ist abgeschlossen. In der Handschriftensammlung der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel werden zwei der bedeutendsten Musikhandschriften des Mittelalters aufbewahrt. Die in der Fachwelt nur mit der Abkürzung W1 und W2 bezeichneten Handschriften überliefern das Repertoire mehrstimmiger Kompositionen, das sich seit dem 12. Jahrhundert an der Kathedrale Notre Dame zu Paris herausgebildet hatte. Diese beiden wichtigsten Musikhandschriften des Mittelalters stehen erstmals frei zugänglich im Netz zur Verfügung: http://www.hab.de/bibliothek/wdb/mssdigital.htm .
W1 (Cod. Guelf. 628 Helmst) und W2 (1099 Helmst.) stellen sowohl einen Brennpunkt der musikwissenschaftlichen Forschung als auch eine Hauptquelle für die historische Aufführungspraxis mittelalterlicher Musik dar. Die Polyphonie, bei der sich im Gegensatz zum einstimmigen gregorianischen Choral, zu einer Unterstimme gleichzeitig eine oder mehrere Oberstimmen in freier melodischer Gestaltung entfalten, markiert einen epochalen Wandel in der europäischen Musikgeschichte. Das Pariser Repertoire ist in nur vier Handschriften weltweit nahezu vollständig enthalten. Die beiden Wolfenbütteler Pergamentkodizes stammen aus dem 13. Jahrhundert und befanden sich im 16. Jahrhundert im Besitz des Reformationshistorikers Matthias Flacius Illyricus. In die Herzog August Bibliothek gelangten sie über die Universitätsbibliothek Helmstedt.
http://idw-online.de/pages/de/news442596
Digitalisate:
http://diglib.hab.de/mss/628-helmst/start.htm
http://diglib.hab.de/mss/1099-helmst/start.htm
W1 (Cod. Guelf. 628 Helmst) und W2 (1099 Helmst.) stellen sowohl einen Brennpunkt der musikwissenschaftlichen Forschung als auch eine Hauptquelle für die historische Aufführungspraxis mittelalterlicher Musik dar. Die Polyphonie, bei der sich im Gegensatz zum einstimmigen gregorianischen Choral, zu einer Unterstimme gleichzeitig eine oder mehrere Oberstimmen in freier melodischer Gestaltung entfalten, markiert einen epochalen Wandel in der europäischen Musikgeschichte. Das Pariser Repertoire ist in nur vier Handschriften weltweit nahezu vollständig enthalten. Die beiden Wolfenbütteler Pergamentkodizes stammen aus dem 13. Jahrhundert und befanden sich im 16. Jahrhundert im Besitz des Reformationshistorikers Matthias Flacius Illyricus. In die Herzog August Bibliothek gelangten sie über die Universitätsbibliothek Helmstedt.
http://idw-online.de/pages/de/news442596
Digitalisate:
http://diglib.hab.de/mss/628-helmst/start.htm
http://diglib.hab.de/mss/1099-helmst/start.htm
KlausGraf - am Montag, 26. September 2011, 15:22 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Archives-L is actually discussing on bizarre archives findings.
"A worker cataloging materials from the Clinton governorship was in the middle of going through nearly 2,000 boxes of archived documents when he stumbled upon the priceless artifact. "He didn't know what it was until he opened the box, because the catalog for the box listed the contents as a plaque. But it made no mention of the moon rock,"
http://lightyears.blogs.cnn.com/2011/09/22/moon-rock-found-among-bill-clintons-stuff/

"A worker cataloging materials from the Clinton governorship was in the middle of going through nearly 2,000 boxes of archived documents when he stumbled upon the priceless artifact. "He didn't know what it was until he opened the box, because the catalog for the box listed the contents as a plaque. But it made no mention of the moon rock,"
http://lightyears.blogs.cnn.com/2011/09/22/moon-rock-found-among-bill-clintons-stuff/

KlausGraf - am Montag, 26. September 2011, 14:12 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Hübsche Illustrationen dokumentiert:
http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/heinrich-von-kleist/kaethchen-von-heilbronn.html
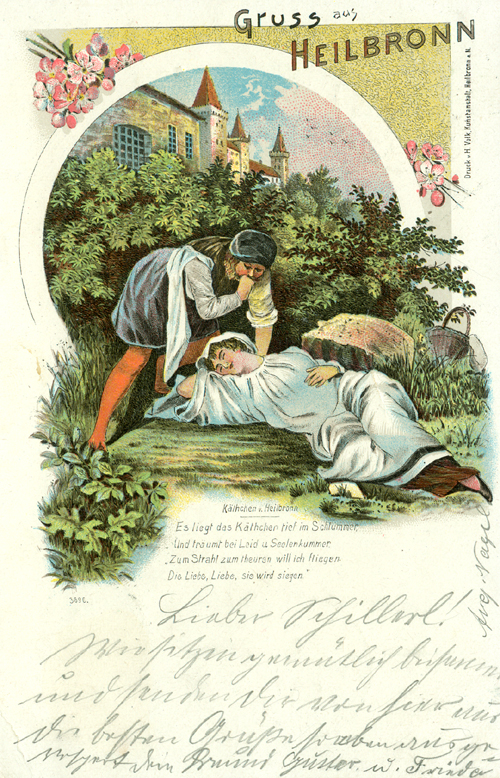
http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/heinrich-von-kleist/kaethchen-von-heilbronn.html
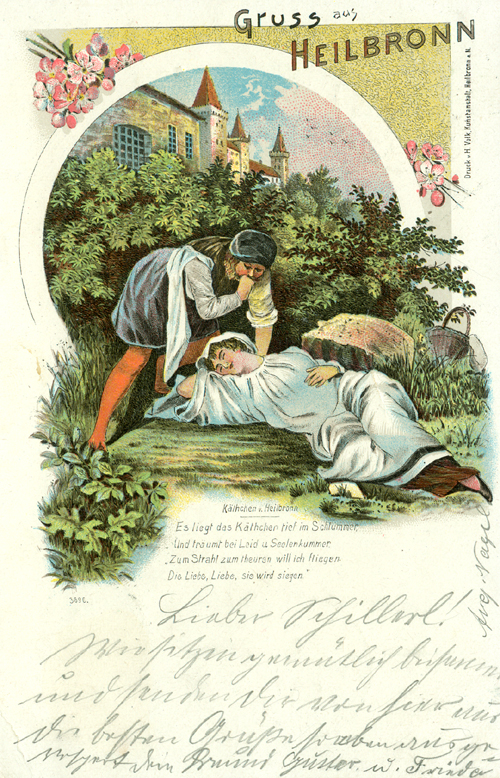
KlausGraf - am Montag, 26. September 2011, 13:38 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
> aus datenschutzrechtlichen Gründen können in Baden-Württemberg
> Informationen zu Kulturdenkmalen nur an Eigentümer, bzw. an von
> Eigentümern bevollmächtigte Institutionen oder Personen gegeben
> werden. Aus diesem Grunde können wir Ihnen keine
> Denkmalverzeichnisse zur Verfügung stellen.
> Diese Vorgehensweise wurde erst kürzlich zwischen dem Landsamt für
> Denkmalpflege und dem Datenschutzbeauftragten des Landes
> Baden-Württemberg besprochen und abgestimmt.
http://archiv.twoday.net/stories/41781612/#41782499
Es heißt im Denkmalschutzgesetz von Baden-Württemberg: Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes sind
Sachen, Sachgesamtheiten und Teile von Sachen,
an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. Es heißt öffentliches, nicht amtliches Interesse. Es ist daher absolut widersinnig, der Allgemeinheit die Kenntnis der Kultudenkmale zu entziehen. Der Denkmalbestand des Landes wird daher zu einer Geheim-Ressource - das darf nicht Schule machen!
§ 14 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes sagt ausdrücklich: Die Einsicht in das Denkmalbuch ist jedermann gestattet, der ein berechtigtes Interesse darlegt. Als berechtigtes Interesse kann von der Verwaltung nicht einfach das Interesse des Eigentümers definiert werden, denn der Gesetzgeber hat anders entschieden. Berechtigtes Interesse ist "ein nach vernünftiger Erwägung durch die Sachlage gerechtfertigtes Interesse tatsächlicher oder rechtlicher Art" (enger: rechtliches Interesse).
Update:
Denkmallisten im Internet:
http://www.denkmalliste.org/denkmallisten.html
Auf offiziellen Websites publizierte Gesamtlisten gibt es in 8 Bundesländern, in Hessen ist sie im Aufbau, in SH fehlt nur Lübeck.
> Informationen zu Kulturdenkmalen nur an Eigentümer, bzw. an von
> Eigentümern bevollmächtigte Institutionen oder Personen gegeben
> werden. Aus diesem Grunde können wir Ihnen keine
> Denkmalverzeichnisse zur Verfügung stellen.
> Diese Vorgehensweise wurde erst kürzlich zwischen dem Landsamt für
> Denkmalpflege und dem Datenschutzbeauftragten des Landes
> Baden-Württemberg besprochen und abgestimmt.
http://archiv.twoday.net/stories/41781612/#41782499
Es heißt im Denkmalschutzgesetz von Baden-Württemberg: Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes sind
Sachen, Sachgesamtheiten und Teile von Sachen,
an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. Es heißt öffentliches, nicht amtliches Interesse. Es ist daher absolut widersinnig, der Allgemeinheit die Kenntnis der Kultudenkmale zu entziehen. Der Denkmalbestand des Landes wird daher zu einer Geheim-Ressource - das darf nicht Schule machen!
§ 14 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes sagt ausdrücklich: Die Einsicht in das Denkmalbuch ist jedermann gestattet, der ein berechtigtes Interesse darlegt. Als berechtigtes Interesse kann von der Verwaltung nicht einfach das Interesse des Eigentümers definiert werden, denn der Gesetzgeber hat anders entschieden. Berechtigtes Interesse ist "ein nach vernünftiger Erwägung durch die Sachlage gerechtfertigtes Interesse tatsächlicher oder rechtlicher Art" (enger: rechtliches Interesse).
Update:
Denkmallisten im Internet:
http://www.denkmalliste.org/denkmallisten.html
Auf offiziellen Websites publizierte Gesamtlisten gibt es in 8 Bundesländern, in Hessen ist sie im Aufbau, in SH fehlt nur Lübeck.
KlausGraf - am Montag, 26. September 2011, 13:21 - Rubrik: Archivrecht
http://www.ilds2011.org/index.php?show=papers
http://blogs.library.duke.edu/scholcomm/2011/06/09/a-second-front/
http://blogs.library.duke.edu/scholcomm/2011/06/09/a-second-front/
KlausGraf - am Montag, 26. September 2011, 13:11 - Rubrik: Open Access
Einladung zur Präsentation der Neuerscheinung „Bewegte Bilder – starres Recht?“ am 6. Oktober um 18:00 Uhr in die Deutsche Kinemathek.
Gesetze haben großen Einfluss auf unsere kollektive Erinnerung an das audiovisuelle Erbe. Experten, Juristen und Praktiker aus Archiven geben einen Überblick zu den Auswirkungen rechtlicher Bestimmungen auf den Umgang mit dem filmischen Archivgut.
Die Publikation knüpft damit an den Diskurs über die rechtlichen Rahmenbedingungen des Filmerbes an, der in den letzten Jahren gerade in der Deutschen Kinemathek geführt wurde.
Der Verwaltungsdirektor der Deutschen Kinemathek, Dr. Paul Klimpel, präsentiert als Herausgeber das Buch und diskutiert das Thema mit angesehenen Experten.
Deutsche Kinemathek
Veranstaltungsraum, 4.OG
Potsdamer Straße 2
10785 Berlin
Weitere Informationen zum Buch finden Sie im PDF.
Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Gesetze haben großen Einfluss auf unsere kollektive Erinnerung an das audiovisuelle Erbe. Experten, Juristen und Praktiker aus Archiven geben einen Überblick zu den Auswirkungen rechtlicher Bestimmungen auf den Umgang mit dem filmischen Archivgut.
Die Publikation knüpft damit an den Diskurs über die rechtlichen Rahmenbedingungen des Filmerbes an, der in den letzten Jahren gerade in der Deutschen Kinemathek geführt wurde.
Der Verwaltungsdirektor der Deutschen Kinemathek, Dr. Paul Klimpel, präsentiert als Herausgeber das Buch und diskutiert das Thema mit angesehenen Experten.
Deutsche Kinemathek
Veranstaltungsraum, 4.OG
Potsdamer Straße 2
10785 Berlin
Weitere Informationen zum Buch finden Sie im PDF.
Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
symposium_recht_sdk - am Montag, 26. September 2011, 12:20 - Rubrik: Filmarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bob Peckham hat Handschriftendigitalisate zusammengestellt:
http://www.utm.edu/staff/bobp/vlibrary/chansonnier.shtml

http://www.utm.edu/staff/bobp/vlibrary/chansonnier.shtml

KlausGraf - am Montag, 26. September 2011, 00:09 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Heute war ich in Kamp-Lintfort:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cultural_heritage_monuments_in_Kamp-Lintfort
Die Arbeit mit der Denkmalliste
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Baudenkm%C3%A4ler_in_Kamp-Lintfort
ist unzumutbar. Ich hatte sie mir ausgedruckt, aber bei Ortschaften, bei denen der Denkmalbestand über viele Ortsteile verstreut ist, ist es ein absolutes No-go, dass der Ortsteil nicht angegeben ist. Man kann als Nicht-Ortskundiger nicht systematisch dokumentieren, weil man nicht weiß, wo welche Straße liegt. Und natürlich kann man auch nur bedingt mit dem Navi arbeiten.
Bequem geht sowieso anders. Wieso gibt es als Vorbereitung für einen solchen Wettbewerb nicht flächendeckende Denkmallisten? Wieso kann man sich nicht einen flotten Hochladeserver leisten und die Bilder dann auf Commons verschieben? Denn der Hochladeprozess ist ohne Commonist quälend langsam und nur für Einzelbilder zumutbar. Wieso bekommt man nach Auswahl des Orts nicht eine anklickbare Denkmalliste, aus der dann die Angaben zum Objekt automatisch übernommen werden können?
Noch ein Gedanke. Es geht ja um die Dokumentation des Denkmalbestands und nicht um besonders tolle Objekte. Daher wäre es beim nächsten Mal besser, zusätzlich zur Bewertung der besten Bilder (die Kriterien liegen immer noch nicht vor) sehr viele Preise an alle Teilnehmer zu verlosen, um einen Anreiz auch für diejenigen zu schaffen, die es mit unscheinbaren Denkmälern zu tun haben und keine fantastischen Fotos machen können.
Obwohl der Wettbewerb ein toller Erfolg ist, empfinde ich die Öffentlichkeitsarbeit als verschnarcht. Auf der internationalen Seite gibt es zu wenige und zu langweilige Meldungen, in der deutschsprachigen Seite hat man die Austauschmöglichkeit unter "Erfahrungen" gut versteckt. Ein Projektblog wäre anzustreben.
Von meinen bisjherigen 9 Beiträgen
http://archiv.twoday.net/search?q=wiki+monuments
ist übrigens kein einziger unter "Presse" verlinkt.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cultural_heritage_monuments_in_Kamp-Lintfort
Die Arbeit mit der Denkmalliste
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Baudenkm%C3%A4ler_in_Kamp-Lintfort
ist unzumutbar. Ich hatte sie mir ausgedruckt, aber bei Ortschaften, bei denen der Denkmalbestand über viele Ortsteile verstreut ist, ist es ein absolutes No-go, dass der Ortsteil nicht angegeben ist. Man kann als Nicht-Ortskundiger nicht systematisch dokumentieren, weil man nicht weiß, wo welche Straße liegt. Und natürlich kann man auch nur bedingt mit dem Navi arbeiten.
Bequem geht sowieso anders. Wieso gibt es als Vorbereitung für einen solchen Wettbewerb nicht flächendeckende Denkmallisten? Wieso kann man sich nicht einen flotten Hochladeserver leisten und die Bilder dann auf Commons verschieben? Denn der Hochladeprozess ist ohne Commonist quälend langsam und nur für Einzelbilder zumutbar. Wieso bekommt man nach Auswahl des Orts nicht eine anklickbare Denkmalliste, aus der dann die Angaben zum Objekt automatisch übernommen werden können?
Noch ein Gedanke. Es geht ja um die Dokumentation des Denkmalbestands und nicht um besonders tolle Objekte. Daher wäre es beim nächsten Mal besser, zusätzlich zur Bewertung der besten Bilder (die Kriterien liegen immer noch nicht vor) sehr viele Preise an alle Teilnehmer zu verlosen, um einen Anreiz auch für diejenigen zu schaffen, die es mit unscheinbaren Denkmälern zu tun haben und keine fantastischen Fotos machen können.
Obwohl der Wettbewerb ein toller Erfolg ist, empfinde ich die Öffentlichkeitsarbeit als verschnarcht. Auf der internationalen Seite gibt es zu wenige und zu langweilige Meldungen, in der deutschsprachigen Seite hat man die Austauschmöglichkeit unter "Erfahrungen" gut versteckt. Ein Projektblog wäre anzustreben.
Von meinen bisjherigen 9 Beiträgen
http://archiv.twoday.net/search?q=wiki+monuments
ist übrigens kein einziger unter "Presse" verlinkt.

Interessantes Thema, gut gelegener und organisierter Tagungsort - eigentlich ideale Voraussetzungen für einen guten Archivtag.
Bei den von mir besuchten Veranstaltungen stachen quasi schon gewohnheitsrechtlich der Arbeitskreis Archivpädagik, aber auch der Vortrag der Waalwijks in der Sektion 2 und der lebhafte Sitzungsverlauf beim Thema "Werbefilme" in der Fachgruppen-Sitzung 1 hervor. Über die Enttäuschungen habe ich bereits berichtet (Prantl, Manegold).
"Vda goes Facebook" - aber der Archivtag nicht Web 2.0. Trotz der 8 flying reporters war der aktuelle Berichterstattung von Echtzeit ein wenig weit entfernt. Vielleicht lag dies nicht nur am abendlichen Begenungsabend, sondern vielmehr am fehlenden WLAN. Will man wirklich Web 2.0-fähig sein, so sollte ab dem nächsten Archivtag kostenloses WLAN bereitstehen.
Ein Lichtblick: der BKK Unterausschuss Bildungsarbeit will sich verstärkt dem Thema Web 2.0 widmen. Aber wären nicht eigenständige Arbeitskreise in VdA und BKK sinnvoller?
Es sieht so aus, als sollte sich der VdA Gedanken zum Thema Kinderberteuung auf Archivtagen machen.
Wolf Thomas - am Sonntag, 25. September 2011, 20:17 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen





Ob KollegInnen aufgrund der Archivalia-Berichterstattung einen Blick auf die Bilder geworfen haben?
s. zu Slevogts Nachlass: http://archiv.twoday.net/stories/38775636/
Wolf Thomas - am Sonntag, 25. September 2011, 20:04 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
21. Spetember 2011


AK Archivpädagogik


Eröffnungsveranstaltung+Stehempfang


22. September 2011
Gemeinsame Arbeitssitzung

Sektion 2

Sektion 3

23. September 2011




AK Archivpädagogik


Eröffnungsveranstaltung+Stehempfang


22. September 2011
Gemeinsame Arbeitssitzung

Sektion 2

Sektion 3

23. September 2011


Wolf Thomas - am Sonntag, 25. September 2011, 17:24 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Sonntag, 25. September 2011, 17:12 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen



Wirtschaftsarchive stellen in ihrer Herangehensweise immer eine gewisse Herausforderung für öffentlich-rechliche Archivierende dar. Der tägliche "Überlebenskampf" erfodert eine konsequente, erfolgsorientierte, evaluierte Öffentlichkeitsarbeit.
Eine der Messgrößen ist dabei die Generierung von PR-Wert; darunter sind Gelder zu verstehen, die die Marketing-Abteilung nicht für Anzeigen etc. aufbringen muss. Dieser Wert ermittelt sich aus der Berichterstattung in den Medien, deren lokale bis hin zur globalen Verbreitung mit einer Geldwert beziffert wird. So gelang es dem Kraft-Archiv bspw. 2008 durch eine Ausstellung mit Publikation zum 100-jährigen Bestehen von Toblerone einen PR-Wert von 25 Millionen € zu erwirtschaften.
Wobei das history marketing im Genussmittelbereich mit dem sehr emotionalen Faktor "Das war eben mmmhhhhh!" agieren kann.
Dennoch könnte dieser Ansatz bei den Kostenberechnung für entsprechende Projekte in allen anderen Archivsparten die Diskussionen bereichern.
Wolf Thomas - am Sonntag, 25. September 2011, 16:55 - Rubrik: Wirtschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus der Besprechung der FAZ vom 24.12.2010 via Perlentaucher:
" .... E.L. Doctorow erzählt in diesem Roman die Geschichte der Brüder Collyer, die es wirklich gegeben hat. Es waren Söhne reicher Eltern, die abgeschieden lebten und sammelten: Zeitungen, Möbel, Geschirr, Instrumente. Als die Polizei sie tot in ihrem Haus fand, mussten sie aus über 100 Tonnen Müll ausgegraben werden. Schon vorher waren sie - gerade wegen ihrer Unsichtbarkeit - eine Boulevardsensation. Doctorow nun, so Rezensent Daniel Haas, befördert die beiden Brüder mit seinem Roman vom Boulevard in die Sphäre der Kunst und Kultur. Er zeichnet sie nicht als Verrückte, sondern als "Archivare" ihrer Epoche. Für Haas ein "ergreifendes" Buch, das ihm wieder einmal zeigt, dass die Literatur wirklichkeitsgesättigter sein kann als das Leben. ...."
Die Frankfurter Rundschau betitelt ihre Rezension vom 16.1.2011 gar mit: "Ein Archiv der ganzen Welt".
Dank für den Hinweis an Prof. Dr. Heribert Prantl auf dem Bremer Archivtag 2011!
Wolf Thomas - am Sonntag, 25. September 2011, 16:43 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.onlinelupe.de/social-media/100-dinge-die-man-uber-google-plus-wissen-sollte/ verspricht eine Zusammenfassung der interessantesten deutschsprachigen Artikel über G+.
Meine eigenen Beiträge auf G+ sind meist öffentlich:
https://plus.google.com/117546351384071338747/posts?hl=de
Meine eigenen Beiträge auf G+ sind meist öffentlich:
https://plus.google.com/117546351384071338747/posts?hl=de
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nachdem Uhde in der Archivliste vom 8. September einen Ausschnitt aus der Wirtschafts-Seite der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung vom 5.9.2011 verbreitete, Herr Contributor Wolf aber keine Anstalten machte, dies zu melden, mach ich das eben, da das Faktum wirklich ganz interessant erscheint. Jeder vierte Azubi bricht ab:
http://www.waz-abo.de/_SITn8frgAAAABOaUVp/_SP0/nachrichten/wirtschaft-und-finanzen/Jeder-vierte-Azubi-bricht-seine-Lehre-ab-id5028388.html
Die im Druck beigegebene Grafik fehlt hier. Die höchste Abbruchquote haben mit 44 % die Köche, die niedrigste mit 3 % die Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (Verwaltungsfachangestellte 3,5 %).
http://www.waz-abo.de/_SITn8frgAAAABOaUVp/_SP0/nachrichten/wirtschaft-und-finanzen/Jeder-vierte-Azubi-bricht-seine-Lehre-ab-id5028388.html
Die im Druck beigegebene Grafik fehlt hier. Die höchste Abbruchquote haben mit 44 % die Köche, die niedrigste mit 3 % die Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (Verwaltungsfachangestellte 3,5 %).
KlausGraf - am Sonntag, 25. September 2011, 14:29 - Rubrik: Ausbildungsfragen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Teil I von "Informationsbewertung von Microblognachrichten"
http://lislounge.wordpress.com/2011/09/24/informationsbewertung-von-microblognachrichten-teil-i/
http://lislounge.wordpress.com/2011/09/24/informationsbewertung-von-microblognachrichten-teil-i/
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://infodisiac.com/blog/2011/09/summary-reports-for-all-wikimedia-wikis/
Wikisource (de)
http://stats.wikimedia.org/wikisource/EN/ReportCardTopWikis.htm#lang_de
Wikiquote (de)
http://stats.wikimedia.org/wikiquote/EN/ReportCardTopWikis.htm#lang_de
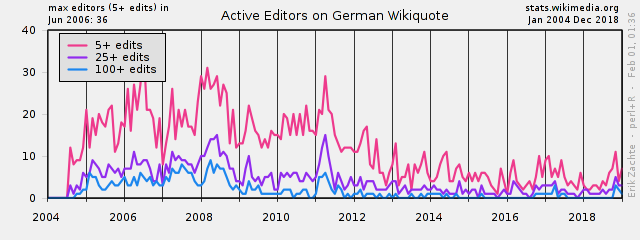
Wikisource (de)
http://stats.wikimedia.org/wikisource/EN/ReportCardTopWikis.htm#lang_de
Wikiquote (de)
http://stats.wikimedia.org/wikiquote/EN/ReportCardTopWikis.htm#lang_de
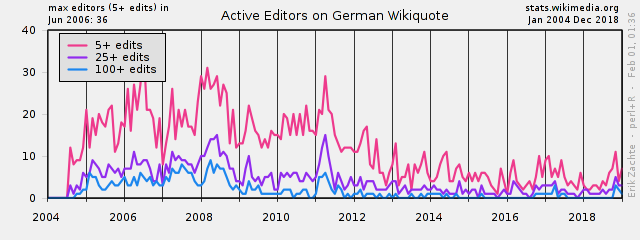
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Peter Bichsel ist - wie Martin Walser - ein Geschichtenerzähler des Alltags. Doch während Walser von den Sorgen, Nöten und gelegentlichen Freuden des Kleinbürgers in zudem recht umfangreichen Romanen erzählt, schreibt Bichsel in seinen kleinen Geschichten vor allem über „kleine“ Bürger und ihren großen Wunsch, anders, will heißen aufregender, wirklich(er) zu leben. Sicher, auch Walsers an ihrem Alltag leidende Helden sind nicht selten von gerade eben diesem Wunsch beseelt, doch finden sie sich - wie es sich für „richtige“ Erwachsene gehört - mit ihrem Anpassungs- und Mitmacherdasein ab. Ganz anders dagegen bei Bichsel. Als große Kinder bzw. als Kind gebliebene Erwachsene sind seine Hauptfiguren immer auch von Sehnsucht getriebene Träumer. Und so brechen sie aus und auf, verweigern sich hier und da und leben ein Leben, welches das „richtige“ Leben ihnen verwehrt, wenn auch nur in Gedanken.
Zur bereits vorhandenen Gruppe solch lebenssüchtiger Gedankenspieler aus Bichselscher Feder gesellt sich nun ein weiterer hinzu. Er heißt Cherubin Hammer, und das ist auch schon so ziemlich das einzige, was wir w i r k l i c h über ihn wissen. Cherubin Hammer nämlich, den gibt es - wie der Titel des Buches erahnen läßt - gleich zweimal, bzw. wie man bei der Lektüre feststellen kann, eigentlich sogar dreimal. Da ist zum einen jener Cherubin Hammer, der dem Erzähler zufolge tatsächlich Cherubin Hammer hieß und dessen Bild in 54 durchnumerierten, für Prosatexte ungewöhnlichen Fußnoten entworfen wird. Er war, was man gemeinhin einen „richtigen Kerl“ nennt: groß, breit, laut, strahlend, trinkfest und vor Gesundheit strotzend. Als mit allen Wassern gewaschener Unternehmer, der mal im Bau, mal in Wein und Antiquitäten seine Geschäfte machte, warf er mit Hunderternoten um sich, machte seine Sauftouren stets mit dem Taxi, auch wenn die Beizen nur 30Meter voneinander entfernt waren, und schlug gern mal mit der Faust auf den Tisch. Er war präsent - unübersehbar und unüberhörbar.
Ganz anders dagegen jener Cherubin Hammer, dem der Fußnoten-Cherubin-Hammer seinen Namen leiht. Ebenfalls groß und breit von Statur, ansonsten aber dicklich, plump, langsam und schwerfällig, ist dieser zu alledem ein stiller Held. Darüber hinaus hat er, was dem „richtigen“ Cherubin Hammer - zumindest in Bichsels Text - fehlt, nämlich eine „richtige“ Biographie, das heißt eine mit Fakten bestückbare Lebensbeschreibung. Geboren 1926, arbeitete der „ausgebildete und diplomierte Gymnasiallehrer“ im Archiv einer Verwaltung (was in den Augen des Erzählers einer Abschiebung gleichkommt). Er war verheiratet, hatte einen Sohn und ein Haus mit Garten. Jeden Tag trug er einen Stein auf bzw., wie man in seiner Region sagte, in den Berg; warum er das tat, dafür weiß auch der Autor keinen Grund zu finden. Hinterlassen hat er etwas mehr als vierzig schwarze, überwiegend leere Wachstuchhefte, die er allesamt mit dem Titel „Die Tagebücher“ überschrieben hatte. Denn: der Akten lesende und bearbeitende Bürobeamte Cherubin Hammer, der wäre gern sein Leben lang ein Schriftsteller gewesen. Und so ist dieser Kopf-und-Herzenswunsch-Cherubin-Hammer denn auch so etwas wie der dritte Cherubin Hammer in Bichsels Buch. Gleichzeitig ist er der, den eigentlich niemand kannte. Nur ein kleines Mädchen, dem er Geschichten erzählte, und Lydia, der er Gedichte schickte.
Der Inhalt von Bichsels neuem Büchlein derart knapp und deshalb überaus unvollständig zusammengefaßt, mag verwirren. Verwirrung aber ist auch bei der Lektüre der Geschichten selbst angesagt, sie darf sogar als ihr wesentlicher Motor bezeichnet werden. Doch was dem einen wie ein - durch die Fußnoten erhöhtes - Durcheinander und Unordnung erscheinen mag, wird dem anderen ein lustvolles Spielen mit Identität(en) sein. „Biographie“, sie ist auch hier in altvertrauter Manier „Ein Spiel“ von Schein und Sein, von Person und Rolle, von Sollen und Wollen, von (innerer, eigener) Identität und (äußerem, fremdproduziertem) Bild. Peter Bichsel bewegt sich damit in der Literaturtradition von Max Frisch, dem - wenn man so will - „Urvater“ der Identitäts- und Bildnisproblematik in der deutschsprachigen Schweizer Gegenwartsliteratur. (Daß dieses Sich-Bewegen in voller Bewußtheit, wenn nicht gar in erfurchtsvoll-freundschaftlicher Reminiszenz an den 1991 Verstorbenen geschieht, zeigt sich auch gleich in den ersten beiden Zeilen des Buches, die wie ein Echo der ersten Worte des Stiller klingen.) Gleichzeitig aber folgt Bichsel konsequent seiner eigenen Erzähl- und Literaturspur, in der die Identitätsproblematik verquickt ist mit einem spielerischen Sprachskeptizismus.
Nicht zu finden ist der in den zwei lediglich in den Erzählfluß eingeschobenen und durch Kursivdruck auch optisch abgehobenen Geschichten der jeweiligen Frau des jeweiligen Cherubin Hammer. Auffallend ist an beiden Geschichten zudem, daß hier „ordentlich“ bzw. „geordnet“ im Sinne von traditionell erzählt wird und das, obgleich man sich auch hier ein aufregenderes Leben hätte vorstellen können. Im Gegensatz zu den Männern jedoch nehmen die beiden Frauen mit den „gewöhnlichen“ Namen (Rosa Fässler, Bertha Schmied) ihr Erdendasein so, wie es ist. Bildungs-, Zuwendungs-, Zuneigungs- und Zärtlichkeitsverzicht werden akzeptiert, scheinbar ohne daß daraus innere Unruhe oder Unzufriedenheit erwachsen, im Gegenteil.
Am Ende des Buches stellt sich die Frage, wer nun hinsichtlich seines Lebens am meisten zu bedauern ist bzw. wer nun das „wirklichere“ Leben gelebt hat. Es scheint dies jedoch eine Frage, auf die sich keine eindeutige, keine alle vereinende Antwort finden lassen wird. Denn während für die einen „wirklich“ gleichzusetzen ist mit laut, schrill, aufregend, spannend und Ausbruch, bedeutet es für die anderen das mehr oder minder genußvolle, leise Akzeptieren und Sich-Einrichten im alles andere als „lustigen“ Gegebenen. Ob sich dabei allerdings Männer und Frauen - wie im Buch - voneinander unterscheiden, bleibt dahingestellt. Zumindest scheint der Druck nach Selbstbehauptung und Selbstdarstellung mittlerweile die Geschlechter mehr denn je zu einen und gerade deshalb auch wieder, wenn auch anders, zu trennen. Vielleicht aber ist es ja bei Bichsels Geschichte(n) auch eine Frage der Generationen. Trotz aller Schweizbezüge handelt es sich hier jedoch auf keinen Fall um ein allein auf die helvetischen Landesgrenzen beschränktes Dilemma - auch wenn die Initialen von Cherubin Hammer einen solchen Gedanken aufkommen lassen können."
Quelle: Berliner LeseZeichen, Ausgabe 6/99 (c) Edition Luisenstadt, 1999
Dank an Hans Waalwijk (Amsterdam) für den Hinweis auf dem Bremer Archivtag!
Wikipedia-Artikel Peter Bichsel
Wolf Thomas - am Sonntag, 25. September 2011, 13:06 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

""Was verstehen wir Frauen auch von Politik?" - Entnazifizierung ganz normaler Frauen in Bremen (1945-52)
Bremen, August 1945. Die Internierungslager der Alliierten füllen sich rasch. Nicht nur mit Männern. Auch Frauen werden inhaftiert. „Ganz normale“ Frauen, die im NS-Staat vielfältige Handlungsmöglichkeiten nutzen konnten. Waren sie fanatische Anhängerinnen des Nationalsozialismus, wie die amerikanische Militärregierung befürchtete? Nur Befehlsempfängerinnen, unwissende Mitläuferinnen oder gar Opfer, wie viele Frauen behaupteten?
Gestapo-Agentin und Denunziantin, KZ-Aufseherin und Funktionärin der NS-Frauenschaft, SS-Helferin und Fürsorgerin, Lehrerin und Ärztin, weiblicher Kapo und Sekretärin der Gestapo in Bremen oder im fernen Minsk. Sie alle werden entnazifiziert. Wie erklären sie nach 1945 ihr Handeln? Welches Bild entwerfen sie im Entnazifizierungsverfahren von sich selbst? Wie deutet die deutsche Nachkriegsgesellschaft ihre Aktivitäten? Was verstehen diese „ganz normalen“ Frauen unter Politik?
Montag, 19. September 2011, 19.30 Uhr
Mittwoch, 21. September 2011, 19.30 Uhr
Donnerstag, 22. September 2011, 19.30 Uhr
Dienstag, 4. Oktober 2011, 19.30 Uhr
Sonntag, 9. Oktober 2011, 11.00 Uhr
Mittwoch, 2. November 2011, 19.30 Uhr
Dienstag, 15. November 2011, 19.30 Uhr
Dienstag, 22. November 2011, 19.30 Uhr
Karten können bei der bremer shakespeare company vorbestellt werden: http://www.shakespeare-company.com"
Quelle: http://www.sprechende-akten.de/
Hat jemand die Aufführung am 22. September besucht und kann hier berichten?
Wolf Thomas - am Sonntag, 25. September 2011, 12:56 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das umfangreiche Werk des portugiesischen Jesuiten Antonio de Macedo
(Coimbra
1612- Lissabon 15. Juli 1693) Diui Tutelares Orbis Christiani:
Opus Singulare, In Quo de Sanctis Regnorum, Prouinciarum, Vrbium
Maximarum Patronis Agitur (Lissabon 1687) habe ich leider nie zu
Gesicht bekommen. Es scheint tatsächlich von außerordentlicher
Seltenheit zu sein, in Deutschland haben die über den
http://www.vthk.de/ erschlossenen kirchlichen Bibliotheken kein
Exemplar nachgewiesen, der KVK hat nur ein Exemplar im
protestantischen Hannover (die NB in Lissabon hat dagegen mehrere
Exemplare).
Die behandelten Heiligen findet man bei Estor und Fabricius:
http://books.google.de/books?id=pdVEAAAAcAAJ&dq=valenus%20galenus&pg=PA567
http://books.google.de/books?id=8O85AAAAMAAJ&dq=%&pg=PA261

(Coimbra
1612- Lissabon 15. Juli 1693) Diui Tutelares Orbis Christiani:
Opus Singulare, In Quo de Sanctis Regnorum, Prouinciarum, Vrbium
Maximarum Patronis Agitur (Lissabon 1687) habe ich leider nie zu
Gesicht bekommen. Es scheint tatsächlich von außerordentlicher
Seltenheit zu sein, in Deutschland haben die über den
http://www.vthk.de/ erschlossenen kirchlichen Bibliotheken kein
Exemplar nachgewiesen, der KVK hat nur ein Exemplar im
protestantischen Hannover (die NB in Lissabon hat dagegen mehrere
Exemplare).
Die behandelten Heiligen findet man bei Estor und Fabricius:
http://books.google.de/books?id=pdVEAAAAcAAJ&dq=valenus%20galenus&pg=PA567
http://books.google.de/books?id=8O85AAAAMAAJ&dq=%&pg=PA261

KlausGraf - am Sonntag, 25. September 2011, 04:45 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In Krämers Scriptores lesen wir:
Zarter, Petrus scriptor 1471/80
Kathedralis (Stuhlschreiber).
Handschriften
Nürnberg, StadtB, Solg. 2°16 (ehem. Raym. Krafft, 1739, chart. 2°2) (1471), aus Augsburg, OP (fem.) St. Katharina ("buchampt").
Covington, VA, Collection of Harry A. Walton jr., A-545 (a. 1480).
Literatur
(Katalog) Raymund Krafft, 1739, S. 32.
Bond-Faye, S. 519.
Zarter wird als Schreiber in der Abschrift der Mentelin-Bibel in Nürnberg mit dem Datum 1471 genannt, wohl aus der Vorlage übernommen:
http://www.handschriftencensus.de/10999
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0063_b481_JPG.htm
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hsk0619b.html
Im Supplement to the census of medieval and renaissance manuscripts in the United States and Canada (1962), S. 519 wird in der Sammlung von Harry A. Walton unter A-545 ein "Hymnarium cum calendario" (Pergament, 415 Bl.) 1480 von einem Schreiber Zarter aufgeführt, das inzwischen in der Stadt- und Staatsbibliothek Augsburg als 8° Cod. 232 gelandet ist, 1993 vom Antiquariat Konrad Meuschel in Honnef erworben. Die fehlerhafte Paginierung reicht bis 415. Beschreibung von Juliane Trede (ohne Nennung der Vorprovenienz Walton):
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/projekt-Augsburg-pdfs/OctCod232.pdf
Zarter schrieb den Band für ein Franziskanerteriarinnenkloster. Der Einband weist auf Ulm.
Die Sammlung von Harry A. Walton wurde anscheinend aufgelöst, etliche Handschriften sind im Handel nachweisbar. Walton starb 2007:
http://app.cul.columbia.edu:8080/exist/scriptorium/individual/CSmH-24.xml
http://www.highbeam.com/doc/1P2-12811393.html
#forschung
Zarter, Petrus scriptor 1471/80
Kathedralis (Stuhlschreiber).
Handschriften
Nürnberg, StadtB, Solg. 2°16 (ehem. Raym. Krafft, 1739, chart. 2°2) (1471), aus Augsburg, OP (fem.) St. Katharina ("buchampt").
Covington, VA, Collection of Harry A. Walton jr., A-545 (a. 1480).
Literatur
(Katalog) Raymund Krafft, 1739, S. 32.
Bond-Faye, S. 519.
Zarter wird als Schreiber in der Abschrift der Mentelin-Bibel in Nürnberg mit dem Datum 1471 genannt, wohl aus der Vorlage übernommen:
http://www.handschriftencensus.de/10999
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0063_b481_JPG.htm
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hsk0619b.html
Im Supplement to the census of medieval and renaissance manuscripts in the United States and Canada (1962), S. 519 wird in der Sammlung von Harry A. Walton unter A-545 ein "Hymnarium cum calendario" (Pergament, 415 Bl.) 1480 von einem Schreiber Zarter aufgeführt, das inzwischen in der Stadt- und Staatsbibliothek Augsburg als 8° Cod. 232 gelandet ist, 1993 vom Antiquariat Konrad Meuschel in Honnef erworben. Die fehlerhafte Paginierung reicht bis 415. Beschreibung von Juliane Trede (ohne Nennung der Vorprovenienz Walton):
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/projekt-Augsburg-pdfs/OctCod232.pdf
Zarter schrieb den Band für ein Franziskanerteriarinnenkloster. Der Einband weist auf Ulm.
Die Sammlung von Harry A. Walton wurde anscheinend aufgelöst, etliche Handschriften sind im Handel nachweisbar. Walton starb 2007:
http://app.cul.columbia.edu:8080/exist/scriptorium/individual/CSmH-24.xml
http://www.highbeam.com/doc/1P2-12811393.html
#forschung
KlausGraf - am Sonntag, 25. September 2011, 04:11 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Dieser Hohenstaufen verdiente es — wegen der großen deutschen Kaiser, die wie Adler von ihm aufstiegen, und die sich der Reihe nach in gothischen Gemählden auf dem benachbarten Kloster Lorch befinden, — er verdiente es sehr, daß eine kolossalle Piramide mit den Namen und Hauptthaten jener Kaiser auf ihm errichtet würde. Es zeugt von Gleichgültigkeit und Stumpfsinne für das Große der Vorzeit, daß dieß nicht schon längst geschehen ist.
Dies schrieb ein unbekannter Autor, der mit Johann Gottfried Pahl (damals Pfarrer in Neubronn) befreundet war, im Oktober 1807 in einem kurzen, in zwei Teilen im Morgenblatt für gebildete Stände (Februar 1808, S. 147, 150f.) erschienenen Text Rechberg. Rosenstein. Hohenstaufen.
Zum Thema:
http://archiv.twoday.net/stories/6412734 (Pahl hatte schon 1803 ein Denkmal auf dem Hohenstaufen gefordert)
Dies schrieb ein unbekannter Autor, der mit Johann Gottfried Pahl (damals Pfarrer in Neubronn) befreundet war, im Oktober 1807 in einem kurzen, in zwei Teilen im Morgenblatt für gebildete Stände (Februar 1808, S. 147, 150f.) erschienenen Text Rechberg. Rosenstein. Hohenstaufen.
Zum Thema:
http://archiv.twoday.net/stories/6412734 (Pahl hatte schon 1803 ein Denkmal auf dem Hohenstaufen gefordert)
KlausGraf - am Sonntag, 25. September 2011, 00:34 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2011/09/beowulf-in-hungarian-and-french-and-telugu-.html
Dass man in 1 Minute 20 (deutsche Version) einen hinreichenden Eindruck von dem Poem bekommt, halte ich für ausgeschlossen.
Dass man in 1 Minute 20 (deutsche Version) einen hinreichenden Eindruck von dem Poem bekommt, halte ich für ausgeschlossen.
KlausGraf - am Samstag, 24. September 2011, 23:21 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://research.hrc.utexas.edu:8080/hrcxtf/view?docId=ead/00484p1.xml
Bilder in zu kleiner Auflösung!
Via
http://bibliostoria.wordpress.com/2011/09/23/the-popular-imagery-collection-stampe-dipinti-e-disegni-europei-popolari-xv-xviii-secolo/
.jpg)
Bilder in zu kleiner Auflösung!
Via
http://bibliostoria.wordpress.com/2011/09/23/the-popular-imagery-collection-stampe-dipinti-e-disegni-europei-popolari-xv-xviii-secolo/
.jpg)
KlausGraf - am Samstag, 24. September 2011, 22:56 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.nzz.ch/nachrichten/zuerich/stadt_und_region/schwarzenbach-archiv_zentralbibliothek_snm_zuerich_1.12625088.html
Die Industriellenfamilie Schwarzenbach schenkt der Zentralbibliothek Zürich (ZB) und dem Schweizerischen Nationalmuseum (SNM) das Archiv der Seidenfirma Robert Schwarzenbach & Co. In einem zweijährigen Projekt wird die Schenkung nun gesichtet, konserviert und katalogisiert.
Damit würden wertvolle Informationen zur Wirtschafts-, Sozial- und Textilgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts gesichert, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der ZB und des SNM vom Freitag. Das Archiv in Thalwil berge umfangreiche Geschäftskorrespondenz und persönliche Nachlässe der Familie Schwarzenbach. Zudem enthalte das Archiv auch besondere Einzelstücke wie beispielsweise die einzige erhaltene Mitschrift einer Rede, die Adolf Hitler im August 1923 in Zürich hielt.
Die Industriellenfamilie Schwarzenbach schenkt der Zentralbibliothek Zürich (ZB) und dem Schweizerischen Nationalmuseum (SNM) das Archiv der Seidenfirma Robert Schwarzenbach & Co. In einem zweijährigen Projekt wird die Schenkung nun gesichtet, konserviert und katalogisiert.
Damit würden wertvolle Informationen zur Wirtschafts-, Sozial- und Textilgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts gesichert, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der ZB und des SNM vom Freitag. Das Archiv in Thalwil berge umfangreiche Geschäftskorrespondenz und persönliche Nachlässe der Familie Schwarzenbach. Zudem enthalte das Archiv auch besondere Einzelstücke wie beispielsweise die einzige erhaltene Mitschrift einer Rede, die Adolf Hitler im August 1923 in Zürich hielt.
KlausGraf - am Samstag, 24. September 2011, 22:27 - Rubrik: Wirtschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://creativecommons.org/weblog/entry/29133
Europeana — Europe’s digital library, museum and archive, and the first major adopter of the Public Domain Mark for works in the worldwide public domain — has adopted a new Data Exchange Agreement. The agreement, which data providers and aggregators will transition to by the end of 2011, authorizes Europeana to release the metadata for millions of cultural works into the public domain using the CC0 public domain dedication. All metadata for cultural works accessible via the Europeana portal, including previously-delivered metadata, will then be available for free and open re-use.
Europeana — Europe’s digital library, museum and archive, and the first major adopter of the Public Domain Mark for works in the worldwide public domain — has adopted a new Data Exchange Agreement. The agreement, which data providers and aggregators will transition to by the end of 2011, authorizes Europeana to release the metadata for millions of cultural works into the public domain using the CC0 public domain dedication. All metadata for cultural works accessible via the Europeana portal, including previously-delivered metadata, will then be available for free and open re-use.
KlausGraf - am Samstag, 24. September 2011, 22:13 - Rubrik: Open Access
Via
http://www.tribur.de/blog/?p=16841
Wer die Handschrift ohne DRM der British-Library (zu kleine Lupe) durchblättern will, kann dies auf Commons tun:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luttrell_Psalter.pdf
Wikipedia-Artikel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Luttrell-Psalter

KlausGraf - am Samstag, 24. September 2011, 21:54 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Monika Lehner hat in einem nur eingeschränkt geteilten Beitrag auf Google+ darauf aufmerksam gemacht, dass das Google-Digitalisat
Kirchen-Geschichte, das ist: Catholisches Christenthum, durch die ganze Welt ausgebreitet ... erstlich beschriben ... Durch Cornelium Hazart, Nunmehr aber Auß der Nider- in die Hoch-Teutsche Sprache übers. und vermehret
1678 [-1684, Bd. 2 angebunden]
http://books.google.at/books?id=pNFJAAAAcAAJ
aus der ÖNB Wien stammt und erhebliche Mängel aufweist:
- Das Buch ist zu eng gebunden
- Es liegt daher und durch Beschneidung der Seiten sehr oft Textverlust vor (erstmals S. 10, 37, 43 usw.)
- Es wird häufig nur eine Spalte digitalisiert (erstmals S. 27)
- die berüchtigten rosa Finger sind sichtbar (erstmals S. 95)
Beispiel für eine Seite aus einem weiteren Buch aus Wien, bei dem nur eine Spalte sichtbar ist:
http://books.google.at/books?id=sbtJAAAAcAAJ&pg=PA149
Hat man aus den vielen Scanfehlern in München nichts dazugelernt?
Update: http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=17297
Stellungnahme der ÖNB
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg45947.html
Monika Lehner kommentiert diese
https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/CMd2PxY8hU6

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Google_scanfehler_wien.jpg
Kirchen-Geschichte, das ist: Catholisches Christenthum, durch die ganze Welt ausgebreitet ... erstlich beschriben ... Durch Cornelium Hazart, Nunmehr aber Auß der Nider- in die Hoch-Teutsche Sprache übers. und vermehret
1678 [-1684, Bd. 2 angebunden]
http://books.google.at/books?id=pNFJAAAAcAAJ
aus der ÖNB Wien stammt und erhebliche Mängel aufweist:
- Das Buch ist zu eng gebunden
- Es liegt daher und durch Beschneidung der Seiten sehr oft Textverlust vor (erstmals S. 10, 37, 43 usw.)
- Es wird häufig nur eine Spalte digitalisiert (erstmals S. 27)
- die berüchtigten rosa Finger sind sichtbar (erstmals S. 95)
Beispiel für eine Seite aus einem weiteren Buch aus Wien, bei dem nur eine Spalte sichtbar ist:
http://books.google.at/books?id=sbtJAAAAcAAJ&pg=PA149
Hat man aus den vielen Scanfehlern in München nichts dazugelernt?
Update: http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=17297
Stellungnahme der ÖNB
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg45947.html
Monika Lehner kommentiert diese
https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/CMd2PxY8hU6

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Google_scanfehler_wien.jpg
KlausGraf - am Samstag, 24. September 2011, 15:21 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nathanael Busch (Marburg/Handschriftencensus) schreibt mir:
auf Archivalia haben Sie im Juli 2010 auf die hochinteressante Digitalisierung von zahlreichen ungedruckten Hss-Katalogen hingewiesen:
http://archiv.twoday.net/stories/6420452/
Im Blog schrieben Sie, es handle sich um 146 Filme. Heute führt der Links ins Leere und nur über Umwege (google-Suche) finde ich ca. 70 dieser Filme.
Wissen Sie etwas über den Verbleib der restlichen Dateien? Bin ich unfähig, sie zu finden, oder hat gar jemand festgestellt, dass da doch der eine oder andere Katalog "unpublished" bleiben soll?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe seinerzeit Mentzel-Reuters von der MGH-Bibliothek angemailt, aber dieser erklärte, er habe keine Ressourcen für eine Erschließung und so habe ich mich mit den Dateien nicht weiter beschäftigt.
Die Suche des IA ist offenkundig defekt. Selbst wenn man die verlinkten Metadaten anklickt, wird nichts gefunden:
http://www.archive.org/details/corpusofunpublis08prep
Allerdings kann man über die URL blättern:
http://www.archive.org/details/corpusofunpublis01prep
http://www.archive.org/details/corpusofunpublis02prep
Stichproben zufolge scheint das bis ca. vol. 74 zu funktionieren. Google hat Treffer, die im 300er Bereich liegen und nicht mehr gefunden werden:
http://www.google.de/search?q=%22A+Microfilm+Corpus+of+Unpublished%22+site:archive.org&num=100&hl=de&safe=off&prmd=imvns&filter=0&biw=1280&bih=909
Man könnte in Toronto mal anfragen ...
auf Archivalia haben Sie im Juli 2010 auf die hochinteressante Digitalisierung von zahlreichen ungedruckten Hss-Katalogen hingewiesen:
http://archiv.twoday.net/stories/6420452/
Im Blog schrieben Sie, es handle sich um 146 Filme. Heute führt der Links ins Leere und nur über Umwege (google-Suche) finde ich ca. 70 dieser Filme.
Wissen Sie etwas über den Verbleib der restlichen Dateien? Bin ich unfähig, sie zu finden, oder hat gar jemand festgestellt, dass da doch der eine oder andere Katalog "unpublished" bleiben soll?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe seinerzeit Mentzel-Reuters von der MGH-Bibliothek angemailt, aber dieser erklärte, er habe keine Ressourcen für eine Erschließung und so habe ich mich mit den Dateien nicht weiter beschäftigt.
Die Suche des IA ist offenkundig defekt. Selbst wenn man die verlinkten Metadaten anklickt, wird nichts gefunden:
http://www.archive.org/details/corpusofunpublis08prep
Allerdings kann man über die URL blättern:
http://www.archive.org/details/corpusofunpublis01prep
http://www.archive.org/details/corpusofunpublis02prep
Stichproben zufolge scheint das bis ca. vol. 74 zu funktionieren. Google hat Treffer, die im 300er Bereich liegen und nicht mehr gefunden werden:
http://www.google.de/search?q=%22A+Microfilm+Corpus+of+Unpublished%22+site:archive.org&num=100&hl=de&safe=off&prmd=imvns&filter=0&biw=1280&bih=909
Man könnte in Toronto mal anfragen ...
KlausGraf - am Samstag, 24. September 2011, 14:43 - Rubrik: Kodikologie
" ... Dr. Clemens Rehm (Stuttgart): Neue Entwicklungen im Kulturgutschutz
Dr. Gerald Maier (Stuttgart) und Christina Wolf (Stuttgart): Deutsche Digitale Bibliothek und Archivportal-D
Dr. Bettina Schmidt-Czaia (Köln): Bergungsbilanz und Bürgerarchiv - Erste Weichenstellungen für den Wiederaufbau des Historischen Archivs der Stadt Köln ...."
Link zum Tagungsprogramm
Rehm
1) Verweis auf dem wohl im Herbst 2011 Band zur Frühjahrstagung 2011 der Fachgruppe 1 zum Thema
2) 2007 Kulturgüterrückgabegesetz. Eine aktuelle Änderung bezieht Landes- und Kommunalarchive mit ein, so dass in 114 UNESCO-Mitgliedstaaten niemand mehr gutgläubig Besitz an entfremdeten Archivgut erwerben kann
3) Die gemeldeten Archivbestände erfahren im Katastrophenfall eine bevorzugte Behandlung
4) Neue Richtlinie vom 29.4.2010 stellt als Kriterium für national wertvolles Archivgut fest, dass das, was als archivwürdig bewertet wurde (inkl. Sammlungsgut), als solches angesprochen werden kann.
5) Eingetragene Archive haben als weitere Voraussetzungen Findmittel zu den Beständen nachzuweisen
6) Ob national wertvolles Archivgut im Gemeindearchiv NN wirklich das Ansehen des Archivs steigert, bleibt bei "inflationär" wachsender Eintragungszahl abzuwarten.
7) Die Inkriminierung des Veräußerung in das Ausland bleibt als Erfolg festzuhalten.
Maier/Wolf:
1) Folien sollen als PDF auf der Homepage des VdA - hoffentlich schnell - verfügbar gemacht werden. Daher warten wir ab ....
Schmidt-Czaia:
1) Bestandserfassung (in den Asylarchiven):
- ca. 22% (355.000 Einheiten) sind erfasst, davon lediglich 44% identifiziert
2) Mangel an Diplomarchivaren führt zum Appell an die Ausbildungsstellen nicht nachzulassen
3) 5,2 Mio. Digitalisate erstellt und qualitätsgeprüft. (wie schnell kommen die nun in das digitale Archiv?)
4) Personalstand Restauratoren: 10 dipl., 16 Hilfskräfte
- es können nur deutschsprachige Restauratoren eingestellt um der Dokumentationspflicht in den zu erwartenden Gerichtsverfahren nachkommen zu können (Viva Europa!)
5) Zum jahresende werden 35 Hilfskräfte für das RDZ eingestellt.
6) Neubau lag S.-C. "besonders am Herzen"
7) Wettbewerbsbüro Freischlad + Holz aus Darmstadt führte den Wettbewerb durch.
8) Nicht berücksichtigte Beiträge erfüllten Fachnormen nicht und waren auch nicht reparierbar(Ceterum censeo: Ich will die 40 Entwürfe der Ausstellung gerne publiziert sehen!).
9) Gewinnerentwurf (Wächter+Wächter, Darmstadt) stimmt S.-C. "sehr zufrieden".
10) Die insgesamt fünf Entwürfe auf den Plätzen 1-3 werden nun verfahrenskonform bewertet, so dass - theoretisch - die Chance besteht, dass ein anderer Entwurf ausgewählt wird.
Dr. Gerald Maier (Stuttgart) und Christina Wolf (Stuttgart): Deutsche Digitale Bibliothek und Archivportal-D
Dr. Bettina Schmidt-Czaia (Köln): Bergungsbilanz und Bürgerarchiv - Erste Weichenstellungen für den Wiederaufbau des Historischen Archivs der Stadt Köln ...."
Link zum Tagungsprogramm
Rehm
1) Verweis auf dem wohl im Herbst 2011 Band zur Frühjahrstagung 2011 der Fachgruppe 1 zum Thema
2) 2007 Kulturgüterrückgabegesetz. Eine aktuelle Änderung bezieht Landes- und Kommunalarchive mit ein, so dass in 114 UNESCO-Mitgliedstaaten niemand mehr gutgläubig Besitz an entfremdeten Archivgut erwerben kann
3) Die gemeldeten Archivbestände erfahren im Katastrophenfall eine bevorzugte Behandlung
4) Neue Richtlinie vom 29.4.2010 stellt als Kriterium für national wertvolles Archivgut fest, dass das, was als archivwürdig bewertet wurde (inkl. Sammlungsgut), als solches angesprochen werden kann.
5) Eingetragene Archive haben als weitere Voraussetzungen Findmittel zu den Beständen nachzuweisen
6) Ob national wertvolles Archivgut im Gemeindearchiv NN wirklich das Ansehen des Archivs steigert, bleibt bei "inflationär" wachsender Eintragungszahl abzuwarten.
7) Die Inkriminierung des Veräußerung in das Ausland bleibt als Erfolg festzuhalten.
Maier/Wolf:
1) Folien sollen als PDF auf der Homepage des VdA - hoffentlich schnell - verfügbar gemacht werden. Daher warten wir ab ....
Schmidt-Czaia:
1) Bestandserfassung (in den Asylarchiven):
- ca. 22% (355.000 Einheiten) sind erfasst, davon lediglich 44% identifiziert
2) Mangel an Diplomarchivaren führt zum Appell an die Ausbildungsstellen nicht nachzulassen
3) 5,2 Mio. Digitalisate erstellt und qualitätsgeprüft. (wie schnell kommen die nun in das digitale Archiv?)
4) Personalstand Restauratoren: 10 dipl., 16 Hilfskräfte
- es können nur deutschsprachige Restauratoren eingestellt um der Dokumentationspflicht in den zu erwartenden Gerichtsverfahren nachkommen zu können (Viva Europa!)
5) Zum jahresende werden 35 Hilfskräfte für das RDZ eingestellt.
6) Neubau lag S.-C. "besonders am Herzen"
7) Wettbewerbsbüro Freischlad + Holz aus Darmstadt führte den Wettbewerb durch.
8) Nicht berücksichtigte Beiträge erfüllten Fachnormen nicht und waren auch nicht reparierbar(Ceterum censeo: Ich will die 40 Entwürfe der Ausstellung gerne publiziert sehen!).
9) Gewinnerentwurf (Wächter+Wächter, Darmstadt) stimmt S.-C. "sehr zufrieden".
10) Die insgesamt fünf Entwürfe auf den Plätzen 1-3 werden nun verfahrenskonform bewertet, so dass - theoretisch - die Chance besteht, dass ein anderer Entwurf ausgewählt wird.
Wolf Thomas - am Freitag, 23. September 2011, 20:43 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Dr. Regina Keyler (Stuttgart): Selbstbedienungsscanner im Lesesaal – erste Erfahrungen des Landesarchivs Baden-Württemberg
Dr. Bettina Joergens (Detmold) und Dr. Andrea Wettmann (Dresden): Werbefilme als Mittel der Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Oliver Sander (Koblenz): Einstellung von Bildern in Wikimedia – Erfahrungen des Bundesarchivs ...."Link zum Tagungsprogramm
Keyler:
1) Nur ein paar Zahlen, da ich später hineingeraten bin:
- Nutzung der Scanner an den 6 Standorten zwischen 9% und 30 %
- Hauptstaatsarchiv Stuttgart: 2500 Scans im Monat
- Scan kostet 20 Cent
2) Zur Wahrung der Schutzrechte werden lediglich Unterlagen vorgelegt, ddie 100 Jahre oder älter sind
Wettmann/Joergens:
Wettmann:
1) Sächsischer Imagefilm entstand in werbender Absicht (ach was!) im Kontext einer Imagekampagne des Freistaats
2) Zuständiges Innenressort wandte sich an das Staatsarchiv und erteilte den Auftrag
-Prämisse: Archive sind moderne Dienstleister, "kein Lehrfilm"
3) Einsatz:
- Youtube-Kanal des Freistaats Sachsen
- eigene Website
- bei archivpädagogischen Veranstaltungen, Führungen, Tagen der offenen Tür
Joergens:
1) "Archives go Hollywood"
2) Filme diene der Schwellenabsenkung zwischen Archiven und ihrem Publikum
3) Nach dem iconic turn des vorigen Jhdts. sind Filme ein wirkmächtiges Werbeinstrument
4) Vor dem Einstieg ist die Frage zu klären: Was soll bei wem erreicht werden?
5) Das LAV ist an 3 im Entstehen begriffenen Filmprojekten beteiligt:
- mit Uni Göttingen entsteht ein 20min Lehrfilm über die Arbeit der Archive. Die Rohfassung liegt vor
- mit Universität Münster entsteht ein Lehrfilm über die Arbeit der Historiker in Archiven
- mit edicam entsteht ein dreiteiliger (á 3min) Imagefilm über das Landesarchiv NRW
6) Erfahrung hat das Landesarchiv mit dem Detmolder Film
Bemerkenswerte Diskussion:
- der sächsische Film sei eine "Peinlichkeit"; sowohl Stimme als auch Aussagen der Hauptdarstellerin wurden beanstandet
- der Detmolder Film führe eine "Benutzerguerilla" vor. Der Film vermittelt ein vollständig falsches Bild
- Imagefilm sollten kurz und so profesionell wie möglich sein (die Kollegen Staatsarchivare scheinen ja genug zu haben)
- Sind Filme ein weiterer Werbekanal für archivische Öffentlichkeitsarbeit? Die Frage der angehenden Kollegin der FH Potsdam blieb unbeantwortet. Daher von mir: selbstverständlich sind sie dies; man sollte sich einmal die Web 2.0-Aktivitäten der Museen ansehen, die wie selbstverständlich ihre großen Ausstellungen mit mindestens einem Filmbeitrag im Netz bewerben.
- Inwieweit die von Rehm angeregte Kooperation mit lokalen Fernsehsendern zu durch das Archiv im Web verwendbaren Ergebnissen führt, bleibt abzuwarten.
Sander:
1) "Ich hätte mir mehr davon versprochen"
2) Ansonsten nichts Neues zum Wikimedia-Projekt des Bundesarchivs. Der Eindruck unendlicher Bläuigkeit des Bundesarchivs bei diesem für das deutsche Archivwesen wegweisenden Projekt wurde auch in Bremen nicht entkräftet.
Dr. Bettina Joergens (Detmold) und Dr. Andrea Wettmann (Dresden): Werbefilme als Mittel der Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Oliver Sander (Koblenz): Einstellung von Bildern in Wikimedia – Erfahrungen des Bundesarchivs ...."Link zum Tagungsprogramm
Keyler:
1) Nur ein paar Zahlen, da ich später hineingeraten bin:
- Nutzung der Scanner an den 6 Standorten zwischen 9% und 30 %
- Hauptstaatsarchiv Stuttgart: 2500 Scans im Monat
- Scan kostet 20 Cent
2) Zur Wahrung der Schutzrechte werden lediglich Unterlagen vorgelegt, ddie 100 Jahre oder älter sind
Wettmann/Joergens:
Wettmann:
1) Sächsischer Imagefilm entstand in werbender Absicht (ach was!) im Kontext einer Imagekampagne des Freistaats
2) Zuständiges Innenressort wandte sich an das Staatsarchiv und erteilte den Auftrag
-Prämisse: Archive sind moderne Dienstleister, "kein Lehrfilm"
3) Einsatz:
- Youtube-Kanal des Freistaats Sachsen
- eigene Website
- bei archivpädagogischen Veranstaltungen, Führungen, Tagen der offenen Tür
Joergens:
1) "Archives go Hollywood"
2) Filme diene der Schwellenabsenkung zwischen Archiven und ihrem Publikum
3) Nach dem iconic turn des vorigen Jhdts. sind Filme ein wirkmächtiges Werbeinstrument
4) Vor dem Einstieg ist die Frage zu klären: Was soll bei wem erreicht werden?
5) Das LAV ist an 3 im Entstehen begriffenen Filmprojekten beteiligt:
- mit Uni Göttingen entsteht ein 20min Lehrfilm über die Arbeit der Archive. Die Rohfassung liegt vor
- mit Universität Münster entsteht ein Lehrfilm über die Arbeit der Historiker in Archiven
- mit edicam entsteht ein dreiteiliger (á 3min) Imagefilm über das Landesarchiv NRW
6) Erfahrung hat das Landesarchiv mit dem Detmolder Film
Bemerkenswerte Diskussion:
- der sächsische Film sei eine "Peinlichkeit"; sowohl Stimme als auch Aussagen der Hauptdarstellerin wurden beanstandet
- der Detmolder Film führe eine "Benutzerguerilla" vor. Der Film vermittelt ein vollständig falsches Bild
- Imagefilm sollten kurz und so profesionell wie möglich sein (die Kollegen Staatsarchivare scheinen ja genug zu haben)
- Sind Filme ein weiterer Werbekanal für archivische Öffentlichkeitsarbeit? Die Frage der angehenden Kollegin der FH Potsdam blieb unbeantwortet. Daher von mir: selbstverständlich sind sie dies; man sollte sich einmal die Web 2.0-Aktivitäten der Museen ansehen, die wie selbstverständlich ihre großen Ausstellungen mit mindestens einem Filmbeitrag im Netz bewerben.
- Inwieweit die von Rehm angeregte Kooperation mit lokalen Fernsehsendern zu durch das Archiv im Web verwendbaren Ergebnissen führt, bleibt abzuwarten.
Sander:
1) "Ich hätte mir mehr davon versprochen"
2) Ansonsten nichts Neues zum Wikimedia-Projekt des Bundesarchivs. Der Eindruck unendlicher Bläuigkeit des Bundesarchivs bei diesem für das deutsche Archivwesen wegweisenden Projekt wurde auch in Bremen nicht entkräftet.
Wolf Thomas - am Freitag, 23. September 2011, 19:50 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
"..... 1. Zugang – Gebühren – Amtshilfe: Umgang mit Personenstandsunterlagen im Jahr 3 nach der Reform
Moderation: Dr. Urich Nieß (Mannheim)
Kurzstatements mit anschließender Diskussion:
Dr. Robert Zink (Bamberg): Archivische Zuständigkeiten für Personenstandsunterlagen im Überblick
Dr. Johannes Rosenplänter (Kiel): Zwischen Paragraphen und Pragmatismus: Personenstandsunterlagen in der Benutzung
Dr. Jochen Rath (Bielefeld): Die Offenbarung – und deren Verbot im Archiv: Adoptionshinweise in Registern ...."
Link zum Tagungsprogramm
Zink:
Prolog: Es ist befremdlich, wenn der Vorsitzende des BKK-IT-Ausschusses seine Präsentation nicht starten kann. Zu spät ist er jedenfalls nicht gekommen, denn er hat vor mir den Frühstücksraum verlassen.
1) Archivische Zuständigkeiten regeln sich nach dem "Stammlandprinzip", nach Gesetzen des Bundes bzw. der Länder oder nach Tradition
2) § 7 PStG schreibt die Anbietung an das "zuständige, öffentliche Archiv" vor
- i.V.m. wird die Regelung für die Sammelakten durch eine Rechtsverordnung der Länder vorgesehen
-§ 25 regelt die Übernahme
3) Die Länderregelungen sind notwendig, da Art. 85 GG vorsieht, dass durch ein Bundesgesetz keine Aufgaben an Kommunen gegeben werden können.
4) Die Aufgabenübertragung kann daher erfolgen durch
- Anpassungsgesetz der Länder,
- Rechtsverordnung der Länder,
- Empfehlungen der Archivpflege oder der kommunalen Spitzenverbände
- eine Ländervorschrift ist wegen der Ansicht, dass Archivierung Teil der kommunalen Selbstverwaltung ist, rechtlich strittig.
5) 3 Modelle:
- Kommunalmodell: Erst-, Zweitscchriften und Sammelakten im Kommunalarchiv
- Staatsmodell: Erstschriften und Sammelakten im Kommunalarchiv, Zweitschriften im Staatsarchiv (z. B. NRW)
- Stadtstaatenmodell: Erst-, Zweitscchriften und Sammelakten im Staatsarchiv (z. B. Berlin Hamburg)
6) Offene Fragen:
- Sonderstandesamt Berlin II
- Kassation der Zweitschriften in der DDR 1976
- Finanzierung lt. Konnexitätsprinzig müssten der Bund bzw. die Länder die Kommunen bei der Aufgabenerledigung unterstützen
- Archivierung der elektronischen Register ab 1.1.2014:
zentral, dezentral, Landeszentralregister
Verbleib der "Sicherungsregister"
Rosenplänter:
1) Der Flickenteppich der Benutzungsregelung reicht von der Vorlage der Originale im Staatsarchiv Hamburg bis zur Versagung der Benutzung aus konservatorischen Gründen im Stadtarchiv Nürnberg (dort allerdings Aufbau einer Umfangreichen Datenbank: http://stadtarchiv.nuernberg.de/aktuelles/personenstandsunterlagen.html )
2) Sperrung der Bestände aus rechtlichen Gründen, wenn schutzwürdige Belange Betroffener oder Dritter vorliegen:
- z. B. in Kiel bei Totgeburten aus dem Jahr 1952 lebten die Eltern noch
-z. B. Kinder in Heiratsregister (Bildunterschrift "Geburt- und Eheschließung von Kindern 1930" - wie geht das?)
3) Schäfer (Staatsarchiv Hamburg): Im PStG genannte Schutzfristen sind die Grenzen, danach ist eine Versagung nur aus besonderen Gründen möglich. "Es geht um die Bereitstellung von"
4) Hecker (Stadtarchiv München): "Schutzfristen stehen im Archivgesetz"
Rath:
1) Offenbarungsverbot für Adoptionen (und Transsexuelle) regelt § 1758 BGB
2) Entsrechende Nachträge finden sich irregulär in Heiratsregister. Vernachlässigbar sind wegen der Fristen die Eintträge in den Geburtsregister
3) In Bielefeld fanden sich in 463 Heiratsregisterbänden 226 Fälle in 16 der 17 Standesamtsbezirke
4) Lösung: Rote Markierung der Einbände und interne Eintrag in die Archivdatenbank; Vorlage der markierten Bände erfolgt mit Papiermanschette, ggf. durch Einzelkopie
Tiemann (Münster) forderte eine archivisch einheitliche Auslegung des Rechtsbefriff "schutzwürdige Belange Betroffener oder Dritter" im Kontext des PStG. Nieß (Mannheim) schlägt ein Rechtsgutachten vor.
Moderation: Dr. Urich Nieß (Mannheim)
Kurzstatements mit anschließender Diskussion:
Dr. Robert Zink (Bamberg): Archivische Zuständigkeiten für Personenstandsunterlagen im Überblick
Dr. Johannes Rosenplänter (Kiel): Zwischen Paragraphen und Pragmatismus: Personenstandsunterlagen in der Benutzung
Dr. Jochen Rath (Bielefeld): Die Offenbarung – und deren Verbot im Archiv: Adoptionshinweise in Registern ...."
Link zum Tagungsprogramm
Zink:
Prolog: Es ist befremdlich, wenn der Vorsitzende des BKK-IT-Ausschusses seine Präsentation nicht starten kann. Zu spät ist er jedenfalls nicht gekommen, denn er hat vor mir den Frühstücksraum verlassen.
1) Archivische Zuständigkeiten regeln sich nach dem "Stammlandprinzip", nach Gesetzen des Bundes bzw. der Länder oder nach Tradition
2) § 7 PStG schreibt die Anbietung an das "zuständige, öffentliche Archiv" vor
- i.V.m. wird die Regelung für die Sammelakten durch eine Rechtsverordnung der Länder vorgesehen
-§ 25 regelt die Übernahme
3) Die Länderregelungen sind notwendig, da Art. 85 GG vorsieht, dass durch ein Bundesgesetz keine Aufgaben an Kommunen gegeben werden können.
4) Die Aufgabenübertragung kann daher erfolgen durch
- Anpassungsgesetz der Länder,
- Rechtsverordnung der Länder,
- Empfehlungen der Archivpflege oder der kommunalen Spitzenverbände
- eine Ländervorschrift ist wegen der Ansicht, dass Archivierung Teil der kommunalen Selbstverwaltung ist, rechtlich strittig.
5) 3 Modelle:
- Kommunalmodell: Erst-, Zweitscchriften und Sammelakten im Kommunalarchiv
- Staatsmodell: Erstschriften und Sammelakten im Kommunalarchiv, Zweitschriften im Staatsarchiv (z. B. NRW)
- Stadtstaatenmodell: Erst-, Zweitscchriften und Sammelakten im Staatsarchiv (z. B. Berlin Hamburg)
6) Offene Fragen:
- Sonderstandesamt Berlin II
- Kassation der Zweitschriften in der DDR 1976
- Finanzierung lt. Konnexitätsprinzig müssten der Bund bzw. die Länder die Kommunen bei der Aufgabenerledigung unterstützen
- Archivierung der elektronischen Register ab 1.1.2014:
zentral, dezentral, Landeszentralregister
Verbleib der "Sicherungsregister"
Rosenplänter:
1) Der Flickenteppich der Benutzungsregelung reicht von der Vorlage der Originale im Staatsarchiv Hamburg bis zur Versagung der Benutzung aus konservatorischen Gründen im Stadtarchiv Nürnberg (dort allerdings Aufbau einer Umfangreichen Datenbank: http://stadtarchiv.nuernberg.de/aktuelles/personenstandsunterlagen.html )
2) Sperrung der Bestände aus rechtlichen Gründen, wenn schutzwürdige Belange Betroffener oder Dritter vorliegen:
- z. B. in Kiel bei Totgeburten aus dem Jahr 1952 lebten die Eltern noch
-z. B. Kinder in Heiratsregister (Bildunterschrift "Geburt- und Eheschließung von Kindern 1930" - wie geht das?)
3) Schäfer (Staatsarchiv Hamburg): Im PStG genannte Schutzfristen sind die Grenzen, danach ist eine Versagung nur aus besonderen Gründen möglich. "Es geht um die Bereitstellung von"
4) Hecker (Stadtarchiv München): "Schutzfristen stehen im Archivgesetz"
Rath:
1) Offenbarungsverbot für Adoptionen (und Transsexuelle) regelt § 1758 BGB
2) Entsrechende Nachträge finden sich irregulär in Heiratsregister. Vernachlässigbar sind wegen der Fristen die Eintträge in den Geburtsregister
3) In Bielefeld fanden sich in 463 Heiratsregisterbänden 226 Fälle in 16 der 17 Standesamtsbezirke
4) Lösung: Rote Markierung der Einbände und interne Eintrag in die Archivdatenbank; Vorlage der markierten Bände erfolgt mit Papiermanschette, ggf. durch Einzelkopie
Tiemann (Münster) forderte eine archivisch einheitliche Auslegung des Rechtsbefriff "schutzwürdige Belange Betroffener oder Dritter" im Kontext des PStG. Nieß (Mannheim) schlägt ein Rechtsgutachten vor.
Wolf Thomas - am Freitag, 23. September 2011, 19:09 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Mir kommen fast die Tränen, lese ich bei Schmalenstroer:
Auf der gleichen Pressekonferenz wurde verkündet, dass eine halbe Milliarde Menschen täglich Facebook nutzen. Früher oder später wird daher ein Historiker völlig zurecht fragen, wie diese Plattform aussah, auf der immerhin ein Vierzehntel der Weltbevölkerung ihre Zeit verplempert hat. Da es aber kein Backup, kein Archiv und keine lokale Installation von Facebook gibt, wird der zukünftige Historiker es recht schwer haben. Er kann mit Hilfe von Screenshots versuchen, die Funktionen zu rekonstruieren. Hier öffnet sich ein Loch in unserem archivierten Wissen: Behörden haben Archive. Firmen auch. Verwaltungsakte sind leicht zu rekonstruieren. Musik, Bücher, Zeitschriften, Filme gibt es auf festen, irgendwie doch greifbaren Tonträgern. Einzelne, nicht dynamische Webseiten archiviert das Internet Archive. Das bisherige Facebook wird hingegen demnächst für immer verschwinden.
http://schmalenstroer.net/blog/2011/09/facebooks-groes-timeline-experiment-als-problem-fr-zuknftige-historiker/
Auf der gleichen Pressekonferenz wurde verkündet, dass eine halbe Milliarde Menschen täglich Facebook nutzen. Früher oder später wird daher ein Historiker völlig zurecht fragen, wie diese Plattform aussah, auf der immerhin ein Vierzehntel der Weltbevölkerung ihre Zeit verplempert hat. Da es aber kein Backup, kein Archiv und keine lokale Installation von Facebook gibt, wird der zukünftige Historiker es recht schwer haben. Er kann mit Hilfe von Screenshots versuchen, die Funktionen zu rekonstruieren. Hier öffnet sich ein Loch in unserem archivierten Wissen: Behörden haben Archive. Firmen auch. Verwaltungsakte sind leicht zu rekonstruieren. Musik, Bücher, Zeitschriften, Filme gibt es auf festen, irgendwie doch greifbaren Tonträgern. Einzelne, nicht dynamische Webseiten archiviert das Internet Archive. Das bisherige Facebook wird hingegen demnächst für immer verschwinden.
http://schmalenstroer.net/blog/2011/09/facebooks-groes-timeline-experiment-als-problem-fr-zuknftige-historiker/
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/online-publikationen-dhi-rom/mittelalter/signaturenliste
Übrigens: Voller Copyright-Vermerk mit Drohungen und CC-Lizenz beißt sich!
Übrigens: Voller Copyright-Vermerk mit Drohungen und CC-Lizenz beißt sich!
KlausGraf - am Freitag, 23. September 2011, 13:29 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.allgemeine-zeitung.de/region/kultur/literatur/11188948.htm
Einen Sensationsfund wittert Annelen Ottermann, Abteilungsleiterin für Handschriften, Rara und Alte Drucke in der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek. Schon vor einigen Jahren wurde hier der Pergamentumschlag eines historischen Druckes von 1545 entdeckt. Was man Mitte des 16. Jahrhunderts für „Abfall“ gehalten hatte, so die Entdeckung von Ottermann, habe sich nach Ablösung als Fragment einer illustrierten Apokalypsenhandschrift aus der Wende von 9. zum 10. Jahrhundert entpuppt.
Der Fund sei in vielfacher Hinsicht atemberaubend: Frühmittelalterliche illuminierte Apokalypsenhandschriften seien von äußerster Seltenheit - zu nennen sind hier allen voran die frühkarolingische Handschrift der Stadtbibliothek Trier - erklärt die Expertin. Auch die Zahl der bislang bekannten Fragmente sei begrenzt. Das Mainzer Fragment mit der Signatur Ms facs [recte: frag] 18 müsse, nach allem was bislang bekannt sei, nach der Vorlage der Trierer Handschrift um 900 und mit großer Wahrscheinlichkeit im nördlichen Frankreich entstanden sein.
Auf der Innenseite, die vor der Ablösung verborgen und damit über Jahrhunderte geschützt war, zeigt das 27 mal 19 Zentimeter große, von einer Bordüre gerahmte Fragment die Vision auf Patmos nach Apc. I, 7-10.
Die Textseite hält eine weitere Überraschung für die Handschriftenforschung bereit. Es handelt sich hier nämlich nicht um den reinen Text der Johannes-Apokalypse, sondern um das Fragment des Apokalypsenkommentars von Beda Venerabilis. Das Mainzer Fragment, so Ottermann, sei damit das früheste Zeugnis eines illuminierten Kommentars zum letzten Buch der Bibel außerhalb der spanischen Überlieferung.

Einen Sensationsfund wittert Annelen Ottermann, Abteilungsleiterin für Handschriften, Rara und Alte Drucke in der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek. Schon vor einigen Jahren wurde hier der Pergamentumschlag eines historischen Druckes von 1545 entdeckt. Was man Mitte des 16. Jahrhunderts für „Abfall“ gehalten hatte, so die Entdeckung von Ottermann, habe sich nach Ablösung als Fragment einer illustrierten Apokalypsenhandschrift aus der Wende von 9. zum 10. Jahrhundert entpuppt.
Der Fund sei in vielfacher Hinsicht atemberaubend: Frühmittelalterliche illuminierte Apokalypsenhandschriften seien von äußerster Seltenheit - zu nennen sind hier allen voran die frühkarolingische Handschrift der Stadtbibliothek Trier - erklärt die Expertin. Auch die Zahl der bislang bekannten Fragmente sei begrenzt. Das Mainzer Fragment mit der Signatur Ms facs [recte: frag] 18 müsse, nach allem was bislang bekannt sei, nach der Vorlage der Trierer Handschrift um 900 und mit großer Wahrscheinlichkeit im nördlichen Frankreich entstanden sein.
Auf der Innenseite, die vor der Ablösung verborgen und damit über Jahrhunderte geschützt war, zeigt das 27 mal 19 Zentimeter große, von einer Bordüre gerahmte Fragment die Vision auf Patmos nach Apc. I, 7-10.
Die Textseite hält eine weitere Überraschung für die Handschriftenforschung bereit. Es handelt sich hier nämlich nicht um den reinen Text der Johannes-Apokalypse, sondern um das Fragment des Apokalypsenkommentars von Beda Venerabilis. Das Mainzer Fragment, so Ottermann, sei damit das früheste Zeugnis eines illuminierten Kommentars zum letzten Buch der Bibel außerhalb der spanischen Überlieferung.

KlausGraf - am Freitag, 23. September 2011, 09:46 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"... Sektionssitzung 3: Rechte und Pflichten der Archive, Rechtsfragen der Nutzung
Leitung: Dr. Ulrike Gutzmann (Wolfsburg)
Berichterstattung: Dr. Monika Storm (Mainz)
Dr. Peter Sandner (Wiesbaden): Von der Findmitteldatenbank zum virtuellen Lesesaal im Netz. Rechtliche Fragen bei der Umgestaltung des Archivinformationssystems HADIS
Prof. Dr. Johannes Weberling (Berlin): Besondere Anforderungen der Aufarbeitung totalitärer Systeme für Archivgesetze am Beispiel des Stasi-Unterlagen-Gesetzes und der SAPMO
Dr. Wolfgang Zimmermann (Karlsruhe): Strategische Allianz oder unliebsame Konkurrenz? Rechtliche Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit von Archiven mit genealogischen Online-Anbietern
..."
Link
Notizen:
Sandner:
1) Veränderte Benutzererwartungen + Bereitstellung von Digitalisaten = HADIS 2
-individualsierte Nutzung
- Vorrang für Digitalisatnutzung
- Workflow für Nutzung und Recherche
2) Rechtsgebiete
-Allg. Datenschutz (Beteiligung von ca. 20 Archiven) führt zur Einschaltung des Datenschutzbeauftragten (Sammlung von Nutzerdaten)
- Barrierefreiheit !
- ArchivG: Zulässigkeit von Onlinepublikation der Findmittelo (analog ArchivG NRW)
- NutzungsO: neue Nutzungsform ("online")
- GebührenO: angedacht pauschale Abgeltung der Nutzung
-UrhG: Kein geschütztes Material im vrtuellen Lesesaal
Weberling :
1) Archive müssen Wissenschaftsfreiheit herstellen
- Art. 5 (3) GG versus Art. 1 (1), 2( 1) GG
2) Aufarbeitung der SED-Diktatur liegt im öffentlichen Interesse (s. z. B. § 32a BStU-Gesetz)
3) Verbreitung uangenehmer, wahrer Tatsachen (IM-Benennung) stellen keine Beeinträctigung des Sozialphäre des Betroffenen dar
Zimmermann:
1) Genealogie entspringt dem Recht auf eigene Geschichte
2) "Archiv für alle" muss verantwortbare Zugänge liefern
3) Kooperationen zwischen Archiv und Anbieter muss unter folgenden Prämissen stattfinden:
- Eigentum der Bestände bleibt beim Archiv
-nur Bestände ohne geschützte Angaben
3) Online werden Bestände und Indices angeboten
4) Vertrag regelt:
- Aufgabenverteilung (Digitalisierung, Indexerstellung)
- Eigentumsverhältnisse (Bestände: Archiv, Indices: Anbieter)
- Nutzungs- und Verwertungsrechte (Einfaches Nutzungsrecht an Indices für Archive)
5) Präsentationsformen:
- vernetzt: Bestände: Archiv, Indices: Anbieter
- exklusiv: Bestände und Indices bei Anbieter
- parallel: Bestände bei Archiv, Bestände und Indices bei Anbieter
Leitung: Dr. Ulrike Gutzmann (Wolfsburg)
Berichterstattung: Dr. Monika Storm (Mainz)
Dr. Peter Sandner (Wiesbaden): Von der Findmitteldatenbank zum virtuellen Lesesaal im Netz. Rechtliche Fragen bei der Umgestaltung des Archivinformationssystems HADIS
Prof. Dr. Johannes Weberling (Berlin): Besondere Anforderungen der Aufarbeitung totalitärer Systeme für Archivgesetze am Beispiel des Stasi-Unterlagen-Gesetzes und der SAPMO
Dr. Wolfgang Zimmermann (Karlsruhe): Strategische Allianz oder unliebsame Konkurrenz? Rechtliche Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit von Archiven mit genealogischen Online-Anbietern
..."
Link
Notizen:
Sandner:
1) Veränderte Benutzererwartungen + Bereitstellung von Digitalisaten = HADIS 2
-individualsierte Nutzung
- Vorrang für Digitalisatnutzung
- Workflow für Nutzung und Recherche
2) Rechtsgebiete
-Allg. Datenschutz (Beteiligung von ca. 20 Archiven) führt zur Einschaltung des Datenschutzbeauftragten (Sammlung von Nutzerdaten)
- Barrierefreiheit !
- ArchivG: Zulässigkeit von Onlinepublikation der Findmittelo (analog ArchivG NRW)
- NutzungsO: neue Nutzungsform ("online")
- GebührenO: angedacht pauschale Abgeltung der Nutzung
-UrhG: Kein geschütztes Material im vrtuellen Lesesaal
Weberling :
1) Archive müssen Wissenschaftsfreiheit herstellen
- Art. 5 (3) GG versus Art. 1 (1), 2( 1) GG
2) Aufarbeitung der SED-Diktatur liegt im öffentlichen Interesse (s. z. B. § 32a BStU-Gesetz)
3) Verbreitung uangenehmer, wahrer Tatsachen (IM-Benennung) stellen keine Beeinträctigung des Sozialphäre des Betroffenen dar
Zimmermann:
1) Genealogie entspringt dem Recht auf eigene Geschichte
2) "Archiv für alle" muss verantwortbare Zugänge liefern
3) Kooperationen zwischen Archiv und Anbieter muss unter folgenden Prämissen stattfinden:
- Eigentum der Bestände bleibt beim Archiv
-nur Bestände ohne geschützte Angaben
3) Online werden Bestände und Indices angeboten
4) Vertrag regelt:
- Aufgabenverteilung (Digitalisierung, Indexerstellung)
- Eigentumsverhältnisse (Bestände: Archiv, Indices: Anbieter)
- Nutzungs- und Verwertungsrechte (Einfaches Nutzungsrecht an Indices für Archive)
5) Präsentationsformen:
- vernetzt: Bestände: Archiv, Indices: Anbieter
- exklusiv: Bestände und Indices bei Anbieter
- parallel: Bestände bei Archiv, Bestände und Indices bei Anbieter
Wolf Thomas - am Donnerstag, 22. September 2011, 20:41 - Rubrik: Archivrecht
Nach Auskunft von Beatrix Zumbült, wiss. Mitarbeiterin bei der Dr. Jörn Günther Rare Books AG (Stalden/Schweiz), befindet sich die seit dem beginnenden 20. Jahrhundert wiederholt im Antiquariatshandel angebotene Handschrift mit dem 'Speculum humanae salvationis', dt. ('Spiegel menschlicher behaltnis'), die sich zuletzt in Amsterdam in der Bibliotheca Philosophica Hermetica unter der Signatur BPH 78 befand, inzwischen im Besitz der Dr. Jörn Günther Rare Books AG, Stalden/Schweiz.
http://www.handschriftencensus.de/news
Zur BPH
http://archiv.twoday.net/search?q=hermetic
Zur Handschrift
http://www.archive.org/stream/manuscriptedesm00firgoog#page/n35/mode/2up =
http://books.google.de/books?id=z7gZAAAAMAAJ&pg=PA13 (US-Proxy)
http://www.handschriftencensus.de/news
Zur BPH
http://archiv.twoday.net/search?q=hermetic
Zur Handschrift
http://www.archive.org/stream/manuscriptedesm00firgoog#page/n35/mode/2up =
http://books.google.de/books?id=z7gZAAAAMAAJ&pg=PA13 (US-Proxy)
KlausGraf - am Donnerstag, 22. September 2011, 19:59 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"..... Sektionssitzung 2: Rechtsfragen im Kontext von Übernahmen und Sicherung
Leitung: Mag. Dr. Irmgard Christa Becker (Marburg)
Berichterstattung: Dr. Jens Blecher M.A. (Leipzig)
Drs. Hans Waalwijk (Amsterdam/Niederlande): (R)echt digital. Ein Vergleich deutscher und niederländischer Gesetzgebung über die Originalität Born digital Unterlagen
Hans-Joachim Hecker (München): Entwendet und beschädigt - Verfolgung des Täters und Schutz des Archivguts
Joachim Küppers (Neuss [Rechtsamt]): Sicherung von Archivgut (kommunaler) Unternehmen - Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen!
....."
Link
Notizen:
Waalwijk :
1) Wäre auch ein Tagungsthema gewesen: "Langweilige Archivare beschäftigen sich mit langweiliger Gesetzgebung, oder?"
2) Digitales Nichtschriftgut ist weder in den Niederlanden noch in Deutschland gesetzlich gefasst.
3) Langzeitarchivierung sollte da anfangen, bevor das born digital das Licht der Welt erblickt.
4) Daraus folgt eine Erhöhung der Archivreichweite (s. Schäfers Forderung zur Querschnittsgesetzgebung): Schriftgut-Verwaltung-Registratur-Zwischenarchiv-Archiv!
5) Erschließung der digitalen Unterlagen erfolgt durch Zufügen von Metadaten - quasi wie bisher.
Hecker:
Neben den Archivgesetzen sind folgende Bestimmungen für den Schutz von Archivgut zu beachten:
§ 242, §243 Abs. 1 Ziff 5 StGB Diebstahl
- die zweite Norm gilt für Archivgut mit wissenschaftlicher Relevanz und zieht ein höheres Strafmaß nach sich
-gilt für alle öffentlichen Archiv (incl der Deposita)
§ 303, 304 StGB Sachbeschädigung
- auch gilt die 2. Norm für Archivgut mit wissenschaftlicher Relevanz (gemeinschädliche Sachbeschädigung
§ 303a, b StGB "Datenklau"
§ 133 StGB Verwahrungsbruch (Strafakte gegen die öffentliche Ordnung)
- u. a. Beschädigung, Zerstörung, Unbrauchbarmachung und Entziehung aus der öffentlichen Gewahrsam von Akten, .....
- während bei Bibliotheken und Museen kein öffentliches Gewahrsam vorliegt nimmt die Rechtsprechung bzw. Literatur dies bei Archiven an.
- Lt. Strafstatitstik wurden in den Jahren 1996 bis 2006 ca. 35 Fälle im Jahr ermittelt
- hohe Dunkelziffer: ".... in der Öffentlichkeit ein Massendelikt ...."
- Zitat: " ..... "Sie glauben doch nicht, dass Sie alles bekommen haben. [O-Ton eines Beamten bei einer Aktenübergabe] Eigentlich ist das eine Selbstbezichtigung. ...."
Was darf man im begründeten Verdachtsfall tun?
§ 127 StPO (evt § 229 BGB) erlauben dass Festhalten des Verdächtigen mit angemessener körperlicher Gewalt ("Anspringen"). Für alle weiteren Schritte ist die Polizei zu rufen!
Küppers:
Für alle kommunalen Unternehmen (Eigenbetriebe, AöR, AG, Gmbh) gilt , dass die Unterlagen, die vor der Privatisierung entstanden sind, gemäß § 10 (5) i.V.m. § 4 (2) ArchivG NW dem Kommunalarchiv anzubieten sind.
Nach der Privatisierung sind lediglich die Eigenbetriebe abgabepflichtig, die nicht am wirtschaftlichen Leben teilnehmen abgabepflichtig. Regelung sollte per Dienstanweisung erfolgen.
Bei allen übrigen Organisationsformen ist der jurisitisch sauberste Weg, der der Satzungsänderung (evt reichen Vorstands-, bzw. Gesellschafterbeschluß)
Leitung: Mag. Dr. Irmgard Christa Becker (Marburg)
Berichterstattung: Dr. Jens Blecher M.A. (Leipzig)
Drs. Hans Waalwijk (Amsterdam/Niederlande): (R)echt digital. Ein Vergleich deutscher und niederländischer Gesetzgebung über die Originalität Born digital Unterlagen
Hans-Joachim Hecker (München): Entwendet und beschädigt - Verfolgung des Täters und Schutz des Archivguts
Joachim Küppers (Neuss [Rechtsamt]): Sicherung von Archivgut (kommunaler) Unternehmen - Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen!
....."
Link
Notizen:
Waalwijk :
1) Wäre auch ein Tagungsthema gewesen: "Langweilige Archivare beschäftigen sich mit langweiliger Gesetzgebung, oder?"
2) Digitales Nichtschriftgut ist weder in den Niederlanden noch in Deutschland gesetzlich gefasst.
3) Langzeitarchivierung sollte da anfangen, bevor das born digital das Licht der Welt erblickt.
4) Daraus folgt eine Erhöhung der Archivreichweite (s. Schäfers Forderung zur Querschnittsgesetzgebung): Schriftgut-Verwaltung-Registratur-Zwischenarchiv-Archiv!
5) Erschließung der digitalen Unterlagen erfolgt durch Zufügen von Metadaten - quasi wie bisher.
Hecker:
Neben den Archivgesetzen sind folgende Bestimmungen für den Schutz von Archivgut zu beachten:
§ 242, §243 Abs. 1 Ziff 5 StGB Diebstahl
- die zweite Norm gilt für Archivgut mit wissenschaftlicher Relevanz und zieht ein höheres Strafmaß nach sich
-gilt für alle öffentlichen Archiv (incl der Deposita)
§ 303, 304 StGB Sachbeschädigung
- auch gilt die 2. Norm für Archivgut mit wissenschaftlicher Relevanz (gemeinschädliche Sachbeschädigung
§ 303a, b StGB "Datenklau"
§ 133 StGB Verwahrungsbruch (Strafakte gegen die öffentliche Ordnung)
- u. a. Beschädigung, Zerstörung, Unbrauchbarmachung und Entziehung aus der öffentlichen Gewahrsam von Akten, .....
- während bei Bibliotheken und Museen kein öffentliches Gewahrsam vorliegt nimmt die Rechtsprechung bzw. Literatur dies bei Archiven an.
- Lt. Strafstatitstik wurden in den Jahren 1996 bis 2006 ca. 35 Fälle im Jahr ermittelt
- hohe Dunkelziffer: ".... in der Öffentlichkeit ein Massendelikt ...."
- Zitat: " ..... "Sie glauben doch nicht, dass Sie alles bekommen haben. [O-Ton eines Beamten bei einer Aktenübergabe] Eigentlich ist das eine Selbstbezichtigung. ...."
Was darf man im begründeten Verdachtsfall tun?
§ 127 StPO (evt § 229 BGB) erlauben dass Festhalten des Verdächtigen mit angemessener körperlicher Gewalt ("Anspringen"). Für alle weiteren Schritte ist die Polizei zu rufen!
Küppers:
Für alle kommunalen Unternehmen (Eigenbetriebe, AöR, AG, Gmbh) gilt , dass die Unterlagen, die vor der Privatisierung entstanden sind, gemäß § 10 (5) i.V.m. § 4 (2) ArchivG NW dem Kommunalarchiv anzubieten sind.
Nach der Privatisierung sind lediglich die Eigenbetriebe abgabepflichtig, die nicht am wirtschaftlichen Leben teilnehmen abgabepflichtig. Regelung sollte per Dienstanweisung erfolgen.
Bei allen übrigen Organisationsformen ist der jurisitisch sauberste Weg, der der Satzungsänderung (evt reichen Vorstands-, bzw. Gesellschafterbeschluß)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 22. September 2011, 19:52 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 22. September 2011, 19:29 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Gemeinsame Arbeitssitzung: Informationsgesellschaft und Archivgesetze
Leitung: Dr. Bernhard Post (Weimar)
Berichterstattung: Dr. Eberhard Fritz (Altshausen)
Dr. Fred J.W. van Kan (Arnheim/Niederlande): Seid mutig - Archive dienen der Information und nicht der Geheimhaltung!
Dr. Udo Schäfer (Hamburg): Quod non est in actis, non est in mundo. Zur Funktion öffentlicher Archive im demokratischen Rechtsstaat
Dr. Bartholomäus Manegold (Berlin): Archivrecht? Archivrecht! Zu den verfassungsrechlichen Rahmenbedingungen öffentlicher Archive in Deutschland ...."
Link
"Herr Fred" van Kan verglich die niederländische und deutsche Archivgesetzlage unter Berücksichtgung von Benutzungsversagung. Hauptaufgabe der Archive ist seines Erachtens die Herstellung der Öffentlichkeit nach Maßgabe des Artikels 6 des archivarischen Ehrenkodex.
Uwe Schäfer widmete sich der Aktenmäßigkeit der Verwaltung als Basis für eine rationale Verwaltungsführung. Dessen historische Basis, der Kanon 38 des 4. Laterankonzils (1215), schrieb die Nierschrift von Prozesshandlungen vor kirchlichen Gerichten vor, um die "Rechtmäßigkeit" der Verhandlungen zu dokumentieren. Von dort aus schlug Schäfer in Brücke zu den einschlägigen Entscheidungen bundesrepublikanischer Gerichte: Bundesverfassungsgericht 6.6.1983, Bundesverwaltungsgericht 16.3.1988, 1996 Oberverwaltungsgericht Lüneburg und schließlich 2000 Oberverwaltungsgericht Greifswald, dem eine Umkehr der Beweislast entnommen werden kann, wenn die Verwaltung dem Gebot der Schriftlichkeit nicht nachkommt.
Die zunehmende Digitalisierung des Verwaltungshandels erfodert nach Schäfer ein stärkeres Engagement der Archive bei der Beratung der Behörden zur Stabilisierung der digitalen Unterlagen. Rechtstaats- und Demokratieprinzip gilt es durch Sicherung der digitalen Unterlagen zu wahren. Schäfer postuliert die Erweiterung der Archivgesetz zu Querschnittsgesetzen, die den Archiven die Zuständigkeit für die Schriftgutverwaltung zuschreibt.
Zum Manegold-Vortrag warte ich auf den Tagungsband - s. Titel - vielleicht wird es geschrieben besser.
Nachtrag, 23.9.2011:
Bericht der "flying reporters"
Leitung: Dr. Bernhard Post (Weimar)
Berichterstattung: Dr. Eberhard Fritz (Altshausen)
Dr. Fred J.W. van Kan (Arnheim/Niederlande): Seid mutig - Archive dienen der Information und nicht der Geheimhaltung!
Dr. Udo Schäfer (Hamburg): Quod non est in actis, non est in mundo. Zur Funktion öffentlicher Archive im demokratischen Rechtsstaat
Dr. Bartholomäus Manegold (Berlin): Archivrecht? Archivrecht! Zu den verfassungsrechlichen Rahmenbedingungen öffentlicher Archive in Deutschland ...."
Link
"Herr Fred" van Kan verglich die niederländische und deutsche Archivgesetzlage unter Berücksichtgung von Benutzungsversagung. Hauptaufgabe der Archive ist seines Erachtens die Herstellung der Öffentlichkeit nach Maßgabe des Artikels 6 des archivarischen Ehrenkodex.
Uwe Schäfer widmete sich der Aktenmäßigkeit der Verwaltung als Basis für eine rationale Verwaltungsführung. Dessen historische Basis, der Kanon 38 des 4. Laterankonzils (1215), schrieb die Nierschrift von Prozesshandlungen vor kirchlichen Gerichten vor, um die "Rechtmäßigkeit" der Verhandlungen zu dokumentieren. Von dort aus schlug Schäfer in Brücke zu den einschlägigen Entscheidungen bundesrepublikanischer Gerichte: Bundesverfassungsgericht 6.6.1983, Bundesverwaltungsgericht 16.3.1988, 1996 Oberverwaltungsgericht Lüneburg und schließlich 2000 Oberverwaltungsgericht Greifswald, dem eine Umkehr der Beweislast entnommen werden kann, wenn die Verwaltung dem Gebot der Schriftlichkeit nicht nachkommt.
Die zunehmende Digitalisierung des Verwaltungshandels erfodert nach Schäfer ein stärkeres Engagement der Archive bei der Beratung der Behörden zur Stabilisierung der digitalen Unterlagen. Rechtstaats- und Demokratieprinzip gilt es durch Sicherung der digitalen Unterlagen zu wahren. Schäfer postuliert die Erweiterung der Archivgesetz zu Querschnittsgesetzen, die den Archiven die Zuständigkeit für die Schriftgutverwaltung zuschreibt.
Zum Manegold-Vortrag warte ich auf den Tagungsband - s. Titel - vielleicht wird es geschrieben besser.
Nachtrag, 23.9.2011:
Bericht der "flying reporters"
Wolf Thomas - am Donnerstag, 22. September 2011, 19:24 - Rubrik: Archivrecht
Neelie Kroes, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und zuständig für die Digitale Agenda, möchte einen umfassenden Zugang zu den Daten der öffentlichen Hand schaffen. Auf dem Open Forum Europe Summit 2011 in Brüssel erklärte sie am heutigen Donnerstag, in der Weiterverwendung dieser Daten liege ein noch weitgehend ungenutztes Potenzial. Daher möchte Kroes die seit 2003 bestehende Richtlinie zur Weiterverwendung staatlicher Informationen verbessern: Die Daten der öffentlichen Hand sollen in einfach zu nutzenden Formaten, ohne restriktive Lizenzbedingungen und kostenlos oder für wenig Geld bereitgestellt werden.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Freier-Zugang-zu-staatlichen-Informationen-1348449.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Freier-Zugang-zu-staatlichen-Informationen-1348449.html
KlausGraf - am Donnerstag, 22. September 2011, 19:21 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wie komme ich denn dazu, einer Internetenzyklopädie kostenfrei akademisch professionell recherchierte Inhalte zu schenken, um mich dann als Dank dafür mit fachfremden, neurotischen Ignoranten prügeln zu müssen, die maximal Zugriff auf Google haben?
http://www.kanzleikompa.de/2009/10/28/animal-farm-reloaded-%E2%80%93-der-kompa-und-das-liebe-phi-1/
Mir verschlug es die Sprache. So ein ungehobeltes Subjekt, dessen Selbstdisziplin und Kommunikationsfähigkeit mehr als zu wünschen übrig ließen, war tatsächlich zum Admin aufgestiegen? Ich konnte es nicht fassen.
Heute weiß ich, dass Cyron zur Kardinalsriege in der Wikipedia gehört. Im Rahmen des aktuellen Streits um die Relevanzkriterien bin ich ihm an verschiedenen Stellen wieder beobachtend begegnet. In jedem zweiten Beitrag lässt er einen Kraftausdruck fallen. Es war für mich nicht ansatzweise nachvollziehbar, wie man einen solchen Menschen die Kompetenz zur öffentlichen Kommunikation zubilligen konnte. [...] Cyron markierte für mich endgültig, dass die Wikipedia auf den Hund gekommen war.
Cyron, der RL krankheitsbedingt immer mit gesenktem Blick herumschlurft, ist übrigens mit einem eher mäßigen Artikel Zedler-Preisträger.
http://www.kanzleikompa.de/2009/11/16/animal-farm-reloaded-%E2%80%93-der-kompa-und-das-liebe-phi-4/
Letzte Folge:
http://www.kanzleikompa.de/2011/09/21/animal-farm-reloaded-%E2%80%93-der-kompa-und-das-liebe-phi-5/
Zum Kontext:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Sperrpr%C3%BCfung&oldid=93944807
Die Wikipedia-Admins sind überwiegend eine erbärmliche Mischpoke.
 http://wiki.coldmirror.net
http://wiki.coldmirror.net
http://www.kanzleikompa.de/2009/10/28/animal-farm-reloaded-%E2%80%93-der-kompa-und-das-liebe-phi-1/
Mir verschlug es die Sprache. So ein ungehobeltes Subjekt, dessen Selbstdisziplin und Kommunikationsfähigkeit mehr als zu wünschen übrig ließen, war tatsächlich zum Admin aufgestiegen? Ich konnte es nicht fassen.
Heute weiß ich, dass Cyron zur Kardinalsriege in der Wikipedia gehört. Im Rahmen des aktuellen Streits um die Relevanzkriterien bin ich ihm an verschiedenen Stellen wieder beobachtend begegnet. In jedem zweiten Beitrag lässt er einen Kraftausdruck fallen. Es war für mich nicht ansatzweise nachvollziehbar, wie man einen solchen Menschen die Kompetenz zur öffentlichen Kommunikation zubilligen konnte. [...] Cyron markierte für mich endgültig, dass die Wikipedia auf den Hund gekommen war.
Cyron, der RL krankheitsbedingt immer mit gesenktem Blick herumschlurft, ist übrigens mit einem eher mäßigen Artikel Zedler-Preisträger.
http://www.kanzleikompa.de/2009/11/16/animal-farm-reloaded-%E2%80%93-der-kompa-und-das-liebe-phi-4/
Letzte Folge:
http://www.kanzleikompa.de/2011/09/21/animal-farm-reloaded-%E2%80%93-der-kompa-und-das-liebe-phi-5/
Zum Kontext:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Sperrpr%C3%BCfung&oldid=93944807
Die Wikipedia-Admins sind überwiegend eine erbärmliche Mischpoke.
 http://wiki.coldmirror.net
http://wiki.coldmirror.netnoch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.vensteropleuven.be/
Eine gemeinschaftliche Bilddatenbank von UB, Museum und Stadtarchiv. Die Auflösung könnte besser sein.

Eine gemeinschaftliche Bilddatenbank von UB, Museum und Stadtarchiv. Die Auflösung könnte besser sein.

KlausGraf - am Donnerstag, 22. September 2011, 16:27 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.internet-law.de/2011/09/kann-ein-geschmacksmuster-zitiert-werden.html
RA Stadler macht auf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=57668&pos=0&anz=630
aufmerksam, ohne
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschmacksmuster#Geschmacksmuster_und_Bildrechte
zu zitieren.

RA Stadler macht auf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=57668&pos=0&anz=630
aufmerksam, ohne
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschmacksmuster#Geschmacksmuster_und_Bildrechte
zu zitieren.

KlausGraf - am Donnerstag, 22. September 2011, 16:16 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.lndb.lv/lv/Lapas/DigitalObject/urn.nbn.lv-digi-6175?returl=WhatsNew
Ich möchte damit auf die
Exlibris-Digitalisate (Schwerpunkt 20. Jh.) der Lettischen Digitalen Bibliothek aufmerksam
machen:
http://www.lndb.lv/lv/Lapas/DigitalObjectsSearchResult.aspx?t=c&colid=2482
KlausGraf - am Donnerstag, 22. September 2011, 16:01 - Rubrik: Bildquellen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
RePEc, das Nachweisinstrument zu Publikationen und Preprints in den Wirtschaftswissenschaften, stellt seinen Nutzern einen neuen Service zur Diskussion: Ein Peer Review Showcase für herausragende Gutachten zu Artikeln aus den Wirtschaftswissenschaften.
http://www.scinoptica.com/pages/topics/peer-review-showroom-bei-repec.php
Begrüßenswert!
http://www.scinoptica.com/pages/topics/peer-review-showroom-bei-repec.php
Begrüßenswert!
KlausGraf - am Donnerstag, 22. September 2011, 15:28 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://mediahistoryproject.org/
We are a non-profit initiative dedicated to digitizing collections of classic media periodicals that belong in the public domain for full public access.
Die Inhalte, meist nach 1922 erschienen, sind allenfalls Public Domain in den USA.
Via
http://weblog.hist.net/archives/5829/

We are a non-profit initiative dedicated to digitizing collections of classic media periodicals that belong in the public domain for full public access.
Die Inhalte, meist nach 1922 erschienen, sind allenfalls Public Domain in den USA.
Via
http://weblog.hist.net/archives/5829/

KlausGraf - am Donnerstag, 22. September 2011, 14:48 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Pendant zum "Fabian":
http://hhch.eurospider.com/spezialsammlungen/alte-drucke-rara/handbuchhistorisch/index.html
"Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland, Österreich und Europa" (ohne die Schweiz)
http://134.76.163.162/fabian
 Foto: stibiwiki, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Foto: stibiwiki, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://hhch.eurospider.com/spezialsammlungen/alte-drucke-rara/handbuchhistorisch/index.html
"Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland, Österreich und Europa" (ohne die Schweiz)
http://134.76.163.162/fabian
 Foto: stibiwiki, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Foto: stibiwiki, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.deKlausGraf - am Donnerstag, 22. September 2011, 14:41 - Rubrik: Bibliothekswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 22. September 2011, 14:05 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 22. September 2011, 12:57 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen




