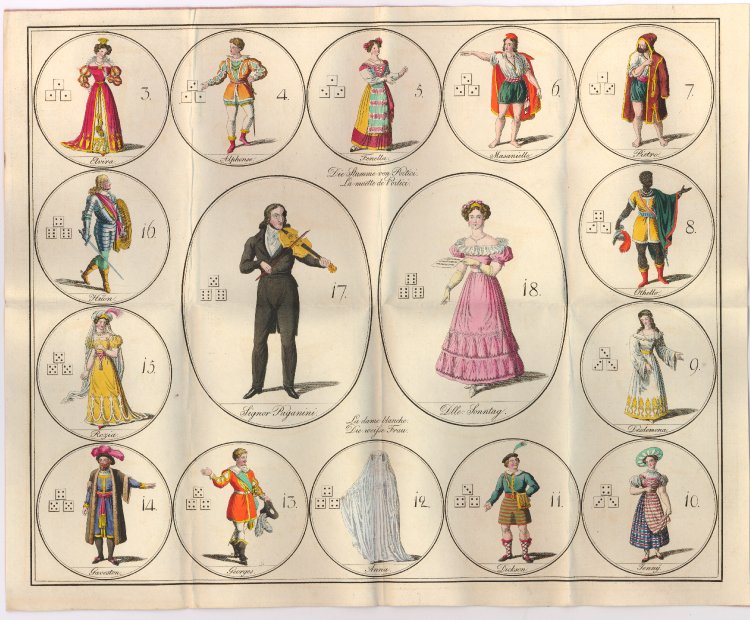KlausGraf - am Freitag, 21. November 2008, 19:07 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die von mir anlässlich der Besprechung des Buchs von Lehment über das Fotografieren von Kunstgegenständen
http://archiv.twoday.net/stories/5333018/
kürzlich problematisierte Thematik hat durch eine Gerichtsentscheidung besondere Brisanz gewonnen.
http://www.pr-inside.com/de/fuer-kommerzielle-fotos-von-sanssouci-darf-r930308.htm
Potsdam (AP) Für das kommerzielle Fotografieren des berühmten Potsdamer Schlosses Sanssouci sowie der anderen historischen Herrenhäuser und Gärten der Region dürfen weiter Gebühren kassiert werden. Das Landgericht Potsdam gab am Freitag einer Klage der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten gegen zwei Bildagenturen und einen Fotografen statt. Die Trägerin der Kulturstätten wollte unterbinden, dass an ihr vorbei Fotos ihres Eigentums zum Kauf angeboten werden. Die Stiftung hatte
die Agenturen auf Unterlassung und Schadensersatz verklagt. Dessen Höhe müsse aber gesondert festgelegt werden, sagte der Vorsitzende der 1. Zivilkammer des Landgerichts, Wolfgang Christ. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Entscheidung droht ein Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro. Christ betonte, es gehe nicht um die Einschränkung der Pressefreiheit. Das Geschäft der betroffenen Agenturen seien Bilder für Bücher, Kalender, Broschüren oder Plakate. Die Richter räumten der Schlösserstiftung als Eigentümer der preußischen Schlösser und Gärten in Brandenburg und Berlin das Recht auf Schutz ein. «Der Eigentümer kann mit seiner Sache nach seinem Belieben verfahren und auch Bedingungen stellen», sagte Christ. Die Stiftung hatte kommerzielle Fotos ohne Erlaubnis untersagt. Genehmigungen werden aber in der Regel gegen die Zahlung von Gebühren ausgestellt, wie ein Stiftungssprecher sagte. Private Fotos wie Erinnerungsbilder von Touristen sind weiter ohne Einschränkungen möglich. [...] Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di reagierte mit Unverständnis auf das Urteil. Das Gericht räume dem Grundrecht auf Eigentum «einen nicht nachvollziehbaren Vorrang vor dem Grundrecht der Pressefreiheit ein. Die journalistische Tätigkeit der Fotografen und der Agentur wird unzulässig und völlig unsachgemäß eingegrenzt», kritisierte die Gewerkschaft. Ver.di kündigte an, die Kläger auch in den nächsten Instanzen zu unterstützen. «Es sieht so aus, als benötigen wir eine höchstrichterliche Entscheidung, um die Verhältnisse wieder gerade zu rücken», erklärte Ulrike Maercks-Franzen von der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union in ver.di.
Die Urteilsschelte ist voll und ganz zu unterschreiben. Ohne die Urteilsgründe zu kennen, ist festzuhalten: Der Fehlgriff des BGH in der Entscheidung Schloss Tegel ist massiv kritisiert (zuletzt von Lehment aaO). Sacheigentum und Immaterialgüterrecht sind zwei Paar Stiefel, hob der BGH in seiner jüngeren Entscheidung "Friesenhaus" hervor.
Auch aus der Sicht des öffentlichen Rechts, dem die Schlösserstiftung als Stiftung des öffentlichen Rechts unterliegt, sehe ich erhebliche Probleme bei der Begründung des Eingriffs in die Handlungs- und Pressefreiheit des Fotografen. Eine Rechtsgrundlage in der Stiftungssatzung sehe ich nicht:
http://www.spsg.de/index_222_de.html
Gemäß Stiftungssatzung sind die Parks kostenfrei zugänglich, daher ist bei urheberrechtlich geschützten Werken (z.B. moderner Kunst) die Panoramafreiheit nach § 59 UrhG gegeben: Es handelt sich um öffentliche Parks. "Auch Privatwege gelten als öffentlich, wenn sie nur jedermann frei zugänglich sind" (Dreier in Dreier/Schulze, UrhR, ²2006, § 59 Rz 3). Selbst eine nächtliche Schließung (z.B. eines Friedhofs) ändert daran nichts.
Für Dreier, der selbst eine andere Position vertritt, legt die Formulierung in BGH "Friesenhaus", dass die gewerbliche Verwertbarkeit "nicht als selbständiges Ausschließlichkeitsrecht dem Eigentum zuzuordnen" sei, den Schluss nahe, dass "das Eigentum ganz generell der gewerblichen Verwertung der Ansichten durch Dritte nicht entgegensteht" (ebd. Rz 14).
BGH Friesenhaus:
http://de.wikisource.org/wiki/Bundesgerichtshof_-_Friesenhaus
Wenn also die Parkwege in Potsdam öffentlich sind, kann die Entscheidung keinen Bestand haben, da die gewerbliche Verwertung von Fotos jedenfalls in dem von § 59 UrhG freigegebenen Rahmen vom BGH ausdrücklich zugelassen wurde.
Die Hintergründe beleuchtet gut ein Artikel in der Märkischen Allgemeinen.
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11367272/63369/Warum-die-Potsdamer-Schloesserlandschaft-immer-weniger-in-repraesentativen.html
VERLAGE: Bilder haben neuerdings einen doppelten Preis
Warum die Potsdamer Schlösserlandschaft immer weniger in repräsentativen Büchern vorkommt
POTSDAM - „Potsdam ist auf der Hassliste die Nummer eins“, sagt Christian Sprang, der Justiziar des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main. Und er meint die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, weil sie Rechnungen herausschickt, sobald ein Buchverlag eine Aufnahme von Schloss Sanssouci oder einer anderen königlichen Immobilie veröffentlicht. Und nun führt sie auch noch einen Prozess, der das als Recht zementieren soll. Heute wird dazu ein erstes Urteil gesprochen (siehe MAZ vom 17.10.).
Ein großer süddeutscher Reiseführer-Verlag, der auf keinen Fall genannt werden möchte, staunte im letzten Jahr nicht schlecht, als er für ein Potsdam-Kapitel in einem Berlin-Büchlein aufgefordert wurde, pro Bild 50 Euro an die Stiftung zu überweisen. „Wir waren sehr überrascht, hatten wir doch bereits 50 Euro für die Nutzungsrechte an eine Fotoagentur gezahlt. Nun sollten wir nachträglich noch Eigentumsrechte erwerben.“ Sie machte sich schlau und erfuhr, dass die derzeitige Rechtslage das hergibt.
„So eindeutig ist die Rechtslage bisher nicht“, meint indes Christian Sprang. „Wir bewegen uns bisher in einer Grauzone, denn die Schlösser und Gärten sind ja mehr als 70 Jahre nach dem Tod ihrer Erbauer nicht mehr urheberrechtlich geschützt.“ Bisher empfahl er den Verlagen, sich mit der Stiftung zu vergleichen, um kostspielige Prozesse zu vermeiden. „Doch nun werden wir sehen, wie weit das Hausrecht einer öffentlichen Einrichtung greift.“
Der Hamburger Verlag Ellert & Richter, bekannt für seine Bildreisebücher, musste 2004 für seinen Band „Schönes Potsdam“ mehrere Tausend Euro an die Stiftung in Potsdam überweisen. Verleger Gerhard Richter hatte außerdem seinen Fotografen zu entlohnen. Der wiederum musste seine Verwertungsrechte an die Stiftung abtreten. „Das war die Bedingung.“ Richter wollte damals schon mit dem Börsenverein zusammen einen Musterprozess anstrengen, scheute sich dann aber wegen mangelnder Unterstützung. „Wegen dieser Entwicklung werde ich unsere Bildbandreihen deutlich zurückfahren und mich anderen verlegerischen Herausforderungen widmen“, sagt er.
„Wir müssen die Bücher trotz hoher Produktionskosten sehr knapp kalkulieren und verfügen nur über ein äußerst knappes Budget“, sagt die Redakteurin des großen süddeutschen Verlags. Für den hart umkämpften Reiseführer-Markt werde das mit Sicherheit Konsequenzen haben. Und Gabriele Forst, Herausgeberin bei Marco Polo, hätte gern ein, zwei Bilder mehr in ihrem Potsdam-Führer von den Schlössern gezeigt. „Das ist ärgerlich, denn eigentlich fördern wir mit unseren Publikationen ja den Tourismus.“
Welchen Verlag man auf das Thema auch anspricht, überall grassiert die Angst. Viele möchten auf keinen Fall namentlich erwähnt werden, da Zahlungsaufforderungen oder eine Verschlechterung des Verhandlungsklimas befürchtet werden. Oft geht diese Bitte mit Verwünschungen oder Verdächtigungen einher. Einer meint: „Die Stiftungsmitarbeiter wollen doch nur ihre eigenen Publikationen monopolisieren und auf diesem Wege die Konkurrenz ausschalten.“ Den Verlagen sei es schon bisher kaum möglich, im Sortiment der stiftungseigenen Shops aufgenommen zu werden.
„Wenn sich die Rechtsposition der Stiftung durchsetzt“, sagt Jörg Neubert vom Chemnitzer Kalender-Verlag Phillis, „dann wird künftig auch jede Dorfkirche verlangen können, dass für die Abbildung eines Altars eine Bildgebühr bezahlt werden muss“. Gerade habe er einen entsprechenden Brief von einem Pfarrer erhalten. Seine Jahreskalender mit dem Titel „Glanzlichter Berlin-Brandenburg“ kommen nun schon seit drei Jahren ohne Königsschlösser und -gärten aus. Stattdessen zeigen sie das Brandenburger Stadttor in Potsdam, das neue Hans-Otto-Theater oder märkische Landschaften. „Die Berliner Olympiastadion GmbH bedankt sich bei mir für die gute Werbung, wenn ich mich für eine Stadion-Aufnahme entscheide.“ Und er verweist auf die gute Zusammenarbeit mit der sächsischen oder der bayerischen Schlösserstiftung, die noch nie von ihm Geld wollten.
Die Auswirkungen der Regelung sind heute bereits mit Händen zu greifen. In dem gerade im Hinstorff-Verlag erschienene repräsentativen Bildband Brandenburg sind lediglich vier Luftaufnahmen von Potsdamer Schlössern enthalten. Die Fotografen können die Gebühr nämlich umgehen, wenn sie ihre Fotos nicht vom Gelände der Stiftung aus anfertigen. Nach dieser Rechtsauffassung darf das Berliner Schloss Charlottenburg von der Straße aus gezeigt werden. Dabei wird um halbe Meter gefeilscht.
Hinstorff-Verlegerin Eva Maria Buchholz möchte den Bildband „Potsdam“ mit Fotos von Ulf Böttcher von 2001 eigentlich noch einmal auflegen. Doch nun würde die Stiftung dafür 8000 bis 9000 Euro verlangen. Christian Sprang vom Börsenverein hält solche Summen für maßlos. Einige Verlage würden sich mit dem Rückgriff auf Fotos aus DDR-Zeiten helfen, weiß er. „Damals gab es so ein Regime noch nicht .“ (Von Karim Saab)
 Luftbild der Anlage von Schloss Sanssouci (aus Wikipedia). Foto: Wolfgang Pehlemann Wiesbaden Germany. Lizenz: "Lizenz cc-by-sa V. 3.0 unter Nennung meines Namens direkt unter Bild".
Luftbild der Anlage von Schloss Sanssouci (aus Wikipedia). Foto: Wolfgang Pehlemann Wiesbaden Germany. Lizenz: "Lizenz cc-by-sa V. 3.0 unter Nennung meines Namens direkt unter Bild".
http://archiv.twoday.net/stories/5333018/
kürzlich problematisierte Thematik hat durch eine Gerichtsentscheidung besondere Brisanz gewonnen.
http://www.pr-inside.com/de/fuer-kommerzielle-fotos-von-sanssouci-darf-r930308.htm
Potsdam (AP) Für das kommerzielle Fotografieren des berühmten Potsdamer Schlosses Sanssouci sowie der anderen historischen Herrenhäuser und Gärten der Region dürfen weiter Gebühren kassiert werden. Das Landgericht Potsdam gab am Freitag einer Klage der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten gegen zwei Bildagenturen und einen Fotografen statt. Die Trägerin der Kulturstätten wollte unterbinden, dass an ihr vorbei Fotos ihres Eigentums zum Kauf angeboten werden. Die Stiftung hatte
die Agenturen auf Unterlassung und Schadensersatz verklagt. Dessen Höhe müsse aber gesondert festgelegt werden, sagte der Vorsitzende der 1. Zivilkammer des Landgerichts, Wolfgang Christ. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Entscheidung droht ein Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro. Christ betonte, es gehe nicht um die Einschränkung der Pressefreiheit. Das Geschäft der betroffenen Agenturen seien Bilder für Bücher, Kalender, Broschüren oder Plakate. Die Richter räumten der Schlösserstiftung als Eigentümer der preußischen Schlösser und Gärten in Brandenburg und Berlin das Recht auf Schutz ein. «Der Eigentümer kann mit seiner Sache nach seinem Belieben verfahren und auch Bedingungen stellen», sagte Christ. Die Stiftung hatte kommerzielle Fotos ohne Erlaubnis untersagt. Genehmigungen werden aber in der Regel gegen die Zahlung von Gebühren ausgestellt, wie ein Stiftungssprecher sagte. Private Fotos wie Erinnerungsbilder von Touristen sind weiter ohne Einschränkungen möglich. [...] Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di reagierte mit Unverständnis auf das Urteil. Das Gericht räume dem Grundrecht auf Eigentum «einen nicht nachvollziehbaren Vorrang vor dem Grundrecht der Pressefreiheit ein. Die journalistische Tätigkeit der Fotografen und der Agentur wird unzulässig und völlig unsachgemäß eingegrenzt», kritisierte die Gewerkschaft. Ver.di kündigte an, die Kläger auch in den nächsten Instanzen zu unterstützen. «Es sieht so aus, als benötigen wir eine höchstrichterliche Entscheidung, um die Verhältnisse wieder gerade zu rücken», erklärte Ulrike Maercks-Franzen von der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union in ver.di.
Die Urteilsschelte ist voll und ganz zu unterschreiben. Ohne die Urteilsgründe zu kennen, ist festzuhalten: Der Fehlgriff des BGH in der Entscheidung Schloss Tegel ist massiv kritisiert (zuletzt von Lehment aaO). Sacheigentum und Immaterialgüterrecht sind zwei Paar Stiefel, hob der BGH in seiner jüngeren Entscheidung "Friesenhaus" hervor.
Auch aus der Sicht des öffentlichen Rechts, dem die Schlösserstiftung als Stiftung des öffentlichen Rechts unterliegt, sehe ich erhebliche Probleme bei der Begründung des Eingriffs in die Handlungs- und Pressefreiheit des Fotografen. Eine Rechtsgrundlage in der Stiftungssatzung sehe ich nicht:
http://www.spsg.de/index_222_de.html
Gemäß Stiftungssatzung sind die Parks kostenfrei zugänglich, daher ist bei urheberrechtlich geschützten Werken (z.B. moderner Kunst) die Panoramafreiheit nach § 59 UrhG gegeben: Es handelt sich um öffentliche Parks. "Auch Privatwege gelten als öffentlich, wenn sie nur jedermann frei zugänglich sind" (Dreier in Dreier/Schulze, UrhR, ²2006, § 59 Rz 3). Selbst eine nächtliche Schließung (z.B. eines Friedhofs) ändert daran nichts.
Für Dreier, der selbst eine andere Position vertritt, legt die Formulierung in BGH "Friesenhaus", dass die gewerbliche Verwertbarkeit "nicht als selbständiges Ausschließlichkeitsrecht dem Eigentum zuzuordnen" sei, den Schluss nahe, dass "das Eigentum ganz generell der gewerblichen Verwertung der Ansichten durch Dritte nicht entgegensteht" (ebd. Rz 14).
BGH Friesenhaus:
http://de.wikisource.org/wiki/Bundesgerichtshof_-_Friesenhaus
Wenn also die Parkwege in Potsdam öffentlich sind, kann die Entscheidung keinen Bestand haben, da die gewerbliche Verwertung von Fotos jedenfalls in dem von § 59 UrhG freigegebenen Rahmen vom BGH ausdrücklich zugelassen wurde.
Die Hintergründe beleuchtet gut ein Artikel in der Märkischen Allgemeinen.
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11367272/63369/Warum-die-Potsdamer-Schloesserlandschaft-immer-weniger-in-repraesentativen.html
VERLAGE: Bilder haben neuerdings einen doppelten Preis
Warum die Potsdamer Schlösserlandschaft immer weniger in repräsentativen Büchern vorkommt
POTSDAM - „Potsdam ist auf der Hassliste die Nummer eins“, sagt Christian Sprang, der Justiziar des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main. Und er meint die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, weil sie Rechnungen herausschickt, sobald ein Buchverlag eine Aufnahme von Schloss Sanssouci oder einer anderen königlichen Immobilie veröffentlicht. Und nun führt sie auch noch einen Prozess, der das als Recht zementieren soll. Heute wird dazu ein erstes Urteil gesprochen (siehe MAZ vom 17.10.).
Ein großer süddeutscher Reiseführer-Verlag, der auf keinen Fall genannt werden möchte, staunte im letzten Jahr nicht schlecht, als er für ein Potsdam-Kapitel in einem Berlin-Büchlein aufgefordert wurde, pro Bild 50 Euro an die Stiftung zu überweisen. „Wir waren sehr überrascht, hatten wir doch bereits 50 Euro für die Nutzungsrechte an eine Fotoagentur gezahlt. Nun sollten wir nachträglich noch Eigentumsrechte erwerben.“ Sie machte sich schlau und erfuhr, dass die derzeitige Rechtslage das hergibt.
„So eindeutig ist die Rechtslage bisher nicht“, meint indes Christian Sprang. „Wir bewegen uns bisher in einer Grauzone, denn die Schlösser und Gärten sind ja mehr als 70 Jahre nach dem Tod ihrer Erbauer nicht mehr urheberrechtlich geschützt.“ Bisher empfahl er den Verlagen, sich mit der Stiftung zu vergleichen, um kostspielige Prozesse zu vermeiden. „Doch nun werden wir sehen, wie weit das Hausrecht einer öffentlichen Einrichtung greift.“
Der Hamburger Verlag Ellert & Richter, bekannt für seine Bildreisebücher, musste 2004 für seinen Band „Schönes Potsdam“ mehrere Tausend Euro an die Stiftung in Potsdam überweisen. Verleger Gerhard Richter hatte außerdem seinen Fotografen zu entlohnen. Der wiederum musste seine Verwertungsrechte an die Stiftung abtreten. „Das war die Bedingung.“ Richter wollte damals schon mit dem Börsenverein zusammen einen Musterprozess anstrengen, scheute sich dann aber wegen mangelnder Unterstützung. „Wegen dieser Entwicklung werde ich unsere Bildbandreihen deutlich zurückfahren und mich anderen verlegerischen Herausforderungen widmen“, sagt er.
„Wir müssen die Bücher trotz hoher Produktionskosten sehr knapp kalkulieren und verfügen nur über ein äußerst knappes Budget“, sagt die Redakteurin des großen süddeutschen Verlags. Für den hart umkämpften Reiseführer-Markt werde das mit Sicherheit Konsequenzen haben. Und Gabriele Forst, Herausgeberin bei Marco Polo, hätte gern ein, zwei Bilder mehr in ihrem Potsdam-Führer von den Schlössern gezeigt. „Das ist ärgerlich, denn eigentlich fördern wir mit unseren Publikationen ja den Tourismus.“
Welchen Verlag man auf das Thema auch anspricht, überall grassiert die Angst. Viele möchten auf keinen Fall namentlich erwähnt werden, da Zahlungsaufforderungen oder eine Verschlechterung des Verhandlungsklimas befürchtet werden. Oft geht diese Bitte mit Verwünschungen oder Verdächtigungen einher. Einer meint: „Die Stiftungsmitarbeiter wollen doch nur ihre eigenen Publikationen monopolisieren und auf diesem Wege die Konkurrenz ausschalten.“ Den Verlagen sei es schon bisher kaum möglich, im Sortiment der stiftungseigenen Shops aufgenommen zu werden.
„Wenn sich die Rechtsposition der Stiftung durchsetzt“, sagt Jörg Neubert vom Chemnitzer Kalender-Verlag Phillis, „dann wird künftig auch jede Dorfkirche verlangen können, dass für die Abbildung eines Altars eine Bildgebühr bezahlt werden muss“. Gerade habe er einen entsprechenden Brief von einem Pfarrer erhalten. Seine Jahreskalender mit dem Titel „Glanzlichter Berlin-Brandenburg“ kommen nun schon seit drei Jahren ohne Königsschlösser und -gärten aus. Stattdessen zeigen sie das Brandenburger Stadttor in Potsdam, das neue Hans-Otto-Theater oder märkische Landschaften. „Die Berliner Olympiastadion GmbH bedankt sich bei mir für die gute Werbung, wenn ich mich für eine Stadion-Aufnahme entscheide.“ Und er verweist auf die gute Zusammenarbeit mit der sächsischen oder der bayerischen Schlösserstiftung, die noch nie von ihm Geld wollten.
Die Auswirkungen der Regelung sind heute bereits mit Händen zu greifen. In dem gerade im Hinstorff-Verlag erschienene repräsentativen Bildband Brandenburg sind lediglich vier Luftaufnahmen von Potsdamer Schlössern enthalten. Die Fotografen können die Gebühr nämlich umgehen, wenn sie ihre Fotos nicht vom Gelände der Stiftung aus anfertigen. Nach dieser Rechtsauffassung darf das Berliner Schloss Charlottenburg von der Straße aus gezeigt werden. Dabei wird um halbe Meter gefeilscht.
Hinstorff-Verlegerin Eva Maria Buchholz möchte den Bildband „Potsdam“ mit Fotos von Ulf Böttcher von 2001 eigentlich noch einmal auflegen. Doch nun würde die Stiftung dafür 8000 bis 9000 Euro verlangen. Christian Sprang vom Börsenverein hält solche Summen für maßlos. Einige Verlage würden sich mit dem Rückgriff auf Fotos aus DDR-Zeiten helfen, weiß er. „Damals gab es so ein Regime noch nicht .“ (Von Karim Saab)
 Luftbild der Anlage von Schloss Sanssouci (aus Wikipedia). Foto: Wolfgang Pehlemann Wiesbaden Germany. Lizenz: "Lizenz cc-by-sa V. 3.0 unter Nennung meines Namens direkt unter Bild".
Luftbild der Anlage von Schloss Sanssouci (aus Wikipedia). Foto: Wolfgang Pehlemann Wiesbaden Germany. Lizenz: "Lizenz cc-by-sa V. 3.0 unter Nennung meines Namens direkt unter Bild".KlausGraf - am Freitag, 21. November 2008, 18:07 - Rubrik: Archivrecht
Kaum hat sich der Begriff ECM etabliert und im Kontext Web 2.0 um collaborative Funktionsinhalte erweitert, so bringt die Verbindung mit dem Informations- und Wissensmanagement die nächste Stufe. Inwieweit sich die Numerierung 2.0-3.0-4.0... durchsetzt muss sich zeigen. Der Aufsatz ist jedenfalls sehr empfehlenswert:
ECM 3.0
ECM 3.0
schwalm.potsdam - am Freitag, 21. November 2008, 17:06 - Rubrik: Records Management
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.suedwest-aktiv.de/landundwelt/suedwestumschau/3975931/artikel.php
Dass die im Verhandlungsergebnis ausdrücklich festgehaltene Klosterbibliothek nur kunsthistorisch wertlose Akten enthält, dürfte bekannt gewesen sein: Schon 1826 hatte die Universität Heidelberg das gesamte wertvolle Inventar erworben. Wieviel wert der ebenfalls erwähnte "Museumsbereich" ist, ist noch offen: Es geht dabei um eine alte Brennerei und ein Feuerwehrmuseum. Bereits im Generallandesarchiv Karlsruhe lagern über 8000 Urkunden zum Kloster Salem, die das Land haben will. Eine Schätzung steht aber auch hier noch aus.
Oettinger dementierte, dass je die Rede davon gewesen sei, Prinz Bernhard könne Generalmanager in Salem werden. "Wir entscheiden, was dort geschieht. Es geht um die Geschäftsbesorgung vor Ort, dabei greifen wir auf die Erfahrung der Familie zurück."
Dass die im Verhandlungsergebnis ausdrücklich festgehaltene Klosterbibliothek nur kunsthistorisch wertlose Akten enthält, dürfte bekannt gewesen sein: Schon 1826 hatte die Universität Heidelberg das gesamte wertvolle Inventar erworben. Wieviel wert der ebenfalls erwähnte "Museumsbereich" ist, ist noch offen: Es geht dabei um eine alte Brennerei und ein Feuerwehrmuseum. Bereits im Generallandesarchiv Karlsruhe lagern über 8000 Urkunden zum Kloster Salem, die das Land haben will. Eine Schätzung steht aber auch hier noch aus.
Oettinger dementierte, dass je die Rede davon gewesen sei, Prinz Bernhard könne Generalmanager in Salem werden. "Wir entscheiden, was dort geschieht. Es geht um die Geschäftsbesorgung vor Ort, dabei greifen wir auf die Erfahrung der Familie zurück."
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://gams.uni-graz.at/fedora/get/collection:stub/bdef:Collection/get
Mit den hier zusammengestellten 164 Texten beginnt eine Neuedition jener rechtserheblichen mittelalterlichen Dokumente (Urkunden) aus der Zeit bis 1192, welche einen Bezug zur Steiermark aufweisen.

Mit den hier zusammengestellten 164 Texten beginnt eine Neuedition jener rechtserheblichen mittelalterlichen Dokumente (Urkunden) aus der Zeit bis 1192, welche einen Bezug zur Steiermark aufweisen.

KlausGraf - am Freitag, 21. November 2008, 13:26 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.archive.org/details/dasdomnenwesen00albruoft
Zum Thema hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=dom%C3%A4nen
Zur Zeit wird in erheblichem Umfang deutschsprachige Literatur vor 1923, insbesondere zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, durch das Internetarchiv bereitgestellt.
Zum Thema hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=dom%C3%A4nen
Zur Zeit wird in erheblichem Umfang deutschsprachige Literatur vor 1923, insbesondere zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, durch das Internetarchiv bereitgestellt.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.reformiert-info.de/side.php?news_id=2760&part_id=0&part3_id=0&navi=20
Stellungnahme der Evangelisch-reformierten Kirche zu Presseberichten vom heutigen, 20. November 2008
"Zur Zeit finden zahlreiche, erfolgversprechende Gespräche mit kirchlichen, wissenschaftlichen und kommunalen Einrichtungen und Trägern statt, um die Johannes a Lasco Bibliothek auf eine neue finanzielle Grundlage zu stellen. Dies ist notwendig, nachdem die Kirchenleitung als Stiftungsaufsicht und das Kuratoriums einen großen Verlust des ursprünglich ca. acht Millionen Euro betragenen Stiftungsvermögen zur Kenntnis nehmen mussten. Um den Erfolg dieser Gespräch nicht zu gefährden, können derzeit dazu keine öffentlichen Äußerungen abgegeben werden. Die Gespräche mit der deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) über eine Förderung sind bislang nicht abgeschlossen.
Die Kündigungen eines Großteils der Mitarbeiter werden ausdrücklich bedauert, sind jedoch angesichts der derzeitigen finanziellen Situation der Einrichtung unablässig. Von den Kündigungen betroffen sind ausschließlich der wissenschaftliche und der bibliothekarische Betrieb, der vorrübergehend eingestellt werden muss. Wie auch vor dem Arbeitsgericht vorgetragen, ist eine Wiederaufnahme der Beschäftigung nach einer tragfähigen finanziellen Neuaufstellung der Johannes a Lasco Bibliothek möglich.
Die in der Bibliothek geplanten Veranstaltungen in diesem Jahr und darüber hinaus sind nicht gefährdet. Das in der Einrichtung verbleibende Personal wird diese auch in der Zukunft in bewährter Weise begleiten."
Leer, den 20. November 2008
Jann Schmidt,
Kirchenpräsident der Evangelisch-reformierten Kirche und Vorsitzender der Kuratoriums der Stiftung Johannes a Lasco Bibliothek
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/5273455/
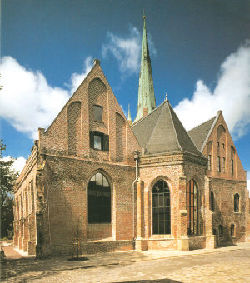
Stellungnahme der Evangelisch-reformierten Kirche zu Presseberichten vom heutigen, 20. November 2008
"Zur Zeit finden zahlreiche, erfolgversprechende Gespräche mit kirchlichen, wissenschaftlichen und kommunalen Einrichtungen und Trägern statt, um die Johannes a Lasco Bibliothek auf eine neue finanzielle Grundlage zu stellen. Dies ist notwendig, nachdem die Kirchenleitung als Stiftungsaufsicht und das Kuratoriums einen großen Verlust des ursprünglich ca. acht Millionen Euro betragenen Stiftungsvermögen zur Kenntnis nehmen mussten. Um den Erfolg dieser Gespräch nicht zu gefährden, können derzeit dazu keine öffentlichen Äußerungen abgegeben werden. Die Gespräche mit der deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) über eine Förderung sind bislang nicht abgeschlossen.
Die Kündigungen eines Großteils der Mitarbeiter werden ausdrücklich bedauert, sind jedoch angesichts der derzeitigen finanziellen Situation der Einrichtung unablässig. Von den Kündigungen betroffen sind ausschließlich der wissenschaftliche und der bibliothekarische Betrieb, der vorrübergehend eingestellt werden muss. Wie auch vor dem Arbeitsgericht vorgetragen, ist eine Wiederaufnahme der Beschäftigung nach einer tragfähigen finanziellen Neuaufstellung der Johannes a Lasco Bibliothek möglich.
Die in der Bibliothek geplanten Veranstaltungen in diesem Jahr und darüber hinaus sind nicht gefährdet. Das in der Einrichtung verbleibende Personal wird diese auch in der Zukunft in bewährter Weise begleiten."
Leer, den 20. November 2008
Jann Schmidt,
Kirchenpräsident der Evangelisch-reformierten Kirche und Vorsitzender der Kuratoriums der Stiftung Johannes a Lasco Bibliothek
Update zu:
http://archiv.twoday.net/stories/5273455/
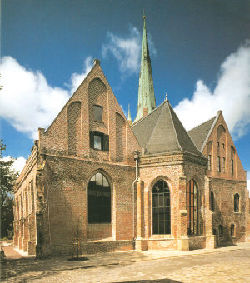
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Kulturgüter vom Reißwolf bedroht
berichtet die Sächsische Zeitung am 20.11.2003. "Mit der Forderung, das Archivgut des Freistaates Sachsen aus Kostengründen weitgehend zu vernichten, hat der Landesrechnungshof einen Proteststurm von Historikern, Archivaren und Politikern hervorgerufen."
http://archiv.twoday.net/stories/103438/
Die Links zur Sächsischen Zeitung funktionieren natürlich nicht mehr.
Zur Sächsischen Rechnungshof-Affäre siehe hier:
http://archiv.twoday.net/stories/107913/
http://archiv.twoday.net/stories/104453/
http://archiv.twoday.net/stories/104329/
http://archiv.twoday.net/stories/89084/
http://archiv.twoday.net/stories/85158/
berichtet die Sächsische Zeitung am 20.11.2003. "Mit der Forderung, das Archivgut des Freistaates Sachsen aus Kostengründen weitgehend zu vernichten, hat der Landesrechnungshof einen Proteststurm von Historikern, Archivaren und Politikern hervorgerufen."
http://archiv.twoday.net/stories/103438/
Die Links zur Sächsischen Zeitung funktionieren natürlich nicht mehr.
Zur Sächsischen Rechnungshof-Affäre siehe hier:
http://archiv.twoday.net/stories/107913/
http://archiv.twoday.net/stories/104453/
http://archiv.twoday.net/stories/104329/
http://archiv.twoday.net/stories/89084/
http://archiv.twoday.net/stories/85158/
KlausGraf - am Freitag, 21. November 2008, 02:11 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://medien-internet-und-recht.de/rss_druckversion_mir.php?mir_dok_id=1809
Der unter anderem für das Urheberrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20.11.2008 entschieden, dass bereits derjenige in die Rechte des Tonträgerherstellers eingreift, der einem fremden Tonträger kleinste Tonfetzen entnimmt.
Siehe auch:
http://sewoma.de/berlinblawg/2008/11/20/sevriens/sample/
http://de.wikipedia.org/wiki/Sampling_(Musik)
http://stattaller.blogspot.com/2008/11/bushido-wegen-urheberrechtsverletzung.html
Das Urheberrecht soll die Kreativität schützen, doch das einzige, was passiert, ist eine massive Behinderung derselben. Solange die Gerontokraten des BGH das Sagen haben ...
Der unter anderem für das Urheberrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20.11.2008 entschieden, dass bereits derjenige in die Rechte des Tonträgerherstellers eingreift, der einem fremden Tonträger kleinste Tonfetzen entnimmt.
Siehe auch:
http://sewoma.de/berlinblawg/2008/11/20/sevriens/sample/
http://de.wikipedia.org/wiki/Sampling_(Musik)
http://stattaller.blogspot.com/2008/11/bushido-wegen-urheberrechtsverletzung.html
Das Urheberrecht soll die Kreativität schützen, doch das einzige, was passiert, ist eine massive Behinderung derselben. Solange die Gerontokraten des BGH das Sagen haben ...
KlausGraf - am Freitag, 21. November 2008, 01:03 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.uni-r.de/Universitaet/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen/0808_August/080923_RafaelBall.htm
Die UB Regensburg galt als eine besonders innovative deutsche Universitätsbibliothek.
Ball erregte 2006 durch ein Anti-Open-Access-Pamphlet Aufmerksamkeit, das in der Blogosphäre harsch kritisiert wurde:
http://archiv.twoday.net/stories/2808047/
http://blog.juergen-luebeck.de/archives/704-Open-Access-The-Road-to-Hell.html
http://log.netbib.de/archives/2006/07/04/oa-angeblich-nicht-allein-selig-machend/
Die UB Regensburg galt als eine besonders innovative deutsche Universitätsbibliothek.
Ball erregte 2006 durch ein Anti-Open-Access-Pamphlet Aufmerksamkeit, das in der Blogosphäre harsch kritisiert wurde:
http://archiv.twoday.net/stories/2808047/
http://blog.juergen-luebeck.de/archives/704-Open-Access-The-Road-to-Hell.html
http://log.netbib.de/archives/2006/07/04/oa-angeblich-nicht-allein-selig-machend/
KlausGraf - am Donnerstag, 20. November 2008, 23:32 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Unsere Kritik:
http://archiv.twoday.net/stories/5322885/ ("viel heiße Luft")
Weitere Kritikpunkte:
http://www.kartentisch.de/?p=285
Zitat:
" Bis die Europeana ein wirklich nützliches und praktikables digitales Panorama der europäischen Kultur werden könnte, ist noch ein langer Weg. Insgesamt sehe ich nicht viel, worüber man sich bei Google ernsthaft Sorgen machen müßte."
Siehe auch:
http://jorgeledo.net/2008/11/europeana-en-abierto-y-en-beta/
Fundierte Kritik aus französischer Sicht:
http://latribunedesarchives.blogspot.com/2008/11/europeana-peut-encore-mieux-faire.html
Der Server ist offenkundig nicht so ausgelegt, dass er den durch den Werberummel verursachten Ansturm bewältigen kann. Wenn man den Mund so voll nimmt, sollte man wenigstens dafür sorgen, dass auch Europas Kulturwelt Zugriff hat, ohne minutenlang zu warten. "Massive use is slowing europeana down" - sie war aber auch schon vor der offiziellen Eröffnung quälend langsam.
Gerade kam ich mit Mühe und Not zur Startseite, eine Suche war dann erst einmal nicht mehr möglich.
Aufgrund der Nicht-Erreichbarkeit spricht die WELT, die ansonsten unkritisch und ohne eigene Prüfung das Angebot referiert, von einem "Fehlstart":
http://www.welt.de/webwelt/article2756604/Fehlstart-fuer-erste-digitale-EU-Bibliothek-Europeana.html
Ansonsten übt sich die Presse im Nachbeten der Pressemitteilung.
NACHTRAG:
Es hat sich nichts geändert. Nach wie vor werden bei der Suche nach goethe und der Eingrenzung auf Texte und Sprache de nur sechs ungarische Titel gefunden. Wie krank ist das denn?
http://www.europeana.eu/portal/brief-doc.html?query=goethe&qf=TYPE:text&qf=LANGUAGE:de
Tasächlich ist in Weimar etliches von Goethe digitalisiert (Link geht auf das ZVDD):
http://tinyurl.com/5hbzj5
"Die Europeana verfügt über ein Jahresbudget von gerade einmal 2,5 Millionen Euro, 14 Vollzeitkräfte arbeiten daran, Europas Kulturschätze ins digitale Zeitalter zu heben."
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,591570,00.html
Und dann so ein Murks!
Europeana ist derzeit nur ein europäischer Furz gegen Google.

http://archiv.twoday.net/stories/5322885/ ("viel heiße Luft")
Weitere Kritikpunkte:
http://www.kartentisch.de/?p=285
Zitat:
" Bis die Europeana ein wirklich nützliches und praktikables digitales Panorama der europäischen Kultur werden könnte, ist noch ein langer Weg. Insgesamt sehe ich nicht viel, worüber man sich bei Google ernsthaft Sorgen machen müßte."
Siehe auch:
http://jorgeledo.net/2008/11/europeana-en-abierto-y-en-beta/
Fundierte Kritik aus französischer Sicht:
http://latribunedesarchives.blogspot.com/2008/11/europeana-peut-encore-mieux-faire.html
Der Server ist offenkundig nicht so ausgelegt, dass er den durch den Werberummel verursachten Ansturm bewältigen kann. Wenn man den Mund so voll nimmt, sollte man wenigstens dafür sorgen, dass auch Europas Kulturwelt Zugriff hat, ohne minutenlang zu warten. "Massive use is slowing europeana down" - sie war aber auch schon vor der offiziellen Eröffnung quälend langsam.
Gerade kam ich mit Mühe und Not zur Startseite, eine Suche war dann erst einmal nicht mehr möglich.
Aufgrund der Nicht-Erreichbarkeit spricht die WELT, die ansonsten unkritisch und ohne eigene Prüfung das Angebot referiert, von einem "Fehlstart":
http://www.welt.de/webwelt/article2756604/Fehlstart-fuer-erste-digitale-EU-Bibliothek-Europeana.html
Ansonsten übt sich die Presse im Nachbeten der Pressemitteilung.
NACHTRAG:
Es hat sich nichts geändert. Nach wie vor werden bei der Suche nach goethe und der Eingrenzung auf Texte und Sprache de nur sechs ungarische Titel gefunden. Wie krank ist das denn?
http://www.europeana.eu/portal/brief-doc.html?query=goethe&qf=TYPE:text&qf=LANGUAGE:de
Tasächlich ist in Weimar etliches von Goethe digitalisiert (Link geht auf das ZVDD):
http://tinyurl.com/5hbzj5
"Die Europeana verfügt über ein Jahresbudget von gerade einmal 2,5 Millionen Euro, 14 Vollzeitkräfte arbeiten daran, Europas Kulturschätze ins digitale Zeitalter zu heben."
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,591570,00.html
Und dann so ein Murks!
Europeana ist derzeit nur ein europäischer Furz gegen Google.

KlausGraf - am Donnerstag, 20. November 2008, 23:14 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
"Wenn jemand überlegt, Koch zu werden, kann er auch als Zivi in unserer Küche arbeiten, und im Archiv gibt es Arbeit für Leute, die gern recherchieren und schreiben."
Geschäftsführer Manuel Berger Helios-Kreiskrankenhauses Gotha in der Thüringischen Landeszeitung (Link)
Geschäftsführer Manuel Berger Helios-Kreiskrankenhauses Gotha in der Thüringischen Landeszeitung (Link)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 20. November 2008, 19:11 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Unser IT-Gipfelblog ist so etwas wie das 'Gedächtnis' oder Archiv dieser Veranstaltungsreihe der Bundesregierung geworden"
Hasso-Plattner-Institut Direktor Christoph Meinel auf heute de (Link)
Link zum Blog:
https://it-gipfelblog.hpi-web.de/
Hasso-Plattner-Institut Direktor Christoph Meinel auf heute de (Link)
Link zum Blog:
https://it-gipfelblog.hpi-web.de/
Wolf Thomas - am Donnerstag, 20. November 2008, 19:10 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Maximilian : Der künigklich Landtfriden. Worms, 1495. 08. 07., Mit Verbesserungen des Freiburger Reichstagsabschieds. Freiburg, 1498. 09. 04., [Augsburg], [nach 1498] [BSB-Ink M-283]
http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0002/bsb00022845/images/
http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0002/bsb00022845/images/
KlausGraf - am Donnerstag, 20. November 2008, 03:03 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 20. November 2008, 01:58 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/newsticker/EU-weites-Buendnis-fuer-wissenschaftsfreundliches-Urheberrecht--/meldung/119053
In Berlin hat sich am Wochenende das European Network for Copyright in Support of Education and Science (ENCES) formiert, das in Brüssel die Interessen von Bildung und Wissenschaft im Bereich der Urheberrechtsregulierung stärker vertreten will. Das Netzwerk soll als EU-weites Pendant zum deutschen Aktionsbündnis "Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft" agieren, das sich vor allem im Rahmen der ersten und zweiten Novellierung des Urheberrechts immer wieder für wissenschaftsfreundliche Bestimmungen einsetzte. Die ENCES-Unterstützer haben sich auf die Fahnen geschrieben, dass Wissen und Informationen in digitaler Form für alle Nutzer überall zu jeder Zeit "unter fairen Bedingungen" verfügbar sein müssen.
http://www.ences.eu/
In Berlin hat sich am Wochenende das European Network for Copyright in Support of Education and Science (ENCES) formiert, das in Brüssel die Interessen von Bildung und Wissenschaft im Bereich der Urheberrechtsregulierung stärker vertreten will. Das Netzwerk soll als EU-weites Pendant zum deutschen Aktionsbündnis "Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft" agieren, das sich vor allem im Rahmen der ersten und zweiten Novellierung des Urheberrechts immer wieder für wissenschaftsfreundliche Bestimmungen einsetzte. Die ENCES-Unterstützer haben sich auf die Fahnen geschrieben, dass Wissen und Informationen in digitaler Form für alle Nutzer überall zu jeder Zeit "unter fairen Bedingungen" verfügbar sein müssen.
http://www.ences.eu/
KlausGraf - am Donnerstag, 20. November 2008, 00:41 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Henrik Lehment: Das Fotografieren von Kunstgegenständen
(= Schriften zum deutschen und internationalen Persönlichkeits- und
Immaterialgüterrecht 20). Göttingen: V&R unipress 2008. 235 S. 38,90 Euro.
Inhaltsverzeichnis:
http://www.amazon.de/gp/reader/3899714555/ref=sib_rdr_toc?ie=UTF8&p=S006&j=0#reader-page
(Als Besprechungsexemplar stellte der Verlag ein PDF zur Verfügung.)
Die Kieler Dissertation bei Haimo Schack beschäftigt sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der Fotografie von Kunstwerken. Der Schwerpunkt liegt auf dem Urheberrecht. Der Autor beschreibt sein Ziel so: "Im Folgenden soll zunächst untersucht werden, ob und in welchem Umfang der
Fotograf für die Ablichtung von Kunstgegenständen urheberrechtlichen Schutz
beanspruchen kann. Im zweiten Teil wird dann der Frage nachgegangen, welche
Rechtspositionen es ermöglichen, das Fotografieren eines Kunstgegenstandes und
die anschließende Verwertung der Aufnahmen zu untersagen. Besonderes Augenmerk
wird hier gerichtet auf das Urheberrecht des Künstlers und dessen Schranken,
die Rechte des Eigentümers sowie auf vertragliche Untersagungsmöglichkeiten
desjenigen, der den Zugang zum Werk kontrollieren kann. Schließlich werden
im dritten Teil die vielfältigen Vertragsverhältnisse bei der Vergabe der Bildrechte
an Fotografien von Kunstgegenständen untersucht" (S. 16).
Dass beim manuellen Abfotografieren zweidimensionaler Kunstgegenstände das erforderliche Mindestmaß persönlicher geistiger Leistung gegeben ist, um den Lichtbildschutz nach § 72 UrhG entstehen zu lassen, wird vom Autor bejaht. Seine Argumentation ist oberflächlich und einseitig voreingenommen. Die herrschende juristische Meinung sieht das anders:
http://archiv.twoday.net/stories/4850312/
Deutlich wird, wie sich der Autor in den Prämissen verheddert. Hertins Urbild-Theorie, demzufolge ein Bild geschützt ist, wenn es als erstmalige fotografische Darstellung gelten kann, scheitert an den Fotokopien. Kombiniert man die Forderung nach dem Mindestmaß und dem Urbild, bekommt der Autor Probleme bei der manuellen Fotografie von Fotokunst: "Sieht man die Fotokunst neben der bildenden Kunst als gleichwertig an, so ist es nicht nachvollziehbar, wenn ein Museumsfotograf für manuelle Reproduktionsfotografien von Gemälden und Skulpturen ein Leistungsschutzrecht nach § 72 UrhG erwirbt, nicht aber für handwerklich ebenso gelungene Aufnahmen der Werke von
Fotokünstlern wie Helmut Newton oder Andreas Gursky" (S. 31). Dass die Lichtbildkopie vom Schutz nach § 72 UrhG ausgeschlossen sein soll, hat der BGH aber in seiner Entscheidung Bibelreproduktion unmißverständlich dargelegt. Wenn in einer Zille-Ausstellung ein Fotograf sowohl Fotografien als auch Bilder fotografiert, löst man das Problem dadurch einfachsten, dass man ihm in keinem von beiden Fällen ein Leistungsschutzrecht gewährt, da bei einer originalgetreuen Abbildung nicht das erforderliche Mindestmaß an geistiger Leistung gegeben ist. Originalität und Originaltreue schließen sich aus. Das sieht man auch in den USA (Bridgeman v. Corel, 1999) und in Japan zutreffenderweise so.
Der Autor geht auf die praktisch wichtige Frage der Digitalisate nicht ein. Da diese aber keine manuellen Fotografien sind, wird man annehmen dürfen, dass er sie wie Fotokopien schutzlos lässt.
Mit deutlichem Abscheu referiert der Autor die Praxis der "Open-Access-Portale" wie Wikimedia Commons, die aus Kunstbänden abgescannte Bilder auch zur kommerziellen Nutzung anbieten. "Die Rechtsinhaber sehen jedoch wegen der Schwierigkeit, nachzuweisen, dass gerade ihre Fotografie verwendet wurde, oft von einer Klage ab" (S. 62). Meines Wissens sehen sie nicht nur "oft", sondern bislang immer von einer Klage ab, denn ihre Position ist, wie dargestellt, eher schwach begründet. Wenn der Lichtbildschutz, wie der Autor immer wieder betont, der schöpferischen Tätigkeit des Urhebers nahe steht, dann kann man für den Fall der Ununterscheidbarkeit von Fotos eines Kunstwerks doch nicht ernsthaft behaupten, der manuell fotografierende Fotograf würde etwas grundsätzlich anderes tun als derjenige, der ein Tonband oder einen Film kopiert.
Das vom Autor nicht beachtete Kriterium der Unterscheidbarkeit spielt auch bei einem anderen Leistungsschutzrecht eine Rolle: nämlich bei den wissenschaftlichen Ausgaben, die sich "wesentlich" von bisher bekannten Ausgaben unterscheiden müssen (§ 70 UrhG). Würden auch Editionen geschützt, die sich von bereits bekannten Ausgaben nicht unterscheiden, so ließe sich bei einer (insbesondere musikalischen) Verwertung nicht feststellen, welche der Editionen benutzt wurden (Loewenheim, in: Schricker, Urheberrecht, 3. Aufl., Münche3n 2006, § 70 Rz. 7 nach Amtl. Begründung BT-DS IV, 270 S. 87).
Zustimmen kann man dagegen dem Ergebnis zur Unterscheidung von Lichtbildwerken und Lichtbildern, dass nämlich " für die Werkqualität einer Fotografie [eines Kunstwerks] eine künstlerische Aussage des Fotografen notwendig ist. [...] Damit sind die meisten Reproduktionsfotografien dreidimensionaler Kunstgegenstände als bloße Sachabbildung mangels künstlerischer Aussage nur nach § 72
UrhG als einfache Lichtbilder geschützt." (S. 50f.). Zutreffend ist auch: "Mit dem Gestaltungsspielraum des Fotografen wächst auch der Entscheidungsspielraum der Gerichte, ob die konkrete Gestaltung der Aufnahme bereits ausreicht, um eine künstlerische Aussage zu bejahen. In soweit ist
die Einschätzung des Gesetzgebers von 1965, dass die Abgrenzung vom Lichtbildwerk zum einfachen Lichtbild erhebliche Schwierigkeiten bereitet auch
heute noch aktuell. Es liegt an der Natur der Fotografie, den Aufnahmegegenstand
realistisch abzulichten, dass im Bereich der kleinen Münze stets eine gewisse Unsicherheit bestehen bleibt, ob die jeweilige Bildgestaltung für die Annahme
einer künstlerischen Aussage ausreicht" (S. 60). Solche Abgrenzungsprobleme müssen aber, wenn die Schutzfrist für einfache Lichtbilder abgelaufen ist, zwingend Auswirkungen haben auf die haftungsrechtlichen und strafrechtlichen Implikationen des Urheberrechts. Wenn man - das vom Autor ignorierte - Interesse der Allgemeinheit an einer starken Public Domain in die Waagschale wirft, kann es nicht bei der Devise "Im Zweifel keine Nutzung" bleiben. Artur Wandtke/Winfried Bullinger, Die Marke als urheberrechtlich schutzfähiges Werk, GRUR 1997, S. 573-580, hier S. 577 formulierten: "Die zeitliche Begrenzung des Urheberrechts hat nicht nur bloß eine negative Ausschlußfunktion. Sie hat vor allem auch die positive Zuordnungsfunktion, urheberrechtliche Werke dem Gemeingebrauch zur Verfügung zu stellen". Es darf nicht zu Lasten des Nutzers gehen, der legitimerweise von der Public Domain Gebrauch machen will, wenn Lichtbildwerke und Lichtbilder von Kunstwerken extrem schwer zu unterscheiden sind.
S. 65 meint der Autor, es sei "zu erwägen, die Zitierfreiheit
de lege ferenda im Interesse der kunstwissenschaftlichen Auseinandersetzung auch auf Fotografien des Kunstwerkes zu erstrecken". Das ist falsch: Anders als bei der Katalogbildfreiheit oder bei der Berichterstattung über Tagesereignisse setzt das Zitatrecht nicht voraus, dass der Zitierende das Bild des Kunstwerks selbst angefertigt haben muss. Soweit sich der Autor auf andere Juristen beruft, sind diese ebenfalls auf dem Holzweg. Im Schricker-Kommentar steht dazu nichts, mehr noch: Die Ausführungen (§ 51 Rz. 17) zur Belegfunktion des Zitats mit Blick auf RGZ Codex Aureus wären offenkundig sinnlos. Die Auseinandersetzung mit dem Bild in der Entscheidung Codex Aureus, die von der Schützbarkeit der Handschriftenabbildung ausging (was inzwischen von Vogel in Schricker § 72 Rz. 23 explizit abgelehnt wird), bezog sich auf die Frage, ob das Faksimile der gemeinfreien Handschriftenillustration den Inhalt erläuterte oder nur schmückendes Beiwerk war. Das Reichsgericht hätte sich die ganze umständliche Argumentation sparen können, wenn man der abwegigen Ansicht folgt, dass die Verwendung fremder Kunstfotografien nicht dem Zitatrecht unterfällt. Wenn es zulässig ist, fremde Laufbilder zu zitieren (siehe BGH zu TV Total), um sich mit dem in ihnen Dargestellten, dem ja kein Werkcharakter zukommt, auseinanderzusetzen, dann ist es auch erlaubt, fremde Kunstfotos zu zitieren, um sich mit dem dargestellten gemeinfreien oder geschützten Werk auseinanderzusetzen. Auch von Sinn und Zweck des Zitatrechts, das aufs engste mit den Kommunikationsgrundrechten des Art. 5 GG zusammenhängt, wäre eine solche Einschränkung nicht zu rechtfertigen.
In Teil 2 der Arbeit geht es um den "Schutz vor dem Fotografen", also um die Wirksamkeit von Fotografierverboten. Die der herrschenden urheberrechtlichen Lehre, Resultat des eifrigen Wirkens der Verwerterlobby, treu folgende konservative Position des Autors, wird deutlich aus Formulierungen wie dieser: "Um der Missbrauchsgefahr zu Lasten des Urhebers vorzubeugen, muss das
Merkmales »Tagesereignis« restriktiv ausgelegt werden" (S. 76 zu § 50 UrhG). Anders als etwa bei jüngeren Dissertationen in der UFITA-Schriftenreihe fallen die durch die Kommunikationsgrundrechte abgesicherten berechtigten Interessen der Allgemeinheit unter den Tisch. Zum Zitatrecht liest man daher folgerichtig: "Allerdings ist zu berücksichtigen, dass § 51 Nr. 1 als Privilegierung wissenschaftlicher Werke konzipiert ist, so dass auch für Bildzitate in den übrigen Werken bei der Ermittlung des Zitatzwecks und des
zulässigen Umfangs die strengeren Anforderungen des § 51 Nr. 1 UrhG angewendet
werden sollten, um nicht entgegen der gesetzgeberischen Absicht eine Besserstellung
der nicht-wissenschaftlichen Werke zu fördern" (S. 81).
Zur engen Auslegung der Katalogbildfreiheit des § 58 UrhG (S. 87-95) verweise ich als Korrektiv auf meinen Aufsatz in der Kunstchronik 2005, der selbstverständlich vom Autor nicht berücksichtigt wird:
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2007/371/
Rundum überzeugend wird dagegen das Fotografierverbot des Sacheigentümers behandelt (S. 99-109). Der Autor stimmt erfreulicherweise in den Chor der Kritiker an BGH "Schloss Tegel" ein: "Damit stellen weder das Fotografieren eines Kunstgegenstandes noch die Verwertung solcher Fotografien einen Eingriff in das Sacheigentum dar, so dass dem Eigentümer kein Unterlassungsanspruch nach § 1004 BGB zusteht. [...] Der Eigentümer eines Kunstgegenstandes kann [...] auf Grund seines Sacheigentums nicht verhindern, dass Dritte den Kunstgegenstand fotografieren und die Aufnahmen gewerblich verwerten. Die Autoren, die von einer entsprechenden Untersagungsbefugnis des Eigentümers ausgehen, berücksichtigen die urheberrechtlichen Wertungen nicht hinreichend." (S. 104, 108). Zum Thema siehe im Internet:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fotos_von_fremdem_Eigentum
Abzulehnen sind dann wieder die Ansichten über die vertraglichen Fotografierverbote. "Im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung wird man daher vielfach zum Ergebnis kommen, dass zumindest die gewerbliche Verwertung von Fotografien, die ohne Entgelt angefertigt wurden, auch ohne ausdrückliche Regelung stillschweigend ausgeschlossen ist" (S. 116). Dass die Monopolstellung des Eigentümers in Konflikt mit den grundrechtlich geschützten Interessen der Allgemeinheit steht, wird wieder unterschlagen. Bei den Darlegung zur möglichen Haftung des Fotografen stimmt bereits die stillschweigend angenommene Prämisse nicht, dass immaterialgüterrechtliche Grundsätze anwendbar sein müssen: Wenn es kein Recht am Bild der eigenen Sache gibt, welches Immaterialgut soll denn dann betroffen sein?
Die für die genannten "Open Access Portale" wichtige Frage, ob die Unterstellung eines Fotos unter eine freie Lizenz, die die gewerbliche Nutzung einschließt, gegen vertragliche Regelungen verstößt, die eine gewerbliche Nutzung ausschließen, bleibt unerörtert. Soweit der Fotograf nicht individuell fassbar ist, sondern anonym oder unter einem Wegwerf-Nick auf Wikimedia Commons hochlädt, wird man dem Eigentümer des gemeinfreien Gegenstands keinen Anspruch gegen weitere Nutzer zusprechen können. Die Ausweitung der kaugummiartigen "Mitstörerhaftung" wäre hier fehl am Platz, sofern man die Interessen der Allgemeinheit an einer reichen Public Domain recht gewichtet. Auch wird man die Bemühungen, Abbildungen gemeinfreier Kunstwerke zur allgemeinen Nutzung gegen die Kommerzialisierungsinteressen des Eigentümers bereitzustellen, nicht als "sittenwidrig" ansehen können (dies in Weiterführung der Argumentation S. 142f.).
Wenig von Sachkunde geprägt ist, was über das öffentlichrechtliche Benutzerverhältnis zu lesen ist (S. 145-152). Der Autor verteidigt die von mir - nicht nur in diesem Weblog - wiederholt angegriffene Kommerzialisierungspraxis der Museen mit fragwürdigen Argumenten und wendet sich auch gegen den Aufsatz von Bullinger (Festschrift Raue). So ist es absolut nicht haltbar, bei Vorliegen grundrechtlich geschützter Interessen dem Benutzer keinen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung zuzugestehen, da es sich beim Fotografieren für gewerbliche Zwecke angeblich um eine Sonderbenutzung handeln würde (S. 148). Die Vermittlung des Werkgenusses, die Sinn und Zweck kulturgutverwahrender Institutionen ist, hat immer auch die Möglichkeit von Reproduktionen und anderer Vervielfältigungen (z.B. der Edition von Texten) in Betracht zu ziehen.
Ein besonderes "Glanzstück" dieser tendenziös und einseitig argumentierenden Dissertation ist die Auseinandersetzung mit mir: "Nach Ansicht von Graf stellt ein Fotografierverbot im Museum einen Verstoß gegen die in Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG verbürgte Informationsfreiheit dar. Auch das gewerbliche Fotografieren von Museumsgut soll von der Informationsfreiheit
geschützt sein, da der öffentliche Auftrag der Museen, Kulturgüter zugänglich zu machen, einer Kommerzialisierung entgegenstehe. Ausgangspunkt dieser Überlegung ist die These, dass ein grundrechtlicher Anspruch auf Zugang zu Kulturgütern
im staatlichen Besitz besteht, den Graf – leider wenig strukturiert und ohne dogmatisch überzeugende Herleitung – aus Gedanken des Kulturstaatsprinzips, der Forschungsfreiheit, der Informationsfreiheit sowie der Befristung des Urheberschutzes
entwickelt" (S. 150). Man kann sich durch einen Blick in die herangezogene Publikationen, eine Rezension mehrerer Bände zum Thema Museumsrecht, leicht davon überzeugen, dass für eine strukturiertere und dogmatisch überzeugendere Herleitung (die mir als Nicht-Jurist ja ohnehin schwerfällt) schlicht und einfach nicht der Platz vorhanden war:
http://www.vl-museen.de/lit-rez/graf99-1.htm
(Wenn ich nichts übersehen habe, wird kein anderer Autor so im Haupttext abgewatscht.)
Ausführlicher habe ich meine Überlegungen in gedruckten und online zugänglichen Veröffentlichungen niedergelegt, die der Autor alle zu ignorieren beliebt. Eine Auswahl:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/kultjur.htm
http://www.jurawiki.de/FotoRecht
http://archiv.twoday.net/stories/4477824/
Der Autor behandelt das öffentlichrechtliche Benutzungsverhältnis oberflächlich und ohne Einsicht in die starke Bindung des öffentlichen Rechts an die Grundrechte. Besonders abstrus wird es, wenn die von Bullinger ins Feld geführte Sozialpflichtigkeit des Eigentums mit dem Argument zurückgewiesen wird, der Staat könne sich gar nicht auf den Grundrechtsschutz nach Art. 14 GG berufen (S. 152). Genau das tun die Museen und die Kultusministerkonferenz aber, wenn sie ihre rechtswidrigen Reproduktionsgebühren für gemeinfreie Objekte rechtfertigen, siehe
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/kultjur.htm
Fotografierverbote stellen Eingriffe in das Grundrecht der Meinungs-, Presse-, Wissenschafts- und Informationsfreiheit dar, die nach öffentlichem Recht nur zulässig sind, wenn überragende öffentliche Belange für sie streiten und nicht lediglich das fiskalische Monopolisierungs-Interesse des Staates.
Es stellt einen gravierenden Mangel der Arbeit dar, dass das wichtige Recht der "Editio princeps" § 71 UrhG (siehe etwa http://archiv.twoday.net/stories/4807346/ ) vollständig übergangen wird, obwohl es vermutlich mehr und mehr praktische Bedeutung erlangen wird. Zu völlig anderen Schlüssen als der Autor kommen Götting/Lauber-Rönsberg, Der Schutz nachgelassener Werke, Baden-Baden 2006, S. 84-91.
Nicht näher eingegangen werden soll auf die umfangreiche Erörterung der Rechtsverhältnisse zwischen (angestellten oder freien) Fotografen und Bildagenturen sowie der Beziehungen zwischen Bildagenturen und Nutzern. Unverständlich erscheint mir, dass die Frage der Belegexemplare (siehe http://archiv.twoday.net/stories/4898583/ ) nicht angesprochen wird.
Es entspricht der dargestellten Grundtendenz der Arbeit, dass die auf maximale Kommerzialisierung des Kulturguts abzielenden Kooperationen zwischen Kunstmuseen und Bildagenturen nicht ansatzweise kritisch gesehen werden (S. 203-207). Bei der Erörterung der Beziehungen von Künstler und VG Bild-Kunst fehlen erwartungsgemäß Aussagen zu freien Lizenzen.
Die Zusammenfassung der Arbeit in prägnanten Thesen ist löblich, ändert aber nichts an dem negativen Gesamteindruck, der vor allem aus der einseitigen Parteinahme des Verfassers gegen die Berücksichtigung der Interessen der Allgemeinheit (und nicht nur der Open-Access-Bewegung) resultiert. Dadurch und durch die dargestellten Mängel wird der wissenschaftliche Wert des Buchs beeinträchtigt.
Gut zur Tendenz der Arbeit passt der Rechtevermerk des Verlags: "Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Verlages öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch bei einer entsprechenden Nutzung für Lehr- und Unterrichtszwecke." Das ist eindeutig illegal (und sollte von Mitbewerbern abgemahnt werden), denn weder ist diese Hochschulschrift "für den Unterrichtsgebrauch an Schulen" bestimmt noch ist erkennbar, wieso es nicht zulässig sein soll, auch hier "veröffentlichte kleine Teile eines Werkes" gemäß § 52a UrhG zugänglich zu machen.

(= Schriften zum deutschen und internationalen Persönlichkeits- und
Immaterialgüterrecht 20). Göttingen: V&R unipress 2008. 235 S. 38,90 Euro.
Inhaltsverzeichnis:
http://www.amazon.de/gp/reader/3899714555/ref=sib_rdr_toc?ie=UTF8&p=S006&j=0#reader-page
(Als Besprechungsexemplar stellte der Verlag ein PDF zur Verfügung.)
Die Kieler Dissertation bei Haimo Schack beschäftigt sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der Fotografie von Kunstwerken. Der Schwerpunkt liegt auf dem Urheberrecht. Der Autor beschreibt sein Ziel so: "Im Folgenden soll zunächst untersucht werden, ob und in welchem Umfang der
Fotograf für die Ablichtung von Kunstgegenständen urheberrechtlichen Schutz
beanspruchen kann. Im zweiten Teil wird dann der Frage nachgegangen, welche
Rechtspositionen es ermöglichen, das Fotografieren eines Kunstgegenstandes und
die anschließende Verwertung der Aufnahmen zu untersagen. Besonderes Augenmerk
wird hier gerichtet auf das Urheberrecht des Künstlers und dessen Schranken,
die Rechte des Eigentümers sowie auf vertragliche Untersagungsmöglichkeiten
desjenigen, der den Zugang zum Werk kontrollieren kann. Schließlich werden
im dritten Teil die vielfältigen Vertragsverhältnisse bei der Vergabe der Bildrechte
an Fotografien von Kunstgegenständen untersucht" (S. 16).
Dass beim manuellen Abfotografieren zweidimensionaler Kunstgegenstände das erforderliche Mindestmaß persönlicher geistiger Leistung gegeben ist, um den Lichtbildschutz nach § 72 UrhG entstehen zu lassen, wird vom Autor bejaht. Seine Argumentation ist oberflächlich und einseitig voreingenommen. Die herrschende juristische Meinung sieht das anders:
http://archiv.twoday.net/stories/4850312/
Deutlich wird, wie sich der Autor in den Prämissen verheddert. Hertins Urbild-Theorie, demzufolge ein Bild geschützt ist, wenn es als erstmalige fotografische Darstellung gelten kann, scheitert an den Fotokopien. Kombiniert man die Forderung nach dem Mindestmaß und dem Urbild, bekommt der Autor Probleme bei der manuellen Fotografie von Fotokunst: "Sieht man die Fotokunst neben der bildenden Kunst als gleichwertig an, so ist es nicht nachvollziehbar, wenn ein Museumsfotograf für manuelle Reproduktionsfotografien von Gemälden und Skulpturen ein Leistungsschutzrecht nach § 72 UrhG erwirbt, nicht aber für handwerklich ebenso gelungene Aufnahmen der Werke von
Fotokünstlern wie Helmut Newton oder Andreas Gursky" (S. 31). Dass die Lichtbildkopie vom Schutz nach § 72 UrhG ausgeschlossen sein soll, hat der BGH aber in seiner Entscheidung Bibelreproduktion unmißverständlich dargelegt. Wenn in einer Zille-Ausstellung ein Fotograf sowohl Fotografien als auch Bilder fotografiert, löst man das Problem dadurch einfachsten, dass man ihm in keinem von beiden Fällen ein Leistungsschutzrecht gewährt, da bei einer originalgetreuen Abbildung nicht das erforderliche Mindestmaß an geistiger Leistung gegeben ist. Originalität und Originaltreue schließen sich aus. Das sieht man auch in den USA (Bridgeman v. Corel, 1999) und in Japan zutreffenderweise so.
Der Autor geht auf die praktisch wichtige Frage der Digitalisate nicht ein. Da diese aber keine manuellen Fotografien sind, wird man annehmen dürfen, dass er sie wie Fotokopien schutzlos lässt.
Mit deutlichem Abscheu referiert der Autor die Praxis der "Open-Access-Portale" wie Wikimedia Commons, die aus Kunstbänden abgescannte Bilder auch zur kommerziellen Nutzung anbieten. "Die Rechtsinhaber sehen jedoch wegen der Schwierigkeit, nachzuweisen, dass gerade ihre Fotografie verwendet wurde, oft von einer Klage ab" (S. 62). Meines Wissens sehen sie nicht nur "oft", sondern bislang immer von einer Klage ab, denn ihre Position ist, wie dargestellt, eher schwach begründet. Wenn der Lichtbildschutz, wie der Autor immer wieder betont, der schöpferischen Tätigkeit des Urhebers nahe steht, dann kann man für den Fall der Ununterscheidbarkeit von Fotos eines Kunstwerks doch nicht ernsthaft behaupten, der manuell fotografierende Fotograf würde etwas grundsätzlich anderes tun als derjenige, der ein Tonband oder einen Film kopiert.
Das vom Autor nicht beachtete Kriterium der Unterscheidbarkeit spielt auch bei einem anderen Leistungsschutzrecht eine Rolle: nämlich bei den wissenschaftlichen Ausgaben, die sich "wesentlich" von bisher bekannten Ausgaben unterscheiden müssen (§ 70 UrhG). Würden auch Editionen geschützt, die sich von bereits bekannten Ausgaben nicht unterscheiden, so ließe sich bei einer (insbesondere musikalischen) Verwertung nicht feststellen, welche der Editionen benutzt wurden (Loewenheim, in: Schricker, Urheberrecht, 3. Aufl., Münche3n 2006, § 70 Rz. 7 nach Amtl. Begründung BT-DS IV, 270 S. 87).
Zustimmen kann man dagegen dem Ergebnis zur Unterscheidung von Lichtbildwerken und Lichtbildern, dass nämlich " für die Werkqualität einer Fotografie [eines Kunstwerks] eine künstlerische Aussage des Fotografen notwendig ist. [...] Damit sind die meisten Reproduktionsfotografien dreidimensionaler Kunstgegenstände als bloße Sachabbildung mangels künstlerischer Aussage nur nach § 72
UrhG als einfache Lichtbilder geschützt." (S. 50f.). Zutreffend ist auch: "Mit dem Gestaltungsspielraum des Fotografen wächst auch der Entscheidungsspielraum der Gerichte, ob die konkrete Gestaltung der Aufnahme bereits ausreicht, um eine künstlerische Aussage zu bejahen. In soweit ist
die Einschätzung des Gesetzgebers von 1965, dass die Abgrenzung vom Lichtbildwerk zum einfachen Lichtbild erhebliche Schwierigkeiten bereitet auch
heute noch aktuell. Es liegt an der Natur der Fotografie, den Aufnahmegegenstand
realistisch abzulichten, dass im Bereich der kleinen Münze stets eine gewisse Unsicherheit bestehen bleibt, ob die jeweilige Bildgestaltung für die Annahme
einer künstlerischen Aussage ausreicht" (S. 60). Solche Abgrenzungsprobleme müssen aber, wenn die Schutzfrist für einfache Lichtbilder abgelaufen ist, zwingend Auswirkungen haben auf die haftungsrechtlichen und strafrechtlichen Implikationen des Urheberrechts. Wenn man - das vom Autor ignorierte - Interesse der Allgemeinheit an einer starken Public Domain in die Waagschale wirft, kann es nicht bei der Devise "Im Zweifel keine Nutzung" bleiben. Artur Wandtke/Winfried Bullinger, Die Marke als urheberrechtlich schutzfähiges Werk, GRUR 1997, S. 573-580, hier S. 577 formulierten: "Die zeitliche Begrenzung des Urheberrechts hat nicht nur bloß eine negative Ausschlußfunktion. Sie hat vor allem auch die positive Zuordnungsfunktion, urheberrechtliche Werke dem Gemeingebrauch zur Verfügung zu stellen". Es darf nicht zu Lasten des Nutzers gehen, der legitimerweise von der Public Domain Gebrauch machen will, wenn Lichtbildwerke und Lichtbilder von Kunstwerken extrem schwer zu unterscheiden sind.
S. 65 meint der Autor, es sei "zu erwägen, die Zitierfreiheit
de lege ferenda im Interesse der kunstwissenschaftlichen Auseinandersetzung auch auf Fotografien des Kunstwerkes zu erstrecken". Das ist falsch: Anders als bei der Katalogbildfreiheit oder bei der Berichterstattung über Tagesereignisse setzt das Zitatrecht nicht voraus, dass der Zitierende das Bild des Kunstwerks selbst angefertigt haben muss. Soweit sich der Autor auf andere Juristen beruft, sind diese ebenfalls auf dem Holzweg. Im Schricker-Kommentar steht dazu nichts, mehr noch: Die Ausführungen (§ 51 Rz. 17) zur Belegfunktion des Zitats mit Blick auf RGZ Codex Aureus wären offenkundig sinnlos. Die Auseinandersetzung mit dem Bild in der Entscheidung Codex Aureus, die von der Schützbarkeit der Handschriftenabbildung ausging (was inzwischen von Vogel in Schricker § 72 Rz. 23 explizit abgelehnt wird), bezog sich auf die Frage, ob das Faksimile der gemeinfreien Handschriftenillustration den Inhalt erläuterte oder nur schmückendes Beiwerk war. Das Reichsgericht hätte sich die ganze umständliche Argumentation sparen können, wenn man der abwegigen Ansicht folgt, dass die Verwendung fremder Kunstfotografien nicht dem Zitatrecht unterfällt. Wenn es zulässig ist, fremde Laufbilder zu zitieren (siehe BGH zu TV Total), um sich mit dem in ihnen Dargestellten, dem ja kein Werkcharakter zukommt, auseinanderzusetzen, dann ist es auch erlaubt, fremde Kunstfotos zu zitieren, um sich mit dem dargestellten gemeinfreien oder geschützten Werk auseinanderzusetzen. Auch von Sinn und Zweck des Zitatrechts, das aufs engste mit den Kommunikationsgrundrechten des Art. 5 GG zusammenhängt, wäre eine solche Einschränkung nicht zu rechtfertigen.
In Teil 2 der Arbeit geht es um den "Schutz vor dem Fotografen", also um die Wirksamkeit von Fotografierverboten. Die der herrschenden urheberrechtlichen Lehre, Resultat des eifrigen Wirkens der Verwerterlobby, treu folgende konservative Position des Autors, wird deutlich aus Formulierungen wie dieser: "Um der Missbrauchsgefahr zu Lasten des Urhebers vorzubeugen, muss das
Merkmales »Tagesereignis« restriktiv ausgelegt werden" (S. 76 zu § 50 UrhG). Anders als etwa bei jüngeren Dissertationen in der UFITA-Schriftenreihe fallen die durch die Kommunikationsgrundrechte abgesicherten berechtigten Interessen der Allgemeinheit unter den Tisch. Zum Zitatrecht liest man daher folgerichtig: "Allerdings ist zu berücksichtigen, dass § 51 Nr. 1 als Privilegierung wissenschaftlicher Werke konzipiert ist, so dass auch für Bildzitate in den übrigen Werken bei der Ermittlung des Zitatzwecks und des
zulässigen Umfangs die strengeren Anforderungen des § 51 Nr. 1 UrhG angewendet
werden sollten, um nicht entgegen der gesetzgeberischen Absicht eine Besserstellung
der nicht-wissenschaftlichen Werke zu fördern" (S. 81).
Zur engen Auslegung der Katalogbildfreiheit des § 58 UrhG (S. 87-95) verweise ich als Korrektiv auf meinen Aufsatz in der Kunstchronik 2005, der selbstverständlich vom Autor nicht berücksichtigt wird:
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2007/371/
Rundum überzeugend wird dagegen das Fotografierverbot des Sacheigentümers behandelt (S. 99-109). Der Autor stimmt erfreulicherweise in den Chor der Kritiker an BGH "Schloss Tegel" ein: "Damit stellen weder das Fotografieren eines Kunstgegenstandes noch die Verwertung solcher Fotografien einen Eingriff in das Sacheigentum dar, so dass dem Eigentümer kein Unterlassungsanspruch nach § 1004 BGB zusteht. [...] Der Eigentümer eines Kunstgegenstandes kann [...] auf Grund seines Sacheigentums nicht verhindern, dass Dritte den Kunstgegenstand fotografieren und die Aufnahmen gewerblich verwerten. Die Autoren, die von einer entsprechenden Untersagungsbefugnis des Eigentümers ausgehen, berücksichtigen die urheberrechtlichen Wertungen nicht hinreichend." (S. 104, 108). Zum Thema siehe im Internet:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fotos_von_fremdem_Eigentum
Abzulehnen sind dann wieder die Ansichten über die vertraglichen Fotografierverbote. "Im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung wird man daher vielfach zum Ergebnis kommen, dass zumindest die gewerbliche Verwertung von Fotografien, die ohne Entgelt angefertigt wurden, auch ohne ausdrückliche Regelung stillschweigend ausgeschlossen ist" (S. 116). Dass die Monopolstellung des Eigentümers in Konflikt mit den grundrechtlich geschützten Interessen der Allgemeinheit steht, wird wieder unterschlagen. Bei den Darlegung zur möglichen Haftung des Fotografen stimmt bereits die stillschweigend angenommene Prämisse nicht, dass immaterialgüterrechtliche Grundsätze anwendbar sein müssen: Wenn es kein Recht am Bild der eigenen Sache gibt, welches Immaterialgut soll denn dann betroffen sein?
Die für die genannten "Open Access Portale" wichtige Frage, ob die Unterstellung eines Fotos unter eine freie Lizenz, die die gewerbliche Nutzung einschließt, gegen vertragliche Regelungen verstößt, die eine gewerbliche Nutzung ausschließen, bleibt unerörtert. Soweit der Fotograf nicht individuell fassbar ist, sondern anonym oder unter einem Wegwerf-Nick auf Wikimedia Commons hochlädt, wird man dem Eigentümer des gemeinfreien Gegenstands keinen Anspruch gegen weitere Nutzer zusprechen können. Die Ausweitung der kaugummiartigen "Mitstörerhaftung" wäre hier fehl am Platz, sofern man die Interessen der Allgemeinheit an einer reichen Public Domain recht gewichtet. Auch wird man die Bemühungen, Abbildungen gemeinfreier Kunstwerke zur allgemeinen Nutzung gegen die Kommerzialisierungsinteressen des Eigentümers bereitzustellen, nicht als "sittenwidrig" ansehen können (dies in Weiterführung der Argumentation S. 142f.).
Wenig von Sachkunde geprägt ist, was über das öffentlichrechtliche Benutzerverhältnis zu lesen ist (S. 145-152). Der Autor verteidigt die von mir - nicht nur in diesem Weblog - wiederholt angegriffene Kommerzialisierungspraxis der Museen mit fragwürdigen Argumenten und wendet sich auch gegen den Aufsatz von Bullinger (Festschrift Raue). So ist es absolut nicht haltbar, bei Vorliegen grundrechtlich geschützter Interessen dem Benutzer keinen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung zuzugestehen, da es sich beim Fotografieren für gewerbliche Zwecke angeblich um eine Sonderbenutzung handeln würde (S. 148). Die Vermittlung des Werkgenusses, die Sinn und Zweck kulturgutverwahrender Institutionen ist, hat immer auch die Möglichkeit von Reproduktionen und anderer Vervielfältigungen (z.B. der Edition von Texten) in Betracht zu ziehen.
Ein besonderes "Glanzstück" dieser tendenziös und einseitig argumentierenden Dissertation ist die Auseinandersetzung mit mir: "Nach Ansicht von Graf stellt ein Fotografierverbot im Museum einen Verstoß gegen die in Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG verbürgte Informationsfreiheit dar. Auch das gewerbliche Fotografieren von Museumsgut soll von der Informationsfreiheit
geschützt sein, da der öffentliche Auftrag der Museen, Kulturgüter zugänglich zu machen, einer Kommerzialisierung entgegenstehe. Ausgangspunkt dieser Überlegung ist die These, dass ein grundrechtlicher Anspruch auf Zugang zu Kulturgütern
im staatlichen Besitz besteht, den Graf – leider wenig strukturiert und ohne dogmatisch überzeugende Herleitung – aus Gedanken des Kulturstaatsprinzips, der Forschungsfreiheit, der Informationsfreiheit sowie der Befristung des Urheberschutzes
entwickelt" (S. 150). Man kann sich durch einen Blick in die herangezogene Publikationen, eine Rezension mehrerer Bände zum Thema Museumsrecht, leicht davon überzeugen, dass für eine strukturiertere und dogmatisch überzeugendere Herleitung (die mir als Nicht-Jurist ja ohnehin schwerfällt) schlicht und einfach nicht der Platz vorhanden war:
http://www.vl-museen.de/lit-rez/graf99-1.htm
(Wenn ich nichts übersehen habe, wird kein anderer Autor so im Haupttext abgewatscht.)
Ausführlicher habe ich meine Überlegungen in gedruckten und online zugänglichen Veröffentlichungen niedergelegt, die der Autor alle zu ignorieren beliebt. Eine Auswahl:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/kultjur.htm
http://www.jurawiki.de/FotoRecht
http://archiv.twoday.net/stories/4477824/
Der Autor behandelt das öffentlichrechtliche Benutzungsverhältnis oberflächlich und ohne Einsicht in die starke Bindung des öffentlichen Rechts an die Grundrechte. Besonders abstrus wird es, wenn die von Bullinger ins Feld geführte Sozialpflichtigkeit des Eigentums mit dem Argument zurückgewiesen wird, der Staat könne sich gar nicht auf den Grundrechtsschutz nach Art. 14 GG berufen (S. 152). Genau das tun die Museen und die Kultusministerkonferenz aber, wenn sie ihre rechtswidrigen Reproduktionsgebühren für gemeinfreie Objekte rechtfertigen, siehe
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/kultjur.htm
Fotografierverbote stellen Eingriffe in das Grundrecht der Meinungs-, Presse-, Wissenschafts- und Informationsfreiheit dar, die nach öffentlichem Recht nur zulässig sind, wenn überragende öffentliche Belange für sie streiten und nicht lediglich das fiskalische Monopolisierungs-Interesse des Staates.
Es stellt einen gravierenden Mangel der Arbeit dar, dass das wichtige Recht der "Editio princeps" § 71 UrhG (siehe etwa http://archiv.twoday.net/stories/4807346/ ) vollständig übergangen wird, obwohl es vermutlich mehr und mehr praktische Bedeutung erlangen wird. Zu völlig anderen Schlüssen als der Autor kommen Götting/Lauber-Rönsberg, Der Schutz nachgelassener Werke, Baden-Baden 2006, S. 84-91.
Nicht näher eingegangen werden soll auf die umfangreiche Erörterung der Rechtsverhältnisse zwischen (angestellten oder freien) Fotografen und Bildagenturen sowie der Beziehungen zwischen Bildagenturen und Nutzern. Unverständlich erscheint mir, dass die Frage der Belegexemplare (siehe http://archiv.twoday.net/stories/4898583/ ) nicht angesprochen wird.
Es entspricht der dargestellten Grundtendenz der Arbeit, dass die auf maximale Kommerzialisierung des Kulturguts abzielenden Kooperationen zwischen Kunstmuseen und Bildagenturen nicht ansatzweise kritisch gesehen werden (S. 203-207). Bei der Erörterung der Beziehungen von Künstler und VG Bild-Kunst fehlen erwartungsgemäß Aussagen zu freien Lizenzen.
Die Zusammenfassung der Arbeit in prägnanten Thesen ist löblich, ändert aber nichts an dem negativen Gesamteindruck, der vor allem aus der einseitigen Parteinahme des Verfassers gegen die Berücksichtigung der Interessen der Allgemeinheit (und nicht nur der Open-Access-Bewegung) resultiert. Dadurch und durch die dargestellten Mängel wird der wissenschaftliche Wert des Buchs beeinträchtigt.
Gut zur Tendenz der Arbeit passt der Rechtevermerk des Verlags: "Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Verlages öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch bei einer entsprechenden Nutzung für Lehr- und Unterrichtszwecke." Das ist eindeutig illegal (und sollte von Mitbewerbern abgemahnt werden), denn weder ist diese Hochschulschrift "für den Unterrichtsgebrauch an Schulen" bestimmt noch ist erkennbar, wieso es nicht zulässig sein soll, auch hier "veröffentlichte kleine Teile eines Werkes" gemäß § 52a UrhG zugänglich zu machen.

KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2008, 23:45 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das Kölner Migration-Audio-Archiv stellt seine neue Veröffentlichung vor:
" ..... Deutschland ist seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland, in das Menschen unterschiedlicher Herkunft aus den verschiedensten Gründen eingewandert sind. „In Deutschland angekommen ...“ ist unter „Bertelsmann Chronik“ soeben im wissenmedia Verlag erschienen und versammelt eine Auswahl von rund 40 Beiträgen aus dem migration-audio-archiv, das seit 2004 die Lebensgeschichten von Migranten in Deutschland zusammenträgt. In diesem Buch erzählen Männer und Frauen jeden Alters und unterschiedlichster Herkunft, wie und warum sie nach Deutschland gekommen sind, wie sie aufgenommen wurden, wie sie das Land und die Menschen erlebten und immer noch erleben – wie sie „angekommen“ sind. Die Erzählungen spannen dabei einen weiten Bogen von den Erlebnissen der ersten „Gastarbeiter“, die in den 50er-Jahren angeworben wurden, bis hin zu den Eindrücken der Einwanderer, die vor kurzem erst nach Deutschland kamen. So entsteht ein einzigartiges Panorama bewegender Einwanderungsgeschichten – mal nachdenklich, mal traurig, aber auch dramatisch, kurios und optimistisch. Ergänzt mit privaten Fotos, die die Erzählenden zur Verfügung gestellt haben, bekommt das Thema Einwanderung in diesem Buch viele persönliche Gesichter. Gleichzeitig wird auf diese Weise immer auch ein Stück
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erzählt – in diesem Fall sehr emotional, individuell, authentisch.
......... Die vorliegende Publikation ist die erste Veröffentlichung von ausgewählten Erzählungen in transkribierter Form, als geschriebenes
Wort. Als Audioerzählung sind sie hörbar unter www.migration-audio-archiv.de – eine außergewöhnliche, interaktive Website, die 2007 für den Grimme Online Award nominiert wurde. Initiatoren des migration-audio-archiv sind die Journalistin Sefa Inci Suvak sowie der Autor und Designer Justus Herrmann.
„In Deutschland angekommen ...“
Einwanderer erzählen ihre Geschichte .
1955 bis heute
Sefa Inci Suvak / Justus Herrmann (Hrsg.)
2008, Bertelsmann Chronik, wissenmedia Verlag GmbH, Gütersloh/München
352 Seiten, 16,00 x 24,00 cm
Gebunden mit Schutzumschlag, mit Lesezeichen
ISBN 978-3-577-14647-0"
Zum Archiv mit Presseinfo siehe: http://archiv.twoday.net/stories/2221619/
Wolf Thomas - am Mittwoch, 19. November 2008, 19:42 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
(via literaturport.de)
"Leben und Wirken des zwischen 1921 und 1934 am Potsdamer Reichsarchiv tätigen Historikers Karl Heinrich Schäfer finden bereits seit einigen Jahren das Interesse von Wissenschaftern aus dem Historischen Institut der Universität Potsdam. Sein für die Stadt- und Landesgeschichte, aber auch für die Geschichtswissenschaft in der Region Brandenburg wichtiger Nachlass konnte nun in Kooperation mit der Katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul in einem Findbuch teilweise erschlossen werden. Ermöglicht wurde dieses Projekt durch eine Förderung des brandenburgischen Innenministeriums.
Am 11. Juni 2008 übergaben Prof. Dr. Heinz-Dieter Heimann und seine Mitarbeiter von der Universität Potsdam das Findbuch an den Pfarrer von St. Peter und Paul, Propst Klaus-Günter Müller. Aus diesem Anlass werden Teile des Nachlasses, darunter beispielsweise einige Fotografien zur Potsdamer Stadtgeschichte, der Öffentlichkeit vorgestellt.
In der Biographie Karl Heinrich Schäfers verknüpfen sich politische Umstände und persönliche Lebensentscheidungen in beispielhafter Weise. 1871 geboren, studierte Schäfer zunächst evangelische Theologie, bevor er 1902 zum Katholizismus konvertierte, was zum Verlust seiner Stellung am Stadtarchiv Köln führte. Im Auftrag der Görres-Gesellschaft war der mit einer Arbeit zur mittelalterlichen Kirchengeschichte promovierte Schäfer daraufhin einige Jahre in römischen Archiven tätig. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde er 1921 an das neugegründete Reichsarchiv in Potsdam berufen. Obwohl beruflich eher ein Außenseiter im von ehemaligen preußischen Offizieren dominierten Reichsarchiv, wurde Potsdam doch schnell zur Heimat für Schäfer und seine Frau. Ihre Wohnung gehörte zu den bekannten Orten bürgerlicher Kultur in der Stadt. Dies änderte sich auch nach Schäfers politisch motivierter Versetzung in den Ruhestand 1934 nicht. 1942 wurden Schäfer und seine Frau wegen des Hörens englischer Radiosender denunziert und verhaftet, im Januar 1945 starb der ehemalige Archivrat im Konzentrationslager Sachsenhausen.
Lange Zeit hatte man Schäfers Leistungen für die Landeskulturgeschichte der mittelalterlichen Mark Brandenburg nicht ausreichend gewürdigt. Erst in den vergangenen Jahren wurden seine Schriften wieder verstärkt zur Kenntnis genommen, woran die Potsdamer Historiker großen Anteil haben. Der wissenschaftliche und private Nachlass des Archivars befindet sich im Diözesanarchiv Berlin und im Archiv der Potsdamer Propsteikirche St. Peter und Paul. Im Zuge der wissenschaftsgeschichtlichen Arbeiten an der Professur von Heinz-Dieter Heimann konnte der Potsdamer Bestand jetzt geordnet und erfasst werden. Dabei kamen nicht nur für die Landesgeschichte interessante Quellen, wie alte Drucke und Manuskripte, zum Vorschein, sondern auch private Dokumente, die Einblicke in das kulturelle Leben eines bürgerlichen Haushaltes im Potsdam der Zwischenkriegszeit gewähren.
Insgesamt umfasst der Potsdamer Nachlassteil etwa 650 Bände aus Schäfers Bibliothek sowie rund 1.600 einzelne Dokumente, wie Briefe, Fotos und Zeitungsberichte, die jetzt in dem Findbuch erfasst sind. So ist es beispielsweise möglich, schnell einen Überblick über die in ganz Europa verteilten Korrespondenzpartner Schäfers zu erhalten."
Quelle:
http://idw-online.de/pages/de/news263289
s. a. Bestandsinformationen zum Teilnachlass im Diözesanarchiv Berlin:
http://www.dioezesanarchiv-berlin.de/best%20V-030.html
Wolf Thomas - am Mittwoch, 19. November 2008, 19:40 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ..... Der Verein besteht seit 30 Jahren und ist bekannt dafür, dass er zu städtebaulichen Themen selten ein Blatt vor den Mund nimmt, über ein umfassendes historisches Archiv mit Postkarten und Dokumenten verfügt und in den vergangenen 16 Jahren rund 70000 Euro für 43 Projekte gespendet hat. ...."
Quelle: Kieler Nachrichten
Quelle: Kieler Nachrichten
Wolf Thomas - am Mittwoch, 19. November 2008, 19:36 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
2008/11/19 Jean-Claude Guédon wrote in the AMSCI OA Forum:
> Larry is right, and Stevan is right. Both routes should be followed and both
> routes should be demanded by students. Let us stop this exclusive attitude
> with regard to OA. Two roads exist. They are equally valuable. Rather than
> declaring one suprior to the other, it would be far more useful to examine
> how to make these two approaches help each other.
I agree with this.
Rainer Kuhlen has posted in INETBIB a question regarding Professor Harnad's position to the aims of the German "Urheberrechtsbündnis" ("improving copyright is slowing the OA movement"):
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg37662.html
I have replied to this at
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg37671.html
Here is a short summary in English:
1. It is a myth that green OA only works with a mandate.
Have a look at the NL "Cream of Science"!
2 It is a myth that mandates are legally possible in all contries.
At least in Germany it is impossible or very difficult to make mandates legally valid.
3. It is a myth that deposit with closed access is legally possible in all countries.
At least in Germany the copyright act forbidds such depositing without the consent of the holder of the exclusive rights. See
http://archiv.twoday.net/stories/5193609/
4. It is a myth that the "Request Button" works.
See my little tests
http://archiv.twoday.net/stories/5193609/
http://archiv.twoday.net/stories/5247312/
On October 11, I requested 7 titles from the U of Tasmania repository found with the following query:
http://tinyurl.com/5dbssm
On October 12 and 14 I get summa summarum 2 results, i.e. the PDFs of the requested eprints.
For me this is enough empirical evidence to say that there is until now no empirical evidence that the RCB works!
5. It is a myth to think that is all a question of embargo terms.
There are disciplines with publishers which are making case-to-case decisions and publishers which don't accept green OA. Depositing eprints closed access which cannot be used before the last dying author is 70 years dead doesn't make sense.
6. It is am myth that the primary aim of the OA movement is to make the journal literature free.
A lot of people don't share this position. For a broader definition of OA see
http://archiv.twoday.net/stories/5251764/
> Larry is right, and Stevan is right. Both routes should be followed and both
> routes should be demanded by students. Let us stop this exclusive attitude
> with regard to OA. Two roads exist. They are equally valuable. Rather than
> declaring one suprior to the other, it would be far more useful to examine
> how to make these two approaches help each other.
I agree with this.
Rainer Kuhlen has posted in INETBIB a question regarding Professor Harnad's position to the aims of the German "Urheberrechtsbündnis" ("improving copyright is slowing the OA movement"):
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg37662.html
I have replied to this at
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg37671.html
Here is a short summary in English:
1. It is a myth that green OA only works with a mandate.
Have a look at the NL "Cream of Science"!
2 It is a myth that mandates are legally possible in all contries.
At least in Germany it is impossible or very difficult to make mandates legally valid.
3. It is a myth that deposit with closed access is legally possible in all countries.
At least in Germany the copyright act forbidds such depositing without the consent of the holder of the exclusive rights. See
http://archiv.twoday.net/stories/5193609/
4. It is a myth that the "Request Button" works.
See my little tests
http://archiv.twoday.net/stories/5193609/
http://archiv.twoday.net/stories/5247312/
On October 11, I requested 7 titles from the U of Tasmania repository found with the following query:
http://tinyurl.com/5dbssm
On October 12 and 14 I get summa summarum 2 results, i.e. the PDFs of the requested eprints.
For me this is enough empirical evidence to say that there is until now no empirical evidence that the RCB works!
5. It is a myth to think that is all a question of embargo terms.
There are disciplines with publishers which are making case-to-case decisions and publishers which don't accept green OA. Depositing eprints closed access which cannot be used before the last dying author is 70 years dead doesn't make sense.
6. It is am myth that the primary aim of the OA movement is to make the journal literature free.
A lot of people don't share this position. For a broader definition of OA see
http://archiv.twoday.net/stories/5251764/
KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2008, 17:40 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.fotostoria.de/?p=1276
Google stellt jetzt das Bildarchiv der LIFE mit Millionen historischer Aufnahmen ins Netz: LIFE photo archive hosted by Google.
Die Quelle wird mit “source:life” eingeschränkt, also z.B. http://images.google.com/images?q=Marie+Curie+source:life
Wie sieht es mit dem Urheberrecht aus?
Gemäß Staatsvertrag steht US-Urhebern in Deutschland die Inländerbehandlung zu. Die Fotos, die man wohl alle als Lichtbildwerke anzusehen hat, sind also NICHT urheberrechtlich geschützt, wenn
* der Fotograf 70 Jahre tot ist oder
* die Vorschriften über anonyme Werke anzuwenden sind.
In Betracht kommt eventuell auch die "Editio princeps" (§ 71 UrhG).
Ein Copyrightvermerk, der ein in D gemeinfreies Bild betrifft, kann nach dem UWG abgemahnt werden.
In den anderen europäischen Ländern gilt der Schutzfristenvergleich, soweit keine eigenen Staatsverträge mit den USA bestehen. Ist ein Bild in den USA gemeinfrei, dann auch in diesen Ländern.
Bilder, die vor 1923 publiziert wurden, sind gemeinfrei (Public Domain) in den USA. Die Kennzeichnung eines Bilds mit unzutreffendem Copyright-Vermerk verstößt gegen US-Urheberrecht. Allerdings dürfte dieser Fall eher selten sein, denn das Life Magazine wurde erst 1936 gegründet:
http://de.wikipedia.org/wiki/Life_(Magazin)
Im Google Blog heisst es: "Only a very small percentage of these images have ever been published. The rest have been sitting in dusty archives".
Allerdings tauchen auch ältere Bilder in Googles LIFE-Fotoarchiv auf.
Für die anderen Bilder gilt:
http://www.copyright.cornell.edu/public_domain/
 Tafel von 1870, gemeinfrei!
Tafel von 1870, gemeinfrei!
Google stellt jetzt das Bildarchiv der LIFE mit Millionen historischer Aufnahmen ins Netz: LIFE photo archive hosted by Google.
Die Quelle wird mit “source:life” eingeschränkt, also z.B. http://images.google.com/images?q=Marie+Curie+source:life
Wie sieht es mit dem Urheberrecht aus?
Gemäß Staatsvertrag steht US-Urhebern in Deutschland die Inländerbehandlung zu. Die Fotos, die man wohl alle als Lichtbildwerke anzusehen hat, sind also NICHT urheberrechtlich geschützt, wenn
* der Fotograf 70 Jahre tot ist oder
* die Vorschriften über anonyme Werke anzuwenden sind.
In Betracht kommt eventuell auch die "Editio princeps" (§ 71 UrhG).
Ein Copyrightvermerk, der ein in D gemeinfreies Bild betrifft, kann nach dem UWG abgemahnt werden.
In den anderen europäischen Ländern gilt der Schutzfristenvergleich, soweit keine eigenen Staatsverträge mit den USA bestehen. Ist ein Bild in den USA gemeinfrei, dann auch in diesen Ländern.
Bilder, die vor 1923 publiziert wurden, sind gemeinfrei (Public Domain) in den USA. Die Kennzeichnung eines Bilds mit unzutreffendem Copyright-Vermerk verstößt gegen US-Urheberrecht. Allerdings dürfte dieser Fall eher selten sein, denn das Life Magazine wurde erst 1936 gegründet:
http://de.wikipedia.org/wiki/Life_(Magazin)
Im Google Blog heisst es: "Only a very small percentage of these images have ever been published. The rest have been sitting in dusty archives".
Allerdings tauchen auch ältere Bilder in Googles LIFE-Fotoarchiv auf.
Für die anderen Bilder gilt:
http://www.copyright.cornell.edu/public_domain/
 Tafel von 1870, gemeinfrei!
Tafel von 1870, gemeinfrei!KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2008, 15:09 - Rubrik: Fotoueberlieferung
http://www.bitkom.org/files/documents/Web_2.0_fuer_die_oeffentliche_verwaltung.pdf
Via
http://fabilouslibrarian.wordpress.com/2008/11/19/web-20-fur-die-offentliche-verwaltung-leitfaden-von-bitkom/
Via
http://fabilouslibrarian.wordpress.com/2008/11/19/web-20-fur-die-offentliche-verwaltung-leitfaden-von-bitkom/
KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2008, 14:37 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
The Royal Society Digital Archive is easily the most
comprehensive journal archive in science and contains some of the
most significant scientific papers ever published. Covering
almost 350 years of scientific research across the disciplines it
is a priceless academic resource. The Royal Society Digital
Journal Archive, dating back to 1665 and containing approximately
52,000 articles, is available online and is FREE for a three
month period.
http://journals.royalsociety.org/home/main.mpx
comprehensive journal archive in science and contains some of the
most significant scientific papers ever published. Covering
almost 350 years of scientific research across the disciplines it
is a priceless academic resource. The Royal Society Digital
Journal Archive, dating back to 1665 and containing approximately
52,000 articles, is available online and is FREE for a three
month period.
http://journals.royalsociety.org/home/main.mpx
KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2008, 01:26 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
200 Fragen an das Kantonsarchiv Basel-Land:
http://www.baselland.ch/main_fragen-htm.274575.0.html
(URL hatte sich gegenüber http://archiv.twoday.net/stories/407962/ geändert)

http://www.baselland.ch/main_fragen-htm.274575.0.html
(URL hatte sich gegenüber http://archiv.twoday.net/stories/407962/ geändert)

KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2008, 01:08
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die bei Google fehlenden Bände 10 und 11 sind vorhanden (dafür fehlen zwei andere):
http://www.archive.org/search.php?query=publisher:"Stuttgart%20In%20Commission%20bei%20F.H.%20Köhler"
Zum Thema:
http://archiv.twoday.net/stories/4904342/
http://www.archive.org/search.php?query=publisher:"Stuttgart%20In%20Commission%20bei%20F.H.%20Köhler"
Zum Thema:
http://archiv.twoday.net/stories/4904342/
KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2008, 01:01 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.archive.org/search.php?query=subject:"German%20language%20--%20Dialects%20Swabian"
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/3634748/
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/3634748/
KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2008, 00:52 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 19. November 2008, 00:49 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://medienpaedagogik.phil.uni-augsburg.de/denkarium/?p=448
Auch die zweite Auflage von Andersons Buch “Theorie and Practice of Online-Learning” gibt es wieder komplett online als E-Book! Das ist hervorragend - auch für die Lehre! Man kann das Buch als Ganzes oder die Kapitel einzeln herunterladen. In einem kurzen Interview (eigener Button “Video”) erläutert Terry Andersons die Vorteile dieser Publikationsform, die ganz klar in der sehr viel weiteren Verbreitung liegen.
Wie recht er hat: Ich habe auch den Eindruck, dass unsere online zugänglichen Arbeitsberichte viel mehr gelesen werden als andere Publikationen. Leider gelten diese Publikationen nach wie vor nichts für die wissenschaftliche Karreire. Umso wichtiger sind sämtliche Open-Bewegungen, die darauf hinarbeiten, dass auch Publikationen mit Peer-Review endlich online verfügbar sind, dass man zusammen mit Verlagen neue Strategien findet, die sowohl den Unternehmen eine Existenzberechtigung geben und Gewinne bescheren als auch der Wissenschaft und den dort Tätigen etwas bringen.
Auch die zweite Auflage von Andersons Buch “Theorie and Practice of Online-Learning” gibt es wieder komplett online als E-Book! Das ist hervorragend - auch für die Lehre! Man kann das Buch als Ganzes oder die Kapitel einzeln herunterladen. In einem kurzen Interview (eigener Button “Video”) erläutert Terry Andersons die Vorteile dieser Publikationsform, die ganz klar in der sehr viel weiteren Verbreitung liegen.
Wie recht er hat: Ich habe auch den Eindruck, dass unsere online zugänglichen Arbeitsberichte viel mehr gelesen werden als andere Publikationen. Leider gelten diese Publikationen nach wie vor nichts für die wissenschaftliche Karreire. Umso wichtiger sind sämtliche Open-Bewegungen, die darauf hinarbeiten, dass auch Publikationen mit Peer-Review endlich online verfügbar sind, dass man zusammen mit Verlagen neue Strategien findet, die sowohl den Unternehmen eine Existenzberechtigung geben und Gewinne bescheren als auch der Wissenschaft und den dort Tätigen etwas bringen.
KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2008, 21:15 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/16/AR2008111601753.html
Siehe hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=waldseem
Siehe hier:
http://archiv.twoday.net/search?q=waldseem
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://geschichtspuls.de/art1218-125-jahre-diercke-weltatlas

Leider gibt es die erste Ausgabe nicht online, obwohl sie gar nicht umfangreich wäre.

Leider gibt es die erste Ausgabe nicht online, obwohl sie gar nicht umfangreich wäre.
KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2008, 20:46 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
WLB Stuttgart verlangt ab 2009 30 Euro im Jahr Benutzergebühren
Wieso sollen Steuerzahler doppelt bezahlen?
Upsate:
http://feeds.feedburner.com/~r/netbib/DFxV/~3/490916577/
Wieso sollen Steuerzahler doppelt bezahlen?
Upsate:
http://feeds.feedburner.com/~r/netbib/DFxV/~3/490916577/
KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2008, 20:16 - Rubrik: Bibliothekswesen
"..... [Kerstin] Bartelt arbeitete nach dem Tsunami beim Verein „Missing People e.V.“ und half Menschen bei der Suche nach ihren Angehörigen oder Behördengängen. Heute betreibt sie zusammen mit ihrem Freund das „Khao Lak Forum“, in dem sie Tipps für die Region gibt und anderen Usern die Möglichkeit bietet, sich über Land und Leute auszutauschen.
Gegründet wurde das Forum von Heinrich Großkopf. Auch er sagt: „Es hat sich viel verändert.“ Der Niedersachse weiß, wovon er spricht: Er dokumentierte unter dem Namen „Radarheinrich“ den Tsunami und die Folgen mit Bildern, Augenzeugenberichten und Videos. Sein Archiv gehört zu den größten Datensammlungen zur Katastrophe weltweit. ....."
Quelle: Focus
"Dieses Archiv dient der Dokumentation des Tsunamiereignisses von 2004 und der Erhaltung wertvoller Dateien für die Nachwelt. Von den bisher aufgenommenen 7.000 Dateien sind bereits über 3.000 schon wieder aus dem Internet verschwunden. Ausser den bereits aufgenommen Dateien liegen mir noch Listen und andere Archive mit vielen weiteren Fotos vor. Ich hatte mich vorerst nur um die Fotos gekümmert, die erfahrungsgemäß sehr schnell wieder verschwinden, also die Pressefotos. Fotos, die in relativ stabilen Archiven lagern werden momentan aufgenommen.
Dieser Tsunami wurde in unserem heutigen Medienzeitalter eigentlich sehr vielseitig dokumentiert, jedoch in unzähligen verschiedenen Quellen. Die Inhalte dieser Quellen werden hier als Kopie zusammengefasst um Betroffenen, der Wissenschaft, der Bildung und jedem anderen Interessierten die Möglichkeit zur vereinfachten Recherche zu bieten, was damals am 26.12.04 überhaupt passiert ist.
Den Aufbau, die Pflege und die Wartung von diesem Tsunami Archiv betreibe ich als privates Hobby. Es steht keine Organisation dahinter. Das Datenforum, in dem ein Großteil der Bilder abgelegt ist, wurde in einer freiwilligen Tätigkeit von dem Informatiker Jens Wolf aufgebaut. Vielen Dank Jens für diese Arbeit, nur dadurch wurde eine Gestalltung dieser Seite in diesem Umfang möglich."
Quelle: http://www.radarheinrich.de/
Gegründet wurde das Forum von Heinrich Großkopf. Auch er sagt: „Es hat sich viel verändert.“ Der Niedersachse weiß, wovon er spricht: Er dokumentierte unter dem Namen „Radarheinrich“ den Tsunami und die Folgen mit Bildern, Augenzeugenberichten und Videos. Sein Archiv gehört zu den größten Datensammlungen zur Katastrophe weltweit. ....."
Quelle: Focus
"Dieses Archiv dient der Dokumentation des Tsunamiereignisses von 2004 und der Erhaltung wertvoller Dateien für die Nachwelt. Von den bisher aufgenommenen 7.000 Dateien sind bereits über 3.000 schon wieder aus dem Internet verschwunden. Ausser den bereits aufgenommen Dateien liegen mir noch Listen und andere Archive mit vielen weiteren Fotos vor. Ich hatte mich vorerst nur um die Fotos gekümmert, die erfahrungsgemäß sehr schnell wieder verschwinden, also die Pressefotos. Fotos, die in relativ stabilen Archiven lagern werden momentan aufgenommen.
Dieser Tsunami wurde in unserem heutigen Medienzeitalter eigentlich sehr vielseitig dokumentiert, jedoch in unzähligen verschiedenen Quellen. Die Inhalte dieser Quellen werden hier als Kopie zusammengefasst um Betroffenen, der Wissenschaft, der Bildung und jedem anderen Interessierten die Möglichkeit zur vereinfachten Recherche zu bieten, was damals am 26.12.04 überhaupt passiert ist.
Den Aufbau, die Pflege und die Wartung von diesem Tsunami Archiv betreibe ich als privates Hobby. Es steht keine Organisation dahinter. Das Datenforum, in dem ein Großteil der Bilder abgelegt ist, wurde in einer freiwilligen Tätigkeit von dem Informatiker Jens Wolf aufgebaut. Vielen Dank Jens für diese Arbeit, nur dadurch wurde eine Gestalltung dieser Seite in diesem Umfang möglich."
Quelle: http://www.radarheinrich.de/
Wolf Thomas - am Dienstag, 18. November 2008, 18:37 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"In Kiew wurde am Dienstag eine wissenschaftliche Veröffentlichung des Nationalen Instituts für Strategieforschung zum Holodomor in der Ukraine 1932 - 1933 auf Grund der Unterlagen aus dem politischen Archiv des deutschen Bundesaußenministeriums präsentiert. Wie Institutsdirektor, Juri Ruban, auf einer Pressekonferenz in der Nachrichtenagentur UNIAN ausführte wurden damit die Rechenschaftsberichte von deutschen Diplomaten über damalige Ereignisse in der Ukraine zum ersten Mal auf Ukrainisch veröffentlicht. Nach seinen Worten plane das Institut auch weitere Publikationen der Schriftenreihen der europäischen diplomatischen Archive zum jeweiligen Thema. Die nun präsentierten Angaben wurden von den italienischen, britischen und polnischen Archiven herausgegeben. Diese bewiese, so Ruban, dass Hungersnot dreißiger Jahre ein Genozid am ukrainischen Volk gewesen sei, und dass die europäische Diplomatie über das Ziel – Vernichtung der Ukraine als politischer Erscheinung, als freiheitsliebender Nation - gewusst habe. Die Zukunft der Ukraine wäre damit ohne Zweifel in Gefahr gebracht, resümierte, Juri Ruban, Direktor des Nationalen Instituts für Strategieforschung bei einer Präsentation in Kiew der jüngsten Forschungen zum Holodomor auf Grund der deutschen Archivunterlagen."
Quelle:
http://www.nrcu.gov.ua/index.php?id=475&listid=78858
Quelle:
http://www.nrcu.gov.ua/index.php?id=475&listid=78858
Wolf Thomas - am Dienstag, 18. November 2008, 18:35 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" ...... Elizabeth Peyton wurde mit nur zwei Fingern an der rechten Hand geboren [1965 in Danbury, Connecticut]. Ab Mitte der Achtziger studierte sie an der School for Visual Arts in New York. In einer Zeit, die die nicht gegenständliche Kunst hochhielt, interessierte sie sich für die als altmodisch geltende Porträtmalerei. Zum Broterwerb arbeitete sie im Archiv einer Fotoagentur im Archiv. Sie suchte auf Anfrage Bildmaterial heraus, so stieß sie auf die Vorlagen für ihren späteren Stil. ....
Sie malt, worauf sie Lust hat. Michelle entstand auf Bitten des Kunstmagazins „W. Art & Design“. Von Format und Stil hingegen ist Michelles Porträt eine typische Peyton. Die künftige First Lady hat ihr nicht Modell gesessen, das Gemälde entstand nach der Vorlage einer Fotografie. ....."
Quelle:
http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Die-Dritte-Seite;art705,2663644
Sie malt, worauf sie Lust hat. Michelle entstand auf Bitten des Kunstmagazins „W. Art & Design“. Von Format und Stil hingegen ist Michelles Porträt eine typische Peyton. Die künftige First Lady hat ihr nicht Modell gesessen, das Gemälde entstand nach der Vorlage einer Fotografie. ....."
Quelle:
http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Die-Dritte-Seite;art705,2663644
Wolf Thomas - am Dienstag, 18. November 2008, 18:34 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Pädagogische Hochschule Ruhr
Eröffnung der Duisburger Gebäude
im Wintersemester 1968/69
4. - 5. Dezember 2008
Universität Duisburg-Essen
Campus Duisburg
Gebäude LB - Raum 107 und
Gerhard-Mercator-Haus
Eine Veranstaltung für die
interessierte Öffentlichkeit
Abendvortrag
Donnerstag 4.12.2008
Gebäude LB - Raum 107
Grußwort
18.30 - 19.00 Uhr
Prof. Dr. Franz Bosbach
Prorektor für Studium und Lehre
Universität Duisburg-Essen
Die Lehrerausbildung im bildungspolitischen
Kontext
19.00 - 19.45 Uhr
anschließend Diskussion
Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Rita Süssmuth - Berlin
Professorin der PH Ruhr ab 1966
Bundestagspräsidentin
1988 - 1998
Empfang
20.00 - 21.00 Uhr
im Foyer
Symposiumsvorträge
Freitag 5.12.2008
Gerhard-Mercator-Haus
Begrüßung
9.30 - 9.50 Uhr
Albert Bilo
Direktor der Universitätsbibliothek Duisburg-Essen
Die Lehrerausbildung im Rheinland in der
1. Hälfte des 20. Jhs.
9.50 - 10.20 Uhr
anschließend Diskussion
Dr. Thomas Becker - Bonn
Archivleiter Universitätsarchiv Bonn
Lehrerbildung in Köln unter dem Anspruch von Wissenschaft und Ausbildung (1946-1971)
10.30 - 11.00 Uhr
anschließend Diskussion
Prof. em. Dr. Ernst Heinen - Köln
Professor der Geschichte und ihrer Didaktik
11.10 - 11.40 Uhr Kaffeepause
Außenseiter? Archivische Streiflichter zur Pädagogischen
Akademie Oberhausen (1946-1953) und zum Institut für Handarbeitskunde Köln (1947-1968)
11.40 - 12.10 Uhr
anschließend Diskussion
Dr. Andreas Freitäger - Köln
Archivar der Universität Köln
Geschichte der Pädagogischen Akademie/Hochschule in Duisburg und ihr Übergang zur Gesamthochschule Duisburg
12.20 - 12.50 Uhr
anschließend Diskussion
Prof. em. Dr. Helmut Schrey - Duisburg
Gründungsrektor der Gesamthochschule Duisburg
13.00 - 14.10 Uhr Mittagspause
Die Pädagogische Hochschule Ruhr 1972-1980 Höhepunkt und Integration
14.10 - 14.40 Uhr
anschließend Diskussion
Prof. em. Dr. Dr. Siegfried Keil - Marburg
Professor der Sozialethik, ehem. Rektor der PH Ruhr
14.50 - 15.00 Uhr Kaffeepause
Die ‚grundständige‘ Lehrerausbildung an der Gesamthochschule/Universität in Essen. Zum Verhältnis von erziehungswissenschaftlicher Grundbildung und fachlicher Qualifizierung
- angefragt -
15.00 - 15.30 Uhr
anschließend Diskussion
Prof. Dr. phil. Wilfried Breyvogel - Essen
Professor i.R. der Erziehungswissenschaft
Struktur und Perspektiven der aktuellen
Lehrerausbildung in NRW
15.40 - 16.10 Uhr
anschließend Diskussion
Prof. Stud.-Dir. Friedrich B. Müller - Duisburg-Essen
Honorarprofessor der Didaktik der Geschichte
Kontakt
Universitätsbibliothek Duisburg-Essen
Universitätsarchiv
Geibelstr. 41
47057 Duisburg
Tel.: 0203 379-4391
0201 183-2486
E-Mail: archiv@ub.uni-duisburg-essen.de
Eröffnung der Duisburger Gebäude
im Wintersemester 1968/69
4. - 5. Dezember 2008
Universität Duisburg-Essen
Campus Duisburg
Gebäude LB - Raum 107 und
Gerhard-Mercator-Haus
Eine Veranstaltung für die
interessierte Öffentlichkeit
Abendvortrag
Donnerstag 4.12.2008
Gebäude LB - Raum 107
Grußwort
18.30 - 19.00 Uhr
Prof. Dr. Franz Bosbach
Prorektor für Studium und Lehre
Universität Duisburg-Essen
Die Lehrerausbildung im bildungspolitischen
Kontext
19.00 - 19.45 Uhr
anschließend Diskussion
Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Rita Süssmuth - Berlin
Professorin der PH Ruhr ab 1966
Bundestagspräsidentin
1988 - 1998
Empfang
20.00 - 21.00 Uhr
im Foyer
Symposiumsvorträge
Freitag 5.12.2008
Gerhard-Mercator-Haus
Begrüßung
9.30 - 9.50 Uhr
Albert Bilo
Direktor der Universitätsbibliothek Duisburg-Essen
Die Lehrerausbildung im Rheinland in der
1. Hälfte des 20. Jhs.
9.50 - 10.20 Uhr
anschließend Diskussion
Dr. Thomas Becker - Bonn
Archivleiter Universitätsarchiv Bonn
Lehrerbildung in Köln unter dem Anspruch von Wissenschaft und Ausbildung (1946-1971)
10.30 - 11.00 Uhr
anschließend Diskussion
Prof. em. Dr. Ernst Heinen - Köln
Professor der Geschichte und ihrer Didaktik
11.10 - 11.40 Uhr Kaffeepause
Außenseiter? Archivische Streiflichter zur Pädagogischen
Akademie Oberhausen (1946-1953) und zum Institut für Handarbeitskunde Köln (1947-1968)
11.40 - 12.10 Uhr
anschließend Diskussion
Dr. Andreas Freitäger - Köln
Archivar der Universität Köln
Geschichte der Pädagogischen Akademie/Hochschule in Duisburg und ihr Übergang zur Gesamthochschule Duisburg
12.20 - 12.50 Uhr
anschließend Diskussion
Prof. em. Dr. Helmut Schrey - Duisburg
Gründungsrektor der Gesamthochschule Duisburg
13.00 - 14.10 Uhr Mittagspause
Die Pädagogische Hochschule Ruhr 1972-1980 Höhepunkt und Integration
14.10 - 14.40 Uhr
anschließend Diskussion
Prof. em. Dr. Dr. Siegfried Keil - Marburg
Professor der Sozialethik, ehem. Rektor der PH Ruhr
14.50 - 15.00 Uhr Kaffeepause
Die ‚grundständige‘ Lehrerausbildung an der Gesamthochschule/Universität in Essen. Zum Verhältnis von erziehungswissenschaftlicher Grundbildung und fachlicher Qualifizierung
- angefragt -
15.00 - 15.30 Uhr
anschließend Diskussion
Prof. Dr. phil. Wilfried Breyvogel - Essen
Professor i.R. der Erziehungswissenschaft
Struktur und Perspektiven der aktuellen
Lehrerausbildung in NRW
15.40 - 16.10 Uhr
anschließend Diskussion
Prof. Stud.-Dir. Friedrich B. Müller - Duisburg-Essen
Honorarprofessor der Didaktik der Geschichte
Kontakt
Universitätsbibliothek Duisburg-Essen
Universitätsarchiv
Geibelstr. 41
47057 Duisburg
Tel.: 0203 379-4391
0201 183-2486
E-Mail: archiv@ub.uni-duisburg-essen.de
KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2008, 02:31 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://video.google.nl/videoplay?docid=-2245387161960017497
http://www.flickr.com/photos/nationalmaritimemuseum/
http://www.flickr.com/photos/nationalmaritimemuseum/
KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2008, 00:42 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2008, 00:23 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2008, 00:06 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Kündigungen bei Thurn und Taxis in Regensburg
http://archiv.twoday.net/stories/102285/
Update dazu:
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/bestaende/hofbibliothek/kontakt.htm

http://archiv.twoday.net/stories/102285/
Update dazu:
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/bestaende/hofbibliothek/kontakt.htm

KlausGraf - am Dienstag, 18. November 2008, 00:02 - Rubrik: Herrschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.canada.com/ottawacitizen/news/bustech/story.html?id=e1a69f5b-3452-41dd-89a3-beea1d8a8ccd
Google expected to take over Ottawa data firm
Bert Hill, The Ottawa Citizen
Published: Friday, November 14, 2008
Google, the Internet search giant, is expected to announce today that
it has bought a vast Canadian digital database of newspaper microfilms
and other historical records from an Ottawa company.
Bob Huggins, chief executive officer of PaperOfRecord.com (POR), said
yesterday that the deal means that thousands of genealogists,
researchers and history buffs can now access information previously
locked in the dusty microfilm records of newspapers and libraries.
"We have build a vast compendium of 20 million images of newspaper
pages recording everyday life over 500 years. Much of this information
previously was not available to ordinary people." [...]
Google expected to take over Ottawa data firm
Bert Hill, The Ottawa Citizen
Published: Friday, November 14, 2008
Google, the Internet search giant, is expected to announce today that
it has bought a vast Canadian digital database of newspaper microfilms
and other historical records from an Ottawa company.
Bob Huggins, chief executive officer of PaperOfRecord.com (POR), said
yesterday that the deal means that thousands of genealogists,
researchers and history buffs can now access information previously
locked in the dusty microfilm records of newspapers and libraries.
"We have build a vast compendium of 20 million images of newspaper
pages recording everyday life over 500 years. Much of this information
previously was not available to ordinary people." [...]
KlausGraf - am Montag, 17. November 2008, 23:45 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
D-Lib Magazine November/December 2008
Volume 14 Number 11/12
http://www.dlib.org/dlib/november08/zuber/11zuber.html
A Study of Institutional Repository Holdings by Academic Discipline
By Peter A. Zuber
"The results from this research help to illustrate both an overall acceptance rate of institutional repositories as well as collection patterns in institutional repository content based on contributions from various academic disciplines.
H1. Institutional repositories do not yet demonstrate broad, discipline diverse contributions.
The assessment of collection diversity and coverage revealed only one institution whose content exceeded a fifty percent coverage rate. On average, of the institutions surveyed, only nineteen percent of the forty-seven disciplines were represented with at least one holding. Given that the disciplines included were only those encountered during the survey, the percentage would tend to drop even more if all known disciplines were included. The hypothesis is supported.
H2. Academic disciplines having prior history in pre-print and e-print practices contribute the greatest percentage of content.
Engineering contributed the majority of content of any discipline with thirty-six percent. Combining Physical and Social Sciences created a thirteen percent contribution; nearly twenty-three percentage points lower than Engineering. The combined disciplines ranked third nationally, two percentage points below Business, with fifteen percent. The hypothesis is not supported.
H3. The majority of institutional repositories do not provide incentives for publication, such as highlighting recent additions.
In total, eighteen institutions sponsored repositories, and fourteen, or seventy-eight percent of those provided incentives either as "Paper of the Day," "Most recent," or "Most popular." The location of incentive(s) varied depending on the site, with all BePress installations having the incentive(s) on the main page, and most DSpace installations having a single incentive on sub-pages. The hypothesis is not supported."
Volume 14 Number 11/12
http://www.dlib.org/dlib/november08/zuber/11zuber.html
A Study of Institutional Repository Holdings by Academic Discipline
By Peter A. Zuber
"The results from this research help to illustrate both an overall acceptance rate of institutional repositories as well as collection patterns in institutional repository content based on contributions from various academic disciplines.
H1. Institutional repositories do not yet demonstrate broad, discipline diverse contributions.
The assessment of collection diversity and coverage revealed only one institution whose content exceeded a fifty percent coverage rate. On average, of the institutions surveyed, only nineteen percent of the forty-seven disciplines were represented with at least one holding. Given that the disciplines included were only those encountered during the survey, the percentage would tend to drop even more if all known disciplines were included. The hypothesis is supported.
H2. Academic disciplines having prior history in pre-print and e-print practices contribute the greatest percentage of content.
Engineering contributed the majority of content of any discipline with thirty-six percent. Combining Physical and Social Sciences created a thirteen percent contribution; nearly twenty-three percentage points lower than Engineering. The combined disciplines ranked third nationally, two percentage points below Business, with fifteen percent. The hypothesis is not supported.
H3. The majority of institutional repositories do not provide incentives for publication, such as highlighting recent additions.
In total, eighteen institutions sponsored repositories, and fourteen, or seventy-eight percent of those provided incentives either as "Paper of the Day," "Most recent," or "Most popular." The location of incentive(s) varied depending on the site, with all BePress installations having the incentive(s) on the main page, and most DSpace installations having a single incentive on sub-pages. The hypothesis is not supported."
KlausGraf - am Montag, 17. November 2008, 22:23 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.earlham.edu/~peters/fos/2008/11/protesting-us-bishops-decision-to.html
Zum Thema des Schutzes liturgischer Texte:
http://archiv.twoday.net/stories/5109580/
Zum Thema des Schutzes liturgischer Texte:
http://archiv.twoday.net/stories/5109580/
KlausGraf - am Montag, 17. November 2008, 22:06 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Update zu: http://archiv.twoday.net/stories/5315857/
"We are sending this mail to inform you that the scan of the book "Allgemeines Künstler-Lexicon.", that you have sponsored, has been completed. The scanned copy is available at the following URL.
http://openlibrary.org/b/OL13445246M
Thanks for sponsoring the scan!"
Eine Freundin hat ebenfalls eine Notiz erhalten.
"We are sending this mail to inform you that the scan of the book "Allgemeines Künstler-Lexicon.", that you have sponsored, has been completed. The scanned copy is available at the following URL.
http://openlibrary.org/b/OL13445246M
Thanks for sponsoring the scan!"
Eine Freundin hat ebenfalls eine Notiz erhalten.
KlausGraf - am Montag, 17. November 2008, 21:18 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
„Wer so was noch mal sehen will, muss aber ins Archiv schauen“
Peter Neururer, Trainer MSV Duisburg, zur allgemeinen Belustigung pflegte Neururer damals nach Erfolgen (VfL Bochum) stets mit eigenartigen Verrenkungen auf dem Rasen zu tanzen.
Quelle: Welt (Link)
Peter Neururer, Trainer MSV Duisburg, zur allgemeinen Belustigung pflegte Neururer damals nach Erfolgen (VfL Bochum) stets mit eigenartigen Verrenkungen auf dem Rasen zu tanzen.
Quelle: Welt (Link)
Wolf Thomas - am Montag, 17. November 2008, 21:02 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Somnus" für das Medizintechnikunternehmen des Jahres 2008: Lattoflex:
" .... Bereits seit 1967 existiert ein einzigartiges Archiv für Schlafphysiologie sowie eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Bremervörde, die mit zahllosen Patenten für die ständige Weiterentwicklung der Lattoflex-Bettsysteme sorgt. .....Der Somnus, benannt nach dem römischen Gott des Schlafes, wird seit 2005 vom Schlafmagazin in drei Kategorien vergeben: herausragende Mitarbeit in der Selbsthilfe, wissenschaftlich-publizistisches Engagement und innovative technische Entwicklungen. Den Somnus für technische Innovation erhalten Firmen, die mit ihren Geräten und Errungenschaften rund um den Schlaf Bedeutsames geleistet haben ...."
Quelle:
http://www.presseportal.de/pm/73598/1302959/lattoflex
" .... Bereits seit 1967 existiert ein einzigartiges Archiv für Schlafphysiologie sowie eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Bremervörde, die mit zahllosen Patenten für die ständige Weiterentwicklung der Lattoflex-Bettsysteme sorgt. .....Der Somnus, benannt nach dem römischen Gott des Schlafes, wird seit 2005 vom Schlafmagazin in drei Kategorien vergeben: herausragende Mitarbeit in der Selbsthilfe, wissenschaftlich-publizistisches Engagement und innovative technische Entwicklungen. Den Somnus für technische Innovation erhalten Firmen, die mit ihren Geräten und Errungenschaften rund um den Schlaf Bedeutsames geleistet haben ...."
Quelle:
http://www.presseportal.de/pm/73598/1302959/lattoflex
Wolf Thomas - am Montag, 17. November 2008, 21:00 - Rubrik: Wirtschaftsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Stadtarchiv Wiesbaden feiert am Freitag, 21. November, ab 19 Uhr in seinen Räumlichkeiten, Im Rad 42, sein drittes Archivfest, diesmal unter dem Motto: "Ordnung muss sein!"
Was so streng klingt, kommt an diesem Abend mit leichtem Augenzwinkern daher, denn: Von der Obrigkeit und öffentlichen Institutionen erlassene Regeln des menschlichen Zusammenlebens enthalten - aus heutiger Sicht - manch Kurioses und Amüsantes. "
Quelle:
http://www.main-rheiner.de/region/objekt.php3?artikel_id=3519030
Was so streng klingt, kommt an diesem Abend mit leichtem Augenzwinkern daher, denn: Von der Obrigkeit und öffentlichen Institutionen erlassene Regeln des menschlichen Zusammenlebens enthalten - aus heutiger Sicht - manch Kurioses und Amüsantes. "
Quelle:
http://www.main-rheiner.de/region/objekt.php3?artikel_id=3519030
Wolf Thomas - am Montag, 17. November 2008, 20:59 - Rubrik: Veranstaltungen
"Das Archiv „Metroproletan“ wurde im September 1990 gegründet, als das selbstverwaltete Kommunikationszentrum KOMM noch als Ort linker Gegenkultur existierte und noch nicht in ein Mainstream-Kulturprojekt umgewandelt worden war. Das „Metroproletan“ wollte jedoch von Anfang an mehr sein als die „KOMM-Hausbibliothek“. Neben dem Sammeln und Archivieren linker Literatur, Zeitschriften und Dokumenten wurden und werden Diskussionen, Lesungen und Ausstellungen veranstaltet ....."
Link:
http://redside.antifa.net/cms/metroproletan/
Wolf Thomas - am Montag, 17. November 2008, 20:57 - Rubrik: Archive von unten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Im SWR1-Radio lief am 30.10. eine Sendung zum Thema "Vorfahren gesucht – Abenteuer Ahnenforschung".
Dort kamen u.a. Manuel Andrack und Sascha Ziegler zu Wort. Ein Mitschnitt kann als Podcast heruntergeladen werden.
Weblinks:
http://www.swr.de/swr1/bw/programm/-/id=446250/nid=446250/did=4049676/1g0ax70/index.html
(mit Podcast)
http://www.swr.de/ratgeber/familie/ahnenforschung-im-internet/-/id=1778/nid=1778/did=3598188/1wmp8p4/index.html
Quelle:
http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2008/11#Eine_.22Gebrauchsanweisung.22.2C_die_neugierig_macht
Dort kamen u.a. Manuel Andrack und Sascha Ziegler zu Wort. Ein Mitschnitt kann als Podcast heruntergeladen werden.
Weblinks:
http://www.swr.de/swr1/bw/programm/-/id=446250/nid=446250/did=4049676/1g0ax70/index.html
(mit Podcast)
http://www.swr.de/ratgeber/familie/ahnenforschung-im-internet/-/id=1778/nid=1778/did=3598188/1wmp8p4/index.html
Quelle:
http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2008/11#Eine_.22Gebrauchsanweisung.22.2C_die_neugierig_macht
KlausGraf - am Montag, 17. November 2008, 20:18 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Ein Besuch der Website und das Ausprobieren der dort gebotenen Möglichkeiten ist sehr lohnenswert. Man kann nicht nur Karten mit der relativen bzw. absoluten Verteilung der Nachnamen auf Basis des Telefonbuchs von 1998 und des Reichstelefonbuchs von 1942 erzeugen. Es ist auch möglich, beliebige Vornamen auf Grundlage des Telefonbuchs von 1998 zu kartieren. Beides ergibt interessante Ergebnisse und sicher vielfach auch Überraschungen. Ist dieser oder jener Vorname hauptsächlich im Norden, Osten, Süden oder Westen des Landes gebräuchlich? Probieren Sie es aus! Hatten Personen aus Ihrer Familie schon 1942 einen Telefonanschluss? Sehen Sie nach, ob sich Einträge für die jeweiligen Namen finden lassen. Man findet die Website unter der Adresse http://www.gen-evolu.de/ . (bw)"
http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2008/11#Genevolu
Beispiel:
Für den Familiennamen Graf finden sich insgesamt 665 Einträge im Reichstelefonbuch von 1942. Die eingetragenen Orte mit den häufigsten Telefonanschlüssen sind:
(50%) Neu Pölla (Niederdonau)
(50%) Stampf (Niederdonau)
(33.333%) Olbendorf (Steiermark)
Nicht so komfortabel ist die Vornamenkartierung (Beispiel Hariolf):

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2008/11#Genevolu
Beispiel:
Für den Familiennamen Graf finden sich insgesamt 665 Einträge im Reichstelefonbuch von 1942. Die eingetragenen Orte mit den häufigsten Telefonanschlüssen sind:
(50%) Neu Pölla (Niederdonau)
(50%) Stampf (Niederdonau)
(33.333%) Olbendorf (Steiermark)
Nicht so komfortabel ist die Vornamenkartierung (Beispiel Hariolf):
KlausGraf - am Montag, 17. November 2008, 20:13 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ja. Das ergibt sich aus den Ausführungen von RA Tobias Strömer:
http://www.zoomer.de/news/topthema/-/-/artikel/online-recht-es-gibt-kein-vermummungsverbot-fuer-surfer-
Zu den Möglichkeiten siehe
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Google_Book_Search
http://www.zoomer.de/news/topthema/-/-/artikel/online-recht-es-gibt-kein-vermummungsverbot-fuer-surfer-
Zu den Möglichkeiten siehe
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Google_Book_Search
KlausGraf - am Montag, 17. November 2008, 17:30 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Zimmermann, Karin (Hrsg.)
Die Codices Palatini germanici in der Universitätsbibliothek Heidelberg (Cod. Pal. germ. 1 - 181)
Wiesbaden, 2003
Bibliographische Information
Sammlung
Persistente URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/zimmermann2003
URN: urn:nbn:de:bsz:16-diglit-26679
Die Codices Palatini germanici in der Universitätsbibliothek Heidelberg (Cod. Pal. germ. 1 - 181)
Wiesbaden, 2003
Bibliographische Information
Sammlung
Persistente URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/zimmermann2003
URN: urn:nbn:de:bsz:16-diglit-26679
KlausGraf - am Montag, 17. November 2008, 17:08 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
1988 - Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach ersteigert für umgerechnet 3,15 Millionen Mark im Londoner Auktionshaus Sotheby's das Originalmanuskript von Franz Kafkas Romanfragment «Der Prozess«.
Quelle: Link
Quelle: Link
Wolf Thomas - am Montag, 17. November 2008, 00:01 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.ariadne.ac.uk/issue57/waaijers-et-al/
Leo Waaijers writes about copyright, prestige and cost control in the world of open access while in two appendices Bas Savenije and Michel Wesseling compare the costs of open access publishing and subscriptions/licences for their respective institutions.
Excerpt:
Recommendation 1
Transferring the copyright in a publication has become a relic of the past; nowadays a “licence to publish” is sufficient. The author retains the copyrights. Institutions should make the use of such a licence part of their institutional policy.
Recommendation 2
The classic impact factor for a journal is not a good yardstick for the prestige of an author. Modern digital technology makes it possible to tailor the measurement system to the author. Institutions should, when assessing scientists and scholars, switch to this type of measurement and should also promote its further development.
Recommendation 3
The traditional subscription model for circulating publications is needlessly complex and expensive. Switching to Open Access, however, requires co-ordination that goes beyond the level of individual institutions. Supra-institutional organisations, for example the European University Association, should take the necessary initiative.
Leo Waaijers writes about copyright, prestige and cost control in the world of open access while in two appendices Bas Savenije and Michel Wesseling compare the costs of open access publishing and subscriptions/licences for their respective institutions.
Excerpt:
Recommendation 1
Transferring the copyright in a publication has become a relic of the past; nowadays a “licence to publish” is sufficient. The author retains the copyrights. Institutions should make the use of such a licence part of their institutional policy.
Recommendation 2
The classic impact factor for a journal is not a good yardstick for the prestige of an author. Modern digital technology makes it possible to tailor the measurement system to the author. Institutions should, when assessing scientists and scholars, switch to this type of measurement and should also promote its further development.
Recommendation 3
The traditional subscription model for circulating publications is needlessly complex and expensive. Switching to Open Access, however, requires co-ordination that goes beyond the level of individual institutions. Supra-institutional organisations, for example the European University Association, should take the necessary initiative.
KlausGraf - am Sonntag, 16. November 2008, 18:16 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 16. November 2008, 18:06 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.gvsu.edu/library/digitalcollections/index.cfm?id=E1FAD505-FED9-CD9A-EF5D016E44CA1857
Fast nur Einzelblätter, aber wenn ich recht sehe auch zwei komplette Drucke digitalisiert, was der mitlesende GW-Spezialist sicher bestätigen oder widerlegen kann ...

Fast nur Einzelblätter, aber wenn ich recht sehe auch zwei komplette Drucke digitalisiert, was der mitlesende GW-Spezialist sicher bestätigen oder widerlegen kann ...

KlausGraf - am Sonntag, 16. November 2008, 06:14 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Johan Hanselaer fragte in Exlibris nach Ergänzungen zu seiner Liste von OPACs und Bibliographien mit digitalisierten Titelseiten
STCV = catalogues of books printed in Flanders (17th-18th century):
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/databank/stcv
VD-17: Bibliography of German Imprints of the 17th Century:
http://www.vd17.de/ (Schlüsselseiten)
Catalogue of the Radboud University Nijmegen:
http://cat.ubn.kun.nl/DB=1/SET=6/TTL=4/LNG=EN/
Ergänzungen:
Das frühe deutsche Buchtitelblatt
http://inkunabeln.ub.uni-koeln.de/titelblatt/
Juristische Dissertationen des 16.-18. Jahrhunderts
http://dlib-diss.mpier.mpg.de/
U Murcia
http://gargoris.cpd.um.es/cgi-bin/abweb/X6103/ID9282/G0
Luther-Katalog
http://dbs.hab.de/luther/
Griechischer Geist aus Basler Pressen
http://www.ub.unibas.ch/kadmos/gg/
Opera poetica Basiliensia
http://www.ub.unibas.ch/spez/poeba/
UB Osnabrück, Ius Commune Bibliothek
http://osopc4.ub.uni-osnabrueck.de:8080/DB=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sst%2Bj-ic
U of Oklahoma, History of Science Collection
http://digital.libraries.ou.edu/histsci/
Pitts Theology Library
http://www.pitts.emory.edu/dia/woodcuts.htm
Projekt Historischer Roman
http://www.uibk.ac.at/germanistik/histrom/
The Books of Isaac Norris at Dickinson College
http://deila.dickinson.edu/norris/
Stadtbibliothek Empoli (Italien), Drucke des 16. Jahrhunderts
http://www.comune.empoli.fi.it/biblioteca/avvio.htm
Ungarische retrospektive Bibliographie
http://mnb.oszk.hu/
Uni Lecce und Bibliotheken der Terra d'Otranto
http://siba3.unile.it/archives/asearch.html
Slowakei, Projekt Staré tlače (1477-1830)
https://www.kis3g.sk/
Sehr umfangreich, aber so gut wie unbekannt!
UB Lund, Döbelius-Bücher
http://libris.kb.se/hitlist?q=www6.ub.lu.se
UB Kyushu, Rechtsgeschichte
http://www.lib.kyushu-u.ac.jp/hp_db_f/deutsch/index.htm
UB Salamanca
http://brumario.usal.es/search*spi~S3/
Sehr umfangreich
Biblia Sacra (NL, BE)
http://www.bibliasacra.nl/
UB Breslau (Wroclaw)
http://www.bu.uni.wroc.pl/katalogi/kartkowy/wkkosd1.html
Digitalisierter Kartenkatalog mit Titelblattscans
IRCJS Kyoto
http://shinku.nichibun.ac.jp/gpub/top_e.html
Bücher vor 1900 über Japan
Dickinson College, Isaac Norris Collection
http://deila.dickinson.edu/norris/index.html
Update 2010:
Limoges, Grand Seminaire
http://scd.unilim.fr/public-inventaire/afficher.php
Update 2011:
DHI Paris
http://vzlbs2.gbv.de/DB=44/LNG=DU/
z.B.
http://vzlbs2.gbv.de/DB=44/XMLPRS=N/PPN?PPN=142510262
STCV = catalogues of books printed in Flanders (17th-18th century):
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/databank/stcv
VD-17: Bibliography of German Imprints of the 17th Century:
http://www.vd17.de/ (Schlüsselseiten)
Catalogue of the Radboud University Nijmegen:
http://cat.ubn.kun.nl/DB=1/SET=6/TTL=4/LNG=EN/
Ergänzungen:
Das frühe deutsche Buchtitelblatt
http://inkunabeln.ub.uni-koeln.de/titelblatt/
Juristische Dissertationen des 16.-18. Jahrhunderts
http://dlib-diss.mpier.mpg.de/
U Murcia
http://gargoris.cpd.um.es/cgi-bin/abweb/X6103/ID9282/G0
Luther-Katalog
http://dbs.hab.de/luther/
Griechischer Geist aus Basler Pressen
http://www.ub.unibas.ch/kadmos/gg/
Opera poetica Basiliensia
http://www.ub.unibas.ch/spez/poeba/
UB Osnabrück, Ius Commune Bibliothek
http://osopc4.ub.uni-osnabrueck.de:8080/DB=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sst%2Bj-ic
U of Oklahoma, History of Science Collection
http://digital.libraries.ou.edu/histsci/
Pitts Theology Library
http://www.pitts.emory.edu/dia/woodcuts.htm
Projekt Historischer Roman
http://www.uibk.ac.at/germanistik/histrom/
The Books of Isaac Norris at Dickinson College
http://deila.dickinson.edu/norris/
Stadtbibliothek Empoli (Italien), Drucke des 16. Jahrhunderts
http://www.comune.empoli.fi.it/biblioteca/avvio.htm
Ungarische retrospektive Bibliographie
http://mnb.oszk.hu/
Uni Lecce und Bibliotheken der Terra d'Otranto
http://siba3.unile.it/archives/asearch.html
Slowakei, Projekt Staré tlače (1477-1830)
https://www.kis3g.sk/
Sehr umfangreich, aber so gut wie unbekannt!
UB Lund, Döbelius-Bücher
http://libris.kb.se/hitlist?q=www6.ub.lu.se
UB Kyushu, Rechtsgeschichte
http://www.lib.kyushu-u.ac.jp/hp_db_f/deutsch/index.htm
UB Salamanca
http://brumario.usal.es/search*spi~S3/
Sehr umfangreich
Biblia Sacra (NL, BE)
http://www.bibliasacra.nl/
UB Breslau (Wroclaw)
http://www.bu.uni.wroc.pl/katalogi/kartkowy/wkkosd1.html
Digitalisierter Kartenkatalog mit Titelblattscans
IRCJS Kyoto
http://shinku.nichibun.ac.jp/gpub/top_e.html
Bücher vor 1900 über Japan
Dickinson College, Isaac Norris Collection
http://deila.dickinson.edu/norris/index.html
Update 2010:
Limoges, Grand Seminaire
http://scd.unilim.fr/public-inventaire/afficher.php
Update 2011:
DHI Paris
http://vzlbs2.gbv.de/DB=44/LNG=DU/
z.B.
http://vzlbs2.gbv.de/DB=44/XMLPRS=N/PPN?PPN=142510262
KlausGraf - am Sonntag, 16. November 2008, 04:40 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.heise.de/newsticker/Bundestagsabgeordneter-laesst-wikipedia-de-sperren-Update--/meldung/118930
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_Diskussion:Kurier#Einstweilige_Verf.C3.BCgung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Café#Lutz_Heilmann
https://secure.wikimedia.de/spenden/list.php
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,590643,00.html
http://www.mark.linkeblogs.de/2008/11/15/wie-peinlich-lutz-heilmann-mdb-im-kreuzzug-gegen-wikipedia/
Leseempfehlung:
http://netzwertig.com/2008/11/15/heilmann-vs-wikipedia-das-land-braucht-eine-neue-medienkompetenz/
Die Zensoren wirken, rtc und Admin Felistoria und weitere Admins, die es alle in Ordnung finden, dass 14 Tage die falsche Version gesperrt bleibt ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Lutz_Heilmann#www.wikipedia.de
Zutreffend dagegen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lutz_Heilmann
Dass man so tun kann, als gäbe es den heutigen Mediensturm nicht, ist einfach nur ridikül.
Update:
http://www.lawblog.de/index.php/archives/2008/11/15/verlangerter-wehrdienst-bei-der-stasi/#comment-362950
http://it-recht-blog.de/wikipedia-de-einstweilige-verfuegung-heilmanns-gegen-wikimedia
http://www.telemedicus.info/article/1043-Heilmann-gegen-Wikimedia-Die-wichtigsten-Fakten.html
Fundierte juristische Wertung
http://www.ln-online.de/news/pdf/1751026
http://piratenblog.wordpress.com/2008/11/15/lutz-heilmann-wikipedia/
Kritik an Wikipedia
http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/das-wikipedia-syndrom/
Heilmann zieht zurück:
http://linksfraktion.de/pressemitteilung.php?artikel=1246470002
http://www.heise.de/newsticker/Wikipedia-Sperre-Bundestagsabgeordneter-Heilmann-kapituliert--/meldung/118952
Und gibt sich reuig
http://www.taz.de/1/leben/internet/artikel/1/schuld-und-suehne-1/
http://www.netzeitung.de/internet/internet/1215377.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_Diskussion:Kurier#Einstweilige_Verf.C3.BCgung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Café#Lutz_Heilmann
https://secure.wikimedia.de/spenden/list.php
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,590643,00.html
http://www.mark.linkeblogs.de/2008/11/15/wie-peinlich-lutz-heilmann-mdb-im-kreuzzug-gegen-wikipedia/
Leseempfehlung:
http://netzwertig.com/2008/11/15/heilmann-vs-wikipedia-das-land-braucht-eine-neue-medienkompetenz/
Die Zensoren wirken, rtc und Admin Felistoria und weitere Admins, die es alle in Ordnung finden, dass 14 Tage die falsche Version gesperrt bleibt ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Lutz_Heilmann#www.wikipedia.de
Zutreffend dagegen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lutz_Heilmann
Dass man so tun kann, als gäbe es den heutigen Mediensturm nicht, ist einfach nur ridikül.
Update:
http://www.lawblog.de/index.php/archives/2008/11/15/verlangerter-wehrdienst-bei-der-stasi/#comment-362950
http://it-recht-blog.de/wikipedia-de-einstweilige-verfuegung-heilmanns-gegen-wikimedia
http://www.telemedicus.info/article/1043-Heilmann-gegen-Wikimedia-Die-wichtigsten-Fakten.html
Fundierte juristische Wertung
http://www.ln-online.de/news/pdf/1751026
http://piratenblog.wordpress.com/2008/11/15/lutz-heilmann-wikipedia/
Kritik an Wikipedia
http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/das-wikipedia-syndrom/
Heilmann zieht zurück:
http://linksfraktion.de/pressemitteilung.php?artikel=1246470002
http://www.heise.de/newsticker/Wikipedia-Sperre-Bundestagsabgeordneter-Heilmann-kapituliert--/meldung/118952
Und gibt sich reuig
http://www.taz.de/1/leben/internet/artikel/1/schuld-und-suehne-1/
http://www.netzeitung.de/internet/internet/1215377.html
http://archiv.twoday.net/polls/7273/main
Bitte beteiligen! (Ist leider nur mit Registrierung möglich)
Zum Hintergrund:
http://archiv.twoday.net/stories/5323877/comments/5324066/

Bitte beteiligen! (Ist leider nur mit Registrierung möglich)
Zum Hintergrund:
http://archiv.twoday.net/stories/5323877/comments/5324066/

KlausGraf - am Samstag, 15. November 2008, 19:32 - Rubrik: Allgemeines
Mit welcher Berechtigung zockt das kostenpflichtige schottische SCRAN-Projekt, das Europeana zumüllt, seine Benutzer ab, wenn es z.B. um simple Titeblätter geht, die man nicht selten anderweitig kostenlos im Netz findet, z.B.
Here is a link to a Europeana cultural treasure:
http://www.europeana.eu/resolve/record/00401/8B975582E6A841CC7C512147CB2800F2BE9749FD
http://www.folger.edu/template.cfm?cid=1770
Leicht auffindbar über Google Bildsuche

Das Suchwort Orchand findet bei Europeana nichts, was am fehlerhaften Import der Metadaten liegt:
In der Tumbnail-Übersicht steht
Title page from 'A New Or...
1638
während auf der oben verlinkten Seite die Signatur als Titel gewählt wird.
Here is a link to a Europeana cultural treasure:
http://www.europeana.eu/resolve/record/00401/8B975582E6A841CC7C512147CB2800F2BE9749FD
http://www.folger.edu/template.cfm?cid=1770
Leicht auffindbar über Google Bildsuche

Das Suchwort Orchand findet bei Europeana nichts, was am fehlerhaften Import der Metadaten liegt:
In der Tumbnail-Übersicht steht
Title page from 'A New Or...
1638
während auf der oben verlinkten Seite die Signatur als Titel gewählt wird.
KlausGraf - am Samstag, 15. November 2008, 19:25 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Damit Archivalia lebendiger wird, gebe ich bis auf weiteres die Kommentarfunktion für alle frei. Es ist also nicht mehr erforderlich, sich auf twoday (kostenlos) zu registrieren, um einen Kommentar abzugeben.
Die Kommentarfunktion habe ich vor längerer Zeit einschränken müssen, nachdem ein Spammer dutzende Beiträge mit Kommentaren versehen hatte. Inzwischen hat Twoday standardmäßig eine Spam-Sicherung durch Captcha, also ein leicht verzerrtes Wort, das eingegeben werden muss, was ja keine wirkliche Hürde darstellt. Ich werde die Freigabe zurücknehmen, falls in größerem Maße Mißbrauch mit der Kommentarfunktion getrieben wird.
In bestimmten Fällen (v.a. bei Einträgen über die Wikipedia) ermögliche ich keine Kommentare, da ich einer bestimmten demokratiefeindlichen und die Meinungsfreiheit einschränkenden Klientel kein Forum verschaffen möchte. Kommentare zu löschen, die sich auf solche Beiträge beziehen, aber bei kommentierbaren Beiträgen eingebracht werden, behalte ich mir vor. Ansonsten gelten die zuletzt unter
http://archiv.twoday.net/stories/5323877/ (Kommentar)
dargestellten Grundsätze.
Ich würde mich freuen, wenn meine Ausführungen zu den "Archivierenden" zu dem eben genannten Beitrag kommentiert werden würden.
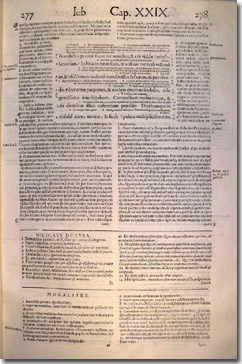
Die Kommentarfunktion habe ich vor längerer Zeit einschränken müssen, nachdem ein Spammer dutzende Beiträge mit Kommentaren versehen hatte. Inzwischen hat Twoday standardmäßig eine Spam-Sicherung durch Captcha, also ein leicht verzerrtes Wort, das eingegeben werden muss, was ja keine wirkliche Hürde darstellt. Ich werde die Freigabe zurücknehmen, falls in größerem Maße Mißbrauch mit der Kommentarfunktion getrieben wird.
In bestimmten Fällen (v.a. bei Einträgen über die Wikipedia) ermögliche ich keine Kommentare, da ich einer bestimmten demokratiefeindlichen und die Meinungsfreiheit einschränkenden Klientel kein Forum verschaffen möchte. Kommentare zu löschen, die sich auf solche Beiträge beziehen, aber bei kommentierbaren Beiträgen eingebracht werden, behalte ich mir vor. Ansonsten gelten die zuletzt unter
http://archiv.twoday.net/stories/5323877/ (Kommentar)
dargestellten Grundsätze.
Ich würde mich freuen, wenn meine Ausführungen zu den "Archivierenden" zu dem eben genannten Beitrag kommentiert werden würden.
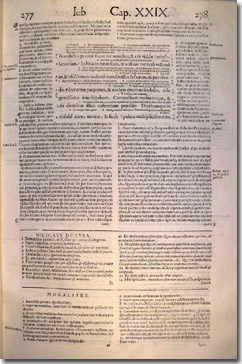
KlausGraf - am Samstag, 15. November 2008, 18:01 - Rubrik: Allgemeines
"Archivare vertragen kein Tageslicht"
Link zum gleichlautenden Pressebericht in der Badischen Zeitung
Wolf Thomas - am Samstag, 15. November 2008, 16:59 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolfgang Görl stellt in der SZ (Link) den neuen Leiter des Münchener Stadtarchivs vor: Michael Stephan.
Wolf Thomas - am Samstag, 15. November 2008, 16:57 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"SZ: Gibt es schon Pläne für Ihren Ruhestand?
Bauer: Zunächst werde ich mir einen längeren Urlaub genehmigen. Dann aber werde ich der Stadtgeschichte wie bisher durch Publikationen und Vorträge zuarbeiten. ...."Hoffentlich stehen ihm dann alle Bestände zur Verfügung - so als einfacher Nützer ....
Quelle: Link zum SZ-Artikel
Bauer: Zunächst werde ich mir einen längeren Urlaub genehmigen. Dann aber werde ich der Stadtgeschichte wie bisher durch Publikationen und Vorträge zuarbeiten. ...."Hoffentlich stehen ihm dann alle Bestände zur Verfügung - so als einfacher Nützer ....
Quelle: Link zum SZ-Artikel
Wolf Thomas - am Samstag, 15. November 2008, 16:55 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Ausgehtipp für das Isar-Metropölchen: http://www.dieregistratur.de/
Wolf Thomas - am Samstag, 15. November 2008, 16:52 - Rubrik: Unterhaltung
Archivar Ludwig Bauer studiert ein 450 Jahre altes Bürgerbuch der Stadt Hemau.
Wolf Thomas - am Samstag, 15. November 2008, 16:50 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Samstag, 15. November 2008, 16:38 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Macht das MDZ jetzt regelmäßig womöglich am Wochenende seine Sammlungen dicht? Schon zum zweiten Mal werden Anfragen abgewiesen: "You don't have permission to access /~mdz on this server."
Daher kann ich jetzt den genauen Wortlaut der Beschriftung der selten dämlichen Suchfunktion nicht wiedergeben, die keine Freitextsuche ermöglicht mit der Konsequenz, dass bei der Eingabe des Autorennamens nider kein einziges Werk gefunden wird. Benutzer suchen heute nun einmal nach dem Muster von Google und alle vernünftigen Bibliothekskataloge stellen sich darauf ein. Im OPACplus der BSB findet man 18 Treffer zu Nider mit dem Online-Filter, darunter auch Werke, in denen nider im Titel erscheint. Aber auch diese werden nicht gefunden, wenn ich mich recht entsinne.
Daher kann ich jetzt den genauen Wortlaut der Beschriftung der selten dämlichen Suchfunktion nicht wiedergeben, die keine Freitextsuche ermöglicht mit der Konsequenz, dass bei der Eingabe des Autorennamens nider kein einziges Werk gefunden wird. Benutzer suchen heute nun einmal nach dem Muster von Google und alle vernünftigen Bibliothekskataloge stellen sich darauf ein. Im OPACplus der BSB findet man 18 Treffer zu Nider mit dem Online-Filter, darunter auch Werke, in denen nider im Titel erscheint. Aber auch diese werden nicht gefunden, wenn ich mich recht entsinne.
KlausGraf - am Samstag, 15. November 2008, 16:00 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
„Wer wissen möchte, welche Medikamente mit welcher Wirkung bei bestimmten Krankheitsbildern eingesetzt wurden, kann entweder innerhalb von drei Minuten das System befragen oder einen Doktoranden drei Monate in ein staubiges Archiv schicken“
Dr. Marcus Creutzenberg, Intensiv-Mediziner im Universitätsklinikum Regensburg, stellte das Patientendaten-Managementsystem (PDMS) seiner interdisziplinären operativen Intensiv-Station vor.
Quelle: (Link)
Dr. Marcus Creutzenberg, Intensiv-Mediziner im Universitätsklinikum Regensburg, stellte das Patientendaten-Managementsystem (PDMS) seiner interdisziplinären operativen Intensiv-Station vor.
Quelle: (Link)
Wolf Thomas - am Samstag, 15. November 2008, 15:09 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Focus (Link) berichtet: "Im Londoner Hulton Archive lagern 65 Millionen Pressefotos. Sie zeigen Kriege und Krisen sowie zahlreiche Alltagsszenen mit nicht alltäglichen Geschichten. ....
Die Geschichte des Hulton-Archivs beginnt mit dem britischen Nachrichtenmagazin „Picture Post“, das der Verleger Sir Edward G. Hulton zusammen mit dem deutsch-ungarischen Auswanderer und Zeitschriftenpionier Stefan Lorant 1938 gründete. Mit Lorant kamen auch die Fotojournalisten Felix Man und Kurt Hutton nach London, damals noch unter den Namen Hans Baumann und Kurt Hübschmann. Das Magazin entwickelte sich zum wichtigsten News-Lieferanten der Kriegsjahre. ....
Nachdem die „Picture Post“ eingestellt wurde, verkaufte Hulton 1957 seine Kollektion an die BBC. Seit 1996 gehört das riesige Archiv mit den raren, zum Teil mehr als 150 Jahre alten Fotografien und Bildern der Bildagentur Getty....."
Die Geschichte des Hulton-Archivs beginnt mit dem britischen Nachrichtenmagazin „Picture Post“, das der Verleger Sir Edward G. Hulton zusammen mit dem deutsch-ungarischen Auswanderer und Zeitschriftenpionier Stefan Lorant 1938 gründete. Mit Lorant kamen auch die Fotojournalisten Felix Man und Kurt Hutton nach London, damals noch unter den Namen Hans Baumann und Kurt Hübschmann. Das Magazin entwickelte sich zum wichtigsten News-Lieferanten der Kriegsjahre. ....
Nachdem die „Picture Post“ eingestellt wurde, verkaufte Hulton 1957 seine Kollektion an die BBC. Seit 1996 gehört das riesige Archiv mit den raren, zum Teil mehr als 150 Jahre alten Fotografien und Bildern der Bildagentur Getty....."
Wolf Thomas - am Samstag, 15. November 2008, 15:01 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.rechthaber.com/das-historische-urteil-21-der-postbote-im-rosenstrauch/
Aus der Serie einer meiner Lieblingsfälle:
Fällt der Beifahrer während der Fahrt aus dem Fenster, so haftet auch der Fahrer für 50% der Verletzungsfolgen. Zu den Pflichten eines Autofahrers gehört es nämlich, sein Fahrzeug sofort abzubremsen, wenn sich der Beifahrer so weit aus dem Fenster lehnt, dass er hinaus zu stürzen droht (Oberlandesgericht Karlsruhe, 10 U 24/98).
Aus der Serie einer meiner Lieblingsfälle:
Fällt der Beifahrer während der Fahrt aus dem Fenster, so haftet auch der Fahrer für 50% der Verletzungsfolgen. Zu den Pflichten eines Autofahrers gehört es nämlich, sein Fahrzeug sofort abzubremsen, wenn sich der Beifahrer so weit aus dem Fenster lehnt, dass er hinaus zu stürzen droht (Oberlandesgericht Karlsruhe, 10 U 24/98).
KlausGraf - am Samstag, 15. November 2008, 04:06 - Rubrik: Unterhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://static.twoday.net/jhagmann/files/Artikel-AuW-0811.pdf
Jürg Hagmann mächte deutlich machen, dass es beim RM nicht nur um prospektive Langzeitarchivierung geht.
http://jhagmann.twoday.net/stories/5322246/
Jürg Hagmann mächte deutlich machen, dass es beim RM nicht nur um prospektive Langzeitarchivierung geht.
http://jhagmann.twoday.net/stories/5322246/
KlausGraf - am Samstag, 15. November 2008, 03:49 - Rubrik: Records Management
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.injoest.ac.at/projekte/laufend/mittelalterliche_judenurkunden/
Diese sind online, was nicht nur
http://arcana.twoday.net/stories/5322495/
fein findet.
Der erste Band der Regesten zur Geschichte der Juden in Österreich im Mittelalter, 2005 in Buchform erschienen[Eveline Brugger, Birgit Wiedl, Regesten zur Geschichte der Juden im Mittelalter. Band 1: Von den Anfängen bis 1338. Hg. vom Institut für Geschichte der Juden in Österreich. StudienVerlag, Innsbruck-Wien-Bozen 2005], ist nun auf der Website des Instituts als PDF File zugänglich.

Diese sind online, was nicht nur
http://arcana.twoday.net/stories/5322495/
fein findet.
Der erste Band der Regesten zur Geschichte der Juden in Österreich im Mittelalter, 2005 in Buchform erschienen[Eveline Brugger, Birgit Wiedl, Regesten zur Geschichte der Juden im Mittelalter. Band 1: Von den Anfängen bis 1338. Hg. vom Institut für Geschichte der Juden in Österreich. StudienVerlag, Innsbruck-Wien-Bozen 2005], ist nun auf der Website des Instituts als PDF File zugänglich.

KlausGraf - am Samstag, 15. November 2008, 03:44
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Man braucht nur einmal goethe einmal bei der unsäglichen Europeana und bei http://www.songza.com einzugeben, um zu begreifen, dass der Zug für solche anmaßenden Projekte wie Europeana abgefahren ist. Was auf Europeana an kurzen Ton- und Videoschnipseln zu Goethe vorhanden ist, ist lächerlich. Via Songzaa aber hat man Zugriff z.B. auf zwei Erlkönig-Videos, eine gute Konzertaufnahme und ein witziges Schulprojekt, oder den Eingangsmonolog des Faust.
Und im Original selbst ist noch eine ganze Menge mehr zum Erlkönig vorhanden:
http://www.youtube.com/results?search_query=erlkönig&search_type=&aq=f
Glaubt irgendjemand ernsthaft, jemand würde Europeana statt YouTube konsultieren oder auch nur ergänzend? Die Qualität von YouTube übertrifft die kargen Europeana-Inhalte bei weitem.
Und im Original selbst ist noch eine ganze Menge mehr zum Erlkönig vorhanden:
http://www.youtube.com/results?search_query=erlkönig&search_type=&aq=f
Glaubt irgendjemand ernsthaft, jemand würde Europeana statt YouTube konsultieren oder auch nur ergänzend? Die Qualität von YouTube übertrifft die kargen Europeana-Inhalte bei weitem.
KlausGraf - am Samstag, 15. November 2008, 02:46 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen