23.09.2010-24.09.2010, Universität Würzburg, Philosophicum, Am Hubland, Übungsraum 11
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=14408
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=14408
KlausGraf - am Freitag, 6. August 2010, 23:20 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Freitag, 6. August 2010, 22:22 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" Jetzt geht's endlich los: Die ersten Projekte des Masterplans werden nun umgesetzt. Nachdem im Frühjahr Kritik am langatmigen Planungsprozess laut geworden war, will die Stadt nun in jedem Interventionsraum ein Projekt angehen.
..... Das „Pilotprojekt“ im Inneren Grüngürtel wird möglicherweise am längsten von allen sieben auf den ersten Spatenstich warten müssen: Zum Bau des neuen Stadtarchivs am Eifelwall soll im Herbst der Architekten-Wettbewerb ausgeschrieben werden. Die Verhandlungen über das Grundstück zwischen Eifelwall und Hans-Nipperdey-Straße, das zur Verlängerung des Grüngürtels dienen soll, gestalten sich schwierig. In einem Wertgutachten soll ermittelt werden, welcher Preis angemessen erscheint. Wann der Bau genau beginnt, steht zwar noch nicht fest. Ziel ist es jedoch, das neue Stadtarchiv 2014 zu eröffnen. "
Quelle: Kölnische Rundschau, 6.8.2010
..... Das „Pilotprojekt“ im Inneren Grüngürtel wird möglicherweise am längsten von allen sieben auf den ersten Spatenstich warten müssen: Zum Bau des neuen Stadtarchivs am Eifelwall soll im Herbst der Architekten-Wettbewerb ausgeschrieben werden. Die Verhandlungen über das Grundstück zwischen Eifelwall und Hans-Nipperdey-Straße, das zur Verlängerung des Grüngürtels dienen soll, gestalten sich schwierig. In einem Wertgutachten soll ermittelt werden, welcher Preis angemessen erscheint. Wann der Bau genau beginnt, steht zwar noch nicht fest. Ziel ist es jedoch, das neue Stadtarchiv 2014 zu eröffnen. "
Quelle: Kölnische Rundschau, 6.8.2010
Wolf Thomas - am Freitag, 6. August 2010, 21:03 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
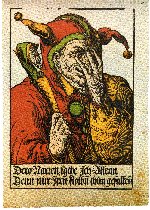
" .... Geschmäht und verleumdet sah der Reformator seinen Platz nicht länger in der Defensive, sondern verhalf der evangelischen Lehre nun mit zunehmender Angriffslust zum Durchbruch. In einer Flut von Flugschriften und –blättern, in der sich beide Seiten an Deftigkeit zu überbieten suchten, wurde das Zerwürfnis zwischen der römisch-katholischen Kirche und ihrer Opposition öffentlich ausgetragen. Buchdruck und -handel hatten der Polemik das erste Massenmedium zur Verfügung gestellt und verzeichneten ihrerseits erste Rekordergebnisse.
....
Die Ausstellung, in der über 50 besonders imposante Druckgrafiken zu Wort kommen, wird vom 6. August bis 31. Oktober 2010 im Rahmen des Museumsrundganges zu sehen sein."
Quelle: Wartburg,Homepage
Wolf Thomas - am Freitag, 6. August 2010, 17:31 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
![[Portrait of Thelonious Monk, Minton's Playhouse, New York, N.Y., ca. Sept. 1947] (LOC)](http://farm5.static.flickr.com/4110/4843753116_8ae0835d21.jpg)
Thelonious Monk, Minton´s Playhouse, Sept. 1947 (LOC)
"Celebrated jazz artists come to life in photographs by William P. Gottlieb. His images document the jazz scene in New York City and Washington, D.C., from 1938 to 1948, a time recognized by many as the "Golden Age of Jazz".
Gottlieb was both a notable jazz journalist and a self-taught photographer who captured the personalities of jazz musicians and told their stories with his camera and typewriter. His portraits depict such prominent musicians and personalities as Louis Armstrong, Duke Ellington, Billie Holiday, Thelonious Monk, Ella Fitzgerald, and many more.
The first 219 images in this set show the photos published alongside the photographer's personal recollections in his book, The Golden Age of Jazz. We'll add more photos each month until all 1,600 are in Flickr, with thanks to our Music Division for contributing such dramatic images.
To learn more about William Gottlieb, visit the Library's Performing Arts Encyclopedia, Gottlieb Collection. By looking at Gottlieb’s negatives here, you’ll see examples of the raw camera images and also copies of his final cropped images for insight into the creative process. At LOC, we also have special features like interviews with Gottlieb, ”In His Own Words".
In accordance with the wishes of William Gottlieb, the photographs in this collection entered into the public domain on February 16, 2010, but rights of privacy and publicity may apply. Privacy and publicity rights protect the interests of the person(s) who may be the subject(s) of the work or intellectual creation. Users of photographs in the Gottlieb collection are responsible for clearing any privacy or publicity rights associated with the use of the images."
Link: http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/sets/72157624588645784/
Wolf Thomas - am Freitag, 6. August 2010, 09:32 - Rubrik: Fotoueberlieferung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Bekanntgabe des Wettbewerbsthemas erfolgt am 01.09.2010.
Link: http://www.koerber-stiftung.de/bildung/geschichtswettbewerb.html
Link: http://www.koerber-stiftung.de/bildung/geschichtswettbewerb.html
Wolf Thomas - am Freitag, 6. August 2010, 08:55 - Rubrik: Archivpaedagogik

1. Bild: http://archiv.twoday.net/stories/6438286/
2. Bild: http://archiv.twoday.net/stories/6443103/
Tipp: Kommentare lesen!
Wolf Thomas - am Freitag, 6. August 2010, 07:19 - Rubrik: Unterhaltung
Vladimir Votýpka: Böhmischer Adel. Familiengeschichten. 2. Aufl. Wien usw. 2008 stützt sich vor allem auf persönliche Begegnungen mit böhmischen Adeligen 1970/72. S. 151f. erfährt man etwas über das gerettete Adelsarchiv der Wratislaw. S. 203-223 ist ein Kapitel zum schändlichen Umgang mit dem beweglichen Kulturgut der Adelsfamilien und zum Denkmalschutz der Schlösser in der Epoche des Kommunismus.
Rezensionen:
http://www.buecher.de/shop/buecher/boehmischer-adel/votypka-vladimr/products_products/content/prod_id/22497444/#faz
http://library.fes.de/fulltext/afs/htmrez/81132.htm

Rezensionen:
http://www.buecher.de/shop/buecher/boehmischer-adel/votypka-vladimr/products_products/content/prod_id/22497444/#faz
http://library.fes.de/fulltext/afs/htmrez/81132.htm

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Fritz J. Raddatz lässt durch das Antiquariat Albrecht in Schriesheim 350 Widmungsexemplare verkaufen, da, so der SPIEGEL 31/2010, S. 103 Marbach sie aus Platzgründen nicht archivieren wollte.
http://www.boersenblatt.net/390304/template/bb_tpl_antiquariat/ zitiert aus dem Vorwort von Raddatz:
"Sich von Büchern trennen, das ist, als würfe man Brot weg. Sich von signierten Büchern trennen, das ist, als verriete man Freunde. [...] Derlei kann man nicht wegwerfen. Kultur ist das Tradierte. [...] Man soll geliebte Bücher in andere Hände weitergeben, hoffend, es werden behütende sein, Hände von Buchnarren und Lesern, die sie nun in ihren Schutz nehmen wollen."
Katalog als PDF:
http://www.antiquariat.com/kat165.pdf

http://www.boersenblatt.net/390304/template/bb_tpl_antiquariat/ zitiert aus dem Vorwort von Raddatz:
"Sich von Büchern trennen, das ist, als würfe man Brot weg. Sich von signierten Büchern trennen, das ist, als verriete man Freunde. [...] Derlei kann man nicht wegwerfen. Kultur ist das Tradierte. [...] Man soll geliebte Bücher in andere Hände weitergeben, hoffend, es werden behütende sein, Hände von Buchnarren und Lesern, die sie nun in ihren Schutz nehmen wollen."
Katalog als PDF:
http://www.antiquariat.com/kat165.pdf

KlausGraf - am Freitag, 6. August 2010, 01:39 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der SPIEGEL 31/2010, S. 126f. stellt die Thesen von Eckhard Höffner: Geschichte und Wesen des Urheberrechts, 2010 vor:
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,709761,00.html
http://www.scribd.com/doc/35179710/Spiegel-Explosion-des-Wissens
Siehe auch
http://www.fifoost.org/wordpress/?p=1640
Lesenswert auch Höffners Ausführungen zum modernen Datenbankschutzrecht:
http://www.fifoost.org/wordpress/?p=1584
Update: Interview mit dem Autor
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33092/1.html

http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,709761,00.html
http://www.scribd.com/doc/35179710/Spiegel-Explosion-des-Wissens
Siehe auch
http://www.fifoost.org/wordpress/?p=1640
Lesenswert auch Höffners Ausführungen zum modernen Datenbankschutzrecht:
http://www.fifoost.org/wordpress/?p=1584
Update: Interview mit dem Autor
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33092/1.html

KlausGraf - am Freitag, 6. August 2010, 01:28 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Patrick Oelze: Fraischpfänder - ein frühneuzeitlicher Rechtsbrauch im Südwesten des Alten Reiches. In: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 69 (2010), S. 449-261 erwähnt die Hohenlimburger "Schwarze Hand" und bringt einen literarischen Beleg von Jean Paul zu mumifizierten Händen als Fraischpfändern bei, verzichtet aber darauf, rechtshistorische Literatur zu "Leibzeichen" anzugeben.
Siehe meinen Aufsatz zur Erinnerungskultur der Strafjustiz:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/strafj.htm#a222
Jean Paul sagt in seinen Biographischen Belustigungen von 1796, dass die Hände im Fraischpfänderschrank als Relikte von Kindern galten, die ihre Eltern geschlagen hatten und die aus dem Grab herauswuchsen:
http://books.google.de/books?id=L0c_AAAAcAAJ&lpg=PA41
Definition von Fraischpfand durch Zinkernagel im Handbuch für angehende Archivare 1800:
http://books.google.de/books?id=aQxFAAAAYAAJ&pg=PA524
Deutsches Rechtswörterbuch:
http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/e/fr/eisp/fand/freispfand.htm
 Hohenlimburger Schwarze Hand Bildquelle
Hohenlimburger Schwarze Hand Bildquelle
Siehe meinen Aufsatz zur Erinnerungskultur der Strafjustiz:
http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/strafj.htm#a222
Jean Paul sagt in seinen Biographischen Belustigungen von 1796, dass die Hände im Fraischpfänderschrank als Relikte von Kindern galten, die ihre Eltern geschlagen hatten und die aus dem Grab herauswuchsen:
http://books.google.de/books?id=L0c_AAAAcAAJ&lpg=PA41
Definition von Fraischpfand durch Zinkernagel im Handbuch für angehende Archivare 1800:
http://books.google.de/books?id=aQxFAAAAYAAJ&pg=PA524
Deutsches Rechtswörterbuch:
http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/e/fr/eisp/fand/freispfand.htm
 Hohenlimburger Schwarze Hand Bildquelle
Hohenlimburger Schwarze Hand BildquelleKlausGraf - am Freitag, 6. August 2010, 00:48 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 5. August 2010, 23:10 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Seine Heiligkeit Papst Benedikt XVI. plante nach Angaben des Kardinals Raffele Farina 1997, sich auf das Amt des Leiters des vatikanischen Geheimarchivs und der Bibliothek zurückzuziehen. Er erhielt dafür jedoch nicht die Erlaubnis des damaligen Papstes Johannes Paul II.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/7928493/Pope-Benedict-wanted-to-be-a-librarian.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/7928493/Pope-Benedict-wanted-to-be-a-librarian.html
KlausGraf - am Donnerstag, 5. August 2010, 23:00 - Rubrik: Kirchenarchive
Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. August 2010, 21:25 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Gerade kassierte der Artikel über das Stadtarchiv Bergisch Gladbach einen Löschantrag wegen Trivialität:
http://de.wikipedia.org/wiki/Stadtarchiv_Bergisch_Gladbach
Der Ersteller des Artikels hat sich wirklich sehr wenig Mühe gegeben.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stadtarchiv_Bergisch_Gladbach
Der Ersteller des Artikels hat sich wirklich sehr wenig Mühe gegeben.
KlausGraf - am Donnerstag, 5. August 2010, 19:36 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein Radio-Feature von Margarete von Schwarzkopf für NDR 1 Niedersachsen (Erstausstrahlung: 18.2.2010, Link )
Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. August 2010, 18:37 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
A analysis of the future of film archives.
Link
Link
Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. August 2010, 18:32 - Rubrik: Filmarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://booksearch.blogspot.com/2010/08/books-of-world-stand-up-and-be-counted.html
Update:
http://arstechnica.com/science/news/2010/08/googles-count-of-130-million-books-is-probably-bunk.ars
Update:
http://arstechnica.com/science/news/2010/08/googles-count-of-130-million-books-is-probably-bunk.ars
KlausGraf - am Donnerstag, 5. August 2010, 18:30 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Repetitorium enthält heraldisches Grundwissen für gebildete Laien, aber auch für angehende Historiker und Kunsthistoriker, für Museologen und Designer. Sie werden sowohl in die Wappenkunde als auch in die Wappenkunst eingeführt. Wappen als Identifikationssymbole der Vergangenheit und Gegenwart können Familiensinn, Heimatliebe oder Patriotismus ausdrücken, sie sind für alle Freunde der Geschichte und Kunstgeschichte eine wichtige Quelle. Damit die Wappen aber keine bloßen Bilderrätsel bleiben, will der kleine Band helfen, sie zu aufzulösen und ihren Informationsgehalt zu entschlüsseln. Das Buch ist aus Lehrveranstaltungen für Geschichtsstudenten an der Freien Universität und Technischen Universität Berlin hervorgegangen und in einer Seminarwoche des Herold, Vereins für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften (gegr. 1869) weiterentwickelt worden. Gerne möchte der Band aber auch den akademischen Bannkreis überschreiten und in lockerer Frageform in die Anfangsgründe der Familien-, Kommunal- und Staatsheraldik einführen.
Dr. phil. Eckart Henning M.A. ist Honorarprofessor für Archivwissenschaft und Historische Hilfswissenschaften der Neuzeit am Institut für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Humboldt-Universität zu Berlin, Sprecher der Fachgruppe „Historische Hilfswissenschaften“ und Begründer des „Herold-Jahrbuchs“. Er ist Mitglied der Académie Internationale d’Héraldique (Genf) und weiterer Fachgesellschaften des In- und Auslands. Er war als Archivar von 1970-1983 am Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz tätig, bis er zum Direktor des Archivs zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin-Dahlem berufen wurde, das er von 1984-2006 leitete."
112 Seiten. 13 Abbildungen, © 2010. BibSpider, Berlin, ISBN 978-3-936960-43-3, 23 €
Quelle: Verlagsangaben
Dr. phil. Eckart Henning M.A. ist Honorarprofessor für Archivwissenschaft und Historische Hilfswissenschaften der Neuzeit am Institut für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Humboldt-Universität zu Berlin, Sprecher der Fachgruppe „Historische Hilfswissenschaften“ und Begründer des „Herold-Jahrbuchs“. Er ist Mitglied der Académie Internationale d’Héraldique (Genf) und weiterer Fachgesellschaften des In- und Auslands. Er war als Archivar von 1970-1983 am Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz tätig, bis er zum Direktor des Archivs zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin-Dahlem berufen wurde, das er von 1984-2006 leitete."
112 Seiten. 13 Abbildungen, © 2010. BibSpider, Berlin, ISBN 978-3-936960-43-3, 23 €
Quelle: Verlagsangaben
Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. August 2010, 18:26 - Rubrik: Hilfswissenschaften
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Der VdA-Arbeitskreis „Archivpädagogik und Historische Bildungsarbeit“ hat eine Plattform eingerichtet, über die einerseits Erfahrungen aus einzelnen Bereichen der Archivpädagogik und Historischen Bildungsarbeit mitgeteilt werden können und andererseits jeder Nutzer dieser Plattform von den schon fertigen Modulen anderer profitieren kann.
Das Motto lautet also: Profitieren und engagieren.
Im Mittelpunkt der Beschreibungen sollten einzelne Elemente/Module innerhalb von Veranstaltungen und Angeboten stehen, alsoVorgehensweisen und Methoden innerhalb eines Gesamtangebots, die sich als „gute Ideen“ bewährt haben. Aber auch die Vorstellung gelungener Gesamtprojekte ist möglich. Das Leerformular soll Sie einladen, kurz und knapp Ihre Ideen und Erfahrungen für die Archiv-konkret-Sammlung zu beschreiben und einfach auf „Daten absenden“ klicken. Ihr Vorschlag geht an die Koordinierungsstelle (Roswitha Link, Stadtarchiv Münster, An den Speichern 8, 48157 Münster, LinkRoswitha@stadt-muenster.deDiese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. ). Wir freuen uns über jeden Beitrag.
... und hier geht's zum Formular: eigene Aktionen eintragen und absenden!
Inhalt [Stand: 2.6.2010]
1. Einzelsequenzen
1.1 Urkunden selber ausstellen (Dr. Wolfhart Beck, Münster)
1.2 Urkunden/Dokumentenpuzzle (Dieter Klose, Detmold)
1.3 Das beschädigte Dokument (Dieter Klose, Detmold)
1.4 Einstieg in eine Führung (Dr. Clemens Rehm, Stuttgart)
1.5 Geld gießen (Dr. Clemens Rehm, Stuttgart)
1.6 Allgemeine Magazinführung als „Zeitreise“ entlang von Papier und Schrift (Dr. Wolfhart Beck, Münster)
1.7 Abenteuer Schrift (Ingrid Baier, Fürth)
1.8 Allgemeine Führung, hier: Der Einstieg (Roswitha Link, Münster)
1.9 Erste Begegnung mit der Kurrentschrift (Roswitha Link, Münster)
1.10 Von der Pergamenturkunde zum digitalen Datenträger, hier: Einstiegssequenz (Merit Kegel, Leipzig)
1.11 Rettet Archibald! - Ein Detektivspiel. Hier: Einstiegssequenz (Merit Kegel, Leipzig)
2. Archivbesuche / Projekte
2.1 Szenische Lesung aus Archivali(en) (Dr. Wolfhart Beck, Münster)
2.2 Thematische Archivführung mit anschließender Quellenarbeit (Dr. Annekatrin Schaller, Neuss)
2.3 „Experten“gruppenarbeit (Dieter Klose, Detmold)
2.4 Meine Stadt, die X-Straße, Rathaus, Bahnhof, Schule usw. gestern und heute (Dieter Klose, Detmold)
2.5 Inszenierung von Archivalie(n) (Dr. Wolfhart Beck, Münster)
2.6 Buchbinden - kinderleicht. Herstellen eines DIN A5 Ringbuchs (Ingrid Baier, Fürth)
2.7 Die Bauten der Grafen von Pückler-Limpurg (Ingrid Baier, Fürth)
2.8 Rettet Archibald! - Ein Detektivspiel Hier: Führung als Detektivspiel – 60 Minuten sowie Mitmachangebot – 45 Minuten (Merit Kegel, Leipzig in Zusammenarbeit mit Theresa Rossenbach, TU Dresden)
2.9 Forscher-AG: Schuljubiläum (Andreas Froning, Gescher)"
Quelle: archivpaedagogen.de
Das Motto lautet also: Profitieren und engagieren.
Im Mittelpunkt der Beschreibungen sollten einzelne Elemente/Module innerhalb von Veranstaltungen und Angeboten stehen, alsoVorgehensweisen und Methoden innerhalb eines Gesamtangebots, die sich als „gute Ideen“ bewährt haben. Aber auch die Vorstellung gelungener Gesamtprojekte ist möglich. Das Leerformular soll Sie einladen, kurz und knapp Ihre Ideen und Erfahrungen für die Archiv-konkret-Sammlung zu beschreiben und einfach auf „Daten absenden“ klicken. Ihr Vorschlag geht an die Koordinierungsstelle (Roswitha Link, Stadtarchiv Münster, An den Speichern 8, 48157 Münster, LinkRoswitha@stadt-muenster.deDiese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. ). Wir freuen uns über jeden Beitrag.
... und hier geht's zum Formular: eigene Aktionen eintragen und absenden!
Inhalt [Stand: 2.6.2010]
1. Einzelsequenzen
1.1 Urkunden selber ausstellen (Dr. Wolfhart Beck, Münster)
1.2 Urkunden/Dokumentenpuzzle (Dieter Klose, Detmold)
1.3 Das beschädigte Dokument (Dieter Klose, Detmold)
1.4 Einstieg in eine Führung (Dr. Clemens Rehm, Stuttgart)
1.5 Geld gießen (Dr. Clemens Rehm, Stuttgart)
1.6 Allgemeine Magazinführung als „Zeitreise“ entlang von Papier und Schrift (Dr. Wolfhart Beck, Münster)
1.7 Abenteuer Schrift (Ingrid Baier, Fürth)
1.8 Allgemeine Führung, hier: Der Einstieg (Roswitha Link, Münster)
1.9 Erste Begegnung mit der Kurrentschrift (Roswitha Link, Münster)
1.10 Von der Pergamenturkunde zum digitalen Datenträger, hier: Einstiegssequenz (Merit Kegel, Leipzig)
1.11 Rettet Archibald! - Ein Detektivspiel. Hier: Einstiegssequenz (Merit Kegel, Leipzig)
2. Archivbesuche / Projekte
2.1 Szenische Lesung aus Archivali(en) (Dr. Wolfhart Beck, Münster)
2.2 Thematische Archivführung mit anschließender Quellenarbeit (Dr. Annekatrin Schaller, Neuss)
2.3 „Experten“gruppenarbeit (Dieter Klose, Detmold)
2.4 Meine Stadt, die X-Straße, Rathaus, Bahnhof, Schule usw. gestern und heute (Dieter Klose, Detmold)
2.5 Inszenierung von Archivalie(n) (Dr. Wolfhart Beck, Münster)
2.6 Buchbinden - kinderleicht. Herstellen eines DIN A5 Ringbuchs (Ingrid Baier, Fürth)
2.7 Die Bauten der Grafen von Pückler-Limpurg (Ingrid Baier, Fürth)
2.8 Rettet Archibald! - Ein Detektivspiel Hier: Führung als Detektivspiel – 60 Minuten sowie Mitmachangebot – 45 Minuten (Merit Kegel, Leipzig in Zusammenarbeit mit Theresa Rossenbach, TU Dresden)
2.9 Forscher-AG: Schuljubiläum (Andreas Froning, Gescher)"
Quelle: archivpaedagogen.de
Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. August 2010, 18:17 - Rubrik: Archivpaedagogik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
AGHET - Ein Völkermord [Armenian Genocide] from AGHET on Vimeo.
"Das ist eine ausnahmslose Dokumentation über den Völkermord an den Armeniern im Jahre 1915, welcher jedoch bis heute von der Türkei geleugnet wird. Der Film zitiert zum ersten mal Berichte unter anderem aus dem Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin, den amerikanischen National Archives, der Library of Congress sowie aus Archiven in Frankreich, Dänemark, Schweden, Armenien, Russland und der Türkei. Diese geheimen Dokumente wurden lange Zeit aus falscher Rücksichtnahme zurück gehalten und lassen keinen Zweifel an einem grausamen Völkermord. "Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. August 2010, 18:07 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
"Die Wienbibliothek im Rathaus hat im Juli den Nachlass des Dichters und Aktionskünstlers Hubert Fabian Kulterer angekauft, der u.a. wichtige Dokumente sowie unveröffentlichte Texte und Briefe der Wiener Gruppe enthält. Wolfgang Bauer, Konrad Bayer, Raoul Hausmann, Ernst Jandl, Friederike Mayröcker, Heidi Patacki oder Gerhard Rühm sind nur einige der berühmten Wiener und internationalen KünstlerInnen, die in der Sammlung vorkommen. "Der Nachlass ist aufgrund seiner unglaublichen Vielfalt an Materialien für die Forschung, für Ausstellungen und Buchprojekte ein großer Gewinn für die Wienbibliothek", freut sich Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny.
Kulterer, 1938 in Klagenfurt geboren, inskribierte nach der Matura Deutsche Philologie an der Universität Wien und promovierte 1965. Schon während des Studiums tauchte er in die Wiener Künstler- und Avantgardeszene ein und pflegte intensive Kontakte zu Ernst Fuchs, H. C. Artmann und Konrad Bayer. Diesen und anderen bot Kulterer mit der seit 1961 erscheinenden Zeitschrift "Eröffnungen" eine Plattform, die sowohl graphisch wie inhaltlich zu den interessantesten österreichischen Zeitschriftenprojekten zählte. Das Archiv dieser Zeitschrift macht einen großen Teil des Nachlasses aus.
Weitere interessante Materialien sind die teils unveröffentlichten Texte von H.C. Artmann sowie Skizzen und Tagebucheintragungen von Hannes Schneider, der einige Jahre lang Redakteur bei den "Eröffnungen" war. "Diese Dokumente stellen wertvolle Ergänzungen zu den Nachlässen Artmann und Schneider dar, die 2004 bzw. 2006 von der Wienbibliothek erworben wurden", unterstrich die Direktorin der Wienbibliothek Sylvia Mattl-Wurm. Kulterers Sammlung an Büchern, Briefen, Autographen und Kunst eilte schon zu Lebzeiten ein gewisser Ruf voraus, auch deshalb, weil die Massen des Sammelguts ihn dazu zwangen, im einzig papierfreien Platz seiner Wohnung zu nächtigen: der Badewanne. Dort fand man ihn, wie Gerhard Ruiss in seinem Nachruf berichtet, am 24. April 2009 tot auf."
Quelle: Wien, Rathauskorrespondenz v. 22.7.2010
Kulterer, 1938 in Klagenfurt geboren, inskribierte nach der Matura Deutsche Philologie an der Universität Wien und promovierte 1965. Schon während des Studiums tauchte er in die Wiener Künstler- und Avantgardeszene ein und pflegte intensive Kontakte zu Ernst Fuchs, H. C. Artmann und Konrad Bayer. Diesen und anderen bot Kulterer mit der seit 1961 erscheinenden Zeitschrift "Eröffnungen" eine Plattform, die sowohl graphisch wie inhaltlich zu den interessantesten österreichischen Zeitschriftenprojekten zählte. Das Archiv dieser Zeitschrift macht einen großen Teil des Nachlasses aus.
Weitere interessante Materialien sind die teils unveröffentlichten Texte von H.C. Artmann sowie Skizzen und Tagebucheintragungen von Hannes Schneider, der einige Jahre lang Redakteur bei den "Eröffnungen" war. "Diese Dokumente stellen wertvolle Ergänzungen zu den Nachlässen Artmann und Schneider dar, die 2004 bzw. 2006 von der Wienbibliothek erworben wurden", unterstrich die Direktorin der Wienbibliothek Sylvia Mattl-Wurm. Kulterers Sammlung an Büchern, Briefen, Autographen und Kunst eilte schon zu Lebzeiten ein gewisser Ruf voraus, auch deshalb, weil die Massen des Sammelguts ihn dazu zwangen, im einzig papierfreien Platz seiner Wohnung zu nächtigen: der Badewanne. Dort fand man ihn, wie Gerhard Ruiss in seinem Nachruf berichtet, am 24. April 2009 tot auf."
Quelle: Wien, Rathauskorrespondenz v. 22.7.2010
Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. August 2010, 18:03 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
DECHAINEES - UNLEASHED from Max Karli on Vimeo.
"Lucie découvre qu'une militante notoire de la période du mouvement de libération des femmes à Genève serait sa véritable grand-mère. Contre le gré de sa famille, la jeune femme se lance à sa recherche pour déterrer le secret de famille. "Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. August 2010, 17:58 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Link zum PDF
Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. August 2010, 17:50 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) hat 44 Briefe des Schriftstellers Heimito von Doderer (1896-1966) an den Germanisten Dietrich Weber gekauft.
ÖNB-Direktorin Johanna Rachinger sagte, damit könne der bereits reichhaltige Nachlass-Bestand des großen Dichters um bedeutende Autografen erweitert werden. "Äußerst bemerkenswert und auffällig" sei die verschiedenfarbige Gestaltung der Briefe. Der Briefwechsel stammt aus den Jahren 1959 bis 1966. Er behandelt nicht nur Fachfragen wie die Vervollständigung der Bibliografie von Doderers Werken, sondern belegt auch die enge Freundschaft und Verbindung des Ehepaars Doderer mit dem Ehepaar Weber. Doderer fühlte sich von den Interpretationen des noch "jungen" Forschers offensichtlich sehr angesprochen und fühlte sich von ihm verstanden."
Quelle: 3sat, Kulturzeitnachrichten, 22.7.2010
ÖNB-Direktorin Johanna Rachinger sagte, damit könne der bereits reichhaltige Nachlass-Bestand des großen Dichters um bedeutende Autografen erweitert werden. "Äußerst bemerkenswert und auffällig" sei die verschiedenfarbige Gestaltung der Briefe. Der Briefwechsel stammt aus den Jahren 1959 bis 1966. Er behandelt nicht nur Fachfragen wie die Vervollständigung der Bibliografie von Doderers Werken, sondern belegt auch die enge Freundschaft und Verbindung des Ehepaars Doderer mit dem Ehepaar Weber. Doderer fühlte sich von den Interpretationen des noch "jungen" Forschers offensichtlich sehr angesprochen und fühlte sich von ihm verstanden."
Quelle: 3sat, Kulturzeitnachrichten, 22.7.2010
Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. August 2010, 17:44 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Spanien stellt in dreierlei Hinsicht einen besonders interessanten Fall dar. Erstens wurde mit dem Archiv von Simancas 1540 in Kastilien erstmals eine Art zentrales Staatsarchiv gegründet und somit eine Programmatik der Aufbewahrung und dauerhaften Zurverfügungstellung regierungsrelevanter Schriften entwickelt und institutionell durchgesetzt. ...."
Zitat aus: Brendecke, Arndt: „Diese Teufel, meine Papiere ...“ Philipp II. von Spanien und das Anwachsen administrativer Schriftlichkeit. aventinus nova Nr. 5 (Winter 2006), in: aventinus, URL: http://www.aventinus-online.de/no_cache/persistent/artikel/7785/ (5.8.2010)
Zur Geschichte des Staatsarchivs s. Homepage des Archivs (span.)
Zitat aus: Brendecke, Arndt: „Diese Teufel, meine Papiere ...“ Philipp II. von Spanien und das Anwachsen administrativer Schriftlichkeit. aventinus nova Nr. 5 (Winter 2006), in: aventinus, URL: http://www.aventinus-online.de/no_cache/persistent/artikel/7785/ (5.8.2010)
Zur Geschichte des Staatsarchivs s. Homepage des Archivs (span.)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. August 2010, 17:31 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... Der ideale Ort um Beweise für einen historischen Hintergrund der Ilias zu finden wäre sicher der Palastbezirk. Hier müsste ein Archiv angesiedelt gewesen sein, falls die Troianer Schrift kannten. Homer beschreibt zudem den Palast des Priamos als ungewöhnlich großes Gebäude, reich geschmückt und Platz bietend für alle Söhne und Töchter des Königs, welches also, falls Grabungen etwas ähnliches liefern würden, als starker Beweis gelten könnte.
Leider wurde jedoch bereits beim Aufbau des römischen Ilion [3] ein Großteil des Burgbergs abgetragen, so dass Grabungsfunde der Schichten Troia VI bis VIII (die zeitlich in dem von Homer beschriebenen Rahmen liegen) nur in einem kleinen Bereich um die Stadtmauer, aber eben nicht im Siedlungszentrum möglich sind. ...."
Zitat aus: Fischer, Mark-Oliver: Hisarlik und Troia. aventinus antiqua Nr. 2 (Winter 2005), in: aventinus, URL: http://www.aventinus-online.de/no_cache/persistent/artikel/7701/ (5.8.2010)
Leider wurde jedoch bereits beim Aufbau des römischen Ilion [3] ein Großteil des Burgbergs abgetragen, so dass Grabungsfunde der Schichten Troia VI bis VIII (die zeitlich in dem von Homer beschriebenen Rahmen liegen) nur in einem kleinen Bereich um die Stadtmauer, aber eben nicht im Siedlungszentrum möglich sind. ...."
Zitat aus: Fischer, Mark-Oliver: Hisarlik und Troia. aventinus antiqua Nr. 2 (Winter 2005), in: aventinus, URL: http://www.aventinus-online.de/no_cache/persistent/artikel/7701/ (5.8.2010)
Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. August 2010, 17:28 - Rubrik: Archivgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Soeben erreichte mich zu dem unter
http://archiv.twoday.net/stories/6437252/
dokumentierten Skandal folgende Mail.
Sehr geehrter Herr Dr. Graf,
inzwischen konnte ich die für eine Beantwortung Ihrer am 22. Juli 2010 an die Frau Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz (SBB-PK) gerichteten E-Mail notwendigen Auskünfte einholen und den mit der Walter de Gruyter GmbH & Co. KG abgeschlossenen Vertrag einsehen, der die Realisierung der digitalisierten und durch ein Bündel komfortabler Suchfunktionen nutzerfreundlich aufgewerteten Fassung von Teilen unserer sonst nur analog verfügbaren Bestände der "Vossischen Zeitung" regelt.
Danach ist Ihrem Sachvortrag korrigierend entgegen zu halten, dass die Zusammenarbeit mit dem Verlag eben nicht zu dem Zweck und mit dem Ergebnis erfolgte, eine schlichte digitale Kopie zu erstellen, mit der die Nutzer dann allein gelassen werden.
Es wurde vielmehr zusätzlich ein anspruchsvolles Instrumentarium geschaffen, das es dem interessierten Leser erlaubt, zwischen speziellen Sucheinstiegen zu wählen, wie der Volltextsuche mit farblicher Kennzeichnung der Treffer im Text, der Suche nach einer bestimmten Ausgabe, einem Datum und Zeiträumen, nach Artikeln, nach Abbildungen oder nach Werbeblöcken.
Dieser Mehrwert konnte nur durch die zusätzlichen Investitionen eines leistungsfähigen Partnerunternehmens realisiert werden, das allerdings unser gemeinsames Produkt zur Refinanzierung entsprechend wirtschaftlich verwerten muss.
Dafür wird das beschriebene Produkt als Gesamtpaket interessierten Institutionen zu einem angemessenen Preis angeboten.
Die Nutzerinnen und Nutzer unserer Staatsbibliothek können aber - und dies ist unser Vorteil aus der gefundenen Kooperation, die Sie despektierlich als "Kungeln" bewerten - ohne zusätzlichen Kostenaufwand auf die beschriebene Datenbank zugreifen, und sie steht sogar im RemoteAccess (also bei Vorhandensein eines gültigen Benutzeraus-weises) von jedem Internet-PC aus zur Verfügung. Der Zugang erfolgt also ortsunabhängig.
Wenn beispielsweise Sie, sehr geehrter Herr Dr. Graf, in Neuss sich einen Benutzungsausweis der SBB-PK zulegen, können Sie auch in Neuss das Angebot nutzen.
Aber auch ohne Benutzerausweis stehen Ihnen bei uns zusätzlich zum nicht gering zu achtenden "Groß-Strehlitzer Kreisblatt" in der Digitalen Bibliothek der SBB 100 Zeitungstitel mit insgesamt ca. 480.000 Zeitungsseiten als Images zur unentgeltlichen Nutzung bereit.
Sollten Sie trotz dieser Klarstellungen und Erläuterungen weiterhin tiefer in die vertraglichen Grundlagen der mit der Walter de Gruyter GmbH & Co. KG begonnenen Kooperation einsteigen wollen, so möchte ich Sie wegen der in dem Vertrag auch enthaltenen technischen und finanziellen sowie persönlichen Daten darauf hinweisen, dass wir noch unserem Vertragspartner die Gelegenheit zur Stellungnahme geben und selbst ergänzend prüfen müssen, in welchem Umfang wir den Vertragstext in Anwendung der einschlägigen Vorschriften des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz - IFG) Ihnen konkret bekannt geben dürfen.
Wegen des damit verbundenen Aufwandes werden gemäß § 10 Absatz 1 IFG für Amtshandlungen nach diesem Gesetz Gebühren und Auslagen erhoben, wenn - wie in diesem Falle zwingend zu erwarten - es nicht nur um die Erteilung einfacher Auskünfte gehen wird.
So sieht die Verordnung über die Gebühren und Auslagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Informations-gebührenverordnung - IFGGebV) für die Erteilung einer schriftlichen Auskunft bei Herausgabe von Abschriften, wenn im Einzelfall ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand zur Zusammenstellung von Unterlagen entsteht, insbesondere wenn zum Schutz öffentlicher oder privater Belange Daten ausgesondert werden, einen Gebührenbetrag vor von 60 bis 500 Euro.
Angesichts des bereits entstandenen und darüber hinaus schon jetzt absehbaren weiteren Abklärungsaufwandes sind Sie also aus Gründen der Fairness schon jetzt darauf hin zu weisen, dass eine Gebühr im oberen Bereich des benannten Rahmens anfallen wird, weshalb eine weitere Bearbeitung Ihres Antrages auch erst dann erfolgen kann, wenn ein angemessener Anzahlungsbetrag auf die zu erwartende Gebühr, also 250 Euro, bei uns eingegangen sein wird.
Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie gleichwohl an Ihrem Antrag festhalten wollen.
Sollte dies der Fall sein und sollten Sie mir dies ausdrücklich erklären, übermittele ich Ihnen gerne umgehend die für eine Zahlung erforderlichen Daten.
Anderenfalls darf ich mich schon jetzt für Ihr Interesse an unseren Projekten bedanken.
Mit besten Grüßen
Im Auftrag [...]
\ STIFTUNG PREUSSISCHER KULTURBESITZ
http://archiv.twoday.net/stories/6437252/
dokumentierten Skandal folgende Mail.
Sehr geehrter Herr Dr. Graf,
inzwischen konnte ich die für eine Beantwortung Ihrer am 22. Juli 2010 an die Frau Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz (SBB-PK) gerichteten E-Mail notwendigen Auskünfte einholen und den mit der Walter de Gruyter GmbH & Co. KG abgeschlossenen Vertrag einsehen, der die Realisierung der digitalisierten und durch ein Bündel komfortabler Suchfunktionen nutzerfreundlich aufgewerteten Fassung von Teilen unserer sonst nur analog verfügbaren Bestände der "Vossischen Zeitung" regelt.
Danach ist Ihrem Sachvortrag korrigierend entgegen zu halten, dass die Zusammenarbeit mit dem Verlag eben nicht zu dem Zweck und mit dem Ergebnis erfolgte, eine schlichte digitale Kopie zu erstellen, mit der die Nutzer dann allein gelassen werden.
Es wurde vielmehr zusätzlich ein anspruchsvolles Instrumentarium geschaffen, das es dem interessierten Leser erlaubt, zwischen speziellen Sucheinstiegen zu wählen, wie der Volltextsuche mit farblicher Kennzeichnung der Treffer im Text, der Suche nach einer bestimmten Ausgabe, einem Datum und Zeiträumen, nach Artikeln, nach Abbildungen oder nach Werbeblöcken.
Dieser Mehrwert konnte nur durch die zusätzlichen Investitionen eines leistungsfähigen Partnerunternehmens realisiert werden, das allerdings unser gemeinsames Produkt zur Refinanzierung entsprechend wirtschaftlich verwerten muss.
Dafür wird das beschriebene Produkt als Gesamtpaket interessierten Institutionen zu einem angemessenen Preis angeboten.
Die Nutzerinnen und Nutzer unserer Staatsbibliothek können aber - und dies ist unser Vorteil aus der gefundenen Kooperation, die Sie despektierlich als "Kungeln" bewerten - ohne zusätzlichen Kostenaufwand auf die beschriebene Datenbank zugreifen, und sie steht sogar im RemoteAccess (also bei Vorhandensein eines gültigen Benutzeraus-weises) von jedem Internet-PC aus zur Verfügung. Der Zugang erfolgt also ortsunabhängig.
Wenn beispielsweise Sie, sehr geehrter Herr Dr. Graf, in Neuss sich einen Benutzungsausweis der SBB-PK zulegen, können Sie auch in Neuss das Angebot nutzen.
Aber auch ohne Benutzerausweis stehen Ihnen bei uns zusätzlich zum nicht gering zu achtenden "Groß-Strehlitzer Kreisblatt" in der Digitalen Bibliothek der SBB 100 Zeitungstitel mit insgesamt ca. 480.000 Zeitungsseiten als Images zur unentgeltlichen Nutzung bereit.
Sollten Sie trotz dieser Klarstellungen und Erläuterungen weiterhin tiefer in die vertraglichen Grundlagen der mit der Walter de Gruyter GmbH & Co. KG begonnenen Kooperation einsteigen wollen, so möchte ich Sie wegen der in dem Vertrag auch enthaltenen technischen und finanziellen sowie persönlichen Daten darauf hinweisen, dass wir noch unserem Vertragspartner die Gelegenheit zur Stellungnahme geben und selbst ergänzend prüfen müssen, in welchem Umfang wir den Vertragstext in Anwendung der einschlägigen Vorschriften des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz - IFG) Ihnen konkret bekannt geben dürfen.
Wegen des damit verbundenen Aufwandes werden gemäß § 10 Absatz 1 IFG für Amtshandlungen nach diesem Gesetz Gebühren und Auslagen erhoben, wenn - wie in diesem Falle zwingend zu erwarten - es nicht nur um die Erteilung einfacher Auskünfte gehen wird.
So sieht die Verordnung über die Gebühren und Auslagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Informations-gebührenverordnung - IFGGebV) für die Erteilung einer schriftlichen Auskunft bei Herausgabe von Abschriften, wenn im Einzelfall ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand zur Zusammenstellung von Unterlagen entsteht, insbesondere wenn zum Schutz öffentlicher oder privater Belange Daten ausgesondert werden, einen Gebührenbetrag vor von 60 bis 500 Euro.
Angesichts des bereits entstandenen und darüber hinaus schon jetzt absehbaren weiteren Abklärungsaufwandes sind Sie also aus Gründen der Fairness schon jetzt darauf hin zu weisen, dass eine Gebühr im oberen Bereich des benannten Rahmens anfallen wird, weshalb eine weitere Bearbeitung Ihres Antrages auch erst dann erfolgen kann, wenn ein angemessener Anzahlungsbetrag auf die zu erwartende Gebühr, also 250 Euro, bei uns eingegangen sein wird.
Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie gleichwohl an Ihrem Antrag festhalten wollen.
Sollte dies der Fall sein und sollten Sie mir dies ausdrücklich erklären, übermittele ich Ihnen gerne umgehend die für eine Zahlung erforderlichen Daten.
Anderenfalls darf ich mich schon jetzt für Ihr Interesse an unseren Projekten bedanken.
Mit besten Grüßen
Im Auftrag [...]
\ STIFTUNG PREUSSISCHER KULTURBESITZ
KlausGraf - am Donnerstag, 5. August 2010, 17:26 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz
Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. August 2010, 17:24 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"For the first time, the main page of National Library and Archives of Iran (NLAI) has established a new section to disseminate news about Iran and the world's libraries and archives.
According to the public relations department of NLAI, the organization's PR manger, Hamed Yari said: "The individual section of libraries and archives news has been launched for the first time by NLAI with an object of solving some of the deficiencies which exist in covering library and archives news and the necessity of considering the field's news as an individual type.
He went on to say that in order to expand the country scientifically we should alter our looks towards the scientific and cultural centers including libraries, so considering the libraries and archives' incidents individually will be among the vital and impressive methods."
Moreover he said that the new page will explore the news websites of all international archive, culture and science centers as well as library information dissemination pages to find news pieces.
In the first phase, some 10 news pieces will be found by the organization's experts and following translations they will be uploaded to the website, he added.
The country's library and archives centers can send their news to the PR department on the following e-mail address; Pria@nlai.ir or 02188644053 ."
Iran Book News Agency, 31.07.2010
Link: Homepage (eng.) of NLAI
According to the public relations department of NLAI, the organization's PR manger, Hamed Yari said: "The individual section of libraries and archives news has been launched for the first time by NLAI with an object of solving some of the deficiencies which exist in covering library and archives news and the necessity of considering the field's news as an individual type.
He went on to say that in order to expand the country scientifically we should alter our looks towards the scientific and cultural centers including libraries, so considering the libraries and archives' incidents individually will be among the vital and impressive methods."
Moreover he said that the new page will explore the news websites of all international archive, culture and science centers as well as library information dissemination pages to find news pieces.
In the first phase, some 10 news pieces will be found by the organization's experts and following translations they will be uploaded to the website, he added.
The country's library and archives centers can send their news to the PR department on the following e-mail address; Pria@nlai.ir or 02188644053 ."
Iran Book News Agency, 31.07.2010
Link: Homepage (eng.) of NLAI
Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. August 2010, 17:11 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Begrüßung durch den Präsidenten des Bundesarchivs, Prof. Dr. Hartmut Weber
"Am 27. Juli 2010 besuchte Frau Dr. Chiu-yen Lin, Vize-Generaldirektorin der National Archives Administration in Taipeh, in Begleitung von Frau Lee, ihrer Assistentin, sowie Frau Yi-ping Chiang, Dolmetscherin und Referentin der Teipeh-Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland, das Bundesarchiv am Dienstort Koblenz. Frau Lin interessierte sich für Fragen des Archiv- und Records-Managements ebenso wie für das Digitale Archiv.
Nach der Begrüßung durch den Präsidenten des Bundesarchivs stellten Frau Dr. Hänger, Frau Schenke und Herr Rausch das Digitale Archiv des Bundesarchivs vor. Dabei wurde über Abgabeverfahren, Behördenberatung, Echtheits- und Bewertungskriterien sowie über die Aufbewahrung der Dokumente bzw. deren Migration gesprochen.
Für die taiwanesische Archivverwaltung sind diese Themen von großer Bedeutung, da die dortige Verwaltung 2010 umfassend die elektronische Akte einführen will. Eine Hausführung von Herrn Dr. Gleixner, bei der allgemeine Fragen zur Archivorganisation erörtert wurden, rundete das Besuchsprogramm ab."
Bundesarchiv, Pressemeldung
Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. August 2010, 17:03 - Rubrik: Staatsarchive
"Manche Leiden plagen die Menschheit seit Jahrtausenden. Blasen- und Harnsteine, die in Mumien gefunden wurden, sind heute beredte Indizien. Ebenso lange bemühen sich Heilkundige, solchen Leiden zu Leibe zu rücken. Einen detailreichen Querschnitt durch die medizinischen Epochen bietet das Museum zur Geschichte der Urologie in Düsseldorf. In diesem Jahr feiert die Deutsche Gesellschaft für Urologie e.V. (DGU) das zehnte Jahr des Sammlungsbestandes ihres in seiner Art bundesweit einzigartigen Museums und Archivs in Düsseldorf.
Ein Endoskop mit Gasbogenlampe von Antonin Jean Descormeaux, dem Vater der modernen Endoskopie, gehört mit zu den wertvollsten Exponaten des Museums. Gleiches gilt für ein großes Lithotripsieset von Jean Civiale. Der französische Chirurg hatte in den 1830er-Jahren den Lithotriptor erfunden, mit dem er erstmals erfolgreich Blasensteine entfernen konnte, ohne den Unterleib des Patienten operativ öffnen zu müssen. Von der männlichen Beschneidung, dem ältesten überlieferten chirurgischen Eingriff, über die Lehre von den Kardinalsäften und die Harnschau bis zur modernen klinischen Medizin wird das gesamte historische Spektrum der Urologie thematisiert. Die Sammlung des Museums besteht jedoch nicht nur aus rund 1500 Instrumenten, sondern sie umfasst auch mehr als 8500 Publikationen, eine Vielzahl an Original-Lithografien und Dokumenten, persönliche Gegenstände bekannter Urologen sowie Kuriosa des Faches.
„Die Geschichte der Urologie wird ganzheitlich als Ergebnis von Lebensweisen, Interessen und Erinnerungen von Menschen unterschiedlicher Herkunft, von Ärzten und Patienten, gesehen“, sagt Museumsleiter Dr. Friedrich Moll, für den das Spezialmuseum „Wissensspeicher, öffentliches Medium und Botschafter der deutschen Urologie“ zugleich ist. Die Sammlung zeichnet die Entwicklung des professionellen Selbstverständnisses der Urologen und auch die wechselvolle Geschichte der Urologie und der Deutschen Gesellschaft für Urologie nach.
Die Idee eines Urologie-Museums reicht weit zurück: Schon 1909 in Berlin, beim zweiten Kongress der 1906 gegründeten alten Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V., war die Einrichtung einer geschichtlichen Sammlung gefordert worden. Aber erst in den 1950er-Jahren wurde laut Moll in Dresden intensiver damit begonnen. Durch den Mauerbau 1961 sei sie aber verloren gegangen. Eine danach in Berlin begonnene neue Sammlung entging Ende der 1980er-Jahre knapp der Zerstörung durch Wasserschäden. Vom dritten Archivar der DGU-Geschichte, Professor Peter Rathert, zwischenzeitlich in Düren untergebracht und wesentlich erweitert, kamen die Bestände im Jahr 2000 nach Düsseldorf.
Das Museum ( http://museum.dgu.de ) ist in die DGU-Geschäftsstelle in der Uerdinger Straße 64 integriert und unterstreicht laut Moll durch die räumliche Einbindung, dass die Erfahrungen und wissenschaftlichen Ansätze anderer Epochen auch für aktuelle Fragestellungen von Bedeutung sind. Die Zahl der Besucher hat seit der Eröffnung stetig zugenommen, obwohl Besichtigungen und Führungen nur nach Vereinbarung (Telefon: 0211-5160960) möglich sind. Die historischen, „immer etwas gefährlich aussehenden Instrumente“ kommen nach Molls Beobachtung beim Publikum am besten an: Allein die Vorstellung ihrer Anwendung lässt die meisten Besucher erleichtert sein, in der urologischen Gegenwart zu leben.
Auch in diesem Jahr hat die historische Ausstellung des Urologie-Museums einen festen Platz auf der DGU-Jahrestagung: Dort steht dann die Andrologie als Grundlage der reproduktiven Gesundheit des Mannes im Blickpunkt.
Der 62. Kongress der DGU findet vom 22. bis 25. September 2010 im Congress Center Düsseldorf statt.
Journalisten können sich bereits jetzt für den 62. DGU-Kongress in Düsseldorf akkreditieren:
http://www.otseinladung.de/event/2b25081e7a
DGU/ BDU- Pressestelle:
Bettina-C. Wahlers
Sabine M. Glimm
Stremelkamp 17
21149 Hamburg
Tel.: 040 - 79 14 05 60
Mobil: 0170 - 48 27 28 7
E-Mail: info@wahlers-pr.de
Weitere Informationen:
http://www.dgu-kongress.de
http://www.urologenportal.de "
Quelle: http://idw-online.de/pages/de/news381639
Herzlichen Glückwunsch!
s. zum Urologie-Archiv auf Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/4085493/
http://archiv.twoday.net/stories/5830715/
Ein Endoskop mit Gasbogenlampe von Antonin Jean Descormeaux, dem Vater der modernen Endoskopie, gehört mit zu den wertvollsten Exponaten des Museums. Gleiches gilt für ein großes Lithotripsieset von Jean Civiale. Der französische Chirurg hatte in den 1830er-Jahren den Lithotriptor erfunden, mit dem er erstmals erfolgreich Blasensteine entfernen konnte, ohne den Unterleib des Patienten operativ öffnen zu müssen. Von der männlichen Beschneidung, dem ältesten überlieferten chirurgischen Eingriff, über die Lehre von den Kardinalsäften und die Harnschau bis zur modernen klinischen Medizin wird das gesamte historische Spektrum der Urologie thematisiert. Die Sammlung des Museums besteht jedoch nicht nur aus rund 1500 Instrumenten, sondern sie umfasst auch mehr als 8500 Publikationen, eine Vielzahl an Original-Lithografien und Dokumenten, persönliche Gegenstände bekannter Urologen sowie Kuriosa des Faches.
„Die Geschichte der Urologie wird ganzheitlich als Ergebnis von Lebensweisen, Interessen und Erinnerungen von Menschen unterschiedlicher Herkunft, von Ärzten und Patienten, gesehen“, sagt Museumsleiter Dr. Friedrich Moll, für den das Spezialmuseum „Wissensspeicher, öffentliches Medium und Botschafter der deutschen Urologie“ zugleich ist. Die Sammlung zeichnet die Entwicklung des professionellen Selbstverständnisses der Urologen und auch die wechselvolle Geschichte der Urologie und der Deutschen Gesellschaft für Urologie nach.
Die Idee eines Urologie-Museums reicht weit zurück: Schon 1909 in Berlin, beim zweiten Kongress der 1906 gegründeten alten Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V., war die Einrichtung einer geschichtlichen Sammlung gefordert worden. Aber erst in den 1950er-Jahren wurde laut Moll in Dresden intensiver damit begonnen. Durch den Mauerbau 1961 sei sie aber verloren gegangen. Eine danach in Berlin begonnene neue Sammlung entging Ende der 1980er-Jahre knapp der Zerstörung durch Wasserschäden. Vom dritten Archivar der DGU-Geschichte, Professor Peter Rathert, zwischenzeitlich in Düren untergebracht und wesentlich erweitert, kamen die Bestände im Jahr 2000 nach Düsseldorf.
Das Museum ( http://museum.dgu.de ) ist in die DGU-Geschäftsstelle in der Uerdinger Straße 64 integriert und unterstreicht laut Moll durch die räumliche Einbindung, dass die Erfahrungen und wissenschaftlichen Ansätze anderer Epochen auch für aktuelle Fragestellungen von Bedeutung sind. Die Zahl der Besucher hat seit der Eröffnung stetig zugenommen, obwohl Besichtigungen und Führungen nur nach Vereinbarung (Telefon: 0211-5160960) möglich sind. Die historischen, „immer etwas gefährlich aussehenden Instrumente“ kommen nach Molls Beobachtung beim Publikum am besten an: Allein die Vorstellung ihrer Anwendung lässt die meisten Besucher erleichtert sein, in der urologischen Gegenwart zu leben.
Auch in diesem Jahr hat die historische Ausstellung des Urologie-Museums einen festen Platz auf der DGU-Jahrestagung: Dort steht dann die Andrologie als Grundlage der reproduktiven Gesundheit des Mannes im Blickpunkt.
Der 62. Kongress der DGU findet vom 22. bis 25. September 2010 im Congress Center Düsseldorf statt.
Journalisten können sich bereits jetzt für den 62. DGU-Kongress in Düsseldorf akkreditieren:
http://www.otseinladung.de/event/2b25081e7a
DGU/ BDU- Pressestelle:
Bettina-C. Wahlers
Sabine M. Glimm
Stremelkamp 17
21149 Hamburg
Tel.: 040 - 79 14 05 60
Mobil: 0170 - 48 27 28 7
E-Mail: info@wahlers-pr.de
Weitere Informationen:
http://www.dgu-kongress.de
http://www.urologenportal.de "
Quelle: http://idw-online.de/pages/de/news381639
Herzlichen Glückwunsch!
s. zum Urologie-Archiv auf Archivalia:
http://archiv.twoday.net/stories/4085493/
http://archiv.twoday.net/stories/5830715/
Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. August 2010, 16:51 - Rubrik: Archive von unten
Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. August 2010, 16:49 - Rubrik: Medienarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Folgt man Klangschreibers Blog-Eintrag, dann muss es als eine neue Aufgabe für Archive gelten, die Klanglandschaften ihres Sprengels zu dokumentieren. Macht das schon jemand?
Link
Link
Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. August 2010, 16:45 - Rubrik: Musikarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 5. August 2010, 15:35 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"On the occasion of a workshop organized by the French Ministry of Culture, Jean-Wilfrid Bertrand visited today at the ICA Secretariat. A meeting was held in the presence of Gerard Ermisse and Pascal Even (Service interministériel des Archives de France), David Leitch, Christine Martinez and Christophe Jacobs (ICA Secretariat).
Jean-Wilfrid Bertrand told us about the projects of the National Archives of Haiti for years to come. Whether the National Records Management Programme, the construction of a new infrastructure for archives and the creation of a university degree on documentary engineering, the energy expended by the teams of archivists, including its leaders, is intense.
The "small steps' policy" advocated by the Director seems to be the right way to succeed, despite the earthquake. Projects will develop gradually and donors will be allowed to support these initiatives on the basis of clearly identifiable and documented projects.
Culture is part of the reconstruction phase, mentioned in the Post-Disaster Needs Assessment [PDNA] signed in New York last February. Heritage institutions have to deal with rescue operations including collections affected. For archives, there are dozens of public institutions that have been rescued by teams of volunteers. Christophe Jacobs, the responsible officer for the ICA Emergency Response Management Program, presented the report and the conclusions of the second Blue Shield International mission in Port-au-Prince last week (18th-23rd July).
The treatment center for the damaged documentary heritage will be opened soon. This structure will allow volunteers to find a suitable way to provide help in the treatment of these collections. Some are in containers, others still under the rubble, but in both cases, danger is clearly present and we should act as quickly as possible.
ICA reaffirmed to Jean Wilfrid Bertrand its full support, including Blue Shield's project and the possibility to develop a FIDA (Fund for International development of Archives) or a PCOM (Programme Commission) project in Haiti. Colleagues will have the pleasure to meet Jean-Wilfrid Bertrand and discover these projects at our CITRA conference, held next September in Oslo (Norway). "
Link: ICA, press room
Jean-Wilfrid Bertrand told us about the projects of the National Archives of Haiti for years to come. Whether the National Records Management Programme, the construction of a new infrastructure for archives and the creation of a university degree on documentary engineering, the energy expended by the teams of archivists, including its leaders, is intense.
The "small steps' policy" advocated by the Director seems to be the right way to succeed, despite the earthquake. Projects will develop gradually and donors will be allowed to support these initiatives on the basis of clearly identifiable and documented projects.
Culture is part of the reconstruction phase, mentioned in the Post-Disaster Needs Assessment [PDNA] signed in New York last February. Heritage institutions have to deal with rescue operations including collections affected. For archives, there are dozens of public institutions that have been rescued by teams of volunteers. Christophe Jacobs, the responsible officer for the ICA Emergency Response Management Program, presented the report and the conclusions of the second Blue Shield International mission in Port-au-Prince last week (18th-23rd July).
The treatment center for the damaged documentary heritage will be opened soon. This structure will allow volunteers to find a suitable way to provide help in the treatment of these collections. Some are in containers, others still under the rubble, but in both cases, danger is clearly present and we should act as quickly as possible.
ICA reaffirmed to Jean Wilfrid Bertrand its full support, including Blue Shield's project and the possibility to develop a FIDA (Fund for International development of Archives) or a PCOM (Programme Commission) project in Haiti. Colleagues will have the pleasure to meet Jean-Wilfrid Bertrand and discover these projects at our CITRA conference, held next September in Oslo (Norway). "
Link: ICA, press room
Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. August 2010, 15:09 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://infobib.de/blog/2010/08/05/gerausche-und-sounds-aller-art-zum-freien-download/
http://www.freesound.org/
Um einen Ton zu hören, muss man sich einloggen (oder habe ich etwas übersehen). Die CC-Sampling-Lizenz kann man nicht als "frei" bezeichnen: "You may not use this work to advertise for or promote anything but the work you create from it." Die kommerzielle Verwertbarkeit ist auch bei der Verbreitung eingeschränkt. Ein Webradio, das sich durch Werbung finanziert, kann die Geräusche ebensowenig verwenden wie die Wikipedia. Das ist nicht akzeptabel, wenn es um freie Inhalte geht.
An die Adresse des Archivalia-Contributors, der seine Bilder auf Flickr mit NC versieht:
http://archiv.twoday.net/stories/6353383/
http://www.freesound.org/
Um einen Ton zu hören, muss man sich einloggen (oder habe ich etwas übersehen). Die CC-Sampling-Lizenz kann man nicht als "frei" bezeichnen: "You may not use this work to advertise for or promote anything but the work you create from it." Die kommerzielle Verwertbarkeit ist auch bei der Verbreitung eingeschränkt. Ein Webradio, das sich durch Werbung finanziert, kann die Geräusche ebensowenig verwenden wie die Wikipedia. Das ist nicht akzeptabel, wenn es um freie Inhalte geht.
An die Adresse des Archivalia-Contributors, der seine Bilder auf Flickr mit NC versieht:
http://archiv.twoday.net/stories/6353383/
KlausGraf - am Donnerstag, 5. August 2010, 14:54 - Rubrik: Musikarchive
Die 2004 eingereichte Dissertation von Antje Foresta geb. Niederberger (bei Dieter Mertens) ist in überarbeiteter Form online in Freidok
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7674/
"Das vorliegende Buch hat sich zum Ziel gesetzt, mit Brants Geschichtswerk De origine et conversatione bonorum regum et laude civitatis Hierosolymae cum exhortatione eius recuperandae vertraut zu machen, es zugleich in einen literarischen und politischen Kontext zu stellen und ihm mit Methoden der Kulturgeschichte und Humanismusforschung näher zu kommen." (S. 258) Wichtig ist die Arbeit für die Erforschung des Diskurses über die türkische Bedrohung Europas.
Dieses Geschichtswerk bequem zugänglich als Digitalisat (das Exemplar Hartmann Schedels mit handschriftlichen Zusätzen)
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00026708/image_1
Deutsche Übersetzung von Kaspar Frey:
http://aleph500.huji.ac.il/nnl/dig/books/bk001374063.html

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7674/
"Das vorliegende Buch hat sich zum Ziel gesetzt, mit Brants Geschichtswerk De origine et conversatione bonorum regum et laude civitatis Hierosolymae cum exhortatione eius recuperandae vertraut zu machen, es zugleich in einen literarischen und politischen Kontext zu stellen und ihm mit Methoden der Kulturgeschichte und Humanismusforschung näher zu kommen." (S. 258) Wichtig ist die Arbeit für die Erforschung des Diskurses über die türkische Bedrohung Europas.
Dieses Geschichtswerk bequem zugänglich als Digitalisat (das Exemplar Hartmann Schedels mit handschriftlichen Zusätzen)
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00026708/image_1
Deutsche Übersetzung von Kaspar Frey:
http://aleph500.huji.ac.il/nnl/dig/books/bk001374063.html
KlausGraf - am Donnerstag, 5. August 2010, 14:03 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Nutzen Sie breite Gestaltungsräume und verwalten Sie selbstständig einen Bereich unseres Dokumentenarchivs.
Unser Zentrales Kaufmännisches Archiv ist bei Ihnen in den besten Händen. Denn lückenlos übernehmen und erfassen Sie in Ihrer Rolle archivierungspflichtige Dokumente, bereiten sämtliche Dokumente zur Einlagerung auf, kontrollieren Aufbewahrungsfristen und nehmen auch die Archivierung selbst in die Hand. Dass Sie dabei ab und an auch schwerere Lasten tragen und per Dienst-Pkw transportieren, betrachten Sie als Teil Ihres sehr eigenständigen Aufgabenfelds. Selbstverständlich verantworten Sie die Zutrittskontrolle, überwachen die technischen Einrichtungen und sorgen dafür, dass das Zentralarchiv jeder Prüfung standhält.
Wir setzen unser volles Vertrauen in Sie, wenn Sie als ausgebildeter Wissenschaftlicher Dokumentar/Archivar über gute Kenntnisse in der Dokumentenverwaltung verfügen und bereits mit Datenbanken/Dokumentenmanagementsystemen gearbeitet haben. Der Umgang mit den MS-Office-Programmen ist Ihnen vertraut und Sie beherrschen die englische Sprache in Wort und Schrift mindestens gut.
Sie sehen: eine vielfältige und spannende Herausforderung, eingebunden in ein Umfeld, das Sie motiviert, fördert und weiterbringt. Sie suchen genau das?
Dann schicken Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, des frühestmöglichen Eintrittstermins und der Kennziffer 16006 gleich an:
Merz Group Services GmbH
Ursula Albrecht
Ludwigstraße 22
64354 Reinheim
Telefon: 06162 8009-748
E-Mail: recruiting@merz.de"
Link zur Online Bewerbung
Unser Zentrales Kaufmännisches Archiv ist bei Ihnen in den besten Händen. Denn lückenlos übernehmen und erfassen Sie in Ihrer Rolle archivierungspflichtige Dokumente, bereiten sämtliche Dokumente zur Einlagerung auf, kontrollieren Aufbewahrungsfristen und nehmen auch die Archivierung selbst in die Hand. Dass Sie dabei ab und an auch schwerere Lasten tragen und per Dienst-Pkw transportieren, betrachten Sie als Teil Ihres sehr eigenständigen Aufgabenfelds. Selbstverständlich verantworten Sie die Zutrittskontrolle, überwachen die technischen Einrichtungen und sorgen dafür, dass das Zentralarchiv jeder Prüfung standhält.
Wir setzen unser volles Vertrauen in Sie, wenn Sie als ausgebildeter Wissenschaftlicher Dokumentar/Archivar über gute Kenntnisse in der Dokumentenverwaltung verfügen und bereits mit Datenbanken/Dokumentenmanagementsystemen gearbeitet haben. Der Umgang mit den MS-Office-Programmen ist Ihnen vertraut und Sie beherrschen die englische Sprache in Wort und Schrift mindestens gut.
Sie sehen: eine vielfältige und spannende Herausforderung, eingebunden in ein Umfeld, das Sie motiviert, fördert und weiterbringt. Sie suchen genau das?
Dann schicken Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, des frühestmöglichen Eintrittstermins und der Kennziffer 16006 gleich an:
Merz Group Services GmbH
Ursula Albrecht
Ludwigstraße 22
64354 Reinheim
Telefon: 06162 8009-748
E-Mail: recruiting@merz.de"
Link zur Online Bewerbung
Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. August 2010, 07:30 - Rubrik: Personalia
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://cms.flu.cas.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=1113
28. 7. 2010:
Knihy počtů města Brna z let 1343-1365 (ed. Mendl); Die altčechische Katharinenlegende (ed. Spina); Die Metzer Chronik des Jacques D´Esch über die Kaiser und Könige aus dem Luxemburger Hause (ed. Wolfram); Der Bau der Stadtkirche in Brüx von 1517 bis 1532 (MVGDB 30) von Joseph Neuwirth; Der Neubau der Brüxer Pfarrkirche 1517-1532 (MVGDB 30) von Ludwig Schlesinger
28. 6. 2010:
Ukazatel jmen k latinským zemským deskám brněnským a olomouckým (F. Černý); M. Šimona Plachého z Třebnice Prameny Plzeňské (ed. Strnad); Deutsche Reichstagsakten 11 Sigmund (1433-1435) ed. Beckmann; Ein Formelbuch aus dem XIV. Jahrhunderte (MVGDB 29) von W. Katzerowsky; Zwei Formelbücher des XIV. Jahrhunderts aus Böhmen (MVGDB 27) von Ludwig Schlesinger
28. 5. 2010:
Scriptores rerum lusaticarum 1; Scriptores rerum lusaticarum 2; Scriptores rerum lusaticarum 3; Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte der Stadt Prag im Mittelalter I-II (MVGDB 44) von Franz Pick
28. 7. 2010:
Knihy počtů města Brna z let 1343-1365 (ed. Mendl); Die altčechische Katharinenlegende (ed. Spina); Die Metzer Chronik des Jacques D´Esch über die Kaiser und Könige aus dem Luxemburger Hause (ed. Wolfram); Der Bau der Stadtkirche in Brüx von 1517 bis 1532 (MVGDB 30) von Joseph Neuwirth; Der Neubau der Brüxer Pfarrkirche 1517-1532 (MVGDB 30) von Ludwig Schlesinger
28. 6. 2010:
Ukazatel jmen k latinským zemským deskám brněnským a olomouckým (F. Černý); M. Šimona Plachého z Třebnice Prameny Plzeňské (ed. Strnad); Deutsche Reichstagsakten 11 Sigmund (1433-1435) ed. Beckmann; Ein Formelbuch aus dem XIV. Jahrhunderte (MVGDB 29) von W. Katzerowsky; Zwei Formelbücher des XIV. Jahrhunderts aus Böhmen (MVGDB 27) von Ludwig Schlesinger
28. 5. 2010:
Scriptores rerum lusaticarum 1; Scriptores rerum lusaticarum 2; Scriptores rerum lusaticarum 3; Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte der Stadt Prag im Mittelalter I-II (MVGDB 44) von Franz Pick
KlausGraf - am Donnerstag, 5. August 2010, 06:01 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bislang vor allem Regionalia aus dem Altbestand
http://s2w.hbz-nrw.de/llb/
RSS-Feed:
http://s2w.hbz-nrw.de/llb/rss
http://s2w.hbz-nrw.de/llb/
RSS-Feed:
http://s2w.hbz-nrw.de/llb/rss
KlausGraf - am Donnerstag, 5. August 2010, 05:55 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://finds.org.uk/
"The Portable Antiquities Scheme is a voluntary scheme to record archaeological objects found by members of the public in England and Wales." Die Datenbank umfasst inzwischen 400.000 Einträge.

"The Portable Antiquities Scheme is a voluntary scheme to record archaeological objects found by members of the public in England and Wales." Die Datenbank umfasst inzwischen 400.000 Einträge.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Neuerscheinung der MGH http://www.mgh.de/home/aktuelles/newsdetails/rudolf-pokorny-augiensia/2395d6b69d/
KlausGraf - am Donnerstag, 5. August 2010, 04:07 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 5. August 2010, 03:32 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://biblionik.de/2010/08/04/sacherschliessung-mit-wikipedia-spielidee
Die müsste man nur vom Kopf auf die Füße stellen, also einen Open-Data-Server mit Nachweisen zu freien Volltexten (auch retrodigitalisierter Literatur) aufsetzen, dessen Inhalte bei passenden Wikipedia-Artikeln eingebunden werden können und von dem aus diese Einbindungen wiederum angezeigt werden.
BASE und Google Scholar erfassen nur einen Teil der im Netz vorhandenen kostenfrei einsehbaren Fachliteratur. Es wäre an der Zeit, einen Gesamtnachweis als freies Projekt aufzusetzen.
Die müsste man nur vom Kopf auf die Füße stellen, also einen Open-Data-Server mit Nachweisen zu freien Volltexten (auch retrodigitalisierter Literatur) aufsetzen, dessen Inhalte bei passenden Wikipedia-Artikeln eingebunden werden können und von dem aus diese Einbindungen wiederum angezeigt werden.
BASE und Google Scholar erfassen nur einen Teil der im Netz vorhandenen kostenfrei einsehbaren Fachliteratur. Es wäre an der Zeit, einen Gesamtnachweis als freies Projekt aufzusetzen.
KlausGraf - am Donnerstag, 5. August 2010, 03:19 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Donnerstag, 5. August 2010, 03:06 - Rubrik: Universitaetsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nachweise bietet:
http://www.rambow.de/ahnenlisten-buergerlicher-familien.html
Gut wäre es, wenn diese Liste ergänzt werden könnte durch die bei http://www.lib.byu.edu/fhc/index.php digitalisierten deutschsprachigen Bücher.
Bei GenWiki dürfte derzeit nur einschlägig sein:
http://wiki-de.genealogy.net/Chronik_der_Schotten-Crainfelder_Familie_Spamer
http://www.rambow.de/ahnenlisten-buergerlicher-familien.html
Gut wäre es, wenn diese Liste ergänzt werden könnte durch die bei http://www.lib.byu.edu/fhc/index.php digitalisierten deutschsprachigen Bücher.
Bei GenWiki dürfte derzeit nur einschlägig sein:
http://wiki-de.genealogy.net/Chronik_der_Schotten-Crainfelder_Familie_Spamer
KlausGraf - am Donnerstag, 5. August 2010, 02:58 - Rubrik: Genealogie
und will seine 29.000 mit Hilfe von Microsoft digitalisierten Bücher einbringen.
http://www.resourceshelf.com/2010/08/03/yale-university-joins-hathitrust-and-some-current-hathitrust-statsvisualizations/
http://www.resourceshelf.com/2010/08/03/yale-university-joins-hathitrust-and-some-current-hathitrust-statsvisualizations/
KlausGraf - am Donnerstag, 5. August 2010, 02:47 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.dilibri.de/rlb/content/structure/296109
1000 Jahre St. Stephan in Mainz : Festschrift / hrsg. von Helmut Hinkel Mainz : Verl. der Ges. für Mittelrheinische Kirchengeschichte, 1990
Werner Goez: Leben und Werk des heiligen Willigis
PDF
33Franz Staab: Eine Metzer Miniatur des heiligen Willigis aus dem 12. Jahrhundert
PDF
47Isnard W. Frank: Sancta Sedes Maguntina. Willigis und der "Heilige Stuhl von Mainz"
PDF
59Franz Staab: Reich und Mittelrhein um 1000
PDF
101Gerhard Ludwig Müller: Die Situation der Theologie in der Zeit des Erzbischofs Willigis
PDF
113Georg May: Die Kanonistik um das Jahr 1000
PDF
159II. Das Stift St. Stephan
PDF
163Franz Staab: Die Verehrung des heiligen Stephan
PDF
187Michael Hollmann: Beiträge zur Geschichte des Stifts St. Stephan in Mainz
PDF
239Ludwig Falk: Die "Muntat", der städtische Immunitätsbezirk des Stephansstiftes
PDF
283Anna Egler: Willigis und die Stifte in Stadt und Erzbistum Mainz
PDF
309Peter Walter: Das Stephansstift und der Humanismus: Dietrich Gresemund der Jüngere
PDF
323Friedhelm Jürgensmeier: Informativprozeß des Mainzer Weihbischofs Christoph Nebel (1733-1769)
PDF
333Franz Dumont: Karl Kolborn: Erneuern und bewahren
PDF
373III. Die Pfarrei St. Stephan
PDF
377Anton Ph. Brück: Zur Geschichte der Pfarrei St. Stephan in Mainz
PDF
389Klaus Mayer: Aus Ruinen erstanden. St. Stephan in Mainz 1945-1989
PDF
403IV. Bau und Ausstattung der St. Stephanskirche
PDF
407Ernst Coester: Die Baugeschichte und künstlerische Stellung der St. Stephanskirche
PDF
455Joachim Glatz: Die Ausstattung der Stephanskirche
PDF
481Klaus Mayer: Die Kirchenfenster von Marc Chagall zu St. Stephan in Mainz
PDF
489Franz Josef Hassel: Römische Münzen auf einer Glocke der St. Stephankirche
PDF
493Johann Michael Fritz und Joachim Glatz: Liturgica aus dem Schatz von St. Stephan
PDF
513Sigrid Duchhardt-Bösken: Die Vasa sacra der St. Stephanskirche aus dem 17. - 19. Jahrhundert
PDF
533Wilhelm Jung: Die Willigis-Kasel aus St. Stephan in Mainz
PDF
547Mechthild Reinelt: Gewebefragmente aus St. Stephan
PDF
549Eva Zimmermann: Die spätgotischen Reliefstickereien auf einem Ornat aus St. Stephan
PDF
561Mechthild Reinelt: Der Chormantel des Bischofs Joseph Ludwig Colmar
PDF
565Die Autoren/ Nachweis der Abbildungen
PDF
567
1000 Jahre St. Stephan in Mainz : Festschrift / hrsg. von Helmut Hinkel Mainz : Verl. der Ges. für Mittelrheinische Kirchengeschichte, 1990
Werner Goez: Leben und Werk des heiligen Willigis
33Franz Staab: Eine Metzer Miniatur des heiligen Willigis aus dem 12. Jahrhundert
47Isnard W. Frank: Sancta Sedes Maguntina. Willigis und der "Heilige Stuhl von Mainz"
59Franz Staab: Reich und Mittelrhein um 1000
101Gerhard Ludwig Müller: Die Situation der Theologie in der Zeit des Erzbischofs Willigis
113Georg May: Die Kanonistik um das Jahr 1000
159II. Das Stift St. Stephan
163Franz Staab: Die Verehrung des heiligen Stephan
187Michael Hollmann: Beiträge zur Geschichte des Stifts St. Stephan in Mainz
239Ludwig Falk: Die "Muntat", der städtische Immunitätsbezirk des Stephansstiftes
283Anna Egler: Willigis und die Stifte in Stadt und Erzbistum Mainz
309Peter Walter: Das Stephansstift und der Humanismus: Dietrich Gresemund der Jüngere
323Friedhelm Jürgensmeier: Informativprozeß des Mainzer Weihbischofs Christoph Nebel (1733-1769)
333Franz Dumont: Karl Kolborn: Erneuern und bewahren
373III. Die Pfarrei St. Stephan
377Anton Ph. Brück: Zur Geschichte der Pfarrei St. Stephan in Mainz
389Klaus Mayer: Aus Ruinen erstanden. St. Stephan in Mainz 1945-1989
403IV. Bau und Ausstattung der St. Stephanskirche
407Ernst Coester: Die Baugeschichte und künstlerische Stellung der St. Stephanskirche
455Joachim Glatz: Die Ausstattung der Stephanskirche
481Klaus Mayer: Die Kirchenfenster von Marc Chagall zu St. Stephan in Mainz
489Franz Josef Hassel: Römische Münzen auf einer Glocke der St. Stephankirche
493Johann Michael Fritz und Joachim Glatz: Liturgica aus dem Schatz von St. Stephan
513Sigrid Duchhardt-Bösken: Die Vasa sacra der St. Stephanskirche aus dem 17. - 19. Jahrhundert
533Wilhelm Jung: Die Willigis-Kasel aus St. Stephan in Mainz
547Mechthild Reinelt: Gewebefragmente aus St. Stephan
549Eva Zimmermann: Die spätgotischen Reliefstickereien auf einem Ornat aus St. Stephan
561Mechthild Reinelt: Der Chormantel des Bischofs Joseph Ludwig Colmar
565Die Autoren/ Nachweis der Abbildungen
567
KlausGraf - am Donnerstag, 5. August 2010, 02:38 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 4. August 2010, 22:56 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 4. August 2010, 22:53 - Rubrik: Webarchivierung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 Quelle: Bundesarchiv
Quelle: Bundesarchiv"Im Rahmen eines Workshops werden in der Berliner Dienststelle des Bundesarchivs am 6. August 2010 das Haftstättenverzeichnis der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" und weitere Module des Informationsportals zur Zwangsarbeit im NS-Staat präsentiert.
Das Internetportal "Zwangsarbeit im NS-Staat" bietet unter www.zwangsarbeit.eu umfassende Informationen zur Geschichte der NS-Zwangsarbeit. Ab August 2010 wird als ein neues Modul das Haftstättenverzeichnis der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft in das Portal integriert. Das Haftstättenverzeichnis entstand im Zusammenhang mit den Auszahlungen an ehemalige Zwangsarbeiter/innen: NS-Opfer, die in einem Konzentrationslager Zwangsarbeit leisten mussten, erhielten laut Stiftungsgesetz eine höhere Leistung (Kategorie A) als Zwangsarbeiter, die nicht in ein Konzentrationslager verschleppt worden waren. Es gab jedoch auch viele Orte, die zwar formal nicht als Konzentrationslager galten, in denen aber vergleichbare Bedingungen herrschten. Nach dem Stiftungsgesetz konnten deshalb weitere Haftorte den Konzentrationslagern gleichgestellt und als „andere Haftstätten“ anerkannt werden.
Das datenbankgestützte Internetverzeichnis enthält Informationen zu mehr als 3.800 Lagern und Haftstätten, deren Nutzungsdauer als Haftorte für Zwangsarbeiter/innen und geografische Lage sowie Literatur- und Quellenangaben.
Tagungsstätte ist der Konferenzraum über dem Casino, gleich am Haupteingang des Bundesarchivs in 12205 Berlin-Lichterfelde, Finckensteinallee 63. Bitte melden Sie sich bei der Wache an. Eine Teilnehmerliste wird dort vorliegen.
Öffentliche Verkehrsverbindungen finden Sie unter http://www.s-bahn-berlin.de (auch in english); der Bus 184 hält direkt vor dem Bundesarchiv, Haltestelle „Bundesarchiv“. Für Anreisende mit dem PKW stehen genügend Parkplätze zur Verfügung.
Ablaufplan
Freitag, 6. August 2010
10.00 – 11.00 Empfang, Formalitäten
11.00 – 11.15 Herr Dr. H.-D. Kreikamp (Bundesarchiv), Begrüßung
11.15 – 11.30 Herr Günter Saathoff (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft), Grußwort
11.30 – 13.00 Frau Dr. Sylvia Rogge-Gau (Bundesarchiv), Das Haftstättenverzeichnis der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und das Informationsportal Zwangsarbeit im NS-Staat
13.00 – 14.00 Mittagessen in der Kantine des Bundesarchivs
14.00 – 15.00 Diskussion
15.00 – 16.00 Führung für interessierte Gäste über das Gelände des Bundesarchivs
Anmeldung:
Dr. Sylvia Rogge-Gau, Tel.: 0(049)30/187770-455, E-Mail: s.rogge-gau@bundesarchiv.de."
Quelle: Bundesarchiv, Pressemitteilung
Wolf Thomas - am Mittwoch, 4. August 2010, 22:10 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Delegation beim Rundgang über das Gelände des Bundesarchivs vor dem Gebäude des Ernst-Posner-Baus. Quelle: Bundesarchiv
"Eine vom Vizeminister des Innern der SR Vietnam geleitete 15-köpfige Delegation, der leitende Mitarbeiter des Justiz- und des Innenministeriums, der Staatlichen Schriftgut- und Archivverwaltung sowie nachgeordneter Einrichtungen angehörten, weilte vom 19. - 20. Juli 2010 im Bundesarchiv.
Prof. Dr. Hartmut Weber hieß die Delegation am 19. Juli herzlich in Berlin-Lichterfelde willkommen und stellte ihnen das Bundesarchiv, seine Zuständigkeit, Organisationsstruktur und Bestände vor. Angesichts des in Vorbereitung befindlichen vietnamesischen Archivgesetzes und mehrerer Archivbauprojekte interessierten sich die Gäste besonders für die diesbezüglichen deutschen Erfahrungen. Viele Nachfragen gab es aber auch zum strukturellen Aufbau des Bundesarchivs und zu seiner finanziellen Ausstattung. Nach einer Vorstellung der Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR durch Dr. Henning Pahl und einer kurzen Einführung in die Online-Findmittel des Bundesarchivs zeigten sich die Delegationsmitglieder hoch erfreut, dass in den DDR- und SAPMO-Beständen auch eine Reihe von Originalschriftstücken aus der Feder von Ho Chi Minh und Pham van Dong überliefert sind. Beim anschließenden Rundgang über die Liegenschaft informierten sich die Gäste bei Dr. Sebastian Barteleit ausgiebig über den Ernst-Posner-Bau und besichtigten die Schutzverfilmung, die Restaurierungswerkstatt und die beiden Lesesäle.
Am 20. Juli 2010 stand Hoppegarten auf dem Besuchsprogramm. Nach einem Rundgang im Archivcenter Hoppegarten mit Besichtigung der dortigen Massenkonservierung von Archivgut.
....."
Quelle: Bundesarchiv, Pressemitteilung
Wolf Thomas - am Mittwoch, 4. August 2010, 22:06 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Why Play History?
There are tons of free historical games, interactives and simulations on the web. Playing history aggregates info on these resources in a simple, searchable database making it easy to find, rate, and review historical games. There are currently 126 shared games.
Search for Games
Use the search box that appears in the upper right corner any playing history page to search through the directory of games.
Rate And Review Games
Rate And Review Games
The most valuable part of Playing History is community member reviews. Create an account and login to make contributions to the community. "
Link: http://playinghistory.org/
There are tons of free historical games, interactives and simulations on the web. Playing history aggregates info on these resources in a simple, searchable database making it easy to find, rate, and review historical games. There are currently 126 shared games.
Search for Games
Use the search box that appears in the upper right corner any playing history page to search through the directory of games.
Rate And Review Games
Rate And Review Games
The most valuable part of Playing History is community member reviews. Create an account and login to make contributions to the community. "
Link: http://playinghistory.org/
Wolf Thomas - am Mittwoch, 4. August 2010, 22:02 - Rubrik: Archivpaedagogik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Mittwoch, 4. August 2010, 21:58 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Tagungsprogramm 2010
Das Tagungsprogramm für 2010 ist derzeit im Entstehen und kann sich bis zur Tagung noch ändern.
Mittwoch, der 22. Sept 2010
14.00 Die Ordnung der Dinge. Inventarisation und Objektphotographie im Museum
Den Überblick zu bewahren ist bei der Verwaltung einer Museumssammlung eine der zentralen Aufgaben. Um sie zu erfüllen gilt es, alle Objekte zu erfassen. Ein Workshop soll Einblick geben, wie Objekte mit Hilfe einer Datenbank erfaßt und digital photographiert werden.
Der Themenblock enthält folgende Beiträge:
15.00 Ulrich Gloede, CD-Lab, Victor Pröstler, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern: Vorstellung der browserbasierten Software VINO und MuseumPlus
Ulrich Gloede | Viktor Pröstler
Markus Hundemer, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern: Digitale Objektphotographie
Markus Hundemer
Praktische Übung
17.30 Abendessen
18.30 Round-Table-Gespräch:
EDV-Einsatz in Museum und Archiv (Dr. Bernhard Grau, Clemens Menter, Dr. Viktor Pröstler, Michael Ritz)
Bernhard Grau | Clemens Menter | Viktor Pröstler | Michael Ritz
Donnerstag, der 23. Sept 2010
09.30 Begrüßung und Eröffnung
09.45 Axel Ermert, Institut für Museumsforschung: museumdat und museumvok: Austauschformat und Schnittstelle zu einem internetbasierten Thesaurus
10.30 Pause
10.45 Joachim Kemper, Staatsarchiv München: Erschließungsrichtlinien an Archiven im Vergleich
Joachim Kemper
11.30 Robert Kirchmaier, Bayerische Staatsgemäldesammlung: Urheberrecht bei Bildaufnahmen
12.15 Mittagspause
Kurzbeiträge
14.00 Adlib
14.30 AUGIAS
15.00 digiCULT
15.30 Imdas pro
16.00 Pause
16.30 FAUST
17.00 Robotron Daphne
17.30 HiDa
18.00 MuseumPlus
19.00 Abendessen
Freitag, der 24. Sept 2010
09.00 Susanne Klemm, Fränkisches Museum: Erfahrungsbericht über die Digitalisierung von Inventarblättern
09.30 Elisabeth Stürmer und Bernhard Wörrle, Münchner Stadtmuseum: Einführung von Daphne am Münchner Stadtmuseum
10.00 Wolfgang Jahn, Haus der Bayerischen Geschichte: Das Bildarchiv des HdBG - Alte Bilder auf neuen Wegen
10.30 Pause
10.45 Ulrich Gloede, CD-Lab: Das Bildarchiv der Landesstelle unter VINO – eine Intranetlösung
11.15 Markus Hundemer und Marion-Isabell Hoffmann, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Ed Gartner, CD-Lab: Die digitale Erschließung der photographischen Vorbildersammlung des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege
11.45 Schlußdiskussion
12.00 Ende der Veranstaltung: Zusammenfassung und Schlußwort"
Link
Das Tagungsprogramm für 2010 ist derzeit im Entstehen und kann sich bis zur Tagung noch ändern.
Mittwoch, der 22. Sept 2010
14.00 Die Ordnung der Dinge. Inventarisation und Objektphotographie im Museum
Den Überblick zu bewahren ist bei der Verwaltung einer Museumssammlung eine der zentralen Aufgaben. Um sie zu erfüllen gilt es, alle Objekte zu erfassen. Ein Workshop soll Einblick geben, wie Objekte mit Hilfe einer Datenbank erfaßt und digital photographiert werden.
Der Themenblock enthält folgende Beiträge:
15.00 Ulrich Gloede, CD-Lab, Victor Pröstler, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern: Vorstellung der browserbasierten Software VINO und MuseumPlus
Ulrich Gloede | Viktor Pröstler
Markus Hundemer, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern: Digitale Objektphotographie
Markus Hundemer
Praktische Übung
17.30 Abendessen
18.30 Round-Table-Gespräch:
EDV-Einsatz in Museum und Archiv (Dr. Bernhard Grau, Clemens Menter, Dr. Viktor Pröstler, Michael Ritz)
Bernhard Grau | Clemens Menter | Viktor Pröstler | Michael Ritz
Donnerstag, der 23. Sept 2010
09.30 Begrüßung und Eröffnung
09.45 Axel Ermert, Institut für Museumsforschung: museumdat und museumvok: Austauschformat und Schnittstelle zu einem internetbasierten Thesaurus
10.30 Pause
10.45 Joachim Kemper, Staatsarchiv München: Erschließungsrichtlinien an Archiven im Vergleich
Joachim Kemper
11.30 Robert Kirchmaier, Bayerische Staatsgemäldesammlung: Urheberrecht bei Bildaufnahmen
12.15 Mittagspause
Kurzbeiträge
14.00 Adlib
14.30 AUGIAS
15.00 digiCULT
15.30 Imdas pro
16.00 Pause
16.30 FAUST
17.00 Robotron Daphne
17.30 HiDa
18.00 MuseumPlus
19.00 Abendessen
Freitag, der 24. Sept 2010
09.00 Susanne Klemm, Fränkisches Museum: Erfahrungsbericht über die Digitalisierung von Inventarblättern
09.30 Elisabeth Stürmer und Bernhard Wörrle, Münchner Stadtmuseum: Einführung von Daphne am Münchner Stadtmuseum
10.00 Wolfgang Jahn, Haus der Bayerischen Geschichte: Das Bildarchiv des HdBG - Alte Bilder auf neuen Wegen
10.30 Pause
10.45 Ulrich Gloede, CD-Lab: Das Bildarchiv der Landesstelle unter VINO – eine Intranetlösung
11.15 Markus Hundemer und Marion-Isabell Hoffmann, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Ed Gartner, CD-Lab: Die digitale Erschließung der photographischen Vorbildersammlung des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege
11.45 Schlußdiskussion
12.00 Ende der Veranstaltung: Zusammenfassung und Schlußwort"
Link
Wolf Thomas - am Mittwoch, 4. August 2010, 21:55 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Das Gedächtnis unserer Stadt
Unbestritten ist, dass es für die Identifikation des eigenenStandpunktes und für die Bestimmung von Zielen ungemein wichtig istzu wissen, wo man eigentlich herkommt. Das gilt für jeden Einzelnen,aber das gilt auch für die Gemeinschaft.
In Krefeld engagieren sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in Vereinen und Projekten, die sich mit der Erforschung, Aufbereitung und Darstellung unserer Stadtgeschichte und den vielen kleinen und großen Geschichten aus der Stadt Krefeld beschäftigen. Dieses Engagement ist wichtig und ich freue mich jedes mal, wenn ich die Gelegenheit habe, solche Menschen und ihre Veranstaltungen zu besuchen.
Dieses bürgerschaftliche Engagement entbindet uns aber nicht davon, öffentlich und wissenschaftlich unsere Geschichte zu dokumentieren und Zugänglich zu machen. Dieses Aufgabe übernimmt unser Stadtarchiv. In der vergangenen Woche hatte ich das Vergnügen den Leiter, Herrn Dr. Richter, zu besuchen und mit von ihm die Arbeit des Archivs erklären zu lassen. Dieser Besuch hat meine Auffassung von der Bedeutung des Vergangenen für Gegenwart und Zukunft nochmal gestärkt. Einen besonderen Stellenwert hat in diesem Zusammenhang für mich die Zeit des Nationalsozialismus. Die NS-Dokumentationsstätte leistet eine besonders wertvolle Arbeit. Die Chance jungen Menschen die Schrecken des Naziterrors so greifbar und gut dokumentiert nahe zu bringen ist für unsere Demokratie besonders wichtig. Im Übrigen bin ich davon überzeugt, dass es auch unsere Verantwortung gegenüber den Opfern ist, sie als Menschen sichtbar zu machen, im Gegensatz zu den Tätern von damals.
Daneben ist es unverzichtbar, dass Schülerinnen und Schüler, oder auch andere Interessierte die Möglichkeit haben, selber zu Stadtgeschichte zu forschen. So lernt man seine Stadt besonders gut kennen. Ich finde es besonders wichtig, dass die Menschen sich mit Krefeld identifizieren, es zu unserer gemeinsamen Stadt machen. Diese Identifikation lässt sich aber nicht verordnen, sie muss durch Angebote ermöglicht werden. Die Recherchemöglichkeiten im Archiv gehören dazu. Genauso wie die Beteiligung an Projekten, wie bspw. der Erstellung eines regionalen Künstlerverzeichnisses durch den Verein „Kunst und Krefeld“, wo das Archiv hilft oder auch die Archivierung privater Hinterlassenschaften von Menschen des öffentlichen Lebens unserer Stadt.
Ich bin froh, diesen Besuch gemacht zu haben und habe wieder viel über meine Stadt gelernt. Abschließend kann ich allen Krefelderinnen und Krefeldern nur raten, auch mal das Archiv zu besuchen und Neues an und in Krefeld zu entdecken."
Frank Meyer, Bürgermeister der Stadt Krefeld, 15.07.2010
Link
Unbestritten ist, dass es für die Identifikation des eigenenStandpunktes und für die Bestimmung von Zielen ungemein wichtig istzu wissen, wo man eigentlich herkommt. Das gilt für jeden Einzelnen,aber das gilt auch für die Gemeinschaft.
In Krefeld engagieren sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in Vereinen und Projekten, die sich mit der Erforschung, Aufbereitung und Darstellung unserer Stadtgeschichte und den vielen kleinen und großen Geschichten aus der Stadt Krefeld beschäftigen. Dieses Engagement ist wichtig und ich freue mich jedes mal, wenn ich die Gelegenheit habe, solche Menschen und ihre Veranstaltungen zu besuchen.
Dieses bürgerschaftliche Engagement entbindet uns aber nicht davon, öffentlich und wissenschaftlich unsere Geschichte zu dokumentieren und Zugänglich zu machen. Dieses Aufgabe übernimmt unser Stadtarchiv. In der vergangenen Woche hatte ich das Vergnügen den Leiter, Herrn Dr. Richter, zu besuchen und mit von ihm die Arbeit des Archivs erklären zu lassen. Dieser Besuch hat meine Auffassung von der Bedeutung des Vergangenen für Gegenwart und Zukunft nochmal gestärkt. Einen besonderen Stellenwert hat in diesem Zusammenhang für mich die Zeit des Nationalsozialismus. Die NS-Dokumentationsstätte leistet eine besonders wertvolle Arbeit. Die Chance jungen Menschen die Schrecken des Naziterrors so greifbar und gut dokumentiert nahe zu bringen ist für unsere Demokratie besonders wichtig. Im Übrigen bin ich davon überzeugt, dass es auch unsere Verantwortung gegenüber den Opfern ist, sie als Menschen sichtbar zu machen, im Gegensatz zu den Tätern von damals.
Daneben ist es unverzichtbar, dass Schülerinnen und Schüler, oder auch andere Interessierte die Möglichkeit haben, selber zu Stadtgeschichte zu forschen. So lernt man seine Stadt besonders gut kennen. Ich finde es besonders wichtig, dass die Menschen sich mit Krefeld identifizieren, es zu unserer gemeinsamen Stadt machen. Diese Identifikation lässt sich aber nicht verordnen, sie muss durch Angebote ermöglicht werden. Die Recherchemöglichkeiten im Archiv gehören dazu. Genauso wie die Beteiligung an Projekten, wie bspw. der Erstellung eines regionalen Künstlerverzeichnisses durch den Verein „Kunst und Krefeld“, wo das Archiv hilft oder auch die Archivierung privater Hinterlassenschaften von Menschen des öffentlichen Lebens unserer Stadt.
Ich bin froh, diesen Besuch gemacht zu haben und habe wieder viel über meine Stadt gelernt. Abschließend kann ich allen Krefelderinnen und Krefeldern nur raten, auch mal das Archiv zu besuchen und Neues an und in Krefeld zu entdecken."
Frank Meyer, Bürgermeister der Stadt Krefeld, 15.07.2010
Link
Wolf Thomas - am Mittwoch, 4. August 2010, 21:50 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"The Social Networks and Archival Context Project (SNAC) will address the ongoing challenge of transforming description of and improving access to primary humanities resources through the use of advanced technologies. The project will test the feasibility of using existing archival descriptions in new ways, in order to enhance access and understanding of cultural resources in archives, libraries, and museums.
Archivists have a long history of describing the people who—acting individually, in families, or in formally organized groups—create and collect primary sources. They research and describe the people who create and are represented in the materials comprising our shared cultural legacy. However, because archivists have traditionally described records and their creators together, this information is tied to specific resources and institutions. Currently there is no system in place that aggregates and interrelates those descriptions.
Leveraging the new standard Encoded Archival Context-Corporate Bodies, Persons, and Families (EAC-CPF), the SNAC Project will use digital technology to “unlock” descriptions of people from finding aids and link them together in exciting new ways. We will:
* Create efficient open-source tools that allow archivists to separate the process of describing people from that of records.
* Create a prototype integrated historical resource and access system that will link descriptions of people to one another and to descriptions of resources in archives, libraries and museums; online biographical and historical databases; and other diverse resources."
Homepage
Archivists have a long history of describing the people who—acting individually, in families, or in formally organized groups—create and collect primary sources. They research and describe the people who create and are represented in the materials comprising our shared cultural legacy. However, because archivists have traditionally described records and their creators together, this information is tied to specific resources and institutions. Currently there is no system in place that aggregates and interrelates those descriptions.
Leveraging the new standard Encoded Archival Context-Corporate Bodies, Persons, and Families (EAC-CPF), the SNAC Project will use digital technology to “unlock” descriptions of people from finding aids and link them together in exciting new ways. We will:
* Create efficient open-source tools that allow archivists to separate the process of describing people from that of records.
* Create a prototype integrated historical resource and access system that will link descriptions of people to one another and to descriptions of resources in archives, libraries and museums; online biographical and historical databases; and other diverse resources."
Homepage
Wolf Thomas - am Mittwoch, 4. August 2010, 21:47 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Mit dem Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland hätten viele Behörden der DDR ihre Arbeit eingestellt und nicht nur Aktenberge, sondern auch elektronisch gespeicherter Daten hinterlassen. Ihre Auswertung im Koblenzer Bundesarchiv laufe noch immer. Die Daten aus den Rechenzentren der DDR müssten aufwändig entschlüsselt werden, berichtete die Online-Ausgabe der Rhein-Zeitung am 31.07.2010:
Magnetbänder seien noch viele Jahre nach der Wiedervereinigung gefunden worden - in Kellern und auf Dachböden der früheren Ämter bis zum Jahr 2000, so Andrea Hänger. Die promovierte Archivarin arbeite seit zehn Jahren für das Koblenzer Bundesarchiv und leite das Referat „elektronische Archivierung“. Die Bundesbehörde habe nach der Wiedervereinigung viele Daten aus abgewickelten DDR-Rechenzentren übernommen - darunter auch brisante Dateien wie den „Zentralen Kaderdatenspeicher“ der DDR-Regierung. Er enthalte Biografien von mehr als 600.000 Führungskräften der DDR. Besonders ergiebig für die Forschung sei der „Datenspeicher Gesellschaftliches Arbeitsvermögen“ mit Informationen über den kompletten beruflichen Werdegang von mehr als sieben Millionen Menschen.
Das Koblenzer Archiv habe eine enorme Puzzlearbeit zu bewältigen. In der Frühzeit der elektronischen Datenverarbeitung sei Speicher überall knapp gewesen. Da hätten sich Programmierer die tollsten Codierungen einfallen lassen, um möglichst viel Informationen auf den spärlich ausgerüsteten Computern speichern zu können. Leider seien diese Verfahren oft nicht dokumentiert worden."
Quelle: www.datensicherheit.de
Magnetbänder seien noch viele Jahre nach der Wiedervereinigung gefunden worden - in Kellern und auf Dachböden der früheren Ämter bis zum Jahr 2000, so Andrea Hänger. Die promovierte Archivarin arbeite seit zehn Jahren für das Koblenzer Bundesarchiv und leite das Referat „elektronische Archivierung“. Die Bundesbehörde habe nach der Wiedervereinigung viele Daten aus abgewickelten DDR-Rechenzentren übernommen - darunter auch brisante Dateien wie den „Zentralen Kaderdatenspeicher“ der DDR-Regierung. Er enthalte Biografien von mehr als 600.000 Führungskräften der DDR. Besonders ergiebig für die Forschung sei der „Datenspeicher Gesellschaftliches Arbeitsvermögen“ mit Informationen über den kompletten beruflichen Werdegang von mehr als sieben Millionen Menschen.
Das Koblenzer Archiv habe eine enorme Puzzlearbeit zu bewältigen. In der Frühzeit der elektronischen Datenverarbeitung sei Speicher überall knapp gewesen. Da hätten sich Programmierer die tollsten Codierungen einfallen lassen, um möglichst viel Informationen auf den spärlich ausgerüsteten Computern speichern zu können. Leider seien diese Verfahren oft nicht dokumentiert worden."
Quelle: www.datensicherheit.de
Wolf Thomas - am Mittwoch, 4. August 2010, 21:18 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Vor 20 Jahren hatte die Werdohler Stadtverwaltung im Rahmen eines sogenannten Depositalvertrages umfangreiches Akten- und Archivmaterial – wenn auch nicht komplett, wie etwa die Brückenakte aus dem 16. Jahrhundert – an das Kreisarchiv in Altena abgegeben. Mittelfristig, sprich im Laufe des nächsten Jahres, sollen diese Unterlagen aber zurück nach Werdohl kommen. Der Kreis hat das bestehende Vertragsverhältnis gekündigt.
„Wir sind deshalb gehalten, uns jetzt vor Ort um eine Unterbringungsmöglichkeit dieses Materials zu kümmern“, so Rainer Gumz, der in dieser Frage zuständige Abteilungsleiter. In einem ersten Schritt wolle man sich nach Ende der Sommerferien beim Westfälischen Archivamt in Münster beraten lassen, welche Kriterien für ein solches eigene Archiv erfüllt werden müssen.
Natürlich liegt ein Hauptaugenmerk auf der Frage, welche Räumlichkeiten für eine Archivnutzung in Betracht gezogen werden können. Hier steht man im Rathaus allerdings noch am Anfang der Überlegungen. Nicht ausgeschlossen wird von Rainer Gumz, dass auch der Bahnhofs-Anbau mit in die Gedankenspiele einbezogen werden könnte.
Zu prüfen sei dort oder auch in anderen Räumlichkeiten, wie es um die Feuchtigkeit bestellt ist und wie viel Platz vorhanden sei. Immerhin müssten im Extremfall 140 laufende Meter Archivmaterial aus dem 19. und 20. Jahrhundert aus Altena übernommen werden. Auch der Kostenfaktor spielt laut Gumz eine Rolle. Es gelte, Regale zu beschaffen oder auch Schutzhüllen für die Akten. Die Frage, ob auch ein Archivar eingestellt werden müsse, beantwortete Gumz unter Hinweis auf die Finanzlage der Stadt mit „eher nicht“.
Den Hintergrund für die Kündigung des Depositalvertrages machte Kreisarchivarin Dr. Christiane Todrowski deutlich: „Wir verwahren bei uns neben all den klassischen Archivbeständen auch die Unterlagen aus fünf Städten und sind personell, vor allem aber räumlich an unsere Grenzen gestoßen.“ Deshalb habe sie „die Reißleine gezogen“. Nichts passe mehr hinzu, außer vielleicht Personenstandsregister.
Bei den in Altena aufbewahrten Unterlagen aus Werdohl handele es sich vornehmlich um Verwaltungs- und Personalakten, Bauanträge oder Ratsprotokolle – vornehmlich aus der Zeit seit der kommunalen Neuordnung. Aber auch Zwangsarbeiter-Unterlagen, Akten zum Armenwesen oder der Kirchen seien dabei.
„Wir haben den betroffenen Kommunen bei der Vertragskündigung gesagt, dass sie ihr Material künftig selbst verwalten müssen“, so Dr. Christiane Todrowski. Für Werdohl bestehe das Angebot, die vorhandenen, laufenden 140 Meter in Altena zu belassen. Wie man damit umgehen werde, sei noch offen. Allerdings: Zwei Drittel des Werdohler Materials sei schon verpackt, „und eigentlich macht es auch Sinn, das Archiv dort zu unterhalten, wo es auch gebraucht wird“, so die Kreisarchivarin."
Quelle: come-on.de, 29.07.2010
„Wir sind deshalb gehalten, uns jetzt vor Ort um eine Unterbringungsmöglichkeit dieses Materials zu kümmern“, so Rainer Gumz, der in dieser Frage zuständige Abteilungsleiter. In einem ersten Schritt wolle man sich nach Ende der Sommerferien beim Westfälischen Archivamt in Münster beraten lassen, welche Kriterien für ein solches eigene Archiv erfüllt werden müssen.
Natürlich liegt ein Hauptaugenmerk auf der Frage, welche Räumlichkeiten für eine Archivnutzung in Betracht gezogen werden können. Hier steht man im Rathaus allerdings noch am Anfang der Überlegungen. Nicht ausgeschlossen wird von Rainer Gumz, dass auch der Bahnhofs-Anbau mit in die Gedankenspiele einbezogen werden könnte.
Zu prüfen sei dort oder auch in anderen Räumlichkeiten, wie es um die Feuchtigkeit bestellt ist und wie viel Platz vorhanden sei. Immerhin müssten im Extremfall 140 laufende Meter Archivmaterial aus dem 19. und 20. Jahrhundert aus Altena übernommen werden. Auch der Kostenfaktor spielt laut Gumz eine Rolle. Es gelte, Regale zu beschaffen oder auch Schutzhüllen für die Akten. Die Frage, ob auch ein Archivar eingestellt werden müsse, beantwortete Gumz unter Hinweis auf die Finanzlage der Stadt mit „eher nicht“.
Den Hintergrund für die Kündigung des Depositalvertrages machte Kreisarchivarin Dr. Christiane Todrowski deutlich: „Wir verwahren bei uns neben all den klassischen Archivbeständen auch die Unterlagen aus fünf Städten und sind personell, vor allem aber räumlich an unsere Grenzen gestoßen.“ Deshalb habe sie „die Reißleine gezogen“. Nichts passe mehr hinzu, außer vielleicht Personenstandsregister.
Bei den in Altena aufbewahrten Unterlagen aus Werdohl handele es sich vornehmlich um Verwaltungs- und Personalakten, Bauanträge oder Ratsprotokolle – vornehmlich aus der Zeit seit der kommunalen Neuordnung. Aber auch Zwangsarbeiter-Unterlagen, Akten zum Armenwesen oder der Kirchen seien dabei.
„Wir haben den betroffenen Kommunen bei der Vertragskündigung gesagt, dass sie ihr Material künftig selbst verwalten müssen“, so Dr. Christiane Todrowski. Für Werdohl bestehe das Angebot, die vorhandenen, laufenden 140 Meter in Altena zu belassen. Wie man damit umgehen werde, sei noch offen. Allerdings: Zwei Drittel des Werdohler Materials sei schon verpackt, „und eigentlich macht es auch Sinn, das Archiv dort zu unterhalten, wo es auch gebraucht wird“, so die Kreisarchivarin."
Quelle: come-on.de, 29.07.2010
Wolf Thomas - am Mittwoch, 4. August 2010, 21:13 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" .... In dem Stück nehmen Umweltaktivisten auf der ganzen Welt Geiseln, um der Öffentlichkeit klar zu machen, dass es für die Umwelt bereits „fünf nach zwölf“ ist. ..... So finden sich unter den Geiseln neben der Supermarktkassiererin auch der eitle Erbe eines großen Unternehmens, ein junger Abiturient und eine biedere Archivarin. Diese ungewöhnliche Kombination kam sehr gut beim Publikum an: Nach dem überraschenden Ende des Bühnenkrimis bedankten sich die jungen Zuschauer mit endlosem Applaus und lauten Jubelrufen. ...."
Quelle: Essliner Zeitung
Quelle: Essliner Zeitung
Wolf Thomas - am Mittwoch, 4. August 2010, 21:10 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Link to ArchivesNext
Wolf Thomas - am Mittwoch, 4. August 2010, 21:05 - Rubrik: Web 2.0
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
1) In Th. Ottens/H. Hellenkempers/J. Kunows/M. M. Rinds (Hrsg.)
Fundgeschichten. Archäologie in Nordrhein-Westfalen.
(Schriften zur Bodendenkmalpflege in Nordrhein-Westfalen Band 9.
Begleitbuch zur Landesausstellung 2010/2011, Mainz 2010, 576 Seiten, 630 farbige Abbildungen.) findet sich die Miszelle "´Ausgrabungen´ kriegsbetroffener Altfunde in einem archäologischen Museum - Archivarchäologie im Rheinland" von Marion Euskirchen und Klaus Frank (S. 158 - 160). Die im Krieg verschollenen bzw. zerstörten Gräberfunde in Leverkusen-Rheinsdorf werden durch Recherchen in den Archiven der an den Ausgrabungen beteikigten Institutionen rekonstruiert - Archivarchäologie eben.
Homepage der Ausstellung: http://www.fundgeschichten.de/
2) Auf archaeoforum.de findet sich ein weiteres Beispiel für diese neue archäologische Hilfswissenschaft.
Fundgeschichten. Archäologie in Nordrhein-Westfalen.
(Schriften zur Bodendenkmalpflege in Nordrhein-Westfalen Band 9.
Begleitbuch zur Landesausstellung 2010/2011, Mainz 2010, 576 Seiten, 630 farbige Abbildungen.) findet sich die Miszelle "´Ausgrabungen´ kriegsbetroffener Altfunde in einem archäologischen Museum - Archivarchäologie im Rheinland" von Marion Euskirchen und Klaus Frank (S. 158 - 160). Die im Krieg verschollenen bzw. zerstörten Gräberfunde in Leverkusen-Rheinsdorf werden durch Recherchen in den Archiven der an den Ausgrabungen beteikigten Institutionen rekonstruiert - Archivarchäologie eben.
Homepage der Ausstellung: http://www.fundgeschichten.de/
2) Auf archaeoforum.de findet sich ein weiteres Beispiel für diese neue archäologische Hilfswissenschaft.
Wolf Thomas - am Mittwoch, 4. August 2010, 20:46 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Der papierfreie Autor ist nicht in Sicht" from Ansgar Warner on Vimeo.
Link zum Blog-Eintrag auf e-books-news.deWolf Thomas - am Mittwoch, 4. August 2010, 20:28 - Rubrik: Literaturarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Siegm. Jac. Baumgartens Nachrichten von einigen schätzbaren Handschriften der zahlreichen Bibliothek des weiland hochberümten Kanzlers von Ludwig, die zum Verkauf noch vorrätig sind" (Halle 1749) ist ein interessantes Beispiel für gelehrte Handschriftenbeschreibung im 18. Jahrhundert. Sie wurde jetzt digitalisiert
http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/titleinfo/1657199
Detailliert beschrieben werden vor allem Pergamenthandschriften aus dem Besitz des 1743 gestorbenen Hallenser Universitätskanzlers Johann Peter von Ludewig (1668-1743), die noch nicht verkauft worden waren. Im vierbändigen gedruckten Auktionskatalog Ludewigs von 1745 (alle 4 Bände in einem Google-Digitalisat http://books.google.de/books?id=Uk4VAAAAQAAJ ) waren die über 900 Handschriften des berühmten Historikers nur ganz knapp aufgelistet worden.
Der Theologe Siegmund Jakob Baumgarten (1706-1757) schrieb einerseits eine Werbeschrift, um den Verkauf der kostbaren Stücke anzukurbeln, andererseits eine gelehrte Abhandlung, die sich auf hohem Niveau um die Charakterisierung der Codices bemüht.
Papierhandschriften beschreibt Baumgarten nur zwei. Ich beschäftige mich nur mit der ersten, einer Handschrift Lamperts von Hersfeld, die von Baumgarten S. 31-40 ausführlich behandelt wird. Anhand der online vorliegenden MGH-Ausgabe von 1894
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00000741/image_51
wurde rasch klar, dass es sich um die Göttinger Handschrift Ms. hist. 88 handeln muss, 1893 im Göttinger Handschriftenkatalog beschrieben:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0718_b029_jpg.htm
Weitere Beschreibungen
Archiv der Gesellschaft 7 (1839), S. 456-459
http://books.google.com/books?id=zOk1AAAAMAAJ&pg=PA456
Holder-Egger in: Neues Archiv 19 (1894), S. 153f.
http://www.digizeitschriften.de/main/dms/img/?PPN=PPN345858530_0019&DMDID=dmdlog13
Holder-Egger in den Monumenta Erphesfurtensia, 1899, S. 47, 134f.
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00000744/image_142
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00000744/image_55
Die Handschrift wird kurz aufgeführt im erwähnten Manuskript-Katalog der Bibliothek Ludewigs von 1745 Bd. 4, S. 93 Nr. 488:
http://books.google.de/books?id=Uk4VAAAAQAAJ&pg=RA1-PA93
Über die Vorbesitzer der Handschrift gibt ein von Baumgarten S. 37f. zitierter Vermerk Auskunft. Es waren
Petrus Albinus (1543-1598)
http://de.wikipedia.org/wiki/Petrus_Albinus
Andreas Erasmus von Seidel (1650-1707, das Todesdatum in manchen Quellen anders, ich folge http://www.bbaw.de/bbaw/MitgliederderVorgaengerakademien/AltmitgliedDetails?altmitglied_id=2547 )
Ludwig Otto von Plotho (1663-1731)
http://www.bbaw.de/bbaw/MitgliederderVorgaengerakademien/AltmitgliedDetails?altmitglied_id=2120
Der Göttinger Kalalog zitiert Bibliotheca Plothoniana, Bd. 2, 1732, S. 838 Nr. 10899
Die Göttinger Bibliothek kaufte die Handschrift 1792 aus J. S. Semlers Bibliothek in Halle: also aus dem Nachlass von Johann Salomo Semler (1725-1791).
Dazwischen hat also, wie wir jetzt wissen, Ludewig die Handschrift besessen.
Der Codex enthält in seinem ersten, nach Bl. 361 1506 niedergeschriebenen Teil wichtige hoch- und spätmittelalterliche Geschichtsquellen aus dem mitteldeutschen Raum. Der Lampert-Text und weitere Erfurter Geschichtsquellen gehen nach Holder-Egger auf einen verlorenen mittelalterlichen Codex des Erfurter Petersklosters zurück.
Wichtig ist die Beobachtung Holder-Eggers (NA 19, S. 143), dass der erste Teil in humanistischer Schrift geschrieben ist. Die dem Trithemius-Umkreis angehörige Würzburger Schwesterhandschrift aus dem Schottenkloster ist ebenfalls in Humanistica geschrieben:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0083_b114_JPG.htm
Aus einer der Vorlagen beider Handschriften exzerpierte auch Hartmann Schedel. Man wird den Codex der humanistischen Beschäftigung mit den mittelalterlichen Geschichtsquellen des Hochmittelalters zuweisen dürfen. Die wiederholte Anrufung des hl. Hieronymus könnte mit der humanistischen Hieronymus-Verehrung zusammenhängen, während Holder-Egger vermutete, sie sei von dem Angehörigen eines Stifts geschrieben worden, das den hl. Hieronymus als Schutzpatron hatte.
Der zweite Teil, nach den zitierten Beschreibungen ebenfalls Anfang des 16. Jahrhunderts geschrieben, überliefert vor allem die Ältere Hochmeisterchronik, einen kurzen deutschen Text über die Ordensgründung und ein Verzeichnis der Deutschordensablässe.
Die Überlieferungszusammenstellung von Ralf G. Päsler der Älteren Hochmeisterchronik im Handschriftencensus (2004) hat die Göttinger Handschrift übersehen:
http://www.handschriftencensus.de/werke/869
Bereits durch einen Blick in die Edition von Max Töppen in den Scriptores Rerum Prussicarum 3 (1866), S. 524, der sie nicht kannte, ließ sich feststellen, dass aufgrund der Mitüberlieferung die Göttinger Handschrift der Jenaer, Stuttgarter (HB V 72) und Wiener (DOZA Hs. 427B) nahesteht:
http://books.google.de/books?id=-4AOAAAAYAAJ&pg=PA524
Man wird abwarten müssen, was die noch ungedruckte Pariser Dissertation (2009, bei J.-M. Moeglin)) von Mathieu Olivier über die Ältere Hochmeister-Chronik (mit kritischer Edition) zur Göttinger Handschrift zu sagen hat, aber die Zusammengehörigkeit der genannten Handschriften (einschließlich der Göttinger) hat Olivier bereits in einem Aufsatz (in: Mittelalterliche Eliten und Kulturtransfer ... 2009, S. 165) kurz thematisiert:
http://books.google.de/books?id=xtpMqVq3TVcC&pg=PA165 (Vollständige Ansicht)
Außer der Älteren Hochmeisterchronik überliefert die Göttinger Handschrift, ihr vorangehend, Bl. 385 die 'Narratio de primordiis Ordinis Theutonici', dt.
Der Handschriftencensus http://www.handschriftencensus.de/werke/2299 gibt hier nur eine Handschrift (DOZA Hs. 787), während Udo Arnold im Verfasserlexikon (²VL 6, 857) die beiden Stuttgarter Handschriften (HB V 72 und HB V 73) und DOZA Hs. 427b nennt, nicht aber die Göttinger Handschrift.
Das Bl. 452 ff. überlieferte Verzeichnis der Ablässe des Deutschen Ordens fehlt in Falk Eisermanns Artikel "Ablaßverzeichnisse" (²VL 11, Sp. 7f.). Hier ist von der genannten Handschriftengruppe nur die Jenaer Handschrift vertreten, auch ist Eisermann Töppens Edition (S. 713-719, Leithandschrift Töppens ist nicht angegeben) entgangen:
http://books.google.de/books?id=-4AOAAAAYAAJ&pg=PA713
Ob Axel Ehlers, Die Ablasspraxis des Deutschen Ordens im Mittelalter (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 64), Marburg 2007 außer der Heid. Hs. 68 - siehe http://www.handschriftencensus.de/10534 - noch weitere Überlieferungen nennt, wäre zu überprüfen.
Nachtrag:
In ihrer Beschreibung von ULB Halle, ThSGV 3147 nennt Brigitte Pfeil (Katalog der deutschen und niederländischen Handschriften ... 2007, S. 143 die Göttinger Hs. 2° Hist. 88 (ein Google-Schnipsel aus dem Band "Mittelalterliche Texte" hg. von Schieffer 1996 S. 226 verführte mich zunächst, das Quartformat anzunehmen. Völlig unangemessen ist das von den Handschriftenbibliotheken betriebene Umsignieren ihrer Handschriften. Wieso musste Göttingen auf die Idee verfallen, die traditionell ohne Formatangabe zitierten Handschriften nun mit einer Formatangabe zu versehen, die sich jedenfalls nicht zweifelsfrei aus den alten Katalogen ergibt? Und wieso kann man nicht, wenn man schon derlei Schabernack betreibt, eine Konkordanz auf die Website stellen?). ThGSV 3147 (die lateinischen Teile sind 1492 datiert) stammt möglicherweise aus Leipzig und diente als Vorlage für die "Chronica Montis Sereni" des Göttinger Codex. Auch das "Chronicon Terrae Misnensis" überliefern beide Handschriften. Ausgehend von diesem Befund und dem Erstbesitzer Albinus wird man an eine Entstehung der Göttinger Handschrift im mitteldeutschen Raum zu denken haben, vielleicht in Leipzig-Erfurter Humanistenkreisen.
Nachträglich sehe ich, dass die Zugehörigkeit der Göttinger Handschrift zur Ludewig-Bibliothek anhand der Schrift Baumgartens bereits von Hesse 1844 SS Bd. 5, S. 150
http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_SS_5_S._150
notiert, von den späteren Autoren aber offenkundig ignoriert wurde!
#forschung
 Johann Peter von Ludewig
Johann Peter von Ludewig
http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/titleinfo/1657199
Detailliert beschrieben werden vor allem Pergamenthandschriften aus dem Besitz des 1743 gestorbenen Hallenser Universitätskanzlers Johann Peter von Ludewig (1668-1743), die noch nicht verkauft worden waren. Im vierbändigen gedruckten Auktionskatalog Ludewigs von 1745 (alle 4 Bände in einem Google-Digitalisat http://books.google.de/books?id=Uk4VAAAAQAAJ ) waren die über 900 Handschriften des berühmten Historikers nur ganz knapp aufgelistet worden.
Der Theologe Siegmund Jakob Baumgarten (1706-1757) schrieb einerseits eine Werbeschrift, um den Verkauf der kostbaren Stücke anzukurbeln, andererseits eine gelehrte Abhandlung, die sich auf hohem Niveau um die Charakterisierung der Codices bemüht.
Papierhandschriften beschreibt Baumgarten nur zwei. Ich beschäftige mich nur mit der ersten, einer Handschrift Lamperts von Hersfeld, die von Baumgarten S. 31-40 ausführlich behandelt wird. Anhand der online vorliegenden MGH-Ausgabe von 1894
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00000741/image_51
wurde rasch klar, dass es sich um die Göttinger Handschrift Ms. hist. 88 handeln muss, 1893 im Göttinger Handschriftenkatalog beschrieben:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0718_b029_jpg.htm
Weitere Beschreibungen
Archiv der Gesellschaft 7 (1839), S. 456-459
http://books.google.com/books?id=zOk1AAAAMAAJ&pg=PA456
Holder-Egger in: Neues Archiv 19 (1894), S. 153f.
http://www.digizeitschriften.de/main/dms/img/?PPN=PPN345858530_0019&DMDID=dmdlog13
Holder-Egger in den Monumenta Erphesfurtensia, 1899, S. 47, 134f.
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00000744/image_142
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00000744/image_55
Die Handschrift wird kurz aufgeführt im erwähnten Manuskript-Katalog der Bibliothek Ludewigs von 1745 Bd. 4, S. 93 Nr. 488:
http://books.google.de/books?id=Uk4VAAAAQAAJ&pg=RA1-PA93
Über die Vorbesitzer der Handschrift gibt ein von Baumgarten S. 37f. zitierter Vermerk Auskunft. Es waren
Petrus Albinus (1543-1598)
http://de.wikipedia.org/wiki/Petrus_Albinus
Andreas Erasmus von Seidel (1650-1707, das Todesdatum in manchen Quellen anders, ich folge http://www.bbaw.de/bbaw/MitgliederderVorgaengerakademien/AltmitgliedDetails?altmitglied_id=2547 )
Ludwig Otto von Plotho (1663-1731)
http://www.bbaw.de/bbaw/MitgliederderVorgaengerakademien/AltmitgliedDetails?altmitglied_id=2120
Der Göttinger Kalalog zitiert Bibliotheca Plothoniana, Bd. 2, 1732, S. 838 Nr. 10899
Die Göttinger Bibliothek kaufte die Handschrift 1792 aus J. S. Semlers Bibliothek in Halle: also aus dem Nachlass von Johann Salomo Semler (1725-1791).
Dazwischen hat also, wie wir jetzt wissen, Ludewig die Handschrift besessen.
Der Codex enthält in seinem ersten, nach Bl. 361 1506 niedergeschriebenen Teil wichtige hoch- und spätmittelalterliche Geschichtsquellen aus dem mitteldeutschen Raum. Der Lampert-Text und weitere Erfurter Geschichtsquellen gehen nach Holder-Egger auf einen verlorenen mittelalterlichen Codex des Erfurter Petersklosters zurück.
Wichtig ist die Beobachtung Holder-Eggers (NA 19, S. 143), dass der erste Teil in humanistischer Schrift geschrieben ist. Die dem Trithemius-Umkreis angehörige Würzburger Schwesterhandschrift aus dem Schottenkloster ist ebenfalls in Humanistica geschrieben:
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0083_b114_JPG.htm
Aus einer der Vorlagen beider Handschriften exzerpierte auch Hartmann Schedel. Man wird den Codex der humanistischen Beschäftigung mit den mittelalterlichen Geschichtsquellen des Hochmittelalters zuweisen dürfen. Die wiederholte Anrufung des hl. Hieronymus könnte mit der humanistischen Hieronymus-Verehrung zusammenhängen, während Holder-Egger vermutete, sie sei von dem Angehörigen eines Stifts geschrieben worden, das den hl. Hieronymus als Schutzpatron hatte.
Der zweite Teil, nach den zitierten Beschreibungen ebenfalls Anfang des 16. Jahrhunderts geschrieben, überliefert vor allem die Ältere Hochmeisterchronik, einen kurzen deutschen Text über die Ordensgründung und ein Verzeichnis der Deutschordensablässe.
Die Überlieferungszusammenstellung von Ralf G. Päsler der Älteren Hochmeisterchronik im Handschriftencensus (2004) hat die Göttinger Handschrift übersehen:
http://www.handschriftencensus.de/werke/869
Bereits durch einen Blick in die Edition von Max Töppen in den Scriptores Rerum Prussicarum 3 (1866), S. 524, der sie nicht kannte, ließ sich feststellen, dass aufgrund der Mitüberlieferung die Göttinger Handschrift der Jenaer, Stuttgarter (HB V 72) und Wiener (DOZA Hs. 427B) nahesteht:
http://books.google.de/books?id=-4AOAAAAYAAJ&pg=PA524
Man wird abwarten müssen, was die noch ungedruckte Pariser Dissertation (2009, bei J.-M. Moeglin)) von Mathieu Olivier über die Ältere Hochmeister-Chronik (mit kritischer Edition) zur Göttinger Handschrift zu sagen hat, aber die Zusammengehörigkeit der genannten Handschriften (einschließlich der Göttinger) hat Olivier bereits in einem Aufsatz (in: Mittelalterliche Eliten und Kulturtransfer ... 2009, S. 165) kurz thematisiert:
http://books.google.de/books?id=xtpMqVq3TVcC&pg=PA165 (Vollständige Ansicht)
Außer der Älteren Hochmeisterchronik überliefert die Göttinger Handschrift, ihr vorangehend, Bl. 385 die 'Narratio de primordiis Ordinis Theutonici', dt.
Der Handschriftencensus http://www.handschriftencensus.de/werke/2299 gibt hier nur eine Handschrift (DOZA Hs. 787), während Udo Arnold im Verfasserlexikon (²VL 6, 857) die beiden Stuttgarter Handschriften (HB V 72 und HB V 73) und DOZA Hs. 427b nennt, nicht aber die Göttinger Handschrift.
Das Bl. 452 ff. überlieferte Verzeichnis der Ablässe des Deutschen Ordens fehlt in Falk Eisermanns Artikel "Ablaßverzeichnisse" (²VL 11, Sp. 7f.). Hier ist von der genannten Handschriftengruppe nur die Jenaer Handschrift vertreten, auch ist Eisermann Töppens Edition (S. 713-719, Leithandschrift Töppens ist nicht angegeben) entgangen:
http://books.google.de/books?id=-4AOAAAAYAAJ&pg=PA713
Ob Axel Ehlers, Die Ablasspraxis des Deutschen Ordens im Mittelalter (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 64), Marburg 2007 außer der Heid. Hs. 68 - siehe http://www.handschriftencensus.de/10534 - noch weitere Überlieferungen nennt, wäre zu überprüfen.
Nachtrag:
In ihrer Beschreibung von ULB Halle, ThSGV 3147 nennt Brigitte Pfeil (Katalog der deutschen und niederländischen Handschriften ... 2007, S. 143 die Göttinger Hs. 2° Hist. 88 (ein Google-Schnipsel aus dem Band "Mittelalterliche Texte" hg. von Schieffer 1996 S. 226 verführte mich zunächst, das Quartformat anzunehmen. Völlig unangemessen ist das von den Handschriftenbibliotheken betriebene Umsignieren ihrer Handschriften. Wieso musste Göttingen auf die Idee verfallen, die traditionell ohne Formatangabe zitierten Handschriften nun mit einer Formatangabe zu versehen, die sich jedenfalls nicht zweifelsfrei aus den alten Katalogen ergibt? Und wieso kann man nicht, wenn man schon derlei Schabernack betreibt, eine Konkordanz auf die Website stellen?). ThGSV 3147 (die lateinischen Teile sind 1492 datiert) stammt möglicherweise aus Leipzig und diente als Vorlage für die "Chronica Montis Sereni" des Göttinger Codex. Auch das "Chronicon Terrae Misnensis" überliefern beide Handschriften. Ausgehend von diesem Befund und dem Erstbesitzer Albinus wird man an eine Entstehung der Göttinger Handschrift im mitteldeutschen Raum zu denken haben, vielleicht in Leipzig-Erfurter Humanistenkreisen.
Nachträglich sehe ich, dass die Zugehörigkeit der Göttinger Handschrift zur Ludewig-Bibliothek anhand der Schrift Baumgartens bereits von Hesse 1844 SS Bd. 5, S. 150
http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_SS_5_S._150
notiert, von den späteren Autoren aber offenkundig ignoriert wurde!
#forschung
 Johann Peter von Ludewig
Johann Peter von LudewigKlausGraf - am Mittwoch, 4. August 2010, 16:13 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.insidehighered.com/news/2010/08/04/medieval
Siehe auch Beiträge im Weblog
http://www.inthemedievalmiddle.com/
Siehe auch Beiträge im Weblog
http://www.inthemedievalmiddle.com/
KlausGraf - am Mittwoch, 4. August 2010, 15:41 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Mittwoch, 4. August 2010, 15:17 - Rubrik: Staatsarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wolf Thomas - am Mittwoch, 4. August 2010, 07:02 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 3. August 2010, 18:04 - Rubrik: Internationale Aspekte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 3. August 2010, 18:01 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 3. August 2010, 17:57 - Rubrik: Landesgeschichte
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.kabarettarchiv.at/Ordner/aktuell.htm#reaktionen
Siehe auch: http://archiv.twoday.net/search?q=kabarett
Siehe auch: http://archiv.twoday.net/search?q=kabarett
KlausGraf - am Dienstag, 3. August 2010, 17:50 - Rubrik: Filmarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.nytimes.com/2010/08/03/us/03fbi.html?_r=1&hpw
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/us/20100803-wiki-LetterToLarson.pdf
Das FBI-Symbol wird von der Wikipedia nicht "geführt", es illustriert den Artikel, und das Gleiche gilt auch für die anderen Hoheitszeichen z.B. Wappen in der Wikipedia.

http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/us/20100803-wiki-LetterToLarson.pdf
Das FBI-Symbol wird von der Wikipedia nicht "geführt", es illustriert den Artikel, und das Gleiche gilt auch für die anderen Hoheitszeichen z.B. Wappen in der Wikipedia.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bei Google finden wir, der nützlichen Zusammenstellung von
http://www.rambow.de/adelslexika.html
folgend, auf der Suche nach den Albertini von Ichtratzheim das "Gothairches genealogisches Farchenbuch der freiherrlichen Gaufer"
http://books.google.com/books?id=PbYTAAAAYAAJ&pg=PA6
Bei jedem Jahrgang scheint man sich viel Mühe mit der Unauffindbarkeit der Google-Digitalisate aus der New York Public Library gegeben zu haben, 1868: "Gothailches Genealogilches Lafchenbuch Ber Freiherrlichen Hauler Auf Bas ..."
Übrigens sind ab 1870 Gotha-Bände in HathiTrust nur mit US-Proxy nutzbar http://catalog.hathitrust.org/Record/000053320
http://www.rambow.de/adelslexika.html
folgend, auf der Suche nach den Albertini von Ichtratzheim das "Gothairches genealogisches Farchenbuch der freiherrlichen Gaufer"
http://books.google.com/books?id=PbYTAAAAYAAJ&pg=PA6
Bei jedem Jahrgang scheint man sich viel Mühe mit der Unauffindbarkeit der Google-Digitalisate aus der New York Public Library gegeben zu haben, 1868: "Gothailches Genealogilches Lafchenbuch Ber Freiherrlichen Hauler Auf Bas ..."
Übrigens sind ab 1870 Gotha-Bände in HathiTrust nur mit US-Proxy nutzbar http://catalog.hathitrust.org/Record/000053320
KlausGraf - am Dienstag, 3. August 2010, 13:26 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/titleinfo/2380432
Danke, ULB Halle!
Zum Buch siehe die Monographie von Harm Cordes (Google-Vorschau)
http://books.google.de/books?id=oU7x2wbT5tYC&pg=PA12

Danke, ULB Halle!
Zum Buch siehe die Monographie von Harm Cordes (Google-Vorschau)
http://books.google.de/books?id=oU7x2wbT5tYC&pg=PA12

KlausGraf - am Dienstag, 3. August 2010, 12:21 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
" Die neue Version des Handbuches steht im Bereich Qualifizierung auf den Seiten des nestor Kompetenznetzwerkes zum Download bereit:
http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/index.php
Das Handbuch wurde um einzelne Artikel ergänzt, weitere Artikel wurden z.T. erheblich überarbeitet und die Verweise im gesamten Handbuch wurden überprüft und ggf. aktualisiert.
Neben dieser aktualisierten und kostenlosen Online Version des Handbuches, kann das Handbuch auch weiter als gedruckte Fassung in der Version 2.0 über den Buchhandel oder direkt beim vwh Verlag
https://shop.strato.de/epages/Store8.sf/?ObjectPath=/Shops/61236266/Products
/978-3-940317-48-3 zum Preis von 24,90 € bezogen werden."
via Archivliste.
http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/index.php
Das Handbuch wurde um einzelne Artikel ergänzt, weitere Artikel wurden z.T. erheblich überarbeitet und die Verweise im gesamten Handbuch wurden überprüft und ggf. aktualisiert.
Neben dieser aktualisierten und kostenlosen Online Version des Handbuches, kann das Handbuch auch weiter als gedruckte Fassung in der Version 2.0 über den Buchhandel oder direkt beim vwh Verlag
https://shop.strato.de/epages/Store8.sf/?ObjectPath=/Shops/61236266/Products
/978-3-940317-48-3 zum Preis von 24,90 € bezogen werden."
via Archivliste.
Wolf Thomas - am Dienstag, 3. August 2010, 10:26 - Rubrik: Digitale Unterlagen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Konferenz findet am 04. und 05. Oktober 2010 in der Staatsbibliothek zu Berlin statt.
Digitale Fotografien, Film- und Tonaufnahmen, Bücher und Museumsobjekte sind nicht länger in Archiven, Bibliotheken und Museen verborgen oder auf einzelnen Webseiten verstreut, sondern leichter zugänglich und vielfältig nutzbar über zentrale Services und Internetportale - so die Vision, die Projekte wie die Europeana vorantreibt.
Auf dieser Tagung bringen wir Beteiligte zusammen: Kulturgüter bewahrende Museen, Archive, Bibliotheken und audiovisuellen Archive; Aggregatoren als Knotenpunkte auf dem Weg in die Europeana; Projekte, die spezifische Inhalte für die Europeana zusammenführen; und schließlich Planer und Gestalter der Europeana und ihres deutschen Pendants mit dem Arbeitstitel "Deutsche Digitale Bibliothek" (DDB).
Neben den aktuellen Entwicklungen um die Europeana und die "Deutsche Digitale Bibliothek" liegt ein Schwerpunkt auf der Diskussion um den Aufbau eines nachhaltigen Aggregatoren-Netzwerks, das die Aufbereitung der Inhalte der Einrichtungen der einzelnen Kulturbereiche sicherstellt. Hier berichten sowohl Aggregatoren als auch Anbieter von Inhalten aus ihrer jeweiligen Perspektive von ersten Erfahrungen. Die Vermittlung von Wissen und das Lernen mit Hilfe von digitalem Kulturerbe steht im Zentrum eines eigenen Themenblocks.
Technische und inhaltliche Standards und Fragen einer Best Practice auf dem Weg ins "Semantische Web" bilden einen weiteren Schwerpunkt.
Schließlich zeigen die stark inhaltlich orientierten Europeana-Projekte die Bandbreite und Vielfalt des digitalen Kulturerbes Europas, von Musikinstrumenten über mittelalterliches Amtsschrifttum bis hin zu archäologisch und architektonisch bedeutsamen Inhalten.
Veranstalter der Tagung sind ATHENA, EuropeanaLocal-D, European Film Gateway, BHL-Europe und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Aktuelle Informationen, Anmeldungen etc werden schrittweise auf der Konferenzwebseite http://www.armubi.de/tagung2010 für Sie bereitgestellt.
Vorläufiges Programm
(Stand 29.07.2010)
Deutsches Kulturerbe auf dem Weg in die Europeana Veranstaltung am 4. und 5. Oktober 2010 Staatsbibliothek zu Berlin, Otto-Braun-Saal
Ziele der Veranstaltung: Öffentliche Bewerbung aller Projekte und der Europeana, Informationsaustausch zwischen den Projekten, Austausch zu Best-Practice, Austausch zwischen Content-Collector und Data-Provider,
04.10.2010
09:30 Registrierung
10:00 Willkommensansprachen (Hr. Parzinger, Frau Lux,)
10:30
Block 1
§ Jill Cousins, Europeana Foundation: (Europeana)
§ N.N: "ddb"
Mittagspause
Block 2 (nachmittags)
§ Monika Hagedorn-Saupe, Institut für Museumsforschung, SMB-PK
(noch ohne Titel) (Athena)
§ Georg Eckes, Deutsches Institut für Filmforschung
"Film und Filmerbe in Europa: EFG - The European Film Gateway als Aggregator für Europeana. Statusbericht und Ausblick" (European Film Gateway)
§ Birgit Gray, Deutschen Welle
(noch ohne Titel) (VideoActive/EUScreen/ Assets)
Kaffeepause
§ Angelika Menne-Haritz, Bundesarchiv
(noch ohne Titel) (APEnet)
§ Michael Götze, Zentral- und Landesbibliothek
Lokale und Regionale Archive, Bibliotheken und Museen in der Europeana (Europeana Local)
Erfahrungsberichte der Kultureinrichtungen mit der Europeana
§ Christina Wolf, Landesarchiv Baden-Württemberg
Archivgut im Kontext. Materialien des Landesarchivs Baden-Württemberg für die Europeana.
05.10.10
Block 3
N.N.: Think Motion
§ Hans-Christian Schmitz, Fraunhofer Institute for Applied Information Technology
(noch ohne Titel) (Natural europe)
§ Henning Scholz, Museum für Naturkunde - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin
Biodiversity Heritage Library for Europe - Naturwissenschaftliches Erbe für Europeana (BHL-Europe)
Kaffeepause
N.N.: ARROW
§ Christian Bizer
(Vortrag zu: LinkedData, Web of Data, Semantic Web, SKOS, RDF etc.)
§ Stefan Gradmann, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Linked Open Europeana: Das Europeana Data Model (europeana connect)
Mittagspause
Block 4
§ Andreas Richter, Ethnologisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin
MIMO - musical instrument museums online (MIMO)
N.N.: Europeana Regia
§ Ernesto Harder, Friedrich-Ebert-Stiftung - Archiv und Bibliothek der sozialen Demokratie
Heritage of the People´s Europe - Internationale Sozialgeschichte in der Europeana. (HOPE)
N.N.: Carare
§ Rachel Heuberger, Universitätsbibliothek Frankfurt am Main
Judaica Europeana - Der Beitrag der Juden zur Stadtentwicklung in Europa. (Judaica Europeana)
N.N.: Europena Travel
N.N.: EuropeanaFoto
via Archivliste
Digitale Fotografien, Film- und Tonaufnahmen, Bücher und Museumsobjekte sind nicht länger in Archiven, Bibliotheken und Museen verborgen oder auf einzelnen Webseiten verstreut, sondern leichter zugänglich und vielfältig nutzbar über zentrale Services und Internetportale - so die Vision, die Projekte wie die Europeana vorantreibt.
Auf dieser Tagung bringen wir Beteiligte zusammen: Kulturgüter bewahrende Museen, Archive, Bibliotheken und audiovisuellen Archive; Aggregatoren als Knotenpunkte auf dem Weg in die Europeana; Projekte, die spezifische Inhalte für die Europeana zusammenführen; und schließlich Planer und Gestalter der Europeana und ihres deutschen Pendants mit dem Arbeitstitel "Deutsche Digitale Bibliothek" (DDB).
Neben den aktuellen Entwicklungen um die Europeana und die "Deutsche Digitale Bibliothek" liegt ein Schwerpunkt auf der Diskussion um den Aufbau eines nachhaltigen Aggregatoren-Netzwerks, das die Aufbereitung der Inhalte der Einrichtungen der einzelnen Kulturbereiche sicherstellt. Hier berichten sowohl Aggregatoren als auch Anbieter von Inhalten aus ihrer jeweiligen Perspektive von ersten Erfahrungen. Die Vermittlung von Wissen und das Lernen mit Hilfe von digitalem Kulturerbe steht im Zentrum eines eigenen Themenblocks.
Technische und inhaltliche Standards und Fragen einer Best Practice auf dem Weg ins "Semantische Web" bilden einen weiteren Schwerpunkt.
Schließlich zeigen die stark inhaltlich orientierten Europeana-Projekte die Bandbreite und Vielfalt des digitalen Kulturerbes Europas, von Musikinstrumenten über mittelalterliches Amtsschrifttum bis hin zu archäologisch und architektonisch bedeutsamen Inhalten.
Veranstalter der Tagung sind ATHENA, EuropeanaLocal-D, European Film Gateway, BHL-Europe und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Aktuelle Informationen, Anmeldungen etc werden schrittweise auf der Konferenzwebseite http://www.armubi.de/tagung2010 für Sie bereitgestellt.
Vorläufiges Programm
(Stand 29.07.2010)
Deutsches Kulturerbe auf dem Weg in die Europeana Veranstaltung am 4. und 5. Oktober 2010 Staatsbibliothek zu Berlin, Otto-Braun-Saal
Ziele der Veranstaltung: Öffentliche Bewerbung aller Projekte und der Europeana, Informationsaustausch zwischen den Projekten, Austausch zu Best-Practice, Austausch zwischen Content-Collector und Data-Provider,
04.10.2010
09:30 Registrierung
10:00 Willkommensansprachen (Hr. Parzinger, Frau Lux,)
10:30
Block 1
§ Jill Cousins, Europeana Foundation: (Europeana)
§ N.N: "ddb"
Mittagspause
Block 2 (nachmittags)
§ Monika Hagedorn-Saupe, Institut für Museumsforschung, SMB-PK
(noch ohne Titel) (Athena)
§ Georg Eckes, Deutsches Institut für Filmforschung
"Film und Filmerbe in Europa: EFG - The European Film Gateway als Aggregator für Europeana. Statusbericht und Ausblick" (European Film Gateway)
§ Birgit Gray, Deutschen Welle
(noch ohne Titel) (VideoActive/EUScreen/ Assets)
Kaffeepause
§ Angelika Menne-Haritz, Bundesarchiv
(noch ohne Titel) (APEnet)
§ Michael Götze, Zentral- und Landesbibliothek
Lokale und Regionale Archive, Bibliotheken und Museen in der Europeana (Europeana Local)
Erfahrungsberichte der Kultureinrichtungen mit der Europeana
§ Christina Wolf, Landesarchiv Baden-Württemberg
Archivgut im Kontext. Materialien des Landesarchivs Baden-Württemberg für die Europeana.
05.10.10
Block 3
N.N.: Think Motion
§ Hans-Christian Schmitz, Fraunhofer Institute for Applied Information Technology
(noch ohne Titel) (Natural europe)
§ Henning Scholz, Museum für Naturkunde - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin
Biodiversity Heritage Library for Europe - Naturwissenschaftliches Erbe für Europeana (BHL-Europe)
Kaffeepause
N.N.: ARROW
§ Christian Bizer
(Vortrag zu: LinkedData, Web of Data, Semantic Web, SKOS, RDF etc.)
§ Stefan Gradmann, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Linked Open Europeana: Das Europeana Data Model (europeana connect)
Mittagspause
Block 4
§ Andreas Richter, Ethnologisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin
MIMO - musical instrument museums online (MIMO)
N.N.: Europeana Regia
§ Ernesto Harder, Friedrich-Ebert-Stiftung - Archiv und Bibliothek der sozialen Demokratie
Heritage of the People´s Europe - Internationale Sozialgeschichte in der Europeana. (HOPE)
N.N.: Carare
§ Rachel Heuberger, Universitätsbibliothek Frankfurt am Main
Judaica Europeana - Der Beitrag der Juden zur Stadtentwicklung in Europa. (Judaica Europeana)
N.N.: Europena Travel
N.N.: EuropeanaFoto
via Archivliste
Wolf Thomas - am Dienstag, 3. August 2010, 10:20 - Rubrik: Veranstaltungen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Historisches Archiv der Stadt Köln, Heumarkt 14


Rheinsch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv, Unter Sachsenhausen 10-26

Gebäude der Postanschrift


Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befinden sich die Büroräume und der Lesesaal, den man sich mit der Wirtschaftsbibliothek teilt.

Das Gebäude in der Bildmitte stellt die Zukunft des RWWA dar und befindet sich nur unweit des alten Standortes in der Gereonstr. 5 - 11.
Historisches Archiv des Erzbistums Köln, Gereonstr. 2 - 4



Rheinisches Bildarchiv, Kattenbug 18-24

Zufallsfund

Größere Bildansichten gewünscht? Einfach das jeweilige Bild anklicken!


Rheinsch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv, Unter Sachsenhausen 10-26

Gebäude der Postanschrift


Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befinden sich die Büroräume und der Lesesaal, den man sich mit der Wirtschaftsbibliothek teilt.

Das Gebäude in der Bildmitte stellt die Zukunft des RWWA dar und befindet sich nur unweit des alten Standortes in der Gereonstr. 5 - 11.
Historisches Archiv des Erzbistums Köln, Gereonstr. 2 - 4



Rheinisches Bildarchiv, Kattenbug 18-24

Zufallsfund

Größere Bildansichten gewünscht? Einfach das jeweilige Bild anklicken!
Wolf Thomas - am Dienstag, 3. August 2010, 06:20 - Rubrik: Wahrnehmung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/24095/
Müller-Langer, Frank and Watt, Richard (2010): Copyright and Open Access for Academic Works. Published in: Review of Economic Research on Copyright Issues , Vol. 1, No. 7 (2010): pp. 45-65.
Abstract
In a recent paper, Prof. Steven Shavell (see Shavell, 2009) has argued strongly in favor of eliminating copyright from academic works. Based upon solid economic arguments, Shavell analyses the pros and cons of removal of copyright and in its place to have a pure open access system, in which authors (or more likely their employers) would provide the funds that keep journals in business. In this paper we explore some of the arguments in Shavell’s paper, above all the way in which the distribution of the sources of journal revenue would be altered, and the feasible effects upon the quality of journal content. We propose a slight modification to a pure open access system which may provide for the best of both the copyright and open access worlds.
Müller-Langer, Frank and Watt, Richard (2010): Copyright and Open Access for Academic Works. Published in: Review of Economic Research on Copyright Issues , Vol. 1, No. 7 (2010): pp. 45-65.
Abstract
In a recent paper, Prof. Steven Shavell (see Shavell, 2009) has argued strongly in favor of eliminating copyright from academic works. Based upon solid economic arguments, Shavell analyses the pros and cons of removal of copyright and in its place to have a pure open access system, in which authors (or more likely their employers) would provide the funds that keep journals in business. In this paper we explore some of the arguments in Shavell’s paper, above all the way in which the distribution of the sources of journal revenue would be altered, and the feasible effects upon the quality of journal content. We propose a slight modification to a pure open access system which may provide for the best of both the copyright and open access worlds.
KlausGraf - am Dienstag, 3. August 2010, 05:30 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Während die deutschen Informationsfreiheitsgesetze die Forschungsdaten und -unterlagen der Hochschulen ausdrücklich ausnehmen, wurde in Großbritannien nun durch eine Entscheidung klargestellt, dass die Informationsfreiheit sich dort auch auf von Wissenschaftlern zusammengetragene Datenbestände der Universitäten bezieht.
"The decision in the Queen's case indicates that any interested party can use FoI laws to request any data belonging to a UK university, whether they form part of an academic's published work or whether they are still raw."
http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?sectioncode=26&storycode=412475&c=2
"The decision in the Queen's case indicates that any interested party can use FoI laws to request any data belonging to a UK university, whether they form part of an academic's published work or whether they are still raw."
http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?sectioncode=26&storycode=412475&c=2
KlausGraf - am Dienstag, 3. August 2010, 05:24 - Rubrik: Datenschutz
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Christian Alschners wichtige Dissertation aus dem Jahr 1969 wurde postum republiziert:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-38932
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-38932
KlausGraf - am Dienstag, 3. August 2010, 05:20 - Rubrik: Kodikologie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Dienstag, 3. August 2010, 03:51 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
KlausGraf - am Dienstag, 3. August 2010, 02:46 - Rubrik: Digitale Bibliotheken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://archiveros.tk/
Laut Mail ist http://archives20.ning.com/ vorerst gerettet und soll künftig mit dem anderen Netzwerk zusammegelegt werden.
Laut Mail ist http://archives20.ning.com/ vorerst gerettet und soll künftig mit dem anderen Netzwerk zusammegelegt werden.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Gibt es freie oder kostengünstige Software, mit der man PDFs erstellen kann, bei denen der E-Text unter dem Faksimile liegt?
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Technikwerkstatt#Frage_zu_pdf-Dokument
Siehe auch:
http://archiv.twoday.net/stories/597021/
http://archiv.twoday.net/stories/338568/ (2004)
"PDF Searchable Image is a PDF Image Only document with the addition of a text layer beneath the image."
http://www.dclab.com/pdfconversion3.asp
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Technikwerkstatt#Frage_zu_pdf-Dokument
Siehe auch:
http://archiv.twoday.net/stories/597021/
http://archiv.twoday.net/stories/338568/ (2004)
"PDF Searchable Image is a PDF Image Only document with the addition of a text layer beneath the image."
http://www.dclab.com/pdfconversion3.asp
Die als Bd. 96, 1998 des Jahrbuchs des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein erschienene wichtige Monographie von Manfred Tschaikner ist online:
http://tinyurl.com/3x589op (PDF eingebunden)
(Die fehlenden Seiten am Schluss sollen noch ergänzt werden.)
http://tinyurl.com/3x589op (PDF eingebunden)
(Die fehlenden Seiten am Schluss sollen noch ergänzt werden.)
KlausGraf - am Montag, 2. August 2010, 18:52 - Rubrik: Geschichtswissenschaft
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 2. August 2010, 17:01 - Rubrik: English Corner
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass die Wissenschaftsgemeinde von BibliothekarInnen irgend etwas innovatives erwartet, solange uns nichts besseres einfällt als spannende Linksammlungen zusammen zu tragen, gerne auch in ViFas, eigentlich gemeinfreie Literatur zu leicht überhöhten Preisen an andere Bibliotheken zu verkaufen, Kataloge anzubieten, auf deren Einträge man nicht vernünftig verlinken kann und immer noch Webseiten aufzusetzen, auf denen bestenfalls “internetartige Zustände” herrschen… Meint Edlef Stabenau
http://log.netbib.de/archives/2010/08/02/bibliothekarische-an-und-aussichten
http://log.netbib.de/archives/2010/08/02/bibliothekarische-an-und-aussichten
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Montag, 2. August 2010, 16:12 - Rubrik: Bestandserhaltung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?page_id=7759
Glückwunsch zum 2000. Beitrag:
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=7933

Glückwunsch zum 2000. Beitrag:
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=7933

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Um aktuelle interne Arbeiten und Aufgaben erledigen zu können, müssen ab sofort die Öffnungszeiten des Stadtarchivs in Coburg angepasst werden.
Jeweils Montags bleibt das Stadtarchiv zukünftig für den Publikumsverkehr geschlossen. Die übrigen Öffnungszeiten (Dienstag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr) bleiben unverändert.
Bereits in der nächsten Woche wird das Stadtarchiv einmalig am Donnerstag, 5. August und Freitag, 6. August geschlossen bleiben.
Der Hintergrund für die nun beschlossene Änderung ist die Entscheidung des Coburger Stadtrates, die offene Stelle des Archivleiters vorerst nicht zu besetzen. Entsprechend enttäuscht kommentiert Coburgs 2. Bürgermeister und Kulturreferent Norbert Tessmer die Entscheidung: "Dadurch das der Coburger Stadtrat in seiner letzten Sitzung leider nicht der Empfehlung der Verwaltung gefolgt ist und die Stelle des Archivleiters, unabhängig von einer Entscheidung über das Für oder Wider des Stadtmuseums, wiederbesetzt hat, ergeben sich nun Konsequenzen, die so keiner wollte. Die personelle Situation im Stadtarchiv – das im Übrigen eine kommunale Pflichtleistung darstellt – ist dermaßen angespannt, dass die verbliebenen Mitarbeiter derzeit keine Möglichkeit haben, interne Arbeiten während des Publikumsverkehrs zu erledigen."
Mit Mehrheit hatte sich am vergangenen Donnerstag der Stadtrat dafür entschieden, die Stelle des Archivleiters, der gleichzeitig die mögliche Leitung des Stadtmuseums übernehmen soll, erst dann auszuschreiben, wenn feststeht, ob die Pläne für ein Stadtmuseum umgesetzt werden oder nicht. "Ich bedauere dass wir diesen Schritt gehen mussten – leider war er aber vor der momentanen Vorgabe durch die Politik unvermeidlich", so Norbert Tessmer abschließend."
Quelle: Amt für Schulen, Kultur und Bildung der Stadt, Pressemeldung vom 2. August, 2010, 10:15, Link
Jeweils Montags bleibt das Stadtarchiv zukünftig für den Publikumsverkehr geschlossen. Die übrigen Öffnungszeiten (Dienstag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr) bleiben unverändert.
Bereits in der nächsten Woche wird das Stadtarchiv einmalig am Donnerstag, 5. August und Freitag, 6. August geschlossen bleiben.
Der Hintergrund für die nun beschlossene Änderung ist die Entscheidung des Coburger Stadtrates, die offene Stelle des Archivleiters vorerst nicht zu besetzen. Entsprechend enttäuscht kommentiert Coburgs 2. Bürgermeister und Kulturreferent Norbert Tessmer die Entscheidung: "Dadurch das der Coburger Stadtrat in seiner letzten Sitzung leider nicht der Empfehlung der Verwaltung gefolgt ist und die Stelle des Archivleiters, unabhängig von einer Entscheidung über das Für oder Wider des Stadtmuseums, wiederbesetzt hat, ergeben sich nun Konsequenzen, die so keiner wollte. Die personelle Situation im Stadtarchiv – das im Übrigen eine kommunale Pflichtleistung darstellt – ist dermaßen angespannt, dass die verbliebenen Mitarbeiter derzeit keine Möglichkeit haben, interne Arbeiten während des Publikumsverkehrs zu erledigen."
Mit Mehrheit hatte sich am vergangenen Donnerstag der Stadtrat dafür entschieden, die Stelle des Archivleiters, der gleichzeitig die mögliche Leitung des Stadtmuseums übernehmen soll, erst dann auszuschreiben, wenn feststeht, ob die Pläne für ein Stadtmuseum umgesetzt werden oder nicht. "Ich bedauere dass wir diesen Schritt gehen mussten – leider war er aber vor der momentanen Vorgabe durch die Politik unvermeidlich", so Norbert Tessmer abschließend."
Quelle: Amt für Schulen, Kultur und Bildung der Stadt, Pressemeldung vom 2. August, 2010, 10:15, Link
Wolf Thomas - am Montag, 2. August 2010, 09:35 - Rubrik: Kommunalarchive
"Zum Schutz der Beweissicherung an der Unglücksstelle Waidmarkt wird die Stadt Köln komplizierte unterirdische "Anschlussinjektionen" für ihr Bergungsbauwerk in Auftrag geben. Die Verwaltung informierte jetzt den Hauptausschuss über den aktuellen Stand der Archivbergung und des Baus des Bergungsbauwerks. Dieses Bauwerk ist notwendig, um die letzten dort vermuteten zehn Prozent der Archivmaterialien des Historischen Archivs aus dem Grundwasser bergen zu können.
Die Bergungsarbeiten dürfen keinerlei Auswirkungen auf das eingestützte Gleiswechsel-Bauwerk der Nord-Süd-U-Bahn haben, um die anschließende Beweissicherung nicht zu gefährden. Seit Juni wird mit über 60 Betonpfählen eine unterirdische "Mauer" rund um die Verdachtsfläche am Gleiswechsel-Bauwerk errichtet. 54 von 63 Bohrpfählen sind inzwischen gesetzt. Die jetzt in Auftrag gegebenen "Anschlussinjektionen" sollen diese Mauer derart an die benachbarte Schlitzwand anschließen, dass kein Boden von außen in das Bergungsbauwerk eintreten kann.
Erst nach Abschluss dieser Arbeiten kann die eigentliche Bergung und Erstversorgung der Archivalien beginnen. Alle Maßnahmen werden ständig detailliert mit den Gutachtern der beteiligten Behörden und Baubeteiligten sowie der Staatsanwaltschaft abgestimmt. Das führt notwendigerweise zu Zeitverzögerungen in den Planungs- und Bauabläufen, ist aber im Sinne der Beweissicherung unverzichtbar.
Nach derzeitigen Berechnungen wird die Bergung der letzten Archivalien voraussichtlich im Oktober bis November durchgeführt. Der Abschluss ist im November geplant. Auch der neue Terminplan ist mit den Gutachtern besprochen.
Die Gesamtkosten für das Bauwerk, die Bergung und die Erstversorgung der Archivalien belaufen sich auf circa 10 Millionen Euro."
Quelle: Pressemitteilung der Stadt Köln v. 27.07.2010
Die Bergungsarbeiten dürfen keinerlei Auswirkungen auf das eingestützte Gleiswechsel-Bauwerk der Nord-Süd-U-Bahn haben, um die anschließende Beweissicherung nicht zu gefährden. Seit Juni wird mit über 60 Betonpfählen eine unterirdische "Mauer" rund um die Verdachtsfläche am Gleiswechsel-Bauwerk errichtet. 54 von 63 Bohrpfählen sind inzwischen gesetzt. Die jetzt in Auftrag gegebenen "Anschlussinjektionen" sollen diese Mauer derart an die benachbarte Schlitzwand anschließen, dass kein Boden von außen in das Bergungsbauwerk eintreten kann.
Erst nach Abschluss dieser Arbeiten kann die eigentliche Bergung und Erstversorgung der Archivalien beginnen. Alle Maßnahmen werden ständig detailliert mit den Gutachtern der beteiligten Behörden und Baubeteiligten sowie der Staatsanwaltschaft abgestimmt. Das führt notwendigerweise zu Zeitverzögerungen in den Planungs- und Bauabläufen, ist aber im Sinne der Beweissicherung unverzichtbar.
Nach derzeitigen Berechnungen wird die Bergung der letzten Archivalien voraussichtlich im Oktober bis November durchgeführt. Der Abschluss ist im November geplant. Auch der neue Terminplan ist mit den Gutachtern besprochen.
Die Gesamtkosten für das Bauwerk, die Bergung und die Erstversorgung der Archivalien belaufen sich auf circa 10 Millionen Euro."
Quelle: Pressemitteilung der Stadt Köln v. 27.07.2010
Wolf Thomas - am Montag, 2. August 2010, 08:46 - Rubrik: Kommunalarchive
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Näheres:
http://philobiblos.blogspot.com/2010/08/links-reviews.html
http://latimesblogs.latimes.com/jacketcopy/2010/07/david-marksons-library-for-sale.html
http://www.facebook.com/group.php?gid=138148862885737&ref=ts

http://philobiblos.blogspot.com/2010/08/links-reviews.html
http://latimesblogs.latimes.com/jacketcopy/2010/07/david-marksons-library-for-sale.html
http://www.facebook.com/group.php?gid=138148862885737&ref=ts

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.journaldunet.com/solutions/expert/47489/la-protection-juridique-des-bases-de-donnees-illustree-par-les-dernieres-jurisprudences.shtml
Die restriktive Rechtsprechung schadet der Informationsfreiheit.
Die restriktive Rechtsprechung schadet der Informationsfreiheit.
KlausGraf - am Sonntag, 1. August 2010, 19:56 - Rubrik: Archivrecht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Manchmal entdeckt er in seinen Kisten und Schachteln Bücher, für die er keine Verwendung hat. Die gibt er dann Pensionistenheimen, Pfarrämter oder Gefängnissen. „Da besteht natürlich auch eine Wechselbeziehung, aber eigentlich mache ich das, weil ich hoffe, dass andere daran eine Freude haben. Bücher würde ich nie wegwerfen, es steckt zu viel Arbeit in ihnen, sogar in Schundromanen.“
Antiquar Max Federmann in Wien, der jüngste Wiener Antiquar.
http://diepresse.com/home/panorama/wien/584841/index.do?from=suche.intern.portal
Antiquar Max Federmann in Wien, der jüngste Wiener Antiquar.
http://diepresse.com/home/panorama/wien/584841/index.do?from=suche.intern.portal
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2010/07/30/International/Loveparade-wurde-zum-Totentanz
Was es mit der Totentanz-Metapher auf sich hat, erklärt
http://de.wikipedia.org/wiki/Totentanz
Siehe auch:
http://de.wikisource.org/wiki/Totentanz
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Danse_Macabre

Was es mit der Totentanz-Metapher auf sich hat, erklärt
http://de.wikipedia.org/wiki/Totentanz
Siehe auch:
http://de.wikisource.org/wiki/Totentanz
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Danse_Macabre

KlausGraf - am Sonntag, 1. August 2010, 19:26 - Rubrik: Miscellanea
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Briefe Max Liebermanns sind wichtige Dokumente für die Kunstgeschichts- und Geschichtsforschung, die bedeutende Äußerungen über seine Kunst, über die Berliner Secession, die Akademie der Künste, die zeitgenössische Kunstdiskussion und die Berliner Gesellschaft der Zeit zwischen 1890 und 1935 enthalten.
Anlässlich des 100jährigen Jubiläums der Liebermann-Villa im Jahr 2010 hat sich die Max-Liebermann-Gesellschaft Berlin das Ziel gesetzt, die Briefe des Künstlers wissenschaftlich zu erforschen und als historisch-kritische Gesamtedition herauszugeben.
In Kooperation mit dem Verfasser des Liebermann-Werksverzeichnisses, Prof. Dr. Matthias Eberle (Kunsthochschule Berlin-Weißensee) und Dr. Martin Faass (Liebermann-Villa am Wannsee) wird der Dresdener Liebermann-Spezialist Ernst Volker Braun die Künstlerbriefe bearbeiten. Dabei wird er vom wissenschaftlichen Beirat der Liebermann-Villa am Wannsee unterstützt.
Ab Mai 2011 soll jährlich ein Band der auf insgesamt acht Bände ausgelegten Briefedition im Deutschen Wissenschaftsverlag (DWV) erscheinen und auch im Buchhandel erhältlich sein.Das Projekt durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Hermann Reemtsma Stiftung ermöglicht.
Bitte treten Sie mit uns in Kontakt, wenn Sie durch Liebermann-Autographen oder anderes Quellenmaterial die Briefedition unterstützen können.
Projektstelle Liebermann-Briefedition
Simone Schweers
Tel.: 030-805 85 90 12
Email briefedition@liebermann-villa.de
Quelle: Homepage der Liebermann Villa
Anlässlich des 100jährigen Jubiläums der Liebermann-Villa im Jahr 2010 hat sich die Max-Liebermann-Gesellschaft Berlin das Ziel gesetzt, die Briefe des Künstlers wissenschaftlich zu erforschen und als historisch-kritische Gesamtedition herauszugeben.
In Kooperation mit dem Verfasser des Liebermann-Werksverzeichnisses, Prof. Dr. Matthias Eberle (Kunsthochschule Berlin-Weißensee) und Dr. Martin Faass (Liebermann-Villa am Wannsee) wird der Dresdener Liebermann-Spezialist Ernst Volker Braun die Künstlerbriefe bearbeiten. Dabei wird er vom wissenschaftlichen Beirat der Liebermann-Villa am Wannsee unterstützt.
Ab Mai 2011 soll jährlich ein Band der auf insgesamt acht Bände ausgelegten Briefedition im Deutschen Wissenschaftsverlag (DWV) erscheinen und auch im Buchhandel erhältlich sein.Das Projekt durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Hermann Reemtsma Stiftung ermöglicht.
Bitte treten Sie mit uns in Kontakt, wenn Sie durch Liebermann-Autographen oder anderes Quellenmaterial die Briefedition unterstützen können.
Projektstelle Liebermann-Briefedition
Simone Schweers
Tel.: 030-805 85 90 12
Email briefedition@liebermann-villa.de
Quelle: Homepage der Liebermann Villa
Wolf Thomas - am Sonntag, 1. August 2010, 18:31 - Rubrik: Museumswesen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Nein, meint Shieber
http://blogs.law.harvard.edu/pamphlet/2010/07/31/will-open-access-publication-fees-grow-out-of-control/
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/6210846/
http://archiv.twoday.net/stories/6066656/
http://blogs.law.harvard.edu/pamphlet/2010/07/31/will-open-access-publication-fees-grow-out-of-control/
Siehe auch
http://archiv.twoday.net/stories/6210846/
http://archiv.twoday.net/stories/6066656/
KlausGraf - am Sonntag, 1. August 2010, 17:57 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Landblawgende ist eine von mir geschaffene Kreuzung aus Blawg (juristisches Blog) und Landplage.
http://www.kanzleikompa.de/2010/07/31/jurablogger-in-selbstreflexion/
http://www.kriegs-recht.de/5-grunde-warum-juristische-blogs-chancen-in-deutschland-haben-%E2%80%93-eine-replik/
http://www.telemedicus.info/article/1819-Chancen-von-Jurablogs-Ein-Debattenbeitrag.html
http://rainbraun.blogspot.com/2010/07/kurz-und-schmerzbefreit.html
U.a.m.
http://www.kanzleikompa.de/2010/07/31/jurablogger-in-selbstreflexion/
http://www.kriegs-recht.de/5-grunde-warum-juristische-blogs-chancen-in-deutschland-haben-%E2%80%93-eine-replik/
http://www.telemedicus.info/article/1819-Chancen-von-Jurablogs-Ein-Debattenbeitrag.html
http://rainbraun.blogspot.com/2010/07/kurz-und-schmerzbefreit.html
U.a.m.
KlausGraf - am Sonntag, 1. August 2010, 17:20 - Rubrik: Archivrecht
Ein wichtiges Problem erörtert:
http://oanetzwerk.wordpress.com/2009/08/21/welcher-link-ware-ihnen-recht/
http://oanetzwerk.wordpress.com/2009/08/21/welcher-link-ware-ihnen-recht/
KlausGraf - am Sonntag, 1. August 2010, 17:10 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 1. August 2010, 17:04 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die österreichische Archiv-Zeitschrift Scrinium kann mit ihrem Jahrgang 63 kostenlos als PDF heruntergeladen werden (wie schon die Jahrgänge 60 und 61/62), meldet
http://arcana.twoday.net/stories/6448995/
Direktlink:
http://www.voea.at/scrinium/scrinium63/Scrinium_63.pdf
Enthalten sind viele Beiträge zu österreichischen Universitätsarchiven.
Juliane M i k o l e t z k y
Die Fachgruppe „Archive an österreichischen Universitäten
und wissenschaftlichen Einrichtungen“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Helga K a u d e l
Archiv der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz
(KUG-Archiv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Alois K e r n b a u e r
Universitätsarchiv der Karl-Franzens-Universität Graz . . . . . . . . . . . . 18
Marieluise V e s u l a k
Archiv und Dokumentation der Technischen Universität Graz . . . . . . 26
Peter G o l l e r
Universitätsarchiv der Universität Innsbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Elisabeth H a s e n b i c h l e r
Archiv der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Herbert E d l i n g e r
Das Archiv der Johannes Kepler Universität Linz (AJKU) . . . . . . . . . . 41
Carla C a m i l l e r i , Edith L e i s c h - P r o s t
Das Archiv des Technischen Museums Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Lynne H e l l e r
Archiv der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien . . . . . 53
Juliane M i k o l e t z k y
Das Universitätsarchiv der Technischen Universität Wien . . . . . . . . . 58
Kurt M ü h l b e r g e r, Thomas M a i s e l
Archiv der Universität Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Christa R i e d l - D o r n
Abteilung Archiv und Wissenschaftsgeschichte am
Naturhistorischen Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Eva S c h o b e r
Das Universitätsarchiv der Akademie der bildenden Künste Wien . . . 83
Stefan S i e n e l l
Das Archiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften . . . . . 86
Peter W i l t s c h e
Das Archiv der Universität für Bodenkultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
*
Christian O p r i e ß n i g
Sicherung, Archivierung und Dokumentation der Archive von
Erzherzog-Kaiser Ferdinand Maximilian von Mexiko . . . . . . . . . . . . . 97
*
Buchbesprechungen
Historische Bildungsarbeit. Kompass für Archive?
Vorträge des 64. Südwestdeutschen Archivtags am 19. Juni 2003
[eigentlich: 2004] in Weingarten, hg. von Clemens Rehm,
Stuttgart 2006 (Thomas Zeloth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Digitale Bilder und Filme im Archiv. Marketing und Vermarktung.
Vorträge des 66. Südwestdeutschen Archivtags am 24. Juni 2006
in Karlsruhe-Durlach, hg. von Michael Wettengel, Stuttgart 2007
(Wilhelm Deuer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Das Deutsche Archivwesen und der Nationalsozialismus.
75. Deutscher Archivtag 2005 in Stuttgart, hg. v. VdA –
Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V., Essen 2007
(Christian Hillen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Adlers Fittiche. Wandlungen eines Wappenvogels. Dokumentation
einer Präsentation des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz.
Berlin 2008 (Michael Göbl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Michael Hochedlinger, Aktenkunde. Urkunden- und Aktenlehre der
Neuzeit (= Historische Hilfswissenschaften Bd. 3, Wien-München 2009)
(Joachim Kemper) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Archive im (räumlichen) Kontext – Archivbauten und ihr Umfeld.
Vorträge des 68. Südwestdeutschen Archivtags am 21. Juni 2008 in Ulm,
Landesarchiv Baden-Württemberg, hg. von Beat Gnädinger,
Stuttgart 2009 (Alfred Ogris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
*
Chronik des VÖA
Personalnachrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Standardisierung von Erschließung. Bericht über den VÖA-Workshop am
2. März 2009 (Helga Penz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Bericht über die Generalversammlung des Verbandes Österreichischer
Archivarinnen und Archivare am 15. September 2008 in St. Pölten,
Festspielhaus, Haydnsaal (Thomas Maisel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
*
Die Mitarbeiter dieses Bandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
http://arcana.twoday.net/stories/6448995/
Direktlink:
http://www.voea.at/scrinium/scrinium63/Scrinium_63.pdf
Enthalten sind viele Beiträge zu österreichischen Universitätsarchiven.
Juliane M i k o l e t z k y
Die Fachgruppe „Archive an österreichischen Universitäten
und wissenschaftlichen Einrichtungen“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Helga K a u d e l
Archiv der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz
(KUG-Archiv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Alois K e r n b a u e r
Universitätsarchiv der Karl-Franzens-Universität Graz . . . . . . . . . . . . 18
Marieluise V e s u l a k
Archiv und Dokumentation der Technischen Universität Graz . . . . . . 26
Peter G o l l e r
Universitätsarchiv der Universität Innsbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Elisabeth H a s e n b i c h l e r
Archiv der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Herbert E d l i n g e r
Das Archiv der Johannes Kepler Universität Linz (AJKU) . . . . . . . . . . 41
Carla C a m i l l e r i , Edith L e i s c h - P r o s t
Das Archiv des Technischen Museums Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Lynne H e l l e r
Archiv der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien . . . . . 53
Juliane M i k o l e t z k y
Das Universitätsarchiv der Technischen Universität Wien . . . . . . . . . 58
Kurt M ü h l b e r g e r, Thomas M a i s e l
Archiv der Universität Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Christa R i e d l - D o r n
Abteilung Archiv und Wissenschaftsgeschichte am
Naturhistorischen Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Eva S c h o b e r
Das Universitätsarchiv der Akademie der bildenden Künste Wien . . . 83
Stefan S i e n e l l
Das Archiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften . . . . . 86
Peter W i l t s c h e
Das Archiv der Universität für Bodenkultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
*
Christian O p r i e ß n i g
Sicherung, Archivierung und Dokumentation der Archive von
Erzherzog-Kaiser Ferdinand Maximilian von Mexiko . . . . . . . . . . . . . 97
*
Buchbesprechungen
Historische Bildungsarbeit. Kompass für Archive?
Vorträge des 64. Südwestdeutschen Archivtags am 19. Juni 2003
[eigentlich: 2004] in Weingarten, hg. von Clemens Rehm,
Stuttgart 2006 (Thomas Zeloth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Digitale Bilder und Filme im Archiv. Marketing und Vermarktung.
Vorträge des 66. Südwestdeutschen Archivtags am 24. Juni 2006
in Karlsruhe-Durlach, hg. von Michael Wettengel, Stuttgart 2007
(Wilhelm Deuer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Das Deutsche Archivwesen und der Nationalsozialismus.
75. Deutscher Archivtag 2005 in Stuttgart, hg. v. VdA –
Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V., Essen 2007
(Christian Hillen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Adlers Fittiche. Wandlungen eines Wappenvogels. Dokumentation
einer Präsentation des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz.
Berlin 2008 (Michael Göbl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Michael Hochedlinger, Aktenkunde. Urkunden- und Aktenlehre der
Neuzeit (= Historische Hilfswissenschaften Bd. 3, Wien-München 2009)
(Joachim Kemper) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Archive im (räumlichen) Kontext – Archivbauten und ihr Umfeld.
Vorträge des 68. Südwestdeutschen Archivtags am 21. Juni 2008 in Ulm,
Landesarchiv Baden-Württemberg, hg. von Beat Gnädinger,
Stuttgart 2009 (Alfred Ogris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
*
Chronik des VÖA
Personalnachrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Standardisierung von Erschließung. Bericht über den VÖA-Workshop am
2. März 2009 (Helga Penz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Bericht über die Generalversammlung des Verbandes Österreichischer
Archivarinnen und Archivare am 15. September 2008 in St. Pölten,
Festspielhaus, Haydnsaal (Thomas Maisel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
*
Die Mitarbeiter dieses Bandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
KlausGraf - am Sonntag, 1. August 2010, 16:47 - Rubrik: Open Access
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
KlausGraf - am Sonntag, 1. August 2010, 16:11 - Rubrik: Unterhaltung
Biographie, Genealogie und Archive gemeinsam im digitalen Zeitalter. Detmolder Sommergespräche 2006 und 2007. Hrsg. von bettina Joergens. Insingen: Verlag Degener & Co. 2009. 268 S., 24,90 Euro
Der hier bereits angezeigte Band dokumentiert zwei Detmolder Sommergespräche, die dem löblichen Ziel dienen, den Dialog zwischen den Genealogen (mitunter als "Geschlechtskranke" geschmäht) und den Archivaren zu verbessern.
Der erste Teil hat einen quellenkundlichen Akzent. Er setzt ein mit einem Beitrag (Plato), der osteuropäische Oral-History-Projekte und den "Flickenteppich von Erinnerungskulturen" (S. 38) vorstellt. Lebendig berichtet Schäfer von einem "Geschichte von unten"-Oral-History-Projekt in Lippe. Anhand von Traditionsquellen (überwiegend Selbstzeugnissen/Ego-Dokumente) verdeutlicht Prieur-Pohl quellenkritische Caveats (hoffentlich zu Nutz und Frommen von Familienforschern als einer der Zielgruppen des Bandes). Quellenkritisch bearbeitet Doetzer-Berweger den Briefwechsel der jüdischen Familien Rosenberg, Eisenstein und Eichenberg 1933-1947.
Krüggelers Aufsatz enthält interessante Auskünfte zur Namensführung und zu dem, was man über Bauernfamilie in Varensell ca. 1750-1813 durch archivalische Forschungen herausbekommen kann. Im Anhang werden auszugsweise Inventarlisten abgedruckt. Es wird allerdings nicht begründet, wieso der Familienname der Familie mit F. abgekürzt wird. Dies ist nun mehr als befremdlich: Historische Forschung in dieser Zeit, die mehr als 200 Jahre zurückliegt, bedeutet, Ross und Reiter, also auch Namen zu nennen. Eine solche Anonymisierung - zumal wenn sie nicht begründet wird - hat hier keinen Platz. Die Aufnahme eines solchen "exemplarisch" gedachten Beitrags ist das denkbar falsche Signal an die Genealogen!
Über den genealogischen Quellenwert von Amtsgerichtsbestände unterrichten knapp Hammes und Lüking. Die Bewertungsproblemtik von Massenakten und -daten spricht Metzke an. Wenn auch künftig eine Familiengeschichtsforschung der Mittel- und Unterschichten möglich sein soll, "müssen auch weiterhin personenbezogene Massendateien in den Archiven vorgehalten werden" meint er zu Recht (S. 183).
Der zweite Teil des Bandes thematisiert vor allem Fragen der Computer-Genealogie. Junkers gibt einen Überblick zu Genealogieprogrammen und Verkartungsprojekten, Niebuhr stellt die genealogischen Sammlungen in der Detmolder Abteilung des Landesarchivs NRW vor und spricht auch die Frage der aktuellen Ergänzungsüberlieferung, also Übernahme privater Sammlungen an. Die Probleme der Langzeitarchivierung digitaler Daten verdeutlicht Kahnert, wobei es allerdings sinnvoll gewesen wäre, der anvisierten genealogischen Zielgruppe einige brauchbare Internetadressen an die Hand zu geben.
Außerordentlich oberflächlich behandelt Wischhöfer den Gegensatz von Open Access (siehe dazu besser http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/ und insbesondere http://archiv.twoday.net/stories/6164988/ ) und dem Wunsch nach Kommerzialisierung des Kulturguts in Form der Kirchenbücher im geplanten Kirchenbuchportal. Der Beitrag erhellt die Problematik keineswegs.
Das kostenlose niederländische Personenstandsdatenportal Genlias http://www.genlias.nl stellt Rensch vor. Über die sehr engen Beziehungen zwischen dem Staatsarchiv Bremen und der Gesellschaft für Familienforschung ("Die Maus") berichten Elmshäuser und Voss.
Zwei Beiträge (Wischhöfer und Küntzel/Leiverkus) präsentieren Praxisbeispiele zur Einbindung von Ehrenamtlichen im Archiv.
Den aus meiner Sicht gehaltvollsten Beitrag hat die Herausgeberin Joergens vorgelegt. Eine Wissenschaftsgeschichte der Disziplin Genealogie unter Einbeziehung der kulturwissenschaftlichen Forschungen der letzten Jahre zur Denkfigur Genealogie ist ein Desiderat. Indem Joergens nach der "Geschichte der Praxis der Genealogie" anhand von genealogischen Aufzeichnungen und visuellen Darstellungen im Detmolder Archiv fragt, legt sie, auch wenn ihr sehr viel Wichtiges entgangen ist, durchaus bemerkenswerte Bausteine für eine solche Wissenschaftsgeschichte vor. Sie sieht "Genealogie als Archivierungssystem zur Ordnung synchroner und diachroner Komplexität" (S. 157).
Ergänzende Hinweise zu diesem Thema:
http://archiv.twoday.net/stories/4349225/
http://archiv.twoday.net/stories/5145834/
http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2009/13798/
http://archiv.twoday.net/stories/6186936/
Der Band, dem man eine opulentere (vor allem farbige) Bebilderung und ein Register gewünscht hätte, eignet sich nicht nur für Archivbibliotheken und wissenschaftlich arbeitende Genealogen. Aufgrund der quellenkundlichen Beiträge kann er auch hilfswissenschaftlich orientierten Bibliotheken empfohlen werden.
INHALT
Vorwort (Jutta Prieur-Pohl) S. 7
Biographie, Genealogie und Archive gemeinsam im digitalen Zeitalter. Die Detmolder Sommergespräche als Diskussionsforum - eine Einleitung. (Bettina Joergens) S. 9-19
1. Genealogie, Biographie, Alltagsgeschichte: Perspektiven und Probleme der Quellenforschung
"Die Ungleichzeitigkeit von Systembruch und persönlicher Neuorientierung. Einige Anmerkungen zur Oral History nach Nationalsozialismus und dem Zusammenbruch der Sowjetunion" (Alexander von Plato). S. 23-44
"Oma" als Quelle. Frauen in Lippe suchen ihre Geschichte (Ingrid Schäfer). S. 45-62
Vorsicht Quelle! Über den Umgang mit biographischen Quellen (Jutta Prieur-Pohl). S. 63-78
"Aus Menschen werden Briefe" - aus Briefen werden Biographien. Die Korrespondenz einer jüdischen Familie zwischen Verfolgung und Emigration 1933 - 1947 (Oliver Doetzer). S. 79-98
"Biographie" eines eigenbehörigen Bauern aus der Grafschaft Rietberg (Wilhelm Krüggeler). S. 99-120
Familienforscher und Amtsgerichtsbestände am Beispiel des Landesarchivs NRW Abteilung Ostwestfalen-Lippe (Ulrike Hammes und Lars Lüking ). S. 121-134
Familie, Zeit und Ordnung. Genealogie historisch betrachtet (Bettina Joergens). S. 135-172
Genealogie als Beitrag zur Erinnerungskultur (Hermann Metzke). S. 173-183
2. Archive, Forschung und (Computer-)Genealogie: Perspektiven für neue Kooperationen
Genealogieprogramme und Verkartungsprojekte. Ein systematischer Überblick (Günter Junkers). S. 187-196
Überlieferungsbildung und genealogische Sammlungen (Hermann Niebuhr). S. 197-212
Digitaler Stammbaum - für die Ewigkeit? Technische Aspekte der Langzeitarchivierung (Wolfgang Kahnert). S. 213-219
Open Access oder "Turning Archival Databases into Goldmines"? Überlegungen zu einem Kirchenbuchportal der deutschen Kirchenarchive im europäischen Kontext (Bettina Wischhöfer). S. 221-227
Das Projekt Genlias in den Niederlanden (Jacques van Rensch). S. 229-234
Kreative Mitarbeiterbeschaffung im Landeskirchlichen Archiv Kassel - Das Modell Friendraising (Bettina Wischhöfer). S. 235-244
Das Staatsarchiv Bremen und die Gesellschaft für Familienforschung Bremen - Entwicklung und Grundlagen einer Kooperation (Konrad Elmshäuser und Rudolf Voss ). S. 245-260
Ehrenamtliche im Archiv - Denkanstöße aus der Praxis (Astrid Küntzel und Yvonne Leiverkus). S. 261-266
Der hier bereits angezeigte Band dokumentiert zwei Detmolder Sommergespräche, die dem löblichen Ziel dienen, den Dialog zwischen den Genealogen (mitunter als "Geschlechtskranke" geschmäht) und den Archivaren zu verbessern.
Der erste Teil hat einen quellenkundlichen Akzent. Er setzt ein mit einem Beitrag (Plato), der osteuropäische Oral-History-Projekte und den "Flickenteppich von Erinnerungskulturen" (S. 38) vorstellt. Lebendig berichtet Schäfer von einem "Geschichte von unten"-Oral-History-Projekt in Lippe. Anhand von Traditionsquellen (überwiegend Selbstzeugnissen/Ego-Dokumente) verdeutlicht Prieur-Pohl quellenkritische Caveats (hoffentlich zu Nutz und Frommen von Familienforschern als einer der Zielgruppen des Bandes). Quellenkritisch bearbeitet Doetzer-Berweger den Briefwechsel der jüdischen Familien Rosenberg, Eisenstein und Eichenberg 1933-1947.
Krüggelers Aufsatz enthält interessante Auskünfte zur Namensführung und zu dem, was man über Bauernfamilie in Varensell ca. 1750-1813 durch archivalische Forschungen herausbekommen kann. Im Anhang werden auszugsweise Inventarlisten abgedruckt. Es wird allerdings nicht begründet, wieso der Familienname der Familie mit F. abgekürzt wird. Dies ist nun mehr als befremdlich: Historische Forschung in dieser Zeit, die mehr als 200 Jahre zurückliegt, bedeutet, Ross und Reiter, also auch Namen zu nennen. Eine solche Anonymisierung - zumal wenn sie nicht begründet wird - hat hier keinen Platz. Die Aufnahme eines solchen "exemplarisch" gedachten Beitrags ist das denkbar falsche Signal an die Genealogen!
Über den genealogischen Quellenwert von Amtsgerichtsbestände unterrichten knapp Hammes und Lüking. Die Bewertungsproblemtik von Massenakten und -daten spricht Metzke an. Wenn auch künftig eine Familiengeschichtsforschung der Mittel- und Unterschichten möglich sein soll, "müssen auch weiterhin personenbezogene Massendateien in den Archiven vorgehalten werden" meint er zu Recht (S. 183).
Der zweite Teil des Bandes thematisiert vor allem Fragen der Computer-Genealogie. Junkers gibt einen Überblick zu Genealogieprogrammen und Verkartungsprojekten, Niebuhr stellt die genealogischen Sammlungen in der Detmolder Abteilung des Landesarchivs NRW vor und spricht auch die Frage der aktuellen Ergänzungsüberlieferung, also Übernahme privater Sammlungen an. Die Probleme der Langzeitarchivierung digitaler Daten verdeutlicht Kahnert, wobei es allerdings sinnvoll gewesen wäre, der anvisierten genealogischen Zielgruppe einige brauchbare Internetadressen an die Hand zu geben.
Außerordentlich oberflächlich behandelt Wischhöfer den Gegensatz von Open Access (siehe dazu besser http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/ und insbesondere http://archiv.twoday.net/stories/6164988/ ) und dem Wunsch nach Kommerzialisierung des Kulturguts in Form der Kirchenbücher im geplanten Kirchenbuchportal. Der Beitrag erhellt die Problematik keineswegs.
Das kostenlose niederländische Personenstandsdatenportal Genlias http://www.genlias.nl stellt Rensch vor. Über die sehr engen Beziehungen zwischen dem Staatsarchiv Bremen und der Gesellschaft für Familienforschung ("Die Maus") berichten Elmshäuser und Voss.
Zwei Beiträge (Wischhöfer und Küntzel/Leiverkus) präsentieren Praxisbeispiele zur Einbindung von Ehrenamtlichen im Archiv.
Den aus meiner Sicht gehaltvollsten Beitrag hat die Herausgeberin Joergens vorgelegt. Eine Wissenschaftsgeschichte der Disziplin Genealogie unter Einbeziehung der kulturwissenschaftlichen Forschungen der letzten Jahre zur Denkfigur Genealogie ist ein Desiderat. Indem Joergens nach der "Geschichte der Praxis der Genealogie" anhand von genealogischen Aufzeichnungen und visuellen Darstellungen im Detmolder Archiv fragt, legt sie, auch wenn ihr sehr viel Wichtiges entgangen ist, durchaus bemerkenswerte Bausteine für eine solche Wissenschaftsgeschichte vor. Sie sieht "Genealogie als Archivierungssystem zur Ordnung synchroner und diachroner Komplexität" (S. 157).
Ergänzende Hinweise zu diesem Thema:
http://archiv.twoday.net/stories/4349225/
http://archiv.twoday.net/stories/5145834/
http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2009/13798/
http://archiv.twoday.net/stories/6186936/
Der Band, dem man eine opulentere (vor allem farbige) Bebilderung und ein Register gewünscht hätte, eignet sich nicht nur für Archivbibliotheken und wissenschaftlich arbeitende Genealogen. Aufgrund der quellenkundlichen Beiträge kann er auch hilfswissenschaftlich orientierten Bibliotheken empfohlen werden.
INHALT
Vorwort (Jutta Prieur-Pohl) S. 7
Biographie, Genealogie und Archive gemeinsam im digitalen Zeitalter. Die Detmolder Sommergespräche als Diskussionsforum - eine Einleitung. (Bettina Joergens) S. 9-19
1. Genealogie, Biographie, Alltagsgeschichte: Perspektiven und Probleme der Quellenforschung
"Die Ungleichzeitigkeit von Systembruch und persönlicher Neuorientierung. Einige Anmerkungen zur Oral History nach Nationalsozialismus und dem Zusammenbruch der Sowjetunion" (Alexander von Plato). S. 23-44
"Oma" als Quelle. Frauen in Lippe suchen ihre Geschichte (Ingrid Schäfer). S. 45-62
Vorsicht Quelle! Über den Umgang mit biographischen Quellen (Jutta Prieur-Pohl). S. 63-78
"Aus Menschen werden Briefe" - aus Briefen werden Biographien. Die Korrespondenz einer jüdischen Familie zwischen Verfolgung und Emigration 1933 - 1947 (Oliver Doetzer). S. 79-98
"Biographie" eines eigenbehörigen Bauern aus der Grafschaft Rietberg (Wilhelm Krüggeler). S. 99-120
Familienforscher und Amtsgerichtsbestände am Beispiel des Landesarchivs NRW Abteilung Ostwestfalen-Lippe (Ulrike Hammes und Lars Lüking ). S. 121-134
Familie, Zeit und Ordnung. Genealogie historisch betrachtet (Bettina Joergens). S. 135-172
Genealogie als Beitrag zur Erinnerungskultur (Hermann Metzke). S. 173-183
2. Archive, Forschung und (Computer-)Genealogie: Perspektiven für neue Kooperationen
Genealogieprogramme und Verkartungsprojekte. Ein systematischer Überblick (Günter Junkers). S. 187-196
Überlieferungsbildung und genealogische Sammlungen (Hermann Niebuhr). S. 197-212
Digitaler Stammbaum - für die Ewigkeit? Technische Aspekte der Langzeitarchivierung (Wolfgang Kahnert). S. 213-219
Open Access oder "Turning Archival Databases into Goldmines"? Überlegungen zu einem Kirchenbuchportal der deutschen Kirchenarchive im europäischen Kontext (Bettina Wischhöfer). S. 221-227
Das Projekt Genlias in den Niederlanden (Jacques van Rensch). S. 229-234
Kreative Mitarbeiterbeschaffung im Landeskirchlichen Archiv Kassel - Das Modell Friendraising (Bettina Wischhöfer). S. 235-244
Das Staatsarchiv Bremen und die Gesellschaft für Familienforschung Bremen - Entwicklung und Grundlagen einer Kooperation (Konrad Elmshäuser und Rudolf Voss ). S. 245-260
Ehrenamtliche im Archiv - Denkanstöße aus der Praxis (Astrid Küntzel und Yvonne Leiverkus). S. 261-266
KlausGraf - am Freitag, 30. Juli 2010, 22:56 - Rubrik: Genealogie
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen




